




Dass der so lange geforderte Facharzt für Allgemein- und Fa milienmedizin jetzt fix kommen soll, begrüßen Ärzteschaft und Standesvertretung. Es gibt zwar schon noch einige kritische As pekte (z. B. approbierter Arzt, Entlohnung in der Lehrpraxis). Solange eine gesetzliche Verankerung aussteht, halten sich die direkt oder indirekt Betroffenen allerdings zurück, jene im öf fentlichen Diskurs lautstark zu thematisieren. Denn niemand will, dass damit dem wichtigen Projekt der Wind aus den Segeln genommen wird und jedwedes Gegenargument es noch stop pen könnte.
Bislang sind die Rahmenbedingungen für die Einführung des Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin niedergeschrie ben – wir haben diese in unserer aktuellen Titelgeschichte für Sie zusammengefasst. Details betreffend die Umsetzung gilt es erst auszuformulieren. Das wird wohl weiterer harter Verhand lungen bedürfen.
Die Änderung des Ärztegesetzes, welche Voraussetzung für die Schaffung der Facharztausbildung ist, soll in den kommenden Wochen bis Monaten im Nationalrat eingebracht werden. Eu ropaweit hat sich das Modell der Allgemein- und Familienme dizin als Fachdisziplin längst etabliert, unsere Alpenrepublik ist hier also ein Nachzügler. Die Sichtweisen und Erwartungen von Politik, Standesvertretung, Jungmediziner:innen, Gesundheits kasse und Universitätsvertreter:innen divergieren naturgemäß. Wir haben – stellvertretend – einige Stellungnahmen für Sie eingeholt. Alle Befragten hoffen auf eine Attraktivierung der Allgemeinmedizin. Als Allheilmittel gegen den Ärztemangel sieht den Facharzttitel aber niemand. Die Facharztausbildung soll selbstverständlich ebenso zur qualitativen Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beitragen.

Wenn Sie die neue Ausgabe unseres Fachmagazins in den Hän den halten, findet bzw. fand hoffentlich gerade der 53. Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemein medizin in Graz statt (24. bis 26.11.2022). Im Vorjahr hat er ja leider – coronabedingt – kurzfristig abgesagt werden müssen. Es freut uns, vor Ort als Medienpartnerin mit unserer druck frischen Hausärzt:in und einer Spezialausgabe Rare Diseases vertreten zu sein.
Abgesehen von der topaktuellen Titelgeschichte zur Aus- und Fortbildung, enthält unser Fachmagazin wie gewohnt viele wertvolle medizinische Beiträge, darunter einen praxisnahen DFP-Fortbildungsartikel („Literaturstudium“) zum Themen komplex Mammakarzinom: von der Früherkennung über die onkologische Therapie bis hin zu den Möglichkeiten der Plasti schen Chirurgie/der Brustrekonstruktion.
Eine spannende und lehrreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at

medizinisch
06 „Abklärung oft lückenhaft“ Verdauungsbeschwerden auf den Grund gehen
10 Die Koloskopie und das Mikrobiom Postinterventionelle Darmbeschwerden mit Probiotika reduzieren
14 Wege zu einem gesunden Kreuz Aktiv bei unspezifischen Rückenschmerzen
16 Die Hüfte als muskuloskelettales Kongressthema Schmerzen reduzieren, Mobilität wiederherstellen, Belastbarkeit erhöhen
20 Rheuma erkennen und behandeln Entwicklungen in Diagnostik und Therapie
34 DFP: Brustkrebs Onkologische Therapie und Brustrekonstruktion
38 Ein Standbein in der Onkologie Misteltherapie: Erste S3-Leitlinie Komplementärmedizin
40 „LDL-C-Senkung noch im hohen Alter?“
Entscheidend ist das Gesamtrisiko
41 Postinfektiöser Haarausfall COVID-19 als Auslöser von Effluvium
42 Gute Aussichten
Update COPD: Krankheitsmechanismus und maßge schneiderte Behandlung
44 Tako-TsuboKardiomyopathie Wenn die Psyche das Herz aus dem Rhythmus bringt
48 Auf kurze Sicht ... Progrediente Myopie kann irreversible Sehbehinde rungen zur Folge haben
50 Ein häufiges Phänomen (nicht nur) im Alter
Was Schnarchen lästig und Atemaussetzer lebensge fährlich macht
52 Eine „laufende“ Herausforderung
Die senile Rhinitis erfordert eine neurologische Abklärung
24 Facharzttitel in Sicht
Allgemeinmedizin soll aufgewertet werden –noch etliche Fragen offen
28 „Längere Ausbildungszeit unweigerlich erforderlich“ Prof.in Dr.in Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre, MedUni Wien, im Gespräch
30 Berufsethos vor Pflicht Wie zufrieden ist die Ärz teschaft mit dem DiplomFortbildungs-Programm?
32 ÖÄK-Psy-Diplom-Weiterbildung als Chance
Der positive Effekt ärztli cher Beziehungskompetenz
57 Ich warte lieber ab ... COVID-19-Risikogrup pen motivieren, bei Infek tion rasch zu handeln
58 „Damit wir wissen, was wir tun“ Dr.in Susanne Rabady, ÖGAM-Präsidentin, im Interview
60 Verwundbare Lunge Impfungen gelten als wichtiges Instrument für die Prävention in der Pneumologie
64 Nicht auf die leichte Schulter nehmen Die Hausstaubmilben allergie hat im Herbst Hochsaison
extra
67 SPRECHStunde „Physiotherapie bei Osteoporose?“
68 Umwelt Sicht Sache „Co-Benefits für Klima und Gesundheit“
66 „Umckaloabo“ gegen respiratorische Infekte Wie die KaplandPelargonie nach Europa kam
67 Impressum

Wiederkehrenden oder persistierenden Verdauungsbeschwerden sollte unbedingt auf den Grund gegangen werden
Welche Rolle kommt der Unterscheidung zwischen organisch bedingten und funktionellen Verdauungsbeschwerden in der Praxis zu?
Diese Unterscheidung ist unerlässlich für die klinische Pra xis. Leider zeigt sich, dass die Abklärung von Verdauungsbe schwerden oft lückenhaft ist und somit immer wieder organisch bedingte Erkrankungen als Reizdarm und/oder funktionelle Dyspepsie fehldiagnostiziert werden. Auch wenn es definierte Kriterien gibt, wann ein Reizdarm syndrom oder eine funktionelle Dyspepsie wahrscheinlich sind, sind beide eine Ausschlussdiagnose. Eine genaue Dia gnostik ist somit unerlässlich, um keine organisch bedingten Verdauungsprobleme zu übersehen.
Welche Auslöser sind bei funktionellen Verdauungsproblemen häufig?
Verdauungsstörungen können verschiedene Ursachen ha ben, die wiederum für zahlreiche und überlappende Be schwerden verantwortlich sind, etwa Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, abdominelle Krämpfe, epigastrische Schmerzen, Völlegefühl und psychische Ko morbiditäten. Diese sind häufige Gründe dafür, dass Pa tientinnen und Patienten eine hausärztliche oder gastro enterologische Praxis aufsuchen. Bei zirka der Hälfte der Betroffenen kann jedoch im Rahmen der Routinediagnostik keine organische Ursache für die Beschwerden nachgewie sen werden. Es besteht daher oft Unsicherheit, wie viel Aufmerksamkeit der weiteren Abklärung beige messen werden soll.
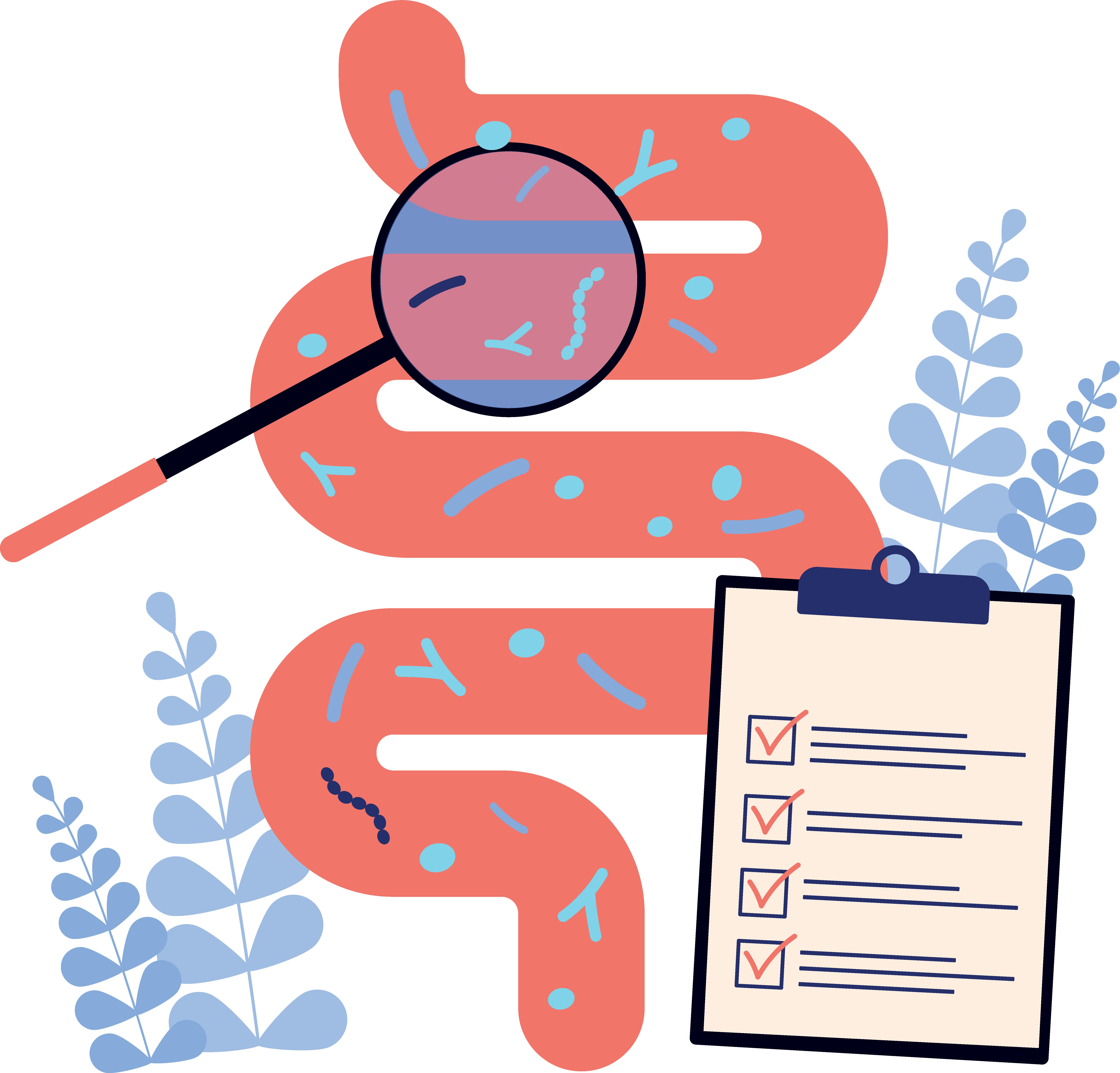
HAUSÄRZT:IN: Verdauungsstörun gen haben in Europa eine hohe Präva lenz. Braucht es hierfür mehr Awareness? Dr. ABLEITNER: Ganz bestimmt! Der Ver dauung kommt eine zentrale Rolle in unse rem Leben und für unsere Gesundheit zu. Es ist daher sehr wichtig, Verdauungs problemen, wenn sie länger bestehen, auf den Grund zu gehen. Diese werden zwar als Belastung wahrgenommen, jedoch oft nicht als echte Erkrankung angesehen. So wohl Ärzte als auch Patienten sollten sen sibilisiert werden, derartige Beschwerden ernster zu nehmen.
Es gibt mittlerweile eine große Anzahl von Studien, die sich mit der Pathogenese des Reizdarmsyndroms beschäftigen. Die Auslöser sind meist multifaktoriell. Stress als alleiniger Faktor kann nicht als Ursache für ein RDS oder eine funktionelle Dys pepsie angesehen werden. Dennoch konnte in mehreren Stu dien belegt werden, dass Stress einen Einfluss auf die gastrointestinale Funktion hat. Als
intestinalen Infekt ausgelöst werden kann. Ebenso kann eine Antibiotikatherapie als Auslöser eines RDS infrage kommen. Darüber hinaus scheinen genetische und epige netische Aspekte bei der Entwicklung einer funktionellen Verdauungsstörung eine Rolle zu spielen. Und auch das Mikrobiom hat einen Einfluss. Dieses kann sich u. a. durch falsche Ernährung nachteilig verändern.
Welche Beschwerden stehen im Vordergrund?
Die häufigsten Beschwerden sind Bauchschmerzen, Me teorismus, Diarrhoe und/oder Obstipation. Bei einem Reizdarmsyndrom lassen sich im Wesentlichen drei Typen definieren, die sich nach der primären Beschwerdesymp tomatik richten. Erstens das Reizdarmsyndrom vom Di arrhoe-Typ, zweitens das Reizdarmsyndrom vom Obsti pationstyp, drittens das Reizdarmsyndrom vom Mischtyp. Bei der funktionellen Dyspepsie unterscheidet man das „epigastric pain syndrome“ (EPS), welches hauptsächlich durch epigastrische Schmerzen gekennzeichnet ist, vom postprandialen „d istress syndrome“ (PDS), welches im Wesentlichen durch unangenehmes Völlegefühl und frü he Sättigung zutage tritt.


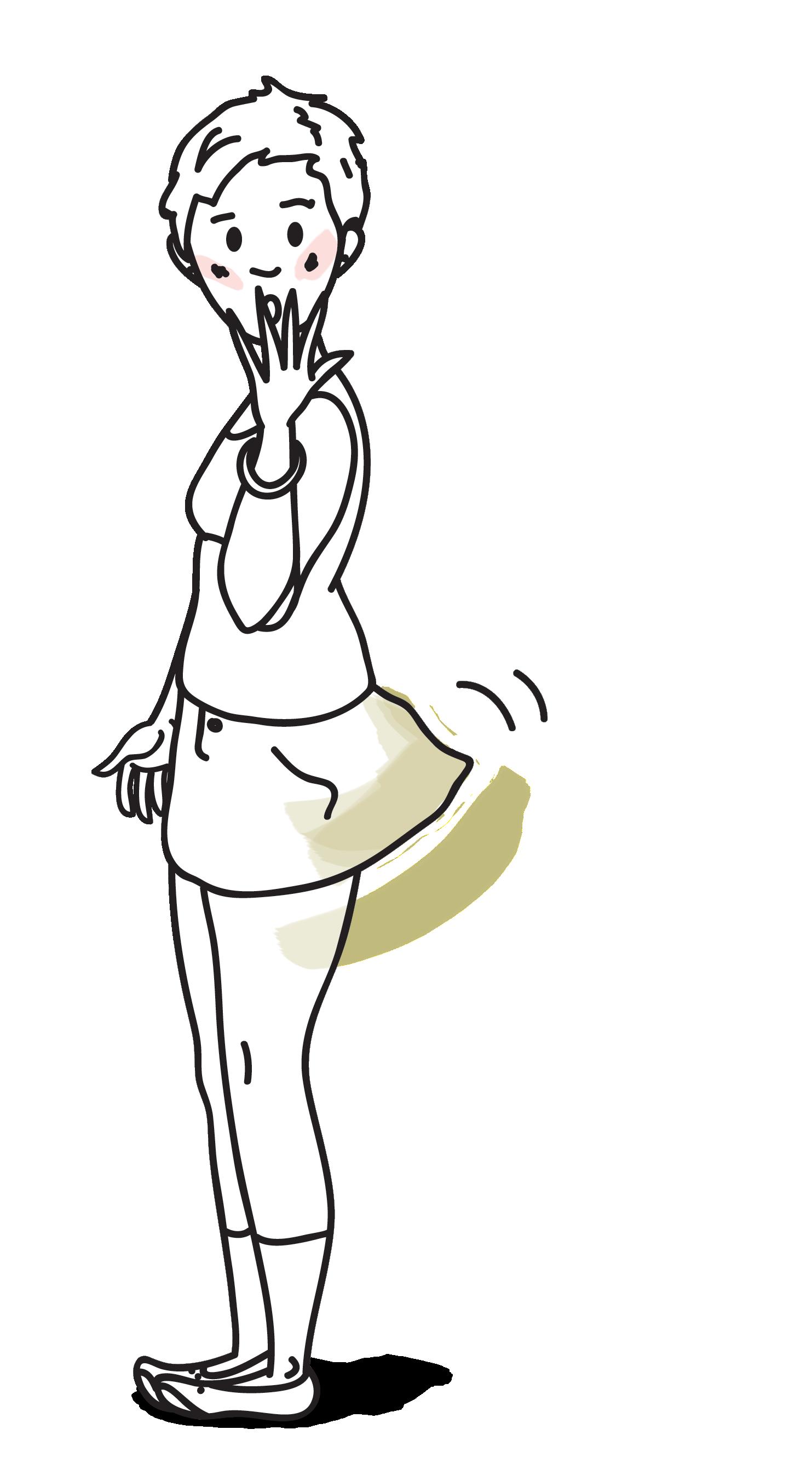

Welche Rolle kommt dem Schmerz zu? Schmerz spielt bei fast allen funktionellen Beschwerden eine Rolle. Dennoch ist dieser oft nicht das Hauptsymptom. Problematisch ist, dass klassische Schmerzmittel bei funkti onellen Verdauungsbeschwerden meist nicht helfen. Der Einsatz von NSAR verschlimmert die Situation meist so gar noch.
Wann ist eine Überweisung zum Facharzt notwendig?
Wichtig ist es zunächst, die Verdauungsbeschwerden des Patienten ernst zu nehmen. Zudem ist eine genaue Anam nese bezüglich der Dauer und Art der Beschwerden unum gänglich. Sollten diese länger bestehen und keine Ursache fassbar sein, so sollte ein Spezialist hinzugezogen werden. Bestehen sogar Warnsymptome, nämlich Blut im Stuhl, Anämie oder Zeichen eines Malabsorptionssyndroms, soll te die weitere Abklärung dringlich erfolgen.
Welche pflanzlichen Hilfen gibt es?
Es gibt einige Phytotherapeutika, deren Einsatz beim Reizdarmsyndrom hilfreich sein kann. Allen voran sind das Präparate, welche hochdosiertes Pfefferminzöl ent halten. Zudem dürfte Kümmelöl hilfreich sein. Es sind auch Kombinationspräparate erhältlich, deren Einsatz erwogen werden sollte. Als weitere Phytotherapeutika kommen solche infrage, die Myrrhe enthalten. Auch Ing wer oder Kurkuma können bisweilen eine Hilfe sein. Einschränkend ist jedoch zu bemerken, dass die Studienla ge bezüglich der Phytotherapeutika im Allgemeinen eher heterogen ist.
Welche Medikamente kommen grob betrachtet infrage?
Bei der medikamentösen Therapie der funktionellen Dyspepsie kann der Einsatz von Protonenpumpenhem >

Das Reizdarmsyndrom hat viele mög liche Ursachen. Die richtige Diagnose ist für eine erfolgreiche Therapie wich tig. Häufig durchlaufen die Patienten viele Untersuchungen, ohne am Ende eine ausreichende Erklärung für ihre Beschwerden zu erhalten.

Herr Prof. DDr. Muss, wie häufig begeg net Ihnen das Reizdarmsyndrom?
In unsere ernährungsmedizinische und im munologische Schwerpunktpraxis kommen häufig Patienten, nachdem sie sich bereits vielen klinischen Un tersuchungen zur Abklärung ih rer Verdauungsbeschwerden un terzogen haben. Diese Patienten leiden unter unregelmäßigen Stuhlveränderungen, haben ei nen trägen Darm, Bauchschmer zen oder vermehrte Flatulenz, jedoch anscheinend ohne orga nische Ursachen.
Was sind die häufigsten Risikofaktoren?
in Bezug auf die Ernährungsgewohnheiten notwendig. Hierzu kommen auch häufig weitere medizinische Konzepte zum Ein satz. Nur sehr selten müssen wir allerdings dabei auf Arzneimittel verweisen.


Welche medikamentösen Therapien bewähren sich in Ihrer Praxis?
Prof. DDr. Claus Muss, Ph.D. Ernährungsmediziner, Präventologe und Immunologe, Coautor von Fachbüchern und wissenschaftlichen Journalen

Häufig steht der Reizdarm mit Stress in Verbindung. Die ursächliche Ab klärung geht über das Immunsystem und die mikrobiologische Stuhlprobenuntersu chung zum Ausschluss eines Ungleichge wichts der Darmbakterien (Mikrobiom). In der ausführlichen Anamnese sind dabei Fehlernährung, Nahrungsmittelunverträg lichkeiten (Nahrungsmittelintoleranzen) oder aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente häufig zu eruieren.
Was kann helfen?

Der Erfolg der Therapie hängt davon ab, in wieweit die individuellen Ursachen erkannt werden und sich in der Folge adaptieren las sen. Manchmal sind dabei einschneidende Verhaltensänderungen sowie Korrekturen
Die Therapiekonzepte richten sich nach den Ursachen der Beschwerden. In den meisten Fällen muss zunächst die Mikro flora des Darms optimiert werden. Wie in unserem Buch „Was hilft bei Leaky Gut“, erschienen im Süd west Verlag, beschrieben, muss auch primär die Darmschleim haut als wichtige Voraussetzung dafür behandelt werden. Ent zündungslindernde und entgif tende Maßnahmen sind daher eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Darmsanierung. Hierfür kommen bestimmte na türliche Wirkstoffe zum Einsatz. Anschließend erfolgt eine Aus wahl von Darmbakterien (Pro biotika) nach individuellen Ge sichtspunkten, denn leider hilft nicht jedes Probiotikum beim Reizdarm. Bei unserem Therapiekonzept lassen wir uns von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten, die auch in Kooperation mit der In ternationalen Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin (i-gap.org) erforscht werden. U. a. wurden in placebokontrollier ten, randomisierten Doppelblindstudien bestimmte PMA-Zeolithe (z. B. PANACEO MED DARM-REPAIR) auf ihre Wirkung bei Darmentzündungen und beim „Leaky Gut Syndrom“ untersucht. Hierdurch konnte in einer Anwendungsbeobachtung auch eine deutliche Reduktion von Diarrhoe, Flatulenz und Bauchschmerzen ermittelt werden.
mern eine Besserung bringen. Zusätz lich können auch Prokinetika versucht werden.
Beim Reizdarmsyndrom kann eine Therapie mit Rifaximin probiert wer den. Auch der Einsatz von Probiotika ist hier oftmals sinnvoll.
Und welche Lebensstilmaßnahmen helfen nachweislich?
Zu den Lebensstilmaßnahmen zählen zunächst ausreichende körperliche Betätigung sowie verschiedene Entspannungstechniken. Die bedeutendste Rolle hat jedoch die Er nährung. Bei der Behandlung von Verdauungsstörungen kommen verschiedene Diäten, z. B. die FODMAP-Diät, zum Einsatz. Es spielt jedoch nicht nur eine Rolle, was gegessen wird, sondern auch wie und wann. So kann die Veränderung der eige nen Esskultur zu einer wesentlichen Besserung der Symptomatik führen.

Fundamental ist, dass die Speisen lang sam und in Ruhe gegessen und lange ge kaut werden. Dies wirkt sich wesentlich auf die Verdaulichkeit der zugeführten Speisen aus und kann somit Symptome lindern. Weil die Verdauungsleistung
über den Tag abnimmt, sollten vor allem rohe Lebensmittel ab dem frühen Nachmittag nicht mehr verzehrt werden, da sie eine zu große Belastung für das Verdauungssystem darstellen. Eine bewusste Auswahl der Speisen ist ebenso ein wichtiger Faktor. Schließlich weiß man selbst am besten, was man
Das Interview führte Karin Martin.
Für eine Koloskopie muss der Darm optimal vorbereitet sein, um das Risiko für Intervallkarzinome zu reduzieren. Hierzu bedarf es einer oralen Darmla vage. Diese beeinflusst das Darmmik robiom jedoch erheblich und kann auch zu persistierenden Darmbeschwerden führen. Nach wie vor scheuen viele Pa

tientinnen und Patienten deshalb die Koloskopie als wichtige Vorsorgeun tersuchung. Aktuell wird sie nur von einem Bruchteil der Personen in An spruch genommen. Zwar gäbe es alternativ die Option, den Darm auch mittels Kapselendoskopie zu untersuchen oder eine Betrachtung von außen mittels CT oder MRT vor zunehmen, diese Alternativen sind je doch kosten- und/oder zeitintensiver und werden auch nicht erstattet. Zudem muss der Darm für diese Untersuchun gen noch besser vorbereitet werden, da keine Spülmöglichkeit wie bei der
Koloskopie besteht. Sollte sich bei der Untersuchung des Darms durch Kapsel, CT oder MRT die Notwendigkeit einer Biopsie oder einer Polypektomie her ausstellen, führt ohnehin kein Weg an ei ner Darmspiegelung vorbei. Findet man nichts, verbleibt ein relevantes Risiko, z. B. einen Polyp übersehen zu haben.
Die Koloskopie stellt quasi eine effiziente 2-in-1-Untersuchung dar. „Bei der Entdeckung von Polypen haben wir große Fortschritte gemacht, einerseits durch eine verbesserte Technik, andererseits durch die zunehmende Erfahrung des Untersu-
„Es ist völlig klar, dass man bei einer Darmspülung Effekte auf das Mikrobiom hat.“
chungsteams“, so der Gastroenterologe Prof. Dr. Joachim Labenz vom Diakonie Klinikum JungStilling in Siegen. Künftig könnte auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden. „Dadurch steigt die Zahl der rechtzeitig entdeckten Polypen, die präventiv ex zidiert werden können. Selbst das minimale Risiko eventueller Nachblutungen bei deren Entfernung ist kein Problem, da die Blu tung im Regelfall gleich bei der Untersuchung gestillt werden kann“, meint der Darmspezialist.
EXPERTE:
Prof. Dr. Joachim Labenz Privatpraxis für Gastroenterologie & Hepatologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Siegen (D), em. Direktor der Medizinischen Klinik I

Für eine freie Sicht im Darm ist eine vollständige Entleerung erforderlich. Durch das Fasten und die Darmlava ge, die der Koloskopie vorausgehen, kommt es allerdings zu einer erheb
lichen Veränderung des Mikrobioms. Seit die Wissenschaft mehr über die zentrale Bedeutung sowie die Sensitivität der menschlichen Mikrobiota weiß, werden La xativa sparsamer eingesetzt. Dennoch wird die Darmflora im Rahmen der Koloskopie vorbereitung dezimiert: Ein wichtiger Teil jener Mikroor ganismen, die für Verdauung und Immunsystem verant wortlich sind, geht vorüber gehend verloren – die Diges tion ist beeinträchtigt und das Fehlen nützlicher Bakterien ermöglicht es z. B. Fäulniskei men, sich im Darm breitzu machen. Es kann nach einer Koloskopie mehrere Wochen und sogar Monate dauern, bis sich die Darmflora wieder erholt hat. Die besag te Veränderung des Mikrobioms macht sich bei bis zu 80 % der Untersuchten nach einer Darmspiegelung bemerkbar: Sie klagen über postinterventionelle Darmbeschwerden wie etwa Meteoris

mus, Diarrhoe, Bauchschmerzen und Obstipation. Und genau diese Nach wirkungen sind es, weswegen manche eine erneute Darmspiegelung ablehnen bzw. eine solche Untersuchung erst gar nicht vornehmen lassen, wenn sie bei spielsweise von Familie und Freunden von erlebten Beschwerden erfahren.
Dabei ist die Koloskopie nicht nur die wichtigste Vorsorgeuntersuchung für den Darm: Die vorbereitenden Maß

OMNi-BiOTiC® COLONIZE: Ergänzt die Darmflora nach der Koloskopie – nachweislich & natürlich.

„Es erscheint schon sinnvoll, nach einer Koloskopie ein Probiotikum zu nehmen, um die Diversität und somit die Qualität des Darmmikrobioms zu erhöhen.“
Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.

nahmen können für viele Menschen auch einen großen gesundheitlichen Nutzen bringen, gibt es doch Stellen im Darm, etwa in Divertikeln oder in der Blinddarm mündung, wo sich Kot über Wochen und sogar Monate ansammeln kann, der dort vor sich hin fault und den ge samten Organismus belasten kann. Diese Verdauungs rückstände werden durch die Darmlavage ebenfalls entfernt. „ E s ist meiner Beobachtung zufolge gerade bei Patienten mit Divertikeln so, dass jenen die Vor bereitung für die Darmspiegelung gelegentlich guttut. Ich habe Patienten, die das zweimal im Jahr freiwillig machen – ohne Darmspiegelung. Danach berichten sie, dass es ihnen über Wochen oder sogar Monate deutlich besser gehe“, schildert der Experte.

„E s ist völlig klar, dass man bei einer Darmspülung Effekte auf das Mikrobiom hat. Und da erscheint es schon sinnvoll, nach einer Koloskopie ein Probiotikum zu nehmen, um die Diversität und somit die Quali tät des Darmmikrobioms zu erhöhen“, so der Gas troenterologe. „W ir haben daher vier Wochen lang untersucht, ob die Patienten nach einer Koloskopie Beschwerden hatten und ob das unter Placebo anders war als unter Anwendung eines Probiotikums “ Eine genetische Sequenzierung sollte zeigen, ob das Probi otikum eine Auswirkung auf die Diversität des Mikro bioms hat. Für diese Studie1 erhielten rund 90 Personen, die sich zu einer Vorsorgekoloskopie vorstellten, über einen Zeitraum von 30 Tagen täglich ein Multi speziesprobiotikum mit den Bakterienstämmen Bifido bacterium bifidum W23, Bifidobacterium lactis W51, En terococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus rhamnosus WGG und Lactococcus lactis W19 oder Placebo. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten: In der Verumgruppe war die Alphadiversität, also die Vielfalt des Mikrobioms im Darm des jeweili gen Patienten, tatsächlich deutlich höher als in der Pla cebogruppe. Bemerkenswert war außerdem das signifi kant erhöhte Vorkommen eines jener Bakterienstämme, die im eingenommenen Probiotikum enthalten waren. Was besonders interessant für all jene Patienten ist, die eine Darmspiegelung aufgrund der daraus resultieren den Verdauungsbeschwerden bis jetzt gescheut haben: Unter der Einnahme des Probiotikums kam es zu sig nifikant weniger Tagen mit Obstipation. Darüber hinaus wurden auch deutlich weniger Tage mit Verdauungsbe schwerden wie Diarrhoe oder Meteorismus verzeichnet.
Thore Hansen und Margit Koudelka
Quelle: 1 Labenz J et al., Ein Multispezies-Probiotikum zeigt einen positiven Effekt auf das intestinale Mikrobiom und reduziert Darmsymptome nach einer oralen Darmla vage zur Vorsorge-Koloskopie: randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Multicenterstudie (COLONIZE). Z Gastroenterol. 60(08): 643–643 (2022).

Unspezifischen Rückenschmerzen vorbeugen und sie – aktiv – behandeln

Kreuz- und Rückenschmerzen betreffen beinahe jeden von uns und haben viel fältige Ursachen und Folgen. Sie stellen nicht nur eine individuelle Belastung für die Betroffenen dar, sondern auch eine außerordentliche Belastung für unser Gesundheits- und Sozialsystem, wo sie enorme Kostentreiber sind. Laut Statis tik Austria sollen in Österreich rund 1,9 Millionen Erwachsene an chronischen Rückenschmerzen leiden. Allein in Wien fallen jährlich (direkte) Kosten von rund 174 Millionen Euro für die Behandlung von chronischen unspezifischen Rü ckenschmerzen an. In Deutschland wer den die direkten medizinischen Kosten je Betroffenem mit 9.000 Euro pro Jahr beziffert – die indirekten Kosten durch Arbeitsausfall (Krankschreibung, Frühberentungen etc.) sind noch deutlich hö her und belaufen sich pro Jahr zusätzlich auf mehr als 20.000 Euro.
Auf Infekte der oberen Atemwege folgen die sogenannten muskuloskelettalen Erkrankungen, d. h. Probleme mit dem Bewegungs- und Stützapparat wie Kreuzund Rückenschmerzen, als zweithäufigste Ursache für Krankenstand und Ar beitsausfall. Menschen mit Mehrfach belastungen und speziellen Rollen, etwa Frauen und Mütter, leiden häufig daran. Besonders betroffen sind auch Menschen mit Tätigkeiten am Bildschirmarbeits
platz, an Supermarktkassen sowie Berufskraftfahrer, Außen dienstmitarbeiter, Bau- und Schwerarbeiter. Es handelt sich somit um ein höchstrele vantes medizinisches und auch volkswirtschaftliches Problem. In unserer modernen westli chen Zivilisation leidet – wie erwähnt – fast jeder Mensch mindestens einmal im Le ben an Kreuz- oder Rücken schmerzen und belastet so das Gesundheits- und Sozialsys tem mit Kosten, die in diesem Ausmaß nicht immer notwendig wären.
GASTAUTOR: Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, MedUni Wien

Kreuz- oder Rückenschmerzen sind in der Mehrzahl der Fälle nicht bedrohlich und bedürfen nach Ausschluss gefähr licher Ursachen keiner ausufernden weiterführenden Diagnostik und The rapie. Betroffene können auch selbst sehr viel zur Linderung und Vorbeu gung von Kreuz- und Rückenschmerzen beitragen. Möglichkeiten reichen von einfachen physikalischen Maßnahmen wie der Wärmeapplikation bis hin zu ge zielten Übungen, die im Rahmen einer Bewegungs- und Trainingstherapie Rü
ckenschmerzen lindern und einem Wiederauftreten vor beugen können. Eine gezielte Verhaltensprävention umfasst z. B. auch regelmäßige kör perliche Aktivitäten im Sinne der nationalen und interna tionalen Bewegungsempfeh lungen für einen gesundheits förderlichen Lebensstil. Als Verhältnisprävention sind u. a. ergonomisch optimierte Ar beitsplätze und Arbeitsabläu fe, aber auch entsprechende Verhältnisse im Bereich Er holung und Freizeit zu betrachten. Eine gute Work-Life-Balance ist jedenfalls anzustreben.
Etwa 80 % der Rückenschmerzen sind sogenannte „u nspezifische bzw. nichtspezifische“ Rückenschmerzen, d. h. Schmerzepisoden, bei denen eine ge fährliche Ursache primär nicht fassbar ist. Der Rest sind Rückenschmerzen mit spezifischen und entsprechend fass baren organischen Ursachen, z. B. ein symptomatischer Bandscheibenvorfall, Frakturen, eine schwerwiegende Osteo porose, Tumorabsiedelungen (Metasta sen), gewisse Infektionserkrankungen
etc. Bei Ersteren, den „u nspezifischen bzw. nichtspezifischen“ Rückenschmer zen, soll ärztlicherseits kein Overdocto ring (Überbehandlung durch unnötige weiterführende Diagnostik und Be handlung) erfolgen. Besonders wichtig ist es hier, auf eine primäre Krankschrei bung zu verzichten und die Betroffenen nicht durch Bettruhe in eine kontrapro duktive Inaktivität und passive Rolle zu drängen. Vielmehr sind bei unspezifi schen bzw. nichtspezifischen Kreuz- und Rückenschmerzen konventionelle bzw. konservative Maßnahmen durchzufüh ren und die Patienten zu informieren, dass die Schmerzen nicht gefährlich sind und Bewegung die Schmerzsitua tion nicht verschlechtert, sondern – im Gegenteil – sogar verbessert. Die Maß nahmen umfassen die medikamentöse Schmerztherapie (Analgetika und Myo tonolytika oder Muskelrelaxantien) sowie physikalisch-medizinische Maß nahmen wie Bewegungs- und Trainings therapie sowie Wärmeanwendungen verschiedenster Applikationsart, die üblicherweise innerhalb von sechs Wo chen zum Erfolg führen. Wenn sich nach dieser Zeit keine Besserung eingestellt hat, ist eine fachärztliche weiterführen de Diagnostik und – je nach Ursache –Therapie angezeigt.
Die Therapie von chronischem Rücken schmerz wiederum ist die Domäne der Physikalischen Medizin und der soge nannten Interdisziplinären Schmerzme dizin, die Schmerzen und ihre Chroni fizierung als Folge biopsychosozialer
Faktoren sieht. Sie hat die umfassende Behandlung der durch Schmerz einge schränkten körperlichen, psychischen und sozialen Funktionen der betroffe nen Menschen zum Ziel. Dazu zählen u. a. eine Verbesserung der Fitness, Belas tungskapazität, Koordination und Körperwahrnehmung sowie eine bessere Kontrolle der individuellen Belastungs grenzen. Psychotherapeutische Inter ventionen zielen auf eine Verringerung der emotionalen Beeinträchtigung und auf eine Veränderung des auf Schonung ausgerichteten Krankheitsverhaltens sowie der Einstellungen und Befürch tungen in Bezug auf Aktivität und Ar beitsfähigkeit ab.
In der Vorbeugung von negativen Fol gen von Zivilisationskrankheiten sowie von Rückenschmerzen haben Bewegung und regelmäßige körperliche Aktivität eine enorme Bedeutung. Daher sollten die nationalen und internationalen Be wegungsempfehlungen konsequent um gesetzt werden. Bewegung kann auch gegen Rückenschmerzen sozusagen „w ie ein Medikament“ eingesetzt wer den. Eine ergonomische Beratung sowie die ergonomische Einrichtung des Bild schirmarbeitsplatzes wirken präventiv, denn richtiges Sitzen vor dem Compu ter will gelernt sein. Unser Rücken soll beim Sitzen am Computer nicht be-, sondern entlastet werden! Themen der Ergonomie, der Arbeitsorganisation, die ergonomische Gestaltung des Bild schirmarbeitsplatzes und der Umgang mit (neuen) psychischen Belastungen
sind heutzutage für die Erhaltung –auch, aber nicht nur – unserer Rücken gesundheit entscheidend. Entspannung ist wichtig, denn man kann nicht gleich zeitig geistig angespannt und körperlich entspannt sein und umgekehrt. Unser Schlaf erfüllt viele Funktionen, die für unser körperliches und geistiges Wohl befinden wichtig sind. Der Schlaf sowie die Liegesituation beim Schlafen beein flussen auch unsere Rücken- und Wir belsäulengesundheit.
Kreuz- und Rückenschmerzen haben zumeist keine gefährliche Ursache – wir alle können zu ihrer Prävention und Be handlung sehr viel beitragen. Bei anhal tenden oder spezifischen Beschwerden sollte jedenfalls ärztliche Hilfe und die an den Universitäten gelehrte State-ofthe-Art-Medizin in Anspruch genom men werden.
Rückenschmerzen –vorbeugen und aktiv behandeln Von Richard Crevenna Reihe Gesundheit.Wissen MedUni Wien im MANZ Verlag 2022


Schmerzen reduzieren, Mobilität wiederherstellen, Belastbarkeit erhöhen
Von 6. bis 8. Oktober fand heuer die 58. ÖGU und 3. ÖGOuT Jahrestagung zum Thema „Traumatologie und Ortho pädie der Hüfte“ statt. Nach zwei virtu ellen Jahrestagungen war dies – nach den Einschränkungen des täglichen Lebens während der letzten Jahre in der Coro napandemie – die erste Jahrestagung mit persönlichem Kontakt. Trotz des Vormarsches der Digitalisierung war das Interesse ungebrochen hoch. Insgesamt nahmen 862 Personen am Kongress teil, davon 620 Orthopädinnen, Orthopäden, Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen. Das Kongressthema war als muskuloske lettales Konzept zu verstehen. Themati siert wurde die Region als Ganzes – und sie wurde von den jeweiligen Expertin nen und Experten aus den Fachgruppen „Orthopädie und Orthopädische Chirur gie“, „Unfallchirurgie“ und „Orthopädie und Traumatologie“ innerhalb der drei Tage intensiv diskutiert.
Die einfache Beschreibung der Hüf te als Kugelgelenk mit einem „ single center of rotation“ ist zwar konzepti onell anerkannt, die Abweichungen
der Kopf- und Pfannenform („out of round“) und deren Einfluss auf die mögliche Entwicklung von Coxarthro se sind allerdings Gegenstand der Wis senschaft. Vor allem in der gelenkerhal tenden Behandlung sind derzeit viele Fragen offen. Die Anatomie und die Biomechanik der Hüfte als Grundlage für die Konzeption neuer Therapiean sätze werden intensiv beforscht. Auf Basis der Interpretation der Ergebnisse klinischer, anatomischer und biome chanischer Studien fließen dabei neue Erkenntnisse in unsere Behandlungs konzepte ein.

In der gelenkerhaltenden Therapie reicht das Spektrum von der konser vativen Behandlung bei Kindern mit Morbus Perthes und Hüftdysplasie bis hin zu den Osteotomien des Beckens und des hüftgelenknahen Oberschen kels. Während die Hüftdysplasie eine angeborene Fehlstellung ist, stellt der Morbus Perthes eine Entwicklungsstö rung dar, die mit einer verminderten Durchblutung des Hüftkopfes – vor wiegend zwischen dem vierten und zehnten Lebensjahr – einhergeht. So wohl bei M. Perthes als auch bei der Hüftdysplasie sind Abklärungen, Beob achtung und stadiengerechte Behand
lung durch eine Kinderorthopädin bzw. einen Kinderorthopäden unerlässlich. Als Warnsignale sind Leisten-, Ober schenkel- und Knieschmerzen, Hinken und vor allem Bewegungsverlust in der Hüfte zu werten.
Als letzte Maßnahme zur Wiederher stellung der Hüftgelenkfunktion sind in den Spätstadien der Erkrankung –nach Fragmentierung des Hüftkopfes mit Verlust des Hüftkopfzentrums – die operativen Therapien notwendig. Dazu müssen Osteotomien (Knochenschnit te) am Oberschenkel oder Becken zur Zentrierung des Hüftkopfes durchge führt werden. Bei der Hüftdysplasie sind zur Gelenkerhaltung ebenfalls Osteotomien des Beckens zwecks ei ner besseren Überdachung und der Normalisierung der biomechanischen Verhältnisse des Hüftgelenkes erfor derlich. Ziel ist dabei die Ausheilung der Deformität.
Das femoroazetabuläre Impingement – ein pathologischer Kontakt zwischen Schenkelhals und Pfannendach bei be stimmten Bewegungsexkursionen – ist auf eine angeborene Formvariante des Hüftkopfes oder der Pfanne zurück zuführen. Diese Formvariante bewirkt im Rahmen repetitiver Aktivitäten die
vermehrte Beanspruchung der Ge lenklippe an der Pfanne und konse kutiv Risse. Die Abnützung leitet dann die Entwicklung einer Hüftarthrose ein. Hier führen mitunter scharfe oder dumpfe Schmerzen im Leis tenbereich bis hin zu Steifheit – vor allem nach längerem Stehen und Sitzen – zu Ein schränkungen der sportlichen und alltäglichen Aktivität. In diesem Fall hat, neben der offenen Chirurgie, insbeson dere die Hüftarthroskopie in der Behandlung von funktio nellen Beschwerden wie Leis tenschmerzen einen immer höheren Stellenwert. Ihre Rolle in der Arthroseprävention ist je doch noch als hypothetisch zu erachten.
GASTAUTOR: Prim. Priv.-Doz. Dr. Vinzenz Smekal Unfallkrankenhaus Klagenfurt am Wörthersee, Abt. f. Orthopädie und Traumatologie, Präsident der ÖGU und der ÖGOuT
Ein besonderer Schwerpunkt der Ta gung waren die Verletzungen und Brü
che der Hüfte. Dabei wurden Fraktu ren der Gelenkpfanne von hüftnahen Oberschenkel- und solche von Schenkelhalsbrüchen unterschieden. Insbesondere wurden die unterschiedlichen Behandlungskonzepte in Ab hängigkeit von Unfallmecha nismus und Alter beleuchtet. Während bei jungen Patien ten alle Anstrengungen zum Hüfterhalt unternommen werden sollten, spielt bei al ten und geriatrischen Patien ten der primäre Gelenkersatz eine immer bedeutendere Rolle. Diese sind zumeist von einer begleitenden Multimor bidität, einer Polypharmazie, der Sarkopenie und einer Osteoporose gezeichnet. Sie benötigen ein geriatri sches Co-Management zur optimalen Behandlung. Das oberste Ziel ist die möglichst rasche Mobilisation. Sie er fordert ein Co-Management im Sinne eines multidisziplinär abgestimmten Konzeptes aus den Bereichen Geria
trie, Innere Medizin, Unfallchirurgie, Orthopädie, Anästhesie, Physiothera pie und Pflege zur Deckung der Be dürfnisse betagter Patienten. Auch biomechanische Untersuchungen von unterschiedlichen Implantaten und ihren Positionierungen im Knochen zur Erhöhung der Belastbarkeit sowie die Vermeidung von Osteosyntheseversagen – vor allem bei schlechter Knochenqua lität – waren Inhalt zahlreicher Vorträge, die zum Ziel hatten, die unmittelbare Belastung für die Patienten sicherer zu machen.

Der primäre Gelenkersatz ist sowohl für Frakturen als auch für die Erkran kung, die Coxarthrose, eine etablierte Behandlungsoption. Durch die Aus dünnung des Knorpels wird das Hüft gelenk immer weniger belastbar. Der Krankheitsverlauf beginnt zumeist mit Leistenschmerzen nach Belastung und einer Bewegungseinschränkung, vor allem der Innenrotation der Hüfte, die
der gelenkerhaltenden Behandlung sind viele Fragen offen. Neue Therapieansätze werden derzeit intensiv beforscht.“
Betroffene vorerst zu einer Anpassung des Aktivitätsprofils zwingt. Zunehmende funktionelle Einschrän kung und dauernder Belastungsschmerz machen in der Folge einen Hüftgelenkersatz notwendig. Vorgestellt wurden klinische Ergebnisse von Implantaten mit unterschiedlicher Verankerungsstre cke im Oberschenkelschaft sowie unter schiedliche minimalinvasive Zugangs wege zum Hüftgelenk.
Die schwierige Hüfte und das Kompli kationsmanagement wurden im letzten Drittel der Jahrestagung thematisiert.
Dadurch war es möglich, die Spannung der Veranstaltung bis zum Ende auf rechtzuerhalten. Darunter fielen die Planung und Rekonstruktion des Hüft kopfzentrums bei Dysplasie, Stabili sierungsoptionen bei Instabilität nach primärer Endoprothese sowie die Dia gnostik und Behandlung pathologischer Hüftfrakturen. Pathologische Brüche der Hüftknochen durch Knochenkrebs sind häufig das erste Symptom dieser Erkrankung. Selten treten zuvor Hüft schmerzen auf, die zumeist nachts begin nen und dann zum Dauerschmerz wer den. Schwellungen im Hüftbereich sind zusammen mit Gewichtsverlust und un gewöhnlicher Müdigkeit schon als späte Symptome zu werten. Bei Frakturen, die ohne adäquate Gewalteinwirkung vor allem bei jungen Patienten entstehen, sollte der operierende Unfallchirurg deshalb zum Ausschluss einer malignen Erkrankung immer eine Biopsie vor nehmen.
Als operative Lösungen für spezifische Probleme nach primärem Hüftgelenker satz – beispielsweise für periprothetische
Brüche, Infektionen oder Lockerungen, die mit fehlenden Verankerungsmög lichkeiten einer herkömmlichen Pro these einhergehen – wurden die derzeit verfügbaren Hardware-Lösungen vor gestellt, die von Metallaugmentationen bis hin zu Megaprothesen zwecks Er haltung der Mobilität und Integrität des Körperstammes reichen.
Besonders freudig erinnern werden wir uns auch an die Spendenübergaben an die Organisationen „ H ilfe für die Ukraine“ und „ Ä rzte ohne Grenzen“, die sich mit beeindruckenden Festvor trägen inklusive einer Videobotschaft über „ Surgery on the Frontline“ und mit einem Längs- und Querschnitt über „ 5 0 Jahre Ärzte ohne Grenzen“ bei den Gesellschaften bedankten. Insgesamt blicken wir zufrieden auf eine geglück te und spannende Jahrestagung zurück. Ich bin sicher, dass alle Teilnehmer Wis senswertes für ihre tägliche Arbeit mit den Patienten mitnehmen konnten. <
„In
THC-basiert: Wirkstoff Dronabinol: magistrale Zube reitung als ölige Lösung oder Kapseln der Gelben Box (RE1) des EKO zugeordnet, Erstattung nach Vorabbewilligung Nabilon – Canemes®: Kapseln nicht im EKO gelistet, Erstattung bei chemotherapiebedingter Emesis und Nausea
THC-CBD-Gemisch: Nabiximols – Sativex®: Mundspray seit Herbst 2019 im gelben Bereich des EKO gelistet, Kostenübernahme bei mittel schwerer und schwerer Spastik bei MS
Wesentlich sind hingegen die Kontrain dikationen. An erster Stelle sind psychiatrische Vorerkrankungen wie Schizophre nien oder Panikattacken zu nennen, da Psychosen ausgelöst werden können. Weitere Kontraindikationen sind Schwan gerschaft und Stillzeit sowie eine mani feste KHK.
Das Nebenwirkungsprofil von Drona binol ist dosisabhängig und mit den psychotropen Eigenschaften sowie der verstärkenden Wirkung auf den Sym pathikus assoziiert. Zu den häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen zählen Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit sowie Mundtrockenheit.
Cannabinoide wurden schon 3000 vor Christus in China als Heilpflanze beschrie ben, in Europa hatten sie eine echte Blü tezeit zwischen 1880 und 1900. In dieser Zeit wurden Cannabispräparate, wie Tink turen, u. a. zur Behandlung von Schmer zen, Spasmen, Asthma, Schlafstörungen, aber auch Rheuma, Cholera und Tetanus eingesetzt. Dies hatte 1898 mit der erst maligen Entwicklung von synthetischen Arzneimitteln (beispielsweise Aspirin) und mit den rechtlichen Einschränkungen durch die Opi umkonvention ein jähes Ende. Das Interesse am Medizinal hanf erwachte in den 1960er Jahren wieder, als THC (Tetra hydrocannabinol, Dronabinol) in Israel erstmals isoliert wur de. Der zweite, medizinisch am meisten erforschte Inhaltsstoff ist CBD (Cannabidiol).
THC wird vor allem in der Palli ativ- und Schmerzmedizin zur Verbesserung der Lebensqua lität eingesetzt, während CBD medizinisch in der antikonvul siven/antiepileptischen Therapie zur An wendung kommt, allerdings in einer deut lich höheren Dosierung (Faktor 1 : 100 im Verhältnis zu THC).
CBD-basiert: Wirkstoff Cannabidiol: magistral als ölige Lösung, nicht gelistet, Erstattung bei therapierefraktären Epilepsien möglich Epidyolex®: ölige Lösung seit 2021 im gelben Bereich des EKO gelistet, Erstattung bei therapierefraktären Epilepsien möglich

Wird Dronabinol über mehrere Tage lang sam aufdosiert, kann die Verträglichkeit wesentlich verbessert werden – ganz nach dem Motto: start low – go slow.
Nach langsam erfolgter Auftitrierung soll te der Effekt nach maximal zwei Wochen einsetzen. Es können bis zu drei Monate vergehen, bis die optimale Erhaltungsdo sis erreicht ist. Es treten keine Toleranzentwicklungen auf.

Dronabinol in der Allgemeinpraxis
Der Wirkstoff Dronabinol hat heute in der allgemeinmedizinischen Praxis vor allem durch seine Clusterwirkung in der Symptombehandlung von on kologischen, geriatrischen und Palliativpatienten sowie bei chronischen Schmerzzustän den einen wesentlichen Stel lenwert.
Die Clusterwirkung ergibt sich aus dem Wirkmuster von Dro nabinol: Es ist zentral muskel relaxierend, antikachektisch, antiemetisch, analgetisch, an xiolytisch, sedierend und anti phlogistisch.
Dronabinol wird über das CYP450-System verstoffwechselt –Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die über jenes abgebaut werden, sind theoretisch mög lich. Im Wesentlichen muss man jedoch keine Interaktionen befürchten, es sind keine relevanten Probleme bekannt.
Bereicherung der potenziellen Medikation Immer wieder haben die Patient:innen bzw. ihre Angehörigen Vorurteile bezüglich der Einnahme des Wirkstoffes Dronabinol, sei es eine vermutete Abhängigkeit oder ein befürchteter rauschähnlicher Zustand. Beides tritt im Rahmen des medizinischen oralen Gebrauches nicht auf. Anderer seits kann man als Behandler:in auch in schwierigen Arzt-Patienten-Beziehungen die „Mystik“ des Präparates positiv im Sin ne eines Behandlungserfolges und einer Symptomlinderung einsetzen. Oft reagie ren Patient:innen, die weitgehend medi kamentöse Therapien ablehnen, neugierig auf das Angebot, den Wirkstoff Dronabi nol bei ihren Beschwerden zu probieren. Ist nun der Wirkstoff Dronabinol ein Wun dermittel oder ein Teufelszeug? Meine Antwort: Weder noch, er ist einfach eine Bereicherung der potenziellen Medikation und sollte im therapeutischen Portfolio ei nen fixen Stellenwert innehaben.
Referenzen beim Herausgeber.
In den letzten 30 Jahren verzeichnete die Diagnostik und Therapie rheumatischer Erkrankungen bahnbrechende Entwicklungen


einflusst entscheidend den gesamten Krankheitsverlauf sowie die Prognose der Erkrankung und ist damit sowohl für Beeinträchtigung bzw. Erhalt kör perlicher Funktionen als auch für die Entwicklung von Komorbiditäten und Mortalität verantwortlich.
zeptorantagonisten (Anakinra) gibt es zwei weitere Interleukin-Therapien (IL-6-Rezeptorblocker Tocilizumab und Sarilumab).
• Ebenso stehen ein Co-Stimulations blocker (Abatacept) und bei Thera pieversagen Rituximab (Anti CD20, B-Zellen) zur Verfügung.
Prim. Doz.

Dr. Edmund Cauza
Abteilung für Innere Medizin, Akutgeriatrie und Remobilisation und stv. Ärztlicher Direktor im Herz-Jesu Krankenhaus Wien
… ist eine chronisch progredient verlau fende systemische Autoimmunerkran kung, bei der es zu destruierenden Ver änderungen der Ge lenke kommen kann. Die Prävalenz liegt laut Studien zwi schen 0,3 und 1,0 %; die Ursache ist bis jetzt nicht restlos geklärt. Es werden genetische Faktoren, die für den Schwe regrad der Erkrankung verantwortlich sein dürften, Umweltfaktoren (Einfluss des Rauchens bzw. toxischer Substan zen) und Infektionen diskutiert. In Stu dien wurde auch ein Zusammenhang zwischen entzündlichen Veränderungen der Mundschleimhaut (Peridontitis), des Gastrointestinaltraktes und der Entstehung bzw. dem Verlauf von chro nisch entzündlichen Reaktionen nach gewiesen. Die Entzündungsaktivität be-
Konventionelle krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (csDMARDs)
• Die initiale medikamentöse Behand lungsstrategie beinhaltet nichtste roidale Antirheumatika und/oder Kortikosteroide. Zeitgleich wird eine csDMARDs-Therapie etabliert, als Goldstandard fungiert Methotrexat. Biologische krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (bDMARDs)
• Zum jetzigen Zeitpunkt sind insgesamt fünf Tumornekrosefaktor-Inhibitoren etabliert: Adalimumab, Etanercept, Infliximab, Certolizumab, Golimumab.
• Neben der Behandlung mit dem schwach wirksamen Interleukin-1-Re
Zielgerichtete synthetische krankheits modifizierende antirheumatische Medi kamente (tsDMARDs)
• Zu den neuesten therapeutischen Ent wicklungen zählen die sogenannten Ja nuskinase-Inhibitoren: Tofacitinib, Ba ricitinib, Upadacitinib und Filgotinib.
Die Behandlungsschritte sind in den na tionalen wie auch in den internationalen Therapie-Guidelines (EULAR/ACR) definiert.1
… ist eine chronisch entzündliche Er krankung des Bewegungsapparates mit einer starken Psoriasis-Assoziation. Zu sätzlich liegt häufig ein Nagelbefall vor. Der Großteil der Betroffenen leidet an einer asymmetrischen, schmerzhaften
Schwellung von ein bis vier Gelenken (Oligoarthritis). Bevorzugt erkranken einzelne Finger- oder Zehengelenke. Eine typische Manifestation dieser Verlaufsform ist die Daktylitis, d. h. eine Schwellung nicht nur einzelner Gelenke, sondern eines ganzen Fingers („Wurstfinger“) oder einer ganzen Zehe („Wurstzehe“). Hierbei ist neben dem Endgelenk auch das Mittel- und Grund gelenk eines Strahls betroffen, gleichzei tig liegt eine Tenosynovialitis der Flexo rensehnenscheiden vor.
Selten kommt es zu einem schweren Verlauf mit ausgeprägter Zerstörung der betroffenen Gelenke (Arthritis mutilans). Hier können sich eine Ver kürzung und ein „ Einschrumpfen“ der Finger zeigen („Teleskopfinger“) Schwere Verkrüppelung und Behinde rung ist die Folge. Die Manifestation an Sehnenansätzen, Bandansätzen und Kapselansätzen ist typisch für die Pso riasisarthritis und wird als Enthesiopa thie bezeichnet (griech. „enthesis“ = „ A nsatzpunkt“).
Neben den typischen Veränderungen des Bewegungsapparates können auch extraartikuläre Manifestationen vorhan den sein. Zusätzlich zu Nagelverände rungen („Ölnägel“) oder Tüpfelnägeln oder zur Ablösung eines Nagels (Ony cholyse) können Augenveränderungen sowie viszerale Manifestationen (selten Amyloidosen oder Myositis) auftreten. Komorbiditäten wie chronisch entzünd liche Darmerkrankungen (CED) oder eine Uveitis sind nicht selten.
Therapieempfehlungen erfolgen nach den sogenannten EULAR1- oder GRAPPA2-Kriterien. Anders als bei der rheumatoiden Arthritis wird der Thera pieerfolg nicht nur am Bewegungsappa rat gemessen, sondern es werden auch extraskelettale Veränderungen – Ver minderung des Haut-, Nagel- und Seh nenansatzbefalles – berücksichtigt. Neben nichtsteroidalen Antirheumatika und/oder Kortikosteroiden ist eine systemische Therapie – zuerst mit csDMARDs, dann bei Notwendigkeit auch mit bDMARDs – die Standardtherapie geworden.
Über die biologischen krankheitsmodifizierenden Therapien, etwa mit den Interleukin-17-Inhibitoren Secukinumab, Ixekizumab und Brodalumab, hin aus kommt Ustekinumab (Interleu kin-12/23-Inhibitor) zur Anwendung.
Bei Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis, aber auch bei jenen mit einer Spondylarthritis oder Psoriasisarthritis ist das kardiovaskuläre Risiko im Ver gleich zu Gesunden ca. um das 1,5-Fa che erhöht. Bereits zum Zeitpunkt der Diagnose besteht eine subklinische Atherosklerose. Als unabhängiger Risi kofaktor liegt hier eine Entzündung per se vor, die für die atherosklerotischen Veränderungen verantwortlich ist. Das Risiko, einen tödlichen Myokardinfarkt zu erleiden, ist um das 1,5- bis 2,5-Fache erhöht. Das Risiko einer Herzinsuffizi enz auf das 2-Fache. Klassische kardiovaskuläre Erkrankun gen treten bei Patienten mit rheumatoi der Arthritis signifikant häufiger auf als in der Normalbevölkerung: Dazu zählen erhöhter Blutdruck, Arteriosklerose, koro nare Herzkrankheit, Schlaganfall und throm boembolische Ereignisse. Deshalb ist es besonders wichtig, einerseits die Krankheits aktivität der RA, andererseits die zusätz lichen Herz-KreislaufErkrankungen bestmöglich zu behandeln, um so das kardiovaskuläre Risiko der Patientin nen und Patienten zu verringern.
Die Mitbeteiligung der Lunge in Form einer interstitiellen Lungenerkrankung (RA-ILD) gehört zu den häu figsten Organmanifes tationen bei rheuma
toider Arthritis und zählt zu den drei Haupttodesursachen von Betroffenen.
Besonders bewährt hat sich ein kombi niertes Kraft- und Ausdauertraining, bei dem Regelmäßigkeit von besonderer Wichtigkeit ist:
• Empfohlen werden dreimal pro Wo che mindestens 30 Minuten Ausdau ertraining …
• … sowie regelmäßiges Krafttraining der großen und kleinen Muskelgrup pen.
Bei Patienten, die unter Morbus Bech terew (Spondylitis ankylosans) leiden, kommen Bewegungs- und Haltungs übungen hinzu. Es konnte in mehreren Studien belegt werden, dass für Pati enten mit einer milden bis mittleren Krankheitsaktivität körperliche Bewe gung (Training) vorteilhaft ist.
1 eular.org/recommendations_eular_acr.cfm
2 GRAPPA: Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis.
<

Rauch Schon 1992, im Rahmen eines Kammertages der Österreichi schen Ärztekammer (ÖÄK) in Schruns, ist der Beschluss zum Facharzt für Allgemeinmedizin gefasst worden. Nun, fast genau 30 Jahre später, soll die Einfüh rung des entsprechenden Titels samt Ausbildung endlich Reali tät werden. Eine Arbeitsgrup pe im Ministerium hat am 19. September das Positionspapier zum neuen „Facharzt für All gemeinmedizin und Familienmedizin“ einstimmig beschlossen. „Es waren lang wierige und zum Teil sehr schwierige
EXPERTE: Johannes Rauch Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu mentenschutz
Verhandlungen, die jetzt Erfolg zeigen“, freut sich ÖÄK-Präsident Dr. Johannes Steinhart. Man müsse anerkennen, dass sich Gesundheitsminister Johannes Rauch und Sektionschefin Dr.in Katharina Reich sehr für den Facharzt für Allgemein medizin und Familienmedizin einge setzt hätten. Für Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärz tekammer und Bundeskuri enobmann der niedergelasse nen Ärzte, muss dieser Schritt „als Meilenstein und längst verdienter Ausdruck der Wert schätzung und Anerkennung der Allgemeinmedizin“ gewer tet werden: „Wir sind über zeugt, dass damit wieder mehr junge Ärztinnen und Ärzte den Weg in die Allgemeinmedizin finden werden“, sagt er.
Um die Allgemeinmedizin zu attrakti vieren, hat das Gesundheitsministeri
um bereits im April 2018 eine Liste mit zahlreichen Maßnahmen erstellt, die nach vier Bereichen kategorisiert sind: universitäre Ausbildung, postpromotio nelle Ausbildung, Berufsausübung und –
Die Allgemeinmedizin und Familienmedizin wird ein Facharztstudium. Ein erstes Positionspapier der wichtigsten Stakeholder wurde einstimmig beschlossen.

Die Ausbildung im Anschluss an das Medizinstudium wird bis 2030 in mehreren Schritten von bisher drei auf fünf Jahre verlängert.
Die zwei zusätzlichen Jahre werden als Lehrpraxis und überwiegend im niedergelassenen Bereich absolviert.
Auch in der dreijährigen Grundausbildung soll es einige Änderungen geben.
Voraussetzung für die Schaffung einer Facharztausbildung ist eine Änderung des Ärztegesetzes, die in den kommen den Monaten im Nationalrat eingebracht werden soll.
„Durch die Schaffung des Facharztes für Allgemeinund Familienmedizin in Österreich stellen wir die Ausbildung nach internationalem Vorbild neu auf.“
Ein Meilenstein nach 30-jährigen Bemühungen erreicht –Allgemein- und Familienmedizin werden aufgewertet –noch etliche Fragen offen
übergreifend – Image/Prestige sowie Be rufsbild. Die Einführung der Fachärztin bzw. des Facharztes für Allgemeinmedi zin und Familienmedizin wurde dabei als eine der wesentlichen Maßnahmen
angesehen. Aus diesem Grund widmete sich seit Dezember 2021 eine eigens ein gerichtete Unterarbeitsgruppe intensiv der Ausgestaltung eines solchen neuen Sonderfaches.
Die betroffenen Stakeholder – Ge sundheitsministerium, Ärztekammer, Krankenanstaltenträger, Bundeslän der, Sozialversicherung – erarbeiteten in Kooperation mit nationalen und internationalen Expertinnen und Ex perten zentral auch eine genaue De finition des Aufgabengebietes, Ausbil dungsinhalte und Ausbildungsdauer sowie die Übergangsbestimmungen in der Einführungsphase des neuen Son derfaches.
Zentrale Neuerungen umfassen bei spielsweise eine neu ausgestaltete, wei terentwickelte Ausbildung – u. a. durch Erweiterung der Lehrpraxis. So wurde die Definition des Aufgabengebietes für das Sonderfach Allgemeinmedizin und Familienmedizin erarbeitet:
• Das Aufgabengebiet umfasst die primäre Gesundheitsversorgung, insbesondere die ganzheitliche, kon tinuierliche und koordinative medi zinische Betreuung.


• Beinhaltet ist die Gesundheitsför derung, Krankheitserkennung und Krankenbehandlung einschließlich der Einleitung von Rehabilitations-
und Mobilisationsmaßnahmen aller Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung – unter Berücksichtigung des Um felds der Person, der Familie, der Gemeinschaft und ihrer Kultur.
• Die Fachärztin/der Facharzt für All gemeinmedizin und Familienme dizin soll die erste Anlaufstelle für sämtliche gesundheitliche Anliegen sein und dazu beitragen, die Gesund heitskompetenz des Einzelnen sowie spezifischer Populationsgruppen zu stärken, insbesondere durch gesund heitsfördernde Aktivitäten sowie Beratung und Aufklärung unter Be rücksichtigung des jeweiligen epide miologischen Hintergrundes.
• Als wesentlich wird zudem die Zu sammenarbeit mit und Koordination von Fachärztinnen/Fachärzten ande rer Sonderfächer (SF), mit Vertrete rinnen/Vertretern anderer Wissen schaften, mit Angehörigen anderer Gesundheits- und Sozialberufe (bzw. eines anderen Berufes) und mit Ein richtungen im Gesundheitswesen, insbesondere Krankenanstalten bzw. Kuranstalten, hervorgehoben.
• Auch gezielte Zuweisungen zu Spe zialistinnen/Spezialisten, die feder führende Koordination zwischen den Versorgungsebenen, das Zusam menführen und Bewerten/Einschät zen bzw. Umsetzen aller Ergebnisse sind Teil des Aufgabengebietes.
Herr DDr. Reinisch und Frau Prof. Pabinger beleuchten in diesem eLearningVideo auf verständliche Art und Weise das Thema Gentherapien aus verschiedenen Richtungen.
Der Zugang ist ganz einfach über den QR-Code oder den unten angeführten Link.* mit 2 DFPPunkten
https://www.vielgesundheit.at/fortbildungen/dfp/ grundlagen-gentherapie
*Der Link zur Website www.vielgesundheit.at ist als Service für unsere Kunden gedacht. Pfizer ist für den Inhalt dieser Website nicht verantwortlich. Das eLerarning Grundlagen der Gentherapie wurde in Zusammenarbeit mit Pfizer erstellt.
Pfizer Corporation Austria GmbH Wien www.pfizer.at, www.pfizermed.at
• Darüber hinaus ist die Wahrneh mung von allgemeinärztlichen Tä tigkeiten, insbesondere in Organi sationen wie Kindergärten, Schulen, Polizei- oder Heeresdienst sowie Be hörden, inkludiert.
Die Ziele, die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer sind ebenfalls zentrale inhaltliche Schwerpunkte des Positionspapiers. Hierzu ist z. B. schon festgehalten, dass sich die Ausgestal tung ebenso wie in den anderen Son derfächern an der Basisausbildung, der Sonderfachgrund- sowie der Sonder fachschwerpunktausbildung orientiert. Im Gegensatz zu den übrigen SF erfolgt in der Allgemeinmedizin jedoch die Sonderfachschwerpunktausbildung in Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen, Lehr ambulatorien oder Primärversorgungs einheiten (PVE), also im niedergelasse nen Bereich.
Wesentlich ist, dass durch die Fachärz tin/den Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin die Lehrpraxis
stufenweise auf insgesamt 24 Monate angehoben werden soll und durch diese Ausweitung des Praxisteils den ange henden Hausärzten ein wertvoller, um fassender Einblick in die Arbeit in der Niederlassung ermöglicht wird – und somit auch eine gezielte Vorbereitung. Jene umfasst nicht nur Faktoren wie Pa tientinnen- und Patientenkontakt und -behandlung, sondern ebenso Erfahrun gen mit den unternehmerischen Aspek ten, die eine Ordination mit sich bringt. So soll die Lehrpraxis auch dazu beitra gen, dass Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner nach Abschluss der Ausbildung sich schneller zutrauen, in die Niederlassung zu gehen.
Im Gesundheitsministerium hofft man, dass durch diese wesentlichen Neue rungen die Ausbildung für allgemein medizinische Turnusärztinnen und Tur nusärzte und auch fertig ausgebildete Allgemeinmedizinerinnen und -medi ziner optimal weiterentwickelt werden kann. Gesundheitsminister Johannes
Rauch zeigt sich über den einstimmigen Beschluss der Ausbildungskommission erfreut: „Die Allgemeinmedizin ist die wichtigste Säule in der medizinischen Primärversorgung“, hält er fest. „Durch die Schaffung des Facharztes für Allge mein- und Familienmedizin in Österreich stellen wir die Ausbildung nach interna tionalem Vorbild neu auf. Wir kommen damit einer zentralen Forderung der jungen Ärzteschaft nach, die seit Jahren diagnostiziert, dass die Verbesserung der Ausbildungsqualität die wichtigste Maß nahme gegen den Hausärztemangel ist. Durch den neuen Fokus auf die Lehrpra xis im niedergelassenen Bereich können wichtige Inhalte weitergegeben werden, sodass sich wieder mehr junge Medizi ner für eine Niederlassung entscheiden “ Für die Patienten werde die Schaffung des „Facharztes für Allgemeinmedizin“ vermutlich nicht so wichtig sein, fügt der Minister hinzu. Für die betroffenen Ärzte jedoch schon. Sie würden damit mit den Facharztkollegen auf eine Ebene geho ben. Rauch hält das für einen wichtigen Baustein, um den Beruf der Allgemein mediziner attraktiver zu machen.
 Mag.a Karin Martin
Mag.a Karin Martin
Es ist eine positive Entwicklung, wenn die Qualität der Ausbildung in der Allgemeinmedizin weiter angehoben wird und der Praxisteil im niedergelassenen Bereich mehr Platz bekommt. Eine hochwertige Ausbildung der Allgemeinmediziner:innen ist die Grundvoraussetzung für eine umfassende Behandlung der Patient:innen sowie für die Entlastung der Krankenhäuser und Fachärzte, die derzeit mit dem Ausbau der Primärversorgungszentren vorangetrieben wird. Diese Erwartung einer hohen Ausbildungsqualität sollte mit der Verleihung des Facharztes für All gemeinmedizin tatsächlich realisiert werden, denn die Bezeichnung Facharzt allein macht die Versorgung für die Patient:innen noch nicht besser. Das wäre dann eine reine Imagepolitur. Zu bedenken ist, dass sich die Umstellung und Verlängerung der Ausbildung um 1,5 Jahre auch negativ auswirken kann. Besonders in der Übergangszeit vom alten auf das neue System kann es zu einer Verschärfung der Nachbesetzungsproblematiken kommen, da eineinhalb Jahrgänge an Nachwuchs fehlen werden. Hier braucht es sinnvolle Begleitmaßnahmen. Zudem ist der Facharzt für Allge meinmedizin nicht als Allheilmittel zu sehen. Die Österreichische Gesundheitskasse arbeitet derzeit intensiv an allen Ecken des Sys tems, um die Versorgungssicherheit für die Patient:innen zu gewährleisten. Neben besagtem Ausbau der Primärversorgung werden verschiedenste Zusammenarbeitsformen und flexible Arbeitszeitmodelle für Ärzt:innen realisiert, die in der Kassenversorgung mithel fen wollen. Neben den attraktiven Einkommensmöglichkeiten in der Allgemeinmedizinpraxis wollen wir mit dem sogenannten SorglosPaket auch schon in der Planung und beim Einstieg in die freiberufliche Tätigkeit unterstützen. Hier wollen wir Interessent:innen früher abholen und Pakete schnüren, die dann auch in der Umsetzung nachhaltig und gut für Patient:innen und Ärzt:innen funktionieren. Mit diesem Anspruch gehen wir zusätzliche Wege, die noch viel eher ansetzen, nämlich an der Universität. Hier wollen wir mit gezielten Hausarztquoten und Stipendienmodellen frühzeitig junge Menschen finden, die gerne mithelfen, eine gute Versorgung für alle zur Verfügung zu stellen. Ich bin überzeugt: Davon gibt es eine ganze Menge, einerlei ob Facharzt oder nicht.
„Verlängerte Ausbildung kann sich auch negativ auswirken“© SGKK Andreas Huss, ÖGK-Obmann ÄK Wien Anna Rauchenberger
MR Dr. Johannes Steinhart,
ÖÄK-PräsidentDr. Edgar Wutscher, Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzt:innen
Die Gremien der Österreichischen Ärztekammer haben einstimmig die Einführung des Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin beschlossen. In Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz sowie einer Untergruppe der § 44-Kommission, einem beratenden Organ des Bundesministers, konnte nun die Einführung fixiert werden. Damit steht das Grundgerüst. 30 Jahre voller langwieriger und schwieriger Verhandlungen sind nun erfolgreich zu einem Abschluss gekommen. Mit der Umsetzung wird eine jahrelange Forde rung der Österreichischen Ärztekammer erfüllt. Weitere Gespräche sind noch offen, da für die Umsetzung Änderun gen im Ärztegesetz durchgeführt werden müssen. Sobald die Gespräche mit dem Ministerium abgeschlossen sind und die Änderung des Ärztegesetzes im Parlament beschlossen ist, kann bei der Österreichischen Ärztekammer der Antrag auf Facharztzuerkennung gestellt werden. Der Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Wichtig ist auch, dass die Ausbildung gleichzeitig weiterentwickelt wird. Sie wird zukünftig fünf Jahre dauern, wobei die zu sätzlichen zwei Jahre in der Lehrpraxis verbracht werden. Damit steigt die Ausbildungsqualität, weil die Allgemein medizin dort vermittelt wird, wo sie gemacht wird. Die Ausbildungsdauer erlaubt es, die Zeit in der Lehrpraxis auch flexibler zu gestalten. So kann etwa ein Teil im urbanen und einer im ländlichen Bereich absolviert werden. Ein Meilenstein ist nun gesetzt, aber weitere müssen folgen, Stichwort Kassenärztemangel. Zudem muss die Gesprächs medizin anerkannt und ein einheitlicher Leistungskatalog endlich tatsächlich umgesetzt werden. Und man darf nicht auf die Wahlärzte vergessen, die ihren Beitrag für die Versorgung leisten.
Dr. Richard Brodnig, BSc, Obmann der Jungen Allgemein medizin (JAMÖ)



Das Gesundheitsministerium hat die Facharztausbildung für Allgemein- und Familienmedizin zugesagt und schafft somit eine zukunftsträchtige Chance, die Allgemeinmedizin nachhaltig aufzuwerten und für die kommenden Generationen zu attraktivieren. Einerseits ermöglicht der Titel eine lang überfällige Gleichstellung mit anderen Fächern, die mit Ausbil dungsende einen Facharzttitel erhalten, andererseits kann im Zuge der längeren Ausbildung endlich die Lehrpraxis, der Ort, an dem Allgemein- und Familienmedizin praktiziert wird, ausgebaut werden.
Die Lehrpraxis ist nachweislich der Ausbildungsabschnitt, der Begeisterung für die Allgemeinmedizin weckt. Nur hier können die Prinzipien der Allgemein- und Familienmedizin wirklich verinnerlicht werden. Die Kontinuität der Patient:innenversorgung, die fächerübergreifende Symptombehandlung, die Erfassung des Menschen in seiner Mehr dimensionalität sowie die Betreuung von Mehrfacherkrankten sind die Kernaspekte der Allgemein- und Familienmedizin, welche nur in der Lehrpraxis vermittelt werden können.
Eine Verlängerung der Lehrpraxisdauer auf zwei Jahre stellt hier im internationalen Vergleich das Minimum dar. Es muss österreichweit zu einer besseren und einheitlichen Entlohnung in der Lehrpraxis kommen. Aus einigen Bundesländern wurde von Kolleg:innen geäußert, dass sie eine Lehrpraxis mit derart schlechter Bezahlung keinesfalls länger als sechs Monate absolviert hätten und aus finanziellen Grün den sonst in ein anderes Fach gewechselt wären. Hierfür müssen die Entscheidungsträger Lösungen finden, damit es nicht zum Wechsel eigentlich motivierter Kolleg:innen in andere Ausbildungen kommt. Mit allen noch offenen Aspekten ist das Zugeständnis zum Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin der richtige Schritt zur Aufwertung der Allgemeinmedizin und damit der Gesundheitsversorgung Öster reichs. Wir von der JAMÖ haben ein österreichweites Netzwerk von Ärzt:innen in allgemeinmedizinischer Ausbildung und hoffen, uns mit dem Wissen hieraus nachhaltig einbringen zu können. In diesem Sinne stehen wir den Entscheidungsträger:innen gerne für Diskussionen und konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung.
„Ein Meilenstein ist gesetzt, weitere müssen folgen“
„Bessere und einheitlichere Entlohnung in der Lehrpraxis“© © ÄK Tirol Wolfgang Lackner © Martin Wiesner
Univ.-Prof.in Dr.in Anita Rieder, Vizerektorin der MedUni Wien für Lehre, im Gespräch über die künftigen Anforderungen an das Studium
HAUSÄRZT:IN: Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht Facharztausbildung und -titel für die Allgemein- und Familien medizin?
Prof.in RIEDER: Der Facharzttitel allein ist nicht das Anliegen der All gemeinmedizin, sondern die daraus resultierenden Konsequenzen für die Umsetzung in die tägliche ärztliche Pra xis. Die Anforderungen an die hausärzt liche Tätigkeit sind groß, denn es muss ein komplexes Versorgungsspektrum abgedeckt werden. Das muss sich in der Ausbildungsqualität niederschlagen. Die Ausbildung für Ärztinnen und Ärz te in der Allgemeinmedizin ist genauso spezifisch und fokussiert zu sehen, zu behandeln und anzubieten wie jene für andere Fachärzt:innen. Dies ist ein wich tiges Zeichen für den Nachwuchs, der sich für die Allgemeinmedizin entschei den will.
Bei der Früherkennung demenzieller Erkrankungen nehmen die Hausärztinnen und -ärzte eine sehr zentrale Rolle ein. Sie haben durch eine oftmals langjährig bestehende vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung die Chance, das sensible Thema Hirngesundheit frühzeitig bei ihren Patientinnen und Patienten anzusprechen. „Viele von ihnen sind sehr dankbar, wenn von Expert:innenseite der Anstoß kommt, kognitive Probleme zu thematisieren, da dieses Thema immer noch häufig mit Scham und Unsicherheit besetzt ist“, sagt Julia Wimmer-Elias, Psychologin der MAS Alzheimerhilfe. Die Demenzexpertin empfiehlt routinemäßig Fragen in Vorsorgeuntersuchungen mit aufzunehmen. So könnten die Hausärzte potenzielle Warnsignale für das Vorliegen einer demenziellen Erkrankung erheben:
• „Haben Sie das Gefühl, vergesslich zu sein?“
• „Haben Sie bei der Bewältigung gewohnter Alltagsaktivitäten Schwierigkeiten?“
• „Bemerken Sie Persönlichkeitsveränderungen?“
Falls sich ein Demenzverdacht zeigt, können Hausärzte frühzei tig weitere Abklärungsschritte einleiten und die Patienten haben ehest möglich Zugang zu medikamentösen bzw. psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten.
Weitere Infos unter: alzheimerhilfe.at und ig-pflege.at

Inwiefern betrifft die Umstellung die MedUni?
In der Lehre haben wir als MedUni Wien in unserem Entwick lungsplan und unse rer Leistungsvereinbarung einen Schwer punkt Allgemeinmedizin gesetzt. Wir ha ben viele Lehrinhalte bereits im Pflichtcurriculum und kooperieren mit den niedergelassenen Kolleg:innen. Im Klinisch Praktischen Jahr ist es möglich, acht bis sechzehn Wochen in der Allgemeinmedizin zu verbringen. Wir haben ein spezifisches Ex zellenzprogramm mit Hospitationen und aktuelle Spezialfort-
bildungen. Eine Facharztausbildung Allgemeinmedizin verändert für uns daher grundsätzlich wenig im Studium. Die Professur Primary Care wird gera de besetzt. So sind wir gut vorbereitet und bauen unser Exzellenzprogramm aus, und mit der Professur werden wei tere Inhalte aus Primary Care Medicine eingebracht werden.
Für die Universitätskliniken könnte man sich vorstellen, dass dann Fachärzt:innen für Allgemeinmedizin in Ausbildung in einzelne Abteilungen für einen kleine ren Teil ihrer Ausbildung rotieren könn ten, um diesen Versorgungslevel eben falls kennen zu lernen.
Das Studium wird jedenfalls länger dauern … Ja, bei einer Facharztausbildung ist eine längere Ausbildungszeit unweigerlich erforderlich. Wobei ihre Vorteile dann auch umgesetzt werden müssen – näm lich, dass die fachspezifische Ausbildung vertieft werden kann und die Qualitäts sicherung gewährleistet wird. Eine län gere Ausbildungszeit ermöglicht somit auch die längere praktische Ausbildung im Setting Primärversorgung/Allge meinmedizin, die Vorbereitung auf die selbstständige Tätigkeit und ein breite res Portfolio berufsspezifischer Kompe tenzen.
Sind Ausbildung und Titel als Allheil mittel im Kontext des Ärztemangels zu sehen?
Nein, natürlich sind sie kein Allheil mittel, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Für weitere Schritte sind vor allem Politik, Kassen und Ärztekammer gefragt, damit die Absolvent:innen auch eine ausgezeichnete Facharztausbildung erhalten und die Rahmenbedingungen in den Ordinationen und Primärversor gungszentren attraktiv genug sind. Als MedUni Wien können wir durch unser Curriculum dazu beitragen.
Das Interview führte Mag.a Karin Martin.


Seitüber125Jahrenarbeitenwirdaran, Lebenzuschützen,zuverbessernundzuverlängern.

Wie zufrieden ist die Ärzteschaft mit dem Diplom-Fortbildungs-Programm?
sierung/Festigung der eigenen Kompe tenzen, Selbstverständnis/Berufsethos, Interesse an den Fortbildungsthemen und die Sicherstellung des Patienten wohls. Diese Auswahlmöglichkeiten er hielten jeweils einen Zuspruch von über 90 % – die Verpflichtung laut Ärztege setz hingegen 72,63 %.

Das Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Akademie der Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) ist österreichweit einheitlich gestaltet und umschreibt einerseits die Anfor derungen für alle Ärztinnen und Ärz te, andererseits die von den Anbietern einzuhaltenden Qualitätsstandards der Fortbildungen. Doch wie steht es um die Zufriedenheit der Ärzteschaft mit dem Programm? Antworten liefert eine ak tuelle Onlineumfrage*, an der insgesamt 6.278 Ärztinnen und Arzte teilnahmen. Die Ergebnisse präsentierten Dr. Harald Schlögel, ÖÄK-Vizepräsident und Prä sident der Ärztekammer für Niederös terreich, sowie Dr. Peter Niedermoser, Präsident des wissenschaftlichen Bei rats der Österreichischen Akademie der Ärzte und Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich, im Rahmen eines Pressegesprächs**
Die allgemeine Zufriedenheit ist der Umfrage zufolge hoch: 92,4 % der Teil nehmenden sind mit der Qualität der Fortbildungen „sehr bzw. eher zufrie den“ „ Das zeigt, dass wir mit unseren DFP-approbierten Angeboten auf ei nem richtigen Weg sind. Mit 24.787 DFPapprobierten Fortbildungen konnten wir 2021 auch um 28 Prozent mehr anbieten
als noch im ersten Coronajahr 2020 “ , freute sich Dr. Schlögel. „ Für 80,5 % der Ärzteschaft ist es sehr oder eher wichtig, dass eine Fortbildung DFP-ap probiert ist“, ergänzte Dr. Niedermoser.
„Die hohe Teilnehmerzahl beweist zu dem, dass unsere Ärztinnen und Ärzte ihre Fortbildung sehr ernst nehmen“, betonte Dr. Schlögel. Der Erfüllungs grad der Fortbildungspflicht beträgt 97 %. Gefragt wurde nach den Gründen, die Fortbildungsverpflichtung wahrzu nehmen. Die vier wichtigsten: Aktuali
Präsenzfortbildungen sind sowohl in kurzer als auch in längerer Form und mit großem Abstand die bevorzugten Fortbildungsarten, gefolgt von den On lineformaten Webinar und E-Learning (Literaturstudium). Die digitalen Fort bildungen nehmen eine immer wichti gere Rolle ein – die Qualität wurde von 94 % der Teilnehmenden mit sehr oder eher zufriedenstellend bewertet. „ Bei den Webinaren hat sich das DFP-appro bierte Angebot auf einem Niveau von 5.214 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Tendenz weiter stei gend“, bilanzierte Dr. Niedermoser. Im Vergleich zum Vor-COVID-19-Niveau handelt es sich um ein Wachstum von mehreren tausend Prozent (siehe Abbil dung). „I nsofern wirkte die Pandemie
als ein wesentlicher Digitalisierungsmotor im Bereich der Fortbildung“, so der Vortragende weiter. Das E-LearningAngebot steigerte sich um rund 23 Prozent – von 720 im Jahr 2020 auf 885 DFP-approbierte Angebote im Jahr 2021.
Gibt es auch Kritikpunkte seitens der Ärztinnen und Ärz te? Dr. Niedermoser zufolge bieten beispielsweise manche Fachgesellschaften wenige Fortbildungsveranstaltungen an. Die Pathologie betreffend bestehe etwa ein Defizit bei ELearnings. Allerdings gebe es von der ÖÄK die Zusicherung einer organisatorischen und finanziellen Unterstützung für kleinere Fachgruppen. Dr. Schlögel ergänzte, dass manche Fortbildungen mit Kosten verbunden seien oder die Organi sation vor Ort nicht immer optimal funktioniere. „Aber die Akzeptanzzahlen steigen von Befragung zu Befragung. Wir werden in der Ausgestaltung immer besser.“
Zur Erreichung eines DFP-Diploms müssen 250 Fortbil dungspunkte innerhalb von fünf Jahren gesammelt werden –diese Anforderung befinden 64,6 % für angemessen, 23,9 % erachten das als etwas zu hoch. Um die Fortbildungen zu do kumentieren, wird ein sogenanntes „Online-Fortbildungs konto“ angeboten. Dieses nützen 76 % der Befragten.
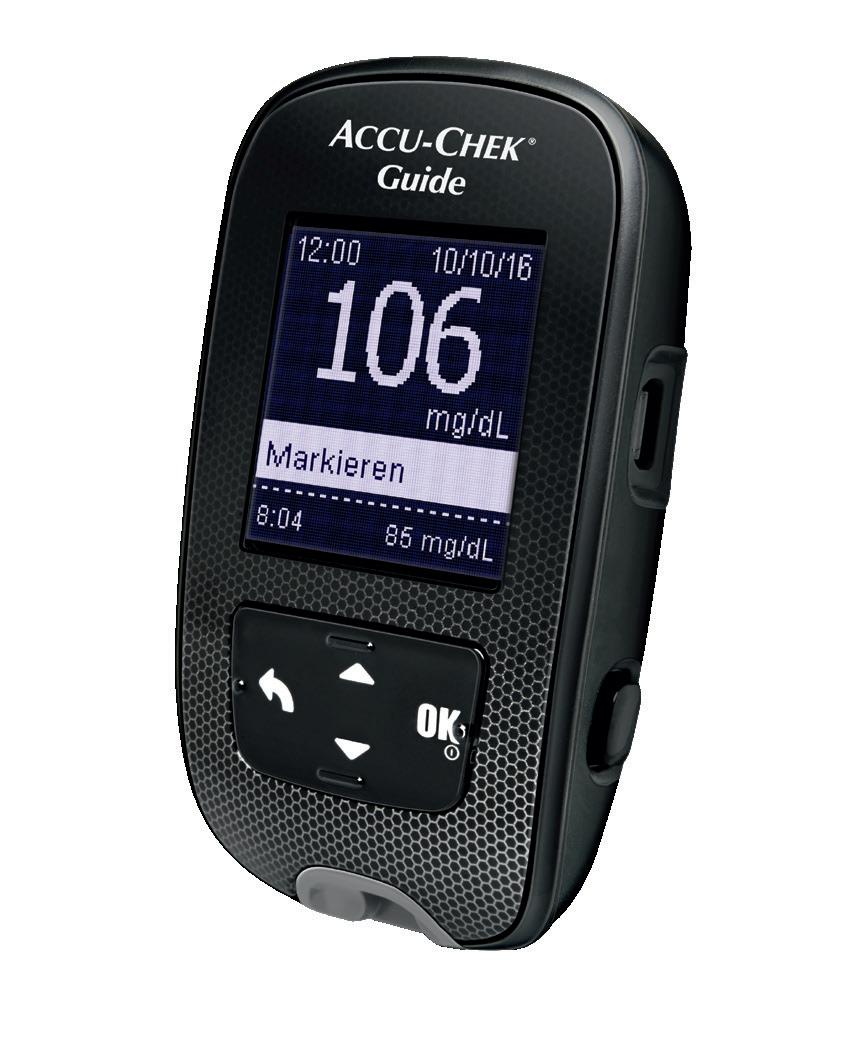

Auch der Themenkomplex Qualitätssicherung und evi denzbasierte Medizin wurde diskutiert. In puncto kom plementärmedizinischer Diplome fand Dr. Niedermoser, Leiter des Referats für komplementäre Medizin der ÖÄK, klare Worte: „ Diese Inhalte werden nachgefragt. Und mei ner Meinung nach ist es besser, eine strukturierte Ausbil dung bzw. Fortbildung zu haben, als diese nicht anzubieten. Denn so bleiben komplementäre Methoden in den Hän den von Ärztinnen und Ärzten, welche sie auf Basis der Schulmedizin auch wirklich komplementär einsetzen – und nicht in den Händen von Personen, die mit der Medizin de facto nichts am Hut haben, wie es in anderen Ländern häufig der Fall ist.“
Dr. Schlögel wies außerdem darauf hin, dass Medizin stets „work in progress“ sei. „ Medizin ist nie ‚fertig‘. Neue Er krankungen wie COVID-19 treten auf, und weltweit wird in so vielen Bereichen geforscht, es gibt unzählige neue Ansätze, so viele Ideen ... Das oberste Ziel ist es, dem Pa tienten zu helfen. Und häufig gibt es verschiedene Zugän ge, die zum Ziel führen. Wir achten bei den Fortbildungen darauf, diese Meinungsvielfalt abzubilden. Diskussion ist wichtig und es gilt, sie aufrechtzuerhalten.“
 Anna Schuster, BSc
Anna Schuster, BSc
* Die aktuelle Umfrage wurde mit einem von der Akademie der Ärzte und der Stab stelle Qualitätsmanagement der Ärztekammer für Oberösterreich konzipierten Fra gebogen und mit Hilfe des Befragungsprogramms „essentials“ der Firma Questback technisch umgesetzt. Die Zielgruppe waren Ärztinnen und Ärzte, die ein aktiviertes Online-Fortbildungskonto auf meindfp.at und eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Rund 16 % nahmen an der Umfrage teil.


** Pressekonferenz „Hohe Zufriedenheit mit dem Diplom-Fortbildungs-Programm der Akademie der Ärzte der Österreichischen Ärztekammer“, 7. September 2022, Presseclub Concordia, Wien.
sorgen mit jedem Modul nachweislich für eine verbesserte Behandlungsquali tät und eine höhere Zufriedenheit von Ärzt:innen und Patient:innen3
verstehen. Teilnehmende Ärzt:innen bestätigen das mit ihren Rückmeldun gen: Die günstigen Lernbedingungen in solch anregendem Rahmen fördern die Vermittlung einer gesunden Le bensführung der zu behandelnden Patient:innen.
Das
Naturgarten-Ambiente
Die Coronapandemie stellt seit 2020 Patient:innen und Ärzt:innen vor beson dere Herausforderungen. Erschwerte Rahmenbedingungen, beispielsweise Zugangsbeschränkungen bei Ordina tionen, passager eingeschränkte medi zinische Leistungsangebote und auch überlastete Leistungsanbieter, hatten für Mediziner:innen eine massive Zunahme kon flikthafter Begegnungen mit Patienten und ihren Ange hörigen zur Folge. Somit stiegen das Burnout-Risiko und das Risiko juristischer Klagen. Eine professionelle, patient:innenzentrierte Ge sprächsführungskompetenz und die Fähigkeit zur Selbst sorge haben sich somit als Notwendigkeit erwiesen. Entsprechend der ärztlichen Ausbildungsordnung in Österreich ist „der Erwerb psychosozialer Kompe tenz vorzusehen, der auch Supervision mit der Möglichkeit zur Selbstreflexion mit einzuschließen hat“ 1 Im medizini schen Bereich als Supervisionsform seit langem bewährt ist die Balintgruppen arbeit.2 Die Psy-Diplom-Weiterbildun gen der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) bieten sie als wesentlichen Teil der Weiterbildung an. Drei aufeinander aufbauende Weiterbildungsmodule, die Psychosoziale Medizin (Psy1), die Psy chosomatische Medizin (Psy2) und die Psychotherapeutische Medizin (Psy3),
Zur Evaluation der Wirkung des Lehr ganges Psychosoziale Medizin (Psy1), der im Naturhotel Steinschalerhof im niederösterreichischen Pielachtal4 stattfand, wurde eine Studie durch geführt5. In dieser sind die Erhöhung der Effektivität ärztlicher Behand lung sowie die burnoutprophylakti sche Wirkung auf die teilnehmenden Ärzt:innen belegt. Die ärztliche Übung der Gesprächsführung in diesem Rah men dient ergo sowohl der Qualitätssi cherung als auch der Gesundheitsvor sorge der Teilnehmer:innen.
Die Ärzt:innen und die Leh renden der ÖÄK-Psy-Dip lom-Weiterbildungen erleben die Lehrgänge in einer Atmo sphäre von Freude und Inte resse. Den Teilnehmer:innen zufolge erzielt der Abwechs lungsreichtum des Miteinan derlernens Leichtigkeit und Stärkung und steigert somit die persönliche Lebensqua lität erheblich. Effektive Weiterbildung kann und soll gleichermaßen Erholung sein.
Das qualitätssichernde Prin zip der Selbstsorge6 bildet die Grundla ge ärztlicher Burnoutprophylaxe.
Ein idyllischer Naturgarten4 fungiert als ideale Stätte der Weiterbildung. Selbstsorge und stärkende Erholung durch dieses Ambiente optimieren die Lernerfahrung der Teilnehmer:innen in lebendiger Gemeinsamkeit. Eine naturbelassene Umgebung als Ort der Weiterbildung ist als biopsychosozi alökologische Maßnahme im Sinne von „G reen Care Empowerment“ 7 zu
Die ÖÄK-Psy-Diplom-Weiterbildung für Ärzt:innen für Allgemeinmedi zin, Fachärzt:innen aller Sonderfächer und Ärzt:innen in Ausbildung erwei tert in dem Wissen um psychosoziale Wechselwirkungen die spezifischen diagnostisch-therapeutischen Fähig keiten und Fertigkeiten im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation und des ärztlichen Gesprächs. Sie folgt dem derzeit gültigen biopsychosozialen Wis senschaftsmodell von Gesundheit und Krankheit und vertieft eine biopsycho sozioökologische ärztliche Haltung.3
Literatur:
1 RIS Rechtsinformationssystem des Bundes. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Ärztinnen-/ Ärzte-Ausbildungsordnung 2015, Fassung vom 10.07.2022. § 9. (4), ris.bka.gv.at


2 Wißgott N, Erkenntnisse der Balintarbeit im Kontext der Palliative Care. In: Balint-Journal 2019, 4(4), S. 121-124. Georg Thieme Verlag.
3 Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik: integrativetherapie.oeagg.at/ fortbildung-weiterbildung; psydiplome.info
4 Naturhotel Steinschalerhof: steinschaler.at

5 Wißgott N, Zur Wirkung der Diplomweiterbildung „Psy chosoziale Medizin (Psy1)“. In: Balint-Journal 2022, 3(4), S. 23: 85– 89. Georg Thieme Verlag.
6 Lippmann FO, Selbstsorge – (k)ein Thema für Ärzte. In: Balint-Journal 2012; 13: 101-112. Georg Thieme Verlag.
Die onkologische Therapie steht immer im Vordergrund –die Möglichkeit der Brustrekonstruktion wird von Anfang an mitberücksichtigt

Mit etwa 30 % aller Krebserkrankungen bei Frauen stellt Brustkrebs die häufigste dar. Eine von acht Frauen in Österreich ist im Laufe ihres Lebens mit dieser Di agnose konfrontiert. Früh festgestellt, stehen die Chancen auf eine komplette Heilung dieser bösartigen Erkrankung sehr gut, weshalb der Früherkennung im Kampf gegen den Brustkrebs ein hoher Stellenwert zukommt.
Frauen zwischen dem 45. und dem 69. Lebensjahr können eine Mammographie unkompliziert und ohne Überweisung bei spezialisierten Radiologinnen und Radiologen alle zwei Jahre auf Kosten
der Krankenkasse durchführen lassen. In den Jahren 2018/2019 konnten durch die ses Programm in Österreich über 2.800 invasive Mammakarzinome entdeckt werden, von welchen sich 77 % noch in einem sehr frühen und somit sehr gut therapierbaren Stadium befanden.
Das Brustkrebsrisiko kann durch gene tische Mutationen deutlich erhöht sein. Obwohl mehrere Genveränderungen be kannt sind, die dieses leicht steigern, haben Mutationen der Brustkrebsgene 1 und 2 (die sogenannten BRCA1- und BRCA2Gene) hierbei den größten Einfluss. Eine Ausschaltung dieser Tumor-SuppressorGene erhöht für Frauen das Risiko, an Brustkrebs bzw. Eierstockkrebs zu er kranken, um das 6- bzw. 30-Fache (siehe
Tabelle). Der häufigste Erkrankungsbe ginn bei einer BRCA1-Mutation liegt zwi schen dem 40. und dem 50. Lebensjahr, bei BRCA2-Mutationen tritt die Erkrankung hingegen etwa zehn Jahre später ein. Die beiden Genmutationen werden auto somal-dominant vererbt und können so mit sowohl durch die Mutter als auch durch den Vater mit einem Risiko von 50 % an Kinder weitergegeben werden. Pati entinnen, in deren Familie Brust- oder Eierstockkrebs gehäuft oder in sehr jun gem Alter auftritt, sollten in einem Spe zialzentrum eine genetische Beratung in Anspruch nehmen (siehe Infobox).
Eine prophylaktische Entfernung der Brustdrüse kann frühzeitig erfolgen, im Idealfall ab dem 25. Lebensjahr. Die prophylaktische subkutane Mastektomie senkt in diesem Fall, nach heutigen Stu dienerkenntnissen, das Risiko, an Brust krebs zu erkranken, auf etwa 10 %.
Aufgrund hormoneller Faktoren sollte die Entfernung der Eierstöcke nach ge nauer Abwägung durch die behandeln den Spezialisten erst in fortgeschritte nem Alter erfolgen.


Die Therapie des Brustkrebses ist in der heutigen Zeit hoch standardisiert und längst nicht mehr auf eine Fachrichtung beschränkt. Die Behandlung sollte in je dem Fall in einem zertifizierten Brustge sundheitszentrum erfolgen, da hier die Zusammenarbeit der Spezialisten der ein zelnen Fachgebiete optimal gewährleistet

2 Brustkrebsfälle, einer davon vor dem 50. Lebensjahr
3 Brustkrebsfälle vor dem 60. Lebensjahr
1 Brustkrebsfall vor dem 35. Lebensjahr
1 Brustkrebsfall vor dem 50. Lebensjahr und 1 Fall von Eierstockkrebs jeglichen Alters
2 Eierstockkrebsfälle jeglichen Alters
Männlicher Brustkrebs jeglichen Alters
ist. Jeder einzelne Patientinnen- und Pati entenfall wird in einem interdisziplinären Tumorboard vorgestellt. Diesem gehören immer Ärztinnen und Ärzte der folgenden Fachrichtungen an: Onkologie, Chirurgie, Gynäkologie, Radiologie und Radioon kologie sowie Pathologie. Idealerweise wird das Team noch durch Ärztinnen und Ärzte der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie sowie durch speziell ausgebildete BreastCareNurses, Psychologinnen/Psychologen und eine Ernährungsberatung ergänzt.
Die operative Entfernung des Primär tumors ist der zentrale Punkt in einem therapeutischen Setting. Hierbei stehen je nach Lage, Größe und Art des Tumors verschiedene Operationsmöglichkeiten zur Verfügung:
Bei der brusterhaltenden Therapie (BET) wird der Tumor mit nur einem Teil der Brust entfernt. Häufig kann die Schnitt führung dabei so gewählt werden, dass die Ästhetik nach der Operation kaum be einträchtigt wird. Ist die Brust besonders groß, kann der Eingriff zusammen mit der Plastischen Chirurgie als Tumorlageadaptierte Reduktionsplastik durchge führt werden. In etwa 70–80 % kann die Tumorentfernung auf diese Art erfolgen.
Bei größeren Tumoren, bei welchen die BET als Therapie nicht ausreicht, steht oft die subkutane Mastekomie als Option zur Verfügung. Auch für prophylaktische Eingriffe bei BRCA-Mutationen ist diese Technik Mittel der Wahl. Hierbei wird das komplette Brustdrüsengewebe unter der Haut und der subkutanen Fettschicht ent fernt. Der Hautmantel kann erhalten wer
den (SSME – „skin sparing mastectomy“), oft auch der Mamillen-Areola-Komplex (NSME – „nipple sparing mastectomy“)
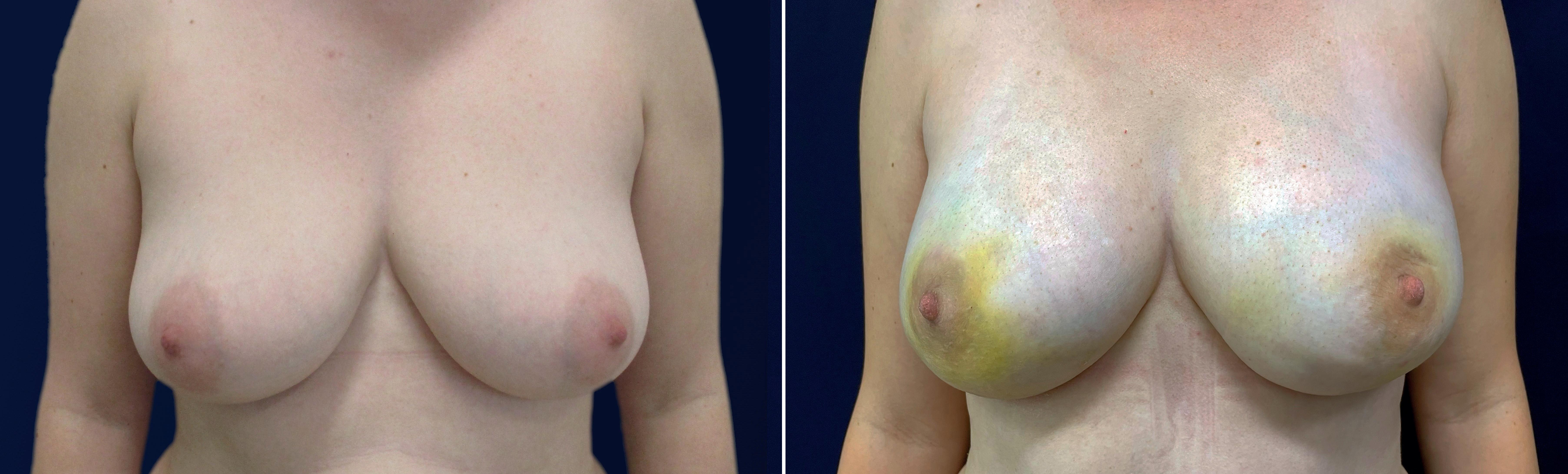
Eine Rekonstruktion des fehlenden Drü sengewebes kann durch Brustimplantate oder Eigengewebe erfolgen.
Ist hingegen auch die Brusthaut von der bösartigen Erkrankung betroffen oder die Tumorausbreitung bereits zu fort geschritten, muss unter Umständen die komplette Brust und Brusthaut im Sinne einer Ablatio entfernt werden.
Je nach Art, Größe und Ausdehnung des Tumors kann auch eine Sentinel-Lymph knotenentfernung, bei welcher der sog. Wächterlymphknoten in der Achsel un tersucht wird, oder eine radikale axilläre Lymphknotenentfernung notwendig sein.
Inzwischen steht zur Behandlung des Brustkrebses nicht mehr nur die Che motherapie zur Verfügung. Handelt es sich um einen sogenannten hormon sensitiven Tumor, kann eine Hormon behandlung begleitend oder als Ersatz der klassischen Chemotherapie durch geführt werden. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit einer Antikörper-/ Immuntherapie bei einigen Tumorarten.
Für die Entscheidungsfindung im Tu morboard, mit welcher medikamentösen Therapie begonnen werden kann, ist eine genaue Diagnose des Tumorge webes notwendig. Diese gewinnt man im Rahmen einer Biopsie oder durch eine bereits erfolgte Tumoroperation. Neoadjuvante Therapien werden noch vor dem eigentlichen Eingriff begonnen, um peripher zirkulierende Tumorzellen zu eliminieren und die Tumorgröße im Vorfeld zu verkleinern.
Die Bestrahlung hat ihren Stellenwert hauptsächlich postoperativ, sie kann das
Risiko einer Rezidiverkrankung verrin gern. Bei einer brusterhaltenden Thera pie besteht die Indikation zur Bestrah lung der Brust, bei Befall von mehr als zwei Lymphknoten auch zur Bestrah lung des Lymphabflusses.
Palliative Fälle, in denen keine operative Behandlung mehr möglich ist, sind heute Gott sei Dank selten. Bei ihnen kann die Strahlentherapie aber auch als palliative Maßnahme gesetzt werden.
Oberstes Ziel der Behandlung des Mam makarzinoms ist selbstverständlich im mer die onkologisch bestmögliche Thera pie. In der Wahrnehmung vieler Frauen trägt eine wohlgeformte Brust wesent lich zu einem positiven Körpergefühl bei, weshalb die ästhetische Komponente an unserem Brustgesundheitszentrum von Anfang an bei der Behandlung berück sichtigt wird.
Im Idealfall kann die Schnittführung bei der brusterhaltenden Therapie so gewählt werden, dass postoperativ kaum ein Un terschied wahrgenommen wird. Auch tu moradaptierte Brustverkleinerungen sind, wie oben bereits angemerkt, oft möglich. In den anderen Fällen stehen uns in der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie heu te viele Möglichkeiten zur Verfügung, unseren Patientinnen wieder zu einem guten Körpergefühl zu verhelfen. Die wichtigsten Methoden werden im Fol genden kurz angeführt. Welche davon am besten für die jeweilige Patientin geeignet ist, ist eine höchst individuelle Entscheidung.
Volumenunterschiede oder Konturde fekte der Brust können oft mit einer Eigenfetttransplantation sehr gut ausge glichen werden. Hierbei wird körpereige >
nes Fett von beispielsweise Bauch oder Oberschenkel abgesaugt, aufbereitet und noch in der gleichen Operation in die Brust eingebracht. Es handelt sich dabei um einen kleinen Eingriff in Allgemein narkose.
Bei der subkutanen Mastektomie wird der komplette Drüsenkörper entfernt, was zu einem erheblichen Volumenverlust führt. Dieses fehlende Volumen kann oft noch im selben Eingriff durch ein Brustimplan tat ausgeglichen werden. Das Implantat wird entweder unter dem Brustmuskel (M. pectoralis major) oder auf diesem Muskel eingesetzt. Beide Methoden ha ben ihre jeweiligen Vor- und Nachteile und sollten ausführlich mit einem darauf spezialisierten plastischen Chirurgen be sprochen werden. Die Implantatrekonstruktion ist bei ausreichend vorhande nem Hautmantel eine sehr sichere und schnelle Möglichkeit des Brustwiederauf baus (siehe Abb. 1, Seite 35). Unter Umständen wird zur Stabilisierung des Implantates ein Netz oder eine azellu läre Matrix mit eingebracht. Da es sich bei einem Brustimplantat jedoch um einen Fremdkörper handelt, bestehen Risiken wie Kapselfibrose, Implantatruptur, Im plantatverschiebung, Fremdkörpergefühl und ein unnatürliches Aussehen. Weiters ist zu bedenken, dass Implantate wegen Materialermüdung nach einem bestimm ten Zeitraum gewechselt werden sollten.
Der Expander ist ein Brustimplantat, welches von außen über eine kleine Ka nüle mit Kochsalzlösung angefüllt und so mit Schritt für Schritt ausgedehnt werden kann. Ist bei einer Patientin die Rekon-
struktion mittels Implantates gewünscht, der Hautmantel aber nicht ausreichend, so kann zunächst ein Expander verwen det werden. Über mehrere Wochen wird dieser bis zur gewünschten Größe ange füllt, um die Haut zu dehnen, und kann dann gegebenenfalls gegen ein Silikon implantat getauscht werden.
Die Art der Brustrekonstruktion stellt die aufwändigste Variante dar. Hierbei wird körpereigenes Gewebe verwendet, um das Brustdrüsengewebe und gege benenfalls die Haut an der Brustwand zu ersetzen. Die Operationszeiten sind bei dieser Art der Rekonstruktion meist deutlich länger als bei einer Implantat rekonstruktion. Dafür kann komplett auf Fremdmaterial verzichtet werden, was implantatassoziierte Komplikatio nen ausschließt und für ein natürlicheres Brustgefühl sorgt.
Die Rekonstruktion mittels des Muscu lus latissimus dorsi und die sogenannte DIEP-Lappenplastik stellen hierbei die häufigsten Varianten dar. Bei Ersterer wird der große Muskel des Rückens zu sammen mit Fettgewebe und bei Bedarf Haut nach vorne umgeschlagen. Am Rü cken bleibt eine gerade Narbe.
Bei der DIEP(„deep inferior epigastric perforator“)-Lappenplastik entnehmen wir dem Unterbauch Haut und Fettgewe be, wobei darauf geachtet wird, dass die entsprechende Gefäßversorgung mit prä pariert wird. Das Gewebe wird zur Re konstruktion der Brust verwendet und die einzelnen Blutgefäße unter dem Mikroskop mit Venen und Arterien an der Brustwand neu zusammengenäht (siehe Abb. 2). Die Bauchdecke wird wie bei einer Bauchdeckenstraffung verschlos-


sen. Weitere mögliche Entnahmestellen sind Oberschenkel, Gesäß oder Flanken.
Muss die Brustwarze bzw. der Warzen vorhof im Rahmen der onkologischen Operation entfernt werden, so kann auch hier eine Rekonstruktion erfol gen. Durch moderne Verfahren können Brustwarze und Vorhof optisch dreidi mensional tätowiert werden. Operative Verfahren stehen ebenso zur Verfügung. Bei einem oftmals kleinen Eingriff in örtlicher Betäubung wird die Haut der Brust so umschnitten und „aufgestellt“, dass ein neuer Nippel gebildet wird. Ist die Brustwarze der anderen Seite recht groß, so kann diese verkleinert und das entnommene Gewebe ebenfalls zur Re konstruktion der fehlenden Brustwarze verwendet werden.
Literatur bei den Verfassern.
Fortbildungsanbieter: St. Josef Krankenhaus Wien
Lecture Board: Dr. Karl Renner Facharzt für Chirurgie, Wien brusterkrankung.at
Dr.in Johanna Holzhaider 2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich
Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Durch die Betreuung in zertifizierten Brustgesundheitszentren mit interdisziplinärer Zusammenarbeit ist in Österreich ein hoher Behandlungsstandard gesichert.
Treten Brust- oder Eierstockkrebsfälle familiär gehäuft auf, sollte eine genetische Beratung erwogen werden.

Bei einer chirurgischen Behandlung sollte auch die ästhetische Komponente berücksichtigt werden.
So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-ChoiceFragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet.
Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.
Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 31. Mai 2023.
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben. … 20–30 %. … 3–10 %. … 1–3 %. … 0 %.
1 2
Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, wird bei vorliegender Mutation eines BRCA-Genes durch die subkutane Mastektomie deutlich gesenkt und beträgt dann laut Studien in etwa … (1 richtige Antwort)
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!
3
Welche Behandlungen sind häufig Bestandteil der umfassenden Brustkrebstherapie? (3 richtige Antworten)
Radiatio. Therapieultraschall. Immuntherapie. Operation.
Welche Vorteile hat die Rekonstruktion mit Eigengewebe gegenüber der Implantatrekonstruktion? (3 richtige Antworten)
Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse: NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:
Name
Anschrift PLZ/Ort E-Mail
Viele Mediziner:innen schwören bei ihren Krebspatient:innen auf die Mistel therapie – erste S3-Leitlinie Komplementärmedizin bestätigt Wirksamkeit
Die Heilkraft der Mistel, die oft auch als goldener Zweig bezeichnet wird, ist heute durch zahlreiche Studien und Me taanalysen dokumentiert. Dr.in Myriam Odeh, Oberärztin an der Frauenklinik im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, ist eine begeisterte Verfechterin der komplementärmedizinischen Metho de. Im Webinar „ M isteltherapie mit ISCADOR: Grundlagen und Anwendung“ des Fortbildungsforums Naturheilkunde berichtete sie: „ Die Metaanalyse ,Qua lity of life in cancer patients treated with misteltoe‘1 aus dem Jahr 2020 zeigt eine signifikante Verbesserung der Lebens qualität in der Mittelwertdifferenz bei Patientinnen und Patienten, die zusätz lich zur onkologischen Standardthera pie eine Misteltherapie erhalten haben. Die Effekte waren am größten, je jünger die Teilnehmer waren und je länger sie die Behandlung beibehielten. Zudem gab es eine Subgruppenanalyse, bei der eine Verbesserung bei Schmerz, Übel keit, Erbrechen, Diarrhoe untersucht und dokumentiert wurde.“
Eine weitere Metaanalyse2 aus dem selben Jahr deutet darauf hin, dass die adjuvante Iscador-Behandlung von Tu morpatienten mit einem längeren Über leben verbunden sein kann. Diese Meta analyse ist ein Follow-up – bereits 2009 gab es eine Publikation dazu. „ Nun sind viele aktuelle Studien hinzugekommen. Die Ergebnisse sind signifikant positiv zugunsten der Misteltherapie. Ob die einzelnen Studien randomisiert waren
oder nicht, hat nichts am Ausgang geän dert. Die besten Ergebnisse wurden in der Gruppe der Patientinnen mit Zer vixkarzinom erzielt, die bescheidensten Ergebnisse – sie waren aber immer noch signifikant positiv – bei Patientinnen und Patienten mit Bronchialkarzinom“, so Dr.in Odeh.
Viele Menschen haben die verständli che Sorge, dass sich eine Misteltherapie während einer Chemo- oder Antikör pertherapie störend auswirken könnte. Da die Patienten unter weniger Neben wirkungen leiden, befürchten manche, dass auch weniger Wirksamkeit gege ben sei. Diese Thematik hat sich eine Interaktionsstudie näher angesehen.3 Dr.in Odeh: „Verschiedene Chemotherapeutika wurden an humanonkologischen Zellen untersucht. Gemessen hat man Proliferation, Apoptose, Zellzyklus so wie VEGF. Zudem wurde mit verschie denen Dosierungen der Misteltherapie gearbeitet. Man konnte sehen, dass die Misteltherapie die Wirkung der Chemo therapie nicht herabgesetzt hat, sondern dass man sogar in höheren Dosierungen eine höhere Zytotoxität in der Kombi nation erreichte. Dasselbe erkennt man an einem Beispiel mit dem Antikörper Trastuzumab. Diese Kombination ist ebenso als sicher einzustufen und könn te zu einer besseren Effizienz führen “ Die Misteltherapie wird über Spritzen
subkutan gegeben. Dr.in Odeh erklärte: „ Die meisten Patienten spritzen sich das Präparat dreimal die Woche in den Bauch oder Oberschenkel.“ Wichtig ist die Wahl des passenden Wirtsbaumes und der richtigen Dosierung. So werden in der Gynäkologie zumeist die Kieferund die Apfelmistel ausgewählt. Es be steht die Möglichkeit der kontanten oder der rhythmischen Dosierung. Im nieder gelassenen Bereich hat – der Fachärztin zufolge – die rhythmische Dosierung Vorteile: „ Es gibt Serienpackungen mit Ampullen in aufsteigender Reihenfolge. Die Patienten können selbst ausprobie ren, bei welchen sich eine gute Reaktion zeigt. Um die Einstichstelle herum sollte eine leichte Reaktion zu sehen sein. Die se darf sich auch in Jucken oder Bren nen äußern. Bleibt eine Reaktion ganz aus, kann man die Dosis erhöhen. Bei einer Überreaktion sollte sie reduziert werden. Man kann nicht wirklich etwas falsch machen.“
Die Wirkung der Misteltherapie ist klinisch belegt. So wurde von der „S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen PatientInnen“* mit 1a-Evidenz grad bestätigt, dass der Mistelgesamtextrakt therapeutisch zur Verbesserung der Lebens qualität subkutan gegeben werden kann.
* leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/ komplementaermedizin

Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung können be kanntlich an ausgeprägter körperlicher, geistiger und seelischer Erschöpfung leiden. „Während einer Systemtherapie sind rund 90 % der Betroffenen von ei ner akuten Fatigue betroffen, 20-50 % von einer chronischen“, erläuterte Dr.in Daniela Paepke, Oberärztin am Brust zentrum in der Frauenklinik am Klini kum rechts der Isar, TU München, in einem weiteren Seminar zum Thema „C ancer Related Fatigue“. Die Erschöp fung trete typischerweise auf, ohne dass man sagen könne, der Mensch habe sich wahnsinnig angestrengt, übernommen oder überarbeitet. Mehr Schlaf und längere Erholungsphasen wirkten nicht mehr ausgleichend.
Die „ S3-Leitlinie Komplementärme dizin in der Behandlung von onkologi schen PatientInnen“ (siehe Kasten) rate Betroffenen zu Sport und Bewegung als Therapie. Am besten wirke eine Kom
bination von Ausdauer- und Kraftsport. Empfohlen werden dabei 150 Minuten moderate oder 75 Minuten anstrengen de körperliche Aktivität pro Woche. Dr.in Paepke: „ Die Leitlinie hat sich auch positiv zur Misteltherapie geäußert. Man kann sie unter einer Systemthera pie zur Verbesserung der Lebensqualität verabreichen. Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologen in der Onkologie – AGO Kommission – hat das Thema schon län ger aufgegriffen und vergibt eine ,KannOption‘ neben der Systemtherapie zur Reduzierung von Nebenwirkungen.“
Dr.in Paepke ist von der Misteltherapie und der positiven Wirkung von Sport überzeugt: „Ich schließe meine Patien tinnen sofort nach der Diagnose in ein integratives Gesamtkonzept ein. Wenn sie daran teilnehmen, beobachte ich nicht bei 90 % der Patientinnen eine Fatigue. Sondern vielleicht bei 20-30 %. Aber auch diese können damit umge hen, es passt für sie. Es ist wichtig, früh in
das Programm einzusteigen – und nicht erst, wenn die Fatigue schon da ist.“ Auch die Metaanalyse „C ancer-related fatigue in patients treated with mistle toe extracts“4 bestätigt übrigens, dass die Misteltherapie statistisch und klinisch signifikant die Fatigue im Zusammen hang mit onkologischen Erkrankungen vermindern kann, verglichen mit der Kontrollgruppe, die keine Mistelthera pie bekommen hat.
Gabriella MühlbauerStudien:
1 Loef M, Walach H, Quality of life in cancer patients treated with mistletoe: a systematic review and metaanalysis. BMC Complement Med There 20, 227 (2020), doi: 10.1186/s12906-020-03013-3.
2 Ostermann T et al., A Systematic Review and Meta-Ana lysis on the Survival of Cancer Patients Treated with a Fermented Viscum album L. Extract (Iscador): An update of Findings, Complement Med Res 2020; 27(4):260-271, doi: 10.1159/000505202. Epub 2020 Jan 10.
3 Weissenstein U et al., Interaction of standardized mist letoe (Viscum album) extracts with chemotherapeutic drugs regarding cytostatic and cytotoxic effects in vitro. BMC Complementary and Alternative Medicine 14, 6 (2014); 16, 271 (2016); 19, 23 (2019). doi: 10.1186/14726882-14-6.
4 Pelzer F, Loef M, Martin DD et al., Cancer-related fatigue in patients treated with mistletoe extracts: a systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer 30, 6405–6418 (2022). doi: 10.1007/s00520-022-06921-x.
Therapie kann auch bei Hochbetagten sinnvoll sein –entscheidend ist das Gesamtrisiko
LDL-Cholesterins niemals vaskuläre Er krankungen.
Der Nutzen einer primärpräventiven Statintherapie ist bei jungen Menschen gut belegt. Ist eine solche auch bei der älteren Generation sinnvoll?
bei der gemeinsamen Verabreichung besondere Vorsicht geboten. Generell ist es bei älteren Menschen wichtig, nicht mit der höchsten Dosis zu beginnen.
Der Therapieentscheid, ob erhöhte Cho lesterinwerte bei älteren Menschen über 75 Jahre pharmakologisch behandelt wer den sollen oder nicht, muss sehr individu ell gefällt werden. Ausschlaggebend sei die Summendosis der Belastung, so Prof. Dr. Andreas Zirlik, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Univer sitätsklinik Graz, im Gespräch mit der Hausärzt:in.
HAUSÄRZT:IN: Gilt „The lower, the better“ auch für Menschen ab 75 Jahren? Prof. ZIRLIK: Grundsätzlich gilt dieses Prinzip ein Leben lang. Allerdings sollte man zwei Punkte beachten: Zum einen ist die Cholesterinbelastung – so wie je der andere Risikofaktor – ein Integral über Zeit: Demzufolge lassen sich aus ei nem punktuellen Wert keine Rückschlüs se ziehen. Ein Beispiel: Wenn bei einem herzgesunden 78-jährigen Patienten erst malig ein hoher Wert gemessen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus Schäden ergeben, gering. Zum ande ren ist die Korrelation zwischen hohem LDL-Cholesterin und kardiovaskulären Ereignissen in der Gesamtpopulation zwar eindeutig belegt. Dennoch entwi ckeln 25-30 % der Menschen trotz hohen

Wenn bei jungen Menschen sehr hohe LDL-Werte auftreten, dann liegt der Ver dacht nahe, dass eine heterozygote geneti sche Belastung im Sinne einer familiären Hypercholesterinämie besteht. In diesem Fall ist eine frühzeitige Pharmakothera pie ratsam, um die Kurve über viele Jahre flach zu halten. Anders sieht es aus, wenn ein asymptomatischer 80-Jähriger, der in seiner Anamnese keine Gefäß- oder vas kulären Erkrankungen aufweist, die Erst diagnose einer Hypercholesterinämie erhält. Basierend auf dem Nutzen-RisikoProfil, wird man bei diesem Patienten kei ne lipidsenkende Therapie mehr starten. Hingegen profitiert ein Patient, der zu sätzlich zu den erhöhten Fettstoffwech selwerten noch andere Begleiterkrankun gen hat, die mit deutlich erhöhtem Risiko einhergehen, auch in höherem Alter von einer neu begonnenen Statintherapie.
Der Metabolismus verändert sich im Laufe der Jahre – auch Multimorbidität ist bei älteren Menschen ein Thema. Worauf gilt es besonders zu achten, wenn Statine im Alter verordnet werden? Im Allgemeinen sind Statine gut ver träglich. Statininduzierte Muskelenzym entzündungen treten bei etwa einem Prozent der Patientinnen und Patienten auf. Wegen der Polypharmazie mit zuneh mendem Alter sind jedoch Interaktionen zu beachten, und gegebenenfalls ist eine Dosisreduktion vorzunehmen. Zu Wech selwirkungen kann es beispielsweise bei gleichzeitiger Einnahme von bestimm ten Immunsuppressiva respektive AntiViren-Medikamenten kommen – ebenso bei einer Kombination mit anderen Li pidsenkern. Da sowohl Statine als auch Fibrate mit dem Risiko einer muskulä ren Toxizität und konsekutiv mit dem einer Rhabdomyolyse behaftet sind, ist
Gibt es Alternativen zu Statinen – ist etwa eine Ernährungsumstellung zielführend? Im Normalfall stellt die Statintherapie die Basistherapie dar – auch aufgrund ihrer antiinflammatorischen Effekte. Bei Kontraindikationen oder Statinintoleranz sind auch Ezetimib – ein Cholesterinaufnah mehemmer im Darm – sowie die Bem pedoinsäure, welche eine Erhöhung der LDL-Rezeptoren in der Leber bewirkt, eine Option. Bei schweren Lipidstoff wechselstörungen mit deutlich erhöhten LDL-Werten können zudem PCSK9-In hibitoren eingesetzt werden. Small inter fering RNA (siRNA) unterbinden durch RNA-Interferenz die hepatische Synthese von PCSK9 – der Abbau von LDL-Re zeptoren wird gehemmt. Bei Übergewicht sollte immer eine Gewichtsabnahme an gestrebt werden. Das LDL-C selbst lässt sich jedoch nur schwer über alleinige Di ätmaßnahmen kontrollieren – im Schnitt gelingt eine Senkung um max. 15 Prozent. Das Interview führte Mag.a Sylvia Neubauer.
Bei vorliegenden kardiovaskulären Erkran kungen sollte eine Statintherapie gestartet oder fortgesetzt werden.
• Bei Personen über 75 Jahre ohne wei tere Risikofaktoren liegen derzeit keine überzeugenden Hinweise für ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis zum Start einer Statintherapie in der Primärprävention vor.
• Besonders im hohen Alter sollte aufgrund potentieller Nebenwirkungen nicht mit der höchsten Statindosis gestartet werden. Eine Kombination mit anderen lipidsenken den Therapien könnte angestrebt werden.
• Bei Polypharmazie sollten mögliche Wech selwirkungen berücksichtigt werden.
COVID-19
In einer retrospektiven Analyse von Krankenakten des englischen Gesundheitssystems wurden die Daten von ambulanten Patienten mit einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion ausgewertet: Von den insgesamt 62 registrierten Symptomen, welche zwölf Wochen nach der Infektion fortdauerten, wurde Haarausfall – gleich nach Anosmie – an zweiter Stelle angeführt.1
Fieberhafte Infektionen können einen vermehrten Ausfall von Haaren nach sich ziehen, das Gleiche gilt für eine COVID19-Erkrankung. Hierfür wird ein Mechanismus verantwort lich gemacht, der auch als telogenes Effluvium (TE) be kannt ist.2 Durch verschiedenste Faktoren wird die Wachs tumsphase der Haare verkürzt. Neben Infektionen können beispielsweise auch Stress, bestimmte Medikamente, Nähr stoffmangel und Erkrankungen der Schilddrüse das telogene Effluvium hervorrufen. Das auslösende Ereignis liegt dabei meist Wochen bis Monate zurück.3,4 In der Regel ist der dif fuse Haarausfall jedoch reversibel und die Haarpracht rege neriert sich von selbst wieder. Bei zusätzlichen Symptomen wie Ausschlag, Brennen oder juckender Kopfhaut sollte eine Dermatologin bzw. ein Dermatologe aufgesucht werden – so die Empfehlung der American Academy of Dermatology Association.2 Außerdem wird darauf hingewiesen, dass viele Menschen während der Pandemie Stress empfänden – auch dieser kann bekanntlich Haarausfall verursachen.
Das telogene Effluvium tritt erst mit einem größeren zeitli chen Abstand zu einer Infektion auf, wodurch einerseits vie le Betroffene ver-unsichert sind, andererseits die Diagnose erschwert wird. Bisherige Studien weisen aufgrund geringer Fallzahlen Limitationen auf. Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass Kliniker bei Patienten mit Haarausfall eine vorausgehende COVID-19-Infektion unbedingt als Ursache berücksichtigen sollten.4,5 Letztendlich ist das telogene Efflu vium ein Krankheitsbild, das viel Empathie und Aufmerk samkeit erfordert.3
Mag.a Ines Pamminger, BA
1 Subramanian A et al., Nat Med. 2022 Aug;28(8):1706-1714. doi: 10.1038/s41591-022-01909-w.
2 AAD: aad.org/public/diseases/hair-loss/causes/covid-19 (abgerufen am 3.10.22).
3 Rebora A, Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019 Aug 21;12:583-590. doi: 10.2147/CCID.S200471.
4 Aksoy H et al., Dermatologic Therapy. 2021;34:e15175.
doi: 10.1111/dth.15175.
5 Abrantes TF et al., J Am Acad Dermatol. 2021 Oct;85(4):975-976. doi: 10.1016/j.jaad.2021.07.021.
Update COPD: Neue Erkenntnisse über den Krankheitsmechanismus sollen Betroffenen eine maßgeschneiderte Behandlung ermöglichen
Bei einer Pressekonferenz anlässlich der 46. Jahresta gung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumolo gie (ÖGP)* berichtete ÖGPVizepräsident Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für In nere Medizin am Kepler Uni versitätsklinikum Linz, über die Fortschritte in der Be handlung von COPD.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernd Lamprecht Vizepräsident der Öster reichischen Gesellschaft für Pneumologie, Vorstand der Uniklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumolo gie, Kepler Universitäts klinikum, Linz

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) belegt nach Herzinfarkt und Schlaganfall Platz drei in der Liste der häufigsten Todesursachen – in der EU wie auch weltweit. Somit zählt sie zu den bedeu tendsten und zudem stetig wachsenden Volkskrankheiten. Schätzungen zu folge sind allein in Österreich 400.000 Menschen von COPD betroffen, aber bei nur 20 Prozent ist die Erkrankung auch diagnostiziert. Vielen Menschen „ nur“ als Raucher lunge geläufig, ist COPD durch eine überschießende Entzündungsreaktion
in der Lunge gekennzeich net, die wiederum zu einer irreversiblen Schädigung der Lungenstruktur und in weite rer Folge zur Zerstörung des Lungengewebes führt. Dabei gibt es zwei Ausprä gungsformen, die auch ge meinsam auftreten können: eine Obstruktion der Atem wege und/oder das Lungen emphysem. Beide rufen die gleichen COPD-typischen („ A HA“ )Symptome hervor: Auswurf, Husten, Atemnot. Rauchen (auch passiv) ist zwar der Hauptrisikofaktor für eine COPD, nichtsdestotrotz gibt es noch weitere Risikofaktoren wie
• eine genetische Prädisposition,
• eine gestörte Entwicklung der Lunge im Mutterleib, etwa durch Frühgeburt,
• durchgemachte Infektionen (häufige Atemwegsinfektionen, Asthma und Tuberkulose),
• Umweltfaktoren (Einatmen von Umweltgiften, z. B. Feinstaub).
Kommen mehrere dieser Faktoren zusammen, potenziert sich das Erkrankungsrisiko.
„M ittlerweile kann man die komplexen Zusammenhänge dieser Erkrankung im mer besser verstehen“, zeigte sich Prof. Lamprecht erfreut. „Man ist zu einer genaueren Kenntnis der verschiedenen Ausprägungsformen gelangt.“ Das er mögliche wiederum, individuell auf die jeweilige Ausprägungsform der Betroffe nen einzugehen und eine maßgeschnei derte Therapie zusammenzustellen. Bei spielsweise kann man unterscheiden, wer am besten von einer Tripletherapie pro fitiert und bei wem wiederum eine duale Bronchodilatation zu bevorzugen ist. Als Hilfswerkzeug für den Therapieent scheid fungieren Biomarker, etwa die Eosinophilen. Sind diese beispielsweise über die Norm erhöht, so ist eine Triple therapie, bestehend aus zwei Bronchodi latatoren und einem inhalativen Kortiko steroid, indiziert. Patienten mit niedriger EosinophilenZahl hingegen würden nicht von einer zusätzlichen Kortisongabe profitieren. „Diese Patienten erhalten eine duale Bronchodilatation, bestehend aus zwei bronchienerweiternden Medikamenten, ohne zusätzliches Kortison“, erläuterte der Experte.
Die inhalative Therapie stellt seit jeher eine wichtige Säule der COPD-Therapie dar, aber nur, wenn der Patient die In halation auch richtig durchführt. Maß geschneiderte Therapien spielen auch hierbei eine Rolle. Je nach inspiratori schem Fluss und koordinativen Fähig keiten wird der für den Patienten am besten geeignete Inhalator ausgesucht.
Längst schon bei Asthma etabliert, ge winnt die Therapie mit Biologika nun auch bei COPD nach und nach an Bedeu

tung. So spielen die Zytokine IL-5 und IL-33 nicht nur bei Asthma, sondern auch bei COPD eine wichtige Rolle. Die Blockade der beiden Zytokine, so Prof. Lamprecht, zeige in Studien signifikante Effekte auf die Exazerbationsfrequenz.
Immer exakter wird zudem das Wissen über den Einsatz einer interventionellen Behandlung bei COPD-Patienten, die im Zuge ihrer Erkrankung an einem Lungenemphy sem leiden.
Prof. Lamprecht: „ Eine besonders vielversprechende neue interventionelle Behandlungsmethode ist die sogenann te bronchiale Rheoplastie.“ Hierbei werden im Rahmen einer Bronchoskopie bestimmte schleimproduzierende Zellen mittels elektrischer Energie abgetragen. Es kommt zu einer Reduktion der Schleimproduktion in der Bron chialschleimhaut und damit auch zu weniger häufigen mo deraten bis schweren Exazerbationen. Erste Erfolge seien, laut dem Lungenexperten, sehr vielversprechend, weitere klinische Studien im Laufen.
Trotz immer fortschrittlicherer Therapiemöglichkeiten spielt eine frühe Diagnose der Erkrankung nach wie vor eine wesentliche Rolle für die Prognose. Denn: „ Je früher die COPD behandelt wird, desto besser sind heute die Mög lichkeiten, den weiteren Lungenfunktionsverlauf günstig zu beeinflussen“, so Prof. Lamprecht. Dies sei von zentraler Bedeutung, „denn COPD ist nicht heilbar und führt unbe handelt zu starken Einbußen von Lebensqualität und vor zeitigem Tod.“
Die Alarmglocken sollten jedenfalls bei Auftreten der AHA-Symptome läuten. Bei Auswurf, Husten und Atemnot sollte der Patient dringend bei einem Lungenfacharzt vor stellig werden. Weiters brauche es in der Diagnostik sensitivere Lungen funktionstests. State of the Art sei seit Jahrzehnten die Spi rometrie. Das Problem bestehe jedoch darin, „dass dieser Lungenfunktionstest frühe COPD-Stadien nicht zuverlässig erkennen lässt, sondern nur fortgeschrittene und damit irre versible“, erklärte der Experte.
Die Kombination von sensitiveren Lungenfunktionstests und der Berücksichtigung individueller Risikofaktoren in der Anamnese sowie unterstützende bildgebende Verfah ren in der Diagnostik würden in Zukunft eine frühzeitigere Diagnose und damit auch eine maßgeschneiderte Therapie ermöglichen.
Mag.a Ulrike Krestel* Die 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) fand von 29. September bis 1. Oktober unter dem Motto „Prävention in der Pneumo logie“ in Salzburg statt.
Redewendungen wie „schweren Her zens“, „sich etwas zu Herzen nehmen“ oder „ Das bricht mir das Herz “ ver deutlichen, dass Emotionen die Herz
gesundheit direkt beeinflussen können. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Tako-Tsubo-Kardiomyopathie bzw. das Broken-Heart-Syndrom. Diese kardiologische Erkrankung wurde erstmals 1990 in Japan beschrieben: Dabei handelt es sich um eine lebensbedrohliche, akut auftretende Herzschwäche, die sich durch eine bestimmte Verformung des Herzmuskels auszeichnet. Die Erkran kung ist nach einem – zum Tintenfisch
fang benutzten – Tonkrug (Tako-Tsubo) benannt, weil die linke Herzkammer in der Akutphase diesem ähnelt.
Die betroffenen Personen leiden oft un ter herzinfarktähnlichen Symptomen, Rhythmusstörungen oder kardialen Stauungszeichen. Eine Unterscheidung gelingt nur mittels Angiographie, wobei

„Die Botschaft lautet: Das psychische Wohlbefinden sowie die resiliente Haltung sind lehr- und erlernbar.“
Wenn die Psyche das Herz aus dem Rhythmus bringt
sich – anders als beim Herzinfarkt – of fene Herzkranzgefäße nachweisen las sen. Als Ursache wird unter anderem eine vorübergehende Verkrampfung der kleinsten Gefäße im Herzmuskel vermutet, die zu einer Minderdurch blutung führt, welche sogar in einem lebensbedrohlichen Pumpversagen en den kann.

Betroffen sind mehrheitlich Frauen, aber auch Männer, wobei ältere und alte Personen ein höheres Erkrankungsrisi
ko aufweisen. Ein Zusammenhang mit endogenen Östrogenen im Rahmen der Menopause ist wahrscheinlich. Hervorgerufen wird die Erkrankung durch eine zumeist negative psychoso ziale Stressbelastung. Als beispielhaf te Auslöser können Verlusterlebnisse, interpersonelle Konflikte, berufliche Zurücksetzung und die Mehrfachbelas tung der Frauen genannt werden. In sel tenen Fällen wird die Erkrankung auch durch positive Situationen ausgelöst. Nach der Akutphase ist die Prognose gut, denn die anfänglich ausgeprägten Symptome bilden sich in der Regel bin nen weniger Tage vollständig zurück. Wichtig für die betroffenen Personen sind eine Wiederherstellung und der Erhalt von Aktivität sowie die erneute Teilhabe am beruflichen, gesellschaft lichen und sozialen Leben, außerdem die Reduktion der Pflegebedürftigkeit und das Erlernen von Kenntnissen und Fähigkeiten bezüglich eines herzgesun den Lebensstils. Dazu zählen neben ei nem angepassten Bewegungs- und Er nährungsprogramm insbesondere die Aneignung von Strategien zur Stress bewältigung sowie Entspannungstech niken und die Förderung der Resilienz gegenüber psychosozialen Stressoren.

 GASTAUTORINNEN-TEAM:
Tamara Reicher, BSc, MSc Klinische Psychologin, Rehazentrum Bad Tatzmannsdorf
Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Jeanette StrametzJuranek Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Rehazentrum Bad Tatzmannsdorf
© Andi Bruckner, andibruckner.com
GASTAUTORINNEN-TEAM:
Tamara Reicher, BSc, MSc Klinische Psychologin, Rehazentrum Bad Tatzmannsdorf
Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Jeanette StrametzJuranek Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Rehazentrum Bad Tatzmannsdorf
© Andi Bruckner, andibruckner.com
Vorrangig an der Psychologie orientiertes
Im Rehabilitationszentrum der Pensionsversicherungs anstalt (PVA) Bad Tatzmannsdorf wurde von Tamara Reicher, BSc, MSc aufgrund des vorhandenen Allein stellungsmerkmals „Tako-Tsubo-Kardiomyopathie“ ein speziell auf diese Erkrankung abgestimmtes psycholo gisches Therapieangebot entwickelt und etabliert. Die Auseinandersetzung mit den auslösenden psychosozi alen Belastungen und ihre Verarbeitung sowie die Än derung des Lebensstils sind neben der medizinischen Therapie eines Tako-Tsubo entscheidend für den Be handlungserfolg. Im Fokus des vorrangig psychologisch ausgerichteten Therapiekonzepts stehen ein Resilienz training in Kombination mit einer Entspannungstechnik sowie eine psychologische Behandlung in erhöhtem Aus maß, die wesentlich zur Identifikation von individuellen Stressoren und zu ihrer Bewältigung beiträgt. Zum einen fördert das zweiteilige Resilienztraining die Selbstfür sorge, zum anderen stärkt es die positiven Emotionen. Ziel ist, das psychische Wohlbefinden zu erhöhen und die Resilienz der Patientinnen und Patienten gegenüber Stressoren nachhaltig positiv zu beeinflussen. In diesem vorwiegend praxisorientierten Seminar stehen lösungs- und zukunftsorientierte psychologische Strate gien im Zentrum, die vorrangig positive Gedanken, Ge fühle und Verhaltensweisen aktivieren und fördern, um die Selbstwirksamkeit der Patientinnen und Patienten in Bezug auf ihr psychisches Wohlbefinden und ihre Resilienz zu erhöhen. Diese ressourcenorientierten positiv psychologischen Strategien und Interventionen werden den Betroffenen im Rahmen des Seminars präsentiert und von ihnen erprobt. Die Strategien sollen im Alltag konkrete Möglichkeiten bieten, das eigene Leben und die Umwelt aktiv zu gestalten und sich selbstwirksam wahrzunehmen. Ergänzend wird den Patientinnen und Patienten des Resilienztrainings eine Entspannungstech nik gesondert in zwei Einheiten vermittelt, um Rege neration und Erholung im Alltag selbstständig fördern und Anspannung reduzieren zu können. Das im Seminar Erlernte kann zum einen als präventive Maßnahme zur Verbesserung der psychischen Gesundheit, zum anderen zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Hand lungsfähigkeit in herausfordernden und turbulenten Si tuationen und Phasen des Lebens eingesetzt werden. Die Botschaft lautet: Das psychische Wohlbefinden sowie die resiliente Haltung sind lehr- und erlernbar.
Tipp: Um Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Tako-Tsubo-Kardiomyopathie einen raschen und un komplizierten Zugang zur Rehabilitation zu bieten, ist in diesem konkreten Fall eine direkte Antragstellung per Fax unter der Nummer 03353/6000-43290 beim Medizinischen Sekretariat des Rehabilitationszentrums Bad Tatzmanns dorf möglich.
die Zunahme der axialen Augenbau länge komme es zu einer Dehnung und Verdünnung der Netzhaut sowie kon sekutiv zu einer erhöhten Anfälligkeit für Augenschäden. „ Die Progressions minderung im frühen Lebensalter stellt daher ein wichtiges therapeutisches Ziel dar“, so Dr. Scholler.
Weltweit wird eine Zunahme der Kurz sichtigkeit beobachtet, was zum Großteil auf Änderungen der Sehgewohnheiten und der Lichtexposition zurückzufüh ren ist. Die Prävalenz der Myopie liegt bei 30–40 % in Europa, Australien sowie Nordamerika und zwischen 50 und 97 % in Asien. Schät zungen zufolge soll es bis 2050 fünf Milliarden (50 % der Weltbevölkerung) Kurz sichtige und eine Milliarde (10 %) hochgradig myope Menschen geben.1 Da der digi tale Erstkontakt immer früher stattfindet, leiden vermehrt auch Kinder unter dieser Form der Fehlsichtigkeit. Myopie be ginnt meist im Grundschulal ter und zeigt während der Pubertät eine Progression, die bis ins junge Erwachse nenalter andauern kann. Kurzsichtigkeit geht mit einem erhöhten Risiko einher, degenerative Augenerkrankungen zu entwickeln. Es sind daher Maßnahmen gefragt, die das Fortschreiten in Richtung einer hohen Myopie drosseln.
treten einer Myopie ist bei geringer Tageslichtexposition um den Faktor 5 erhöht und steigt durch ein hohes Maß an Naharbeit bis auf das 16-Fache an.2 Eine Lichtexposition im Freien kann demzufolge als protektiv angesehen werden, wohingegen Tätigkei ten im Haus wie Fernsehen, Computernutzung und Lesen als potenzielle Risikofaktoren zu betrachten sind.
Kurzsichtigkeit führt zu unscharfem Sehen in der Ferne. Aufgrund eines Missverhältnisses von Brechkraft und Achslänge des Auges liegt der Fern brennpunkt nicht auf, sondern vor der Netzhaut im Glaskörper. Das Wahr scheinlichkeitsverhältnis für das Auf
Die hohe Myopie stellt ne ben dem Faktor Lebensalter das Hauptrisiko einer Viel zahl von degenerativen Au generkrankungen wie Katarakt, Glau kom, Netzhautablösung und myope Makuladegeneration dar. Patientinnen und Patienten mit einer Myopie zwi schen −6 dpt und −10 dpt weisen ein 3-fach erhöhtes Risiko auf, eine Seh behinderung zu erleiden. Personen mit einer Myopie von mehr als −10 dpt haben sogar ein um den Faktor 22 er höhtes Risiko, degenerative Augener krankungen zu entwickeln.3 Ursache dafür ist die mit der Kurzsich tigkeit einhergehende Gewebedehnung – insbesondere im hinteren Augenab schnitt. „ Das vermehrte Längenwachs tum des Augapfels wirkt sich negativ auf die Architektur der Netzhaut aus“, sagt Dr. Andreas Scholler, Facharzt für Au genheilkunde und Optometrie. Durch


Auf pharmakologischer Ebene steht Atropin in Konzentrationen zwischen 0,01 % und 0,05 % für die Off-LabelAnwendung zur Verfügung. „ Einmal täglich abends appliziert, können die Augentropfen nachweislich weiteres Längenwachstum bremsen“, weiß der Facharzt eines Augenzentrums mit My opieschwerpunkt. Die Therapie sollte als Langzeitbehandlung konzipiert sein. Empfohlen werden halbjährliche Kontrollintervalle mit jeweiliger Bestimmung der Refraktion in Zykloplegie und Mes sung der Achslänge. In der Praxis wird die Behandlung mit Atropin häufig in einer Dosierung von 0,01 % begonnen und nach Bedarf gesteigert. „ Nebenwir kungen wie Mydriasis oder eine redu zierte Nahsehschärfe durch eine leicht verringerte Akkommodationsamplitude sind in diesen geringen Konzentratio nen kaum zu erwarten“, so der Experte. Die 0,05 %igen Atropin-Augentropfen verlangsamen das Fortschreiten der My opie am deutlichsten – verglichen mit 0,01 % und 0,025 %.4
Des Weiteren lässt sich die Progression durch eine optische Korrektion mit ei ner zweiten Bildebene vor der Netzhaut verringern – etwa durch multifokale Kontaktlinsen. Durch die Addition der Kontaktlinsen wird ein peripherer my opischer Defokus hervorgerufen, der das Fortschreiten der Myopie hemmt. Ob Kinder im Grundschulalter diese bereits akzeptieren, muss immer im Ein zelfall ermittelt werden. Vergleichbare progressionsmindernde Effekte erzie len Orthokeratologie-Linsen, die über Nacht getragen werden. Ihre Wirkung
beruht auf einer zentralen Abflachung und einer peripheren Aufsteilung des Hornhautepithels.
„Derzeitige Studien untersuchen Kom binationstherapien“, so Dr. Scholler über die Möglichkeit, Tagesaustauschkontaktlinsen einzusetzen, welche die Aminosäure Tyrosin an das Auge abgeben.
„ Z iel ist es, direkten Einfluss auf den Dopaminspiegel des Auges auszuüben, der eine Rolle beim Längenwachstum spielt“, erläutert der Facharzt. Dieser in Erprobung befindliche therapeutische Ansatz könnte in der klinischen Praxis künftig eine große Bedeutung haben.
Neuartige Brillengläser mit peripher defokussierender Funktion, der soge nannten „Defocus Incorporated Mul tiple Segments (DIMS)“ Technologie, sind seit April 2021 auch in Österreich verfügbar. Dabei handelt es sich um spe zielle Einstärkengläser, in deren Vorder fläche 396 kleine Pluslinsen eingearbeitet
sind. „Diese bewirken in der Peripherie des Gesichtsfeldes einen zusätzlichen myopen Defokus“, erklärt Dr. Scholler: „Dadurch wird in der Netzhaut ein Steuerungssignal zur Reduzierung des übermäßigen axialen Längenwachstums erzeugt.“
Im Rahmen einer sechsjährigen klini schen Follow-up-Studie wurde das Fort schreiten der Myopie bei Kindern unter sucht, die MiYOSMART-Brillengläser mit der DIMS-Technologie trugen. Sie verbesserte den Outcome einer frühe ren dreijährigen Nachfolgestudie:5 Diese Fortsetzung einer zweijährigen randomi sierten Kontrollstudie6 wurde im British Journal of Ophthalmology veröffentlicht und belegte die Wirksamkeit der Gläser bei Kindern im Alter von acht bis 13 Jah ren. Es zeigte sich: Die speziellen Gläser verringern deutlich die Myopieprogres sion in Dioptrien sowie das axiale Län genwachstum im Vergleich zu herkömm lichen Einstärkengläsern.
Die sechsjährige klinische Nachfolgestu die bestätigt nun, dass die Auswirkungen dieser Brillengläser auf die Myopiekon
trolle über einen längeren Zeitraum an halten. Darüber hinaus beweist die Fol low-up-Studie, dass es nach Absetzen zu keinem Rebound-Effekt kommt.7,8,9
Mag.a Sylvia NeubauerQuellen:
1 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016.
2 Lagrèze WA, Schaeffel F, Preventing myopia. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 575–80. doi: 10.3238/arztebl.2017.0575.
3 Verhoeven V et al., Visual consequences of refractive errors in the general population. Ophthalmology 2015; 122: 101–9.
4 Jonas JB et al., IMI prevention of myopia and its progressi on. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62(5):6.
5 Lam CS et al., Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology. 2022 Aug;106(8):1110-1114. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2020-317664.
6 Lam CSY et al., Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. 2020 Mar;104(3):363-368. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2018-313739.
7 Lam CSY et al., Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.

8 Wong HB et al., Ocular component growth curves among Singaporean children with different refractive error status. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Mar;51(3):1341-7. doi: 10.1167/iovs.09-3431.
9 Chamberlain P et al., Axial length targets for myopia control. Ophthalmic Physiol Opt. 2021; 41: 523– 531. doi.org/10.1111/ opo.12812.
*„Normalisiert das Augenlängenwachstum“ bedeutet Wiederherstellung des emmetropen Augenwachstums. Kaymak, H., Graff, B., Neller, K. et al. Myopietherapie und Prophylaxe mit „Defocus Incorporated Multiple Segments“-Brillengläsern. Ophthalmologe (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s00347-021-01452-y
Was Schnarchen lästig und Atemaussetzer lebensgefährlich macht
lich verkürzte Lebenserwartung sind Folgen einer unbehandelten schweren Schlafapnoe.
Schnarchen ist ein Geräusch, das beim Schlafen durch Vibration des Weichgau mens und des Zungengrundes entsteht. Normalerweise geht die Luft beim Ein atmen durch die Nase, vorbei an Gau mensegel, Zäpfchen und Zunge. Der Luftweg bleibt offen. Schnarchen weist auf einen erhöhten Atemwiderstand hin, stört den Schlaf des Betroffenen und den des Bettpartners noch mehr. Das Phänomen ist häufig und nimmt im Alter zu. So schnarchen etwa 15 % der Kinder, 10 % der jungen Frauen, 30 % der jungen Männer, 40 % der älteren Frauen und 60 % der älteren Männer. Die Ursachen sind vielfäl tig. Bei Kindern spielen vor allem vergrößerte Rachen dachmandeln (im Volksmund „ Polypen“ genannt) und Gau menmandeln eine Rolle, bei Erwachsenen Übergewicht, erschlaffendes Gewebe im Alter, große Mandeln oder ungünstig vernarbte Mandel operationen, ein verdickter Zungengrund und eine große Zunge. Weiters ein „f liehen des“ Kinn, eine behinderte Nasenatmung durch eine schiefe Na senscheidewand, eine Allergie oder Nasenpolypen; außerdem Alkohol, be ruhigende Medikamente und eine „er
Unter einer Schlafapnoe versteht man Atempausen von mehr als zehn Sekun den Dauer, die mindestens zehnmal pro Stunde auftreten. Sie sind von so genannten Aufweckreaktionen beglei tet. Der Apnoiker fühlt sich morgens wie gerädert und ist auch untertags müde. Bei der obstruktiven Schlafapnoe kommt es aufgrund eines Kollapses der Atemwege zu Atemaussetzern, bei der zentralen Schlafapnoe liegt der Grund dafür im Atem kontrollzentrum des Gehirns. Im Gegensatz zum Symptom Schnarchen, das zwar lästig, aber nicht unbedingt gesund heitsschädlich ist, handelt es sich bei der Schlafapnoe um eine Krankheit, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann. Bezie hungsprobleme, chronische Schlafstörungen, Kopfschmer zen, Tagesmüdigkeit mit Kon zentrationsschwäche und eine größere Unfallhäufigkeit, Depressionen, Blut hochdruck, Herzrasen, Schlaganfall und Herzinfarkt sowie insgesamt eine deut
Die Abklärung einer schlafbezogenen Atemstörung beginnt mit einer aus führlichen Schlafanamnese, idealerwei se gemeinsam mit dem Bettpartner des Patienten, gefolgt von einer gründlichen HNO-ärztlichen Untersuchung mit Be rücksichtigung aller möglichen anato mischen und funktionellen Engstellen. Dann wird eine sogenannte respiratori sche Polygraphie („k leines“ Schlaflabor) vereinbart. Dazu schläft der Schnarcher eine Nacht mit einem Diagnosegerät, das folgende Parameter misst: den Luft fluss durch die Nase, die Sauerstoffsät tigung im Blut, den Puls, die Brust- und Bauchbewegungen, die Körperlage, die Lautstärke der Schnarchgeräusche und die Lichtstärke im Raum.


Im Anschluss werden die Befunde be sprochen, es wird erörtert, ob ein Be handlungsbedarf besteht und welche Therapiemöglichkeiten in Frage kom men. Bei häufigen Atemaussetzern muss auch noch eine große Schlaflaborunter suchung (Polysomnographie) vereinbart werden. Schließlich wird in Absprache mit dem Patienten ein Therapieplan er stellt.
Es gibt eine Vielzahl von nicht evi denzbasierten Therapiemöglichkeiten, die vornehmlich über das Internet oder verordnungsfrei in Apotheken angeboten werden. Dazu zählen unter anderem Antischnarchsprays, Nasen spangen und -pflaster, Kinnriemen, Homöopathika, Gaumenspangen, An tischnarchrucksäcke, Antischnarchrin ge, Akupressur und Hypnosetherapie. Solche Maßnahmen mögen durchaus im Einzelfall hilfreich sein, es liegen jedoch derzeit meines Wissens keine belastbaren Studien vor, welche die Ef fektivität belegen würden.
Eine Behandlung des Schnarchens ist grundsätzlich nicht immer erforderlich. Wenn keine Schlafapnoe vorliegt, der Schnarcher allein schläft oder der Bett partner nicht wesentlich gestört ist, muss man nichts machen. Auch die Empfeh lung von getrennten Schlafzimmern ist durchaus eine Option.
Lifestyle-Modifikationen wären sehr oft sinnvoll, führen aber leider nur selten zu einem dauerhaften Therapieerfolg. Dazu gehören: Gewichtsverlust, mehr Sport, Verzicht auf Alkohol, schweres Abendessen und müde machende Me dikamente. Der limitierende Faktor ist die mangelnde Disziplin und Ausdauer der Menschen.
So wie man andere Muskelgruppen trainieren kann, kann man auch die Gaumenöffnermuskulatur trainieren und dadurch eine Besserung des Schnar chens erreichen. Am besten studiert ist diesbezüglich das regelmäßige Spielen
des Didgeridoos, eines traditionellen In struments der Aborigines.
Ein Schlafpositionstrainer ist ein häu fig verordnetes Gerät, das sich bequem tragen lässt und dauerhaft dabei hilft, die Rückenlage während der Nacht zu verhindern, und bei vielen Schnarchern und Apnoikern als alleinige Therapie maßnahme ausreicht.
Zahnärztlich angepasste Zahnschienen für die Nacht, die den Unterkiefer etwas nach vorne verlagern, schaffen mehr Platz hinter der Zunge und helfen auch vielen Schnarchern.
Die Therapie der Wahl für schwe re Apnoiker, insbesondere für stark übergewichtige und alte Menschen, ist jedoch nach wie vor die Anpassung ei ner sogenannten CPAP-Maske („con tinuous positive airway pressure“), bei welcher der Patient zur Nacht wie ein Luftballon aufgeblasen wird, wodurch seine Atemwege pneumatisch geschient werden und so nicht mehr kollabieren können. Diese Geräte sind inzwischen klein, leise und bei regelmäßiger An wendung zu 100 % effektiv. Anders als
die zuvor aufgezählten Therapiemaß nahmen wird ein CPAP-Gerät von den Krankenkassen bezahlt.
Schließlich gibt es noch eine Reihe von Operationen, die bei sorgfältig gewähl ter Indikationsstellung dem Problem des Schnarchens und der nächtlichen Atem aussetzer dauerhaft ein Ende bereiten können: Dazu gehören die Begradigung der Nasenscheidewand, die Verkleine rung von Nasenmuscheln, die Entfer nung vergrößerter Gaumenmandeln und Rachendachmandeln, das Straffen des Gaumensegels und eine teilweise Umverlagerung der Gaumenmuskula tur, selten auch eine Verkleinerung des Zungengrundes, die Implantation eines Zungenschrittmachers und die operati ve Vorverlagerung des Kiefers. Vor einer Schnarchoperation sollte zudem leitlini enkonform eine DISE („d rug induced sleep endoskopy“) erfolgen, eine endo skopische Untersuchung der Atemwege in oberflächlich gehaltener Narkose. <
Die senile Rhinitis ist meist harmlos, eine neurologische Abklärung aber erforderlich
Zu den häufigen Krankheitsbildern im fort geschrittenen Alter zählt die senile Rhi nitis. „Tatsächlich leiden etwa 10–15 % der Senioren an einer sogenannten Alterstropfnase“, weiß Dr.in Elke Fröhlich-Sorger. Die Fachärz tin für Hals-, Nasen- und Oh renheilkunde hat sich unter anderem auf die geriatrische HNO-Heilkunde spezialisiert. Die Krankheitszeichen äh neln oft jenen einer akuten Erkältung oder Allergie. Des halb erfolgen Diagnose und Behandlung meist sehr spät. Dr.in Fröhlich-Sorger schildert die wichtigsten Symptome zur Unterscheidung: „Die Sekretion aus der Nase ist zumeist wasserklar und dünnflüssig. Die Alterstropfnase tritt – als ständiger Begleiter – unabhängig von den Jahreszeiten und ohne wesentliche Begleitsymptome auf. Im Gegensatz dazu zeigen akute Erkältungskrankheiten wie die saisonale Influ enza oder die Coronainfektion eine Häufung in der kalten Jahreszeit. Sie sind durch ein plötzliches Auftreten, gepaart mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit, gekennzeichnet. Bei Erkältungen ist die Nasenatmung oft stark eingeschränkt, die Beschaffenheit der Nasensekretion reicht von klar bis schleimig-gelblich eingedickt. Zudem können Husten, Fie ber-, Kopf- und Gelenkschmerzen vorliegen, aber auch Ge schmacks- und Geruchsstörungen.“
Der wässrige Schnupfen im Alter wird etwa durch be stimmte äußere Reize verstärkt. Betroffene sollten daher stark gewürzte und zu heiße Speisen sowie rasche Tempe raturwechsel vermeiden, so die Expertin. „ Die Therapie möglichkeiten der senilen Rhinitis sind auf unterschiedli che Nasensprays beschränkt. Es kommen beispielsweise regenerierende, befeuchtende Nasenpflegen, glukokorti koidhaltige Sprays oder nasale Anticholinergika zur An wendung. Soleinhalationen helfen unterstützend.“
Die Medizinerin nennt verschiedene Ursachen für die Entstehung einer senilen Rhinitis, etwa Allergien oder eine chronische Sinusitis. „ Neurologische Grunderkran kungen, zum Beispiel eine Parkinson-Demenz, können primär mit solch einer Symptomatik auffallen, was eine neurologische Abklärung unbedingt erforderlich macht“, gibt Dr.in Fröhlich-Sorger zu bedenken. Außerdem führten altersbedingte Zellveränderungen der Nasenschleimhaut zu einer verlängerten Verweildauer von Schadstoffen so wie zu einer veränderten Zusammensetzung des Sekretes. Häufig komme es dabei zu einer Gefäßerweiterung, die der Patient als behinderte Nasenatmung wahrnehme.
Mag.a Ines Pamminger, BA
y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten. y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch. +43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at

COVID-19-Risikogruppen motivieren, bei einer Infektion rasch zu handeln
„COVID-19 positiv – Nicht warten, An ruf schnell starten!“
„Neben den Coronaimpfungen sind die beiden oralen Therapieoptionen – ge zielt eingesetzt – sicher ein Zugewinn im Management der COVID-19-Pandemie“, macht Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Univ.-Klinik für Urologie, Infektiologe an der MedUni Wien, im Rahmen einer Pressekonferenz* in der Bundes hauptstadt aufmerksam. Die antivirale Behandlung mit PF-07321332 (Nirmat relvir)/Ritonavir oder mit Molnupiravir (im Rahmen des Compassionate-UseProgramms) ist aufgrund ihrer Darrei chungsform für den niedergelassenen Bereich besonders relevant und zielt da rauf ab, bei Personen mit einem erhöhten Risiko schwere Verläufe zu verhindern.
Die Therapie sollte zum frühestmögli chen Zeitpunkt nach der Diagnosestel lung – jedoch spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Sympto me – begonnen werden. Laut Prim. Priv.Doz. Dr. Arschang Valipour, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf, wirken die oralen Virustatika weitgehend unabhängig von Virusmutationen bzw. -varianten. „M indestens ein Drittel der Bevölke rung gehört einer Risikogruppe an“, weiß Prim. Valipour. Sind den Betrof fenen Risikofaktoren und Therapie möglichkeiten allerdings nicht bekannt, verzögert sich der Behandlungsbeginn oder wird das kritische Zeitfenster ver passt. Um den Wissensstand der Bevöl kerung zu erheben, gab die Österreichi sche Lungenunion (ÖLU) im August 2022 eine Umfrage** in Auftrag.

Den bekanntesten Risikofaktor stellen der Umfrage zufolge Lungenerkrankun gen dar, 49,2 % der Teilnehmenden ga ben ihn bei der offenen (ungestützten) Abfrage an. An zweiter und dritter Stelle folgten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mit 38,6 % bzw. 30 %. Bei der geschlossenen (gestützten) Abfrage wurden ebenfalls Lungenerkrankungen am häufigsten genannt (79,3 %). Weiters zählen Krebserkrankungen (71,9 %), Asthma bronchiale (68,6 %), Autoimmunerkrankungen (65,5 %) sowie Herzin suffizienz (64,2 %) zu den bekanntesten Risikofaktoren. Besonders auffällig war in der Umfrage: Der Risikofaktor Alter wird ganz klar unterschätzt. In der offe nen Abfrage nannten ihn nur 10,7 % der Teilnehmenden, in der geschlossenen Abfrage wurde er von 56,1 % angegeben.
Viel Aufklärungsarbeit ist außerdem noch hinsichtlich der Behandlungs möglichkeiten im Falle einer Infektion vonnöten. Fast die Hälfte der Befragten (46,6 %) wusste nicht, dass es gezielte Therapien gibt. Auch rund ein Viertel der Personen (24,4 %), welche sie be reits kennen, würde abwarten, wie die Krankheit verläuft, und die Medika mente nicht frühzeitig einnehmen. Da mit sich das ändert, startete die ÖLU im Oktober 2022 eine groß angelegte Awareness-Kampagne mit dem Claim
Dr. Harald Schlögel, 1. ÖÄK-Vizepräsi dent und Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, bezieht Stellung: „Die zentrale Botschaft der Kampagne lautet völlig zu Recht: Im Infektionsfall sofort mit der Vertrauensärztin, dem Vertrau ensarzt Kontakt aufnehmen. Die niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner werden die antiviralen COVID-19-Medikamente wohlüberlegt mit individueller Prüfung der Indikation und angemessenem Medikationsmanage ment verordnen “ Eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung über und der Ver teilung von Therapiesubstanzen spielen auch die öffentlichen Apotheken. Mag.a Dr.in Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, weist darauf hin, dass der Weg zur Medi kation sogar durchgängig digital sein kön ne, und spricht diesbezüglich von einer „in Europa einzigartigen Pionierarbeit“ Gundula Koblmiller, MSc, Vorstandsmit glied und Sprecherin der ÖLU, freut sich über die breite Akzeptanz der Kampagne, die auch über Risikofaktoren aufklären soll, und betont: „Für uns als Selbsthilfe verein ist die Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachgesellschaften, der Apotheker- und der Ärztekammer sowie der Pharmaindustrie von großer Bedeutung.“
Anna Schuster, BSc* Pressekonferenz „Aktuelle Umfrage zu COVID-19: Ergebnisse zeigen Unsicherheiten bei Risikofaktoren und Unwissen um zielgerichtete COVID-19-Therapien. Awareness-Bildung als wirksame Gegenmaßnahme“, 5. Oktober 2022, Skybar in Wien.
** Das Institut MindTake führte die Online-Befragung im Auftrag der ÖLU durch, gewählt wurde eine Bruttostich probe von N = 1.000. Die Nettostichprobe (Personen ab 30 Jahren) lag bei N = 827.
Eine Awareness-Kampagne der Österreichi schen Lungenunion (ÖLU) läuft von Oktober 2022 bis März 2023 und wird multimedial umge setzt, u. a. in Form von Printinseraten, Bus- und Straßenbahnbranding sowie Informationsflyern, die in Arztpraxen und öffentlichen Apotheken aufgelegt werden können und kostenlos zur Verfügung stehen. Landingpage der Kampagne: lungenunion.at/covid-19-Therapien
Sind die Kolleg:innen in den Allgemeinpraxen ausreichend informiert, um im Fall der Fälle rasch und richtig zu handeln?
Wir haben an der Karl-Landsteiner-Uni versität bereits zu Beginn der Pandemie eine Infoplattform für die Primärversor gung eingerichtet. Hier finden sich alle Informationen, die Hausärztinnen und -ärzte brauchen: von der Diagnostik über Klinik und Verlauf bis hin zu Imp fungen und Medikamenten1. Die Website wird regelmäßig aktualisiert. Man kann sich hier oder auf der ÖGAMHomepage auch unseren wöchentlichen Newsletter ansehen bzw. ihn abonnie ren.2 Auch einen wöchentlichen 15-mi nütigen Videopodcast geben wir heraus – inzwischen auch zu anderen Themen als COVID.
er die Maske aufgehabt hat. Angesteckt haben sich die Leute, wenn sie zum Kaffeetrinken gegangen sind und die Maske abgenommen haben. Nämlich gegenseitig. Die FFP3-Maske in der Ordination schützt also wirklich, auch vor Influenza. Denn COVID ist ja jetzt nicht mehr unser einziges Problem. In ein paar Wochen ist eine Grippeepide mie sehr gut möglich. Ähnlich verhält es sich mit anderen respiratorischen Viren wie dem RSV, unter dem die Kin der so leiden.
Ihre abschließenden Forderungen an die Politik?
HAUSÄRZT:IN: Um Wissenslücken in der österreichischen Bevölkerung zu schließen, hat die Österreichische Lungenunion im Oktober eine groß angelegte Awareness-Kampagne zu COVID-19-Therapien gestartet. Eine sinnvolle Herangehensweise?
Dr.in RABADY: Das Erste und Wich tigste ist aus meiner Sicht: Risikoper sonen sind durch die rezente Impfung geschützt. Nicht immer vor der Anste ckung, aber mit sehr, sehr hoher Sicher heit vor einem schweren Verlauf. Wir sehen bei geimpften Risikopersonen praktisch keine schweren Verläufe. Das ist der beste Schutz. Antivirale Therapien wird man sinnvol lerweise bei einer starken Risikokonstellation verschreiben, z. B. bei immun supprimierten Personen und/oder wenn bei Patienten die letzte Impfung schon länger zurückliegt. Man muss das im Einzelfall genau abwägen und mit der Patientin/dem Patienten besprechen.
Darüber hinaus bieten wir ein Pointof-Care-Webtool3: Die Kolleg:innen können damit blitzesgeschwind – mit einem Knopfdruck – herausfinden, wie bei der Therapie vorzugehen ist. Auch die Medikamenten- und Evidenzüber sicht kann sehr hilfreich sein. Bei Paxlo vid z. B. braucht es ja ein Medikationsmanagement. Die Vorgehensweise wird Schritt für Schritt erklärt. Auch zu Long COVID gibt es ein solches webbasiertes Point-of-Care-Tool. Wir haben wirklich alles. Die Kolleginnen und Kollegen müssen es nur wissen und die Plattfor men nutzen.
Wie wichtig sind andere Maßnahmen wie Hygiene und Masken? Hygienemaßnahmen gewinnen gerade wieder an Bedeutung. Das Coronavirus wird bekanntlich nicht über Schmier infektionen übertragen, sondern durch Aerosole. Anders verhält es sich jedoch mit all den „Winterviren“, die jetzt auf uns zukommen. Die Hygienespender bekommen damit endlich einen Sinn! Die Maske verhindert sowohl bei COVID19 als auch bei anderen respiratorischen Viren die Infektion. Niemand von uns hat sich je in der Praxis infiziert, solange
Erstens das Maskentragen propagieren! Es geht nicht darum, Infektionswellen komplett zu verhindern. Das ist sowie so nicht machbar. Die Leute tragen im Privatbereich keine Masken. Es geht darum, sie flacher zu halten, weil unse re Ordinationen jetzt schon übergehen. Und wenn ich mir da eine Epidemie mit mehreren Erregern – Stichwort Twinde mie – vorstelle, dann bin ich froh, dass ich selbst nicht mehr in der Praxis bin … Zweitens auf Impfaufrufe setzen – auch zum Beispiel in Bezug auf Influenza. Die Epidemie wird heuer wahrschein lich deutlich früher eintreffen als früher. Jeder Kollege/jede Kollegin kann einen Beitrag leisten, indem er/sie seine/ihre Patientinnen und Patienten anregt, sich impfen zu lassen.
Wien ist hier vorbildhaft. Eine sehr ernsthafte Anregung abschließend von mir: Bitte die Grippeimpfung in allen Bundesländern gratis anbieten und sie bewerben! Wir sollten den Menschen klar vermitteln: Man kann sich vor einer schweren Erkrankung schützen.
Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
1 kl.ac.at/coronavirus
2 oegam.at/covid-19, covid-19.infotalk.eu
3 kl.ac.at/allgemeine-gesundheitsstudien/antivirale-therapie
Dr. in Susanne Rabady, Ärztin f. Allgemeinmedizin und ÖGAM-Präsidentin, leitet das Department für Allgemeinund Familienmedizin an der Karl Landsteiner Privatuni versität für Gesundheitswissenschaften und ist Mitglied der Coronakommission.

gelten als wichtiges Instrument für die Prävention in der Pneumologie
der Auffrischungsimpfung aber noch zuwarten, so der Experte, da vermutlich erst sechs Monate nach durchgemachter Infektion eine Boosterwirkung durch die neu erliche Immunisierung zu erwarten sei.

Die 46. Jahrestagung der Österreichi schen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) stand unter dem Motto „P räven tion in der Pneumologie“.* In diesem Kontext spielt gerade auch das Thema Impfungen eine wesentliche Rolle. Denn die Lunge ist als „Umweltorgan“ in stän digem Austausch mit dem Außen – und dadurch schädigenden Umweltfaktoren wie Krankheitskeimen besonders stark ausgesetzt. Ist sie erkrankt, kann dies für jedes Organsystem gravierende Folgen haben – eine gesunde Lunge gilt somit als wichtiger Faktor für Gesamtkonstitu tion und Lebenserwartung. Welche Vak zine gerade jetzt im Herbst für wen zu empfehlen sind, wurde am Kongress im „Update Impfungen“ thematisiert. „Die Geschichte der Impfungen ist durch viele kleine und große Erfolge gekennzeichnet“, hielt OA Dr. Michael Meilinger vom ÖGP-Arbeitskreis „I n fektiologie und Tuberkulose“ einleitend fest. „ Denken wir nur an die Ausrottung der Pocken oder der Kinderlähmung in Österreich durch entsprechende Imp fungen. Auch die Zahl der HepatitisB-Erkrankungen nahm durch weit verbreitete Immunisierungen deutlich ab. Und man muss gar nicht so weit zurückblicken, um noch mehr Erfolgs geschichten zu finden: Denken wir nur an die bereits rückläufigen Zahlen von Gebärmutterhalskrebs durch die Vakzi ne gegen HPV oder die seit zwei Jahren sehr emotional diskutierte Impfung ge gen SARS-CoV-2.“
Die Impfung gegen SARS-CoV-2 zeige eine exzellente Wirksamkeit, was den Schutz vor schwer verlaufen den Infektionen betreffe, fuhr OA Meilinger fort. Erst vor wenigen Wochen hat ja das nationale Impfgremium alle Personen ab dem zwölften Lebensjahr zum vierten Stich aufgerufen. So werden nun die ersten drei Impfungen ge gen SARS-CoV-2 als Grundimmunisierung verstanden –und die vierte als erste Auf frischung.
Neben einer Komplettierung bzw. Auf frischung der Coronaimpfung ist auch heuer wieder die saisonale Vakzinati on gegen Influenza empfohlen. Prof. Meilinger: „Da die Influenza in den letz ten beiden Jahren vor allem aufgrund des Tragens von Masken und verminderter sozialer Kontakte deutlich weniger in der Bevölkerung zirkulierte als in den Jahren vor der Coronapande mie, ist von einer mittlerweile nachlassenden natürlichen Immunität in der Bevölke rung auszugehen, wodurch die Impfung einen umso höheren Stellenwert hat.“
OA Dr. Michael Meilinger Abteilung für Innere Medizin und Pneumo logie, KH Nord – Klinik Floridsdorf, Wien

Außerdem halten derzeit va riantenangepasste Impfstoffe Einzug in das Corona-Impfportfolio. Prof. Meilinger: „ Nun bzw. demnächst sind auch solche verfügbar, die einen besseren Schutz gegen die OmikronVarianten BA.1 bzw. BA.4 und BA.5 bieten. Vor schweren Verläufen schützt aber auch eine Auffrischung mit den bis her verwendeten Coronavakzinen.“
Die Auffrischung hat aus Sicht des natio nalen Impfgremiums also obersten Stel lenwert, unabhängig davon, ob mit den schon länger verfügbaren Impfstoffen oder den erwähnten omikronangepass ten geimpft wird. Menschen, die bereits grundimmunisiert seien und zusätzlich in den letzten Monaten eine Coronainfektion durchgemacht hätten, könnten mit
Seit wenigen Jahren sind in Österreich stärker wirksame Vakzine gegen Influenza ver fügbar, welche entsprechend dem österreichischen Impf plan vor allem älteren Men schen, Immungeschwächten und chronisch Kranken emp fohlen werden. Aber auch auf die Kinder dürfe nicht vergessen werden, so der Ex perte: „Die Impfung gegen Influenza ist im kostenfreien Kinderimpfprogramm enthalten. Und dies kommt nicht nur den Kindern zugute, deren Risiko, zu erkran ken bzw. einen schweren Verlauf zu ent wickeln, reduziert wird. Kinder sind oft Treiber des Influenzainfektgeschehens und hauptverantwortlich für die Infekt verbreitung. Ältere, vulnerable Personen, welche für schwere Influenzaverläufe noch deutlich anfälliger sind, stecken sich oft bei ihnen an. So können durch hohe Durchimpfungsraten bei Kindern auch ältere und stärker gefährdete Personen besser geschützt werden.“
Weiters ist es sinnvoll, den Beginn der Grippesaison zum Anlass zu nehmen, den individuellen Impfstatus hinsichtlich weiterer respiratorisch übertragbarer Infektionen, welche das ganze Jahr über auftreten können, zu prüfen. So fielen vor der Coronapandemie und der damit einhergehenden Kontaktreduktion über Jahre weltweit steigende Fallzahlen von Pertussis auf, welche u. a. auf fehlende Auffrischungen bei Erwachsenen zu rückzuführen sind. Eigentlich sollten diese nach der Grundimmunisierung im Kindesalter alle zehn Jahre erfolgen. Da es ab dem 60. Lebensjahr im Rahmen der sogenannten Immunseneszenz zu einer nachlassenden Immunantwort auf Vakzine kommt, sind Auffrischungen ab diesem Alter im Fünf-Jahres-Intervall empfohlen. Prof. Meilinger: „ Bei der Pertussis gilt es aber vor allem auch, die ganz Kleinen zu schützen, da Säuglinge immer wieder schwere Verläufe erlei den können. So sollten insbesondere
Personen im Umfeld von Neugebore nen und Säuglingen bzw. Kleinkindern auf einen aufrechten Impfschutz ach ten “ Außerdem wird Frauen im letzten Drittel der Schwangerschaft eine Immu nisierung gegen Pertussis angeraten, da schützende Antikörper über die Plazen ta an den Fötus weitergegeben werden.
Nicht nur die Pertussiszahlen sind vor Beginn der Coronapandemie gestiegen. Auch die Rate der Pneumokokkenin fektionen ging in Österreich bis 2020 deutlich in die Höhe. Pneumokokken seien die häufigsten bakteriellen Erre ger einer Pneumonie, so Prof Meilinger, könnten aber auch Infekte der oberen Atemwege, eine Otitis media, eine Me ningitis oder eine lebensbedrohliche Sepsis verursachen. Diesbezüglich sind vor allem Menschen ab dem 60. Le bensjahr stärker gefährdet, außerdem jene mit chronischen Herz- oder Lun generkrankungen, aber beispielsweise
auch Patienten mit Diabetes oder einge schränkter Immunabwehr. Bei den Pneumokokken hat sich in den letzten Jahren ebenfalls viel in puncto Impfstoffentwicklung getan. So sind in Österreich heuer erstmalig breiter wirksame Konjugatvakzine verfügbar, welche sich nicht wie bisher gegen 13 unterschiedliche Serotypen von Pneu mokokken richten, sondern gegen 15 bzw. 20. Somit ist man durch solche hö hervalenten Vakzine noch besser vor ei ner Pneumokokkeninfektion geschützt. Prof. Meilinger führt abschließend aus: „ Auch wenn es gerade in letzter Zeit oftmals emotionale Impfdebatten gibt, sollte man bedenken, dass Impfungen erwiesenermaßen zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen zählen und ge impfte Personen seit Jahrzehnten dazu beitragen, unzählige Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern.“
PA/KaM* Die 46. Jahrestagung der Österreichischen Gesell schaft für Pneumologie (ÖGP) fand von 29. September bis 1. Oktober 2022 unter dem Motto „Prävention in der Pneumologie“ in Salzburg statt.
Derzeit wird wieder heftig geniest. Doch nicht nur Rhinoviren reizen die Schleimhäute in der Nase. Auch Haus staubmilben fordern von Allergien geplagte Patientinnen und Patienten heraus. Die zweithäufigste Allergie form in Europa hat in den Übergangs zeiten Hochsaison. Vor allem bei Men

schen mit Asthma bronchiale kann sie zu Atemnot führen. Prim. Dr. Josef Bolitschek, Abteilungsvorstand der Pneumologie am Ordensklinikum Linz, warnt vor chronischen Spätfolgen und empfiehlt eine fachärztliche Abklä rung. „Entgegen einer weit verbreiteten Meinung vieler Betroffener sind aller
dings nicht die mikroskopisch kleinen Tierchen in den Matratzen die Aller gieauslöser, sondern die winzigen ei weißhaltigen Kotballen der Milben“, sieht der Experte Aufklärungsbedarf. „ D iese Eiweißmoleküle sind so klein, dass sie gemeinsam mit dem Hausstaub über die Atemwege in die
Lungenschleimhäute gelangen. Dort bildet der Körper Antikörper, die zu einer vermehrten Ausschüttung des körpereigenen Gewebehormons Histamin führen und eine leichte Entzündung der Schleimhäute in Augen, Nase und Bronchien auslösen kön nen.“

Feuchtes Klima und Katzenhaare verschlimmern die
Typische Symptome sind juckende oder geschwollene Augen, vermehr tes Niesen, eine verstopfte Nase und/ oder erschwertes Atmen. „ Patienten mit Asthma bronchiale, bei denen die allergischen Reaktionen sogar Atem not verursachen können, sollten daher regelmäßig den Lungenfacharzt aufsu chen, um Spätfolgen wie chronisches Asthma oder COPD zu vermeiden“, führt Prim. Bolitschek weiter aus. „Vor allem Raucher haben diesbezüglich ein erhöhtes Risiko. Auch eine hartnäcki ge allergische Rhinitis sollte behandelt werden, um die Entwicklung von chro nischem Asthma zu verhindern.“ Hausstaubmilben sind übrigens in nahezu allen Haushalten zu finden, die in einer Höhe von bis zu 1.500 m über dem Meeresspiegel liegen. Bei über 1.500 Höhenmeter liegt die Pro blematik fast bei null. „ E s gibt Unter suchungen, die zeigen, dass vor allem Menschen, die zum Beispiel neben einem Fluss wohnen, wesentlich häu figer unter einer Hausstaubmilbenallergie leiden als Bewohner trockenerer Gebiete“, kennt der Facharzt weitere spannende Details. Katzenhaaraller gene verschlimmern die Symptomatik.
„ D ie Wirkung verstärkt sich oftmals, wenn im Hausstaub zusätzlich noch Katzenhaarallergene sind. Das sind we sentlich potentere Allergene als jene der Hausstaubmilbe.“
Mithilfe einer Hyposensibilisierung kann die Empfindlichkeit Betroffe ner und damit auch die Reaktion auf das Allergen sehr gut reduziert wer den. „ D ie Erfolgsraten liegen zwi schen 70 und 80 Prozent “ , betont der Experte abschließend. Auch all gemeine Tipps könne man seinen Patienten natürlich kommunizieren, etwa zu hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden, auf Sauberkeit achten, Staubfän ger entfernen, Bettwäsche regelmäßig waschen und nur aufschlagen (nicht aufschütteln), u. Ä. m.
PA/KaMErfolgreichste Therapie: eine Hyposensibilisierung
Wie die KaplandPelargonie nach Europa kam „Umckaloabo“ lautet der Name der KaplandPelargonie (Pelargonium sidoides) in der Sprache der südafrikanischen Zulu. Dies be deutet „Beschwerden/Erkrankungen der Lunge“ oder „Schmerzen im Brustbereich“. So mit wäre bereits geklärt, wofür dieser Vertreter der Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae) – genauer gesagt dessen Wurzel – traditionell in Südafrika verwendet wurde. Ende des 19. Jahrhunderts erkrankte ein englischer Major, Charles Henry Stevens, an Tuberkulose. Auf Anraten seines Arztes reiste er wegen des günstigen Klimas nach Südafri ka. Ein Heilkundiger behandelte ihn in Lesotho mit einem Sud aus der Wurzel der Kapland-Pelargonie und Stevens gesundete. 1920 wurde der Genfer Missionsarzt Dr. Adrien Sechehaye auf diese Pflanze aufmerksam. Er behandelte in den darauffolgenden Jahren etwa 800 Personen und publi zierte seine Erkenntnisse im Jahr 1930. Daraufhin kam die Umckaloabowurzel nach Europa, wo sie zur Behandlung von Tuberkulose eingesetzt wurde. Längst kann TBC mit Antibiotika effizienter behandelt werden. Als Heilpflanze hat die Kapland-Pelargonie deshalb jedoch nicht ausgedient und spielt in der Phytotherapie von Atemwegsbeschwerden nach wie vor eine Rolle. Das ist auf die Inhaltsstoffe Cuma rine, Gerbstoffe und einfache phenolische Verbindungen zu rückzuführen. Die European Scientific Cooperative on Phy totherapy (ESCOP) führt die pharmakologische Wirkung bei Symptomen von respiratorischen Infekten und banalen Erkältungen wie verstopfter oder laufender Nase, Hals schmerzen und Husten an. Dieser Effekt wird durch eine Steigerung der Interferon-Produktion, die Aktivierung der Killerzellen und den Schutz der Zelle vor Viruszerstörung erzielt. Dargereicht wird die Arznei als alkoholischer Ex trakt in Tropfen- sowie als Trockenextrakt in Tablettenform. Als Nebenwirkungen werden in sehr seltenen Fällen leichte Magen-Darm-Beschwerden sowie leichtes Zahnfleisch- oder Nasenbluten beschrieben. Wechselwirkungen sind nicht be kannt. Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte aus Vorsichtsgründen vermieden werden, weil dafür bislang keine Untersuchungen zur Unbedenklichkeit vorliegen.
 Margit Koudelka
Margit Koudelka
Quellen:
ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy; Kooperation Phytophar maka: arzneipflanzenlexikon.info (abgerufen am 21.09.2022).
Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie (ÖGPHYT), Aktuelle Heilpflanze Pelargonie, phytotherapie.at
Patientin Viola H. (72) ist vor einem Monat gestürzt. Glücklicherweise kam sie mit einer Prellung davon, doch gleichzeitig erhielt sie die Diagnose Osteoporose und fürchtet sich nun vor dem nächsten Sturz. Ihre Hausärztin empfiehlt eine Physiotherapie, um mehr Stabilität zu erlangen. Frau H. weiß nicht, ob sie dem Training ge wachsen ist: Was, wenn die Therapie mehr schadet, als sie nützt?
Physiotherapeut LEDINGER: Er halten Menschen mit Osteoporose eine Verordnung für eine Physiothe rapie, können die Interventionen sehr unterschiedlich aussehen. Passend zu Alter, Sturzrisiko oder speziellen Grunderkrankungen, etwa Diabetes mellitus, Rheumatoider Arthritis, Morbus Parkinson, Herzinsuffizienz u. v. m., gestalten sich Therapieansätze äu ßerst individuell. Eine OsteoporoseStandardtherapie erscheint wegen dieser Gesichtspunkte nicht adäquat. In Bezug auf Sturzprophylaxe den

ken auch bei Osteoporose viele zuerst an Gleichgewichtstraining. Liegt eine Sturzgefährdung vor, sollte aber im Detail erhoben werden, was die Ur sache für das erhöhte Risiko ist. Oft mals trägt ein Kraftdefizit oder eine Grunderkrankung mehr zum Sturzrisi ko bei als „schlechte Balance“ an sich. Genau hier ist es entscheidend, mit einer gezielten Trainingstherapie ent gegenzuwirken. Dabei stehen häufig funktionelle Übungen im Vordergrund, welche exakt das individuelle Defizit im Alltagskontext der Betroffenen ad ressieren. Auch eine Kombination mit Gleichgewichtstraining kann sinnvoll sein. Solide durchgeführte Übersichts arbeiten, welche Ergebnisse zu diesen Arten von Interventionen bei älteren Menschen zusammenfassten, berichten über eine Reduktion der Sturzrate von einem Viertel.
Viele Osteoporosepatientinnen und -patienten sorgen sich um die Belast barkeit ihrer Knochen im Rahmen einer Therapie. Ist beispielsweise ein
Krafttraining indiziert, müssen Betrof fene zuerst gut aufgeklärt werden und es müssen ihnen eventuelle Ängste ge nommen werden. Personalisierte und supervidierte Trainings sind generell sehr risikoarm. Ein multidisziplinäres Vorgehen in enger Abstimmung mit der Haus- oder Fachärztin und ande ren Gesundheitsberufen ist für den langfristigen Therapieerfolg entschei dend. Beim Training ist grundsätzlich auf eine regelmäßige Durchführung (mindestens zweimal pro Woche) und auf eine progressive Belastungsanpas sung zu achten. Gerade diese Punkte sind in der Praxis nicht immer leicht umzusetzen. Ein weiterer Aspekt ist der Umgang mit einem sehr hohen Sturzrisiko und häufigen Stürzen oder sturzbedingten Frakturen in der Ver gangenheit. Lassen sich Sturzinzidenz und -risiko nicht unmittelbar beeinflus sen, so können Edukation, Falltrainings und Hüftprotektoren dem Risiko, Frakturen zu erleiden, und der Sturz angst umgehend entgegenwirken.
Herausgeber und Medieninhaber: RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Helena Valasaki, BA. Cover-Foto: shutterstock.com/vectorfusionart
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Ornela-Teodora Chilici, BA, ornela-teodora.chilici@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwor tung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke.
Offenlegung: gesund.at/impressum

Mit Gesundheitsschutz für Umwelt schutz zu argumentieren, hat eine lange Tradition. Angesichts der sich verschär fenden Klimakrise und des immer enger werdenden Fensters, in dem das Pariser Klimaziel erreicht werden kann, gewinnt die Argumentation in Form gesundheit licher Co-Benefits von Klimaschutz an Brisanz. Denn anders als die Redukti on von Treibhausgasemissionen wirken diese Zusatznutzen schnell und kommen der Bevölkerung direkt zugute.
Der Klimawandel ist zu einer realen Krise geworden, de ren Folgen sich immer deut licher zeigen. Extremwet tereignisse wie Hitzewellen, Dürreperioden, Starknieder schläge und Stürme werden häufiger und nehmen an In tensität zu. Die weitreichen den Folgewirkungen der globalen Erwärmung stellen eine gesamtgesellschaftliche

Mag.a Dr.in Ulli Weisz Forschungskoordinatorin am Ludwig Boltzmann Institute for Lung Health, Mitglied des Fachkollegiums der Scientists4Future Österreich „Menschen lassen sich während einer individuellen existenziell bedrohlichen Gesundheitskrise leichter dazu bewegen, ihr Verhalten grundlegend zu ändern.“

Bedrohung dar, die – ohne schnelle und effektive Gegenmaßnahmen – die ge sundheitlichen, wirtschaftlichen und so zialen Folgen der COVID-19-Pandemie bei Weitem übersteigen wird.
Auf Grund der Komplexität des Klima systems sind Prognosen über zukünftige Entwicklungen und insbesondere über lokale Auswirkungen klimatischer Ver änderungen stets mit Unsicherheiten behaftet. Es besteht kein Zweifel, dass sich die Klimakrise weltweit unabhängig vom zukünftigen Emissionspfad wegen der Trägheit des Klimasystems verschär fen wird. Folglich sind alle Akteurinnen und Akteure gefordert Anpassungsstrategi en an unvermeidbare Folgen des Klimawandels systema tisch weiterzuentwickeln und rasch umzusetzen. Hier gilt es, besonders sensible und gesell schaftlich relevante Sektoren wie Gesundheitssysteme und ihre Organisationen besser vorzubereiten und vulnerable Bevölkerungsgruppen – dazu zählen ältere, sozial isolierte Menschen, chronisch Kranke und Kleinkinder sowie expo nierte Berufsgruppen – wirk samer zu schützen. Auch in reichen Ländern wie Öster reich sind ärmere Bevölkerungsgrup pen besonders betroffen. Sie haben nachweislich eine schlechtere gesund heitliche Ausgangslage und tragen gleichzeitig am wenigsten zum Klima wandel bei. Die Implementierung von Hitzeaktionsplänen, Monitoring- und Warnsystemen ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Gesundheit der Bevöl kerung. Es geht aber auch darum, diese Maßnahmen in abgestimmte politische Anpassungs- und Klimaschutzstrategi en einzubetten.
Aus Sicht der Medizin werden Fragen nach dem Zusammenspiel klimatischer Verän derungen und großer epidemiologischer Entwicklungen immer dringlicher. Das betrifft die Zunahme von häufig lebensstilassoziierten chronischen Erkrankungen wie COPD und Asthma, kardiovaskulären Erkrankungen, Adipositas und Diabetes Typ 2 sowie ihre Wechselwirkungen mit Allergien und COVID-19.
Fest steht: Je schneller und effektiver die Treibhausgasemissionen reduziert wer den, desto geringer werden die Folgen sein, an die es sich anzupassen gilt, und desto geringer die Kosten und Anstren gungen, um das Ziel der Pariser Klima schutzvereinbarung noch zu erreichen. So werden parallel zu den Warnungen vor klimawandelbedingten Risiken die Chancen für die Gesundheit betont, die der Klimaschutz bietet. Grundsätzlich gilt es zu unterscheiden: Global und langfristig gesehen kön nen alle Klimaschutzmaßnahmen Ge sundheit schützen. Sie vermeiden oder mindern zukünftige Krankheitslast als direkte Folge (z. B. Hitze) oder indi rekte Folge (z. B. Luftverschmutzung, Wasser- und Lebensmittelknappheit) klimatischer Veränderungen. Bestimmte Maßnahmen zeigen darüber hinaus ge sundheitsförderliche Effekte, die in der internationalen Literatur als „health and climate co-benefits“ bezeichnet werden.
Diese gesundheitlichen Zusatznutzen haben – im Gegensatz zu den zeitlich stark verzögerten und räumlich unge wiss auftretenden Effekten von Klima schutz, die entscheidend vom Erfolg internationaler konzertierter Bemü hungen abhängen – eine schnellere und
lokal realisierbare Wirkung. Das heißt, sie kommen denjenigen, die sie erzielen, jedenfalls zugute. Wenn größere Bevöl kerungsgruppen erreicht werden, also Einflüsse auf Populationsebene möglich sind, haben sie außerdem das Potenzial, das Gesundheitssystem substanziell zu entlasten. Für den Nachweis potenziel ler Effekte von Maßnahmen stellt die epidemiologische begleitende Gesund heitsforschung eine grundlegende Vor aussetzung dar.

In den Klimasachstandsberichten werden gesundheitliche Co-Benefits behandelt, die im Zusammenhang mit unterschied lichen Anpassungs- und Klimaschutzbe reichen wie dem Umstieg auf erneuer bare Energieträger, einer klimagerechten Raum- und Stadtplanung, Gebäudeisolie rung und Änderungen des Ernährungsund Verkehrssystems stehen. Erzielbare Gesundheitseffekte reichen von geringe rer Hitzesterblichkeit über eine Verbesse
rung der mentalen Gesundheit bis hin zur Verringerung von Adipositas, Atemwegsund Krebserkrankungen. Die Forschung zu „Co-Benefits“ im Gesundheitssystem steht noch am Beginn. Mit dem Argu ment „K limaschutz ist Gesundheits schutz“ wird jedoch die Schlüsselrolle be tont, die „health professionals“ im Kampf gegen die Klimakrise einnehmen können.

Ansatzpunkte, welche ein hohes Treibhausgasreduktionspotenzial aufweisen und gleichzeitig zur Verringerung von Erkran kungen beitragen, die durch Bewegungs mangel und eine ungesunde Ernährung entstehen, sind für Ärztinnen und Ärzte besonders relevant: Sie sind nämlich mit den Folgen dieser Gesundheitsprobleme tagtäglich konfrontiert.
Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeu tig: Weniger Fleisch und tierische Produk te, weniger verarbeitete, hochkalorische Lebensmittel, dafür mehr Gemüse, Hül senfrüchte und Obst sowie mehr körperli che Bewegung und weniger motorisierter
Individualverkehr, so die Kernbotschaft der Empfehlungen. Komplexer ist die Frage, wie hier eine Trendumkehr gelin gen kann.
Neben erforderlichen politischen Rah menbedingungen sind es Angehörige der Gesundheitsberufe und vor allem Medi zinerinnen und Mediziner, die – so die Hoffnung – hier einen wichtigen Beitrag leisten können. Denn sie stehen in direk tem Kontakt mit den Betroffenen, die ihnen großes Vertrauen entgegenbringen. Dadurch können sie leichter Einfluss auf den Lebensstil der Bevölkerung nehmen als andere Akteurinnen und Akteure und ihre Patientinnen und Patienten zu einem gesünderen und klimafreundlicheren Le ben bewegen. Dieser Gedanke wurzelt in einer vielleicht schon in Vergessenheit geratenen frühen Einsicht der Gesund heitsförderung: Menschen lassen sich im Krankheitsfall – während einer individu ellen existenziell bedrohlichen Gesund heitskrise – leichter dazu bewegen, ihr Verhalten grundlegend zu ändern.
Literatur bei der Verfasserin.
boso medicus exclusive Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreund lich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.

So individuell wie die Gesundheit.
Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und Qualität von boso: die Marke, auf die sich auch 96 % aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten in der Praxis verlassen.

(API-Studie der GfK 01/2016)
BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Österreich Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at
Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.
Herzstolpern: Patienteninitiative zur verbesserten Vorsorge
Jeder dritte Schlaganfall in Österreich wird durch Vorhof flimmern verursacht, welches häufig von Betroffenen kaum wahrgenommen und oftmals unerkannt bleibt. Daher haben Bristol Myers Squibb und Pfizer als Allianz die Patientenini tiative Herzstolpern ins Leben gerufen, welche vor allem äl
tere Menschen dazu animieren soll, regelmäßig ihren Puls zu messen und bei Unregelmäßigkeiten im Rhythmus ihren Arzt/ ihre Ärztin aufzusuchen.
Unterstützende Materialien zur Aufklärung von Patientinnen und Patienten sind unter www.herzstolpern.at zu finden.
Quelle: Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. | Bristol Myers Squibb Gesellschaft m.b.H.

432-AT-2100041, 05/2021 PP-ELI-AUT-0712/05.2021


Buchtipp: Fassung vom 15.3.2022, 1. Auflage
Mit dem FlexLex Medizinrecht halten Sie eine umfassende Gesetzessamm lung in Händen. Diese Ausgabe, er schienen im facultas Verlag, bietet eine Kombination aus Print und Online, mit tels QR-Code im Buch kann auf viele Gesetze Online zugegriffen werden.
Die digitalen Vorteile:
• Flexibel: Die Printversion ist auch auf allen mobilen Endgeräten tagesaktu ell nutzbar.
• Persönliche E-Mail-Benachrichtigung: FlexLex ist die einzige Gesetzes sammlung, die über jede Gesetzesän derung der Printausgabe tagesaktuell informiert.
• Interaktiv: Digitale Zusatzfeatures für registrierte Nutzer:innen sind ganz einfach über einen QR-Code im Buch abrufbar, inklusive Fassungsvergleich und Stichtagsabfrage.
Quelle: facultas Verlag