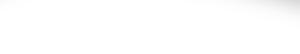nota bene
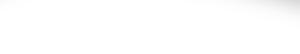



Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.
Franz Kafka, 1883 – 1924
5. Jahrgang | 1. Ausgabe | April 2018 | € 5,00
03 Editorial
Grußworte von Anneli Zenker und Manfred Preuss
04 Mütter und Väter der Pflege (6)
Vinzenz von Paul – ein Heiliger gestaltet die Geschichte der Pflege
06 9. GeriatrieForum
Johannesklinik Bad Wildbad setzt Akzente
07 Pflege und Politik
Pflege rückt endlich auch in den Focus der Politik
08 Bad Liebenzell
Die Lindenwirtin – Erlebnistheater in Bad Liebenzell
10 Johanneshaus Bad Wildbad
Erfahrungen über mein Praktikum im Johanneshaus Bad Wildbad
11 Johanneshaus Bad Wildbad
Länger fit und selbstständig mit Kognitivem Training nach Stengel
12 Landkreis Calw
Singen begeistert – Chöre als Kulturbotschafter aus dem Landkreis Calw
14 Liebe
Dum spiro spero – Solange ich atme, hoffe ich
16 Bad Wildbad
Wild entschlossen über die Wild Line in Bad Wildbad
18 Musik
Wie wunderbar der Heilige Geist klingt
19 Literatur
Alt werden ist nichts für Feiglinge
20 Ergotherapie
Fatigue und der Ansatz für die Behandlung in der Ergotherapie
22 Ernährung
Mit Pflanzenkraft in den Power-Frühling 2018
23 Natur und Heilkunde
Pestwurz – ein Arzneimittel?
Terminvorschau
15. Juli 2018
Sommerfest des Johanneshauses und der Johannisklinik Bad Wildbad
7. bis 9. Dezember 2018 Winter.Kurpark.Zauber
Der romantische Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Wildbad

Impressum
Herausgeber:
MHT
Gesellschaft für soziale
Dienstleistungen mbH
Hochwiesenhof 5–10
75323 Bad Wildbad
www.mht-dienstleistung.de
www.johanneshaus-bad-wildbad.de
www.johannesklinik-bad-wildbad.de
www.johanneshaus-bad-liebenzell.de
Redaktion:
Gabriele Pawluczyk | Martin Kromer | Wolfgang Waldenmaier
gabriele.pawluczyk @monacare.de
Grafische Umsetzung:
Dagmar Görlitz
kontakt@goerlitz-grafik.com
Drucktechnische Umsetzung: Karl M. Dabringer
dabringer@gmx.at
Auflage: 3.000
nota bene | April – 2018 Seite 2
Inhalt
Liebe Leserinnen und Leser unserer nota bene, nun gehen wir mit dieser Zeitschrift in den 5. Jahrgang. Fünf Jahre mit unterschiedlichen Themen und Ereignissen. Stets ist alles im Fluss, in der Veränderung. Jeder Tag überrascht uns mit neuen bewegenden Momenten, Momenten der Freude oder auch der Herausforderung.
Stets sind es die Herausforderungen, die uns zum NachDenken, Um-denken bewegen. Sie zeigen uns, es will sich etwas verändern, es will sich etwas NEU zeigen. Das ALTE darf verabschiedet, losgelassen werden. Ihm darf für seine Unterstützung in der Vergangenheit von Herzen DANKE gesagt werden. Ohne das Alte stünden wir heute nicht da, wo wir sind.
Gleichzeitig rührt sich etwas Neues. Ein Zauber des Neu anfangs.
Das zeigt sich gerade auch in der Natur. Wir dürfen Zeugen sein, am jährlich wiederkehrenden Zauber des Neuanfangs der Natur, am Frühling. Das Grün fängt wieder an zu wachsen. Die ersten Blumenblätter drücken sich durch die Erde an die durch die ersten wärmenden Sonnenstrahlen erfüllte Luft. Das Zwitschern der Vögel erfüllt wieder den Raum. Auch wir strecken unsere Gesichter den wärmenden Strahlen entgegen und fühlen auf unserer Haut den Genuss des Lichtes, der Helligkeit und Wärme. Der Winter mit der Kälte, Dunkelheit und Ruhe ist vorbei. Der Wandel ist da! Hurra!
Wie sagte bereits Vincent van Gogh: Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frohen Abschied vom Winter und einen zauberhaften Frühlingsanfang – nota bene – wohlgemerkt…
Ihre
Anneli Zenker
Geschäftsführerin MHT

Zum Geleit
Die Umstellung auf die Sommerzeit brachte uns in diesem Jahr den großen Vorteil, abends eine Stunde länger bei Tageslicht Schnee schaufeln zu können. Wer sehnt sich nach diesem langen, kalten und ungemütlich nassen Winter jetzt nicht auf die ersten Frühlingsboten? Ein wenig in der Sonne sitzen, sich an den ersten Blumen und Blüten erfreuen – und Kraft tanken zu können für neue Aufgaben. Und neue Aufgaben warten immer und überall auf uns. In der Arbeit mit und für ältere Menschen haben wir das ganze Jahr Frühling – für den Aufbruch, einerseits Bewährtes zu wahren und andererseits gemeinsam neue Wege zu gehen, ist immer Saison. Die aktuelle Diskussion über den Stellenwert von Pflege zeigt, dass dieses in den nächsten Jahrzehnten weiter dramatisch an Bedeutung gewinnende Thema nun endlich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Noch fehlen die überzeugenden Denkmodelle, noch die dringend erforderlichen Lösungsansätze – aber immerhin, zumindest ist ein Anfang gemacht und wir alle haben es in der Hand, dass die Stimme der Menschen, die oft aufopferungsvoll in der Pflege arbeiten, nicht wieder verstummt. Nutzen wir auch für diesen Einsatz die neue Kraft, die uns der Frühling verleiht. Wie wir mit unseren Alten, Kranken und all den Menschen umgehen, die sich tagein tagaus für deren Belange und Wohlergehen einsetzen – das ist die Messlatte für eine humane Gesellschaft.
Manfred Preuss GlobalConcept.Consult AG



April – 2018 | nota bene Seite 3 Editorial
Editorial
nota bene
Liebe findet ausschließlich durch das Handeln ihren Ausdruck. Das war die feste Überzeugung des Vinzenz von Paul. Sein Wahlspruch „Liebe sei Tat“ ist der Nachwelt durch seine zahlreichen Werke eindrücklich im Gedächtnis.
Vinzenz von Paul –
ein Heiliger gestaltet die Geschichte der Pflege


Geboren wurde der Heilige Vinzenz von Paul am 24. April 1581 in der Gegend um Dax/ Gascogne in Frankreich. In Toulouse studierte er Theologie. Durchaus spannende, abenteuerliche Episoden aus seinem Leben wurden von den Biographen und Forschern überliefert. So wurde er im Jahre 1605 auf der Suche nach kirchlichen Einkommensquellen von türkischen Piraten nach Tunis verschleppt und dort als Sklave verkauft. Nach dreijähriger Gefangenschaft kam er frei und landete über Umwege in

nota bene | April – 2018 Seite 4 Mütter und Väter der Pflege (6)
Paris. Im Jahre 1612 trat Vinzenz eine Pfarrstelle in Clichy an. Danach war er Hauslehrer und Kaplan bei einer reichen Familie. Bei der Inspektion der Güter der Familie Gondi kam Vinzenz von Paul intensiv mit den Sorgen und Nöten der Landbevölkerung in Kontakt.
Die herrschenden Defizite im Umgang mit den Ärmsten und den von Krankheiten Geplagten veranlassten ihn im Jahre 1617, während seiner Zeit als Pfarrer in der Gemeinde von Chatillonles-Dombes, die „Bruderschaft der Damen der christlichen Liebe“ ins Leben zu rufen. Diese Institution verstand sich als Gegenentwurf zu den ansonsten klösterlich organisierten Formen der Krankenpflege und der Armenbetreuung. Der Heilige Vinzenz hat diesen Unterschied mit eigenen Worten folgendermaßen beschrieben:
„ Ihr habt als Kloster die Häuser der Kranken, als Zelle eine Mietkammer, als Kapelle die Pfarrkirche, als Kreuzgang die Straßen der Stadt, als Klausur den Gehorsam, als Gitter die Gottesfurcht und als Schleier die heilige Bescheidenheit.“
Statt eines verpflichtenden Gelübdes, wie im Kloster üblich, gab es eine auf ein Jahr befristete Absprache, die jeweils wieder um ein weiteres Jahr verlängert werden konnte. Diese Verfahrensweise scheint sehr modern und erinnert durchaus an heutige Verträge und Absprachen. Die Damen der christlichen Liebe stammten meist aus besser gestellten Kreisen. Die Arbeit, vor allem in den Brennpunkten wie Paris, war alles andere als leicht. Louise von Marillac, eine der engsten Mitarbeiterinnen von Vinzenz von Paul, machte sich dafür stark, junge Mädchen aus der Provinz anzustellen, die der schweren körperlichen Arbeit durch ihre Erfahrungen mit der Landarbeit eher gewachsen waren. Die Aufgaben der Gemeinschaft beschränkten sich nicht nur auf die Pflege der Kranken
und auf das Betreuen der Ärmsten, sie weiteten sich vielmehr aus auf die Gefangenenfürsorge, die Betreuung sittlich gefährdeter Mädchen und – man höre und staune – die Beaufsichtigung eines Hospizes für ältere Ehepaare. Diese Gemeinschaft war letztendlich die Keimzelle des Ordens der Vinzentinerinnen (Orden der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz), der bis heute besteht
das Mutterhaus ist in Freiburg im Breisgau. In ihrem Logo liest man bis auf den heutigen Tag den Wahlspruch des Vinzenz von Paul: „Liebe handelt“. Vinzenz von Paul verstarb am 27. September 1660 in Paris.
tion der Katholischen Kirche. Die Vinzentinerinnen waren das Vorbild für die Arbeit der Mutter Teresa und ihrer Mitschwestern. Sie legten im neunzehnten Jahrhundert den Grundstein für die Entstehung der deutschen Caritas.

Die Vinzentinerinnen zählen in unseren Tagen zu einer weltweiten Frauenbewegung. Es ist die größte Frauenorganisa-

Im Jahre 1737 wurde Vinzenz von Paul von Papst Clemenz XII. heiliggesprochen. Begründung dafür war zu jener Zeit sein Einsatz für Kranke, Bettler, Findelkinder, verwahrloste Jugendliche, Geisteskranke, Strafgefangene, Flüchtlinge und Vertriebene. Er gilt heutzutage als der Wegbereiter des organisierten sozialen Engagements.
Seine sterblichen Überreste sind heute, eingebettet in ein wächsernes Abbild, in einem Glassarg in der Chapelle Saint-Vincent-de-Paul in Paris als Reliquie ausgestellt. Das Herz des Heiligen Vinzenz wird ebenfalls in Paris, in der Kapelle des Mutterhauses der Vinzentinerinnen aufbewahrt. Sein offizieller Gedenktag ist sein Todestag, der 27. September, und der wird sowohl in der Römisch-Katholischen Kirche als auch in der protestantischen und der anglikanischen Kirche jährlich aufs Neue begangen.
Wolfgang Waldenmaier
April – 2018 | nota bene Seite 5 Mütter und Väter der Pflege (6)
–
Das sehr gut besuchte
9. GeriatrieForum Bad Wildbad der Johannesklinik widmete sich den Themen „Schwindel – Ein großes Problem, nicht nur im Alter“ und „Beinschmerzen – Wenn es kribbelt, brennt und schmerzt“.
Beide Vorträge hielt Jens Heese, Oberarzt der Neurologie und Sektionsleiter Geriatrie am HeliosKlinikum Pforzheim.
Johannesklinik
Bad Wildbad
setzt Akzente

Schwindel ist kein seltenes Problem. 29 % aller Frauen und 17 % aller Männer leiden an Schwindel. Bei hochaltrigen Menschen über 90 Jahren leiden sogar mehr als 50 % unter Schwindel. Eindrücklich stellte Jens Heese fest, wie chronischer Schwindel zu einem dauerhaften Problem für den Betroffenen werden kann: chronischer Schwindel erzeugt Angst, die zu Bewegungseinschränkung führt, was wiederum Muskelabbau zur Folge hat. Letztlich kommt es dann zu
fehlendem Training des Gleichgewichts, was den Schwindel verstärkt. Ein Teufelskreis, dem es zu entkommen gilt.
Im Verlauf wurden die verschiedenen Formen des Schwindels, deren Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten detailliert dargestellt. Hierzu wurden mehrere Fallbeispiele vorgestellt, die eindrücklich die unterschiedlichen Behandlungsansätze aufzeigten.
Eine häufige Form des Schwindels ist der gutartige Lagerungsschwindel, der sehr häufig auch junge Menschen befällt und der erfolgreich durch Lagerungstechniken behandelt werden kann. Diese eindrucksvollen Lagerungstechniken demonstrierte Heese an einem Freiwilligen.
Beinschmerzen sind nach Rückenschmerzen mit 30 % die zweithäufigste Ursache für chronische Schmerzen, erläuterte Jens Heese im zweiten Vortrag. Hervorgehoben wurde, dass es sehr viele Ursachen für Beinschmerzen gibt und es einer genauen Diagnostik bedarf, um die Schmerzen erfolgreich behandeln zu können. Auch wurden
die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten detailliert beschrieben.
Jens Heese ging in seinem Vortrag auch auf die unruhigen Beine ein, das sogenannte „Restless-Leg-Syndrom“. Hierbei handelt es sich um einen häufig nächtlichen Bewegungsdrang, der mit Schmerzen und Gefühlsstörungen einhergeht und der ausschließlich in Ruhe und Entspannung auftritt und durch Bewegung gebessert wird. Ein Phänomen, das viele ältere Menschen kennen und das inzwischen als eigenständiges Krankheitsbild angesehen wird und unter dem ca. 10 % der über 65-Jährigen leidet.
Unter lang anhaltendem Beifall beendete Jens Heese seine Vorträge. Dr. Thomas Müller, Chefarzt der Johannesklinik, wertete das 9. GeriatrieForum als großen Erfolg und zeigte sich hocherfreut von den vielen positiven Rückmeldungen und der großen Teilnehmerzahl: „Die Johannesklinik hat mit ihren GeriatrieForen eine Vortrags- und Diskussionsreihe geschaffen, die von der Fachöffentlichkeit mit Interesse und Engagement angenommen wird.“

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die Auszeichnung der Johannesklinik als einer der besten Rehakliniken im Bereich Geriatrie in Deutschland gewürdigt (Bild von links: Bürgermeister Klaus Mack, Chefarzt Dr. Thomas Müller, PDL Enisa Porcic, Anneli Zenker, Manfred Preuss, Tourismuschef Stefan Köhl).
nota bene | April – 2018 Seite 6 GeriatrieForum
Pflege rückt endlich auch in
den Focus der Politik

Mehr Personal, bessere Bezahlung – die Parteien der neuen Regierungskoalition haben sich auf Maßnahmen zur Verbesserung der Altenund Krankenpflege geeinigt. Doch wie sollen sie umgesetzt werden?
Zu den Berichten über die Einigung von Union und SPD im Bereich Pflege erklärt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:
„Die verlautbarten Ergebnisse im Bereich Pflege weisen darauf hin, dass sich zu den Sondierungsergebnissen keine großartigen Veränderungen ergeben haben. Wenn das stimmt, dann
Weitere Stimmen zum Thema:
Der Sozialverband VdK nannte eine bessere Bezahlung von Pflegern längst überfällig. „Die Mehrkosten für bessere Bezahlung und mehr Personal dürfen aber nicht dazu führen, dass die Eigenanteile von Pflegebedürftigen weiter steigen.“
Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält die Einigung auf 8.000 zusätzliche Pflegekräfte für „nicht ausreichend, um den Pflegenotstand wirksam zu beheben.“ Er schätzt den Bedarf an zusätzlichem Personal auf rd. 100.000 Pflegekräfte.
Lesen Sie auch den Kommentar zu diesem Thema auf Seite 21.
ist das enttäuschend. Wir wollen gute Pflege mit gutem Personal zu fairen Bedingungen. Das will wohl auch die Große Koalition, sie sagt aber nicht, wer das finanzieren soll. Zahlt das der Versicherte über höhere Beiträge zur Pflegeversicherung? Zahlen das die Steuerzahler über einen Steuerzuschuss in die Pflegeversicherung? Oder sind am Ende die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen sowie die Kommunen die Dummen, die das über höhere Eigenanteile berappen müssen? Diese Frage bleibt komplett offen.
Genauso schwerwiegend ist aber auch die Frage, wo die Fachkräfte herkommen sollen, die schon heute fehlen? Sicherlich werden Maßnahmen wie eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm, eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten sowie eine Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften für etwas Linderung sorgen. Es wird aber keinesfalls ausreichen. Dazu muss dringend auch eine erleichterte Zuwanderung aus Drittstaaten kommen. Zudem brauchen wir endlich eine flexiblere Handhabung der starren Fachkraftquote, die Ressourcen bindet, die eigentlich schon gar nicht mehr vorhanden sind.“
April – 2018 | nota bene Seite 7 Pflege und Politik



„Die Schönheit und der Glanz früher Jahrhunderte erschließen sich in Bad Liebenzell wohl erst auf den zweiten und dritten Blick“, erklärt Barbara Schmidtke, Initiatorin, Autorin und Re -
und obere Bad Liebenzell, bevor sie sich an frisch zubereiteter Hausmannskost im alten „Gasthaus zur Linde“ laben. Der heutige Kulturtreff Bürgerhaus ist das Domizil des Freien The -
Die Lindenwirtin Erlebnistheater in Bad Liebenzell

gisseurin des kultigen Theaterstücks, das im Mai des vergangenen Jahres

Premiere feierte. Das ungewöhnliche Theater-Konzept bietet Gästen einen Nachmittag, der alle Sinne anspricht. Ein Unterhaltungsstück bei dem man sehen, hören, riechen und schmecken kann, genügte der leidenschaftlichen Theatermacherin allerdings nicht, um ihre liebgewonnene Heimat zu präsentieren. Zum Auftakt der Veranstaltung erleben die Besucher daher eine historische Stadtführung durch das untere
aters und hier beginnt im historischen Saal des Gasthauses der zweite und da-


nota bene | April – 2018 Seite 8
mit offizielle Teil des Theaterstücks zur „Lindenwirtin“.
In Zusammenarbeit mit der Kurstadt wurde ein Schauspiel mit Musik und Erlebnisgastronomie an authentischem Ort entwickelt, bei dem die Besucher einen Einblick in die „gute alte Zeit“ bekommen, in der unsere Ur-Großeltern selbst noch Kinder waren. Mit viel Liebe zum Detail und ungewöhnlich feinteiligen Recherchen werden Liebenzeller Originale aus der Wilhelminischen Zeit zum Leben erweckt und dem Zuschauer mit ihren Vorlieben und Besonderheiten vorgestellt. Da-

zu hat sich Barbara Schmidtke in eine waschechte Berlinerin verwandelt. Mit Hemdbluse und Handtasche reist sie alias Clara Wortmann vom Berliner Boulevard „Unter den Linden“ zur Sommerfrische in den Schwarzwald. Im alten Ortskern von Liebenzell findet sie Quartier im „Gasthaus zur Linde“ und erlebt hier sonnige Tage fernab der großen Weltgeschichte. Sie taucht ein

in den Mikrokosmos der Jahrhundertwende und nimmt regen Anteil an dem Alltagsleben von Bürgern, Dienstboten und der resoluten Lindenwirtin vor absolut authentischer Kulisse in Liebenzells schönstem Jugendstilsaal.
1904 hatte der württembergische König Wilhelm II. den Ort besucht und davon profitierte Liebenzell zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der zunehmenden Reiselust der Städter. Szenen daraus sind in der „Lindenwirtin“ durchaus originalgetreu wiedergegeben, denn zum geselligen Beisammensein trifft sich die Gesellschaft im Gasthaus mit
Spieltermine für die Lindenwirtin:
29.04.2018 – 16.00 Uhr
27.05.2018 – 16.00 Uhr
12.08.2018 – 16.00 Uhr
30.09.2018 – 15.00 Uhr
21.10.2018 – 15.00 Uhr
Karte: 35,– Euro inkl. Stadtführung und Menü, Getränke werden separat berechnet. Reservierung über www.reservix.de oder
im Servicecenter Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2–4, 75378 Bad Liebenzell
Telefon: 07052/408–0

der eigenen Brauerei. Im Kommunikationszentrum der Stadt wird gut bürgerlich aufgetischt und ein süffiges Helles vom Lindenbräu gezapft. Bier hatte damals deutlich weniger Alkoholgehalt als heute und zählte somit zu einem Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung. In der Wirtschaft fühlte sich auch der „Ledrebatsch“ wohl, der sich mit seinem ausgeprägten Selbstbewusstsein


und schlagfertigem Witz im Gedächtnis der Liebenzeller eingeprägt hat. Mit seiner Sprache, Mimik und Gestik charakterisiert Daniel Bock diese Figur aus der damaligen Zeit, die ihm buchstäblich auf den „Leib geschrieben“ ist. Der Geschmack des Gerstensaftes lockt ihn zu ausgiebigen Besuchen in den Gasthof und während er mit der Lindenwirtin liebäugelt, macht ihm die neu angereiste Berlinerin schöne Augen.
Wer eintauchen möchte in die Zeit der Sommerfrische, die vor über 100 Jahren vornehmlich zum adeligen und großbürgerlichen Sommervergnügen zählte, kann das Freie Theater Bad Liebenzell in zwei Akten erleben und einen vergnüglichen Nachmittag mit allen Sinnen genießen.
Sabine Zoller
April – 2018 | nota bene Seite 9 Bad Liebenzell
Fotos: Sabine Zoller
Erfahrungen
über mein Praktikum im Johanneshaus Bad Wildbad

Zu meiner Person
Ich bin 20 Jahre alt und komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier, zeichne und koche sehr gerne mit Freunden. Nach dem Abitur habe ich zunächst einen einjährigen Freiwilligendienst in Ecuador absolviert. Während dieser Zeit konnte ich sehr viele Eindrücke über eine gänzlich andere Kultur bekommen und habe festgestellt, dass ich in meinem späteren Beruf etwas Soziales erlernen möchte. So bin ich anschließend nach Ulm gezogen, wo ich aktuell im dritten Semester Psychologie studiere.
Warum ein Praktikum?
Im letzten Jahr an der Universität habe ich vor allem sehr viel theoretischen Input bekommen. Deshalb wollte ich unbedingt auch die andere Seite, also das tatsächliche Arbeitsleben eines Psychologen kennen lernen. Bei meiner Recherche stieß ich auf das Johanneshaus und war dabei von den vielfälti-
gen Therapieangeboten, aber auch von der vorgestellten Philosophie äußerst angetan. So war es schnell entschieden, dass ich zwei Sommermonate im wunderschönen Bad Wildbad verbringen würde.
Mein Arbeitsalltag im Johanneshaus
Während meines achtwöchigen Praktikums durfte ich zunächst in die verschiedenen Therapiebereiche schnuppern. Des Weiteren durfte ich die Pflege und auch den Alltag der Heimleitung kennenlernen. Jeder Bereich war dabei auf seine Weise eine bereichernde Erfahrung für mich. Meine Aufgabe war es zunächst, zu beobachten, in Kontakt mit den Bewohnern zu treten und auch an den Therapieangeboten mitzuwirken. Schließlich durfte ich auch selbst kleine Projekte, wie etwa die Rekrutierung von Bewohnern für die Heimbeiratswahl, übernehmen. Außerdem konnte ich mit einigen Bewohnern Biographiearbeit machen, was mich sehr fasziniert, aber auch mitgenommen hat und daher besonders einprägsam für mich war. Stets begleitet, im direkten und übertragenen Sinn, wurde ich dabei von Frau Heimerdinger, der Psychologin und meiner Mentorin.
Was habe ich mitgenommen?
Neben sehr vielen Eindrücken habe ich vor allem gelernt, die Wichtigkeit der ruhigen Momente zu verstehen. Es war ein kleiner „Kultursprung“ vom leistungsorientierten Universitätsalltag hin zu einer Langzeitpflegeeinrichtung für chronisch psychisch Kranke, in der es entscheidend ist, sich Zeit zu nehmen. Damit meine ich, dass es sehr wichtig ist, z. B. ein „Schwätzchen“ mit einem Bewohner zu halten oder sich einmal eine Weile daneben zu setzen. Die Bindung, die dabei entsteht, ist, wie ich finde, das entscheidende Gut aller Mitarbeiter für ihre Tätigkeit im Johanneshaus. Von meiner letzten Woche ist mir noch ein sehr schönes Er-
lebnis präsent, das dies ganz gut veranschaulicht: Ich habe mich einfach mal ans Klavier gesetzt und ein wenig gespielt und ein paar Bewohner haben zugehört. Schließlich kam ein Bewohner dazu und zeigte begeistert seine Musikbox, auf der er jede Menge klassischer Lieder hatte, und fragte, ob er diese abspielen dürfe. So spielte er sie ab und die anderen hörten zu. Es war ein sehr friedlicher und bedeutsamer Moment für mich.
Insgesamt kann ich sagen, dass mir die Zeit für meine persönliche Entwicklung sehr viel gebracht hat. Ich glaube, erst im Praktikum habe ich verstanden, was es wirklich heißt, wenn jemand psychisch krank ist. Auch habe ich viel über Arbeitsstrukturen und damit verbundenen Problemen und Lösungsansätzen gelernt. Und ich wurde letztlich in meinem Wunsch, Psychologie zu studieren, bestärkt.
Ein kurzer Dank:
Vielen Dank zunächst an die Bewohner, die oftmals sehr nachsichtig mit mir waren und mir mit Freundlichkeit und Neugier begegnet sind. Danke auch an alle Mitarbeiter, die mir so viel Einblick in ihren Arbeitsalltag gewährt haben und all meine Fragen beantworteten.
Und nun?
Im Moment sitze ich im PC Pool der Universität Ulm, schaue nach draußen und sehe das triste Novemberwetter, das leider viel zu nebelig ist. Aber ich genieße es wirklich, wieder unter meinen Kommilitonen zu sein und neue Vorlesungen und Seminare zu besuchen. Es gibt noch so viel zu lernen! Und öfters einmal denke ich an all die Menschen im Johanneshaus zurück und an die Zeit, die ich mit Ihnen verbringen durfte…
Clara Hertneck
(Den ausführlichen Bericht finden Sie unter www.johanneshaus-bad-wildbad.de)
nota bene | April – 2018 Seite 10 Johanneshaus Bad Wildbad
Das Kognitive Training nach Dr. med. Franziska Stengel ist ein sozialkommunikatives und gesundheitsorientiertes Training kognitiver Funktionen, wie Konzentration und Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Denken, Sprache und aller Gedächtnissysteme. Dabei werden Inhalte und Fragestellungen aus dem täglichen Leben gegriffen. Entwickelt wurde die Trainingsmethode von der österreichischen Ärztin, Psychologin und Soziologin Dr. med. Franziska Stengel. Kognitives Training nach Stengel wird von ausgebildeten Fachtherapeuten durchgeführt.
Hirnleistungstraining umfasst das Training kognitiver Funktionen, wie z. B. Konzentration, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Problemlösung. Dabei ist das Kognitive Training kein Selbstzweck, sondern verfolgt komplexe therapeutische Ziele, wie das Erlangen der Grundarbeitsfähigkeiten, die unter anderem verbunden sind mit einer Verbesserung der eigenständigen Lebensführung, der Selbstständigkeit, der Belastungsfähigkeit und auch des situationsgerechten Verhaltens. Kognitives Training wird auch im Rahmen der psychisch-funktionellen Behandlung zur Verbesserung und Stabilisierung der psychischen Grundleistungsfunktionen, wie Antrieb und Belastbarkeit, angewandt. Die Stengel-Methode fördert darüber hinaus die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Interaktionsfähigkeit, die sozio-emotionale Kompetenz und das Selbstvertrauen.
Aus ärztlicher Sicht ist die Anwendung evaluierter Therapieverfahren, also auf ihre Wirksamkeit hin wissenschaftlich überprüfter Verfahren, auch und gerade im Bereich Hirnleistungstraining unabdingbar. Nur evaluierte Therapieverfahren gewährleisten das notwendige Maß an Therapiesicherheit, d. h. dass das angestrebte therapeutische Ziel mit den gewählten Mitteln und Methoden auch erreicht werden kann.

Länger fit und selbstständig mit Kognitivem Training nach Stengel
Das Kognitive Training nach Dr. med. Franziska Stengel ist wirksam und mehrfach wissenschaftlich überprüft. Es enthält eine autonomiezentrierte Pädagogik, eine Methodik der Übungsauswahl und umfangreiches Therapiematerial. Alle therapeutischen Standards werden bei diesem Therapieverfahren eingehalten, wie z. B. keine Zeitvorgaben, kein Leistungsdruck, kein schulisches, quizartiges Vorgehen, vertiefte Informationsverarbeitung und Verwendung von sinnhaftem Material. Eine spezielle Fragetechnik ermöglicht das therapeutisch geleitete, selbstständige Erfassen von Zusammenhängen und verhindert jegliches abfragendes Vorgehen. Das Material in allen Schwierigkeitsgraden besteht aus dem alltäglichen Leben und führt bei den Patienten zu neuen Erkenntnissen und Aha-Erlebnissen. Nicht die richtige Lösung ist das vorrangige Ziel, sondern das Spekulieren, Diskutieren und gemeinsame partnerschaftliche Überlegen. Pädagogische
Literaturhinweise:
Grundsätze wie „Jeder beteiligt sich, wie er möchte“, „Jeder ist Lehrer und Lernender zugleich“ ermöglichen besondere kognitiv und sozial anregende und stützende gruppendynamische Prozesse. Das Training wird als gruppentherapeutische Maßnahme, aber auch als Einzeltherapie durchgeführt.
In einer Studie (CoTraP) konnte nachgewiesen werden, dass Kognitives Training nach Stengel nicht allein kognitive Funktionen fördert, sondern auch schmerzlindernd und befindlichkeitsbessernd wirkt sowie Gesundheitszustand und Lebensqualität positiv beeinflusst. Bei Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparates kann es die Klinikverweildauer bei besserer Befindlichkeit und größerer Schmerzlinderung verringern.
Jasmin Artmann (2017 Weiterbildung zur Fachtherapeutin für Kognitives Training)
Ergopraxis 05/08 von S. Ladner-Merz Ergotherapie & Rehabilitation 05/02 von S. Ladner-Merz, A. Konzelmann, S. Danz
April – 2018 | nota bene Seite 11 Johanneshaus Bad Wildbad
Zwei über alle Maßen bekannte Institutionen sind im Landkreis Calw beheimatet und liegen nur knapp dreißig Kilometer voneinander entfernt. Gemeint sind die Knabenund Jugendchöre aus Calw und Altensteig, die als Kulturbotschafter den Nordschwarzwald im In- und Ausland vertreten.
Aurelius Sängerknaben Calw
Dass Singen als Wundermittel zum Jungbleiben zählt, beweist Deutschlands Chor-Legende Gotthilf Fischer. Im Februar 2018 feierte der „Herr der singenden Heerscharen“ seinen 90. Geburtstag und auch in Calw bestätigen die Aurelius Sängerknaben, dass „Singen die beste Medizin“ ist, die Gesundheit fördert und einfach „zu einem guten Leben dazugehört“. Perfekte Intonation, harmonischer Zusammenklang, brillante Phrasierungen und klare Stimmen werden dem Chorgesang der Aurelianer zugeordnet, die auf Aurelius, den ersten Patron des Klosters Hirsau in Calw verweisen, das im 8. Jahrhundert nach Christus erbaut wurde. Da über Jahrhunderte hinweg Klöster entscheidende Impulse für die abendländische Kultur gegeben haben, pflegen die Sängerknaben auch

heute die Tradition der geistlichen und weltlichen Chormusik in verschiedensten Besetzungen. Mittlerweile hat sich der 1983 gegründete Knabenchor zu

Singen ist die Antwort auf alle Fragen, die das Leben stellt, ist Glück für heute, Hoffnung für morgen“
(Gotthilf Fischer, Leiter der FischerChöre)
Singen begeistert –Chöre als Kulturbotschafter aus dem Landkreis Calw


einem gefragten Klangkörper entwickelt, der nicht nur vor dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, Joachim Gauck, sondern auch vor ge-
krönten Häuptern, wie der schwedischen Königin Silvia, gesungen hat. Rund vierzig glockenklare Knabenstimmen unter Leitung von Bernhard Kug-
nota bene | April – 2018 Seite 12

Christophorus-Kantorei Altensteig
Zu einem Konzertchor „mit erlesenem Klang“ zählt das nur knapp dreißig Kilometer von Calw entfernte und mit Goldmedaillen mehrfach prämierte Ensemble der Christophorus-Kantorei Altensteig. 1962 im Auftrag von Arnold Dannemann, dem damaligen Präsidenten des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland, gegründet, besteht die Christophorus-Kantorei aus einem gemischten Jugendchor des Christophorus-Musikgymnasiums Altensteig, das seinen rund 580 Schülerinnen und Schülern Musik als wichtigen Teil an der schulischen Ausbildung vermittelt. Das einzigartige an diesem Konzertchor besteht darin, dass alle Mädchen- und Männerstimmen im Alter von 13 bis 18 Jahren in dieser einen Schule unterrichtet werden. Das breit gefächerte

ler begeisterten auf der Blumeninsel Mainau bei einem Festakt zur schwedi-
schen Kinderstiftung „World Childhood Foundation“. Die Aurelius Knaben werden schon früh in Gesang und Stimmbildung unterrichtet. Als Sänger des Nachwuchschores besuchen sie bei ihrem ersten Konzertauftritt in der Regel die 4. Klasse der Grundschule. Wer sich stimmlich gut entwickelt, kann in den Konzertchor wechseln und als Solist in verschiedenen Opernhäusern im In- und Ausland auftreten oder mit dem Konzertchor international auf Konzertreisen gehen.


Repertoire umfasst geistliche und weltliche Chormusik sowie Aufführungen oratorischer Werke, Opern und Musicals. Unter der künstlerischen Leitung
von Michael Nonnenmann und Friederike Rademann (Choreografie) begeisterte an Ostern 2018 die Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Das konzertante Werk bot nicht nur szenische Darbietungen sondern zudem eine bildhafte Umsetzung des Textes mit ausdrucksvollem Tanz. Zur Freude aller Mitwirkenden geht es in den Pfingstferien auf eine zweiwöchige Tournee. Während der Chor in den vergangenen Jahren nach Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Spanien, Irland, in die USA und nach Neuseeland gereist ist, ist die Reiseroute des 50-köpfigen Ensembles 2018 über Ungarn und Kroatien nach Albanien geplant, um dort an Wettbewerben teilzunehmen.


April – 2018 | nota bene Seite 13 Landkreis Calw
Sabine Zoller
Fotos: Sabine Zoller
Es war ein grauer, wolkenverhangener Mittwochnachmittag Anfang Dezember. Ich hatte mir gerade eine Tasse Tee gemacht und mich auf mein neues Buch gefreut, das schon auf dem Sofa bereit lag, als ob es auf mich warten würde. Gerade als das Wasser kochte, klingelte mein Telefon. Es war mein Freund. Ich wunderte mich, dass er so früh schon anrief, freute mich aber immer, seine Stimme zu hören. Er müsse mir etwas sagen, er habe es gerade von einem seiner engsten Freunde erfahren. Gestern Abend kam die frisch Verlobte von einem von Ihnen, bei einem tragischen Autounfall ums Leben.
Und jetzt? Was kommt jetzt? Nach dem Schock, der Wut, der unendlichen Trauer, der großen Leere. Man macht einfach weiter. Der Alltag hört nicht auf, nur weil ein Mensch nicht mehr da ist. Egal, wie wichtig dieser Mensch war. Man geht in die Arbeit, man kümmert sich um den Haushalt, man hält seine Liebsten etwas länger und stärker fest als sonst und dann kocht man das Abendessen. Natürlich ist das Thema Tod gerade in so einer Zeit omni-

präsent. Man redet mit Freunden darüber, mit seinen Eltern, den Verwandten. Egal wo man hingeht, man wird daran erinnert. Die Schlagzeilen an den Zeitungsständen, die Plakate an der Autobahn, die vor zu schnellem Fahren warnen, die Kriegs- und Anschlagsmeldungen im Radio. Normalerweise ist

man abgestumpft – diesen Themen gegenüber. Man registriert sie, schüttelt traurig den Kopf, nimmt sich vor, das nächste Mal doch wieder etwas mehr

für Amnesty International zu spenden und hofft, mit ein wenig schlechtem Gewissen, dass es die eigene Familie nie treffen wird.
Aber was ist mit der Hoffnung? Dem Glauben an das Gute? Dem kindlichen Vertrauen in das Morgen? Morgen ist
alles besser. Morgen tut es nicht mehr so weh, morgen ist sie bestimmt wieder da, morgen wird wieder ein schöner Tag. Dem reinen Gottvertrauen? Die eigenen Sorgen und Ängste in Gottes Hand zu legen und darauf zu vertrauen, dass Er es wieder gut macht? Aber was kann Er wieder gut machen, wenn einem das Wichtigste genommen wird? Der Ehepartner, das eigene Kind, die beste Freundin, die Geschwister oder die Eltern. Er kann Sie ja nicht einfach wiederbeleben, den Tod rückgängig ma-

nota bene | April – 2018 Seite 14

chen und Sie ewig leben lassen. Oder doch? Was wäre, wenn man die Auferstehung nicht wörtlich nimmt, sondern als eine Metapher für das Überdauern der Liebe sogar über den Tod hinaus?
„Amor vincit Omnia“
„Die Liebe besiegt Alles“ (Virgil)
Natürlich bleibt die Art der Liebe nicht gleich, doch wenn der schlimmste Schmerz nachlässt, kann man überall Spuren der Liebe entdecken. In den Umarmungen der Freunde, die für einen da sind, dem 273. Kuchen der Nachbarn, dem Lächeln eines Kindes, wenn man auf dem Weg in die Arbeit ist, oder dem sanften Wind, der einem die Wange küsst. In den geteilten Erinnerungen an die glückliche Zeit, als der Andere noch da war, das Anstoßen auf der Trauerfeier und dem Seitenstechen verursachenden Gelächter, wenn man sich an gemeinsame Schandtaten erinnert.
Die Beerdigung unserer Freundin war zwei Monate später an einem eiskalten Donnerstagnachmittag auf einem Waldfriedhof in der Mitte der Stadt. Würde ich ein Buch schreiben und müsste eine Beerdigungsszene inszenieren, hätte ich diesen Tag genauso beschrieben, wie er tatsächlich stattfand.
„Es war ein trister Nachmittag. Egal wo man hinsah, waren nur Weiß- und Grautöne. Die Wiesen, Bäume und Straßen waren schneebedeckt und dämpften die Alltagsgeräusche auf eine fast unaushaltbare Stille. Der Schnee fiel an diesem Tag auch nicht zur Erde, er schwebte wie in Zeitlupe zu Boden und verwandelte die Luft in eine flirrende Masse aus unwirklicher, kalter Schönheit. Der Wind war nicht zu spüren und doch tönte leise an einem der Bäume ein kleines Glockenspiel, als würde es die Trauerzeremonie begleiten wollen. Wir standen in einem großen Kreis um die

kleine Eiche herum, unter der Sie Ihre letzte Ruhe finden sollte. Immer noch schneite es und der Himmel war grau und undurchdringlich wie Stein. Das passende Wetter für so eine Beerdigung, dachte ich. Der Pastor sprach ein paar letzte Worte, die ich durch das Dröhnen der Stille um uns herum nicht verstand, oder nicht verstehen wollte. Die Gesichter der restlichen Trauergesellschaft waren so weiß und unbewegt wie die Landschaft um uns herum. Selbst das Glockenspiel war
verstummt. Und dann trat ihr Verlobter an dieses kleine Erdloch unter dem kleinen Baum und sank auf die Knie, tränenleer und doch mit so viel Liebe im Gesicht, dass es einem fast das Herz zerriss. Er legte Ihr seinen Verlobungsring ins Grab und neigte den Kopf, als ob er ein letztes Mal mit ihr Zwiesprache halten wolle. In genau diesem Moment öffnete sich der Himmel ein wenig und es brach ein einzelner Sonnenstrahl aus der Wolkendecke hervor und tauchte ihn in goldenes Licht.“
Man kann diesen Moment als Zufall bezeichnen. Oder man kann ihn als Hoffnungsschimmer nehmen. Als Hoffnung darauf, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Dass wir durch den Tod nicht von denen getrennt werden, die uns so wichtig sind. Sondern, dass die reine Liebe immer ein Teil von uns bleiben wird und in allen zufälligen, unmögli-

chen und vielleicht auch genau in den richtigen Situationen für uns sichtbar wird.
„Dum spiro spero. Dum spero amo. Dum amo vivo“
„Solange ich atme, hoffe ich. Solange ich hoffe, liebe ich. Solange ich liebe, lebe ich.“ (Cicero)
Felicitas Steckler
(mit Bildern von Matthias Kanisch)
April – 2018 | nota bene Seite 15 Liebe
Wer noch nie auf einer Fußgänger-Hängebrücke war, kann sich nur schwer vorstellen, welche Mischung aus purem Naturerlebnis, Spannung und Freiheitsgefühl ihn dort erwartet. Ein Player der ersten Stunde im Bereich Hängebrückenbau ist die Firma Eberhardt aus Hohentengen, Spezialist für Bewehrungsbau und Bauwerke, die einen besonderen Charm haben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es Günter Eberhardt und sein Team nach Bad Wildbad hingezogen hat, um dort eine neuartige Hängebrückenkonstruktion umzusetzen.
Die neue Hängebrücke in Bad Wildbad:
daher das Ende der Brücke noch nicht ein. Das macht die Begehung so interessant,“ beschreibt Roland Haag, Projektleiter des derzeit noch im Bau befindlichen Projekts.
Eine weitere Besonderheit wird die Aufhängung sein, die durch 2 Stahlseile realisiert wird. Über eine Länge von 380 m hängt die gesamte 1,20 Meter breite Brücke nur an diesen beiden Stahlseilen. Der Brückenverlauf beginnt im Bereich Auchhalder Kopfweg und führt zum Herrmannsweg im
Es braucht wilde Entschlossenheit, über diese Brücke zu gehen, die nicht ohne Grund den Namen Wild Line tragen und ein neue Attraktion der Kurstadt werden wird.
Wild entschlossen
über die Wild Line in Bad Wildbad
„Die Brücke wird absolut einmalig in der Art der Ausführung werden und schon allein deshalb ein spannendes Erlebnis für Besucher bieten: Die Wild Line wird nach oben verspannt werden und

so liegt der höchste Punkt der 380 m langen Brücke in etwa 60 m Höhe über dem Grund in der Brückenmitte. Die Besucher blicken also beim Eintritt in die Brücke auf einen leichten Anstieg der filigranen Konstruktion und sehen
Bereich Gleitschirmflieger-Schutzhütte. Der Clou dabei: Die Brücke wird sich ganzheitlich in das Ensemble von Naturparadies mit Baumwipfelpfad und Sommerbergbahn integrieren.

„In Bad Wildbad geschieht derzeit sehr viel, was das Tourismus-Konzept und die Vermarktung angeht. Wir haben



daher von Anbeginn der ersten Gespräche darauf geachtet, dass sich die Brücke optimal in das Gesamtkonzept integrieren wird. So gibt es z. B. einen Märchenpfad im Bereich zwischen Baumwipfelpfad und Wild Line, ausgerichtet nach dem Märchen „Das kalte Herz“.
nota bene | April – 2018 Seite 16 Bad Wildbad


Im Verlauf der Geschichte kommt es zu einer Entscheidung zwischen dem sicheren Weg und dem Weg der Mutigen. Letzterer wird über die Wild Line führen, wobei sich alle Besucher, diejenigen die den sicheren Weg gehen, und die Wild Line Bezwinger am anderen
Ende wieder gemeinsam treffen können. Beide Wege werden am gleichen Punkt enden“, sagt Stefan Walliser, Marketing Verantwortlicher des Wild Line Projektes.
„Für mich bedeutet der Bau von Hängebrücken mehr als nur das Bauwerk, das man physikalisch sieht. Eine Hängebrücke steht für mich für Vertrauen und Mut – in das Bauwerk und diejenigen, die es gemeinsam realisieren. Brücken verbinden voneinander getrennte Punkte und die Menschen gehen zusammen darüber oder aufeinander zu. Die Wild Line hat den besonderen Charm, dass man jeweils das andere Ende der Brücke noch nicht sehen kann und auf der Brücke dann gemeinsam

neue Blickwinkel und Eindrücke über die wunderschöne Natur und Ortschaft in Bad Wildbad hat“ schwärmt Investor Günter Eberhardt.
Die Wild Line wird ein weiterer Besuchermagnet in Bad Wildbad werden und soll alle Bereiche, Tourismus, Gastronomie, Hotellerie und Handel gleichermaßen fördern, so der Plan von Roland Haag und Bürgermeister Mack. Die Eröffnung ist bereits Pfingsten 2018 geplant und die Beteiligten arbeiten mit Nachdruck an der Realisierung.
red
(mit freundlicher Unterstützung der Wild Line Projektgruppe)
Technische Daten WildLine
0 Ca. 500 Laufmeter Anker und Pfähle
0 2 St. Tragseile Durchmesser 75 mm, Mindestbruchkraft 562 t pro Seil
0 Ca. 70.000 St. Stahlbau-Einzelteile
0 Ca. 11.000 Meter Schweißnähte
0 Ca. 4.300 Laufmeter tragende Seile (ohne Geländerseile)
0 Alle Seillitzen der tragenden Seile aneinandergelegt, ergeben eine Länge von ca. 930 km (Luftlinie Berlin-London)
Pro Brückenkopf zwei jeweils 2,5 Tonnen schwere Kraftumlenkeplatten mit 4 Erdankern, die jeweils auf 100 Tonnen Zug ausgelegt sind.
0 Gesamtlänge Brücke 380 m
0 Brückenpfeiler +24,5 m
0 Laufstegbreite 1,20 m
0 Tragkraft: 600 Personen zugelassen –nur 300 Personen (Wohlfühleffekt)
Alle Seile aneinander gereiht: Litzen und Abspannseile insgesamt 934,3 km
Das Seil würde LUFTLINIE Hamburg bis Mailand oder Frankfurt bis Rom reichen. An ein Tragseil können 6 Eisenbahnloks gehängt werden ohne zu reißen, so eine Lok 84 t hat.
0 Tragseile: 2 Stk
0 Durchmesser 75 mm
0 Länge: je 380 m
0 Gewicht: je 13 t
0 Windseil: 1 Stk
0 Durchmesser 40 mm
0 Länge: 295 m
0 Gewicht: 3 t
0 Höhe der Stahlpylone: 24,5 m
0 Gewicht der Stahlpylone: je 41 t (Summe 82 t)
April – 2018 | nota bene Seite 17 Bad Wildbad
Wie wunderbar der Heilige Geist klingt
Eine Bachkantate zu Pfingsten

Das Pfingstfest ist das letzte der drei christlichen Hochfeste im Laufe des liturgischen Kirchenjahres. Das Fest der Geistsendung, als eigenständiger kirchlicher Feier- und Festtag, fand seinen Ursprung Ende des 4. Jahrhunderts. Pfingsten bildet den Abschluss des Osterfestkreises, der am Sonntag Septuagesimae seinen Anfang nahm. Die Feier der Sendung des Heiligen Geistes, als Teil der Dreieinigkeit Gottes, stellt natürlicherweise eine für die Christenheit immens wichtige theologische Säule des religiösen Lebens dar. Zu diesem hohen Fest hat uns Johann Sebastian Bach ganz selbstverständlich einen großen Schatz kirchenmusikalischer Werke geschenkt.
Hier nun daraus eine Kantate, und zwar das am 29. Mai 1724 erstmals aufgeführte Werk Erhöhtes Fleisch und Blut, BWV 173 Diese Pfingstkantate gehört zum ersten Leipziger Jahrgang, hat aber ihren Ursprung in der zwei Jahre vorher entstandenen Köthener Glückwunschkantate Durchlauchtester Leopold, BWV 173a Wir haben hier ein typisches Beispiel aus Johann Sebastian Bachs Parodierpraxis. Der Meister übernimmt die ersten fünf Sätze aus BWV 173a, fügt den passenden sakralen Text ein, mischt die Reihenfol-
ge der Gesangssolisten neu und hängt einen Pfingstchoral als Schluss-Satz an. Hier das Ergebnis: Nach dem EingangsRezitativ der Tenorstimme erklingt in vornehm schreitender, höfisch anmutender Manier die Tenorarie „Ein geheiligtes Gemüte“. Gleich anschließend hören wir die Altarie in Begleitung der Streicher und des Bc.-Instrumentariums: „Gott will, o ihr Menschenkinder“. Dann folgt etwas ganz und gar Besonderes, nämlich ein dreistrophiges Arioso, eigentlich schon ein Kunstlied, das sich Sopran und Bass miteinander teilen. „So hat Gott die Welt geliebt“ beginnt mit der Bass-Stimme. Die zweite Strophe (Sopran) wird durch ein herrliches Zwischenspiel der begleitenden Flöten und dem Basso continuo eingeleitet. Das Zwischenspiel vor der dritten Strophe – einem Duett – erhält eine dramatische Forcierung durch den plötzlichen Einsatz der Streicher. Den fünften Satz, das Rezitativ für Sopran und Tenor, hat Bach fast nahtlos aus der Köthener Profankantate übernommen. Der Unterschied: bei BWV 173a heißt es: „Durchlauchtigster, den Anhalt Vater nennt“; in unsrer Pfingstkantate lautet der Text: „Unendlichster, den man doch Vater nennt“. Im Schlusschoral kommt dann der alles durchdringende Pfingstgedanke, eingebettet in das spielerisch wogende Gesamtinstrumentarium, in vollem Glanz zum Tragen.
Wolfgang Waldenmaier
CD-Tipps:
Cantatas BWV 172-175;
Bach-Kollegium Stuttgart, Helmuth Rilling; Hänssler ,2000
Cantatas BWV 34, 173, 184, 129; La Petit Bande; Sigiswald Kuijken; Accent, 2012
Cantatas BWV 147, 173, 181; Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman; Erato, 1999
nota bene | April – 2018 Seite 18 Musik
Alt werden ist nichts für Feiglinge
Wie wir unsere Eltern im Alter begleiten können
In ihrem Wegweiser „Nicht mehr wie immer“ gibt Katja Werheid erwachsenen Kindern, oft selbst schon dem Rentenalter nahe gekommen, Tipps im Umgang mit alternden Eltern. Katja Werheid, geb. 1969, lehrt in Berlin Neuropsychologie und Alterspsychotherapie und forscht mit Schlaganfall- und Demenzpatienten und deren Angehörigen. Aus dieser Arbeit heraus entstand das Buch, das unterschiedlichste Aspekte des Alterns beleuchtet und bisweilen humorvoll und mit einem Augenzwinkern Hilfestellung im Umgang damit gibt. Zum Beispiel wenn von der 87-jährigen Großmutter Waltraud berichtet wird, die ihre Enkelin, inzwischen schon Mitte 40 und damit längst erwachsen, seit Jahrzehnten während ihrer Besuche mit Buttercremetorte verwöhnt, weil sie die doch als Kind immer so gerne mochte. Heute würde die Enkelin etwas anderes bevorzugen. Etwas, das leichter verdaulich und für die Großmutter weniger beschwerlich herzustellen wäre. Doch keiner von beiden wagt es, dieses anzusprechen – aus der Sorge heraus, den anderen zu enttäuschen. Oder vielleicht, weil sich im tiefsten Inneren beide wünschen, es bliebe alles eben so wie immer. Was hier so banal klingt, ist doch oft die Problematik: In unserer multimedialen Zeit mit tausenderlei Kommunikationswegen scheint die Kommunikation in den engsten familiären Beziehungen oft am wenigsten zu gelingen, wie eben zwischen alternden Eltern und erwachsenen Kindern. Welche Hindernisse oder Gegenspieler da auftreten können, wie man diese auflösen oder damit Frieden schließen und weiterleben kann, wird in dem Buch beschrieben. Dabei kommt die Autorin

ganz ohne erhobenen Zeigefinger aus, zeigt vielmehr Verständnis für alle Beteiligten, was sehr wohltuend und ermutigend wirkt.
Zur Entspannung für diejenigen, die an der einen oder anderen Stelle doch hin und wieder ein schlechtes Gewissen auf Grund zu wenig Zeitinvestment für die eigenen Eltern beschleicht, möglicherweise weil sie selbst noch im Berufsleben stehen und wenig Zeit haben, beschreibt die Autorin, dass es keineswegs auf die Dauer oder wöchentliche Häufigkeit der Kontakte zu unseren Altvorderen ankommt, sondern vielmehr auf die empfundene Qualität dieser Kontakte. Wir brauchen uns also nicht permanent auf der Pelle zu hocken, wenn wir wissen, dass wir ein gutes Verhältnis zueinander haben und uns gegenseitig wertschätzen und vertrauen. Nicht die Quantität der gemeinsam verbrachten Zeit ist entscheidend, sondern vielmehr die Qualität. Üben wir also früh, über Small Talk hinaus miteinander ins Gespräch zu
Katja Werheid
„Nicht mehr wie immer“, erschienen im Piper Verlag GmbH,
ISBN 978-3-492-06092-9
Preis 15,– €
kommen und die Zeit mit unseren Eltern, Onkeln und Tanten aktiv zu gestalten. Um schwierige Themen anzusprechen eignet sich, soweit noch möglich, ein Spaziergang an einen Ort, zu dem man einen gemeinsamen Bezug hat.
Daneben kommen wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse keineswegs zu kurz, beispielsweise wenn es um verschiedene krankheitsbedingte Einschränkungen geht oder um die Häufigkeit unterschiedlicher Todesursachen je nach Alter. Denn obwohl jedes Kind bis zur Volljährigkeit scheinbar schon 18.000 Leichen in verschiedensten Medien gesehen haben soll, gehören das echte Sterben und der Tod in unserer Gesellschaft eher zu den Tabuthemen, die in professionelle Hände wie Kliniken, Pflegeheime und Hospize ausgelagert wurden. Daher hält es die Autorin für ratsam, sich auch damit zu befassen: „Denn wirklich erwachsen sind wir erst, wenn wir uns eingestehen, dass die gemeinsame Zeit mit den Eltern endlich ist.“ Und nicht nur die gemeinsame Zeit mit den Eltern ist endlich, sondern auch die eigene Lebenszeit. Vielleicht dient zum weisen Altwerden auch die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit und die Klärung, welche Wünsche und Erwartungen man selbst im Blick auf das eigene Alter, Sterben und Tod hat. So gelesen leistet das Buch vermutlich einen Beitrag zur Erleichterung und Unterstützung der eigenen Kinder, Nichten und Neffen oder sonstiger Helfer und Kümmerer. Denn die Veränderung unserer Eltern liegt nicht in unserer Verantwortung, unsere eigene aber sehr wohl!
Zugleich wird der Ratgeber ganz praktisch. Wenn es darum geht, Ressourcen zu erkennen und zu stärken oder Netzwerke zu aktivieren und Helferkreise zu kreieren. Es werden Ideen aufgezeigt und im Anhang hilfreiche Adressen genannt. Katja Werheid ist es mit diesem Buch gelungen, einen nützlichen, gleichzeitig leicht und teilweise amüsant zu lesenden Ratgeber für all die zu schreiben, die sich mit der Problematik des Alterns von Eltern und Verwandten und nicht zuletzt mit dem eigenen Altern konstruktiv auseinandersetzen wollen. Demzufolge kein Buch für Feiglinge!
Ursula Dehner
April – 2018 | nota bene Seite 19 Literatur
Fatigue und der Ansatz für die Behandlung in der Ergotherapie
Jeder kennt das Gefühl, erschöpft zu sein. Ein langer Arbeitstag mit viel Trubel und unvorhergesehenen Ereignissen – kein Wunder, am Abend sinkt man erschöpft in den Sessel und fühlt sich ausgelaugt und erledigt. Was aber, wenn die Erschöpfung bereits mor-


gens nach dem Aufstehen eintritt, was, wenn die einfachsten Tätigkeiten zu einer ungewohnten Anstrengung führen? Dann besteht der Verdacht, dass die Erkrankung der Fatigue Ursache für die Erschöpfung ist.

Als Fatigue (aus dem Französischen „Müdigkeit“) wird die pathologische psychophysiologische Ermüdbarkeit bezeichnet. Sie äußert sich darin, dass der Betroffene bei ausreichen-
der Kraft und Koordinationsfähigkeit durch motorische Belastung bereits nach kurzer Zeit erschöpft ist.
Welche Behandlung sieht die Ergotherapie für die Menschen mit Fatigue vor? Dazu ein Beispiel aus der Praxis. Eine junge Frau, Mitte vierzig, meldet sich zur Ergotherapeutischen Behandlung an. Sie leidet an MS und bekommt vom Arzt eine Verordnung über eine motorisch-funktionelle Behandlung mit dem Ziel, die Beweglichkeit und Geschicklichkeit der Hände und Finger zu verbessern. Die Ergotherapeutin erhebt anhand des COPM (Canadian Occupational Performance Measure) die Betätigungsanliegen der Patientin. Sie gibt das Hantieren mit Schrauben, das Schneiden von Gemüsen und Ankleben von Wimpern als Anliegen an, für die sie sich eine Verbesserung in der Performanz (Ausführung) durch die Therapie erhofft. Nun gilt es mittels des Befundes herauszufinden, was die Ursache für die Einschränkungen in diesen Aktivitäten ist. Im Anamnesegespräch berichtet die Patientin darüber, sich ungewöhnlich schnell müde und erschöpft zu fühlen. So habe sie bei der Hausarbeit das Problem, dass sie beim Schneiden des Gemüses die Kraft verliere. Bei der Arbeit fällt ihr schwer, den Radträger zu heben, an welchem sie Räder montieren muss.
Mit dem funktionellen Befund erhebt die Therapeutin den Status der oberen Extremität. Sie überprüft dazu die Koordination der Finger-, Hand- und Armbewegung, misst die Kraft in den Schultern und der Hand und überprüft die Sensibilität der Hände. Der Befund schließt mit einer Überprüfung der Tonusverhältnisse in der Hand mit den Fingern und Arm mit der Schulter ab. Im beschrie -
benen Fall führt diese Untersuchung zu folgendem Befund: Die Handkraft ist deutlich herabgesetzt, die Überprüfung mit dem Vigrometer führt zu Tage, dass diese nach wenigen Messungen deutlich nachlässt. Dieses besagt, dass eine muskuläre Fatigue besteht, die sich im Rahmen einer Multiplen Sklerose, an welcher die Patientin erkrankt ist, als Hauptsymptom gebildet hat.
Um das Ergebnis zu sichern, bittet die Ergotherapeutin die Patientin, den Würzburger Erschöpfungsinventar bei Multipler Sklerose (WEIMuS) auszufüllen. Anhand dieses Assessment erhält sie den Grad der Ermüdung, anhand einer Skala von 0-4. Als Automechanikerin arbeitet die Patientin mit schweren und kalten Trägern, an welche Räder zu montieren sind. Sie führt eine stehende Tätigkeit aus und befestigt mit Schrauben die Räder an dem Träger. In der Halle ist es kühl mit kalten, weil aus Stahl bestehende Materialien, mit denen sie hantiert. Bei der Analyse des Arbeitsplatzes und der Tätigkeit wird der oben beschriebene Befund im Verhältnis zu der auftretenden Symptomatik gesetzt: die kühle Halle, in der die Patientin arbeitet, und das Material, mit dem sie umgeht, bringen es mit sich, dass die Finger steif und unbeweglich werden. Das wiederholte Greifen und Tragen von Radträgern ermüdet die Muskeln der Schulter, weshalb sie über Rückenund Nackenschmerzen klagt und nach der Tätigkeit so erschöpft ist, dass es ihr schwer fällt, die notwendigen Verrichtungen im Haushalt zu erledigen. Nun gilt es mittels der Therapie eine Verbesserung der Performanz in den Betätigungsbereichen zu erreichen. Die Ergotherapeutin entscheidet sich für folgende Ansätze:
nota bene | April – 2018 Seite 20 Ergotherapie
0 Selbstmanagementkonzept bei Fatigue
0 Adaptation der Küchenutensilien
0 Erarbeiten von physiologisch kraftsparenden Bewegungsmustern zum Tragen und Heben schwerer Lasten
0 Erlernen von Entspannungstechniken
0 Abbau der Fingersteifigkeit durch Anwendungen von Wärme mit Empfehlungen für zu Hause und am Arbeitsplatz
In der Therapie übt die Patientin das körpernahe Heben und Tragen. Gemeinsam mit der Therapeutin erarbeitet sie einen Arbeitsablauf, der wiederholt gleichbleibende Bewegungen durch eine Änderung im Arbeitsablauf ersetzt und eine Erholungsphase nach einer Phase der körperlichen Aktivität vorsieht. Das Schneiden von Gemüse erprobt sie mittels Hilfsmitteln, die eine gelenkschonende und optimale Kraftübertragung erlauben. Die Ar-
beitsplatzgestaltung in der Küche wird mittels einer Stehhilfe verändert und ermöglicht der Patientin, die stehende mit der sitzenden Tätigkeit abzuwechseln.
Im Rahmen des Selbstmanagements erhebt die Therapeutin die Belastungsfähigkeit der Patientin. Sie bittet sie, den Tagesablauf zu protokollieren und auf einer Skala von 1-10 einzuschätzen, wie hoch das Niveau an Energie ist, mit welchem sie sich betätigt. Der Zusammenhang von Energie und der von der Tageszeit abhängigen Schwankungen darin, ergeben ein Bild, welches es erlaubt, Maßnahmen des Managements einzuleiten. Als das Profil erstellt ist, erstellt die Patientin mit Unterstützung der Therapeutin individuelle Maßnahmen des Selbstmanagements. Dazu gehören:
0 Aktivitäts- und Ruhephasen gezielt aufeinander abzustimmen
0 Prioritäten zu setzen, Ereignisse vorausschauend zu planen
0 Im persönlichen und beruflichen Umfeld über die eigene Verfassung sprechen und über deren Folgen aufklären.
Mit dem Ergebnis der Behandlung bewertet die Patientin die Veränderung in der Performanz der von ihr genannten Anliegen. In der Betätigung „Gemüse schneiden“ ist eine Verbesserung eingetreten, für das Hantieren mit Schrauben bewertet sie ebenfalls besser in der Performanz. Die Ergotherapie stellt den Zusammenhang von Beschwerden und Einschränkungen mit dem Alltag und seinen Betätigungen her. Mit der Behandlung hat die Patientin Maßnahmen erlernt, die die Beschwerden lindern und solche erprobt, die das Auftreten dieser Beschwerden herabsetzen oder verhindern. Ihre Betätigungen richtet sie daraufhin aus und gewinnt ihren Alltag zurück, einen Alltag mit Lebensqualität und in Selbstbestimmung.
Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin
Mehr Offenheit, Mut und Problembewußtsein
in der Pflegediskussion
ein Kommentar
Als wesentliche Eckpunkte nennt der Koalitionsvertrag zur Verbesserung der Alten- und Krankenpflege ein Sofortprogramm mit 8.000 Fachkräften und eine künftig bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Danke, ist man geneigt zu sagen. Doch taugen diese Ankündigungen zu mehr als einem nur schnellen vordergründigen Effekt?
Leider hat man vergessen zu sagen, wo man denn die 8.000 Fachkräfte für das Sofortprogramm hernehmen will. Schon heute dauert es oft mehrere Monate, bis eine freigewordene Fachkraftstelle überhaupt wieder neu besetzt werden kann. Und überhaupt – 8.000 Fachkräfte bedeuten, dass nicht einmal jedes Pflegeheim in Deutschland eine neue Stelle kriegen würde, von Kran-
kenhäusern und Rehakliniken ganz zu schweigen. Nach einer aktuellen Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) sind alleine bei den Krankenhäusern in Baden-Württemberg aktuell 1.200 Stellen bei den Pflegefachkräften unbesetzt.
Hier scheint schon die bloße Ankündigung hilflos. So wird man den Problemen nicht Herr. Um verlorengegangenes Vertrauen zumindest bei den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen, die die Situation der Pflege aus eigener Erfahrung kennen, bedarf es für die Politik mehr als solcher politischer „Blendgranaten“.
Da wird man sich doch bei der zweiten Ankündigung, der besseren Bezahlung,
–
sicher leichter tun. Pflegekräfte, Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen schon seit langem deutlich verbesserte Personalschlüssel und ebenso deutlich bessere Vergütungen für die Pflege. Gescheitert ist dies jedoch immer an den Kostenträgern – und genau hier sitzt doch derselbe Staat, der jetzt über seine Regierung grundlegende Verbesserungen verspricht, über die örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger am längsten Hebel. Wer als Staat qualitative Verbesserung zu seinem Programm macht, der hat auch die Verpflichtung und Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese auch durch andere, untergeordnetere Stellen desselben Staates nicht konterkariert, sondern schlicht umgesetzt werden. Also nur Mut, wir geben die Hoffnung nicht auf…
Manfred Preuss
April – 2018 | nota bene Seite 21 Ergotherapie
Mit Pflanzenkraft in den Power-Frühling 2018

Die Winterzeit geht langsam vorüber, die letzten kalten Tage schleichen sich noch ein und die ersten warmen Tage zeigen sich in voller Pracht. Mit der Sonne, die aus purer Energie besteht, wird den Menschen und den Pflanzen die notwendige Energie wiedergeschenkt, die wir in den letzten dunklen und kalten Monaten nach und nach verloren haben. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, dass sich der Frühling schon bald den Weg bahnen wird.
Mit den einhergehenden Frühlingsgefühlen fühlen viele auch die Energie des Aufbruchs, die Motivation, neue Wege zu beschreiten, und den Wunsch, etwas zu verändern. Diese Power kann genutzt und vervielfacht werden, um die Ziele, Wünsche und Erfahrungen schneller zu erreichen und erlebbarer zu greifen.
Wie soll die Power sichergestellt werden?
Dies wird dadurch sichergestellt, indem die pflanzliche Kraft in den Ernährungsalltag integriert wird. Die Pflanzenkraft umfasst nicht nur grünes Gemüse, sondern alles, was die Natur auf natürliche Weise und verzehrbereit zur Verfügung stellt. Verzehrbereit bedeutet in diesem Fall, dass die Nahrungsmittel für die Verwendung nicht nochmal in unterschiedlichen, industriellen Prozessen verarbeitet werden mussten und dabei die wertvollen Vitamine verloren haben. Die Energie wird durch die Sonne bereitgestellt und vor
allem in Form von Gemüse und Obst gespeichert. Jeder Eingriff, der nach der Ernte noch erfolgt, bedeutet einen mehr oder weniger hohen Energieverlust dieser pflanzlichen Lebensmittel.
Ergo: Desto unverarbeiteter das Essen, desto mehr Energie bleibt vorhanden. Je mehr Energie und Vitamine vorhanden bleiben, desto mehr Energie geht auf den Menschen über. Das ist ein Naturgesetz. Das ist spürbar.
Welche Lebensmittel sollten in den Alltag integriert werden, um sich vitaler und energiereicher für den Frühling zu wappnen?
Im Besten Fall entscheidet man sich für saisonales und regionales Obst und Gemüse. Beim Gemüse gibt es momen-
pinambur, Weißkohl, Wirsingkohl und Zwiebeln. Zurzeit ist das einzige saisonale Obst der Apfel aus heimischer Lagerware. Alle anderen Obstsorten sollten eingefroren gekauft werden, die in BIO-Qualität geerntet worden sind.
Wie sollten diese Lebensmittel verzehrt werden?
Zu empfehlen ist, das Obst und Gemüse möglichst roh zu verzehren. Der rohe Genuss dieser Lebensmittel hat den Vorteil, dass die Vitamine erhalten bleiben und auf diesem Weg am besten vom Körper aufgenommen werden. Die Verarbeitung, das Kochen oder Braten dieser Lebensmittel führen zum Energieverlust dieser Lebensmittel und das ist ebenfalls spürbar. Nach dem Essen tritt Müdigkeit und Energielosigkeit ein. Beim rohen Genuss dieser Lebensmittel bleibt die Energie erhalten und der Mensch spürt folglich mehr Power. (Doch Achtung: Nicht jedes Gemüse sollte roh verzehrt werden. Bitte vorher informieren.) Der einfachste Konsum dieser Lebensmittel wird in Form von grünen Smoothies empfohlen. Auf der Webseite „www.gruenesmoothies.de“ können viele gesunde, energiereiche Rezepte gefunden und nach und nach Richtung Sommer getestet werden.

tan mehr Optionen als beim Obst. So ist ab dem Monat März saisonales und aus heimischer Lagerware folgendes Gemüse zu empfehlen: Butterrüben, Champignons, Kartoffeln, Lauch, Karotten, Pastinaken, Rosenkohl, rote Beete, Rotkohl, Spinat, Steckrüben, To -
Bis zum Sommer eine fröhliche und energiereiche Zeit und bleiben Sie weiterhin gesund!
Mateo Sudar
Unabhängiger Ernährungsberater und Mitarbeiter im MHTTeam
nota bene | April – 2018 Seite 22 Ernährung
Natürliche Hilfe
Ein Ratschlag aus der Apotheke

Vielen Besuchern einer heutigen Apotheke ist sicherlich nicht bekannt, dass trotz der großen Anzahl chemisch produzierter Arzneimittel bis heute ungefähr ein Drittel des Arzneischatzes aus unserer Natur stammt. Selbst modernste Entwicklungen nutzen häufig die Natur als Lieferanten der Ausgangssubstanzen.
Um die Vielfalt der Pflanzenwelt mit ihren Arzneistoff liefernden Arten besser kennen zu lernen, bin ich immer wieder auch mit der Kamera in der Natur unterwegs, um einzelne Exemplare für mein Archiv festzuhalten.
In regelmäßiger Folge möchte ich deshalb an dieser Stelle einzelne Pflanzen vorstellen und über ihre Wirkungsweise informieren.
Friedrich Böckle
(Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell)

Pestwurz –ein Arzneimittel?
Einer der ersten Frühjahrsblüher in unserer Landschaft ist die Pestwurz (Petasites hybridus), die mit ihren bis zu 40 cm hohen Blütenständen oft große Feuchtbereiche beeindruckend beherrscht und häufig entlang von Fluss- und Bachläufen bis in den Sommer hinein vegetationsbestimmend sein kann. Die rötlich-weißen bis violetten zahlreichen Einzelblüten sind auch deshalb so auffallend und bestimmend, da in dieser Blütephase keine grünen Blätter erscheinen. Diese entwickeln sich erst nach dem Abblühen und erreichen dann riesige Ausmaße mit Einzeldurchmessern von bis zu 70 cm.
Der deutsche Name Pestwurz stammt aus der Nutzung als Mittel gegen die Pest im Mittelalter. Dabei wurden Umschläge mit den Blättern im Bereich der „Pestbeulen“ gemacht. Bereits im Altertum wurden die Blätter bei Hautentzündungen und Geschwüren von den Griechen und Römern eingesetzt. Entzündungshemmende Inhaltsstoffe sind auch nachweislich enthalten, so dass diese Anwendungen durchaus Erleichterung verschafften.
Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Pflanze dann als Schmerzmittel mit entkrampfender Wirkung erkannt und speziell bei Migräne empfohlen. Klinische Studien im 20. Jahrhundert haben diese Wirkung bestätigt und bis vor 10 Jahren gab es in Deutschland mehr als 2 Millionen Verwender.
Doch die Forschung hat dann auch ein großes Handicap zutage gebracht: Pestwurz enthält die sog. Pyrrolizidinalkaloide, die nachweislich leberschädigend sind und denen auch eine krebserregende Eigenschaft zugeordnet wird. Im Jahr 2009 wurden dementsprechend alle in Deutschland zugelassenen Arzneimittel aus Pestwurz vom Markt genommen. Die Hersteller hatten zwar zuvor reagiert und Pestwurzpflanzen mit geringerem Gehalt der schädigenden Stoffe gezüchtet und zudem Extraktionsmethoden entwickelt, mit denen die Alkaloide zum großen Teil entfernt werden konnten. Formelle Gründe ließen jedoch eine Neuzulassung scheitern.
In der Schweiz wurde dagegen unter dem Namen Tesalin ein Pestwurzpräparat zugelassen, das als Mittel bei Allergien und besonders bei Heuschnupfen angeboten wird. Das in Deutschland vor 2009 im Verkehr befindliche Migräneschmerzmittel Petadolex wird weiterhin in Großbritannien hergestellt und kann als Import bezogen werden.
Das Beispiel Pestwurz zeigt, dass bei natürlichen Heilmitteln aus dem Pflanzenreich häufig Nutzen und Schaden nahe beieinanderliegen. Meine Empfehlung: genießen Sie die Schönheit dieser Pflanze in der Natur – eine Verwendung als Arzneimittel in Form von Teezubereitungen ist dagegen verboten!
April – 2018 | nota bene Seite 23
Natur und Heilkunde
Foto: Friedrich Böckle


nota bene | April – 2018 Seite 24