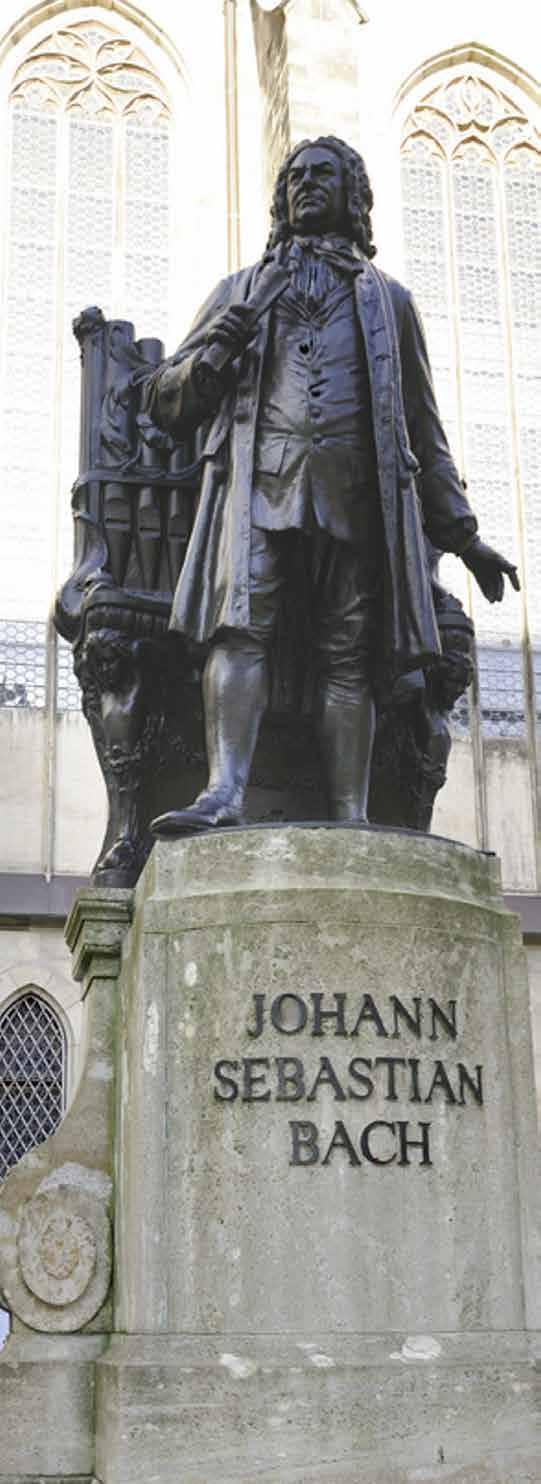
1 minute read
Wie wunderbar der Heilige Geist klingt
from Neu Nota Bene 11
by Mateo Sudar
Eine Bachkantate zu Pfingsten
Das Pfingstfest ist das letzte der drei christlichen Hochfeste im Laufe des liturgischen Kirchenjahres. Das Fest der Geistsendung, als eigenständiger kirchlicher Feier- und Festtag, fand seinen Ursprung Ende des 4. Jahrhunderts. Pfingsten bildet den Abschluss des Osterfestkreises, der am Sonntag Septuagesimae seinen Anfang nahm. Die Feier der Sendung des Heiligen Geistes, als Teil der Dreieinigkeit Gottes, stellt natürlicherweise eine für die Christenheit immens wichtige theologische Säule des religiösen Lebens dar. Zu diesem hohen Fest hat uns Johann Sebastian Bach ganz selbstverständlich einen großen Schatz kirchenmusikalischer Werke geschenkt.
Advertisement
Hier nun daraus eine Kantate, und zwar das am 29. Mai 1724 erstmals aufgeführte Werk Erhöhtes Fleisch und Blut, BWV 173 Diese Pfingstkantate gehört zum ersten Leipziger Jahrgang, hat aber ihren Ursprung in der zwei Jahre vorher entstandenen Köthener Glückwunschkantate Durchlauchtester Leopold, BWV 173a Wir haben hier ein typisches Beispiel aus Johann Sebastian Bachs Parodierpraxis. Der Meister übernimmt die ersten fünf Sätze aus BWV 173a, fügt den passenden sakralen Text ein, mischt die Reihenfol- ge der Gesangssolisten neu und hängt einen Pfingstchoral als Schluss-Satz an. Hier das Ergebnis: Nach dem EingangsRezitativ der Tenorstimme erklingt in vornehm schreitender, höfisch anmutender Manier die Tenorarie „Ein geheiligtes Gemüte“. Gleich anschließend hören wir die Altarie in Begleitung der Streicher und des Bc.-Instrumentariums: „Gott will, o ihr Menschenkinder“. Dann folgt etwas ganz und gar Besonderes, nämlich ein dreistrophiges Arioso, eigentlich schon ein Kunstlied, das sich Sopran und Bass miteinander teilen. „So hat Gott die Welt geliebt“ beginnt mit der Bass-Stimme. Die zweite Strophe (Sopran) wird durch ein herrliches Zwischenspiel der begleitenden Flöten und dem Basso continuo eingeleitet. Das Zwischenspiel vor der dritten Strophe – einem Duett – erhält eine dramatische Forcierung durch den plötzlichen Einsatz der Streicher. Den fünften Satz, das Rezitativ für Sopran und Tenor, hat Bach fast nahtlos aus der Köthener Profankantate übernommen. Der Unterschied: bei BWV 173a heißt es: „Durchlauchtigster, den Anhalt Vater nennt“; in unsrer Pfingstkantate lautet der Text: „Unendlichster, den man doch Vater nennt“. Im Schlusschoral kommt dann der alles durchdringende Pfingstgedanke, eingebettet in das spielerisch wogende Gesamtinstrumentarium, in vollem Glanz zum Tragen.
Wolfgang Waldenmaier
CD-Tipps:
Cantatas BWV 172-175;
Bach-Kollegium Stuttgart, Helmuth Rilling; Hänssler ,2000
Cantatas BWV 34, 173, 184, 129; La Petit Bande; Sigiswald Kuijken; Accent, 2012
Cantatas BWV 147, 173, 181; Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman; Erato, 1999








