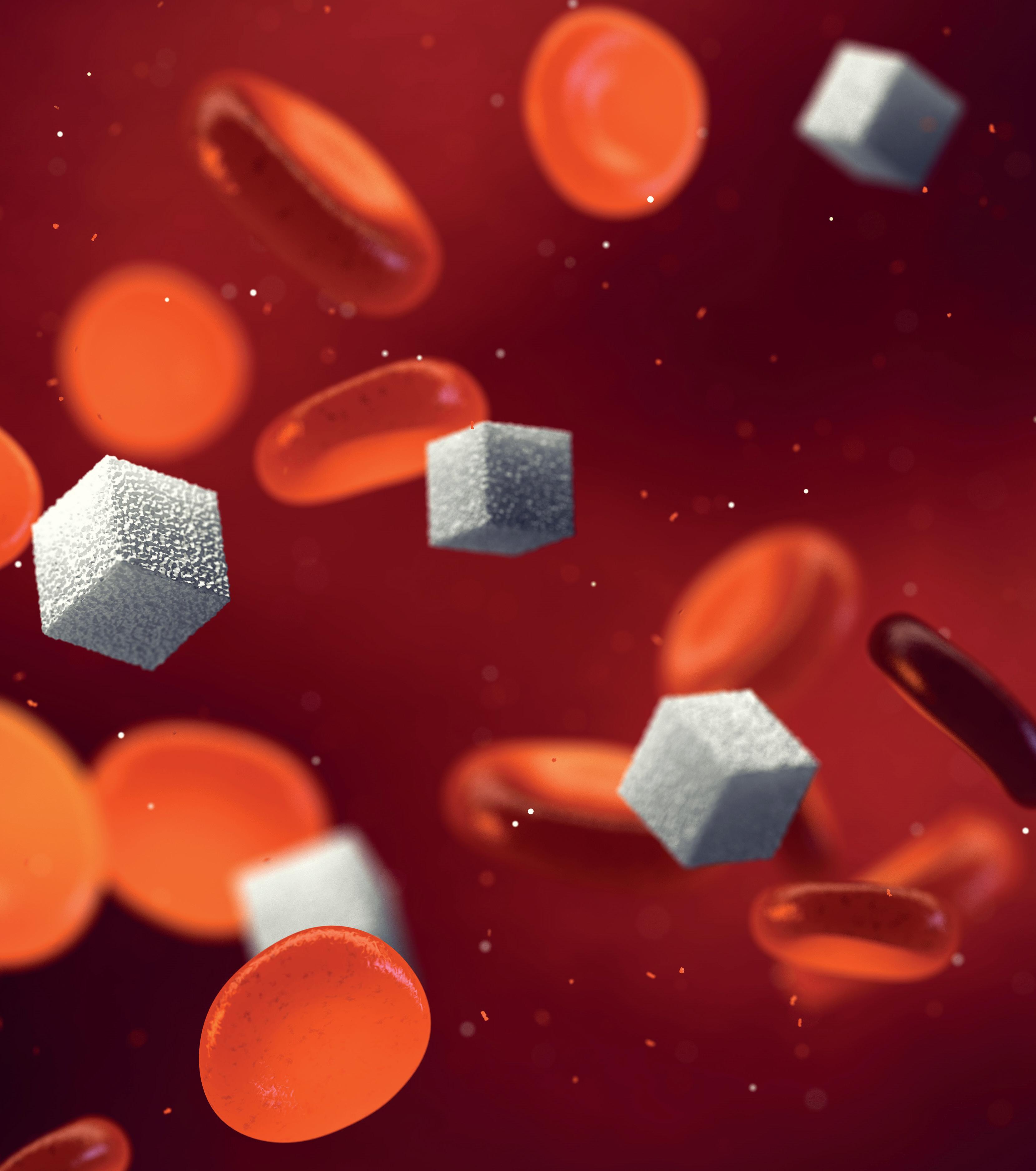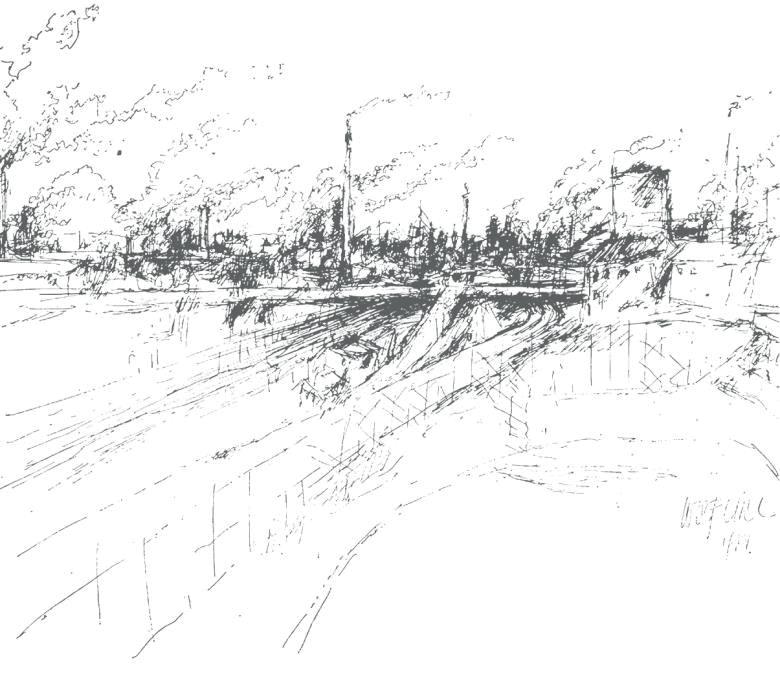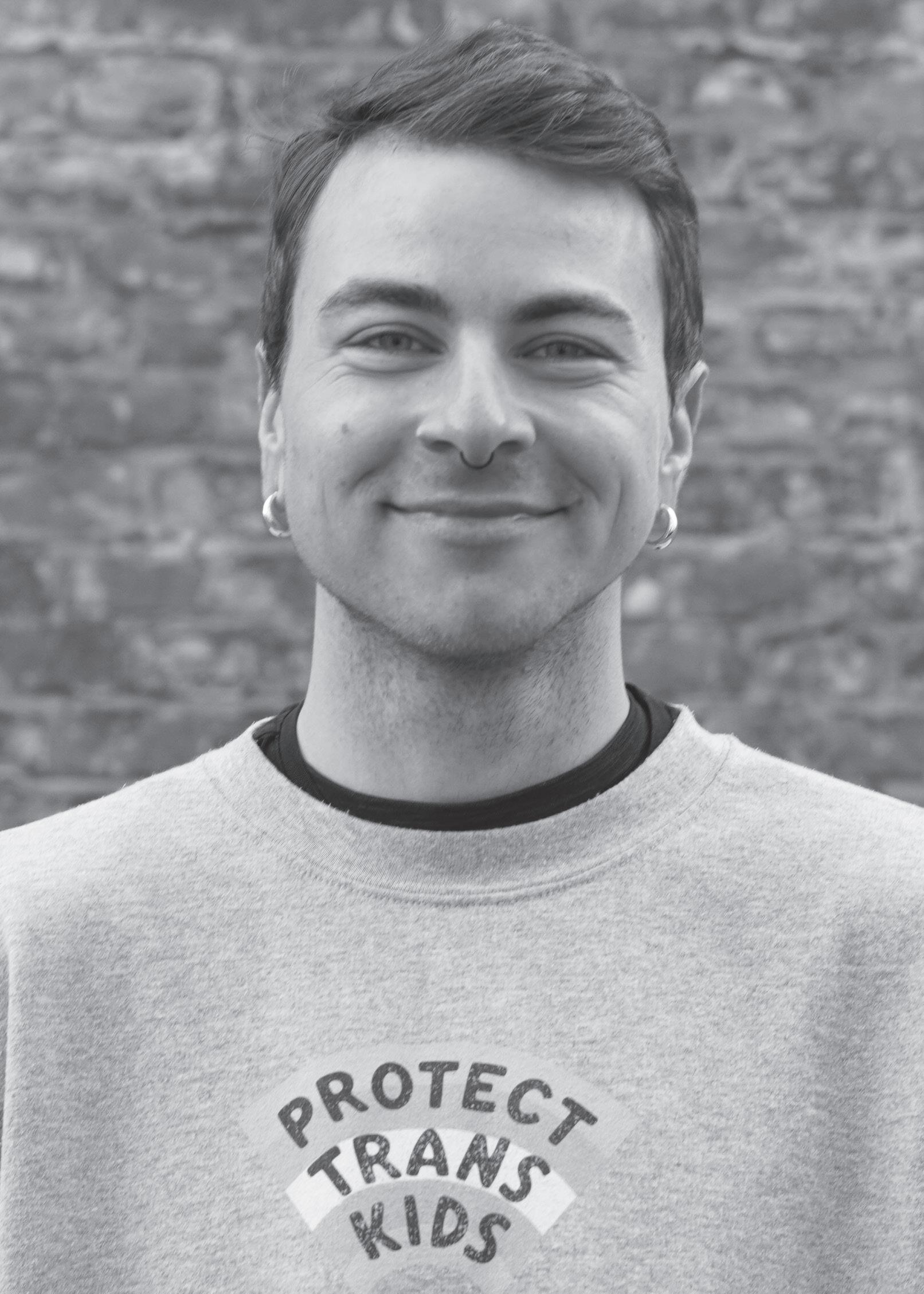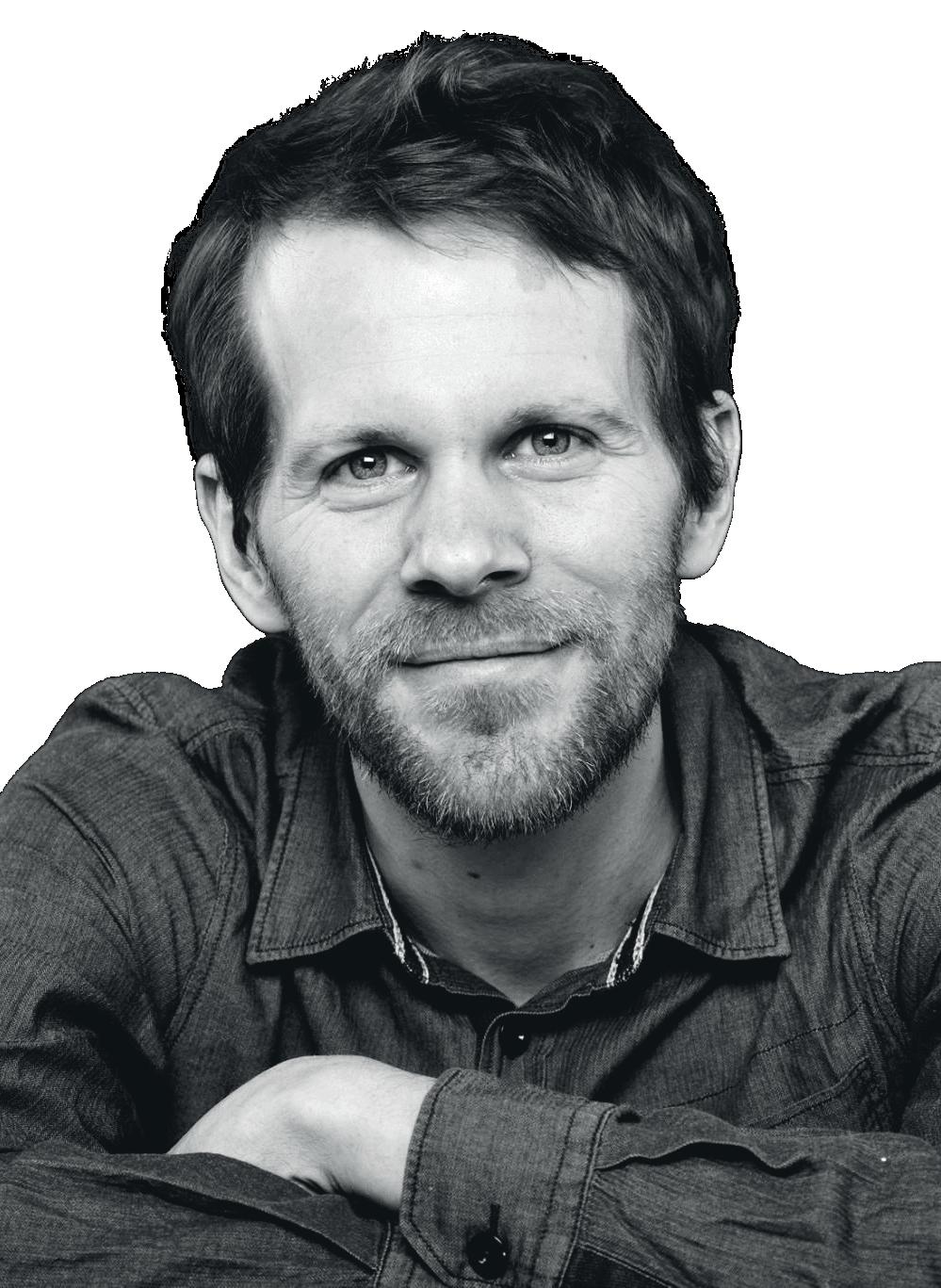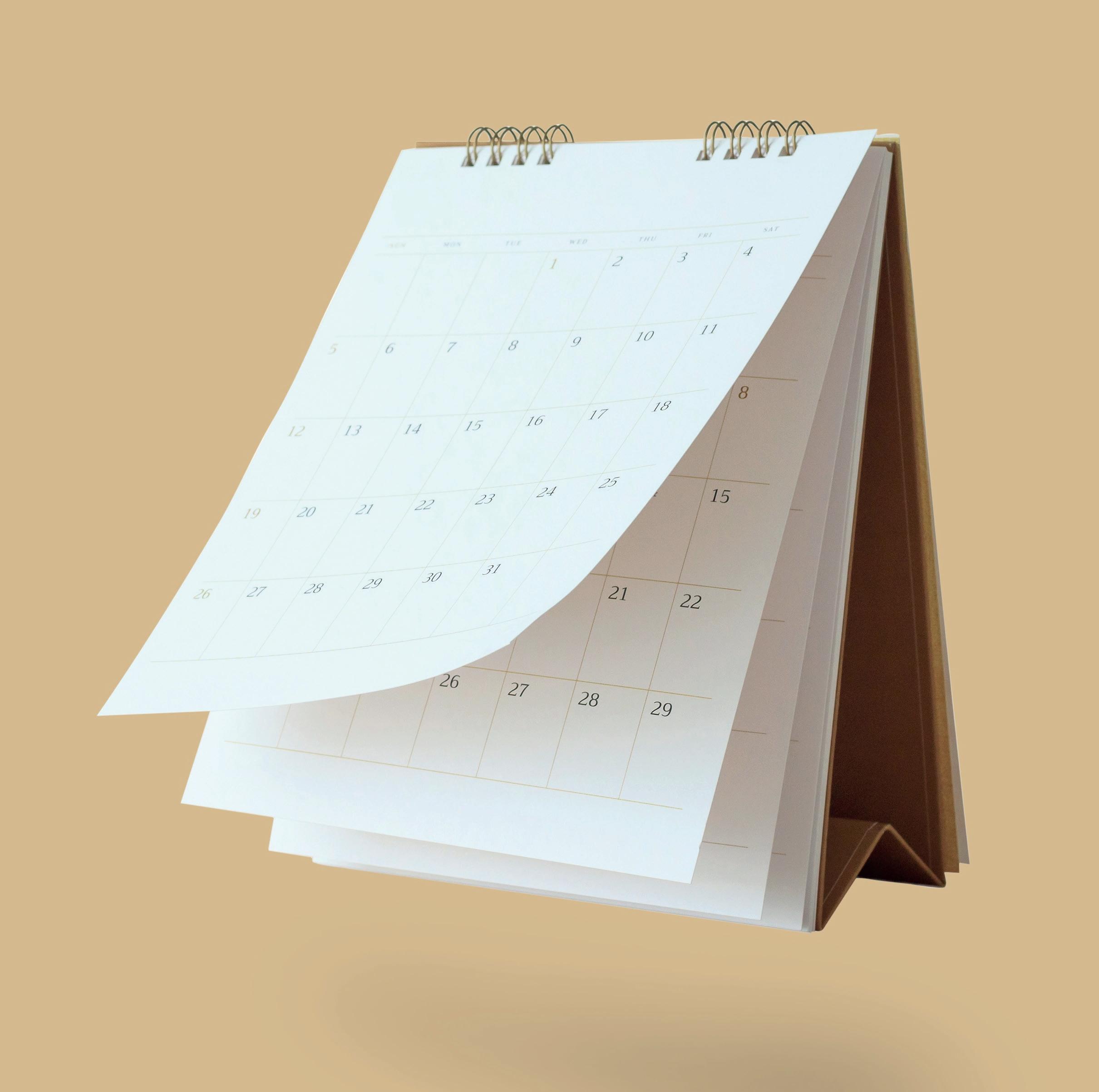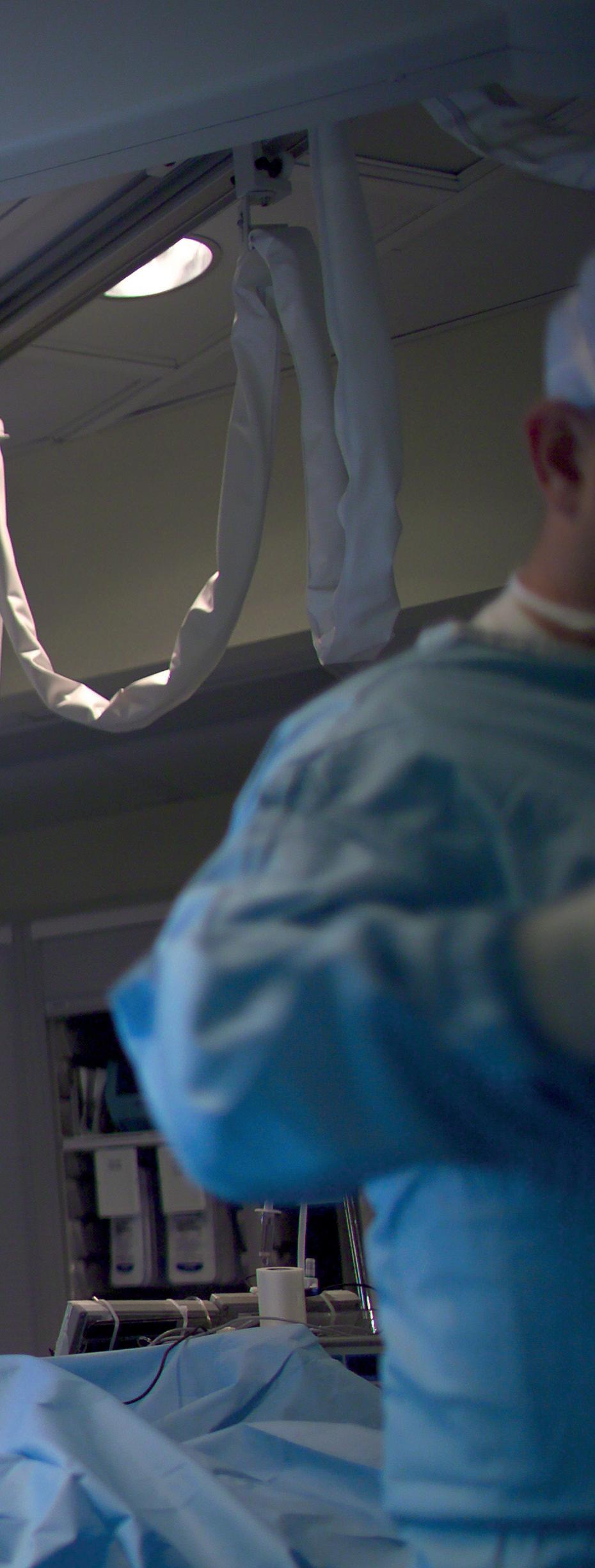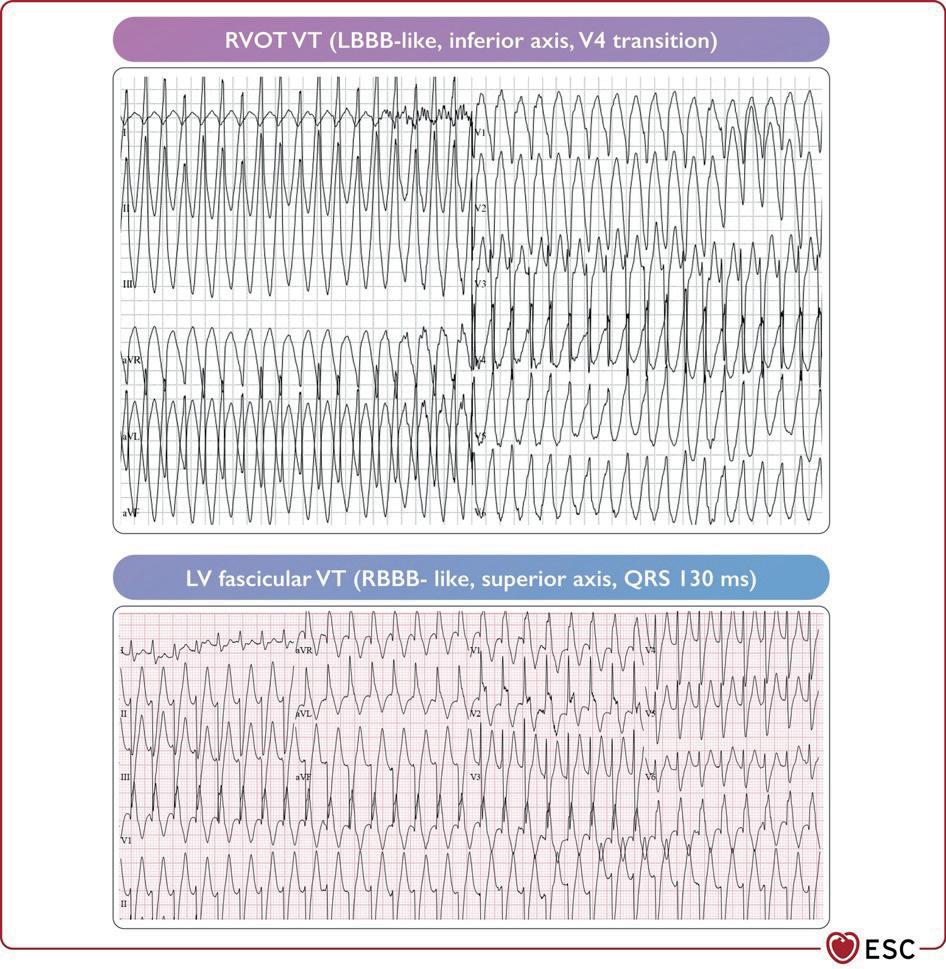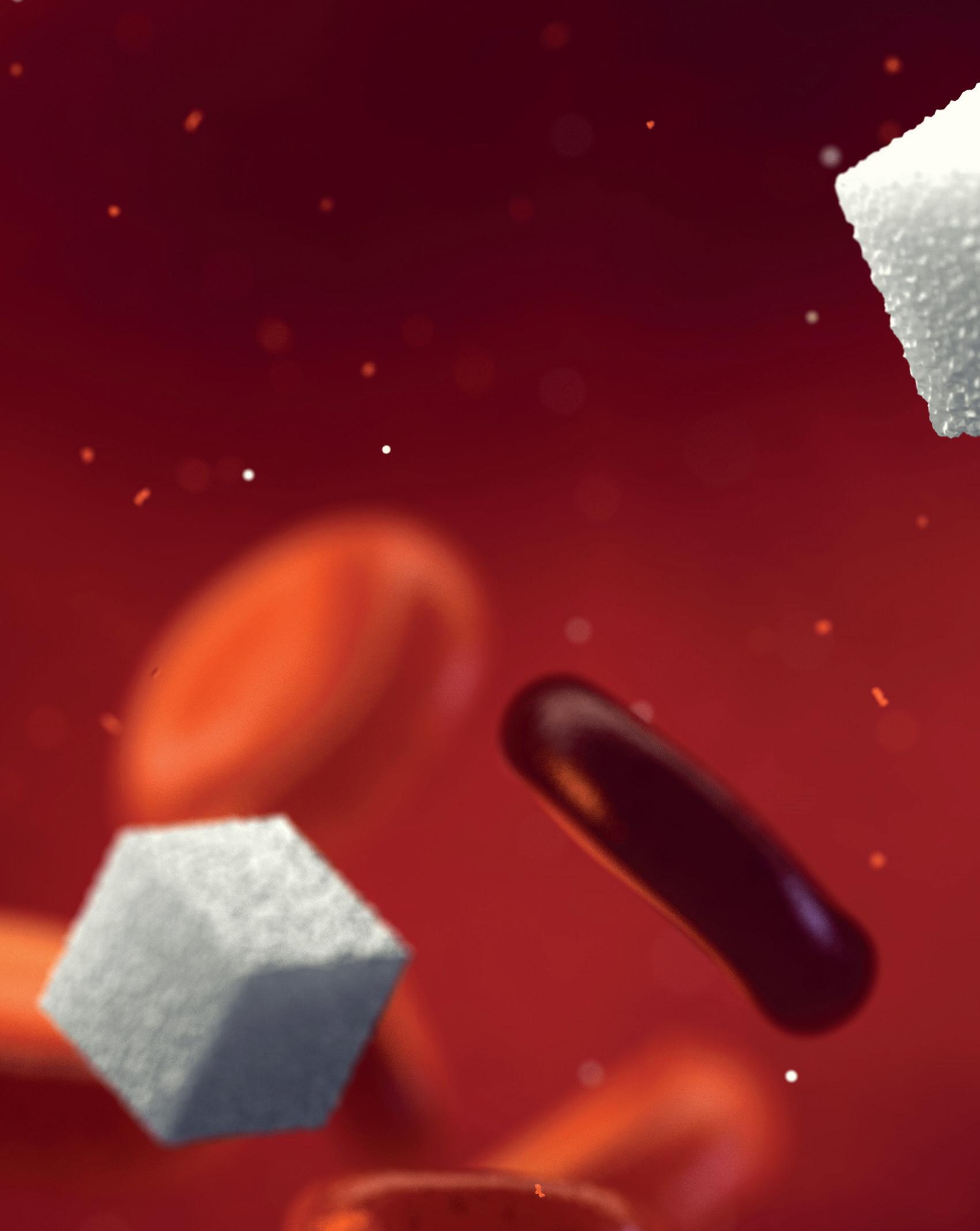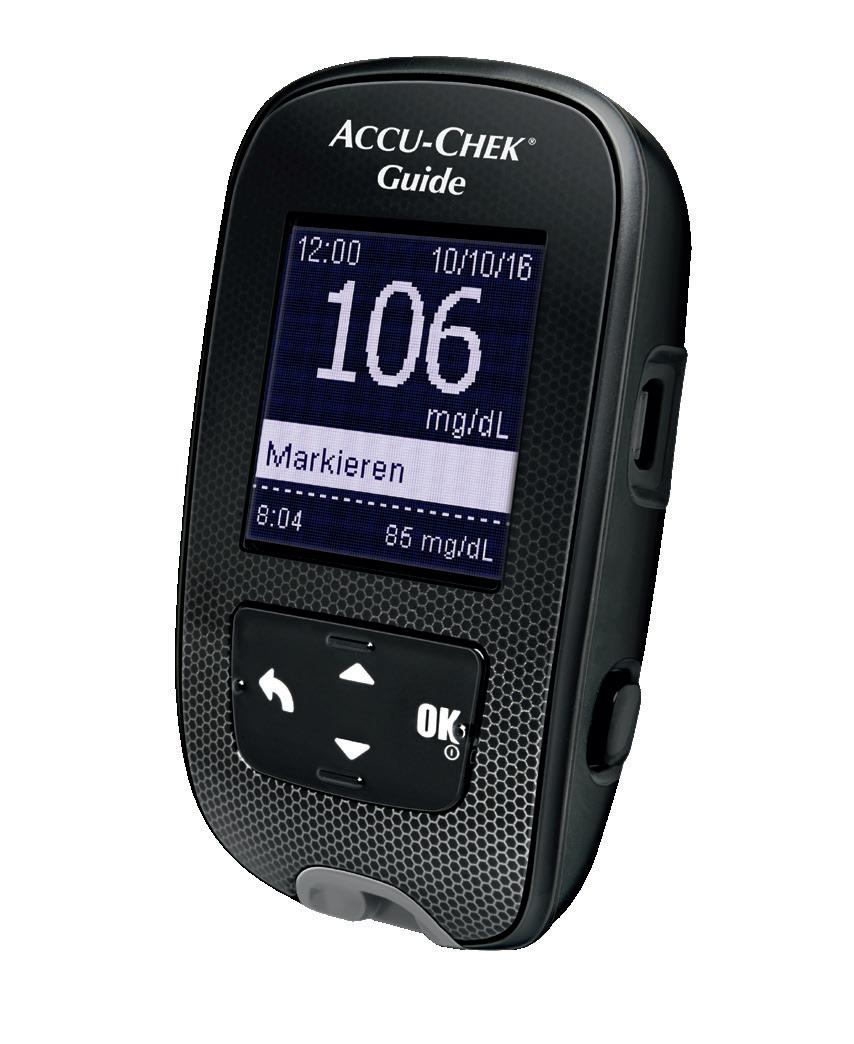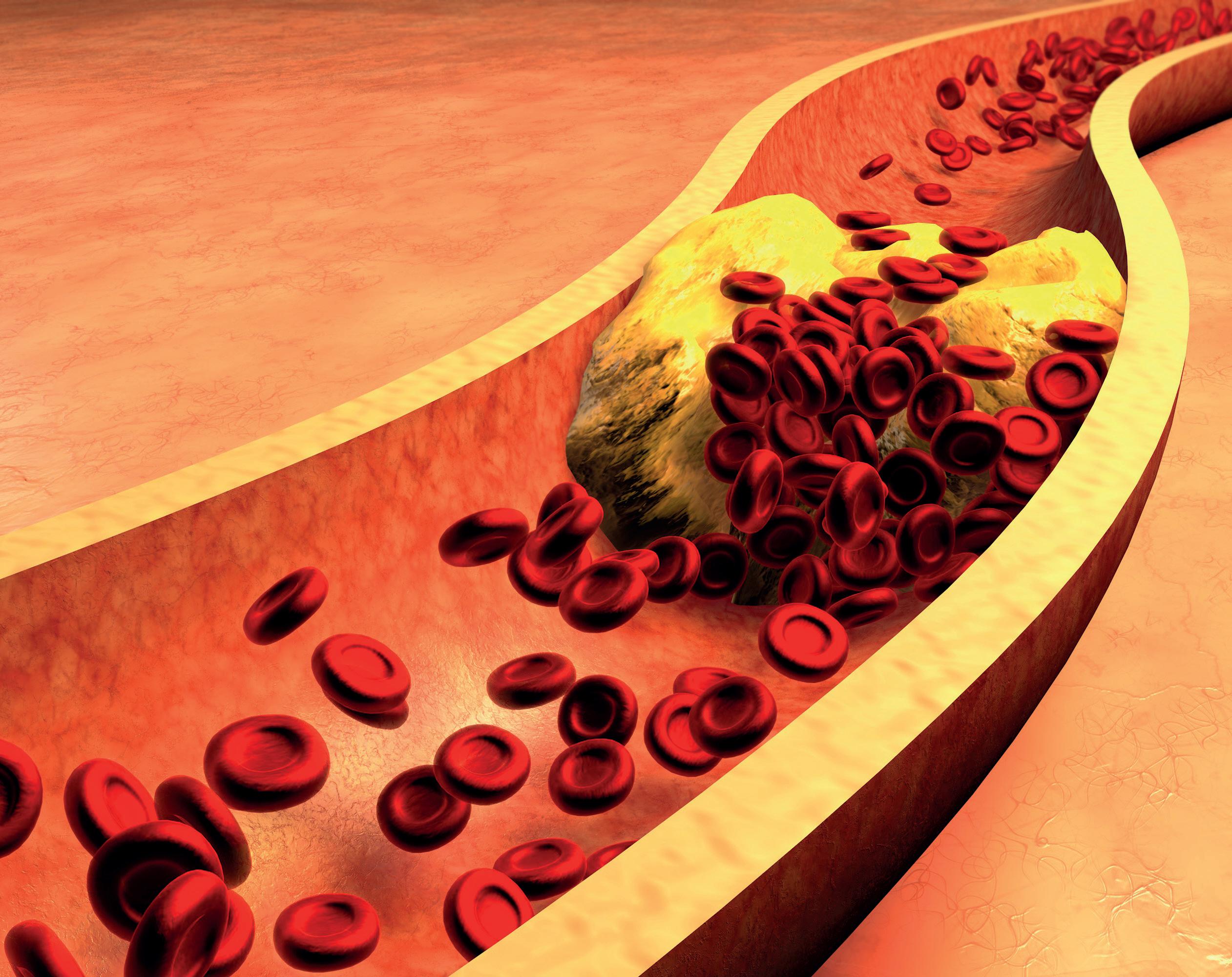Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien Kommentar des Kurienobmanns der niedergelassenen Ärzt:innen 2023 Neujahrswünsche ESC-Guidelines: ventrikuläre Arrhythmien & plötzlicher Herztod Praxiswissen Kardiologie 01/2023 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie Sexuelle & geschlechtliche VIELFALT in der Praxis
Facettenreiche Neujahrswünsche
Wir, das Redaktionsteam der RegionalMedien Gesundheit, sind mit vielen guten Vorsätzen und großem Tatendrang ins neue Jahr gestartet. Und so hoffen wir, dass Ihnen, werte Leser:innen, die druckfrische Jännerausgabe unserer Hausärzt:in gefällt. Wie immer haben wir versucht, einen bunten Mix von praxisnahen Themen für Sie zusammenzustellen. Besonders „bunt“ ist diesmal unsere Titelgeschichte, widmet sie sich doch dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das wohl bekannteste Symbol der LGBTIQA*-Community (die sperrige Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell) ist die Regenbogenfahne. Was sie vor allem ausdrücken will? Aufbruch, Veränderung, Toleranz und Akzeptanz, aber auch Hoffnung und Frieden. Das sind Werte, für die wir wohl alle stehen. Und doch sind wir nicht davor gefeit, im Alltag diskriminierend zu agieren. Oft passiert das unbewusst oder ohne Absicht, zum Beispiel, wenn es im Rahmen der Anamnese zu einem Outing kommt und man nicht gut damit umzugehen weiß. Ein Neujahrsvorsatz 2023 kann sein, noch mehr auf einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Patient:innen zu achten.
Ein Twindemie-Winter
In den ersten Wochen des Jahres 2023 standen in vielen Ordinationen freilich andere Probleme im Vordergrund. Zu der nach wie vor hohen Anzahl der Grippekranken gesellen sich Infektionen mit dem Coronavirus, mit RSV und banale HNO-Infekte. Das gleichzeitige Auftreten von mehreren Viren stellt die Gesundheitsversorgung vor enorme Herausforderungen: Die Wartezimmer sind brechend voll, die Telefone klingeln durchgehend und die Patient:innen

müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Im Zuge dessen ist dem Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes, Dr. Wolfgang Schreiber, wichtig, daran zu erinnern, auch das Angebot der Telemedizin zu nutzen. Die facettenreichen Neujahrs-„Wünsche“ der niedergelassenen Ärzt:innenschaft hat für uns Bundeskurienobmann Dr. Edgar Wutscher in einem Kommentar auf Seite 47 zusammengefasst.

Das Ende der Pandemie?
Die Weltgesundheitsorganisation ist übrigens optimistisch, dass der globale Gesundheitsnotstand wegen der Coronapandemie im neuen Jahr aufgehoben werden kann. Die Hoffnung sei zu sagen: „Dies ist keine Pandemie mehr “ , so Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Aussendung. Klar sei aber auch: „Das Virus wird bleiben.“ Die Welt habe jedoch die Werkzeuge – Impfstoffe, Medikamente und Verhaltensregeln –, um damit fertigzuwerden. Auch die Zahl der Fälle von Mpox (Affenpocken) sei um mehr als 90 Prozent zurückgegangen, und in Uganda habe es seit einer Weile nun keine neuen Ebolafälle mehr gegeben. Mit Blick auf 2023 meint der WHO-Chef daher,


es gebe allen Anlass zur Hoffnung, aber leider auch allen zur Sorge, etwa durch die Hungerkrise vor allem in Afrika, oder Malaria- und Tuberkuloseerkrankungen. Nicht alle Krisen und Ungerechtigkeiten werden sich im neuen Jahr beheben lassen – aber die Hoffnung auf ein Ende möglichst vieler stirbt zuletzt.
Ein gesundes & farbenfrohes Jahr 2023!
Ihre Mag. a Karin Martin


Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit karin.martin@regionalmedien.at
Änderungen vorbehalten.
Hausärzt:in
© RegionalMedien Gesundheit © shutterstock.com/Marish
Editorial
Moderne Schmerzmedizin Podiumsdiskussion: Ambulante Schmerztherapie heute Veranstalter: Rückfragen an office@gesund.at DFP-Punkte in Planung Details folgen Hausärzt:in trifft Kliniker:in IN LINZ PräsenzFortbildung Sa., 3. Juni 2023 Haus Ärzt:in DIALOGTAG
medizinisch politisch
06 Krankheit mit Variationen Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Depression
09 Vielgestaltige Dynamik
Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig
20 DFP Praxiswissen Kardiologie
ESC-Guidelines 2022: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod
24 Paradigmenwechsel bei Therapie

Kongressnachlese: Diabetes mellitus Typ 2 –Neues und Bewährtes
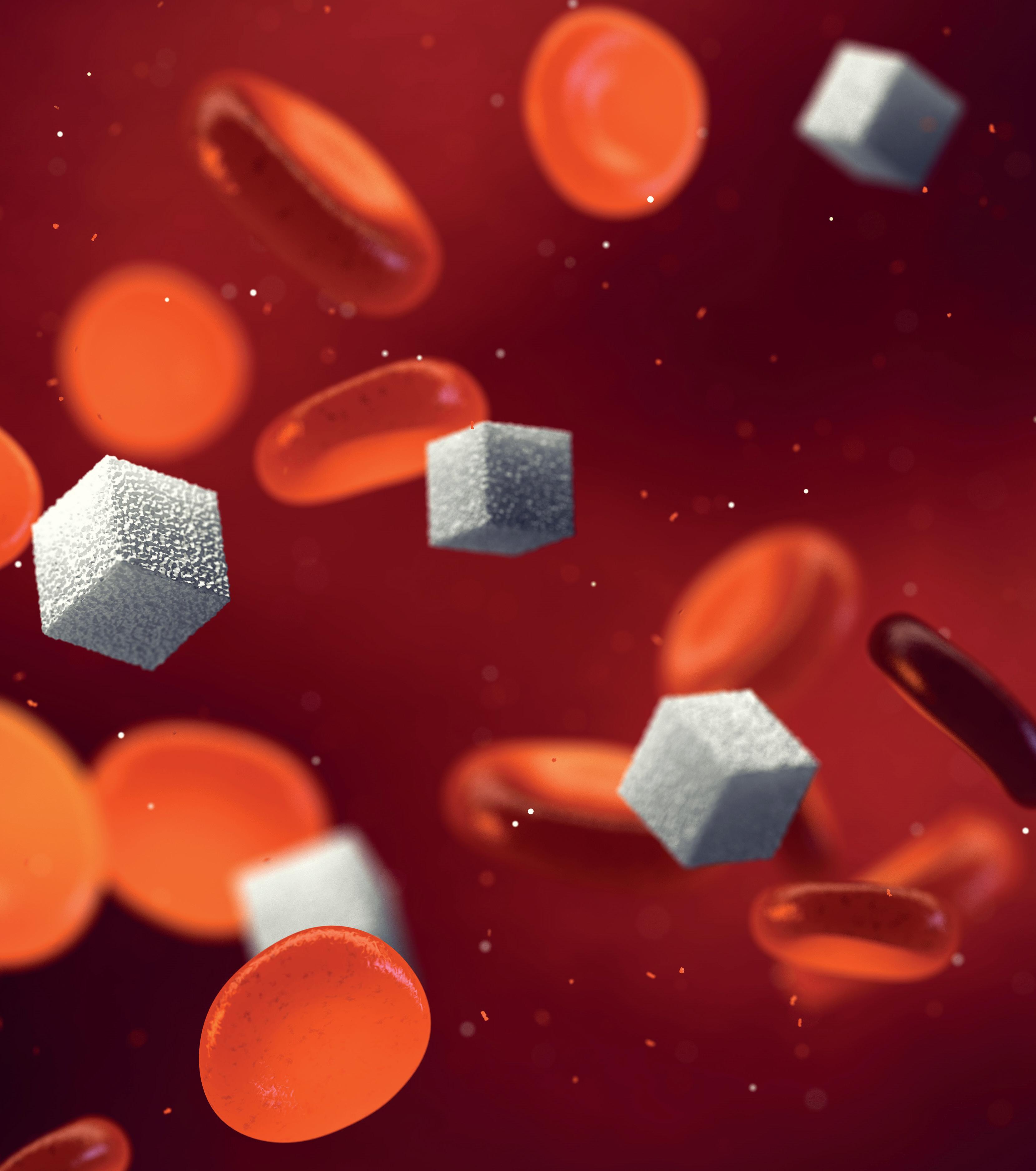
26 Das weibliche Gehirn altert anders Auch bei Demenz geschlechtsspezifische
Unterschiede berücksichtigen
28 Räuber des erholsamen Schlafes
Ein Rückblick auf die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung
31 Frühes Handeln gefragt Familiäre Hypercholesterinämie ist die häufigste genetische Erkrankung in der allgemeinärztlichen Praxis
34 Lebererkrankungen –differentialdiagnostisch betrachtet
Praxisupdate Hepatologie: Hausärzt:innen sind in der Betreuung unerlässlich
DOSSIER DIVERSITÄT
12 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Ein Weg hin zur Normalität – noch weit weg von der Selbstverständlichkeit
16 Ein Gewinn an Lebensqualität HIV-Therapie: Nur mehr sechs statt 365 Behandlungstage jährlich
pharmazeutisch
40 Neues aus der Phyto-Welt
Relevante Forschungsergebnisse für den klinischen Alltag
43 Wissenschaft trifft Praxis
COVID-19: Aktuelle Entwicklungen
46 Innovatives vom Markt Teil 2 APOKongress 2022: Migränemedikamente im Überblick
18 Auf dem Weg zum gefühlten Geschlecht Eine professionell begleitete Transition stellt die wirksamste Behandlungsoption von transidenten Menschen dar 47 Arzt Sicht Sache
49
extra
Ausblick 2023 – Wünsche & Forderungen der niedergelassenen Ärzt:innen
Impressum
Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis
2. 24 09
Multifaktorielles Risikomanagement bei Diabetes mellitus Typ
Psyche
© shutterstock.com/Kiselev Andrey Valerevich © shutterstock.com/nobeastsofierce
& Soma.
Krankheit mit Variationen

Das Bild der Depression ist vordergründig oft ein klares: eine am Sessel sitzende oder im Bett liegende Person, ihre Hände im Gesicht, allgemein erschöpft wirkend und regungslos erstarrt.
Im ICD-10 findet man als Hauptsymptome die depressive Stimmung, In-
teressenverlust, Freudlosigkeit sowie Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Als weitere Symptome können Konzentrations- und Denkstörungen, Reduktion von Selbstwertgefühl, verstärkte Schuldgefühle und körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Ap-

Hausärzt:in medizinisch 6 Jänner 2023
© unsplash.com/Nik
Die typischen Erscheinungsformen der Depression bei Männern, Frauen, alten Menschen, saisonal und in Kombination mit einer Hypomanie oder Manie
Shuliahin
„Depression hat viele Gesichter und erfordert daher unterschiedliche Behandlungsstrategien.“
SeriePSYCHE
petitveränderungen und Sexualfunktionsstörungen auftreten. Affektive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen –rund jede vierte Frau und jeder achte Mann erkrankt im Laufe des Lebens daran und etwa 20 % aller Depressionen verlaufen chronisch. Zwischen 40 % und 70 % der depressiven Patient:innen berichten über suizidale Gedanken. 10-15 % aller Patient:innen mit einer schweren rezidivierenden Depression sterben durch Suizid.
Die männliche Variation
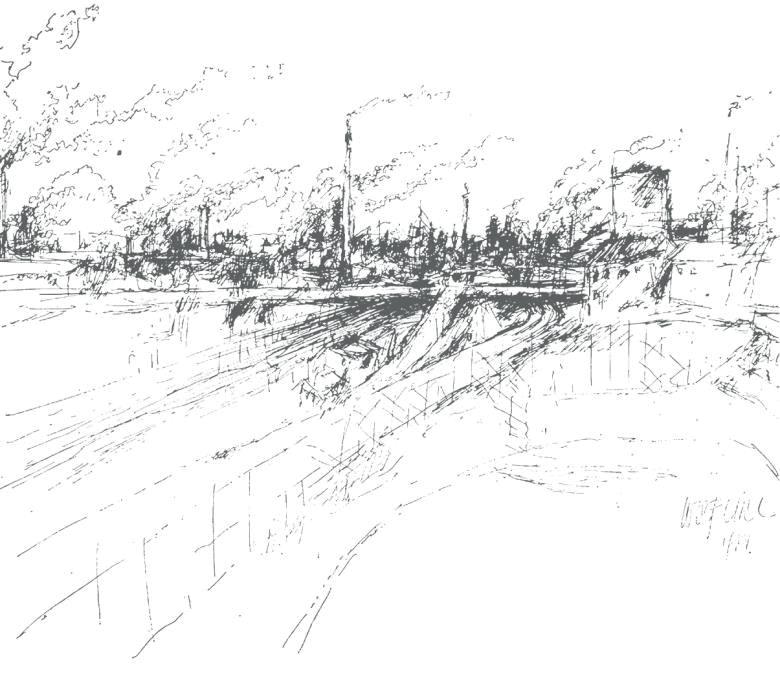
Frauen unternehmen Suizidversuche dreimal häufiger als Männer, jedoch ist bei Männern die Suizidrate dreimal so hoch. Das Testosteron des Mannes ist hierfür u. a. verantwortlich. Es führt zu Dysphorie, zu erhöhter Aggression und zu Sucht- und Risikoverhalten. Diese Darstellungen sind aber nur bedingt kompatibel mit unserer klassischen Vorstellung von einer Depression. Die bestehenden Diagnostikmanuale sind weniger gut in der Erfassung dieser externalisierenden Faktoren und die Depression wird dadurch von den Behandelnden schwerer erkannt. Die „G otland Scale for Male Depression“ berücksichtigt männliche genderspezifische Depressionsdarstellungen und greift insbesondere Indikatoren wie Stress, Suchtverhalten oder Aggression auf.
Auch unterliegt der Mann weiterhin einem männlichen Rollenstereotyp. Er geht weniger in Behandlung – Depressivität wird als Schwäche und eher als eine weiblich konnotierte Erkrankung angesehen. Beim Verlust des Arbeits-
GASTAUTOR:INNEN-TEAM:



platzes und auf anderen leistungs- oder statusbezogenen Ebenen steigt beim Mann das Depressions- und Suizidrisiko, ebenso nach einer Trennung.
Bei Männern zeigen sich als Symptome einer Depression oftmals auch somatische Probleme, etwa ein Druckgefühl im Brustbereich, Kopfschmerzen oder verstärktes Schwitzen sowie allgemeine Unruhe. Auch Sport ist für Männer oft „überlebensnotwendig“, um innere Anspannungen zu reduzieren, aber auch, um leistungsorientiertes Verhalten in der Freizeit fortzuführen. Von Angehörigen oder Behandelnden als behandlungsbedürftig eingeschätzt zu werden, untergräbt die Vorstellungen, was es bedeutet, autonom und ein Mann zu sein. Um den Zugang zu seelischen Hilfen annehmbarer zu machen, sind entstigmatisierende Maßnahmen in männlich dominierten Lebensbereichen notwendig, z. B. stimmige Rollenvorbilder oder Kampagnen in den unterschiedlichsten Medien.

Die weibliche Variante


Es gibt verschiedene Hypothesen, warum Frauen doppelt so oft an Depression leiden: Mehr Östrogen und Progesteron führt zu einer anderen Emotionsverarbeitung, vermehrte Monoaminooxidasen bewirken einen stärkeren Abbau von Neurotransmittern und die allgemeinen Hormonschwankungen einer Frau (Menstruation, Schwangerschaft, Menopause) bedingen eine erhöhte Vulnerabilität.
Dies wird sichtbar, wenn sich der Testosteronspiegel des Mannes im Alter reduziert, es kommt dann zu einem Anstieg der Depressionsrate beim männlichen Geschlecht (Late-OnsetHypogonadismus).
Starke hormonelle Veränderungen sowie multifaktorielle Gründe wie Erwartungs- und Verantwortungsdruck oder körperliche Veränderungen bringt auch eine Schwangerschaft mit sich. Die sogenannte Schwangerschaftsdepression oder postpartale Depression tritt bei bis zu 10 % der Frauen auf.
Stress und die damit verbundene chronisch erhöhte Kortisolausschüttung sind ein Hauptauslöser psychischer Erkrankungen. Stress ist bei Frauen mit Doppel- und Dreifachbelastung (Haushalt, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung bis hin zur Pflege und Betreuung von erkrankten Familienmitgliedern) umso relevanter. Dazu kommt der Druck, außerdem dynamisch, sportlich, erfolg-
Hausärzt:in medizinisch
DSAin Mag.a Marlene Mayrhofer, MBA Geschäftsführerin der PSZ gGmbH
Dr. Gerald Grundschober Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Chefarzt PSD & Club der PSZ gGmbH
>
© PSZ © PSZ
LUNGE.UMWELT.ARBEITSMEDIZIN 3. und 4. März 2023 Priesterseminarhaus ( Harrachstraße 7, Linz) Anmeldung: Lunge.Umwelt.Arbeitsmedizin - gamed.at Themenschwerpunkte: • Lungenkrebs • Mikroplastik in Lunge und Umwelt • COPD und Arbeit • Bodyplethysmographie Die Österr. Gesellschaft für Arbeitsmedizin und die Österr. Gesellschaft für Pneumologie laden Sie ein 42.workshop
„Die Gründe für das vermehrte Auftreten der Depression bei Frauen zeigen, dass die Betrachtung des sozialen Umfeldes bei der Behandlung und Prävention eine große Rolle spielt.“
reich und attraktiv zu sein. Das können viele nicht mehr erfüllen.
Frauen sind zudem häufiger Opfer von seelischem, körperlichem und sexuellem Missbrauch und dies verändert das eigene Sicherheitsgefühl und das Kohärenzgefühl in Bezug auf das Leben.
Weitere Erscheinungsformen
Depression im Alter (bei rund 20 %) ist oft geprägt von zunehmenden körperlichen Einschränkungen, chronischen Schmerzen, reduzierter Autonomie, Verlust von Partner:innen und Freund:innen sowie Konfrontation mit dem eigenen Sterben. Die unterdiagnostizierte Altersdepression kann als Demenz verkannt werden, fördert indirekt aber auch eine demenzielle Entwicklung.
Die saisonale Depression tritt besonders in den Herbstund Wintermonaten auf. Oft wird sie durch weniger Tageslicht getriggert, präsentiert sich mit vermehrtem Drang nach Schlaf, erhöhtem Appetit (mehr Kohlenhydrate) und einer Gewichtszunahme. Therapeutisch ist die Anwendung einer Tageslichtlampe (z. B. 10.000 Lux für 30 Min.) als Erstes zu empfehlen, aber auch ein täglicher Spaziergang im Tageslicht kann hilfreich sein.
Bei der bipolar affektiven Erkrankung äußert sich die Depression in Kombination mit einer Hypomanie oder Manie. Diese Krankheitsdualität wird leider häufig übersehen, weil die Menschen im Höhenflug einer (Hypo-) Manie nicht als Patient:innen in der Ordination erscheinen. Die Behandlung einer bipolaren Erkrankung erfordert pharmakologisch eine andere Strategie. Psychoedukation ist beispielsweise ein wichtiger Behandlungsbaustein, damit die Patient:innen ihre Erkrankung besser wahrnehmen und schnell Gegenstrategien einleiten können – wie u. a. die Adaption der antidepressiven Therapie, die Beachtung der Stressfaktoren und eine rasche Kontaktaufnahme mit behandelnden Ärzt:innen.
Fazit
Die Depression – oder besser die affektive Störung – hat viele Variationen: Reden wir darüber, lassen wir uns von unseren Patient:innen ihre persönliche Variante erzählen und entwickeln wir persönliche Behandlungsmodelle! Grundpfeiler der Behandlung sind: Pharmakotherapie und Psychotherapie, psychosoziale Interventionen wie die Veränderung von Lebens- und Umweltbedingungen, Bewegung und Kontakt zu Mitmenschen, eventuell auch zu anderen Betroffenen.
Online-Tipp: buendnis-depression.at, psz.co.at
Vorschau: Lesen Sie in der Februar-Ausgabe der Hausärzt:in mehr zum Thema Schwangerschaftsdepression.
<
Vielgestaltige Dynamik

Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig
SeriePSYCHE
„A ls mich MR Dr. Reinhold Glehr, Hausarzt in Hartberg und Vorstandsmitglied der STAFAM, fragte, ob ich gemeinsam mit ihm über das Thema psychiatrische Erstbegegnungen in der hausärztlichen Praxis sprechen möchte, habe ich gleich zugesagt – und zwar wirklich gerne, weil ich die Kooperation zwischen Psychiatrie und Allgemeinmedizin als extrem wichtig erachte“, begann Priv.-Doz.
Dr. Christian Fazekas, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an der Med Uni Graz sowie Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, seinen Vortag am 52. Kongress für Allgemeinmedizin.* „ Der Stellenwert von Hausärztinnen und -ärzten bei psychosozialen Themen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Sowohl-als-auch-Perspektive
Einen Fokus legte Doz. Fazekas auf somatoforme bzw. funktionelle Störungen. „Wie wir wissen, handelt es sich um vielgestaltige Körperbeschwerden, bei denen keine hinreichend erklärende pathophysiologische Ursache festzustellen ist“, erläuterte der Psychiater und Psychotherapeut das Krankheitsbild. Alle

Hausärzt:in medizinisch 9 Jänner 2023 >
EXPERTE:
Priv.-Doz. Dr. Christian Fazekas Stv. Leiter der Univ.Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie, Med Uni Graz
© privat
© shutterstock.com/Kiselev
Andrey Valerevich
„Die Trennung von Psyche und Soma ist eine willkürliche.“
Organsysteme könnten betroffen sein, die Somatisierung sei zumeist mit Erschöpfung, Müdigkeit sowie verminderter Leistungsfähigkeit vergesellschaftet und häufig würden gesundheitsbezogene Ängste die Betroffenen plagen. „Oftmals ist die Anzahl der Arztbesuche groß. Der hohe Leidensdruck steht bei diesen Patientinnen und Patienten im Vordergrund“, weiß Doz. Fazekas. Man bewege sich in einem medizinischen Bereich, in dem keine klare Diagnose von Anfang an möglich sei. Vielmehr müsse man im Sinne einer Arbeitshypothese und Simultandiagnostik vorgehen. „ Möglichst früh eine ‚Sowohl-als-auchPerspektive‘ einzunehmen ist entscheidend – sprich: zu berücksichtigen, dass ein multifaktorielles Geschehen im Spiel sein kann. Psychosoziale Beschwerdeaspekte sind genauso zu beachten wie die somatischen.“ Bezüglich der Therapie verwies der Psychiater auf die S3-Leitlinie Funktionelle Körperbeschwerden (AWMF Nr. 051-001) und betonte: „ Zumeist gibt es nicht die schnelle Antwort auf oder Lösung für diese Beschwerden. Damit der Patient die unklare Situation besser ‚aushalten‘ kann, ist gerade bei somatoformen Störungen die Arbeit auf Ebene einer tragfähigen Arzt-Patienten-Beziehung wesentlich.“ Letztendlich sei ein multidisziplinäres Management gefragt. Komorbiditäten lägen bei Betroffenen häufig vor – etwa Depressionen und Angststörungen bei bis zu 50 % bzw. 30 %.
Frühe Anzeichen erkennen
In der frühen Phase von affektiven Störungen und Angsterkrankungen zeigen sich dem Experten zufolge häufig körperliche Begleitsymptome – bei einer Depression zum Beispiel unspezifische Kopf- oder Bauchschmerzen, Müdigkeit/Erschöpfung sowie Suchtmittelkonsum. Angsterkrankungen äußern sich mitunter unterschiedlich, je nachdem, welche Form vorliegt (siehe Tabelle). Betreffend bipolare Störungen unterstrich Doz. Fazekas, dass es bei Anzeichen wie dem typischen „ Auf und Ab der Gefühle“, euphorischen, selbstüberschätzenden (Risiko-)Verhalten und Schlafmangel erforderlich sei, Fach-
KÖRPERLICHE BEGLEITREAKTIONEN BEI ANGSTERKRANKUNGEN
Panikattacken
Herzrasen
Atemnot
Schwindel
Übelkeit
Zittern
Müdigkeit/Erschöpfung
plötzlich auftretende intensive Angst
Phobien
Vermeidungsverhalten (je nach Art der Phobie: Agoraphobie, Klaustrophobie, soziale Phobie, Flugangst usw.)
Generalisierte Angststörung
Schwitzen
Zittern
Schwindel
Oberbauchschmerzen
Schlaflosigkeit
innere Unruhe
Anspannung
sozialer Rückzug
generalisierte Ängstlichkeit
expertinnen und -experten besonders rasch einzubinden – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer erhöhten Suizidalität.
Auch bei somatoformen Störungen ist laut Doz. Fazekas das Suizidrisiko erhöht. Seine grundlegende Botschaft: „ Bitte sprechen Sie das Thema an und fragen Sie gezielt nach, wenn Sie bei einem Patienten eine Vermutung in Richtung Suizidgefährdung haben.“ Man wisse, dass Menschen, die eine Suizidhandlung durchführten, im Jahr und speziell in den Wochen davor vermehrt Kontakt mit dem Gesundheitssystem hätten – am häufigsten mit Hausärztinnen und -ärzten. „ Das Aufsuchen von Medizinerinnen und Medizinern vor der Suizidhandlung bietet eine besonders wichtige Gelegenheit für Interventionen zur Suizidprävention“, resümierte Doz. Fazekas. Natürlich müsse man das nicht allein bewältigen, vielmehr solle man Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen sowie Kriseninterventionszentren einbinden. Zudem gibt es in Österreich einen Nationalen Suizidpräventionsplan (SUPRA), der Orientierung bieten und hilfreiche Informationen liefern kann.**
Take-home-Message
Abschließend machte Doz. Fazekas aufmerksam: „ Psychiatrische und somatische Morbidität verstärken sich wechselseitig. Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung verursachen mitunter doppelt so hohe Kosten im Gesundheitssystem wie Personen, die psychisch gesund sind – aufgrund deutlich höherer Kosten im somatischen Bereich.“ Dass
das psychische Geschehen körperliche Symptome hervorruft, sei in den Bereichen Depression, Angsterkrankungen und funktionelle Störungen besonders häufig der Fall. Die Take-home-Message des Psychiaters lautet somit: „ Möglichst frühzeitig an die Arbeitshypothese psychiatrische Erkrankung und/oder psychosoziale Belastung denken. Denn die Trennung von Psyche und Soma ist eine willkürliche.“
Anna Schuster, BSc
* 52. Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), 24.-26. November 2022, Stadthalle Graz. Siehe auch Hausärzt:in 12/2022: „Plädoyer für diagnostische Unschärfe“, MR Dr. Reinhold Glehr.
** SUPRA – Suizidprävention Austria, siehe: gesundheit. gv.at/leben/suizidpraevention.html , sozialministerium. at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/ Psychische-Gesundheit/Suizid-und-SuizidpräventionSUPRA.html
AKTUELL
Psychosomatic Assessment Health Disk
An der Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie der Med Uni Graz wurde ein Tool entwickelt, das einen raschen Überblick über den Gesundheitszustand der Patientin/ des Patienten ermöglicht. In der „Health Disc“ wird die Zufriedenheit in sechs Dimensionen abgefragt: körperliches Befinden, Sozialleben, Sexualität, psychisches Befinden, Schlaf und Arbeits-/Leistungsfähigkeit. Erscheint ein Bereich besonders belastet, lässt sich gezielt nachfragen, außerdem kann das Tool zu Verlaufsbeobachtungen herangezogen werden.
Die „Health Disc“ ist unter folgendem Link abrufbar: psychologie.medunigraz.at/forschung/ klinische-forschung
Publikation: Fazekas C et al., Wien Klin Wochenschr 134, 569–580 (2022).
Hausärzt:in medizinisch 10 Jänner 2023
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Ein Weg hin zur Normalität – noch weit weg von der Selbstverständlichkeit
Wieso braucht es die Sensibilisierung für Themen der sexuellen und geschlechtlichen Identität in der Primärversorgung? Einerseits gibt es für LGBTIQA*-Personen spezifische Gesundheitsbedrohungen. Andererseits sind Hausärztinnen und -ärzte bei vielen Problemen erste Ansprechpartner:innen. Ein Outing kann mitunter im Rahmen der Anamnese erfolgen, wenn diese Informationen nötig sind, um eine adäquate Behandlung sicherzustellen. Nicht immer erfolgt eine Diskriminierung hierbei wissentlich oder mit Absicht – sie könnte oft verhindert werden.
Diskriminierung schadet
Der Arztbesuch ist zum Beispiel für queere Personen und Transpersonen (siehe Glossar) häufig mit unangenehmen Erfahrungen verbunden und stellt für jene Personen, die auf gesundheitliche Unterstützung angewiesen sind, eine zusätzliche Hürde dar. Sowohl dass dieses Thema aktuell ist als auch dass großer Handlungsbedarf gegeben ist, zeigt die Entstehung der Plattform queermed.at auf. Dort finden Patient:innen Empfehlungen zu „LGBTIQA*-freundlichen“ Ärzt:innen und haben außerdem die Möglichkeit, selbst welche abzugeben. Anderen wird dadurch der Gang zum bzw. zur Ärzt:in erleichtert. Negative Erfahrungen und bereits das Antizipieren von Ablehnung oder Anfeindung können der Gesundheit schaden:
Die Studienergebnisse von Kasprowski et al.1 zeigen, dass es um die psychische und die körperliche Gesundheit von LGBTIQA*-Menschen deutlich schlechter bestellt ist als um die der übrigen Bevölkerung. Gemäß diesen sind sie dreibis viermal so häufig von psychischen Erkrankungen betroffen und leiden öfter an potenziell stressbedingten körperlichen Krankheiten wie Migräne, Herzkrankheiten, Asthma und chronischen Rückenschmerzen. Als Datengrundlage der Untersuchung dienten 23.657 Personen mit heterosexuellen und 4.511 mit LGBTIQA*-Selbstbeschreibungen ab einem Alter von 18 Jahren in Deutschland. Der Begriff LGBTIQA* (lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell) steht für die Vielfalt von Geschlechtern und sexuellen Orientierungen – also für die gesamte Farbpalette des Regenbogens. Diese komplexe Mannigfaltigkeit sollte jedoch nicht auf die Sexualität beschränkt werden, sie umfasst auch die jeweils individuelle Identität, Lebensform und die dementsprechenden Bedürfnisse. In der medizinischen Praxis können all diese Aspekte bei der Prävention, Diagnose und Therapie von Krankheiten Berücksichtigung finden. Auf den folgenden Seiten geben Expert:innen hierzu verschiedenste Einblicke in ihre Praxiserfahrungen.
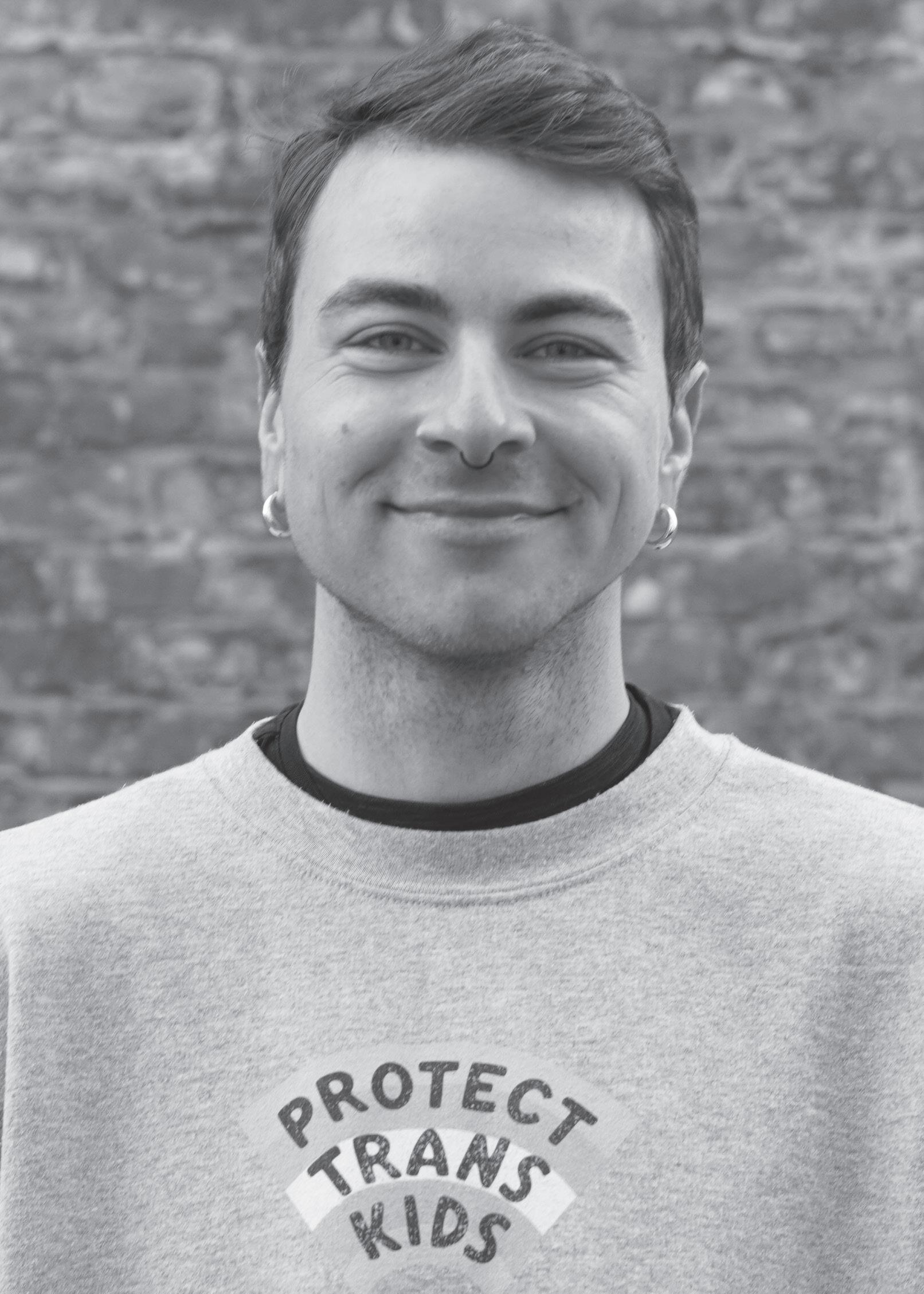
Mag.a Ines Pamminger, BA
1 DIW Wochenbericht, 2021/6, S. 79-88. doi.org/10.18723/diw_wb:2021-6-1
medizinische Versorgung statt Diskriminierung“
Die Diskriminierung von LGBTIQA*-Personen ist nach wie vor nicht verschwunden. Orte, an denen diese besonders häufig erlebt wird, sind Praxen von Ärzt:innen. Untersuchungen bringen sehr oft Coming-outs mit sich, speziell bei Transpersonen, da in der Anamnese etwaige Medikationen und Operationen offengelegt werden müssen. Häufig ist es ungewiss, wie die behandelnde Person auf das Outing reagieren wird und ob eine allfällige Behandlung angepasst erfolgen kann. Dies kann beispielsweise eine entsprechende Beratung zur Verhütung bei gleichgeschlechtlichem Sex betreffen, aber auch die medizinisch korrekte Behandlung von Transpersonen, die eine Hormontherapie machen. Queere Patient:innen haben deshalb zwei spezielle Bedürfnisse, wenn ein Ärzt:innenBesuch geplant ist: Zum einen sollen diskriminierende Erfahrungen vermieden werden, zum anderen muss eine adäquate medizinische Versorgung sichergestellt werden.
Um diese Unsicherheiten im Vorhinein abzubauen, wurde queermed gegründet. Es ist ein Online-Verzeichnis von queer-

12 Jänner 2023
„Adäquate
Julius Jandl Plattformgründer von queermed.at
© Tatjana Gabrielli
Das Team von queermed.at, dem Online-Verzeichnis von queer- und transfreundlichen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen.
und transfreundlichen Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen. Queeren Personen und Transpersonen wird dadurch der Gang zum Arzt oder zur Ärztin erleichtert.
Das Verzeichnis bekämpft aber klarerweise nur ein Symptom der anhaltenden Diskriminierung, die queere Personen und Transpersonen erfahren. Diskriminierung erfolgt dabei oft nicht mit böser Absicht, sondern aus Unwissen. Daher ist ein Hauptanliegen von queermed, dass medizinisches Personal besser für die Arbeit mit LGBTIQA*-Themen sensibilisiert und ausgebildet wird, um besser auf alle Patient:innen eingehen zu können.
oder „kein Eintrag“ möglich. Von Bezeichnungen wie Patienten und Patientinnen oder solchen mit Binnen-I ist abzuraten, die derzeit korrekte Bezeichnung ist Patient:innen oder Patient*innen. Für eine offizielle Geschlechtsänderung braucht es ein ärztliches Gutachten, welches Sie in Ihrer Praxis ausstellen können.
ist eine Form der emotionalen Gewalt“
Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner Direktorin der Gender Medicine & Diversity Unit, Frauengesundheitszentrum, Med Uni Innsbruck

Gender Medizin/Diversitas ist als Querschnittmaterie zu betrachten –d. h. in alle Fachbereiche der Medizin sowie in die Ausbildung aller Gesundheitsberufe und in die medizinischen Universitäten in Forschung, Lehre und Klinik zu integrieren. An der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) ist Gender Medizin/Diversitas beispielsweise in der Pflichtlehre und damit auch in den Pflichtprüfungen seit 2007 in allen unseren Studiengängen integriert – nämlich Humanmedizin, Zahnmedizin und Molekularmedizin und im klinischen PhD. Zusätzlich gibt es seit 2006 eine Gender Medizin/DiversitasRingvorlesung, daneben unterrichten wir seit 18 Jahren bei den Ärztetagen in Grado.
Laut Höchstgerichtsurteil und EuGHUrteil haben Menschen das Recht, weder als Frau noch als Mann bezeichnet oder benannt zu werden – d. h., die binäre Personenbezeichnung ist vorbei. Was heißt das für uns in der Praxis? Ich würde vorschlagen, Personen, die dezidiert darauf hinweisen, zu fragen, wie sie angesprochen werden wollen. Derzeit sind laut Innenministerium offiziell die Bezeichnungen „divers“, „inter“, „offen“
Immer wieder bieten konservative, religiöse und fundamentalistische Kreise – etwa Freikirchen und Sekten – eine sogenannte „Umpolung“ bzw. „Konversion“ von sexuellen Orientierungen und Identitäten an. D. h., mithilfe von Gehirnwäsche werden LGBTIQA* genötigt und manipuliert, ihre Emotionen und Bedürfnisse zu unterdrücken, sich ihrer zu schämen, starke Schuldgefühle zu entwickeln und ein heterosexuelles, normatives Leben zu führen bzw. heterosexuell zu schauspielern. Diese Manipulation kann aus psychotherapeutischer Sicht nur als unethisch erachtet werden. Konversionstherapie ist eine Form der emotionalen Gewalt. Manche Opfer dieser Gewalt unternehmen dann Suizidversuche oder verüben Suizid.

Wie kann ich LGBTIQA* unterstützen? LGBTIQA* benötigen folgende psychologische Unterstützung: Sie brauchen Menschen und Helfer:innen, die sie darin bestärken, sich selbst besser anzunehmen und zu akzeptieren. Helfende Berufsgruppen können dazu beitragen, dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans*idente, inter*, queere und asexuelle Menschen ein solides Selbstwertgefühl aufbauen, Selbstsicherheit erlangen und Bedürfnisse authentisch und frei leben können.
Helfende Berufsgruppen sollten die Bedürfnisse von LGBTIQA* immer ernst nehmen und validieren – ohne nach dem Warum zu fragen oder zu pathologisieren.
Die althergebrachten Normen von Sexualität haben nun endgültig ausgedient. An ihre Stelle tritt das, was man zusammenfassend mit der Abkürzung LGBTIQA* auszudrücken versucht – nämlich eine sehr individualisierte Vorstellung von dem, was es unter der Überschrift „ Sexualität des Menschen“ gibt. Nicht ein Sittenverfall, nicht sexuelle Devianz und auch nicht die Medien sind die Urheber all dessen. Nein, ganz im Gegenteil: LGBTIQA* gibt es, seit es Menschen gibt. Nur vermochte man nicht, darüber zu reden, aus Angst, selbst stigmatisiert zu werden, oder einfach auf Grund fehlenden Wissens.
Indessen hat das Wissen an Umfang zugenommen und tatsächlich lassen sich
GLOSSAR
LGBTIQA*: Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, trans*ident, inter*, queer und asexuell Lesbisch/schwul: gleichgeschlechtliche Orientierung von Frauen/Männern
Bisexuell: sexuelles Empfinden und Verhalten in Bezug auf das eigene wie auch ein anderes Geschlecht
Trans*Personen fühlen sich nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig. Inter*Personen sind mit genetischen, chromosomalen und/oder hormonellen Besonderheiten geboren worden, die sich nicht eindeutig dem Männlichen oder dem Weiblichen zuordnen lassen. Seit einigen Jahren sprechen sich ärztliche Richtlinien gegen rein kosmetische Eingriffe im frühen Kindesalter aus.
Queere Personen fühlen sich einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig.
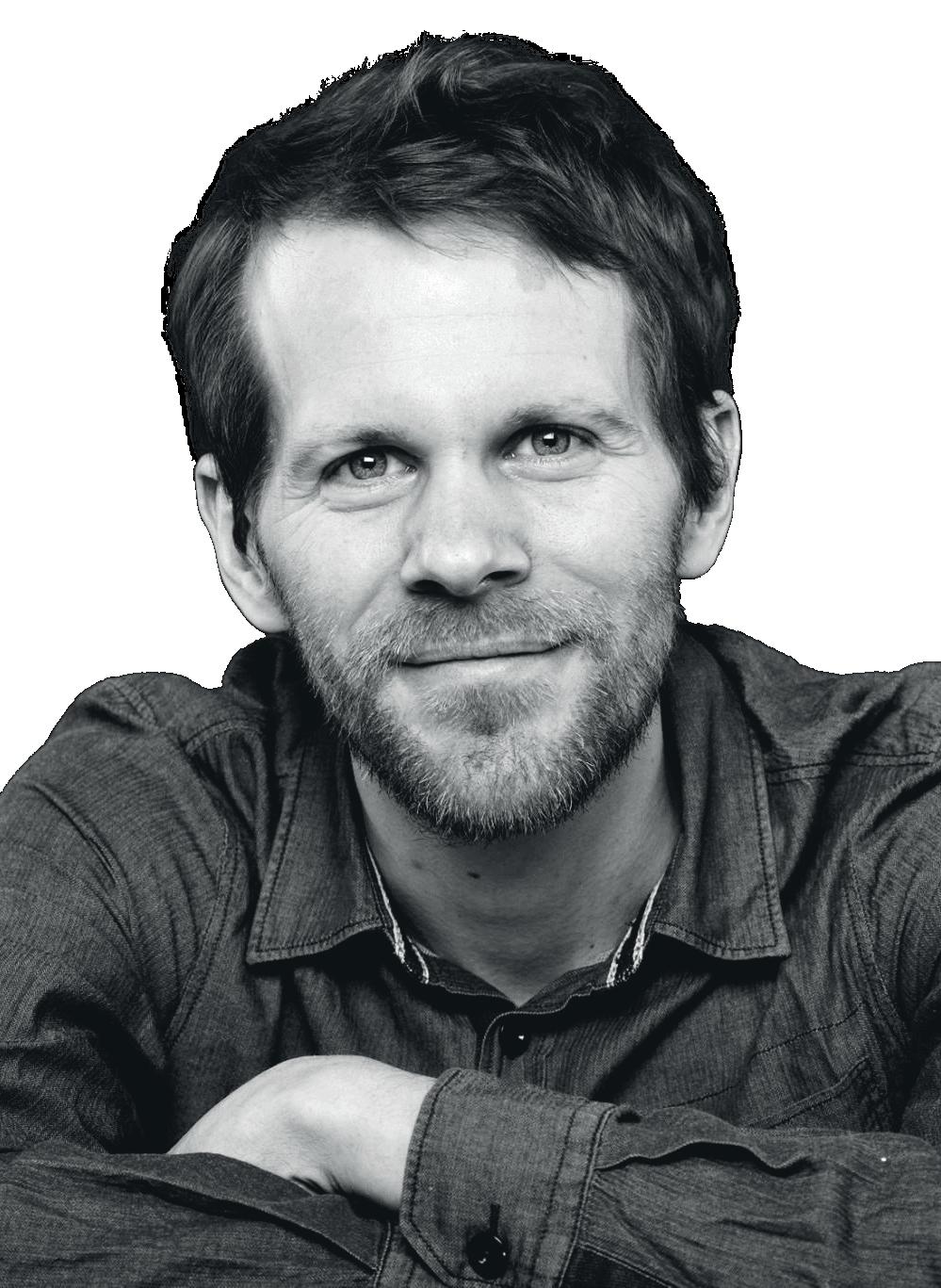
Cisgender: Übereinstimmung der Geschlechtsidentität einer Person mit ihrem bei der Geburt (biologisch) zugewiesenen Geschlecht
Pansexualität: geschlechtsunabhängiges Begehren
Asexualität: Abwesenheit sexueller Empfindung gegenüber anderen
Hausärzt:in politisch 13 Jänner 2023
„Die binäre Personenbezeichnung ist vorbei“
„Konversionstherapie
„LGBTIQA* gibt es, seit es Menschen gibt“
>
© Tatjana Gabrielli
© Christof Lackner
Mag. Florian Friedrich, BA Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Salzburg
© Christoph Strom
MR Dr. Georg Pfau Sexualmediziner in Linz
© richter-fotografie.com
alle unter dieser komplizierten Abkürzung subsummierten Phänomene auf Basis der Embryologie und Endokrinologie biologisch erklären.
„LG“ beschreibt die sexuelle Orientierung jedes Menschen auf ein gewisses Geschlecht hin. Die Mehrheit der Männer ist gynäphil orientiert („steht“ also auf Frauen), aber eben nicht alle – vice versa die Frauen.
Auch die Transsexualität lässt sich aus der somatosexuellen Entwicklung des Menschen erklären. „Echte“ Transsexualität ist keine Marotte oder Laune, sondern der schuldlos akquirierte, unveränderbare Wunsch, in einem anderen als dem Geburtsgeschlecht durchs Leben zu gehen. Es gibt keine Therapie dafür, außer das Geschlecht des Körpers an das des Gehirns anzugleichen. Betroffene haben ein Recht auf eine faire und seriöse Behandlung – der ganze Vorgang von der Erkenntnis der eigenen Transsexualität bis hin zur Geschlechtsanpassung ist belastend genug.
Eine erfüllte Sexualität ist eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen des Lebensglücks. Grundsätzlich sollten wir Ärzt:innen bereit sein, allen Formen der Sexualität unserer Patient:innen wohlwollend gegenüberzustehen und sie entsprechend affirmativ zu behandeln. Außer die gelebte Sexualität führt zu einem physischen oder psychologischen Schaden, dann ist es unsere Pflicht einzugreifen.
„Anerkennung der Identität“
problematisch ist. Manche warten damit jedoch bewusst bis zum Ende der Schulzeit oder länger, um sich Anfeindungen zu ersparen. Denn: Auch wenn sich einiges verbessert hat – Diskriminierung ist keine Seltenheit. Auch das Nicht-ernstNehmen oder In-Frage-Stellen der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ist eine Form von Diskriminierung. Daher können Personen in Gesundheitsberufen durch ihre Reaktionen, ihre Fragen und Hilfestellungen unterstützend oder aber diskriminierend wirken. Was Menschen in einem Coming-outProzess vor allem brauchen, ist Respektierung und Anerkennung ihrer Identität. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind immer schon Teil des Lebens. Daher sollte auch möglichst unaufgeregt damit umgegangen und vor allem darauf geachtet werden, was die Person in ihrem individuellen Prozess gerade braucht. In manchen Fällen ist die Empfehlung von spezialisierten Beratungsstellen (z. B. Courage-Beratung1) sinnvoll. Oft ist jedoch schon ein selbstverständliches Anerkennen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt enorm entlastend. Auch durch das Auflegen von Foldern oder Aufhängen von Plakaten zum Thema LGBTIQA* kann dieses Anerkennen bereits sichtbar gemacht werden.
1 Courage ist eine anerkannte Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen, die Beratung ist kostenlos und anonym: courage-beratung.at
LEITFADEN FÜR ÄRZT:INNEN
In Zusammenarbeit mit Queermed Deutschland hat Queermed Österreich einen Leitfaden für einen diskriminierungssensiblen Umgang mit Patient:innen entwickelt. Einerseits soll durch die dort erwähnten Maßnahmen Ungleichbehandlung verhindert werden, andererseits können Signale gesetzt werden, welche die Angst vor dieser reduzieren: queermed-deutschland.de/leitfaden-sensibilisiertenumgang-mit-patientinnen
Mag.a Stefanie



Rappersberger Psychologin, Sexualpädagogin, FH-Campus Wien, Lehrgangsleitung Sexualpädagogik der ÖGS, Vorstandsmitglied der Plattform Sexuelle Bildung
Wie herausfordernd ein Coming-out-Prozess ist, hängt ganz wesentlich davon ab, wie das Umfeld – die Familie, die Freund:innen und auch Lehrer:innen oder Ärzt:innen – darauf reagiert. Je unterstützender das soziale Umfeld ist, desto geringer ist die Belastung. Es gibt sehr gelungene Prozesse, bei denen – aufgrund der Akzeptanz und Unterstützung durch Eltern, Freund:innen und Umfeld – das Coming-out insgesamt un-
Regenbogenfamilien sind Familien, in denen sich mindestens ein Elternteil als LGBTIQA* identifiziert. Sie sind aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität der Eltern vielfäl-
tigen Formen der Diskriminierung im rechtlichen und privaten Bereich ausgesetzt, welche die Gesundheit der Familienmitglieder beeinträchtigen können.1 Das bekannteste Modell zur Erklärung der psychischen und physischen Auswirkungen von Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität ist das Minderheitenstressmodell.2 Dieses ordnet Stressfaktoren im Zusammenhang mit dem Minderheitenstatus in ein Spektrum ein, das sich von distalen (z. B. Belästigung, Hassdelikte) bis hin zu proximalen (z. B. Verheimlichung der eigenen sexuellen Orientierung, Erwartung von Ablehnung) Faktoren erstreckt. Der individuelle Minderheitenstress kann sich in Regenbogenfamilien in analoger Weise auf der partnerschaftlichen und familiären Ebene manifestieren. Diese Stressoren reichen von rechtlicher Diskriminierung (z. B. fehlende rechtliche Absicherung der Eltern-Kind-Beziehung) über Aggressionen im Alltag (z. B. Mobbing des Kindes in der Schule) bis hin zur Internalisierung negativer gesellschaftlicher Einstellungen oder zum Verheimlichen der Partnerschaft oder der Familienform. Mittels eines aktuellen systematischen Reviews werden wir die verschiedenen Formen der Diskriminierung von Regenbogenfamilien und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern, ihre Beziehungen und das gesamte Familienleben zusammenfassen und die Befunde in einem integrativen Risiko-ResilienzFamilienmodell beschreiben.3 Diese Forschung trägt dazu bei, für die Folgen von Diskriminierungserfahrungen in Bezug auf die psychische und körperliche Gesundheit aller Familienmitglieder
Hausärzt:in politisch 14 Jänner 2023
„Minderheitenstress in Regenbogenfamilien“
© Toni
Rappersberger
Univ.-Prof.in Dr.in Martina Zemp Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien
Magdalena Siegel, BSc MSc Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien
© Barbara Mair © privat
von Regenbogenfamilien zu sensibilisieren sowie ihnen vorzubeugen.
Literatur:
1 Siegel M et al., Front. Psychol., 2021, 12, Article 644258. doi.org/10.3389/fpsyg.2021.644258
2 Meyer IH, Psychological Bulletin, 2003, 129, 674–697. doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674
3 Siegel M et al., Children. 2022, 9(9), 1364. doi.org/10.3390/children9091364
„A kzeptanz in der Arztpraxis?!“
Die Geschlechtsidentität einer Person ist, wie sie ist! Da gibt es nichts zu „akzeptieren“ oder zu „tolerieren“ – oder müssen Heterosexuelle danach trachten, „akzeptiert“ zu werden? Die individuelle Wahl seines Seins braucht aus Sicht der Psychoanalyse nur eine Grundvoraussetzung: Sie sollte nach eigenem Wunsch autonom erfolgen – und nicht durch Druck von außen, etwa durch gesellschaftliche oder soziale Normen. Seit 30 Jahren begleite ich – z. B. im Rahmen meiner hausärztlichen, aber auch meiner psychotherapeutischen Tätigkeiten – Menschen bei ihrem Comingout. Infolgedessen wurde meine Ordination als „schwulenfreundlich“ auf der HOSI-Website1 angeführt – als ob dies eine besondere Erwähnung wert sein sollte! In jüngster Zeit tritt das Transgender-Thema stärker in den Vordergrund; dutzende Menschen wurden und werden in unserer Praxis schon begleitet. Neben psychosozialen sind bei der Geschlechtsidentität auch medizinische Besonderheiten zu berücksichtigen, etwa Nebenwirkungen diverser Behandlungen, aber auch geschlechtsspezifische Risikoprofile, Krankheitshäufigkeiten und spezielle pharmakologische Behandlungen. Das fächerübergreifende Miteinander funktioniert in Tirol aus Sicht der Hausarztmedizin vollkommen friktionsfrei – z. B. mit der HIV-Ambulanz bei der Prävention von Geschlechtskrankheiten oder mit der Hormonambulanz bei der Transgender-Begleitung. Alle Beteiligten profitieren dabei von klaren Gestaltungsabläufen und einem fortlaufenden fachlichen Austausch.
1 Homosexuelle Initiative Tirol, hositirol.at
„P flege laut Ethikkodex“
Professionelle Pflege wird laut dem Ethikkodex mit Respekt und ohne Wertung des Alters, der Hautfarbe, des Glaubens, der Kultur, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung ausgeübt. Für Pflegeberufe ergibt sich somit auch aus beruflich-ethischem Verständnis ein Bedarf, das eigene Wissen bezüglich sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Bereich der Pflege zu prüfen und sich für dieses Thema zu sensibilisieren. Vor allem beschäftigt sich die professionelle Pflege mit den Aktivitäten des täglichen Lebens. Eine davon ist auch die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Um bedarfsgerechte Pflegeinterventionen setzen zu können, werden zu Behandelnde in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet. Krankheiten sind in ihrer Entstehung auch auf Faktoren der individuellen Lebensweisen zurückzuführen, dabei spielt der Bereich der Sexualität eine wesentliche Rolle. Es ist wichtig, sich als Pflegeperson in diesem Bereich gut auszukennen, da Pflegekräfte Personen in unterschiedlichen Bereichen und Lebensphasen zu dieser Thematik begleiten. Sei es zum Beispiel …
Ö-Nurse-Praxis
• … in der Schulgesundheitspflege, um Gesundheitskompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sexuellen Gesundheit zu fördern und bei der sexuellen Entwicklung zu unterstützen.
• … die professionelle Begleitung von Männern und Frauen bei einer Geschlechtsumwandlung im stationären Krankenhausprozess.
• … die Unterstützung von älteren Menschen, die lebenslang ihre sexuellen Bedürfnisse heimlich ausgelebt haben. Wenn diese bei zunehmender Pflegeabhängigkeit zum Vorschein kommen, gilt es, sich der Probleme der Menschen anzunehmen und Lösungen zu finden.
• … die Gewährleistung psychosozialer Betreuung bei unheilbarer sexuell übertragbarer Krankheit.
• U. v. m. …
Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben, sind in der medizinischen Versorgung oft Vorurteilen ausgesetzt, die seitens der Behandler:innen zu besonders überzogenen Schutzmaßnahmen vor vermeintlichen Ansteckungsgefahren führen. So gibt es Berichte, dass Personen mit einer HIV-Infektion bei endoskopischen Untersuchungen letztgereiht werden, um Kreuzkontaminationen der Gerätschaft zu verhindern, bei Alltagstätigkeiten im Spitalssetting vom Gegenüber plötzlich Handschuhe angelegt werden oder die zahnärztliche Behandlung durch vorgeschobene Erklärungen abgelehnt wird. Derart diskriminierende Maßnahmen sind nicht nur unbegründet, sondern hinterlassen auch Narben im Selbstwert der Betroffenen und können zu psychischen Problemen führen. Bei Menschen, die über ihre HIV-Infektion Bescheid wissen und regelmäßig eine moderne antivirale Medikation einnehmen, lässt sich nämlich im Normalfall kein Virus im Blut und anderen Körperflüssigkeiten nachweisen: Daher gibt es auch keine erhöhte Ansteckungsgefahr und besondere Schutzmaßnahmen sind nicht notwendig.
Univ. Prof. Dr. Alexander Zoufaly FA für Innere Medizin und Infektiologie, Präsident der Österreichischen AIDS-Gesellschaft

Eine relevante Virusmenge lässt sich übrigens auch nicht bei HIV-positiven Müttern nachweisen, die bereits in der Schwangerschaft und weiter danach regelmäßig eine moderne HIV-Medikation einnehmen. Dadurch ist eine Übertragung auf das Kind während der Geburt und auch beim Stillen praktisch ausgeschlossen. In jedem Fall ist das frühzeitige Erkennen einer Infektion durch den HIV-Test in jeder Schwangerschaft essentiell. Sollte der Test positiv ausfallen, ist unbedingt eine rasche Therapieeinleitung und deren engmaschige Überwachung durch eine:n erfahrene:n HIV-Behandler:in notwendig.


Hausärzt:in politisch 15 Jänner 2023
„Überzogene HIVSchutzmaßnahmen“
Dr. Herbert Bachler Hausarzt, Psychotherapeut, TGAM-Präsident, Innsbruck
© privat
Daniel Peter Gressl, DGKP
für Gesundheits- und Krankenpflege, Judenburg
© privat
< © shutterstock.com/Rainbow Black
© Michael Mrkvicka
Ein Gewinn an Lebensqualität
HIV-Therapie: Nur mehr sechs statt 365 Behandlungstage jährlich
mediziner gemeinsam eine Gruppenpraxis in Wien und verfügen über langjährige Erfahrung in der Behandlung von HIV-positiven Patient:innen. Für sie stellt die Zulassung dieser Dualtherapie „einen noch revolutionäreren Schritt in der HIV-Therapie dar, als die Einführung von once-daily-Regimen“ Da die beiden Substanzen nur alle zwei Monate injiziert werden müssen, seien Patient:innen nicht gezwungen, täglich an die Einnahme ihrer Medikamente zu denken. Die Behandlung mit Cabotegravir und Rilpivirin bedeutet für Patient:innen nur sechs Behandlungen pro Jahr ab der ersten Erhaltungsdosis, somit reduziert sich die Anzahl der Behandlungstage von 365 auf sechs.
Anwendung
Dank moderner Therapien können HIV-positive Menschen inzwischen ein Leben bei guter Gesundheitsprognose führen – sofern die Diagnose und der Behandlungsbeginn frühzeitig erfolgen. Die lebenslange Einnahme antiviraler Medikamente stellt Betroffene dennoch vor große Herausforderungen.
Ein unschöner Reminder
55 % (n = 1306/2389) der Personen, die nach ihren Behandlungswünschen und ihrer Einstellung zu innovativen Medikamenten befragt wurden, zogen es vor, nicht jeden Tag Medikamente einnehmen zu müssen, solange ihre HIV-Infektion unterdrückt bleibt.1 Dies zeigte die von ViiV Healthcare durchgeführte globale HIV-Patient:innenstudie Positive Perspectives Wave 2. Darüber hinaus gaben 58 % (n = 1394/2389) an, dass die tägliche Einnahme eine ständige Erinnerung an HIV in ihrem Leben
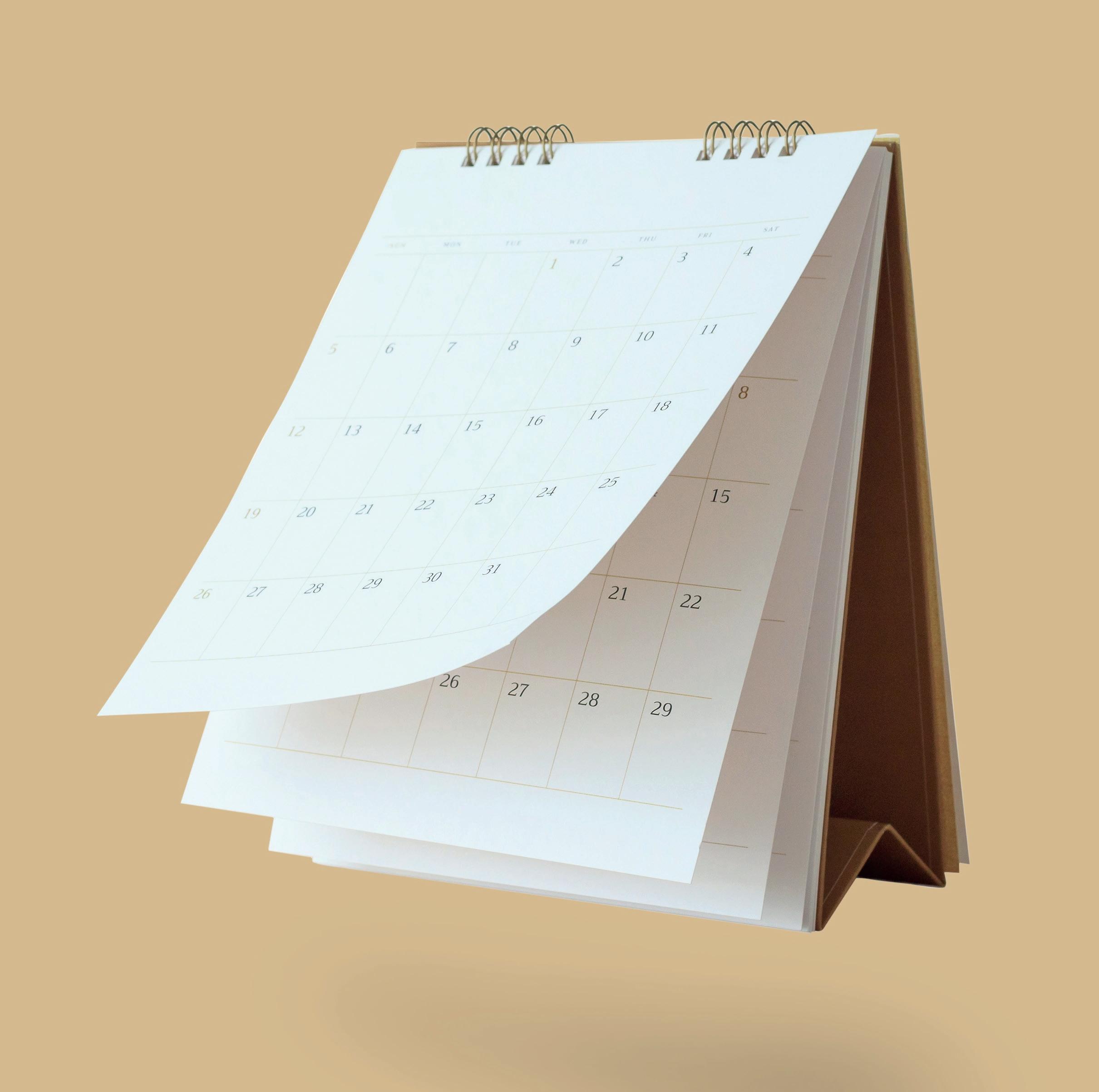
darstelle. Bis zu 38 % (n = 906/2389) der Teilnehmer:innen berichteten über Ängste, dass die tägliche Medikation die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte, ihren HIV-Status anderen gegenüber zu offenbaren.2
Neue Langzeittherapie
Die Kombination der beiden Wirkstoffe Cabotegravir und Rilpivirin ist die erste langwirksame HIV-1-Therapie zur Behandlung virologisch supprimierter Erwachsener (HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml), welche nur alle zwei Monate angewendet werden muss. Seit Jänner 2023 wird sie aus der Gelben Box im österreichischen Erstattungkodex erstattet. Dr. Horst Schalk, Vorstandsmitglied der ÖGNÄ-HIV (Österreichische Gesellschaft niedergelassener Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter) und Dr. Karl Heinz Pichler, Vizepräsident der ÖGNÄ-HIV führen als Allgemein-
Cabotegravir ist in Kombination mit Rilpivirin für die Behandlung von Infektionen mit dem humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) bei Erwachsenen, die virologisch supprimiert (HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml) und auf einem stabilen antiretroviralen Regime eingestellt sind, indiziert. Die beiden Wirkstoffe werden zum gleichen Termin von einer medizinischen Fachkraft als zwei intramuskuläre Injektionen in das Gesäß verabreicht. Um die Verträglichkeit der Arzneimittel vorher zu prüfen, können Cabotegravir und Rilpivirin vor Beginn der Injektionen über einen Zeitraum von etwa einem Monat (mindestens 28 Tage) in Tablettenform gegeben werden. Die Patient:innen dürfen keine gegenwärtigen oder dokumentierten Resistenzen gegenüber nicht-nukleosidalen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTI) oder Integrase-Inhibitoren (INI) aufweisen und es darf unter diesen Wirkstoffklassen in der Vergangenheit zu keinem virologischen Versagen gekommen sein.
PA/InP
1 De Los Rios P et al., Popul. Med. 2020;2(July):23. doi.org/10.18332/popmed/124781
2 De Los Rios P et al., AIDS Behav. 2021 Sep;25(9): 961–972. doi.org/10.1007/s10461-020-03055-1
Hausärzt:in politisch 16 Jänner 2023 © shutterstock.com/Kwangmoozaa
Auf dem Weg zum gefühlten Geschlecht
Eine professionell begleitete, auf Informationen basierende Transition stellt die wirksamste Behandlungsoption von transidenten Menschen dar
„Das Outing ist ein heikler Prozess und eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit. Anfangs hat man viele Zweifel und ist sich oft selbst nicht im Klaren darüber, wer man ist. Das hält einige davon ab, nach außen zu gehen. Es jemandem zu sagen, ist die größte Hürde für viele“, sagt Sam Vincent Schweiger. Als Transmann kennt er die innere Zerrissenheit, wenn die gefühlte Geschlechtsidentität nicht mit den biologischen Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Hausärzt:innen können Betroffene auf ihrem Weg begleiten – es gilt, Möglichkeiten und Grenzen der geschlechtsangleichenden Interventionen aufzuzeigen und gleichermaßen den Wunsch nach dahingehenden Maßnahmen sowie ihre Notwendigkeit individuell zu prüfen.
Entpathologisierung der Transidentität
Die Revision der ICD-Klassifikation hat sowohl zu einer längst fälligen Entpathologisierung als auch zu einer Entstigmatisierung beigetragen. In der ICD-11 wurde der ursprüngliche Begriff „Transsexualismus“ durch „Geschlechtsinkongruenz“ ersetzt: Transidentität wird nicht mehr den Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen zugeordnet, sondern als eine Normvariante der Geschlechtsidentitätsentwicklung angesehen. Die
ärztliche Diagnose sollte sich demgemäß weniger auf die Geschlechtsidentität an sich beziehen, sondern vielmehr auf die Entität der Betroffenen, auf die Kontinuität der Selbstdefinition sowie auf den Leidensdruck und die Begleitumstände. „Es gibt keinen richtigen oder falschen Hinweis, ob man transident ist oder nicht. Jede Person kann nur die Summe der Gefühle, die sie in sich trägt, und den Wunsch, im empfundenen Geschlecht zu leben, als ‚Beweis‘ sehen“, so Schweiger. Er empfiehlt, sich bei der Auswahl geeigneter Therapieverfahren am Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung zu orientieren.
Die hausärztliche Praxis als Drehscheibe zum Fachbereich
Eine Transition bietet Transpersonen die Aussicht, in ihrer gefühlten Identität zu leben. Gleichzeitig hat dieser Entschluss langfristige Folgen, die sorgfältig evaluiert werden müssen. Auf welchen Wegen Transpersonen in das Gesundheitssystem gelangen, ist unterschiedlich. Vor allem im ländlichen Bereich öffnen sich viele zunächst ihren Hausärzt:innen. Als Brückenbauer:innen können diese auf die Anliegen der Betroffenen eingehen und entsprechende Hebel in Bewegung setzen – etwa indem niedergelassene Ärzt:innen als Schnittstelle in Hinblick
auf Fachorganisationen fungieren. Unabdingbare Voraussetzung, um eine geschlechtsangleichende Hormontherapie starten zu können, sind die Sicherung einer Diagnose und die Indikationsstellung durch erfahrene Psychotherapeut:innen oder Psychiater:innen.
Identitätsstiftend: Geschlechtsangleichende Hormontherapie
„Um die geplante Hormontherapie an das individuelle Risikoprofil anzupassen, sind eine ausführliche Eigen- und Familienanamnese, körperliche Untersuchungen und die Bestimmung relevanter laborchemischer Parameter notwendig“, macht Coach, Supervisorin und Hormonspezialistin Dr.in Katharina Maria Burkhardt auf das wegweisende prätherapeutische Risikoscreening aufmerksam. Komorbiditäten wie Diabetes, arterielle Hypertonie, eine Fettstoffwechselstörung oder chronische Lebererkrankungen müssen einer adäquaten Behandlung zugeführt werden und stellen bei suffizienter Therapie keine absolute Kontraindikation dar.
Im Wesentlichen findet bei Transfrauen eine Estrogensubstitution und Androgensuppression statt, während bei Transmännern eine Testosteronsubstitution und Estrogensuppression durchgeführt

Hausärzt:in politisch 18 Jänner 2023
© shutterstock.com/Katya
Rekina
wird. „Idealerweise werden bioidente Hormone verwendet und transdermal appliziert“, merkt Dr.in Burkhardt an. Man könne dadurch den First-Pass-Effekt der Leber umgehen, wodurch „zum Teil unerwünschte Nebeneffekte – etwa eine geringere Bioverfügbarkeit und somit auch geringere Wirkung sowie die Notwendigkeit von höheren Dosen –ausbleiben“, so die Expertin. Nach Therapieeinleitung sind regelmäßige klinische und laborchemische Verlaufskontrollen erforderlich: um die richtige Dosis zu finden, in dreimonatigem Abstand, später in jährlichen Intervallen. „Um Werte vergleichen zu können, sollten diese immer mit derselben Hormonanwendungspause (24 h bei transdermaler und oraler Hormonzufuhr), beim selben Labor, zur gleichen Uhrzeit und bei einem
vorhandenen Zyklus am gleichen Zyklustag bestimmt werden “ Hausärzt:innen können Transpersonen während der geschlechtsangleichenden Hormontherapie medizinisch betreuen, wenn eine solche durch eine Fachkraft etabliert wurde.
Chirurgische Therapieoptionen
Rigide Behandlungsrichtlinien mit Altersbeschränkung und zeitlichen Vorgaben für den Ablauf der Transition sind problematisch und werden mehrheitlich nicht (mehr) befürwortet. Auch die Entscheidung für oder gegen bestimmte körpermodifizierende Behandlungen sollte sich bei Indikation an den Bedürfnissen der behandlungsuchenden Person orientieren – mit der obersten Prämisse, bestehendes oder antizipier-
tes Leid zu mindern. Die chirurgischen Behandlungsmethoden sind hierbei mannigfaltig: Sie reichen von der Entfernung respektive Rekonstruktion der Geschlechtsorgane des biologischen Geschlechts (z. B. Hysterektomie, Adnektomie, Mastektomie) bis hin zum Aufbau der Geschlechtsorgane des gelebten Geschlechts (z. B. Penoidaufbau).
Mag.a Sylvia Neubauer
LINKS ZUM THEMA
Behandlungsstandard Transidentität hormon-netzwerk.at (unter Downloads)
„Transmenschen brauchen einen Platz im Gesundheitssystem“
troffene – Transgender-Personen wie Angehörige – wenden können. Transidenten Menschen mangelt es hier oft an Orientierung – das beginnt bereits mit der Frage „Welche Ärzt:in soll ich aufsuchen? “ .
Informationen, Schulungen und Workshops transgender-team.at schweigsamer.at © privat
Haben Sie konkrete (gesundheitspolitische) Verbesserungsvorschläge?
Sam Vincent Schweiger ist Gründungsmitglied der Peer-to-Peer-Beratungsstelle TTA (Transgender Team Austria). Im Gespräch mit der Hausärzt:in macht er auf teils gravierende Lücken in der medizinischen Versorgung von Menschen, die sich als trans* erleben, aufmerksam.

HAUSÄRZT:IN: Woran mangelt es in der Gesundheitsversorgung von Transmenschen?
SCHWEIGER: Was fehlt, ist eine umfassende Struktur bzw. Infrastruktur. Es gibt viel zu wenige Anlaufstellen in den Bundesländern, an die sich Be-
TTA ist eine ehrenamtliche Beratungsstelle, in der Transmenschen sowie Therapeut:innen ihre Erfahrungen und ihr Wissen an andere weitergeben. Es bräuchte jedoch mehr öffentliche Stellen für die Behandlung und Begleitung von Transitionen. Die wenigen auf Transpersonen spezialisierten Ärzt:innen werden häufig überrannt – Transgender-Ambulanzen stoßen an ihre Grenzen. Für spezifische Operationen steht österreichweit nur wenig Fachpersonal, für den Penoidaufbau gar nur ein einziger Arzt zur Verfügung. Wartezeiten von mindestens sechs Monaten für Therapieplätze und operative Geschlechtsangleichungen sind keine Seltenheit. Hinzu kommt, dass Ärzt:innen auf die Anforderungen, die Transpersonen an sie stellen – die Beratung, Behandlung und Nachbetreuung –, nicht immer adäquat reagieren. Das ist verständlich, weil Erfahrung und Wissen fehlen.
Das Gesundheitssystem für Transpersonen muss sich strukturell verbessern – in erster Linie durch die Schaffung öffentlicher Kompetenzzentren und breiter interdisziplinärer Netzwerke. Auch Schulungsarbeit ist ein Thema. TTA bietet Weiterbildungen in Form von Schulungen und Workshops in Schulen und Arztpraxen an. Daneben wären aber auch professionell aufgestellte Informations- und Weiterbildungszentren, die sich explizit an interessierte Mediziner:innen richten, vonnöten. Im Kleinen hilft es schon, wenn in der medizinischen Grundversorgung positive Zeichen gesetzt werden – zum Beispiel, indem Informationsmaterial über Transorganisationen in der Ordinationspraxis aufliegt. Neben der Informationsvermittlung wird so auch ein trans*freundlicher Rahmen geschaffen. Generell wäre es von Bedeutung, den Bereich der Gendergesundheit und -medizin bereits in der medizinischen Grundausbildung zu implementieren. Man kann hier eine Nische besetzen, deren Bedeutung wächst.
Das Interview führte Mag.a Sylvia Neubauer.
Hausärzt:in politisch 19 Jänner 2023
Sam Vincent Schweiger von Transgender Team Austria.
Praxiswissen: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod
State of the Art – die ESC-Guidelines 2022

Die neuen Guidelines für ventrikuläre Tachykardien (VT) und die Prävention des plötzlichen Herztodes („ s udden cardiac arrest – SCA“) wurden im Rahmen des diesjährigen ESCKongresses in Barcelona präsentiert.1 Sie sind sehr umfangreich, da auch viele Empfehlungen bezüglich genetischer Herzerkrankungen implemen-

tiert wurden. Nichtsdestotrotz sind die Empfehlungen sehr praxisrelevant und wurden durch viele Abklärungsund Entscheidungsbäume auch überaus anwenderfreundlich gestaltet. Da die Abhandlung aller Krankheitsentitäten [ischämische Kardiomyopathie (CMP), nichtischämische CMP, extrasystolieinduzierte CMP, hypertrophe
CMP, arrhythmogene CMP, inflammatorische CMP oder primäre elektrische Herzerkrankungen] zu umfangreich wäre, werden in diesem Artikel die koronare Herzerkrankung (KHK) als häufigste Entität und die extrasystolieinduzierte CMP herausgegriffen, zudem wird auf die Neuerungen in den Guidelines eingegangen.
Hausärzt:in DFP 20 Jänner 2023 © shutterstock.com/Carolina
LITERATUR
K. Smith MD
Indikationen zur Katheterablation
Bezüglich der Katheterablation bei Patientinnen und Patienten mit KHK und symptomatischen VT- bzw. ICD-Schocks (ICD = implantierbarer KardioverterDefibrillator) besteht eine Klasse-I-Indikation. Zusätzlich sollte die Ablation der Eskalation einer medikamentösen anti-
arrhythmischen Therapie (z. B. neuerliche Aufsättigung mit Amiodaron) vorgezogen werden. Auch können Personen mit einer hämodynamisch tolerierten VT und einer linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) von ≥ 40 % nun – als Alternative zu einer ICD-Versorgung – primär einer Ablation unterzogen werden (IIa). Eine prophylaktische Katheterablation bei KHK kann (nach ICD-Versorgung) erwogen werden, wurde aber auf eine IIb-Indikation herabgestuft.
Wann mit ICD versorgen?
Die Indikation einer ICD-Versorgung bei KHK war bisher nur bei einer LVEF von ≤ 35 % und einem NYHA(„ New York Heart Association“)-Stadium II-III gegeben. Gemäß den neuen Guidelines sollte man Patientinnen und Patienten mit ischämischer CMP auch im NYHA-Stadium I mit einem primärprophylaktischen ICD versorgen, wenn die LVEF ≤ 30 % beträgt (IIa). Überdies sollten Betroffene, die nach dreimonatiger optimaler medikamentöser Therapie eine LVEF zwischen 36 und 40 % und nichtanhaltende VT im Langzeit-EKG zeigen, einer elektrophysiologischen Untersuchung unterzogen werden. Sind hier VT auslösbar, ist eine ICD-Versorgung indiziert (IIa). Im Fall einer Synkope bei einem vorangegangenen Myokardinfarkt wird ebenso eine elektrophysiologische Untersuchung empfohlen, wenn die nichtinvasiven Tests zur Synkopenabklärung unauffällig waren (IIa). Bei Patientinnen und Patienten mit Koronarspasmen als Genese eines SCA besteht nun ebenfalls eine IIa-Indikation zur ICD-Implantation. Als Beispiel für einen Algorithmus der neuen Guidelines sei hier die Abklärung und Behandlung bei stabiler KHK gezeigt (siehe Abb. 1, S.22).
Weitere Neuerungen der ESC-Guidelines
VES-induzierten CMP gab es folgende Neuerungen: Prinzipiell sollte eine VES-induzierte CMP angenommen werden, wenn die VES-Last im HolterEKG über 10 % liegt (IIa). Bei diesen Patientinnen und Patienten ist auch eine kardiale MRT empfohlen, um die idiopathische (nicht strukturelle) Genese der Erkrankung zu bestätigen (IIa).
Therapeutisch wird für die symptomatische VES/VT oder die VES-induzierte CMP die Katheterablation als KlasseI-Indikation empfohlen, wenn der Ursprungsort der VES der rechte Ausflusstrakt oder der linke Faszikel ist. Im EKG zeigt sich hier typischerweise bei der rechtsventrikulären Ausflusstrakttachykardie (RVOT) ein Linksschenkelblock mit inferiorer Achse und Überganszone V4 (siehe Abb. 2, S. 22) – oder bei Ursprung im linksposterioren Faszikel ein Rechtsschenkelblock mit superiorer Achse und relativ schmalem Kammerkomplex um 130 ms (siehe Abb. 3, S. 22).
GASTAUTOR: Prim. Priv.-Doz. Dr. Martin Martinek, MBA, FESC, FHRS Leiter der Abteilung für Innere Medizin 2 mit Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen
Bei einem VES-Ursprung in anderen Regionen besteht eine IIa-Indikation zur Ablation. Alternativ können Betablocker oder – bei symptomatischen Patienten ohne CMP – Kalziumantagonisten vom Nichtdihydropyridin-Typ bzw. Flecainid versucht werden (IIa). Auch bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten mit > 20 % VES-Last kann eine Katheterablation erwogen werden, um einer CMP vorzubeugen (IIb). Personen, die mit einem biventri-
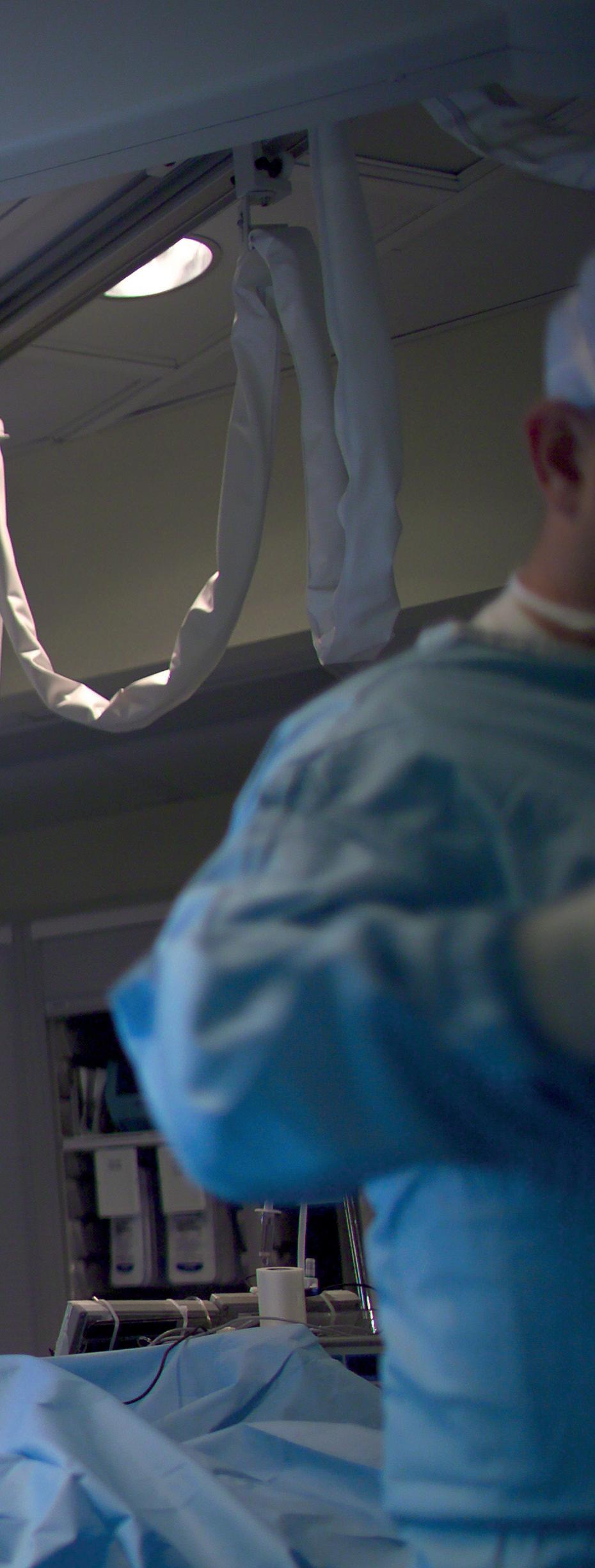
DFP-Pflichtinformation
Fortbildungsanbieter: Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM)
Im Themenfeld der idiopathischen ventrikulären Extrasystolie (VES) und der
Lecture Board: OA Mag. Dr. Lukas Fiedler Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Landesklinikum Wr. Neustadt Dr.in Johanna Holzhaider 2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich

Hausärzt:in DFP 21 Jänner 2023
© Ordensklinikum Linz
>
DFP-Punktesammler
ABBILDUNG 1
Nein Nein
Nein Ja
Ja Ja
ebenso einer Katheterablation oder alternativ einer antiarrhythmischen Therapie unterzogen werden (IIa). Amiodaron sollte bei idiopathischer Extrasystolie nicht als Erstlinientherapie eingesetzt werden (III).
Fazit
Abkürzungen: KHK (koronare Herzkrankheit), ICD (implantierbarer Kardioverter-Defibrillator), ILR (implantierbarer LoopRekorder), LVEF (linksventrikuläre Ejektionsfraktion, MI (Myokardinfarkt), VT (ventrikuläre Tachykardie), NYHA (New York Heart Association), PES (programmierte elektrische Stimulation), SMVT (anhaltende monomorphe ventrikuläre Tachykardie).
* Brignole M et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018;39:1883–1948. Übersetzter Nachbau der Abbildung 15 aus den ESC-Guidelines1
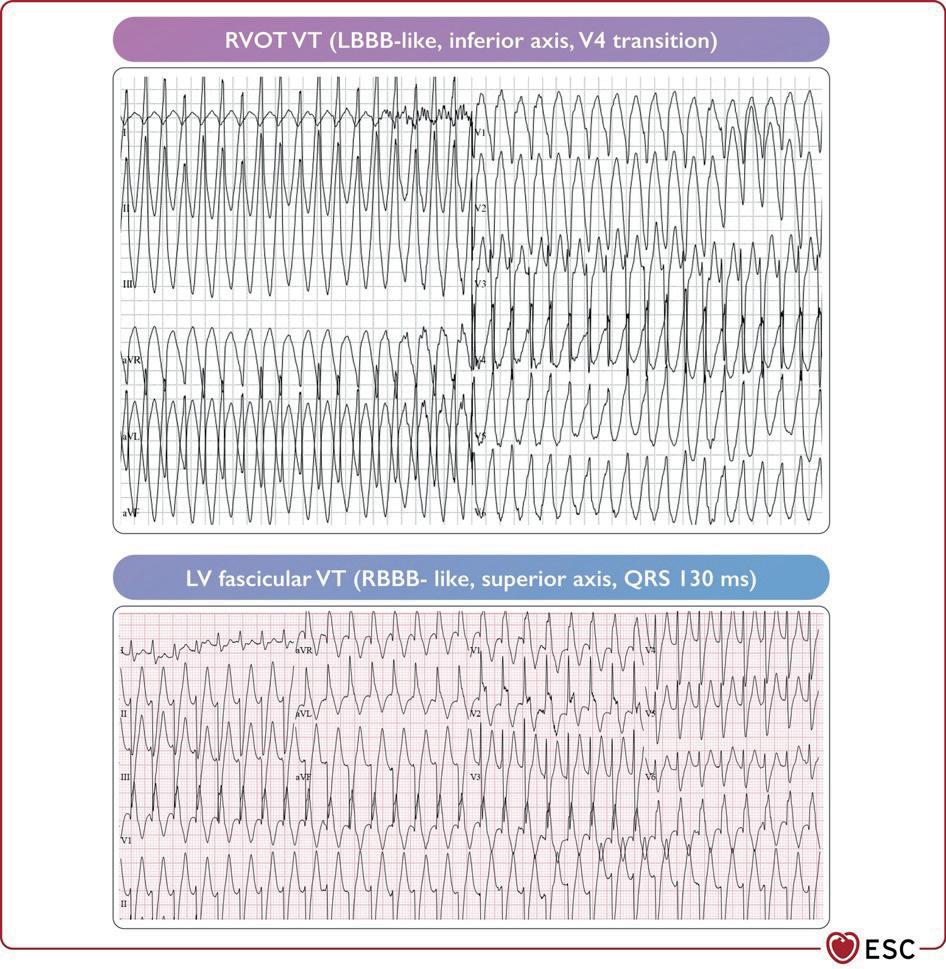
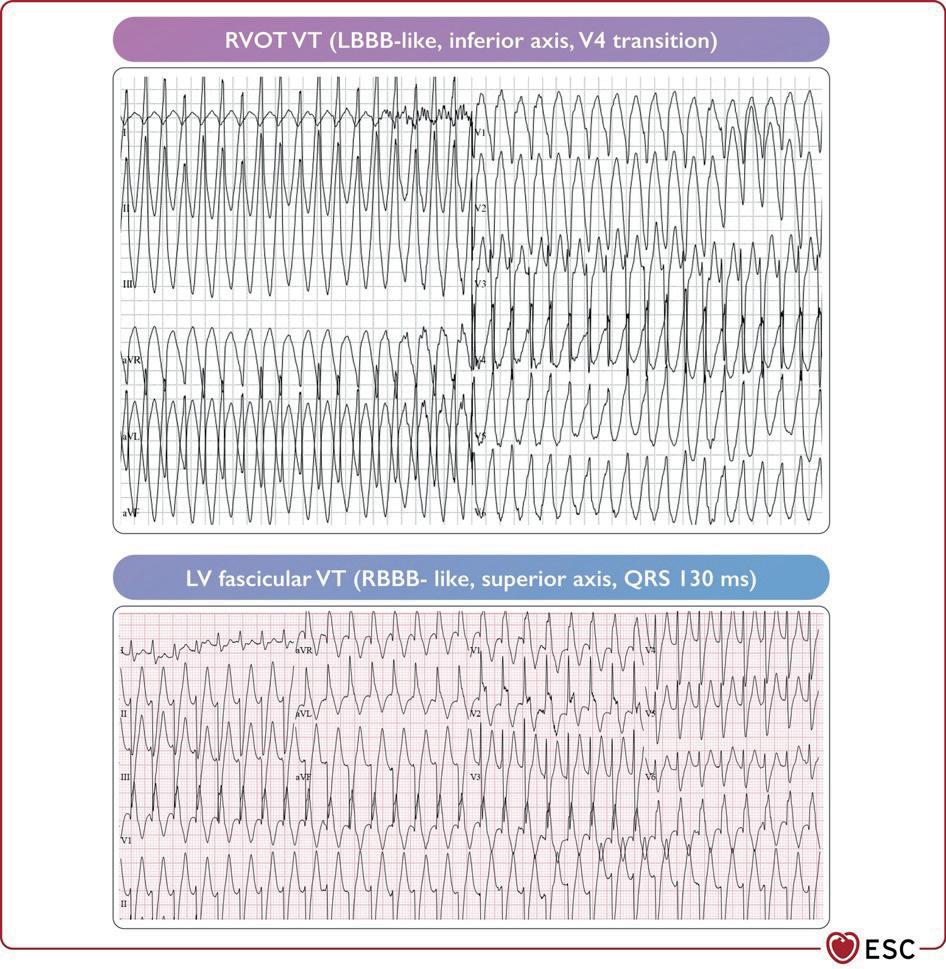
kulären Schrittmacher versorgt sind und davon aufgrund ver mehrter VES nicht profitieren (Stimulationsanteil < 95 %) sollten
ABBILDUNG 2
Zusammenfassend wurde die Katheterablation bei beiden Entitäten – ischämische CMP und VES-induzierte CMP – in den ESC-Guidelines 2022 deutlich aufgewertet. Die Indikation zur primärprophylaktischen ICD-Implantation bei KHK wurde nachgeschärft. Es finden sich grafische Darstellungen aller Algorithmen, die sehr hilfreich für die Abklärung und Behandlung aller Krankheitsentitäten mit Bezug zu VT und SCA sind. Der letzte Teil der Guidelines beinhaltet zusätzlich alltagstaugliche Algorithmen für häufige klinische Situationen wie nichtanhaltende VT im Holter, erstes Auftreten einer VT, Vorgehen nach SCA und Evaluierung bei Verdacht auf SCA als Todesursache inklusive Diagnostik bei Verwandten. Ebenso sind Algorithmen für die Akutbehandlung bei rhythmologischen Notfällen vorgegeben, die für Notaufnahmen und Intensivstatio-
Übersetzter Nachbau der Abbildung 3 aus den ESC-Guidelines1: typische idiopathische ventrikuläre Tachykardie-Morphologien.
Hausärzt:in DFP
Algorithmus zur Risikostratifizierung und Primärprävention des plötzlichen Herztodes bei Patienten mit chronischer koronarer Herzkrankheit und reduzierter Ejektionsfraktion. Patient:in mit chronischer koronarer Herzkrankheit LVEF 36-40 % Keine SMVT auslösbar und unklare Synkope SMVT auslösbar Nichtanhaltende VT oder unklare Synkope LVEF
35 % ICD (Klasse I) PES (Klasse I) Follow-up NYHA-Klasse ≥ II ICD-Implantation (Klasse IIa) ICD-Implantation (Klasse IIa) ILR-Implantation* (Klasse I) LVEF
30 % LVEF-Evaluation 6-12 Wochen nach
bei Patient:innen mit LVEF von ≤ 40 % bei der Entlassung (Klasse
≤
≤
akutem MI
I)
EKG einer rechtsventrikulären Ausflusstrakttachykardie (RVOT), Linksschenkelblock mit inferiorer Achse und Überganszone V4.
Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze
Die neuen ESC-Guidelines bieten strukturierte Abklärungs- und Behandlungspfade für Patientinnen und Patienten mit Kammertachykardien und für die Prävention des plötzlichen Herztodes. Die Katheterablation bei ischämischer Kardiomyopathie hat eine Aufwertung erfahren. Erweiterung der ICD-Indikation bei ischämischer Kardiomyopathie um NYHA-I-Patienten mit LVEF von < 30 %.
DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

Aufwertung der Katheterablation bei idiopathischer ventrikulärer Extrasystolie und VES-induzierter Kardiomyopathie. Indikation zur elektrophysiologischen Untersuchung bei ischämischer Kardiomyopathie und LVEF von 36-40 % sowie bei unklaren Synkopen nach Myokardinfarkt.
So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch. Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 31. Juli 2023.
Ab welcher ventrikulären Extrasystolie(VES)-Last im Holter kann man eine VES-induzierte Kardiomyopathie annehmen? (1 richtige Antwort)
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch! Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse: NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:
Bei asymptomatischen Patientinnen und Patienten mit einer VESLast von > 20 %, unabhängig vom Ursprungsort der VES.
Bei Vorliegen einer symptomatischen VES oder bei einer VESinduzierten Kardiomyopathie, wenn der Ursprungsort der rechte Ausflusstrakt oder der linke Faszikel ist.
Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail
Hausärzt:in DFP 23 Jänner 2023
DFP-Fragen zu „Praxiswissen: ventrikuläre Arrhythmien und plötzlicher Herztod“
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben. Ab > 10 %. Ab > 20 %. Ab > 30 %. Unter welchen Voraussetzungen ist bei einer ischämischen Kardiomyopathie eine primärprophylaktische ICD-Indikation (Klasse-IIa-Indikation) gegeben? (1 richtige Antwort) In welchen Fällen ist die Katheterablation als Klasse-I-Indikation bei idiopathischer ventrikulärer Extrasystolie (VES) empfohlen? (1 richtige Antwort) LVEF ≤ 35 % und NYHA III-IV. LVEF ≤ 30 % und NYHA I. LVEF ≤ 40 % und NYHA I.
Patientinnen und Patienten mit einer VES-Last von > 10 % zur Prävention einer VES-induzierten
Bei allen
Kardiomyopathie.
1 2 3
LITERATUR
Paradigmenwechsel bei Therapie
„Nicht die alleinige Optimierung der Glukosewerte, sondern das Management aller Mitspieler des Metabolischen Syndroms sollte im Vordergrund stehen.“
Diabetes mellitus Typ 2 stellt mit Abstand die häufigste Diabetesform dar. Zudem muss von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Schätzungen zufolge wird die Zahl der in Österreich an Diabetes Typ 2 erkrankten Menschen bis zum Jahr 2045 von 800.000 auf eine Million steigen. „Diabeteserkrankungen fordern in Österreich jährlich in etwa 10.000 Todesfälle, somit sterben mehr Menschen an den Folgen einer Diabeteserkrankung als an Brust- oder Darmkarzinomen“, erklärt Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer von der Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Med Uni Graz, am 52. Kongress für Allgemeinmedizin*. Athe-
rosklerotische Schäden an großen und kleinen Gefäßen stellen die wichtigste pathologische Manifestation dar. Herzinfarkt, Schlaganfall, Dialysepflicht und Erblindung sind letztlich lebenszeitlimitierende oder fatale Konsequenzen von Diabetes.
Multifaktorielles Risikomanagement
Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine Erkrankung, die meist mit arteriellem Hypertonus, Hyperlipidämie, Fettleber und Übergewicht einhergeht. „ Folglich beruht die Behandlung der Diabeteserkrankung auf einem multifaktoriellen Risikomanagement, das erwiesenermaßen Komplikationen und Mortalität senkt“, so der Experte. „Während die Therapie bis vor circa einem Jahrzehnt noch auf Metformin, Sulfonylharnstoffe, Pioglitazon und Insulin beschränkt war, können wir
EXPERTE:

heute auf eine Vielzahl weiterer Antidiabetika zurückgreifen, welche nicht nur den Blutzucker, sondern auch das kardiovaskuläre und renale Risiko senken “ Hervorzuheben seien SGLT2-Hemmer und einige GLP-1-Rezeptoragonisten. Sie zeigen laut Doz. Aberer neben positiven Effekten auf kardiovaskuläre Risikofaktoren auch eine deutliche Risikoreduktion in Hinblick auf Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulären Tod.
Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Univ.Klinik für Innere Medizin, Med Uni Graz
Die „a lten“ Diabetesmedikamente könnten zwar den Blutzucker, jedoch nur sehr beschränkt diabetische Komplikationen reduzieren. Daher haben sich auch die Empfehlungen in puncto blutzuckersenkender Therapie geändert.
Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes sollte weiterhin Metformin die medikamentöse Erstlinientherapie darstellen. „Vor allem die UKPDS-Studie hat einen Benefit von Metformin in

Hausärzt:in medizinisch 24 Jänner 2023
©
privat
© shutterstock.com/nobeastsofierce
Kongressnachlese: Diabetes mellitus Typ 2 – Neues und Bewährtes
Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko gezeigt, zudem ist Metformin sehr effizient blutzuckersenkend, leicht gewichtsreduzierend, relativ nebenwirkungsarm und billig“, erläutert der Endokrinologe.
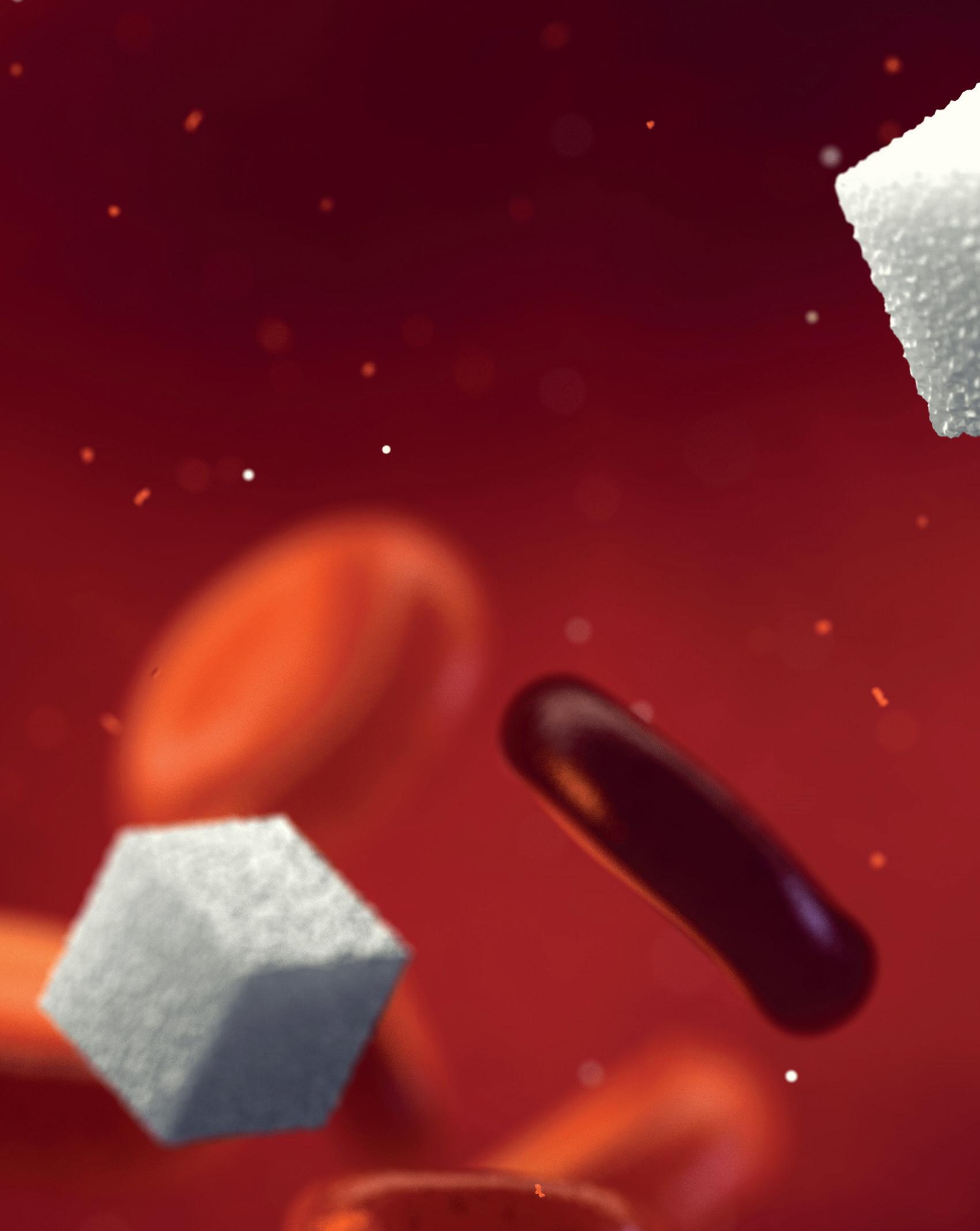
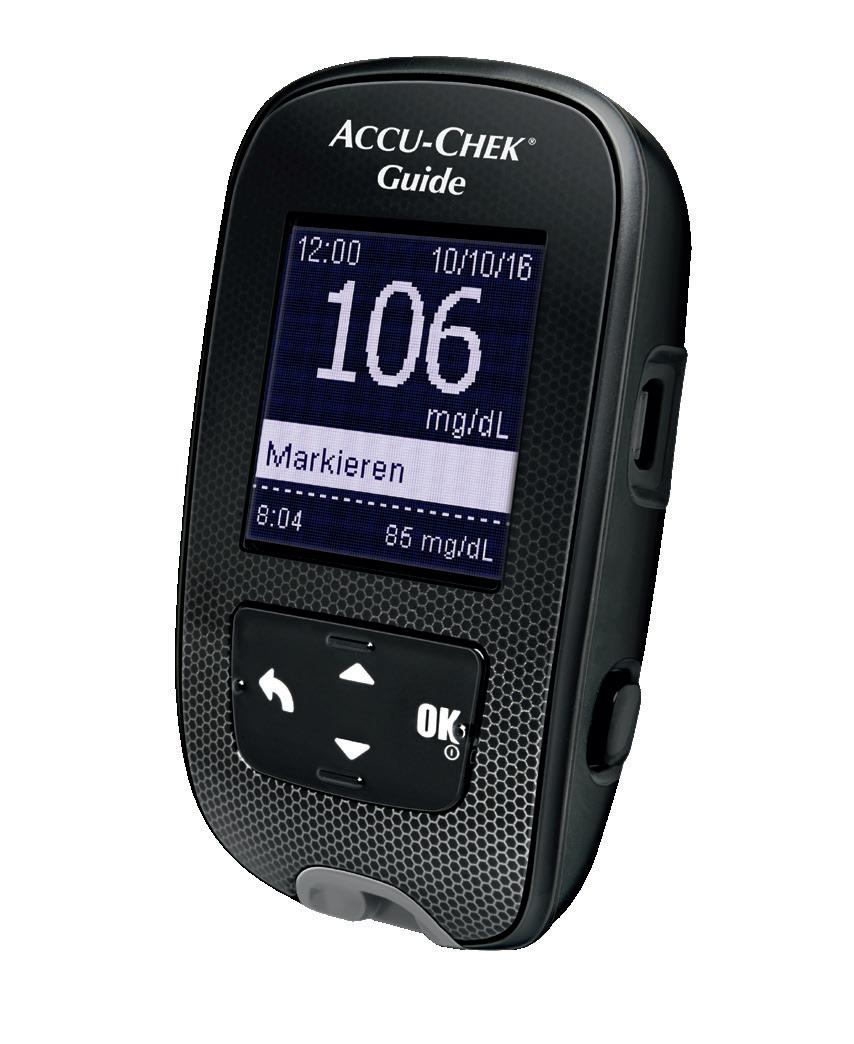
Doz. Aberer: „Im Falle der Notwendigkeit einer Therapieeskalation sollte in der Folge das individuelle kardiovaskuläre Risiko des Patienten evaluiert werden. Bei bereits stattgehabten kardiovaskulären Ereignissen oder hohem Risiko, solche zu erleiden, sollte als nächster Therapieschritt ein SGLT2-Hemmer oder ein GLP-1-Rezeptoragonist mit erwiesenem kardiovaskulärem Nutzen ergänzt werden.“ DPP4-Hemmer hätten in Endpunktstudien zwar kardiovaskuläre Sicherheit bewiesen, jedoch keinen kardiovaskulären Vorteil gezeigt. Der Einsatz von Sulfonylharnstoffen und Pioglitazon sei in industrialisierten Ländern in den Hintergrund gerückt. „Insulin ist dann empfohlen, wenn unter oraler bzw. GLP-1-RA-Therapie keine ausreichende Blutzuckersenkung möglich ist oder wenn Kontraindikationen den Einsatz oder die Fortführung der Erstlinientherapie nicht erlauben“, informiert Doz. Aberer.

* Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin (STAFAM), „Vom Harmlosen und Bedrohlichen ... vom Seltenen und Häufigen“, 24.-26. November 2022, Stadthalle Graz.


Ersterscheinung in: KongressJournal – Offizielle Kongresszeitung der Steirischen Akademie für Allgemeinmedizin , 25. November 2022, Unlimited Media GmbH.
EINFACH MESSEN

MAG’S ANDERS
JEDER
Accu-Chek
MEHR ALS MESSEN Dann
Accu-Chek Guide ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2022 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3 SCAN ME INFOS & BESTELLEN
Dann empfehlen Sie:
Instant
empfehlen Sie:
<
Das weibliche Gehirn altert anders
Auch bei Demenz geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen
späteren Leben zu geben. Insgesamt ist es sehr unklar, wann und wie lange man es geben soll. Und natürlich kommen auch die negativen Aspekte der Hormonersatztherapie hinzu“, erklärt die Expertin. Diesbezüglich sind also noch wichtige Fragen offen, auf die Studien noch keine ausreichenden Antworten liefern konnten.

Neues Medikament in Sicht
Rund 150.000 Menschen in Österreich leben mit der Diagnose Demenz, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Warum das so ist, welche Rolle dabei die Hormone spielen und was es bezüglich der Therapiemöglichkeiten Neues gibt, erläuterte die Leiterin der Ambulanz für Demenzerkrankungen an der Medizinischen Universität Wien, Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann, in einem MeinMed-Webinar (siehe Aktuell). Grundsätzlich lässt die kognitive Fähigkeit bei allen Menschen im Alter nach, hier besteht bei gesunden Menschen kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ebenso geschlechterunabhängig ist es, dass eine frühe Diagnose und ein baldiger Behandlungsbeginn den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. In Bezug auf Demenzerkrankungen sind Frauen jedoch klar im Nachteil. Vor allem spielt ihre höhere Lebenserwartung bei der Entwicklung von dementiellen Erkrankungen eine Rolle. Aber auch neurobiologisch sind Frauen benachteiligt. Aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, dass sich schädliche Eiweißablagerungen, die Plaques, im Gehirn bei Frauen häufiger
bilden. Diese können in der Folge bekanntlich Entzündungsprozesse und im höheren Lebensalter eine Demenzerkrankung auslösen.
Hormoneller Schutz für das Gehirn
EXPERTIN: Assoc.-Prof.in Priv.Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann Leiterin der Ambulanz für Demenzerkrankungen an der MedUni Wien
Eine wichtige Rolle im Hinblick auf Alzheimer und andere Formen der Demenz spielt der Östrogenspiegel, der bei Frauen mit der Menopause rasch absinkt. „Wir wissen heute, dass die Lebenszeitexposition gegenüber Östrogen ein entscheidender Faktor ist“, so Prof.in Stögmann. Östrogen wirkt in mehrfacher Hinsicht neuroprotektiv. Es verbessert die Synapsenregenerierung, die Hippocampusleistung, den Blutfluss, den zerebralen Glukosehaushalt sowie die Acetylcholinproduktion. Östrogen ist also eine günstige Substanz für die Gehirnleistung. Zum Thema Hormonersatztherapie bei Demenz gab es bereits zahlreiche Studien. „ Dabei hat man gesehen, dass eine Substitution im mittleren Leben, also vor dem 70. Lebensjahr, wahrscheinlich einen protektiven Einfluss hat. Aber es ist nachteilig, Östrogen im
Seit rund 20 Jahren stehen Medikamente zur Verfügung, die Demenzerkrankungen zwar nicht ursächlich behandeln, jedoch den Verlauf abschwächen oder verlangsamen können. Derzeit wird ein Antikörper-Medikament (Lecanemab) erforscht, das erstmals die krankmachenden Eiweißverbindungen im Gehirn abbauen kann. In ersten Studien zeigte sich eine deutliche Verzögerung des Krankheitsverlaufes, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. In Europa ist ein Antrag auf Marktzulassung dieses neuen Medikaments bis Ende März 2023 geplant. Allerdings warnt Prof.in Stögmann vor zu hohen Erwartungen, da Lecanemab auch deutliche Einschränkungen aufweist. So ist bislang beispielsweise unbekannt, ob und wie sehr die Wirkung des Medikaments über die Studiendauer von 18 Monaten hinaus anhält. Zudem eignet sich Lecanemab nur zum Einsatz bei Menschen, die zwar Beta-AmyloidPlaques im Gehirn aufweisen, aber erst sehr geringe Einschränkungen ihrer Hirnleistungsfähigkeit haben.
Margit Koudelka

AKTUELL
Im Rahmen von MeinMed hielt Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Elisabeth Stögmann einen Vortrag zum Thema „Demenz: Mann und Frau unterschiedlich krank“. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/mediathek
Das Webinar wurde unterstützt von: MedUni Wien

Hausärzt:in medizinisch 26 Jänner 2023
© shutterstock.com/sun ok © MedUni
Matern
Wien,
Räuber des erholsamen Schlafes
Ein Rückblick auf die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung*
Klagen über einen nicht erholsamen Schlaf nehmen zu, nicht zuletzt als Folge der COVID-19-Pandemie und der angespannten weltpolitischen Lage. Dennoch besteht kein Grund zur Panik, denn Schlafstörungen können effizient und nachhaltig behandelt werden, wie die zahlreichen Beiträge beim Kongress zum Thema Schlafmedizin und -forschung eindrucksvoll zeigten. Es ist gelungen, mit Prof. Dr. Till Roenneberg (LMU München) einen der kreativsten Forscher auf dem Gebiet der Chronobiologie als Keynote-Sprecher zu gewinnen. In zwei Vorträgen legte er facettenreich dar, wie unser Lebensstil dazu beiträgt, nicht nur weniger zu schlafen, sondern auch biologische Rhythmen (z. B. Ausschüttung von Melatonin und Cortisol) zu stören. Die Thematik ist komplex und kann nicht allein aus schlafmedizinischer Perspektive betrachtet werden. Hier muss auch die Politik auf nationaler wie internationaler Ebene tätig werden (Stichwörter: Zeitumstellung, Schulunterrichtsbeginn).
Mit dem Handy ins Bett
Digitale Endgeräte wie Smartphones sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wie kaum ein anderes technisches Hilfsmittel beeinflussen sie auf subtile Weise den Schlaf-wach-Rhythmus. Smartphone-Displays besitzen einen ho-
hen Anteil an blauwelligem Licht, das aktivierend wirkt und uns so wertvolle Schlafzeiten raubt, wie eine aktuelle Studie an der Universität Salzburg zeigt. Prof.in Dr.in Kerstin Hödlmoser (Universität Salzburg) warnte deshalb davor, „mit dem Handy ins Bett zu gehen“ Wer trotzdem nicht auf seinen digitalen Bettpartner verzichten will, sollte einen Blaulichtfilter verwenden. Der wachmachende Effekt von blauem Licht könne aber auch dazu beitragen, müdigkeitsbedingte Unfälle zu reduzieren, argumentierte Prof.in Dr.in Andrea Rodenbeck (Göttingen) in ihrem Vortrag. Dennoch ist Vorsicht geboten. Da blauwelliges Licht besonders effektiv die Melatoninproduktion unterdrückt, könnte der Zusammenhang zwischen einem erhöhten Krebsrisiko (die WHO stufte chronische Nachtarbeit bereits vor Jahren als kanzerogen ein) und jahrzehntelanger Schichtarbeit auch die Folge nächtlicher Blaulichtexposition sein.
Schöne neue Welt der Wearables
Die Verwendung von Aktivitäts- und Schlaf-Trackern boomt, trotz der Kritik an deren Genauigkeit und Aussagekraft. Experten auf dem Gebiet der Artificial Intelligence meinten, dass mit Hilfe von Machine-LearningAlgorithmen tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnet würden, erklärte Dr. Matteo Cesari (Med Uni Innsbruck). Schlaf-Tracker werden mittlerweile mit verschiedenen Typen von Sensoren ausgestattet (z. B. Beschleunigungssensoren, Plethysmografen zur Analyse der Herzfrequenz und der Pulswelle, Photozellen zur Bestimmung der Sauerstoffmenge im Blut) und können mittels neuronaler Netze Daten valide auswerten. Künstliche Intelligenz (KI) werde auch zunehmend bei polygrafischen Schlafauswertungen im Schlaflabor eingesetzt, so Dr. Peter Anderer (MedUni Wien). Vergleichsstudien von „ manuellen“ Schlafstadienauswertungen und KI-Algorithmen zeigten eine hohe Übereinstimmung, sodass die
American Academy of Sleep Medicine die Schaffung eines Referenzdatensatzes zur Zertifizierung KI-basierter Schlafauswertungssysteme vorbereitet.

Telemedizin & Schlafapnoe
Auf dem Gebiet der Telemedizin zeichneten sich ebenfalls neue Trends ab, nicht zuletzt aufgrund der COVID-19-Pandemie, so OA Dr. Rainer Popovic (FranziskusSpital in Wien & Ordination in Zwettl) in seinem Vortrag. Anfänglich bedeutete Telemedizin vor allem die Durchführung kontaktloser Patientenbesprechungen mittels Videokonferenzen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass diese Technologie sowohl zur Diagnosestellung als auch für eine effiziente Therapieverlaufskontrolle aus der Ferne genutzt werden kann. Der Markt boomt, vor allem bezüglich des Angebotes von Kleingeräten und Apps für Smartphones, die nicht nur Informationen über den Schlaf liefern, sondern auch eine Therapiekontrolle, z. B. bei Heimbeatmungsgeräten, ermöglichen. Neben technischen Innovationen gebe es auch neue Ansätze in der Behandlung der obstruktiven Schafapnoe, berichtete Dr. Popovic. Habe man früher vor allem die Anatomie der oberen (subglottischen) Atemwege für die Verminderung des Atemflusses verantwortlich gemacht, zeige sich immer mehr, dass auch die Steuerung der Muskeln, die diese Atemwege offenhielten, eine große Rolle spiele.
Auch Neurostimulationsverfahren des N. hypoglossus könnten laut aktueller deutscher und amerikanischer Leitlinie bei mittel- bis hochgradiger obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt werden, erläuterte OÄ Dr.in Birte Bender (Med Uni Innsbruck). Dieses Verfahren sollte dann angewendet werden, wenn eine PAPTherapie nicht möglich ist. Residuale Tagesschläfrigkeit trotz optimaler CPAP-Therapie könne mitunter ein großes Problem sein, sei aber medikamentös therapierbar, erklärte OÄ Dr.in Angelika Kugi (LKH Villach). Ein Grund: Mehr als ein Drittel der Schlafapnoe-
Hausärzt:in medizinisch 28 Jänner 2023 © unsplash.com/Claudia
Mañas
Patienten leiden auch unter insomnischen Beschwerden. Diese könnten, so Doz. Dr. Michael Saletu (LKH Graz), mit einem Non-Benzodiazepin mit relativ langer Halbwertszeit erfolgreich therapiert werden. Bereits bei niedriger Dosierung zeigten sich deutliche Symptomverbesserungen.
Bewegt im Schlaf
Unruhiger Schlaf sei oft Folge anderer – vor allem neurologischer – Erkrankungen, so der Tenor eines Symposiums über Bewegungsstörungen im Schlaf unter der Leitung von OÄ Dr.in Anna Heidbreder und Prof.in Dr.in Birgit Högl (Med Uni Innsbruck). Wenn auch eine Reihe motorischer Phänomene keinen direkten Krankheitswert hat (z. B. exzessiver fragmentarischer Myoklonus, hypnagoger Fußtremor, Einschlafmyoklonien), so ist eine diagnostische Abgrenzung von schlafbezogenen Epilepsien erforderlich. Anders verhält es sich mit dem Syndrom der ruhelosen Beine (Restless-Legs-Syndrom, RLS), das eindeutig als pathologisch einzustufen ist.
Eine neue S2k-Leitlinie zum Management des RLS empfiehlt die Kontrolle und Optimierung des Eisenstoffwechsels und einen langsamen, symptomorientierten Einsatz medikamentöser und nichtmedikamentöser Behandlungsoptionen. Neben organisch bedingten Bewegungsstörungen dürften auch Emotionen und andere psychische Faktoren bei nicht erholsamem Schlaf eine Rolle spielen. So rückt der Zusammenhang zwischen Schlaf, Impulskontrolle und Emotionsregulation zunehmend in das Blickfeld der Schlafforschung. Phänomene wie Fehlwahrnehmungen des Schlafs, ein erhöhtes Grundanspannungsniveau (Hyperarousals) oder schlafbezogenes abnormes sexuelles Verhalten (auch als „Sexsomnia“ oder „Sleep Sex“ bezeichnet) waren Thema eines Symposiums unter der Leitung von Dr. Omid Amouzadeh-Ghasikolai (LKH Graz).
Gestörter Schlaf bei Kindern
Dr. Werner Sauseng (Kumberg, Steiermark) wies in seinem Vortrag auf die
Überschneidungen der klinischen Symptome von OSAS (einem der häufigsten Schlafprobleme bei Kindern) und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom) hin. Bei beiden Erkrankungen könne die Hyperaktivität im Vordergrund stehen. Das Thema ADHS stand auch im Mittelpunkt eines Satellitensymposiums unter der Leitung von Prof. Dr. Osman Ipsiroglu (Vancouver), der dafür plädierte, in der Betreuung von Kindern mit ADHS und RLS dem Schlaf wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Prof. Dr. Reinhold Kerbl (Leoben) fasste wissenschaftliche Neuigkeiten auf dem Gebiet der pädiatrischen Schlafmedizin zusammen. Unter anderem zeigte sich, dass Babys und Kleinkinder während des Lockdowns eine schlechtere Schlafqualität hatten, wahrscheinlich aufgrund von elterlichem Stress.
Gastautor: Gerhard Klösch, MPH (Pressereferent der ÖGSM)
* 30. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM/ASRA), Juni 2022.
Hausärzt:in medizinisch
Rezeptstudie
Österreichischer Verschreibungsindex
Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.

+43
weltweit
anonym Sichere
flexibel Flexibler Zugriff auf ein bedienerfreundliches
120 € Bis zu 120 € pro Stunde
Hier scannen um sich zur Teilnahme zu registrieren. Alexa Ladinser alexa.ladinser@iqvia.com +43 (0) 664 8000 2237 Lidia Wojtkowska medicalindex@iqvia.com 0800 677 026 (kostenlos)
FÜR WEITERE FRAGEN:
(0) 664 8000 2237
Weltweite Studie zu indikationsbezogenen Verordnungen!
und anonyme Datenübermittlung 1x/Quartal.
Online-Tool.
Aufwandsvergütung
Frühes Handeln gefragt
Familiäre Hypercholesterinämie ist die häufigste genetische Erkrankung in der allgemeinärztlichen Praxis
war jede Hilfe zu spät gekommen. Sie war damals dreizehn Jahre alt gewesen. Die anschließende medizinische Abklärung ergab die Diagnose Familiäre Hypercholesterinämie. Die rechtzeitige Diagnose und der frühe Start einer hocheffektiven lipidsenkenden Therapie hätten die dramatischen Geschehnisse verhindern können.
Kaskadenscreening
Case Study – Die nachfolgende Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Namen, Alter und Ort wurden geändert: Es war ein wolkenloser Samstagmorgen, als Maria (44 Jahre) in Begleitung ihrer Tochter Lena (16 Jahre) und ihres Mannes Gerhard (46 Jahre) zu einer gemeinsamen Bergtour aufbrach. Der Aufstieg zur Alpenrose sollte mit einem Kaiserschmarrn und einem atemberaubenden Panorama belohnt werden. Doch auf halbem Weg verspürte Maria plötzlich einen vernichtenden Druck auf der Brust. Gerhard, der schon ein Stück weit vorausgegangen war, rannte, alarmiert durch die Hilfeschreie seiner Tochter, den Wanderweg hinab. Bei seiner Frau angekommen, verständigte er sofort die Rettung. Die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungshelikopters erschien wie eine Ewigkeit. Mit diesem wurde Maria zum nächstgelegenen Herzkatheter gebracht. In der Koronarangiographie zeigte sich eine hochgradige Stenose der distalen LAD, welche erfolgreich mittels Stents eröffnet werden konnte. Maria hatte Glück. Als ihr Vater mit 42 Jahren einen Herzinfarkt erlitten hatte,
GASTAUTOREN-TEAM:
MMag. Dr. Reinhold
Innerhofer
Klinisches Institut für Labormedizin, MedUni Wien, Österreichisches Register für Familiäre Hypercholesterinämie, reinhold.innerhofer@ meduniwien.ac.at
Univ.-Prof. DDr. Christoph Binder

Klinisches Institut für Labormedizin, MedUni Wien, Österreichisches Register für Familiäre Hypercholesterinämie
Univ.-Prof. Dr. Hans Dieplinger Institut für Genetische Epidemiologie, Med Uni Innsbruck, Österreichisches Register für Familiäre Hypercholesterinämie

Familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist eine genetisch bedingte Störung im Cholesterinstoffwechsel, welche zu erhöhtem Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) führt und von Geburt an wirkt. Da das LDL-C sowohl ursächlich als auch kumulativ der Atherosklerose zugrunde liegt1, haben Betroffene ein stark erhöhtes kardiovaskuläres Risiko.2 Leider wird die FH oft nicht oder zu spät erkannt. Dabei ist sie weder so selten, noch harmlos. Nach neueren Schätzungen betrifft FH eine von 311 Personen.³ Damit ist sie die häufigste genetische Erkrankung in der allgemeinärztlichen Praxis und häufiger als alle 26 im österreichischen Neugeborenenscreening enthaltenen Erkrankungen zusammen.8
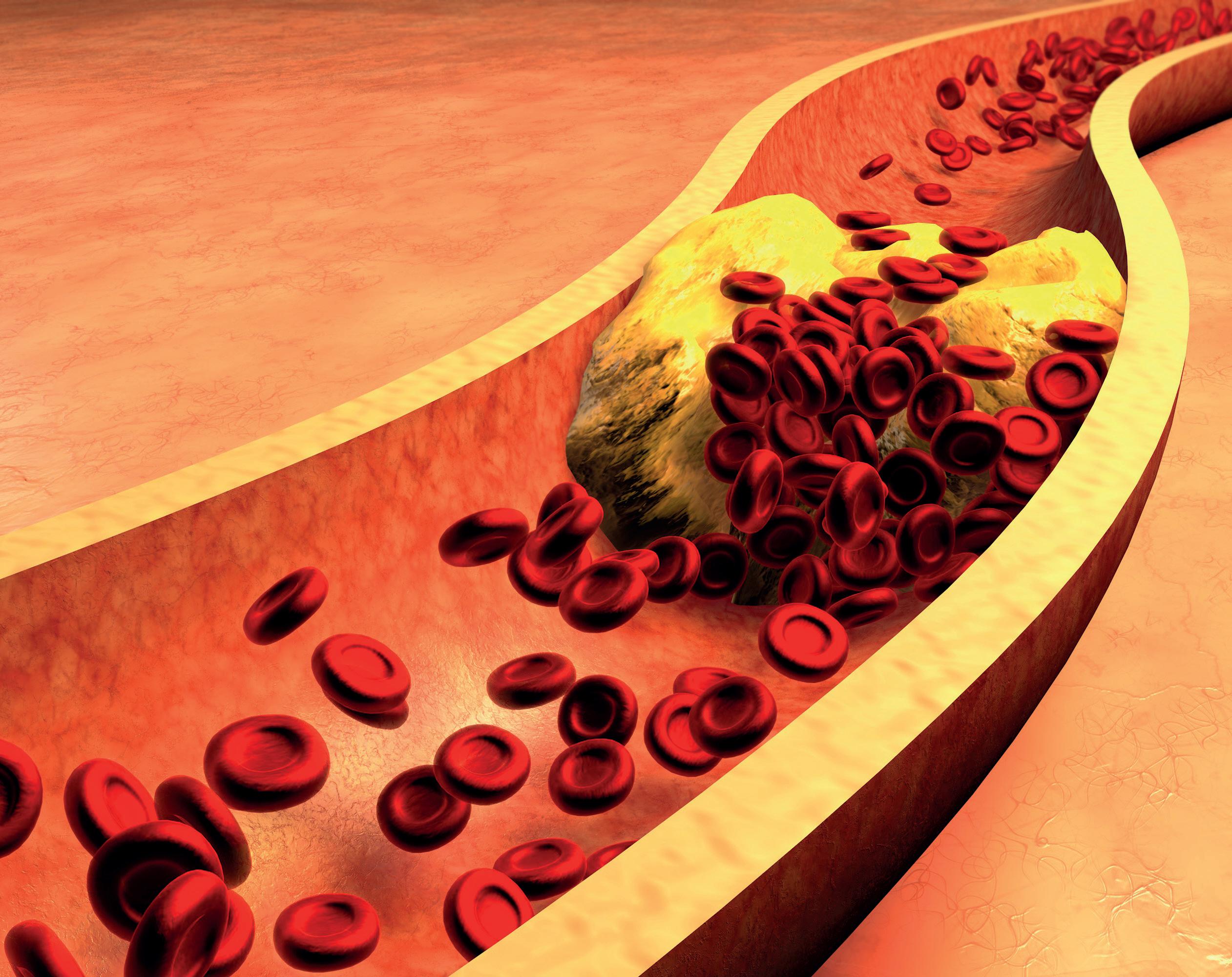
Aus diesem Grund hat die österreichische Atherosklerosegesellschaft (AAS) vor sechs Jahren das FH-Register ins Leben gerufen. Ziel ist der flächendeckende Aufbau eines Patientenregisters. Mittels Kaskadenscreenings können, ausgehend von einem betroffenen Indexpatienten, Verwandte untersucht und nach erfolgter Diagnose einer frühzeitigen, präventiven Behandlung zugeführt werden.
Diagnosestellung
An eine FH sollte immer gedacht werden bei:
• LDL-C ≥ 190 mg/dl (Erwachsene); ≥ 160 mg/dl (Kinder),
• vorzeitiger koronarer Herzkrankheit,
• positiver Familienanamnese,
• Xanthomen.
Sekundäre Ursachen einer LDL-C-Erhöhung wie Hypothyreose, Cholestase, Nephrotisches Syndrom, schwere Adipositas, Anorexie und Medikamente (z. B. Retinoide) sollten ausgeschlossen werden.
FH-Scores
Für die Diagnose der FH stehen diverse Scores zur Verfügung. Am häufigsten angewandt werden:

• Dutch-Lipid-Clinic-Network(DLCN)-Score,
• Simon-Broome-Score,
• Simon-Broome-Score – adaptiert für Kinder.
Für die Diagnose der FH bei Kindern und Jugendlichen ist der DLCN nicht validiert.4 In dieser Population sollten die SimonBroome-Kriterien verwendet werden.5 Die Scores können im Internet und über mobile Apps aufgerufen werden.

Hausärzt:in medizinisch 31 Jänner 2023
© MedUni Wien ©
© privat >
Hansi Weissensteiner
© shutterstock.com/Ralwell
© Prof. Thomas Stulnig 2016
Dosis Prava Fluva Simva Atorva Rosuva Ezetimib (EZE) EZE + Atorva EZE + Rosuva
10 mg 1,3 1,4 1,5 1,8 1,2 1,7 2,1
20 mg 1,4 1,2 1,4 1,7 2,0 2,0 2,4
40 mg 1,4 1,3 1,6 1,9 2,3 2,3 3,0
80 mg 1,4 1,8 2,0 2,4
Umrechnungsfaktoren auf LDL-Cholesterin vor Start der Lipidsenkenden Medikation.
LDL-C auf unbehandelte Werte rückrechnen
Häufig wird die Diagnose durch eine bereits etablierte lipidsenkende Therapie erschwert. Sollte kein LDL-C vor Beginn der Therapie bekannt sein, kann mithilfe der obigen Tabelle das LDL-C vor Therapiestart ermittelt werden.
Genetische Diagnose
Macht der Score eine FH-Diagnose wahrscheinlich, sollte eine Gensequenzierung erfolgen. Dazu können die Betroffenen an ein Referenzzentrum überwiesen werden. Um Referenzzentren in Ihrer Nähe zu finden, steht Ihnen folgender Link zur Verfügung: findmylipidclinic.com/#/patient-interface/practitioners. Bei begründetem Verdacht wird die genetische Diagnostik von der Krankenkasse übernommen. Aktuell werden an den Referenzzentren alle relevanten Gene getestet. Zusätz-
lich haben Betroffene die Möglichkeit, sich in das österreichische Register für Familiäre Hypercholesterinämie aufnehmen zu lassen.
Pathophysiologie und Genetik
Einem hohen LDL-C können sowohl monogenetische als auch komplexe polygenetische Ursachen zugrunde liegen. Die Abklärung von 314 Patienten mit einem LDL-C von ≥ 195 mg/dl an einem internationalen Referenzzentrum ergab bei 54 % eine monogenetische Ursache und bei weiteren 13 % eine polygenetische Ursache. Bei etwa einem Drittel der Patienten konnte mit den angewandten Untersuchungsmethoden keine genetische Ursache identifiziert werden.6
Bei den monogenetischen Ursachen wird zwischen den autosomal co-dominanten bzw. dominanten und den autosomal rezessiven unterschieden. Die Tabelle rechts oben gibt einen Überblick.7
Pharmakologische Therapie
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
• Die FH gehört zu den häufigsten genetischen Erkrankungen in der allgemeinärztlichen Praxis.
- Die Diagnose lässt sich anhand des LDL-C, der Familienanamnese und spezifischer Krankheitszeichen eingrenzen und mittels genetischer Untersuchung bestätigen. Diese erfolgt an Referenzzentren, von wo aus Personen in das österreichische FH-Register aufgenommen werden können.
Das FH-Register bietet die Infrastruktur, um mittels Kaskadenscreenings betroffene Verwandte zu identifizieren und genetisch zu charakterisieren. Dadurch lässt sich langfristig der Behandlungsstatus von Betroffenen verbessern, des Weiteren kann ihr Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden, verringert werden.
Die von Geburt an erhöhten LDLPartikeln bedingen das schnelle Voranschreiten der Atherosklerose. Daher empfehlen Guidelines, ab zirka zehn Jahren mit der pharmakologischen Therapie zu beginnen. Hierfür stehen heute viele potente Optionen zur Verfügung. Aus Platzgründen wollen wir nur auf die Neuzugänge eingehen.
Seit Dezember 2020 gibt es nun mit Inclisiran neben den bereits etablierten monoklonalen Antikörpern eine halbjährlich subkutan zu verabreichende siRNA-Therapie gegen PCSK9. Bempedoinsäure ist in der EU seit April 2020 auf dem Markt. Dabei handelt es sich um einen leberspezifischen ATP-Citrat-Lyase-Hemmer. Dieses En-
Gen Vererbung Häufigkeit*
Co-dominant
LDLR Autosomal co-dominant 80-85 %
APOB Autosomal co-dominant 5-10 %
PCSK9 Autosomal co-dominant 1 %
Rezessiv
LDLRAP1 Autosomal rezessiv < 1 %
LIPA Autosomal rezessiv << 1 %
ABCG5/8 Autosomal rezessiv < 1 %
Dominant
APOE Autosomal dominant << 1 %
STAP1 Autosomal dominant << 1 % * bezogen auf monogenetische Ursachen.
zym ist der HMG-CoA-Reduktase vorgelagert und bewirkt eine Senkung der hepatischen Cholesterinsynthese, was – wie auch bei den Statinen – zu einer verstärkten Expression der LDLRezeptoren führt.
Literatur:
1 Ference BA et al., Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. European heart journal 38, 2459–2472 (2017).
2 Khera AV et al., Diagnostic Yield and Clinical Utility of Sequencing Familial Hypercholesterolemia Genes in Patients With Severe Hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 67, 2578–2589 (2016).
3 Hu P et al., Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Circulation 141, 1742–1759 (2020).
4 Watts GF et al., Familial hypercholesterolaemia: A model of care for Australasia. Atherosclerosis Supp 12, 221–263 (2011).
5 Wiegman A et al., Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 36, 2425–2437 (2015).
6 Wang J et al., Polygenic Versus Monogenic Causes of Hypercholesterolemia Ascertained Clinically. Arteriosclerosis Thrombosis Vasc Biology 36, 2439–2445 (2016).
7 Berberich AJ & Hegele RA, The complex molecular genetics of familial hypercholesterolaemia. Nat Rev Cardiol 16, 9–20 (2018).
8 neugeborenenscreening.at (abgerufen am 19.06.2022).
<
Hausärzt:in medizinisch 32 Jänner 2023
Lebererkrankungen – differentialdiagnostisch betrachtet
Praxisupdate Hepatologie: Hausärzt:innen sind in der Betreuung unerlässlich
Hausärztinnen und -ärzte nehmen in der Wahrnehmung, der primären Abklärung und im Langzeitmanagement von Patientinnen und Patienten mit Leberkrankheiten eine Schlüsselposition ein. Da Lebererkrankungen in vielen Fällen über lange Zeit asymptomatisch verlaufen, kommt ihnen in der sorgfältigen Abklärung von pathologischen Leberfunktionstests (LFT) eine besondere Bedeutung zu. Im Langzeitmanagement chronisch kranker Leberpatientinnen und -patienten sind die primär betreuenden Hausärztinnen und Hausärzte unerlässlich.
Die Gesamtprävalenz von Lebererkrankungen steigt, jedoch sind sie in vielen Fällen behandelbar – zum Beispiel ist eine Zunahme von Fettlebererkrankungen zu verzeichnen, gleichzeitig gibt es etwa bei CHC oder CHB moderne, erfolgreiche Therapiestrategien.
Im Erstbefund zeigen sich häufig erhöhte Transaminasen (ALT) oder Cholestaseparameter (AP, gGT). Bei den modernen Möglichkeiten der Labordiagnostik und Sonographie sollte auf keinen Fall die zentrale Bedeutung einer eingehenden Anamnese bei Patientinnen und Pa-
tienten mit erhöhten LFT unterschätzt werden (Infobox 1).
Fehlinterpretationen vermeiden
Eine relativ genaue Eingrenzung der Differentialdiagnose, welche auf einer detaillierten Anamnese – zusammen mit wenigen Labortests und der Sonographie der Leber sowie der ableitenden Gallenwege –basiert, ist oft möglich (siehe Abbildung 1, S. 36).

Das Gallensteinleiden stellt die häufigste Erkrankung in der Gastroenterologie dar. Wie in Abbildung 1 zu sehen, erwarten wir uns bei symptomatischen Gallensteinleiden primär ein cholestatisches Enzymmuster (= gGT und/ oder AP > ALT) und sonographisch erweiterte Gallenwege sowie einen positiven Steinnachweis. Bei kurzer Zeitspanne zwischen erster Kolik und Vorstellung des Patienten kann sich ein akuter Steinverschluss jedoch biochemisch als hepatitisches Muster präsentieren (= ALT > AP und/oder gGT), da die Erhöhung von ALT (durch Regurgitation von Galle in die Leberläppchen) der von AP/gGT Stunden/Tage vorausgeht.

Dies erklärt, warum in Fällen mit akutem/perakutem Steinverschluss ein solches Enzymmuster oft als akute Hepatitis fehlinterpretiert wird. Entscheidend ist hier die Anamnese unter Berücksich-
INFO 1
Wichtige anamnestische Fragen/Angaben bei erhöhten LFT
Vorerkrankungen? – Familienanamnese, Berufsanamnese
Vorbestehende Leberkrankheit? –Hinweise auf Dekompensation?
Koliken? – Hinweis auf Steinleiden?
Schmerzen? Juckreiz?
> Wo? Oberbauch re? Schulterblatt re? BWS?/LWS?
Gewichtsverlust? – Hinweis auf Tumorerkrankung? – B-Symptomatik?
Alkoholkonsum? Drogenkonsum?
Arbeitsanamnese, Umfeld, Garten- oder Kanalarbeit
> DD: Leptospirose, toxininduzierte Leberkrankheit
Medikamenteneinnahme?
> DD: Antibiotika, NSAR, Psychopharmaka, Cumarine …
Naturheilprodukte, Tees, Nahrungsergänzungsmittel, Anabolika
Auslandsanamnese
> DD: Hepatitis A, B, E, Parasiten …
Hausärzt:in medizinisch 34 Jänner 2023 © shutterstock.com/Natali _ Mis ©
privat
>
GASTAUTOR: Univ.-Prof. Dr. Peter Fickert ÖGGH-Präsident, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Med Uni Graz
ABBILDUNG 1
INFO 2
DD erhöhter LFT
Bilirubin isoliert
Unkonj. Bili
Cholestatisch
Konj. Bili AP > ALT
Ultraschall
Nicht mechanisch
Hämolyse Hämatome Mb. Gilbert
Bakt. Infekte Sepsis, TSS Med/tox. Post-OP Alkoholische Hepatitis Dekompensierte Zirrhose (PBC)
tigung folgender Beschwerden: starke wellenförmige Schmerzen im rechten Oberbauch, welche zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden andauern, Schmerzen, die in die Magengegend und in den Rücken ausstrahlen. Anamnestische Fragen und Angaben zur Naturheilmittel- oder Nahrungsergänzungsmitteleinnahme (z. B. Aloe vera, Teufelskrallenextrakte, Schöllkraut, Nahrungsergänzungsmittel zum Mus-
Mechanisch
Cholelithiasis Cholangitis Tumor Pankreatitis
Hepatitisch
ALT > AP
Viral - A, B, C, D, E - CMV, EBV, HSV Ischämisch Med/tox. Bakteriell AIH - Mb. Weil „akuter Stein“
kelaufbau) sind bei der Abklärung erhöhter LFT sehr wichtig. Die Latenzzeit bis zum Auftreten solcher Krankheitsbilder („drug-induced liver injury“ = DILI) kann zwischen einer Woche und drei Monaten betragen. Auf mögliche immunallergische Symptome wie Exantheme ist unbedingt zu achten. Bauchschmerzen und Fieber können Symptome einer DILI sein. Die Differentialdiagnose sollte nicht wegen eines früh gehegten Verdachts
Für die Diagnosestellung einer HE werden bei Zirrhose folgende DD ausgeschlossen:*
Entgleisung bei Diabetes mellitus (Hypo-, Hyperglykämie, Ketoazidose, Laktatazidose)
Elektrolytstörungen (z. B. Hyponatriämie, Hyperkalzämie)
Infektionen (z. B. Harnwegsinfekt, SBP, Pneumonie, Neuroinfektionen und septische Enzephalopathie)
Alkohol-, Drogen-, Mischintoxikation (z. B. Benzodiazepine, Neuroleptika, Opioide)
Neurologische Erkrankungen (Epilepsie, Wernicke-Enzephalopathie)
Strukturelle zerebrale Ursachen (z. B. Blutungen, Raumforderungen)
Psychiatrische Erkrankungen (z. B. dementielle Syndrome, Psychose)
* S2k-Leitlinie der DGVS „Komplikationen der Leberzirrhose“ 2019
eingeschränkt werden, zudem ist jene einer klassischen Virushepatitis immer in Betracht zu ziehen. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit eines chronischen Verlaufs einer Hepatitis E bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten.
Bei vielen Patientinnen und Patienten mit erhöhten LFT liegt eine nichtalkoholische Fettlebererkrankung vor, die oft bereits aufgrund des häufig bestehenden adipösen Ernährungszustandes – in vielen Fällen auch zusammen mit einem Metabolischen Syndrom – beobachtet wird. In deren Risikostratifizierung kommt dem einfachen FIB-4-Index eine zentrale Bedeutung zu: Dieser lässt sich anhand von Alter, AST, ALT sowie der Thrombozytenzahl einfach mit Online-Rechnern bestimmen. Liegt der FIB-4-Index unter 1,3, so kann von der Abwesenheit einer signifikanten Leberfibrose ausgegangen werden, Werte über 1,3 sollten hingegen eine LeberElastographie bedingen. Wenn der Wert zwischen 7,9 und 9,6 liegt, dann kann von der Möglichkeit einer fortgeschrittenen Fibrose ausgegangen werden, während bei einem Wert von über 9,6 eine fortgeschrittene Fibrose als praktisch gesichert gilt. Ein FIB-4-Index von über 2,67 sollte zu einer Vorstellung bei Leberspezialistinnen und -spezialisten veranlassen.
Hausärzt:in medizinisch 36 Jänner 2023
ABBILDUNG 2 Serum-Albumin - Aszites-Albumin = SAAG SAAG ≥ 1,1 SAAG ≤ 1,1 Algorithmus und DD von Aszites Aszites-Eiweiß < 2,5 g/dL: - Zirrhose - PHT Aszites-Eiweiß > 2,5 g/dL: - Kardiogen - Budd-Chiari Zytologie & hohes LDH: - Peritoneal-CA - Triglyceride - Amylase/Lipase - Bilirubin - Glukose Seltene Ursachen: - Hämatologische Erkrankungen (Lymphom, Leukämie, Histiozytose X) - Infektionen (Clamydien, Brucellose, Salmonellose, Mb. Whipple, Amöbiasis, TBC) - Nephrotisches Syndrom, Mb. Crohn, Endometriose, chylöser Aszites Wichtiger Hinweis: Serum-Albumin vom selben Tag!
ABBILDUNG
3
Hausärzt:innen können sehr viel bewirken
Identifikation von Risikopersonen und Alarmsignalen Adipositas, Alkoholabusus, Drogen, familiäre Häufung, Hep B + C, Thrombopenie, Leberhautzeichen, periphere Ödeme, Sarkopenie ...
Screening von Risikopersonen Sonografie, nichtinvasive Fibrosetests, Virusdiagnostik
Sichere Diagnose und Suche nach Therapieansätzen! Lebensstilmodifikation, antivirale Therapie, Impfungen ...
Bei Vorliegen einer Zirrhose Varizenscreening, HCC-Screening
α/β-Blocker, Statine Vermeidung von NSAR, Aminoglykosiden und „Naturheilprodukten“
Komplikationen der Leberzirrhose
Wesensveränderungen wie eine mentale Verlangsamung, Antriebsstörungen, Konzentrationsschwäche, gesteigertes Schlafbedürfnis und Störungen der Feinmotorik mit verändertem Schriftbild sind oft die ersten Anzeichen für das Vorliegen einer hepatischen Enzephalopathie (HE). Diese kann sich in fortgeschrittenen Stadien durch zunehmende Müdigkeit, Sprachstörungen, Krämpfe, Rigor und Asterixis äußern. Entscheidend sind die Anamnese und das klinische Bild. Die Serum-Ammoniak-Spiegel-Bestimmung wird wegen zu geringer Sensitivität bzw. Spezifität in aktuellen Leitlinien nicht mehr empfohlen (siehe Infobox 2).
Auslöser einer HE können Infektionen (z. B. HWI, Pneumonie, SBP), Diätfehler und Obstipation sein. Diätetisch sollte keine regelhafte Proteinrestriktion durchgeführt werden, sondern Milchprodukte und pflanzliche Eiweißquellen bevorzugt werden. Medikamentös steht die Gabe von Laktulose [45-90 g (= etwa 3-4 EL) pro Tag] in der Akutphase im Vordergrund. Bei einer Dauergabe sollte Laktulose so dosiert wer-
den, dass der Patient zweimal am Tag breiigen Stuhl hat. Rifaximin 400 mg (3 x 1) hat eine sehr gute Wirksamkeit.
Das Auftreten von Aszites kann als Menetekel der Krankengeschichte von Leberzirrhotikern gesehen werden –der Bestimmung des Serum-AlbuminAszites-Gradienten kommt dabei große differentialdiagnostische Bedeutung zu (siehe Abbildung 2).
In der Therapie des Aszites bei portal dekompensierten Lebererkrankungen ist auf eine ausreichende Eiweißzufuhr von 1,5 g pro kg Körpergewicht pro Tag zu achten und – unter Kontrolle der Nierenfunktionsparameter und Einleitung einer Spironolacton-Furosemid-Therapie – zu empfehlen. Generell wird Menschen mit Aszites eine salzarme Ernährung angeraten, jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass bei gutem Ansprechen auf Diuretika kein Nutzen für eine strenge Kochsalzrestriktion bewiesen ist. Bei schwer zu behandelndem Aszites sollte ein spezialisiertes Zentrum mit der Möglichkeit, einen transjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunt (TIPS) für diese Patientinnen und Patienten zu legen, kontaktiert werden.
Die Klinik von Varizenblutungen im Rahmen einer portal dekompensierten Lebererkrankung kann sehr variabel sein und sollte immer eine umgehende Spitalseinweisung nach sich ziehen. Bei Meläna oder Hämatemesis und klinischem Ver-
dacht einer Varizenblutung sollten vasoaktive Substanzen wie Terlipressin oder Somatostatin zusammen mit einer Antibiotika-Prophylaxe zum frühestmöglichen Zeitpunkt verabreicht werden. Eine besondere Bedeutung kommt Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern in der Betreuung von chronisch Leberkranken hinsichtlich diätetischer Maßnahmen und körperlichen Trainings zu. Muskeltraining, Ausdauertraining und eine gut bilanzierte Ernährung mit überwiegend pflanzlichem Eiweiß und der Einnahme von Spätmahlzeiten können einer Sarkopenie und letztendlich auch einer Enzephalopathie entgegenwirken – sie sollten in ihrer Bedeutung keinesfalls unterschätzt werden. Hausärztinnen und Hausärzte nehmen in der Diagnostik und in der Betreuung chronischer Lebererkrankungen eine zentrale Rolle ein. Sie können sehr viel bewirken! (siehe Abbildung 3) <
Hausärzt:in medizinisch
Neues aus der Phyto-Welt
Relevante Forschungsergebnisse für die klinische Praxis*
Es gibt viele interessante Untersuchungen über pflanzliche Arzneimittel, doch häufig handelt es sich dabei leider um sehr kleine Studien. Zudem sind in diesen Präparaten meist Extrakte enthalten, die in derselben Form wie in der Untersuchung nicht immer erhältlich sind. Weil wir in Österreich jedoch das große Privileg der Magistralen Rezeptur haben, kann bei verfügbarem Wirkstoff oft schnell die Studienmedikation in Apothekenqualität nachgebaut werden. Diese weltweit selten gewordene Kompetenz erhöht das Ansehen österreichischer Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker. Darüber hinaus kann sie für Patientinnen und Patienten – gerade in Zeiten von Lieferengpässen und Versorgungsnotständen sowie in Katastrophenfällen – sehr nützlich sein.
Eibisch- und Malvenextrakte
Im letzten Jahr kamen mehrere Studien über die dermatologische Anwendung von Eibisch- und Malvenextrakten heraus.1,2 Unter ihnen stechen vor allem Arbeiten aus dem Iran hervor, weil dort einerseits sanktionsbedingte Lieferprobleme bei synthetischen Arzneimitteln bestehen, andererseits auch eine eigene Fakultät für Traditionelle Persische Medizin (TPM) existiert. Aus diesen Gründen werden öfters Studien publiziert, die zwar kleine Teilnehmerzahlen haben, aber meist ein gutes Studiendesign aufweisen. Wenn solche Studienmedikationen rezeptiert und magistral nachgebaut werden sollen, dann fast immer nur für eine kleinere Patientenzahl. Dennoch ist es sehr wichtig, bei der magistralen Zubereitung genau auf die Studienmedikation zu achten und zu prüfen, ob sich diese ohne Probleme mit den Mitteln, die auf unserem Markt verfügbar sind, reproduzieren lässt. In mehreren rezenten Studien wurden Eibisch- und Malvenextrakte in Hinblick

GASTAUTOR: Mag. Heinrich Justin Evanzin Apotheker, Heilpflanzenexperte, Mediziner in Ausbildung
auf die Indikation atopische Dermatitis in der pädiatrischen Praxis untersucht. Dabei konnte eine einprozentige Eibischcreme bei einer zweimaligen Anwendung pro Tag über zwei Wochen und bei anschließender Erhaltungstherapie (dreimal pro Woche) ein gleichwertiges Ergebnis erzielen wie eine einprozentige Hydrokortisoncreme im Endpunkt „Vergleich des Hautbildes“. Die Studie zu einem Malvenextrakt in Basiscreme vs. Basiscreme ergab eine Überlegenheit der Malvenzubereitung der Placebocreme im „Vergleich von Hautregeneration und Rötungen“ Interessant sind auch die mitpublizierten In-silico-Untersuchungen über mögliche Wirkmechanismen. Die Gruppe um Naseri et al.2 konnte zeigen, dass die Oligosaccharide des Eibischs an PDE4, IL-6 und TNFα binden. Damit gibt es nun eine Erklärung für die entzündungshemmende Wirkung des Eibischs. Bei den beiden Studienmedikationen handelt es sich um ethanolische Extrakte, die reduziert und anschließend in eine Cremegrundlage eingearbeitet wurden und leider nicht in derselben Form bei uns verfügbar sind. Daher können wir nur eine ähnliche Rezeptur verschreiben, bei der wir den aufgedeckten Wirkmechanismus der wasserlöslichen Wirkstoffe beider Schleimdrogen ausnützen. Dazu kann ein Infus rezeptiert werden, der mit einem Konservierungsmittel (0,15 g Kaliumsorbat und 0,2 g wasserfreie Zitronensäure auf 100 g) versetzt und mit einem Gelbildner (z. B. 1 g Hydroxyethylzellulose) zu einem in der
Akutphase lindernden, kühlenden und entzündungshemmenden Gel wird.
Schwarzkümmelöl
Neues aus der Forschung gibt es auch zur Wirkung des Schwarzkümmels (Nigella sativa) bei Acne vulgaris. Zum einen wurde ein Schwarzkümmeltrockenextrakt in einer Hydrogelformulierung mit einem einfachen Placebohydrogel verglichen.3 Dabei konnte mit einer täglich zweimaligen Anwendung über 60 Tage eine Verbesserung des Acne Disability Index Scores um 63 % erreicht werden. In der Placebogruppe verbesserte sich dieser Wert nur um 4,5 %.
Zum anderen konnte eine etwas ältere – aber für die Praxis interessante Studie – darstellen, dass topisch appliziertes Schwarzkümmelöl bei zyklusbedingten Brustschmerzen eine mit topisch appliziertem Diclofenac vergleichbare Wirkung zeigte.4 Dabei wurden beide pharmakologisch aktiven Formulierungen mit einer Placebogruppe verglichen. Zwar ist die topische Anwendung von Diclofenac bei Brustschmerzen relativ unüblich, dennoch eignet sie sich dazu, die Wirkung des Schwarzkümmelöls bezüglich schmerstillender Eigenschaften abzuschätzen. Topisch appliziertes Schwarzkümmelöl kann somit als analgetische Option zur Senkung des Schmerzmittelverbrauchs bei zyklusbedingten Brustschmerzen herangezogen werden. In der Studie wurde ein dreißigprozentiges Schwarzkümmel-
INFO Eibischgel Rp./ Rad. Altheae 40 g Aqua purif. ad 98,65 g M.f. Infusum (!) deinde add Kalium sorbicum 0,15 g Acidum citricum anhydricum 0,2 g Hydroxyaethylcellulosum 1,0 g/q. s. Misce at fiat Ius gelatum. Abzufüllen in eine Tube.
Hausärzt:in pharmazeutisch 40 Jänner 2023
© privat © shutterstock.com/MyraMyra
ölgel eingesetzt. Um die Studienmedikation nachzubauen, ist es jedoch sinnvoller, eine Cremegrundlage zu verwenden. Es können 30 g Schwarzkümmelöl in 100 g einer Cremeoder Salbengrundlage eingearbeitet werden. Die topische Anwendung von Schwarzkümmelöl kann so als sichere und unbedenkliche Option für die symptomatische Behandlung von Mastodynie genutzt werden.
Anwendung bei Infektionen
Schwarzkümmelöl steht im Fokus vieler Studien der letzten Jahre, insbesondere bei SARS-CoV-2-Infektionen. Es enthält neben essenziellen Fettsäuren auch interessante Wirkstoffe wie das entzündungshemmende Thymochinon und das spasmo- und bronchiolytische α-Hederin. Diese Kombination scheint gerade bei akutem Husten bzw. bei einem Infekt der oberen, aber auch der unteren Atemwege förderlich zu sein. Die Summe dieser Studien deutet darauf hin, dass eine Schwarzkümmelölsubstitution von ca. 1 g pro Tag bei milder bis moderater COVID-Erkrankung sinnvoll eingesetzt werden kann. Eine rezente Studie von November 2022 weist überdies darauf hin, dass sogar mit Long Covid assoziierte Symptome – etwa Fatigue, Geruchsverlust sowie langanhaltender Hustenreiz – signifikant gelindert werden können.5 Hierbei wurde festgestellt, dass sich dieser Effekt in Kombination mit einer Vitamin-D-Substitution noch synergistisch verstärken lässt.5 Besagte Ergebnisse können aus phytotherapeutischer Sicht gut nachvollzogen werden und lassen sich natürlich auch auf andere virale Infekte der Atemwege und die Rekonvaleszenzphasen danach umlegen. Die Studienresultate laden regelrecht dazu ein, in den praktischen Alltag integriert zu werden. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe erhielten die Patienten in den Verumgruppen entweder 900 mg Schwarzkümmelöl oder 2.000 IE Vitamin D oder beides über einen Zeitraum von 14 Tagen. Beides ist auch in Österreich in sehr ähnlicher Form verfügbar.
Pelargoniumextrakt
Neuigkeiten gibt es auch in Bezug auf Pelargoniumextrakt (EPs 7630). Es konnten eine Reduktion der Hustenattacken sowie eine Verkürzung der Schnupfendauer nachgewiesen und im Vergleich mit Amoxicillin bei bakterieller Sinusitis eine Gleichwertigkeit beschrieben werden.6,7 In vitro zeigt der Standardextrakt auch eine Wirkung gegen SARSCoV-2.8 Somit gibt es viele neue Studien, die zum rationalen Einsatz von Phytopharmaka im klinischen Alltag anregen.
* Der Experte war Vortragender bei den 37. Südtiroler Herbstgesprächen von 19. bis 23. Oktober 2022 in Bozen.
Quellen:
1 Meysami M et al., Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2021;21(9):1673-1678. doi: 10. 2174/1871530320666201023125411.
2 Naseri V et al., Phytother Res. 2021 Mar;35(3):1389-1398. doi: 10.1002/ptr.6899.
3 Soleymani S et al., Phytother Res. 2020 Nov;34(11):3052-3062. doi: 10.1002/ptr.6739.
4 Huseini HF et al., Planta Med. 2016 Mar;82(4):285-8. doi: 10.1055/s-0035-1558208.
5 Said S et al., Front. Pharmacol., 08 November 2022/13, 4648. doi.org/10.3389/ fphar.2022.1011522
6 Gökçe Ş et al., Eur J Pediatr. 2021 Sep;180(9):3019-3028. doi: 10.1007/s00431-021-04211-y.
7 Perić A et al., Ann Otol Rhinol Laryngol. 2020 Oct;129(10):969-976. doi: 10.1177/0003489420918266
8 Papies J et al., Front. Pharmacol., 25 October 2021, 2871. doi.org/10.3389/fphar.2021.757666
<
y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at
Wartezimmer TV
Wissenschaft trifft Praxis
COVID-19: Aktuelle Entwicklungen

Sorgenkind China
Nach dem Ende der Null-COVID-Politik und fast drei Jahren andauernder Abschottung hat China seine Grenzen zum Ausland wieder geöffnet. Der erste Flieger landete am 9. Jänner 2023 in Wien. Wegen der starken Corona-Ausbreitung im Land hat sich Österreich wie zahlreiche andere Staaten für eine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik entschieden. Mit den vielen Neuinfektionen in China pro Tag wächst auch die Sorge hinsichtlich der Entwicklung neuer Virusvarianten. Um diese zu entdecken, wies Chinas Gesundheitsamt die Provinzbehörden an, regelmäßig Proben des Virus zu analysieren und über die Ergebnisse zu berichten. Eine wirksame medikamentöse Therapie wäre angesichts der hohen Zahl von COVID-19-Erkrankungen besonders wichtig. Chinesische Wissenschaftler wollen nun mit einer zum Schlucken geeigneten Form des Wirkstoffs Remdesivir in der Behandlung von Risikopatienten keine schlechteren Ergebnisse belegt haben als mit dem im Westen bekannten Paxlovid (Pfizer). Auch Paxlovid selbst ist stark gefragt.
Neue Variante in den USA
In den USA geht ein beträchtlicher Teil der neuen Corona-Infektionen auf die erst seit kurzem bekannte Variante XBB.1.5 zurück. So schätzt die US-Gesundheitsbehörde CDC, dass in der Woche vor dem Jahreswechsel hinter rund 40,5 Prozent aller Neuinfektionen XBB.1.5 steckte. Die Variante könnte laut CDC leichter übertragbar sein. Sie zeichnet sich durch die Mutation F486P im sogenannten Spikeprotein aus. Das ist der Teil des Virus, mit dem es an menschliche Zellen bindet. Was dies genau bedeutet, ist noch unklar. Es gibt jedenfalls keine Hinweise, dass XBB.1.5 zu schwereren Krankheitsverläufen führt.
Immunstatus ist entscheidend
Schwere COVID-19-Krankheitsverläufe sind durch überschießende Immun- und Entzündungsprozesse im Körper charakterisiert. Beim Long-Covid-Syndrom dürfte – umgekehrt – offenbar ein stark antientzündlicher Immunstatus gegeben sein. Das konnten Wiener Wissenschaftler mit umfangreichen Blutplasma-Analysen von Geimpften ohne nachfolgende Erkrankung, Personen mit restlos überstandener COVID-19-Erkrankung und Long-CovidPatienten herausfinden. Die wissenschaftliche Arbeit von Experten rund um Univ.-Prof. Dr. Christopher Gerner von der Fakultät für Chemie der Universität Wien und von Forschern der MedUni Wien ist im Open-Access-Online-Journal „iScience“ erschienen (DOI: 10.1016/j.isci.2022.105717).
APA/reuters/red
Innovatives vom Markt
Teil 2 APOKongress 2022: Migränemedikamente im Überblick
Das zweite Kapitel des Vortrags widmete Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut Spreitzer am APOkongress 2022 den neuen Medikamenten zur Therapie und Prophylaxe der Migräne. Vorab brachte der Experte einen kurzen Abriss über den Krankheitsmechanismus: Bei Migräne kommt es zu einer Überaktivität von Nervenzellen im Hirnstamm. Über den Trigeminusnerv, der alle Blutgefäße im Gehirn innerviert, werden Schmerzsignale an das Gehirn weitergeleitet, es kommt zu einer Gefäßdilatation und in weiterer Folge zu einer Steigerung der Gefäßpermeabilität sowie zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren. Die Folgen sind erhöhte Schmerzempfindlichkeit, Übelkeit oder Erbrechen sowie erhöhte Licht- und Lärmempfindlichkeit.
Eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie der Migräne spielt das Calcium Gene Related Peptide (CGRP). Die Spiegel des Neuropeptids, das aus 37 Aminosäuren besteht, sind zu Beginn einer Attacke erhöht, was wiederum die Erweiterung der Gefäße, den Schmerz und die Entzündung auslöst. Am Ende der Attacke normalisieren sich die Spiegel wieder.
Lasmiditan für die Akuttherapie
In der Akuttherapie von Migräne sind mittlerweile seit 1993 Triptane als „G oldstandard“ im Einsatz. Diese
wirken als Agonisten am 5-HT-Serotonin-Rezeptor auf die Subtypen 1B und 1D und hemmen die Freisetzung des CGRP. Es kommt zu einer Vasokonstriktion der kranialen Gefäße, gehemmt werden weiters die Schmerzweiterleitung sowie der neuronale Entzündungsprozess.
Nachteil: Aufgrund ihrer peripheren vasokonstriktorischen Wirkung sind Triptane bei koronarer Herzkrankheit, Hypertonie und Gefäßerkrankungen kontraindiziert. Lasmiditan (Rayvow®) kann als Weiterentwicklung der Triptane eingestuft werden, allerdings mit einer agonistischen Wirkung auf den Serotonin-Rezeptor Subtyp 1F, der keine periphere Vasokonstriktion auslöst. Damit stellen koronare Herzkrankheiten keine Kontraindikation mehr dar. Fraglich ist, ob Triptan-Nonresponder auf Lasmiditan ansprechen.
EXPERTE:
Migränetagen pro Monat indiziert und bindet – wie seine Vorgänger Galcanezumab und Fremanezumab – direkt an CGRP, wodurch verhindert wird, dass es an seinen Rezeptor andockt.
Neu: Eptinezumab zeichnet sich durch einen sehr raschen Wirkungseintritt aus und ist das erste Migräne vorbeugende Mittel, das intravenös verabreicht wird, mit dem Vorteil, dass die Infusion nur alle drei Monate indiziert ist.
Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Helmut Spreitzer Department für Pharmazeutische Wissenschaften, Universität Wien

Rimegepant zur Akuttherapie und Prophylaxe

Eptinezumab zur Migräneprophylaxe
Nach Erenumab (Aimovig®), Galcanezumab (Emgality®) und Fremanezumab (Ajovy®) gibt es nun mit Eptinezumab (Vyepti®) einen weiteren monoklonalen Antikörper zur Migräneprophylaxe. Eptinezumab ist bei mindestens vier
Rimegepant (Vydura®) ist das erste Migränemedikament aus der Gruppe der CGRP-Rezeptor-Antagonisten, das in Tablettenform verabreicht werden kann und sowohl für die Akuttherapie als auch für die Migräneprophylaxe einsetzbar ist. Zwar zeigt es etwas weniger Wirksamkeit als Triptane, weist aber eine gute Verträglichkeit auf und kann auch bei Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren eingesetzt werden. Da Rimegepant über CYP3A4 metabolisiert wird, sollte auf Ko-Medikationen geachtet werden.
Mag.a Ulrike Krestel
* Die wissenschaftliche Fortbildungstagung für Apothekerinnen und Apotheker fand von 5. bis 6. November in Salzburg und von 12. bis 13. November in Wien statt.
Hausärzt:in pharmazeutisch 46 Jänner 2023
©
Picture
privat © shutterstock.com/Ground
Seitenblicke auf die Medizin Arzt Sicht Sache
„Unsere Neujahrswünsche 2023“
Ausbau von Impfprogrammen
Flexibilisierung der Kassenmedizin

Adaptierungen Mutter-Kind-Pass
Prävention wird auch 2023 eines der wichtigsten Themen bleiben. Denn als Arzt möchte man nicht hinterherhinken, sondern die Patienten behandeln, bevor sie schwer erkrankt sind. Die Untersuchungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zielen genau darauf ab – und der Erfolg spricht für sich: Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit ist seit dessen Einführung rapide gesunken, die Gesundheit der Mütter und Kinder gestiegen. Wir stehen hinter diesem Erfolgskonzept, leider fehlte hierfür die Wertschätzung seitens der Politik und der Sozialversicherung. Die Leistungen wurden fast drei Jahrzehnte lang nicht einmal an die Inflation angepasst. Erst die Drohung, aus dem Vertrag auszusteigen, hat dann den Stein ins Rollen gebracht. Denn nach Jahren des Hinhaltens und der vergeblichen Proteste war es einfach genug. Die Valorisierung der Beträge über die letzten 28 Jahre wurde bereits fixiert. Zusätzlich wurde vereinbart, dass wir unverzüglich Verhandlungen über Adaptierungen und die Einführung neuer Leistungen führen werden.

Was die Vorsorge angeht, haben wir bereits vor einigen Jahren einen „ Jugendpass“, also die Erweiterung des MutterKind-Passes bis zum 18. Lebensjahr, mit wichtigen Vorsorgeuntersuchungen erarbeitet. Präventionsmedizin bedeutet unter anderem, Jugendliche ärztlich zu begleiten, etwa bei Lebensstil- und Suchtproblemen. Präventionsmedizin inkludiert aber auch ein sinnvolles Impfprogramm. Es ist zu begrüßen, dass das kostenlose HPV-Impfprogramm bis zum 21. Lebensjahr erweitert worden ist. Auch der vom Ministerium ab der Wintersaison 2023 geplante österreichweite Ausbau des Influenza-Impfprogramms ist ein wichtiger Schritt in der Prävention. Aus unserer Sicht wäre es hier erstrebenswert, wenn die Influenza- genauso wie die COVID-Impfung in der Ordination bereits gelagert ist und der Patient damit direkt geimpft werden kann. Damit erspart er sich Wege und der Arzt kann nach dem durchgeführten Check des Impfpasses sowie einem Beratungs- und Aufklärungsgespräch sofort impfen.
Facharzttitel für Allgemeinmedizin
Wir blicken positiv in die Zukunft, was die Anerkennung der Allgemeinmedizin angeht. Denn unsere jahrelange Forderung nach einem eigenen Facharzt ist erfüllt worden. Es sind nun noch Gespräche offen, weil für die Umsetzung Änderungen im Ärztegesetz durchgeführt werden müssen. Ich denke, dass der neue Facharzt dazu beitragen kann, dem Kassenärztemangel entgegenzuwirken. Derzeit sind österreichweit über 160 Kassenstellen in der Allgemeinmedizin unbesetzt.
Was die Kassenmedizin angeht, kämpfen wir nach wie vor mit starren Strukturen und fehlender Flexibilität. So ist es derzeit beispielsweise nicht möglich, dass ein Spitalsarzt auch eine Kassenordination betreibt. Somit muss sich jeder, der in beiden Welten arbeiten möchte, als Wahlarzt niederlassen. Das ist nur ein Manko von vielen. Die Rahmenbedingungen durch die Kassenverträge mit Deckelungen und der „FünfMinuten-Medizin“ müssten sich dringend ändern, ebenso jene für Gruppenpraxen, Jobsharing etc. Auch die Richtlinien für Hausapotheken schrecken viele davor ab, eine Praxis zu eröffnen. Die anachronistische Kilometerregelung verhindert das faire duale System von Hausapotheken und öffentlichen Apotheken. Erstrebenswert wäre ein kundenfreundliches Neben- und Miteinander von öffentlichen Apotheken und ärztlichen Hausapotheken. Und: Ärzte brauchen ausreichend Zeit für ihre Patienten. Hilfreich wäre etwa, die Chefarztpflicht bei der Arzneimittelbewilligung abzuschaffen, was zu Beginn der Pandemie auch geschehen ist. Das sollte so bleiben. In der Kassenmedizin muss alles getan werden, um Wartezeiten zu verkürzen und Aufnahmestopps zu vermeiden.
Förderung der Primärversorgung
Mehr Flexibilität benötigen wir auch in der Förderung der Primärversorgung: Derzeit werden die EU-Gelder in Österreich explizit nur an Primärversorgungszentren ausgeschüttet. Primärversorgung umfasst aber die gesamte niederschwellige und wohnortnahe Gesundheitsversorgung, egal ob sie in einer Einzelordination, einer Gruppenpraxis oder einer Primärversorgungseinrichtung stattfindet.
47 Jänner 2023 Hausärzt:in Kommentar <
© Ärztekammer Tirol, Wolfgang Lackner
©
wei
shutterstock.com/wan
OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte.
Expert:innen gründen Cholesterin-Allianz

Interdisziplinäre Bewegung möchte HKE als Todesursache Nr. 1 eliminieren
Prof.in Dr.in Alexandra Kautzky-Willer, Stoffwechsel- und Genderexpertin der MedUni Wien, Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, Arbeiterkammer Niederösterreich, sowie Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek, Past-Präsident der ÖKG, am 14.12.22 zu einer Pressekonferenz.
In Vertretung der interdisziplinären Bewegung luden Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, ÖDG-Präsident, Univ.-
Die Allianz verfolgt drei klare Ziele: Jede:r Österreicher:in kennt seinen/ ihren LDL-C-Wert; jede:r Österreicher:in kennt seinen/ihren LDLC-Zielwert; jede:r Österreicher:in erreicht seinen/ihren individuellen LDL-C-Zielwert. „Um das zu verwirk-
lichen, brauchen wir die Mitwirkung von allen – von Risikopatient:innen ebenso wie von Ärzt:innen, weiteren Health Care Professionals sowie Entscheidungsträger:innen im Gesundheitssystem. Ein Bewusstsein muss auch in der breiten Bevölkerung bestehen“, betont Prof.in Kautzky-Willer. Weitere Expert:innen sowie Institutionen sind eingeladen, sich der CholesterinAllianz anzuschließen. Siehe: cholesterinallianz.at
Quelle: Cholesterin-Allianz
IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber:
RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Helena Valasaki, BA. Cover-Foto: Tatjana Gabrielli
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Ornela-Teodora Chilici, BA, ornela-teodora.chilici@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte bzw. gänzlich orthografisch/grammatikalisch korrekte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke.
Offenlegung: gesund.at/impressum
Hausärzt:in informativ 49 Jänner 2023
© Novartis Pharma GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger
Von li. nach re.: Prof. Rupp, Prof.in Kautzky-Willer, Prof. Clodi, Prof. Siostrzonek.