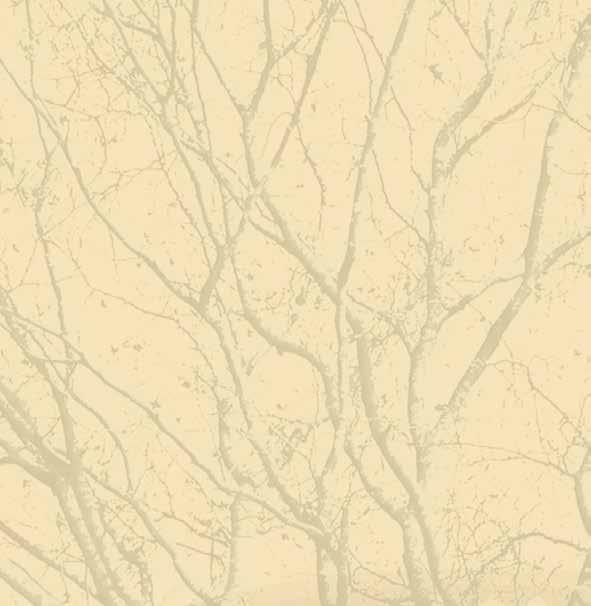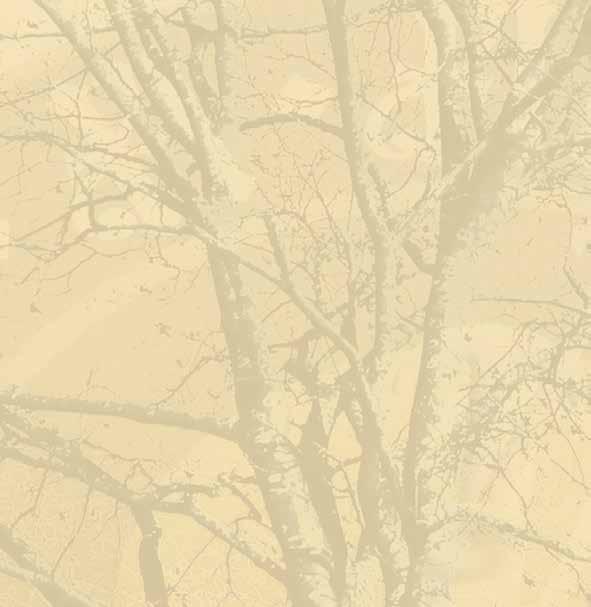6. Jahrgang | 2. Ausgabe | Juli 2019 | € 5,00 Der Sommer, der vergeht, ist wie ein Freund, der uns Lebewohl sagt
Victor Hugo, französischer Schriftsteller, 1802 – 1885 nota bene
03 Editorial
Grußworte von Anneli Zenker und Manfred Preuss
04 Demenz
Häufigkeit von Demenzerkrankungen
05 Demenz
Leben mit Demenz in der Kommune
06 Ernährung
Achtung: Sie essen auch das Kleingedruckte!
08 Bad Wildbad
Bad Wildbad grüßt Gäste aus Großbritannien
10 Literatur
Unter Tränen gelacht
11 Musik
Die Hitze des Sommers und die Frische des Herbstes
12 Demenz
Von Mensch zu Mensch
14 Pflegepolitik
Spahn beim bpa
15 Pflegepolitik
Ja bitte, aber schnell und unkompliziert
16 Bad Liebenzell
Getrennt wurzeln. Gemeinsam wachsen.
18 Demenz
Esstraining bei dementiell veränderten Bewohnern
19 Demenz
Der neue Expertenstandard „Demenz“ zieht in die Johanneshäuser ein
20 Aus der Umgebung
Klassik im Kloster, Benefizkonzerte seit 2006
22 Ergotherapie
Wohlbefinden bei der Arbeit – Gesundheitsförderung durch Ergotherapie
23 Natur und Heilkunde
Tollkirsche – nicht nur Homöopathicum
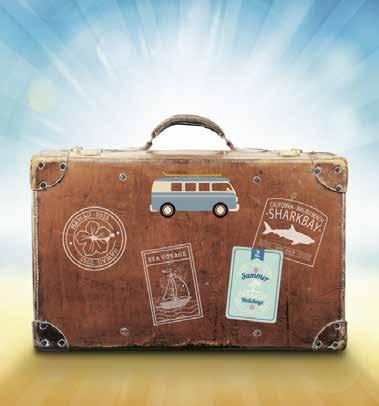
Impressum
Herausgeber:
MHT
Gesellschaft für soziale
Dienstleistungen mbH
Hochwiesenhof 5–10
75323 Bad Wildbad
www.mht-dienstleistung.de
www.johanneshaus-bad-wildbad.de
www.johannesklinik-bad-wildbad.de
www.johanneshaus-bad-liebenzell.de
Redaktion:
Gabriele Pawluczyk | Martin Kromer | Wolfgang Waldenmaier
gabriele.pawluczyk @monacare.de
Grafische Umsetzung:
Dagmar Görlitz
kontakt@goerlitz-grafik.de
Drucktechnische Umsetzung:
Karl M. Dabringer
dabringer@gmx.at
Auflage: 3.000
nota bene | Juli – 2019 Seite 2
Inhalt
Sommer – Sonne – Erfrischung …
… an einem kühlen See in Badesachen unter einem Sonnenschirm mit einem gekühlten Getränk oder dem Lieblingseis sitzend, ein Buch in der Hand oder liebe Freunde an der Seite, die Natur betrachtend oder im Gespräch vertieft, so lässt es sich aushalten …
Jetzt ist die Zeit, die Seele einmal baumeln zu lassen. Den Alltag beiseite zu schieben und mal wieder zu genießen und zu träumen. Kein großartiges Planen, kein voller Terminkalender – einfach nur „SEIN“.
Aussteigen, sich Zeit nehmen für sich selbst, für die Familie, für Freunde. Wieder bewusst wahrnehmen, sich berühren lassen, innehalten, achtsam werden für den Moment im hier und jetzt.
Der Mensch opfert seine Gesundheit, um Geld zu machen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit wieder zu erlangen. Und dann ist er so ängstlich wegen der Zukunft, dass er die Gegenwart nicht genießt; das Resultat ist, dass er nicht in der Gegenwart lebt; er lebt, als würde er nie sterben, und dann stirbt er und hat nie wirklich gelebt (Dalai Lama).
LEBEN wir JETZT.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine berührende und erfüllende Sommerzeit. Nota bene – wohlgemerkt …
Ihre
Anneli Zenker
Geschäftsführerin MHT
nota bene

Zum Geleit


„Ich beginne meine Reise, die mich zum Sonnenuntergang meines Lebens führt.“ Dies war wohl der beeindruckendste Satz aus einem Brief, den Ronald Reagan vor 25 Jahren im Alter von 83 Jahren an sein amerikanisches Volk richtete. Ronald Reagan, dieser starke, einst mächtigste Mann der Welt, hat sein Land über seine beginnende Demenzerkrankung informiert. Ein außergewöhnlicher Schritt für die damalige Zeit. Er hat sicher auch einen Beitrag dazu geleistet, sich langsam, aber nur sehr vorsichtig abzukehren von der beklemmenden Tabuisierung der Demenz in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Weitere prominente Schicksale wurden bekannt – Herbert Wehner, Margot Thatcher, Inge Meysel, Bubi Scholz, Harald Juhnke oder auch Rudi Assauer, um nur einige wenige zu nennen. Und der große Walter Jens, dessen Sohn mit seinem Buch über die Erkrankung seines Vaters die Debatte über den Umgang mit dieser Krankheit massiv befördert hat. Unverändert zählt die Demenz zu den großen Herausforderungen unseres Gemeinwesens. Wir widmen uns in dieser Ausgabe diesem Thema mit einigen Beiträgen, die völlig unterschiedliche Ansätze haben. Und wir wollen die Menschen innerhalb und außerhalb der Johanneshäuser für einen Lehrsatz der international geschätzten Gerontologin, Frau Prof. Ursula Lehr, begeistern, der für die Ewigkeit taugt: „Sehe nicht nur Grenzen, sondern die noch verbliebenen Möglichkeiten. Frage nicht nur nach dem, was Du nicht mehr kannst, sondern nach dem, was Du kannst – und tue dies.“
Manfred Preuss GlobalConcept.Consult AG
Juli – 2019 | nota bene Seite 3 Editorial
Editorial
Häufigkeit von Demenzerkrankungen
In Deutschland leben gegenwärtig rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Jahr für Jahr treten mehr als 300.000 Neuerkrankungen auf. Infolge der demografischen Veränderungen kommt es zu weitaus mehr Neuerkrankungen als zu Sterbefällen unter den bereits Erkrankten. Aus diesem Grund nimmt die Zahl der Demenzkranken kontinuierlich zu. Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt, wird sich nach Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf rund 3 Millionen erhöhen. Dies entspricht einem mittleren Anstieg der Zahl der Erkrankten um 40.000 pro Jahr oder um mehr als 100 pro Tag.
Krankheitsdauer und Mortalität
Demenzen verlaufen zumeist irreversibel und dauern bis zum Tode an. Sie verkürzen die verbleibende, altersübliche Lebenserwartung, die Krankheitsdauer lässt sich jedoch im Einzelfall nicht zuverlässig vorhersagen. Allgemein gilt, dass die Überlebenszeit umso geringer ist, je später im Leben die Erkrankung eintritt, je schwerer die Symptome sind und je mehr körperliche Begleiterkrankungen bestehen Europäische Studien fanden eine mittlere Krankheitsdauer von 3 bis 6 Jahren. Die Dauer schwankt jedoch sehr stark zwischen den Erkrankten; in einigen Fällen wurden Überlebenszeiten von 20 und mehr Jahren berichtet. Im Durchschnitt beläuft sich die Dauer bei einem Krankheitsbeginn im Alter unterhalb von 65 Jahren auf 8 bis 10 Jahre. Sie verringert sich auf weniger als 7 Jahre bei einem Beginn zwischen 65 und 75 und geht auf weniger als 5 Jahre bei einem Beginn zwischen 75 und 85 und auf weniger als 3 Jahre bei einem Beginn oberhalb von 85 Jahren
zurück. Eine Alzheimer-Demenz dauert in der Regel geringfügig länger an als eine vaskuläre Demenz… Einige Verlaufsstudien lassen vermuten, dass die Überlebenszeiten im Einklang mit der allgemein zunehmenden Lebenserwartung angestiegen sind und weiterhin ansteigen werden.
Lebenszeitrisiko
Nach begründeten Schätzungen darf man annehmen, dass rund ein Drittel der im Alter von über 65 Jahren verstorbenen Menschen in der letzten Lebensphase an einer Demenz gelitten hat. Auf die Zahl der hiesigen Sterbefälle übertragen bedeutet das, in Deutschland sterben derzeit pro Jahr rund 290.000 ältere Menschen, die zu Lebzeiten an einer Demenz erkrankt gewesen sind. Unter den Männern, die ein Alter von 65 Jahren erreichen, erkranken bei der gegenwärtigen Lebenserwartung zwischen 25 und 30 Prozent an einer Demenz, unter den Frauen sogar zwischen 37 und nahezu 50 Prozent… Das Risiko hängt stark von der individuellen Lebenserwartung ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir fast alle eine Demenz entwickeln würden, wenn wir nur lange genug leben würden. Käme es nicht zu vorzeitigen Todesfällen aufgrund von anderen Erkrankungen, so würden demnach bis zum Alter von 70 Jahren im Durchschnitt 2 – 3 Prozent und bis zum Alter von 80 Jahren knapp 15 Prozent der Menschen an einer Demenz erkranken. Bis zu einem Alter von 90 Jahren wären fast 50 Prozent der Bevölkerung betroffen, bis zum Alter von 95 Jahren mehr als 70 Prozent und wenn alle ein Alter von 100 Jahren erreichen würden, blieben vermutlich nur 10 – 20 Prozent von einer Demenzerkrankung verschont.

Leben mit Demenz in der Kommune
Es ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Menschen mit Demenz sowie ihre Angehörigen zu unterstützen, ihre Ressourcen wertzuschätzen und sie in dasöffentliche Leben einzubeziehen.
Quelle:
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
nota bene | Juli – 2019 Seite 4 Demenz
red
Ganz Europa und so auch Deutschland mit seinen Kommunen und Gemeinden sind einem beispiellosen demographischen Wandel unterworfen. In einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung nimmt auch die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen zu. Dies stellt das Umfeld – und keineswegs nur das private, wie Angehörige und Betreuende, sondern auch das Gemeinwesen –vor oft unerwartete, nicht selten sogar große Herausforderungen.

Diese Entwicklung macht auch vor Bad Liebenzell nicht halt. Laut einer Studie von Frau Susanne Himbert von der Fachstelle Demenz und Kommune der Alzheimer Gesellschaft Baden Württemberg sind ca. 200 der über 65-jährigen Menschen an Demenz erkrankt, das sind 9,9 % der Bevölkerung. Dies soll in Bad Liebenzell wie auch in anderen Gemeinden in ganz Europa, die sich auf den Weg zur Demenzfreundlichen Kommune machen, kein Tabuthema sein. Seit mehreren Monaten verstärken die Verantwortungsträger der Stadt mit Unterstützung von Frau Himbert ihre Bemühungen und ihr Engagement auf dem Weg zu einer solchen demenzfreundlichen Kommune.
Mit der Gründung eines Netzwerkes für Demenz, in dem die unterschiedlichsten Akteure, wie die Kommunale Verwaltung, Ärzte, professionell Pflegende, Apotheken, Vereine, Stadtseniorenrat, Kirchen, Polizei und Feuerwehr, lokale Wirtschaftsunternehmen und noch andere, vernetzt zusammen-
arbeiten, wird zunächst all dem, was es jetzt bereits an Unterstützung vor Ort gibt, Rechnung getragen. Darüber hinaus wird eine Plattform für weitere koordinierte und wachsende Unterstützung und Hilfestellung geschaffen. Ein solches Netzwerk ermöglicht und fördert den Informationsaustausch sowie eine schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit aller Beteiligten und ermöglicht so manchen Synergie-Effekt.
In den Gemeinden, die sich auf den Weg gemacht haben, finden sich unterschiedliche Bausteine. In Bad Liebenzell ist u.a. die Errichtung einer wohnortnahen Koordinierungs- bzw. Anlaufstelle für Betroffene in Planung. Dort werden Menschen umfassende Beratung, Orientierungshilfen und Informationen zu den Unterstützungsund Hilfeangeboten vor Ort erhalten können, wodurch deren Inanspruchnahme erleichtert werden soll. Weiter dürfen die Menschen mit Demenz in die Gemeinschaft, wie zum Beispiel bei Vereinsveranstaltungen, eingebunden bleiben oder werden. Im Sinne der Inklusion und Integration sollen sie ermutigt werden, an Aktivitäten des Gemeinwesens teilzunehmen und – wo möglich – mitzugestalten. So können sie ihre Ressourcen gewinnbringend für das Gemeinwohl einbringen.
Damit dies ohne Vorbehalte möglich wird, ist es erforderlich und ein weiteres Ziel dieser kommunalen Netzwerke, über die Krankheit Demenz umfassend zu informieren und aufzuklären. Dies soll der Angst vor der Begegnung und einer Stigmatisierung von an Demenz erkrankten Menschen entgegenwirken. Wie bereits vor Jahren begonnen wurde, barrierefreie Zugänge zu Straßen, Geschäften und Häusern zu schaffen, geht es nunmehr darum, eine neue Kultur des Helfens, ein neues Miteinander, sozusagen „Barrierefreiheit in den Köpfen“ zu schaffen. Wird das Umfeld mutiger
im Umgang mit erkrankten Menschen, wirkt dies dem Rückzug aus Scham und damit auch der Vereinsamung Erkrankter und deren Angehöriger entgegen. So stellten Ärzte des Rush Medical Center in Chicago in einer Studie fest, dass ein verlässlicher Freundeskreis und regelmäßige Kontakte zu Angehörigen die klinischen Zeichen einer Alzheimer-Demenz sogar verhindern können. Das Fehlen eines Freundeskreises oder von Angehörigen kann durch den häufigen Kontakt zu Ehrenamtlichen oder die Teilnahme an regelmäßigen Gruppenangeboten zumindest ein wenig ersetzt werden. Ziel aller Aktivitäten ist es, die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz zu erhalten, sie nicht nur als Patienten oder Dienstleistungsnehmer zu sehen, sondern als Bürger und vollwertige wie auch aktive Mitglieder unserer Gesellschaft.
Wir dürfen uns miteinander auf den Weg machen, das Leben von Demenzkranken und ihrer Angehörigen in einer Gemeinde, einem Stadtteil oder der Nachbarschaft lebenswert zu erhalten. Dabei bedarf es des Mutes, eingefahrene Wege und Kommunikationswüsten zu verlassen, Neues zu erproben und dabei im Austausch von- und miteinander zu lernen.
Ursula Dehner
Quelle und weitere Informationen: Susanne Himbert, Fachstelle Demenz und Kommune der Alzheimer Gesellschaft Baden Württemberg, Impulsvortrag „Erfolgreich arbeiten in Demenznetzwerken“
https://www.demenzundkommune-bw.de
Studie Demenzfreundliche Kommunen in Europa
www.efid.info
Vertiefende Literatur
Im Leben bleiben
Unterwegs zu Demenzfreundlichen Kommunen
Reimer Gronemeyer, Gabriele Kreutzner, Verena Rothe
ISBN: 978-3-8394-2996-9
Juli – 2019 | nota bene Seite 5 Demenz

An meinem Kühlschrank hängt die Postkarte mit dem Spruch von Michael Richter: „Man isst auch das Kleingedruckte“. Eine Erinnerung, die ich inzwischen verinnerlicht habe und die mich beim Einkaufen manchmal einiges an Zeit kostet –Produkt in die Hand nehmen, umdrehen, lesen.
Die Lebensmittelindustrie ist verpflichtet anzugeben, was sich in einem Lebensmittel oder einer Lebensmittelzubereitung befindet. Aber selbst mit Brille fällt es mir oft schwer zu erkennen, was dort steht; und habe ich es entziffert, stellt sich die Frage, ob ich weiß, was sich hinter den Angaben verbirgt?
Achtung: Sie essen auch das Kleingedruckte!
Ein Beispiel dafür ist Glutamat, besser bekannt als Geschmacksverstärker. Immer wieder heiß diskutiert, von der Lebensmittelindustrie als unbedenklich eingestuft und versucht, dies durch Studien zu belegen. Leider werden solche Studien oft von genau den Firmen gesponsert, die vom Verkauf der Produkte profitieren.
Nur Betroffene sehen das anders. Bei ihnen kann der Verzehr vom Geschmacksverstärker Glutamat zu gesundheitlichen Problemen führen. Es können nachfolgende Nebenwirkungen auftreten:
q Bluthochdruck
q Magen-Darmbeschwerden
q Migräne
q Herzbeschwerden
q Schweißausbrüche
q Angststörungen
q Depressionen
Bei sehr empfindlichen Menschen kann es das China-Restaurant-Syndrom (da Glutamat dort oft verwendet wird) auslösen. Bemerkbar macht sich dieses durch Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, Gliederschmerzen, Übelkeit.
Auch auf das Sättigungsgefühl hat Glutamat eine starke Auswirkung. Es wirkt

nota bene | Juli – 2019 Seite 6 Ernährung
Gesünder leben –Ernährung als Lebensstil (1)
auf das appetitregelnde Hormon Leptin ein. Die Information „ich bin satt“ kommt beim Gehirn dadurch nicht mehr an. Folglich esse ich weiter, obwohl ich längst genug Nahrung zu mir genommen habe. Menschen und Tiere werden durch Glutamat dazu gebracht, mehr zu essen, als sie eigentlich müssten und sollten. Die Menschen, die sich für die Versuche zur Verfügung gestellt hatten, schlangen ihr Essen schneller herunter, kauten weniger und machten auch weniger Pausen zwischen den einzelnen Happen.

Vielleicht ist Ihnen dieses Phänomen schon einmal nach dem Genuss einer Tüte Kartoffelchips aufgefallen. Wann haben Sie die Tüte weggelegt? Richtig, nachdem der letzte Krümel gegessen war.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Also einfach nur noch Lebensmittel ohne Geschmacksverstärker oder Glutamat kaufen? Gar nicht so einfach!
Da Glutamat auch Lebensmittel geschmacklich aufwertet, die qualitativ minderwertig sind und die der Verbraucher sonst nicht kaufen würde (viele haben sich über die Jahre auch an den klassischen Tütensuppengeschmack gewöhnt), möchte die Lebensmittelindustrie nicht darauf verzichten. Immerhin würde dies zu hohen finanziellen Einbußen führen. Also muss „das Kind einen anderen Namen“ bekommen. Auch unter folgenden Namen und Bezeichnungen kann sich der Ge -
schmacksverstärker verstecken:
q Würze
q Aroma (darf bis 30 % reines Natriumglutamat enthalten)
q Natriumglutamat
q E 621 bis E 625 (Salze der Glutaminsäure)
q Auch Maltodextrin, Carrageen, Weizenprotein oder Trockenmilcherzeugnis kann ein Hinweis auf Glutamat sein.
Oft wird als Alternative Hefeextrakt benutzt (leider auch bei Biolebensmitteln). In der Wirkung ist dieses exakt gleich wie das „echte“ Glutamat. Da es als Zutat gilt und nicht als Zusatzstoff, darf auf der Inhaltsstoffliste „ohne deklarierungspflichtige Zusatzstoffe“ stehen. Prima für die „Clean-Label-Bewegung“ (sauberes Etikett), deswegen wird es in der Nahrungsmittelindustrie inzwischen sehr gerne eingesetzt. Werden wir als Verbraucher da nicht ziemlich getäuscht?
Wie kann ich mich davor schützen?
q Lebensmittel so naturbelassen wie möglich kaufen, dafür eignen sich sehr gut Bauernmärkte oder Hofläden.
q Je weniger Zutaten auf einem Produkt aufgeführt werden, umso besser.
q Auf klare eindeutige Bezeichnungen, Zutaten achten (was ich nicht kenne, kaufe ich nicht).
q Auf Fertigwürzmittel weitgehend verzichten, stattdessen Würzmischungen selber zusammen mischen, z. B. Mischung für Bolognese:
Kräutersalz (am besten ohne Rieselhilfe), Pfeffer, Paprika, Basilikum, Oregano, Majoran und eventuell Knoblauchpulver miteinander vermischen, in Schraubgläsern trocken aufbewahren. Einmal zubereitet,
bin ich damit beim Würzen genauso schnell wie mit einer „fixen Tüte“.
q Auch Gemüsebrühen können aus fein zerkleinertem Gemüse und einem guten Salz auf Vorrat zubereitet werden.
q Statt Fertig-Salatsoßen, Salatsoßen aus einem hochwertigen Öl, Essig oder Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Kräutern und eventuell Senf im Schüttelbecher vermengen (hält sich im Kühlschrank einige Tage).
q Fertiggerichte meiden.
q Beim Restaurantbesuch nach den Inhaltsstoffen fragen.
q Fast-Food-Ketten meiden.
q Bei Bio-Fertiggerichten drauf achten, Produkte ohne Hefeextrakt zu kaufen. Glutamat ist gewöhnlich in Bioprodukten nicht enthalten.
Wer intensiver in die Materie einsteigen will, findet gute Infos in den Büchern von Hans-Ulrich Grimm, z. B. „Chemie im Essen“, über Lebensmittel-Zusatzstoffe oder die „Ernährungslüge“.
Aber auch die Organisation foodwatch klärt auf ihrer Internetseite den Verbraucher auf und erhebt für sich den Anspruch: „foodwatch entlarvt die verbraucherfeindlichen Praktiken der Lebensmittelindustrie und kämpft für das Recht der Verbraucherinnen und Verbraucher auf qualitativ gute, gesundheitlich unbedenkliche und ehrliche Lebensmittel“.
Bianka Zielke
MHT Ernährungsberaterin und Diätassistentin

Bianka Zielke wird in der heutigen und in den nächsten Ausgaben von nota bene Tipps und Informationen aus ihrem Berufsleben vermitteln, die interessierte Leser bei einer gesunden Ernährung unterstützen wollen.
Juli – 2019 | nota bene Seite 7 Ernährung
Das auserkorene Ziel dieser außergewöhnlichen Aktion galt den Besuchern aus Großbritannien. Während das Vereinigte Königreich heute mit mehr als 800 Übernachtungen im Jahr nach den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich zu einem der wichtigsten ausländischen Zielmärkte für die Kurstadt zählt, war der Badeort im Schwarzwald bereits im 19. Jahrhundert ein beliebtes Feriendomizil der Insulaner. Um den Briten trotz drohendem Brexit ein Zeichen von Heimat

zu vermitteln, lockte das Marcel Baluta Ensemble im Forum König-Karls-Bad mit einer „Musikalische Reise nach England“ und auch das Kino bot ein besonderes Programm. Britische Gerichte gab es bei Moknis Restaurant Rossini, dem Hotel Weingärtner sowie dem Family-Resort Kleinenzhof. Für eine typisch englische Teatime hatte sich


Im April hisste Bürgermeister Klaus Mack gemeinsam mit Touristikchefin Stefanie Dickgiesser nicht nur die britische Fahne in Bad Wildbad, sondern bot darüber hinaus in der Kurstadt erstmals „Britische Wochen“ verbunden mit einem attraktiven Programm rund um Kur, Kultur und Kulinarik.
Bad Wildbad grüßt Gäste aus Großbritannien
die Kaffee Manufaktur entschieden. Traditionelles Teegebäck, Apple Pie mit süßen Äpfeln und knuspriger Kruste sowie Mandelkuchen ergänzen dort mittlerweile mit einem Rauchtee das Sortiment, weil kein geringerer als der britische Staatsmann Winston Chur-


chill den über Kiefernholz geräucherten Tee zusammen mit seinen kubanischen Zigarren zu genießen wusste.
Wichtigstes Motiv für die Aktion, die über facebook auch in London beworben wurde, ist die „Englische Kirche“ im Kurpark der Kurstadt. Auf Betreiben des englischen Gesandten in Stuttgart, G. J. R. Gordon, wurde das Gotteshaus aus rotem Sandstein für



die vielen englischen Gäste in Wildbad gebaut, wie Barbara Hammann-Reister vom Geschichtsverein berichtet. Auslösender Faktor für den Besucherstrom
nota bene | Juli – 2019 Seite 8 Bad Wildbad
aus Großbritannien ist eine Veröffentlichung des Londoner Allgemeinmediziners Dr. Augustus Bozzi Granville (1783–1872), der Wildbad im Jahr 1837 unter den „Spas of Germany“, also den Thermen des deutschsprachigen Raums, als Nummer eins tituliert. „Da das Wildbadwasser von Natur aus so heiß ist, wie es für den menschlichen Körper am besten geeignet ist, ist es den warmen Quellen vorzuziehen, die spontan gekühlt werden müssen.“
1837, als die 18-jährige Victoria Königin von Großbritannien und Irland wird, gibt es bereits eine erste Bahnverbindung von London nach Birmingham. Doch in Baden und Württemberg müs-

natürlich warm und sanft murmelnd, werde ich nie vergessen.“ Neben seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlichte Granville mehr als 220 Bücher und Schriften, die in sieben Sprachen zu lesen sind. Als britischer Arzt praktizierte er in Kissingen, um in den Sommermonaten die zahlreichen englischsprachigen Kurgäste ohne Sprachschwierigkeiten zu behandeln. Granville war es auch, der den italienischen Komponisten Gioachino Antonio Rossini (1792–1868) für eine Kur in Wildbad begeistert haben soll und der eine lange alphabetische Liste für die Lebensmittel erstellte, die er für den Patienten als geeignet oder ungeeignet hielt. Dabei waren Mandelmilch


sen die Wege noch mit Pferdekutschen zurückgelegt werden. Für die beschwerliche Reise nach Wildbad, dessen Lage der Autor „inmitten der Wildnis des Schwarzwaldes“ beschreibt, benötigt Granville allein von Stuttgart aus zehn Stunden. Doch die Kraft des Mineralwassers lässt die Strapazen schnell vergessen: „Diesen angenehmen Eindruck,


welchen das Wasser auf mich machte, als es aus der Tiefe hervorquellend über meinen Körper floss, durchsichtig wie das gläserne Aquamarin, weich,

ge Palais Thermal – entstanden und lockten adelige Gäste wie Zarin Alexandra Fjodorowna (1798–1860) in den Badeort. Medien, wie die erstmals 1842 erschienene „Illustrated London News“ berichteten darüber und so ist in dem erfolgreichen Periodikum auch

und Bier erlaubt, Glühwein, Punsch und Tee verpönt. Für einen Kuraufenthalt empfahl er die Monate Mai bis September und war damit Auslöser für viele weitere Gäste aus Großbritannien, die sich in den Sommermonaten für sechs bis acht Wochen mit ihrer Dienerschaft in Wildbad einquartierten. Auch die wohlhabende Lady Ann Vavasour berichtet in ihrer Reisebeschreibung aus dem Jahr 1842 ausführlich über einen Besuch in Wildbad. Sie lobt die Sauberkeit in den Bädern mit dem durchlaufenden Wasser und nennt Wildbad „gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen den wichtigsten deutschen Kurorten an Schönheit und Romantik seiner Umgebung.“
Um den Anforderungen der Badegäste gerecht zu werden, wurde investiert. Neue Bauwerke wie das Badhotel und das Graf-Eberhard-Bad – das heuti-

die „Englische Kirche“ in Wildbad abgebildet. Zuständig für die Kirche war die "Society of the Propagation of the Gospel in foreign parts" (Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums in fremden Ländern). Daher kamen die Geistlichen aus England, wie William Ludlow, der von 1863 bis 1888 als anglikanischer Geistlicher im Sommer in Wildbad tätig war. Auch sein Nachfolger Reverend Alexander Frederick Dyce predigte in den Sommermonaten von 1889 bis 1897 in Wildbad – in den Wintermonaten dagegen wirkte er im südfranzösischen St. Raphael. Einst im Stil einer mittelalterlichen Dorfkirche für englische Gäste erbaut, zählt das Kleinod heute zu einem attraktiven Zeremonienort für Hochzeiten aller Couleur.
Sabine Zoller
Juli – 2019 | nota bene Seite 9 Bad Wildbad
Fotos:
Sabine Zoller




Eine Tochter berichtet von der Demenzerkrankung ihres Vaters
Unter Tränen gelacht
Bettina Tietjen ist eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands. Man kennt sie als erfolgreiche Talkmasterin in vielen Produktionen der ARD und vor allem des NDR.
In ihren Sendungen zeigt sie, wie man auf geschickte und einfühlsame Art – dazu mit einem gerüttelt Maß an Humor – interessante und unterhaltsame Lebensgeschichten über die Talkgäste in Erfahrung bringt.
Nun hat sie vor einiger Zeit ein Buch veröffentlicht, das ganz tief in ihr eigenes privates Leben blicken lässt: „Unter Tränen gelacht – Mein Vater, die Demenz und ich“.
Bettina Tietjen beschreibt auf eindringliche Weise, wie die Krankheit ihres Vaters beginnt und sich dann mehr und mehr ausweitet. Sie erzählt von Begebenheiten, die ihr erst im Rückblick als untrügliche Zeichen einer dementiellen Entwicklung einleuchteten. Vom anfänglichen „Tüdeln“ des geliebten Vaters bis hin zur völligen Orientierungslosigkeit. Die Geschichte dieser Demenz beginnt mit einem nächtli-
chen Anruf der Polizei, die der Autorin mitteilt, doch bitte sofort von Hamburg aus nach Wuppertal zum Reihenhaus des Vaters zu kommen. Die Polizei teilt ihr zudem mit, die Betreuerin sei betrunken im Wohnzimmer vorgefunden worden und nun im Krankenhaus und ihr verwirrter Vater würde gerade von Nachbarn zu Bett gebracht.
Diesen Schock, dass von jetzt auf gleich nichts mehr ist wie vorher, dass der Vater nun eben nicht mehr alleine im Reihenhaus in Wuppertal leben kann, den beschreibt Bettina Tietjen sehr anschaulich und nachvollziehbar. Es musste ein Platz in einem Pflegeheim gesucht werden. Die Schwester der Autorin hatte sich die letzten zwanzig Jahre um den Witwer gekümmert, deshalb beschlossen die beiden Schwestern, dass ein Pflegeheim in Hamburg gesucht wird.
Das Buch handelt vom Auf und Ab der Gefühle, vom Schmerz und von der Trauer, den geliebten Elternteil zu verlieren und zuschauen zu müssen, wie er sich entfernt, verändert, nicht mehr der ist, auf den immer Verlass war. Aber es handelt auch von glücklichen Momenten des Zusammenseins, von komischen Augenblicken, vom gemeinsamen Lachen und von wohltuender Nähe. Den Vater in der letzten Phase seines Lebens begleitet zu haben, sei letztendlich eine Quelle der Kraft für sie gewesen, resümiert Bettina Tietjen in ihrem äußerst lesenswerten, mutigen Buch.
Wolfgang Waldenmaier
Bettina Tietjen:
Unter Tränen gelacht – Mein Vater, die Demenz und ich Piper Verlag München, 2016; Taschenbuchausgabe, 6. Auflage, Dezember 2018
(auch als Hörbuch erhältlich)
nota bene | Juli – 2019 Seite 10 Literatur
Notizen zu Vivaldis Violinkonzerten „L’Estate“ und „L’Autunno“
Die Hitze des Sommers und die Frische des Herbstes
Der Sommer
Wenn eine erbarmungslos sengende Sonne, eine lähmend schwere Hitze je adäquat in eine musikalische Form gegossen wurde, dann aufs Eindrücklichste im „Sommer“ aus „Le Quattro Stagioni“ von Antonio Vivaldi (Violinkonzert, op. 8,2, g-moll). Im ersten Satz (Allegro non molto) begegnet uns ein Szenarium, in dem die heiß brennende Sonne in Melodie und Instrumentarium hörbar Mensch und Tier niederdrückt und das Leben nahezu zum Erliegen bringt. Am Ende dieses Satzes kündigt sich ein wahrhaft stürmisches Sommergewitter an.
In Satz Nummer zwei (Adagio/Presto) spüren wir eine aufgeladene nervöse Stimmung in allen Fasern der Musik. Vivaldi bietet alles an sirrenden, schwir-
CD-Tipps



renden Klängen, um die Angst vor dem unmittelbar bevorstehenden Unwetter in Töne zu setzen.
Und dann erfüllen sich im dritten Satz (Presto) alle Befürchtungen: Blitz und Donner schrecken sowohl den Hirten als auch seine Herde. Hagel prasselt gnadenlos auf die Erde herab und zerschlägt und vernichtet damit die Ernte. Dramatisch und nahezu ohne Hoffnung endet hier Vivaldis „Sommer“.
Der Herbst
Antonio Vivaldis Konzert „L’Autunno“ (Violinkonzert, op. 8,3, F-Dur) besitzt von Anfang an einen ganz gegensätzlichen Charakter zum schwermütigen „Sommer“. Die strahlende Tonart bietet hier den Hintergrund für eine musikalische Kurzgeschichte über die Freuden

des Lebens. Im ersten Satz (Allegro) wird getanzt, gesungen, getrunken und ausgelassen gefeiert.
Im zweiten Satz (Adagio) kehrt Ruhe ein in die Menge der eben noch wild und freudig feiernden Erntehelfer. Vivaldis Musik schildert in sanften Tönen den erholsamen Schlaf nach einem rauschenden Fest.
Am nächsten Morgen beginnt mit dem dritten Satz (Allegro) die herbstliche Jagd. Mit Jagdhörnern, mit Hunden und Gewehren geht es musikalisch dem Wild an den Kragen. Die Flucht der Tiere vor den Jägern und das Nachsetzen der Meute gießt Vivaldi zum Schluss in ein fulminantes Allegro.
Wolfgang Waldenmaier
Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten/The Four Seasons/Le Quattro Stagioni:
7 The Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung Neville Marriner; Decca, 1970
7 Wiener Philharmoniker, Anne Sophie Mutter, Leitung Herbert von Karajan; Warner Classic, 1984
7 The English Chamber Orchestra, Nigel Kennedy, Violin & Director; EMI Classics, 1987
7 Hamburg Soloists, Florin Paul, Leitung Emil Klein; Sony Classical, 2013
Juli – 2019 | nota bene Seite 11 Musik

Von Mensch zu Mensch
Wenn ich dement werde, soll mein Leben einfach, übersichtlich und voraussichtlich sein. Und so sein, dass ich das gleiche mache jeden Tag zur gleichen Zeit, auch wenn es dauert, bis ich es begreife.
Wenn ich dement werde, musst du ruhig mit mir sprechen, damit ich keine Angst bekomme und nicht das Gefühl kriege, dass du böse mit mir bist. Du sollst mir immer erzählen, was du tust. Du solltest mich wählen lassen und respektieren, was ich wähle.
Wenn ich dement werde, denke daran, dass es gut für mich wäre, schöne Erlebnisse zu haben, auch dass du sie mir erzählst, bevor ich sie erlebe.

Wenn ich dement werde, brauche ich und kriege ich viel mehr Schlaf, als ich eigentlich will. Und wenn ich schlafe, habe ich immer Angst, dass ich nicht mehr wach werde. Gib mir Mut zum schlafen.
Wenn ich dement werde, kann ich vielleicht nicht mehr mit Messer und Gabel essen, aber bestimmt sehr gut mit den Fingern. Lass mich das tun.
Wenn ich dement werde, kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich gerne möchte, dann musst du lernen, mir das zu zeigen.
Wenn ich dement werde, und ich bin eigensinnig und boshaft und habe schlechte Laune, dann bin ich das, weil ich mich machtlos und hilflos fühle. Das hasse ich.


Wenn ich dement werde und Panik kriege, dann, weil ich zwei Dinge gleichzeitig denken soll. Halt meine Hand fest und hilf mir, mich auf eine Sache zu konzentrieren.


nota bene | Juli – 2019 Seite 12
Demenz

Wenn ich dement werde, bin ich leicht zu beruhigen, nicht mit Worten, sondern in dem du ganz ruhig neben mir sitzt und meine Hand festhältst.
Wenn ich dement werde, verstehe ich nicht das Abstrakte. Ich will sehen, spüren und begreifen, wovon du sprichst.
Wenn ich dement werde, habe ich das Gefühl, dass andere mich nicht mehr verstehen. Genauso schwer ist es für mich, andere zu versehen. Mach deine Stimme ganz leise und sieh mir ins Gesicht, dann verstehe ich dich am besten. Mache wenig Worte und einfache Sätze und versuche herauszufinden, ob ich alles verstanden habe. Schaue mich an und lache, bevor du mit mir sprichst.
Vergiss nicht, dass ich viel vergesse!

Wenn ich dement werde, möchte ich gute Musik hören von damals, aber ich habe vergessen, welche. Lass sie uns zusammen hören, ich vermisse das. Ich mag auch gerne singen, aber nicht allein.
Wenn ich dement werde und sage: „Ich will nach Hause“, dann antworte mir ernsthaft, damit ich merke, dass du weißt, dass ich mich im Moment sehr unsicher fühle.
Wenn ich dement werde und schimpfe, dann gehe einen Schritt zurück von mir, so spüre ich, dass ich immer noch Eindruck machen kann. Ich bin oft verzweifelt. Verzweifle nicht auch du!

Gedanken eines Menschen mit beginnender Demenz


Juli – 2019 | nota bene Seite 13 Demenz
Es ist gar keine Frage, die Stimmung im gut gefüllten Veranstaltungssaal war beim Besuch des Bundesgesundheitsministers Spahn vor über 600 Vertretern der bpa-Mitgliedseinrichtungen im Berliner Titanic-Hotel in hohem Maße angespannt. Und obwohl in den vergangenen Monaten nicht alle Verlautbarungen des Ministers die ungeteilte Zustimmung des bpa und seiner Mitglieder gefunden hatten, war die Erwartungshaltung groß.

„Die Zahl der privaten Pflegedienste und Pflegeheime wächst von Jahr zu Jahr weiter an. Wir sind verlässliche Partner der Pflegebedürftigen in ganz Deutschland – sei es auf dem platten Land oder in der Großstadt“, hatte bpaPräsident Bernd Meurer einleitend betont und hinzugefügt: „Den Heimen und Pflegediensten ist es gelungen, innerhalb der letzten zwei Jahre 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs zu besetzen. Das ist im Vergleich zu anderen Branchen ein wirklich herausragender Erfolg. Jedoch brauchen wir eine belastbare Strategie zur Versorgung einer stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen bei einer bestenfalls stagnierenden Zahl an Fachkräften. Schon heute finden viele pflegebedürftige Menschen nur mit großer Mühe die notwendige professionelle Unterstützung.“
Die Mitgliederversammlung 2019 des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Berlin empfing als Gastredner den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
Spahn beim bpa
Spahn, der weitestgehend frei sprach und sich auch in komplizierten Details absolut sicher bewegte, zeigte hohes Verständnis für die Forderungen und Standpunkte des Verbandes, ausdrücklich einschließlich des umstrittenen Problems eines angemessenen kalkulatorischen Unternehmerlohns. Er machte glaubhaft deutlich, dass für ihn die privaten Träger hierzulande ein wichtiges Standbein in der Pflege seien, ohne die es ein massives Versorgungsproblem gäbe. So sehr Übereinstimmung in vielen fachlichen Fragen erkennbar war, wie der besseren personellen Ausstattung der Einrichtungen, der attraktiveren Vergütung der Pflegemitarbeitenden oder der Notwendigkeit der unbürokratischeren Anwerbung aus-
ländischer Fachkräfte, so sehr forderte der Minister aber auch ein engagierteres Eintreten der privaten Träger für die Schaffung möglichst einheitlicher tariflicher Grundlagen über die Grenzen einzelner Trägerverbände ein.
Nach einer breit angelegten Diskussion mit dem Minister verließ man nach gut zwei Stunden den Saal mit einem guten Gefühl – irgendwie fühlte man sich mit seinen Problemen verstanden und aufgehoben. Ob dieses Gefühl aber von Dauer sein wird, kann erst die Zukunft zeigen – wenn aus Worten Taten werden müssen.

nota bene | Juli – 2019 Seite 14 Pflegepolitik
red
Mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen will die Bundesregierung der Personalnot in der Alten- und Krankenpflege entgegenwirken. So heißt es. Klingt erst einmal gut. Ein entsprechendes Gesetz für höhere Löhne hat die Bundesregierung schon einmal auf den Weg gebracht. Ziel ist es dabei, dass künftig möglichst in der gesamten Pflegebranche einheitliche Tariflöhne gezahlt werden sollen. Und da fängt das Problem schon an. Viele Arbeitgeber, nicht nur die privaten, lehnen einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag ab – zu unterschiedlich sind die strukturellen Rahmenbedingungen in großstädtischen Ballungszentren gegenüber dem platten Land. Zudem wird eine gesetzliche Regelung von vielen als Angriff auf die Tarifautonomie gesehen.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) reagiert auf die vorgetragenen Bedenken dünnhäutig: „Wer nicht begreift, dass wir besser bezahlen müssen, wer glaubt, dass wir allein mit Zuwanderung dieses Problem lösen, hat in der Pflege nicht viel begriffen.“ Sehr geehrter Herr Bundesminister, hier haben aber eindeutig Sie nicht verstanden, worum es geht.
Bedenken an der seitens der Bundesregierung bisher bevorzugten tariflichen Lösung bedeuten ja nicht, dass allen Akteuren nicht bewusst wäre, dass es in der Branche dringend zu attraktiveren Vergütungsmodellen kommen muss. Dies war und ist unstrittig. Keiner hat gesagt, dass er nicht besser bezahlen wolle. Und um das noch einmal in aller
Pflegekräfte sollen besser bezahlt werden
Ja bitte, aber schnell und unkompliziert
Ein Kommentar von Manfred Preuss

Klarheit deutlich zu machen – wenn es um die bessere Vergütung unserer Mitarbeitenden geht, marschieren wir an vorderster Front und Schulter an Schulter mit allen, die dies ernsthaft auch wollen.
Nur wollen wir nicht weiter endlos darüber diskutieren. Und wir wollen auch keine Zeit vergeudenden Stellvertreterdiskussionen, ob und wie das eventuell mit einem flächendeckenden Tarifvertrag geregelt werden könnte. Wir wollen schnelle und unkomplizierte Lösungen. Wenn wir uns alle einig sind, dass die Menschen in der Altenund Krankenpflege mehr verdienen
Patientenschützer warnen bei dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vor einer Kostenexplosion. Eine Finanzierung wäre wohl nur über eine weitere Anhebung der Pflegeversicherungsbeiträge möglich. Im Moment liegt der Beitragssatz bei 3,05 % des Brutto – Kinderlose zahlen 3,3 %. Die Beiträge waren erst zum Jahresanfang 2019 erhöht worden. red
müssen, dann lassen sie uns auf eine durchschnittliche Erhöhungsquote der jeweils real gezahlten Vergütungen verständigen – gerne 3 %, 5 % oder auch mehr. Nichts lässt sich für jeden Träger einfacher dokumentieren und belegen als der daraus resultierende Mehraufwand zu seinen tatsächlichen Personalkosten.
Will man, dass der Leistungsempfänger die Mehrkosten trägt, müssen sie in die Pflegesätze einfließen. Will man, dass der Leistungsempfänger nicht in Anspruch genommen wird, muss man die jeweils ermittelten Beträge den Trägern in Form von staatlichen Zuschüssen zukommen lassen. Das mag unkonventionell sein, aber machbar. Wenn wir uns anstelle dessen auf eine kräfte- und zeitraubende Tarif- und Finanzierungsdiskussion einlassen, werden wir bald das Vertrauen verspielt haben, dass wir wirklich etwas verändern wollen. Und das wäre der Supergau.
Juli – 2019 | nota bene Seite 15 Pflegepolitik
Direkt am Ufer der Nagold liegt der erste philosophische Themenpark Europas, eingebettet in eine Parklandschaft, die mit prägenden farblichen Nuancen aus der Pflanzenwelt wie ein Natur-Gemälde aussieht.
2017 als gemeinnützige Stiftung in Bad Liebenzell eröffnet, bietet der Park seinen Besuchern nicht nur eine spannende Zeitreise durch die Welt der Philosophie, sondern auch einen faszinierenden Rundgang durch die Welt von Blüten und Pflanzen. Der Name Sophie steht als Kürzel für „Soft Philosophy“ und soll philosophische Weisheiten bei einem Spaziergang auf leicht verständliche Art und Weise vermitteln.

Dass der Sophie-Park im Quellenschutzgebiet von Bad Liebenzell angelegt wurde, verdient besondere Aufmerksamkeit. Hier plätschert eine der elf Quellen, die die Kurstadt besitzt, denn Wasserquellen sind wie philosophische Gedankenquellen wichtige Lieferanten für das menschliche und pflanzliche Wohlergehen. Das zwei Hektar große Areal ist weltweit einzigartig. Es weist nicht nur eine abenteuerliche Zeitreise durch 2500 Jahre Geistesgeschichte von der Antike über das Mittelalter und die Renaissance bis hin zur Aufklärung und Moderne auf, sondern bietet auf dem lehrreichen Rundweg zudem zehn verschieden gestaltete Parkregionen, die nicht nur mit Pflanzen bezaubern, sondern mit ihrer Staudenpracht auch der Nase ein großes Vergnügen bereiten. Von Mai bis Oktober wandelt sich das

Bild des Parks durch seine Bepflanzung und bietet so immer wieder aufs Neue eine farbenfrohe Landschaft.
Rund 100 Weisheiten sind im Park auf witterungsbeständigen Acrylgralsscheiben verewigt und farblich dazu
passend sind auch die Pflanzenbeete zu den Themenbereichen gestaltet. Dazu wurden zu jeder dargestellten Epoche im Park Gewächse passend nach Farben ausgewählt. Für die insgesamt 14 Pflanzenflächen wurden 4.300 Stauden, Gräser und Rosen gepflanzt,


nota bene | Juli – 2019 Seite 16
Fotos: Sabine Zoller
Gemeinsam wachsen.
Blühende Beetkollektionen im Sophie Park Bad Liebenzell
Getrennt wurzeln.

die Anne Rosteck in einem Pflanzenplan akribisch zugeordnet hat.
Die gebürtige Flensburgerin hat ihr Handwerk in der 1926 gegründeten Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin gelernt, die seit über 90 Jahren mit ihrem Namen für Pflanzenqualität und Gartenkultur steht. Im Anschluss folgte ein Studium der Landschaftsarchitektur in Weihenstephan, Bayern, um danach im größten Botanischen Garten der Welt, Kew Gardens in London, Gartenkultur (Horticulture) zu studieren. Zudem hat sich Rosteck in verschiedenen Gärten des Königreiches umgesehen und ihre Studien auf Landsitzen wie Coleton Fishacre aus den 1920er Jahren mit üppigem Garten am Meer vervollständigt. Wieder zurück in Deutschland hat sie bei der Staudengärtnerei von Zeppelin die Bepflanzungsplanung übernommen und ist somit Ansprechpartnerin für gestalterische Fragen. Durch den Kontakt zu Ines Veith, der Ideengeberin und Initiatorin des Sophie-


Parks wurde Rosteck zur Gestalterin der Sophie-Parkbeete auserkoren, um mit ihrem Fachwissen die Feinkompositionen so zu gestalten, dass Parkbesucher ganzjährig ihre Lieblingsplätze mit attraktiven Beeten aufsuchen können. Wichtigste Voraussetzung für die Gestaltung war zunächst die Zuordnung von Pflanzen, die als monochrome (griechisch ‚einfarbige‘) Beete in ihrer Farbgebung den Farbvorgaben der jeweiligen Epoche angepasst werden mussten: Ockerfarben und Gelb stehen also für das „Mittelalter“, die Farbe Lila für die „Renaissance“ und die „Denker der Region“ sind in Blau gehalten. Die „Aufklärung“ triumphiert in Rot und die „Moderne“ in Orange. „Lebensweisheiten“ sind in Pink und die „Philosophen der Welt“ in Grün zu bepflanzen. Alles in allem keine einfach zu bewältigende Aufgabe, da die Besonderheiten von Boden und Klima zu beachten sind. Anne Rosteck stellte sich daher zunächst der wichtigen Aufgabe, um aus dem rund 2500 Arten und Sorten umfassenden Sortiment der Staudengärtnerei solche Pflanzen auszuwählen, die in Verbindung mit dem Bad Liebenzeller Klima auch gut gedeihen können. Damit waren mediterrane Pflanzen, die trockenen Böden den Vorzug geben, sofort aussortiert. Gesucht wurden solche, die auch ein kalter Winter nicht umbringen kann und die auch dann gedeihen, wenn viel Wasser steht.
Um die Beete optisch von den Wegen im Park abzugrenzen, wurden ausdau-

ernde und pflegeleichte Stauden mit einer Hecke begrenzt, die optisch wie eine „Rückenlehne“ zu den kontrastreichen, weichen Gewächsen in den Beeten zu betrachten ist. Für die rote Farbsinfonie der „Aufklärung“ wurden leuchtend signalrote Bodendecker-Rosen mit den ungewöhnlichen Blüten der Lupinen kombiniert. Purpurglöckchen, rotlaubiger Knöterich und Blattschmuckstauden vervollständigen die Farbeinheit, die durch den Großen Wiesenknopf bereichert wird, der eine Wuchshöhe von 30 bis zu 120 Zentimetern erreicht. Insgesamt sind pro Beetfläche rund zwanzig verschiedene Pflanzen zu sehen, die auf den jeweils 60 qm großen Beeten eine neue Heimat gefunden haben. Alle Pflanzen stammen aus der Staudengärtnerei und wurden in sieben Tagen mit fünf Mitarbeitern fachgerecht gepflanzt.

Wer sich vorab über den Sophie Park informieren möchte, findet in dem Begleitbuch von Ines Veith weitere wissenswerte Informationen. Das Buch „Sophie Park Bad Liebenzell –Ein Spaziergang durch die Welt der Philosophie“ ist für zehn Euro im Rathaus in Bad Liebenzell zu erwerben.
Sabine Zoller
Juli – 2019 | nota bene Seite 17 Bad Liebenzell
Seit über einem Monat wird im Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam von Montag bis Freitag ein Esstraining (Frühstück und Mittagessen) für an Demenz erkrankte Bewohner durchgeführt. Die Auswahl der dafür in Frage kommenden Bewohnerinnen und Bewohner wird nach Rücksprache mit der Pflege und den Beschäftigungstherapeutinnen getroffen und ständig verifiziert. Auch die Küche ist in dieses Training mit eingebunden, da sie die entsprechende Darreichungsform des Essens vorbereitet.
Esstraining bei dementiell veränderten Bewohnern


Was soll das Esstraining bewirken?
An Demenz erkrankte Bewohner verlieren und vergessen die vor der Erkrankung vorhandenen Fähigkeiten, auch die der Nahrungsaufnahme. Dies können Außenstehende nicht so leicht nachvollziehen, obwohl für den Bewohner selbst die Welt in Ordnung scheint. Der Anspruch ist nicht der, dass nach dem Esstraining die Bewohner wieder
selbstständig essen und trinken können, vielmehr soll es den Erhalt der vorhandenen Ressourcen so lange wie möglich bewirken, in diesem speziellen Fall die einfache Nahrungsaufnahme.
Wie wird das Esstraining durchgeführt?
Die Aufgabe der Therapeutinnen ist es, die Bewohner zur selbständigen Nah-

rungsaufnahme zu motivieren. Hierbei ist wichtig, dass das Essen von dem Bewohner selbst eingenommen wird. Die Hilfestellung der Therapeutinnen besteht darin, eventuell die Hand/den Arm zu führen und die Bewohner zu ermuntern und an das Essen und Trinken zu erinnern.
Für die Therapeutinnen ist jeder Tag bei dem Esstraining eine neue Heraus-
forderung, da es bedeutet, die Bewohner immer wieder da abzuholen, wo sie stehen. Auch ändert sich die Tagesform der Bewohner fast täglich. Das Frühstück klappt meist sehr selbständig, hier wird eher nur animiert und erinnert. Während des Mittagessens bemerkt man bereits die nachlassenden Kräfte, sehr viele Bewohner benötigen wesentlich mehr Unterstützung, sei es anreichen oder auch vermehrt erinnern.

Da diese Form der Ressourcenerhaltung nicht ergebnisorientiert ist und sein kann, ist hier eine Bewertung nicht möglich.
Katrin Schmälzle, Maria Narandzic, paw.
nota bene | Juli – 2019 Seite 18 Demenz
Der neue Expertenstandard ,,Demenz“ zieht in die Johanneshäuser ein
Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat 2018 den Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ veröffentlicht.
In dem Standard werden die personzentrierte Haltung und die Beziehungsgestaltung thematisiert. Das heißt, der Mensch mit Demenz wird mit seiner Persönlichkeit angenommen und in dieser bestärkt. Der Tagesablauf und die Beschäftigungsangebote werden individuell für den Menschen gestaltet. Seit Anfang dieses Jahres haben die Johanneshäuser in Bad Wildbad und Bad
ausgetauscht und ausgewertet. Darüber hinaus wurde das Wissen über Demenz aufgefrischt, vertieft und der Expertenstandard vorgestellt. Aktuell befassen sich die Arbeitsgruppen mit verschiedenen Kontakt- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich in den Pflegealltag integrieren lassen und die optimale Umsetzung der Beziehungsgestaltung und person-zentrierten Haltung fördern.
Dabei entstand die Idee, sogenannte Fühlschnüre mit Bewohnern herzustellen, die momentan in der Praxis erprobt werden. Im Herbst werden dann die Erfahrungen ausgewertet und bei positiver Rückmeldung werden die Fühlschnüre weiterhin in den Einrichtungen eingesetzt

Liebenzell-Monakam ausgebildete Demenzexperten und eine Demenzfachkraft. Um auch anderen Mitarbeitern das Wissen zu vermitteln, wurden Anfang 2019 Arbeitsgruppen in beiden Einrichtungen ins Leben gerufen. Es ist den Johanneshäusern wichtig, dass die Mitarbeiter aktiv an der Implementierung des Standards mitwirken und ihre Ideen einbringen können.
Zum Einstieg wurden Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Demenz

Ausarbeitung des Expertenstandards zu beginnen und dementsprechend auch das Betreuungs- und Therapiekonzept anzupassen.
Das Wohlergehen der Bewohner liegt den Einrichtungen sehr am Herzen, weshalb die Mitarbeitenden dem Expertenstandard mit Freude entge -

werden. Die vorhandenen Betreuungsund Therapieangebote werden genauer durchleuchtet und bei Bedarf neu strukturiert.
Da auch die Angehörigen durch die Einrichtungen miteinbezogen und gut beraten werden sollen, wurden Infomaterialien in Form von Flyern in beiden Häusern ausgelegt. Ideen zur weiteren Aufklärung und Beratung werden aktuell gesammelt und sind in Planung. Ziel ist es, im Herbst mit der schriftlichen
genblicken, denn ,,die Würde des Menschen ist unantastbar“ und sie bleibt es auch bei dementiell Erkrankten.
Denise Schmidt Qualitätsmanagement
Juli – 2019 | nota bene Seite 19 Demenz
Sabine Zoller ist Initiatorin und Veranstalterin der Benefizkonzerte „Klassik im Kloster“. Seit 2006 holt sie internationale Musiker und Sänger ebenso wie junge Talente nach Bad Herrenalb, die die vielfältigen Konzerte mittlerweile weit über die Grenzen der Region hinaus als Marke bekannt gemacht haben

Längst ist „Klassik im Kloster“ aus dem Kulturkalender im Nördlichen Schwarzwald nicht mehr wegzudenken. Was vor vierzehn Jahren mit einem Konzert in der Klosterkirche Bad Herrenalb begann, hat sich zu einem Konzept entwickelt, das in Summe einen Spendenerlös von über 40.000 Euro für soziale Projekte generieren konnte. Als Organisatorin, Veranstalterin und Moderatorin laufen bei Sabine Zoller alle Fäden für die Konzerte zusammen, die über den Landkreis Calw hinaus auch in Freudenstadt eine Heimat gefunden haben. Insgesamt 45 erfolgreiche Veranstaltungen bezeugen ihr außerordentliches Engagement mit dem sie zudem ihre Vielfalt und Kreativität stets aufs Neue beweist.
Wer in der Klosterkirche ein Konzert erlebt, spürt die besondere Atmosphäre. Die Künstler fühlen sich wohl und zele-


Benefizkonzerte seit 2006
brieren mit Leidenschaft ihren Auftritt, der nicht selten mit stehenden Ovationen Belohnung findet. Schon 2006, 2007 und 2008 füllten swingende Melodien die ersten Konzerte. Doch kein Erfolg währt ewig. Eine neue Idee musste her. Mit dem Ausnahmesänger Arno Raunig gelang 2009 der Sprung in die klassische Musik. Der einstige

Wiener Sängerknabe sang sich mit dem „Concilium Musicum Wien“ in die Herzen der Zuschauer und begeisterte als Sopranist bei einem abendfüllenden Programm 2010 rund um „Ave Maria“-Interpretationen von Gounod, Verdi, Schubert, Caccini, Diabelli, Mozart, Faure, Saint- Saens, Liszt, Dvorá k, Tosti, Cherubini, und Weinwurm.


nota bene | Juli – 2019 Seite 20
Klassik im Kloster
Bei der Organisation zu diesem Konzert kam Sabine Zoller erstmals auf die Idee, Kindechöre aus der Region für Klassik im Kloster zu gewinnen. 2009 debütierte der Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben mit seinen silberhellen Knabenstimmen in der Klosterkirche gemeinsam mit dem „Cantus Juvenum“ Chor aus Karlsruhe. Das war die Geburtsstunde für eine rasant anwachsende Schar an jungen Talenten, die sich als „Junge Chöre“ Jahr um Jahr auf einen Auftritt bei „Klassik im Kloster“ freuen. Bereits 2016 konnte die magische Zahl von 1.000 Jugendlichen gesprengt werden. Abwechselnd mit dem Jungen Kammerchor der Lutherana zu Karlsruhe, dem Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben sowie Chor und Orchester des Helmholtz Gymnasiums Karlsruhe sind die Jugendlichen jährlich am 2. Advent-Samstag in der Klosterkirche zu Gast. Besonderer Beliebtheit erfreut sich seit 2017 das Sommerkonzert der hochbegabten Musikschüler aus dem Helmholtz-Gymnasium. Unter dem Motto „Kinder für Kinder“ begeistern 100 Jugendliche vom Chor und Orchester der Schule mit dem Thema „Filmmusik“, um Spenden für Waisenkinder in Indien zu sammeln.
Für den fünfzehnten Geburtstag, im Jahr 2020 prognostiziert die Organisatorin bereits die Zahl von 2.000 Jugendlichen, die dann bei Klassik im Kloster einen Auftritt haben. Nach eigener Aussage sind es nach wie vor die jungen Talente, die durch „Klassik im

Kloster“ gefördert werden sollen. Der organisatorische Aufwand ist enorm. Viele Veranstalter scheuen die damit verbundenen Kosten, Raummieten und Gebühren, die auch für „Klassik im Kloster“ stets einen großen Kraftakt bedeuten.
Als Historikerin präsentiert Sabine Zoller gerne interessante Themen. Zum 200. Geburtstag von Franz Liszt gab es die seltene Gelegenheit, die späten Kompositionen des Klaviervirtuosen als Orgelmusik zu erleben. Auf der „Königin der Instrumente“ spielte der Landeskantor der evangelischen Kirche in Österreich, Matthias Krampe, fünf Jahre in Folge mit eigens dafür transkribierten Werken namhafter Komponisten, wie Edvard Grieg, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Max Reger und Carl Philipp Emanuel Bach. Ergänzt wurden die Sommerkonzerte durch weitere Künstler, die mit historischen Kostümen zum 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach aufspielten oder mit ausgelassener Walzerseligkeit die Epoche des Biedermeier mit speziell gekleideten Darstellern und Johann Strauß Melodien begleiteten.
Last, but not least aber ist es Sabine Zoller mit ihren internationalen Weihnachtskonzerten gelungen, Jahr um Jahr am zweiten Sonntag im Advent für Bad Herrenalb ein besonderes Highlight zu setzen. Barbara Helfgott aus Österreich startete die 10. Veranstaltung der Konzertserie mit ihrem Damenensemble „Rondo Vienna“. Danach


folgte eine „Flämische Weihnacht“ mit dem van Mol-Trio aus Belgien, 2013 Marimba-Virtuosin und Kammermusikerin Katarzyna Mycka aus Gedansk mit einer „Slawischen Weihnacht“, 2014 begeisterte Bariton Omar Garrido aus Mexiko mit einer „Mexikanischen Weihnacht“, 2015 berührte ein traditioneller Lucia-Zug bei einer „Schwedischen Weihnacht“, 2016 erklangen gälische Harfenmelodien mit Gesang von Aylish Kerrigan zur „Irischen Weihnacht“, 2017 überzeugte Sergej Riasa-

now mit Bajanklängen zur „Russischen Weihnacht“ und 2018 eroberte das Gissando Quartett mit Trompete und Posaune das Publikum zu einer „Amerikanischen Weihnacht“.
Für 2019 gibt es in Bad Herrenalb am 8. Dezember eine „Ligurianische Weihnacht“ mit Knopfakkordeon und Dudelsack und fünf Musikern aus dem Nordwesten Italiens sowie zwei Auftritte der „Jungen Chöre“ am 7. Dezember in Bad Herrenalb und am 14. Dezember in Freudenstadt.

Juli – 2019 | nota bene Seite 21 Aus der Umgebung
Fotos: Sabine Zoller
red
„Ich fühl mich rundherum wohl!“ Eine Aussage, die nicht nur für die Freizeit, sondern auch für das Arbeiten gelten kann. Wie das gelingen kann, dazu hier ein paar Denkanstöße.
Wohlbefinden bei der Arbeit –Gesundheitsförderung durch Ergotherapie

Gesund zu sein bedeutet, sich körperlich, seelisch, geistig und sozial wohl zu fühlen. Eine einfache, klare und überzeugende Erklärung für das, was Gesundheit bedeutet. Doch ist das ebenso einfach im beruflichen Alltag umzusetzen?
Ausgeschlafen und fit bei der Arbeit, wach und aufmerksam für das, was ansteht, flexibel und anpassungsfähig für Neues – wer wünscht sich nicht eine solche Verfassung für die eigene berufliche Tätigkeit. Erschöpfung und Anstrengung sind nicht selten die andere Seite der Medaille von Arbeit. Die eigene Tätigkeit geht nicht Hand in Hand mit der Arbeit der anderen Kollegen. Man arbeitet scheinbar alles ab, dennoch bleibt immer etwas unerledigt. Wenn dieses oder ähnliches den Arbeitsalltag prägt, dann spannt der Nacken, schmerzt der Rücken und wächst die innere Unruhe.
Innehalten und beschreiben, wie man sich gerade fühlt, gehören zu den ersten Schritten in der Förderung zur Ge -
sundheit, wie sie im Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam von der Praxis für Ergotherapie angeboten wird. Während der Arbeitszeit bietet sie Maßnahmen zur gesundheitlichen Förderung an, bei denen es gilt herauszufinden und zu erkunden, wo es „zwickt“ und womit dieses zu lösen ist.
Eine Behandlung eines Triggerpunktes, eine Übung zur Kräftigung des Rückens oder eine Form der Entspannung sind Angebote, mit welchen die Teilnehmer ihr Wohlbefinden wieder herstellen und so ihre eigene Gesundheit fördern. Geht das so einfach? Ja, sagt die Erfahrung, denn die Mitarbeitenden, die dieses Angebot nutzen, stellen fest, es tut ihnen gut.
Der Mensch steht mit der Arbeit, die Arbeit mit dem Betrieb in einem Wirkzusammenhang, der das Befinden bei der Arbeit prägt. Eine Balance unter ihnen wirkt auf Wohlbefinden und Gesundheit, die Arbeit selbst wird zur Quelle von Gesundheit.
tet eines der Angebote. Pause von der Arbeit – Pause also, um abzuschalten aus dem Modus, was soll ich tun, und einzuschalten auf den Modus, was tut mir gut. An dem Verständnis, Gesundheit als etwas zu verstehen, was bei der täglichen Arbeit immer wieder neu in Balance zu bringen ist, setzt die Förderung an.
Das Programm zur Förderung der Gesundheit während der Arbeit bietet Beratung und Behandlung zum gesunden Arbeiten an. Ansatz ist das Befinden, Ziel das Wohlbefinden. Durch das Angebot zur Gesundheitsförderung übernehmen die Mitarbeitenden selbst Verantwortung, mit den eigenen Kräften nachhaltig umzugehen. Um mit Elan, Energie und Freude durchzustarten in einen arbeitsreichen Tag.
 Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin/
Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin/
Beraterin Betriebliche
Gesundheitsförderung IHK
Was kann der Einzelne tun, um sich wohl zu fühlen? „Mach mal Pause“ lau-
nota bene | Juli – 2019 Seite 22 Ergotherapie
Ein Ratschlag aus der Apotheke

Vielen Besuchern einer heutigen Apotheke ist sicherlich nicht bekannt, dass trotz der großen Anzahl chemisch produzierter Arzneimittel bis heute ungefähr ein Drittel des Arzneischatzes aus unserer Natur stammt. Selbst modernste Entwicklungen nutzen häufig die Natur als Lieferanten der Ausgangssubstanzen.
Um die Vielfalt der Pflanzenwelt mit ihren Arzneistoff liefernden Arten besser kennen zu lernen, bin ich immer wieder auch mit der Kamera in der Natur unterwegs, um einzelne Exemplare für mein Archiv festzuhalten.
In regelmäßiger Folge möchte ich deshalb an dieser Stelle einzelne Pflanzen vorstellen und über ihre Wirkungsweise informieren.
Friedrich Böckle (Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell)
Tollkirsche –nicht nur Homöopathicum
Wer im Juli und August die heimischen Laubwälder durchstreift, bemerkt bisweilen kräftige, bis zu zwei Meter hohe Pflanzen, die leuchtend schwarze kirschförmige Früchte tragen. In wenigen Fällen können diese Früchte auch gelb gefärbt sein.
Es handelt sich um die Tollkirsche (Atropa belladonna), deren große Giftigkeit einen Genuss der Früchte absolut verbietet. Speziell bei Kindern, die im Wald spielen, kommt es immer wieder zu Vergiftungsfällen. Zum Glück schmecken die Früchte nicht sehr gut, so dass ein Verzehr von mehreren Exemplaren selten vorkommt.
Die Tollkirsche enthält mehrere stark wirkende Alkaloide, deren bekanntestes sicherlich das Atropin ist. Atropin wirkt krampflösend im Bereich der glatten Muskulatur. Die Behandlung von spasmischen Schmerzen im Gastrointestinal- und Gallenbereich sowie bei kolikartigen Schmerzen im Blasenbereich ist somit ein Anwendungsbereich.
Die Substanz wirkt am Herzen stark frequenzsteigernd und führt auch zu einer Pupillenerweiterung. So wurden Atropin-Augentropfen über Jahrhunderte von Augenärzten zum Erweitern der Pupille zu Diagnosezwecken verwendet. Eine spontane Blutdruckerhöhung ist nicht selten. Atropinampullen sind bis heute im Notfallkoffer der Ärzte enthalten und werden bei akuten Herzrythmusstörungen bei niedriger Herzfrequenz eingesetzt.

Der Einsatz von atropinhaltigen Arzneimitteln bleibt dem Arzt vorbehalten. Die Giftigkeit der Substanz ist zu groß, um damit freiverkäufliche Präparate auf den Markt zu bringen.
Der große Teil der Anwendungen durch Patienten selbst oder nach Anordnung von Ärzten mit naturheilkundlicher Ausbildung ist deshalb der Homöopathie vorbehalten. Belladonna ist sicherlich eine Pflanze mit den vielseitigsten Indikationen in der Homöopathie. Sowohl als Einzelpräparat als auch in vielen Mischpräparaten wird dabei die Tollkirsche verwendet. Viele Erkältungsmittel sind dabei vertreten und speziell bei fieberhaften Infekten der Mandeln, der Atemwege, des Urogenitaltraktes, aber auch der Gehirnhaut wird dieses Homöopathikum häufig eingesetzt.
Sollten Kinder trotz des schlechten Geschmacks einmal die „Kirschen“ gegessen haben, so erkennt man dies an den typischen Vergiftungssymptomen: Herzarrhytmien, Hautrötung, Mundtrockenheit und Pupillenerweiterung.
Juli – 2019 | nota bene Seite 23
Natürliche Hilfe
Natur und Heilkunde
(Foto Tollkirsche, F. Böckle)
ich ich bin vergesslich und ihr ihr meint, ich merk das nicht
ich ich lebe in meiner welt und ihr ihr lebt in eurer welt berühren sie sich noch meine und eure welt?
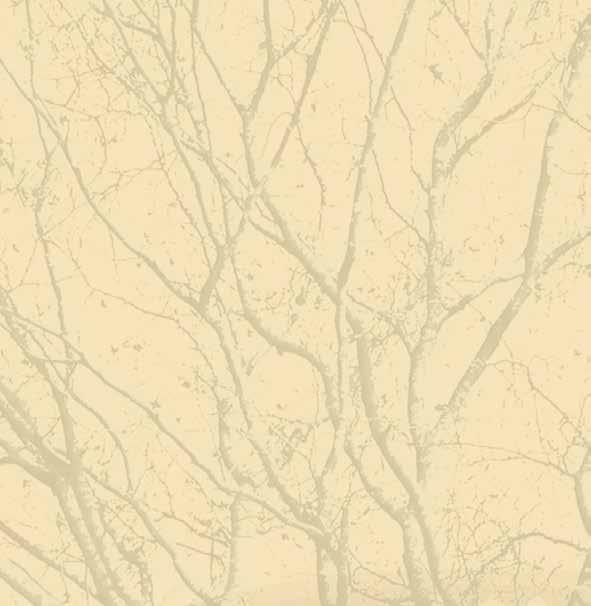
manchmal will ich noch kommen in eure welt wenn ich singe wenn ich tanze wenn ich lache aber oft bleibe ich am liebsten in meiner welt
sie reizt mich nicht mehr eure welt der hektik, der falschen freundlichkeit, der klugheit und logik
manchmal kommt ihr in meine welt, wenn ihr mich pflegt, wenn ihr mir sagt, was gut sei für mich das strengt mich oft an, denn auch ihr seid oft angestrengt wenn ihr mir begegnet und das will ich nicht
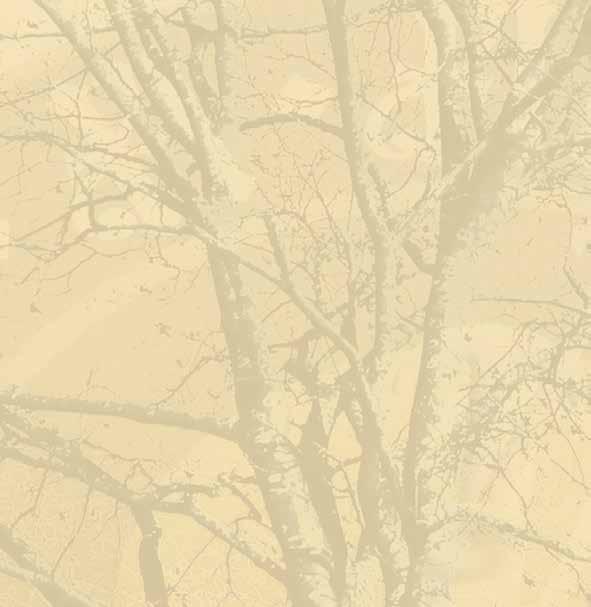
seid doch die, die ihr seid und verstellt euch nicht und lasst mich so wie ich bin vergesslich – aber lebendig dement – aber empfindsam klein im kopf – aber groß im herzen


schenkt mir eure liebe, dann schenk ich euch meine denn liebe wächst nicht im kopf, sondern im herzen auch bei mir
nota bene | Juli – 2019 Seite 24
Pfarrerin Birgit Enders




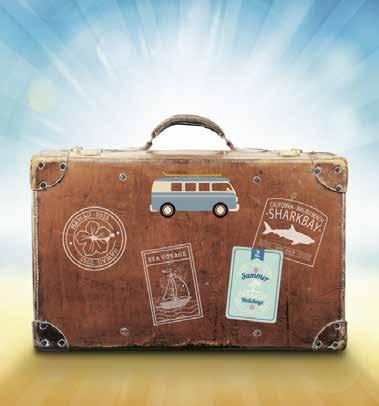











































































 Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin/
Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin/