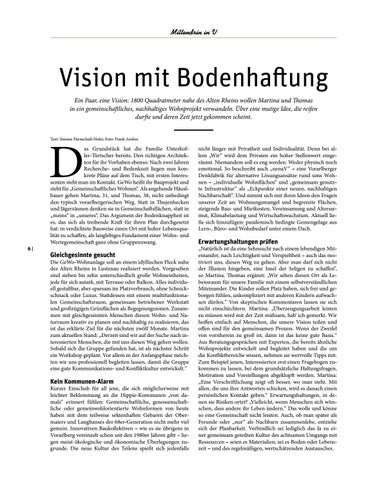Mittendrin in V
Vision mit Bodenhaftung Ein Paar, eine Vision: 1800 Quadratmeter nahe des Alten Rheins wollen Martina und Thomas in ein gemeinschaftliches, nachhaltiges Wohnprojekt verwandeln. Über eine mutige Idee, die reifen durfte und deren Zeit jetzt gekommen scheint.
D
Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Foto: Frank Andres
6|
as Grundstück hat die Familie Unterkofler-Türtscher bereits. Den richtigen Architekten für ihr Vorhaben ebenso. Nach zwei Jahren Recherche- und Bedenkzeit liegen nun konkrete Pläne auf dem Tisch, mit ersten Interessenten steht man im Kontakt. GeWo heißt ihr Bauprojekt und steht für „Gemeinschaftliches Wohnen“. Als angehende Häusl bauer gehen Martina, 31, und Thomas, 38, nicht unbedingt den typisch vorarlbergerischen Weg. Statt in Thujenhecken und Jägerzäunen denken sie in Gemeinschaftsflächen, statt in „meins“ in „unseres“. Das Argument der Bodenknappheit ist es, das sich als treibende Kraft für ihren Plan durchgesetzt hat: in verdichtete Bauweise einen Ort mit hoher Lebensqualität zu schaffen, als langlebiges Fundament einer Wohn- und Wertegemeinschaft ganz ohne Gruppenzwang.
Gleichgesinnte gesucht
Die GeWo-Wohnanlage soll an einem idyllischen Fleck nahe des Alten Rheins in Lustenau realisiert werden. Vorgesehen sind sieben bis zehn unterschiedlich große Wohneinheiten, jede für sich autark, mit Terrasse oder Balkon. Alles individuell gestaltbar, aber sparsam im Platzverbrauch, ohne Schnickschnack oder Luxus. Stattdessen mit einem multifunktionalen Gemeinschaftsraum, gemeinsam betriebener Werkstatt und großzügigen Grünflächen als Begegnungszonen. Zusammen mit gleichgesinnten Menschen diesen Wohn- und Naturraum kreativ zu planen und nachhaltig zu realisieren, das ist das erklärte Ziel für die nächsten zwölf Monate. Martina zum aktuellen Stand: „Derzeit sind wir auf der Suche nach interessierten Menschen, die mit uns diesen Weg gehen wollen. Sobald sich die Gruppe gefunden hat, ist als nächster Schritt ein Workshop geplant. Vor allem in der Anfangsphase möchten wir uns professionell begleiten lassen, damit die Gruppe eine gute Kommunikations- und Konfliktkultur entwickelt.“
Kein Kommunen-Alarm
Kurzer Einschub für all jene, die sich möglicherweise mit leichter Beklemmung an die Hippie-Kommunen „von damals“ erinnert fühlen: Gemeinschaftliche, genossenschaftliche oder gemeinwohlorientierte Wohnformen von heute haben mit dem teilweise sektenhaften Gebaren der Obermaiers und Langhanses der 68er-Generation nicht mehr viel gemein. Innovativen Baukollektiven – wie es sie übrigens in Vorarlberg vereinzelt schon seit den 1980er Jahren gibt – liegen meist ökologische und ökonomische Überlegungen zugrunde. Die neue Kultur des Teilens spießt sich jedenfalls
nicht länger mit Privatheit und Individualität. Denn bei allem „Wir“ wird dem Privaten ein hoher Stellenwert eingeräumt. Niemandem soll es eng werden. Weder physisch noch emotional. So beschreibt auch „nenaV“ – eine Vorarlberger Denkfabrik für alternative Lösungsansätze rund ums Wohnen – „individuelle Wohnflächen“ und „gemeinsam genutzte Infrastruktur“ als „Eckpunkte einer neuen, nachhaltigen Nachbarschaft“. Und nimmt sich mit ihren Ideen den Fragen unserer Zeit an: Wohnungsmangel und begrenzte Flächen, steigende Bau- und Mietkosten, Vereinsamung und Altersarmut, Klimabelastung und Wirtschaftswachstum. Aktuell ließe sich hinzufügen: pandemisch bedingte Gemengelage aus Lern-, Büro- und Wohnbedarf unter einem Dach.
Erwartungshaltungen prüfen
„Natürlich ist da eine Sehnsucht nach einem lebendigen Miteinander, nach Leichtigkeit und Verspieltheit – auch das motiviert uns, diesen Weg zu gehen. Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, eine Insel der Seligen zu schaffen“, so Martina. Thomas ergänzt: „Wir sehen diesen Ort als Lebensraum für unsere Familie mit einem selbstverständlichen Miteinander. Die Kinder sollen Platz haben, sich frei und geborgen fühlen, unkompliziert mit anderen Kindern aufwachsen dürfen.“ Von skeptischen Kommentaren lassen sie sich nicht einschüchtern. Martina: „Überzeugungsarbeit leisten zu müssen wird mit der Zeit mühsam, hab‘ ich gemerkt. Wir hoffen einfach auf Menschen, die unsere Vision teilen und offen sind für den gemeinsamen Prozess. Wenn der Zweifel von vornherein zu groß ist, dann ist das keine gute Basis.“ Aus Beratungsgesprächen mit Experten, die bereits ähnliche Wohnprojekte entwickelt und begleitet haben und die um die Konfliktbereiche wissen, nehmen sie wertvolle Tipps mit. Zum Beispiel jenen, Interessierten erst einen Fragebogen zukommen zu lassen, bei dem grundsätzliche Haltungsfragen, Motivation und Vorstellungen abgeklopft werden. Martina: „Eine Verschriftlichung zeigt oft besser, wo man steht. Mit allen, die uns ihre Antworten schicken, wird es danach einen persönlichen Kontakt geben.“ Erwartungshaltungen, in denen sie Risiken ortet? „Vielleicht, wenn Menschen sich wünschen, dass andere ihr Leben ändern.“ Das wolle und könne so eine Gemeinschaft nicht leisten. Auch, ob man später als Freunde oder „nur“ als Nachbarn zusammenlebe, entziehe sich der Planbarkeit. Verbindlich sei lediglich das Ja zu einer gemeinsam geteilten Kultur des achtsamen Umgangs mit Ressourcen – seien es Materialien, sei es Boden oder Lebenszeit – und des regelmäßigen, wertschätzenden Austausches.