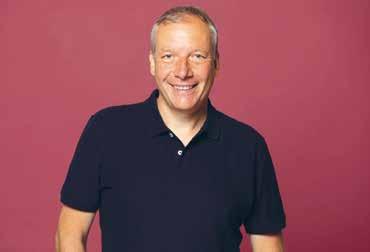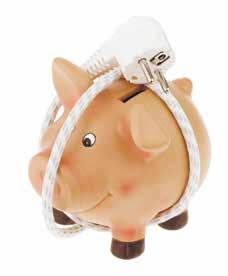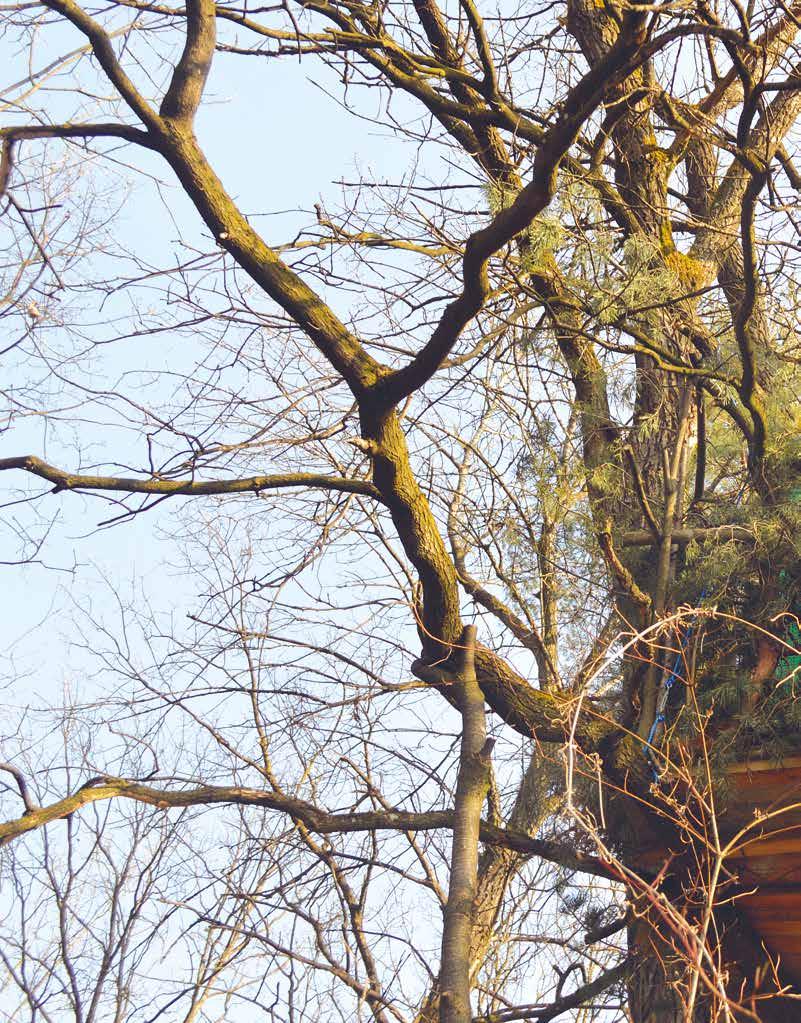Mittendrin in V
DU BIST NICHT ALLEINE
Geschützter Raum zum Reden und Zuhören: Selbsthilfe-Gruppen leisten einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft und leben von ehrenamtlichem Engagement und jeder Menge Löwenherzblut.
44 |
D
er amerikanische Börsenmakler Bill W. war 22, als er zu trinken begann. Trotz der Einsicht, an einer Krankheit zu leiden, trotz mehrfachen Entzugsphasen und kraftvollen spirituellen Erfahrungen verspürte er eines Abends – allein in einem Hotel in einer fremden Stadt – wieder den mächtigen Zug zur Flasche. Da überkam ihn ein Gedanke, der den Anfang für eine weltweite Bewegung markieren sollte: Wenn er jetzt nur mit einem Menschen in einer ähnlichen Situation reden könnte, würde er vielleicht dem Suchtdruck entkommen. Also rief er die Pfarren der Umgebung an, ob man ihm nicht jemanden vermitteln könne, der alkoholkrank war. Es kam zur entscheidenden Begegnung mit dem für seine Trinksucht bekannten Chirurgen Bob S. Und es sollte sich tatsächlich bewahrheiten: Reden, zuhören – und helfen – hilft. Diese rudimentär gefasste Erzählung bildet den Anfang der Erfolgsgeschichte der Anonymen Alkoholiker, jener Selbsthilfe-Initiative, die von den genannten Protagonisten 1935 in den USA gegründet wurde und inzwischen in rund 185 Staaten dieser Erde vertreten ist. Was für diese Bewegung Ausgangspunkt war, ist bis heute auch der eigentliche Kern der Selbsthilfe-Idee: eine Gemeinschaft zu bilden, die Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilt, um sich gegenseitig bei einem gemeinsamen Problem zu helfen. Egal, ob es dabei um eine Nahrungsunverträglichkeit geht, ein schweres Schicksal oder ein Suchtverhalten. Oberstes Gründungsprinzip: Du musst selbst betroffen sein. Der geschützte Rahmen und die Anonymität sollen dafür sorgen, dass sich Betroffene gut aufgehoben fühlen und sich mit ihren Sorgen dem Kollektiv öffnen können.
Text: Simone Fürnschuß-Hofer, Fotos: AdobeStock, privat
Selbsthilfe-Netz Vorarlberg
In Vorarlberg sind fast 100 unterschiedlichste Selbsthilfe-Vereine und Gruppen unter dem Dach der Plattform „Selbsthilfe Vorarlberg“ versammelt. Geschäftsführer Nikolas Burtscher: „Selbsthilfegruppen entstehen immer dann, wenn es eine Versorgungslücke im Staat gibt. In unserem Netzwerk dreht es sich zu 85 Prozent um gesundheitliche Themen wie Behinderung oder chronische Erkrankungen, die anderen 15 Prozent sind psychosozialen Themen zuzuordnen: beispielsweise verwaiste Eltern, Hinterbliebene nach einem Suizid oder vereinsamte Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen zusammentun.“ Die Selbsthilfe Vorarlberg sieht sich als Anlauf- und Servicestelle für Mitglieder und Neugründungen. Ihre Aufgaben reichen vom Organisieren von Räumlichkeiten bis hin zu „Übersetzungs-Nachhilfe“ bei Gesetzestexten. „Die Gruppensprecher*innen werden bei Bedarf auch in ihrer Kommunikation geschult. Und darin, wie sie psychischen Druck abwenden und sich abgrenzen können. Das gelingt, indem sie sich ihrer Rolle bewusstwerden: dass ihre Arbeit keinen professionellen Anspruch hat, sondern lediglich einen Rahmen bietet“, sieht Nikolas Burtscher einen wichtigen Auftrag in der Befähigung engagierter Personen. „In die Inhalte mischen wir uns nicht ein, bei unseren Schulungen geht es mehr um Haltung und Sprache. Dass zum Beispiel kein ‚du musst‘ formuliert wird und ich nicht meine Lösung als die richtige für andere empfinde“, erklärt Burtscher, wie wichtig diese Unterscheidung zwischen Expertise und dem Selbsthilfe-Prinzip ist. „Bei schwierigen Themen kann man natürlich durchaus auch einmal eine Fachperson in ein Treffen einladen.“
Kooperation statt Konkurrenz
Es läge im Selbstverständnis der Selbsthilfe-Communities, sich in keinen Wettbewerb zu Institutionen zu begeben. Statt in Konkurrenz zu denken würde man viel lieber Anknüpfungspunkte suchen und gemeinsam projektieren. Der studierte Sozialarbeiter dazu: „Vielleicht war das früher anders, aber jetzt ist der Blick beidseitig ein zugewandter. Wir suchen ganz aktiv Kooperationen
Geschäftsführer der „Selbsthilfe Vorarlberg" Nikolas Burtscher