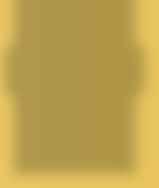nota bene




Weihnachten kennt keine Grenzen. Es verbindet Kulturen, Geschlechter, Kinder und Erwachsene, Arm und Reich.
6. Jahrgang | 3. Ausgabe | Dezember 2019 | € 5,00
Gudrun Kropp (*1955), Lyrikerin
der Kinästhetik in Ergotherapie und Pflege
23 Natur und Heilkunde
Bären lieben Bärentrauben
Letzte Meldung

Impressum
Herausgeber:
MHT
Gesellschaft für soziale
Dienstleistungen mbH
Hochwiesenhof 5–10
75323 Bad Wildbad
www.mht-dienstleistung.de
www.johanneshaus-bad-wildbad.de



www.johannesklinik-bad-wildbad.de www.johanneshaus-bad-liebenzell.de
Redaktion:
Gabriele Pawluczyk | Martin Kromer |
Wolfgang Waldenmaier






gabriele.pawluczyk @monacare.de


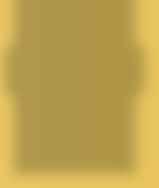
Das Magazin FOCUS GESUNDHEIT hat die Johannesklinik Bad Wildbad auch für 2020 in den Kreis der besten Rehakliniken Deutschlands im Bereich Geriatrie aufgenommen. Ein Glückwunsch dem gesamten Team.
Grafische Umsetzung:
Dagmar Görlitz
kontakt@goerlitz-grafik.de
Drucktechnische Umsetzung:
Karl M. Dabringer
dabringer@gmx.at
Auflage: 3.000
nota bene | Dezember – 2019 Seite 2 Inhalt 03 Editorial Wünsche zur Weihnacht von Anneli Zenker und Manfred Preuss 04 Weihnachten Weihnachten in aller Welt 06 Johannesklinik Bad Wildbad
wird gemacht in der geriatrischen Rehabilitation? 07 11. GeriatrieForum Bad Wildbad Was bedeutet eigentlich Alter? 08 Bad Liebenzell Ein Gespräch mit Ines Veith 10 Gedanken zu Weihnachten Die etwas andere Weihnachtsgeschichte 11 Literatur Hannes Wader – Trotz alledem 12 Musik The Christmas Songs 14 Qualitätskontrolle in Pflegeheimen Der neue Pflege TÜV startet durch!
Pflegepolitik
Amt blockiert Entlastung Spahn will Vorschlag zur Pflege-Finanzierung vorlegen 16 Bad Wildbad
Legende vom Holländer Michel 18 Ernährung
Leben is(s)t süß 20 Ehrenamt
Kuchen, Liedern und alten Menschen 21 Johanneshaus Bad LiebenzellMonakam Fröhliches Zimtsternebacken – Lieder zur Weihnachtszeit 22 Ergotherapie
Ansatz
Was
15
Auswärtiges
Die
Das
Von
Der

ir wünschen all den Menschen in unseren Einrichtungen, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, unseren Rehabilitanten und Patienten, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ihren Angehörigen und Familien und unseren Freunden und Geschäftspartnern von ganzem Herzen segensreiche und besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
Gemeinsam mit Ihnen allen werden wir uns auch künftig immer dafür einsetzen, Offenheit, Toleranz und Vertrauen in einem wertschätzenden und respektvollen Miteinander zu leben. Danke für Ihre Unterstützung und Ihr lebendiges Miteinander.
Ihre
Anneli Zenker Manfred Preuss
Geschäftsführerin MHT
GlobalConcept.Consult AG
Seite 3 Dezember – 2019 | nota bene Editorial
So, wie wir das Weihnachtsfest kennen, wird es in anderen Ländern der Erde nicht zwangsläufig ebenfalls gefeiert. Mag auch der Grundgedanke ähnlich sein, bringt doch jedes Land seine eigenen Sitten und Gebräuche in das Fest mit ein.
Weihnachten in aller Welt

An langen Vorweihnachtsabenden macht es Spaß, zu schauen, wie Weihnachten in aller Welt gefeiert wird. Ein typisch deutsches Weihnachtsfest findet an einem – im Idealfall – kalten, verschneiten Dezemberabend, am Abend des 24. Dezembers, in einer gemütlichen Wohnstube statt, die von einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum dominiert wird. Es gibt Plätzchen und Stollen, jede Menge Süßigkeiten und Geschenke und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag werden aufwendige Festtagsbraten auf den Tisch gebracht. Die Kinder in Deutschland zählen die Tage bis zum Fest an ihrem Weihnachtskalender ab und schreiben in der Vorweihnachtszeit einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. So kennen die meisten von uns das Weihnachtsfest. Doch obwohl Weihnachten überall in der christlichen Welt den gleichen Ursprung hat, wird es überall unterschiedlich gefeiert.


Weihnachten in aller Welt –Frankreich, England und den USA
Weihnachten in aller Welt – das sind viele kleine Unterschiede. Der bärtige Alte, den wir den Weihnachtsmann nennen, heißt in Frankreich zum Beispiel Père Noël. Er kommt in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in die Häuser und hinterlässt seine Geschenke. Gedichte aufsagen und weihnachtliche Lieder singen muss hier niemand, um es nicht mit der Rute des Weihnachtsmannes zu tun zu bekommen. Den Heiligen Abend verbringen die


nota bene | Dezember – 2019 Seite 4 Weihnachten
Franzosen auch nicht in trauter Familienrunde unter dem Weihnachtsbaum. Stattdessen feiern sie ausgelassen mit Bekannten und Freunden in Restaurants und auf Partys.

Auch in den USA und in Großbritannien sieht Weihnachten anders aus als bei uns in Deutschland. Father Christmas oder Santa Claus, wie er in Amerika heißt, bringt die Geschenke am Weihnachtsmorgen, lässt sie unter dem Weihnachtsbaum liegen oder steckt sie in weihnachtliche Socken, die eigens zu diesem Zweck aufgehängt werden.

Weihnachten in aller Welt –Skandinavien und Russland Weihnachten ist in aller Welt beliebt, doch in Finnland liebt man Weihnachten so sehr, dass es seit 1920 sogar den Brauch gibt, Weihnachten schon im Oktober zu feiern. Das sogenannte „kleine Weihnachtsfest“, Pikkujoulu, findet in Schulen, Betrieben und im Freundeskreis statt und artet oftmals in einen regelrechten Wettstreit um das originellste Fest aus. Das skandinavische Weihnachtsfest wurzelt tief in den alten Ernte- und Mittwinterbräuchen und heißt Julfest. Zu den kulinarischen Highlights

von festlichen Gelagen, auf denen Grütze, Gans, Hammel- und Schweinefleisch serviert werden, von Tee, Wodka und alten Geschichten.


Weihnachten in aller Welt –Italien und Griechenland


des Julfests gehören Julbier, Julbrot und das Julstroh, das in der Julstube verstreut wird und an die Krippe erinnert, in der Jesus geboren wurde. Die Geschenke bringt der Joulopukki. Erst am 13. Januar endet in Schweden, Norwegen und Finnland die festliche Weihnachtszeit.

In Italien kennt man den Weihnachtsmann gar nicht. Hier ist es die gute Hexe La Befana, die die Kinder am 6. Januar beschenkt. Am Heiligen Abend versammelt sich die italienische Familie an der prachtvollen Krippe („presepio“), die den Mittelpunkt der weihnachtlich geschmückten Stube bildet, und jedes Familienmitglied zieht aus einem Lostopf die Nummer eines Geschenks.
In Griechenland bekommen die Kinder ihre Geschenke am 1. Januar vom heiligen Vassilus, der sie nachts vor ihrem Bett ablegt. Am Weihnachtsabend selbst, am 24. Dezember, ziehen die Kinder Griechenlands mit Glocken und Trommeln durch die Straßen und singen die sogenannte Kalanda, die Lobgesänge, die Glück für das kommende Jahr bringen sollen. Für ihren Gesang bekommen sie dann kleine Geschenke.

In Russland müssen die Kinder zur Weihnachtszeit aber am längsten warten: Erst am 7. Januar bringt Väterchen Frost die Geschenke. Er kommt in einer Kutsche mit klingelnden Glocken und wird von einer Schneeflocke und der Großmutter Babuschka begleitet. Das russische Weihnachtsfest ist geprägt

Exotisches Weihnachten in aller Welt –Afrika und Down Under Doch nicht nur in Europa wird Weihnachten gefeiert. Weihnachten in aller Welt geht auch exotisch. Auch in Afrika kennt man zum Beispiel den Brauch. So fasten die Christen in Ägypten 43 Tage lang bis zum Heiligen Abend, der dann in einen Festtagsschmaus mündet. In Kenia wird zu Weihnachten traditionell eine Ziege geschlachtet und anschließend mit Nachbarn und Freunden bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. In Nigeria trifft sich die Familie zu Weihnachten zum „Iyan“, einem kräftig mit Chilli gewürztem Gemüseeintopf. Die Ureinwohner Südafrikas feiern Weihnachten ausgelassen wie einen Karnevalsumzug, tanzen, singen und essen viel. Südlich des Äquators fällt Weihnachten nämlich in den Hochsommer und so ist es in vielen Ländern der südlichen Halbkugel üblich, Weihnachten am Strand oder unter freiem Himmel zu verbringen. Vor allem in Australien hat das weihnachtliche Barbecue am Strand Tradition.
So unterschiedlich Weihnachten in aller Welt auch gefeiert wird, überall auf der Welt verabschieden die Menschen das alte und begrüßen das neue Jahr und beschenken sich gegenseitig. Möge allen, wo auch immer auf der Welt sie das Fest begehen, ein friedvolles Weihnachtsfest beschert sein.


Seite 5 Dezember – 2019 | nota bene Weihnachten
Quelle: Literaturtipps, Dumont Reiseverlag
Geriatrische Patientinnen und Patienten leiden in der Regel an mehreren unterschiedlichen Beschwerden. Hierzu gehören Immobilität, Sturzneigung, Schwindel, kognitive Defizite, Inkontinenz, Wundheilungsstörungen, Fehl- und Mangelernährung, Störungen des Flüssigkeitshaushalts, Depressionen, Angststörungen, chronische Schmerzen, Sensibilitätsstörungen, herabgesetzte körperlicher Belastbarkeit, Seh- und Hörbehinderungen und weiteren Erkrankungen.
Was wird gemacht in der geriatrischen Rehabilitation?
Um diese Beschwerden zu erfassen, gibt es in der Geriatrie ein methodisches Grundprinzip: das geriatrische Assessment, das bei Aufnahme und Entlassung erhoben wird. Unter geriatrischem Assessment versteht man den diagnostischen Prozess in der Geriatrie. Er ist eine multidimensionale Gesamterfassung und Bewertung der gesundheitlichen Situation einer Patientin bzw. eines Patienten. Hierzu werden in jedem Arbeitsbereich unterschiedliche Tests und Befragungen durchgeführt, damit ein umfassendes Bild von der Gesamtsituation ermittelt werden kann, in der sich der betroffene Patient befindet.
Die in der Johannesklinik regelmäßig durchgeführten Tests sind:
Pflege:
Erfassung der vorhandenen Hilfsmittel – Barthel-Index –Schmerzskala – Inkontinenzstatus – Ernährungsstatus – Dekubituserfassung und -risikoeinschätzung
Physiotherapie:
Timed up and go-Test – Chair Rising-Test – Transferstufenerfassung –Balance/Tandemstand – Messung der Gehgeschwindigkeit –Tinetti-Test
Ergotherapie:
Erfassung der funktionellen Fähigkeiten – Handkraftmessung –Geldzähltest – Sechs-Fragen-Test – Uhrenergänzungstest
Psychologie:
DIA-S (Depression im Alter) – Mini-Mental-Status – DemTect –Geriatrische Depressionsskala
Logopädie:
Aachener-Aphasie-Test – Schluckstörung
Ärzte:
Anamnese – Körperliche Untersuchung – Labor – EKG – Ultraschall und weitere Untersuchungen nach Bedarf
Sozialdienst:
Erfragung der soziale Situation – Pflegegrad – Wohnliche Situation
Anhand der erhobenen Befunde und individuellen Therapieziele wird dann für jeden Patienten ein Therapieplan erstellt. In wöchentlichen Besprechungen wird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden, ob eine Änderung der Therapie erforderlich ist und ob die Ziele angepasst werden müssen.

Rehabilitationszyklus
Das Therapieangebot der Johannesklinik ist breit gefächert und umfasst alle erforderlichen Behandlungen und Beratungen, um die Ziele der Patienten zu erreichen. Hierzu gehören: Aktivierende Pflege, Angehörigenberatung und -schulung, Anziehtraining, Atemgymnastik, Ausdauertraining, Beckenbodengymnastik, Behandlung auf neurophysiologischer Grundlage (Bobath), Belastbarkeitstraining, Beweglichkeitsförderung der oberen Extremität, Bindegewebsmassage, Dekubitusprophylaxe, Diätberatung/Ernährungsberatung, Elektrotherapie, Entspannungstherapie, Esstraining, Fango, Feinmotoriktraining, Frühstückstraining, Funktionelle Therapie, Gangschulung, Gerätetraining, Gleichgewichtstraining, Haltungsschulung, Handwerk, Haushaltstraining, Heiße Rolle, Hilfe bei Antragsstellungen, Hilfsmittelberatung, Hilfsmittelerprobung, Hilfsmittelversorgung, Hirnleistungstraining, Inhalationen, Kältetherapie, Klassische Massage, Kneipp’sche Güsse und Hydrotherapie, Kontinenztraining, Kontrakturprophylaxe, Krafttraining, manuelle Lymphdrainage, Organisation ambulanter Dienste bzw. teilstationärer oder stationärer Weiterversorgung, Pneumonieprophylaxe, Prothesentraining, psychologische Unterstützung und Gespräche, Rollstuhltraining, Rotlichtbehandlung, Rückenschule, Schlingentischbehandlung, Schlucktraining, Selbsthilfetraining (Insulininjektionen, Katheterversorgung, Anus praeter-Versorgung), Sensibilitätstraining, Sprachübungen, Sprechübungen, Stimmübungen, Stomaberatung, Taping, Transfertraining, Ultraschalltherapie, Vorsorgevollmacht/ Generalvollmacht-Beratungen, Wahrnehmungstraining, Wärmeapplikationen, Waschtraining.
Durch die konsequente, individuell zugeschnittene Anwendung der erforderlichen Therapien gelang es 2018, über 90 % der durchschnittlich 82 Jahre alten Patienten wieder in ihre bisherige Wohnsituation zu entlassen.
Dr. med. Thomas Müller
nota bene | Dezember – 2019 Seite 6 Johannesklinik Bad Wildbad
Was bedeutet eigentlich Alter?
Statistisch gerechnet haben heute Achtzigjährige noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 7,92 Jahren (Männer) bzw. 9,45 Jahren (Frauen), Neunzigjährige noch 3,7 bzw. 4,26 Jahre, und Hundertjährige immerhin noch 1,91 bzw. 2,11 Jahre! Im Forum König-Karls-Bad erfuhren dies die Teilnehmer beim 11. GeriatrieForum Bad Wildbad Ende Oktober. Eingeladen hatte dazu die Johannesklinik Bad Wildbad. Deren Geschäftsführerin, Anneli Zenker, sowie Chefarzt Dr. Thomas Müller begrüßten die rund 50 Teilnehmer, überwiegend Ärzte, Physio- und Psychotherapeuten, Pharmazeuten und Pflegekräfte aus der Region, außerdem auch interessierte Einwohner von Bad Wildbad.

Obige Aussage leitete den Vortrag „Diabetes mellitus – Besonderheiten der Behandlung im Alter“ von Alexander Friedl ein. Friedl ist Ärztlicher Leiter des Geriatrischen Zentrums
Stuttgart, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Diabetologie und Diabetologe DDG. Geriatrie sei vor einigen Jahrzehnten noch „exotisch“ gewesen, da es sich ja „nur“ um „lauter alte Menschen gehandelt habe.“ Friedl hält dagegen: Alter sei nicht unbedingt Hinfälligkeit und keineswegs ein „kleines Thema.“ Geriatrie, so Friedl, ist die Lehre von den Krankheiten und Behinderungen, sowie den Besonderheiten bei alternden und alten Menschen. Bestandteile der Geriatrie sind Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation mit dem Ziel, den Verlust der Selbständigkeit zu vermeiden bzw. Hilfsbedürftigkeit wieder abzubauen.
Was bedeutet eigentlich Alter? Ab 30 Jahren verringern sich alle Körperfunktionen, was keine Krankheit ist, sondern durchaus normal. Das Alter zeigt sich als Syndrom (Kombination von verschiedenen Krankheitsanzeichen) von zahlreichen Symptomen, so u. a. Immobilität, Instabilität, intellektuellem Abbau, Isolation, Inkontinenz, Mangelernährung, Gebrechlichkeit, Schlafstörung, Depression, Delir, chronischem Schmerz, Schwindel, Seh-, Hör-, Sprechund Sprachstörungen, die oft nur teilweise angesprochen und erkannt werden. Rund drei Millionen Menschen über 65 Jahre leiden zudem an Diabetes mellitus (sog. Zuckerkrankheit), ab 80 Jahre sind es bereits bis zu 34 % (ca. 27 Mio.). Fol-

gen des Diabetes mellitus sind vor allem Veränderungen am Nerven- und am Blutgefäßsystem, darunter das diabetische Fußsyndrom. Dazu kommen die Besonderheiten des Diabetes mellitus im höheren Lebensalter, die schwieriger werdenden Therapieziele sowie die Diabetesversorgung im Alter.
Prof. Dr. Gerhard W. Eschweiler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter des Geriatrischen Zentrums der Eberhard Karls-Universität Tübingen, führte am Nachmittag in das Problem des „Delir“ ein, eine akute Störung der Gehirnfunktion, somit eine neurologische Erkrankung, eine Verwirrtheit im Alter, die im gewohnten häuslichen Umfeld zunächst kaum auffalle. Häufig würde diese Erkrankung erst bei einem Klinikaufenthalt erkannt werden. Durch eine zeitliche und örtliche Desorientierung wissen Betroffene oft nicht, wo sie sich befinden und aus welchem Grund sie dort sind. Auf Fragen geben sie oft unsinnig scheinende Antworten, wirken unkonzentriert und lassen sich leicht ablenken. Ihr Zustand ist nicht konstant, geistig klare und geistig verwirrte Phasen wechseln sich teils abrupt ab. Ärger, Reizbarkeit, Unruhe, Angst sowie Halluzinationen sind weitere Anzeichen eines Delirs, auch der Tag- und Nacht-Rhythmus wird oft umgekehrt. Leider würde häufig aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Mangels an geschultem Pflegepersonal im Krankenhaus versäumt, verschiedene Faktoren abzufragen, um festzustellen ob ein Patient an einem Delir leide.
An beide Vorträge (mit Powerpointpräsentationen) des Tages schlossen sich ausführliche Fragen und Diskussionen an, die zeigten, dass die Probleme bekannt sind, man jedoch durchaus dankbar ist für Hinweise und Erklärungen, wie sie in den beiden Referaten von Alexander Friedl und Prof. Dr. Gerhard W. Eschweiler aufgezeigt wurden.
Götz Bechtle
Dezember – 2019 | nota bene Seite 7 11. GeriatrieForum Bad Wildbad
11.
GeriatrieForum Bad Wildbad der Johannesklinik
Alexander Friedl bei seinem Vortrag zum Thema „Diabetes mellitus“
Foto: Bechtle
Dr. Thomas Müller, Anneli Zenker, Prof Dr. Gerhard W. Eschweiler (von links) und Alexander Friedl (nicht im Bild) wirkten beim 11. Geriatrieforum in Bad Wildbad mit.
Ein Gespräch mit Ines Veith

Es ist November. Der teils nebligtrübe Monat überrascht mit Sonnenschein und herbstlichen Farben. Es ist Mittagszeit. Beim Genuss einer herzhaften Kartoffelsuppe aus der Bad Liebenzeller Kurhaus-Küche erzählt Ines Veith über ihr reichhaltiges Leben als Journalistin und Autorin – häufig im Einsatz für politische Häftlinge aus der DDR. Bereits vor der Wende hat Ines Veith über spektakuläre Fluchtschicksale berichtet.
Zum Gespräch hat Ines Veith einen Berliner Mauerstein mitgebracht. „Wenn Mauern im Rahmen zeitgeschichtlicher Prozesse zerbröckeln“, sagt sie, „fallen die Mauerstücke der Erinnerung als dicke Brocken in alle Richtungen. Einer ist in Bad Liebenzell gelandet. Dieses originale Mauerstück mit deutlich erkennbaren Stacheldraht-Narben ist heute glücklicherweise nur noch als Gedenkstein von Bedeutung. Es ist ein Geschenk von lieben Freunden aus Berlin.“
Die Buchautorin lebt und arbeitet seit vielen Jahren in der für sie so besonders lebenswerten Kur- und Bäderstadt und ist vielen als Gründerin und Initiatorin der gemeinnützigen Stiftung SOPHI PARK, dem weltweit ersten philosophischen Park bekannt. Was vielleicht nur wenige wissen: die mittelgroße Frau mit charmantem Lächeln beschäftigt sich bereits mehr als ein halbes Leben lang mit Geschichten über Menschen, die ein besonderes Schicksal erfahren haben. Wahre Begebenheiten, akribisch recherchiert, literarisch und filmisch aufgearbeitet von einer Journalistin, die Film- und Medienwissenschaft sowie Philosophie an der Universität Köln studiert hat.
Mehr als 250 Reportagen für Zeitschriften, vierzehn Romane und Sachbücher sowie mehrere Drehbücher für Spielfilme hat Ines Veith mittlerweile veröffentlicht. Ihr bekanntestes Werk
„Die Frau vom Checkpoint-Charlie“. Der Zeitzeugen-Roman wurde als UFA Produktion im Auftrag von ARD/arte verfilmt und erreichte als TV-Zweiteiler bereits bei der Erstausstrahlung 12 Millionen Zuschauer. Prominent besetzt mit Veronica Ferres beschreibt der Film, angelehnt an wahre Begebenheiten, zehn Jahre aus dem Leben einer alleinerziehenden Mutter, die nach einem misslungenen Fluchtversuch aus der DDR 1982 inhaftiert wird. Wegen „Republikflucht“ zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, wird ihr gegen ihren Willen das Sorgerecht für die Kinder entzogen. Und sie wird in der berüchtigten JVA Burg Hoheneck zusammen mit politischen Häftlingen und Gewaltverbrecherinnen eingesperrt. Die beiden Töchter kommen zur Umerziehung in ein Heim für schwer erziehbare Kinder – der Kontakt zur Mutter ist untersagt. Zwei Jahre später kommt es durch das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen zum Freikauf und der Ausreise in den Westen – doch die Kinder bleiben hinter dem Eisernen Vor-
hang zurück. Was folgt, ist ein Kampf der Mutter um ihre Töchter mit dem Tenor „Gebt mir meine Kinder zurück“. Doch darauf muss sie vier weitere lange Jahre warten.
Menschen eine Stimme geben
1994 erhielt Ines Veith in Bayern Förderung für ihr Drehbuch „Die Frau vom Checkpoint Charlie“. Aus dramaturgischen und rechtlichen Gründen wur-

den die Handlung romanhaft erzählt, die Namen geändert und teilweise auch die Schauplätze. Wie hatte alles begonnen? Über die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte erfährt Ines Veith Details zu etlichen Fluchtschicksalen, darunter auch der Fall Jutta Gallus. Ines Veith wird gebeten, mitzuhelfen, diese Geschichte zu veröffentlichen. Oft wurden erst durch den öffentlichen Druck Verhandlungen innerhalb der deutsch-deutschen Diplomatie möglich und humanitäre Lösungen konnten erzielt werden. „Wer am lautesten auf sich aufmerksam machte, hatte die Chance, gehört zu werden. Insofern war es wichtig, den Opfern des SED-Regimes, eine öffentliche Stimme zu geben.“ Als Mutter eines Sohnes vertritt sie die Meinung, dass Kinder nicht als Spielball politischer Macht missbraucht werden dürfen. Unter dem Tenor „Familiendrama im geteilten Deutschland“ erfährt die Öffentlichkeit 1986 im „Journal für die Frau“ über Gallus, die menschenunwürdigen
nota bene | Dezember – 2019 Seite 8 Bad Liebenzell
Jahre Mauerfall
30
Hafterlebnisse und ihren Wunsch, ein Leben gemeinsam mit den Kindern zu verbringen.
Für die Nachwelt bewahrt Dann 1989 die Wende. Dreißig Jahre nach der „friedlichen Kerzenrevolution“ beschreibt die Buchautorin den Mauerfall als eine „große, dankbare Geschichte“, bei der die Mauer ohne Blutvergießen fällt. Die Geschehnisse in der DDR
„der erste Film, der das Flüchtlingsdrama, also die politische Haft nach einer gescheiterten Flucht so zeigt, wie es wirklich war.“
Gegen das Vergessen
Für Ines Veith ist Jutta Gallus die prominenteste Zeitzeugin, die über ihre Flucht erzählt und noch heute, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, gegen das Vergessen des Unrechts kämpft. Am


zeichnet Ines Veith für die Nachwelt auf. 1991 schreibt sie die Geschichte über Jutta Gallus -mit der sie inzwischen befreundet ist- in einem Zeitzeugen-Roman für den Goldmann Verlag, verflochten mit einer Geschichte über eine Zwangsadoption. Diese beiden Geschichten sind dann Grundlage für die spätere große Verfilmung. Fast fünf Millionen Menschen sind aus der DDR geflohen. Die meisten vor dem Mauerbau, viele jedoch unter lebensbedrohlichen Umständen. Die Frau vom Checkpoint Charlie steht als Symbol für all diese Schicksale. Dies gilt sogar an einigen Universitäten in den USA. In Frankreich hat diese Geschichte mehr als vier Millionen Zuschauer interessiert und wurde vom Michel Lafon Verlag in französischer Sprache veröffentlicht. Viele Betroffene konnten sich mit dieser Figur der Frau vom Checkpoint Charlie identifizieren und noch heute lebt diese Geschichte im Bewusstsein vieler Menschen. 2007 wird der TVZweiteiler ausgestrahlt und ist für viele
12. Oktober 2019 waren die Protagonisten, auf die sich der Film in weiten Teilen bezieht, real im Bürgersaal von Bad Liebenzell zu erleben. Jutta Fleck und ihre jüngste Tochter Beate Gallus berichteten mit eindrucksvollen FilmDokumentationen und ergreifenden Berichten über ihre Lebensgeschichte und den Widerstand gegen das DDRRegime, das System der Bespitzelung und die deutsche Teilung sowie ihren langen Kampf um die Ausreise. Die beiden live in Bad Liebenzell zu erleben, ist kein Zufall. Jutta Fleck und Beate Gallus sind durch Ines Veith eng mit der Bäderstadt verknüpft. Die großen HolzHerzen mit den lachenden Gesichtern, die vom Calwer Künstler Lothar Hudy für den SOPHI PARK gestaltet wurden, stehen symbolisch für Mut, Liebe und Hoffnung. „Herzen, die Gesichter tragen, stellen keine dummen Fragen. Sie sind einfach da im Leben, helfen Lasten wegzuheben“, wie Ines Veith in einem Reimvers beschreibt. Das erste „MutMacher-Herz Mucki“ erblickte am 3.
Mai 1983 das Licht der Welt. Gezeichnet von der neunjährigen Beate für ihre Mutter – ohne zu ahnen, dass diese Zeichnung ihre Mutter erst nach ihrem Freikauf in der BRD erreichen wird. Denn dieses „Kinderherz“ war von der Stasi beschlagnahmt worden.
DeutschDeutsche Geschichte „Den Mauerfall habe ich wie Millionen andere Menschen auch im Fernsehen

gesehen“, berichtet Veith, die diesen Moment als „einen der glücklichsten“ in ihrem Leben beschreibt. „Dafür haben wir uns alle eingesetzt, dass so etwas passiert“, so ihr Tenor zum 30sten Jahrestag des Mauerfalls. „Möge es nie wieder eine Diktatur in Deutschland geben! Vielen Dank all jenen Millionen Menschen, die trotz Angst, nur mit einer Kerze in der Hand, in zahlreichen Demonstrationen bewiesen haben, dass eine friedliche Revolution gegen Unterdrückung und Unfreiheit möglich ist. Diese herzzerreißende Stimmung haben weltweit viele Menschen mitgefühlt und diese großen Gefühle der deutschen Geschichte werden für immer erhalten bleiben und in den Herzen und Köpfen nachfolgender Generationen weiterglühen. Gefühle sind stärker als Mauern, Stacheldraht, Schießbefehle und Minenfelder. Dafür sind wir alle Zeitzeugen und dafür sind wir dankbar.“
Dezember – 2019 | nota bene Seite 9 Bad Liebenzell
Sabine Zoller Fotos: Sabine Zoller
Die etwas andere Weihnachtsgeschichte

Es war ein paar Tage vor Weihnachten, spät in der Nacht. Der Mond verdeckte sich hinter den Wolken und eine tiefe Stille herrschte in den Straßen der Stadt. Flocken wirbelten lautlos vom Himmel und bedeckten smoggeschwärzte Dächer mit einer weißen Decke aus funkelnden Sternen. Der Schlag der Kirchturmuhr war kaum verhallt, da zogen schweren Schrittes ein paar Männer heran. Sie sprühten Hakenkreuze auf die Mauern der Kirche und auf die Wände der Häuser schrieben sie: „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“. Mit schweren Steinen zertrümmerten sie die Schaufensterscheiben ausländischer Geschäfte und Restaurants. Dann zog die Horde johlend weiter.
Totenstille. Niemand hatte etwas gehört oder gesehen. Die Menschen waren mit der Zeit auf dem rechten Auge blind und außerdem taub und stumm geworden. „Jetzt ist es genug! Lasst uns gehen!“ „Was sagst Du da? Wohin sollen wir gehen?“ „Wir gehen zurück in den Süden, wo wir einst herkamen. Dort ist schließlich unsere Heimat. Hier ist es einfach unerträglich. Wir folgen ganz einfach der Aufforderung, die dort gegenüber auf der Hauswand steht: Ausländer raus!“
Mitten in der Nacht wurde die Stadt lebendig. Wie von Geisterhand öffneten sich die Türen der Geschäfte: Zuerst
kam der Kakao. Ihm folgten päckchenweise die Schokoladen und Pralinen in ihren Weihnachtskostümen. Sie wollten nach Ghana und Südafrika, denn das war ihr Zuhause. Dann folgte der Kaffee palettenweise, in Reih´ und Glied wie ein Soldatenheer, der Lieblingstrank der Deutschen. Ihn zog es nach Uganda, Kenia und Lateinamerika. Denn da war seine Heimat. Die Südfrüchte, wie Ananas, Mandarinen und Bananen, räumten ihre Kisten, auch die Feigen und Datteln aus Nordafrika. Nun kam auch Bewegung in Pfefferkuchen, Spekulatius und Zimt sterne, denn die Gewürze in ihrem Inneren zog es nach Indien. Der Dresdner Christstollen zögerte ein wenig. Tränen rannten aus seinen Rosinenaugen als er flüsterte: „Mischlingen wie mir geht es besonders an den Kragen!“ Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan, das sich an seine alte Heimat Persien erinnerte, und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, nur Herkunft zählte jetzt. In der Morgendämmerung starteten Gold und Edelsteine in teuren Chartermaschinen in alle Welt. An diesem Tag brach der Verkehr zusammen. Lange Schlangen japanischer Autos, voll gestopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, krochen gen Osten. Am Himmel sah man die Weihnachtsgänse nach Polen und Ungarn fliegen. Ihnen folgten feine Seidenhemden aus Asien und Teppiche aus dem Orient. Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer aus den Fensterrahmen und schwirr-
ten ins Amazonasbecken. Ihnen folgten dicht gedrängt Teak- und Mahagonimöbel. Die Straßen waren überflutet, denn überall quoll Öl und Benzin hervor, floss in Rinnsalen und Bächen zusammen in Richtung Naher Osten. Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz holten die großen deutschen Autofirmen ihre Krisenpläne aus den Schubladen. Doch was war das? Die Volkswagen und BMW’s begannen sich in ihre Bestandteile aufzulösen. Das Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Selbst die Straßendecke hatte in Verbindung mit ausländischem Asphalt ein besseres Bild abgegeben.
Rechtzeitig zu Weihnachten war der Spuk vorbei und der Auszug geschafft. Nichts Ausländisches war mehr im Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch Äpfel und Nüsse. Das Lied „Stille Nacht“ durfte noch gesungen werden –allerdings nur mit Sondergenehmigung. Es kam immerhin aus Österreich. Nur eines wollte nicht so recht ins Bild passen: Maria, Josef und das Jesuskind waren geblieben. Drei Juden. Ausgerechnet. „Wir bleiben“, sagte Maria, „wenn wir dieses Land auch noch verlassen, wer will, ja, wer kann ihnen dann noch den Weg zurück zeigen, den Weg zurück zu Toleranz und Menschlichkeit?“
(Verfasser unbekannt)
nota bene | Dezember – 2019 Seite 10 Gedanken zu Weihnachten
Hannes Wader schreibt über sein Leben und seine und unsere Zeit
Trotz alledem
Es wird wohl niemand behaupten, dass Hannes Waders Lieder jemals leichte Kost gewesen sind. Oft unbequem waren sie und genauso unbequem waren auch immer seine politischen Aktivitäten und Standpunkte. Aber Wader selbst hat schon im Jahre 1976 in einem Liedtext befürchtet, dass nach seinem Tod das Publikum „…als Sahnetörtchen runterfrisst, was Vollkornbrot gewesen ist“. Nachdem er letztes Jahr seine Abschiedstour absolvierte und seine letzte Platte „Macht’s gut“ auf den Markt brachte, hat der Liedermacher Hannes Wader nun seine Lebensbeschreibung veröffentlicht. Ungeschminkt und geradeheraus in seiner bekannt drastischen, direkten Sprache.
Wader erzählt von seiner Kindheit und Jugend in Bethel bei Bielefeld. Er berichtet von seinem Heranwachsen in der Nachkriegszeit und den damaligen Erziehungsmodellen in der Familie und in der Schule. Die Umbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg und die damit verbundene materielle Not sind ebenso Waders Thema, wie die vermeintliche Enge im Denken der Menschen und die Starrheit der gesellschaftlichen Strukturen. Hannes Wader greift zudem in seinem Buch die Geschichte der Familie weit vor seiner Geburt im Jahre 1942 auf und berichtet in lebhaften Bildern von Ereignissen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, der Weimarer Republik und des aufkommenden Nationalsozialismus. So entsteht eine faszinierende Mischung aus ganz privaten Episoden und den historischen Fakten und Ereignissen des Zwanzigsten Jahrhunderts.
Den Umzug nach Berlin im Jahre 1963, sein dortiges Grafikstudium und die ersten Auftritte als Straßenmusiker markieren einen bedeutenden Wen-
depunkt im Leben Hannes Waders. Er singt in Kneipen und Folk-Clubs, schreibt seine ersten eigenen Lieder und hat im Jahre 1966 seinen allerersten Auftritt beim Festival „Chanson Folklore International“ auf der Burg Waldeck. Reinhard Mey wird später über diesen Auftritt sagen: „Ich saß und hörte, was ich schon immer in unserer Sprache hören wollte. Seine Worte und Melodien verbanden sich, von einer kräftigen Stimme getragen, zu einem überwältigenden Gesang“.
Der Weg Hannes Waders vom Chanson-Poeten zum durch und durch politischen Liedermacher wird in allen
Etappen nachgezeichnet. Seine Zeit der Irrungen und Wirrungen bei der DKP, seine Neuorientierung nach dem Ende der DDR und dem Niedergang der Sowjetunion werden ohne Scheu und unverblümt vom Autor geschildert.
Ganz am Ende des Buches schreibt Hannes Wader: „Und ich denke beim Schreiben die ganze Zeit, ich habe mein gelebtes Leben vor Augen – dabei ist es immer nur der Tod. Was bleibt mir da anderes übrig, als einfach weiter zu machen? Ich beende das letzte Kapitel – mal sehen, was dann passiert.“



Hannes Wader: Trotz alledem – Mein Leben, Penguin Verlag, München, 2019
Dezember – 2019 | nota bene Seite 11 Literatur
Wolfgang Waldenmaier



Bing Crosby – White Christmas (MCA Records, 1955)
Der Weihnachtsklassiker schlechthin, mit der Originalversion von Irving Berlins „White Christmas“, „Jingle Bells“ zusammen mit den Andrew Sisters und mit dem Hawaiianischen Christmas Song „Mele Kalikimaka“.



Frank Sinatra – A Jolly Christmas (Capitol Records, 1957)
„Have yourself a merry little Christmas“ in der Version von „Old Blue Eyes“. Frank Sinatras ist einfach die romantischste Fassung des Songs. Dazu gibt es noch das wunderbare „The First Noel“ und eine faszinierende Interpretation des Kirchenliedes „Adeste Fidelis“ zu hören.



Harry Belafonte – To Wish You A Merry Christmas (RCA, 1958)
Harry Belafontes Weihnachtsplatte beinhaltet die Originalversion des Songs „Mary’s Boychild“. Ein wunderschöner Song, der die gesamte Weihnachtsgeschichte nach Lukas in eine zarte Melodie hüllt. Die gesamte Platte erzeugt beim Zuhören eine ruhige, entspannte Stimmung.
Aus der unüberschaubaren Menge an Musik hier eine kleine Zusammenstellung der schönsten Unterhaltungskünstler aus
The Christmas
Populäre Klassiker zur Advents



Dean Martin – A Winter Romance (Capitol Records, 1959)
Wer kennt nicht Dean Martins Aufnahmen von „Winter Wonderland“, „Let It Snow, Let it Snow, Let It Snow“ oder „Rudolph, The Red Nosed Reindeer“. Auch ohne ein knisterndes Kaminfeuer im Wohnzimmer wird einem beim Hören ganz warm ums winterliche Herz.

nota bene | Dezember – 2019 Seite 12 Musik



Nat King Cole – The Christmas Song (Capitol Records, 1962)
Die Samtstimme von Nat King Cole zaubert zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Atmosphäre in jede Stube. Sein Klassiker „The Christmas Song“, das in deutscher Sprache gesungene „O Tannenbaum“ oder das herrliche Wiegenlied „A Cradle In Bethlehem“ sorgen für absolut weihnachtliches Wohlgefühl.
Musik zur Advents- und Weihnachtszeit schönsten Weihnachtsplatten berühmter Pop- und aus über sechzig Jahren
Christmas Songs
Advents und Weihnachtszeit



Doris Day –The Doris Day Christmas Album (Columbia, 1964)
Doris Day beweist auf ihrem Weihnachtsalbum ihr stimmliches Können mit ihrem unvergleichlichen „Silver Bells“ und Ohrwürmern wie „Toyland“ oder dem legendären „I’ll Be Home For Christmas“.



Barbra Streisand – A Christmas Album (CBS, 1967)
Die großartige Stimme von Barbra Streisand brilliert auf diesem Album in unvergänglichen Songs, wie der kalifornischen Version von „White Christmas“, dem zärtlichen „The Best Gift“, dem „Ave Maria“ von Bach/ Gounod und einer im rasanten Geschwindigkeitsrausch dargebotenen „Jingle Bells“-Aufnahme.
Michael Bublé – Christmas (Reprise Records, 2011)



Michael Bublé’s Christmas Album ist zwar relativ neu (2011), darf aber schon den absoluten Weihnachtsklassikern zugerechnet werden. Neben der großen Zahl an weihnachtlichen Evergreens im swingenden Crooner-Stil, gibt es auf dem Album eine grandiose Fassung des Feliciano-Hits „Feliz Navidad“.
Die meisten Aufnahmen gibt es sowohl als CD, als auch auf Vinyl-Schallplatte

Seite 13 Dezember – 2019 | nota bene Musik
Die Qualitätskontrolle in Pflegeheimen auf der Grundlage von Schulnoten war in der Vergangenheit zunehmend in die Kritik geraten. Künftig soll es mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Leistungsniveaus geben
Der neue Pflege TÜV startet durch!
Am 1. Oktober 2019 trat das neue, indikatorengestützte Qualitäts- und Prüfsystem in der stationären Pflege in Kraft. An diesem Entwicklungsprozess waren viele Wissenschaftler beteiligt, damit dieses System sinnvoll und fundiert erarbeitet werden konnte. Die interne Qualitätssicherung in den Einrichtungen ist mit den externen Qualitätsprüfungen durch den Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK) verknüpft. Um dies zu ermöglichen, müssen die stationären Pflegeeinrichtungen ab sofort halbjährlich für jeden Bewohner Qualitätsdaten, die sogenannten Indikatoren, erfassen und einer neutralen Datenauswertungsstelle übermitteln. Bis Ende Juni 2020 läuft der Erprobungszeitraum, ab Juli 2020 werden die Ergebnisse online veröffentlicht und bundesweit mit anderen stationären Pflegeeinrichtungen, die ähnliche Bewohnerstrukturen haben, verglichen.
Die Datenauswertungsstelle führt statistische Plausibilitätskontrollen durch und teilt die Ergebnisse dem MDK und der betroffenen Einrichtung online mit. Auf dieser Basis findet dann einmal jährlich eine zweitägige Regelprüfung des MDKs in der Einrichtung statt. Wie bisher werden dabei einzelne Bewohner durch den MDK begutachtet sowie die Dokumentationsunterlagen der Einrichtung überprüft. War die Anzahl der zu begutachtenden Bewohner früher von der Größe der Einrichtung abhängig, so ist jetzt die Zahl der Überprüfungen auf 9 Bewohner festgeschrieben.
Sind die MDK-Begutachtungen früher grundsätzlich unangemeldet erfolgt, so müssen die künftigen zweitägigen Überprüfungen einen Tag zuvor angemeldet werden. Anlassbezogene Überprüfungen bei Gefahr im Verzug können wie bisher unangemeldet erfolgen. Bei dem neuen Verfahren steht besonders der Faktor Zeit in der Kritik. Die Datenerhebung sei zu zeitintensiv, da die Mitarbeiter mehrere Stunden mit der Übermittlung an die Datenauswertungsstelle beschäftigt seien. Man sollte dabei allerdings nicht außer Acht lassen, dass die Datenerfassung mit der Zeit routinierter abläuft und somit die Daten schneller erfasst werden können.
Das neue Verfahren wurde bereits in den Johanneshäusern Bad Wildbad und Bad Liebenzell-Monakam erprobt. Der Zeitaufwand war nicht so hoch, wie im Vorfeld angenommen. Die Neuerungen bieten gerade für die interne Qualitätssicherung einen guten Über-
blick, welche Bereiche noch verbessert werden können. Um eine gute Erfassung leisten zu können, wird erneut klar, dass eine detaillierte und zielführende Dokumentation das Bindeglied zwischen der internen Qualitätssicherung und der externen Qualitätsprüfung darstellt.
Seit dem 01.11.2019 prüft der MDK nach dem neuen Prüfverfahren. Zudem ist der MDK gesetzlich verpflichtet, bis zum 31.12.2020 mindestens einmal jede Einrichtung in Deutschland nach diesem Verfahren geprüft zu haben. Bisher wurde an dem Prüfverfahren des MDKs stets die mangelnde Transparenz kritisiert, da die Noten nicht aussagekräftig genug waren. Inwieweit das neue Verfahren hier eine Verbesserung und insbesondere mehr Klarheit für Bewohner und Angehörige bringen kann, wird sich erst in der Praxis zeigen.
MDK Prüfungen bisher Pflege TÜV neu
Schulnoten (vom MDK vergeben)
Der MDK kam unangemeldet
Bewertungsschema mittels Symbolen (Punkte und Quadrate)
Der MDK meldet sich 1 Tag vorher an
Der MDK prüft 2 Tage Keine Datenübermittlung (war gesetzlich nicht vorgesehen)
Der MDK prüfte 1 Tag
Datenerhebung wird an neutrale Stelle übermittelt (Datenauswertungsstelle DAS)
Dokumentation ausschlaggebend
Prüfkatalog orientierte sich nicht am Einstufungsverfahren (Pflegegrade)
Defizite in Teilbereichen konnten durch besonders gute Leistungen in anderen in der Gesamtnote teilweise kompensiert werden
Anzahl geprüfter Bewohner abhängig von Bettenzahl
Fachgespräch gleichwertig wie Dokumentation
Prüfkatalog beinhaltet Fragen aus dem Begutachtungsinstrument des Pflegegrades
Defizite können nicht durch andere Bereiche ausgeglichen werden
9 Bewohner werden geprüft (6 Bewohner werden von der DAS bestimmt und 3 Bewohner vor Ort durch MDK ermittelt)
nota bene | Dezember – 2019 Seite 14 Qualitätskontrolle in Pflegeheimen
Denise Loy
Versorgungslücke in der Pflege
Auswärtiges Amt blockiert Entlastung
bpa fordert schnellere Visaverfahren in den Botschaften
Um die Pflege in Rheinland-Pfalz zu sichern, müssen die Visaverfahren von Pflegekräften besonders aus den WestBalkanländern beschleunigt werden. „Dort warten hochmotivierte und gut ausgebildete Fachkräfte darauf, nach Deutschland kommen zu dürfen, bekommen aber ein Jahr lang nicht einmal einen Botschaftstermin für die Visabeantragung“, kritisiert der Präsident und rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Bernd Meurer. „Deutschland muss sich auf EU-Ebene für eine schnelle Annäherung an Staaten wie Kosovo, Albanien oder Mazedonien einsetzen.“
Pflegeversicherung
„Der West-Balkan gehört zu Europa“, sagte Meurer vor Vertreterinnen und Vertretern der mehr als 500 rheinland-pfälzischen bpa-Mitgliedsunternehmen in Mainz. Beim Besuch einer Berufsmesse im Kosovo habe er vor wenigen Tagen erlebt, wie viele junge Menschen nur darauf warten, nach Deutschland zu kommen und in der Altenpflege zu arbeiten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich kürzlich persönlich vor Ort für die Einwanderung von Pflegekräften stark gemacht.
„In Deutschland fehlen heute zehntausende Pflegefachkräfte und die Botschaften auf dem Balkan halten mo -
tivierte Bewerber tausendfach davon ab, uns bei der Lösung dieser Probleme zu helfen“, erneuerte Meurer seine Kritik am Auswärtigen Amt. „Außenminister Heiko Maas könnte der Pflege in Deutschland im Augenblick mehr helfen als jedes andere Mitglied der Bundesregierung. Es ist nicht zu begreifen, dass er es nicht tut. Wenn nur 50 Visabeamte mehr auf dem Balkan eingesetzt würden, hätten wir in einem halben Jahr keine Personalprobleme mehr, weil internationale Fachkräfte unsere Pflegeteams entlasten“, so Meurer. Das Auswärtige Amt nehme sich aber nicht einmal die Zeit für ein Gespräch über die problematische Situation in den Botschaften.
Spahn will Vorschlag zur PflegeFinanzierung vorlegen
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will bis Mitte kommenden Jahres einen Vorschlag zur Pflege-Finanzierung vorlegen. In den ersten Monaten 2020 plant das Ministerium dazu landesweit Veranstaltungen, Spahn will auch in der CDU darüber diskutieren.
„Aus der Debatte soll eine Entscheidung folgen, die klar macht: Es wird planbarer und verlässlicher, wie viel eine Familie an Eigenanteilen einbringen muss.“ Derzeit müssen Heimbewohner für die eigentliche Pflege im Bundesschnitt etwa 660 Euro zahlen. Dazu kommen noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen. Insgesamt kommen im Bundes-
schnitt rund 1900 Euro an Zahlungen aus eigener Tasche zusammen, es gibt aber erhebliche regionale Unterschiede. Spahn sagte: „Wenn eine Pflegebedürftigkeit über fünf oder sieben Jahre geht, kommen schnell einige Zehntausend Euro zusammen. Es gibt ein Bedürfnis, hier eine höhere Planbarkeit zu haben. Das möchte ich aufnehmen.“ Forderungen, die Pflegeversicherung solle die kompletten Pflegekosten übernehmen, lehnte er ab. „Von der Idee einer Vollversicherung halte ich nichts. Das entspricht nicht meinem Gesellschafts- und Familienbild. Denn dann müsste die Familie keine Verantwortung mehr für die Pflege ihrer Angehörigen tragen.“
Der Minister betonte: „Wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir uns umeinander kümmern, verliert unsere Gesellschaft den Kitt, der sie zusammenhält.“ Ihm sei wichtig, dass die Generationen Verantwortung füreinander übernehmen. „Eine Vollversicherung wäre deshalb das falsche gesellschaftliche Signal.“ Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, nannte das Familienbild des Ministers idealisiert. Der dpa sagte er: „Die Fakten zeigen, dass Großfamilien eine seltene Spezies sind und die Single-Haushalte radikal zunehmen.“
Quelle: bpa Bundesverband
Quelle: Vincentz-Verlag
Dezember – 2019 | nota bene Seite 15 Pflegepolitik
Interaktive Schnitzeljagd für Handynutzer
„Die Legende vom Holländer Michel“



Wer ein Smartphone hat, kann sich ab sofort auf eine spannende Entdeckungstour in Bad Wildbad begeben. Per Webapp besteht die Gelegenheit, mit den Märchenfiguren von Wilhelm Hauff einen interaktiven Spaziergang zu erleben. Wer Lust hat, kann damit selbst Teil einer spannenden Geschichte werden, und so auf charmante Art und Weise wissenswertes über die Stadt und die Natur erfahren.
Tour mit dem Holländermichel Wer kennt sie nicht, die Figuren aus dem Märchen „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff? Den Peter Munk, genannt der Kohlen-Peter, der an einem Sonntag zwischen elf und zwei Uhr geboren ist und daher drei Wünsche frei hat, wenn er im Schwarzwald das Glasmännlein trifft. Allerdings ist da auch noch der gefährliche Holländermichel, der in Sturmnächten sein Unwesen treibt und das Herz des Kohlen-Peter stehlen will.
Eine Geschichte, die auch Erwachsene immer wieder berührt, wird nun mittels einer interaktiven App für Handynutzer lebendig. Denn die Nutzer kommen „live“ mit dem freundlichen und hilfsbereiten Glasmännlein sowie dem derben und frech agierenden Holländermichel in Kontakt.
App für Handynutzer
Wer sich per Handy im Internet unter www.legende-vom-Holländermichel.de registriert, kann die Herausforderungen annehmen und die Abenteuer rund um die Stadt Bad Wildbad meistern. Doch anders als im Märchen haben sich in dieser virtuellen Welt die beiden Waldgeister zusammengerauft und eine neue Methode ausgedacht: Sie wollen nicht mehr jederzeit alle Wünsche erfüllen. Daher gewähren sie den Menschen nur noch einen Wunsch. Und dieser ist erst dann einzulösen, wenn die Aufgaben erfolgreich bewältigt sind.
Wer nun auf der App den Button „Story“ berührt, kann im ersten Kapitel nachlesen, dass es auch heute noch ein Wagnis ist, sich mit dem Holländermichel einzulassen: „Sei auf der Hut, denn der alte Geselle spielt nicht immer fair!“ Doch eine Partie mit dem Waldkönig hat auch ihren Reiz… Und zudem gibt es das Glasmännlein, das darauf achtet, bei der Wahl des richtigen Wunsches nichts zu überstürzen.

Um das auf dem Handy Beschriebene auch mit gesprochenem Wort zu untermalen, ertönt beim Drücken des zweiten Buttons die rauhe Stimme des Holländermichels, der dazu eine klare Aussage macht: „Du löst unsere Aufgaben und sammelst dafür Punkte. Und wir, das Glasmännchen und ich, gewähren dir für die gesammelten Punkte einen Wunsch.“

nota bene | Dezember – 2019 Seite 16
Fotos: Sabine Zoller
Bad Wildbad
Punkte sammeln
Seine klare Ansage lautet: Keine Punkte – keinen Wunsch. Damit fordert er die Nutzer auf, sich mit den Geschichten von Bad Wildbad intensiver zu beschäftigen. Insgesamt sind dreizehn Stationen zu bewältigen, die auf einer Übersicht individuell ausgewählt und aktiviert werden können. Wer sich nun aber schon einmal mit der Geschichte des Holländermichel beschäftigt, startet am besten mit dem Märchenweg auf dem Sommerberg. Der Weg be -

ginnt am Turm vom Baumwipfelpfad und ein Hörspiel berichtet an neun der zehn Stationen über das Märchen und darüber, wie Peter Munk um sein Glück ringt. Wer vor Ort die App aktiviert, bekommt einen Anruf vom Glasmännlein,

das gleich zwei Aufgaben stellt und diese per SMS an den Nutzer versendet. Wer die korrekte Antwort liefert, erhält ebenfalls postwendend eine Nachricht per SMS und bei Abschluss der Aufgabe einen Punkt.
Dreizehn Stationen
Wer nun schon einmal auf dem Sommerberg unterwegs ist, schafft problemlos die gestellten Aufgaben zum Baumwipfelpfad, der Wildline und der Sommerbergbahn. Spannend wird es dann im Badepalast der Extraklasse, dem Forum König-Karls-Bad, das als „Haus des Gastes“ täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet hat. Wasser steht hier im Fokus der Aufgaben und die wissensdurstigen Abenteurer tauchen immer tiefer in die Geschichte der Kur-

stadt ein. Weitere Anlaufstellen sind im Kurpark die Englische Kirche, das Königliche Kurtheater sowie der Spielplatz Räuberberg. Atemberaubend wird es dann beim Besuch der „Feng Shui Gärten“ der Villa Hanselmann, die

seit 2018 zu einem herrlichen Blick über die Dächer von Bad Wildbad einladen. Nach einem Abstecher zur Seifen- und Kaffeemanufaktur gilt es schlussendlich im Café Jats und am Wildbader Hof die finalen Fragen zu beantworten.

Wer mindestens acht Punkte erreicht hat, bekommt als Belohnung einen

individuellen Wunsch erfüllt. So zumindest offiziell! Denn am Ende stellt sich heraus, dass der Holländermichel ein bisschen zu voreilig mit seinem Versprechen war, einen Wunsch zu erfüllen. Glücklicher Weise hat das Glasmännchen einen „Plan B“ parat. Und so kann sich der Handynutzer bei diesem digitalen Spiel schlussendlich über einen Gutschein freuen und sich einen kleinen Wunsch in Wildbad erfüllen.
Sabine Zoller
Hinweis zu den Bildern:
Die Bilder wurden von der Autorin bei einer Erkundungstour im September gemacht.
Damals waren dabei:
Tourismus-Chefin Stefanie Dickgießer, Bürgermeister Klaus Mack und die beiden Tourismus-Aufsichtsräte
Oliver Eder und Uwe Göbel
Dezember – 2019 | nota bene Seite 17 Bad Wildbad
Das Leben is(s)t süß


Süß – dieses Wort bewerten wir doch überwiegend positiv. Wir versüßen uns den Nachmittag, wir belohnen uns mit etwas Süßem, Zucker als Seelentröster oder Energiespender.
Uns entfährt ein: „Ist der süß“, wenn wir ein niedliches Hündchen sehen. Kein negativer Gedanke ist verknüpft mit diesem Wort. Wie kommt das?
Für unsere Vorfahren war der Geschmack süß ein eindeutiges Zeichen, dass etwas genießbar war. Etwas, das man unbedenklich essen konnte, wie süße Früchte und Beeren. Da diese auch nur zu bestimmten Zeiten verfügbar waren, aß man davon auch soviel man bekommen konnte. Kam der Winter, war die süße Zeit vorbei. Süß gab es nur aus natürlichen Lebensmitteln, in begrenzter Form, zu begrenzten Zeiten. Das hat sich geändert.
Die Natur kennt das weiße Pulver Zucker nicht, er wächst nirgendwo und ist auch nicht wie Salz unter der Erde abbaubar. Zucker ist ein Produkt der Industrie, aus Zuckerrübe und Zuckerrohr, und so konnte er die Welt erobern. In raffinierter Form ist Zucker fast unbegrenzt haltbar und transportfähig. Damit konnte er in jedem Haushalt Einzug halten. Zucker ist das Lebensmittel, das unser Geschmacksempfinden am meisten verändert hat. Und er ist nicht nur zu bestimmten Zeiten zugänglich, sondern rund um die Uhr – morgens in der Marmelade, dem Fruchtjoghurt, den Müslimischungen, zwischendurch ein süßes Stückle, ein Softdrink, ein handlicher Pausensnack, der Nachtisch zum Mittagessen, ein Eis, ein Pudding, der Nachmittagskuchen, der Keks zum Kaffee, der Zucker im Tee… Und da gab es doch auch noch die Gummitiere, die
froh machen, der Riegel, der mich mobil macht, der Drink, der mir Flügel verleiht, die extra Portion Milch im Schokoriegel oder ein Zwerg, der so wertvoll wie ein kleines „Steak“ ist.
Worauf ich nicht selbst Appetit habe, darauf macht mir die Werbung Appetit. Natürlich zielgerichtet auf die kleinsten Konsumenten unserer Bevölkerung, denn gewöhnen wir diese früh an den süßen Geschmack, sind uns die Kunden von Morgen sicher. Das wäre ja auch alles kein Problem, wenn da nicht die Nebenwirkungen wären. Nur stehen diese nicht auf dem „Einkaufszettel“ und darüber klärt uns auch nicht die Kassiererin an der Kasse auf.
Ein zu hoher Zuckerkonsum kann zu Karies führen, Diabetes fördern, Blut-
nota bene | Dezember – 2019 Seite 18 Ernährung
Gesünder leben –Ernährung als Lebensstil (2)
hochdruck begünstigen, die Regulierung des Gewichts im Gehirn durcheinanderbringen und somit Übergewicht bewirken. Zuviel Zucker kann in Fett umgewandelt werden und damit das Risiko für Herzkrankheiten steigern. Zucker kann eine Rolle bei der Alzheimerkrankheit und der Entwicklung von Demenz spielen, auch bei Kindern hat man eine geistige Minderleistung durch zu hohen Zuckerkonsum feststellen können. Leider lieben auch Krebszellen Zucker. Sie wachsen besonders gut, wenn sie gut genährt werden.
„Wir stellten fest, dass Saccharose (Haushaltszucker) in Mengen, wie sie in der normalen westlichen Ernährung vorkommen, zu einem verstärkten Tumorwachstum und einem höheren Ausmaß an Metastasenbildung führt. Eine stärkereiche Ernährung hingegen, die keinen Zucker enthält, bringt diese Gefahren in deutlich geringerem Maß mit sich“, so Dr. Peiying Yang, Assistenzprofessorin für Palliative Medizin, Rehabilitation und Integrative Medizin. Und da Zucker auch die gleichen Aktivitätsmuster im Gehirn erzeugt wie süchtig machende Drogen und das Belohnungszentrum stimuliert, kann es auch zur Zuckersucht kommen. Wird dann versucht, auf den Zucker zu verzichten, kommt es zu ähnlichen bis gleichen Symptomen wie beim Alkohol- oder Drogenentzug.
Unser Gehirn braucht Zucker als wichtigsten Energielieferanten. Aber damit ist der Baustein gemeint, den der Körper aus Früchten, Kartoffeln, Reis und anderen Getreideprodukten selber gewinnen kann. Im Notfall auf Umwegen, auch durch fett- und eiweißhaltige Lebensmittel. Nur die süße Versuchung, die braucht es nicht. Die riesigen Mengen Zucker, die wir heute verspeisen, kann unser Körper auf die Dauer gar nicht verarbeiten oder verbrauchen. Das ständig erhöhte Insulin heizt nicht nur die Speicherung von Fett an, son-
dern bewirkt, dass die Zellen im Körper immer schlechter auf das Insulin ansprechen.


Inzwischen ist das auch vielen Menschen bewusst und sie wollen ihren Zuckerkonsum einschränken. Das ist nicht im Interesse der Lebensmittelindustrie. Nur 17 % des Zuckers, den wir Deutschen verspeisen, kaufen wir selbst ein. Gut 83 % verzehren wir als „versteckten Zucker“ dort, wo ihn keiner vermutet. Das kann in den Milchbrötchen zum Frühstück sein, im Schinken, der Salami, in der Teewurst, der Dose Ravioli, der Fertig-Hühnersuppe oder der Tiefkühlpizza. Da ist es wieder, das Kleingedruckte auf der Packung. Und wenn ich das entziffert habe und keinen Zucker drauf finde? Bin ich längst nicht auf der sicheren Seite. Gut getarnt, damit es keiner merkt, verwenden Lebensmittelhersteller auch andere Zuckerarten oder süßende Zutaten, die zum Teil nur schwer als Zucker zu erkennen sind. Zu Zuckern und zucker-
reichen Zutaten gehören Saccharose, Dextrose, Raffinose, Glukose, Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup, Glukosesirup, Glukose-Fructose-Sirup oder Stärkesirup, Karamellsirup, Laktose, Maltose oder Malzextrakt/Gerstenmalzextrakt, Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin. Den Zuckerkonsum reduziert man am besten, indem man naturbelassene Lebensmittel konsumiert! Je weniger Zutaten auf der Zutatenliste stehen und je unverarbeiteter das Lebensmittel, desto besser.
Es geht nicht darum, nie wieder Süßes zu essen oder mit Reue und schlechtem Gewissen ein Stück Kuchen zu verdrücken. Es geht darum, dass ich mir bewusst mache, was ich esse, wieviel ich esse, wann ich esse. Kann ich den Kuchen als etwas Besonderes genießen? Oder esse ich mich an 3 Stück satt? Kann ich mir eine gute Praline auf der Zunge zergehen lassen, den zarten Schmelz spüren, wenn langsam die Schokolade schmilzt, oder esse ich eine Tafel Schokolade wie ein Stück Brot? Brauche ich 2 Löffel Zucker im Kaffee oder tut es doch auch einer? Man kann sich den Zuckerkonsum auch langsam wieder abgewöhnen. Und man kann auf Produkte verzichten, in denen Zucker nichts zu suchen hat. Dazu gehören besonders Fertiggerichte. Natürliches Essen, Essen ohne zugesetzte, versteckte Zuckerarten. Süße aus frischen Früchten oder auch getrocknetem Obst, wie z. B. Datteln und Feigen, die im Müsli sehr gut den Zucker ersetzen können. Oder mit den Worten von Hans Lauber gesagt (Autor von Fit wie ein Diabetiker): „Meine Philosophie ist, ernähre dich aus der Natur heraus, ernähre dich im Rhythmus der Jahreszeiten und schau, dass du das mit Genuss verbindest.“
Bianka Zielke MHT Ernährungsberaterin und Diätassistentin
Dezember – 2019 | nota bene Seite 19 Ernährung
Kurz vor der Ankunft bittet die Studentin der Theologie/Sozialen Arbeit Damaris Diestel ihren Freund, Daniel Wiesner, ganz langsam zu fahren: „Da vorne darfst du aber nur 5 km/h fahren!“. Als Daniel in die Straße zum Johanneshaus in Monakam einbiegt, weiß er warum. Die Aussicht über das Liebenzeller Schwarzwaldtal ist gigantisch. Ganz ruhig wird es im Auto und dann ist nur ein „Ohhh…“ zu hören. Auf den Gesichtern von Damaris, Daniel und der Kommilitonin Elisabeth formiert sich ein Lächeln. Alle zwei Wochen besuchen sie die Bewohner des Johanneshauses Bad Liebenzell-Monakam.
Als die Studenten der Internationalen Hochschule Liebenzell an dem Nachmittag ankommen, ist die Einrichtungsleitung gerade in einer Besprechung und so gehen Damaris, Elisabeth und Daniel selbstständig in den Aufenthaltsbereich 2. Sie tragen bereits eigene Namensschilder des Johanneshauses und sind als „ehrenamtlicher Mitarbeiter“ ausgeschrieben. Es warten bereits 10 ältere Menschen auf sie. Sofort steht eine ältere Dame, Carmen*, auf und nimmt Damaris‘ Hand in ihre eigene. Sie hält sie ganz fest und begrüßt sie mit etwas unverständlichen Worten. Dann bekommt Damaris‘ Strickjacke ihre Aufmerksamkeit und Damaris fragt sie: „Möchten Sie die gerne mal anziehen?“ und zieht sie im selben Moment schon aus und hilft der älteren Dame, sie anzulegen. Die freut sich, sodass Damaris noch hinzufügt: „Die brauche ich nachher aber wieder!“
Elisabeth hat sich derweil zu einer anderen älteren Dame im Rollstuhl begeben. Sie hockt mit einem breiten Lächeln neben dem Rollstuhl. Eine Hand hält sich an der Rollstuhllehne fest und die andere hat sie ganz sanft auf den Unterarm der älteren Damen gelegt. „Hallo Frau Weber*, wir sind heute wieder zu Besuch da!“, beginnt Elisabeth das Gespräch, aber Frau Weber hat Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Sie kann sich kaum artikulieren. Lediglich Laute gibt sie von sich. Liebevoll begrüßen die Studenten jeden einzelnen im Raum.
Den Pflegern sind die Studenten schon bekannt. Diese holen in der Zwischenzeit den Kuchen. Es
Von Kuchen, Liedern und alten Menschen
IHLStudenten engagieren sich für Senioren in Monakam

gibt Apfelstreuselkuchen oder Pudding. Das Austeilen ist gar nicht so leicht, weil nicht jeder der älteren Menschen seine Entscheidung ausdrücken kann, ob er oder sie Kuchen oder Pudding möchten. Daniel sitzt neben Frau Kröger* und fragt eine Pflegerin, ob er ihr beim Essen helfen darf, nachdem sie mit Lauten ihre Arme nach dem Kuchen ausstreckt. Die Pflegerin antwortet: „Aber bitte in kleinen Stücken.“ Ganz behutsam sticht Daniel mit der Kuchengabel ein Kuchenstück ab und führt es Frau Kröger in den Mund. Diese freut sich sichtlich darüber.
Nach dem Kuchenessen holen Elisabeth ihre Gitarre und Daniel seine Violine heraus. Damaris kündigt schon mal an, dass gleich gesungen wird. Frau König*, die im Rollstuhl sitzt, fängt schon mal an: „Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren.“ Damaris fragt daraufhin, ob sie das denn singen möchte und schon spielen Elisabeth und Daniel fröhlich die Melodie dazu. Es geht von Heidelberg über „Mein kleiner, grüner Kaktus“ bis hin zu „Großer Gott, wir loben dich“. Carmen geht dabei wieder langsam auf Damaris zu, greift nach ihren Händen und beginnt mit ihr zu tanzen. Damaris weist sie dabei noch darauf hin: „Aber vorsichtig, Carmen! Nicht, dass Ihnen schwindlig wird!“ und lacht während sie sich mit
Carmen etwas durch den Aufenthaltsraum bewegt.
Nach zwei Stunden packen die Studenten ihre Sachen und verlassen das Johanneshaus wieder. Sie sehen nachdenklich, aber glücklich aus. Damaris fragt im Auto ihre Kommilitonen, wofür sie Gott im Johanneshaus loben würden. Damaris nennt das „Praise Break“, was so viel wie „Lobespause“ bedeutet. Daniel und Elisabeth sagen, dass die alten Menschen dort einen schönen Ort hätten, wo Gott den alten Menschen Gemeinschaft untereinander schenkt. Das freut sie. Damaris fügt am Ende noch hinzu: „Ich werde bestimmt auch mal so eine alte Dame, wo ganz viel Chaos im Kopf herrscht. Das habe ich ja jetzt schon.“ und Daniel lacht.
Auch Anneli Zenker, Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin, kam während des Besuches zu den Studenten und begrüßte sie. Für sie ist der Einsatz dieser jungen Menschen vorbildlich: „An den Gesichtern und Reaktionen unserer Bewohner merken wir, dass die Studenten Trost, Freude und Liebe spenden.“
Dr. Thomas Eisinger (Monakam), Kanzler der Internationalen Hochschule Liebenzell und gewähltes Gemeinderatsmitglied in Bad Liebenzell, freut sich über das Engagement seiner Studenten: „Ich bin immer wieder dankbar, dass unsere Studenten sich so intensiv in Bad Liebenzell einbringen und sich so beherzt um Menschen wie die Senioren im Johanneshaus kümmern. Davon brauchen wir mehr und dafür arbeiten wir täglich!“
Lucas Wehner
nota bene | Dezember – 2019 Seite 20
Ehrenamt
*Die Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert.
Fröhliches Zimtsternebacken im Johanneshaus Bad LiebenzellMonakam
Die Back-Gruppe des Monakamer Johanneshauses war am Tag vor Nikolaus eifrig dabei, leckere Zimtsterne nach einem traditionellen Rezept zu backen. Die Ergebnisse waren genauso herrlich, wie man es auf den Bildern erkennen kann. Die beteiligten Bäckerinnen und Bäcker wünschen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
red



Lieder zur Weihnachtszeit –klassisch und modern
Das Konzert des Duetto Classico war einer der Höhepunkte in der Adventszeit im Johanneshaus Bad Liebenzell-Monakam. Evelina Bott, Sopran, und Monika Erol, Mezzosopran, zauberten mit ihrem romantischen Programm und ihren großartigen Stimmen weihnachtliche Atmosphäre und Vorfreude in die Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner. Ein herzliches Danke, verbunden mit vielen Wünschen auf ein baldiges Wiedersehen.
red

Dezember – 2019 | nota bene Seite 21
Johanneshaus Bad LiebenzellMonakam
Der Ansatz der Kinästhetik in Ergotherapie und Pflege
Aufzustehen und sich zu waschen, sich anzuziehen und das Frühstück zuzubereiten, alles alltägliche Verrichtungen, scheinbar selbstverständlich. Nicht jedoch, wenn mit zunehmendem Alter die Kräfte schwinden, die Beweglichkeit der Gelenke abnimmt und manches schwerer im Gedächtnis bleibt. Manches im Alltag wird zur Bürde. Gesellt sich eine Krankheit mit mannigfaltigen Folgen für Körper und Geist hinzu, wird Unterstützung notwendig. Pflege und Therapie treten auf den Plan. Mit dem Aufspüren, Erarbeiten und Trainieren sinnvoller Betätigungen wird die betroffene Person darin unterstützt, trotz und mit Einschränkungen wegen fortgeschrittenen Alters als auch in der Folge von Krankheit und deren mannigfaltigen Folgen für Körper und Geist eigenständig und kompetent das eigene Leben zu führen. Lebensqualität und Wohlbefinden werden mit Pflege und Therapie wieder möglich.
Um das zu erreichen, wird dem professionellen Handeln ein Konzept zugrunde gelegt, welches das to do am Bewohner, Kunden und Patienten praktisch aufzeigt. Das Konzept der Kinästhetik ist eines davon. Ein Konzept, welches für die Praxis eine Handhabung aufzeigt, die dem Paradigma der Hilfe zur Selbsthilfe gerecht wird.
Der Mensch wird in Körper und Geist unterteilt oder Körper und Geist bilden eine Einheit, die mit sich und der Umwelt in Beziehung steht. In diesen beiden Aussagen steckt das Verständnis dessen, was den Menschen ausmacht. Die erste Aussage entspringt einem mechanischen Weltbild und einer entsprechenden mechanischen Erklärung darüber, was der Mensch ist. Das zweite entspringt einer kybernetischen Sichtweise, die das Bild eines Systems wählt, um zu erklären, was der Mensch ist. Erklärt wird der Mensch anhand eines Systems, welches bestehend aus mehreren Untersystemen fortwährend mit sich und der Umwelt in Beziehung steht und damit lebt. Während eine Mechanik reagiert, agiert ein kybernetisches System. All unser menschliches Verhalten ist Ausdruck dafür, dass Menschen aus der Reaktion der Systeme handeln.
Dieses Paradigma leitet den Ansatz der Kinästhetik, was bedeutet er in der Praxis? Um aus dem Bett aufzustehen, bedarf es aufeinander abgestimmter Bewegungsabläufe, die mit einer Drehung zur Seite eingeleitet werden und im Aufstehen von der Bettkante enden. Ohne Einschränkung ist es die Muskelkraft, die Orientierung und das Körpergefühl, die es selbstverständlich machen, sich zu bewegen und von einer Körperstellung in die andere zu gelangen. Mit Einschränkungen leidet die Wahrnehmung über Richtung und Intensität der eigener Bewegung und behindert das flüssige und leichte Aufstehen, es wird beschwerlich. Unterstützung nach dem Konzept der Kinästhetik bedeutet hier, den Bewegungsablauf des Aufstehens zu begleiten. Begleitet wird er, indem die zu unterstützende Person als auch die Person, die Unterstützung gibt, in der Aktivität miteinander kommunizieren. Dies geschieht über Wahrnehmung und Sprache, in der beide Impulse aus der Wahrnehmung des eigenen Körpers in seiner Haltung und Bewegung dem anderen weitergeben. Aus der Unterstützung wird eine Interaktion, in welcher die Aktivität von beiden ausgeführt und an welcher beide Personen aktiv beteiligt sind.
Am Beispiel: Die Bewegung des Drehens wird über die Schulter eingeleitet. Der Kontakt über das Auflegen der Hand steht an deren Beginn, der Blickkontakt und die verbale Information dessen, was unmittelbar geschieht, machen die Aktivität für den betroffenen Menschen im ganzen wahrnehmbar – er dreht sich mit der Unterstützung zur Seite und wird nicht gedreht. Die Bewegung des einen löst die des anderen aus. Die Rotation an der Schulter geht einher mit einer Rückbewegung der unterstützenden Person, die den Impuls überträgt, indem sie ihre
Stellung verändert. Aus der Berührung an der Schulter wird ein Mitnehmen der Schulter, indem eine Hand an der Schulter flächig und weich aufliegt, die Bewegung der unterstützenden Person überträgt und die Drehung im Oberkörper zur Seite der zu unterstützenden Person auslöst. Beide haben in der Aktivität miteinander kommuniziert, beide waren aktiv!
Hierin liegt die Bedeutung des Konzeptes der Kinästhetik für Therapie und Pflege. Ein Umgang mit Personen, die der Unterstützung bedürfen, nach dem Konzept der Kinästhetik ist immer geprägt von der Haltung, dass beide handeln. Jede Form der Unterstützung nach diesem Ansatz basiert auf eigener Aktivität auch derjenigen Person, die auf Unterstützung angewiesen ist. Die Person wird nicht aus dem Bett geholt, sondern darin begleitet aufzustehen. Das macht beide – die unterstützende als auch die unterstützte Person zu Partnern. Partner im Sinne der gemeinsamen Aktivität. Dies erzeugt Wohlbefinden, denn die zu pflegende Person erhält die Pflege in der eigenen körperlichen Selbstversorgung, wozu sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr selbst in der Lage ist. Eine Pflege eben dieser Selbstversorgung trägt dazu bei, sich wohl zu fühlen. Eine Pflege nach dem Konzept der Kinästhetik trägt dazu bei, dass die Pflege des eigenen Körpers mit Sinn und Verstand erlebt wird, und münzt die Erfahrung des Mangels in eine Erfahrung des Könnens um.
In der Therapie ist der Ansatz Mittel zum Zweck, auf Basis vorhandener Fähigkeiten Betätigungen der körperlichen Selbstversorgung so zu trainieren, dass die Wahrnehmung des Handelns einhergeht mit der Erfahrung des Gelingens. Ein wichtiger Baustein für die Ergotherapie mit ihrem Anspruch, den von Krankheit und Behinderung betroffenen Menschen dazu zu befähigen, selbstbestimmt zu handeln und einer in seinem Lebenszusammenhang sinnvollen Betätigung nachzugehen.
Anke Matthias-Schwarz Ergotherapeutin
nota bene | Dezember – 2019 Seite 22 Ergotherapie
Natürliche Hilfe
Ein Ratschlag aus der Apotheke

Vielen Besuchern einer heutigen Apotheke ist sicherlich nicht bekannt, dass trotz der großen Anzahl chemisch produzierter Arzneimittel bis heute ungefähr ein Drittel des Arzneischatzes aus unserer Natur stammt. Selbst modernste Entwicklungen nutzen häufig die Natur als Lieferanten der Ausgangssubstanzen.
Um die Vielfalt der Pflanzenwelt mit ihren Arzneistoff liefernden Arten besser kennen zu lernen, bin ich immer wieder auch mit der Kamera in der Natur unterwegs, um einzelne Exemplare für mein Archiv festzuhalten.
In regelmäßiger Folge möchte ich deshalb an dieser Stelle einzelne Pflanzen vorstellen und über ihre Wirkungsweise informieren.
Friedrich Böckle (Quellen-Apotheke, Bad Liebenzell)

Auf meinen spätherbstlichen Bergtouren erfreut mich stets der Anblick der weithin leuchtenden Früchte der Bärentraube. Die Pflanze hat vermutlich ihren Namen erhalten wegen der Vorliebe der Bären für diese Früchte.
In den Bergregionen wird wohl daraus auch Marmelade gekocht. Die immergrüne Pflanze ist winterhart und deshalb in den Alpen bis 3000 m Höhe anzutreffen. In Deutschland steht das Gewächs unter Naturschutz.
Pharmazeutisch interessant sind die Blätter, aus denen Arzneimittel produziert werden, die bei Blasenentzündungen erfolgreich eingesetzt werden können. Dafür ist ein Inhaltsstoff (Arbutin) verantwortlich, der sich interessanterweise erst im Körper zum eigentlichen Wirkstoff (Hydrochinon) umbildet und sodann von den Bakterien, die für die Erkrankung verantwortlich sind, freigesetzt wird. Die Vermehrung dieser Bakterien wird durch Hydrochinon gehemmt.
Die Zubereitung von Bärentraubenblättertee ist selbstverständlich ebenso möglich, hat jedoch den Nachteil, dass beim Abkochen auch relativ viele Gerbstoffe aus den Blättern gelöst werden, die unangenehm schmecken und zudem Probleme im Darmtrakt verursachen können. Um dies zu vermeiden, sollte der Tee als „Kaltauszug“ über mehrere Stunden lang zubereitet werden. Nach dem Filtrieren kann er dann zum Trinken erwärmt werden.
Wichtig bei der Therapie ist eine genügend hohe Dosierung. Mindestens 4 Tassen pro Tag oder entsprechend der Angabe der Industrie bei Tabletten, Kapseln oder Tropfen die hohe Dosisangabe. Eine braungrüne Verfärbung des Urins während der Therapie ist nicht selten, jedoch unbedenklich.
Wichtiger Hinweis: Wegen eventueller Leberschädigungen werden Therapien mit Bärentraubenblättern nur eine Woche lang und maximal fünfmal im Jahr empfohlen.
Dezember – 2019 | nota bene Seite 23
Natur und Heilkunde
(Foto Bärentrauben, F. Böckle)
Bären lieben Bärentrauben




nota bene | Dezember – 2019 Seite 24
Joseph von Eichendorff (1788 – 1857), deutscher Dichter und Dramatiker