

Gemeinsam medizinische Zukunft fördern
Der Förderkreis Klinikum Bielefeld unterstützt die Einrichtung eines Skills Labs im Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte
Der Förderkreis Klinikum Bielefeld möchte die Entwicklung zum Universitätsklinikum OWL begleiten und die kontinuierliche Verbesserung der Qualität für Patient*innen und Mitarbeitende verbessern. Aktuell steht die finanzielle Unterstützung der Einrichtung des geplanten Skills Labs im Mittelpunkt. Im „Skills Lab“ sind speziell ausgestattete Unterrichtsräume, in denen angehende Mediziner*innen ihre praktischen Fähigkeiten ausbauen können. Im neu entstehenden Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte wird das Skills Lab das Herzstück darstellen.
MÖCHTEN SIE DEN FÖRDERKREIS KLINIKUM BIELEFELD MIT EINER SPENDE UNTERSTÜTZEN?
Ihre Spende ist online möglich unter https://klinikumbielefeld.de/projekte-entdecken.html
„Mit der finanziellen Unterstützung der Einrichtung eines innovativen Skills Labs fördern wir die medizinische Zukunft, indem wir uns für eine optimale Ausbildung der künftigen Mitarbeitenden einsetzen. Und von gut ausgebildeten Expert*innen profitieren auch immer die Patient*innen.“

Alternativ ist eine Überweisung auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Bielefeld möglich: Empfänger: Klinikum Bielefeld gem.GmbH
IBAN: DE79 4805 0161 0050 0696 81
BIC: SPBIDE3BXXX
Verwendungszweck: Förderkreis Klinikum Bielefeld
Auch Barspenden sind möglich. Kontaktieren Sie hierzu bitte die Referentin für Fundraising.
Ihre Spende kommt sicher an –herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Sandra Knicker
Tel.: 05 21. 5 81 - 20 82
foerderkreis@klinikumbielefeld.de
Spenden an das Klinikum Bielefeld sind steuerlich abzugsfähig und können direkt an die Klinikum Bielefeld gem.GmbH geleistet werden. Eine Zuwendungsbestätigung wird Ihnen unmittelbar nach Eingang der Spende zugesendet.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist einige Zeit vergangen, seit wir Ihnen eine Ausgabe unseres Patient*innenmagazins VISITE präsentiert haben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Ihnen nun eine neue Ausgabe des Magazins überreichen können. Wobei das Wort „überreichen” nur passt, wenn Sie diese VISITE tatsächlich gedruckt in den Händen halten. Vielleicht lesen Sie aber auch gerade in der digitalen Version? Wir haben festgestellt, dass wir tatsächlich mehr Menschen mit unseren Inhalten erreichen können, wenn wir sowohl eine klassische gedruckte Ausgabe als auch eine digitale Version herausgeben. Eine ähnliche Erfahrung haben wir bereits mit unserer Veranstaltungsreihe „Bürger fragen, Ärzte antworten“ gemacht. In der Zeit vor der Corona Pandemie war es eine klassische Veranstaltung an unseren drei Standorten, mit Vorträgen unserer Expert*innen und realen Gästen in unseren Seminarräumen in Bielefeld - Mitte, Bielefeld - Rosenhöhe und Halle/Westf.. Während der Pandemie waren solche Veranstaltungen zu unserem großen Bedauern leider nicht möglich. Also sind wir auf die digitale Variante umgestiegen und haben die Veranstaltungen in Interviewform über Facebook und Instagram „gestreamt“. Das hat auch den Vorteil, dass die Aufzeichnungen anschließend dauerhaft auf unserem YouTube Kanal zu sehen sind und auch als Podcast bei Spotify zu hören sind. Erreicht haben wir über den digitalen Weg tatsächlich stets viele tausend Menschen. Das hat uns dann doch positiv überrascht. Wir werden den digitalen Weg weiter ausbauen.
„Ausbauen“ ist ein gutes Stichwort. Wer am Klinikum Bielefeld - Mitte in diesen Tagen vorbeikommt, dem wird auffallen, dass auf dem Campus des Klinikums eine rege Bautätigkeit herrscht. So kann man unter anderem den Fortschritt der Bauarbeiten für die neue Zentrale Notauf-
nahme sowie den Ausbau der Operationsäle durch ein modernes Container-System beobachten. Zudem wurde Ende November der Grundstein für unser Studierendenhaus gelegt. Was sich genau hinter dem „Studierendenhaus“ verbirgt und was das dort angesiedelte „Skills Lab“ genau ist, kann in der VISITE nachgelesen werden. Sie erfahren auch, welche Pläne unser neu gegründeter Förderkreis für das Klinikum und das Studierendenhaus hat.

Absolut spannend sind auch die weiteren Themen unserer VISITE. Man kann erfahren, wie am Klinikum Bielefeld mit neuesten medizinischen und organisatorischen Techniken Krebs bekämpft wird und welche Rolle das zertifizierte Onkologische Zentrum dabei spielt. Man bekommt auch einen tiefen Einblick in unsere Operationssäle, in die schon seit geraumer Zeit Roboter ihren Einzug gehalten haben, nicht als Operateur, da ist der Mensch absolut unersetzbar, aber als „Kollege“, der auf Anweisung der Mediziner*innen unterstützt. So konnten unsere Orthopäd*innen stolz ihre 1000. Operation mit dem „MAKO ©“ verkünden und die Thoraxchirurg*innen den Beginn des „da Vinci®“Zeitalters im Klinikum. Erfahren können Leser*innen der VISITE auch, wie unsere Zentrale Notaufnahme den Ernstfall mit einem Schockraumtraining simuliert. Wer auf den Ernstfall vorbereitet ist, den kann wenig überraschen. Neu ist auch unsere Adipositas Klinik am Klinikum BielefeldRosenhöhe. Seit kurzer Zeit wird die Klinik von einer Doppelspitze geleitet – als einzige Klinik in der Republik von zwei Frauen – im Bereich der Chirurgie eine Besonderheit.
Es steckt noch mehr drin in unserer VISITE. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre Redaktion
INHALT
TITELTHEMA | DAS STUDIERENDENHAUS AM KLINIKUM BIELEFELD - MITTE

Zentraler Ort des Lernens Grundsteinlegung für Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte
Gemeinsam medizinische Zukunft fördern Der Förderkreis Klinikum Bielefeld unterstützt die Einrichtung eines Sklills Labs für Studierende am Klinikum Bielefeld - Mitte
FORSCHUNG & INNOVATION
Forschungsstandort Klinikum Bielefeld Die Abteilung für Klinische Forschung stellt sich vor
Pilotprojekt Innovationsstation Die Zukunft der stationären Pflege
1000. MAKO © OP in der Orthopädie Roboterarm operiert zum 1000. Mal am Klinikum Bielefeld - Mitte
Minimalinvasive Lungenkrebs-Operationen in der Thoraxchirugie Ein Standard – jetzt mit Verstärkung

MEDIZIN ERLEBEN
Arzneimittelfabrik im Krankenhaus?

Die neuen Reinräume der Krankenhausapotheke –individuelle Maßarbeit unter höchsten Hygienestandards

12 Jahre HOTH
Kooperation von Fachkliniken und Praxen –Endoprothetik-Operationen im Klinikum Halle/Westf.

Aktiv gegen Krebs Spendenlauf finanziert Schulungsdummy für Patient*innen mit einem Tracheostoma
KLINIKUM INTERN
Der Krankenhaussozialdienst Aufgaben, Schnittstellen und neue Herausforderungen am Klinikum Bielefeld
Spitzenmedizin in Doppelbesetzung Die Adipostas Klinik am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe
Schockraumtraining im Krankenhaus
In der Notaufnahme des Klinikums Bielefeld muss jeder Handgriff sitzen
Das Onkologische Zentrum Heimatnahe Spitzenversorgung von Krebspatient*innen
Das Magazin Visite gibt es auch online zum Download
Zentraler Ort des Lernens
Grundsteinlegung für Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte
Axel Dittmar Pressesprecher des Klinikums Bielefeld, Leiter Unternehmenskommunikation
Im Studierendenhaus des Klinikums Bielefeld dreht sich alles um die Studierenden der Medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld. Das viergeschossige Studierendenhaus entsteht aktuell am Klinikum Bielefeld - Mitte auf der Rückseite des großen Hauptgebäudes an der Eduard-Windthorst-Straße. Die Grundsteinlegung fand am 25. November 2022 statt. Die traditionelle Grundsteinlegung dient auch als Zeitdokument, aus diesem Grund wird bei diesem Anlass gerne eine Zeitkapsel in den Grundstein eingearbeitet. Sie enthält oft tagesaktuelle Dokumente, Glücksbringer, Briefe oder andere Gegenstände. Geschäftsführer Michael Ackermann versenkte gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden des Förderkreises Klinikum Bielefeld, Prof. Dr. Theodor Windhorst, der Direktorin für Universitäre Medizin, Priv.-Doz. Dr. Dorothea Stahl sowie dem Bielefelder Stadtkämmerer Rainer Kaschel, der Dekanin der Meidzinischen Fakultät OWL, Univ.-Prof. Dr. Claudia Hornberg und der Geschäftsführerin des Bauunternehmens Hochbau Detert, Norma Bopp-Strecker, das maßgeblich am Bau des Studierendenhauses beteiligt ist, eine Zeitkapsel. Diese wurde gefüllt mit aktuellen Ausgaben der Neuen Westfälischen und des Westfalen Blattes, einer FFP2 Maske, einem Schnelltest sowie einer Flasche hochprozentigem „Puhlmännchen“-Schnaps der Bielefelder Apotheke am Alten Markt. Hinzugefügt wurde auch eine „Survival Map“, die den Studierenden den Start am Klinikum Bielefeld erleichtert hat, ein Foto der ersten Lehrveranstaltung sowie der aktuelle Stundenplan und ein Brief des Referats für Studium und Lehre der Medizinischen Fakultät OWL.
Das Gebäude, das über eine Grundfläche von 2.044 Quadratmeter verfügen wird, soll im Sommer 2024 pünktlich zum dann beginnenden Wintersemester fertig gestellt sein. Als Teil des Universitätsklinikums OWL bietet das Klinikum Bielefeld dann für die praktische Ausbildung der Studierenden der Medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld auch eigene Seminar- und Laborräume an. Mit 2 Hörsälen, einer digitalen Bibliothek, den 9 Seminarräumen, den 5 Trainingsräumen für Operationen, den 2 Forschungs-
laboren und einer Mensa wird Raum geschaffen für die Studierenden, die in dem attraktiven Gebäude arbeiten, diskutieren, zu Mittag essen und forschen können. Es entsteht kein Büchersilo, sondern ein Ort multimedialen Lernens und der interdisziplinären Kommunikation. Das Studierendenhaus versteht sich als Hafen zwischen Krankenbett, Hörsaal, Bibliothek und Studierzimmer. Hier sollen zukünftig die angehenden Mediziner*innen lernen und arbeiten können, dabei sollen innovative Lehrkonzepte wie das „Skills Lab“ umgesetzt werden.
„Wir freuen uns, dass wir den Studierenden der Medizinischen Fakultät auf unserem Campus Gesundheit am Klinikum Bielefeld - Mitte hochattraktive Lernplätze bieten können. Das Gebäude wird Begegnungen und Teamarbeit fördern und die Lernsituation nachhaltig verbessern!“ freut sich Michael Ackermann, der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld.
 Prof. Dr. Theodor Windhorst, Priv.-Doz. Dr. Dorothea Stahl, Rainer Kaschel, Michael Ackermann, Univ.-Prof. Dr. Claudia Hornberg und Norma Bopp-Strecker mit der Zeitkapsel
Prof. Dr. Theodor Windhorst, Priv.-Doz. Dr. Dorothea Stahl, Rainer Kaschel, Michael Ackermann, Univ.-Prof. Dr. Claudia Hornberg und Norma Bopp-Strecker mit der Zeitkapsel
Gemeinsam medizinische Zukunft fördern
Der Förderkreis Klinikum Bielefeld unterstützt die Einrichtung eines Skills Labs für Studierende am Klinikum Bielefeld - Mitte
 Sandra Knicker Unternehmenskommunikation Referentin Fundraising
Sandra Knicker Unternehmenskommunikation Referentin Fundraising


Mittlerweile haben bereits 120 Studierende ihre Ausbildung als Mediziner*innen am Universitätsklinikum (UK) OWL der Universität Bielefeld begonnen und absolvieren den klinischen Teil ihres Studiums unter anderem am Campus Klinikum Bielefeld. Als besonderes Merkmal des Modellstudiengangs Medizin an der Universität Bielefeld gilt unter anderem ein frühzeitiger Praxisbezug sowie die Verzahnung von grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Inhalten. Das Klinikum Bielefeld ist als „Campus Klinikum Bielefeld der Medizinischen
Fakultät OWL der Universität Bielefeld“ Teil des Universitätsklinikums OWL und beteiligt sich an der wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung der angehenden Mediziner*innen. Für diese neue Aufgabe wurde bereits Einiges in die Wege geleitet und auch zukünftig wird es viele weitere innovative Ausbildungsmöglichkeiten am Klinikum Bielefeld - Mitte geben: Eines davon wird das sogenannte SKILLS LAB im Studierendenhaus sein, dessen Einrichtung der Förderkreis Klinikum Bielefeld nun finanziell unterstützen möchte.
Der Förderkreis Klinikum Bielefeld
Kurz nach der Gründung des Universitätsklinikums
OWL bildete sich 2021 der Förderkreis Klinikum Bielefeld. Dieser Förderkreis hat als übergeordnetes Ziel, das Klinikum Bielefeld durch eine Vernetzung mit Unternehmen, Institutionen und interessierten Bürger*innen zu fördern und zu unterstützen. Vorrangig soll es hierbei um die Begleitung des Entwicklungsprozesses zum Universitätsklinikum OWL gehen und die kontinuierliche Verbesserung der Qualität für Patient*innen und Mitarbeitende.
Als Vorsitzender des Förderkreis-Vorstands wurde Prof. Dr. Theodor Windhorst gewählt, der sich als ehemaliger Chefarzt des Klinikums Bielefeld und früherer Ärztekammer-Präsident weiterhin für „sein Krankenhaus“ einsetzen möchte. Neben ihm gehören Dr. Ulrike Puhlmann (Apotheke am Alten Markt), Martin Knabenreich (Bielefeld Marketing) sowie Ingo Schlotterbeck (ASB OWL e.V.) zum Vorstand des Förderkreises.

Die Vorstandsmitglieder steuern die Projekte und Aktivitäten des Förderkreises in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung des Klinikums und mit Unterstützung der Referentin für Fundraising im Klinikum Bielefeld. In der letzten Förderkreis-Sitzung haben sich die knapp 30 Mitglieder des noch recht jungen Förderkreises für das erste große Förderprojekt entschieden: Sie möchten die Einrichtung des geplanten Skills Labs im derzeit entstehenden Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte finanziell unterstützen.

„Die Gründung der Medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld ist ein historisches Ereignis und bringt eine ganz neue Perspektive in die Gesundheitsregion OWL. Als kommunales Krankenhaus und Teil des Universitätsklinikums OWL gehen wir proaktiv mit diesem Entwicklungsprozess um. Gemeinsam mit Förder*innen und Unterstützer*innen möchte das Klinikum Bielefeld die neuen Impulse für Forschung und Innovation, Wissenschaft und Patientenversorgung aufgreifen und bestmöglich zum Wohle der Menschen in unserer Stadt und der Region nutzbar machen.“
Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld„Die Beteiligten haben sich ganz bewusst für die Gründung eines Förder-KREISES entschieden und verzichten auf die Rechtsform eines eingetragenen Fördervereins mit den damit verbundenen Statuten. Uns ist die freie Gestaltung des Engagements besonders wichtig, wir freuen uns über freiwillige Unterstützung und die Ideen der Förderkreismitglieder.“
 Michael
Prof. Dr. Theodor Windhorst, Vorstandsvorsitzender des Förderkreises Klinikum Bielefeld
Michael
Prof. Dr. Theodor Windhorst, Vorstandsvorsitzender des Förderkreises Klinikum Bielefeld
Im Studierendenhaus sollen zukünftig die angehenden Mediziner*innen lernen und arbeiten können, dabei sollen innovative Lehrkonzepte wie das Skills Lab umgesetzt werden.
Das Skills Lab Unter einem „Skills Lab“ versteht man speziell ausgestattete Unterrichtsräume, in denen praktische Fähigkeiten geübt werden können. Die Bezeichnung stammt aus dem Englischen und setzt sich aus „skill“ (Können, Geschick) und der Abkürzung „lab“ für „laboratory“ (Versuchsraum) zusammen. Im Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte wird das Skills Lab im 1. Obergeschoss das Herzstück darstellen. Hier lernen die angehenden Ärzt*innen praktische Fertigkeiten, die sie optimal auf den Berufseinstieg vorbereiten.
So steht im Bereich der Notfallversorgungstechniken ein Simulationsraum „OP-/Schockraum“ zur Verfügung, der es einzelnen Personen oder auch ganzen Teams ermöglicht, konkrete Behandlungsabläufe zu simulieren und das Verhalten in verschiedenen Situationen zu trainieren. Das Szenario kann von außen durch einen Beobachtungsraum verfolgt und durch eine Steuerungseinheit aktiv beeinflusst werden. Zudem steht ein „Patientenzimmer ZNA/Intensivstation“ zur Verfügung, in welchem Techniken aus der Notfallversorgung (z.B. manuelle Beatmung) an Simulationspuppen trainiert werden können.
Im Bereich der Routineversorgungstechniken stehen Räume für die Innere Medizin und die Chirurgie zur Verfügung, in welchen Untersuchungen und Techniken, wie zum Beispiel Sonografie und das chirurgische Nähen geübt werden können. Auch kommunikative Fähigkeiten werden hier geschult – in einem Raum für Kommunikationstraining üben die angehenden Mediziner*innen unter anderem die Anamneseerhebung, das Erklären von Befunden und die Gesprächsführung in Krisensituationen.
Alle Räume des Skills Labs sind mit einem Audio-VideoSystem ausgestattet, das mit den restlichen Räumen des Studierendenhauses verbunden ist und auch eine Übertragung außerhalb des Klinikums ermöglicht. So können Simulationen und Trainingseinheiten des Skills Labs, aber auch alle anderen Lehrveranstaltungen wie Seminare und Vorlesungen übertragen und aufgezeichnet werden. Dabei besteht jederzeit die Möglichkeit zur Kommunikation zwischen Überträger und Empfänger. Für die Übertragung von Simulationen und OPs wird ein Video-Management-System verwendet, welches die Übertragung verschiedener

Bildquellen (z.B. Kamera im OP-Saal, Detailkamera aus Sicht des/der Operateur*in, Patientenmonitor und Endoskop) ermöglicht.
Auch Ärzt*innen in Weiterbildung erhalten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten stetig zu erweitern und zu optimieren, insbesondere durch gemeinsame Trainings von verschiedenen Fach- und Berufsgruppen. Die daraus resultierende verbesserte Zusammenarbeit untereinander kommt unmittelbar der Qualität der Patientenversorgung zugute.
„Die praktische Ausbildung im Studierendenhaus auf dem Campus des Klinikums Bielefeld trägt zur Steigerung der Patientensicherheit vor Ort bei. Die Studierenden lernen, ihr theoretisch erlangtes Wissen anzuwenden und können Untersuchungsund Behandlungstechniken trainieren, um sich so bestmöglich auf den Berufseinstieg und die damit verbundene Verantwortung für die Patient*innen vorzubereiten.“
Priv.-Doz. Dr. med. Dorothea Stahl, Direktorin für Universitäre Medizin am Klinikum Bielefeld

„Der Förderkreis möchte gerne dabei helfen, den Studierenden des Universitätsklinikums OWL eine ideelle und wissenschaftliche Heimat zu geben. Mit der finanziellen Unterstützung der Einrichtung eines innovativen Skills Labs fördern wir die medizinische Zukunft, indem wir uns für eine optimale Ausbildung der künftigen Mitarbeitenden einsetzen. Und von gut ausgebildeten Expert*innen profitieren auch immer die Patient*innen.“

Möchten auch Sie Mitglied im Förderkreis Klinikum Bielefeld werden?
Prof. Dr. Theodor Windhorst, Vorstandsvorsitzender des Förderkreises Klinikum Bielefeld

Möchten Sie den Förderkreis Klinikum Bielefeld mit einer Spende unterstützen?
Auch ohne ein Förderkreis-Mitglied zu sein, können Sie den Förderkreis bei der Einrichtung des Skills Labs im Studierendenhaus am Klinikum Bielefeld - Mitte finanziell unterstützen.
Ihre Spende ist online möglich unter https://klinikumbielefeld.de/projekte-entdecken.html

Alternativ können Sie den Förderkreis per Überweisung auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Bielefeld unterstützen:
Empfänger: Klinikum Bielefeld gem.GmbH IBAN: DE79 4805 0161 0050 0696 81
BIC: SPBIDE3BXXX
Verwendungszweck: Förderkreis Klinikum Bielefeld
Auch Barspenden sind möglich. Kontaktieren Sie hierzu bitte die Referentin für Fundraising.
Spenden an das Klinikum Bielefeld sind steuerlich abzugsfähig und können direkt an die Klinikum Bielefeld gem.GmbH geleistet werden. Eine Zuwendungsbestätigung wird Ihnen unmittelbar nach Eingang der Spende zugesendet.
Der Eintritt als Mitglied in den Förderkreis Klinikum Bielefeld ist jederzeit unkompliziert über die Internetseite des Förderkreises möglich: www.foerderkreis-klinikumbielefeld.de
Förderkreismitglieder können ihr Engagement frei gestalten, die Unterstützung in Form einer finanziellen Zuwendung ist freiwillig und kann in selbst wählbarer Höhe sowie einmalig oder regelhaft erbracht werden. Als Förderkreismitglied werden Sie zweimal im Jahr im Rahmen einer Mitgliederversammlung durch den Vorstand des Förderkreises und die Geschäftsführung über die Entwicklung des Klinikums Bielefeld informiert. Gemeinsam mit dem Vorstand beraten Sie, welche Aktivitäten und/oder Projekte ausgewählt und umgesetzt werden.
Für Fragen rund um den Förderkreis des Klinikums Bielefeld, für Informationen zum Unternehmen und zum Thema Spendenwesen steht Ihnen die Referentin für Fundraising am Klinikum Bielefeld gerne zur Verfügung.
Sandra Knicker
Unternehmenskommunikation | Referentin Fundraising Tel.: 05 21. 5 81 - 20 82 foerderkreis@klinikumbielefeld.de
FORSCHUNGSSTANDORT KLINIKUM BIELEFELD
Die Therapie von kardiovaskulären Erkrankungen ist oftmals komplex und unterliegt in Abhängigkeit neuer Studienergebnisse einem stetigen Wandel.
Dr. med. Ekaterina Stellbrink Studienärztin der Abteilung für klinische Forschung, Assistenzärztin der Universitätsklinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin

In den letzten Jahren standen immer wieder die Fragen im öffentlichen Diskurs, welche Schritte medizinische Behandlungsverfahren und Medizinprodukte durchlaufen müssen und wie lang es dauert, bis diese zur Behandlung von Patient*innen eingesetzt werden können. Am Klinikum Bielefeld - Mitte widmet sich eine ganze Abteilung der klinischen Forschung.
Die klinische Forschung versteht sich als ein Teilgebiet der Medizin, welches sich mit der Prüfung von experimentellen, innovativen Therapiemöglichkeiten auseinandersetzt. Damit neue Arzneimittel oder andere Therapieformen den Patient*innen angeboten werden können, müssen sie in der klinischen Forschung alle Phasen erfolgreich durchlaufen - die sogenannten Studienphasen. Ziel solcher Studien ist es, neue Medikamente und neue medizinische Produkte auf Wirksamkeit und Verträglichkeit zu testen. Sie verfolgen das übergeordnete Ziel, eine wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten und die medizinische Versorgung zu verbessern.
Häufig wird behauptet, dass lediglich große Forschungsinstitute in ihren Laboren Studien durchführen. Tatsächlich wird dort an den experimentellen „präklinischen“ (vor Anwendung in der Klinik) Phasen der Studien gearbeitet und geforscht. Wenn sich der Therapieansatz außerhalb eines lebenden Körpers, „in-vitro“ genannt, als effektiv und sicher erweist, beginnt die klinische Forschung zuerst mit gesunden
Dilani Narendra Praktikantin der Unternehmenskommunikation

Proband*innen und danach mit erkrankten Menschen. Hier kommen die Krankenhäuser oder Praxen ins Spiel. Damit sich Krankenhäuser überhaupt an klinischen Forschung beteiligen können, müssen sie eine Reihe von Anforderungen erfüllen.
Weit nicht alle Häuser werden diesen gerecht. Für die klinische Forschung wird ausgebildetes Personal benötigt, das hervorragende Kenntnisse in den internationalen Leitlinien für klinische Forschung, den GCP (Good Clinical Practise), vorweisen kann, und sich stetig weiterbildet. Daneben muss das Krankenhaus eine gute Infrastruktur vorweisen und über die finanziellen Ressourcen verfügen, die Studien tragen zu können. Sowohl die Überprüfung der Voraussetzungen als auch die Implementierung klinischer Forschung sind aufwendig und benötigen präzise Dokumentation und eine enge Zusammenarbeit mit den Patient*innen. Das Klinikum Bielefeld - Mitte ist eines der Häuser, die die Anforderungen erfüllen und seit Jahren aktiv forschen.
DIE ABTEILUNG FÜR KLINISCHE FORSCHUNG
Seit 2009 existiert am Standort Klinikum Bielefeld - Mitte die Abteilung für klinische Forschung. Die Abteilung ist in der Universitätsklinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin angesiedelt und wurde von Chefarzt Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink initiiert. Die erste Studie, an der die
Abteilung mitwirkte, war eine Medikamentenstudie mit weltweit 20.000 Proband*innen. Studien, die an mehreren Standorten durchgeführt werden, werden als multizentrische Studien bezeichnet. Für die Medizin sind Studien diesen Umfangs von wesentlicher Bedeutung, da eine große Datenlage zur Verfügung steht und somit die wissenschaftliche Aussagekraft größer ist. An solchen Studien mitzuarbeiten, war eine wesentliche Motivation für die Gründung der Abteilung.
Das Team der Abteilung besteht aus den drei Study Nurses/Studienassistentinnen Marion Iselt, Stefanie Watson und Britta Brettschneider, und der Studienärztin Dr. med. Ekaterina Stellbrink, aber auch viele weitere Stations- und Oberärzt*innen werden miteinbezogen. Bei jeder neuen Studie werden die Mitarbeiter*innen von der deutschen Ethikkommission auf ihre Eignung geprüft. Für das Team ist jede Studie ein neues Kapitel mit neuen Sicherheitsaspekten, klinischem Ansatz und Einschlusskriterien. Bei jeder Studie wird sich einem neuen klinischen Problem gewidmet.
Die Abteilung versteht sich als Bindeglied zwischen Forschung und klinischem Alltag. Im Kern geht es in der Forschung um die Verbesserung der bestehenden Therapien. Man schaut, wie die schon bestehenden Therapiemöglichkeiten verbessert werden können, um somit eine bessere Versorgung der Patient*innen sicherzustellen.
WELCHE KLINISCHEN STUDIEN WERDEN AM KLINIKUM BIELEFELD VORGENOMMEN?
Die Abteilung für Klinische Forschung führt die im Klinikum initiierten klinischen Projekte durch und beteiligt sich an der Umsetzung multizentrischer Studien. Zu eigenen Forschungsprojekten gehört die Forschung im Bereich der Rhythmologie (= Lehre der elektrischen Erregung des Herzens), wie zum Beispiel die Untersuchung zu Effektivität und Sicherheit der Wiederholungseingriffe bei Vorhofflimmern im Rahmen des REMATCH-Registers.
Ein wichtiges Thema der multizentrischen Forschung ist die Therapie der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz. Bei den Patient*innen mit Herzinsuffizienz ist häufig ein Ungleichgewicht zwischen der sympatischen und parasympatischen Stimulation des Herzens vorhanden. Das führt zu reduzierter Herzleistung, Arrhythmien und übersetzt sich in ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei den herzinsuffizienten Patient*innen. Die Abteilung arbeitet momentan an den multizentrischen Forschungsprojekten „CVRx BAROSTIM THERAPY“ und „ANTHEM“ mit. Zweck der CVRx BAROSTIM THERAPY- und ANTHEM-Studien besteht darin, die Wirkung von Barorezeptor-Stimulator oder N.Vagus-Stimulator bei Patient*innen mit symptomatischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) zu bestimmen.

WER KANN AN DEN STUDIEN TEILNEHMEN?
Patient*innen, die stationär in der Kardiologie des Klinikums Bielefeld behandelt werden, können mit ihrem Einverständnis an den Studien als Proband*innen teilnehmen. Die Teilnahme an den Studien kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen von den Patient*innen zurückgezogen werden. Die Daten der Studienteilnehmenden werden vertraulich behandelt und verlassen nicht die Abteilung für klinische Forschung. Außerdem werden die Daten anonymisiert und die Mitarbeitenden sind zur Wahrung von Patient*innendaten verpflichtet. Die Sicherheit und das Vertrauen der Patient*innen stellen für das Team die obersten Prioritäten dar.
WIE LÄUFT EINE KLINISCHE STUDIE AB?
Bei einem stationären Aufenthalt oder ambulant nach Entlassung der Patient*innen kann die Möglichkeit zum Einschluss in klinische Studien geprüft werden. Nach dem Einschluss in die Studie werden die Patient*innen regelmäßig zu Kontroll-Visiten in die Forschungsambulanz einbestellt. Dabei werden die festgelegten Parameter (z.B. Ergebnisse der apparativen Diagnostik und Laborwerte), die die Sicherheit und die Effektivität der neuen Therapie prüfen, regelmäßig kontrolliert. Die Untersuchungsergebnisse werden den Patient*innen mitgeteilt und mit ihnen gemeinsam besprochen. Diese Untersuchungen sind nicht nur für
das Forschungsvorhaben wichtig, sondern auch für die Sicherheitsgewährleistung der Patient*innen.
Die Teilnehmenden werden meistens von ihren behandelnden Ärzt*innen an die Abteilung weiterempfohlen. Darüber hinaus melden sich viele Patient*innen selbstständig mit der Frage, ob sie an einer Studie teilnehmen können.
Die Anzahl der Studienteilnehmenden variiert je nach Studie zwischen 1 und 80 Patient*innen. Letztendlich entscheidet der Studienaufbau und die Intensität der ambulanten Betreuung der einzelnen Studienteilnehmenden darüber, wie viele Proband*innen in einer Studie teilnehmen. Für die effektive Rekrutierung der Studienteilnehmer*innen und qualitativ hochwertige Studienergebnisse wurde die Abteilung für klinische Forschung bereits ausgezeichnet.
ZUKUNFTSPERSPEKTIVE DER ABTEILUNG FÜR KLINISCHE FORSCHUNG
Mit dem Beitritt des Klinikums Bielefeld zum Universitätsklinikum OWL im Jahr 2021 verändert sich auch für die Abteilung für klinische Forschung so einiges. Der Forschungsstandort wird gestärkt und es ergeben sich Möglichkeiten, die Abteilung weiter auszubauen. Es werden mehr eigene, in dem Universitätsklinikum Bielefeld initiierte Forschungsprojekte ermöglicht.
In der Kardiologie sind viele Erkrankungen akut und lebensbedrohlich und der Leidensdruck der Patient*innen groß. Häufig sind die Gründe für die Teilnahme an einer Studie die fehlenden oder unzureichenden verfügbaren Therapiemöglichkeiten einer schweren akuten oder chronischen Erkrankung. Die Teilnahme an einer Studie ersetzt nicht die aktuelle leitliniengerechte Therapie der Patient*innen, sondern ermöglicht eine zusätzliche Behandlungsoption. Somit haben viele Patient*innen im Rahmen einer Studie die Möglichkeit, eine ergänzende Therapie zu erhalten.
Außerdem sind einige kardiologische Erkrankungen weniger erforscht und die Patient*innen haben ein großes Interesse, bei der Erforschung dieser Erkrankungen mitzuwirken. Eine weitere Motivation für viele Patient*innen, an den Studien mitzuwirken, ist der gesellschaftliche Nutzen der Forschung. Nur mit der Forschung kann man die Behandlung von Erkrankungen verbessern und die medizinische Versorgungslandschaft innovativer gestalten.

PILOTPROJEKT
Denise Scheulen Stellvertretende Leitung Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
Innovationen in die Praxis umzusetzen oder etablierte Abläufe zu erneuern, ist im Pflegealltag bei laufendem Stationsbetrieb kaum möglich – wenn auch von vielen Pflegekräften dringend gewünscht. Am Klinikum Bielefeld nahm man sich dieser enormen Herausforderung an. Die Innovationsstation auf der 8. Etage am Klinikum Bielefeld - Mitte wurde im Januar 2022 eröffnet – und hat Früchte getragen.
Die 72 Betten der „Innovationsstation“ belegt das Viszeralonkologische Zentrum der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Klinik für Gastroenterologie. Gut 40 hoch motivierte Pflegekräfte traten auf der Station an, um zukunftsweisende Lösungen für häufig auftretende Probleme in der pflegerischen Praxis zu finden und einzuführen. Das Stationskonzept schafft den Raum, um Innovationen unkompliziert in die Pflege der Patient*innen zu integrieren und zu erproben. Das Projekt gibt die Möglichkeit, überholte Prozesse neu und kreativ zu gestalten und Lösungsansätze auszuprobieren. Besonders die bauliche Neugestaltung der Station macht das Ausprobieren von technischen Innovationen möglich.


Vorbereitet wurde das Projekt in einem gemeinsamen Workshop von Pflegenden und Mediziner*innen, die auch den kompletten Umbau der Station gemeinsam
mit der Technischen Abteilung des Klinikums planten. Den Stein ins Rollen brachte ein externer Workshop, bei dem unterschiedliche Berufsgruppen des Klinikums Bielefeld gemeinsam Ideen für die Zukunft des Krankenhauses sammelten. Hier entstand auch die Idee der Innovationsstation. Sanierungsmaßnahmen boten die Chance, die Innovationsstation zu etablieren.
Die Medizin, aber auch die Pflege befinden sich im digitalen Wandel. Diese Transformation soll am Klinikum nicht passiv erlebt, sondern aktiv mitentwickelt werden. Innovationen insbesondere zur Verbesserung des Alltags für die Pflege und damit Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes sind überfällig. Aber auch den mit der Gründung des Universitätsklinikums OWL entstandenen universitären Aufgaben wird man hier gerecht: Das Klinikum nutzt die Station, um digitale und insbesondere telemedizinische Projekte wissenschaftlich zu bearbeiten, mit dem Ziel, die Behandlungsqualität zu verbessern.
Die Innovationsstation startete mit einigen technischen Neuheiten
So wurde beispielweise mit einem Vitalzeichenmonitor (Pulsfrequenz, Blutdruck, Temperatur, Sauerstoffsättigung im Blut) gearbeitet, der eine Schnittstelle
INNOVATIONSSTATION
Der Blick in die Zukunft der stationären Pflege
zum Krankenhausinformationssystem (KIS) bietet. Die Werte, die erfasst werden, gehen dann automatisch in die KIS-Akte. Der Scan der Patientenarmbänder zur Identifikation der Patient*innen verhindert Übertragungsfehler, vereinfacht die Visite und erleichtert dem Pflegepersonal das Messen der Vitalparameter.
Patient*innen haben an Ihren Betten ein Bedsideterminal, auf welchem verschiedene Funktionen genutzt werden können. So unter anderem die ServicerufApp Cliniserve, über welche die Patient*innen ihre Anliegen und Bedürfnisse übermitteln: Vom Wunsch nach Kaffee oder Wasser bis hin zur Information, dass die Infusion durchgelaufen ist oder der Bitte um Lagerungswechsel. Dies erleichtert die Kommunikation zwischen den Patient*innen und Personal und optimiert den Ablauf auf der Station. Doppelte Wege zur Bedarfserfassung und Leistungserbringung werden vermieden. Ebenfalls finden die Patient*innen auf dem Tablet Informationen rund um ihren Klinikaufenthalt sowie verschiedene Entertainmentmöglichkeiten.

Auf der Station wurde von Anfang an mit Dashboards gearbeitet, die die Patiententafeln in den Pflegestützpunkten ersetzen. Bei den Dashboards handelt es sich um große Monitore mit genauer Stationsübersicht, auf denen Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die
Information, dass der/die Patient*in eine Operation hatte oder isoliert werden muss, abzulesen sind. Die Daten werden direkt aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) gezogen und ermöglichen dem Personal einen schnellen Überblick über die gesamte Station und eine optimale individuelle Betreuung der Patient*innen.
Eine weitere Innovation eher praktischer Natur ist ein Kleiderschrank Container-System. Es handelt sich um einen abschließbaren Kleiderschrank auf Rollen, der bei Verlegung des/der Patient*in einfach aus dem Korpus herausgefahren und zusammen mit dem/der Patient*in ins neue Zimmer gefahren werden kann. So kann das aufwändige Packen des persönlichen Eigentums des/der Patient*in vermieden werden, alle Dinge bleiben beim Umzug verschlossen in dem Container, der mit einem Zahlenschloss versehen ist.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Praxis der Innovationsstation werden evaluiert und später in den Alltag weiterer Stationen des Klinikums integriert. So haben sich die eingesetzten Dashboards bereits so bewährt, dass sie auf allen Stationen der drei Standorte des Klinikums Bielefeld angebracht wurden. Zudem wurde die Station 8.1 am Standort Bielefeld - Mitte nach dem Vorbild der Innovationsstation saniert und eingerichtet.

Roboterarm operiert zum 1000. Mal am Klinikum Bielefeld - Mitte



Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zum 1000. Mal wurde nun der MAKO©-Roboterarm der Firma Stryker im Operationssaal der Orthopädischen Klinik am Klinikum Bielefeld - Mitte eingesetzt. Als Jubiläum operierte der Leitende Oberarzt Dr. med. Christoph Barkhausen die rechte Hüfte von Friedhelm Kerz, 69 Jahre.
Vor der Operation hätte er keine Angst, so Kerz: „Ich habe schon schlimmere Operationen hinter mir. Zudem war ich bereits 2019 Patient in der Orthopädie am Klinikum Bielefeld, hier habe ich, ebenfalls mit der Unterstützung des MAKO©-Robotersystems, ein neues Knie bekommen. Mit Dr. Barkhausen habe ich einen sehr kompetenten Operateur, den ich bereits 2019 kennenlernen durfte. Die Auswahl des Arztes ist Vertrauenssache, und da ich damals sehr zufrieden war, komme ich nun wieder.“

„Herr Kerz kann sich in seinem aktuellen Zustand nur unter Schmerzen die Schuhe binden oder Socken anziehen, Bücken ist mehr als problematisch. Als die Schmerzen deutlich zunahmen, kam er zu uns“, so Dr. Barkhausen vor der Operation über seinen Patienten. „Wir haben den MAKO©-Roboterarm in der Vergangenheit nur für die Knieendoprothetik eingesetzt. In diesem Jahr testen wir nun den Ersatz des Hüftgelenks mit dem Roboter, um dies in Zukunft dauerhaft in unser Repertoire zu integrieren“. Dr. Barkhausen ist seit März 2019 Dozent für roboterassistierte Chirurgie und hat bereits international weit über 100 Chirurg*innen im Umgang mit dem System geschult und zertifiziert. Seit 2021 ist das Klinikum Bielefeld ein Hospitationszentrum für roboterassistierte Chirurgie.
Der MAKO©-Roboter wird am Klinikum Bielefeld - Mitte seit 2018 eingesetzt. Damit war das Klinikum Bielefeld das erste Krankenhaus in NRW und das 5. in Deutschland, das den MAKO©einsetzte. Mittlerweile gibt es 7 MAKO©-Roboterarme in NRW und über 30 in Deutschland, weltweit wurden bis heute über 850.000 Eingriffe mit seiner Hilfe vorgenommen.
Der Roboter-Arm operiert nicht selbst, sondern assistiert den Operateur*innen bei ihrer Arbeit – dank seiner Unterstützung können die Ärzt*innen noch präziser operieren und es geht weniger gesundes



Knochengewebe verloren. Mithilfe eines CT wird bereits vor der OP ein dreidimensionales Bild vom Gelenk erstellt. Durch diese 3D-Bilder wissen die Operateur*innen genau, wie die knöchernen Verhältnisse im Gelenk sind und planen anhand dieser Informationen millimetergenau wie das künstliche Gelenk optimal eingesetzt und verankert werden kann.
Nach der Operation sind die Patient*innen dank der schonenden Methode wieder schnell auf den Beinen – das liegt auch an dem „Fast Track“ Konzept, das die Orthopädie in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie, der Pflege und der Anästhesie am Klinikum Bielefeld einsetzt. Mit diesem Konzept werden Patient*innen kurz nach der Operation mobilisiert, sofern es ihr Zustand zulässt. Hierbei werden verschiedene Gangübungen gemacht, die zunächst durch die Physiotherapie begleitet und im weiteren Verlauf der Genesung von dem/der Patient*in eigenständig durchgeführt werden können. Durch die frühe Mobilisierung kommt es zu weniger Komplikationen, geringerem Schmerzmittelbedarf und einer Verbesserung des OP-Ergebnisses.
Auch Friedhelm Kerz wird noch am Tag seiner Operation von Physiotherapeutin Uta Knieps nach dem Fast Track Konzept mobilisiert: „Für uns als Physiotherapeut*innen ist die gewebeschonende Operation mit dem MAKO©-System und der anschließende Einsatz des Fast Track Programms zur schnelleren Mobilisierung der Patient*innen ein echter Gewinn. Die Patient*innen können bereits am ersten Tag wieder stehen“.

Patient Herr Kerz ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich bin sehr überrascht, dass meine Hüfte schon wieder voll belastbar ist. Ich konnte bereits wenige Stunden nach der Operation mit Hilfe eines Gehwagens aufstehen, und das ganz ohne Schmerzen.“
Auch der Operateur Dr. Barkhausen ist zufrieden mit dem Ausgang der 1000. MAKO©-OP am Klinikum Bielefeld: „Die Operation ist sehr gut verlaufen. Durch die Unterstützung des MAKO©-Systems sitzt die Pfanne des Hüftgelenks perfekt. Die Registerzahlen zeigen bereits, dass Gelenke, die mit Hilfe von MAKO© eingesetzt wurden, zu weniger Komplikationen führen. Das ist ein großer Schritt in Richtung Qualitätsverbesserung und ressourcenschonender Nachhaltigkeit.“






MINIMALINVASIVE LUNGENKREBS-OPERATIONEN IN DER THORAXCHIRURGIE
Ein Standard – jetzt mit Verstärkung
Dr. Daniel Valdivia Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am Klinikum Bielefeld - Mitte
Operationen an der Lunge, besonders, wenn es sich um Lungenkrebs handelt, sind eine herausfordernde Aufgabe. Für die Patient*innen war dies meist mit langen Heilungsprozessen, starken Wundschmerzen und langer Liegezeit verbunden. Nicht selten führen diese Faktoren zu Komplikationen und schwerwiegenden Infektionen. Nicht aber im Klinikum Bielefeld: Am Standort Bielefeld - Mitte ist die Klinik für Thoraxchirurgie unter der Leitung von Chefarzt Dr. Daniel Valdivia mittlerweile spezialisiert auf minimalinvasive Eingriffe. Unterstützt wird das Team dabei von Dr. Diego Gonzalez-Rivas, einem der renommiertesten Chirurgen und Entwickler der „UVATS“ Methode, der nun als internationaler Konsilarzt für das Klinikum Bielefeld tätig ist.
In der Klinik von Chefarzt Dr. Valdivia wird standardmäßig minimalinvasiv operiert. Statt den Brustkorb zu öffnen und dann zu operieren, sind inzwischen nur noch kleine Schnitte von wenigen Zentimetern nötig. Diese dienen als Zugänge für eine winzige Kamera und die OP-Geräte. Ein kleiner Schnitt bedeutet auch weniger Schmerzen, ein geringeres Infektionsrisiko, eine schnellere Erholung und einen kürzeren Aufenthalt im Krankenhaus. Nur, wenn ein minimalinvasiver Eingriff nicht möglich ist, wird ein offener Eingriff, also ein größerer Schnitt, in Betracht gezogen. In diesen Fällen wird eine muskelschonende Technik benutzt, um zu ermöglichen, dass die Patient*innen trotz des größeren Schnitts schnell genesen können.
Die UVATS-Methode: gewebeschonende, videoassistierte Operation durch einen einzigen kleinen Schnitt Das Team der Thoraxchirurgie nimmt auch komplexe Operationen routinemäßig uniportal, also durch einen einzigen Einschnitt im Brustkorbbereich, vor.
Durch den kleinen Schnitt kann die gesamte Brusthöhle betrachtet werden. Diese methodische Innovation ermöglicht es, Körpergewebe, Organe und auch Tumore in einer einzigen Operation mit einem einzigen Schnitt zu entfernen.
Entwickelt wurde diese Technik von Dr. Diego Gonzalez-Rivas, der nun auch als internationaler Konsilarzt am Klinikum Bielefeld tätig ist. Der Thoraxchirurg aus dem spanischen La Coruña ist einer der weltweit renommiertesten Chirurgen auf dem Gebiet der Lungenkrebs-Chirurgie.
Diese Technik ist Standard in der Lungenchirurgie der Klinik für Thoraxchirurgie des Klinikums Bielefeld unter der Leitung von Dr. Daniel Valdivia.
Es wurden bereits besonders komplexe Fälle operiert. Zum Beispiel wurde bei einem Patienten Lungenkrebs diagnostiziert, der aufgrund der Lage und Größe des Tumors zunächst mit Hilfe einer Chemotherapie auf eine operable Größe geschrumpft werden musste. Bei der anschließenden Operation in der Klinik von Dr. Valdivia war es besonders wichtig, wegen der eingeschränkten Lungenfunktion so viel gesundes Gewebe wie möglich zu erhalten. Den Tumor zu entfernen und dabei gleichzeitig die Atemwege neu zu rekonstruieren, ist eine der komplexesten Operationen in der Thoraxchirurgie und wird in der Medizin als Manschettenresektion bezeichnet. Dies war durch den Einsatz der UVATS-Methode möglich.
Da bei einem ähnlichen Krankheitsbild oft noch der gesamte betroffene Lungenflügel operativ entfernt wird, unterscheidet sich das Klinikum Bielefeld durch die standardmäßige Anwendung der hochmodernen Operationsmethode UVATS von vielen anderen Kliniken.

Arzneimittelfabrik im Krankenhaus?
Die neuen Reinräume der Krankenhausapotheke –individuelle Maßarbeit unter höchsten Hygienestandards
Dr. Sascha Pretor ApothekerJa, so etwas gibt es! In den neuen Reinräumen der Krankenhausapotheke des Klinikums Bielefeld wurden im Jahr 2021 über 20.000 Zytostatikazubereitungen, also Substanzen, die im Rahmen einer Chemotherapie bei Krebspatient*innen genutzt werden, hergestellt. Und dies geschah patientenindividuell, zeitnah und in höchster Qualität.
Doch was genau ist ein Reinraum? Ein Reinraum unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von einem „normalen“ Raum oder Labor: Erstens wird er kontinuierlich mit Luft belüftet, die mehrere Filterstufen durchströmen muss, wodurch sie von möglichen krankheitserregenden Keimen befreit wird. Zweitens besitzen die Wände und der Fußboden eine sehr glatte Oberfläche und sind somit leicht und gründlich zu desinfizieren. Hier kann sich kein Keim verstecken! Und das ist auch extrem wichtig, denn in einer Zytostatikazubereitung, die direkt über das Patientenblut in den Körper gelangt, dürfen weder Keime noch Partikel enthalten sein. Aus diesem Grund müssen sich die im Reinraum tätigen Mitarbeiter*innen der Apotheke, die Reinigungskräfte eingeschlossen, in keimfreie Spezialkleidung hüllen, um selbst keine Quelle für derartige Verunreinigungen zu sein. Zu guter Letzt wird die Sicherheit noch weiter erhöht, indem die Zubereitungen unter einer sogenannten Sicherheitswerkbank hergestellt werden. Diese baut einen Vorhang aus keim- und partikelfreier Luft auf, der dafür sorgt, dass zum einen die Zubereitung vor Verunreinigungen geschützt wird, zum anderen allerdings auch die herstellende Person vor den in konzentrierter Form zum Teil durchaus aggressiven Substanzen geschützt ist. All diese Vorkehrungen erhöhen die Patientensicherheit auf ein Maximum!
Übrigens: Man findet Reinräume zwar häufig in der Pharmaindustrie, ursprünglich stammt das Konzept aber aus einem ganz anderen Bereich, nämlich der
Elektronik- sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie, um zum Beispiel hochreine Bauteile herzustellen. Ohne Reinräume gäbe es somit auch kein Smartphone!
Aber was genau ist denn eine Zytostatikazubereitung? Zytostatika sind chemische oder pflanzliche Substanzen, die in der Lage sind, Körperzellen zu vernichten oder deren Vermehrung zu verhindern oder zu verzögern. Diese Eigenschaft wird in der Behandlung von Krebserkrankungen in Form von Chemotherapien eingesetzt, damit das Tumorgewebe durch die Zytostatika zerstört wird oder sein Wachstum gehemmt wird.
Damit eine Zytostatikazubereitung hergestellt werden kann, benötigt die Apotheke vom behandelnden Ärzteteam die genaue Dosierung, welche sich in den meisten Fällen nach dem Körpergewicht oder der Körperoberfläche der zu behandelnden Person richtet. Aus diesem Grund gleicht keine Chemotherapie der anderen. Die Körperoberfläche eines Menschen berechnet sich übrigens aus einer komplexen Formel, in die unter anderem das Körpergewicht und die Körpergröße einfließen. Sie liegt zwischen 1,5 bei sehr kleinen und leichten und über 2 Quadratmetern bei großen und kräftigen Menschen. Hieraus wird klar: Die Herstellung von Zytostatikazubereitungen im Klinikum Bielefeld ist kein anonymer Fließbandprozess! Denn vor jeder Herstellung prüft ein/e Apotheker*in noch einmal, ob der Wirkstoff in der angeforderten Dosis zur behandelten Person und ihrer Erkrankung passt. Erst wenn dies alles plausibel ist, erfolgt die Freigabe zur Herstellung im Reinraum. Und da sich die Herstellungsräume im ersten Untergeschoss des Klinikgebäudes befinden, müssen die fertigen Zubereitungen nicht aufwändig kilometerweit transportiert werden, sodass unnötige Wartezeiten für die Patient*innen entfallen.

12 Jahre „HOTH“
Erfolgreiche Kooperation von Fachkliniken und Praxen ermöglicht Endoprothetik-Operationen für Patient*innen im Klinikum Halle/Westf.
Seit über 12 Jahren existiert inzwischen die Kooperation der Abteilungen für Unfallchirurgie von Chefarzt Dr. med. Michael Thiemann im Klinikum Halle/Westf., einem Standort des Klinikums Bielefeld, und der Orthopädischen Klinik im Klinikum Bielefeld - Mitte unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Ludger Bernd. Aus der Idee heraus, Haller Patient*innen vor Ort in Halle operativ mit Endoprothesen und anderen orthopädischen Operationen zu versorgen und ihnen und ihren Angehörigen den Weg nach Bielefeld zu ersparen, entstand die Abteilung, die seitdem unter der klinikinternen Abkürzung „HOTH“ firmiert.

In den letzten 12 Jahren wurden innerhalb dieser Kooperation über 1200 Patient*innen operativ versorgt. Sie erhielten unter anderem 358 Knieprothesen und 438 Hüftprothesen, zahlreiche ambulante und stationäre Gelenkspiegelungen an Schulter und Knie sowie Fußoperationen.
Die Kooperation mit Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich Boudriot, Mitbegründer des Gelenk Center Bielefeld, im Bereich der Knieendoprothesen legte 2015 den Grundstein für weitere mit zahlreichen anderen orthopädischen Kooperationspartnern, wie zum Bei-

spiel Dr. Diab Diab aus der Chirurgischen Praxis Bijan Elahi in Gütersloh, Drs. (NL) Jan Martijn Kooter, Facharzt der Zweigpraxis für Orthopädie in Melle, Prof. Dr. med. Thomas Lichtinger aus dem Gelenk Center Bielefeld und Prof. Dr. med. Norbert Lindner aus dem Facharztzentrum Delbrück, die auf die bereits am Klinikum etablierten orthopädischen Standards aufbauen konnten. Der Standort Halle/Westf. wurde dadurch gestärkt und der neuwertige Operationssaal gut ausgelastet. Die Patient*innen aus der Region ersparen sich zudem eine längere Anreise und können wohnortnah versorgt werden.
Die Kolleg*innen von den Standorten BielefeldMitte und Halle/Westf. arbeiten Hand in Hand: Montags kommt ein Oberarzt aus dem Standort Bielefeld - Mitte in das Klinikum Halle/Westf., um dort in der Notaufnahme das Team zu unterstützen.
In der Regel übernimmt dies Oberarzt Dr. med. Christoph Barkhausen und sieht sich ambulante Patient*innen an, operiert, bearbeitet Konsile und visitiert bereits operierte Patient*innen. In der übrigen Zeit betreut das Team von Dr. Thiemann die Patient*innen auf der Station der Unfallchirurgie.
Die Zusammenarbeit mit dem pflegerischen Team um Stationsleitung Beata Willems schätzen die Bielefelder Orthopäd*innen sehr, da sie mit Leib und Seele gern chirurgisch und sehr zuverlässig arbeiten. Auch in der Weiterbildung unterstützen sich die Bereiche standortübergreifend: Im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie wurden die Bielefelder Kollegen, wie Sergej Becker und Boris Dick, bei Dr. Thiemann und die Haller Kollegen, wie Sarwan Bali und Dan Ciurel, in Bielefeld zum Facharzt weitergebildet. Orhan Kizilpinar kam 2020 als Oberarzt aus Bielefeld zu Dr. Thiemann in die Unfallchirurgie.

Nicht nur die Patient*innen, auch die niedergelassenen Haus- und Fachärzt*innen aus Halle/Westf., Steinhagen, Versmold, Harsewinkel, Gütersloh, Dissen, Borgholzhausen, Werther, Enger und Bielefeld nehmen das Angebot gerne wahr, Patient*innen mit orthopädischen Fragestellungen hier vorzustellen und wenn nötig, operativ versorgen zu lassen. Anschließend geht es zurück zum/zur Fachärzt*in, nach der Operation in die Anschlussheilbehandlung oder in die geriatrische Komplexbehandlung Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Geriatrie am Klinikum Halle/Westf.
 READER
READER
AKTIV GEGEN KREBS
Spendenlauf finanziert Schulungs-Dummy für Patient*innen mit einem Tracheostoma
Carlotta Filius Praktikantin der Unternehmenskommunikation
Eine jährliche Aktion des Klinikums Bielefeld ist der Spendenlauf Aktiv gegen Krebs, bei dem die Teilnehmer*innen an einem Sonntag im Juni gegen eine Spende „rund um das Klinikum“ laufen, in den letzten Jahren fand diese Aktion auf Grund der Pandemie virtuell unter dem Hashtag #aktivgegenkrebsvirtuell in den Sozialen Medien statt. Die dabei von den privaten Teilnehmer*innen gesammelten unterschiedlich großen Spendensummen wurden bereits für verschiedene unterstützende „Angebote für
onkologische Patient*innen im Klinikum Bielefeld“ verwendet.
Mit den Spenden aus 2021 wurde die Anschaffung eines Schulungsmodells für die Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde im Klinikum Bielefeld - Mitte finanziert, in der unter anderem Tumorpatient*innen behandelt werden, die aufgrund ihres Krankheitsbildes ein Tracheostoma erhalten. Im Dezember 2021 erhielt die HNO-Klinik aufgrund

seiner Qualifikation das Zertifikat als Kopf-HalsTumor-Zentrum. Der angeschaffte „Dummy“ dient den Pflegekräften der Station zur Veranschaulichung des richtigen Umgangs mit einem Tracheostoma für Patient*innen sowie Angehörige und wird bereits regelmäßig auf der Station eingesetzt.
Was ist ein Tracheostoma?
Das Wort „Tracheostoma“ ist nicht Jedem sofort ein Begriff, jedoch gibt es viele Menschen in Deutschland wie auch weltweit, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen müssen. Ein Tracheostoma ist eine operativ angelegte Öffnung am Hals, die die Luftröhre mit dem äußeren Luftraum verbindet. Von außen betrachtet ist somit im Hals des/der Betroffenen ein Loch erkennbar. Tracheostoma werden geschaffen, um die Beatmung in bestimmten Situationen sicherzustellen. Dazu wird die Trachealkanüle, ein spezieller Kunststoffschlauch, in das Tracheostoma eingesetzt, durch die die Patient*innen ein- und ausatmen können. Gründe zum Anlegen eines Tracheostomas sind Tumore und Schwellungen nach Operationen im Kopf- und Halsbereich sowie die Prävention von möglichen Schwellungen im Rahmen einer Strahlentherapie. Das temporäre oder dauerhafte Leben mit einer Trachealkanüle bringt viele Herausforderungen für die Betroffenen sowie ihre Angehörigen mit sich.
Leben mit einem Tracheostoma
Welche Fragen und Ängste Patient*innen mit einem Tracheostoma haben, weiß Antonia Olfert. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet seit 2011 auf der Ebene 10 im Klinikum Bielefeld - Mitte, wo Patient*innen der Universitätsklinik für Hals-NasenOhrenheilkunde behandelt werden. Unter anderem absolvierte sie die Weiterbildung zur TracheostomaFachtherapeutin und bietet selbst Schulungen für Mitarbeitende zum Umgang mit einem Tracheostoma an. „Ich arbeite gerne in diesem Beruf und vor allem auch in diesem speziellen Bereich. Man stellt sich jeden Tag der Herausforderung, unsere Patient*innen und deren Angehörige in einer sehr schweren Situation zu unterstützen, zu begleiten, Hilfestellung zu geben und ihnen damit viel Lebensqualität zurückzugeben“, erzählt die 31-Jährige. Schwierigkeiten eines Tracheostomas sind Einschränkungen, die beim Sprechen, Schlucken und Atmen auftreten – Dinge, die Menschen sonst ohne weiteres Nachdenken tun. Außerdem ist das Tracheostoma sowie die Kanüle äußerlich sehr offensichtlich und schwer
zu verstecken, wodurch ein verändertes Selbstbild und Schamgefühle entstehen können. Patient*innen müssen lernen, selbständig damit zu leben und die Fachtherapeutin erklärt, dass Betroffene unterschiedlich schnell verarbeiten können und den Umgang mit einem Trachestoma erlernen. Darum ist es wichtig, individuell auf die Patient*innen und deren Angehörigen einzugehen und dementsprechend Hilfestellung, Beratung und Anleitung anzubieten.
„Dabei ist der Dummy eine große Hilfe, um Patient*innen zu demonstrieren, wie genau eine Trachealkanüle funktioniert, sowie das Vorführen der Tracheostomapflege und das Endotracheal-Absaugen.”
So wird den Patient*innen vor und nach der Operation mit dem Dummy erklärt, was sie wissen müssen – es wird gezeigt, wie beispielsweise eine Trachealkanüle korrekt platziert wird und worin Fehlerquellen bestehen. Der neue Dummy kommt mehrmals wöchent-

lich zum Einsatz. „Mit dem Dummy habe ich ein sehr gutes und leicht verständliches Hilfsmittel an die Hand bekommen. Besonders, da Patient*innen und Angehörige oft medizinische Laien sind und sonst häufig auf ihre Vorstellungkraft zurückgreifen mussten“, erzählt die weitergebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. Des Weiteren kann der Dummy auch für Schulungen von Auszubildenden und neuen Kolleg*innen auf der Station genutzt werden. Somit profitieren nicht nur die onkologischen Patient*innen von dem Erlös des Spendenlaufs, sondern auch Antonia Olfert und ihre Kolleg*innen auf der Ebene 10 im Klinikum Bielefeld - Mitte.

Weitere Projekte, die mit Hilfe der Spendengelder in den letzten Jahren realisiert werden konnten, sind:
X Bewegungsangebote für onkologische Patient*innen in der Akutphase
X Yoga für Brustkrebspatientinnen
X Kochkurse für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen
X eine Broschüre mit Ernährungstipps für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang.
Der Krankenhaussozialdienst am Klinikum Bielefeld
Aufgaben, Schnittstellen und neue Herausforderungen
Daniela König Leitung Sozialdienst am Klinikum BielefeldAm Klinikum Bielefeld unterstützt das Team des Sozialdienstes Patient*innen und ihre An- und Zugehörigen bei einem reibungslosen Übergang in die Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt; z. B. bei einer Aufnahme in ein Pflegeheim oder Bedarf einer Anschlussrehabilitation. Welche Auswirkungen die Pandemie auf diese Aufgabe hatte und wie eine Studie bei der Auswertung dieser helfen soll, lesen Sie in diesem Artikel.
Der Sozialdienst am Klinikum Bielefeld –Ein Unterstützungsangebot für Patient*innen und Angehörige
Die Einrichtung des Sozialdienstes im Krankenhaus ist im Landeskrankenhausgesetz NRW sowie im fünften Buch des Sozialgesetzbuches festgeschrieben und ergänzt die Leistungen der ärztlichen Behandlung und pflegerischen Versorgung um ein umfassendes Beratungsangebot.
Der Krankenhaussozialdienst am Klinikum Bielefeld ist Teil des interdisziplinären Entlassmanagements zum nahtlosen Übergang in den ambulanten Sektor und wird bei Bedarf einer Anschlussversorgung, wie zum Beispiel die Weiterbehandlung in einer RehaKlinik, konsiliarisch eingeschaltet. Im Bereich der Geriatrie, dem Onkologischen Zentrum und in der Palliativbehandlung ist der Sozialdienst ein fester Bestandteil des Behandlungskonzeptes.
Im Team des Sozialdienstes des Klinikums Bielefeld arbeiten an den drei Standorten Bielefeld - Mitte, Bielefeld - Rosenhöhe und Halle/Westf. Sozialarbeiter*innen, Diplom- und Sozialpädagog*innen und Pflegefachkräfte mit den freigestellten Mitarbeitenden der Familialen Pflege zusammen.
Prof. Dr. Anna Lena Rademaker

Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Sozialwesen
Allen Patient*innen des Klinikums steht das Beratungsangebot des Sozialdienstes kostenfrei zur Verfügung. Der individuelle Beratungsbedarf kann sowohl von Patient*innen, deren Angehörigen, durch den ärztlichen Dienst, das Pflegepersonal oder Mitarbeitenden externer Versorgungspartner wie zum Beispiel Pflegeheimen angemeldet werden.
Ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit des Sozialdienstes ist die enge Vernetzung mit anderen Diensten, Behörden und Organisationen im sozialrechtlichen, pflegerischen und rehabilitativen Bereich. Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden gehört ebenso zu den Voraussetzungen einer professionellen Beratung wie der kollegiale Austausch im Arbeitskreis der Krankenhaussozialdienste in der Region.
Das Beratungsangebot des Sozialdienstes Akute Erkrankungen und Notfälle, aber auch chronische Erkrankungen stellen häufig eine besondere Belastung für die Betroffenen und ihre Zu- und Angehörigen dar: die Erkrankung stellt die gesamte Lebenssituation auf den Kopf. Der Sozialdienst berät Patient*innen während des stationären Aufenthaltes zu Themen und Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der Erkrankung auftreten. Häufig stehen Psychosoziale Interventionen, Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, Erstberatung im Falle einer onkologischen Erkrankung, die Bewältigung von Problemen im sozialen Umfeld oder existentielle Krisen und Suchtberatung im Vordergrund. Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden des Sozialdienstes Ansprechpartner*innen für Fragen zu einer gesetzlichen Vertretung im Rahmen einer Betreuung oder Vorsorgevollmacht als auch der Versorgung betreuungsbedürftiger Angehöriger oder der Vermittlung praktischer Alltagshilfen
(z.B. Essen auf Rädern, Hausnotruf, niedrigschwellige Betreuungsangebote).
Auch können im Zusammenhang mit einer akuten oder chronischen Erkrankung wirtschaftliche Probleme auftreten, in deren Fall der Krankenhaussozialdienst beraten und unterstützen kann, zum Beispiel bei der Beantragung von Lohnersatzleistungen, Leistungen des Sozialhilfeträgers, Leistungen für Menschen mit einer Schwerbehinderung oder Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung.
Wenn es einer Anschlussversorgung nach dem Krankenhausaufenthalt bedarf, unterstützt der Sozialdienst die Patient*innen und ihre An- und Zugehörigen bei der Organisation der nachstationären Versorgung, zum Beispiel durch einen ambulanten Pflegedienst, die Versorgung in der stationären Pflege oder Kurzzeitpflege, Leistungen der Haushaltshilfe oder Familienpflege, bei der Überleitung in ein Hospiz oder in stationäre Einrichtungen zur Überwindung sozialer Notlagen wie einer Suchterkrankung oder Obdachlosigkeit und dient als Schnittstelle.
Stellen die Ärzt*innen im Krankenhaus den Bedarf einer Anschlussrehabilitation fest, beauftragen sie den Sozialdienst mit der Planung, Organisation und Antragstellung der Rehabilitationsmaßnahme gemeinsam mit den Patient*innen. So kann, wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind, eine Anschlussheilbehandlung, eine neurologische Frührehabilitation, eine geriatrische Rehabilitation oder auch eine onkologische Rehabilitation aus dem Kran-


kenhaus heraus geplant werden. Auch für ambulante Patient*innen der Strahlenklinik besteht die Möglichkeit, eine onkologische Anschlussheilbehandlung einzuleiten oder dahingehend zu beraten.
Die Beratung durch den Sozialdienst findet nach vorheriger Terminvereinbarung montags bis freitags an den jeweiligen Standorten statt. Die Mitarbeitenden haben auch die Möglichkeit, Patient*innen und/oder ihre Angehörigen direkt im Patientenzimmer zu beraten.
Der Sozialdienst und sein Beratungsangebot ist also umfassend in die vollumfängliche Versorgung der Patient*innen eines Krankenhauses involviert. Fällt dieses Angebot der Unterstützung weg, haben viele Patient*innen und ihre Angehörige kaum bis keine Möglichkeiten, einen problemlosen Übergang in eine, an den Krankenhausaufenthalt anknüpfende, Behandlung zu realisieren – dies kann für den gesundheitlichen Zustand gravierende Folgen haben. Durch die Corona-Pandemie wurde der Sozialdienst des Klinikums vor diese Situation gestellt. Um die Folgen dieser Einschränkungen für die Arbeit des Sozialdienstes und die Versorgung der Betroffenen zu analysieren, hat die Fachhochschule Bielefeld eine Studie gestartet, an der sich auch der Sozialdienst des Klinikums Bielefeld beteiligt.
Aktuelles Forschungsprojekt: postCovid@OWL –
Der Krankenhaussozialdienst im Krisenmodus
Gesundheitliche Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen auf die eigene Lebenssituation bedürfen oft einer psychosozialen und sozialrechtlichen Beratung. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen zur Sicherung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung und der Teilhabe von Erkrankten oder von Erkrankung Bedrohten und Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen in ihrer Lebenswelt deutlich sichtbar gemacht.
Im Rahmen der von der Fachhochschule (FH) Bielefeld in Kooperation mit dem Klinikum Bielefeld und Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) durchgeführten Forschungsstudie „postCOVID@owl“ werden unter der Leitung von Prof. Dr. Anna Lena Rademaker (Fachbereich Sozialwesen FH Bielefeld) die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Soziale Arbeit im Krankenhaussozialdienst untersucht. Im Sinne des Infektionsschutzes wurde zum Beispiel zu Beginn der Pandemie die Möglichkeit zur Kommunikation in bewährter Form sowohl mit Patient*innen und Angehörigen sowie mit Mitarbeitenden innerhalb des Krankenhauses drastisch eingeschränkt. Abstandsregeln und Maßnahmen zur Vermeidung von Kontakten zogen eine Neu-Bewertung notwendiger persönlicher Beratung und möglicher Infektionsgefahr sowohl für Patient*innen als auch Mitarbeitenden im Sozialdienst nach sich. Dies geschah sowohl in dem Bewusstsein, eine angemessene Organisation der Anschlussversorgung für Patient*innen bei größeren Personalausfällen nicht mehr sicherstellen zu können als auch vor dem Hintergrund des individuellen gesundheitlichen Risikos für die einzelnen Mitarbeitenden. Diese Gefahr war vor der Einführung von Impfmöglichkeiten natürlich besonders groß. Darüber hinaus wurde der interprofessionelle Austausch reduziert, Teambesprechungen wurden ausgesetzt und Fallkonferenzen wurden abgesagt. Die Kommunikationsmöglichkeiten mit und über Patient*innen und deren Angehörigen wurde somit auf ein Mindestmaß reduziert. Besuchsverbote in den Krankenhäusern führten wiederum zu einem gesteigerten Informationsbedarf auf Seiten der Angehörigen, der kaum über den Pflegedienst und ärztlichen Dienst abgedeckt werden konnte und zu einer vermehrten Inanspruchnahme des Sozialdienstes geführt hat. Hier hat sich sehr deutlich gezeigt, dass der Sozialdienst eine wichtige kommunikative Schnittstelle zwischen Patient*innen, Angehörigen, Pflegenden und ärztlichem Dienst ist.
Eine weitere Herausforderung zeigte sich bereits in den ersten Monaten der Pandemie und bis heute anhaltend in einer deutlichen Zunahme der Behandlungsfälle mit psychosozialem Beratungs- und Unterstützungsbedarf in der Nachsorgeorganisation. Diese lassen sich einerseits direkt auf die Auswirkungen der Pandemie zurückführen: Kontaktbeschränkungen und somit Wegfall sozialer Unterstützung durch Angehörige, ehrenamtliche und professionelle Dienstleistungen sowie durch Nachbarschaftstreffs. Andererseits wurden bestehende Missstände durch die Pandemie erst sichtbar, die besonders Menschen in instabilen Lebensverhältnissen betreffen, die zur Bewältigung ihres Alltags und Sicherung der Gesundheit oftmals auf soziale Unterstützungssysteme angewiesen sind. Der Bedarf an Unterstützung durch Angebote Sozialer Arbeit im Kontext der Krankenhausbehandlung ist dadurch einmal mehr deutlich geworden.
Das Ziel des Projektes ist, gemeinsam aus der Praxis die aktuelle pandemische Situation sowie ihre Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team zu erforschen.
20 Fachkräfte in Sozialdiensten und Sozialberatungen in OWL haben sich für Expert*innen-Interviews zur Verfügung gestellt, um ihre Expertise und Erfahrungen einzubringen. Zudem dokumentieren sie Situationen ihres Berufsalltags in und nach der Pandemie als Co-Forschende und ermöglichen damit einen Einblick in aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Weiterentwicklung der Beratungs- und Versorgungslandschaft in OWL.
Unter Verwendung der Erkenntnisse in der Praxis soll die Entwicklung neuer und innovativer Konzepte sowie Methoden im Rahmen der pandemischen „Krisenbewältigung“, die Hinweise auf eine auch zukünftig bedarfsgerechte Versorgung, Beratung und Behandlung von Patient*innen nach der Pandemie zulassen, erfolgen. Zudem sollen Indikatoren identifiziert werden, die in der Krise einer Stärkung der interprofessionellen Zusammenarbeit im und Versorgungsqualität durch den Sozialdienst beigetragen haben und die insbesondere mit Blick auf die Soziale Arbeit nach der Covid-19 Pandemie auch langfristig zu einer zukunftsträchtigen Versorgung von Patient*innen beitragen können.
Erste Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden bereits veröffentlicht.
Priv.-Doz. Dr. med. Carolina Pape-Köhler (Chefärztin), Stefanie Wirtz, Dr. med. Beate Herbig (Chefärztin), (v.l.n.r.)

SPITZENMEDIZIN IN DOPPELBESETZUNG
Die Adipositas Klinik am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe
Marlene Flöttmann Unternehmenskommunikation Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Zum 1. Dezember 2021 wurde am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe die Adipositas Klinik gegründet. Die Besonderheit dieser Klinik liegt unter anderem in der Form der Leitung: Die Klinik hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Chefärztinnen. Neben Dr. med. Beate Herbig, die die Klinik seit der Gründung leitet, hat auch Priv.-Doz. Dr. med. Carolina Pape-Köhler seit dem 01.10.2022 die Position als
Chefärztin der Klinik inne. Gemeinsam haben die beiden Chirurginnen langjährige Erfahrung in der Behandlung adipöser Patient*innen.
Dr. Herbig war seit 2012 Chefärztin der von ihr aufgebauten Adipositas Klinik der Schön Klinik in Hamburg. 2021 stellte sie sich der Herausforderung, in Bielefeld das erste Zentrum, das sich ausschließlich
der Behandlung dieser immer weiter verbreiteten Erkrankung Adipositas widmet, aufzubauen. Mit der Neugründung der Adipositas Klinik wurde ein Anlaufpunkt für schwer adipöse Menschen geschaffen, an dem sie sich mit ihren Problemen, Sorgen und Ängsten aufgehoben fühlen und kompetente Hilfe erhalten.
Seit Oktober 2022 verstärkt Priv.-Doz. Dr. med. Carolina Pape-Köhler als weitere Chefärztin die Klinik und leitet diese gemeinsam mit Dr. Beate Herbig. Zuvor hatte Dr. Pape-Köhler die Sektion Adipositaschirurgie der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie des St. Vincenz Krankenhaus Paderborn 2018 gegründet und seitdem geleitet.

Die Medizin wird zwar weiblich, aber der Trend geht bisher ein wenig an den chirurgischen Fächern vorbei. Das Modell der dualen Leitung einer Klinik in Teilzeit mit zwei Chefärztinnen, wie es die Adipositas Klinik nun lebt, ist in dieser Form einmalig und kann als Zukunftsmodell für junge Chirurginnen gesehen werden.
Adipositas ist eine chronische und nicht heilbare Erkrankung, die äußerlich durch eine starke Vermehrung des Körpergewichts auffällt. Um sie zu beschreiben, wird das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße gesetzt. Ab einem errechneten Body Mass Index (BMI) von 30 spricht man von Adipositas. Die Ursachen sind vielfältig und die Gefahr, ernsthafte Folgeerkrankungen zu erleiden, ist sehr hoch: allem voran das Risiko, an Diabetes oder Fettleber zu erkranken. Deutlich erhöht sind auch die Risiken für Herzinfarkt, Schlaganfall oder bestimmte Krebserkrankungen, die dazu beitragen, das schwer adipöse Menschen eine merklich verringerte Lebenserwartung haben.
Die Therapie der Adipositas ist eine Kombination mehrerer Therapiesäulen. Oftmals ist eine AdipositasOperation ein wichtiger zusätzlicher Bestandteil dieser Behandlung und kann helfen, Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Dadurch verbessert sich die Lebensqualität aber auch Lebenserwartung, da sich die Begleiterkrankungen häufig bereits nach kurzer Zeit verbessern. Gerade Diabetiker*innen profitieren sehr von einer solchen operativen Therapie.
Adipositas Klinik
Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe An der Rosenhöhe 27 33647 Bielefeld
Telefon: 05 21. 9 43 - 82 01 E-Mail: stefanie.wirtz@klinikumbielefeld.de
Sprechstundentermine nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 05 21. 9 43 - 82 01
Montags bis donnerstags: 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr Freitags: 08.00 Uhr bis 13:30 Uhr
Schockraumtraining im Krankenhaus
Jeder Handgriff muss sitzen
Axel Dittmar Pressesprecher des Klinikums Bielefeld, Leiter Unternehmenskommunikation

Schwerstverletzte und kritisch kranke Patient*innen, Zeitdruck, Ausnahmezustand: In der Notaufnahme eines Krankenhauses geht es regelmäßig um Leben oder Tod. Seit Jahren ist die Versorgung von schwerstverletzten Patient*innen durch ein Team aus Notfall- und Anästhesiepflegekräften, Unfallchirurg*innen und Anästhesist*innen nach einem festgelegten Schema (Advanced Trauma Life Support) eingeübte und routinierte Praxis. Seit 2022 ganz neu hinzugekommen ist die Ver-
sorgung kritisch kranker Patient*innen im Kreislaufschock aufgrund schwerster internistischer Erkrankungen (z.B. durch blitzartig auftretende Lungenembolien oder Herzinfarkte) im Schockraum der Notaufnahme nach dem ACiLS-Schema (Advanced Critical illness Life Support). Genau wie bei der Versorgung schwerstverletzter Unfallopfer kommt es bei der Versorgung dieser „non-traumaSchockraumpatient*innen“ auf jeden Handgriff und einen reibungslosen Ablauf im Team an.

Aus diesem Grund fand im Jahr 2022 mehrfach ein Non-Trauma-Schockraum-Training der Zentralen Notaufnahmen (ZNA) des Klinikums Bielefeld für die Notfallpflegekräfte und die internistischen Dienstärzt*innen statt.
In die ZNA werden täglich kritisch erkrankte, nichttraumatologische Patient*innen versorgt. Über 500 dieser Patient*innen benötigen eine sofortige Schockraumversorgung in der Notaufnahme mit Beatmung und Kreislaufunterstützung. Zusätzlich werden jährlich bis zu 150 Schwerstverletze – sogenannte polytraumatisierte Patient*innen – in der ZNA Mitte im Schockraum versorgt. Um eine optimale Versorgung und ein bestmögliches Outcome zu gewährleisten, ist eine klar definierte Struktur- und Prozessqualität notwendig.
Die Mitarbeitenden der Zentralen Notaufnahmen trainieren und verinnerlichen beim Non-TraumaSchockraumtraining daher die Abläufe des neuen Versorgungsschemas ACiLS. Davon hängt nicht selten das Leben ihrer Patient*innen ab. Die Simulationssituationen müssen also so nah wie möglich an der Realität sein.

Im Mittelpunkt des Trainings steht das Weißbuch (Leitlinie) der Fachgesellschaft DGINA (Deutsche
Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin). Es gibt Vorträge zur Theorie und dazugehörige praktische Übungen. Dabei steht auch hier das sogenannte ABCDE-Schema im Fokus des Interesses. Verschiedene Fragestellungen zu A wie Airway (Atemweg), B wie Breathing (Beatmung), C wie Circulation (Kreislauf), D wie Disability (neurologisches Defizit) und E wie Exposure/Environment (Erhebung von physischen oder psychischen Krankheitsbefunden) werden durchgesprochen und geübt. Neben dem Umgang mit der NIV-Maske zur nicht-invasiven Beatmung wird an einer Trainingspuppe das Intubieren und die Reanimation geübt.
Insgesamt wird vom Anruf der Einsatzleitstelle mit den ersten Informationen, den Vorbereitungen im Schockraum bis zur Ankunft des/der Patient*in, der Übergabe durch den Rettungsdienst, der Behandlung im Schockraum bis hin zur Übergabe an den OP oder die Intensivstation alle Szenarien durchgespielt.
Da das Schockraumteam aus wechselnden Ärzt*innen und Pflegefachkräften besteht, ist es von enormer Bedeutung, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert und es nicht zu Missverständnissen kommt. Eine wichtige Funktion übernimmt der/die sogenannte Teamleader*in: Er/sie muss jederzeit den Überblick behalten und das fest definierte Schema einhalten, das nach Prioritäten abgearbeitet wird.
Die Übungen in einer sicheren Trainingssituation und der Austausch mit den Kolleg*innen kann im Ernstfall helfen, da die Handgriffe durch die Trainingseinheiten in Fleisch und Blut übergehen. Die Notaufnahme ist durch diese Schulungen der Mitarbeitenden für den Ernstfall bei der Behandlung von Notfallpatient*innen auf der Höhe der Zeit und für den täglichen Ernstfall stets gerüstet.
Das Onkologische Zentrum am Klinikum Bielefeld

Heimatnahe Spitzenversorgung von Krebspatient*innen
Dittmar Pressesprecher des Klinikums Bielefeld, Leiter Unternehmenskommunikation
der Lage, Behandlungsangebote in weit entfernten Behandlungszentren wahrzunehmen. Die heimatnahe Versorgung von schwerkranken Patient*innen hat damit eine neue Entwicklungsstufe erreicht.
Im Frühjahr 2022 wurde das Onkologische Zentrum am Klinikum Bielefeld nach sorgfältiger Vorbereitung als erstes in Bielefeld von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) ausgezeichnet. Diese Zertifizierung bestätigt die höchste medizinische und pflegerische Qualität und das Klinikum Bielefeld kann so die heimatnahe Versorgung von schwerkranken Patient*innen auf einer neuen Entwicklungsstufe leisten.


Die Diagnose Krebs bedeutet für die betroffenen Menschen einen dramatischen Einschnitt in ihr Leben. Sie ruft oftmals existentielle Ängste und Sorgen hervor. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass die Patient*innen eine medizinische und pflegerische Behandlung von höchster Qualität erfahren. Dem Klinikum Bielefeld wurde diese Qualität Anfang 2022 offiziell bestätigt. Mit der Zertifizierung zum Onkologischen Zentrum verbessert sich die medizinische Versorgung krebskranker Patient*innen in Bielefeld und Ostwestfalen nachhaltig. Krebspatient*innen sind oft aufgrund der eingeschränkten Mobilität nicht in
Die Zertifizierung zum Onkologischen Zentrum –was bedeutet sie für die Behandlung der Patient*innen?
Der erfolgreiche Zertifizierungsprozess belegt, dass Patient*innen im Onkologischen Zentrum des Klinikums Bielefeld ganzheitlich und in allen Phasen der Erkrankung auf höchstem Qualitätsniveau behandelt und versorgt werden können. Das Onkologische Zentrum fasst unter einem Dach die bereits bestehenden Organkrebszentren und weitere, an der Behandlung Krebskranker beteiligte Bereiche zusammen: Brustzentrum, Darmkrebszentrum, Magenkrebszentrum, Pankreaskarzinom Zentrum, Gynäkologisches Krebszentrum, Kopf-Hals-Tumorzentrum sind von der DKG zertifiziert und verfügen damit über eine hervorragende Infrastruktur zur interdisziplinären Behandlung von Krebserkrankungen. Unter dem Dach des Onkologischen Zentrums widmen sich die Krebsexpert*innen, die über spezielles Wissen, modernste Geräte und innovative Behandlungsme-

 PANKREASKARZINOM ZENTRUM
KLINIKUM BIELEFELD – MITTE
DARMKREBSZENTRUM
KLINIKUM BIELEFELD – MITTE
PANKREASKARZINOM ZENTRUM
KLINIKUM BIELEFELD – MITTE
DARMKREBSZENTRUM
KLINIKUM BIELEFELD – MITTE
thoden verfügen, noch intensiver der interdisziplinären Kooperation.
Die Standardisierung der Abläufe und Strukturen zieht keine Vereinheitlichung der einzelnen Fälle nach sich - jede Erkrankung wird individuell analysiert. Dafür gibt es die wöchentlichen Tumorkonferenzen, in denen die Erkrankungen der Patient*innen von verschiedenen Expert*innen diskutiert und bewertet werden. Erst nach einer gemeinsamen Einschätzung erfolgt die personalisierte Therapieplanung.
Die vom Krebs betroffenen Patient*innen stehen mit ihren persönlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Behandlung. In einem zertifizierten onkologischen Zentrum muss die Krebsbehandlung immer ganzheitlich sein und der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung aller mit der Krebserkrankung einhergehenden Probleme und Symptome.
Welche Berufsgruppen und Unterstützungsangebote sind im OnkologischenZentrum an der Betreuung der Patient*innen beteiligt?
In den einzelnen Organkrebszentren liegt der Fokus auf der medizinischen Behandlung der Krebserkrankung, bei einem übergeordneten Onkologischen Zentrum kommt dazu aber noch die optimierte Integration von unterstützenden Fachdisziplinen wie Psychoonkologie und Sozialmedizin. Auch die Bedeutung von Ernährungsmedizin und onkologischer Fachpflege ist bei der Betreuung von Krebspatient*innen elementar wichtig und wird in der Regel nur im Rahmen eines zertifizierten onkologischen Zentrums auf professioneller Ebene gewährleistet.
Durch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen kann Patient*innen in allen Phasen der Erkrankung eine weitere wertvolle Unterstützung angeboten werden. Das Klinikum Bielefeld ist bereits seit 2011

als Selbsthilfefreundliches Krankenhaus ausgezeichnet. Eine der kooperierenden Selbsthilfegruppen ist der Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP e.V.), in der sich total Pankreatektomierte und nicht operierte Bauchspeicheldrüsenerkrankte regelmäßig bei ihren Gruppentreffen am Klinikum Bielefeld - Mitte austauschen. Das Onkologische Zentrum bietet den Selbsthilfegruppen den idealen Rahmen für Gruppentreffen und die Möglichkeit, direkt mit Expert*innen in den Austausch zu kommen. Auch können wir als Betroffene Patient*innen mit dem gleichen Krankheitsbild beraten und zur Seite stehen.
Behandlungsparnter*innen des Onkologischen Zentrums nehmen an Forschungsprojekten teil
Darüber hinaus nehmen Zentrumsleitungen und Behandlungspartner*innen an zahlreichen klinischen Studien teil, sodass moderne Therapieformen in der Krebsbehandlung z.B. bei Krebserkrankung der Organe Brust, Magen, Speiseröhre, Darm, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, aber auch bei Erkrankung an Leukämie, Kopf-Hals-Tumoren oder Tumoren im Genitalbereich der Frau angeboten und durchgeführt werden. Somit ist die Behandlung der Patient*innen in vielen Punkten ihrer Zeit ein Stück weit voraus und Patient*innen können von neuesten Therapien profitieren, die über das normale Behandlungsangebot weit hinausgehen.
Die DKG-Zertifizierung bestätigt, dass die Krebstherapie am Klinikum Bielefeld den aktuellen Ansprüchen an die Krebszentren in Deutschland entspricht — und zwar in vollem Umfang. Mit der Zertifizierung endet die Arbeit jedoch nicht. Das haben die Akteur*innen im Rahmen des Prozesses gelernt. Die Zertifizierung ist für das Klinikum eine kontinuierliche Herausforderung. Das hohe Niveau zu halten und weiter zu entwickeln ist eine Verpflichtung, die für Patient*innen gerne eingegangen wird.


Mindestmengen-Transparenzliste der AOK für 2023
Das Klinikum Bielefeld gehört zu den 122 Krankenhäusern in Westfalen-Lippe, die auch im kommenden Jahr 2023 die uneingeschränkte Erlaubnis erhalten haben, Mindestmengen relevante Operationen und Behandlungen mit besonders hohen Risiken für Patient*innen vorzunehmen. Mindestmengen tragen dazu bei, Behandlungsergebnisse zu verbessern und das Risiko von Komplikationen für Patient*innen zu minimieren.
Das Klinikum Bielefeld erbringt an seinen drei Standorten sehr erfolgreich und volumenstark Mindestmengen relevante Eingriffe. Komplexe Kniegelenk-Totalendoprothesen (TEP) werden an den Standorten Mitte, der Rosenhöhe und dem Klinikum Halle/Westf. weit über der geforderten Mindestmenge von 50 Eingriffen pro Jahr und Standort erbracht. Werden die Fallzahlen der Knie-TEPs für alle drei Standorte zusammengefasst, liegt das Klinikum Bielefeld auf Rang 6 von knapp 100 leistungserbringenden Standorten in Westfalen-Lippe.
Am Standort Klinikum Bielefeld Mitte werden komplexe Operationen an der Speiseröhre und komplexe Operationen an der Bauchspeicheldrüse erbracht. In der Rangliste der westfälischen Kliniken rangiert das Klinikum Bielefeld für das Organsystem Pankreas auf Platz 2 von 50 und für das Organsystem Ösophagus auf Rang 4 von 19 Kliniken.

Eine deutliche Konzentration für Leistungen hat es dabei besonders in einem Bereich gegeben: Die Mindestmengen für komplexe Operationen an der Speiseröhre wurden von bisher 10 auf nun 26 Eingriffe pro Jahr angehoben. Die Zahl der leistungsberechtigten Klinikstandorte in WestfalenLippe wurde damit drastisch auf nur noch 17 Standorte reduziert. In Westfalen-Lippe erreichen aber lediglich 5 Kliniken bei komplexen Operationen an der Speiseröhre die neue Mindestmenge, darunter das Klinikum Bielefeld. „Routine steigert Behandlungsqualität“, kommentiert Prof. Dr. Marcel Binnebösel, Chefarzt der Klinik für Allgemein und Viszeralchirurgie am Klinikum Bielefeld Mitte die Veränderungen. „Die Mindestmengenregelung ist ein Schritt hin zur notwendigen Spezialisierung in der Kliniklandschaft in Westfalen-Lippe. Mindestmengen messen Quantität, die in zahlreichen Studien klar den Zusammenhang zur Behandlungsqualität nachweist, Zertifizierungen, wie durch die Deutsche Krebsgesellschaft, messen Qualität und Strukturen in den Zentren. Zusammen sichert die Konzen-
tration und Spezialisierung damit die zu fordernde höchste Behandlungsqualität, ganz im Sinne unserer Patientinnen und Patienten“.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) legt seit 2006 planbare stationäre Leistungen fest, für die Mindestmengen pro Standort eines Krankenhauses oder sogar pro Ärzt*in festgelegt werden. Dabei geht es um Leistungen, für die ein Zusammenhang zwischen Behandlungshäufigkeit und Qualität besteht. Das Ziel ist, anspruchsvolle Leistungen von Krankenhäusern erbringen zu lassen, deren ärztliches Personal genügend Erfahrungen und Routine in der Behandlung haben. Auch Leber- und Nierentransplantationen, Stammzelltransplantationen und die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht von unter 1250 g gehören zu Mindestmengen-relevanten Leistungen. Neu aufgenommen werden komplexe Operationen bei Brust- und Lungenkrebs und der G-BA berät über die Einführung von Mindestmengen für Darmkrebsoperationen.
Die interaktive bundesweite "Mindestmengen-Transparenzkarte" mit allen Kliniken, die im Jahr 2023 Mindestmengen-relevante Behandlungen vornehmen dürfen, ist hier einsehbar.
Erfolgreiche Berufungen
an die Medizinische Fakultät OWL
Das Klinikum Bielefeld ist als Campus Klinikum Bielefeld der Medizinischen Fakultät OWL der Universität Bielefeld Teil des Universitätsklinikums OWL. Bislang haben drei Chefärzte ihren Ruf an die medizinische Fakultät erhalten. Somit sind die von ihnen geführten Kliniken nun universitäre Fachkliniken.
Die Berufungen sind eine Möglichkeit, die Expertise der Mediziner*innen auch in Wissenschaft und Lehre in der Medizinischen Fakultät einzubringen. Zum einen kann den Studierenden ein qualitativ hochwertiges, fundiertes Studium geboten werden, zum anderen bringen die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung für die Patient*innen eine weitere Verbesserung der Behandlungsqualität mit sich.
Bereits im Februar 2021 wurden die ersten beiden Chefärzte, nun Direktoren, des Klinikums Bielefeld zu W3-Professoren berufen. Univ.-Prof. Dr. Martin Rudwaleit, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin und Rheumatologie am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe und Univ.-Prof. Dr. Holger Sudhoff, Direktor der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Klinikum Bielefeld - Mitte sind seitdem Lehrstuhlinhaber der neuen Medizinischen Fakultät OWL.
Im März 2022 erhielt Univ.-Prof. Dr. Christoph Stellbrink, Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Bielefeld - Mitte seine Ernennungsurkunde von dem Rektor der Universität Bielefeld, Prof. Dr. Gerhard Sagerer und der Dekanin der Medizinischen Fakultät, Prof. Claudia Hornberg.
Im Juni 2022 folgte die Berufung von Univ.-Prof. Dr. med. Joachim Feldkamp, Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie am Klinikum Bielefeld - Mitte.
 ANSICHT
READER
ANSICHT
READER
Univ.-Prof. Dr. Martin Rudwaleit Direktor der Universität für Innere Medizin und Rheumatologie am Klinikum Bielefeld - Rosenhöhe
Univ.-Prof. Dr. Holger Sudhoff Direktor der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Klinikum Bielefeld - Mitte
Univ.-Prof. Dr. Christoph Stellbrink Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Klinikum Bielefeld - Mitte


Univ.-Prof. Dr. Joachim Feldkamp Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und Infektiologie am Klinikum Bielefeld - Mitte

Am 5. April 2022 wurde im Klinikum Bielefeld – Mitte durch das Team des Direktors der Universitätsklinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink, erstmalig in NRW ein neuartiges Herzklappensystem implantiert, eine sogenannte TricValve. Weltweit wurden erst 300 solcher Klappen implantiert, in Deutschland gerade einmal 25.
Das System kommt bei sehr schwerer Schlussunfähigkeit einer im rechten Herzen gelegenen Klappe, der Trikuspidalklappe, zum Einsatz -und zwar dann, wenn weder eine Möglichkeit zur Herzoperation noch zu anderen, häufiger durchgeführten Katheterverfahren besteht.
Die TricValve besteht eigentlich aus zwei Klappen, die in die obere und untere Hohlvene eingesetzt werden (Bild) und damit das rechte Herz entlasten. Eingesetzt
werden die Klappen mittels Herzkatheter über die Leiste, also ohne größere Einschnitte am Brustkorb. Entwickelt wurde diese neuartige Klappensystem übrigens in Deutschland und Österreich.
Der 75-jährige Bielefelder Patient, der von Prof. Stellbrink und seinem Team operiert wurde, musste zuvor lange stationär behandelt werden, hing an Infusionsschläuchen und benötigte wiederholte Punktionen, um Wasser aus den Lungen zu ziehen. Leber und Niere waren bereits in Mitleidenschaft gezogen. So war es umso erfreulicher, dass die Operation reibungslos verlaufen ist: „Der Eingriff ist erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen und unser Patient hat sich gut erholt,“ freut sich Oberarzt Priv.-Doz. Dr. Lawrenz, der den Eingriff durchführte. „Früher konnte so schwer kranken Patienten kaum noch geholfen werden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zumindest eine Chance auf
 Auf dem Pressephoto: v.l.n.r.: Juan Serrano (TricValue); Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink, Chefarzt; Norbert Dittert (TricValue); Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Lawrenz, Ltd. OA; Carmen Blaue, Teamleitung Herzkatheterlabor; Dr. med. Kristin Marx, Oberärztin; Benjamin Buck, Stationsarzt.
Auf dem Pressephoto: v.l.n.r.: Juan Serrano (TricValue); Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink, Chefarzt; Norbert Dittert (TricValue); Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Lawrenz, Ltd. OA; Carmen Blaue, Teamleitung Herzkatheterlabor; Dr. med. Kristin Marx, Oberärztin; Benjamin Buck, Stationsarzt.
Abbildung: TricValve®

deutliche Linderung der Beschwerden zu bieten,“ sagt Prof. Stellbrink.
„Aber man sollte natürlich auch vor zu viel Euphorie warnen. Dieses neue Klappensystem kommt nur für wenige Patienten in Frage. Es braucht eine sorgfältige Patientenauswahl und ein gut eingespieltes Team - vor, während und nach der Operation. Jeder Fall wird vorab auch mit unseren herzchirurgischen Partnern im Herzzentrum Bad Oeynhausen besprochen, ob nicht doch ein operatives Vorgehen möglich ist.“
Das Katheter-Herzklappen-Programm am Klinikum Bielefeld ist schon seit mehreren Jahren etabliert, im letzten Jahr wurde die Klinik von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Herzklappenzentrum zertifiziert.
Neuer Präsident der internationalen Politzer-Society

Der Direktor der Universitätsklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Kopf- und Halschirurgie, Universitätsprofessor Dr. Dr. Holger Sudhoff, wurde jetzt in Sao Paulo (Brasilien) zum Vorsitzenden der internationalen Politzer Society gewählt. Prof. Sudhoff ist der erste deutsche Mediziner, der der renommierten Fachgesellschaft vorsitzt und den Kongress der Gesellschaft in Deutschland ausrichten wird.
Univ.-Prof. Sudhoff ist der neue Vorsitzende der internationalen Politzer Society
Die Politzer Gesellschaft trägt den Namen von Adam Politzer (1835-1920). Politzer ist einer der Begründer der modernen Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. Im Jahre 1865 gründete Adam Politzer am Wiener Krankenhaus die erste Abteilung für Ohrenheilkunde. 1895 wurde Politzer in Wien zum ordentlichen Professor für Ohrenheilkunde ernannt und dann auch zum Direktor der Universitäts-Ohrenklinik, welche aus einer Poliklinik und einer kleinen Bettenstation bestand. Die Klinik unter Politzer avancierte zu einer der bedeutendsten otologischen Schulen weltweit.
READER ANSICHT READER ANSICHTGeburtsvorbereitungskurse in Babytown
Die Entbindungsstation Babytown des Klinikums Bielefeld - Mitte bietet regelmäßig Geburtsvorbereitungskurse für werdende Mütter an. Die Kurstermine finden jeweils dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr im Forum in der 12. Etage des Klinikums Bielefeld - Mitte statt. Pro Kurs sind 4 Termine vorgesehen.

Je Kurs sind 10 Teilnehmerinnen möglich (Termine finden ohne Partner statt).
Eine FFP2-Maske ist vom Betreten bis zum Verlassen des Hauses und während der gesamten Veranstaltung zu tragen.
Über aktuelle Hygieneregelungen werden Sie bei der Anmeldung informiert.
Eine FFP2-Maske ist vom Betreten bis zum Verlassen des Hauses und während der gesamten Veranstaltung zu tragen.
Die Anmeldungen erfolgt telefonisch unter: 05 21. 5 81 – 12 30
Veranstaltungsort:
Babytown – 12. Etage
Klinikum Bielefeld - Mitte Teutoburger Str. 50 33604 Bielefeld
Kreißsaalführungen in Babytown

Die Entbindungsstation Babytown in der 12. Etage des Klinikums Bielefeld - Mitte bietet regelmäßig Kreißsaalführungen für werdende Eltern an. Werdende Mütter und ihre Begleitung sind wöchentlich mittwochs um 18:00 Uhr eingeladen, den Kreißsaal und die Mutter-Kind-Station zu besichtigen. Über aktuelle Hygieneregelungen werden Sie bei der Anmeldung informiert. Aktuell ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung unter 05 21. 5 81 – 12 30 möglich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Veranstaltungsort:
Babytown – 12. Etage Klinikum Bielefeld - Mitte Teutoburger Straße 50 33604 Bielefeld

Aqua XXL –Aquafitnesskurse für Adipositas-Patient*innen
Die Adipositas Klinik bietet Aquafitnesskurse für Personen mit starkem Übergewicht an.
Die „Aqua XXL“ Kurse geben übergewichtigen Personen die Möglichkeit, ihre Bewegung wieder zu steigern. Gerade im Wasser wird der gesamte Bewegungsapparat trainiert, sowie Kondition, Herz und Kreislauf. Der Auftrieb im Wasser entlastet Muskeln, Gelenke, die Wirbelsäule und die Bandscheibe.

Die Kurse starten jeweils dienstags und donnerstags um 16:30 Uhr, 17:45 Uhr und 19:00 Uhr (insgesamt 6 Kurse).
Ein Kurs besteht aus jeweils 10 Terminen von 45 Minuten, die in der Physioabteilung auf Ebene U1 des Klinikums Bielefeld - Mitte stattfinden.
Über aktuelle Hygieneregelungen werden Sie bei der Anmeldung informiert.
Die Teilnahmegebühr liegt bei 85 € pro Kurs und Teilnehmer*in. Mitglieder der AdipositasHilfe Deutschland e.V. können vergünstigt mit 75 € teilnehmen.
Terminanfragen:
Stefanie Wirtz
Fachkoordinatorin der Adipositas Klinik E-Mail: stefanie.wirtz@klinikumbielefeld.de Telefon: 05 21. 9 43 - 82 01
Veranstaltungsort: Bewegungsbad, Ebene U1
Klinikum Bielefeld – Mitte Teutoburger Straße 50 33604 Bielefeld
Kurse für pflegende Angehörige und Angehörige von Demenzerkrankten
Im Klinikum Bielefeld - Mitte finden regelmäßig Kurse für pflegende Angehörige und Angehörige von Demenzerkrankten statt. Unter der Leitung der ausgebildeten Gesundheitsund Krankenpflegerin Isabella Kapinos bekommen die Teilnehmer*innen theoretische und praktische Inhalte vermittelt und können vom Erfahrungsaustausch untereinander profitieren.

In den Kursen für Angehörige von Demenzerkrankten wird die kommunikative und die Wahrnehmungskompetenz gestärkt, Biografie-Arbeit besprochen und Umgang mit herausforderndem Verhalten geübt. Ein Kurs besteht jeweils aus drei Terminen mit insgesamt 12 Unterrichtsstunden.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.
Anfragen für Termine und die Anmeldung zum Kurs telefonisch unter 05 21. 581 13 13, mobil unter 01 60. 72 38 27 1 oder per E-Mail an: angehoerigentraining@klinikumbielefeld.de.
Über aktuelle Hygienevorschriften sowie weitere Teilnahmebedingungen werden Sie bei Kontaktaufnahme informiert.
Kommen 11 Container geflogen
Zwei Tage dauerte die Technikshow: Am 28. und 29. Oktober 2022 wurden am Klinikum Bielefeld - Mitte mit Hilfe eines 700 Tonnen und ca. 85m großen Krans insgesamt 11 Operations-Module angeliefert. Diese vormontierten und konfektionierten Container mit je 12,3 Tonnen bis 24,7 Tonnen Gewicht werden auf einen Dachteil des Klinikums Bielefeld - Mitte an der Teutoburger Straße gestellt. In den kommenden Monaten werden die Container zu zwei vollwertigen Operations-Sälen mit entsprechendem hochwertigen OP Licht sowie umweltfreundlicher OP Lüftungstechnik ausgebaut und erhalten einen sterilen Zugang zum bereits bestehenden Zentral-OP im Klinikum Mitte. Diese Maßnahme ist erforderlich, um die Operations-Kapazitäten im Klinikum Bielefeld - Mitte dauerhaft auszubauen.


IMPRESSUM
Herausgeber
Klinikum Bielefeld gem. GmbH Unternehmenskommunikation
Teutoburger Str. 50 | 33604 Bielefeld info@klinikumbielefeld.de
Geschäftsführer Michael Ackermann
Verantwortlich für den Inhalt
Axel Dittmar, Kliniksprecher Redaktion
Axel Dittmar, Jasmine Gabriel, Sandra Knicker, Dr. med. Ekaterina Stellbrink, Dr. med. Thomas Groß, Dilani Narendra, Denise
Scheulen, Marlene Flöttmann, Dr. med. Christoph Barkhausen, Dr. Daniel Valdivia, Dr. Sascha Pretor, Carlotta Filius, Daniela König, Prof. Dr. Anna Lena Rademaker
Bildnachweis
Steffi Behrmann | Klinikum Bielefeld (5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, U4)
Stryker (16–18), Dr. Sascha Pretor (22), Foto Liebert (23), © FH Bielefeld (29), TricValve® (41) stock.adobe.com
Konzeption und Gestaltung screen concept - runge
UNSERE KOMPETENZ FÜR IHRE GESUNDHEIT
KLINIKUM BIELEFELD - MITTE
Teutoburger Straße 50 - 33604 Bielefeld Patienteninformation | Zentrale: Telefon: 05 21. 5 81 - 0
\ Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie Univ.-Prof. Dr. med. Joachim Feldkamp Tel.: 05 21. 5 81 - 35 01
\ Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Prof. Dr. med. Marcel Binnebösel Tel.: 05 21. 5 81 - 38 01
\ Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie Dr. med. Kai Johanning Tel.: 05 21. 5 81 - 30 01
\ Brustzentrum Priv.-Doz. Dr. med. Sebastian Wojcinski Tel.: 05 21. 5 81 - 32 52
\ Zentrum für Frauenheilkunde Prof. Dr. med. Werner Bader Tel.: 05 21. 5 81 - 32 01
\ Klinik für Gastroenterologie Prof. Dr. med. Jan Heidemann Tel.: 05 21. 5 81 - 39 01
\ Klinik für Gefäß- und EndovaskularChirurgie Dr. med. Ralf-Gerhard Ritter Tel.: 05 21. 5 81 - 30 51
\ Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin und Stammzelltherapie Priv.-Doz. Dr. med. Martin Görner, MBA Tel.: 05 21. 5 81 - 36 01
\ Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Holger Sudhoff, FRCS (Lon), FRCPath (Lon) Tel.: 05 21. 5 81 - 33 01
\ Universitätsklinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink Tel.: 05 21. 5 81 - 34 01
\ Klinik für Nuklearmedizin Dr. med. Stephan Block Priv.-Doz. Dr. med. Bernd Nowak Tel.: 05 21. 5 81 - 27 50
\ Orthopädische Klinik Prof. Dr. med. Ludger Bernd Tel.: 05 21. 5 81 - 31 31
\ Unfallchirurgische Klinik Dr. med. Alexander Rübberdt Tel.: 05 21. 5 81 - 31 11
\ Institut für Pathologie Priv.-Doz. Dr. med. Frank Brasch Tel.: 05 21. 5 81 - 28 01
\ Gemeinschaftspraxis für Pathologie Priv.-Doz. Dr. med. Frank Brasch Dr. med. Thomas Heymer Tel.: 05 21. 5 81 - 28 01
\ Klinik für Plastische, Wiederherstellungsund Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie Dr. med. Onno Frerichs und Prof. Dr. med. Hisham Fansa Tel.: 05 21. 5 81 - 39 51
\ Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin Dr. med. Bertram Ruprecht Tel.: 05 21. 5 81 - 35 71
\ Institut für Diagnostische Radiologie Prof. Dr. med. Hans-Björn Gehl Tel.: 05 21. 5 81 - 27 01
\ Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie Priv.-Doz. Dr. med. Hendrik Dapper Tel.: 05 21. 5 81 - 29 01
\ Klinik für Thoraxchirurgie Dr. Daniel Valdivia Tel.: 05 21. 5 81 - 38 51
KLINIKUM BIELEFELD - ROSENHÖHE An der Rosenhöhe 27 - 33647 Bielefeld Patienteninformation | Zentrale: Telefon: 05 21. 9 43 - 0
\ Adipositas Klinik Dr. med. Beate Herbig Priv.-Doz. Dr. med. Carolina Pape-Köhler Tel.: 05 21. 9 43 - 82 01
\ Klinik für Allgemeinchirurgie und Koloproktologie Prof. Dr. hc (TashPMI) Dr. med. habil. Mathias Löhnert Tel.: 05 21. 9 43 - 81 01
\ Augenklinik Prof. Dr. Maged Alnawaiseh Tel.: 05 21. 9 43 - 85 01
\ Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie Prof. Dr. med. Isaak Effendy Tel.: 05 21. 9 43 - 88 01
\ Geriatrische Klinik Dr. med. Wolfgang Schmidt-Barzynski Tel.: 05 21. 9 43 - 87 01
\ Universitätsklinik für Innere Medizin und Rheumatologie Univ.-Prof. Dr. med. Martin Rudwaleit Tel.: 05 21. 9 43 - 83 01
\ Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. med. Mark Schildknecht Tel.: 05 21. 9 43 - 85 51
KLINIKUM BIELEFELD - HALLE/WESTF. Winnebrockstr. 1 - 33790 Halle (Westfalen) Patienteninformation | Zentrale: Telefon: 0 52 01. 1 88 - 0
\ Klinik für Allgemeinchirurgie Dr. med. Michael Feltkamp Tel.: 0 52 01. 1 88 - 95 51
\ Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie Dr. med. Kai Johanning Tel.: 0 52 01. 1 88 - 96 01
\ Belegklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. med. Thilo Bosse Tel.: 0 52 01. 16 16 1 Dr. med. Tatjana Geist Tel.: 0 52 01. 22 10 Dr. med. José M. Gonzalez Fernandez Tel.: 0 52 03. 73 33
\ Hebammen / Kreißsaal Tel.: 0 52 01. 1 88 - 96 40
\ Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Geriatrie Tel.: 0 52 01. 1 88 - 94 01 Dr. med. Markus Brückner
\ Klinik für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin Dr. med. Jörg Schmitthenner Tel.: 0 52 01. 1 88 - 94 51
\ Schlafmedizinisches Zentrum (DGSM) Dr. med. Jörg Schmitthenner Tel.: 0 52 01. 1 88 - 91 70
\ Klinik für Unfallchirurgie Dr. med. Michael Thiemann Tel.: 0 52 01. 1 88 - 95 01
Der Newsroom des Klinikums Bielefeld
UNSERE SOCIAL MEDIA-KANÄLE




Folgen Sie uns! Erhalten Sie bequem alle News, aktuelle Jobangebote u.v.m.
UNSERE BLOGS

Informieren Sie sich über medizinische Themen im Visite-Blog oder in der Sendung Pulsschlag bei Radio Bielefeld, Erfahren Sie alles zum Thema Geburt und den ambitionierten Neubau am Standort Bielefeld - Mitte.

Schauen Sie vorbei, hören Sie rein!





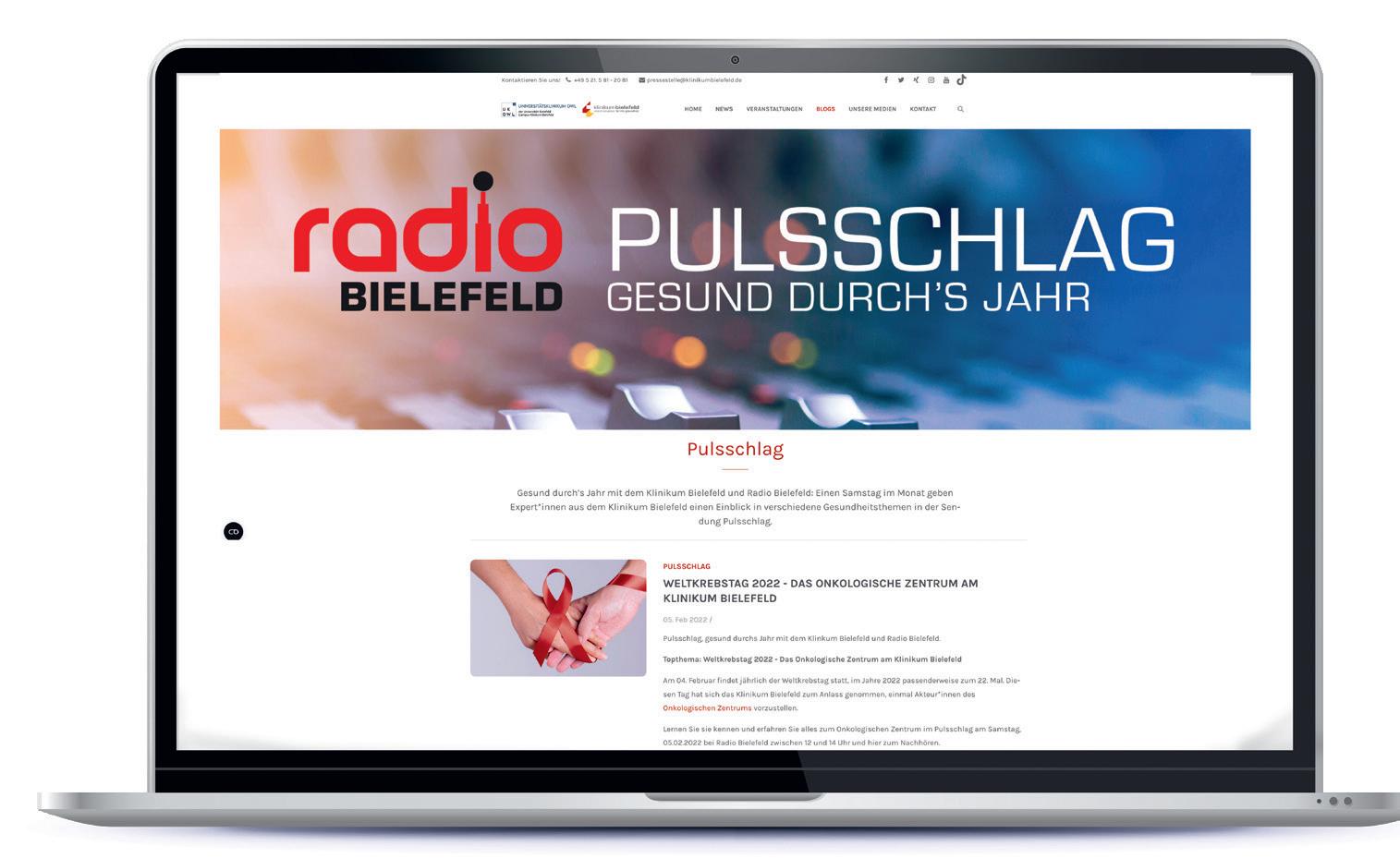


Klinikum Bielefeld gem.GmbH
Teutoburger Straße 50, 33604 Bielefeld info@klinikumbielefeld.de www.teildesganzen-alltagshelden.de

instagram.com/klinikum_bielefeld facebook.com/klinikumbielefeld twitter.com/klinik_news youtube.com/user/KlinikumBielefeld/videos

