58 Prozent der Tschechen sind mittlerweile gegen eine Ausweitung der militärischen Unterstützung der Ukraine, hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Insbesondere Frauen und Senioren würden weitere Waffenlieferungen kritisch beurteilen.
Je nach politischem Lager ist die Solidarität mit der Ukraine unterschiedlich ausgeprägt. So lehnen 93 Prozent der Wähler der Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) eine Aufstockung der Waffenlieferung ab, ebenso wie 81 Prozent der Anhänger von Präsidentschaftskandidat Andrej Babiš (Partei Ano). Hingegen äußerten die Anhänger von Präsidentschaftskandidat Petr Pavel, der Piraten oder der Bürgermeisterpartei Stan ihre Zustimmung für mehr Militärhilfe. Konkret waren 36 Prozent der Befragten dafür, darunter vor allem junge Menschen mit Hochschulbildung.
In den Zahlen zeige sich der Einfluß des Wahlkampfes von Babiš und Pavel, kommentiert Median-Chef Přemysl Čech das Ergebnis.
Der stellvertretende Verteidigungsminister Jan Jireš reagierte in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf die Studie. Er äußerte Verständnis dafür, daß die Menschen in der Frage der Waffenlieferungen vorsichtig seien. Für sein Ressort gelte dabei auch immer die Maxime, daß die Abwehrfähigkeit Tschechiens nicht verringert werde. Außer Waffen und Gerät brauche die Ukraine Ausbildungsangebote, so Jireš. Hier sei Tschechien sehr aktiv, erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister: „Bis Ende dieses Jahres sollen hierzulande bis zu 4000 ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Dies halte ich für einen sehr wichtigen Teil des gesamten westlichen Hilfspakets.“ Den Wert der bisherigen Waffenlieferungen an die Ukraine beziffert das Verteidigungsministerium auf mehr als drei Milliarden Kronen (130 Millionen Euro).


„Ich habe dem Bundeskanzler versichert, daß Tschechien seine internationalen Verpflichtungen einhalten wird“, hat Premierminister Petr Fiala nach dem Treffen mit dem deutschen Regierungschef Olaf Scholz am Dienstag in Berlin erklärt. Im Gegensatz zu Polen will Tschechien keine deutschen Leopard2-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben, sondern damit die eigene Verteidigungsbereitschaft stärken.



Im Sommer hatten Scholz und Fiala in Prag einen Ringtausch vereinbart. Demnach erhält Tschechien 14 deutsche Leopard-2-Kampfpanzer und einen Bergepanzer Büffel als Ausgleich für an die Ukraine gelieferte T72Panzer sowjetischer Bauart. Der erste Panzer vom Typ Leopard 2A4 wurde im Dezember geliefert. Die weiteren Kampfpanzer will der Hersteller Rheinmetall, so der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger, bis zum Frühjahr zur Verfügung stellen. Bei seinem dritten Besuch seit der Amtsübernahme im Dezember 2021 kündigte Fiala an, die Verteidigungsbereitschaft Tschechiens mit zusätzlichem
Kriegsgerät aus Deutschland zu stärken. „Wir sind am Kauf weiterer Leopard-2-Kampfpanzer interessiert, die einen bedeutenden Teil der Modernisierung unserer Armee darstellen werden“, twitterte Fiala.
Außerdem unterstrich Fiala die Notwendigkeit, einen europäischen Raketenabwehrschirm aufzubauen. Dem von Deutschland initiierten Projekt haben
sich bereits 14 Länder angeschlossen, darunter die Tschechische Republik und die Slowakei. Weitere Themen beim Gespräch der Regierungschefs waren die Sicherung der Energieversorgung und der Wunsch Tschechiens, über Terminals in Deutschland Flüssiggas importieren zu können. Fiala: „Die Tschechische Republik hat ein strategisches Interesse daran,
Mit einem Neujahrskonzert des weltberühmten Wihan Quartetts aus Prag ist das Sudetendeutsche Haus ins Kulturjahr 2023 gestartet. Gastgeber war der Freundeskreis Teplitz-Schönau in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband.
Unter den Gästen, die sich dieses hochkarätige Konzert nicht entgehen lassen wollten, war Dr. h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt München und Trägerin des Europäischen


Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie zahlreicher weiterer Auszeichnungen als Brückenbauerin und engierte Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte.
Ebenfalls unter den Konzertbesuchern war Dr. Otto Wiesheu, der langjährige Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr.


Beide Persönlichkeiten wurden von Gastgeber Erhard Spacek vom Freundkreis TeplitzSchönau sowie vom SL-Bundeskulturreferenten Prof. Dr. Ulf Broßmann und SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch begrüßt. Mehr über den großen Abend: Seite 7
die Kapazitäten der deutschen Terminals nutzen zu können. Ich denke hier insbesondere an das Terminal in Lubmin. Dieser Standort ist für uns von Vorteil, weil er an die tschechische Energieinfrastruktur angeschlossen ist.“ Tschechien sei bereit, sich am Betrieb dieses Terminals zu beteiligen. Fiala: „Ich habe heute mit dem Bundeskanzler vereinbart, daß von Lubmin bereits in
In Berlin traf sich Fiala auch mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Friedrich Merz, der den tschechischen Regierungschef in den Bundestag eingeladen hatten. Auch bei diesem Gespräch ging es um die Themen Energie und Sicherheit.



Andrej Babiš berichtet von Morddrohungen

Am Dienstag wollte Präsidentschaftskandidat Andrej Babiš in Königgrätz bei einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. Doch der Ano-Chef sagte kurzfristig alle Termine ab und erklärte auf einer Pressekonferenz, der Grund sei eine gegen ihn gerichtete Morddrohung.
Bereits am Samstag hatte Babiš für Schlagzeilen gesorgt, als er – ebenfalls in einer Pressekonferenz – erklärte, seine Ehefrau Monika Babišová habe einen Drohbrief mit einer Patrone erhalten.
Die Sprecherin der Polizei im Kreis Mittelböhmen, Barbora Schneeweissová, bestätigte die Anzeige und sagte der Presseagentur ČTK, die Ermittler würden sich derzeit mit der Postsendung befassen. Schneeweissová zufolge habe Babiš die Sendung am Donnerstag erhalten und am Samstag darüber informiert. Der Gegenstand, der wie eine Patrone aussehe, werde derzeit von einem Experten untersucht, so die Sprecherin.

Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag findet in Tschechien die Stichwahl zwi-
schen Andrej Babiš und General Petr Pavel um das Amt des Staatspräsidenten statt.
Auch Pavel hatte kurzfristig Wahlkampftermine im Endspurt absagen müssen, allerdings wegen einer schweren Erkältung.
In den letzten Meinungsumfragen hatte Pavel deutlich in Führung gelegen. So prognostizierte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 58,8 Prozent für Pavel und 41,2 Prozent für Babiš.



Höhepunkt des Wahlkampfendspurts war eine Fernsehdebatte am Sonntagabend. Dabei kam es zwischen den beiden
Kontrahenten zu einem heftigen Streit. Auslöser war die Frage, ob Tschechien sich als NatoMitglied an seine Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 halten werde, wenn zum Beispiel Polen von Rußland angegriffen würde.

Babiš sagte dazu, er würde keine tschechischen Soldaten entsenden, und erklärte wörtlich: „Nein, sicher nicht. Ich will Frieden und nicht Krieg. Ich würde keinesfalls unsere Kinder, also die Kinder unserer Frauen, in den Krieg schicken.“
Petr Pavel erläuterte daraufhin das Prinzip der Nato und die dar-
aus folgenden Pflichten der Mitgliedsstaaten: „Wenn ein Mitglied angegriffen wird, kommen ihm die anderen zu Hilfe. Das ist in Artikel 5 enthalten. Wenn wir schon Mitglied einer solchen Organisation sind, folgen daraus im Rahmen der kollektiven Sicherheit für uns nicht nur Vorteile, sondern auch Verpflichtungen.“





Die Aussage von Andrej Babiš, dem Nachbarn Polen bei einem russischen Angriff nicht beizustehen, hatten bereits unmittelbar nach der Debatte in den polnischen Medien für Empörung gesorgt. Torsten Fricke

Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung „Ehrensache Ehrenamt“ – Teil zwei der neuen Serie (Seite 5) ❯ Tschechiens Regierungschef hat sich erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen Premierminister Fiala setzt auf deutsche Leopard-2-Kampfpanzer Jahrgang 75 | Folge 4 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 27. Januar 2023 Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de B 6543 Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Sudetendeutschen Landsmannschaft Zeitung Neudeker Heimatbrief Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Neudeker HeimatbriefZeitung VOLKSBOTE Heimatbrief HEIMATZEITUNGEN IN DIESER AUSGABE ❯ Hochkarätiges Konzert im Sudetendeutschen Haus Fulminanter Start in das neue Kultur-Jahr ❯ Umfrage Weniger Rückhalt für Ukraine
-Ein friedvolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in das Jahr 2023
Im Sudetendeutschen
Haus (von links): Erhard Spacek vom Freundeskreis Teplitz-Schönau, SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch, Karls-Preisträgerin Dr. h. c. Charlotte Knobloch, SL-Bundeskulturreferent Professor Dr. Ulf Broßmann und der ehemalige Staatsminister Dr. Otto Wiesheu. Foto: Hildegard Schuster
Sudetendeutsche Zeitung VOLKSBOTE HEIMATBOTE Neudeker Heimatbrief
der nächsten Heizperiode Gas in die Tschechische Republik fließen kann.“
Torsten Fricke
Bundeskanzler Olaf Scholz und Tschechiens Premierminister Petr Fiala trafen sich zum dritten Mal in Berlin. Fotos: Twitter Petr Fiala CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz lud Tschechiens Premierminister Petr Fiala in den Bundestag ein. ❯ Präsidentschaftskandidat sagte kurzfristig
Wahlkampfauftritte ab
AUS UNSEREM PRAGER BÜRO
Die Tschechische Republik hat einen neuen ersten stellvertretenden Umweltminister, Petr Hladík, der schon jetzt die Arbeit des fehlenden Ministers vollumfänglich ausübt. Wahrscheinlich wird er selbst die höchste Stelle in diesem Amt übernehmen, nachdem der neue Staatspräsident im März vereidigt ist.
Hladík (38) ist ein alter Freund des Prager Sudetendeutschen Büros und somit unserer gemeinsamen Anliegen. Der Christdemokrat war bis 2015 Vorsitzender der KDU-ČSLJugendorganisation „Mladí lidovci“ (Junge Volkspartei), heute ist er stellvertretender Vorsitzender




dieser Partei republikweit. Hladík ist außerdem passionierter Sportler, Initiator zahlreicher umweltpolitischer Maßnahmen in seiner Stadt und aktiver Christ. Er ist bei fast allen Versöhnungsmärschen in Brünn – die die umgekehrte Route der Vertriebenen gehen und von der Initiative „Meeting Brno“ veranstaltet werden – mit dabei. Oft tritt er dort auch als Redner auf. Für SL-Büroleiter Peter Barton organisierte er das Tre en mit dem südmährischen Hauptmann Jan Grolich (KDU-ČSL) kurz nach dessen Wahl. Barton fotogra erte Hladík zusammen mit David Macek (Meeting Brno) und Jan Grolich (rechts) am 23. Juli vorigen Jahres auf einem Brünner
Platz, wo sich nachmittags die Teilnehmer dieser Versöhnungsveranstaltung traditionell tre en. Der SL-Büroleiter freut sich, daß die Sudetendeutschen in Hladík eine Per-



sönlichkeit gefunden haben, die sich stets mit Überzeugung für die Verständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen einsetzt.
Mehr Vertrauen in die Politik
Das Vertrauen der Tschechen in die Politiker des Landes ist gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM hervor. Demnach hätten Ende letzten Jahres mehr Menschen Vertrauen gehabt, als noch im Vorjahresvergleich. Nach wie vor geben jedoch weniger als 40 Prozent der Befragten an, der Regierung, dem Abgeordnetenhaus sowie dem Staatspräsidenten zu vertrauen. Am größten ist mit 70 Prozent das Vertrauen in die Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte. Dem aktuellen Staatspräsidenten Miloš Zeman sprachen in der Umfrage 38 Prozent ihr Vertrauen aus, der Regierung 34 Prozent und den Abgeordneten 33 Prozent.
Vier tschechische Filme bei Berlinale B
gen gewesen. Vrabel hat im November vergangenen Jahres in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem er sagte, Tschechien plane, mit Kampfjets Rußland anzugreifen und Atombomben abzuwerfen. Vrabel war einer der Organisatoren der Proteste gegen die Regierung, denen sich im vergangenen Herbst teils mehrere Zehntausend Menschen angeschlossen hatten. Am Samstag veranstaltete er erneut eine Demonstration des Bündnisses ČR na 1. místě (Die Tschechische Republik zuerst).
Panzer aus Marokko für die Ukraine
Eine Idee beim Bier wird zum großen Nepomuk-Projekt
Kurz vor Weihnachten beschloß der als Fernseh-Wettermoderator bekannte Jörg Kachelmann seine wiederholte, diesmal vierjährige Tätigkeit als Moderator der Leipziger Talksendung „Riverboat“ mit einem Kehraus mit vielen Weggefährten der vergangenen Jahre im Mitteldeutschen Rundfunk. Unter seinen Gästen war auch Klaus Franke aus Breitenbrunn, das ganz nah an der sächsisch-tschechischen Grenze liegt, mit dem Kachelmann als privater WetterdienstUnternehmer vor Jahren eine meteorologische Wetterstation eröffnete und auch sonst gut befreundet blieb.


Franke, der Vorsitzender des 1990 wiedergegründeten Erzgebirgsvereins von Breitenbrunn ist, ließ im Gespräch viele Aktivitäten in seiner Heimat Revue passieren. Dann kam er auf die deutsch-tschechische, sächsischböhmische Nachbarschaft, die gerade im Erzgebirge seit dem EU-Beitritt Tschechiens wieder stark belebt wird, zu sprechen. Breitenbrunn hat als einen Ortsteil auch Halbemeile mit vier Häusern. Dieser Ort hatte auch einen böhmischen Teil, der jedoch mit der Vertreibung und der Zerstörung aller Häuser und auch der Nepomuk-Kapelle von 1830 im Jahre 1953 und der Errichtung von Grenzanlagen völlig zerstört wurde. Daß diese Nepomuk-Kapelle vor knapp zehn Jahren wieder errichtet wurde, verdankt sich der Hartnäckigkeit von Klaus Franke, der 2014 selbst in der Sudetendeutschen Zeitung darüber schrieb und der auf seine erzgebirgische Art die Entstehung dieses deutsch-tschechischen Versöhnungswerkes den Fernsehzuschauern einen Tag vor dem Heiligen Abend 2022 näherbrachte.
Jörg Kachelmann fragte Klaus Franke: „Warum wolltest Du unbedingt die Kapelle bauen?“
Franke begann zu erzählen: „Der Erzgebirgsverein Breitenbrunn macht jedes Jahr seine Himmelfahrtswanderung traditionell ins Böhmische. Zwischen Breitenbrunn und Abertham ist Halbemeile dann Zwischenstation. Da steht eine alte Bank, ein Grashügel mit einer Fichte darauf, dort haben wir immer das erste Bier aufgemacht an Himmelfahrt, am Männertag. Einmal saß ein alter Herr, der leider bereits verstorben ist, neben mir und tippte mich an: ,Klaus, hier war ’ne Kapelle. Schade, daß sie kaputt ist. Als Kind hab ich noch reingeguckt. Da war so ’ne grüne Tür mit einem Guckloch. Und der Nepomuk drinne.‘ Ein Jahr darauf machten wir wieder eine Himmelfahrtswanderung, wieder gab‘s in Halbemeile das erste
Bier, und wieder saß der Mann neben mir. ,Klaus, hier war ’ne Kapelle. Schade, daß sie kaputt ist.‘ ,Na dann müssen wir sie eben wieder aufbauen‘, antwortete ich spontan beim Bier. ,Denkste?’, erwiderte der alte Herr. ,Ja. Ich kenne den Bürgermeister Jan Horník von Gottesgab/Boží Dar. Deutsche Mutter, tschechischer Vater, beste Mischung. Und wir haben da drüben öfter mal ein Fest, und da sprechen wir miteinander.’“
Klaus Franke hielt Wort und sprach den Bürgermeister bei der nächstbesten Gelegenheit an. Der machte durchaus Hoffnung. Ohne Förderung wäre dieses Projekt zwar nicht realisierbar, aber wenn es EU-Gelder gäbe, könnte es klappen. Dennoch vergingen sechs, sieben Jahre.
„Meine Frau und insbesondere mein Sohn wendeten immer wieder ein, ich solle eine Kapelle nicht in der Pampas bauen, sondern besser in Breitenbrunn.“


Doch Franke gab nicht auf, sammelte über die Jahre bei Abrißarbeiten, die seine Firma durchführte, altes Baumaterial und setzte sich selbst ein Ziel: „Bis zu meinem 60. Geburtstag habe ich die Kapelle gebaut –ob mit oder ohne Förderung.“
Als dann der Bürgermeister meldete, daß über ein EU-Programm eine Förderung möglich sei, ging es los. Mittlerweile steht die Kapelle seit fast einem Jahrzehnt. „Nächstes Jahr feiern wir das zehnjährige Jubiläum und planen ein Fest auf der Halbemeile.“
Ulrich Miksch

ei der Berlinale werden dieses Jahr auch vier Filme mit tschechischer Beteiligung gezeigt. Dazu gehört die Groteske „Sedmikrásky“ (Tausendschönchen) von Věra Chytilová aus dem Jahr 1966, die in der Sektion „Retrospektive“ laufen wird. Außerdem ist der animierte Kurzfilm „Deniska umřela“ (Dede ist tot) des Studenten Philipp Kastner von der Prager Filmhochschule Famu zu sehen. Zwei weitere Filme entstanden in tschechischer Koproduktion und haben es auf die Berlinale geschafft. Es sind die Dokumentation „Eastern Front“ von Vitaly Mansky und Yevhen Titarenko und der experimentelle Dokumentarstreifen „Poznámky z Eremocénu“ der Regisseurin Viera Čákanyová. Die 72. Berlinale läuft vom 16. bis 26. Februar. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin zählen neben denen von Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt.
Kampf gegen Falschmeldungen
Am Rande einer Demonstration in Prag hat die Polizei den Organisator der Veranstaltung, Ladislav Vrabel, festgenommen, berichtet das Nachrichtenportal iDnes.cz. Grund hierfür sei die Verbreitung von Falschmeldun-

I

n Tschechien sind von der Firma Excalibur im mährischen Sternberg 20 Panzer modernisiert worden, die Marokko an die Ukraine liefert, hat die englische Zeitung The Guardian berichtet. Dabei soll es sich um Panzer vom sowjetischen Typ T-72 handeln. Marokko ist das erste afrikanische Land, das die Ukraine militärisch unterstützt.
Deutlich mehr illegale Migranten
D

ie Zahl der illegalen Migranten, die von der tschechischen Polizei aufgegriffen wurden, ist im vergangenen Jahr um 160 Prozent angestiegen, haben Polizeipräsident Martin Vondrášek und Fremdenpolizeichef Milan Majer in Prag bekannt gegeben. Insgesamt wurden über 29 000 Menschen aufgegriffen, 18 000 mehr als noch 2021. Wegen des starken Flüchtlingsansturms hat Tschechien zu Ende September Kontrollen an der Grenze zur Slowakei eingeführt. Bei diesen wurden 9400 Flüchtlinge aufgedeckt.
Punk-Musiker stirbt mit 55
Der tschechische Punk-Musiker Petr Hošek ist tot. Der Frontmann der Band Plexis starb im Alter von 55 Jahren, hat die Presseagentur ČTK am Montag berichtet. Hošek wurde in Prag geboren. 1984 gründete er Plexis und war dort Sänger und Baßgitarrist. Erst nach der politischen Wende von 1989 konnte die Band jedoch ihr erstes Album veröffentlichen.
Sudetendeutsche Zeitung
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.
Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.
Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.
© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.
Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 01. 2023 2
PRAGER SPITZEN
❯ Klaus Franke erzählt in der MDR-Talksendung „Riverboat“, wie er eine Kapelle in Böhmen wieder aufgebaut hat
TV-Moderator Jörg Kachelmann lauscht in seiner letzten „Riverboat“-Sendung Talkgast Klaus Franke, wie er eine Kapelle wieder aufgebaut hat.
Um 1830 soll nach Überlieferungen der damalige Eigentümer des Hauses Nummer 1 in Halbemeile, Christof Glaser, aus Dankbarkeit für den erfolgreichen Wiederaufbau seines 1826 abgebrannten Hauses, die Kapelle (links) errichtet haben. Sie wurde dem Heiligen Nepomuk geweiht. In ihr hielten die Bewohner Andachten und Messen an kirchlichen Feiertagen ab. Bereits vor 1940 verschlechterte sich der bauliche Zustand der Kapelle jedoch zusehends, und 1953 wurde sie mit den Wohnhäusern dem Erdboden gleich gemacht. Im Mai 2014 wurde die neu errichtete Kapelle geweiht. Foto: Der Grenzgänger/privat
Beim Festakt zum 60. Jahrestag des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags hat Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, den „extrem unbefriedigenden Zustand“ der Beziehungen zwischen Paris und Berlin kritisiert und einen Neustart gefordert. Zu der Veranstaltung zum Jubiläum des Élysée-Vertrags hatte die Paneuropa-Union Deutschland nach Kempten eingeladen.
Der aus Böhmen stammende Gründer der PaneuropaUnion, Richard Graf Coudenhove-Kalergi, habe schon vor 100 Jahren geschrieben, daß Europa ohne deutsch-französische Aussöhnung und Mitteleuropa ohne deutsch-tschechische Verständigung von Zerfall durch Nationalismus bedroht seien. Diese Grundtatsachen seien heute wieder von neuer Aktualität, obwohl die europäische Einigung inzwischen große Fortschritte gemacht habe. Europa könne nur als enge Schicksalsgemeinschaft überleben in einer Zeit, in der der Krieg in seine Mitte zurückgekehrt sei.
Posselt plädierte für einen grundlegenden Neustart in der deutsch-französischen Freundschaft, die nicht als „Direktorium“ in der EU mißverstanden werden dürfe. Winston Churchill habe in seiner berühmten Zürcher Rede 1946 an Deutsche und Franzosen appelliert, sich in besonderer Weise „in den Dienst der europäischen Einigung zu stellen“, und Helmut Kohl als Ehrenbürger Europas habe stets betont, daß die unverzichtbare deutsch-französische Einheit durch eine besondere Berücksichtigung der kleineren EUMitgliedstaaten und der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen ausbalanciert werden müsse. Nunmehr gelte es dem ElyséeVertrag neue, konkrete Inhalte zu geben.
Als gemeinsame Ziele beider Länder nannte Posselt die Erhaltung und Fortentwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft, die allein Nahrungsmittelsicherheit gewährleiste, ein transeuropäisches Verkehrsnetz mit der rasch auszubauenden „Eisenbahn-Magistrale für Europa“ von Wien über München, Stuttgart und Straßburg nach Paris als Rückgrat, eine ökologisch geprägte deutsch-französische Industriepolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber Konkurrenten wie China herzustellen, eine Europäische Energie-Union, die vor künftigen Erpressungsversuchen schütze, und eine wirkungsvolle Abstimmung beider Länder auf dem Weg zu einer weltweit handlungsfähigen außen- und sicherheitspolitischen Gemeinschaft Europas. Darüber hinaus forderte er die Stärkung des Straßburger Europaparlamentes, das frei über die Zusammensetzung der EU-Kommission entscheiden müsse, sowie einen von Deutschen und Franzosen beflügelten europäischen Patriotismus: „Das Schicksal von Notre Dame liegt auch uns und allen anderen Europäern am Herzen.“
Höhepunkt der Veranstaltung in der Allgäu-Metropole war eine historische Begegnung zwischen dem Internationalen Präsidenten der Paneuropa-Union, Alain Terrenoire aus Frankreich, und dem ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel, Träger des Eu-

Seine Jugend verbrachte Richard Coudenhove-Kalergi in der Mitte Europas auf Schloß Ronsperg in Westböhmen, sein Leben widmete der Visionär dem gesamten Europa.
Als Coudenhove-Kalergi 1950 als erster Preisträger mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet wurde, unterstrich der Gründer der Paneuropa-Union die elementare

Wie sich Europa ändern muß
rer mit einem sehr persönlichen Zeugnis in deutscher Sprache, in dem er seine Familiengeschichte umriß.
Sein Großvater mütterlicherseits, der Verleger Francisque Gay, und sein Vater, der Journalist Louis Terrenoire, hätten in der Zwischenkriegszeit die Zeitung „L‘Aube“ herausgegeben, die sich für den Brückenschlag zwischen Kirche und Arbeiterschaft eingesetzt habe.
Bei einer Trauerfeier für den französischen Außenminister und Friedensnobelpreisträger Aristide Briand, der sich als Ehrenpräsident der PaneuropaUnion bereits in den 1920er Jahren für die deutsch-französische Aussöhnung und die europäische Einigung eingesetzt habe, hätten sich seine Eltern kennengelernt und fortan auch politisch zusammengearbeitet.
Louis Terrenoire sei in den dreißiger Jahren wegen eines Buches, in dem er vor der Appeasement-Politik gegenüber Hitler gewarnt habe, auch in Frankreich heftig angefeindet worden. Schon unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Paris hätten Louis Terrenoire, seine Frau Elisabeth und Schwiegervater Francisque Gay begonnen, dagegen Widerstand zu leisten.
Die Nationalsozialisten hätten durch eine Denunziation von der Funktion Louis Terrenoires als Generalsekretär der Résistance erfahren und ihn ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert, von wo er dann nach Kempten weitertransportiert wurde. Für ihn sei es daher sehr beeindrukkend, erstmalig persönlich in Kempten zu sein, so Alain Terrenoire. Auch das Thema DeutschFranzösischer Vertrag betreffe ihn unmittelbar, denn er habe in den sechziger Jahren seinen Vater bei dessen Ausarbeitung unterstützt und dabei eine junge heimatvertriebene Schlesierin als Übersetzerin der deutschen Texte ins Französische gewinnen können, die bis heute seine Frau sei. Die gemeinsame Tochter lebe seit 18 Jahren in München und habe seit einigen Monaten einen in Bayern geborenen Sohn. Vor dem Hintergrund seiner jahrzehntelangen Mitgliedschaft in der Französischen Nationalversammlung und im Europäischen Parlament appellierte Alain Terrenoire an Deutsche und Franzosen, mehr als tausend Jahre nach Karl dem Großen die Einheit der europäischen Kernvölker und damit des ganzen Kontinents wieder herzustellen.
ropäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen. Ersterer ist der Sohn von Louis Terrenoire, der als Generalsekretär der französischen Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, der Résistance, im KZ-Außenlager Kempten inhaftiert war.
Nach dem Krieg war er ein enger Mitstreiter von Staatspräsident Charles de Gaulle und verhandelte mit Deutschland den Elysée-Vertrag, wobei ihn der junge Alain als Mitarbeiter unterstützte.

Theo Waigels Vater wiederum mußte im Ersten Weltkrieg gegen Frankreich kämpfen, und der ältere Bruder des späteren CSU-Politikers fiel im Zweiten Weltkrieg in Lothringen und ist auf einem Soldatenfriedhof im Elsaß begraben.
Gastgeber im Großen Sitzungssaal des Rathauses von
Kempten war der Oberbürgermeister der Stadt, Thomas Kiechle, Ehrengast die französische Generalkonsulin in München, Corinne Pereira da Silva, die hervorhob, daß die deutsch-französische Freundschaft keinesfalls selbstverständlich sei und unbedingt von der Zivilgesellschaft mitgetragen werden müsse.
Im Rahmen seiner bewegenden Rede präsentierte Theo Waigel den zahlreichen Zuhörern im Kemptener Rathaus das Bajonett seines Vaters von der deutschfranzösischen Front im Ersten Weltkrieg. Er nannte es „schokkierend“, daß Krieg und Nationalismus mit dem Angriff auf die Ukraine wieder ins Herz Europas zurückgekehrt seien. Dennoch zeigte er sich optimistisch, daß sich die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung fortsetzen lasse. Europa brauche
endlich eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), wie sie vor Jahrzehnten sowohl durch den von Deutschland angezettelten Streit um die Präambel des Elysée-Vertrages als auch zuvor durch das Nein der französischen Nationalversammlung zum EVG-Vertrag gescheitert sei: „Die EVG II ist das Gebot der Stunde, aber sieben Jahrzehnte früher wäre sie besser gewesen.“ Der Nationalstaat habe längst die Grenzen seiner Möglichkeiten erreicht, weshalb die EU gleichzeitig Stabilisierung und Heimat gewährleisten müsse: „Wir haben eine kleinräumige, emotionale Heimat und eine große, politische. Beide können nur auf Identität und Werten aufgebaut werden.“ Die europäische Wertegemeinschaft wurzele in Christentum, Aufklärung, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und
Freiheitsrechten. Um möglichst bald Vereinigte Staaten von Europa oder Vereinigte Staaten in Europa zu errichten, gelte es, ein neues „Bündnis für Europa“ ins Leben zu rufen, aus Kirchen, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Heimatvereinen und Landsmannschaften, Bauern, Jugendorganisationen, Kulturschaffenden sowie Städten und Gemeinden. Mit Blick auf Alain Terrenoire rief er aus: „Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrer Familie. Nach dem, was Sie unter dem Nationalsozialismus erleiden mußten, war es eine Großtat, unmittelbar danach mit der Aussöhnung im Dienst der deutschfranzösischen Freundschaft sowie der europäischen Einigung zu beginnen.“
Alain Terrenoire als Internationaler Präsident der Paneuropa-Union faszinierte die Zuhö-
„Totale deutsch-französische Versöhnung“
Bedeutung, die die deutsch-französischen Beziehungen für ganz Europa haben – 13 Jahre bevor Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den historischen Élysée-Vertrag unterzeichneten.


Coudenhove-Kalergi sagte da-
mals in seiner Rede: „Zu diesem entscheidenden Schritt aus einer tragischen Vergangenheit in eine glänzende Zukunft bedarf es nur der Entschlossenheit und Initiative der Führer und Völker Deutschlands, Frankreichs, Ita-
liens und der Benelux-Staaten. Von ihnen hängt es ab, ob Europa in Wolken von Atombomben versinkt – oder ob es aus den Flammen des letzten Weltkrieges wie ein junger Phönix in neuer Herrlichkeit hervorgeht. Dar-
um appelliere ich an alle, die guten Willens sind, eine Bewegung ins Leben zu rufen zur totalen deutsch-französischen Versöhnung durch Erneuerung des Reiches Karls des Großen als Bund freier Völker. “
Zuvor hatte Oberbürgermeister Kiechle, Sohn des früheren Bundeslandwirtschaftsministers Ignaz Kiechle, den französischen Gast durch die Allgäuhalle geführt, in der die mit großen Grausamkeiten verbundene KZ-Haft seines Vaters Louis verortet war, und ihm im Kempten-Museum eindrucksvolle Zeichnungen eines Mithäftlings von Louis Terrenoire, des Lothringers Jean Wernet, aus dem Lageralltag gezeigt, die dort ausgestellt sind.
Der deutsch-französische Festakt endete mit der Eintragung der Ehrengäste ins Goldene Buch der Stadt Kempten sowie dem Musikstück „Gebet für die Ukraine“, das ein Bläserensemble um Stadtkapellmeister Thomas Frasch darbot. Unter den Besuchern waren zahlreiche Sudetendeutsche, wie die Ortsobfrau der SL Kempten, Inge Schwarz.

3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27.01.2023
� Mahnende Worte von Bernd Posselt, Theo Waigel und Alain Terrenoire beim Festakt zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags
� Richard Coudenhove-Kalergi unterstrich bereits 1950 die elementare Rolle der beiden Nachbarn für Europa
Ehrengast Theo Waigel präsentierte das Bajonett, mit dem sein Vater im Ersten Weltkrieg gegen die Franzosen kämpfen mußte. Fotos (4): Stefan Zwinge
Bewegender Moment vor den Erinnerungstafeln am ehemaligen KZ-Außenlager Kempten (von links): Volksgruppensprecher Bernd Posselt, der internationale Paneuropa-Präsident Alain Terrenoire und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle Foto: Johannes Kijas:
Festakt im Kemptener Rathaus (von links): Christian Hoferer, Bundesvorsitzender der Paneuropa-Jugend, die Paneuropa-Präsidenten Alain Terrenoire und Bernd Posselt, OB Thomas Kiechle, Generalkonsulin Corinne Pereira da Silva, Theo Waigel und PEU-Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas.
Zwei große Europäer: Alain Terrenoire und Theo Waigel. Alain Terrenoire trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Kempten ein.
Richard Coudenhove-Kalergi
Mixed Voices: Premiere in St. Michael
„Ich freue mich sehr, daß es endlich klappt und ich mit meinem Chor, den ich nun schon seit über 30 Jahren leite, in St. Michael singen darf“, sagt Roland Hammerschmied, der Leiter des Vocal Ensembels „Mixed Voices“.
■ Samstag, 28. und Sonntag, 29. Januar, Bund der Egerländer Gmoi: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 28. Januar, 16.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Sonntag, 29. Januar, 15.00 Uhr: Requiem für Widmar Hader. Musikalisch gestaltet wird das Requiem von Andreas Willscher und Dietmar Gräf (Orgel) und Moravia Cantat; zelebrieren wird Monsignore Karl Wuchterl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks. Die Urnenbeisetzung findet am Folgetag im Familienkreis statt Kirche St. Vitus, Ludwig-ThomaStraße, Regensburg.
■ Dienstag, 31. Januar, 19.00 Uhr, Tschechisches Zentrum in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: Bernhard Blöchl: Ein Buch in fünf Objekten. Lesung und Gespräch mit dem Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, der anhand von fünf Objekten seinen neuen, bisher persönlichsten Roman „Eine göttliche Jugend“ (Volk Verlag, 2022) vorstellt. Moderation Frances Jackson. Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München.
■ Mittwoch, 1. Februar, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder: Filmessay „Wilder Than Wilderness“ (Planeta Česko). An vielen einst von Menschenhand zerstörten Orten in Tschechien, wo sich Menschen nicht mehr aufhalten, gewinnt nun wieder die Natur die Oberhand. Ein bildgewaltiger Filmessay (Originalton mit Untertiteln) von Regisseur Marián Polák über die Artenvielfalt und die Resilienz der Natur. Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler. Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, München. Eintritt: 8,50 Euro.
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof (siehe rechts oben). Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Krieg in Europa –
Am Mittwoch, 15. Februar, gestaltet der Chor aus Geretsried den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes, der um 18.00 Uhr in St. Michael in der Neuhauser Straße im Zentrum von München stattfindet.
Im Anschluß an den Gottes-
dienst wird der Chor noch für eine halbe Stunde Werke aus dem aktuellen geistlichen Konzertprogramm vortragen.
Zelebrant ist P. Benedikt Lautenbacher SJ.
Im Rahmen des Diözesanen Welttages der Kranken steht der
VERANSTALTUNGSKALENDER
weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.


■ Freitag, 3. Februar, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Filmpräsentation „Trautenau und Riesengebirgsvorland“. Der neue Film vom Filmstudio Sirius erzählt die Geschichte und Entwicklung der Beziehungen von Deutschen und Tschechen in der Region Trautenau.
■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz
■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christian Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de
■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2. Puchheim. Eintritt frei.
■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.
■ Dienstag, 28. Februar, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste: „Goethe in Böhmen – oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.


■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).
■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast:
MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.
■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.
■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.
■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.
Gottesdienst unter dem Motto „Sorge für ihn“. Die Predigt hält Diakon Stephan Häutle, der am Universitätsklinikum der LMU, Campus Innenstadt, arbeitet und mit Schwerpunkt in der Psychiatrischen Klinik an der Nußbaumstraße wirkt.
■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).
■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.
■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.
■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de
■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn.
■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin. Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.
■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.
Spurensuche in der Vergangenheit
– Identität für die Zukunft?
■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar: Seminarwochenende mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband „Spurensuche in der Vergangenheit – Identität für die Zukunft?“
Das Thema Flucht und Vertreibung ist auch über 70 Jahre nach Kriegsende hochaktuell. Neben den Opfern von damals stehen immer stärker die Generationen der Nachgeborenen im Fokus. Was beschäftigt die Kinder und Enkel der Vertriebenen? Welche Hilfen erfahren sie bei der Suche nach ihrer Identität? Zielgruppe sind insbesondere die Nachgeborenen der Vertriebenen, die ihren böhmischen, mährischen oder schlesischen Wurzeln nachspüren oder etwas über Kultur und Geschichte der Sudetendeutschen erfahren und sich mit Landsleuten austauschen möchten.
Das Programm: ■ Freitag, 3. Februar
18.00 Uhr: Abendessen.
19.00 Uhr: Begrüßung, Vorstellungsrunde, Einführung in das Seminarthema, Abfrage der Erwartungen. Moderation: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor, Bad Kissingen und Hildegard Schuster, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, München.
19.30 Uhr: Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen. Referent: Werner Honal, Studiendirektor i. R., Philologe, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher, Unterschleißheim.
■ Samstag, 4. Februar 2023
9.00 Uhr: Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung. Referent: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge, Maintal.
10.45 Uhr: Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten zum Aufbau digitaler sozialer Netzwerke. Referent: Mathias Heider, Historiker, München (online).
14.00 Uhr: Die Unesco und das Weltkulturerbe Bad Kissingen: Die Sicherung der Vergangenheit für die Zukunft im Rahmen einer grenzübergreifenden Kooperation, Stadtführung durch Bad Kissingen. Referent: Gustav Binder, HpM, Bad Kissingen.
19.30 Uhr: Film „Kde domov muj“ (Wo ist meine Heimat?) von Ondřej Valchář mit anschließender Diskussion. Referent: Dr. Günter Reichert, Präsident a.D. der Bundeszentrale für politische Bildung, Bad Honnef.
■ Sonntag, 5. Februar 2023
9.00 Uhr: Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie. Referent: Dr. Raimund Paleczek, Historiker, München
11.30 Uhr: Seminarauswertung und Ergebnissicherung.
12.30 Uhr: Mittagessen und anschließend Abreise.
Die Seminargebühr beträgt bei voller Verpflegung für das gesamte Wochenende 80,00 Euro im Doppelzimmer (plus 3,90 Euro Kurtaxe sowie gegebenenfalls 20,00 Euro Einzelzimmerzuschlag für zwei Nächte).
Anmeldungen per eMail an: info@heiligenhof.de oder schuster@sudeten.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de
Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal
■ Dienstag, 31. Januar, 18.00 Uhr: Gedenkveranstaltung anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen. Veranstaltungsort: Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München.
Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Haus des Deutschen Ostens laden anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen zu einer Gedenkveranstaltung mit anschließendem Empfang ein.
Die Grußworte sprechen Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, und
MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.
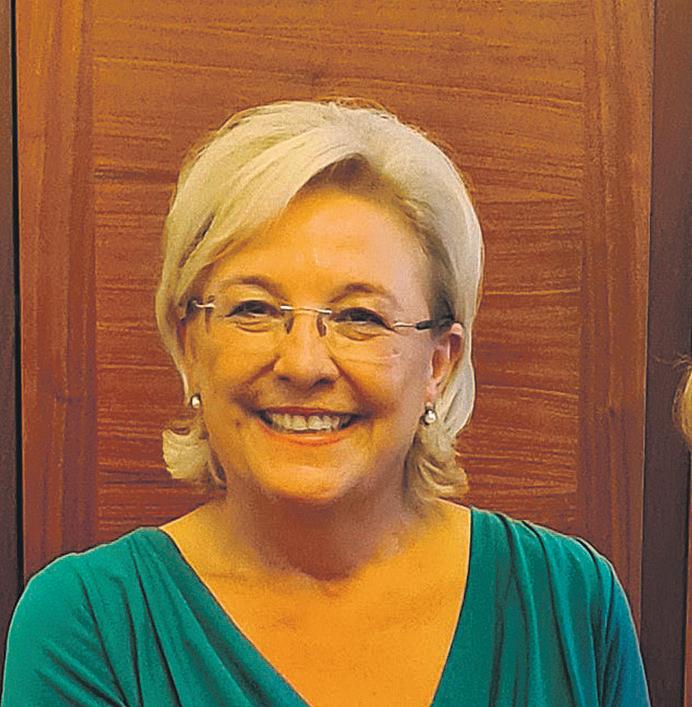
Anschließend referiert Dr. habil. Márta Müller über das Thema „Von der Wiege bis zur Hochschule – Aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens“.
Im Anschluß an die Veranstaltung laden das HDO und das Ungarische Generalkonsulat zu einem kleinen Empfang ein.
Anmeldung per eMail an einladung-muenchen@mfa. gov.hu oder per Telefon unter (0 89) 9 62 28 02 00.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27.01.2023 4 TERMINE ❯ Gedenktag
für vertriebene Ungarndeutsche
MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, und Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, sprechen die Grußworte. Fotos: privat
❯ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr:
� Österreich
würdigt den Erfinder
Am 3. September 1875 wurde Ferdinand Porsche in Maffersdorf in Böhmen geboren. Auch heute, über sieben Jahrzehnte nach seinem Tod am 30. Januar 1951 in Stuttgart, steht der Name Porsche weltweit für automobile Ingenieurskunst. Die Österreichische Post würdigt den genialen Konstrukteur jetzt mit einer Erfindung, die lange in Vergessenheit geraten war – einem E-Automobil.
Daß Ferdinand Porsche bereits vor mehr als 120 Jahren ein echter Pionier der Elektromobilität war, wissen nur Experten. 1899 entwickelte er gemeinsam mit Ludwig Lohner, dem Leiter der Lohner-Werke in Wien, das Elektromobil „System Lohner-Porsche“. Dessen Vorderräder wurden durch Radnabenmotoren mit einer Leistung von jeweils rund drei PS angetrieben, die Reichweite betrug etwa 50 Kilometer.

Bei der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 wurde das Fahrzeug als „erster transmissionsloser Wagen der Welt“ präsentiert und sorgte für großes Aufsehen. Um die Reichweite des wegen
der Bleiakkus sehr schweren Elektrofahrzeugs zu erhöhen, tüftelte Porsche intensiv weiter und entwickelte das erste
Im Stuttgarter Porsche-Museum ist eine voll funktionstüchtige Replik des Semper Vivus, die Weiterentwicklung des Lohner Porsche, zu sehen. Foto: Porsche-Museum

zung zur Schwerstarbeit. Dafür genoß der Fahrer mehr als zwei Meter über der Straße von seinem Einzelsitz aus einen souveränen Überblick. Eine voll funktionsfähige Replik ist im Stuttgarter Porsche-Museum zu sehen.
Im Rahmen der Reihe „Österreichische Erfindungen“ erinnert die Österreichische Post mit einer Sonderbriefmarke an Ferdinand Porsche und den Lohner-Porsche 1899. Ersterscheinungstag ist der heutige Freitag.
� Serie Ehrensache Ehrenamt: Portrait über die Vorsitzende der Gemeinschaft der Wischauer Sprachinsel
Als Vorsitzende der Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel setzt sich Monika Ofner-Reim für den Erhalt und die Dokumentation von Dialekt, Trachten, Brauchtum und Rezepten ein.
D
ie Wischauer Sprachinsel in Südmähren gehörte zu den kleinsten ihrer Art: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebten etwa 3500 Deutschmuttersprachler in den acht Dörfern rund um die Stadt Wischau. Nichtsdestotrotz ist die Wischauer Sprachinsel im sudetendeutschen Kosmos vielen Menschen ein Begriff. Das liegt nicht zuletzt an der auffälligen Tracht, deren charakteristischstes Merkmal die hohe weiße Halskrause ist.Diese Tracht hat auch die in München aufgewachsene Monika Ofner-Reim bereits als Kind fasziniert: Ihre Großmutter stammte aus dem Dorf Rosternitz. Nach der Vertreibung fertigte sie die Wischauer Tracht für Puppen an. Solche derart gekleideten Puppen erfreuten sich großer Beliebtheit unter den heimatvertriebenen Wischauern – diese lebten nun verstreut im süddeutschen Raum und trafen sich regelmäßig im ostwürttembergischen Aalen. Treffen, die Monika Ofner-Reim früh geprägt haben: „Diese Treffen waren Highlights für viele Sprachinsler, denn nach den schweren Kriegszeiten und den Schrecken der Vertreibung, haben sich hier Familien, ehemalige Freunde und Nachbarn wieder getroffen und das dort erlebte Gemeinschaftsgefühl war Balsam für die Menschen. Ich selbst war als Kind und Teenager auch schon bei diesen Treffen dabei und erinnere mich noch gut an die freudige Aufgeregtheit der Erwachsenen, die festliche Stimmung und das Stimmengewirr im Wischauer Dialekt.“
Die Wischauer waren und sind eine kleine, dafür aber umso aktiviere Gemeinschaft. Schon bald entfalteten sich zahlreiche Aktivitäten. 1953 gründete sich in Aalen zunächst die Arbeitsgemeinschaft Wischauer Sprachinsel, 1989 wurde der eingetragene Verein gegründet. Zunächst ging es vor allem darum, die neuen Adressen der Wischauer zu sammeln, um die Gemeinschaft auf diese Weise zusammenzuhalten und beim Lastenausgleich zu helfen.
In den 1970ern und 1980ern wurde die Dokumentation des Wischauer Erbes immer bedeutsamer: Die Mundart wurde auf Band aufgenommen und Bücher mit landeskundlichen Informationen herausgegeben. Monikas Mutter Rosina Reim fing zudem an, die älteren Sprachinsler nach ihren Erinnerungen zu befragen und die Familiengeschichten aufzuschreiben.
Auch Busfahrten in die alte Heimat
organisierten die Wischauer; Fahrten, an die sich Monika Ofner-Reim gerne erinnert: „Es wurden alte Lieder gesungen, Geschichten von früher erzählt und meine Oma konnte mir vor Ort noch vieles zeigen. Lachen und Weinen lagen bei diesen Fahrten nahe beieinander.“
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs knüpften die Wischauer zaghaft Kontakte nach Tschechien, aus denen sich mittlerweile langjährige Freundschaften entwickelt haben.
Die Familie Reim – Mutter Rosina, Vater Wilhelm und Tochter Monika –reiste oft nach Tschechien: um Kontakte zu pflegen, Recherchen zu betreiben und auch um Filmdokumentationen zu begleiten. Außerdem halfen sie den heutigen Bewohnern eines alten Bauern-
hauses bei der Restaurierung desselbigen mit vielen Informationen.
Der Verein, in dessen Vorstand Mutter Rosina im Jahr 2006 gewählt wurde, etablierte sich als kompetenter Ansprechpartner für alle, die mehr über Wischau, seine früheren Bewohner, ihre Sprache und Bräuche erfahren wollten. So half der Verein etwa mehreren jungen Wissenschaftlern aus Deutschland und aus Tschechien bei den Recherchen für ihre Abschlußarbeiten. Außerdem unterstützt der Verein Museen und Ausstellungen mit Exponaten, so zum Beispiel das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin.
All das, was in Jahrzehnten aufgebaut worden ist, möchte Monika Ofner-Reim
erhalten und fortführen. Als ihre Mutter nach vier Amtsperioden entschied, den Vorsitz des Vereins nicht länger zu übernehmen, kandidierte daher ihre Tochter und wurde im Juni 2019 zur ersten Vorsitzenden gewählt.
Der Generationenwechsel vollzieht sich bei den Wischauern reibungslos: „Nicht nur meine Mutter, sondern alle aus der älteren Generation unterstützen mit Rat und Tat und geben bereitwillig ihre Erfahrungen und ihr Wissen weiter, akzeptieren aber auch, wenn das eine oder andere im Laufe der Zeit eventuell anders gemacht wird. Diese Mischung aus Unterstützung und Vertrauen ist immens wichtig und hilft uns ‚Nachfolgegenerationen‘ sehr dabei, wenn wir Aufgaben und Ämter übernehmen.“
Auch der jüngeren Generation ist das Archivieren von Trachten, Gegenständen sowie Dokumenten aus der Wischauer Sprachinsel ein wichtiges Anliegen – ebenso der Erhalt der Wischauer Gemeinschaft: einmal im Monat finden offene Treffen in ihrem Begegnungszentrum in Aalen statt, außerdem treffen sie sich auf den Weihnachts- und Ostermärkten der sudetendeutschen Heimatpflege sowie bei kleineren und größeren Veranstaltungen wie dem Sudetendeutschen Tag. Neben Dialekt, Tracht und Gemeinschaft gibt es ein viertes, was Monika Ofner-Reim mit der Herkunft ihrer Großeltern verbindet: die Küche. „Knejdl mit Stup ist nach wie vor eines meiner Lieblingsgerichte …. und was es dann doch wieder besonders macht: die Knjedl, mit einem Hefeteig, der lange gegangen ist, über einem Leinentuch in Dampf gegart und dazu eine helle Soße mit viel Dill, das bekommt man in keinem Wirtshaus und auch in keinem 5-Sterne-Hotel, das gibt es nur dahuam – auch wenn dieses dahuam jetzt in München und nicht mehr in Rosternitz liegt“, so schreibt Monika Ofner-Reim in einer Festschrift aus Anlaß des 24. Wischauer Heimattreffens im Juni 2019. Um diese Küche zu erhalten und Interessierten zugänglich zu machen, hat sie mit ihrer Mutter ein Kochbuch veröffentlicht: „Koch- und Backrezepte aus der ehemaligen deutschen Sprachinsel bei Wischau“.
Monika Ofner-Reim macht es sichtlich Spaß, Dinge mitzugestalten, weshalb sie gerne bei den Wischauern aktiv ist – und wegen der Menschen, denen sie dort begegnet: „Die vielen interessanten Menschen und tollen Begegnungen – sowohl in unserem Verein als auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, sind eine große Bereicherung, und zusammen mit Gleichgesinnten fällt vieles leichter.“
Dr. Kathrin Krogner-Kornalik
�
Rund um den Jahreswechsel fiel mir ein Gebet in die Hände, das mich unmittelbar ansprach, weil ich mich gut darin wiederfand. Angeblich handelt es sich um einen Segensspruch aus Irland. Die ersten beiden Absätze dieses Gebetes lauten: „Du Gott der Anfänge, segne mich, wenn ich deinen Ruf höre, wenn deine Stimme mich lockt zu Aufbruch und Neubeginn. / Du Gott der Anfänge, behüte mich, wenn ich loslasse und Abschied nehme, wenn ich dankbar zurückschaue auf das, was hinter mir liegt.“
Daß mich dieses Gebet ansprach, hängt mit meiner derzeitigen Lebenssituation zusammen, die von einer Veränderung bestimmt wird. Überall in unserer weltweiten Ordensgemeinschaft der Redemptoristen werden gerade neue Provinzleitungen gewählt. Die einzelnen Teilgebiete der Ordensgemeinschaft, die sogenannten Provinzen, erhalten dabei neue Führungsmannschaften. An der Spitze der Provinzleitung steht jeweils der Provinzial. Er ist der Ordensobere und trägt die Gesamtverantwortung.
In den letzten Wochen wählten auch wir in unserer süddeutschösterreichischen Redemptoristenprovinz. Da der bisherige Provinzial sich nach vielen Jahren nicht mehr für die Aufgabe zur Verfügung stellen wollte, war die Spannung groß. Für wen würden sich die Mitbrüder entscheiden? Schon im November und Dezember gab es zwei Briefwahlgänge unter allen Provinzmitgliedern, welche aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt hatten. Mitte Januar fand mit dem Provinzkapitel eine Art Delegiertenversammlung statt. Diese sollte den Provinzial wählen.
Die Wahl traf mich. Ganz überrascht war ich nicht, weil die Signale bereits zuvor darauf hingedeutet hatten. Ich hatte mich also geistig schon ein wenig darauf einstellen können. Dennoch ist dies ein wahrhaftig neuer Anfang. Auf absehbare Zeit heißt das auch, daß ich die Wallfahrtspfarrei am Schönenberg, die ich erst im September 2020 übernommen hatte, wieder verlassen werde, spätestens dann, wenn ein Nachfolger als Pfarrer gefunden ist. Aber schon jetzt bin ich mit der neuen Aufgabe der Ordensleitung betraut.
Gott sei Dank bin ich bei dieser Aufgabe nicht allein. Mir wurde –ebenfalls durch Wahl – ein gutes Team zur Seite gestellt. So gehe ich mit Hoffnung an die neue Aufgabe heran, auch wenn die Herausforderungen nicht klein sind. Als Redemptoristen sind wir „Missionare der Hoffnung in den Fußspuren des Erlösers Jesus Christus“, wie es unser letztes Generalkapitel formulierte. So vertraue ich, daß auch mein Dienst in der Ordensleitung eine Mission der Hoffnung wird. Tiefster Grund der Hoffnung ist immer Gott, der alle Wege unsers Lebens begleitet.

So schließe ich meine Gedanken mit dem letzten Absatz des Segensgebetes, das mich gegenwärtig stark begleitet: „Du Gott der Anfänge, laß dein Gesicht leuchten über mir, wenn ich in Vertrauen und Zuversicht einen neuen Schritt wage auf dem Weg meines Glaubens.“

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 01. 2023 5
Mut tut gut Mission der Hoffnung
mit einer Sonderbriefmarke Ferdinand Porsche und sein erstes E-Automobil
Das Engagement für die Wischauer liegt bei Monika Ofner-Reim im Blut
Hybridautomobil, den „Semper Vivus“, bei dem zusätzliche Benzinmotoren die Batterien und die Radnabenmotoren mit Energie versorgten.
Die neue Technologie konnte sich damals jedoch nicht durchsetzen, wohl auch, weil das Fahren mit dem „Semper Vivus“ ein ebenso eindrucksvolles wie anstrengendes Erlebnis war. Bei einer Vorderachslast von 1060 Kilogramm – hinten waren es 830 Kilogramm –wurde das Lenken ohne Servounterstüt-
Engagement, das von Herzen kommt: Monika Ofner-Reim mit Dr. Martin Leitgöb.
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Im Januar 993, also vor 1030 Jahren, wurde Stift Breunau bei Prag als erstes Benediktinermännerkloster in Böhmen vom heiligen Adalbert, dem zweiten Bischof von Prag, gegründet. Es wurde mit Mönchen aus dem bayerischen Kloster Niederaltaich besiedelt.

Die erste dreischiffige romanische Krypta, deren Mauerwerk unter dem Chorraum der Klosterkirche erhalten ist, entstand im 11. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert wurde an deren Stelle eine gotische Kirche errichtet. Nachdem in den Hussitenkriegen Kloster und Kirche zerstört worden waren, floh der Konvent 1420 in das Stift Braunau.
Damit begann die Epoche des Doppelklosters Breunau-Braunau, dessen Abt bis zum 20. Jahrhundert seinen Sitz in Breunau hatte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden das Kloster wieder aufgebaut. Die heutige, kunsthistorisch bedeutende Barockanlage entstand 1708 bis 1740.
1939 kam es zur Trennung der beiden Häuser: Die deutschen Benediktiner blieben unter Abt
Dominik in Braunau, die tschechischen Mönche bekamen in Breunau mit einem eigenen Klostervorsteher eine unabhängige Abtei. Im Zweiten Weltkrieg besetzte die Wehrmacht das Klo-
sen. Er erhielt Berufsverbot, arbeitete als Maurer und Lagerarbeiter und kam 1968 kurz in sein Amt zurück. 1969 bis 1990 ging er nach Deutschland ins Exil. In der Benediktinerabtei Braunau
choslowakei die verfallenen Klostergebäude den Benediktinern zurück. Mit Unterstützung ausländischer Benediktinergemeinschaften und des Staates konnten Kloster und Kirche gerettet werden. 1993 wurde das 1000jährige Jubiläum gefeiert. Papst Johannes Paul II. erhob das Stift aus diesem Anlaß zur Erzabtei und besuchte es 1997.
Die Mönche betreuen heute die dortige Pfarrgemeinde und die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau vom Siege am Weißen Berg seelsorgerisch. 2011 wurde, anknüpfend an die jahrhundertealte Tradition des Bierbrauens im Stift Breunau, die Klosterbrauerei Breunauer Bier gegründet.
ster. Der Unterdrückung durch die kommunistische Regierung der Tschechoslowakei folgte 1950 die Enteignung.
Abt Anastáz Opasek wurde 1949 verhaftet und in einem Schauprozeß wegen Hochverrats und Spionage zu lebenslanger Haft verurteilt und zehn Jahre später auf Bewährung freigelas-
im niederbayerischen Rohr fanden er und Mitbrüder Zuflucht.
Das seit 1803 säkularisierte ehemalige Augustiner-Kloster in Rohr war 1946 von den aus Braunau nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen deutschen Benediktinern wiederbelebt worden.
Nach dem politischen Umbruch von 1989 gab die Tsche-
2017 wählte der Konvent seinen langjährigen Prior-Administrator Pater Prokop Siostrzonek zum zweite Erzabt des Stiftes. 2018 wurde die angestrebte Wiedervereinigung der Abteien Breunau und Braunau durch ein Dekret der vatikanischen Ordenskongregation rechtskräftig. Der Erzabt darf nun wieder den Titel Erzabt von Breunau und Braunau tragen.

Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München
Am 1. Februar feiert WolfDieter Hamperl, die personifizierte Egerländer Kultur, mit seiner Familie auf der Seiseralm in Südtirol 80. Geburtstag.
Obwohl Hamperl erst 1990 der Sudetendeutschen Landsmannschaft beitrat, ist er doch von Kindheit an seiner Heimat und deren Kultur verbunden. Diese Heimat war die Neumühle in der Gemeinde Zummern im südlichen Kreis Tachau, wo er als Sohn von Josef und Anna Hamperl zur Welt kam. Die Neumühle war eine Idylle, die Großfamilie lebte dort. Am 6. Dezember 1945 wurden Wolf-Dieter und seine Schwester mit einem amerikanischen Passierschein nach Waidhaus gebracht (Ý Seite 16), die Mutter ging nachts bei Ströbl über die Grenze. Im oberpfälzischen Waidhaus, Vohenstrauß und Weiden verlebte er seine Schulzeit. Nach Abitur und Bundeswehrzeit folgte das Studium der Humanmedizin in München. Hamperl wurde Chirurg, seine Karriere beendete er 2008 als Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Visceralchirugie an der Kreisklinik Trostberg in Oberbayern.
Schon als Gymnasiast interessierte er sich für die böhmische Kultur und erforschte die barokke Besonderheit der böhmischOberpfälzer Akanthusaltäre, was eine erste Reise nach Prag, Laun und Tachau erforderte. Öfters weilte er in den achtziger Jahren im Bezirksarchiv Eger, wo er enge Kontakte zu Jaromír Boháč knüpfte und die Grundlagen für zahlreiche Artikel des Buches „Kunst in Eger“ erarbeitete.
1990 übernahm Hamperl auf heftiges Drängen die Betreuung des Heimatkreises Tachau und den Vorsitz des Heimatkreisvereins in Weiden in der Oberpfalz. Die Erforschung und Dokumentation der Egerländer Kultur war fortan das Ziel: „Ich möchte unsere deutsch-böhmische Kultur unseren Landsleuten, den Oberpfälzern, aber auch den heute im Egerland angesiedelten Tschechen bewußt machen und versuchen, so viel wie möglich zu retten.“
So kämpfte er nicht nur für den Erhalt der Akanthusaltäre in Königstein bei Auerbach oder in der Schloßkapelle in Haid, sondern auch für den des Sankt-Anna-Altars von Johann Christoph Artschlag in der Haider Dekanalkirche. Mit Monsignore Vladimír Born entwickelte sich eine langjährige Freundschaft, die in der Erneuerung der Haider Wallfahrt und dem Erhalt zahlreicher Objekte, besonders der Loretoanlage in Haid, gipfelte. „Leider hat der Tod meiner tschechischen Freude Jaromír Boháč und Monsignore Vladimír Born die Arbeit in Böhmen sehr erschwert“, bedauert er.
Hamperl war seit 1986 Zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender (AEK) und dann Bundeskulturwart sowie Stellvertretender Bundesvüarstaiha des BdEG. Die jährlichen Bundeskulturtage in Marktredwitz und die Egerer Gespräche trugen seine Handschrift. Lange Jahre war Hamperl auch Vorsitzender des Kuratoriums der Egerland-
Kulturhaus-Stiftung Marktredwitz.
Hamperl war Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Als SL-Bundeskulturreferent kümmerte er sich 2013 bis 2020 hauptsächlich um die feierlichen Vergaben der Sudetendeutschen Kultur- und Förderpreise. 2013 wurde Hamperl Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stiftung Egerer Stadtwald in Eger/Cheb, mittlerweile ist er nur Mitglied.
Außerdem fand Hamperl Zeit, das Museum Heimat-Vertreibung-Integration – Tachauer Heimatmuseum in Weiden in der Oberpfalz zu schaffen und zahlreiche Bücher zu schreiben. Erwähnt seien die Bände „Vertreibung und Flucht aus dem ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland 1945–1948“, „Die verschwundenen Dörfer im ehemmaligen Bezirk Tachau“, „Böhmisch-Oberpfälzer Akanthusaltäre“ und „Maurus Fuchs – der vergessene Tirschenreuther Kirchenmaler“, der seine Hauptwerke im Kloster Tepl und im Franziskanerkloster in Tachau hinterließ. Jüngst gab er in seiner Reihe „Schriften zur Tachauer Heimatgeschichte“ den 14. – diesmal zweisprachigen – Band heraus. Autor ist der tschechische Redemtoristenpater Jaroslav Baštář, der über seine zwölf Jahre von 1948 bis 1959 im Grenzgebiet im Kreis Tachau berichtet.
Einige Ämter gab Hamperl auf, dafür nahm er andere an. So ist er seit November 2021 Vorsitzender des Egerer Landtags. Dessen Hauptaufgabe ist der Er-
halt der seit 1952 angesammelten Archivalien im Geschäftssitz im oberpfälzischen Amberg. Das erste, vom bayerischen Freistaat finanzierte Projekt war die Inventarisierung und Digitalisierung der 1493 Bücher umfassenden Bibliothek. Das war Ende Februar 2022 vollbracht. Das zweite über das HDO in München finanzierte Projekt der Inventarisierung und Digitalisierung des Vereinsarchivs und des heimatkundlichen Archivs wird heuer Ende Februar enden. Der Antrag für Hamperls drittes Projekt, die Inventarisierung und Digitalisierung des 3000 Fotos umfassenden Bildarchivs, ist eingereicht.
Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert dem Jubilar von Herzen: „Wolf-Dieter Hamperl ist ein Mann, der umfassende Bildung und energische Tatkraft auf einzigartige Weise miteinander vereint. Dieser hervorragende Mediziner ist zugleich ein erstklassiger Historiker und Kunsthistoriker. Die Liebe zur bäuerlichen Landschaft seiner Egerländer Heimat verbindet er mit profunden Kenntnissen der Kirchengeschichte und Wissen über die prägenden Adelsfamilien dieser Region wie die Löwensteins und die Kolowrats. Jede freie Minute verbringt er im Kreis Tachau, stößt Projekte an, sammelt Informationen und knüpft Verbindungen. Seiner Freundschaft mit dem unvergessenen Dechanten Vladimír Born verdanken wir, daß die Kirche von Haid und das dortige Loreto schöner erstrahlen denn je. Hamperl ist ein Praktiker und Verbandsmensch, der gleichzeitig den schönen Künsten zugetan ist und publizistisch äußerst aktiv. Ich danke ihm für seinen vorbildlichen, von tiefer Heimatliebe geprägten Einsatz und wünsche ihm namens der Sudetendeutschen Volksgruppe, aber auch ganz persönlich viel Glück, Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.”
Auch die Landsleute und die Ortsbetreuer aus dem Heimatkreis Tachau schließen sich diesen guten Wünschen an und danken ihrem Heimatkreisbetreuer für seine verdienstvolle Arbeit.
Nadira Hurnaus
FORUM Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 6 PERSONALIEN Ein Weltbegriff – ein Hochgenuß für Feinschmecker die meistgekauften weil sie so gut sind! WETZEL Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik · Austraße 5 · 89407 Dillingen/Donau Internet: www.wetzel-oblaten.de · eMail: info@wetzel-oblaten.de KARLSBADER OBLATEN � Egerländer mit Leib und Seele Wolf-Dieter Hamperl 80 � Erstes Benediktinermännerkloster auf böhmischem Boden vor 1030 Jahren gegründet Stift Breunau
Unser Angebot Adresse: Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon eMail Geburtsdatum,
und Bayern
Heimatkreis
eMail svg@sudeten.de 4/2023
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler Heimatbrief
Im Sudetendeutschen Haus in München fand das Neujahrskonzert des Heimatkreises und des Freundeskreises Teplitz-Schönau statt. Der Vereinsvorsitzende und Heimatkreisbetreuer Erhard Spacek hatte dafür das weltweit berühmte „Wihan-Quartett“ aus Prag engagiert. Das Quartett aus Leoš Čepický (Erste Violine), Jakub Čepický (Viola/Bratsche), Michal Kanka (Violoncello), Jan Schulmeister (Zweite Violine) und Gast Jiří Žigmund (Zweite Bratsche) spielte Werke von Josef Haydn, Friedrich Smetana und Antonín Dvořák. Mitveranstalter des Konzerts war der Bundesverband der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Wie schön, daß unser Neujahrskonzert wieder stattfinden kann“, jubelte Erhard Spacek. Besonders freue er sich über die rege Teilnahme und die illustren Gäste. Er begrüßte besonders die Karlspreisträgerin der Sudetendeutschen und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, in der ersten Reihe.
„Auch bei uns in Teplitz-Schönau war die jüdische Gemeinde sehr groß“, erläuterte der Heimatkreisbetreuer. Er sprach über die Geschichte der Stadt, die als ältestes Kurbad Böhmens schon 762 gegründet worden sei. Die meisten der internationalen Kurgäste seien im 19. Jahrhundert zu langen Badeaufenthalten gekommen.

Dieses historische Wissen wolle der Freundeskreis Teplitz-Schönau vermitteln. Er organisiere dafür verschiedenste Veranstaltungen und Restaurierungen oder auch Schüleraustausche. „Das alles wird nur mit Spenden finanziert!“
Engagierter Freundeskreis
Derzeit sei das Leben nicht besonders freudvoll mit Blick auf den Krieg in der von Rußland überfallenen Ukraine, bedauerte Spacek. So ähnlich sei es auch in seiner eigenen Kindheit in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gewesen. 1942 in Teplitz-Schönau geboren, besuchte Spacek eine Hotelfachschule, wurde Koch und verließ erst 1964 mit seiner Frau Renate seine Geburtsheimat Richtung Deutschland. In München führte er lange das renommierte böhmischen Lokal Sankt Wenzel in der Maxvorstadt und publizierte Bücher über die böhmische Küche. Seit Spacek im Ruhestand ist, engagiert er sich noch mehr für seine Heimatstadt und veranstaltet seit vielen Jahren immer wieder im Januar das Neujahrskonzert.
Auch dieses Jahr stellte Spacek im Adalbert-Stifter-Saal die Musiker des Abends vor: Leoš Čepický spielte die Erste Violine, Jakub Čepický die Bratsche, Michal Kanka das Cello und Jan Schulmeister die Zweite Violine. Als Gastmusiker übernahm Jiří Žigmund die Zweite Bratsche beim Quintett nach der Pause. Benannt ist das Ensemble nach Hanuš Wihan (1855–1920). Der tschechische Cellist und Musikpädagoge bildete aus Studenten des Prager Konservatoriums ein Streichquartett, das ab 1892 „Bohemian Quartet“ und nach 1918 „Czech Quartet“ hieß. Ab 1895 ersetzte Wihan selbst den erkrankten Cellisten. Das Quartett unternahm Konzertreisen durch Europa und Rußland. Wihans Nachfolger wurde sein Schüler Ladislav Zelenka, der das Quartett bis zur Auflösung 1934 leitete. 1985 erweckten Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žigmund
Sternstunde der Musik
und Aleš Kaspřík das „Wihan-Quartett“ zu neuem Leben. 2014 wurde Čepickýs Sohn Jakub Nachfolger von Žigmund und 2017 Michal Kanka Nachfolger von Kaspřík. „Das Musikensemble ist wirklich spitze“, lobte Spacek und betonte: „Musik ist die einzige Sprache, die jeder versteht.“
Zu Beginn des Abends hatte Ulf Broßmann als Vertreter der SL die Gäste im vollbesetzten Adalbert-Stifter-Saal herzlich begrüßt. „Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft ist der Auftakt 2023 gekennzeichnet durch beachtenswerte,
eindrucksvolle Veranstaltungen“, freute sich der SL-Bundeskulturreferent. Über den denkwürdigen Neujahrsgottesdienst der Sudetendeutschen in der Sankt-Michaels-Kirche in München sei ja schon in der Sudetendeutschen Zeitung von Kulturredakteurin Susanne Habel unter dem Titel „Stern über Bethlehem“ berichtet worden, erinnerte Broßmann.

„Weitere Sterne darf ich jetzt ankündigen, und zwar vier beziehungsweise fünf Sterne aus der Goldenen Stadt“, so Broßmann. Das legendäre „Wihan-
Quartett“ trete das
ße
Meisterwerken aus dem Repertoire der Streichquartette. Die Aufführungen dieser Musiker von klassischen, romantischen, impressionistischen und modernen Werken hätten sie viele Wettbewerbe und Preise weltweit gewinnen lassen. „Für uns sind sie aber auch Brückenbauer zwischen der tschechischen und der deutschen Bevölkerung“, betonte der SL-Bundeskulturreferent.
Broßmanns herzliche Begrüßung der Ehrengäste galt neben den Mitgliedern vom Freundeskreises Teplitz-Schönau und Präsidentin Charlotte Knoblauch besonders auch dem bayerischen ExStaatsminister Otto Wiesheu; außerdem dem letztjährigen SL-Kulturpreisträger für Musik, Stefan Daubner, der HDOÖffentlichkeitsreferentin Lilia Antipow und dem früheren Mitteleuropakorrespondenten der „Süddeutschen Zeitung“, Michael Frank, der 1992 bis 1998 aus Prag berichtete.
Das Konzert wurde dank der überragenden Leistung des „Wihan-Quartetts“ zu einer musikalisch herausragenden Sternstunde, wie sie Broßmann zurecht angekündigt hatte. Das Ensemble bot zunächst zu viert das Streichquartett in D-Dur Opus 64/5 von Joseph Haydn (1732–1809). Das Stück hatte Haydn 1790 komponiert, als er schon 60 Jahre alt war. Er mußte damals erstmals nach England auf Tournee gehen, da seine großzügige Förderung durch den verstorbenen Nikolaus I. Fürst Esterházy in Wien und Ungarn von dessen Sohn, Anton I. Esterházy de Galantha, nicht fortgeführt wurde. In England erkannte das Publikum im Ersten Satz sofort die jubelnden „Larks“ (Lerchen), woher die Benennung „Lerchenquartett“ stammt.


Nach den heiteren Haydn-Klängen gaben die Musiker das Streichquartett Nr. 1 in e-Moll „Aus meinem Leben“ von Friedrich Smetana (1824–1884) zum Besten. Der böhmische Komponist war bei der Komposition des Quartetts im Jahr 1876 schon zwei Jahre lang völlig taub, nachdem er zuvor lange an Tinnitus gelitten hatte. Seine Herkunft aus Leitomischl und sein ganzer Lebensweg spiegeln sich in dieser Komposition, die das „Wihan-Quartett“ sehr einfühsam interpretierte.
Lerchen und Indianer
Nach der Pause mit Sektempfang machte das Ensemble zu fünft weiter und spielte mit dem Bratschisten Jiří Žigmund das Streichquintett mit zwei Violen Nr. 1 in Es-Dur, Opus 97 von Antonín Dvořák (1841–1904). Dvořák hatte es 1893 auf seiner ersten Konzertreise nach Amerika komponiert, und zwar in der Sommerfrische mit seiner Familie im von böhmischen Einwanderern dominierten Dorf Spillville in Iowa. Ob man in dem lebhaften Werk mit vielen Variationen im Larghetto-Satz wirklich Motive aus der traditionellen Musik der indigenen amerikanischen Einwohner hören kann, ist umstritten. Auch bei Dvořáks Sinfonie Nummer 9 mit dem Titel „Aus der neuen Welt“ ist das nur in geringem Maß der Fall. Das Streichquintett, das die sommerliche Naturstimmung auf dem Land atmet, wurde im Januar 1894 in New York uraufgeführt.
Die großartige Interpretation des EsDur-Streichquintetts wurde beim Applaus so sehr bejubelt, daß die Musiker des „Wihan-Quintetts“ noch eine Zugabe boten. Mit einer eigenen Variante der Variation Nr. II des Streichquintetts von Dvořák verabschiedete sich das Ensemble vom Publikum.
Voll Bewunderung für die Leistung der Musiker zeigte sich am Ende auch Michael Frank: „Die knochentrockene und erbarmungslose Akustik in diesem Saal würde keine Fehler verzeihen“, sagte der Journalist und Autor dieser
es eben keine bei dieser Sternstunde der
Susanne
große Erbe der böhmischen Musiktradition an und genie-
weltweit einen hervorragenden Ruf für die Interpretation von
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 7
Zeitung gegenüber. Aber Fehler gab
Musik.
Habel
� Neujahrskonzert in München mit dem Wihan-Quartett Prag
Das „Wihan-Quartett“ tritt im zweiten Konzertteil als Quintett auf: Leoš Čepický (Violine), Jan Schulmeister (Violine), Michal Kanka (Violoncello), Gastmusiker Jiří Žigmund (Bratsche) und Jakub Čepický (Bratsche). Rechts: Nach dem Konzert überreicht Erhard Spacek Dankgeschenke an die Musiker, die sich über den langen Applaus freuen und eine Zugabe geben. Bilder (4): Susanne Habel
SL-Bundeskulturreferent Professor Ulf Broßmann und seine Frau Hildegard mit Erhard Spacek, Christian Graf von Clary und Aldringen mit Ehefrau Maria, alle drei vom Freundeskreis Teplitz-Schönau. Rechts hinter Graf von Clary sitzt Michael Frank.
Nach langer Zwangspause wegen Renovierung und Corona wieder ein voller Adalbert-Stifter-Saal.
Im Sudetendeutschen Haus in München eröffnete die Ausstellung „Mensch, Natur und ihre Katastrophen“. Die von Pavel Scheufler kuratierte Ausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie zeigt historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler. Der Kurator führte bei der Vernissage im Adalbert-Stifter-Saal in die Ausstellung ein, die eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder im Adalbert-Stifter-Verein (ASV) mit dem Tschechischen Zentrum München (TZM) ist.

Auch wenn die Sprache meines Großvaters und Paten, der diese Sammlung von Fotografien begründete, Deutsch war, beherrsche ich es leider nicht so gut“, erläuterte Scheufler einleitend. Daher werde er seinen Vortrag auf tschechisch halten und von Wolfgang Schwarz übersetzen lassen, so der Sammler.
Scheufler weiter: „Das Thema und vor allem die Epoche, aus der die Fotografien stammen, sind mir sehr nahe!“ Im jugendlichen Alter habe er Stefan Zweigs Roman „Die Welt von gestern“ und dessen Worte vom goldenen und sicheren Zeitalter verschlungen. „Ich bin einfach ein wenig sentimental beim Blick auf die Vergangenheit, doch ein solcher Blick ist nicht angebracht, wie auch diese Ausstellung zeigt.“
Schon im Zeitalter der historischen Bilder sei vieles entstanden von dem, was sich im 20. Jahrhundert entwickelt habe und auch viel vom Unheil im 21. Jahrhundert, wie wir gerade sähen. „Ökologische Kata-
Neue Ausstellung im Sudetendeutschen Haus
Fotos von Naturkatastrophen
Vorstandsvorsitzenden des Adabert-Stifter-Vereins und Blanka Návratová, die Leiterin des Tschechischen Zentrums als Veranstaltungspartner, die auch ein Grußwort sprach.

Der Kulturreferent für die böhmischen Länder betonte: „Selbstverständlich ist der Mensch nicht immer der Schuldige, wenn es zu Naturkatastrophen kommt. Doch nahm und nimmt er bis heute oft auch nicht ausreichend zur Kenntnis, daß seine Rolle dabei größer ist als vielleicht gedacht.“
Die Tragweite solcher Unglükke sei für die davon betroffenen Menschen schon damals enorm gewesen, wenn man an Dammbrüche, Windstürme oder Feuerbrünste denke. „Daß die Ausstellung vor dem Hintergrund einer Klimakrise natürlich auch eine ganz starke aktuelle Dimension hat, brauche ich nicht zu betonen“, so Schwarz.
strophen, auch die vom Menschen verursachten, verstärkten sich im 20. Jahrhundert dank der Industrialisierung der böhmischen Länder.“ So könne man beispielsweise die Katastrophen nach den Wirbelstürmen von 1868 und 1870 im Böhmerwald und die folgende Borkenkäfer-Plage mit Entwicklungen im Böhmerwald der heutigen Zeit durchaus gleichsetzen.


Im 19. Jahrhundert gebe es dennoch neben einer Reihe ne-
gativer Entwicklungen, die die ausgestellten Fotografien belegen, auch eine Reihe positiver Beispiele wie etwa die Gründung von Naturreservaten bis hin zum Schutz der Wälder. „Ich erinnere daran, daß gerade in Böhmen das allererste Naturschutzgebiet in Kontintentaleuropa gegründet wurde.“
Mit Absicht habe er sich daher bei der Auswahl der Aufnahmen darum bemüht, auch im letzten Teil der Ausstellung eine etwas positive Richtung zu zeigen. „Viele Katastrophen entstanden oder entstehen ohne menschlichen Einfluß“, gab Scheufler zu, aber bei vielen habe der Mensch Pate gestanden. Die Ausstellung solle eine Anregung zum Nachdenken über unseren Blick auf den Planeten Erde bieten. „Ein durch Fotografien aus einem kleinen Land in Mitteleuropa inspiriertes Nachdenken, aus der Zeit des Aufstiegs der Fotografie und der industriellen Revolution.“
Die Ausstellung gliedere sich in die fünf Teile „Kraft und Macht des Wassers“, „Kraft aus Luft, Land und Boden“, „Der Mensch als Eroberer“ und „Der Mensch als Erneuerer und Fürsorger“. Bei der Auswahl der Fotografien habe er sich auch an der Präsentation von einzelnen Persönlichkeiten orientiert. „Praktisch
alle der bedeutendsten Fotografen aus der Zeit der k. u. k. Monarchie sind vertreten.“
Die Fotografien würden aus seiner Sammlung stammen, der wohl größten tschechischen privaten Fotografiensammlung mit Bilddokumenten aus der Habsburger-Monarchie. Grundlage dafür sei die Sammlung seines Großvaters, der zu Beginn der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts begonnen habe, Positive und Negative zu sammeln. Der Großvater habe sich vor allem für die dokumentarische, keineswegs rein künstlerische Seite der Fotografie interessiert, und sich insbesondere auf Aufnahmen aus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie konzentriert.
Die Sammlung umfasse 40 000 Einzelstücke. Die umfangreichsten Fotografiesammlungen seien Aufnahmenabzüge von František Fridrich sowie Abzüge von Pferden und Schloßinterieurs von Rudolf BrunerDvořák und Stereofotografien von František Kratky.
Scheufler ermahnte: „Jeder kann, so vermute ich, seinen eigenen kleinen Teil zum Gleichgewicht des Lebens auf diesem einzigartigen Planeten beitragen, ein Gleichgewicht, das ganz offensichtlich durch menschliches Verhalten und Habgier gestört wurde.“
Zum Schluß zitierte der Sammler aus Adalbert Stifters Gedicht „Erinnerung an Friedberg“ (1930): „Wende dich ab mein Herz, von den stolzen Palästen der Hauptstadt. / Dort, wo im Abendrot goldene Streifen erglühn, / Dorthin liegt mein Land, mein dunkel geschlossenes Waldtal ...“
Vor Scheuflers Ansprache hatte Wolfgang Schwarz die vielen Gäste der Vernissage begrüßt, darunter auch Peter Becher, den
An die aktuellen Klimaveränderungen und Naturkatastrophen mögen sicher viele der Eröffnungsgäste gedacht haben beim Anblick der Ausstellungsfotos. Die durch Hochwasser 1890 partiell eingestürzte Prager Karlsbrücke ist ebenso zu sehen wie von Erdrutschen beschädigte Häuser im Riesengebirge oder vom Tagebau verursachte Schäden im nordböhmischen Brüx.


 Susanne Habel
Susanne Habel
Bis Freitag, 31. März: „Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler“ in München, Hochstraße 8, Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie. Montag bis Freitag 10.00–18.00 Uhr, Eintritt frei.
KULTUR Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 8
�
Blick in die Ausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie.
Bilder (2): Susanne Habel
Foto-Restauratorin Lucie Horucková, Pavel Scheufler, Kulturreferent Dr. Wolfgang Schwarz und TZM-Direktorin Blanka Návratová.
Jaroslav Kmodras: „Arbeit im Schacht Mayrau“, zeitgenössische Bildinschrift: „Arme Bergmanns-Brotzeit“, um 1903.
Eduard Petrák: „Jüdischer Friedhof, Burg und Fabriken in Jungbunzlau“, um 1893, halbe Stereografie, Ausschnitt.
František Fridrich: „Holzmasse vor dem Negrelli-Viadukt in Prag-Holeschowitz. 26. Mai 1872“, Kabinettkarte.
Unbekannter Fotograf. Zeitgenössische Bildunterschrift: „Die Gemeinde Brzezina nach einem Feuer am 24. April 1901“, Lichtdruck-Ansichtskarte.
Émile Joffé: „Wochenendhaus Nummer143 in Sankt Peter, das der Bach einige Meter stromabwärts trug – damals das Haus von Paul Kohl“.
Mitte Januar fand die Jahrestagung des Bundesfrauenarbeitskreises der SL mit Frauen der SdJ und Frauen der Sudetendeutschen Bundesversammlung unter dem Motto „Frauen im Dialog“ in der Bildungs- und Begegnungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen statt.

Bundesfrauenreferentin Gerda Ott begrüßte die Teilnehmerinnen, insbesondere die der SdJ. Mit dem Satz von Marie von Ebner-Eschenbach: „Man bleibt jung, solange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und einen Widerspruch ertragen kann.“ machte sie auf die Besonderheit der Tagung aufmerksam, bei der erstmals Frauen aus verschiedenen Generationen und unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen zusammen gekommen seien, um sich besser kennenzulernen.
Stefanie Januschko stimmte zwei Lieder aus den gesammelten Werken der SdJ an. Schließlich ist gemeinsames Singen eine gute Grundlage für die Verständigung, und damit wurde ein neues Ritual bei der Frauentagung eingeführt.

Claudia Beikircher leitete die Kennenlernrunde. Dabei stellte sich jede Frau Fragen wie: „Gehöre ich zur Erlebnisgeneration?“, „Bin ich Nachkomme oder Quereinsteiger?“, „Warum bin ich dabei?“ oder „Zu welcher Heimatlandschaft gehöre ich?“. Methodisch mit viel Bewegungselementen aufbereitet, wurde dies ein erfrischender Austausch.
Der zweite Tag begann mit den Liedern „Und die Morgenfrühe“ und „Von allen blauen Hügeln“, die Steffi Januschko wunderbar anleitete und auf dem Klavier begleitete. Nach dem Tagesimpuls über Wurzeln im herkömmlichen als auch im Sinne einer Verwurzelung in einer guten und gesunden Tradition und einer kurzen organisatorischen Einführung durch Gerda Ott startete MarieLuise Kotzian mit ihrem kurzweiligen Vortrag „Frauen im Dialog – vom Kaffeekränzchen zur Chatgruppe“.
Das Kaffeekränzchen sei ein altmodischer oder nostalgischer Begriff für einen festlichen Tisch mit Spitzendeckchen, Meissener oder wenigstens Hutschenreuther Porzellan, feinem Gebäck und Konfekt und duftendem Kaffee. Doch in der älteren Generation hätten sich das auch nicht alle leisten können.
Jahre später treffe man sich im Café in der Stadt und begegne dort immer vielen Frauen. Heutzutage treffe man sich – meist in altersgetrennten Gruppen –ebenfalls im Café und lasse sich Latte Macchiato oder Cappuccino schmecken, habe sein Smartphone vor sich liegen, und echte Entspannung und Gemütlichkeit fänden nur noch bedingt statt.
Die Smartwatch gebe Signale: „Sophie und Jonas von der Kita abholen.“, das Smartphone klingele: „Kommst du mit in die Zumbastunde?“.
Die Gespräche, die die Frauen früher und heute führten, drehten sich um Krankheiten, die Bewältigung des Alltags bis zu hochgeistigen Diskussionen. Häufig werde aber übereinander und nicht miteinander gesprochen. Da sei der angeblich unmögliche Kleidungsstil von Altbundeskanzlerin Angela Merkel nur ein Beispiel. Den männlichen Kommentator, der wochenlang dieselbe Krawatte trage, beanstande die Weiblichkeit nicht.
Frauen seien dem eigenen Geschlecht gegenüber oft überkritisch, anstatt sich zu solidarisieren. Liege das an den 2000 Jahren Geschichte, in denen Frauen oft als Menschen zweiter Klasse angesehen würden und deshalb nicht ebenbürtig zu sein scheinten? Liege es in den Genen? „Wir müssen das ändern“, sagte Kotzian. Frauen seien hilfsbereit. Ohne ihre Ehrenämter in sozi-
alen Bereichen gäbe es auch bei der SL viel weniger Ortsobleute. Frauen lebten gesünder als Männer, trieben mehr Sport, gingen rechtzeitig zum Arzt, kümmerten
Frauen im Dialog
chen Lage, in unserem Land die Stimme frei erheben zu können, ohne mit Repressalien rechnen zu müssen, schloß Kotzian
sich um soziale Kontakte außerhalb der engsten Familie. Frauen träten in den Dialog. Die heutige Gesellschaft sei immer noch männerdominiert. In den Medien seien meist Männer auf den Bildern, wobei die Quotenfrau irgendwo auch noch erscheinen dürfe.
Kotzian: „Wir müssen uns solidarisieren, um Gleichheit in allen Belangen des täglichen Lebens zu erreichen. Egal aus welchem Bereich die Frauen kommen. Wir müssen Foren und Plattformen gründen, um dies zu erreichen. Lernen, unsere Meinung vorzubringen, und uns nicht nach den Vorgaben der Männer richten, auch wenn dies unterschwellig verlangt wird. Die persönliche Ansicht sollte entscheidend sein, nicht die Vorgabe einer Gruppe oder Institution.“
Frauen stellten über die Hälfte der Bevölkerung und mindestens die Hälfte der SL-Mitglieder, dessen solle man sich bewußt sein. Welche Macht und Einflüsse könnten Frauen haben, wenn sie nicht übereinander, sondern miteinander sprächen.
Die Mütter des Grundgesetzes seien Elisabeth Selbert, Friederike „Frieda“ Nadig, Helene Weber – sie habe schon an der Weimarer Verfassung mitgewirkt – und Helene Wessel gewesen. Sie hätten erreicht, daß im Artikel 3 Absatz 2 die Gleichberechtigung von Frauen und Männer aufgenommen worden sei. Doch es habe bis 1971 gedauert, bis Frauen ohne Zustimmung ihres Ehemannes einer Berufstätigkeit hätten nachgehen dürfen.
Heute seien es die jungen Frauen, die sich mit Lösungen für die Rettung des Planeten beschäftigten. Die Älteren sollten mit ihnen in den Dialog treten, um die schlimmste Entwicklung auf diesem Gebiet zu verhindern. Was aus parteipolitischen oder lobbyistischen Gründen in diesem Bereich verhindert werde, müsse sich grundlegend ändern.
Den Frauen die Stimme zu nehmen heiße, sich ins Mittelalter zurückzukatapultieren. Das sähen wir an Ländern wie Afghanistan. Wir seien in der glückli-
Die anschließende Diskussion wollte kein Ende nehmen, sie zeigte Frauen im Dialog. Dann wurde mit Iris Wild Strudel gebacken. Sie hatte dafür die Zutaten und das Werkzeug mitgebracht. Erinnerungen an Großmutters oder Mutters Rezepte wurden wach. Während die einen für den Apfelstrudel die Äpfel schälten und in kleine Stücke zerteilten, die anderen für den Krautstrudel den Schinken in Würfel und das Kraut in Streifen schnitten, bereiteten wieder andere den Teig vor. Dabei wurde die Zeit der Zubereitung für generationsübergreifende Plaudereien und Erzählungen genützt, und Familienrezepte und Familienbrauchtum wurden weitergegeben.
Den Trick mit dem Geschirrtuch, mit dem der Strudel auch sanft und unbeschadet auf dem Backblech landet, wurde ebenso gezeigt wie zuvor das Ausziehen des Teiges.
Er muß so dünn sein, daß man das Muster des Geschirrtuchs sehen kann. Als alle Strudel im Ofen waren, berichtete Kriemhild Heller in Wort und Bild von ihren vielseitigen Aktivitäten in ihrem Heimatort Altwasser nahe Marienbad im Egerland.
Dank der jahrelangen guten Beziehungen mit den jetzigen Bewohnern und den Bürgermeistern seien viele Begegnungen, geradezu Freundschaften entstanden. Dies habe manche Ak-
tionen ermöglicht wie die gelungene und gut besuchte Ausstellung von historischen Fotos von Altwasser. Auch ein Deutschkurs gehöre dazu. Mit viel Zeit und Geld würden die Kontakte gepflegt und Wertvolles restauriert wie demnächst das Gefallenendenkmal.
Zuzana Finger, Stellvertretende Bundesfrauenreferentin und ehemalige Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, widmete sich dem Thema Brauchtum, Tradition und Kultur. Unter Brauchtum verstehe man die überkommenen, traditionellen und landsmannschaftlichen Gebräuche und Verhaltensweisen wie Trachten, Lieder, Gedichte, Märchen, traditionelle Volksfeste und Riten. Man spreche von Brauchtum, wenn eine in einer Gemeinschaft entstandene, regelmäßig wiederkehrende, soziale Handlung in festen, stark ritualisierten Formen stattfinde. Bräuche seien Ausdruck der Tradition. Sie dienten ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie dem inneren Zusammenhalt der Gruppe. Es gebe regionale Bräuche, religiöses Brauchtum, Bräuche im Jahreslauf, Bräuche im Lebenslauf und nicht zuletzt Bräuche der Berufe und Stände sowie Alltagsbräuche. Ebenfalls dazu gehörten Musik und Tänze. Bayern habe beispielsweise die Kuhländler Tänze als immaterielles Erbe ausgezeichnet.
Von diesen zahlreichen Beispielen des Brauchtums, der Tradition und Kultur unserer Volksgruppe ging es nahtlos über zum traditionellen Perlenbasteln mit Waltraud Valentin. Da als näch-
Frischer Wind
Das Grußwort von Volksgruppensprecher Bernd Posselt an die Bundesfrauentagung.
Mich freut, daß bei Eurer Begegnung auf dem Heiligenhof wieder einmal neue Wege der landsmannschaftlichen Arbeit erdacht, erprobt und gegangen werden. Unsere Frauen waren schon während des Krieges, während der Vertreibung und beim Aufbau der Landsmannschaft führend tätig und das Rückgrat nicht nur ihrer Familien, sondern unserer ganzen Volksgruppe.
Heute schlägt sich dies in dem Mut nieder, für das sudetendeutsche Kulturerbe und den landsmannschaftlichen Gedanken Ideen zu entwikkeln, die generationenübergreifend in die Zukunft führen. Dazu gratuliere ich und si-
chere unseren Frauen jede mir mögliche Unterstützung zu, denn ich weiß, dieses Engagement ist nicht immer einfach. Besonders beeindruckt bin ich von dem Novum, daß sich jetzt auf dem Heiligenhof erstmalig Frauen aus den verschiedenen ehrenamtlichen Bereichen und aus verschiedenen Generationen treffen und sich austauschen. Das ist frischer Wind für alle Gemeinschaften und Einrichtungen unserer vielfältigen Volksgruppe!
Dir, liebe Gerda, und Deinen Mitstreiterinnen und Gästen darf ich von Herzen viel Erfolg und Freude auf dem Heiligenhof und bei der anschließenden gemeinsamen Arbeit wünschen, die für uns alle von nachhaltiger Bedeutung ist.
stes Hochfest Ostern gefeiert wird, hatte sie sich für Ostereierbasteleien entschieden und alles dafür mitgebracht. Perlen auffädeln und damit ein Ei schmücken, ist eine Geduldsarbeit, das Ergebnis wunderschön. Wenn man allerdings den Stundenlohn berechnen würde, könnte sich wohl kaum jemand solche beperlten Eier leisten. So nahmen die Frauen nicht nur die Erinnerung an diese Tagung, sondern auch noch ein hübsches Osterei mit nach Hause.


Der dritte Seminartag begann mit dem Impuls von Birgit Unfug aus dem Johannes-Evangelium. In den Gedanken zum Tag lautete die Kernbotschaft: „Bevor wir etwas tun können und aktiv werden, werden wir von Gott beschenkt.“ Da Bräuche ein Thema der Tagung waren, regte Birgit Unfug an, als neuen Brauch das Morgenlied zu singen, das am Tag zuvor gemeinsam gesungen wurde. Das stieß auf große Zustimmung.
Gerda Ott begrüßte anschließend den Kirchenhistoriker Rudolf Grulich, der über „Große sudetendeutsche Frauen“ sprach. Seit vielen Jahren forscht und publiziert er darüber, um die bedeutenden und vergessenen sudetendeutschen Frauenpersönlichkeiten den Landsleuten nahezubringen. Er zitierte aus Josef Mühlbergers Buch „Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen 1900 bis 1939“: „Noch lebte vorweg vom Slawischen her das Matriarchalische weiter. Nicht zu unterschätzen für das Ansehen der Frau und Gattin ist der Einfluß der katholischen Marienverehrung. Daher war die Stellung der Frau in der Familie in den zumeist katholischen Ländern der böhmischen Krone anders als in protestantischen Gegenden.“
Für die Teilnehmerinnen hatte Grulich ein wertvolles Geschenk im Gepäck: „Mitteilungen des Hauses Königstein, Sonderheft 2023. Große sudetendeutsche Frauen“, dessen Vorwort er Bundesfrauenreferentin Gerda Ott gewidmet hatte, der er für ihre Bitte, bedeutende sudetendeutsche Frauen in einem Buch vorzustellen, dankte. Der voraussichtliche Erscheinungstermin ist das erste Quartal 2023.
Als einen Vorgeschmack auf das Buch versammelte Grulich im Sonderheft Aufsätze aus seiner und der Feder von Helmuth Gehrmann sowie von Hildegard Schiebe, der Vorsitzenden des Vereins Jüdisches Museum in Nidda. Schiebe war mit Grulich zur Frauentagung gekommen.
Folgende Frauen werden in dem Heft portraitiert: Evangelische Liederdichterinnen der
Brüdergemeine; Barbara Krafft (1764–1825), eine Portraitmalerin aus Iglau; Theresia Dichtl (1809–1891), eine heiligmäßige Ordensfrau aus dem Böhmerwald; Fanny Neuda (1819–1894), die mährische Verfasserin des ersten jüdischen Gebetbuchs für Frauen; Mitsuko Gräfin Coudenhove-Kalergi (1874–1941), die japanische Schloßherrin in Ronsperg; Hildegard Burjan (1883–1933), Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas socialis; Ida Ehre (1900–1981), Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin; Ida Friederike Görres/Coudenhove-Kalergi (1901–1971), Schriftstellerin und katholische Intellektuelle; Ilse Weber (1903–1944), Kinderbuchautorin, Lyrikerin, Hörfunkautorin und Musikerin; Helga Gräfin Haller von Hallerstein (1927–2017), Politikerin; Schwester Paschalis Blandina Schlömer (* 1943), Trappistin, Pharmazeutin, Ikonographin und Ikonenschreiberin; Maria Christine Freiin von Reibnitz, verheiratete Princess Michael of Kent (* 1945), Mitglied der britischen Königsfamilie; Gertrud Steinl (1922–2020) und Ruth Zielinski († 1991), Gerechte unter den Völkern; so-
wie die Nobelpreisträgerinnen Bertha von Suttner (1843–1914) und Gerty Theresa Cori (1896–1957).
Grulich berichtete, daß er nach der Vertreibung fünf Jahre lang in einer Baracke mit Mutter, Großmutter und Urgroßmutter gelebt habe, und daß ihn die Achtung dafür, was die Frauen damals für ihre Kinder und ältere Familienmitglieder geleistet hätten, nachhaltig geprägt und sein Leben gefestigt habe. Er rief auch dazu auf, die verdienten sudetendeutschen Frauen der Gegenwart stärker zu würdigen und mit Auszeichnungen zu ehren.
Da Urd Rothe-Seeliger, die zweite Stellvertretende Bundesfrauenreferentin, am 22. Dezember 2021 gestorben war, wurde eine neue Stellvertreterin der Bundesfrauenreferentin gewählt. Die einstimmige Wahl fiel auf Birgit Unfug. Sie arbeitet seit vielen Jahren in zahlreichen SLGremien, unter anderem in der Bundesversammlung. Da ihre Vorfahren aus Braunau und Saaz stammen, wurde sie ebenfalls einstimmig als Frauenreferentin für die Landschaft ErzgebirgeSaazerland gewählt.
Bei der Auswertung der Tagung erhielt Bundesfrauenreferentin Gerda Ott viel Lob für das neue Tagungskonzept und die Tagungsleitung. Die Zusammenarbeit mit der SdJ hatten die Frauenreferentinnen als inhaltliche Bereicherung empfunden. Die SdJ-Vertreterinnen waren dankbar für den Austausch mit den Zeitzeuginnen und freuten sich über das Zusammenwirken und die Vernetzung in einer Altersspanne von 25 bis 85 Jahren. Neben den theoretischen Vorträgen kam die praktische Ausübung der Bräuche gut an. Alle wünschten, den generationsübergreifenden Dialog fortzusetzen. Mit dieser Tagung war Neues erfolgreich ausprobiert worden. Die Frauen sind immer wieder für Überraschungen und andere Wege gut. tg/th/at/ar
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 9
� Bundesfrauenarbeitskreis der SL
SL-Kulturförderpreisträgerin Steffi Januschko begleitet die Tagung musikalisch. Bild: Nadira Hurnaus
Die Teilnehmerinnen danken Gerda Ott mit einer Vase mit gelben Tulpen.
Mit Perlen verzierte Ostereier beim sudetendeutschen Ostermarkt 2018 im HDO. Bild: Susanne Habel
Stellvertretende Bundesfrauenreferentin Birgit Unfug, Marie-Luise Kotzian, Claudia Beikircher, Margaretha Michel, Waltraud Valentin, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dorothea Hägele, Ilse von Freyburg, Annegret Kudlich, Bundesfrauenreferentin Gerda Ott, Iris Wild, Kriemhild Heller, Stellvertretende Bundesfrauenreferentin Zuzanna Finger, Helene Wild, Erna Kohl, Dietmar Heller und Hildegard Schiebe. Bilder (2): Horst-Peter Wagner
Aufarbeitung und Versöhnung
Mitte Januar traf sich die oberfränkische SL-Ortsgruppe Naila zum ersten Mal im neuen Jahr.
Mit einem zusammenfassenden Rückblick auf das ereignisreiche Veranstaltungsjahr 2022 erarbeiteten die Landsleute das Programm für heuer. Durch den verbrecherischen Krieg Putin-Rußlands gegen die Ukraine rückte vor allem die Vertreibungsproblematik im Vergleich zu den Vertreibungsverbrechen 1945/46 gegen 15 Millionen Ost- und Südostdeutsche in den Fokus. SL-Vize-Bezirksobmann Adolf Markus begrüßte zusätzlich den Bürgermeister und Stellvertretenden Landrat Frank Stumpf.
Es sei notwendig, mit den immer älter werdenden Zeitzeugen der Erlebnisgeneration die dunklen Seiten der Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten. Dies gelte nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Vertreiberstaaten der ehemaligen sowjetisch-stalinistischen Ostblockstaaten.
Das behindere nicht nur das lange schon eingeleitete Versöhungsstreben, zum Beispiel zwischen den Sudetendeutschen und den Tschechen. Es beschleunige gerade in dieser höchst unruhigen weltpolitischen Lage den Verständigungsprozeß hin zu mehr Frieden. Die Aufarbeitung der geschichtlichen Wahrheit müsse jetzt von den heimatpolitischen und gesellschaftlichen Führungskräften mitsamt eines objektiv ausgerichteten Journalismus der öffentlichrechtlichen Medien gefördert werden.


Was heute unter den Teppich gekehrt werde, fange morgen zu stinken an, stellte Obmann Markus fest. Die Problematik dürfe nicht an die Historiker verwiesen werden, sondern müsse jetzt behandelt werden.
Bürgermeister Stumpf sprach des Gefühl und das Trauma der Menschen an, denen Eigentum und Heimat weggenommen worden seien. Aufarbeitung und Information seien um so notwendiger angesichts der ständigen Machtergreifungen. Der jungen Generation müßten die wahren gesellschaftspolitischen Zusammenhänge zur Konfliktbewältigung vermittelt werden.
Der Bürgermeister bestärkte die SL-Mitglieder und bezog sich auf ihre Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Adolf Markus und Frank Stumpf ehrten im Namen von
Volksgruppensprecher Bernd Posselt das langjährige Vorstandsmitglied Kriemhild Zeh mit der SL-Verdienstmedaille „Dank und Anerkennung“ sowie Vize-Ortsobmann Jürgen Nowakowitz mit dem Großen Ehrenzeichen der SL. Obmann Markus konnte Heidrun Zenk als neues Mitglied begrüßen.

Aus der fast 1000jährigen Geschichte der Sudetendeutschen Volksgruppe mit reichhaltiger Wirtschaft und Kultur in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien streifte Obmann Adolf Markus die Biografie dreier Persönlichkeiten.
Gregor Mendel, der Vater der Vererbungslehre, wurde vor 200 Jahren im Kuhländchen in Ostmähren geboren. Mit seinen drei Mendelschen Gesetzen als Grundlage der Genetik wurde Mendel erst anhand von Pflanzenkreuzungen Anfang des 20. Jahrhunderts von weltberühmten Botanikern als Pionier der Vererbungslehre anerkannt.
Vor 101 Jahren starb der letzte Kaiser der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie Kaiser Karl I., der Vater des Paneuropa-UnionPräsidenten Otto von Habsburg, im Exil auf Madeira. Nach seinen großen Friedensbemühungen im furchtbaren Ersten Weltkrieg ging er als Friedenskaiser in die Geschichte ein und wurde 2004 seliggesprochen.
Die SLVersammlung gedachte des verstorbenen Papstes Benedikt XVI., der als bayerischer Papst für die Sudetendeutschen als Vierter Stamm Bayerns auch ihr sudetendeutscher Papst war. Sie würdigten Benedikt als prägende Gestalt der Katholischen Kirche, als einen Menschen, dessen Weisheit, lebendige Liebe zum Glauben und intellektueller Glanz unseren Respekt verdienten. Erschüttert zeigte sich die Versammlung über Vorverurteilung und Denunziation dieses Papstes, der im Vatikan gezielt die meist alten Mißbrauchsfälle aller Welt anging.
Für die künftige Vertriebenenarbeit kritisierte die Versammlung die Ministerinnen der Ampel-Regierung, Nancy Faeser und Claudia Roth, die die Fördermittel für notwendige Kulturarbeit der Vertriebenenverbände gekürzt und dafür die Förderzuschüsse für die Bekämpfung des Anti-Islamismus erhöht hätten. Da stelle sich die Frage, ob die Vertriebenen in dieser schwindenden „christlichen Abendlandgesellschaft“ mit ihren Grundwerten ein Störfaktor geworden seien. fs
Ein bißchen mehr Frieden und weniger Streit
Mitte Januar traf sich der hessische Altkreis Lauterbach zu seinem ersten Sudetendeutschen Stammtisch im neuen Jahr im Lauterbacher Gasthof Felsen-
Kreisobmann Karl Hans Wienold begrüßte die Landsleute sehr einfühlsam mit dem bekannten Gedicht des österreichischen Schriftstellers Peter Rosegger (1843–1918) „Wünsche zum neuen Jahr“: „Ein bißchen mehr Friede und weniger Streit, / Ein bißchen mehr Güte und weniger Neid, / Ein bißchen mehr Liebe und weniger Haß, / Ein bißchen mehr Wahrheit – das wäre doch was! // Statt so viel Unrast ein bißchen
mehr Ruh‘, / Statt immer nur Ich ein bißchen mehr Du, / Statt Angst und Hemmung ein bißchen mehr Mut / Und Kraft zum Handeln – das wäre gut! // Kein Trübsal und Dunkel, ein bißchen mehr Licht, / Kein quälend Verlangen, ein bißchen Verzicht, / Und viel mehr Blumen, solange es geht, / Nicht erst auf Gräbern – da blüh‘n sie zu spät!“




Damit schuf er gleich einen aktuellen Bezug zu unserer heutigen Zeit. Denn bei diesem mehr als 100 Jahre alten Gedicht gehe es vor allem um das Miteinander, um das friedliche Zusammenleben der Menschen, egal wo auf der Welt. Deshalb sollte man nicht immer nur an sich selbst denken, sondern den an-
deren, wenn nötig, auch mal unterstützen. Auch wenn die Welt immer moderner werde, so sollten sich die Vorstellungen über Moral und Gesetze möglichst nicht ändern. Dies alles drücke Peter Rosegger mit den Worten „Ein bißchen mehr Frieden und weniger Streit“ recht tiefsinnig aus, so Wienold.
Der Kreisobmann ging dann auch auf das diesjährige Vereinsprogramm ein und wies besonders auf die geplante Osterreise nach Görlitz und Bautzen hin, für die noch einige Plätze frei seien. Anmeldungen nehme der BdVKreisvorsitzende Siegbert Ortmann entgegen, Telefon (0 66 41) 9 78 48 97, eMail s.ortmann@ posteo.de
� SL-KG Nordvorpommern Es läuft auch ohne Leiter
Anfang Dezember traf sich die mecklenburg-vorpommersche SL-Altkreisgruppe Nordvorpommern in Zingst zum Adventskaffee. Kreisobmann Peter Barth berichtet.


Selbstgebastelte Stiefel
Anfang Dezember feierte die mecklenburg-vorpommersche SL-Kreisgruppe Rostock in der Begegnungsstätte RostockReutershagen Weihnachten.



Neben der Kreisgruppe Nordvorpommern sind wir die einzige Kreisgruppe der einst so schlagkräftigen Landesgruppe von Mecklenburg-Vorpommern. Dabei stammten mehrere Kreisobleute aus dem Riesengebirge, so neben Rostock und Nordvorpommern auch Stralsund, Neubrandenburg und Friedland. Auch im Landesvorstand war diese Region mit dem Vizelandesobmann, dem Vermögensverwalter sowie dem Kul-
tur- und Presseverantwortlichen stark vertreten. Ein eigenes Mitteilungsblatt wurde herausgegeben. Viele Jahre besuchten der Volksgruppensprecher, Vertreter des EU-Parlamentes sowie des Bundes- und Landtages die Landestreffen. Und bei den Sudetendeutschen Tagen betrieb die Landesgruppe einen eigenen Stand.
Zur Weihnachtsfeier in der festlich geschmückten Begegnungsstätte waren 25 Personen gekommen, darunter Landesobmann Wolfgang Zeisler. Heimatfreundin Marianne Wagner, die still und unauffällig die Leitung der Gruppe übernommen hatte, nachdem sich unser bisheriger Kreisobmann ohne jedwe-
de Verabschiedung ins Ausland abgesetzt hatte, eröffnete mit einem stimmungsvollen Gedicht. Auf der Tafel fand jeder Besucher in einem selbstgebastelten Stiefel einen Weihnachtsmann, als Glücksbringer einen Schornsteinfeger sowie ein kleines Fläschchen. Eine Heimatfreundin hatte auch noch selbstgebakkene Liwanzen mitgebracht. Gesprächsthemen waren die schönen Weihnachtserinnerungen an zu Hause und die ersten Weihnachten nach der Vertreibung – welch eine Unterschied. Heute ist leider in der Allgemeinheit der Kommerz eingezogen.
 Maria Salomon Peter Barth
Maria Salomon Peter Barth
Wegen einer starken Erkältung hatte ich Bedenken teilzunehmen, schließlich gehören alle unsere Besucher zu der besonders gefährdeten Altersgruppe. Nun danke ich Helga Neumann und Oskar Kühnel, beide Soor, die kurzfristig selbständig die Organisation übernahmen wie Raumvorbereitung, Besorgung der Verpflegung sowie Raumübergabe. Gekommen waren zum wiederholten Mal Regina Scheel, Tochter von Brigitte Walter (Reichenberg), und Horst Kubant (Gablonz) beide potentielle neue Mitglieder. Und anwesend waren die Heimatfreunde nicht nur von Zingst, Darß und Fischland – auch Edith Niepel, Ortsbetreuerin von Soor im Riesengebirge, war wieder zu ihren Schäfchen gekommen.


Bei Kaffee und weihnachtlichem Gebäck kam es zu anregenden Gesprächen, wobei natürlich auch der Ukraine-Krieg, vor allem aber Weihnachten zu Hause und die ersten nach der Vertreibung interessante Themen waren. Und natürlich wurde auch das Aus der „Riesengebirgsheimat“ in der bisherigen Zeitschriftenform bedauert.
Leider nahm unsere Geburtstagsfee und Kassiererin Edeltraud Schmidt ebenfalls wegen Erkrankung nicht teil. So war es auf Grund der kurzfristigen Umstellung leider nicht möglich, bereits die Beiträge für 2023 zu kassieren. Aber das Jahr hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht einmal begonnen und wir wollen uns ja bald wieder treffen.
Vor etwa 30 Jahren hatte ich schon einmal erlebt, was eine gute Vertretung wert ist. Bei meinem Umzug von Bitterfeld an die Ostsee führte Anni Wischner meine Arbeit nahtlos weiter. Heute ist der Altkreis Bitterfeld die einzige noch aktive SLGruppe in Sachsen-Anhalt, auch wenn sie von 300 Mitgliedern auf etwa 80 Mitglieder geschmolzen ist. Das ist der Lauf der Zeit, den wir nicht beeinflussen können. Die Kreisgruppe Stralsund, einst die aktivste Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern mit Chor, aktiver Mundartpflege und umfassender Reisetätigkeit, zerfiel nach
keller.
VERBANDSNACHRICHTEN Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 10
� SL-Altkreis Lauterbach/Hessen
� SL-Kreisgruppe Rostock/Mecklenburg-Vorpommern
der Krankheit von Kreisobmann Günther Scholz (Schurz) praktisch ins Nichts.
Edith Niepel (Soor), Oskar Kühnel (Soor) und Horst Kubant (Gablonz). Bilder Robert Arnold
Yvonne Arnold (Ketzelsdorf), Helga Neumann (Soor) und Regina Scheel, (Reichenberg).
Sudetendeutscher Stammtisch im Lauterbacher Gasthof Felsenkeller.
� SL-Ortsgruppe Naila/Oberfranken
SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Vize-Bezirksobmann Adolf Markus und die Geehrten Kriemhild Zeh und Jürgen Nowakowitz sowie Bürgermeister Frank Stumpf.
Unsere weihnachtlich geschmückte Kaffeetafel. An der Stirnseite Marianne Wagner, links stehend unser nordostdeutscher Rübezahl Heinz Berger, bekannt auch von Treffen in Würzburg, Barth, Ribnitz-Damgarten und Zingst.
Bild: Christel Kaschke
Mitte Januar referierte Nadja Atzberger beim Monatstreffen der bayerisch-schwäbischen SLOrtsgruppe über die Westukraine.
M




it Nadja Atzberger hatte die SL-Ortsgruppe nicht nur eine junge, sondern vor allem eine kompetente Referentin gewonnen. Als Landesvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft Ruthenien berichtete sie fachkundig über die Geschichte der einst zu Ungarn gehörenden Region, über die Lage der deutschen Minderheit in der Karpatenukraine und über die langfristigen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges. Als Kind eines deutschen Vaters und einer ukrainischen Mutter kam sie als 13jähriges Mädchen mit ihrer Familie als Spätaussiedler nach Deutschland. Um die Kultur, die Traditionen und die Geschichte ihrer Landsleute nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, engagiert sie sich seit 2016 ehrenamtlich in ihrer Landsmannschaft.
Transkarpatien war den meisten Zuhörern kaum bekannt. Die deutsche Besiedelung des Landes begann 1711 unter dem
Adelsgeschlecht derer von Schönborn. Handwerker und Bauern folgten ihrem Ruf vorwiegend aus Süddeutschland und Böhmen, später auch aus Oberösterreich. Da man den Siedlern günstige Bedingungen und Land bot, erfuhr die Region als Teil des Habsburgerreichs fortan einen ungeheuren Modernisierungsschub. Um 1888 siedelten um Mukatschewo überwiegend in deutschen Dörfern knapp 32 000 Deutsche. Wie in allen deutsch besiedelten Regionen der Sowjetunion begann der Exodus der deutschen Bevölkerung während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Rutheniendeutsche wurden nach Sibirien deportiert, nach 1990 begann schließlich die Welle der Aussiedlung. Heute leben nur noch 3000 deutsche Bewohner in der Karpatenukraine. Trotz fehlenden Sprach-
unterrichts werden die Dialekte bis heute gepflegt und weitergegeben und die deutschen Feiertage begangen.

Unterstützung erhalten die dort lebenden Deutschen vom Auswärtigen Amt und ihren Landsleuten in der Bundesrepublik. Standen bis vor gut einem Jahr Heimattreffen und Reisen in die Westukraine im Mittelpunkt der Tätigkeit der kleinen Landsmannschaft, steht seit dem Angriffskrieg Rußlands die Unterstützung der deutschen Familien und der Binnenflüchtlinge im Mittelpunkt. Bereits zu Beginn des Krieges gab es viele Aktionen und Hilfssammlungen auch für Krankenhäuser und Kinderheime. „Auch heute bemühen wir uns, die dortigen Organisationen zu unterstützen und mit ihnen Kontakt zu halten“, so Atzberger.
Abgesehen von der Ankunft einer immer größer werdenden Zahl von Binnenkriegsflüchtlingen sei die Karpatenukraine bislang von Kriegshandlungen verschont geblieben. Möglicherweise sei dies auf die überwiegend dort lebende ungarische Bevölkerung zurückzuführen. Die oft kritisierte vorsichtige Haltung von Ungarns Staatspräsident Viktor Orban sei sicher auch auf dessen Fürsorge für die starke ungarische Minderheit in der Ukraine zurückzuführen. Bemerkbar machten sich jedoch seit kurzem die Auswirkungen der in der übrigen Ukraine zerstörten Infrastruktur. Die Stimmung sei zwar angespannt, der Zusammenhalt aber riesengroß. Selbst die russischen Bewohner in der Ukraine solidarisierten sich zwischenzeitlich klar mit der Mehrheitsbevölkerung und zeigten sich kämpferisch für eine unabhängige Ukraine. Perfekt scheint aber auch Wladimir Putins Propaganda in den russischen Medien zu wirken. „Meine Verwandten in Moskau fragen uns besorgt, ob wir in Deutschland genügend zu essen hätten“, berichtete Atzberger kopfschüttelnd.
Eine Jadgszene aus den Pollauer Bergen
Wildentenjagd in den Pollauer Auwäldern! Immer wenn ich hierher komme, ist es mir, als käme ich nach Hause zurück, so vertraut umfängt mich diese Landschaft, die ich so sehr liebe.
Von den Hängen der Pollauer Berge grüßt das Bergdorf Pollau ins sonnige Land hinab, und seine alte, aus massiven, grauen Steinquadern erbaute Kirche wirkt wie eine Trutzburg. Am Fuße der Berge die Weindörfer Unter- und Oberwisternitz, dann Bergen eingeschmiegt in den Bergeinschnitt der Klause. Weiter der reiche Weinort Untertannowitz und verschwimmend im Dunst der Ferne die Türme von dem alten Städtchen Nikkolsburg. Wir aber kommen von Auspitz und schreiten rüstig aus. Es blühen die Weingärten, und ein feiner Duft nimmt uns auf. Da gedeihen der herbe Riesling, der rote und weiße Veltliner, dessen feine Blume, Buschbettel, man rühmt. Der süße Muskateller, der rote Burgunder, der blaue Portugieser und viele andere, deren guter Ruf Südmähren als Weinland bekannt gemacht hat. Die Wege, die durch die fruchtbaren, tauüberglänzten Felder und Rebgärten führen, überblüht von blauer Wegwarte. Vor sich der Blick auf die steil aufragende Silhouette der Pollauer Berge, die das freundschaftliche Landschaftsbild beherrschen. Die frischen Wiesen von bunten Farbflecken überschüttet, die üppig wuchern zwischen schlanken zitternden Gräsern, Kuckucksnelken, Hahnenfuß, Margariten und Wiesenglocken. Unter der blauen Himmelsglocke flimmert die Luft im Sonnenglast. Der Ruf der Unken und Frösche schwillt an, unterbrochen vom heiseren Schrei der Möwen, die zu Hunderten längs der Thaya hinstreichen und ihre Leiber in elegantem Flug im Sonnenlicht baden. Eine Wildentenmutter gleitet, ihre Jungen hinter sich herlokkend, ins schützende Schilf.

Der erste Schuß peitscht durch die Luft, und erschreckt steigt eine große Kette Wildenten auf. Dunkle Gesellen sehe ich zwischen ihnen. Das sind Wasserhühner und kleinere schnepfenartige Vögel mit spitz vorgestreckten, langen Schnäbeln, Bekassinen. Vielfältig und einzigartig ist die Tierwelt hier. Im hohen Schilf nistet die heimliche Rohrdommel, in den Lüften ziehen Seereiher mit weitausgespannten Flügeln majestätisch ihre Kreise. Selbst Störche, die im mährischen Raum selten sind, nisten da. Und zu Okuli streichen die Schnepfen übers Land. Wenn aber die ersten Novemberstürme das bunte Laub vor sich hinfegen, lassen sich die schöngezeichneten, silbergrauen Wildgänse in mächtigen Schwär-
und mit Hunden und Kähnen wird nach verlorengegangenem Wild gesucht. Wir bleiben zum Abendanstand.
Der Himmel wird nun blässer, die Tierstimmen verstummen langsam, nur noch der Chor der Grillen beherrscht den Raum, den abendlichen Frieden nicht störend, ihn noch unterstreichend. Der hohe Schatten der Pollauer Berge mit den Ruinen seiner Burgen, der Maidenund der Rosenburg, zu denen ich so gerne hinblicke, wird länger. Noch mächtiger scheinen sie, die Stolzen, im fahlen Grau des hereinbrechenden Abends. Ruhe und Stille umfangen das Landschaftsbild, und ich sitze neben meinem aufhorchenden, jagdbereiten Mann und träume in den Frieden der schönen Natur hin-
cherseits fest verwurzelt durch dreieinhalb Jahrhunderte mit Brünn, aber mütterlicherseits? Da finde ich, was ich ahnte! Der Urgroßvater herrschaftlicher Jäger in Südmähren! Und ich sinne in die Landschaft hinein: Hast du, Ahne, dieses Land so sehr geliebt, daß diese Liebe mit dir nicht sterben konnte, daß sie weiterleben mußte in einem, der einen Tropfen deines Blutes trug?
Still und versonnen treten wir den Heimweg an. Stärker ist in der Kühle der Nacht der Duft der blühenden Rebgärten, der uns umfängt. Ich sinne den alten Riednamen nach, die durch Generationen sich fortpflanzten, wie der letzte Hauch aus dem Munde der Menschen, die hier den Boden umbrachen, in der von Erdgeruch erfüllten Luft und genau so wie heute mit Schere und Blindschnur durch die Weingärten schritten. Sind die Schweißtropfen all dieser Menschen nicht zu den Rebperlen geworden?
Der Schriftsteller, Journalist, Publizist, Drehbuchautor und Herausgeber Friedrich Torberg (1908–1979) entstammte einer deutsch-jüdischen Prager Familie. Mit seinem Roman „Der Schüler Gerber“ katapultierte er sich in die legendäre Prager deutsche Dichterszene, 1933 wurde er verboten, 1940 emigrierte er in die USA, 1951 kehrte er nach Wien zurück. Hier eine Kostprobe aus seinem Buch „Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes“.
Sie ist 1932 gestorben, friedlich und schmerzlos, von Ärzten betreut, von der Familie umsorgt, zu Hause und im Bett – wie damals noch gestorben wurde (und wie es bald darauf so manchem ihrer Angehörigen nicht mehr vergönnt war).
Kurz vor dem Ende offenbarten sich ihr Charakter und ihre Lebensweisheit in einem letzten Ausspruch, mit dem sie das Geheimnis ihrer weithin berühmten Kochkunst preisgab – und zu dem eine in jeder Hinsicht passende Vor-Geschichte gehört.
Gleich allen wahren Köchinnen, die ihre Kunst im häuslichen Gehege ausüben – es wird von ihnen noch die Rede sein –, war auch die Tante Jolesch ausschließlich auf die Genußfreude und das Wohlbehagen derer bedacht, denen sie ihre makellos erlesenen Gerichte auftischte. Es sollte den anderen munden, nicht ihr. Sie selbst begnügte sich damit, ihren Hunger zu stillen. Als man sie einmal nach ihrer Lieblingsspeise fragte, wußte sie keine Antwort.
Jahrelang versuchte man der Tante Jolesch unter allen möglichen Listen und Tücken das Rezept ihrer unvergleichlichen Schöpfung herauszulocken. Umsonst. Sie gab‘s nicht her. Und da sie mit der Zeit sogar recht ungehalten wurde, wenn man auf sie eindrang, ließ man es bleiben. Und dann also nahte für die Tante Jolesch das Ende heran, ihre Uhr war abgelaufen, die Familie hatte sich um das Sterbelager versammelt, in die gedrückte Stille klangen murmelnde Gebete und verhaltenes Schluchzen, sonst nichts. Die Tante Jolesch lag reglos in den Kissen. Noch atmete sie. Da faßte sich ihre Lieblingsnichte Louise ein Herz und trat vor. Aus verschnürter Kehle, aber darum nicht minder dringlich kamen ihre Worte:

„Tante – ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht mitnehmen. Willst du es uns nicht hinterlassen? Willst du uns nicht endlich sagen, wieso deine Krautfleckerln immer so gut waren?“


men aus den gespenstisch geballten dunklen Wolkenfetzen zu oft wochenlanger Rast nieder. Von Wildenten hat man allein 15 verschiedene Arten gezählt.
Selbstverständlich dürfen der putzige Meister Lampe, der viel Äsung in den fruchtbaren Feldern findet, nebst Massen von Rebhühnern und Fasanen und das scheue Reh in den Auwäldern nicht vergessen werden. Auf den Hängen der Pollauer Berge äsen Rudel von Muffelwild, die, vor Jahrzehnten ausgesetzt, hier heimisch wurden, und das größere Dammwild mit seinen flachen Schaufeln. Als Polizist unter allen der listige Fuchs, der mit langer Rute abends heimlich durch die Sträucher streift. Die Tierlaute, die die Stille der Landschaft beherrschen, sind eine vertraute, liebgewordene Sprache für mich. Reich ist die Jagdstrecke,
ein. Vor uns auf der Waldwiese purzeln und tollen zwei Hasenpärchen in verliebtem Spiel. Da teilen sich am gegenüberliegenden Waldrand die Sträucher. Eine Rehgeiß tritt auf hohen Läufen hinaus. Die Lauscher sichern, und in kurzem Abstand folgen zwei Kitze. Ruhig fängt sie nun zu äsen an.
Hinter uns fallen Wildenten patschend ins Wasser, dann wieder Stille. Immer mehr erlischt das fahle Licht. Da höre ich ein eigentümliches, leises Rauschen über unseren Köpfen. Ich blikke auf und sehe eine weiße Eule, die geheimnisvoll vorübergleitet. Nun wieder Ruhe. Warum liebe ich diesen Raum so sehr, daß es mir das Herz zusammenzieht? Fast mehr liebe als Brünn, meine Vaterstadt, wohin ich doch seit Urväterzeit gehöre?
Und einmal nehme ich mein Ahnenbuch und suche. Väterli-


Da liegen der Hasel- und Mosergrund, der Herrenhübl und der Fohwind, dort die Ganzlahn und Halblahn, der Liebling und der Minnichberg. Hier gehen wir am Treml und beim Langensatz vorbei, drüben liegen der Honneflont und die Sauleiten und weiter gehts am Rosenberg, Veiglberg, der Uneh, dem Holzbichl und den Sauröseln vorbei. Altes deutsches Land! Mein Sonnenlandl, wie ich es immer gerne nannte. Niemals werde ich es wiedersehn!

Fortgejagt und fortgetrieben von der verwurzelten Heimaterde. Deutsches Südmähren! Die, welche dich kannten, in deiner breiten, behaglichen Ruhe, du Land der jahrhundertealten deutschen Bauernhöfe, der ebenso alten, gepflegten Rebgärten und fruchtbaren Felder, vergessen dich nie. Ich grüße euch, Pollauer Berge, ihr Kronen des schönen Südmährerlandes. Wir haben euch eingebettet in unsere Herzen, die eine neue Heimat suchen müssen und finden wollen. Alice Zitka
Wäre es nach den Verehrern ihrer Kochkunst gegangen, dann hätte sie sich als Abschiedsmahl ihre eigenen Krautfleckerln zubereiten müssen, jene köstliche, aus kleingeschnittenen Teigbändern und kleingehacktem Kraut zurechtgebackene Mehlspeis, die je nachdem zum Süßlichen oder Pikanten hin nuanciert werden konnte: in der ungarischen Reichshälfte bestreute man sie mit Staubzucker, in der österreichischen mit Pfeffer und Salz. Krautflekkerln waren die berühmteste unter den Meisterkreationen der Tante Jolesch.
Wenn es ruchbar wurde, daß die Tante Jolesch für nächsten Sonntag Krautfleckerln plante – und es wurde unweigerlich ruchbar, es sprach sich unter der ganzen Verwandtschaft, wo immer sie hausen mochte, auf geheimnisvollen Wegen herum, nach Brünn und Prag und Wien und Budapest und (vielleicht mittels Buschtrommel) bis in die entlegensten Winkel der Puszta –, dann setzte aus allen Himmelsrichtungen ein Strom von Krautfleckerl-Liebhabern ein, die unterwegs nicht Speise noch Trank zu sich nahmen, denn ihren Hunger sparten sie sich für die Krautfleckerln auf, und den Durst löschte ihnen das Wasser, das ihnen in Vorahnung des kommenden Genusses im Mund zusammenlief. Und ein Genuß war‘s jedesmal aufs Neue, ein noch nie dagewesener Genuß.
Die Tante Jolesch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf: „Weil ich nie genug gemacht hab …“ Sprach‘s, lächelte und verschied. Damit glaube ich alles berichtet zu haben, was ich zur Ehre ihres Andenkens zu berichten weiß. Ein kleiner Nachtrag noch, der diesem Andenken keinen Abbruch tun wird: Die Tante Jolesch war nicht schön. Zwar drückten sich Güte, Wärme und Klugheit in ihrem Gesicht zu deutlich aus, als daß sie häßlich gewirkt hätte, aber schön war sie nicht. Tanten ihrer Art waren überhaupt nicht schön. Ein Onkel meines Freundes Robert Pick hatte etwas so Häßliches zur Frau genommen, daß sein Neffe ihn eines Tags geradeheraus fragte: „Onkel, warum hast du die Tante Mathilde eigentlich geheiratet?“ Der Onkel dachte eine Weile nach, dann zuckte er die Achseln: „Sie war da“, sagte er entschuldigend.
Von solch exzessiver Häßlichkeit konnte bei der Tante Jolesch nun freilich keine Rede sein, und sie ihrerseits hat nach „schön“ oder „häßlich“ erst gar nicht gefragt, für sie fiel das unter den gleichen Begriff von „Narrischkeiten“ wie die Frage nach ihrer Lieblingsspeise. Sie war davon durchdrungen, daß man derlei Äußerlichkeiten nicht wichtig zu nehmen hatte, und wer das dennoch tat, setzte sich ihrem Tadel, wo nicht gar ihrer Verachtung aus.
Als einer ihrer Neffen auf Freiersfüßen ging und zum Lob seiner Auserwählten nichts weiter vorzubringen hatte als deren Schönheit, bedachte ihn die Tante Jolesch mit einer galligen Zurechtweisung: „Schön ist sie? No und? Schönheit kann man mit einer Hand zudecken!“
Nein, sie hielt nicht viel von Schönheit, bei Frauen nicht und schon gar nicht bei Männern. Und so schließe denn dieses Kapitel mit einem Ausspruch, der die Tante Jolesch nicht nur in sprachlicher Hinsicht auf dem Höhepunkt ihrer Formulierungskraft zeigt: „Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus.“
VERBANDSNACHRICHTEN AUS DER HEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 11 � Südmähren
� SL-Ortsgruppe Aichach/Bayerisch-Schwaben Lage angespannt, Solidarität
� Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten Die Tante Jolesch
ungebrochen
Blick auf Pollau. SCHICKSALSGEMEINSCHAFT EUROPA 26 . BIS28 . MAI 20 2 3 IN REGENSBURG 7 3. SUDETEND E UTSCHER TA G
Nadja Atzberger und SLOrtsobmann Gert-Peter Schwank. Bild: Susanne Marb
Neudeker Heimatbrief

für die Heimatfreunde au+ Stadt und Landkrei+ Neudek
Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Jahresbezugspreis 31,25 EUR. Konto für Bezugsgebühren und Spenden: Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft, Stadtsparkasse
Am Silvesterabend kamen wir von unserem sechsten Hilfstransport in die Ukraine zurück. Bei der Fahrt ins Landesinnere schlug eine Rakete in ein Wohnhaus neben der Straße ein. Diese Stelle hatten wir ein paar Minuten vorher passiert. Doch wie komme ich, ein Neideker Bou, dazu, mich mit meinen 82 Jahren – ich kam am 3. April 1940 in Neudek zur Welt – solchen Gefahren, körperlichen und psychischen Strapazen auszusetzen?
Wir sind vier Männer aus der Region Oberschwaben-Bodensee. Thomas Ruf lebt in Maselheim im Kreis Biberach, Christof Ronge und ich leben in Tettnang im Bodenseekreis und Manuel Mehltretter lebt in Weingarten im Kreis Ravensburg. Wir fanden uns unmittelbar nach der Invasion Rußlands in die Ukraine am 24. Februar auf rein privater Basis zusammen, um aus Eigeninitiative Hilfe zu leisten. Inzwischen ist daraus ein effizientes, gut vernetztes, zielgenaues und bedarfsorientiertes Unternehmen geworden. Mittlerweile hat dieses Team zehn Transporte gefahren.



Wir fahren mit zwei Transportern die Nacht durch, um nach 18 oder 20 Stunden Fahrt in Lemberg, unserem Hauptstützpunkt, anzukommen. Nach oft 40 Stunden ohne Schlaf fallen wir in Tiefschlaf, um nachts von halbstündigem Alarm hochgerissen zu werden. Warum mache ich das?
Ich gestehe, daß ich auf diese Frage keine abschließende Antwort habe. Aber ich bin sicher, daß mein Vertreibungserlebnis damit zu tun hat. Ich war sechs Jahre alt, als meine Familie am 20. April 1946 – es war ein Karfreitag – mit dem dritten Transport aus dem Kreis Neudek mit insgesamt 1222 Personen in Viehwaggons über Karlsbad, Eger, Augsburg nach Burgau ins bayerische Schwaben vertrieben wurde. So bin ich eine Art Beute-Bayer geworden.
Ich bin dort in die Schule gegangen, und ich wurde von den einheimischen Buben bestens aufgenommen. Ich wurde kein einziges Mal abgelehnt. Und heute noch, obwohl ich mit 19 Jahren von dort weggegangen bin und draußen in der Welt war, hängt mein Herz an dieser Stadt.
Die Vertreibung selbst hat mich nie interessiert.
Ich war zu jung und zu arrogant dafür, dieses Ereignis in seiner Tiefendimension zu verstehen.
Als ich jedoch im Alter von etwa 60 Jahren vor den von Wald überwachsenen Grundmauern des zerstörten Bauernhau-
Neideker Bou fährt Hilfsgüter in die Ukraine
ses meiner Großeltern väterlicherseits auf dem Tellerer bei Ullersloh in 860 Metern Höhe stand, war ich wie vom Blitz getroffen. Und als ich am nächsten Tag auf dem Neudeker Friedhof völlig unerwartet vor dem Grab dieser Großeltern stand, da ha-
hatte es sogar genossen, weil es mir – vermeintlich – die Möglichkeit gegeben hatte, überall dazu zu gehören. In Wirklichkeit war es aber doch nicht so. Und jedes Mal, wenn wir auf unseren Ukraine-Fahrten am Übergang Waidhaus Richtung Pilsen und Prag abbiegen und an der Ausfahrt Karlovy Vary/Karlsbad vorbeikommen, spüre ich tief innen ganz deutlich ein Gefühl von Heimat.
be ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Gefühl von Heimat gespürt. Dieses Gefühl sagte mir: „Da gehöre ich hin.“ Bis dorthin war eines meiner Grundgefühle das Gefühl von Heimatlosigkeit. Das hatte mich nicht gestört, ich

Was machen wir konkret in der Ukraine? Wir versorgen Kinderheime, Kinderkrankenhäuser und Waisenhäuser, in denen Kinder untergebracht sind, die ihre Eltern bei den Kämpfen verloren haben oder die auf der Flucht verloren gegangen sind, mit Nahrung, Kleidung und Hygieneartikeln. Auf unserem letzten Transport verteilten wir 350 Weihnachtspakete an krebskranke Kinder in Lemberg und der weiteren Um-




gebung. Das Glück dieser Kinder ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat, nicht vorstellbar. Wir versorgen Krankenhäuser in dieser Region mit Medikamenten, medizinischem Gerät jeglicher Art und Sanitätsprodukten. Eine hiesige Klinik überließ uns 28 hochtechnische Krankenhausbetten, die eine hiesige Spedition kostenlos zum Bezirkskrankenhaus Drogobytsch, etwa 80 Kilometer südlich von Lemberg, transportierte. Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Der Bürgermeister von Lemberg –die Stadt nahm mittlerweile 300 000 Binnenflüchtlinge auf – sagte uns: „Es fehlt an allem!“

Selbstverständlich sind wir auf Sachspenden angewiesen. Geldspenden werden entgegengenommen vom Verein Family Help in Mietingen im Kreis Biberach, IBAN DE72 6545 0070 0000 3839 09. Mit

dem Verwendungszweck „Ukraine-Hilfe“ geht die Spende an uns.
Ich selbst habe die Vertreibung noch direkt erlebt, die anderen beiden sind in der Region Oberschwaben-Bodensee geboren. Die Eltern des einen stammen aus Schlesien, die des anderen aus dem egerländischen Karlsbad.



Mir drängt sich die starke Vermutung auf, daß das unmittelbare oder mittelbare Vertreibungserlebnis zu einem Gespür für die Nöte anderer Menschen führt und oft zu spontaner Hilfeleistung beiträgt. Unmittelbare Hilfen für die Menschen in den Ländern Ukraine, Belarus und Rußland sind seit 1995 elementarer Teil meines Lebens.
Ich arbeite seit 1995 ehrenamtlich für das Maximilian-Kolbe-Werk in Freiburg, das den Überlebenden der Konzentrationslager und Ghettos des Zweiten Weltkriegs in den Ländern Ukraine, Belarus und Rußland Hilfe zukommen läßt. In diesem Rahmen war ich ungefähr 30mal mit Hilfstransporten und bei längeren humanitären Aufenthalten in diesen Ländern unterwegs.
Die vielen Begegnungen mit den dortigen Menschen veränderten mich. Ich löste mich von meiner vorwiegend mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten Weltsicht und wandte mich dem anderen Menschen zu. Das einzige, was mich heute wirklich interessiert, ist der andere Mensch.
Nochmal zurück zu meinem Geburtsort Neudek. Ich wäre glücklich, wenn ich durch meine Freundschaften zu Einwohnern des heutigen Nejdek ein klein wenig beitragen könnte zum gegenseitigen Verstehen, zur Freundschaft und zum – ein großes Wort – Verzeihen. Das Verzeihen erlittener Verletzungen ist der einzige Weg in die innere Freiheit. Es gibt keinen anderen Weg.
Und so werde ich weiter nach Nejdek fahren und jetzige Nejdeker treffen, und ich werde weiter Transporte in die Ukraine fahren. Beides hängt auf geheimnisvolle Weise unterschwellig miteinander zusammen.
Mir ist etwas aufgefallen: Drei von uns vier Fahrern haben einen Vertreibungshintergrund.
Was die Ukraine anbelangt, rechne ich mit dem Schlimmsten, aber ich versuche, mein Bestes zu geben, damit es vielleicht nicht gar so schlimm wird. Wir vier Männer können das Grauen, das gegenwärtig in der Ukraine herrscht und wohl noch lange Zeit herrschen wird, nicht stoppen. Aber wenn es uns gelingt, ein Quentchen Menschlichkeit in dieses Grauen hineinzutragen, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt.
 Herbert Meinl
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
Herbert Meinl
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
München – IBAN: DE69 7015 0000 0906 2126 00, BIC: SSKMDEMMXXX. Redaktionsschluß für Folge 642 (2/2023): Mittwoch, 15. Februar. Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 12 Folge 641 · 1/2023
Meinl bringt Geschenke für eine Mutter mit zwei Töchtern, eine Mutter mit einem Kleinkind, einen kranken Jungen und ein krankes Mädchen sowie für ein Elternpaar, das gerade Zwillinge bekam.
❯ Weihnachtsaktion
Heimatkreis Neudek in der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Josef Grimm, Waxensteinstraße 78c, 86163 Augsburg, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@ t-online.de Heimatmuseum Stadt und Landkreis Neudek, von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg; Besichtigungstermine bei Josef Grimm. Heimatgruppe Glück auf – Freunde des Heimatmuseums Stadt und Landkreis Neudek in Augsburg, eMail heimatgruppe-glueckauf@t-online.de, Internet www.heimatgruppe-glueckauf.de – Vorsitzender und zuständig für den Neudeker Heimatbrief: Josef Grimm. Redaktion:
Herbert
Die lateinische Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale mitten in Lemberg.
Feld und Vieh, Bier und Schlösser
Tüppelsgrün liegt in den Ausläufern des Erzgebirges auf einer Höhe von 492 Metern und wird in seiner gesamten Länge vom Kammersgrüner Bach durchflossen. Der Ort hatte eine eigene römisch-katholische Gemeinde, zu der auch Voigtsgrün und Kammersgrün gehörten.
Tüppelsgrün wurde erstmals in einer Urkunde von Papst Gregor X. 1273 erwähnt, in der der Besitz des Prämonstratenserklosters Tepl bestätigt wurde. Das Kloster besaß damals ein großes Gebiet im Vorgebirge und am Südhang des Erzgebirges, zu dem neben Tüppelsgrün auch Lichtenstadt und andere Dörfer gehörten. Der Ursprung des Ortsnamens läßt sich wahrscheinlich mit dem Namen des Grafen Depolt – daher Diepoltsgrün und Tüppelsgrün – erklären, der um 1130 lebte und die Herrschaft über Elbogen hatte, die auch das Gebiet von Tüppelsgrün umfaßte.
Während Lichtenstadt schon vor Hroznatas Märtyrertod 1217 zum Kloster Tepl gehörte, wurden die umliegenden Dörfer wahrscheinlich von den Prämonstratensern als Kolonialhöfe gegründet, die von Siedlern aus Eger und der Oberpfalz besiedelt wurden. Die meisten der ursprünglichen deutschen Namen dieser Dörfer bestehen aus zwei Wörtern, wobei das erste den Namen des Siedlers oder des ersten Siedlers Diepolt und das zweite mit der Endung -grün eine Lichtung bezeichnet, die durch die Rodung eines Waldes entstand.
Tüppelsgrün gehörte bis zum Ende der Hussitenkriege mit Lichtenstadt zum Kloster Tepl. Doch 1434 zwang König Sigismund den damaligen Abt Racek, ihm die Klostergüter in der Gegend von Lichtenstadt abzutreten, die er anschließend der Burg Elbogen anschloß. 1437 verpfändete Sigismund dann Elbogen an seinen Kanzler Kaspar Schlick, und Tüppelsgrün wurde bis 1605 Teil der Schlick‘schen Herrschaft.
In späteren Zeiten wechselten die Besitzer von Tüppelsgrün mehrmals. Es gehörte hauptsächlich den Herzögen von Sachsen-Lauenburg. Nach der Reform der staatlichen Verwaltung 1850 wurde Tüppelsgrün eine eigenständige Gemeinde im politischen Bezirk Karlsbad.
Laut dem Grundbuch von Elbogen aus dem Jahr 1525 lebten hier Familien mit den Nachnamen Stöhr, Tilp, Schlosser, Ritter oder Friedl, von denen einige noch im 20. Jahrhundert im Dorf verzeichnet sind. Von Anfang an hatte Tüppelsgrün dank seiner geschützten Lage und seines milden Klimas einen rein landwirtschaftlichen Charakter. Hier wurden hauptsächlich Getreide und Kartoffeln angebaut und Kühe, Schafe und Ziegen gehalten.
Schriftliche Hinweise auf den Betrieb der berühmten örtlichen
Brauerei finden sich in der Steuerordnung von 1654. Die Brauerei war bis 1915 in Betrieb und beschäftigte mehr als 200 Mitarbeiter. Den Aufzeichnungen zufolge produzierte die Brauerei im Jahr 1913 insgesamt 56 000 Hek-



Gemeindeamt. Im Mai 1846 wurde eine einklassige Schule für Kinder aus Tüppelsgrün, Voigtsgrün, Sittmesgrün und Spittengrün eröffnet. 1898 wurde das Gebäude vergrößert, und vier Jahre später gab es drei Klassen mit 167 Schülern.


Das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, das als Stele vor dem Gemeindeamt steht, erinnert an 29 Soldaten aus Tüppelsgrün und elf aus dem nahen Kammersgrün. Das Denkmal, das 1930 enthüllt und eingeweiht wurde, kostete 6000 Kronen. 2015 rekonstruierte es die Gemeinde.

1926 eröffnete am Tüppelsgrüner Teich ein Schwimmbad. 29 Umkleidekabinen standen anfangs zur Verfügung, 1930 waren es 300. Die Beliebtheit des Schwimmbads stieg durch die Nähe zur Kurstadt Karlsbad und


gehörte das Dorf zum Postamt in Neurohlau. Nur 1938 bis 1945 hatte Tüppelsgrün wieder kurzzeitig ein eigenes Postamt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die meisten Tüppelsgrüner vertrieben. Danach zogen Tschechen aus dem Landesinneren und einige wenige Rückwanderer aus Jugoslawien nach Tüppelsgrün. 1945 wurde eine lokale Verwaltungskommission eingerichtet, die ein Jahr später von einem lokalen nationalen Ausschuß ersetzt wurde. 1960 wurde die Siedlung Spittengrün vom Dorf Sittmesgrün getrennt und nach Tüppelsgrün eingemeindet, während die Siedlungen Edersgrün und Ruppelsgrün hinzukamen. Ruppelsgrün wurde 1968 Teil von Lichtenstadt.
Bei einer großen Welle von Gemeindefusionen in den 1970er Jahren verlor Tüppelsgrün 1975 seine Unabhängigkeit. Ab 1976 gehörten Tüppelsgrün und die Siedlung Spittengrün zu Neurohlau. Edersgrün wurde an Lichtenstadt angegliedert.
durch das wachsende Interesse an dauerhaftem Wohnraum im Ferienhausgebiet des Tüppelsgrüner Teichs.
Das Schulgebäude, das 1975 geschlossen worden war, diente später als Werksküche und Wohnheim für das Unternehmen Staatsgüter.
Das seit langem ungenutzte und baufällige Gebäude wurde 2002 der Gemeinde zurückgegeben und für 16 Millionen Kronen renoviert. Seit 2010 beherbergt es das Gemeindeamt mit Bibliothek und Gemeindesaal.
Die dem Erzengel Michael geweihte Renaissance-Pfarrkirche
Zu der einschiffigen rechtekkigen Barockkirche gehört ein rechteckiges, dreieckig abgeschlossenes Presbyterium. Der Glockenturm ist achteckig und trägt eine Zwiebelhaube. An die Südwand ist eine rechteckige Sakristei angebaut, ein Überbleibsel des ursprünglichen Gebäudes, mit einem Walmdach aus Blech. Die Haupteingangsfront mit einem rechteckigen Portal aus Stein mit Quaderbogen und einem rechteckigen, halbrunden Fenster in der Achse überragt ein dreiteiliger, geschwungener Dreiecksgiebel mit Volutenflügeln. In der Mitte des Giebels ist die Kirchenuhr. Ein zweiter rechteckiger Seiteneingang befindet sich in der südlichen Längswand der Kirche. Drei Paare von rechteckigen, halbrunden Fenstern mit Verkleidung unterbrechen die Seitenwände der Kirche.


Im Turm auf dem Dach der Kirche hängt eine Glocke aus dem Jahr 1576, die Gregor Albrecht aus Schlackenwerth schuf und aus der ursprünglichen Kirche übernommen wurde. Das Kirchenschiff hat eine flache Decke, das Presbyterium und die Sakristei haben ein Kreuzgratgewölbe. Pilaster mit hohen Gesimskapitellen gliedern die Innenwände.
hen
Im Dorf gab es eine Reihe von Geschäften und Handwerksbetrieben: sieben Gaststätten, mehrere Gemischtwarenläden, eine Metzgerei, eine Bäckerei, ein Schuhgeschäft, eine Schreinerei, eine Stellmacherei, eine Schmiede, eine Molkerei, einen Friseursalon und ein Sägewerk.
Die Geschichte des Tüppelsgrüner Schulwesens beginnt 1502. Bis zum 19. Jahrhundert fand der Unterricht in den Häusern statt, wobei unqualifizierte Personen wie Soldaten, Gastwirte oder Handwerker unterrichteten. Erst im Herbst 1844 wurde mit dem Bau eines eigenen Schulgebäudes begonnen. Es trug die Nummer 44 und beherbergt heute das
die 1927 eingeführte Busverbindung zwischen Karlsbad und Tüppelsgrün.
Seit 1921 hatte das Dorf elektrischen Strom, allerdings nur für die öffentliche Beleuchtung und wenige Häuser. Die meisten
In der Zeit der gesellschaftlichen Veränderungen nach dem November 1989 stand die Frage der Wiedererlangung der Unabhängigkeit von Tüppelsgrün auf der Tagesordnung. Im November 1990 wurden Tüppelsgrün
Häuser wurden noch mit Petroleumlampen beleuchtet.
Ein eigenes Postamt bestand in Tüppelsgrün 1870 bis 1923 und bediente auch Voigtsgrün, Kammersgrün und Pechöfen. Später
und der Stadtteil Spittengrün wieder unabhängig. Seitdem ist die Einwohnerzahl des Dorfes gestiegen, nicht nur durch den Bau neuer oder den Umbau bestehender Häuser, sondern auch
entstand im 16. Jahrhundert auf der rechten Seite der Straße nach Voigtsgrün im oberen Teil des Dorfes. Um die Kirche wurde ein Friedhof angelegt. Eine Chronik aus dem 18. Jahrhundert bezeichnet die Kirche als ein älteres Gebäude nur aus Lehmmauern. Der langgezogene Bau hatte einen rechteckigen Grundriß, ein Satteldach und einen barocken Glockenturm über dem Eingang. An die südliche Längswand der Kirche wurde eine rechteckige Sakristei angebaut, die heute noch steht und unter der sich die Gruft der Besitzer des SchlickGutes befand. 1786 wurde die Renaissancekirche abgerissen. Die neue Barockkirche errichtete 1786 bis 1787 der Karlsbader Baumeister Joseph Seifert mit dem Zimmermeister Martin Höhnl aus Schlackenwerth.
Die Innenausstattung und den hölzernen Hauptaltar schuf der Bildhauer und Maler Wenzel Lorenz aus Lichtenstadt 1795. In der Mitte des Altars steht eine Statue des Erzengels Michael. Die Seitenflügel des Altars mit seinen Statuen stammen aus dem Jahr 1870. Im Kirchenschiff befindet sich auf der rechten Seite des Triumphbogens ein Seitenaltar der schmerzensreichen Gottesmutter mit kleinen Heiligenfiguren und einem modernen Gemälde. Auf der linken Seite des Triumphbogens befindet sich eine Kanzel mit ähnlichem Aufbau. Im Presbyterium stehen die älteren Seitenaltäre, die Wenzel Lorenz 1795 renoviert hatte. 1853 baute Josef Schimek aus Pilsen die Orgel.
Das Schloßgebäude wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut, als Tüppelsgrün zur Schlakkenwerther Herrschaft gehörte. Bis 1843 wurde es um einen Nordflügel im Empire-Stil erweitert und anschließend mehrfach umgebaut. Später wechselte das Gut in den Besitz mehrerer privater Eigentümer, und nach 1945 wurde es dem örtlichen Gutshof zur Bewirtschaftung übergeben. Heute sind die Gebäude des sogenannten Neuen Schlosses baufällig. Pavel Andrš in „Krušnohorský Herzgebirge Luft“,
toliter Bier. Ihr letzter Besitzer war Anton Weber, ein Industrieller, der auch eine Brauerei in Fischern und Schlackenwerth besaß. Der Abriß des 35 Meter ho-
Schornsteins im Jahr 1927 bedeutete das Ende der örtlichen Brauerei.
NEUDEKER HEIMATBRIEF Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 13 � Tüppelsgrün
übersetzt von Josef Grimm
Gefallenendenkmal
und 2009.
Das Neue Schloß in deutscher Zeit
Das Strandbad eröffnet 1926.
Heute dient der Weiher den Datschenbewohnern zum Bootfahren. Alte Panoramaaufnahme.
Das Alte Schloß ist heute eine Pension.
Das alte Gasthaus Stöhr ist immer noch in Betrieb.
Das ehemalige Schulgebäude beherbergt jetzt das Gemeindeamt.
Sankt Michael mit Zwiebeltürmchen.
für die Kreise Dux, Bilin und Teplitz-Schönau








Heimatlandschaft
und Mittelgebirge –

Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –

Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –

Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Eine Bäderpartnerschaft bahnt sich an
Dank der Vermittlung Erhard Spaceks, des Heimatkreisbetreuers und Vorsitzenden des Freundeskreises Teplitz-Schönau, nahmen die Bemühungen um eine Städtepartnerschaft zwischen den Bade- und Kurorten Teplitz-Schönau im böhmischen Mittelgebirge und Bad Kissingen in Unterfranken am südöstlichen Rand der Rhön Mitte Januar konkrete Formen an.
Auf Vorschlag von Steffen Hörtler, Stellvertretender SLBundesvorsitzender, Obmann der SL-Landesgruppe Bayern und Vorsitzender der CSU-Fraktion des Bad Kissinger Stadtrats, besuchten Mitglieder der CSUFraktion des Rathauses die Stadt Teplitz-Schönau. Sie wollten gemeinsam mit Ratsmitgliedern des TeplitzSchönauer Magistrats über eine eventuelle Städtepartnerschaft sprechen und gleichzeitig die Stadt kennenlernen.
An dem Besuch nahmen neben Steffen Hörtler die Stadtratsmitglieder Wolfgang Lutz, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Gudrun Heil-Franke, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Nikola Renner, Stadtratsbeauftragte für Kultur, und Erhard Spacek als Organisator und Dolmetscher teil. Die Gäste wohnten während ihres Besuchs im Hotel Prince de Ligne am Schloßplatz. Zur ersten Kontaktaufnahme und zum gegenseitigen Kennenlernen hatten sie den Oberbürgermeister Jiří Štábl (ANO), dessen Stellvertreter und Senator Hynek Hanza
(ODS), die Magistratsmitglieder Monika Peterková (ODS) und Radka Růžičková zum Abendessen in das Restaurant des Hotels Prince de Ligne eingeladen. In angenehmer und lockerer Stimmung wurden die ersten Kontakte geknüpft.
Am nächsten Tag unternahm die Delegation aus Unterfranken eine Stadtführung mit Erhard Spacek. Dazu gehörte ein Besuch des Kurhauses Beethoven mit einer Besichtigung des Hauses, die der Geschäftsführer der Teplitzer Bäder-AG, Michal Sinčak, leitete. Zum Mittagessen im stilvollen Restaurant Beetho-

genen Sommer beim Internationalen Fußballturnier der Jugend in Bad Kissingen mitgespielt hatten. Die jungen Fußballer sagten, sie freuten sich, auch am diesjährigen Turnier in Bad Kissingen teilzunehmen. Einen Eindruck der reichen Teplitz-Schönauer Kultur vermittelten die Besichtigung des Stadttheaters und im dortigen Kleinen Saal ein Konzert des Ensembles „Clarinet Society“.
Den Tag beschloß ein Abendessen mit Oberbürgermeister Štabl und seiner Frau Martina sowie Senator Hanza im BrauereiRestaurant Monopol. Zu später Stunde stieß auch noch Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel zu der Runde. Vogel war auf Einladung von Steffen Hörtler und zur Freude der CSURatsmitglieder eigens angereist, um die zukünftige Partnerstadt ebenfalls kennenzulernen.

Zum runden Abschluß war noch ein Besuch des Gymnasiums verabredet. Hier erwarteten Direktor Zdeněk Bergmann, der Geschichtslehrer Michal Rak und die Deutschleh rerin Kamila Wolfová die Gäste aus Bad Kissingen. Den Besuchern hatte sich auch die Teplitzer Stadträtin Peterková angeschlossen, die im Magistrat für das Schulwesen zuständig ist.
Bergmann er klärte zunächst an einem Modell die ver schiedenen Gebäude des Gymnasiums, wozu nicht nur ein ehemaliges Kloster mit Schule, sondern auch eine Sportanlage und sogar ein zoologischer Garten gehören. Das Teplitzer Gymnasium unterrichtet rund 850 Schüler und entspricht in seiner Größe etwa dem Gymnasium in Bad Kissin-

gen. Schüleraustauschprogramme zwischen beiden Städten wurden bereits in die Praxis um-
gesetzt. Natürlich freuen sich alle auf eine weitere Zusammenarbeit.
Das letzte gemeinsame Mittagessen fand dann – wiederum auf Einladung der CSU-Fraktion – im Restaurant Prince de Ligne statt. Hieran beteiligten
sich ebenfalls noch einmal Oberbürgermeister Štábl und Senator Hanza. Alle Beteiligten äußerten sich abschließend sehr zufrieden über die gemeinsamen Tage in Teplitz. Steffen Hörtler faßte das Ergebnis dieses Treffens kurz zusammen, indem er betonte, daß die Stadt TeplitzSchönau mit ihren Vertretern ein durchaus gleichberechtigter Partner für Bad Kissingen sei, und daß er sich auf eine beiderseitige erfolgreiche Zusammenarbeit freue. „Bad Kissingen kann viel von Teplitz lernen“, fügte er hinzu. Man verabschiedete sich herzlich voneinander, wobei Oberbürgermeister Vogel zum Schluß eine Einladung zum nächsten Treffen in
ven waren auch Radek Popovič, der Generaldirektor der Aktiengesellschaft Bad Teplitz in Böhmen, Geschäftsführer Michal Sinčák, Oberbürgermeister Jiří Štábl, Senator Hynek Hanza und Stadträtin Radka Růžičková gekommen. Bei dieser Gelegenheit kamen auch gegenseitige Anregungen in Fragen Kur- und Bäderwesen zur Sprache, die bei einer zukünftigen Städtepartnerschaft sicher eine wichtige Rolle spielen werden.
Anschließend besichtigte die Delegation die Eissporthalle und das Erstliga-Stadion. Dort trafen sie Teilnehmer der U15-Fußballmannschaft, die im vergan-
Der gemeinsame Abend verlief in überaus freundschaftlicher Atmosphäre.
Am letzten Tag fand der offizielle Empfang im Rathaus statt. Dort empfingen Oberbürgermeister Jiří Štábl, Senator Hynek Hanza sowie die Stadträtinnen Monika Peterková und Radka Růžičková ihre Gäste aus Deutschland. Oberbürgermeister Dirk Vogel und die Mitglieder der CSU-Fraktion des Bad Kissinger Stadtrats dankten herzlich für die Einladung und brachten ihre Freude über eine zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit zum Ausdruck.
 Bad Kissingen aussprach. Der Termin wird noch abgesprochen.
Jutta Benešová
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Erz-
Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733
Bad Kissingen aussprach. Der Termin wird noch abgesprochen.
Jutta Benešová
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Erz-
Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733
14 Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023
� Teplitz-Schönau und Bad Kissingen
Das ehemalige Stadttheater heißt heute Erzgebirgisches Theater.
Zum Gymnasium gehören ein Kloster und ein Zoo. Vor dem Hotel de Ligne steht die Pestsäule.
Nikola Renner, Dr. Dirk Vogel, Steffen Hörtler, Dr. Gudrun Heil-Franke, Erhard Spacek, Hynek Hanza, Jiří Štábl und seine Frau Martina Štěpková sowie Wolfgang Lutz im Brauerei-Gasthof Monopol.
Erhard Spacek, Dr. Radka Růžičková, Jiří Štábl, Nikola Renner, Steffen Hörtler, Dr. Gudrun Heil-Franke, Hynek Hanza und Wolfgang Lutz vor den Trophäen des FC Teplitz im Stadion.
Am runden Tisch im Rathaus sagt Bürgermeister Dr. Dirk Vogel: „Wir können unsere europäischen Freunde nicht hinhalten und müssen zeitnah einen klaren Prozeß für die Städtepartnerschaft Bad-Kissingen mit Teplitz-Schönau starten.“
❯ František Bartoš
HEIMATBOTE
FÜR
DEN KREIS BISCHOFTEINITZ
Mährischer Maler in Böhmerwald-Orten
Auf der Tachauer Seite des Heimatboten (➞ HB 1+2/2023) war kürzlich ein Beitrag über den aus Tachau gebürtigen Maler Franz Rumpler (1848–1922).
1863 kam er zur Ausbildung nach Wien – und blieb Zeit seines Lebens dort beziehungsweise in Klosterneuburg. Diesen Weg von der Peripherie ins Zen-

trum der Monarchie gingen viele Menschen bis ins frühe 20. Jahrhundert zur Ausbildung, zur Arbeitssuche, als dorthin versetzte Beamte in Behörden, Bil-
dungsstätten oder beim Militär. So führt bereits 1931 Karl Haudek alias Armin Carolo in zwei Beiträgen unter der Überschrift „Wäldlersöhne in Wie-

ner Erde“ in der Budweiser Monatszeitschrift „Waldheimat“ Persönlichkeiten auf, die aus dem Böhmerwald stammten und in Wien beerdigt sind.
E
ine ähnliche, wie man es heute nennt Binnen-Migration, gab es aber immer auch zwischen den weiten Teilen der Habsburger-Monarchie sowie ihrer Nachfolgestaaten noch bis Mitte der 1930er Jahre – aus denselben oben genannten Gründen.
Diesen Weg ging ein Maler, auf den ich erst vor kurzem aufmerksam wurde und der sicher nur wenigen bekannt ist, obwohl ihn die ältesten noch Lebenden unter den Heimatvertriebenen des Bischofteinitzer und Tauser Kreises kennen könnten. Sein Name ist František Bartoš. Ich fand ihn durch ein im Handel angebotenes Aquarell von seiner Hand, das tschechisch betitelt ist mit „samota u Smolova“ – deutsch etwa „Einschichte bei Schmolau“, datiert 1943. Zu sehen sind darauf zwei Häuser mit Holzzaun, wohl an einem Bächlein gelegen, vielleicht mit einem kleinen Teich rechts unten.
Da meine Mutter in dem Ort ihre ersten Jahre zur Schule ging, weil die Rosenmühle mit Rosendorf politisch zu Schmolau gehörte, erwarb ich das Blatt. Über das Internet konnte ich einige wenige Stationen aus dem Leben dieses Künstlers zusammentragen.
Geboren ist Bartoš am 18. Juni 1903 im kleinen mährischen Dorf Slavíč/Slawitsch, heute Stadtteil von Mährisch Weißkirchen. Er studierte – vielleicht in Brünn – für das Lehramt; seine künstlerische Ausbildung erwarb er durch Privatunterricht bei verschiedenen Malern.
So arbeitete er Zeit seines Lebens hauptberuflich als Zeichenlehrer an Grund- und weiterführenden Schulen. Die Malkunst faszinierte ihn aber auch im privaten Leben.
Das früheste bisher bekannte Aquarell stammt von 1930, da war er 27 Jahre alt. Es zeigt den mit Bäumen bewachsenen Damm des Przechina-Teiches beim Dorf Beneschau, einem Ort im Hultschiner Ländchen; vielleicht hatte er hier oder in der Gegend eine erste Stelle als Lehrer. Doch schon Anfang der 1930er Jahre muß er als Lehrer in die Bischofteinitzer Region gekommen sein. Er arbeitete als Zeichenlehrer und lebte wohl auch in Bischofteinitz, später in Neugedein. Hier ist sogar seine Adresse bekannt: Naměsti – Stadtplatz 6.



Nach der Besetzung des Sudetenlandes durch das Hitler-Regime 1938 mußte er nach Taus ausweichen, das in der „RestTschechei“ beziehungsweise im Protektorat lag, und war dort Schulinspektor. Bei der Revolution im Februar 1948 wurde er von den Kommunisten wegen seiner politischen Überzeugung seines Amtes als Schulinspektor enthoben. Wohl um das Jahr 1965 hat man ihn weit weg nach Mittelböhmen versetzt. Denn da taucht sein Name in der Chronik des Städtchens Mníšek pod Brdy/ Mnischek unter Kammwald auf. Dort hält der Chronist über František Bartoš Folgendes fest: „Vor seiner Pensionierung kam ein hervorragender Maler, der alle Maltechniken beherrschte, in unsere mittelböhmische Region nach Mnischek. Er unterrich-
tete zwei bis drei Jahre Mathematik und Zeichnen in der Schule. Er ging mit den Kindern aufs Feld und zeichnete frei … Schon 1933 wurden die Zeichnungen seiner Schüler in Madrid, Barcelona und Paris ausgestellt.“ 1978 ist er gestorben, vielleicht in Mnischek. Den Ort und das
von Bartoš, darunter wohl vier, die sich als die 1942 erwähnten identifizieren lassen.
Bartoš war Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitschrift „Český kreslíř“/„Der tschechische Zeichner“ und im SZVU, dem 1925 gegründeten Verband Westböhmischer Bildender Künstler mit Sitz in Pilsen. Im Rahmen von dessen Ausstellungen –bis zur durch die Kommunisten verfügten Zwangsauflösung dieses Verbandes 1951 – zeigte er dort weitere Werke wie zwei Kohlezeichnungen der Kirchen in Bischofteinitz und Stockau. Diese beiden Zeichnungen finden sich – neben weiteren mit Motiven aus Bischofteinitz, Horschau, Plöss, Stankau, Weißensulz – als Illustrationen in dem bereits 1947 von seiner Bischofteinitzer Lehrerkollegin Anna Polakova (1910–1999) auf Tschechisch verfaßten Touristenführer „Horšovský Týn, perla Českého lesa“/„Bischofteinitz, Perle des Böhmischen Waldes“ mit Beschreibung der Sehenswürdigkeiten in und um Bischofteinitz.



Das Zucker-von-Tamfeld-Wappen.




genden Verwaltungsgebäude, dem früheren Schloß und Meierhof. Die Brauerei wurde 1980 gesprengt, das Wappen über dem Haupteingang des durch ein Feuer Ende Oktober 2014 zur Ruine gewordenen alten Gemäuers ist bis heute an seinem Platz. Diese Zeichnungen sind erhalten als in der Druckerei von Ervin Brejcha in Bischofteinitz gedruckte Postkarten-Motive. Vermutlich hatte Brejcha nach 1945 eine dort bestehende Drukkerei von deutschen Besitzern übernommen. Denn die alteingesessene, 1925 von Emmanuel Brejcha gegründete Firma hatte ihren Sitz in Pilsen. Sie war vor allem bekannt für den Druck von Bierdeckeln. Womöglich war die Weißensulzer Brauerei schon vor 1945 einer ihrer Kunden.
Vielleicht gibt es unter den Lesern des Heimatboten solche, die speziell die drei Motive aus Schmolau genauer zuordnen können. Zdeněk Prochazka, der unermüdliche tschechische Forscher und Chronist dieser Region aus Taus, konnte die Motive nicht identifizieren; auch das dortige Museum hat bisher keine weiteren Angaben über die Motive gemacht. Klaus Oehrlein
genaue Datum konnte ich bisher nicht eruieren.
Die Motive seiner Gemälde, die heute noch existieren oder von denen man die Titel kennt, fand er großteils im Umkreis von Bischofteinitz, Neugedein und Taus. Während seiner Amtszeit in Taus organisierte er 1942 eine umfassende Ausstellung seiner Werke. Als Titel werden dabei unter anderem genannt „Kirche in Luschenitz“, „Haus in Tilmitschau“, „Petrowitz“. Alle drei Orte liegen im Umland von Taus. Außerdem „Alte Scheune“, „Einschichte in Schmolau“, „Der älteste Bauernhof in Schmolau“. Im Bestand des Tauser Museums befinden sich heute sechs Werke
Auch nach dem Krieg beschickte er die Pilsener Ausstellung des Verbandes mit Bildern: 1947 in Öl „Winterlandschaft bei Bischofteinitz“ und als Aquarell „Frühling in Stockau“, 1949 „Spáňov“ – Spanow liegt zwischen Taus und Neugedein – und 1950 die Ausstellung zum 25jährigen Jubiläum dieses Künstlerverbandes mit „Alte Schmiede in Taus“.





Wohl auch erst nach 1945 sind zwei Motive aus Weißensulz entstanden: die dortige ehemalige Brauerei des Heiligenkreuzer Barons Kotz von Dobrš und das Zucker-von-Tamfeld-Wappen, das Wappen eines Vorfahren der Kotz, am neben der Brauerei lie-
Welche zwei Gebäude sind mit der „Einschichte“ wohl dargestellt? Wo lagen dieser „Älteste Bauernhof“, ein Holzhaus, und das Anwesen mit der davor liegenden Toreinfahrt in Schmolau oder wer waren deren letzte deutsche Besitzer? Wer hat oder kennt weitere Motive des Malers František Bartoš? Hinweise bitte an die Redaktion (➝ siehe Impressum oben) oder direkt an mich, Pfarrer Klaus Oehrlein, eMail st.valentinus@ web.de
Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 15
Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
Bischofteinitz Ronsperg Hostau
„Einschichte in Schmolau“, 1942.
Dieses Bild von 1942 hat keinen Namen, vielleicht auch Schmolau. „Der älteste Bauernhof in Schmolau“, 1942.
„Gasse in Plöß“
„Brücke in Weißensulz“
„Klosterkirche in Stockau“
???
„Teich-Damm am Przechina-Teich bei Beneschau“, 1930.
Die Weißensulzer Brauerei.
Heimatbote für den Kreis Ta<au
� Tachau

Is dös wos, is dös wos
Als in Tachau noch die Wäschebleiche an der Miesa war und die Frauen dort noch die Wäsche „im Boch floderten“, knieten einmal zwei Frauen nebeneinander.
Da fing die eine an zu jammern: „Is dös wos, is dös wos!“ Nach einer Weile wieder: „Is dös wos, is dös wos!“
Da sagte die andere: „No, wos isan åffa?“ Da erwiderte die erste: „No, hålt ma Moidl.“
„No, wos isan mit dein Moidl?“„No, jå, a kind kröigts hålt; is dös wos, is dös wos!“
„No“, sagte die andere wieder, „no, Gott‘s Will‘n, dös is sua årgh niat, dös is die erscht niat u is die letzt niat, dåu brauchst niat sua tou.“
Nach einer Weile dieselbe: „I, wos håut sie denn für oin?“ Da sagte die erste: „No, hålt dein Boum!“ Da fing auch die zweite an: „Is dös wos, is dös wos!“ Maria Fröhlich
Töchtern
Eine Heugabel im Popo

Wolf-Dieter Hamperl schildert seine Kindheit im oberpfälzischen Waidhaus. Wir veröffentlichen die Schilderung in mehren Folgen.
Am 5. Dezember 1945 kamen meine Mutter Anna Hamperl, meine knapp zweijährige Schwester Ingrid und ich, der knapp dreijährige Wolf-Dieter, samt Tante Marie Bär mit ihrer fünfjährigen Tochter Traudl und dem zehn Monate alten Kleinkind Margit an der Grenze in Waidhaus an. Wir hatten beim Narodny Vybor/Nationalausschuß in Haid/Bor eine Reiseerlaubnis/Travel permission nach Waidhaus bekommen, weil uns die Kreuzwirttante eine Aufenthaltserlaubnis für Waidhaus besorgt hatte.
Anna Grötsch, die Kreuzwirttante, war eine geborene Höring und in der Neumühle geboren. Sie war die einzige Schwester meiner Großmutter und eine Tante meiner Mutter. Bei ihr fanden wir Aufnahme. Wegen der vielen amerikanischen Soldaten, die im Gasthaus Zum Weißen Kreuz verkehrten, zogen wir in das große Haus von Heinrich Wolf, Besitzer der Dampfsäge und ein Onkel meiner Mutter, in der Eslarner Straße 130, heute 18 bis 20. Im Dachgeschoß hatte Heinrich Wolf zwei Zimmer uns sechs zur Verfügung gestellt. Dort wohnten wir schlecht und recht zusammen. Die ständigen Streitereien unter den Kindern und die unterschiedlichen Wesensarten der Schwestern veranlaßten meine Mutter, eine eigene Wohnung zu suchen. Das war im Waidhaus der damaligen Zeit, der Ort war voller „Flüchtlinge“, eine schwierige Angelegenheit.
Schöne Jahre im Lermerhaus
Schließlich fand sich mit Hilfe der Gemeinde eine schöne Einzimmerwohnung im ersten Stock des Lermerhauses in der Eslarner Straße 7. Dieses Haus war im Besitz von Heinrich Wolf ju-
nior, einem Cousin meiner Mutter. Im ersten Stock bewohnte Lina Ries/Ganther mit ihrem Mann eine sehr schön eingerichtete Dreizimmerwohnung. Ihr Mann und sie erledigten die Buchhaltung der Firma J. A. Wolf. Sie waren vor dem Krieg von Donaueschingen hierher gezogen, doch Robert Ries fiel im Zweiten Weltkrieg, und uns wurde das Wohnzimmer der Wohnung zugewiesen. Am 2. Februar 1947 zogen wir ein.
Auf einem Schlitten sitzend und mit einer Decke über dem Kopf brachte uns Mutter in das neue Zuhause. Mit Lina Ries verstanden wir uns von Anfang an sehr gut. Wir Kinder durften tagsüber in ihrer großen Küche spielen. Ein besonderes Erlebnis war, als Heinrich Wolf aus der britischen Kriegsgefangenschaft heimkam. In der großen Küche standen Frau Wolf und ihre Kinder, seine Eltern und andere Wolfverwandte, darunter auch meine Mutter und ich im Halbkreis und begrüßten den Heimkehrer. Die Freude war groß und der Worte viele.
Dieser Heinrich Wolf junior soll, so wurde erzählt, seinen Onkel Anton Wolf in einem Brief über die drohende Vertreibung informiert haben. Die britische Presse habe dies berichtet, und der Onkel möge doch seine bewegliche Habe mit seinem Bulldog nach Waidhaus bringen. Doch Großvater glaubte das nicht, er konnte sich das einfach nicht vorstellen.
Unsere Einzimmerwohnung
Die Kücheneinrichtung und Schlafzimmermöbel wurden von einem Schreiner aus Siebenbürgen, der sich in Miesbrunn niedergelassen hatte, gefertigt. Die Couch stammte von einer Waidhauser Polsterei. Den gemütlichen Polsterstuhl lieferte der Dachboden, wo die Möbel eines Generals aus Dresden zwischengelagert waren. Der Blechherd war ein Werk des Neustadt-
lers Karl Prinz. Das alles paßte in das schöne, sonnige Südzimmer, der vordere Teil war Kochund Wohnbereich, der hintere das Schlafzimmer. Ein blau gefliester Kachelofen stand links in der Mitte und sorgte für Wärme. Diese Einrichtung konnte erst im Lauf der Jahre angeschafft werden. Woher die früheren Möbel stammten, weiß ich nicht mehr.
Mein Vater kam am 3. April 1947 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zu uns. Das war natürlich eine große Freude. Aber ich hatte meinen Vater bis dahin nur von Fotografien, den Schilderungen meiner Mutter und den vielen Briefen gekannt. Mein Vater war dann viel zu Hause, weil er noch nicht entnazifiziert war. Das Verfahren lief am Landratsamt in Vohenstrauß. Er war von Beruf Volks- und Bürgerschullehrer, beim Militär war er Oberleutnant der WaffenSS. Deshalb war er auch in den Kriegsgefangenenlagern im hessisch Darmstadt, im württembergischen Kornwestheim und im oberbayerischen Moosburg.
Seine Tätigkeiten wechselten zwischen denen eines Waldaufsehers und eines Sägewerksarbeiters, meist mußte er Bretter aufschichten. Gerne denke ich an die Radfahrten vorne auf der Stange sitzend zu dem Waldstück in Richtung Spielhof, wo wir auch viele Pilze fanden. Einmal zeigte er mir eine Kreuzotter, die mit ihren Jungen an einer Böschung in der Sonne lag. Nebenher sammelten wir noch Schwarz-, meist Preiselbeeren. Auf dem großen Sägewerksplatz fanden wir viele Spielmöglichkeiten, meist „Versteckeles“.
Da mein Vater von der Spruchkammer in Vohenstrauß unter dem Vorsitz von Christian Kreuzer, dem späteren Landrat, als Mitläufer eingestuft wurde, durfte er ab dem 1. Januar 1950 wieder unterrichten. Das tat er in den Ortschaften Waidhaus, Eslarn, Reinhardsrieth und Burkhardsrieth. Er unterrichtete die bäuerlichen Berufsschüler und
die Bauhilfsarbeiter. Zu den Schulorten war er mit dem Fahrrad unterwegs. Er war streng, aber beliebt. Noch lange erinnerte man sich an den „Hamperllehrer“.
Obwohl die Wohnverhältnisse beengt waren, habe ich nur schöne Erinnerungen an die Waidhauser Zeit. Die Familie Wolf, die im Erdgeschoß mit Dienstmädchen, Bad und einem feudalen Wohnzimmer wohnte, hatte die Söhne Heinrich, Heiner oder Heini gerufen, und den jüngeren Walter, Walti genannt. Mit Heiner konnten wir nicht so viel spielen, weil er oft im Wohnzimmer wegen seines Asthmas inhalieren mußte oder dort krank lag. Walti war der jüngere, stotterte etwas und wir sausten viel im Garten herum. Der war für uns ein echter Spielplatz, und es war auch immer etwas los. Einmal schlug bei einem heftigen Gewitter der Blitz in den großen Kirschbaum im hinteren Garten ein. Er spaltete den Stamm, so daß die eine Hälfte sich zur Erde neigte und wir großartige Klettermöglichkeiten bis hoch in die Krone hatten. Leider stürzte Walti ab und brach sich den Unterarm. Die Folgen waren Gipsverband und Bettruhe.

Ein anderer Spielplatz war im ersten Stock der Scheune, die zur kleinen Landwirtschaft gehörte und heute noch steht. Dort befand sich ein großer Heuhaufen, den wir hinaufkletterten. Bei einem kleinen Fenster richteten wir uns einen Spähposten ein und beobachteten den Garteneingang. Das Hinabrutschen war immer ein großes Vergnügen. Doch einmal passierte es: Die Magd hatte die Heugabel mit den Zinken nach oben angelehnt, und Walti verletzte sich am Popo. Wieder war ich dabei gewesen und durfte mich bei Waltis Eltern nicht blicken lassen. Walti lag mindestens zwei Wochen krank im Wohnzimmer. Täglich kam der Hausarzt, einmal durfte ich den Freund besuchen. Walter hat alles gut überstanden. Fortsetzung folgt
n Schönnbrunn. Wie berichtet, starb Franz Härtl, Ortsbetreuer von Großgropitzreith, am 6. Oktober mit 86 Jahren (Ý HB 3/2023). Seine Mutter, eine geborene Haubner aus Schönbrunn Nr. 107, hatte Stephan Härtl aus Großgropitzreith Nr. 36 geheiratet. Sie weilte zur Entbindung am 13. Februar 1936 in ihrem Elternhaus und überlebte die Geburt ihres Sohnes nur um zwei Stunden. Getauft wurde Franz Härtl in Tachau in der Erzdekanalkirche Mariä Himmelfahrt, die erste Heilige Kommunion empfing er in der Klosterkirche der Franziskaner.
Stiefmutter Berta aus Albersdorf brachte ein Kind mit in die zweite Ehe von Vater Stephan. Sie war Franz und seinen Halbgeschwistern eine gute und fürsorgliche Mutter. Die Ferien verbrachte Franz oft bei seinen Großeltern in Schönbrunn. Gerne erzählte er auch von seinem 1942 verstorbenen Großgropitzreither Großvater, der Finanzbeamter in der k. u. k. Monarchie war. Erinnerungen an die Vertreibung über Wiesau, Königshofen und Mellrichstadt blieben in seinem Gedächtnis haften. Nach dem Schulabschluß machte er eine Fleischerlehre, legte die Meisterprüfung ab und wurde als Metzgermeister mit einem Fleischerfachgeschäft in Hessen selbständig.
Sohn Achim aus erster Ehe und den angeheirateten zwei
und war glücklich im Kreise seiner Familie.
Im Ruhestand widmete er sich vermehrt der Heimat. Mit Gabi nahm er oft Quartier im Kastanienhof in Georgenberg und bereiste von dort aus die Orte seiner Kindheit. Mit Karl Wilfling, Sohn der allzeit hilfsbereiten und nach dem Krieg in Tachau verbliebenen Anna Wilfling, hielt er stets Kontakt und überbrückte so die sprachlichen Barrieren. Der Kapelle in Großgropitzreith galt seine besondere Aufmerksamkeit, eine große Verehrung zeigte er für Pfarrer Johann Andreas Blaha.


Franz Härtl war ein humorvoller Mensch mit einer großen Lebenserfahrung. Aufrecht, immer mit einem Hut auf dem Haupt, blickte er dankbar, stolz und zufrieden auf seine Lebenszeit. Schmunzelnd und mit besonderer Freude sagte er oft zu mir: „Du bist meine Ortsbetreuerin.“
Diese Aussage drückte nicht nur die gegenseitige Wertschätzung aus, es war vielmehr auch die Referenz an seinen Geburtsort Schönbrunn. Dabei verbargen sich hinter seinem Frohsinn der Hauch von Wehmut und die Sehnsucht nach der leiblichen Mutter. Die Ewigkeit hat sie wieder vereint. Ludmilla Himmel
WIR GRATULIEREN
Wir gratulieren folgenden treuen Abonnenten des Tachauer Heimatboten, die im Monat Februar Geburtstag feierten und feiern, und wünschen von ganzem Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes überreichen Segen.
n Pfraumberg, Mühloh. Am 12. Josef Hüttl (Konsum Peppe, Haus-Nr. 137), 97 Jahre, und am 24. Erich Roppert (Lenkerer, Mühloh Haus-Nr. 18), 89 Jahre.
n Hesselsdorf. Am 2. Josef Magerl (Posterer), 91 Jahre, und am 7. Brigitte Langguth, Brükkenstraße 35, 99098 Erfurt, 77 Jahre. Anni Knarr Ortsbetreuerin
n Godrusch. Am 28. Roland Sperl (Storzen, Haus-Nr. 5), 96 Jahre. Franz J. Schart Ortsbetreuer
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Februar Dr. Wolf-Dieter Hamperl, unserem Heimatkreisbetreuer, am 1. zum 80. Geburtstag (Ý Seite 6) und Sieglinde Wolf, Marktbetreuerin von Altzedlisch und Ortsbetreuerin von Innichen,
Uschau und Reichenthal, am 15. zum 68. Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit, Gottes Segen und danken für alle Arbeit für unsere Heimat!
Manfred Klemm Stellvertretender Heimatkreisbetreuer
Katharina und Claudia seiner zweiten Frau Gabi war er ein liebevoller Vater. Er freute sich über seine drei Enkelkinder
Sudetendeutsche Zeitung Folge 4 | 27. 1. 2023 16
Ortsbetreuerin
Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
�
Waidhaus – Folge
WIR BETRAUERN
Kindheit in
I
Christine Obermeier Stellvertretende Stadtbetreuerin
Waidhaus aus der Vogelperspektive.
In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser der „Riesengebirgsheimat“
Sie halten heute die erste Ausgabe unserer Heimatzeitung im Jahr 2023 in der Hand. Wir möchten Sie, stellvertretend für die Heimatkreise Hohenelbe und Trautenau, als treue, langjährige oder auch neue Abonnenten herzlich begrüßen und Ihnen für das Neue Jahr alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
Wir hoffen sehr, daß Sie in Ihrer Heimatzeitung, auch wenn diese nun im neuen Gewand erscheint, alles das wiederfinden, was Sie an ihr schätzen und nicht missen möchten: Interessantes und Wissenswertes aus der Heimat, Erinnerungen, Erlebnisse, Berichte von Heimatreisen und

Treffen sowie vor allem die Geburtstage und Familiennachrichten.
Damit das so bleibt, brauchen wir nach wie vor Ihre Mithilfe. Bitte schicken Sie weiterhin zahlreich Ihre lesenswerten Beiträge und Fotografien an die Redaktion und tragen Sie so zur bestmöglichen Gestaltung unserer Heimatseiten bei.
In heimatlicher Verbundenheit grüßen Sie sehr herzlich
Verena Schindler
1.Vorsitzende Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V.

Wigbert Baumann


1. Vorsitzender Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V.


Stabwechsel in der Redaktion
Mit der Liquidation des Preußler-Verlags stand auch die „Riesengebirgsheimat“ vor einer Zeitenwende. Innerhalb der Sudetendeutschen Zeitung kann sie natürlich nicht mehr in gewohntem Umfang erscheinen. Die Enttäuschung bei vielen Lesern ist nachvollziehbar, trotzdem war es der einzig gangbare Weg, die Heimatzeitung überhaupt noch am Leben zu erhalten.
Zu dem neuen Gesicht der Zeitung gehört auch ein neues Gesicht in der Redaktion. Herr Peter Barth konnte leider nicht mehr von der Sudetendeutschen Zeitung übernommen werden, auch hier ist eine neue Zeit angebrochen.
Unser Dank gilt seinem jahrzehntelangen Schaffen für die „Riesengebirgsheimat“.
Mein Name ist Karin WendeFuchs, geb. 1953 in Kaufbeuren. Meine Eltern stammten aus Aussig, mein Urgroßvater aus Freiheit im Riesengebirge. So habe ich in beiden Regionen meine Wurzeln. Seit 2008 bin ich Redakteurin des „Aussiger Boten“. Durch die intensive Bindung zur Heimat und mein Interesse an den Menschen, die mir Beiträge senden oder Kontakt zu mir suchen, sind im Laufe der Jahre echte Freundschaften entstanden. Ich verspreche, dass ich bei meinem nächsten Besuch in Aus-

sig auch die Riesengebirgsregion bereisen werde, schließlich bin ich mit den Geschichten vom „Rübezahl“ aufgewachsen. Wenn Sie redaktionelle Bei-
träge für die „Riesengebirgsheimat“ haben, senden Sie diese bitte direkt an meine eMailAdresse: Riesengebirgsheimat@t-online.de.
Von Beruf bin ich Werbetexterin und seit 15 Jahren Redakteurin. Mein Mann Josef Fuchs ist Grafik-Designer. Gemeinsam arbeiten wir an der Gestaltung der Heimatzeitungen.
Ich möchte Sie bitten, mir Ihr Vertrauen zu schenken und mich durch Ihre Mitarbeit an der „Riesengebirgsheimat“ zu unterstützen.
Vielen Dank!
Ihre Karin Wende-Fuchs
Redaktion
Sollte die Redaktion nicht besetzt sein, hinterlassen Sie bitte Namen und Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter (Tel. 08641 6999521)oder schreiben Sie ein eMail an Riesengebirgsheimat@t-online.de.
Die Redaktion behält sich vor, redaktionelle Beiträge zu veröffentlichen, zu ändern bzw. zu kürzen. Auch wann der Artikel erscheint, wird von der Redaktion festgelegt. Bitte Beiträge nicht mehrmals einsenden. Bei Artikeln mit Bild die Quelle angeben (Foto: ...). Die Fotos möglichst per eMail als jpeg oder pdf senden.
Jeder kann schreiben. Sie müssen keine perfekten Manuskripte einsenden, wir bringen auch Ihre Notizen sprachlich in Form.
Geburtstagslisten:

Liebe HOBs! Bitte schicken Sie die Geburtstagslisten bis zum 15. des Vormonats per eMail an In Ausnahmefällen auch per Fax 08641 61329 oder per Post an Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen).
Bereinigen Sie die Listen, d.h. Verstorbene streichen (das Internet nach Todesanzeigen durchforsten, Abgleich mit der Mitgliederliste). Bitte in Ihrer Liste vermerken, welche Kontaktdaten Sie als HOB veröffentlichen wollen, Name und Telefon oder Name, Telefon, eMailadresse.
Danke, Peter Barth
Das Wort wurde ihm schon in die Wiege gelegt, als Peter Barth 1937 in Trautenau zur Welt kam. Nach der Vertreibung 1946 landete die Familie ausgerechnet in Barth, einer Stadt an der Ostsee. Alle kennen seine Worte, wenn er sich am Telefon meldet: Hier ist Peter Barth aus Barth.

Bereits mit 15 Jahren schrieb Peter Barth hier seinen ersten Artikel für die OSTSEE-ZEITUNG. Die Themen suchte sich der 1956 mit dem Titel „Volkskorrespondent“ geadelte stets selbst. Trotz seiner Schreibwut absolvierte Peter Barth ein Chemiestudium an der Universtät Greifswald.
Als Chemiker im Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld ließ er sich hier dauerhaft nieder. Erst im Rentenalter kehrte Peter Barth an die Ostseee zurück und engagierte sich seitdem für die Sudetendeutsche Landsmannschaft. Er ist Vorsitzender der Altkreisgruppe Nordvorpommern. Bis zuletzt war er hochgeschätzter Redakteur der „Riesengebirgsheimat“. Im Laufe der Jahrzehnte sind herzliche Kontakte zu den Heimatfreunden entstanden und Peter Barth bedauert sehr, dass er durch die Liquidation des Preußler Verlags seine Aufgabe verloren hat und von der Sudetendeutschen Zeitung nicht mehr übernommen wurde.
Wir wünschen
Sudetendeutsche Zeitung Folge 04 | 27.01.2023 17
�
Winterstimmung bei der Kirche in Niederlangenau. Mit diesem heiteren Bild von der Kirche Jakobus des Älteren (1511-1518) in Niederlangenau, das uns Frau Verena Schindler zugesandt hat, möchten wir unsere Leser und Heimatfreunde auf ein hoffentlich gutes neues Jahr einstimmen. Foto: Josef Kalensky
ihm Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. Karin Wende-Fuchs
Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge e. V. – 1. Vorsitzende: Verena Schindler, Telefon 0391 5565987, eMail: info@hohenelbe.de, www.hohenelbe.de – Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. – 1. Vorsitzender Wigbert Baumann, Telefon 0931 32090657 – Geschäftsstelle Riesengebirgsstube (Museum-Bibliothek-Archiv), Neubaustr. 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931 12141, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de – www.trautenau.de – Redaktion: Karin WendeFuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Telefon 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: Riesengebirgsheimat@t-online.de – Redaktionsschluss: jeweils der 15. des Vormonats.
Zum Start ins neue Jahr
�
Geburtshaus von Heinrich Wende, Altfreiheit, Marktplatz.
Peter Barth. Quelle: Ostsee-Zeitung
Karin Wende-Fuchs. Heinrich Wende, geb. 1862 in Freiheit.
Illustration: wikipedia, monagip Riesengebirgsheimat@t-online.de.
Heimatblatt für die Kreise Hohenelbe und Trautenau
Am 18. Januar 2023 konnte unser verdienter Landsmann Dr. Pepi Erben, Pistenfahrer und Tiefschnee-Freak, seinen 95. Geburtstag feiern. Lassen wir ihn – brillant in Wort und Schrift –aus seinem ereignisreichen Leben selbst erzählen:

„Das Geschenk, auch im hohen Alter noch leidlich gesund und munter zu sein, muß mir wohl das Schicksal in die Wiege gelegt haben, die nur wenige Meter unterm ‚Schlesischen Steig‘ stand, wo im Dreißigjährigen Krieg der schwedische König Gustaf Adolf mit seinen wilden Reiterscharen das ‚Hohenelber Gebürg‘ überquerte.
Ich wurde am 18. Januar 1928 in Rennerbauden im Riesengebirge (Seehöhe 1300 m) geboren, etwa gleich weit entfernt von Spindlermühle, Petzer/Großaupa und der 1605 m hohen Schneekoppe, die wir Kinder über die Geiergucke und die Wiesenbaude in nur 80 rekordverdächtigen Minuten bezwangen. Dort oben in Rübezahls Reich spielte für uns Kinder im Angesicht der Schneekoppe immer das Skifahren die erste Geige und führte zu überraschenden Erfolgen. Daß meine Altvorderen sogar im Aupatal heimlich „die Rothschilds“ genannt wurden, lag wohl an der Direktvermarktung ihrer Produkte. Schon mein Urgroßvater Anton Erben und sein Sohn „Antona Seff“ trugen die schmackhafte Riesengebirgsbutter und die begehrten „Koppenkaslan“ zu einer festen Abnehmerschaft in unsere Kreisstadt Hohenelbe – Fußmarsch hin und zurück 20 km, Höhenunterschied 1800 m.
Mein erster Schultag in der Bürgerschule zu Hohenelbe am 1. September 1939 fiel aus, der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Ein Jahr später wechselte ich ins dortige Gymnasium und bald darauf, wohl auch wegen meiner skisportlichen Erfolge (Reichsjugendsieger in Garmisch-Partenkirchen usw.), in die Eliteschule auf Schloß Lobkowitz unweit von Prag.
Im letzten Kriegsjahr noch als Halbwüchsiger eingezogen, wagte ich nach kurzer Gefangenschaft den nicht ungefährlichen Fußmarsch von Österreich in die Tschechoslowakei, von wo ich mit meinen kleinen Geschwistern, die durch den plötzlichen Tod unserer Mutter schon zwei lange Jahre als Halbwaisen
Zum 95. Geburtstag unserer „Skikanone“ Dr. Pepi Erben
Erfolge in der Nachkriegszeit und die Entwicklung des Skisports in Deutschböhmen hat der Jubilar in seinem gleichnamigen Buch ausführlich beschrieben.
Besonders hervorzuheben ist aber auch Dr. Pepi Erbens Engagement für den Heimatkreis:
Ab dem Jahr 2000 übernahm er das Amt des Ortsbetreuers für Pommerndorf. Er veröffentlichte in der „Riesengebirgsheimat“ zahlreiche, außerordentlich interessante, faktenreiche Beiträge über die Geschichte des Ortes und seiner Bewohner, unter anderem die Reihe „Aus dem Gemeindegedenkbuch von Oberlehrer Josef Fischer“.
� Riesengebirge Ausflug in die Heimat
Kurzfristig entschieden wir uns, die sonnigen Oktobertage zu einer Reise ins Riesengebirge zu nutzen. Wir genossen das warme Herbstwetter. Die
befindet sich eine UFO-ähnliche Wetterstation, die runde St.Laurentius-Kapelle und ein neues Gebäude der tschechischen Post. Bei dem herrlichen Wetter ging unser Blick viel lieber in die Weite. Bis zu 200 km ist der Rundblick bei guten Wetterverhältnissen und wir hatten großes Glück, denn im Durchschnitt liegt der Gipfel 300 Tage im Jahr im Nebel.

aufwuchsen, aus unserer sudetendeutschen Heimat vertrieben wurde. Ende 1946 flüchtete ich aus dem russisch besetzten Thüringen zu meinem schwer kriegsbeschädigten Bruder in den Westen und holte meine sehnlichst wartenden Schutzbefohlenen nach, bald auch unseren Vater, den die Tschechen nach Haft, Folterung und Zwangsarbeit in Bayern ausgesetzt hatten.
Glückliche Umstände machten es möglich, in Bad Homburg das Abitur nachzuholen und in den Alpen Skirennen zu fahren. Für die Sportpresse war es eine Sensation, als der „Frankfurter Flachlandläufer Pepi Erben“ 1952 den Sprung in die Olympiamannschaft schaffte. Leider hatte ich das Pech, im Abfahrtslauf nach drittbester Zwischenzeit einen komplizierten Beinbruch zu erleiden, der mich veranlasste, an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität ein Wirtschaftsstudium zu beginnen. Mit dem Gewinn der Studentenweltmeisterschaft 1955 hängte ich die Rennlaufkarriere an den Nagel.
Nach der Promotion zum Dr. rer. pol. in Graz war ich als Direktionsassistent und Marketingmanager tätig. Als man mich eines Tages fragte, ob ich als Vorsitzender des Ski-Clubs Taunus ein an den Wochenenden preiswert zur Verfügung stehendes Flugzeug auslasten könne – es war eine viermotorige DC 6 mit über 100 Plätzen – ging ich dieses Risiko ein, setzte aber vor-
Konzert in der Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit in Forst

Am 19. November 2022 fand in der Kirche in Forst vor dem wunderschönen Altarbild wieder ein Konzert mit geistlicher Musik statt. Eingeladen hatte der Verein zur Erhaltung der Forster Kirche. Im Vorfeld wurde die Kirche geputzt, dekoriert und für das Konzert hergerichtet. Der Eintritt war frei, auf Spendenbasis. Auf dem Programm standen u. a. Werke von Händel, Vivaldi, Mozart, Schubert, Beethoven und Dvořák. Am Klavier (ursprünglich Orgel) Petra Opočenská, es sangen Christina Kluge (Deutschland), Sopran und Jaroslav Mrázek, Tenor. Die
Veranstalter freuten sich über einen guten Besuch. Verena Schindler
Die barocke Kirche der hl. Dreifaltigkeit in Forst entstand in den Jahren 1769 - 1775. An derselben Stelle befand sich bereits eine Kirche von 1606.

Seit November 2007 ist die Gemeinde Forst Besitzer der Kirche. Der Verein zur Erhaltung der Forster Kirche wurde gegründet, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Seit 2008 wird der marode Dachstuhl restauriert, was mit hohen Kosten verbunden ist. kw
Quelle: wikipedia
wiegend auf meine amerikanischen Freunde, die noch zuhauf in Frankfurt, Wiesbaden, Heidelberg usw. stationiert waren. Mein erster Wochenend-Skiflug im Januar 1967 war ein Riesenerfolg; zahllose weitere Flüge „all over Europe“ folgten.
Derweil zum Tiefschneefahrer mutiert, katapultierte mich 1976 AEROSKI zum erfolgreichsten europäischen Zubringer für ‚Heli-Skiing Kanada‘, woran natürlich auch meine Frau und unsere Söhne massiv beteiligt waren. Das Familienunternehmen entwickelte sich zum größten europäischen Reiseveranstalter für Heli-Skiing in Kanada (dabei fliegt man im Helikopter auf einen Berg und fährt mit einem Heli-Guide durch unberührten Tiefschnee bergab). 1992 übertrug ich das Unternehmen an die jüngere Generation. Das Tiefschneefahren mit Skiführer abseits der Piste – in den abgelegensten Arealen dieser Welt –das ist wie eine Droge, die dich nicht mehr losläßt.
„Es wäre noch manches zu berichten“, schreibt Dr. Pepi Erben weiter, „etwa 1944 in Zakopane, als ich bei einem Vergleichskampf auf der Schanze mitspringen mußte, obwohl ich als Alpiner nur für den Abfahrtslauf am Kasprovi vorgesehen war – einige ältere Mannschaftskameraden waren bereits an die Ostfront abkommandiert worden ...“
Die skisportlichen Erfolge der Sudetenjugend 1934 - 1944, die
Im Jahr 2000 wurde auch das von ihm und Hans Adolf verfasste, 238 Seiten starke Ortsbuch „Die Riesengebirgsgemeinde Pommerndorf mit ihren Ortsteilen Langenauerberg, Wachur, Grünloch, Pommerndorf-Ortskern, Kratzenplan, Sechsstätten, Mühlberg, Teichhäuser mit Kuckuckshaus, Schönlahn, Hermelhaus, Füllenbauden, Gansbauden, Lahrbauden, Friesbauden, Vorder- und Hinterrennerbauden, Ernsthäuser“ als 5. Buch der Ortsbuchreihe des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge e. V. herausgegeben.
Seit Jahrzehnten hat Dr. Pepi Erben unsere Heimatzeitung mit seinen Artikeln bereichert, ihm selbst haben die fünf Folgen mit dem Titel „Böhmen, dieses Land so schön vor allen – einst auch die Heimat der Sudetendeutschen“ am meisten Freude bereitet. Den Lesern sicherlich auch.
Hoffen wir, dass ihm das Schreiben nach wie vor Freude bereitet, vor allem aber, dass er und seine Frau Sieglinde sich weiterhin guter Gesundheit erfreuen. Dazu der Jubilar selbst: „Trotz meiner bevorstehenden ‚100 minus 5‘ fühle ich mich noch recht gesund, was auch für meine liebe Frau, gebürtig aus dem Nachbarhaus, gilt. Sigi wird am 24. März 86; wir sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet und hoffen, unser Herrgott wird den beiden „Rennerbailern aus dem Hohenelber Gebürg“ noch ein paar gute Zeiteinheiten schenken.“
Der Heimatkreis und sein Vorstand wünschen dem Jubilar beste Gesundheit als kostbares Geschenk aus Gottes Hand und noch viele schöne, glückliche Momente mit seiner lieben Frau Sieglinde. (Beitrag leicht gekürzt).
Verena Schindler, 1. Vorsitzende HKH
Niederhof Neues aus Niederhof
Gemeinde
Bei den Kommunalwahlen im September 2022 wurden neun Personen, die keiner Partei angehören, in den Gemeinderat von Niederhof gewählt. Bei der ersten Gemeinderatssitzung wurde die Wiederwahl von Martin Belovsky als Bürgermeister und David Neumann als stellvertretender Bürgermeister bestätigt. Beide haben sich in ihrer Amtszeit durch eine sehr erfolgreiche Gemeindepolitik ausgezeichnet. Auch wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden.
Friedhof
Bei der Sanierung des Friedhofs wurde in einer ersten Phase der Baumbestand beseitigt. Ab 2023 beginnen die Sanierungsarbeiten an den noch vorhandenen Grabmalen und Grabtafeln.
Religiöse Denkmäler
Die Wegkreuze bei den Häusern im Kleinen Elbtal 121 und auf der Winterleite 81 wurden durch ei-
nen Fachrestaurator aus Königgrätz wiederhergestellt. Die erneuerten Kleindenkmäler sind bereits an ihren alten Standort zurückgekehrt. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Wegkreuze ebenso fachgerecht saniert werden.
Die Statue des Hl. Joseph am Erzplatz wurde am 25.10.2022 abgebaut und zur Restaurierung abtransportiert. Die Restaurierung soll etwa sieben Monate dauern. Diese Sanierung wird finanziert durch den TschechischDeutschen Zukunftsfonds, die Gemeinde Niederhof, durch uns Niederhofer und durch Freunde, die an unseren Niederhofer Gemeindetreffen teilnehmen.
Einen Spendenaufruf werde ich demnächst versenden. Zur Weihe im kommenden Sommer ist eine Festveranstaltung in Niederhof vorgesehen, an der hoffentlich viele von uns teilnehmen werden.
Dr.-Ing. Erich Kraus HOB Niederhof
bunte Laubfärbung machte die Eindrücke noch intensiver.
Der erste Ausflug ging zu den Adersbacher Felsen. Dieses monumentale Gebilde aus Sandstein ist überwältigend! Die früheste Ansicht stammt aus dem Jahr 1739. Viele Jahrhunderte hatte die Bevölkerung großen Respekt vor dem bizarren Felsenlabyrinth und wagte sich nur in Kriegszeiten dahin, um Unterschlupf zu finden.
Heute sind die Adersbacher Felsen mit Wanderwegen durchzogen und ein touristischer Höhepunkt jeder Reise ins Riesengebirge.

Ein weiterer Tagestrip brachte uns mit dem Lift auf den höchsten Berg des Landes, die 1603 m hohe Schneekoppe. Auf dem Gipfel des Granitberges
Unser persönliches Highlight war allerdings das Treffen mit Alexander Schreier, der zufällig das Zimmer uns gegenüber bezogen hatte. Er war sozusagen im Dienst, als Begleiter einer Reise-
gruppe. Wir hatten uns schon einige Male bei Heimattreffen gesehen und genossen es, etwas mehr Zeit miteinander zu verbringen.
Eine Fahrt führte uns nach Pelsdorf, meinem Geburtsort. Wir wurden vom Sohn Gustav Sturm, mit dem wir in enger Verbindung stehen, in Hohenelbe abgeholt. Ein entfernter Verwandter bewohnt jetzt mit seiner Familie mein ehemaliges Elternhaus und ist auch gerade am Renovieren, was mich sehr freut.
Abschließend kann ich sagen, dass wir schöne Stunden mit netten Menschen verleben durften und bedanken uns beim Reiseveranstalter für die tolle Organisation.
Helmut Schreier HOB Pelsdorf
� Spindelmühle 2023 Ski-Weltcup der Damen wieder in Spindelmühle
2019:
Unser Heimatbetreuer Dirk Schulze und seine Gattin Carmen Wolter-Schulze waren 2019 bei diesem Großereignis live dabei. Die begehrten Eintrittskarten hatte Alexander Schreier besorgt.
Nach vier Jahren wird der Weltcup-Slalom der Damen am 28.1.2023 wieder in Spindelmühle stattfinden.


2019: Es sieht so aus, als ob mein Mann Dirk und Tochter Josie die einzigen deutschen Fahnenschwinger sind...
2019 säumten über 20.000 Menschen die Piste und auch dieses Jahr werden viele tschechische Fans erwartet, die auf einen erneuten Sieg ihrer Petra Vlhova hoffen. kw Quelle und Fotos: Carmen Wolter-Schulze
RIESENGEBIRGSHEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 04 | 27.01.2023
Am Renntag herrscht echtes „Riesengebirgswetter“, da kann man einen Schnaps vertragen.
� Heimatkreis Hohenelbe
Pianistin, Sopranistin und Tenor vor der eindrucksvollen Kulisse des Altars.
�
Helmut und Anna Schreier.
Adersbacher Felsen. alle Fotos: Helmut Schreier
� Forst
St. Josephskirche in Niederhof. Foto: wikimedia Addvisor 2012
18
Dr. Pepi Erben mit seiner Gattin Sieglinde. Foto: privat
Trauer um Pater Norbert - Josef Just
Am 21. November 2022 verstarb in Berlin mit 87 Jahren Pater Norbert - Josef Just.
Josef Just wurde am 18. September 1935 als fünftes Kind des Seidenwebers Karl Just und seiner Ehefrau Hedwig, geb. Seidel, in Ober-Soor/Kränke geboren. Nach der Vertreibung 1946 kam die Familie zunächst nach Zingst. Da der Vater hier in seinem Beruf keine Arbeit fand, zogen sie ein halbes Jahr später nach Crimmitschau. Dort begann Josef 1949 eine Bäckerlehre, die er 1951 abbrach, um gemeinsam mit seiner Schwester den drei älteren Brüdern in den Westen Deutschlands zu folgen. In Ottbergen besuchte er das Progymnasium der Franziskaner. Ab 1953 ging er in das Gymnasium Josephinum in Hildesheim, wo er 1958 sein Abitur ablegte. Im selben Jahr trat er in den Franziskanerorden ein und erhielt den Ordensnamen Norbert.
In München studierte er Theologie und wurde auch dort am 19. März 1964 von Kardinal Julius Döpfner zum Priester geweiht. Seine Primiz konnte er am 30. März in Hameln feiern, wo seit 1959 seine Geschwister und auch seine Eltern wohnten.

Nach einem weiteren Studienjahr in München und zwei Kaplansjahren in Hohenhameln bei Peine kam er nach Berlin-Tempelhof und war dort zunächst Kurator in St. Johannes Capistran.
Im Jahr 1967 wurde er Pfarrer der Herz-Jesu-Gemeinde Berlin. Als Mitglied des Priesterrates und Dekan in der Diözese Berlin, und
nicht zuletzt als Mitglied in der Rundfunkverkündigung machte er sich einen Namen.
1989 wurde er Pfarrer in der Pfarrei Liebfrauen in Kiel. Als 1994 der Orden die Niederlassung in Kiel auflöste, kehrte er nach Berlin zurück und wurde Pfarrer in St. Georg in Berlin - Pankow. Hier wirkte er zehn Jahre und zog als 69-Jähriger in den Konvent St. Ludwig in Berlin - Wilmersdorf, um in der Seelsorge mitzuarbeiten. Im März 2014 konnte er dort sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum feiern.
49 Jahre war er Pfarrgemeindeseelsorger und davon 42 Jahre in Berlin. Zusätzlich war er seit 1975 wiederholt Mitglied in der Ordensprovinzleitung. Im Sommer 2020 wurde auch die Niederlassung der Franziskaner in Berlin - Wilmersdorf aufgegeben und Pater Norbert ging in das Seniorenzentrum Kardinal Bengsch in Berlin - Charlottenburg.
Viele Menschen, die ihn in seinen verschiedenen Einsatzorten erlebten, schätzten seine freundliche, humorvolle Art, vielen wurde er zum Begleiter auf ihrem Glaubensweg.
Im Vertrauen auf Gottes Liebe und Güte hat er gelebt. Möge er jetzt die Geborgenheit in Gott erfahren.
Edith Niepel, HOB Soor
Große Hoffnung für unsere Kirche
Geburtstage aus dem Heimatkreis Hohenelbe
geb. Sturm zum 93. 17.02. Siegrun Brückner geb. Goder zum 80. 18.02. Ingrid Bauer geb. Stiller zum 82. 19.02. Emil Markel zum 87. 21.02. Herbert Goder zum 82. 21.02. Gerwald Schöbel zum 96. 23.02. Erika Brückner geb. Fleischer zum 93. 23.02. Maria Zirm zum 83. 25.02. Elisabeth Künchen geb. Bock zum 97.
HOB Verena Schindler Tel. 0391 5565987
Hohenelbe/Riesengebirge e. V.,

Geschäftsführung: Gerhard Baumgartl 87616 Marktoberdorf, Richard-Wagner-Str. 2 Tel. 08342 40528, Fax 08342 7054060 www.hohenelbe.de, eMail: info@hohenelbe.de Sparkasse Allgäu, IBAN: DE 41 7335 0000 0380 271262

BIC: BYLADEM1ALG
n HARTA 18.01. Brigitte Singer (Schorn) zum 83. 11.02. Bärbel Müller (Renner) zum 78.
HOB Ingrid Mainert Tel. 06039 2255 eMail: mainert@t-online.de
n HENNERSDORF
19.01. Johann Kraus zum 86. 22.01. Gerhard Hackel zum 88. 23.01. Johann Cersovsky zum 93 27.01. Josef Pochop zum 91. 12.02. Aloisa Helbig (Hackel) zum 91. 16.02. Gerlinde Henning (Jirscha) zum 96. 18.02. Anna Beranek (Palouch) zum 80. 28.02. Edith Güth (Scholz) zum 93.
HOB Ingrid Mainert s. Harta
n HOHENELBE
16.01. Walburga Waldheim (Milde) zum 96. 28.01. Helga Adler (Kröhn) zum 96. 30.01. Ortwin Hütter zum 78. 31.01. Dr. Herbert von Golitschek zum 83. 04.02. Gabriel Fink zum 41. 09.02. Helmut Weiss zum 94. 10.02. Heinrich Renner zum 81. 13.02. Wolfgang May zum 83. 13.02. Helmut Hanka zum 76. 19.02. Rudolf Mohorn zum 78. 22.02. Bernhard Lebeda zum 72. 25.02. Isolde Leichum (Freiwald) zum 96. 26.02. Dr. Helga Neffe zum 92. HOB Ingrid Mainert s. Harta
n KOTTWITZ
Die Entspannung beim Thema „Coronavirus“ nutzten Markus Decker und Lothar Streck, beide Mitglieder der Sudetendeutschen Bundesversammlung, im September 2022 zur gemeinsamen Reise in unseren Heimatkreis Trautenau.
tan ins Innere der Kirche, durch ein kaum vorstellbares Gewirr von Gerüsten und Stahlstützen.
Besonders hatte sich Tochter Anne-Marie Streck auf diese Reise gefreut. Sie ist die Enkelin von Landwirt Alois Pauer (1915 - 1991) aus Pilnikau (Pilsdorf Nr. 93). Trotz verschiedener baulicher Sicherungsmaßnahmen der letzten Jahre ist der Zustand der Pilnikauer Kirche erschütternd. Der Turmhelm muß komplett erneuert werden. Bürgermeister Josef Cerveny empfing uns sehr freundlich und führte uns spon-
Seit Jahren kommt die Sanierung der Kirche nicht voran, offensichtlich fehlt es an Geld. Trotz großer sprachlicher Hürden verstanden wir, dass der Bürgermeister die Hoffnung nicht aufgibt, dass die Kirche eines Tages wieder in altem Glanz erstrahlt, denn sie ist das Wahrzeichen und der kulturelle Mittelpunkt des Städtchens. Diese Hoffnung teilen wir mit ihm, ebenso seine Erkenntnis, daß dieser Verfall seine Ursache in der Vertreibung der Sudetendeutschen hat – einer furchtbaren Katastrophe.
Daß diese wunderschöne Barockkirche eines Tages wiederhergestellt ist und ob sie wieder als Gotteshaus dienen wird, ist heute noch nicht vorstellbar. Aber der in den jungen und jüngsten Generationen ausgeprägte Wunsch nach Aussöhnung ist nicht mehr zu übersehen. Wir kommen wieder!

Lothar Streck, HOB Pilnikau Fotos: Lothar Streck
26.01. Viktor Rumler (Nr. 161 Niederdorf) zum 79. 06.02. Helmut Augst (Nr. 111) zum 84. 20.02. Günter Wolf (Oberdorf 159) zum 89. 24.02. Walburga Rehnert (Oberdorf 136) zum 87. HOB Gudrun Bönisch Tel. 08377 1293
n MASTIG
16.02. Margit Boes geb. Ettrich zum 80. 26.02. Anna Schiller geb. Hofmann zum 90. 01.03. Helga Ettrich zum 91. 08.03. Helga Zietlow (Ulrich-Knauer) zum 79. HOB Tanja Fritz, Tel. 06222 389787
eMail: meerfritz@gmail.com
n MITTELLANGENAU
04.01. Vinzenz Zirm zum 89. 05.01. Erna Jany geb. Weiß zum 93. 07.01. Horst Hollmann zum 90. 09.01. Erich Lorenz zum 87. 14.01. Hannelore Worrings geb. Reinl zum 85. 15.01. Reinhard Franz zum 89. 29.01. Hilde Kiefer geb. Pogerth zum 83. 31.01. Ilse Franz zum 81. 03.02. Theodor Stiller zum 91. 12.02. Elli Lewald geb. Horak zum 87.
13.02. Dietlinde Hammer geb. Graf zum 91. 15.02. Gertraud Wichmann geb. Franz zum 88. 26.02. Erna Lobbes geb. Wonka zum 90. 26.02. Otto Lorenz zum 90. HOB Verena Schindler, Tel. 0391 5565987

n MOHREN 03.01. Ewald Rücker (Nr. 110) zum 83. 03.01 Anni Bertram geb. Schober zum 92. 08.01 Josef Lorenz (Nr. 66) zum 83. 11.01. Walter Erben (Nr. 148) zum 93. 11.01. Erhard Hoffmann (Nr. 72) zum 88. 15.01. Reinhard Lorenz (Nr. 66) zum 78. 16.01. Anni Eichhorn geb. Lath (Nr. 47) zum 83. 21.01. Roland Lorenz (Nr. 162) zum 96. 25.01. Roland Richter (Nr. 16) zum 94. 03.02. Franz Erben (Nr. 81) zum 85. 03.02. Anneliese Leier (Nr. 152) zum 83. 04.02. Kurt Stiller (Nr. 91) zum 82. 05.02. Emil Schober (Nr. 149) zum 90. 12.02. Horst Schneider (Nr. 62) zum 85. 15.02. Josef Heinzel (Nr. 57) zum 86. 22.02. Walburga Liefeld geb. Jatsch (Nr. 145) zum 89. HOB Christina Auerswald Tel. 0341 24707822, eMail: christina.auerswald@gmx.de
n NIEDERHOF 16.02. Horst Jeschke (Rudolfstal 15) zum 84. 27.02. Erika Becker (Rudolfstal 14) zum 89. 28.02. Roland Beranek (Hanapetershau 285) zum 82. HOB Erich Kraus, Tel. 0351 4718868, eMail: brigitte.und.erich.kraus@web.de
n NIEDERLANGENAU
02.01. Waltraud Milde geb. Hanka zum 80. 04.01. Franz Prokupek zum 90. 07.01. Elke Schön geb. Weikert zum 81. 10.01. Gerlinde Shysan geb. Lorenz zum 85. 13.01. Edith Saß geb. Mahl zum 81. 19.01. Edith Wanner geb. Richter zum 93. 20.01. Rosa Haftendorn geb. Barth zum 89. 21.01. Werner Sacher zum 79. 29.01. Artur Hartel zum 85. 07.02. Sieghard Gall zum 84. 08.02. Marianne Müller geb. Zirm zum 85. 08.02. Ernst Schier zum 86. 08.02. Wolfgang Drescher zum 69. 09.02. Edwin Zirm zum 88. 11.02. Hermine Funk geb. Preissler zum 86. 15.02. Ilse Glowienka
n NIEDERPRAUSNITZ 29.02. Heinz Kloss zum 83. HOB Tanja Fritz s. MASTIG n OBERLANGENAU 17.01. Waltraud Lotz geb. Lang zum 80. 24.01. Annelies Ropte geb. Thole zum 92. 25.01. Marianne Jäger geb. Beranek zum 87. 25.01. Günther Kraus zum 91. 27.01. Rosemarie Ilgen geb. Rilk zum 87.
HOB Bärbel Hamatschek
n OBERPRAUSNITZ 16.02. Christl Scheidt geb. Koschtial (Nr. 161) zum 83. 16.02. Edith Wanka geb. Lorenz (Nr. 21) zum 88. 23.02. Elisabeth Kummer geb. Dittrich (Nr. 138) zum 82. 05.03. Günther Festa (Nr. 211) zum 82. 06.03. Fanni Schweiger geb. Hoschka (Nr. 14) zum 92. 09.03. Arnold Balzer (Nr. 284) zum 85. 09.03. Emil Rzehak (Nr. 186) zum 90.
HOB Tanja Fritz s. MASTIG
n PELSDORF 17.01. Günter Sturm zum 97. 18.01. Heidi Cersovsky geb. Haberzettel zum 81. 20.01. Arno Dressler zum 68. 22.01. Annelies Hillinger geb. Lienert zum 84. 29.01. Waltraut Rother geb. Mähwald zum 94. 29.01. Berta Mai zum 89. HOB Helmut Schreier Tel. 03695 600862
n POLKENDORF 12.01. Anneliese Sailer geb. Luksch (Nr. 30) zum 86. 16.01. Annelies Schnabel geb. Augst (Nr. 27) zum 89. 30.01. Wolfgang Drescher (Nr. 9) zum 88. 07.02. Martha Bigalke geb. Drescher (Nr. 11) zum 85. 16.02. Edeltraud Bachmann geb. Nechanitzky (Nr. 24) zum 93. 23.02. Ilse Saul geb. Schroll (Nr. 59) zum 84. 26.02. Maja Erben (Nr. 33) zum 104. 28.02. Ingeborg Michel geb. Schön (Nr. 66) zum 88.
HOB Sylvia Colditz
n POMMERNDORF 18.01. Dr. Pepi Erben (HOB Pommerndorf) zum 95.
HOB Bärbel Hamatschek
n SCHWARZENTAL 19.01. Christl Dechantreiter geb. Steffan (Nr. 65) zum 90. 29.01. Franz Fries (Nr. 19) zum 81. 02.02. Inge Krüger geb. Bock (Nr. 141) zum 80. 02.02. Walter Schirmer zum 67. 08.02. Helga Thilenius geb. Zumpft zum 81. 09.02. Wilfried Ullrich (Nr. 122) zum 82. 09.02. Rudolf Oberholenzer (Nr. 143) zum 81. 13.02. Margot Fuchs geb. Schirmer (Nr. 158) zum 86. 13.02. Margit Hefel geb. Pittermann (Nr. 82) zum 84. 13.02. Lieselotte Scherra geb. Kraus (Nr. 332) zum 94. 15.02. Brigitte Münchinger geb. Rührich (Nr. 75) zum 79. HOB Gernoth Bock, Tel. 0521 335546
n SPINDELMÜHLEFRIEDRICHSTHAL
Friedrichsthal
28.01. Anna Wiedemann geb. Lauer (F 026 - Hofbauden) zum 92. 01.02. Dietmar Kraus (F 044 Haus Regina) zum 81. 06.02. Dr. Roland Hackel (F 022 Delikatessen) zum 91. 11.02. Elisabeth Dyrba geb. Kraus (F 027 Staatl. Arbeiterhaus) zum 98. 13.02. Dr. Margit Glaab geb. Kindler (F 040 Villa Tosca) zum 87. 28.02. Werner Scholz (F 007Goldhöhe) zum 81. Spindelmühle 19.01. Ursula Koch geb. Lauer (Sp 171 Tannenstr. -Haus Tannenstein) zum 83. 21.01 Dorothea Reuter geb. Adolf (Sp 136 Hotel Panorama St. Peter) zum 82. 26.01. Gisela Tobaben geb. Hollmann (Sp 045 Alpenhotel St. Peter) zum 78. 27.01. Margit Ritschel geb. Kunz (Sp 071 Villa Buchberger St. Peter) zum 85. 28.01. Wifried Kraus (Sp 211 Haus Juliana St. Peter) zum 85. 28.01. Charlotte Stiefel geb. Scholz (Sp 047 St. Peter) zum 84. 28.01. Edeltraud Ledvaij geb. Zinecker (Sp 072 St. Peter) zum 77. 31.01. Hans Erben (Ochsengraben) zum 96. 31.0 Hannelore Richter (Sp 020 Herta) zum 76. 06.02. Ludwig Bradler (Sp 007 Tafelbauden) zum 92. 10.02. Wanda Schulze geb. Erlebach (Sp 026 Sacherbaude) zum 91.
13.02. Eckhardt König (Sp 083 Eichlerbaude) zum 82. 21.02. Edeltraud Deutschmann geb. Kohl (Sp 143 St. Peter) zum 88. 21.02. Heide Suchland geb. Zieris (SP 054 St. Peter, geboren in Grunau/Schlesien) zum 80. 24.02. Hans Fries (Sp 203) zum 93.
RIESENGEBIRGSHEIMAT Sudetendeutsche Zeitung Folge 04 | 27.01.2023
Heimatkreis
Sitz Marktoberdorf
� SOOR
� Pilnikau
Im Rathaus von Pilnikau. Von links: Bürgermeister Josef Cerveny, Lothar Streck und (lesend) Anne-Marie Streck.
Ansicht der Kirche in Pilnikau.
WIR GRATULIEREN 19
Todesanzeige Heimatkreis Trautenau
27.02. Manfred Hollmann (Sp 025 Hohe Quelle) zum 80.
28.02. Marie Grede geb. Kraus (Sp 039) zum 87.
HOB Dirk Schulze Tel. 033732 40383
eMail: tischlerei-dirk-schulze @t-online.de
n STUPNA
23.01. Hilda Werner (Pfeifer Nr. 42) zum 87.
03.02. Nora Kuchta (Tochter von Gretl Kotzian Nr. 3) zum 68.
12.02. Gertrud Ochs (Goll Nr. 20) zum 90.
04.03. Siegfried Maly (Nr. 63) zum 82.
HOB Heidrun Vogt, Tel. 036421 22707
n WITKOWITZ
06.02. Margarete Tirpitz geb. Braun (Oberdorf 3) zum 83.
12.02. Reiner Franz (Ziegenhäuser 234) zum 89.
18.02. Christine Götz geb. Feistauer (Schachtelloch 61) zum 89.
19.02. Siglinde Völker geb. Bien (Mitteldorf 359) zum 88.
20.02. Erna Kranz geb. Donth (Schüsselbauden 143) zum 95.
21.02. Ewald Bien (Mitteldorf 226) zum 83.
21.02. Dr. Kurt Fischer (Mewaldsberg 131) zum 80.
25.02. Edith Weinert geb. Anft (Niederdorf 348) zum 94.
25.02. Christel Kramer geb. Hartig (Oberdorf 264) zum 83.
HOB Hans-Joachim Hönig, Tel. 03949 502153
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Leider ist es aus Platzgründen nicht mehr möglich, die runden Geburtstage extra hervorzuheben.
An dieser Stelle möchten wir daher allen Geburtstagskindern und Jubilaren herzlich gratulieren! Wir wünschen Euch Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
Die Heimatortsbetreuer Hohenelbe/Riesengebirge e. V. und Trautenau e.V.
WIR BETRAUERN
n Hohenelbe
Roland Pittermann, geb. 10.08.1938 in Hohenelbe (Haushalts- und Spielwarengeschäft), verstorben im November 2022.
Dipl.-Ing. Theodor Petera, geb. 28.03.1940 in Hohenelbe (Automobil-Industrie), verstorben am 19.09.2022 in Burbach.
n NIEDERHOF
Margot Drieselmann geb. Hamatschek, geb. 12.03.1929 in Niederhof, Rudolfstal 165, verstorben am 11.08.2022.
Othmar Erben geb. 01.02.1933 in Niederhof, Hammerle 167, verstorben am 23.11.2022.
Helma Richter geb. Zinecker, geb. 19.03.1936 in Niederhof, Gansbachtal 124, verstorben am 17.12.2022.
n NIEDERLANGENAU

Günther Rumler, geb. 20.10.1935 in Niederlangenau (Haus Nr. 173), verstorben am 14.12.2022.
Siegrid Seltenreich, geb. 29.02.1932 in Niederlangenau, verstorben am 04.09.2022 in Meckesheim.
n STUPNA
Nesbedova Irma geb. 28.01.1928 in Stupna (Ullrich Haus Nr. 53), verstorben im Juni 2022.
n WITKOWITZ
Theo Fischer, geb. 21.07.1926 in Witkowitz (Dörrhof 59), verstorben am 24.10.2022 in Siegen.
Geburtstage aus dem Stadt- und Landkreis Trautenau
12.02. Wilma Tröger geb. Thum (H) zum 80. 15.02. Rudolf Schindler (G) zum 89. 23.02. Erika Kudernatsch geb. Wokon (B) zum 94. 25.02. Irmtraud Rudisch geb. Kudernatsch zum 90. Günter Henke s. Altsedlowitz
n JOHANNISBAD 04.02. Prof. Heinz Junek zum 79. 07.02. Harald Kuhnert zum 89. 08.02. Evelyn Kleinert geb. Macudzinski zum 94. 20.02. Ingeborg Kranz geb. Berger zum 79. Günter Henke s. Altsedlowitz
n KAILE 20.02. Maria Richter zum 95. Günter Henke s. Altsedlowitz
n KLADERN 11.02. Helga Morak zum 86. HOB Josef Heina
Günter Henke s. Altsedlowitz n OBER-/NIEDERALBEN DORF – DÖRRENGRUND 28.01. Helmut Hintner (N.A) zum 85. 18.02. Ursula Mandel (Dög.) zum 81. HOB Helena Kessler Tel. 09355 1047
n OBER-/ NIEDERKOLBENDORF 01.02. Erika Pilarski geb. Pfluger (O.K) zum 83. 03.02. Reinhard Lamer (N.K.) zum 86. 15.02. Anna Müller geb. Ruse (O.K) zum 86. HOB Helena Kessler, Tel. 09355 1047
25.02. Josef Melzer (NS 30) zum 94. HOB Edith Niepel, Tel. 03841 632765
n STAUDENZ 24.02. Anni Wondratschek zum 89. 24.02. Franziska Patzak (Nr. 3) zum 86.
Günter Henke s. Altsedlowitz
n WELHOTTA - BÖSIG 06.01. Haribert Staude zum 86. 15.02. Sieglinde Wolf zum 82. 16.02. Walburga Rasch zum 82. 18.02. Dr. Gerhard Paus zum 82. 07.03 Edda Winter zum 81. HOB Sieglinde Wolf
Der Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V. gratuliert zum Geburtstag
02.02. Bernhard Hampel ehem. Protokollführer zum 88. 04.02. Helene Beck, ehem. HOB Goldenöls zum 86. 04.02. Edith Haselbach HOB Trautenbach zum 83 07.02. Helmut Preußler ehem. Verleger, zum 86. 08.02. Peter Barth, ehem. Beirat „Riesengebirgsheimat“, zum 86. 11.02. Hans Wimmer ehem. HOB Kleinaupa, zum 80. 15.02. Sieglinde Wolf, HOB Welhotta-Bösig zum 82. 17.02. Margarita Sachs geb. Lucke, ehem. HOB Schlotten, Kukus zum 90. 22.02. Günter Henke HOB-Sprecher und HOB Lampersdorf sowie für 20 weitere Orte, zum 79. 25.02. Irmtraud Rudisch geb. Kudernatsch, ehem. HOB Hermanitz, Bielaun, Prode, Grabschütz, zum 90. 27.02. Christa Lang, HOB Großaupa III/Petzer, zum 73.
n ALTSEDLOWITZ / MARKAUSCH 09.02. Helene Hamann geb. Fiebich (S) zum 96. 24.02. Siegfried Jansch (S) zum 94.
Günter Henke, Tel. 07257 2208, eMail: henke.g-f@t-online.de
n BAUSNITZ
08.02. Hannelore Latzel geb. Maaser zum 83. 22.02. Gerda Heintschel geb. Haase zum 82. Günter Henke s. Altsedlowitz
n BURKERSDORF 18.02. Maria Effert geb. Potsch zum 91. 19.02. Heinz Niewelt zum 84. Günter Henke s. Altsedlowitz
n DEUTSCH-PRAUSNITZ 09.01. Christa Woerke geb. Capek (132) zum 90. 18.01. Elisabeth Langner geb. Hanusch (17) zum 75. 19.01. Gerhard Fiedler (98) zum 80. 26.01. Rudolf Schirmer (99) zum 97. 16.02. Heinz Futter (100) zum 82. 27.02. Walter Pawel (73) zum 97. vorläufig: Günter Henke s. Altsedlowitz
n DÖBERLE 24.01. Edith Siegel (Hs. Nr. 66) zum 95.
10.02. Gerlinde Heilemann geb. Haase geb. Slawisch (Hs. Nr 69) zum 82. Dr. Siegfried Erben Tel. 03843 842088
eMail: dr.siegfriederben@web.de
n DUBENETZ
02.02. Herta Leppin geb. Mathys, ND 7 zum 87. 03.02. Adolf Rindt, OD 168 zum 84. 12.02. Ingrid Koch geb. Mach zum 78. 16.02. Willi Simla, Nr. 35 zum 93. 18.02. Karl Scholz zum 78. 27.02. Franz Rindt, OD 168 zum 88. Günter Henke s. Altsedlowitz
n FREIHEIT 08.01. Roland Fortelka zum 85. 21.01. Gretl Buhr geb. Kammel zum 81. 22.01. Dieter Hampel zum 82. 23.01. Hansel Zippel zum 85. 25.01. Heinz Wurbs zum 82. 26.01. Werner Adolf zum 89. 26.01. Rudolf Kulbe zum 85. 04.02. Bernhard Hampel zum 88. 07.02. Dr. Franz Baudisch zum 94.
10.02. Hans Hampel zum 81. 14.02. Norbert Rücker zum 82. 16.02. Charlotte Conrad zum 94. 18.02. Ursula Nikisch geb. Gall zum 83. 19.02. Gerhard E Kulbe zum 78. 19.02. Kurt Renner zum 88. 20.02. Gerhard Fleischer zum 91. 22.02. Helga Müller geb. Lorenz zum 83.
23.02. Alfred Kühnel zum 95. 26.02. Alois Kühnel zum 93. 01.03. Ursula Fries zum 79. 12.03. Walter Scholz-Ruhs zum 91.
HOB Dr. Ing. Herbert Gall, Tel. 03744 2413660
eMail: gallhr@online.de
n GLASENDORF
12.02. Christa Kühnel Nr. 40 zum 76.
HOB Alois Zieris, Tel. 03578 314382
n GRADLITZ
06.02. Erika Schmidt geb. Ermann zum 87. 10.02. Elfriede Krüger geb. Selisko zum 96. 23.02. Adolf Friebel zum 83. Günter Henke s. Altsedlowitz
n GROSSBOCK / KLEINBOCK 13.02. Adolf Schreiber zum 87. 13.02. Jeanette Peiser geb. Purr zum 85. 14.02. Hildetraud Mählen geb. Jirasek zum 90. 16.02. Karl Heinz Purr zum 83. Günter Henke s. Altsedlowitz
n HARTMANNSDORF 19.02. Emilie Schmidt zum 88. Günter Henke s. Altsedlowitz
n HERMANITZ, BIELAUN, PRODE und GRABSCHÜTZ 01.02. Karin Tröster (H) zum 80. 08.02. Willi Wollak (P) zum 91.
n KLEINAUPA 03.02. Edith Bauer geb. Ruse zum 79. 11.02. Maria Grzesicek geb. Grabinger zum 90. 11.02. Hans Wimmer zum 80. 18.02. Ursula Mandel geb. Ruse zum 81. 21.02. Schwester Friedholda geb. Sagasser zum 88. 24.02. Siegfried Brunecker zum 78. 25.02. Marie Koller geb. Kirchschlager zum 94. 26.02. Elisabeth Schramm geb. Wimmer zum 86. Günter Henke s. Altsedlowitz
n KÖNIGSHAN 06.02. Annelies Diroll geb. Jindra (Kö 146) zum 94. 08.02. Hannelore Latzel geb. Maaser zum 83. 11.02. Edith Licht geb. Hampel (Kö 33) zum 95. 11.02. Maria Kretschmann geb. Bischof zum 91. 11.02. Irmhild Anders geb. Hallmann (Kö 42) zum 88. 15.02. Berta Goder geb. Bamberg (Kö 87) zum 94. 16.02. Heinz Haase (Kö35) zum 92. 22.02. Gerda Heinschel geb. Haase zum 79. 25.02. Monika Szikora geb. Streit (Kö 126) zum 79. 28.02. Martina Dietze geb. Anders (Kö 127) zum 66. Günter Henke s. Altsedlowitz
n KOKEN 04.02. Maria Fleischer zum 96. 09.02. Elfriede Polz (Gattin des verst. Otto Polz) zum 89. 12.02. Elfriede Grabisch geb. Bock zum 84. 24.02. Hilde Bendel geb. Rindt zum 78. HOB Josef Heina
n LAMPERSDORF 01.02. Elfriede Nossek geb. Amler (Nr. 7) zum 91. 02.02. Werner Polz (Nr. 60) zum 79. 03.02. Harald Steiner zum 81. 04.02. Marie Winklerova geb. Struckel (Nr. 200) zum 90. 05.02. Gertrud Bierbauer geb. Schmidt (Nr. 15) zum 91. 06.02. Hanna Weiss geb. Kopper (Nr. 32) zum 85. 07.02. Adolf Siegel (Nr. 94) zum 82. 08.02. Gottfried Feest (Nr. 153) zum 62. 13.02. Annemarie Greve geb. Klug (Nr. 24/25) zum 82. 14.02. Heidrun Müller geb. Posdiena (Nr. 128) zum 75. 17.02. Edwin Staude (Nr. 7) zum 75. 18.02. Christel Patsch geb. Utecht (Nr. 153) zum 88. 25.02. Walter Lenitschek (Nr. 112) zum 79. 27.02. Dorothea Polz geb. Klatt (Nr. 220) zum 80. Günter Henke s. Altsedlowitz
n LITTITSCH und NEUJAHRSDORF 01.02. Edeltraud Schmidt geb. Fiedler (Li 11/12) zum 82. 07.02. Anni Suckow geb. Mach (Njd 18) zum 91.
n QUALISCH 04.02. Waltraud Schröter geb. Kohl zum 92. 18.02. Elfriede Guba geb. Schreiber zum 92. 19.02. Margarete Haese geb. Föhst zum 88. Günter Henke s. Altsedlowitz
n SCHATZLAR, STOLLEN, BOBER, BRETTGRUND/WERNSDORF, REHORN/QUINTENTAL, SCHWARZWASSER 01.02. Ester Kamenicka (S) zum 50. 02.02. Ulrike Böttcher geb. Groß (S290) zum 80. 03.02. Betti Rummler-Maier geb. Hahn (Sw45) zum 90. 03.02. Volker Bensch (S/St183) zum 84. 03.02. Harald Steiner (S366) zum 81. 03.02. Markus Breyer (S244) zum 59. 04.02. Detlef Weiser (Sw1) zum 63. 08.02. Maria Liebisch geb. Patzak (Bo19) zum 93. 10.02. Lotar Bönisch (S93) zum 93. 11.02. Marie Knauer geb. Purmann (S238) zum 96. 11.02. Otto Hampel (S) zum 93. 11.02. Annelies Olthoff geb. Joudal (S207) zum 91. 12.02. Edith Hoffmann geb. Reimann (S261) zum 94. 14.02. Anna Damerau geb. Lorenz (S191) zum 95. 15.02. Ingeborg Baumgart geb. Bergmann (S235) zum 92. 15.02. Marianne Simmich geb. Illner (Sw25) zum 92. 15.02. Christel Klenner geb. Bader (Wehr) zum 83. 17.02. Irmgard Thamm geb. Rostek (S182) zum 89. 17.02. Annelies Taubova geb. Schmidt (Sw59) zum 89.
17.02. Edwin Staude (Lp7) zum 75.
18.02. Roman Weber (S165) zum 70.
20.02. Reinhold Schöbel (B/W20) zum 94. 22.02. Willibald Scholz (Sw6) zum 70. 23.02. Hans Haase (Bo96) zum 78.
Günter Henke s. Altsedlowitz
n SCHLOTTEN 20.02. Margarita Sachs geb. Lucke zum 90. 20.02. Magda Schab geb. Lesk zum 81. Günter Henke s. Altsedlowitz
n SCHURZ 04.01. Erna Knoblich zum 93. 06.02. Margit Bauer geb. Knapp zum 97. HOB Josef Heina
n SOOR 04.02. Theodor Kühnel (NS 86) zum 87. 11.02. Hedwig Schneider geb. Koch (OS 33) zum 91. 14.02. Elfriede Gehrmann geb. Kühnel (NS 86) zum 80. 15.02. Reinhard Thamm (NS 6) zum 78. 18.02. Josef Beier (OS 23) zum 89. 20.02. Josef Letzel (NS 68) zum 86. 22.02. Waltraud Fitz geb. Scharf (NS 13) zum 81. 23.02. Günther Brandl (OS/KSTK) zum 81.
n WIHNAN 05.02. Lothar Herale (Sohn von Hedl Netuschil) zum 66. 12.02. Helga Kochhafen geb. Lockwenz zum 83. 18.02. Ingrid Messner zum 83. HOB Josef Heina
n WOLTA 01.02. Gertrud Schott geb. Tinla (W16) zum 85. 08.02. Heinz Rose (W7, Höhenweg) zum 80. 10.02. Rudolf Erben (W129) zum 96. 15.02. Josef Stransky (W83) zum 85. 21.02. Annelies Korn geb. Illner (W39) zum 85. Günter Henke s. Altsedlowitz
n WÖLSDORF 31.01. Margarete Prinz geb. Jeschke (OW94) zum 90. 10.02. Walter Jakubetz (OW97) zum 86. HOB Herbert Rzehak, Tel. 07221 979143
n BERNSDORFBERGGRABEN
Rudolf Wolf geb. 1929 in Bernsdorf-Berggraben (Sohn vom Schuhmacher Rudolf Wolf), verstorben am 16.12.2022 in den USA.
n RADOWENZ Irmtraud Röcker geb. Pokorny aus Radowenz, verstorben am 01.10.2022 in Rostock.
n JUNGBUCH Rainalda Weilacher geb. Bönsch aus Jungbuch, verstorben am 15.11.2022 in München.
Liebe Heimatfreunde! Damit unsere Heimatortsbetreuer ihre Listen regelmäßig aktualisieren können, ist es notwendig, daß Angehörige ihre Verstorbenen umgehend den HOBs oder der Redaktion melden. Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Geburtstagskinder, liebe HOBs!
Durch den Herausgeberund Redaktionswechsel ist es möglich, daß Manuskripte evtl. nicht vollständig sind. Durch den späten Erscheinungstermin in der 4. Januarwoche, konnten viele Geburtstage erst nachträglich veröffentlicht werden. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Ich bitte die HOBs künftig alle Geburtstags- und Sterbemeldungen direkt an die Redaktion zu schicken: eMail:
Riesengebirgsheimat @t-online.de
Schlußtermine für Ihre Meldungen: 15.02. für März 15.03. für April 15.04. für Mai 15.05. für Juni 15.06. für Juli 15.07. für August/September 15.09. für Oktober, 15.10 für November 15.11. für Dezember.
Herzlichen Dank! Karin Wende-Fuchs
RIESENGEBIRGSHEIMAT
WIR BETRAUERN
Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau e. V., Sitz Würzburg Geschäftsstelle/Riesengebirgsstube: 97070 Würzburg, Neubaustr. 12 Tel. 0931 12141, Fax 0931 571230
1.
Vorsitzender Wigbert Baumann www.trautenau.de, eMail: riesengebirge-trautenau@freenet.de Sparkasse Mainfranken Würzburg IBAN: DE 31 7905 0000 0001 405695
BIC: BYLADEM1SWU
20 Sudetendeutsche Zeitung Folge 04 | 27.01.2023

















































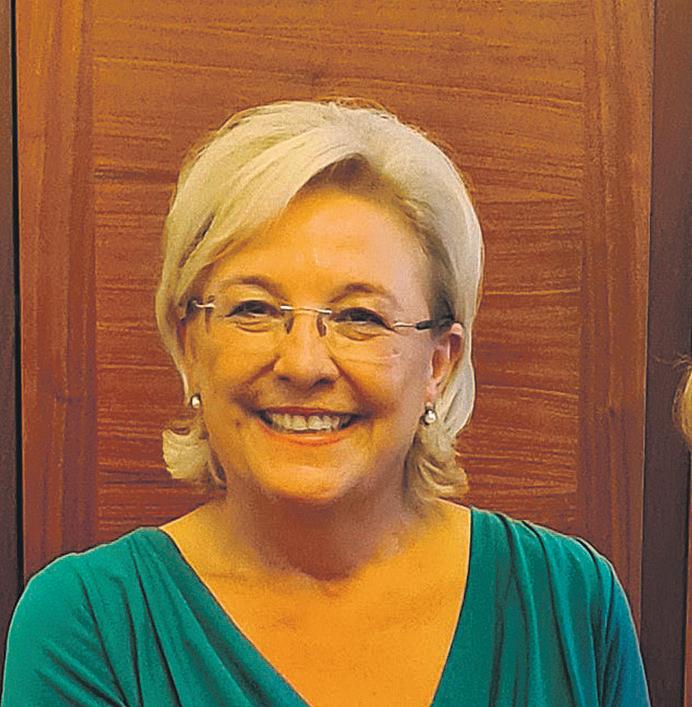


















 Susanne Habel
Susanne Habel
















 Maria Salomon Peter Barth
Maria Salomon Peter Barth


















 Herbert Meinl
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
Herbert Meinl
Heimatkreis Neudek – Patenstadt Augsburg. Heimatkreisbetreuer: Heinrich Hegen, Pflugstraße 41, 86179 Augsburg, Telefon (08 21) XXXXXXX. Heimatmuseum Stadt und Kreis Neudek, Von-Cobres-Straße 5, 86199 Augsburg. Besichtigungstermine bei Josef Grimm, Telefon (08 21) 6 41 42, eMail grimm-augsburg@t-online.de oder Dieter Thurnwald, Telefon (08 21) 88 05 55. Heimatgruppe „Glück auf“ Stadt und Landkreis Neudek – Vorsitzender: Heinrich Hegen. Neudeker Heimatbrief – Verantwortlich von seiten der Heimatgruppe: Dieter Thurnwald. Redaktion: Herbert Fischer, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail neudeker@sudeten.de. Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Erscheint achtmal jährlich im Abstand von etwa sechs Wochen. Jahresbezugspreis 25,00 EUR. Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe: Mittwoch, 14. März.
Neudek Abertham
Bärringen Frühbuß Platten Patenstadt Augsburg
























 Bad Kissingen aussprach. Der Termin wird noch abgesprochen.
Jutta Benešová
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Erz-
Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733
Bad Kissingen aussprach. Der Termin wird noch abgesprochen.
Jutta Benešová
Dux Ossegg
Ladowitz Klostergrab
Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg
Erz-
Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733












































