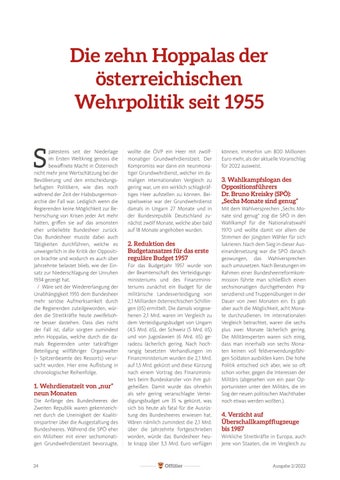Die zehn Hoppalas der österreichischen Wehrpolitik seit 1955
S
pätestens seit der Niederlage im Ersten Weltkrieg genoss die bewaffnete Macht in Österreich nicht mehr jene Wertschätzung bei der Bevölkerung und den entscheidungsbefugten Politikern, wie dies noch während der Zeit der Habsburgermonarchie der Fall war. Lediglich wenn die Regierenden keine Möglichkeit zur Beherrschung von Krisen jeder Art mehr hatten, griffen sie auf das ansonsten eher unbeliebte Bundesheer zurück. Das Bundesheer musste dabei auch Tätigkeiten durchführen, welche es unweigerlich in die Kritik der Opposition brachte und wodurch es auch über Jahrzehnte belastet blieb, wie der Einsatz zur Niederschlagung der Unruhen 1934 gezeigt hat. / Wäre seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1955 dem Bundesheer mehr seriöse Aufmerksamkeit durch die Regierenden zuteilgeworden, würden die Streitkräfte heute zweifelsohne besser dastehen. Dass dies nicht der Fall ist, dafür sorgten zumindest zehn Hoppalas, welche durch die damals Regierenden unter tatkräftiger Beteiligung willfähriger Organwalter (= Spitzenbeamte des Ressorts) verursacht wurden. Hier eine Auflistung in chronologischer Reihenfolge.
1. Wehrdienstzeit von „nur“ neun Monaten Die Anfänge des Bundesheeres der Zweiten Republik waren gekennzeichnet durch die Uneinigkeit der Koalitionspartner über die Ausgestaltung des Bundesheeres. Während die SPÖ eher ein Milizheer mit einer sechsmonatigen Grundwehrdienstzeit bevorzugte,
24
wollte die ÖVP ein Heer mit zwölfmonatiger Grundwehrdienstzeit. Der Kompromiss war dann ein neunmonatiger Grundwehrdienst, welcher im damaligen internationalen Vergleich zu gering war, um ein wirklich schlagkräftiges Heer aufstellen zu können. Beispielsweise war der Grundwehrdienst damals in Ungarn 27 Monate und in der Bundesrepublik Deutschland zunächst zwölf Monate, welche aber bald auf 18 Monate angehoben wurden.
2. Reduktion des Budgetansatzes für das erste reguläre Budget 1957 Für das Budgetjahr 1957 wurde von der Beamtenschaft des Verteidigungsministeriums und des Finanzministeriums zunächst ein Budget für die militärische Landesverteidigung von 2,1 Milliarden österreichischen Schillingen (öS) ermittelt. Die damals vorgesehenen 2,1 Mrd. waren im Vergleich zu dem Verteidigungsbudget von Ungarn (4,5 Mrd. öS), der Schweiz (5 Mrd. öS) und von Jugoslawien (6 Mrd. öS) geradezu lächerlich gering. Nach hochrangig besetzten Verhandlungen im Finanzministerium wurden die 2,1 Mrd. auf 1,5 Mrd. gekürzt und diese Kürzung nach einem Vortrag des Finanzministers beim Bundeskanzler von ihm gutgeheißen. Damit wurde das ohnehin als sehr gering veranschlagte Verteidigungsbudget um 35 % gekürzt, was sich bis heute als fatal für die Ausrüstung des Bundesheeres erwiesen hat. Wären nämlich zumindest die 2,1 Mrd. über die Jahrzehnte fortgeschrieben worden, würde das Bundesheer heute knapp über 3,3 Mrd. Euro verfügen
Offizier DER
können, immerhin um 800 Millionen Euro mehr, als der aktuelle Voranschlag für 2022 ausweist.
3. Wahlkampfslogan des Oppositionsführers Dr. Bruno Kreisky (SPÖ): „Sechs Monate sind genug“ Mit dem Wahlversprechen „Sechs Monate sind genug“ zog die SPÖ in den Wahlkampf für die Nationalratswahl 1970 und wollte damit vor allem die Stimmen der jüngsten Wähler für sich lukrieren. Nach dem Sieg in dieser Auseinandersetzung war die SPÖ danach gezwungen, das Wahlversprechen auch umzusetzen. Nach Beratungen im Rahmen einer Bundesheerreformkommission führte man schließlich einen sechsmonatigen durchgehenden Präsenzdienst und Truppenübungen in der Dauer von zwei Monaten ein. Es gab aber auch die Möglichkeit, acht Monate durchzudienen. Im internationalen Vergleich betrachtet, waren die sechs plus zwei Monate lächerlich gering. Die Militärexperten waren sich einig, dass man innerhalb von sechs Monaten keinen voll feldverwendungsfähigen Soldaten ausbilden kann. Die hohe Politik entschied sich aber, wie so oft schon vorher, gegen die Interessen der Militärs (abgesehen von ein paar Opportunisten unter den Militärs, die im Sog der neuen politischen Machthaber noch etwas werden wollten.).
4. Verzicht auf Überschallkampfflugzeuge bis 1987 Wirkliche Streitkräfte in Europa, auch jene von Staaten, die im Vergleich zu
Ausgabe 2/2022