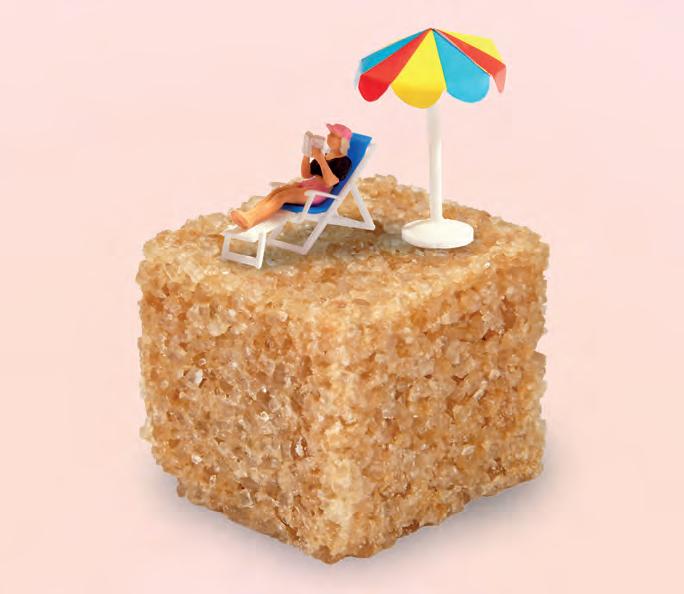6 minute read
Wege durch das österreichische Gesundheitssystem
Wege durch Österreichs Gesundheitssystem
Drei Experten geben richtungsweisende Tipps
Unbestritten ist, dass das Gesundheitssystem Österreichs zu den besten der Welt zählt. Es ermöglicht Personen aus allen Altersklassen und allen sozialen Schichten einen niederschwelligen und freien Zugang zu Gesundheits- und Vorsorgeleistungen. Hat es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an zu hohen Gesundheitsausgaben oder Zahlen von Patientenbetten gegeben, so hat die COVID-19-Pandemie vieles relativiert. Ein weiterer Streitpunkt ist immer wieder das Verhältnis zwischen den Ausgaben für den niedergelassenen Bereich sowie jenen für den stationären Bereich. Wochen- bis monatelange Wartezeiten bei den niedergelassenen Ärzten treiben die Patienten in die teuren Spitalsambulanzen, wodurch die Wege zu einer Behandlung oftmals kompliziert und mühselig werden. Hinzu kommt, dass derzeit viele Patienten aus Angst vor Corona auf notwendige Vorsorge- und Nachsorgeuntersuchungen verzichten. Die HAUSARZT-Redaktion begab sich auf Spurensuche und sprach mit bedeutenden Persönlichkeiten, um zu erläutern, was ein effizientes, finanzierbares Gesundheitssystem braucht, damit eine optimale Patientenversorgung garantiert werden kann. Als Interviewpartner fungierten Univ.Prof. Dr. Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, Dr. Gerald Bachinger, Patientenanwalt in Niederösterreich, sowie Hon. Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich.
HAUSARZT: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in puncto Praktikabilität und Serviceorientierung unseres Gesundheitssystems?
PROF. MARKUS MÜLLER (MM): Wir haben in der Medizin zwei Megatrends – die Digitalisierung und die Ökonomisierung. Neue Technologien und digitale Instrumente ermöglichen es den Ärzten, sich wieder mehr den Patienten zuzuwenden, außerdem steht mehr Zeit für die Arzt-PatientenInteraktion zur Verfügung. Bezüglich der Ökonomisierung wird die Medizin, speziell die Biomedizin, künftig einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellen. Gerade Österreich bietet sich nicht nur dazu an, Innovationen zu konsumieren, sondern auch dazu, sich als Standort zu präsentieren und zu etablieren, an dem Innovationen generiert werden können. Letztendlich steigt auch die Wertschöpfung. Dafür sind zudem strukturelle Änderungen notwendig – es gilt, Ressourcen, Daten und Organisationsformen zu harmonisieren. DR. GERALD BACHINGER (GB): Unser Gesundheitssystem ist sehr kleinteilig und sektoral abgegrenzt aufgebaut. Es ist daher schwierig, die Anforderungen von integrierter Versorgung, durchgehenden Behandlungspfaden und durchgehenden Servicelevels zu erfüllen. Dazu kommt, dass es ausgeprägte berufsständisch abgegrenzte Bereiche der Gesundheitsdienstleister gibt, die eine Kooperation und Vernetzung erschweren. Es wird eine weitere große Herausforderung sein, die isolierten Datensilos der Gesundheitsdaten von Patienten zu vernetzen und so dieses Potential für Qualitätsverbesserungen zu nutzen. Die größte Herausforderung liegt darin, das bestehende Finanzierungssystem umzustellen, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im stationären Bereich. Bei der Finanzierung gibt es bekanntlich sehr viele Geldströme und eine ausgeprägte Intransparenz. Grundsätzlich ist das Finanzierungssystem dual. Das bedeutet, dass der niedergelassene Bereich von den Krankenkassen (Sozialversicherungsbeiträge der Bürger) und der stationäre Bereich durch eine Mischform aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Beiträgen der Länder finanziert wird. Derzeit wird vor allem das Volumen, aber nicht die Qualität gefördert. Das Ziel ist ein Finanzierungssystem, das den Wert, also den Patientennutzen, fokussiert. Als aktuelles Beispiel für die holprige Versorgung in Österreich sind die Organisation und die Durchführung der Covid-Impfungen zu nennen. PROF. BERNHARD RUPP (BR): Zu den größten Herausforderungen zählt die funktionale Trennung von niedergelassenem Bereich und Krankenhaussektor mit unterschiedlichen Qualitätsansprüchen und Finanzierungsanreizen, die oftmals die Patienten nicht in den Mittelpunkt stellen. Österreich hat eine international einzigartige Mischfinanzierung >

Experte zum Thema: Univ.-Prof. Dr. Markus Müller
Rektor der Medizinischen Universität Wien
Foto: © Foto Wilke, 1010 Wien
Experte zum Thema: Hon. Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA
Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich
Experte zum Thema: Dr. Gerald Bachinger
Patientenanwalt in Niederösterreich
„Österreich hat einen ,unerklärlichen Bammel‘ davor, mit anderen Systemen verglichen zu werden.“ „Die größte Herausforderung liegt darin, das bestehende Finanzierungssystem umzustellen.“
durch Beitrags- und Steuermittel und einen erheblichen Teil, den die Patienten zusätzlich noch aus der eigenen Tasche zahlen.
HAUSARZT: Welche Maßnahme(n) würden Sie setzen, wenn Sie alleinbefugt und politisch unabhängig entscheiden könnten?
MM: Es ist wesentlich, beim Thema E-Health weiterhin Fortschritte zu machen und das Verhältnis zwischen Präventiv- und Reparaturmedizin im Sinne einer Stärkung der Prävention anders zu gestalten. GB: Vollkommene und gnadenlose Qualitätstransparenz, die Einführung von Finanzierungen, die value-based sind, und Modelle der Versorgung aus einer Hand (also nicht der Finanzierung aus einer Hand). Das bedeutet, dass ein Träger eine durchgehende Versorgung vom niedergelassenen Bereich bis zum Uniklinikum mit einem bestimmten Budget zu verantworten hat. BR: Das ist eine absurde Vorstellung, denn es gibt ein komplexes Bündel von legitimen Interessen unterschiedlicher Stakeholder und Interessengruppen, die „unter einen Hut“ gebracht werden müssen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Dichter Josef Weinheber einmal gesagt: „Wenn ich einmal reich bin und was zum Reden hab‘, dann ... lass‘ ich alles, wie es ist.“
HAUSARZT: Was unterscheidet das österreichische Gesundheitssystem von anderen? Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal?
MM: Die Versorgungsqualität in Österreich funktioniert für die Versicherten sehr gut. Österreich investiert 11 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in das Gesundheitswesen, die USA beispielsweise 18 Prozent. Trotzdem sind die sogenannten „Health-Outcome-Parameter“ in Österreich besser, beispielsweise zeigt sich das an der geringeren Säuglingssterblichkeit. Vergleicht man die öffentliche solidarische Finanzierung mit einer privaten Gesundheitsfinanzierung so hat unser öffentliches Gesundheitssystem für die Patienten mehr Vorteile. Bei privat finanzierten Systemen beobachtet man häufig ein „Cherry Picking“, also eine Rosinenpickerei, in deren Rahmen Maßnahmen angeboten werden, die ökonomisch sinnvoll sind, aber nicht unbedingt versorgungswirksam. GB: Dass es trotz der vielfältigen Defizite noch recht gut funktioniert. BR: Ja, Österreich hat einen „unerklärlichen Bammel“ davor, mit anderen Systemen verglichen zu werden. So wurde selbst das international gebräuchliche DRG (Diagnosis- Related-Groups-) Krankenhausfinanzierungssystem als LKF (leistungsorientiertes Krankenanstaltenfinanzierungs-) System „austrifiziert“ und verändert – wir sind einfach „unvergleichlich“ gut.
HAUSARZT: Was verstehen Sie unter „patientenzentriert“?
GB: Dies ist ein Schlagwort, das in der österreichischen Diskussion gerne verwendet wird. Es bedeutet, dass die Interessen der Patienten in einem öffentlichen solidarischen System an erster Stelle stehen sollen. Letztlich besteht die Hauptaufgabe darin, die bestmögliche Versorgung zur Verfügung zu stellen. Die Praxis zeigt allerdings: Immer wieder werden viele andere Interessen vorgereiht, etwa berufsständische oder ökonomische Interessen oder Interessen von bestimmten mächtigen Gruppen. BR: Es bedeutet, zu hören und möglichst zu beherzigen, was Patienten wirklich sagen (wollen). Die WHO hat vor mehr als 20 Jahren auch die sogenannte Responsivität ins Spiel gebracht. Es geht hierbei um die Wahrung der Würde, der Entscheidungsautonomie und um die Berücksichtigung der komplexen sozialen Bedürfnisse bei diversen Erkrankungen.
HAUSARZT: Haben Sie Ideen und Vorschläge, die man in einer Reform umsetzen sollte?
MM: Ich setze hier auf eine E-HealthInitiative zur Förderung der Prävention. Diese soll – eng verbunden mit Innovationen aus der Computerwissenschaft und Molekularbiologie – unter anderem spielerische Ansätze bieten, sodass es den Menschen Spaß macht und sie motiviert sind, sich mit Prävention zu befassen. BR: Es funktioniert nur gemeinsam, auf Englisch heißt es so schön: „muddling through“ – wir müssen uns durch die Herausforderungen gemeinsam „durchwursteln“. Es geht eben nicht anders.
HAUSARZT: Was möchten Sie unseren Lesern abschließend mitteilen?
MM: Die Medizin wird sich in den nächsten Jahren sehr stark ändern. Die Digitalisierung und die Molekularbiologie sind jene Quellen, aus denen die Medizin die Innovationen schöpft (z. B. die Impfstoffentwicklung). Auch wird die zentrale Aufgabe darin bestehen, dass Ärzte wieder mehr Zeit für die Kernarbeit und für ihre Patienten haben. Die Medizinische Universität bietet der Bevölkerung weiterhin mit diversen Aktivitäten einen niederschwelligen Zugang zur Medizin, beispielsweise mit dem „Teddybären-Krankenhaus“, der „Langen Nacht der Forschung“ oder dem „Tag der Universität“. GB: Gesundheit geht uns alle an! Ein öffentliches solidarisches Gesundheitssystem kann nur dann gut, kostengünstig und qualitätsvoll sein, wenn es ein reges Interesse, eine Partizipation der Bürger und Patienten gibt. Bürger und Patienten sind Co-Produzenten ihrer eigenen Gesundheit. BR: Wir jammern derzeit (noch) auf hohem Niveau. Die Systemverantwortlichen müssen aber als „Wachhunde“ sorgsam unseren Besitzstand hüten und einerseits verhindern, dass sich Verschlechterungen einschleichen, andererseits quasi als „Spürhunde“ der Spur sinnvoller Verbesserungen folgen und diese „als Beute“ nachhause nehmen.
Fazit
Die Expertengespräche zeigen, dass tatsächlich ein permanenter Optimierungsprozess abläuft, um letztendlich den Österreichern – und zwar unabhängig davon, ob sie krank oder gesund sind – optimale Vorsorge-, Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten zu garantieren. Auch wenn der Gordische Knoten der Zuständigkeiten manchmal zerschlagen werden muss, besteht Einigkeit darüber, dass hierzulande niemals Verhältnisse vorherrschen dürfen, in denen man Menschen altersbedingt oder aufgrund ihrer sozialen Herkunft eine Behandlung verwehrt.