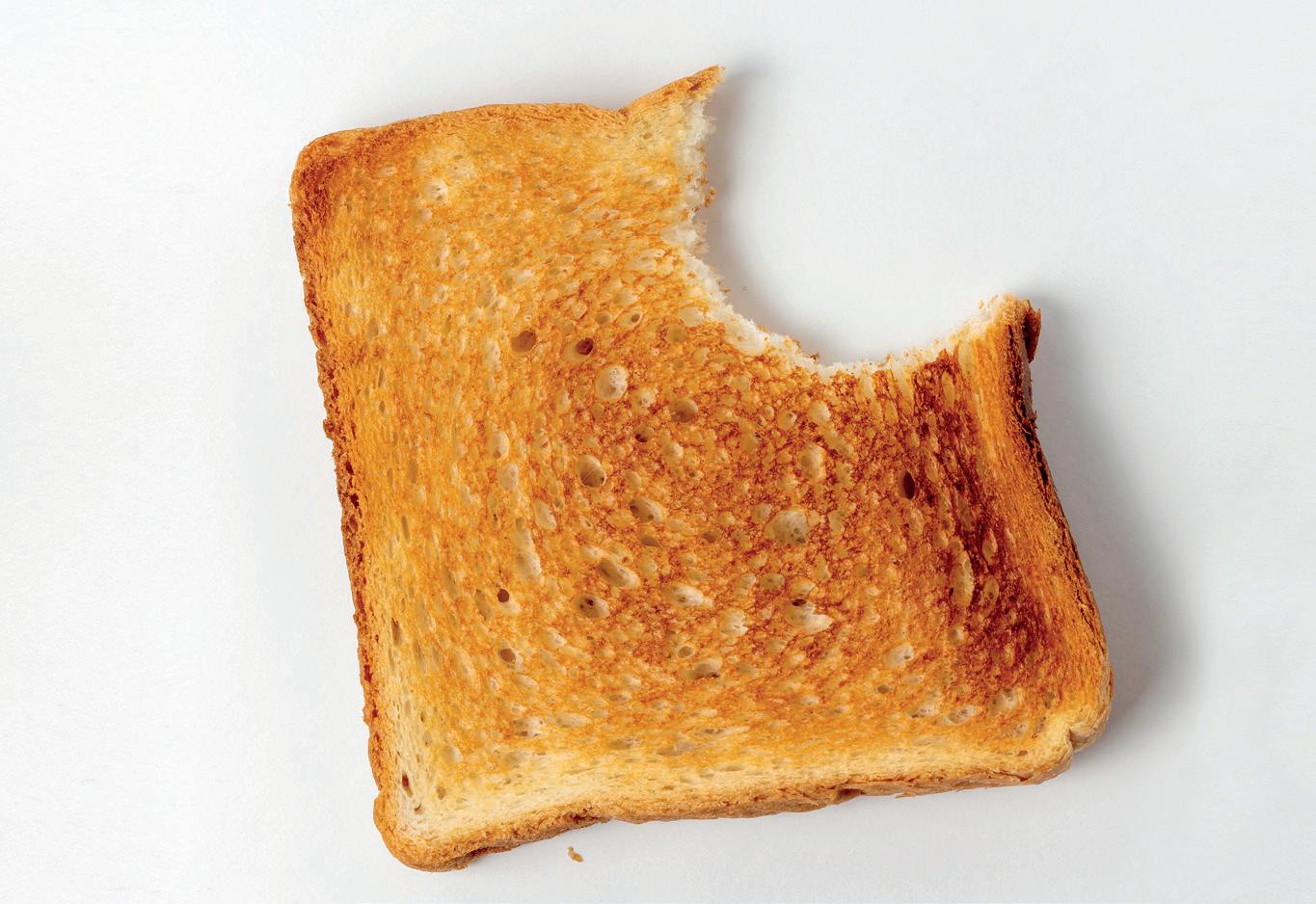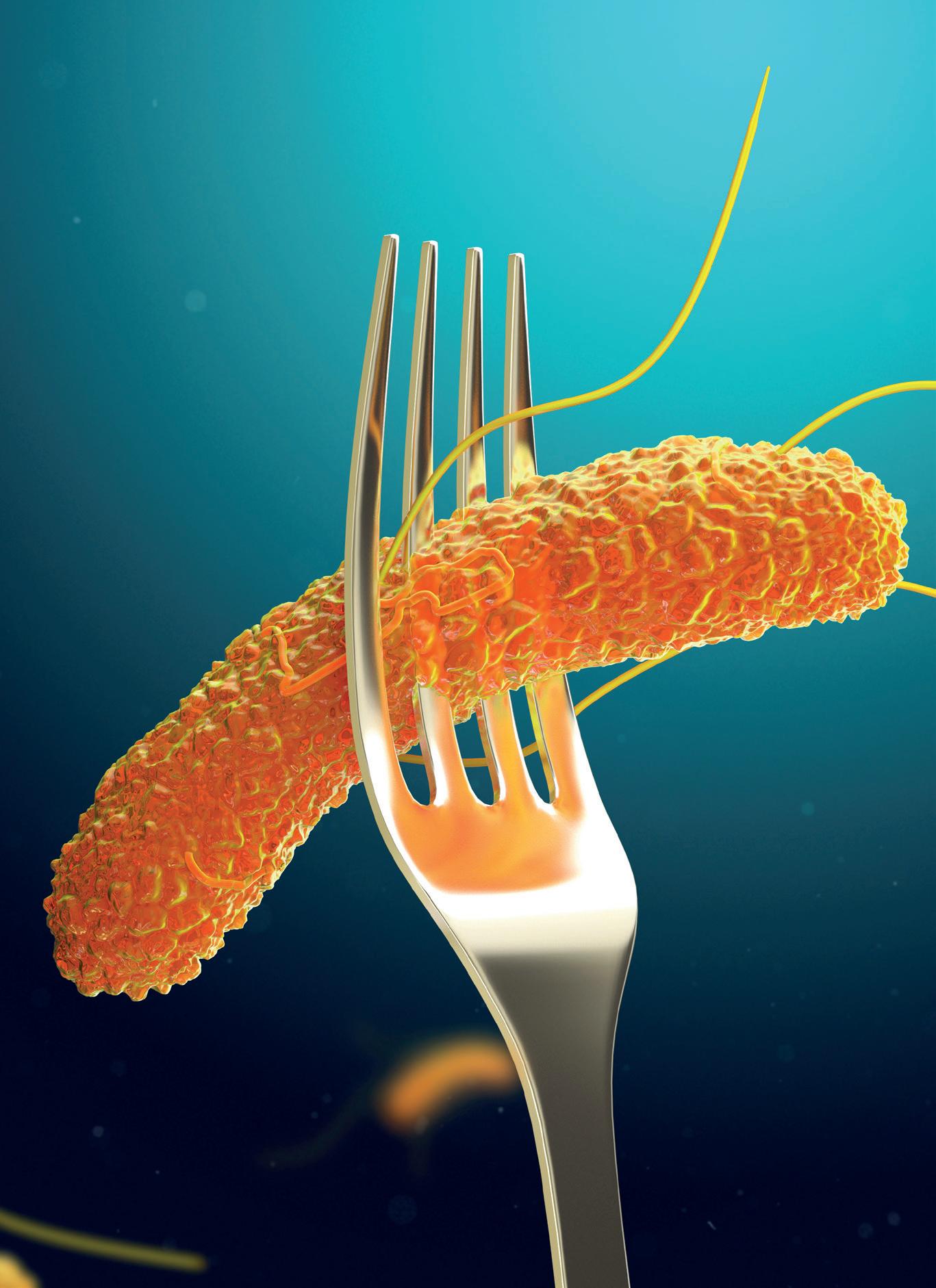
6 minute read
Antibiotika bei akuter Gastroenteritis
Erreger und Ausmaß der Erkrankung als Entscheidungsfaktoren
Die akute Gastroenteritis ist eine weit verbreitete Infektionserkrankung bei Erwachsenen. In vielen Fällen geht sie mit akuter Diarrhö einher. Die Mehrheit der Fälle wird durch Viren verursacht, eine antibiotische Therapie ist daher nicht angezeigt. Selbst bei bakterieller Ursache belegen Studien nur eine geringe Verkürzung der Krankheitsdauer, weshalb die Anwendung von Antibiotika gegen unerwünschte Arzneimittelwirkungen abgewogen werden muss.
Häufigste Erreger
Durch Rotaviren hervorgerufene Durchfallerkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Durchfallerkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Ein weiterer stark verbreiteter Auslöser von Durchfallerkrankungen sind Noroviren. Die Symptomatik umfasst eine schwere Gastroenteritis mit Erbrechen, Diarrhö, Kopf und Muskelschmerzen. Während die Virusinfektion bei gesunden Menschen nicht lebensbedrohlich ist, kann sie für ältere Menschen mit Vorerkrankungen sowie für Kinder eine Gefahr darstellen. Da Viren unempfindlich gegenüber Antibiotika sind, zählt eine Verhinderung der Exsikkose zu den besten Therapien. Flüssigkeits und Elektrolytsubstitution sind vor allem bei vorbelastenden Patienten und Kindern nötig.¹ Wird die Diarrhö durch eine Infektionsquelle verursacht und von Enuresis, Erbrechen und abdominellen Schmerzen begleitet, handelt es sich um eine infektiöse Diarrhö. Der mitverantwortliche Mikroorganismus wird jedoch selten klinisch bestätigt. Im Allgemeinen bessert sich eine akute Gastroenteritis spontan und erfordert keine (antibiotische) Therapie. Der unangebrachte Gebrauch von Antibiotika kann zudem eine antibiotikaassoziierte Diarrhö (AAD) oder andere Komplikationen sowie Resistenzen nach sich ziehen.²
Inkubationszeit von Reisediarrhö
Eine Reisediarrhö stellt eine erhebliche Belastung sowohl für Erkrankte als auch mitreisende Personen dar. Sie tritt bei 30 bis 70 % der Reisenden auf und wird hauptsächlich durch E. coli, Campylobacter jejuni, Shigellen und Salmonellen verursacht.¹ Südostasien, Zentralasien, Indien, Afrika, Mexiko und Lateinamerika gehören zu den Hochrisikogebieten in Hinblick auf Reisediarrhö. Bei Fieber und systemischen Symptomen sollte zuerst an Salmonellen, Campylobacter, Yersinia oder Shigellen gedacht werden. Yersinia zeigt dabei ähnliche Symptome wie eine akute Appendizitis. Während Rota und Noroviren häufig wässrige Diarrhö verursachen, sind Shigellen, C. jejuni, Salmonellen, ShigaToxin produzierende Escherichia coli (STEC) und enteroinvasive E. coli (EIEC) oftmals für blutige Diarrhö verantwortlich. Bei Lebensmittelvergiftungen kann der ursächliche Keim anhand der Inkubationszeit geschätzt werden. Kurze Inkubationszeiten von ein bis sechs Stunden
stehen mit Toxinen wie S. aureus oder Bacillus cereus in Verbindung. C. perfringens oder B. cereus sprechen für eine Inkubationszeit von acht bis 16 Stunden, enterotoxinbildende E. coli (ETEC), Salmonellen, Shigellen und Vibrio cholerae sind bei einer Inkubationszeit von 1672 Stunden sehr wahrscheinlich. Obwohl sich die meisten Fälle einer Reisediarrhö spontan bessern, leiden 10 % der Patienten für einige Wochen oder Monate unter einer persistierenden Diarrhö. Hier sollte an eine parasitäre Infektion, im Besonderen an Giardia, gedacht werden. Wenn fieberfreie blutige Diarrhö und abdominale Schmerzen hinzukommen, kann auch eine STECInfektion dahinterstecken.²
Wann welche Antibiotika?
Akute wässrige Diarrhö ist meist viraler Ätiologie (Noro, Rota und Adenoviren). Doch sogar bei bakterieller Ursache bessern sich die Symptome häufig ohne Behandlung. Zudem verkürzt eine Therapie nicht zwingend die Dauer der Symptome. Studien zeigen diesbezüglich eine EinTagesReduktion im Vergleich zu Placebo. Eine Metaanalyse mit Fluorchinolonantibiotika oder Makroliden verkürzte die Dauer der Symptomatik um 1,32 Tage. Bei blutigem Stuhl und Fieber, bei Shigellen sowie bei Reisediarrhö, begleitet von hohem Fieber über 38,5 Grad, oder im Falle einer Sepsis wird die Anwendung von Antibiotika empfohlen. Obwohl Fluorchinolon wie Ciprofloxacin und Levofloxacin als Erstlinientherapie empfohlen werden, ist die Resistenz gegen diese Antibiotika mittlerweile gestiegen. Darüber hinaus bringen Fluorchinolone höhere Risiken ernster Nebenwirkungen mit sich. Makrolide wie Azithromycin können als antibiotische Therapie bei Campylobacter, Salmonella und hohen Resistenzraten in Bezug auf Fluorchinolonantibiotika in Betracht gezogen werden.² Wie die aktuelle Studienlage zeigt, eignet sich auch das topisch wirksame Antibiotikum Rifaximin zur Prophylaxe einer Reisediarrhö, zur Therapie der afebrilen Gastroenteritis sowie bei E. coli. Außerdem wird das Risiko einer AAD gesenkt. Selbiges gilt für die Entstehung eines postinfektiösen Reizdarmsyndroms.³ Rifaximin ist als nicht resorbierbares Antibiotikum relativ sicher und verkürzte die Symptome im Vergleich zu Plazebo.²
Fazit
Eine akute Gastroenteritis zeigt – abhängig vom Erreger – unterschiedliche Inkubationszeiten und Manifestationen. Die Mehrheit der Fälle wird von Viren ausgelöst, weshalb einer rein symptomatischen Behandlung der Vorzug zu geben ist. Antibiotika verkürzen selbst bei bakteriellen Infektionen die Krankheitsdauer nur minimal, werden jedoch bei schwerer Symptomatik und Risikogruppen empfohlen. Neben den üblichen Wirkstoffen hat sich das nicht resorbierbare Antibiotikum Rifaximin als relativ sicher und effektiv erwiesen.
Mag.a Nicole Resl
Literatur: 1 Wittig J et al., Pharmazeutische Zeitung 2010; 18. 2 Kim YJ et al., Infection & Chemotherapy 2019; 51(2):217243. 3 Pimentel M et al., N Engl J Med 2011; 364:2232.
Neues Produkt unterstützt die körpereigene Abwehr
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5: Bakterien und Vitamin D für das Immunsystem
Eine 3stufige Darmbarriere bildet den wichtigsten natürlichen Schutzschild gegen unerwünschte Viren und andere Keime: die Mikrobiota, die Darmschleimhaut und das darmassoziierte Immunsystem. 7080 % aller Immunzellen des Körpers befinden sich im Darm. Speziell für das Immunsystem in dieser herausfordernden Zeit wurde am Institut AllergoSan in Graz gemeinsam mit anerkannten Experten das Produkt OMNiBiOTiC® ProVi 5 entwickelt: „Fünf Bakterienstämme, jeder ein absoluter Profi, wurden – basierend auf ihren erstaunlichen und faszinierenden Eigenschaften – ausgewählt und mit Bedacht kombiniert“ , erklärt Institutsgründerin Mag.a Anita Frauwallner. Fünf Mrd. Keime gelangen bei jeder Einnahme in den Mund, den Rachen und den Darm. Ergänzt werden sie durch Vitamin D für die Aufrechterhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems.

Quelle: APG Allergosan Pharma GmbH
Mariendistel ist Arzneipflanze des Jahres
Die Früchte des Korbblütlers enthalten wertvolle Stoffe für die Lebergesundheit

Die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – bestehend aus Experten der pharmazeutischen Institute der Universitäten Graz, Innsbruck und Wien – kürt nach strengen Auswahlkriterien die Arzneipflanze des Jahres. Für 2021 fiel die Wahl auf die Mariendistel (Silybum marianum). Wissenschaftliche Studien belegen u. a. die leberschützenden Effekte des Wirkstoffkomplexes Silymarin. „Die Mariendistel findet bei Leberkrankungen, insbesondere bei der lebensstilbedingten Fettlebererkrankung (NAFLD), Anwendung. Daneben werden Patienten mit Hepatitis B und C, sowie mit chemotherapieinduzierter Hepatitis behandelt“ , so Dr.in Annette Jänsch, Fachärztin für Innere Medizin und Naturheilkunde, Immanuel Krankenhaus Berlin. Einige Studien zeigen auch eine schnellere Abheilung einer akuten Hepatitis A unter einer Mariendisteltherapie. Bei der nichtalkoholischen Fettleber (NAFL) verbessert die Mariendistel die Transaminasenaktivität und die Aktivität der GammaGT signifikant. Neben der Verbesserung der Laborparameter weisen die Patienten weniger Müdigkeit, eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und eine höhere Schlafqualität auf.
Quelle: Pressekonferenz der HMPPA, 27.01.2021
Übernahme bringt neues Epilepsie-Medikament
Angelini Pharma erwirbt Arvelle Therapeutics und vermarktet künftig Cenobamate
Angelini Pharma, ein internationales Pharmaunternehmen, und Arvelle Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für Patienten mit ZNSErkrankungen spezialisiert hat, schlossen eine Fusionsvereinbarung ab. Nach der Übernahme von Arvelle Therapeutics wird Angelini Pharma die Lizenz für die Vermarktung von Cenobamate bekommen. Nach dem Erhalt der Zulassung, die für 2021 erwartet wird, plant Angelini die Markteinführung des Antiepileptikums. Cenobamate wurde von der britischen Zulassungsbehörde MHRA als „Promising Innovative Medicine“ für die Behandlung von medikamentenresistenten fokalen Anfällen bei Erwachsenen eingestuft. Cenobamate ist ein kleines Molekül mit einem einzigartigen dualen komplementären Wirkmechanismus. Es wirkt positiv durch die Modulation des γAminobuttersäure(GABAA)Ionenkanals und durch die Hemmung spannungsabhängiger Natriumströme. Schlüsselstudien dokumentierten die klinische Wirksamkeit von Cenobamate, indem sie eine signifikant stärkere Reduktion der mittleren Anfallshäufigkeit zeigten und mehr Patienten eine Reduktion der Anfallshäufigkeit um 50 % oder mehr im Vergleich zur Placebogruppe erreichten.*
* CenobamatVerschreibungsinformation. FDA. Letzter
Zugriff: 20. Juli 2020.
Quelle: Angelini Pharma Österreich GmbH