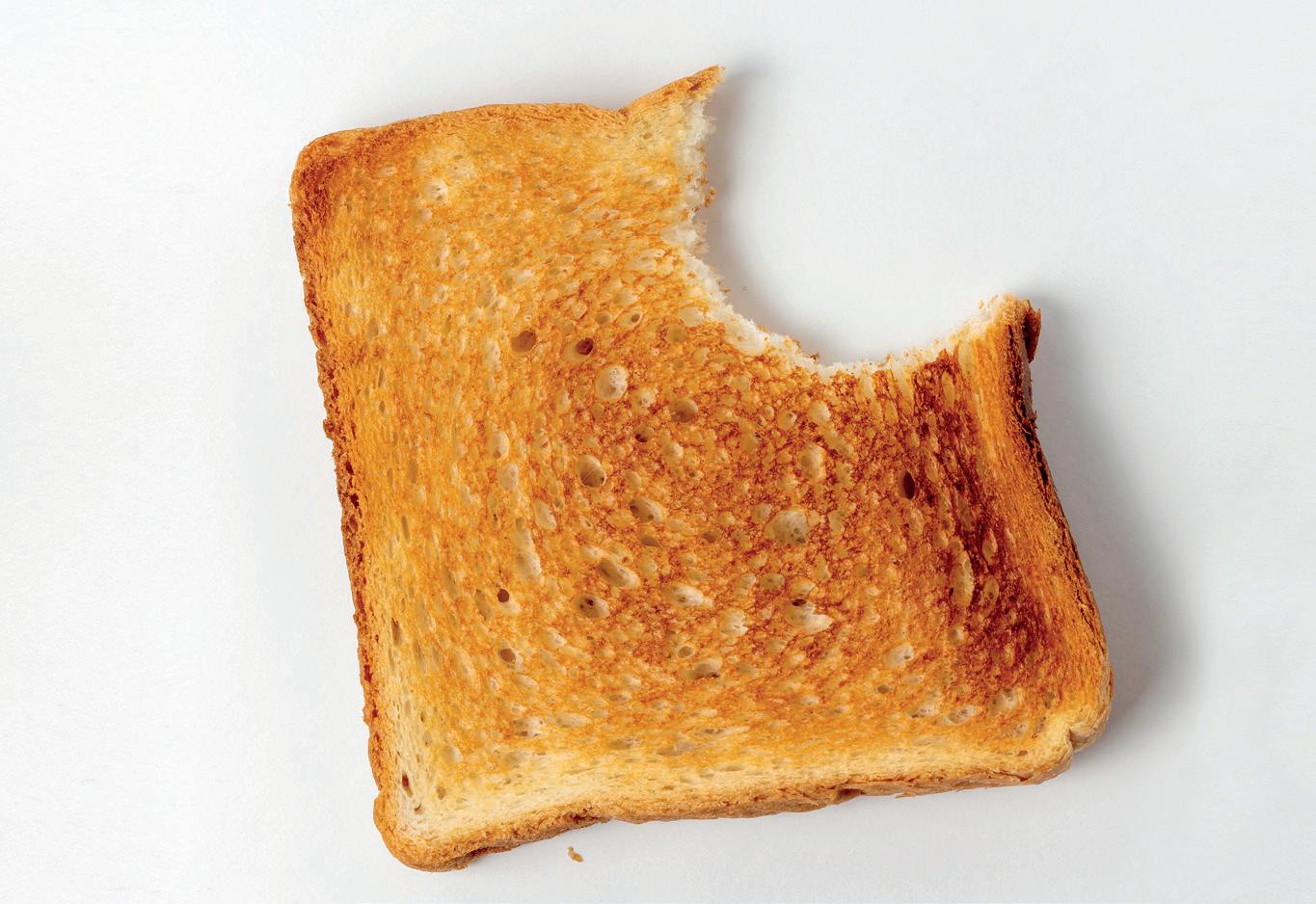9 minute read
Vorhofflimmern in der Praxis
Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Rhythmusstörungen weltweit und damit eine wesentliche kardiale Erkrankung des 21. Jahrhunderts. Patienten haben aufgrund des erhöhten Schlaganfallrisikos auch eine signifikant erhöhte Mortalität. Das wichtigste Ziel der Behandlung von Vorhofflimmern beim gefährdeten Patienten stellt die Schlaganfallprophylaxe mit Antikoagulantien dar. Die Kontrolle der Herzfrequenz dient darüber hinaus der Verhinderung einer tachykardiebedingten Herzinsuffizienz. Alle weiteren therapeutischen Maßnahmen können lediglich die Lebensqualität, jedoch nicht die Prognose verbessern. Als wesentlicher Faktor für das therapeutische Prozedere fungiert die richtige Einschätzung des thromboembolischen Risikos.
Thromboembolisches Risiko
Bei Patienten mit Vorhofflimmern ist das Schlaganfallrisiko im Vergleich zu jenem der Normalbevölkerung um das Fünffache erhöht. Das Risiko ist allerdings nicht homogen verteilt, sondern hängt von gewissen Risikofaktoren ab.¹ Durch die Stase des Blutes im linken Vorhofohr, durch eine Endothelschädigung und eine Hyperkoagulierbarkeit bilden sich Thromben, die im Falle einer Embolisation zu Schlaganfällen führen können.² In den letzten Jahren konnten verschiedene Risikofaktoren und Biomarker identifiziert werden, die mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko in Verbindung stehen. Die wichtigsten Risikofaktoren werden im sogenannten CHA2DS2VAScScore zusammengefasst (Tabelle 1). Dazu zählen die Herzinsuffizienz (congestive heart failure), die Hypertonie, ein Alter über 75 Jahre, Diabetes mellitus, Schlaganfall und vaskuläre Erkrankungen wie signifikante koronare Herzkrankheit oder auch periphere arterielle Verschlusskrankheit, außerdem das weibliche Geschlecht (Sex). Zur Ermittlung des Scores wird für alle Faktoren je ein Punkt vergeben. Für ein Alter von über 75 Jahren und einen stattgehabten Schlaganfall werden zwei Punkte berechnet, da jene Faktoren mit einem besonders hohen Risiko einhergehen.¹ Der Score ist einfach in der Anwendung, gut validiert und der derzeitige Standard bei der Eruierung des Schlaganfallrisikos. Darüber hinaus können Biomarker wie TroponinT oder NTpro BNP in die Einschätzung einbezogen werden.³ Auch die echokardiographisch gemessene Größe des linken Vorhofs könnte künftig dabei helfen, das Risiko zu berechnen. Zudem haben Patienten mit nichtparoxysmalem Vorhofflimmern ein höheres Thromboembolierisiko.4
Experte zum Thema: OA Dr. Lukas Fiedler
Facharzt für Innere Medizin, Abteilung für Innere Medizin, Kardiologie und Nephrologie, Landesklinikum Wiener Neustadt „Patienten mit Vorhofflimmern haben zumeist ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Daher ist eine orale Antikoagulation essentiell.“
Einschätzung des Blutungsrisikos
Wenn dem CHA2DS2VAScScore zufolge eine orale Antikoagulation indiziert ist, sollte auch das Blutungsrisiko des Patienten evaluiert werden. Dies ermöglicht der sogenannte HASBLEDScore (Tabelle 2). Er ist sehr gut validiert und war in Studien komplexeren Scores nicht unterlegen.5 Der besagte Score beinhaltet die Risikofaktoren unkontrollierte Hypertonie, abnormale Nierenund/oder Leberfunktion, stattgehabter Schlaganfall, Blutungsgeschehen in der Anamnese, labile INRWerte, Alter (Elderly = Alter von > 65 Jahren oder extreme Gebrechlichkeit) und Medikamenten oder exzessiver Alkoholkonsum (Drugs). Zur Ermittlung des Scores wird für jeden vorhandenen Faktor ein Punkt vergeben. Ein HASBLEDScore von ≥ 3 bedeutet ein signifikant erhöhtes Blutungsrisiko. Patienten mit einem HASBLEDScore von ≥ 3 sollte eine Antikoagulation nicht vorenthalten werden, auf modifizierbare Faktoren ist genauer zu achten. Darüber hinaus sollte eine regelmäßige bzw. engmaschige Nachkontrolle der Patienten angestrebt werden.
Indikation einer oralen Antikoagulation
Männer mit einem CHA2DS2VAScScore von 0 und Frauen mit einem Score von 1 haben ein niedriges Schlaganfall
X Tabelle 1: Definition des CHA2DS2-VASc-Scores, adaptiert nach Hindricks G et al.1
CHA2DS2-VASc-Score: Risikofaktoren und Definitionen Punkte
C Klinische Herzinsuffizienz oder objektive Anzeichen einer mittelschweren bis schweren LVDysfunktion oder HCM
H Bluthochdruck oder unter antihypertensiver Therapie 1
1
A Alter von ≥ 75 Jahren
D Diabetes mellitus: Behandlung mit oralen Hypoglykämika und/oder Insulin oder bei Nüchternblutglukose von > 125 mg/dl
S Schlaganfall, vorheriger Schlaganfall, TIA oder Thromboembolie
V Vaskuläre Erkrankung: angiographisch signifikante KHK, früherer Myokardinfarkt, pAVK oder Aortenplaque
A Alter zwischen 65 und 74 Jahren 2
1
2
1
Sc Geschlechtskategorie (weiblich) 1
Maximale Punktezahl 9
KHK = koronare Herzkrankheit; HCM = hypertrophe Kardiomyopathie; HF = Herzinsuffizienz; LVEF = linksventrikuläre Auswurffraktion; OAK = orales Antikoagulans; PAVK = periphere arterielle Verschlusserkrankung; TIA = transitorische ischämische Attacke.
X Tabelle 2: Definition des HAS-BLED-Scores, adaptiert nach Hindricks G et al.1
Risikofaktoren und Definitionen Punkte
H Unkontrollierter Hypertonus (SBP von > 160 mmHG)
A Abnormale Nieren- und/oder Leberfunktion: Dialyse, Transplantation, Serumkreatinin von > 200 mmol/l, Zirrhose, Bilirubin von > 2 als obere Grenze der Norm, AST/ALT/ALP von > 3 als obere Grenze der Norm
S Schlaganfall: Schlaganfall vorheriger ischämischer oder hämorrhagischera
B Blutungsanamnese oder Prädisposition: vorherige größere Blutung oder Anämie oder schwere Thrombozytopenie
L Labile INRb: TTR von < 60 % bei Patienten, die VKA erhalten 1
1 Punkt für jeden
1
1
1
E Ältere Menschen: Alter von > 65 Jahren oder extreme Gebrechlichkeit 1
D Drogen- oder übermäßiger Alkoholkonsum: gleichzeitige Verwendung von Thrombozytenaggregationshemmern oder NSAID und/oder übermäßigerc Alkoholkonsum pro Woche
Maximale Punktezahl
1 Punkt für jeden
9
ALP = alkalische Phosphatase; ALT = AlaninAminotransferase; AST = AspartatAminotransferase; SBP = systolischer Blutdruck; INR = International Normalized Ratio; NSAID = nichtsteroidales Antirheumatikum; TTR = Zeit im therapeutischen Bereich; VKA = VitaminKAntagonist. a Hämorrhagischer Schlaganfall würde auch 1 Punkt unter dem "B"Kriterium erzielen. b Nur relevant, wenn der Patient einen VKA erhält. c Alkoholexzess oder missbrauch bezieht sich auf einen hohen Konsum (z. B. von > 14 Einheiten pro Woche), bei dem nach Einschätzung des Arztes eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder eine Beeinflussung des Blutungsrisikos vorliegen würde.
sowie Mortalitätsrisiko (von unter 1 % jährlich) und bedürfen keiner Embolieprophylaxe (KlasseIAEmpfehlung). In diesem Fall wäre das Risiko höher, eine Blutung durch die Antikoagulation zu erleiden, als einen thromboembolischen Schlaganfall. Männer mit einem Score von ≥ 2 und Frauen mit einem Score von ≥ 3 haben hingegen ein deutlich erhöhtes thromboembolisches Risiko und sollten eine Embolieprophylaxe erhalten (KlasseIAEmpfehlung). Bei Männern mit einem CHA2DS2VAScScore von 1 (2 bei Frauen) sollte eine orale Antikoagulation erwogen werden, sie ist aber nicht zwingend erforderlich (KlasseIIaEmpfehlung).¹ In diesen Fällen können zusätzliche Parameter wie die Biomarker oder die Vorhofgröße zur Entscheidung herangezogen werden, aber auch das individuelle Risiko des einzelnen Risikofaktors gilt es zu bedenken. Junge Männer mit einem einzelnen Risikofaktor, zum Beispiel einer gut behandelten Hypertonie, haben ein gering erhöhtes Risiko. Bei normalen Biomarkern und normal großem linkem Vorhof könnte eine Embolieprophylaxe noch hinausgezögert werden. Eine 70jährige Frau mit leicht erhöhtem NTpro BNP und dilatiertem linkem Vorhof sollte andererseits schon eher eine Antikoagulation erhalten. Eine diesbezügliche Entscheidungshilfe ist in Abbildung 1 dargestellt. Sofern eine Antikoagulation indiziert ist, sollten Marcoumar oder NOAK (NonVitamin K antagonist oral anticoagulants) eingesetzt werden. Plättchenaggregationshemmer wie Aspirin und Clopidogrel sind nicht ratsam und sollten bei herzgesunden Patienten mit Vorhofflimmern nicht verordnet werden. Bei Abwesenheit einer zusätzlichen schweren Mitralklappenstenose oder eines mechanischen Klappenersatzes wären NOAK gegenüber VitaminKAntagonisten zu bevorzugen (KlasseIAEmpfehlung). Die derzeit empfohlenen NOAK und ihre Dosierungsempfehlung zeigt Tabelle 3.
Vorhofohrverschluss möglich
Bei besonders hohem Blutungsrisiko oder Kontraindikation in Bezug auf orale Antikoagulation (schwere Anämie, Thrombozytopenie oder intrakranielle Blutungen) sollte an einen interventionellen Vorhofohrverschluss gedacht werden (KlasseIIbEmpfehlung).¹ Im Rahmen der Prozedur wird nach dem Zugang über die Leistenvene und nach transseptaler Punktion das linke Herzohr mit einem Device verschlossen, sodass sich darin keine Thromben mehr bilden können. Im Studienvergleich war dieser interventionelle Herzohrverschluss VitaminKAntagonisten nicht unterlegen.6
X Abbildung 1: Entscheidungshilfe für eine Antikoagulation, adaptiert nach Hindricks G et al.1
Patienten mit VHF/geeignet zur OAKEinnahme
Patienten mit prosthetischen Herzklappen oder milder bis schwerer Mitralstenose Nein Ja
Schritt 1 Identifikation von Niedrigrisikopatienten. VKA mit hoher therapeutischer Range.
Niedriges Schlaganfallrisiko? CHA2DS2VAScScore von 0 bei Männern (m) und von 1 bei Frauen (w).
Ja Nein
Schritt 2
Erwägung einer Schlaganfallprävention bei Patienten mit CHA2DS2VAScScore von ≥ 1 (m) oder von ≥ 2 (w) und Ermittlung des HASBLEDScore. Wenn HASBLEDScore ≥ 3 beträgt, modifizierbare Blutungsrisikofaktoren beachten. Hoher HASBLEDScore kein Grund für Verweigerung von OAK. Keine antithrombotische Behandlung.
CHA2DS2VAScScore
= 1 (m) oder = 2 (w) ≥ 2 (m) oder ≥ 3 (w)
OAK in Betracht ziehen (Klasse IIa) OAK empfohlen (Klasse IA)
Schritt 3 Den Patienten beginnen mit NOAK oder VKA zu behandeln. NOAK werden generell als Erstlinientherapie empfohlen.
VHF = Vorhofflimmern, NOAK = NichtVitaminKAntagonist, OAK = orale Antikoagulantien, w = weiblich, m = männlich, Alter, VKA = VitaminKAntagonist
Fazit
Zusammenfassend sollte bei jedem Patienten mit Vorhofflimmern initial eine Erhebung des thromboembolischen Risikos und des individuellen Blutungsrisikos erfolgen. Hierfür stehen der CHA2DS2VAScScore und der HASBLEDScore zur Verfügung. Bei Patienten mit niedrigem thromboembolischem Risiko ist keine Embolieprophylaxe erforderlich, bei erhöhtem Risiko (Männer: ≥ 2, Frauen: ≥ 3) ist eine orale Antikoagulation klar indiziert. Bei mäßig erhöhtem Risiko (Männer: =1, Frauen: =2) ist eine orale Antikoagulation ratsam. Besteht ein besonders hohes Blutungsrisiko bzw. eine Kontraindikation hinsichtlich einer oralen Antikoagulation, sollte auch an einen interventionellen Herzohrverschluss gedacht werden, da Patienten mit erhöhtem Blutungsrisiko ein hohes Schlaganfallrisiko aufweisen.
Literatur: 1 Hindricks G et al., ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of
CardioThoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020. 2 Iwasaki YK et al., Circulation 2011; 124(20):226474. 3 Hijazi Z et al., J Am Heart Assoc 2017; 6(6). 4 Ganesan AN et al., Eur Heart J 2016; 37(20): 1591602. 5 EstevePastor MA et al., Thromb Haemost 2017; 117(10):18481858. 6 Holmes DR et al., Lancet 2009; 374(9689):53442.
Schmerz, lass nach!
Aktuelle Empfehlungen für die Therapie des Rückenschmerzes
Die Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG) feiern heuer ihr 20jähriges Jubiläum – der HAUSARZT gratuliert recht herzlich! Der inhaltliche Fokus liegt 2021 auf den chronischen Rückenleiden, mit welchen 1,9 Mio. Österreicher (26 % der Bevölkerung über 15 Jahre) zu kämpfen haben. Der HAUSARZT fasst einige Empfehlungen zusammen.
Rückenschmerz auch bei Jungen
Die Binsenweisheit „Je älter die Patienten, desto häufiger macht der Rücken Probleme“ ist überholt. Von den unter 60Jährigen klagt jeder Fünfte (20,8 %) über Schmerzen, bei der Gruppe 60 + sind es mehr als jeder Dritte (38,4 %). „Das zeigt uns: Jugend schützt nicht vor Schmerzen. In jeder Altersgruppe liegt das Schmerzgeschehen im zweistelligen Prozentbereich, auch bei den unter 30Jährigen. Insbesondere hier sollte genauer hingesehen werden, um eine frühzeitige Chronifizierung zu verhindern“ , betont ÖSGPräsident Prim. Priv.Doz. Dr. Nenad Mitrovic.
Leitlinie beherzigen
Unspezifische Kreuzschmerzen sind in der Diagnose und Behandlung eine beträchtliche Herausforderung: Die muskuloskelettalen Beschwerden können verschiedene Ursachen haben. Sie entstehen und verlaufen auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene, und das in Kreisläufen, die sich wechselseitig verstärken. Wo soll also ein Arzt zuerst hinsehen und wie soll er den jeweils besten Ansatz finden, um einem schmerzgeplagten Menschen schnell und nachhaltig Linderung zu verschaffen? Die Österreichische Leitlinie für das Management akuter, subakuter, chronischer und rezidivierender unspezifischer Kreuzschmerzen (https://bit. ly/3rPLrAB) gibt darüber Aufschluss. „Wenn die Leitlinie konsequent beherzigt wird, sollten Kreuzwehpatienten künftig rascher wirksame Hilfe bekommen und überflüssige Röntgenaufnahmen (CT, MRT) oder Wirbelsäulenoperationen der Vergangenheit angehören“ , ist ÖSGGeneralsekretär Prim. Univ.Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc, überzeugt.
Problematische Selbstbehandlung
Aktuell besteht die Gefahr, dass Schmerzpatienten aufgrund der COVID19Sicherheitsmaßnahmen weniger Gehör und Hilfe finden. „Eine Unterversorgung leistet jedoch der Schmerzchronifizierung Vorschub und erhöht die Behandlungsbedürftigkeit dauerhaft“ , gibt ÖSGVizepräsidentin OÄ Dr. Waltraud Stromer zu bedenken. Daher müsse sichergestellt sein, dass medikamentöse Schmerztherapien weiterliefen und alle Maßnahmen einer multimodalen Schmerztherapie durchführbar blieben. In der Realität aber suchen chronische Schmerzpatienten während der CoronaKrise aus Angst vor einer Infektion oder wegen Ausgangsbeschränkungen ihren Arzt seltener oder gar nicht auf, sondern behandeln sich selbst, was am gestiegenen Absatz von OTCAnalgetika sichtbar ist. „Eine Selbstbehandlung mit frei erhältlichen Schmerzmitteln kann jedoch aufgrund möglicher Nebenwirkungen problematisch sein und stellt keinen adäquaten Ersatz für eine ärztlich betreute Schmerztherapie dar“ , schließt Dr. Stromer.
X Infobox: Tipp für Ihre Ordination
Patientenflyer der ÖSG mit dem Titel „Rückenschmerzen: Was bei hartnäckigen Beschwerden hilft“ können unter www.oesg.at bestellt werden.
Emanuel Munkhambwa
Quelle: Aussendungen der Österreichischen Schmerzgesellschaft anlässlich der 20. Österreichischen Schmerzwochen 2021
Expertin zum Thema: OÄ Dr. Waltraud Stromer
ÖSGVizepräsidentin
Foto: © Anna Rauchenberger
Experte zum Thema: Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
ÖSGGeneralsekretär
Foto: © Anna Rauchenberger
Experte zum Thema: Prim. Priv.-Doz. Dr. Nenad Mitrovic
ÖSGPräsident
„Eine Selbstbehandlung mit OTC stellt keinen adäquaten Ersatz für eine ärztlich betreute Schmerztherapie dar.“ „Wenn die Schmerz-Leitlinie konsequent beherzigt wird, gehören überflüssige Röntgenaufnahmen oder Operationen der Vergangenheit an.“ „Bei den unter 30-Jährigen sollte besonders genau auf Rückenschmerzen geachtet werden.“