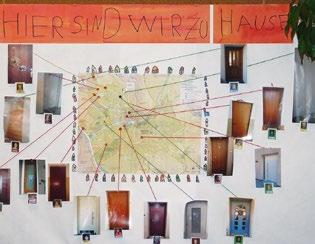GRUNDLEGENDES
Grundlegendes Kindern Wurzeln und Flügel geben – Religiosität im Kindergarten Helga Kohler-Spiegel Beziehung vor Erziehung „Das wichtigste Lebensmittel für Kinder ist Beziehung.“ Beziehung ist die Basis für Entwicklungsbegleitung, sie gibt Mädchen und Jungen Sicherheit und ermöglicht, dass sie sich gut entwickeln und lernen können. Bindungsforschung und Neurodidaktik haben gezeigt: Wenn Kinder sicher gebunden sind, können sie kognitiv und emotional besser lernen, sie können leichter Empathie und soziales Verhalten entwickeln. Von Beginn unseres Lebens an, auch pränatal, sind wir auf Dialog hin bezogen. Nach Mary Ainsworth ist Bindung „die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es beständig betreuen.“ Es ist ein „imaginäres Band, welches in den Gefühlen einer Person verankert ist und das sie über Raum und Zeit hinweg an eine andere Person, die als stärker und weiser empfunden wird, bindet.“ Bindung ist ein Grundbedürfnis: Im Dialog sein, um Sicherheit zu erlangen, sich orientieren, um Angst zu mindern sowie Glaube und Werte zu vermitteln. Sicher gebunden – auch im Religiösen Die jüdisch-christliche Religion beschreibt die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen häufig mit den Bildern von Bindung, Beziehung und Begegnung. Der Name Gottes wird in der Bibel übersetzt mit: „Ich bin da, als der ich da sein werde. Ich bin bei Dir.“ „Religio“ meint „mich rückbinden“, „glauben“ heißt in der hebräischen Wurzel „festhalten“, es ist die Bewegung des kleinen Kindes, wenn es sich in einer unsicheren Situation an den Eltern oder einer anderen Bezugsperson festhält. Das Recht des Kindes auf Religion Friedrich Schweitzer hat das Recht des Kindes, mit Religion in Berührung zu kommen, ausführlich dargelegt. Zur Stärkung des Wohles von Kindern gehört auch die Auseinandersetzung mit all dem, was ein Kind fragen und nachdenken, staunen und fasziniert sein lässt. Fünf große Fragen benennt
8 | Handreichung Religiosität
Schweitzer, „die entweder die Kinder an uns richten oder mit denen wir uns selbst bei der Erziehung konfrontiert sehen. Und es sind ‚große Fragen‘, weil sie zumindest potenziell nach einer religiösen Antwort verlangen.“ • Wer bin ich und wer darf ich sein? Die Frage nach mir selbst • Warum musst du/muss ich sterben? Die Frage nach dem Sinn des Ganzen • Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? Die Frage nach Gott • Warum soll ich Andere gerecht behandeln? Die Frage nach dem Grund ethischen Handelns • Warum glauben manche Kinder an Allah? Manche an Gott? Manche an keinen Gott? Die Frage nach der Pluralität an Religionen und der Vielfalt an Religiosität Mit diesen Fragen wollen und sollen Kinder nicht allein bleiben, es sind Fragen an die Eltern und pädagogischen Fachkräfte. Diese Fragen bedürfen der Auseinandersetzung, gerade in der kulturellen und religiösen Vielfalt heutiger Gesellschaft. Kinder brauchen Vorbilder im Umgang mit diesen Fragen, sie wollen wissen, was ihre Eltern und ihre Pädagoginnen und Pädagogen denken und glauben. So erhalten Kinder auch in religiöser Hinsicht eine anregungsreiche Mit- und Umwelt, in der sie bereits in jungen Jahren über diese „großen Fragen“ nachdenken und später dann ihre eigenen Antworten entwickeln können. Pädagogisch handeln – bei der Hand nehmen Im Wort „Pädagogik“ stecken die beiden altgriechischen Vokabeln „pais“ und „agein“, dies wird übersetzt mit „das Kind bei der Hand nehmen, führen“. In der Antike wurde der Begriff verwendet, wenn der Sklave das freie Kind zum Ort des Lernens begleitete. Lernen kann ein Mensch nur selbst, aber wir begleiten ein Kind an Orte, an denen es lernen kann. Wenn wir pädagogisch handeln, nehmen wir