Klima



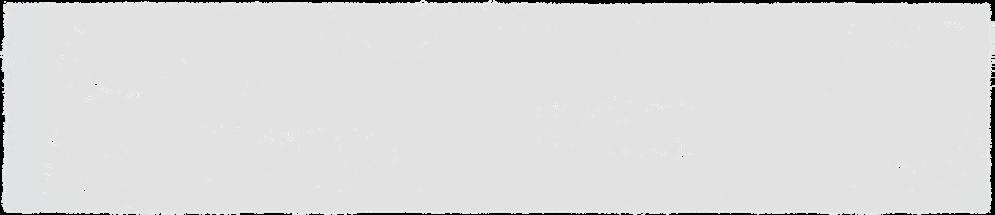
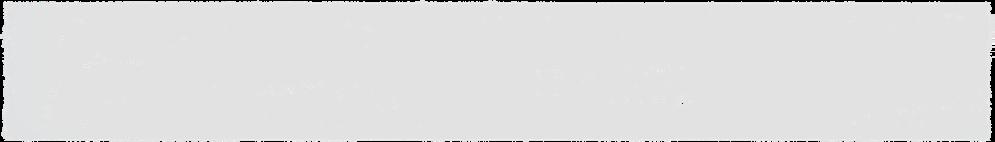






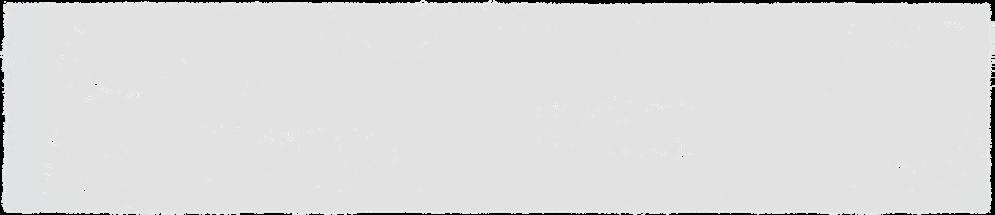
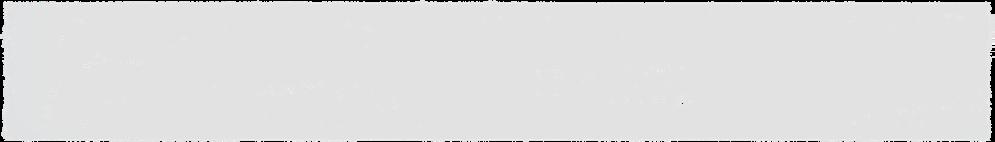







Liebe Kinder, wenn etwas kompliziert wird, sagen Erwachsene oft zu Kindern: „Lass das mal lieber uns machen.“ Manchmal versprechen sie Dinge, die sie nicht ein halten. Bestimmt fällt euch dafür auch ein Beispiel ein. Bei einer sehr wichtigen Sache halten sie ihre Versprechen seit vielen Jahren nicht ein. Es ist die Klimakrise. Wenn wir sie nicht aufhalten, könnte die Erde sich schon bald stärker aufheizen als von der letzten Eiszeit bis heute. Dabei wissen wir schon lange, was wir tun müssen. Wir dürfen bereits in wenigen Jahren kein Erdöl, kein Erdgas und keine Kohle mehr verbrennen. Denn dabei entsteht das Gas Kohlendioxid, das die Erde erhitzt. Das bedeutet: keine Benzin- und Dieselautos, keine normalen Flugzeu ge, keine Öl- und Erdgasheizungen und keine Kohlekraftwerke mehr. Stattdessen müssen wir Solaranlagen, Windkraftanlagen und Elektroautos nutzen. Außerdem sollten wir viel weniger Fleisch und Milchprodukte essen. Von Kindern erwarten Erwachsene, dass sie dazulernen und sich anders verhalten, wenn es gefährlich wird. Bei der Klimakrise schaffen sie das selbst aber nicht. Das hat in den vergangenen Jahren vielen Kindern Angst gemacht.
Sie haben unter dem Namen Fridays for Future gestreikt und demonstriert. Dadurch konnten sie die Welt bereits ein bisschen besser machen, denn nun reden alle über die Klimakrise. Die Regierung verspricht, endlich wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung einzuleiten. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was wir gegen die Klimakrise tun können, die Regierungen und auch jede und jeder Einzelne von uns.
Dann könnt ihr sehen, ob die Erwachsenen ihre Versprechen einhalten. Denn dabei geht es um eure Zukunft!






Du kennst vielleicht die Kinder Ellist, Youlaf, Mo und Stewa schon aus den anderen Schuljahren. In den eBooks stellen sie viele Fragen, diskutieren miteinander und vermitteln euch einige Klimafakten. Sie sind wie du älter geworden.



Immer noch beschäftigen sie sich intensiv mit Fragen des Klimawandels. Manchmal gehen sie sogar gemeinsam zu Demonstrationen für den Klimaschutz. Sie haben zwischenzeitlich vieles gelernt und einige Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler kennengelernt.







Ellist kümmert sich immer noch gern um alle. Er fragt sich, wie es allen Menschen auf der Erde gut gehen kann. Vor allem die Fragen, wie seine Freunde und Freundinnen jetzt und zukünftig gut miteinander leben können, beschäftigen ihn. Wichtig ist ihm, wie man in Streitsituationen zu gemeinsamen Lösungen kommen kann, bei denen niemand benachteiligt wird. Er hat sich wie die Wirtschaftswissenschaftlerin Elinor Ostrom die Frage gestellt, wie man knapper werdende Ressourcen gerecht verteilt. Frau Ostrom hat 2009 den �� Nobelpreis für ihre Forschungen in Fischerdörfern bekommen. Erinnerst du dich an das Fischerspiel in Klasse 2? Da geht es um die Regeln, die Frau Ostrom empfiehlt!
Ellist mag Tiere und Natur immer noch sehr. Er isst hin und wieder Fleisch und trägt ganz selbstverständlich seine Sneaker. Seine Schuhsammlung wird immer größer. Darüber muss er nachdenken, weil er das eigentlich nicht o. k. findet. Braucht man mehr als ein Paar Schuhe? Ellist hat Ideen, wie er diese Zwickmühle den anderen erklären kann. Das gibt regelmäßig lange Diskussionen mit seinen Freundinnen und Freunden.

Rerum, sit, volum alit aut ratendam lab omniam deles qui ipsumquisqui occum adi dolorrovit eiunt, tessequi quia pro molum sandest qui nimpernam, od moluptat fugia consendunt plignim esti dolum quo qui volo rem vidi volupis et dolupta tionse laciteni di res ut as etus inihill itaspit hil et etur? Oluptat ioreprae laborep taspistotata cumquia eratur simus dolora doloreprovid enimolum corrorias volorepta parum quid et quianda aute


Mo, 9 Jahre Mo redet nach wie vor leidenschaftlich gern. Sie möchte ihre Gedanken und ihr Wissen sofort den anderen mitteilen. Sie hat allerdings gelernt, den anderen erst zuzuhören. Mo stellt immer noch viele Fragen. Naturwissenschaftliche Fragen und Probleme begeistern sie. Ihr großes Vorbild ist die Klimaforscherin Friederike Otto. Den Titel des Buches „Wütendes Wetter“ findet Mo grandios. Frau Otto kann außerdem schwierige Klimazusammenhänge sehr gut erklären. So verstehen viele Menschen die Ursachen des Klimawandels. Ob sie dann auch etwas da gegen tun?

Wenn sie Mo reden hören, denken ihre Freunde und Freun dinnen ebenso an den �� Kommunikationsdirektor Carel Mohn.
Herr Mohn leitet die Internetplattform �� Klimafakten.de.

Dort werden alle Informationen zum Klima so geschrieben, dass möglichst viele Menschen sie verstehen können. Herr Mohn re det gern mit denen, die Zweifel an dem Klimawandel haben. Er bleibt auch bei hitzigen Diskussionen entspannt. Mo findet es sehr beeindruckend, wie er etwas für den Klimaschutz tut und viele Menschen erreicht. Das kann er, weil er das Denken der Menschen nachvollziehen kann. In diesem eBook wirst du ihn näher kennenlernen!






Youlaf ist nach wie vor ein aufmerksamer Beobachter und Zuhörer. Manchmal glauben die anderen Kinder, dass er ihnen schon wieder nicht zuhört, was aber nicht stimmt. Youlaf überlegt sich, wie Menschen, Mitwelt und alles andere auf der Welt gut miteinander in Frieden leben könnten. Wichtig ist ihm dabei die Frage der Gerechtigkeit. Youlaf bewundert Malala Yousafzai. Sie hat als 11-jähriges Mädchen in Pakistan begonnen, sich für die Rechte von Mädchen einzusetzen.

Als sie 13 Jahre alt war, wurde sie von den �� Taliban durch Schüsse in Kopf und Hals schwer verletzt. Malala hat für ihren Mut und ihren Einsatz für Mädchenrechte in ihrem Land viele Preise bekommen. 2013 bekam sie sogar den Friedensnobelpreis in Oslo.
Youlafs Großeltern sind in Somalia geboren. Er selbst kam in Deutschland zur Welt. Youlaf hat immer noch den Wunsch, seine Großeltern in Somalia zu besuchen, und hofft, dass dies bald möglich sein wird. Er ist sich sicher, dass in allen Ländern sofort etwas für das Klima getan werden muss. Das meint auch der Meteorologe und Klima forscher Mojib Latif. Mojibs Eltern sind aus Pakistan, er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Herr Latif forscht seit vielen Jahren zur Erderwärmung. Er kritisiert, dass die Energiewende in vielen Ländern der Welt im Schneckentempo vorangeht.
Youlaf möchte, dass auch all seine Freunde und Freundinnen etwas für den Klimaschutz tun. Er hat angeregt, dass alle ge meinsam mit seinen Eltern und seinen zwei Schwestern an Klimademonstrationen teilnehmen.
Stewa hat immer noch sehr viel mehr Fragen als Antworten. Niemand ist vor ihren Fragen sicher. Stewa gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden.
Sie zweifelt an, ob immer alles so ist, wie andere behaupten. Das bedeutet lange, interessante Diskussionen. Stewas Lieblingsforscher ist Stephen Hawking, der welt berühmte Astrophysiker. Er hat sich zeitlebens mit der Erforschung von Himmelserscheinungen beschäftigt.


Rerum, sit, volum alit aut ratendam lab ipidit, omniam deles qui ipsumquisqui occum adi dolorrovit eiunt, tessequi quia pro molum sandest qui nimpernam, od molup tat fugia consendunt plignim esti dolum quo qui volorem vidi volupis et dolupta tionse laciteni di res ut as etus inihill itaspit hil et etur? Oluptat ioreprae laborep taspistotata cumquia eratur simus dolora doloreprovid enimolum corrorias volorepta parum quid et quianda aute


Zusammen mit seiner Tochter Lucy hat er zwei Kinderbücher über den Kosmos geschrieben. Wie Stewa musste Herr Hawking ab seinem 26. Lebensjahr einen Rollstuhl nutzen. Er verlor dann mehr und mehr seine Bewegungsfähigkeit – aber nicht seine hervorragende Denkfähigkeit!
Auch bei Stewa funktioniert das Tüfteln und Experimentieren im Rollstuhl.
Die anderen Kinder mussten lernen, mit einem Talker zu kommunizie ren, weil Stewa nur so sprechen kann. Das funktioniert aber richtig gut. Stewa interessiert sich brennend für den Weltraum. Sie hat gehört, dass sich die erste Frau im Weltall, Walentina Wladimirowna Tereschkowa, ein Leben auf einem anderen Planeten sehr gut vorstellen kann. Jetzt überlegt Stewa, ob das nicht die Lösung unserer Probleme auf der Welt sein könnte – das Leben auf einem anderen Planeten.
Sie fragt sich: Wie gehen wir dann dort mit den Ressourcen um?
Und würde es uns helfen, das von den Menschen verursachte Klimaproblem auf der Erde zu lösen?





Was tut der Wald für das Klima, was Straßen nicht schaffen?
Forschendes Entdecken im Wald und auf der Straße

Stationen 1 bis 5
Was hat Einfluss auf das Klima?





Was tut der Wald für das Klima, was Straßen nicht schaffen?

Ein Ausflug in den Wald oder in den Park helfen dir, eine Antwort zu finden. Du wirst bei einem anschließenden Besuch in einer Straße, in der viel Beton verbaut ist, wenig Grün wächst und keine Bäume sind, einen Unterschied merken.
Bevor du dich mit dem Phänomen Wald und Klima beschäftigst, vorher eine Wiederholung. Du hast vermutlich bereits einiges zu den Themen Klima und Wetter erarbeitet. Wenn nicht, kannst du im eBook Klima.Leben der Klasse 3 dazu einiges nachlesen.
Such dir eine Partnerin oder einen Partner.



a) Tauscht euch aus, was ihr zu der Frage
„Wie kann man Wetter messen?“ wisst.


Wechselt nach 3 Minuten den Partner / die Partnerin
b) Klärt, wie man zu Aussagen über das Klima kommen kann.
Sucht euch nach weiteren 3 Minuten wieder einen neuen Partner oder eine neue Partnerin.

c) Besprecht gemeinsam, welche verschiedenen Messgeräte es gibt und wie man sie benutzt.
Tipp: Die Bilder können euch helfen!


Die Bilder zeigen Messgeräte, die man kaufen kann. Einige Messgeräte kann man selbst herstellen. Bauanleitungen für einen Windmesser (Anemometer) und ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät (Haarhygrometer) kannst du von der Lehrperson bekommen.
Und was tut nun der Wald für das Klima? Kann man das beobachten?

Schließt euch in Gruppen zu vier Kindern zusammen.

Jede Gruppe soll die Wetterdaten im Wald und in der Straße messen. Vermutet vorher: Wird es Unterschiede geben? Welche könnten es sein?
Mo hat sich drei Forschungsfragen überlegt:


a) Mo hat erlebt, dass im Wald fast überall Schatten ist. Sie fragt sich: Hat das Vorteile im Zusammenhang mit Wetter? Und wenn ja, welche?
b) Sie hat gehört, dass der Wald ein guter „Luftfilter“ ist. Was ist ein „Luftfilter“ im Wald? Kann man das messen?

c) Mo hat gelesen, dass der Wald ein guter „CO2-Speicher“ sei.
Was ist mit diesem „CO₂-Speicher“ gemeint?

Wie meistens hat Mo interessante, aber auch herausfordernde Fragen. Sie hat sich aber auch Gedanken gemacht, was und wie sie ihre Fragen im Wald und auf der Straße erforschen würde. Das kannst du auch erkunden!


Wie kann ich messen, wie viel Regen in den Boden geht? Ich gieße mitgebrachtes Wasser auf den Boden und stoppe die Zeit, bis das Wasser im Boden versickert ist (Versickerung messen).
Ich muss schauen und überlegen, welche Elemente oder Gegenstände an dem jeweiligen Ort als �� Luftfilter funktionieren könnten.




Wichtig ist auch, ob man sich an dem Ort wohlfühlen oder erholen kann. Wie riecht es dort? Welche Gefühle habe ich?

Bin ich an diesem Ort vor Lärm geschützt? Ich höre genau hin und schreibe auf, welche Laute und Geräusche ich wahrnehmen kann.


Wer kann an diesem Ort leben? Ich muss beobachten und nachdenken, welche Lebewesen an diesem Ort vorkommen.
Forschendes Entdecken im Wald und auf der Straße Mo hat schon einige Fragen aufgeworfen. Hier sind weitere Forschungsaufträge, die in der Gruppe bearbeitet werden. Ihr werdet gemeinsam einen Wald oder Park und einen Parkplatz aufsuchen und dort in Gruppen die Untersuchungen anstellen. Nehmt das Forschungsbuch oder Notizpapier mit, um die Forschungsergebnisse notieren zu können!

Stationen 1 bis 5
Aufgabe: Protokoll:
Aufgaben:
Temperaturmessung Thermometer, Maßband (oder Zollstock) Temperatur mit dem Thermometer messen: • knapp über dem Boden • in einem Meter Höhe Forschungsbuch

Wasser (2 Liter), Messbecher, Stoppuhr
Beobachtung: Was passiert mit dem Wasser, das an eine Stelle des Bodens gegossen wird?
Protokoll:
Aufgaben:
Messung: Wie lange dauert es, bis kein Wasser mehr an der Oberfläche zu sehen ist? Forschungsbuch
Tischtennisballwindmesser


Beobachtung: Was passiert mit deinem Messgerät, wenn du es in verschiedene Richtungen drehst?
Vermutung: Protokoll:

Messung: Welche höchste Windgeschwindigkeit wird an der Messstelle gemessen? Aus welcher Himmelsrichtung kommt der Wind? Forschungsbuch
Helligkeit
selbsttönende Brillengläser oder Tablet mit Licht messer-App


Protokoll:
Aufgabe:
Protokoll:

Beobachtung: Wie hell oder dunkel ist es an dem jeweiligen Ort? Wie stark blendet die Sonne? Forschungsbuch
Luftfeuchtigkeit
Haarhygrometer
Luftfeuchtigkeit mit dem Hygrometer messen. Forschungsbuch





Forscher und Forscherinnen stellen nach ihren Erhebungen – so nennt man das Messen von Daten die Forschungsergebnisse anderen Forschungsgruppen vor. Dann wer den die Daten verglichen und die Ergebnisse diskutiert.

Die Gruppe schaut sich alle ins Forschungsbuch eingetragenen Ergebnisse an und stellt sie der gesamten Lerngruppe vor.

In der Lerngruppe diskutiert ihr nun die Frage von Mo. Da ihr konkrete Messdaten habt, könnt ihr damit argumentieren.



Was tut der Wald Besonderes für das Klima? Warum ist das so?
Ja, und könnt ihr mir dann auch erklären, warum Bäume für das Klima besser sind als bebaute Flächen?
Da habe ich ein großartiges Bild gefunden. Das gibt Antworten auf deine Frage, Ellist. Die Kinder haben das gerade untersucht und können die Grafik bestimmt erläutern.

Es wäre super, wenn sie es auch anderen Kindern erzählen würden!




Wir Menschen verursachen zu einem großen Teil den Klimawandel. Das kann man auch auf den Fotos auf der nächsten Seite entdecken.
Schaue dir die Fotos auf der nächsten Seite zuerst genau an. Mach dir Gedanken zu den folgenden Fragen:


•
•
•
Was genau ist auf den ersten drei Fotos zu sehen?
Welche Auswirkungen hat das Geschehen auf das Klima?
Welchen Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt es?
Sprich anschließend mit einem anderen Kind über die Fotos:
•
•
Welche gleichen bzw. unterschiedlichen Erklärungen habt ihr?
Vergleicht, was ihr jeweils zum Klimawandel herausgefunden habt.

Es gibt auf der Erde unterschiedlich gestaltete Orte und Landschaften. Manche sind wichtig und haben Vorteile für das Klima. Andere Gestaltungsformen sind nachteilig für das Klima.





• Diskutiere mit deiner Partnerin / deinem Partner über die folgenden Fotos.



• Überlegt, welche Landschaften und Gestaltungsformen gut oder weniger gut für das Klima sind. Begründet eure Antworten!

















Die Sommer in Deutschland werden immer heißer. In den vergangenen Jahren fiel das Wetter oft deutlich zu warm aus. Hitzewellen nahmen zu und ließen die Men schen schwitzen. Die zunehmende Trockenheit und plötzliche Starkregen machten zudem der Natur zu schaffen.

In Sachsen ist der Einfluss des Klimawandels deutlich zu spüren. Klimaforscherinnen und Klimaforscher gehen davon aus, dass die Folgen des Klimawandels in Zu kunft noch zunehmen werden.




Die folgenden Fotos erzählen Geschichten, die (auch) mit dem Klimawandel zu tun haben. Schau dir die Fotos sorgfältig an.




• Was für eine Geschichte erzählt dir das Foto?
• Was auf den Fotos kann mit Klima zu tun haben?
•
Welche Gemeinsamkeit kannst du auf allen Fotos erkennen?

Du hast es erkannt! Das Klima und damit auch eine Klimaerwärmung hat einen Einfluss auf die Natur und auf viele Lebensbereiche der Menschen. Was genau sich verändert, das sollst du in den nächsten Stunden herausarbeiten. Dazu gehört auch, sich zu überlegen, was die Menschen in Zukunft anders machen sollten.
Setze dich mit drei anderen Kindern zusammen. Gemeinsam entscheidet ihr euch nun für die Erarbeitung eines Bereiches:





• Lest zu eurem ausgewählten Bereich die folgenden Texte im eBook. Ihr könnt die Textabschnitte zum Lesen unter euch aufteilen.



• Diskutiert und beantwortet gemeinsam die folgenden Fragen. Notiert die Antworten im Forschungsbuch.
o Warum beeinflusst der Klimawandel den gewählten Bereich?
o Wie ist der gewählte Bereich von diesen Folgen betroffen?
o Wie kann sich der Bereich an die Folgen des Klimawandels anpassen? Denkt dabei an die Gegenwart und an die Zukunft!



o Recherchiert nach weiteren Bildern und Informationen zu deinem ausgewählten Bereich! Verwendet diese für das Lapbook.
o Überlegt euch eine heitere, spannende und kurze Geschichte. Darin soll vorkommen, wie die Klimaerwärmung gestoppt wird oder wie die Erde in Zukunft (2080) aussieht. Geht davon aus, dass alle Menschen der Welt ab morgen klimabewusst leben. Wie sieht die Welt dann 2080 aus? Es können Menschen, Tiere, Technik, Geister usw. darin vorkommen. Schreibt und / oder malt die Geschichte!

Die Ergebnisse sollen der gesamten Lerngruppe vorgestellt werden. Ihr könnt auch eine Ausstellung aller Lapbooks organisieren. Ladet die Kinder anderer Klassen und evtl. eure Eltern ein und erzählt ihnen mithilfe des Lapbooks, was ihr über den Klimawandel wisst und denkt!


In einem Lapbook gibt es mehrere aufklappbare Minibücher. Da können eure Ergeb nisse aufgeschrieben werden. Die Minibücher können unterschiedliche Formen haben.
• Überlegt zusammen, welche Inhalte und Ergebnisse aus dem Forschungsbuch dargestellt werden sollen.
• Jedes Gruppenmitglied gestaltet ein Minibuch mit dem gewählten Themenabschnitt.


• Das „Geschichtenbuch“ und das „große Buch“ gestaltet ihr gemeinsam in der Gruppe.
• Nutzt die gefundenen Bilder und Informationen, malt eigene Bilder, denkt an eure Geschichte und gestaltet so ein einmaliges Lapbook.




Wälder sind vielschichtige �� Ökosysteme. Das sind Lebensgemeinschaften von vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren. Die Menschen sind auf die Wälder als wertvolle CO2-Speicher und Sauerstoff produzenten angewiesen. Durch den Klimawandel wirken verschiedene Störungen auf den Wald, die das Ökosystem spürbar verändern. Diese Störungen können äußere Umwelteinflüsse sein. Dazu zählen zum Beispiel die Folgen von Extremwetterereignissen wie Sturmschäden, Starkregen und Trocken heit. Diese Ereignisse gab es auch schon früher. Durch den Klimawandel werden sie immer häufiger und intensiver.




Ansteigende Temperaturen und weniger Regen in den heißen Sommermonaten können in in Wäldern zunehmend zu Trockenheit und Dürre führen. Dadurch gibt es viele Schädlinge an den Bäumen und häufig vertrocknen die Neuanpflanzungen. Wie stark die Wäl der vom Wassermangel betroffen sind oder in Zukunft sein könnten, ist abhängig von der Baumart, dem Alter der Bäume und deren Standort. Die Frage ist, ob die Bäume an Wasser gelangen können, zum Beispiel durch nahe Flüsse, Grundwasser oder �� Moore. Durch lange Trockenheit steigt auch die Gefahr, dass es zu Waldbränden kommt. Man spricht von der Waldbrandsaison. Eine weitere Folge des Klimawandels ist, dass Bäume durch die Erwärmung immer früher austreiben und teilweise länger grün bleiben. Das hat Vorteile. Wenn es aber im Frühling oder Herbst zu starkem Frost kommt, kann das schwere Schäden für die Bäume bedeuten, von denen sie sich nicht so schnell erholen.









Stürme werden durch den Klimawandel nicht unbedingt häufiger, aber wahr scheinlich zunehmend stärker. Je nach Höhe, Alter und Art der Bäume und wie tief sie im Boden verwurzelt sind, können starke Stürme im Wald großen Schaden anrichten.



Wenn Wasser nach einem Starkregenguss in der wärmeren Zeit des Jahres nicht schnell genug im Boden versickert, kann es zu Überschwemmungen kommen.
Wie auf dem Feld können fruchtbarer Boden weggeschwemmt oder Wurzeln frei gelegt werden. Diese sind dann leichter verwundbar. Starkregen im Winter in Form von intensivem Schneefall kann zur Folge haben, dass Bäume unter der Schneelast brechen oder umfallen.
Neben Wetterextremen können Störungen im Wald auch Lebewesen sein wie zum Beispiel Käfer und bestimmte Pilze. Sie verändern oder zerstören die vorhandenen Waldstrukturen. Durch ansteigende Temperaturen vermehren sich Schädlinge wie zum Beispiel der Borkenkäfer viel schneller und befallen so auch mehr Bäume und Wälder. Borkenkäfer gab es schon immer in Deutschland und Sachsen. Durch den Klimawandel können neue Schädlinge einwandern, denen das Klima hier bei uns vorher zu feucht oder kalt war. Empfindliche Ökosysteme wie Wälder sind auf sol che Neuankömmlinge nicht vorbereitet.







Veränderungen des Klimas können Wälder direkt durch Extremwetter ereignisse oder indirekt durch bessere Bedingungen für Schädlin ge wie zum Beispiel Borkenkäfer schädigen. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass diese Störungsarten in der Zukunft weiter zunehmen werden. Deshalb arbeiten viele Fachleute daran, Maßnahmen und Anpassungsmög lichkeiten für das Überleben der Wälder zu entwickeln. Sind Wälder nicht so stark von diesen Störungen betroffen, sind wärmere Temperaturen und mehr Kohlenstoffdi oxid in der Luft sogar günstig für das Wachstum der Bäume. Davon profitieren selten gewordene Baumarten wie die Weißtanne.


Bleiben Wälder ihrer natürlichen Entwicklung überlassen, nennt man sie Naturwälder. Naturwälder bieten ungestörte Lebensräume für unterschiedlichste Pflanzen und Tiere. Greift der Mensch in das Ökosystem Wald ein, um zum Beispiel Waldflächen für die Produktion von Holz zu nutzen, dann spricht man von einem Wirtschafts wald. Um Folgen des Klimawandels im Wirtschaftswald zu verhindern oder zu mindern, kann der Mensch Anpassungen und Vorkehrungen treffen. Der Natur wald hat von sich aus Möglichkeiten, sich an Klimaveränderungen anzupassen. Das dauert im Vergleich zum Wirtschaftswald in der Regel viel länger.






Wälder können sich auf zweierlei Arten an die Folgen des Klimawandels anpassen:

a) Durch eine natürliche Einwanderung neuer, besser angepasster Baumarten.
b) Durch Evolution, das bedeutet, dass sich bestehende Baumarten an die Veränderungen über mehrere Generationen hinweg anpassen.

Der Mensch kann dabei beide Prozesse beeinflussen. Durch gezielten Waldumbau wird versucht, in Wäldern eine möglichst große Vielfalt an unterschiedlichen Baum arten zu haben. Mischwälder aus Laub- und Nadelbäumen sind besser in der Lage, Störungen wie Extremwetterereignissen oder Schädlingen zu widerstehen und sich diesen anzupassen.
Wald nutzt den Menschen Wälder passen sich an ihre Standorte und Veränderungen an. Sie haben Auswir kungen auf andere Bereiche. Die abgeworfenen Blätter und Nadeln der Bäume werden mit der Zeit zu fruchtbarem Humus. Wichtige Nährstoffe und Wasser können in solchen Böden sehr gut gespeichert werden. In Zeiten steigender Temperaturen und langen Phasen ohne Regen kann das überlebenswichtig für das Ökosystem Wald sein. Der Wald wird auch „grüne Lunge“ für den Menschen genannt. Wälder sind wertvolle Kohlenstoffdioxidspeicher und Sauerstoffproduzenten. Ein Wald wirkt sich positiv auf die Qualität unserer Atemluft und das allgemeine Klima aus. Der Erhalt von Wäldern durch Maßnahmen und die Unterstützung der Anpassungsprozesse durch die Forstwirtschaft ist auch Klimaschutz.





Wasser ist für das Leben sehr bedeutsam. Es bildet die Grundlage für Pflanzen und unser Trinkwasser. Gewässer, also Bäche, Flüsse und Seen, sind wichtige Naturräume nicht nur für Menschen, sondern auch für eine große Tierwelt. Ziel ist es, den Zustand der Gewässer auch in Zeiten des Klimawandels zu erhalten. Schon heute sind einige Auswirkungen wie Hochwasser, Wasser mangel und Verschmutzungen der Gewässer in Sachsen erfahrbar.





Steigen die Temperaturen, verdunstet mehr Wasser.

Es es wird weniger Wasser verfügbar sein. Auch Sachsen kann davon betroffen sein. Die Flüsse werden weniger Wasser führen oder wie die Schwarze Elster in Nord sachsen zeitweise austrocknen. Da die Niederschläge immer häufiger im Sommer fallen, beobachten Forscherinnen und Forscher zunehmend eine große Trocken heit im Frühjahr. Die Trockenheit wirkt sich negativ auf das Wachstum von Pflanzen aus. Diese können dann weniger Stickstoff aufnehmen, was zur Verschmutzung des Grundwassers (also Trinkwassers) und des Wassers an der Oberfläche von Flüssen führen kann. Insgesamt ist ein Sinken des Grundwasserspiegels und damit des Trink wassers in ganz Sachsen zu beobachten. Deutschland hat selten und nur in ganz bestimmten Regionen ernsthafte Probleme mit der zur Verfügung stehenden Menge an Wasser. Das ist in anderen Ländern der Welt ganz anders. Dort ist Wasser knapp und sehr wertvoll. Warum in Deutsch land nur in einzelnen Regionen Wasserprobleme vorliegen, liegt an der gemäßigten Klimazone, in der wir leben. Niederschläge treten hier häufig auf. Wasserman gel ist daher in Sachsen nicht zu befürchten. Phasen der Dürre und Trockenheit, in denen wir wenig Wasser zur Verfügung haben, aber schon.





Untersuchungen von Forscherinnen und Forschern zeigen, dass sich ganz Sachsen in Zukunft auf eine Zunahme von Extremwetterereignissen einstellen muss. Ein extremes Wetterereignis ist ein Ereignis, das an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Jahreszeit eigentlich selten, d.h. außergewöhnlich, ist. Extremwetter ereignisse sind starker Regen (Starkregen) oder langanhaltende Niederschläge. Beides führt zu Überschwemmungen, wenn viel mehr Niederschlag fällt, als der Boden oder die Regenkanalisation in der Stadt aufnehmen können. Auch Flüsse können über die Ufer treten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn diese kurvenlos fließen und wenig Abzweigungen haben. Das Wasser bewegt sich dann schneller flussabwärts.


Wenn Wasser zum Beispiel in Stauseen länger steht und zudem wenig Niederschlag fällt, dann vermischt sich altes Wasser mit frischem Wasser nicht so gut. Algen können dann begünstigt wachsen und auch Bakterien breiten sich schneller aus. Die Qualität des Wassers verschlechtert sich.
Das sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft kümmert sich um Wasserschutzmaßnahmen. Es werden vor allem Maßnahmen geplant und umgesetzt, die dem Schutz vor Extremereignissen wie Dürre und Hochwasser dienen.
Forscherinnen und Forscher arbeiten an weiteren Anpassungsmöglichkeiten, um gutes Trinkwasser bereitstellen zu können. Zum Beispiel werden Stauanlagen gebaut, um Wasser in Trockenzeiten zur Verfügung zu haben. Zudem werden die Menschen auf wassersparendes Verhalten aufmerksam gemacht.








Um die Hochwassergefahr zu mindern, sollen bebaute Flächen, in denen kein oder nur wenig Wasser ablaufen kann, verringert und zurückgebaut werden. Dies wird vor allem mit nicht genutzten Flächen gemacht, zum Beispiel mit der in Flussnähe befindlichen, stillgelegten Volltuchfabrik in Görlitz. Durch den Rückbau der Fabrik entstand Naturraum, der wiederum mit seiner neu geschaffenen Pflanzenwelt (vor allem Wälder mit vielen Laubbäumen) als Schutz vor Hochwasser dient. Häufig sind solche Natur bereiche um Gewässer bekannt für eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzenarten.
Gebiete, in denen Hochwasserereignisse auftreten können, erhalten große Becken, in denen das Hochwasser bei Starkniederschlägen gesammelt werden kann. Auch Schutzwände, die bei Bedarf schnell aufgebaut werden können, sollen in betroffenen Gebieten gelagert werden. Um Menschen in Überschwemmungsgebieten früher zu warnen, finden in verschiedenen Städten Informationsveranstaltungen zum Thema Hochwasser statt. Die Anpassungsmaßnahmen müssen mit Menschen aus der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei abgestimmt werden, da diese vom Wasser leben und es benötigen. Eine enge Zusammenarbeit und das Entwickeln von gemeinsamen Maßnahmen in diesen Bereichen sind daher zwingend notwendig.





Der Boden ist ein wichtiges Element unseres Lebensraums. Klimawirkungen auf den Boden haben weitere Folgen auf andere Bereiche wie das Wasser, unsere Nahrung und das Klima.




Starkregenereignisse treten häufig von Mai bis September auf. Dabei handelt es sich um Gewitterniederschläge mit großen Regentropfen, die in kurzer Zeit sehr viel Regen bringen. Die Regentropfen fallen so fest auf den Boden, dass sich der Erdboden lockert. Es bildet sich Schlamm an der Erdoberfläche. Der Boden nimmt das viele Wasser, welches in kurzer Zeit fällt, nicht auf. Es staut sich an der Erdoberfläche. Ist der Boden nicht mit Pflanzen bedeckt (also ungeschützt), so kann es zum Abtrag der obersten Erdschichten kommen. Bei Starkregen läuft das Wasser dann in bereits vorhandenen Linien des Ackers ab. Man nennt das Bodenerosion. Das passiert bei Ackerböden nach dem Pflügen und dem Ausstreuen der Saat: im Sommer zwischen April und Mai bei den Sommer früchten (Mais, Rüben, Kartoffeln, Erbsen, Sommergetreide), im Winter von August bis Oktober bei den Winterfrüchten (Winterraps, Wintergetreide).



In diesen Zeiträumen ist der Boden besonders anfällig, da keine Pflanzen als Schutz vorhanden sind. In den letzten Jahren haben diese Starkregenereignisse zugenommen.


Sehr wichtig für ein ausgeglichenes Klima ist die Feuchtigkeit bzw. Nässe des Bodens. Gibt es häufiger Starkregen, dann kann der Boden nicht genügend Wasser aufnehmen, da in sehr kurzer Zeit zu viel Regen fällt. Der Boden ist dann schnell „gesättigt“. Bei „normalem“ Niederschlag ist das nicht so: Das Wasser kann im Boden gut versickern, da Regen über lange Zeit in kleineren Mengen fällt.
Starker Wind kann ebenfalls den Boden abtragen, jedoch kommt das in Sachsen nicht ganz so häufig vor wie die Bodenerosion. Wenn keine Pflanzen vorhanden sind, kann der Wind besonders gut die Ackererde wegwehen.







Die Temperatur ist für die Feuchte des Bodens entscheidend. Steigen die Temperaturen und nimmt der Niederschlag ab, haben Pflanzen weniger Wasser zur Verfügung. Passiert das über längere Zeit, werden Pflanzen in ihrem Wachstum gehindert. Dann kann es sein, dass sie eingehen oder welken.

Sachsen ist von Starkregenereignissen betroffen und es gibt Schäden an den Ackerflächen.




Es sind Maßnahmen nötig, die den Abtrag der oberen Bodenschichten verhindern. Besonders wirksam ist eine bunte Fruchtfolge. Das bedeutet verschiedene Frucht arten, die zu unterschiedlichen Zeiten angebaut werden. Sie beanspruchen den Boden unterschiedlich stark und schützen ihn so.
Zeitgleich kann der Acker in unterschiedliche Bereiche gegliedert und mit unterschiedlichen Früchten versehen werden. Diese wachsen unterschiedlich schnell, hoch oder breiten sich aus. So ist der Boden zu unterschiedlichen Jahreszeiten von Pflan zen bedeckt. Diese Maßnahmen sind ebenso geeignet, um den Bodenwasserhaushalt (bzw. die Feuchte im Boden) zu verbessern. Durch sogenannte Mulchsaat kann Wasser besser zurückgehalten und Regen gesammelt bzw. aufgenommen werden. Statt einer Aussaat kann auch der Boden mit Pflanzen material (Stroh, Grünschnitt) abgedeckt werden.

Sturm

Die Empfehlungen zur Vermeidung von Erosion gelten auch bei starkem Wind. Außerdem können zudem Windschutzhecken oder eine Bodenbearbeitung ohne Pflug hilfreich sein.



Artenvielfalt ist ein Maß dafür, wie viele verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen in einem bestimmten Gebiet leben. Viele Tierarten sind nicht nur weltweit, sondern auch in Sachsen sehr bedroht. Die Zerstörung und die intensive Nutzung von Lebensräumen der Tie re führen zum Rückgang und zur Verdrängung von Arten. Die Artenvielfalt nimmt in vielen Gegenden rasant ab.




Die durch den Klimawandel bedingten steigenden Temperaturen, das frühere Beginnen des Pflanzenwachstums und Extremwetterereignisse beeinflussen die Tier- und Pflanzenwelt. Bei längeren Trockenphasen und wenig Niederschlag sinkt das Grundwasser. Die Moore in Sachsen verlieren ihre Grundlage – ausreichend Wasser. Tierarten, die in Mooren leben, sind dann gefährdet.


Da bei Trockenheit mehr Wasser verdunstet, können kleine Bäche oder Teiche austrocknen. Bei größeren Gewässern wie Flüssen passiert das eher nicht. Dort kann ein Anstieg der Wassertemperatur aber zur Verdrängung verschiedener Arten führen und weitere Auswirkungen auf die dort lebende Tier- und Pflanzenwelt haben. Steigen die Temperaturen in Gewässern stark an, fehlt den Fischen lebensnotwendiger Sauerstoff – und sie können tatsächlich ersticken.









Forscherinnen und Forscher stellen fest, dass als Folge des Klimawandels die Jahreszeiten immer früher beginnen. Verschiedene Pflanzen blühen oder entfalten ihre Blätter früher. Dies liegt daran, dass es immer zeitiger im Jahr warm wird. Für Pflanzen ist die eintretende Wärme ein Signal für das Wachstum. Folgen dieser Auswirkungen auf das Klima können nur schwer vorhergesagt werden.
Es steht fest, dass viele Tier- und Pflanzenarten Veränderungen in ihren Lebensräumen erfahren werden. Sie werden von anderen Arten verdrängt oder müssen sich sehr gut an ihren Lebensraum anpassen, um überleben zu können. Bei allen betroffenen Arten ist zu bedenken, dass sie für ihre Anpassung an einen Lebens raum Zeit brauchen. Es ist möglich, dass sich bestehende und neu hinzugekommene Arten wegen passender Klimabedingungen vermischen und dadurch neue Arten entstehen. Auch vom Menschen eingeschleppte Arten können sich aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen in Zukunft noch häufiger verbreiten.
Tier- und Pflanzenarten, die schon an Trockenheit angepasst und wärmeliebend sind, werden sich besser ausbreiten. Dies ist zum Beispiel bei manchen Orchideen, Libellen und Heuschrecken der Fall. Arten, die eher kälteliebend und an nasse Standorte angepasst sind, werden es in ihrem Lebensraum zunehmend schwer haben.

Vermehrung durch Ewärmung Tagfalter werden sich in Zukunft in Sachsen vermehren können, da sich für diese Art ein neuer geeigneter Klimaraum ergibt. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass in den nächsten 70 Jahren nicht nur eine Art (zum Beispiel der Steppen-Gelbling, der schon früher nachgewiesen wurde), sondern 22 neue Schmetterlingsarten in Sachsen zu finden sein werden (zum Beispiel Schwarze Trauerfalter).







Tagfalter können auf Veränderungen von Temperaturen schnell (1- 2 Jahre) reagieren, andere Arten, zum Beispiel Libellen, benötigen hier viel mehr Zeit. In Sachsen sind die Auswirkungen der steigenden Temperaturen als Folge des Klima wandels bei den Tagfaltern sehr deutlich erkennbar.

Forscherinnen und Forscher können Auswirkungen des Klimawandels auf die Tierund Pflanzenwelt nur grob schätzen. Daher sind alle Maßnahmen sinnvoll, welche die Vielfalt der Natur erhalten. Schutzziele und Schutzgebiete können dabei helfen, Arten einen Lebensraum zu bieten. Hierbei handelt es sich um langfristige Aufgaben. Für Lebewesen in Gewässern ist es wichtig, Wan dermöglichkeiten zu schaffen. Sie benötigen dafür Gewässerverbindungen. Das Austrocknen von kleinen Gewässern muss verhindert werden. Moore (wie zum Beispiel das Georgenfelder Hochmoor im Osterzgebirge und die Hühnerheide bei Reitzenhain im Mittelerzgebirge), Wäl der und Grünlandböden sind wichtige Speicher des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2). Daher sollten diese geschützt werden. Moore können mit Holzdämmen verschlossen werden, damit das Wasser im Moor bleibt. Windkrafträder dürfen nur in bestimmten Zonen aufgestellt werden, um Arten wie Vögel, Tagfalter und Libellen vor den großen Rädern zu schützen. In Sachsen hat die Regierung dafür strenge naturschutzrechtliche Grundlagen für den Artenschutz aufgestellt.


Die Landwirtschaft in Sachsen ist vom Klimawandel vor allem durch den erwarteten Anstieg von Extremereignissen betroffen. Durch ausfallenden Regen kommt es zum Wassermangel. Die Pflanzen wachsen nicht und es kann zu Ernteausfällen kommen. Für unsere Ernährung sind wir Menschen auf die Ernte angewiesen.

Durch den Klimawandel werden Extremereignisse wie Hitze, Dürre, Starkregen, Hagel und Stürme in Zukunft häufiger werden. Das hat Folgen für die Landwirtschaft.








Die Folgen des Klimawandels erkennen Landwirte und Landwirtinnen an der früheren Blütezeit der Pflanzen. Das hat den Vorteil, dass früher geerntet werden kann. Wenn es allerdings im Frühling noch einmal Frost gibt, können die Pflanzen erfrieren. Sie sind diese Kälte (noch) nicht gewohnt. Steigen die Temperaturen und bleibt der Regen aus, kommt es zu Trockenphasen und damit wahrscheinlich zu Ernteausfällen.
Extremwetterereignisse und eine weitere Erwärmung können direkte Folgen für das Feld haben: Böden trocknen aus, werden weniger fruchtbar und können weniger Wasser speichern. Dadurch sind sie leichter anfällig für eine Bodenerosion. Nach starkem Regen kann es zu Überschwemmun gen kommen, da nicht mehr genügend Wasser im Boden versickern kann. Als Folge wird wertvoller, fruchtbarer Boden weggeschwemmt, der zum Anbau von Pflanzen dringend gebraucht wird.







Neben einem früheren Blütezeitpunkt und Folgen für den Boden gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass sich Pflanzenschädlinge als Folge des Klimawandels ausbreiten werden. Das können zum Beispiel Beikräuter sein, die bislang nur in wärmeren Klimazonen wachsen konnten und sich nun auch in Deutschland und Sachsen auf Feldern ausbreiten. Wenig Niederschlag und warme Temperaturen sind häufig ebenso perfekte Bedingungen für tierische Schädlinge wie zum Beispiel Kartoffelkäfer oder Blattläuse. Die gab es früher auch, aber nicht so häufig und so viel. Je nach Region und Standort können eine oder mehrere dieser Folgen des Klimawandels bedeuten, dass mehr, weniger oder im schlimmsten Fall gar nichts geerntet werden kann. Man spricht dann von einem Ernteausfall.

Maßnahmen und Anpassungsmöglichkeiten Schon heute können die Landwirte in Sachsen ihre Arbeit an den Klimawandel anpassen.
Wassermangel Pflanzen sollen bei steigenden Temperaturen und längerer Trockenheit wachsen können und eine ausreichende Ernte bringen. Deshalb züchten Fachleute Arten, die besonders wenig Wasser brauchen. Dennoch müssen viele Pflanzen weiter gegossen werden. Hier wird vor allem untersucht, welche Bewässerungsarten sparsam und effektiv sind. Dazu gehören Beregnungsmaschinen. Bleibt der Regen aus, so kann im Notfall auch das Grundwasser genutzt werden. Da das Grundwasser aber auch unser Trinkwasser liefert, muss diese Nutzung durch die Landwirtschaft in Zukunft genau geregelt werden.






Nicht nur Trockenheit, sondern auch Starkregen und Erosion sind Probleme für die Landwirtschaft. Auch hier wird nach Anpassungsstrategien gesucht. Um fruchtbaren Boden vor Erosion zu schützen, können Felder in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, auf denen unterschiedliche Pflanzen wachsen. Dadurch ist der Boden fast nie unbedeckt. Pflanzenreste bilden eine bodenschützende Auflage aus sogenanntem Mulch (Mulchsaat). Das verbessert die Aufnahme von Regenwasser durch den Boden. Werden Pflanzensamen direkt im Mulch gesät, muss der Boden auch nicht extra mit einem Pflug vorbereitet werden.

Netze über Obstbäume, können Schäden durch andere Extremwetterereignisse wie Hagel verhindern.

Unterschiedliche Pflanzen haben den Vorteil, dass bei einem Befall durch Schädlinge nicht gleich die ganze Ernte in Gefahr ist. Es wird zusätzlich an robusteren Sorten und umweltfreundlichen Pflanzenschutzmitteln geforscht.







Die Veränderungen durch den Klimawandel betreffen alle Bereiche unseres Lebens. Steigende Temperaturen, Trockenheit, Hochwasser und andere extreme Wetterereignisse haben Folgen für uns Menschen in den Städten und Gemeinden. Deshalb müssen auch diese Räume an die Auswirkungen des Klimawandels angepasst werden.

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, in einer Stadt zu leben. Auf vielen freien Flächen werden für sie Häuser und andere Gebäude gebaut. Durch die dichte Bebauung und Versiegelung von Flächen ergeben sich schon heute Nachteile, die durch den Klimawandel in Zukunft noch verstärkt werden.

Temperatur Städte heizen sich vor allem im Sommer wegen der engen Bebauung und fehlender kalter Luft viel stärker auf als das Umland außerhalb. Steigen durch den Klima wandel die Temperaturen weiter an, wird es als Folge auch in den Städten immer wärmer werden. Ist es über lange Zeit sehr heiß, wird mehr Wasser gebraucht, um Gärten, Felder, Parks und Bäume an Straßen zu bewässern. Maschinen in der Industrie brauchen mehr Wasser zum Kühlen, um nicht kaputtzugehen. Häufig wird hierfür Grundwasser genutzt. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Starke Hitze allgemein macht nicht nur Pflanzen und Tieren zu schaffen, sondern kann auch für den Menschen gefährlich werden. Unter der Hitzebelastung und den möglichen Folgen leiden ältere und kranke Menschen. Menschen, die draußen arbeiten müssen, zum Beispiel auf Baustellen, sind der Hitze ausgesetzt.


Allergien durch Pollen können zunehmen, da Blumen früher und länger blühen. In Autos, Bussen und Straßenbahnen werden Klimaanlagen benötigt, damit Menschen keinen Hitzschlag bekommen. Bahngleise müssen geschützt werden, damit sie sich nicht durch die starke Wärme verbiegen.






Der Klimawandel bewirkt, dass Extremwetterereignisse, zum Beispiel Starkregen, häufiger werden. Wegen der dichten Bebauung und wasserundurchlässiger Betonböden gibt es in Städten kaum grüne und freie Flächen, auf denen das viele Regenwasser versickern kann. Stattdessen fließt es sturzflutartig und unkontrolliert ab. Wenn in kurzer Zeit so viel Regen fällt, dann können die Kanalsysteme der Städte das Wasser irgendwann nicht mehr aufnehmen. Es kommt dann zu Überschwemmungen. Vor allem ältere Gebäude oder Denk mäler sind von Hochwasserschäden besonders betroffen.


Bereiche in Städten, die sich im Sommer sehr stark aufheizen können oder in denen das Risiko einer Überschwemmung groß ist, werden von Forscherinnen und Forschern auf sogenannten Risikokarten markiert. Solche Karten bilden die Basis, um Menschen zu informieren und konkrete Anpassungen der Städte an die Folgen des Klimawandels zu planen.


Auch wenn man solche Risikokarten nutzen kann, ist die Anpassung einer Stadt an die Folgen des Klimawandels eine große Herausforderung. Viele Maßnahmen sind nur durch aufwendige Sanierungen, Umbauten und lange Entwicklungsprozesse erreichbar.







Um die zunehmende Hitze in Städten zu senken, müssen an erster Stelle wichtige Grünflächen wie Wiesen, Parks und Gärten erhalten und ausgebaut werden. Dies gilt sowohl in Innenstädten als auch für das Umland. Grünflächen kühlen in der Nacht viel stärker ab und senken die Temperatur der nahen Umgebung. Das Pflanzen von Bäumen, die Schatten spenden und Abkühlung schaffen, ist ebenfalls wichtig. Besonders Arten, die wenig Wasser brauchen und denen Hitze nichts ausmacht, sind gut geeignet. Häuser und Gebäude müssen angepasst werden. Ähnlich wie in südeuropäischen Städten kann es hilfreich sein, die Gebäude in hellen Farben zu streichen. Diese reflektieren das Sonnenlicht und heizen sich deshalb nicht so stark auf wie dunkle Farben. Pflanzen auf den Dächern verhindern, dass sich die Gebäude zu sehr aufheizen. Betonierte Flächen wie Parkplätze oder Höfe sollten durch Pflastersteine mit Lücken entsiegelt werden. So werden sie wasserdurchlässig und die Feuchtigkeit des Bodens kann verdunsten und die Umgebung abkühlen.









Ein wasserdurchlässiger (Beton-)Boden hat den großen Vorteil, dass mehr Regen wasser nach Starkregen versickern kann. Dadurch läuft die Kanalisation weniger schnell voll und Hochwasser kann vermieden oder aufgehalten werden. Um auf Starkregen vorbereitet zu sein, ist es wichtig, dass nicht versickerndes Wasser in spezielle Speicher, Teiche, Mulden oder Auffangbecken geleitet wird. Das gesammelte Wasser kann dann langsam abgelassen werden, ohne die Kanäle zu verstopfen.

Eine zentrale Aufgabe des Klimaschutzes ist es, die von Menschen verursachte Erwärmung des Klimas zu stoppen. Folgen des Klimawandels wie zunehmende Hitze und Trockenheit, Starkregen, Stürme und Überschwemmungen sind bereits heute nicht nur weltweit, sondern auch in Sachsen in verschiedensten Bereichen erfahrbar: zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Wald, im Wasserhaushalt und in Städten und Gemeinden. Fachleute arbeiten intensiv an Anpassungsmöglich keiten, um auf ein Leben mit diesen Auswirkungen vorbereitet zu sein. Probleme und Schäden in diesen Bereichen sollen aufgehalten oder gemindert werden.



In diesem �� Video über den Klimawandel erfährst du, warum es wich tig ist, dass die Menschen sich überlegen, wie sie das Leben an die Folgen des Klimawandels anpassen können.
Wie soll die Zukunft für uns aussehen? Was meinst du, was die Menschen tun sollen, damit die Erde sich nicht weiter erwärmt? Wie werden alle mit den Folgen des Klimawandels leben?


Dies wird die Lerngruppe gemeinsam erarbeiten. Dafür werden alle Ideen und Fantasien gesammelt und darüber nachgedacht. Ihr arbeitet in einer
Das Ziel:


Wege und Mittel finden: So können sich die Menschen und die Natur an die Folgen des Klimawandels anpassen!
•
Jede Gruppe (6 Kinder) hat eine Expertin oder einen Experten aus den vorher bearbeiteten Bereichen: Wald, Wasser, Boden, Artenvielfalt, Landwirtschaft, Stadtplanung.
• Jedes Kind stellt den jeweiligen Bereich kurz vor. Nutzt die Aufzeichnungen oder das Lapbook.
•
Besprecht miteinander, wie ihr arbeiten wollt. Welche Wünsche habt ihr? Welche Regeln soll es geben? Wer übernimmt welche Aufgabe?


Dann dürft ihr schimpfen und motzen! Sammelt eure Beschwerden und Kritik:
• Wie ist es zu der Klimaerwärmung gekommen?
• Wer oder was hat die Klimaerwärmung verursacht?

• Welche Probleme gibt es durch die Klimaerwärmung?

• Welche Menschen leiden am meisten unter der Klimaerwärmung?
• Was passiert in der Natur durch die Klimaerwärmung?
Nun geht es um eure Träume und Fantasien! Ihr sollt Lösungen für eine gute Zukunft finden.
Alle Gruppenmitglieder nennen ihre Ideen und Fantasien zur Anpassung von Mensch und Natur an die Klimafolgen! Es gibt keine falschen oder unmöglichen Ideen!

• Wie können alle Menschen und die Natur von euren Lösungen profitieren?
•
Welche Maßnahmen, welche Erfindungen und welche Regeln sind nötig?


• Wie müssen der Mensch, die Natur und die Tiere sich ändern?
• Schreibt und / oder malt alle Ideen auf ein Poster! Verwendet auch ausgeschnittene Bilder und eure Texte!


Jetzt müsst ihr überlegen und entscheiden: Überprüft, welche Chance in welcher Idee steckt! Was kann wie verwirklicht werden?
• Jedes Gruppenmitglied bekommt grüne, rote und drei gelbe Klebepunkte. Damit bewertet ihr jede eurer Ideen der Anpassung von Natur und Mensch an die Folgen des Klimawandels.
Grüner Klebepunkt: Idee der Anpassung ist umsetzbar.
Roter Klebepunkt: Idee der Anpassung ist nicht umsetzbar. Gelber Klebepunkt: Idee der Anpassung ist uns besonders wichtig.

Achtung: Den gelben Klebepunkt könnt ihr nur dreimal vergeben!
• Notiert alle Ideen mit einem gelben Klebepunkt im Forschungsbuch!

• Diskutiert in der Gruppe, welche Forderungen ihr zur Verwirklichung eurer Idee aufstellen müsst. An wen würde sich die Aufforderung richten? Wer muss etwas tun bzw. verändern?
Entscheidungen und Forderungen formulieren: Präsentiert eure gesammelten und geprüften Ideen der gesamten Lerngruppe.
• Stellt die drei gelb markierten Ideen und eine weitere Idee (umsetzbar oder nicht umsetzbar) eurer Wahl vor!
• Tragt eure Forderungen an die jeweiligen Stellen oder Menschen vor!
Wenn alle Lerngruppen ihre Ideen vorgestellt haben, überlegt gemeinsam:
• Was können wir tun, damit unsere Ideen von den entsprechenden Menschen wahrgenommen werden?
• Wie können wir unsere Ideen an diese Menschengruppen herantragen?
• Wann wollen wir diese Aktionen tätigen?

• Wer und was kann uns dabei unterstützen?





Wie lange reichen unsere Energievorräte?
Coole Sache – die Energieträger
Erneuerbare Energien im Klassenzimmer
Elektrische Energie im Alltag

Wie viel Energie benötigen wir an einem Tag?
Energiebedarf in unserer Schule
Energie sparen bei der elektrischen Beleuchtung
Energie gewinnen ohne Treibhausgase – geht das?
Pumpspeicherkraftwerk
Power-to-Gas-Kraftwerk

Ein Pumpspeicherkraftwerk – selbst gebaut
Nachdenkfragen


Bestimmt hast du dich schon mit Fragen zur Energie beschäftigt. Über Energie wird häufig in den Familien diskutiert, man findet viele Berichte über Energiekosten in den Zeitungen. Vermutlich hast du auch im Unterricht schon einiges über Energie gehört.
Überlege gemeinsam mit drei anderen Mitschülern / Mitschülerinnen:
• Wo in eurer Umgebung (in der Schule, in der Wohnung, draußen usw.) gibt es elektrische Energie und Wärmeenergie?


• Welche Rohstoffe werden benötigt, um elektrische Energie und Wärmeenergie zu gewinnen?
• Bei welchem Umwandlungsprozess entsteht viel CO2?




Wo wird weniger CO2 freigesetzt?
Schlagt dann in dem eBook von Klasse 2 und in dem eBook Klasse 3 unter dem Inhalt „Energie“ nach. Nutzt auch die Forschungsbücher, wenn ihr damit gearbeitet habt.

Vergleicht, was euch in Erinnerung geblieben ist.
Ergänzt im Forschungsbuch, was ihr noch nicht berücksichtigt habt.





Die Rohstoffe, die für die Gewinnung von elektrischem Strom und zum Heizen genutzt werden, lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

Kohle, Erdgas und Erdöl sind aus den Ablagerun gen toter Pflanzen und Tiere entstanden. Das dau erte viele Millionen Jahre. Diese Energieträger sind nicht überall auf der Erde zu finden. Sie werden oft in Kraftwerken verbrannt, um elektrischen Strom zu gewinnen. Auch für Heizungen werden sie häufig als Brennstoff genutzt. Beim Verbren nen wird viel CO2 freigesetzt.
Der Vorrat an Kohle, Erdgas und Erdöl ist nicht unerschöpflich. Die fossilen Energieträ ger werden immer weniger. Die Kohlevorkommen auf der Erde werden noch ungefähr 200 Jahre reichen. Erdöl und Erdgas werden schon in 50 Jahren aufgebraucht sein.

Sonne, Wind und Wasser gibt es immer und überall auf der Erde. Um aus ihnen Ener gie zu gewinnen, muss nichts verbrannt werden. Damit entstehen also auch keine Abgase und kein CO2. Kleine Photovoltaik-Anlagen, Windräder und auch Warmwasserspeicher können auf Dächern der Wohnhäuser und in Hausgärten montiert werden. Auch Privatmenschen können so ihre Energie gewinnen.
Pflanzen wie Mais, Raps und Gras, die für das Betreiben von Biogasanlagen ge nutzt werden, können immer wieder neu nachwachsen. Auch Holz und Holzpellets zählen zu den erneuerbaren Energieträgern, da Bäume ebenfalls nachwachsen.
Bei ihrer Verbrennung entsteht zwar CO2, aber nur so viel, wie die Pflanzen zuvor eingelagert hatten.





Und wie verhält es sich mit der Atomenergie? Ist das eine „grüne“ Energie? Entstehen da CO₂-Gase? Ich glaube, der französische Präsident sagt, dass es eine gute Energie sei!




Bei der Erzeugung von elektrischem Strom in Atomkraft werken entstehen wie bei den erneuerbaren Energien nur wenig oder gar keine Abgase. Aber der Rohstoff Uran, den man dafür nutzt, wird nur noch ungefähr bis zum Jahr 2050 reichen. Er ist also genau wie die fossilen Energieträger nicht unerschöpflich.
Die Erzeugung von elektrischem Strom in Atomkraftwerken kann sehr gefährlich für die Menschen werden. Bei Unfällen, Materialschäden oder technischen Problemen im Kraftwerk kann radioaktive Strahlung aus dem Reaktor in die Umwelt gelangen. Auch der radioaktive Abfall, der entsteht, wenn das Kraftwerk normal und sicher funktioniert, strahlt und kann Menschen krank machen. Noch weiß man nicht, wo und wie dieser Abfall ge lagert werden soll. Fachleute fordern, dass radioaktiver Abfall über 1 Million Jahre sicher gelagert werden muss.
In diesem �� Film der Sendung mit der Maus kannst du erfahren, wie ein Atomkraftwerk funktioniert.








Und wie lange reichen die verschiedenen Energieträger für die Versorgung aller Menschen auf der Erde?
Die Frage von Ellist kannst du beantworten!
Sieh dir die nachfolgende Zeichnung genau an! Diskutiere mit deinem Nachbarn / deiner Nachbarin: Was fällt euch auf? Welche Zahlen überra schen euch? Welchen Energieträger würdet ihr am liebsten verwenden?




Man sollte auch fragen bzw. wissen, welches Kraftwerk die Mitwelt am meisten verschmutzt!
Das kannst du den folgenden Zeichnungen entnehmen. Bei der Erzeugung von elektrischem Strom in den verschiedenen

*

* Das Treibhausgas entsteht teilweise schon beim Bau des Kraftwerks, also bevor das Kraftwerk in Betrieb genommen wird.
* bei der Verbrennung ent steht CO2 , aber nur so viel, wie zuvor in den Pflanzen eingelagert war






Schau dir die Zeichnung genau an.
Diskutiere anschließend in einer Gruppe (vier Kinder) diese Fragen:


• Welche Vorteile haben fossile Energien?

• Welche Nachteile haben sie?
• Welche Vorteile haben erneuerbare Energien?
• Welche Nachteile haben sie?
• Warum sollen bis zum Jahr 2022 alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, obwohl mit ihnen doch elektrischer Strom ohne Abgase erzeugt werden kann?.
Mir ist jetzt klar geworden, auf welche Kraftwerke wir in naher Zukunft verzichten sollten!

Vielleicht hast du in der Schule Solaranlagen auf dem Dach des Gebäudes?
Immer mehr Schulen in Deutschland nutzen die Energie der Sonne, um die Klassenräume mit Licht und Wärme zu versorgen.
Hier kannst du erkunden, wie ein Solarmodul funktioniert und was es bewirken kann.
Diese Materialien brauchst du:
Solarmodul einen Motor mit Rotor




Lüsterklemme

Nutze einen schmalen Versandkarton als Gehäuse und Halterung für die kleinen elektrischen Bauteile. Damit lässt sich die Versuchsanordnung stabiler gestalten. Lege den Motor und das Solarmodul auf den Deckel eines Pappkartons und ritze kleine Schlitze / Löcher in den Karton, wo die Kabel vom Solarmodul und Motor liegen. Durch diese kleinen Öffnungen ziehst du nun die Kabel auf die Rückseite des Kartondeckels.



Du kannst den Karton durch eine dünne Holzplatte verstärken, dann ist die Konstruktion stabiler. Verbinde die elektrischen Kabel des Solarmoduls mit der Lüsterklemme, indem du die Kabel mit den kleinen Schrauben festklemmst. Verbinde ebenfalls die Kabel des Motors mit der anderen Seite der Lüsterklemme und klemme sie durch Festdrehen der kleinen Schrauben ein. Achte darauf, dass schwarzes Kabel mit schwarzem Kabel und rotes Kabel mit rotem Kabel gegenüberliegend verbunden ist!



Nun schließe den Deckel und beginne deine Versuchsreihe!



Halte die Box mit der Solarzelle in die Sonne und beobachte den Rotor. Wie bewegt er sich, wenn du
• die Solarzelle vollständig in den Schatten stellst?
• die Solarzelle nur halb in den Schatten stellst?


• die Solarzelle völlig anders zur Sonne ausrichtest?
Schreibe deine Ergebnisse in das Forschungsbuch. Halte fest, in welcher Position das Solarmodul am meisten Strom erzeugt!



Was passiert, wenn du die Kabel vertauschst, also das rote Kabel an das schwarze Kabel anschließt?

Schreibe deine Vermutung in das Forschungsbuch. Probiere es dann aus! Was kannst du beobachten? Notiere es im Forschungsbuch!
Wissenswert: Ein Jahr lang muss das Solarmodul in der Sonne sein. Dann hat man so viel Energie bekommen, wie für die Herstellung eines Solarmoduls benötigt wird.
Kinetische Platten: eine Energie - Überraschung
Frauen und Männer in der Wissenschaft und Technologieforschung knobeln und überlegen, wie man noch auf andere Art und Weise Energie gewinnen kann. Sie suchen nach neuen kreativen Lösungen. Hier kannst du etwas über eine neue Idee erfahren, wie wir alle elektrischen Strom erzeugen können ganz einfach beim Spazierengehen, Tanzen oder Fußballspielen!
So sehen die kinetischen Platten aus. Hier liegen sie in einem Supermarkt!


�� In diesem Video erfährst du, wie die kinetischen Platten funktionieren.

�� In diesem Film kannst du erkennen, wie Bewegung in elektrische Energie umgewandelt wird.
Diskutiere mit einem anderen Kind:


• Wo in eurer Umgebung würdet ihr die kinetischen Platten verlegen?
• Warum dort?


• Wofür würdet ihr den erzeugten Strom nutzen?

Wann benötigen wir elektrische Energie in unserem Alltag? Wie kann die benötigte Energiemenge gemessen werden? Das sind die Fragen, die im Folgenden geklärt werden sollen.
Du erinnerst dich: In unserem Alltag und in der Wohnung finden viele und unterschiedliche Energieumwandlungen statt. Einige davon kannst du nun ausführlich erforschen!
Untersuche den Betrieb der elektrischen Geräte in der Wohnung (am besten an einem Samstag oder Sonntag, da bist du nicht in der Schule):
• Welche Geräte werden in der Wohnung an einem Tag eingeschaltet?
• Wie lange werden diese Geräte benutzt?
• Welche Geräte werden regelmäßig genutzt, welche eher selten?
•
Welche Geräte sind sinnvoll, welche eher nicht?

Notiere alle deine Ergebnisse in der Tabelle im Forschungsbuch!


Wie viel Energie benötigen wir an einem Tag?
Wenn wir die elektrische Energie berechnen wollen, die ein Wasserkocher benötigt, um kaltes Wasser zum Kochen zu bringen, muss die elektrische Leistung des Wasserkochers bekannt sein.
Der Wasserkocher benötigt eine elektrische Leistung in bestimmter Höhe, um elektrische Energie (Strom) in thermische Energie (warmes Wasser) umzuwandeln.


Der abgebildete Wasserkocher benötigt eine elektrische Leistung von 1 800 W. Diese Leistungsangabe kann auf dem Typenschild abgelesen oder mit einem Leistungsmesser gemessen werden.

Welche Angaben kannst du vom Typenschild ablesen? Wie kann man wissen, wie viel elektrische Energie ein Wasserkocher benötigt, um das Wasser zum Kochen zu bringen?

Die Energiemenge ergibt sich aus der Leistung des Wasserkochers und der Zeitdauer, wie lange der Wasserkocher läuft. Wenn der abgebildete Wasserkocher mit einer Leistung von 1 800 W eine Stunde lang Wasser erhitzt, dann werden 1 800 Wattstunden (Wh), also 1 800 W x 1 Stunde elektrische Energie benötigt.
Die Energiemenge wird in der Einheit Kilowattstunde (kWh) angegeben und wird oft als „Stromverbrauch“ bezeichnet. k steht für Kilo, W steht für Watt
Watt ist die Maßeinheit für die Leistung von elektrischen Geräten. Sie wurde im Jahr 1889 festgelegt. Sie ist benannt nach dem schottischen Erfinder James Watt. h steht für Stunde (englisch „hour“ = Stunde)

Mit einer Kilowattstunde Energie kann man

• 1 x warm duschen.

10 Stunden fernsehen.
ein Blech Pizza backen.
zwei Tage den Kühlschrank laufen lassen.



Stewa hat natürlich recht. Es gibt einen Rechenweg, wie die Energiemengen berechnet werden können. Das gilt für alle Geräte, egal welche Leistung sie haben und wie lange sie in Betrieb sind.

Die Energie „Kilowattstunde“ habe ich verstanden. Aber ein Wasserkocher braucht doch nicht eine Stunde, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Das dauert höchstens 5 Minuten!

Im Forschungsbuch ist der Rechenweg erläutert. Damit kannst du die Energiemengen der Geräte in deinem Zuhause berechnen!
Die meisten Menschen wollen den Energiebedarf der einzelnen Geräte nicht berechnen. Darum kann man auch ein Energiemessgerät nutzen. Das kann man kaufen oder auch bei einem Energieversorger ausleihen. Wenn du dieses Gerät hast, kannst du die Energiemenge deiner Schreib tischlampe, eines Laptops oder des Wasserkochers messen.

Notiere diese Messergebnisse im Forschungsbuch!



Beachte dabei, dass du aufschreibst, wie lange das Gerät jeweils in Betrieb ist!S. 35

Bildet eine Lerngruppe mit vier Kindern. Tauscht euch über diese Fragen aus:


• Welche elektrischen Geräte haben den höchsten �� Energiebedarf?

• Welche Geräte nutzt ihr jeden Tag?
• Welche Geräte sind nur kurz an?




• Welche Unterschiede im Energiebedarf beobachtet ihr zwischen euch?
Auch in der Schule wird elektrische Energie benötigt.
• Verabredet euch mit der Hausmeisterin oder dem Hausmeister in der Schule.
• Lasst euch den Energiezähler (Stromzähler) zeigen.
• Erkundigt euch nach dem jährlichen Energiebedarf der Schule.

• Schreibt den Zählerstand des Energiezählers auf.
• Geht am nächsten Tag zur gleichen Zeit noch einmal zum Ablesen. Wie hoch ist der Energiebedarf an einem Tag?

Notiert die Ergebnisse im Forschungsbuch!
Ganz schön viel Energie, die genutzt wird! Kann man da auch was einsparen? Braucht man alle Geräte, die elektrische Energie benötigen?
Ellists Fragen sind sehr wichtig für die Zukunft unserer Erde. Du weißt ja, dass die fossilen Rohstoffe, die für Kraftwerke genutzt werden, nicht mehr lange reichen.
Die regenerativen Energien reichen (noch) nicht aus, um alle Menschen mit ausreichend elektrischer Energie zu versorgen. Aber es gibt Möglichkeiten, Energie einzusparen. Das kannst du nun erforschen!

Die Deckenbeleuchtung in den Zimmern, die Nachtlampe am Bett oder die Schreibtischlampe alle Lampen benötigen elektrische Energie, um zu leuchten. Wenn wir Ellists Überlegungen berücksichtigen, könnte man fragen:

• Gibt es unterschiedliche Leuchtmittel?


•
Gibt es Leuchtmittel, die hell leuchten und dennoch wenig Energie benötigen?
In der Lerngruppe erforscht ihr diese Fragen. Ihr braucht dazu unterschiedliche Leuchtmittel und ein oder mehrere Energiemessgeräte. Wechselt euch beim Ablesen der Werte ab!



•
Vergleiche die Leistung und die Energiemenge, die unterschiedliche Leuchtmittel in 10 Minuten benötigen! Nutze dafür unterschiedliche Leuchtmittel und das Energiemessgerät!

Dieser Versuch muss in Begleitung einer erwachsenen Person durchgeführt werden!
So gehst du vor: Schraube eines der Leuchtmittel (Glühlampe) in eine Lampenfassung ein. Stecke dann das Ener giemessgerät in eine Steckdose. Nun kannst du den Netzstecker der Lampe in das Energiemess gerät einführen.


Schalte die Tischlampe ein und lese die Energiemenge und Leistung von dem Mess gerät (nach 10 Minuten!) ab! Notiere die Zahlen in dein Forschungsbuch.

36



Schalte dann die Lampe aus, ziehe den Stecker der Lampe aus dem Energiemessgerät. Schraube ein anderes Leuchtmittel in die Fassung. Nun kannst du den Stecker der Lampe wieder in das Messgerät einführen.
Verfahre so mit allen weiteren Leuchtmitteln. Beobachte und schreibe in das Forschungsbuch:
•
Welches Leuchtmittel hatte die größte Energiemenge?

• Welches Leuchtmittel brauchte am wenigsten Energie?



• Wie unterscheiden sich die Leuchtmittel in der Helligkeit?

• Sortiere die Leuchtmittel nach ihrer Helligkeit!
Denk daran: Der Stecker muss immer aus der Steckdose entfernt sein, wenn du das Leucht mittel austauschen willst!
Wie hängen die elektrische Energie und das ausgesendete Licht der Leuchtmittel zusammen? In einer Lampe wird elektrische Energie in Strahlungsenergie umgewandelt, also in Licht und in Wärme. Wie viel Licht zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wird, wird mit dem Lichtstrom bezeichnet und in Lumen (lm) gemessen. Der Lichtstrom ist eine wichtige Kenngröße bei Leuchtmitteln. Je nach Leuchtmittel werden unterschiedliche Energiemengen benötigt, um den gleichen Lichtstrom zu erreichen. Eine Glühlampe benötigt fünfmal so viel Energie wie eine LED-Lampe oder eine Energiesparlampe, um den gleichen Lichtstrom zu erreichen. Letztere sind technisch so gebaut, dass nur wenig Strom fließen muss, damit Licht „emittiert“, also ausgestrahlt wird. Sie sind �� energieeffizient.
Eine Glühlampe dagegen wandelt fast die gesamte Energie in Wärme um. Nur etwa 5 % wird in Licht umgewandelt. Deshalb sind Glühlampen seit 2009 verboten und dürfen nicht mehr verkauft werden.



Einige Menschen nutzen aber immer noch Glühlampen. Das verbraucht nicht nur mehr Energie, sondern kostet auch Geld. Durch den Ersatz einer einzigen 60-WattGlühlampe durch eine LED-Leuchte kann man 16 Euro jährlich sparen. Im Vergleich zu einer 45-Watt-Halogenlampe sind es 11 Euro.
Okay, wir können und sollten also die Leuchtmittel nutzen, die wenig Energie benötigen. Kapiert! Das ist wichtig. Aber was bedeuten denn nur die Buchstaben: D, C, E, A und das komische A++?
Ein elektrisches Gerät wird anhand des Energiebedarfs und der Energieeffizienz in eine Energieklasse eingeteilt.

Die Energieeffizienzlabels informieren die Menschen, damit sie energiesparende Geräte erwer ben und die Umwelt schonen. Die Energieeffizienz wird durch die Klassen A (hohe Effizienz) bis G (niedrige Effizienz) gekennzeichnet.





Die Labels befinden sich an allen neuen Waschmaschinen, Fernsehern, Kühlschränken usw.

S. 37

Findet euch wieder in einer Lerngruppe zusammen. Erkundet die Energienutzung in der Schule:
• Wo werden welche Leuchtmittel eingesetzt?

• Welche Leuchtmittel können durch effizientere Leuchtmittel ersetzt werden?

• Welche elektrischen Geräte sollten durch neuere ausgetauscht werden?
•
Wie können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte noch Energie sparen?
Notiert die Ergebnisse im Forschungsbuch!


•

Schreibt eine Liste mit euren Verbesserungsvorschlägen.

Bringt die Liste zur Schulleitung und zur Hausmeisterin / zum Hausmeister mit der Bitte, die Leuchtmittel und elektrischen Geräte zeitnah zu ersetzen.

• Gestaltet Plakate. So sollen die Informationen zum Energiesparen für alle Kinder und Lehrkräfte der Schule deutlich werden.

• Hängt eure Plakate in die Flure und in die Klassenzimmer.
Alle Menschen benötigen Energie für ihre Wohnungen, für ein angenehmes Arbeiten in den Schulen, Geschäften und Büros. Auch Fabriken werden auch in Zukunft viel Energie für die Produktion von Autos, Kleidung, Möbel usw. brauchen.
Verbrennungskraftwerke, die elektrische Energie bereiten, und viele Heizungssysteme stoßen CO2-Emissionen, also Treibhausgase, aus.
Können wir in Zukunft nicht den elektrischen Strom durch regenerative Energien bereitstellen? Also mehr Windräder und Solaranlagen bauen?
Dabei entsteht doch kein CO₂!





Diskutiere mit einem anderen Kind:

• Sollten wir in Deutschland allen Energiebedarf durch regenerative Energieanlagen decken?
•

Überlegt euch, welche Nachteile die einzelnen Energieanlagen haben könnten.
• Wie könnten diese Mankos ausgeglichen werden?
• Wie könnte insgesamt der Energiebedarf gesenkt werden?
Haltet eure Ideen und Gedanken im Forschungsbuch fest!

Das ist eigentlich logisch: Je weniger Energie wir benötigen, desto weniger Energie müssen wir erzeugen. Und wenn wir weniger Energie erzeugen müssen, schafft man wohl die erforderliche Energiemenge aus regenerativen Energien.

Das leuchtet sofort ein. Aber es gibt nicht immer Wind und die Sonne scheint auch nicht immer. Vor allem im Winter nicht. Und nachts auch nicht. Kann ich dann abends im Bett nicht mehr lesen? Ich brauche da das elektrische Leselicht!
Denke an deine Familie und an euren Haushalt. Fallen dir Möglichkeiten ein, wie ihr euren Energiebedarf direkt senken könntet? Notiere drei Ideen.



afik zeigt, dass morgens zwischen Uhr sowie am Abend von Uhr der höchste Energiebedarf besteht. Die Sonne ermöglicht aber um die Mittagszeit in den Voltaikanlagen die größte Umwandlung der Sonnenenergie in elektrische Energie. Was geschieht mit dieser Energie?

Sonnenlicht und Wind können wir nicht speichern. Es kann vorkommen, dass die Energie nicht zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, zu der wir sie nutzen wollen. Hierfür brauchen wir Speicher, die die Energie „aufsammeln“. So können wir die Energie später nutzen.





Für die benötigten Energiemengen eines Hauses genügen große Batterien, die man z. B. im Keller oder im Wohnzimmer an die Wand montiert. Wenn die Photovoltaikanlagen auf dem Dach Strom produzieren, der gerade nicht genutzt wird, kann diese elektrische Energie in den Batterie speichern für einen späteren Gebrauch aufbewahrt werden.


S. 41


�� In diesem Video erfahrt ihr Spannendes über Batterien wie sie hergestellt und wiederverwendet werden können. Besonders interessant sind die Versuche, Batterien aus sehr merkwürdigen Materialien herzustellen!
Sieh dir diesen Film an. Beantworte im Forschungsbuch folgende Fragen:
•
In welchen Geräten im Haushalt befinden sich Batterien?
• Warum sollten Batterien recycelt (wiederverwendet) werden?
•

Warum sind die Rohstoffe für neue Batterien so wertvoll?
• Woran forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?





Dass für kleine Geräte, für Autos oder für die Wohnungsenergie Batterien gebaut werden können, kann ich mir vorstellen. Aber große Fabriken brauchen doch viel mehr Energie. Die müssten doch unendlich viele Batterien aufstellen. Und ich denke nicht, dass es für Fabriken genug Sonnen- oder Windenergie gibt, die umgewandelt und gespeichert werden kann!
Stewa hat mal wieder recht. Noch hat man keine Idee für große Speichermengen an elektrischer Energie. Doch es wird weiter daran geforscht. Es gibt aber durchaus Lösungen, die genug Energie speichern, ohne dass viele Treibhausgase durch Ver brennung freigesetzt werden.








Ein solches Kraftwerk benötigt vor allem Wasser. Mit überschüssiger Sonnen- und Windenergie, die in elektrische Energie umgewandelt wurde, wird Wasser mit Hilfe einer elektrischen Wasserpumpe von einem tiefergelegenen in ein höhergelegenes Speicherbecken befördert und dort „geparkt“. Soll mehr elektrische Energie erzeugt werden, öffnet man die Schleusen im Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks. Das Wasser fließt nun durch ein Rohr nach unten in die Turbine eines Schachtes. Dort treibt das Wasser die Turbine und damit den Generator an, der den Strom erzeugt.

Ich glaube, ich kenne solch ein Pumpspeicherkraftwerk.
Meine Tante wohnt in Zwickau. Und von da aus waren wir mal an solch einem See. Da ist so ein riesiger Staudamm ...





Ellist war offensichtlich in Markersbach. Dort ist das zweitgrößte Pumpspeicherkraftwerk Deutsch lands, 45 km von Zwickau entfernt. Auf dem Bild kannst du das höhergelegene Oberbecken sowie das tiefergelegene Unterbecken sehen. Der Damm um das Oberbecken ist der größte Staudamm Sachsens.

In Deutschland gibt es nur wenige Pumpspeicherkraftwerke. Es eignen sich wegen der landschaftlichen Bedingungen zu wenige Orte dafür. In anderen Ländern mit vielen Bergen und Hö henunterschieden (z. B. Österreich, Schweiz, Norwegen) können Pumpspeicherkraftwerke einfacher gebaut werden.


Deshalb kommen sie dort viel häufiger vor.

Power-to-Gas ist englisch und bedeutet so viel wie „Elektrische Energie zu Gas“. Es ist ein Kraftwerk, das Energie durch Gase speichert. Das klingt ein wenig merk würdig, ist aber eigentlich simpel. Es geht darum, dass ein bestimmtes Gas, nämlich Wasserstoff, erzeugt werden soll. Das geht so: Wenn man unter sicheren Bedingungen Strom durch Wasser fließen lässt, dann wird aus dem flüssigen Wasser gasförmiger Wasser stoff und gasförmiger Sauerstoff. Wenn die Kraftwerke Strom produzieren, der gerade nicht gebraucht wird, kann man hiermit Wasserstoff herstellen. Dieses Gas kann in Tanks aufbewahrt werden.



In einer Brennstoffzelle wird später der Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff wieder zu Wasser. Dabei entsteht elektrische Energie, die wieder genutzt werden kann.


Das Gas, das aus Wasser gemacht wird, wird wieder zu Wasser. Das Gas dient nur als Zwischenspeicher. Diese Speicherkraftwerke brauchen nicht viel Platz und sind unauffällig. Manchmal wird das Gas in großen Tanks unter der Erde aufbewahrt.

Achtung: Das dürft ihr niemals selbst ausprobieren! Nicht zu Hause, nicht in der Schule und nicht mit anderen Kindern! Das ist sehr gefährlich.






Du kannst mit einfachen Materialien selbst ein Pumpspeicherkraftwerk bauen. Am besten probierst du dein Kraftwerk im Garten oder in der Badewanne aus. Diese Materialien brauchst du:
1 Plastikwanne

1 Eimer mit Auslass

1 Handpumpe z. B. mit Kurbel
Wasserrad, Korken, 2 Nägel, Plastikbecher


Wie du weißt, treibt in Zeiten überschüssiger elektrischer Energie diese Energie eine Pumpe an und pumpt das Wasser in einen höhergelegenen Speicher. Du pumpst mit Hilfe deiner Handkurbel das Wasser in den oberen Eimer. Der Auslass deines Eimers muss verschlossen sein. So kann das Wasser im oberen Speicher gesammelt werden. Wenn nun elektrische Energie gebraucht wird und wir einen Generator laufen lassen wollen, um die Energie zu erzeugen, müssen wir das Wasser aus dem Eimer nutzen, um den Generator anzutreiben. Öffne den Auslass des Eimers und sieh zu, wie der Generator (das Wasserrad) sich dreht! Nun haben wir durch das Wasser eine Bewegungsenergie. Würden wir hinter das Wasserrad einen Dynamo schalten, so könnten wir elektrische Energie erzeugen.
Erkläre dem Tischnachbarn / der Tischnachbarin die folgende Skizze eines Pumpspeicherkraftwerkes!






Der Energiebedarf einer Familie soll aus regenerativen Energien gedeckt werden. Es soll keinen CO2-Ausstoß geben: nicht durch elektrische Energie und die Heizung und ebenso nicht durch die Mobilität der Familienmitglieder. Was braucht dein Haus der Zukunft, um ganz ohne CO2-Ausstoß zu sein? Zeichne innerhalb und außerhalb des Hauses deine CO2-freie Stromversorgung, dein CO2-freies Heizungssystem und deine CO2-freie Mobilität ein!
Du findest das Haus in deinem Forschungsbuch.

Zeichne dort deine Energiemaßnahmen hinein.



Menschen benötigen Energie, um ein gutes und zufriedenes Leben führen zu können. Das Bereitstellen von Energie hat Konsequenzen: für die Menschen, die Tiere und die gesamte Erde. Es gibt Fragen, die nicht leicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind. Wir müssen darüber nachdenken und können zu unterschiedlichen Einstel lungen kommen. Dabei lernen wir auch von den Auffassungen anderer Menschen.
Denke allein oder mit anderen Kindern über die folgenden Fragen nach:

• Stell dir vor: In einem Dorf sollen Windräder aufgestellt werden. So will man das Klima schützen. Aber bestimmte Vögel haben dann keinen Lebensraum mehr. Ist es wichtiger, das Klima zu schützen oder die Vögel?
• Denk über folgenden Satz nach: „Vergeude keine Energie – verwerte sie!“
Kann dieses Denken die Klimakrise verhindern?
• Das Installieren von regenerativen Energien ist (noch) sehr teuer. Darf man den Einbau für alle Menschen zur Pflicht machen, auch für arme Menschen?

Was macht das Reisen mit dem Klima?
Urlaubsreisen verändern die Natur
Gehört der Tourismus zu einem guten Leben?
Wer gewinnt beim Wettreisen?



Reiseverzicht oder anders reisen?

Eine Klassenreise


Ich verreise sehr gern.
Geht es dir auch so?
Leider bin ich noch nicht oft verreist. Aber ich stelle mir vor, wie ich mit einem Schiff zu einer Insel fahre. Ich rieche das erste Mal die fremde Luft, sehe das Treiben an dem Anleger ... Jedenfalls sieht das auf den Reiseprospekten immer so fantastisch aus, dass ich große Lust auf das Reisen bekomme.
Sieh dir die Reiseangebote genau an.
•Welche Reise würdest du am liebsten machen? Warum?










•Welche Reise würdest du am wenigsten gern machen? Warum?






Arbeite mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen:


• Sucht die Reiseziele auf einem Globus oder in einem Atlas.
• Kennzeichnet dann diese Ziele in dem Atlas oder auf dem Globus mit Hilfe eines Klebepunktes.

• Was ist das Besondere an den Reisen? Notiert im Forschungsbuch, was bei der jeweiligen Reise hervorgehoben wird.
• Überlegt euch, welche Personen welche Reise unternehmen würden. Welche Gefühle oder Erlebnisse wären bei ihnen ausschlaggebend? (Abenteuer, Ruhe, Fremdheit, Naturerlebnisse, Sport usw.)

• Könnten alle Menschen jede dieser Reisen machen? Begründe!

„Reisen ist für die Menschen wichtig. Man lernt andere Kulturen kennen, entdeckt einsame Landschaften und begegnet unterwegs interessanten Menschen. Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, dass Reisen nicht nur glücklich, sondern auch schlau macht. Reisen hat deshalb viel mit Gerechtigkeit zu tun!“
• Hat Reisen mit Gerechtigkeit zu tun? Warum reisen nicht alle Menschen?
• Überlegt gemeinsam, was gerechte Reisen sind und wie sie gestaltet sein sollten.



Die verschiedenen Verkehrsmittel haben einen unterschiedlichen Energiebedarf und stoßen unterschiedliche Mengen an CO2 aus. Wenn man eine Reise plant, ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen.
Sucht aus den Urlaubsangeboten die Reise aus, die ihr am liebsten unternehmen wollt.
Notiert im Forschungsbuch:




• Mit welchem Verkehrsmittel erreichst du den Urlaubsort?
• Wie lange dauert der Urlaub?
• Welche Verkehrsmittel nutzt du am Urlaubsort?
Ermittelt den CO₂-Ausstoß des Hin- und Rückweges zu deinem Urlaubsort!
• Nutze Google Maps und ermittle die Strecke in km von deinem Wohnort zu dem Urlaubsort.
• Berechne nun, wie viel CO2 deine Reise auf dem Hin- und Rückweg verursacht. Die Daten für die Emissionen der einzelnen Fahrzeuge findest du im Forschungsbuch.
Interessante Reiseziele locken viele Menschen an, die hier ihren Urlaub verbringen wollen. Meistens müssen für die Urlauber Unterkünfte gebaut werden, das heißt, die Natur im Urlaubsort wird verändert. Urlauber nutzen Energie, sorgen für Müll und brauchen viel Wasser.


Schau dir das folgende Bild an. Überlege und schreibe deine Gedanken ins Forschungsbuch:



• Wie wurde die Natur verändert?
• Welche Probleme kann es durch viele Touris ten geben?
• Welche Ideen hast du, um diese Probleme zu verhindern?



Die folgenden Fotos zeigen dir Orte und Gegenden in Gebirgen, in denen Menschen gern Sport treiben. Damit sie das können, müssen die Anwohner und Anwohnerinnen dafür sorgen, dass die Bedingungen stimmen. Häufig leben die Mensc hen in diesen Gebieten davon, dass die �� Touristen kommen. In Obertauern (Österreich) kamen im Winter 2018 auf jeden Einheimischen 1 300 Gäste. Beschreibe, was dir auf den Bildern auffällt!

• Hast du eine Idee, wie der Schnee entstanden ist und verteilt wurde?

• Was wurde in der Natur verändert?
• Welche Folgen hat die Veränderung der Bergregion für die Natur?
• Was könnte man ändern, um Natur und Klima zu schonen?
Diskutiere mit einem anderen Kind. Notiere die Ergebnisse im Forschungsbuch.
Ein älteres Wort für Tourismus ist Fremdenverkehr. Es besagt, dass Menschen in den Urlaub fahren. Sie verbringen ihre freie Zeit in anderen, fernen Orten.
Die dort lebenden Menschen sorgen für die Touristen und Touristinnen. Wenn man den Tourismus auf der ganzen Erde einbezieht, spricht man von einem globalen Tourismus.
Schau dir zusammen mit einem anderen Kind das Säulendiagramm an.
•
Welche Informationen kannst du dem Diagramm entnehmen? (Mio = Millionen; Bio = Billionen)


• Welche Gründe fallen dir für die Entwicklung des Tourismus in den Jahren 1960 bis 2020 ein? Diskutiere mit einem anderen Kind.
• den Touristen, die verreisen können?
• den Menschen, die in den touristischen Zielorten leben?
• den anderen Lebewesen in diesen Zielorten?
• der Natur bzw. Umwelt in diesen Zielorten?
Schreibe ein Fazit in dein Forschungsbuch: Kann der Tourismus für ein gutes Leben sorgen?

• für die Touristen, die verreisen können?
• für die Menschen, die in den touristischen Zielorten ihren Wohnort haben?
• für die anderen Lebewesen in diesen Zielorten?




• für die Natur bzw. Umwelt in diesen Zielorten?
Schreibe ein Fazit: Kann der Tourismus ein gutes Leben verhindern?
Finde eine Antwort auf die Frage: Ist der Tourismus gut oder schlecht?






Leonie ist ist aus dem Urlaub an der Ostsee zurück. Sie schaut sich ihre vielen Urlaubsfotos und die am Strand gesammelten Schätze an. „Das war ein toller Urlaub“, denkt sie sich. Das Wetter war großartig. Ihre Familie hat gezeltet; das fühlte sich abenteuerlich an. Sie hat Kinder aus Polen kennengelernt und sie sind Freunde ge worden. In der Schule trifft sich Leonie mit ihrer Freundin Amalia und sie reden über ihre Ferien. Leonie will ihrer Freundin alles über ihren schönen Urlaub an der Ostsee erzählen. Aber sie kommt nicht dazu. Amalia war auch im Urlaub. Sie erzählt von einer Kreuzfahrt im Mittelmeer, die sie mit den Eltern gemacht hat. Das war vielleicht aufregend! Auf dem Kreuzfahrtschiff konnte sie viele Dinge unternehmen es gab jeden Tag unterschiedliche Spiele für Kinder und sie konnte in einem Swimmingpool mit Rutsche schwimmen. Auf dem Schiff! In vier verschiedenen Häfen haben sie angelegt. Amalia kann sich gar nicht mehr richtig erinnern, welche das waren. Venedig war jedenfalls dabei. Da waren viele Menschen unterwegs. Leonie ist auf einmal unzufrieden. Plötzlich findet sie ihren Urlaub an der Ostsee gar nicht mehr so toll. Eigentlich würde sie auch lieber so eine großartige Kreuzfahrt machen! Vielleicht nächstes Jahr! Das wird sie ihren Eltern vorschlagen. Leonie bringt eines Tages einen Prospekt mit nach Hause, den sie auf dem Rückweg von der Schule im Supermarkt entdeckt hat, und sie zeigt ihn ihren Eltern. Die sind begeistert so eine Kreuzfahrt ist ja gar nicht mal so teuer. Eine Kollegin ihrer Mutter hatte auch eine Kreuzfahrt gemacht. Deshalb hegt Leonies Mutter schon den gleichen Gedanken wie ihre Tochter. Also beschließen alle ge meinsam: Für den nächsten Sommer wird eine Kreuzfahrt gebucht!







Ein Jahr später: Leonie macht in den Sommerferien mit ihren Eltern eine Kreuzfahrt im Mittelmeer.
Leonie fragt sich, ob es alles genau so sein wird, wie es ihre Freundin beschrieben hat. In den Prospekten sieht alles überwältigend aus. Leonie wird nicht enttäuscht. Es ist faszinierend, was man auf dem Kreuzfahrtschiff alles machen kann. Aber nervig sind die vielen Menschen in den Städten, die sie besuchen. In Venedig ist es besonders schlimm. Da kommt man sogar zu Fuß nicht weiter. Am Ende der Sommerferien treffen sich Leonie und ihre Freundin Amalia wieder. Leonie will freudig mit Amalia über die Kreuzfahrterlebnisse sprechen.
Doch Amalia winkt ab. Sie war in diesem Sommer mit ihren Eltern auf den Malediven. Das war ein Abenteuer! Das Land liegt im Indischen Ozean.

Es setzt sich zusammen aus über eintausend Inseln. Amalia hat tauchen gelernt; sie hat so viele bunte Fische und Korallen gesehen, wie man sie sonst nur im Trickfilm sieht das war einfach genial. Sie zeigt Fotos von ihrer Unterkunft: wow, sie wohnten wirklich an einem paradiesischen Ort! Als Leonie die Berichte von ihrer Freundin hört, ist sie gar nicht mehr so begeistert von ihrem Urlaub mit der Kreuzfahrt. „Wir waren gar nicht so weit weg, nur in Europa. Das ist eigentlich langweilig und überhaupt nicht exotisch“, sagt sie nun. Sie würde auch gern mit den Eltern im nächsten Urlaub ganz weit wegfliegen, auf einer Paradiesinsel wohnen, außergewöhnliche Fotos machen und tauchen gehen.

Lies die Geschichte sorgfältig durch. Bilde eine Lerngruppe mit vier Kindern. Erzählt euch den Inhalt der Geschichte.
• Diskutiert: Warum hat die Geschichte den Titel „Wettreisen“?


• Warum will Leonie auch die Reisen von Amalia machen?



• Wer gewinnt oder verliert bei diesem Wettreisen? Hat das etwas mit Gerechtig keit zu tun?

• Erzählt euch gegenseitig, wie in euren Familien ein Urlaub geplant wird. Teilt euch mit, was für jeden Einzelnen das Wichtigste an dem Urlaub ist!
• Findet gemeinsam zwei Schlussteile für diese Geschichte. Ein Ende soll gut ausgehen, der andere Schluss soll kein gutes Ende haben.

•

In dem eBook Klima.Leben Klasse 2 ist die Geschichte von den vier Fischern erzählt. Wenn du sie nicht (mehr) kennst, dann lese die Geschichte noch einmal nach. Die Fischergeschichte ähnelt der Geschichte des Wettreisens. Zwar wird in der einen Geschichte das Fischen thematisiert und in der anderen das Reisen. Aber es gibt Gemeinsamkeiten. Entdeckst du diese?




Menschen wollen verreisen, andere Städte, Länder und Kulturen kennenlernen. Man spricht von einem Massentourismus, da immer mehr Menschen ihre freie Zeit nutzen, um – häufig nur für wenige Tage – an fremde Orte zu fahren oder zu fliegen. Der Massentourismus hinterlässt seine Spuren in diesen Urlaubsgebieten.
Bildet eine Lerngruppe mit vier Kindern. Jedes Kind vertritt einen Urlaubsort, der in den Berichten beschrieben ist: Venedig, Provence, Malediven und Mallorca.
Beantworte für den jeweiligen Ort folgende Fragen:
• Was hat dich in dem Artikel über deinen Urlaubsort beeindruckt?



• Welche Probleme erkennst du in dem Artikel über deinen Urlaubsort?
• Welche Fragen sind für dich offengeblieben?

• Welche Dilemmata oder Zwickmühlen stellst du fest?
Notiere deine Ideen im Forschungsbuch.
Stellt euch anschließend die Urlaubsorte und die gefundenen Ant worten gegenseitig vor. Findet heraus, welche ähnlichen Probleme an allen Urlaubsorten vorherrschen.





Die Stadt Venedig im Nordosten von Italien lebt vom Tourismus. In den letzten Jahren ist die Anzahl an Touristen so stark angestiegen, dass sich Ortsansässige beschweren und der Tourismus die Existenz der Stadt gefährdet. Jährlich kommen ungefähr 30 Millionen Menschen nach Venedig. Die Stadt selbst hat nur 260 000 Einwohner. Venedig besteht aus über 100 Inseln und fast 400 Brücken. Mehr als die Hälfte der Stadt besteht aus Wasserflächen.
Da der Meeresspiegel aufgrund des Klimawandels ansteigt, gibt es zunehmend Überschwemmungen im Stadtgebiet.
Die Stadtverwaltung muss viel Geld ausgeben, um die vielen historischen Gebäude zu schützen. Tourismus ist deshalb eine wichtige Geldeinnahmequelle. Die vielen Kreuz fahrtschiffe stellen aber auch ein Problem dar. Die riesigen Schiffe zerstören die Kulisse der Stadt. Sie bringen meistens nur für einen Tag tausende Menschen in die Stadt, jeden Tag. Die Schiffe und die Touristen und Touristinnen verursachen Abgase und viel Müll. Die Schiffe haben durch den großen Wellenschlag die Kanäle und Häuser von Venedig zerstört.



Die Malediven sind ein Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka. Der Staat besteht aus 1 196 Inseln, von denen 220 von Einheimischen bewohnt werden. Weitere 144 Inseln werden nur für touristische Zwecke genutzt. Die Inseln liegen alle rund 1 Meter über dem Meeresspiegel. Der höchste „Berg“ ist 2,4 Meter hoch und befindet sich auf der Insel Villingili. Da der Klimawandel und das Schmelzen der Gletscher und Eiskappen allmählich den Meeresspiegel erhöhen, sind alle Inseln sehr gefährdet. An den Korallenbänken kann man die Folgen des Klimawandels schon jetzt erkennen. Der Klimawandel führt zu einem Anstieg der Wassertemperaturen und zu immer stärkeren Stürmen. Dies schädigt die kleinen und empfindlichen Korallen und führt zum Korallensterben. Touristen und Touristinnen erleben deshalb immer weniger bunte Korallen.
Es gibt Projekte, die das Korallensterben verhindern wollen. Einige Reiseunternehmen bieten Urlaubern einen „Öko-Tourismus“ an, bei dem Feriengäste während ihres Urlaubs mithelfen können, die Korallen zu retten.



Spiegel – Offline

Touristen erobern die Lavendelfelder in Frankreich
„Nachdem eine Fernsehsendung in Norwegen Szenen von Lavendelfeldern in der französischen Provence zeigte, strömten tausende norwegische Touristen und Touristinnen in die Gegend. Einige lokale Einwohner sehen dies als wirtschaftliche Chance, aber andere erleben den norwegischen Tourismus als unerwünscht und nicht nachhaltig.“




Einheimische auf Mallorca wollen keine Touristen und Touristinnen mehr!

Die wunderschöne spanische Insel Mallorca gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen und hat jedes Jahr mit einer regelrechten Touristenflut zu kämpfen. 13 Millionen Menschen reisen jährlich nach Mallorca, davon kommen rund 40 % allein aus Deutschland. Große Hotelbauten mit regulärer Rundum-Verpflegung, Shoppingzentren und Massen an Müll, die durch den Tourismus produziert werden, machen der Insel schwer zu schaffen. Zu den größen Herausforderungen des Tourismus auf Mallorca zählt jedoch der sogenannte Partytourismus. Die Region rund um den Ballermann an der Platja de Palma ärgert die Einheimischen enorm. Die lauten Partys bringen die Insel in Verruf. Die Einheimischen wollen, dass in Zukunft weniger Menschen nach Mallorca kommen dürfen. „Mallorca gehört uns“ so das Zitat eines Einheimischen. Andere wiederum betonen, dass Mallorca die Touristen und Touris tinnen braucht, weil sie nur so ihren Lebensunterhalt verdienen können.
Der Massentourismus hat in vielen Regionen der Welt negative Folgen für die dort lebenden Menschen, die Natur und das Klima. Müssen die Menschen deshalb auf das Reisen verzichten? Vielleicht geht dann ein wichtiger Aspekt unseres Lebens verloren. Nicht nur die Erholung, sondern auch die Offenheit dem Fremden gegenüber würde leiden. Forscher und Forscherinnen haben festgestellt, dass die Interak tion mit fremden Kulturen nicht nur beeinflusst, was wir denken, sondern auch, wie wir denken. Was können wir tun?



Wenn wir nicht auf das Reisen verzichten wollen, müssen wir die negativen Wirkun gen korrigieren.
Das heißt, es müssen die Folgen für die Natur beachtet werden. Auch die Interessen der Einheimischen sollen mit denen der Touristen in Einklang gebracht werden. Das wäre dann ein „sanfter Tourismus“.
Bildet eine Arbeitsgruppe mit vier Kindern. Überlegt euch, wie ein sanfter Tourismus aus sehen sollte:
•
Welche Regeln sollte es geben?
• Wer stellt diese Regeln auf?


• Was darf in der Natur verändert werden, was nicht?
•

Sollten alle Menschen jederzeit an alle Orte reisen dürfen?
• Welche „sanften“ Reisen würdet ihr vorschlagen?
Stellt euch vor, ihr seid Mitarbeitende eines Reisebüros für „sanften Tourismus“. Eure Aufgabe ist es, Menschen für diese Art Reisen zu gewinnen. Entwickelt entweder
• einen Prospekt, in dem ihr diese Reise anbietet, oder
• eine Reklame für die Reise, die im Radio ausgesendet wird (Podcast), oder

• einen Werbespot, den ihr mit Hilfe einer Kamera (Tablet, Fotokamera oder Handy) filmt.
Denkt bei dem Podcast und dem Werbefilm daran, vorher die Texte zu schreiben und sie vor der Aufnahme einzuüben! Besorgt einige Reiseutensilien, um den Wer bespot interessant gestalten zu können.



Sind Menschen gezwungen, ständig und immer mehr zu konsumieren? Oder können sie mit dem „Um die Wette konsumieren“ aufhören?


Mit diesen Fragen beschäftigte sich Elinor Ostrom (1933 - 2012), eine Politikwissenschaftlerin aus den USA. Sie interessierte sich dafür, wie Men schen zusammenleben und wie sie sich verhalten, wenn sie Ressourcen wie Wasser, Wälder, Weiden oder Fischereien gemeinsam nutzen müssen. Streiten sich Menschen um die Ressourcen und sind sie neidisch aufeinander?


Will jeder die Ressourcen für sich haben? Oder können sie sich einigen und dafür sorgen, dass es gerecht zugeht, sodass sie die Ressourcen lange erhalten können?
Frau Ostrom schaute sich viele verschiedene Gemeinschaften überall auf der Welt an, um diese Fragen zu beantworten. Sie hat herausgefunden, dass manche Gruppen von Menschen nicht gut zusammenarbeiten können jeder will einfach so viel wie möglich haben, und es gibt einen Wettkampf. Wer am meisten hat, gewinnt, und je mehr man hat, desto besser. Sie hat entdeckt, dass Menschen überall auf der Welt sich sehr für Gerechtigkeit interessieren. Erleben Menschen, dass andere mehr besitzen als sie selbst, wollen sie auch mehr bekommen. Verhalten sich einige Menschen gegen Regeln, was nicht bestraft wird, sind sie frustriert und fangen selbst an, die Regeln zu brechen. Solche Gemeinschaften bleiben nicht lange bestehen es gibt zu viel Streit und Konflikte. Die Ressourcen sind schnell aufgebraucht und die Menschen müssen umziehen. Andererseits hat Frau Ostrom ermittelt, dass andere Menschengruppen durchaus gut zusammenarbeiten können. Sie stellen gemeinsam Regeln auf und achten darauf, dass niemand die Regeln bricht. Jemand, der sich nicht an die Regeln hält, wird gerecht dafür bestraft.



Diese Gruppen sorgen dafür, dass Konflikte schnell gelöst werden, so dass keine Frustrationen entstehen. Diese Menschen wissen, dass Ressourcen nicht übernutzt werden dürfen. Sie arbeiten gut zusammen und sorgen dafür, dass die Ressourcen gerecht aufgeteilt werden.



Ihre Forschungen hat Frau Ostrom weltweit angestellt, wie zum Beispiel in der Schweiz, in Japan, in Spanien und auf den Philippinen. 2009 wurde Elinor Ostrom für ihre Arbeit mit dem �� Nobelpreis für Wirtschafts wissenschaften ausgezeichnet. Die Jury war sich einig: Wenn es um nachhaltige Entwicklung und den Klimawandel geht, dann geht es auch darum, dass alle Menschen gut zusammenleben. Sie müssen sich einig sein, wie sie vorhandene Ressourcen, saubere Luft, Wälder, Bodenschätze und anderes mehr nutzen wollen, damit sie lange erhalten bleiben und es allen Menschen auch in der Zukunft gut geht. Wir können also viel von den Gemeinschaften der Welt lernen, die Elinor Ostrom besucht und erforscht hat.
Youlaf, Stewa, Mo und Ellist werden in ein paar Wochen gemeinsam mit ihrer Klasse eine Klassenfahrt unternehmen. Sie sind schon ganz aufgeregt. Mo möchte ihren Forschungskoffer und ihre tragbare Messstation mit Lupe und anderen Messinstrumenten mitnehmen, um Daten zu sammeln. Ellist überlegt, welche Turnschuhe für die Unternehmungen am besten wären und ob er seinen neuen Upcycling-Pullover mit Multifunktionsausrüstung mitnehmen soll. Stewa kann es kaum erwarten, die neuen Reifen vom Rolli zu testen. Damit ist sie noch schnel ler unterwegs. Zudem überlegt sie, ob sie ihr Teleskop mitnehmen darf.


Ich freue mich riesig auf unsere Klassenfahrt.
Wo fahren wir denn hin? Habt ihr eine Idee?


Eins ist schon mal klar: Die Reise muss so verlaufen, dass wir ein gutes Gefühl haben. Ich meine, wegen Klima und der Umwelt und so …





Na klar. Wir haben ge nug darüber gelernt. Mit dem Flugzeug werden wir keine Klassenreise machen.

Ja, aber es geht ja auch darum, dass wir Natur erleben - ich will ja Neues erforschen, aber nicht zerstören. Und wir sollten auch beachten, dass alle Kinder aus der Klasse mitkommen können.


Einige Eltern haben nicht so viel Geld.





1. Jedes Kind schreibt seine Ideen zur Klassenreise in Stichworten auf Karteikarten. Alles, was zu einer Klassenreise gehört, ist wichtig. Denke an: Wohin soll es gehen? Was wollen wir dort tun? Wie kommen wir dort hin? Wo und wie wollen wir schlafen? Wer bereitet die Mahlzeiten zu?
2. Sortiert die Ideen gemeinsam in der Lerngruppe nach übergeordneten Begriffen.


3. Gestaltet eine Mindmap mit den Oberbegriffen und füllt die Verzweigungen mit den zugehörigen Ideen (Erläuterungen und Differenzierungen) aus.
4. Jedes Kind bekommt nun für jeden Oberbegriff einen Klebepunkt. Das Mittel oder Ziel mit den meisten Punkten ist dann demokratisch als gemeinsames Ziel bestimmt. Bei einigen Oberbegriffen können mehrere Möglichkeiten in Frage kommen. Hierfür gibt es dann bis zu drei Klebepunkte pro Kind.
5. Überprüfung: Erstellt eine Mindmap mit den Ergebnissen aus der obigen Abstimmung. Überprüft nun noch einmal gemeinsam, ob alle Kriterien einer klima- und umweltfreundlichen Klassenreise erfüllt sind.

6. Stellt eure klimafreundliche Wunsch-Klassenreise den Eltern im Rahmen eines Elternsprechtages vor. Nutzt die Mindmap und begründet eure Wahl in den wichtigsten Bereichen wie Transport, Ziel usw.


Nachdenkfragen sind solche, bei denen es nicht schnell eine richtige Antwort gibt. Auch beim Reisen und Tourismus gibt es Problemfelder, die in Dilemmata münden: Es gibt kein klares Richtig oder Falsch!
Du kannst allein, mit anderen Kindern und deinen Eltern über folgende Fragen und Aussagen diskutieren:

• Ich möchte nicht darauf verzichten, die Welt zu sehen, nur weil Flugzeuge schlecht für das Klima sind.
• Stell dir vor, du könntest ohne schlechtes Gewissen eine Reise unternehmen, die dir einen allergrößten Wunsch erfüllt. Was erhoffst du dir von dieser Reise?
• Fragen sind der eigentliche Zweck einer Reise. Wer keine Fragen im Gepäck hat, braucht sich nicht auf den Weg machen. Wer nur fertige Antworten hat, bleibt lieber daheim.

• Ist ein Film über ein fremdes Land dasselbe, wie in dieses Land zu reisen?

Was hat Fleischessen mit dem Klima zu tun?

Fleisch, Mitwelt und ein gutes Leben
Stewa: Energieverschwendung

Mo: Kühe sind klimaschädlich
Youlaf: Tiere und ein gutes Leben

Ellist: Fleisch und Konsum

Tierisch gut leben ohne Fleisch?
Klimagerecht essen – geht das?
Welche Ideen haben Menschen zu einer klimafreundlichen Ernährung?
Philosophische Fragen zum Essen







Seit vielen tausend Jahren gehört Fleisch zur Ernährungsweise von Menschen. Fleisch wird in vielen Kulturen an besonderen Festtagen gegessen der Sonntags braten und die Weihnachtsgans in Deutschland, der Truthahn zu �� Thanksgiving in den USA und das Schlachten eines Rindes bei Hochzeiten und Beerdigungen in Madagaskar.
In anderen Ländern, Kulturen und Religionen ist Fleisch ein Tabu. Kühe sind im Hinduismus heilig und dürfen in Indien, Nepal und Bali nicht gegessen werden, während Muslime und Juden wegen ihres Glaubens kein Schweinefleisch essen.

Denk über die folgenden Fragen nach und tausche dich dann mit einem anderen Kind aus!
• Gibt es in deiner Familie Traditionen bei den Fleischgerichten, die an bestimm ten Feiertagen gegessen werden?
• Wann und zu welchen Anlässen steht Fleisch oder Fisch bei euch auf dem Speiseplan? Wann gibt es kein Fleisch oder keine Wurst?

• Gibt es eine andere Tradition bei dir in der Familie? Denk dabei auch an vegetarisches oder veganes Essen!
Tipp: In �� diesem Beitrag kannst du noch mehr über die verschie denen Essvorschriften von verschiedenen Religionen lesen.
Fleisch essen zu können ist für die Menschen auf der ganzen Welt zunehmend wichtig geworden. Fleisch nennt man die weichen Teile des Tierkörpers. Auch Organe wie Herz oder Leber gehören dazu. In den letzten sechzig Jahren ist der Ver brauch von Fleisch in der Welt stark angestiegen.
Schau dir folgendes Diagramm an:





Tragt eure Ergebnisse in das Forschungsbuch ein.
• Woran liegt es, dass die Menschen immer mehr Fleisch essen?
• Welches Fleisch wird am meisten gegessen? Warum dieses Fleisch?

• Was fällt euch noch auf?
In Deutschland hat 2020 im Schnitt jeder Mensch 60 Kilogramm Fleisch gegessen. So viel wiegt ungefähr ein halbes ausgewachsenes Schwein. Wenn eine Familie vier Personen umfasst, wären das zwei ganze Schweine im Jahr.
Im Jahr 2020 wurde im Vergleich zum Vorjahr von jeder Person 750 Gramm weniger Fleisch verzehrt. Während die Menschen 940 Gramm weniger Schweinefleisch und 40 Gramm weniger Rind- und Kalbfleisch aßen, stieg der Verzehr von Geflügelfleisch um 180 Gramm an.
Jeder Mensch in Deutschland isst dazu in einem Jahr 240 Eier und 86 kg Milchpro dukte (Milch, Käse, Joghurt, Butter, Quark etc.).


Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte. In deiner Familie werden eventuell nicht so viel oder mehr Fleisch und Milchprodukte gegessen.
Deine Aufgabe:




Finde heraus, wie viel kg Fleisch und Milchprodukte deine Familie in einem Jahr verbraucht! Frage deine Eltern, wie viele Produkte sie durchschnittlich in einer Woche einkaufen. Schreibe dies in die Tabelle im Forschungsbuch. Überlege, ob es Zeiten gibt, in denen mehr Fleisch und Geflügel gegessen werden (Grillsaison, Feiertage) und ergänze dies in der Tabelle. Dann kannst du einen Wocheneinkauf mit der Anzahl der Wochen im Jahr multiplizieren, in denen eingekauft wird. So erhältst du einen durchschnittlichen Wert. In Deutschland wird gegenwärtig etwas weniger Fleisch gegessen. Damit tun die Menschen nicht nur den Tieren etwas Gutes, sondern auch dem Klima. Denn die Haltung und Fütterung von Rindern, Schweinen und Hühnern verbraucht am allermeisten CO2. Auch ist es für den Menschen selbst nicht gesund, wenn zu viel Fleisch gegessen wird. Ellist, Mo, Youlaf und Stewa haben sich auf die Suche gemacht, um der Sache mit dem Fleisch auf den Grund zu gehen. Jedes Kind weiß etwas Besonderes über die Tierhaltung und deren Auswirkungen auf das Klima und das Leben auf der Erde.
Auf den nächsten Seiten erfährst du, was die Klimakinder so alles über die Herstellung von Fleisch herausgefunden haben.
• Bildet eine Gruppe von vier Kindern. Entscheidet euch für ein Klimakind und erarbeitet in der Gruppe dessen Recherchen.

• Haltet in Stichworten die Aussagen des Klimakindes fest.

• Eine Tabelle als Hilfe für die Recherchen findet ihr im Forschungsbuch.


• Stellt die Ergebnisse der gesamten Lerngruppe vor.
• Überlegt gemeinsam, was man gegen den hohen Fleischkonsum tun könnte.


Ich finde, es ist eine absolute Energieverschwendung, dass wir so viel Fleisch und tierische Produkte essen!
Auf der Erde wird die Hälfte der gesamten Landfläche für Landwirtschaft verwendet. Die meiste Fläche wird für die Viehzucht benötigt. Wenn wir auf dieser Fläche nur Pflanzen anbauen würden, könnten alle Menschen auf der Welt ernährt werden.



Warum das so ist? Für eine Fleischportion braucht man ungefähr 300-mal so viel Fläche wie für die gleiche Portion an Kartoffeln bei des liefert gleich viel Energie. Kühe und die anderen Tiere müssen mit Pflanzen und anderen Futtermitteln gefüttert werden, bis sie groß genug zum Schlachten sind. Diese Pflanzen müssen �� angebaut werden. Rinder sind Pflanzenfresser und benötigen am Tag zwischen 16 und 20 Kilogramm Futter. Allerdings wird die Energie im Tierfutter nicht komplett in Milch, Eier oder Fleisch umgewandelt. Ein großer Energieanteil geht verloren, da die Tiere Gefressenes ausscheiden, Körperwärme abstrahlen, atmen usw. Auch andere Nährstoffe wie Eiweiß, das in Körnern, Mais, Raps und Soja enthalten ist, gehen überwiegend verloren. Daher sollten die Men schen selbst direkt mehr pflanzliche Lebensmittel essen. Oder zumindest weniger Rindfleisch verbrauchen, um weniger Energie zu verschwenden.




Überleg einmal: Auf der Welt hungern täglich über 800 Millionen Menschen. Es werden für landwirtschaftliche Flächen viele Regenwälder abgeholzt, um Weideflächen für Tiere zu haben. Macht es Sinn, so viel Fleisch herzustellen? In manchen Gegenden kann man allerdings keine Nahrungspflanzen anbauen z. B. in den Bergen, wo es hügelig ist und man nicht mit einem Traktor fahren und ein Feld pflügen kann. Das ist ein Grund, weshalb es in den Alpen so viele Kühe gibt. In Steppenregionen wie in Argentinien, in Somalia oder in der Mon golei regnet es nicht genug. In solchen Regionen werden von den dort lebenden Menschen oft Nutztiere wie Kühe, Ziegen und Schafe gehalten. Die meisten Tiere werden allerdings in Gegenden gehalten, in denen man das Land auch verwenden könnte, um pflanzliche Nahrungsmittel für die Menschen anzubauen.
Ich habe gelesen, dass Kühe schädlich für das Klima sind.
Eigentlich sind sie schlimmer als Autoabgase.
Ich erzähl dir nun, warum ich davon ausgehe, dass Kühe das Klima beeinflussen!
Kühe gehören zu einer Gruppe von Tieren, die man Wiederkäuer nennt. Dazu gehören auch Schafe und Ziegen. Vielleicht hast du das Wort schon einmal gehört? Was könnte es bedeuten? Wieder – Käuer? Ich habe es herausgefunden! Das Wort kommt daher, dass die Kühe, Schafe und Ziegen ihre Nahrung zweimal kauen. Ihr Magen hat mehrere Abteile, die Vormägen. Nach kurzem Kauen und Schlucken gelangt die Nahrung dort hinein. Die Nahrung besteht aus Gras und hartem Pflanzenmaterial –das ist schwer zu verdauen! Später legen sich die Tiere gemütlich hin und würgen die Nahrung wieder ins Maul hinauf. Nun kauen sie die Nahrung ausgiebig und schlucken sie in den richtigen Magen hinunter. Das sieht komisch aus, weil sie immerzu kauen, aber selten was ins Maul nehmen.







Kühe und andere Wiederkäuer haben dieses komplizierte Verdauungssystem, bei dem auch viele Bakterien in ihrem Magen mithelfen. Wir Menschen könnten dieses Gras gar nicht essen und verdauen, weil wir nicht dieses raffinierte Verdauungssys tem haben.
Allerdings produziert diese Art der Verdauung viele Gase! Wiederkäuer haben so zusagen eine Biogasanlage in ihrem Magen! Ähnlich wie bei unserer Verdauung: Da entstehen manchmal auch Gase, die wir dann auspupsen! Allerdings entstehen bei den Wiederkäuern viel mehr Gase. Diese Gase gehören auch zu den �� Treibhausgasen. Weißt du noch, was Treibhausgase sind?



Ein Gas, das bei der Verdauung von Kühen entsteht, heißt Methan ist noch folgenschwerer für das Klima als Kohlendioxid, da es viel mehr Wärme auf nimmt. Kuhpupse sind also auch für den Klimawandel verantwortlich! Je mehr Kühe es auf der Welt gibt, desto mehr Kuhpupse gibt es und diese bringen viel Methangas in die Luft.

Ich finde, dass wir viel weniger Wiederkäuer wie Kühe, Schafe und Ziegen halten sollten! Das wäre sicherlich besser für das Klima. Was meinst du?



Ich finde es sehr ungerecht, dass die Menschen Tiere einsperren!
Häufig haben die Tiere viel zu wenig Platz! Dabei haben Tiere doch auch das Recht auf ein gutes Leben!
Ich habe gelesen, dass die Menschen schon seit ungefähr 5 000 10 000 Jahren mit �� Nutztieren wie Kühen, Schweinen, Schafen, Ziegen und Hühnern zusammenleben. Die Tiere liefern Nahrung, und die Menschen schützen die Tiere vor wilden Raubtieren und füttern sie regelmäßig.





Eigentlich ist das eine gute Beziehung, oder? Ich finde nicht! Denn es bedeutet nicht, dass alle Tiere ein gutes Leben haben! Die Tiere werden zwar nicht von Raubtieren getötet, aber die Menschen halten Nutztiere häufig auf eine Art und Weise, die man nicht als „gutes Leben“ bezeich nen kann.
Rindern geht es am besten, wenn sie viel frisches Gras und Heu zu fressen bekommen. In der Landwirtschaft von heute werden sie überwiegend mit Körnern, Soja und Mais und auch mit Fisch und Knochen und allen möglichen sonstigen Produkten gefüttert. Das ist für Rinder ungesund! Ohne ausreichend Gras und Heu bekommen sie schmerzhafte Verdauungs probleme.
Wenn die Tiere in Ställen gehalten werden und nicht genug Platz zum Herumlaufen im Freien haben, bedeutet das Stress für die Kühe. Häufig kämpfen sie dann miteinander. Eigentlich mögen es die Tiere, in Herden zu leben und wie die Menschen eng beieinander zu sein. Wir brauchen den Kontakt zu anderen Menschen, um uns wohlzufühlen. Leben wir zu eng beieinander, haben zu wenig Freiraum oder gar keine Ruhe, dann kann es stressig werden!






Auch stecken sich Menschen wie Tiere gegenseitig mit Krankheiten an. In der Mas sentierhaltung müssen die Tiere regelmäßig mit Antibiotika gespritzt werden, damit sie nicht krank werden.
Ich finde nicht, dass das ein gutes Leben für Tiere ist! Ich bin dafür, dass wir weniger Tiere halten und diesen dann ein gutes Leben ermöglichen.
In einer Fernsehsendung wurde darüber diskutiert, wie gesund das Fleischessen ist. Zum Schluss war man sich einig, dass man wenig Fleisch konsumieren sollte!

In Deutschland und in anderen Ländern essen Menschen so viel Fleisch und andere tierische Lebensmittel, dass es nicht gut für die Gesundheit ist. Jedenfalls werden mehr Menschen, die viel Fleich essen, krank als z. B. vegetarisch lebende Menschen. Noch weiß die Wissenschaft nicht, woran das genau liegt. Meistens kostet Fleisch nicht viel. Es schmeckt den Menschen gut, und es gehört zu ihrer Kultur, dass sie regelmäßig Fleisch essen. Fleisch ist durch den Fettgehalt kalorienhaltig. Viel Fleisch lässt die Menschen dick werden. Die Gewürze in Wurstwaren können bei den Menschen zu Bluthochdruck führen. Dadurch können sie schneller einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen.
Ich finde, wir sollten weniger Fleisch essen, weil zu viel Fleisch nicht gut für uns ist.
Mit wenig Fleisch und viel Obst und Gemüse bleiben wir gesund!



Und noch etwas fällt mir ein: Fleisch ist zu billig! Wenn es mehr kosten würde, kaufen die Menschen nicht so viel ein. Häufig wird es sogar weggeworfen.


Dabei schadet die Tierhaltung selbst schon der Mitwelt!


Fleisch kann man sehr günstig einkaufen. Das liegt daran, dass es nicht teuer in der Herstellung ist. Man kann billige Futtermittel wie Soja- und Maismehl aus Ländern wie Indonesien oder Brasilien einkaufen. Die Tiere bleiben im Stall und man benötigt nicht so viel Weideplatz. Wenn man viele Tiere auf einem engen Raum hält, dann wird es auch preiswerter. Die Leute können viel Fleisch kaufen – Fleisch ist nichts Wertvolles mehr. Dieser Umgang mit der Fleischherstellung hat negative Folgen für unsere Mitwelt. Für den An bau von Futtermitteln wird der Regenwald abgeholzt, was dem Klima sehr schadet. Je mehr Tiere auf engem Raum leben müssen, desto mehr wird auch die Umwelt verschmutzt. Es fallen viele schädliche Stoffe und Abfälle (Kuhmist und Urin) an. Das schadet zum Bei spiel dem Grundwasser und dem Boden. Die Folgen müssen alle Menschen tragen: Das Grundwasser muss gereinigt werden, die Folgen des Klimawandels betreffen viele Menschen auf der Erde. Nur, weil viele Leute reichlich Fleisch essen wollen. Das finde ich ungerecht! Diese Menschen soll ten mehr Verantwortung für die Tiere und die Mitwelt übernehmen. Ich meine, dass sie für Fleisch viel mehr Geld bezahlen sollten. Vielleicht eine Extra-Abgabe leisten oder mehr Steuern bezahlen. Das Geld könnte man dann für den Umweltschutz verwenden.



Ein zu hoher Fleischkonsum ist nicht gut für das Klima, die Mitwelt, die Tiere und die Menschen. Trotzdem wird auf der Welt immer mehr Fleisch produziert. Was kann und sollte sich ändern? Was kann eine einzelne Person tun?
Achtsame Menschen haben darüber nachgedacht und Ideen und Vorschläge entwickelt. Du findest diese Ideen in den folgenden Texten.

Setze dich mit vier weiteren Kindern an den Gruppentisch. Jedes Kind liest einen Text. Danach füllt ihr gemeinsam die Tabelle im Forschungsbuch aus. Diskutiert zusammen die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Anregung. Zum Schluss schreibt jedes Kind seine eigene Entscheidung und seine Vorstellungen zum Fleischkonsum in das Forschungsbuch und begründet sie.





1

Ellists Großmutter kann nicht verstehen, was man gegen Fleisch, Milch und Eier haben kann. Sie findet diese Produkte vor allem für Kinder wichtig, damit sie wach sen und stark werden können.
Tierische Produkte enthalten viele Nährstoffe, die für die Gesundheit wichtig sind, z. B. Eiweiß, Calcium, Vitamine und Eisen. Das ist gerade für Kinder wichtig, weil sie noch wachsen. Viele Werbesendungen erzählen, dass Milch für den Knochenbau wichtig ist!
Deswegen sollten die Menschen nicht aufhören, Fleisch und tierische Lebensmittel zu essen. Am besten ausgewogen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.





Damit Tierhaltung der Umwelt und den Tieren entspricht, halten einige Bauern ihre Tiere nach den Vorgaben der biologischen Landwirtschaft. In der biologischen Tierhaltung haben Tiere genügend Auslauf und vor allem Wiederkäuer genügend Weidefläche. Das ist gut für ihre Gesundheit. Man benötigt allerdings mehr Weide- und Auslaufflächen. Wenn der allgemeine hohe Fleischkonsum durch Biofleisch ersetzt werden sollte, dann würde viel zu viel Weideland gebraucht.
Das Futter von Rindern muss beim Bioanbau aus viel Gras bestehen, nicht nur aus Soja, Mais und anderen Futtermitteln. Deswegen sind tierische Lebensmittel aus dem Bioanbau etwas teurer als übliche tierische Lebensmittel. Einige Menschen meinen, dass Biofleisch und andere tierische Bio produkte besser schmecken und gesünder sind. Das stimmt sicherlich nicht generell und sollte jede und jeder für sich ausprobieren!
Für den Menschen enthält Fleisch viele wertvolle Eiweiße und Vitamine. Da die Großtierhaltung die Mitwelt sehr belastet, schlägt die Ernährungswissenschaft vor, dass man zukünftig eine andere Art von Tieren essen solle – Insekten wie Würmer, Maden, Spinnen, Käfer und Heuschrecken. Diese werden in Insektenfarmen für den Verzehr aufgezogen. Für die Haltung von Insekten werden viel weniger Ressourcen benötigt. Es gibt keinen großen Energiebedarf wie bei der Haltung von Rindern oder Schweinen. Das Problem mit den Kuhpupsen hat man auch nicht.



Aber: Würde man den gesamten Fleischverzehr der Welt durch Insekten ersetzen, dann gäbe es wohl neue Umweltprobleme. Würden Menschen anstatt Wurst und Braten gern Maden und Heuschrecken essen?


In vielen Ländern stehen Insekten auf dem täglichen Speiseplan – in Asien ist das Knabbern von gegrillten Mehlwürmern und frittierten Maden so normal wie für uns Chips, Popcorn oder Salami. Youlaf kennt das auch aus Somalia, wo die Menschen gern gegrillte Heuschrecken knabbern. Auch bei uns findet man Insekten im Ange bot! In einem Supermarkt kannst du verschiedene Produkte kaufen. Wer mutig ist, probiert die Nudeln aus Mehlwürmern!



Die Tierhaltung und die Herstellung von Fleisch verbrauchen viele Ressourcen. Vielen Menschen fällt es allerdings schwer, auf Fleisch zu verzichten. Deshalb wird geforscht, wie man Fleisch im Labor herstellen kann. Dafür legt man Zellkulturen an. Das bedeutet: Tierische Zellen werden in einer Nährflüssigkeit außerhalb des Tierkörpers gezüchtet. So müssen keine Tiere leiden. Man benötigt viel weniger Weideland und Fläche für den Futteranbau. Diese Flächen können für Wälder oder für den Anbau von Biobrennstoffen verwenden werden. So werden keine Kuhpupse erzeugt, die schädlich für das Klima sind. Man weiß nicht, ob für Laborfleisch mehr Energie benötigt wird als für die herkömmliche Tierhaltung. Wenn die Energie dafür aus erneuerbaren Quellen kommen würde, wäre es am besten. Es gibt bereits Hamburgerfleisch und Hühnerfleisch aus Zellkulturen. Menschen probierten es und haben keinen Unterschied zu normalem Fleisch festgestellt.



Es schmeckt wie richtiges Fleisch, fühlt sich im Mund genauso an und sieht genauso aus. Es gibt Firmen, die solche Produkte demnächst in die Supermärkte bringen wollen. Dann können die Menschen selbst entschei den, ob ihnen dieses Fleisch schmeckt.






Manche Menschen leben vegetarisch oder vegan. Sie essen kein Fleisch (manchmal auch keinen Fisch). Die Veganer / Veganerinnen verzichten ganz auf tierische Produkte. Sie essen keine Milchprodukte und Eier, einige vermeiden auch Honig. Viele Menschen verzehren nur manchmal Eier oder nur selten im Jahr Fleisch. Die Gründe für eine vegetarische oder vegane Ernährung sind unterschiedlich. Meistens hat es mit der Umwelt, dem Tierschutz oder der eigenen Gesundheit zu tun. Bei dieser Ernährungsweise muss man aufpassen, dass man wichtige Nährstoffe der tierischen Nahrung wie Eiweiß, Eisen und Vitamine zu sich nimmt. Diese Nährstoffe sind in Bohnen, Linsen, Erbsen, Nüssen und Gemüse sowie Obst enthalten. Da sich immer mehr Menschen vegeta risch oder vegan ernähren, können diese Produkte immer häufiger im Supermarkt gekauft werden. Man sollte darauf achten, woraus diese Produkte hergestellt sind. Viele Menschen fragen sich auch, ob die vegetarischen Gerichte aussehen müssen wie Fleischgerichte. Interessant ist es zu erkunden, wie groß Regale mit Fleisch und wie groß die Regale mit vegetarischen Angeboten sind.



Du weißt nun einiges über eine Ernährung, die den Menschen, den Tieren, dem Klima und auch der Mitwelt guttun würde. Plane mit deiner Lerngruppe ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen, das eure Diskussionen in die Entscheidungen über die Nahrungsmittel einbezieht. Es kann ein sehr gemischtes Angebot entstehen: Es gibt Bioprodukte, Fleisch und Fleischersatz, Insekten, Gemüse, Obst und Getreide. Jedes Kind bringt eine Essensgabe mit – und wird dann erzählen, was daran die Kriterien „bio“, „tiergerecht“ oder „klimagerecht“ erfüllt.
Sprecht während des Essens über diese Fragen:


• Wie schmeckt das Gericht?
• Was ist daran sehr gut? Was ist nicht so gut?


• Wie einfach war die Zubereitung?
• Warum kann dieses Essen zur Gewohnheit werden? Warum nicht?

Klimagerecht essen – geht das? Bio, vegetarisch, vegan, fair, regional: Ellist hat viel über diese Ernährungsformen gelernt. Ihm ist allerdings immer noch nicht klar, wie das Essverhalten mit dem Klimawandel zusammenhängt. Da entdeckt er in der Zeitung folgende Überschrift: allen Kindern deiner Lerngruppe!
Tofuwürste lieben? Na ja, ein bisschen schmecken die ja wie Fleisch. Klimawandel hat mit Essverhalten zu tun? Und dann auch noch mit Gerechtigkeit?

„Klimagerechtigkeit und Esskultur“ oder “Lerne Tofuwürste lieben“ von Harald Lemke (2010)

Denke über die Fragen von Ellist nach:


• Was sind Tofuwürste?
• Was soll das bedeuten: „Lerne Tofuwürste lieben“?




• Was hat Essen mit Klimagerechtigkeit zu tun?

Schreibe deine Ideen und Vermutungen zu der Zeitungsüberschrift in das Forschungsbuch.

Tausche dich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern über eure Ideen aus. Diskutiert in der gesamten Lerngruppe folgende Fragen:

• Was genau bedeutet klimagerecht?
• Was bedeutet es, klimagerecht zu essen?
• Warum sollten die Menschen klimagerecht essen?
• Können alle Menschen klimagerecht essen?
4 Sammelt die Ideen und schreibt sie auf Karten.
Achte darauf, dass du deine Aussagen begründest!
Findet Oberbegriffe für eure Aussagen und sortiert die Ideen darunter.
Sammelt weitergehende Fragen zu dem Thema und haltet sie ebenfalls auf Karten fest.
Gestaltet aus den Oberbegriffen, den Ideen und euren zusätzlichen Fragen ein einfaches Plakat, mit dem ihr später weiterarbeiten könnt. Überlegt eine Überschrift und hängt das Plakat im Klassenraum auf.
Der Arzt Eckart von Hirschhausen wurde interviewt und gefragt, welche Ernäh rungsweise er für Mensch und Erde empfiehlt. Hier seine Antwort: „Ganz klar, die Planetary Health Diet [Planetarische Gesundheitsdiät], auch wenn Diät leider nach Zwang und Verzicht klingt. Dabei bedeutet das Wort eigentlich „Lebensweise“. Denn es geht hier nicht um eine Anleitung zum Abnehmen, sondern um den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Ganz simpel heißt das deutlich mehr Gemüse, Nüsse, Obst und Hülsenfrüchte auf den Teller als bisher und dafür viel weniger Zucker und Fleisch.“

Diskutiert in der Lerngruppe die Aussage von Herrn Hirschhausen!
Welche Fragen für eure eigenen Interviews fallen euch ein?



Welche Ideen haben Menschen zu einer klimafreundlichen Ernährung?

Du hast gemeinsam mit den Kindern aus deiner Klasse Ideen gesammelt, was eine klimagerechte Ernährung sein kann. Auf dem Plakat sind Fragen notiert, die ihr an eine klimagerechte Ernährung habt.
• Entwickle gemeinsam mit anderen Kindern einen Fragebogen, mit dem ihr die Gedanken und Ideen anderer Menschen herausfinden könnt.
• Bildet kleine Gruppen und interviewt die ausgesuchten Menschen!
So könnt ihr einen Fragebogen entwickeln:
Fragebogen vorbereiten
• Sammelt die Fragen, die ihr anderen Menschen stellen möchtet. Was wollt ihr von den Menschen erfahren? Geht es um Wissensfragen? Wollt ihr herausfin den, was die Menschen über das Thema denken?

• Ordnet die gesammelten Fragen.
• Schreibt die ausgewählten Fragen auf. Lasst unter jeder Frage genug Platz für eine Antwort.
Tipp: Wenn ihr den Fragebogen an mehrere Leute verteilen wollt, dann kopiert den fertig vorbereiteten Fragebogen. Ihr könnt ihn auch am Computer tippen und mehrfach ausdrucken.
•
Besprecht in der Lerngruppe, wem ihr die Fragen stellen wollt! (z. B. anderen Kindern, Köchen und Köchinnen; Menschen in Lebensmittelläden; Menschen aus der Landwirtschaft; Politikern und Politikerinnen; Ärzten und Ärztinnen; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und anderen.)

• Wer soll eure Fragen beantworten? Wer kann eure Fragen beantworten?


• Wie viele Personen sollen den Fragebogen ausfüllen?
Tipp: Teilt in der Gruppe ein, wer den Fragebogen an welche Personen verteilt. Sagt den Leuten, wie lange sie Zeit zum Beantworten und Ausfüllen des Frage bogens haben. Vereinbart einen Termin, an dem ihr den Fragebogen einsammelt bzw. zurückhaben wollt.
• Untersucht die gesammelten Antworten und ordnet sie.
Wird etwas doppelt genannt?


Was wisst ihr schon?
Was könnt ihr Neues lernen?
Welchen Antworten stimmt ihr zu, welchen nicht?
Informiert alle Kinder und Lehrkräfte der Schule über das Befragungsergebnis.
Die Interviews haben neue Erkenntnisse und Ideen zum Thema „klimagerechte Ernährung“ gebracht.
Das sollen alle Schulangehörigen erfahren.
•
Gestaltet einen Werbeflyer (Flugblatt) zur klimagerechten Ernährung, den alle mitnehmen können.
• Der Flyer enthält alles Wissenswerte in wenigen Worten und kurzen Sätzen.
• Der Flyer ist so gestaltet, dass er Lust aufs Anschauen macht. Er kann lustig sein, farbig und mit selbst gemalten oder ausgeschnittenen Bildern verziert werden.
Über manche Fragen kann man nachdenken, so viel es geht: Man findet keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. Aber das Nachdenken und Miteinander sprechen hilft, eine Entscheidung zu treffen. Unterhalte dich mit anderen Kindern und / oder Erwachsenen über die folgenden Fragen. Und denk daran: Es darf alles gesagt und gedacht werden!

• Bin ich immer ich, egal, was ich esse?
• Haben Tiere einen Geist?
• Muss ich beim Essen an Rechte denken?



• Darf man alle Tiere essen?
• Sind Möhren Lebewesen?



Wie kann man Kleidung weiterverwenden?
Tauschen
Teilen Verleihen
Reparieren / Verändern
Upcycling

Reparieren von Kleidungsstücken keine (große) Kunst!

Einen Knopf annähen


Ein Loch im T-Shirt oder in der Hose flicken
Kreativ sein – ein Upcycling-Projekt
Nachhaltigkeit in der Mode: Kleidung tauschen, mieten und teilen



Ein Kleidungsstück hat in der Regel eine lange Reise hinter sich, bevor wir es im Laden kaufen können. Viele Menschenhände haben an dem Kleidungsstück ge arbeitet und es wurden Materialien, Werkzeuge und Transportmittel benötigt. In dem Forschungsbuch „Klima.Leben“ Klasse 3 hast du festgehalten, welche Probleme die lange Reise und die Herstellung eines T-Shirts auf das Klima und die Menschen hat. Schau dir dein Forschungsbuch oder das eBook von Klasse 3 noch einmal an!


Tausche dich mit einem anderen Kind über die folgenden Fragen aus:


• Welche Probleme gibt es beim Anbau von Baumwolle?
• Was passiert beim Färben der Garne?

• Warum sollten viele Textilfabriken in Bangladesch und Indien kontrolliert werden?
• Wie viele T-Shirts werden im Durchschnitt von einer Person gekauft, aber nie getragen? Mo hat ein anderes Problem. Manchmal wächst ein Kind so schnell, dass ein Kleidungsstück nicht mehr passt, aber noch schön ist.
Leider passt mir meine Lieblingslatzhose fast nicht mehr. Dabei sieht sie noch so gut aus. Ich will sie nicht wegwerfen! Was könnte ich nur da mit machen?
Kennst du die Überlegung von Mo auch? Gibt es Kleidungsstücke, die dir nicht mehr passen? Hast du Kleidungsstücke, die du nicht mehr leiden magst?



Schau in deinen Kleiderschrank und bringe ein Kleidungsstück (Hose, T-Shirt; Pullover; Kleid), das du nicht mehr anziehst, mit in die Schule.

Bildet eine Gruppe von drei Kindern. Stellt euch die Kleidungsstücke gegenseitig vor und beantwortet folgende Fragen:

• Was hat dir an dem Kleidungsstück gefallen?



• Warum magst du das Kleidungsstück nicht?
• Weshalb ziehst du das Kleidungsstück nicht mehr an?
•
Meinst du, dass ein anderes Kind das Kleidungsstück gern tragen würde?


• Sollte das Kleidungsstück verändert werden, sodass ein anderes Kind es gern an ziehen würde?
Du kannst diese bemalen oder gestalten und ändern, wie du es gut
Ich habe da schon einige Ideen, was man mit Kleidungsstücken machen kann, die man nicht mehr anzieht! Schau dir meine Vorschläge an! Im Forschungsbuch kannst du aufschreiben, was dir daran gut gefällt und was du nicht so gut findest! Dort beantwortest du auch die gestellten Fragen!
Setz dich anschließend mit drei anderen Kindern in einer Gruppe zusammen. Teilt euch gegenseitig mit, wie ihr die Fragen beant wortet habt, und diskutiert über eure Antworten.



Der Tauschhandel hat seinen Ursprung im Steinzeitalter. Zu der Zeit gab es kein Geld und die Menschen hatten es nicht vermisst. Sie kann ten diese Bezahlung ja nicht. Die Steinzeitmenschen jagten, sammelten und stellten alles selbst her, was sie brauchten. Wenn sie mal etwas benötigten, was sie selbst nicht hatten, dann tauschten sie untereinander. So konnten alle die Sachen anbieten, die man zu viel hatte oder die man nicht benutzte. Wahrscheinlich kennst du das Tauschen von Sammelkarten oder Spielzeug mit deinen Freunden.



Mit wem könntest du deine Kleidung tauschen? Welches deiner Kleidungsstücke würdest du gern tauschen? Was würdest du gern für ein Kleidungsstück dafür bekommen?



Teilen und Verleihen diese Handlungen werden seit mehreren Jahr hunderten praktiziert. Vor allem Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn sind gern bereit, Dinge auszuleihen. Oft werden Sachen ausgeliehen, die nur für eine kurze Zeit benötigt werden. Es lohnt sich nicht, sie neu zu kaufen. Vermutlich hast du dir schon mal ein Fahrrad, einen Strandkorb oder deine Eltern haben ein Auto ausgeliehen. Die gleiche Idee gibt es auch für Kleidungsstücke, welche nur für bestimmte Anlässe (bspw. Faschingskostüme) oder Lebensabschnitte (Babykleidung) benötigt werden. Manchmal hat man auch ein Kleidungsstück vergessen und jemand anderes hilft aus (Regenjacke).
Wann hast du dir Kleidung ausgeliehen? Wie hast du dich in diesem geliehenen Kleidungsstück gefühlt? Bist du damit anders umgegangen als mit deiner eigenen Kleidung?



Denke noch einmal an die Steinzeit – an den Tauschhandel. Zu einem späteren Zeitpunkt begannen einige Probleme. Zum Beispiel brauchte gerade niemand Fleisch oder Fisch, der aber da war. Es vergingen dann Tage und die frischen Lebensmittel wurden schlecht. Das Tauschobjekt war nicht mehr gut genug, um getauscht zu werden.
Die Ureinwohner der Insel Yap in Asien kamen auf eine grandiose Idee: Sie began nen, eine ganz besondere Art von Steinen als Tauschmittel zu nutzen. Diese Steine waren wertvoll und verloren auch nach längerer Zeit nicht ihren Wert. Große Steine waren mehr, kleine Steine weniger wert. Diese Idee ist höchstwahrscheinlich der Ursprung des Zahlungsmittels „Geld“.
Hast du schon Flohmärkte besucht, wo gebrauchte Kleidungsstücke, Spielzeug oder ähnliches verkauft wurden? Kannst du dir vorstellen, deine Kleidung zu ver kaufen? Wie viel Geld möchtest du für ein bestimmtes Kleidungsstück bekommen?

Was machst du dann mit diesem Geld?


Reparieren ist eine Idee, um Kleidungsstücke, technische Geräte, Möbel oder ähnliches zu erneuern, wenn diese Dinge beschädigt oder kaputt sind. Damit funktioniert der Gegenstand wieder und kann weiter genutzt werden. Besonders bei kleinen Löchern und Rissen in Kleidungsstücken lohnt es sich, diese zu stopfen oder zu flicken. Damit ist das Kleidungsstück schnell repariert und kann wieder getragen werden.
Hast du ein Kleidungsstück, das zerrissen war oder ein Loch hatte und dann ge flickt wurde? Wie sah der Flicken aus? Wie wirkte nun das Kleidungsstück? Wie hast du dich mit diesem reparierten Kleidungsstück gefühlt?



Der Begriff „Upcycling“ kommt aus dem Englischen. „Cycling“ bedeutet „verwerten“ und „up“ heißt übersetzt „hoch“. Alte Kleidung, scheinbar nutzlose Stoffe oder sonstige Abfallstoffe werden nicht weggeworfen, sondern in etwas Neues und Besonderes verwandelt. Beim Upcycling steigert man also den Wert des Ursprungmaterials. Das neue Teil ist wertvoller, weil sich jemand besonders viel Mühe gegeben hat, weil es sehr kreativ oder äußerst nützlich ist. Hast du schon einmal aus alten Dingen etwas Neues hergestellt? Worum ging es dabei? Hast du es für dich gemacht oder das neue Werk verschenkt? Wie nützlich hast du den neuen Gegenstand empfunden?


Einen Knopf annähen

Diese Materialien benötigst du dafür:
Kleidungsstück, an dem der Knopf fehlt. (Zum Üben kannst du das Annähen an einem Stück Stoff probieren!)

einen farblich passenden Knopf
farblich passendes Nähgarn
eine Nähnadel
eine Schere



1. Nach dem Einfädeln in die Nadel nimmst du den Faden doppelt; am Ende verknotest du die beiden Fäden. Stich von der Rückseite durch den Stoff und nimm dann den Knopf auf.
2. Leg ein Streichholz zwischen Stoff und Knopf. So sitzt der Knopf nicht zu fest auf dem Stoff. Es bleibt ein Steg oder Hals.
3. Nähe den Knopf mit drei bis fünf Stichen an.

4. Ziehe nun das Streichholz heraus und umwickle die Fäden zwischen Knopf und Stoff mehrfach, so dass ein Steg bzw. Hals entsteht.
5. Stich den Faden durch den Steg und ziehe ihn auf die Rückseite. Dort schneidest du den Faden kurz ab.
Ein Loch im T-Shirt oder in der Hose flicken
Gerade wenn es sich um die Lieblingshose handelt, ist es blöd, wenn die Knie beim Hinfallen ein Loch bekommen haben. So kannst du das Loch flicken und eine noch coolere Hose bekommen!
Diese Materialien benötigst du:


eine kaputte Hose oder ein zerrissenes T-Shirt

einen (coolen) Aufnäher
Nähgarn in passender oder einer anderen Farbe
eine Nähnadel
eine Schere

Du kannst den Aufnäher selbst gestalten oder fertig kaufen. Jede Form geht!







Erst einmal kannst du den Steppstich üben. Mit diesem Stich kannst du Stoffe zusammennähen, Nähte versäubern oder auch nur Nähte zur Zierde anlegen. Du arbeitest von rechts nach links.
1. Die Nadel zuerst von unten durch den Stoff (oder durch beide Stoffe, wenn sie aufeinanderliegen) stechen.
2. Dann stichst du die Nadel rechts davon von oben wieder auf die Unterseite.
3. Auf der Rückseite nimmst du den doppelten Abstand (Stichlänge) und führst die Nadel nach vorn und stichst dort wieder durch den Stoff oder die Stoffe. Der Faden muss immer vollständig durchgezogen werden, aber nicht zu fest, denn dann kräuselt sich der Stoff. Und so machst du einen Stich nach dem anderen.
3 1 2



1. Schneide aus dem gewählten Stoffrest eine Fläche aus, die das Loch in deinem Kleidungsstück großzügig überlappt. Achte darauf, dass die Ränder des Flickens nicht ausfransen.
2. Befestige den Flicken mit Stecknadeln auf der rechten (der schönen) Seite über dem Loch.
3. Nähe nun den Flicken mit einem Steppstich fest. Sieht großartig aus mit einem andersfarbigen Faden!





Kreativ sein – ein Upcycling-Projekt Kennst du das? Häufig verliert man einzelne Strümpfe, vor allem in der Waschmaschine. Übrig bleibt immer eine arme Socke. Du kannst ihr wieder einen neuen Wert geben: als Stiftehalter, Handyhülle, wärmende Armstulpe und was dir noch einfällt!




Nachhaltigkeit in der Mode: Kleidung tauschen, mieten und teilen Eine Milliarde Kleidungsstücke sollen bei uns ungenutzt im Schrank liegen. Jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen. Wie kann man diesen Kleidungsstücken einen neuen Wert geben? Wie kann man die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängern? Wie kommt man an neue modische Kleidung, ohne dass neue Ressourcen verbraucht werden? Wie kann man dabei auch noch Geld sparen?
Es gibt viele Ideen du kannst einige auf den Bildern erkennen. Durch Tausch, Verkauf oder Verschenken der Kleidung sorgst du für die Wiederverwendung bestehender und gut erhaltener Kleidung und vermei dest gleichzeitig die zusätzliche Produktion neuer Fast Fashion.



Such dir eine Partnerin oder einen Partner. Schaut gemeinsam die Bilder an und tauscht euch über eure Erfahrungen aus.
•

Gibt es diese Einrichtung in eurer Umgebung?


• Erforscht eure Wohngegend und fotografiert oder zeichnet die Entdeckung in das Forschungsbuch.
• Notiert, was dort getauscht, verschenkt oder verkauft wird.
• Haltet auch fest, welche Personen dort anzutreffen sind.




Nicht nur gebrauchte Kleidung kann man wiederverwenden, reparieren, tauschen oder verkaufen.

Viele Gebrauchsgegenstände, die man selbst nicht mehr braucht, können andere Menschen sehr gut verwenden.

Kann man nicht auch in der Schule oder in einer Klasse etwas zur nachhaltigen Nutzung von Kleidung beitragen? Ihr könnt euch vielleicht eine Aktion überle gen – bestimmt habt ihr fantas tische Ideen!


•
Sammelt alle Ideen, die in der Lerngruppe genannt werden.
• Alle Vorschläge werden angehört und auf ein Plakat oder auf die Tafel geschrieben.

•
Überlegt gemeinsam, welche der Ideen umgesetzt werden soll. Eventuell stimmt ihr mit Hilfe von Klebepunkten ab.
•
Denkt euch gemeinsam einen originellen Namen für eure Aktion aus.
Tipp: Besprecht euch mit den Eltern, bevor ihr Kleidungsstücke für die Aktion von zu Hause mitnehmt. Wann?
Besprecht, wie der zeitliche Rahmen der Aktion sein soll:
• Soll die Kampagne über einen längeren Zeitraum stattfinden?
• Soll sie mehrfach stattfinden?
• Soll die Aktion einmalig sein?
• Was wäre ein mögliches Datum?



Tipp: Bedenkt bei der Terminsuche, dass ihr Vorbereitungszeit benötigt: für das Sammeln der Kleidung sowie des nötigen Materials (Zubehör, Nähutensilien, Tische, Plakate etc.) und die Bekanntmachung des Ereignisses.
• Findet einen Ort in der Schule, an dem eure Aktion aufgebaut oder durchge führt werden kann. Berücksichtigt bei der Raumsuche, ob es eine einmalige, sich wiederholende oder ständige Aktion ist.
Tipp: Fragt beim Hausmeister oder der Schulleitung nach, welche Räume sich dafür eignen und frei sind.
Für wen plant ihr die Aktion:

• für die eigene Lerngruppe


• für alle Kinder und Lehrkräfte eurer Schule
• für die Eltern der Schülerinnen und Schüler
• für die Menschen aus der Nachbarschaft der Schule
Tipp: Überlegt, wie die Menschen von von eurer Aktion erfahren können. Gestaltet einen Aushang, schreibt Einladungen, verteilt Flyer, informiert die örtliche Zeitung usw. Wer macht was?
• Schreibt eine Liste mit allen anfallenden Aufgaben.

• Besprecht, wer von euch (auch als Gruppe) welche Aufgabe übernimmt.
• Haltet die Namen in der Liste fest.

• Notiert, bis wann die Aufgabe erledigt werden soll.

Tipp: Jedes Kind überlegt, was es besonders gut kann oder woran es am meisten Freude hat. Dann bildet ihr Arbeitsgruppen, sodass nicht alle alles erledigen müssen.


Kann man über Jeans, Pullover und Kleider ein philosophisches Gespräch führen? Man kann! Sprich mit anderen Kindern oder Erwachsenen über die folgenden Fragen:
• Wann sagt man, dass eine Person schön gekleidet ist?
• Wird eine Person durch ein Kleidungsstück zu einer anderen Person?


• Sind wir immer jemand anderes, wenn wir neue Kleidung tragen?
•
•
•
Warum fühle ich mich in mancher Kleidung besser als in anderer?

Kann man in einer Kleidung „zu Hause“ sein?




Wie stellst du dir die Zukunft vor?
Das afrikanische Land Angola

Über Zukunft nachdenken
Kannst du die Zukunft vorhersagen?
Du sagst deine Zukunft voraus!
Kann Wissenschaft die Zukunft voraussagen?

Wie sich die Welt verändert
Ein Tag im Leben eines Kindes
Können Menschen heute für die Zukunft leben?
Es geht auch anders – Kinder reden mit!
Kinderpressekonferenz


Neulich habe ich im Museum einen Film gesehen, der mich sehr beeindruckt hat. Erst habe ich gar nicht so richtig verstanden, worum es geht. Ich habe ihn mir dann noch ein zweites Mal angeschaut. Jetzt muss ich immer wieder daran denken: Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
Youlaf hat den Film „Cambeck“ von Binelde Hyrcan angeschaut. Du kannst ihn dir ebenfalls anschauen.
Wunder dich nicht: Der Film ist in Angola gedreht, die Kinder sprechen portugiesisch. Die englischen Untertitel musst du auch nicht lesen können! Mach dir erst einmal deine eigenen Gedanken zu dem Film. Beachte:


• An welchem Ort befinden sich die Jungen?




• Worüber könnten sie sich unterhalten? Was könnten sie darstellen?
• Sind alle Jungen gleichberechtigt am Gespräch beteiligt?
• Gibt es Unterschiede zwischen den Jungen? Sind die Rollen, die sie spielen, ungleich in Bezug auf ihre Entscheidungsmöglichkeit?
�� Binelde Hyrcan: Cambeck, 2011, HD Video, 2’30’’




Schreibe deine Eindrücke und Fragen zu dem Film in das Forschungsbuch.
Sprecht anschließend in der gesamten Lerngruppe über den Film!
• Habt ihr gleiche oder sehr unterschiedliche Ideen zu dem Film?
• Was kann der Film mit „Zukunft“ und „Klimawandel“ zu tun haben?
• Was hat euch an dem Film nachdenklich gemacht?




• Welchen Titel könnte der Film haben? Begründet die Titelwahl!
Wenn du genau wissen möchtest, über was die Jungen sich unterhalten, kannst du die Szene im Forschungsbuch nachlesen.
Der Künstler Binelde Hyrcan hat den Film mit den vier Jungen, die keine Schauspieler sind, an einem Strand in der Nähe der Stadt Luanda gedreht. Luanda ist die Hauptstadt von Angola. Auf dem Foto erkennst du, wie der Regisseur mit den Jungen arbeitet.
Angola ist wie das Land Somalia, wo Youlafs Großeltern leben, ein Land auf dem afrikanischen Kontinent.

Such das Land auf einer Karte oder bei �� Google Maps!








Angola ist etwa dreimal so groß wie Deutschland und damit eines der größten Län der Afrikas. Die Hauptstadt heißt Luanda. In Angola gibt es Reichtum und sehr viel Armut nebeneinander. Das Land hat viele Bodenschätze wie Erdöl, Diamanten und Gold. Doch Reichtum für ein Land oder ein politisches System bedeutet nicht gleich zeitig Reichtum für die Menschen, die in diesem Land leben. Angola ist stark von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen. In den südlichen Gegenden bleibt der Regen aus und dies führt zu Hunger bei den Menschen und zum Sterben der Rinder, die die Lebensgrundlage der Menschen bilden. Aber auch in den anderen Bezirken kann die Bevölkerung durch die unregelmäßigen Niederschläge nicht genügend Getreide und Gemüse anbauen und ernten. Deshalb haben die Menschen immer öfter nicht genügend zu essen. Möchtest du mehr über das Land und seine Menschen erfahren?
Geh im Internet auf die Seite �� kinderweltreise.de und suche das Land Angola!
Über Zukunft nachdenken Youlaf findet es unerträglich, dass Menschen nicht genügend zu essen haben! Er will, dass das aufhört und dass die Menschen lernen, besser mit der Erde und den Mitmenschen umzugehen. Er fragt andere Kinder nach ihren Ideen für ein gutes Leben für alle Menschen auf der Welt. Er ist beeindruckt, wie viel die Kinder über die Probleme der Welt wissen. Sie haben sogar Lösungsvorschläge! Auf der nächsten Seite sind einige Antworten der Kinder abgebildet:
„Durch das CO₂ wird halt die Erdatmosphäre zerstört und dadurch wird es immer wärmer. Dadurch schmilzt der Schnee auf den Bergen. Und deshalb werden auch viel mehr Naturkatastrophen geschehen.“


Leon
„Viele sagen ja, dass Elektroautos viel besser sind als Dieselautos. Dabei stimmt das nicht mal so ganz, denn Elektroautos müssen ja auch den Strom nutzen.“
„Ich würde zuerst einmal viele Solarzellen und Windräder aufstellen. Denn wenn man so von einem Tag auf den anderen in Deutschland die ganzen Kohlekraftwerke abstellen würde, dann hätte man fast gar keinen Strom mehr. Denn man muss erst mal umstellen.“
Pia

 Maria
Maria
„Ich will, dass keine Waffen und so mehr hergestellt werden, damit es auch nicht mehr so viel Krieg gibt.“ Amira



„Die Welt wäre auch um einiges besser, wenn man alle Menschen, egal ob Erwachsene oder Kinder, gleichberechtigt behandeln würde. Denn in Afrika gibt es zum Beispiel Kindersol daten - in Deutschland stellt sich diese Frage gar nicht.“
Lisa„Ich finde es doof, dass es für schwere Berufe nicht so viel Geld und für vergleichsweise einfachere Berufe mehr Geld gibt. Zum Beispiel: Ein Müllmann, der den Müll wegräumt, hat eigentlich einen schweren Job. Aber die Müllmänner kriegen nicht viel Geld und werden von manchen auch verspottet oder so.“


„In manchen Ländern gibt es große Firmen, die in irgendeinem anderen Land irgendwas anbauen. Da gibt es jetzt zum Beispiel richtig viel Avocado-Anbau. Dafür nehmen sie den Dorfbewohnern das ganze Wasser weg, um ihre Avocados zu pflanzen.“

 Max
Max
S. 84 85










Die Kinder haben sehr unterschiedliche Ideen und sehen viele Probleme auf der Welt. Erstelle im Forschungsbuch eine Mindmap und schreibe die wichtigsten Aussagen der Kinder in die Felder! Denke daran, dass du Oberbegriffe benennst und dann die „Äste“ mit Unterthemen ausgestaltest.

Welche Gedanken und Probleme kommen dir in den Sinn, wenn du über die Zu kunft der Welt nachdenkst? Was beschäftigt dich so stark, dass du es anderen Menschen mitteilen möchtest?

Erstelle eine Gedanken-Kartenwelt! Anregungen findest du im Forschungsbuch. Wenn du magst, kannst du anschließend der Lerngruppe deine dringlichsten Gedanken vorlesen!



Menschen lieben es, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Die Fähigkeit, sich die Zukunft vorzustellen, mag tatsächlich das sein, was uns menschlich macht.
Die Klimakinder überlegen, wie es wäre, wenn man die Zukunft vorhersagen könnte.
Das wäre cool! Dann kann ich schon jetzt in der Gegenwart alles richtig machen. Also so, wie es für mein späteres
Das sehe ich genauso!
Ja, ich denke auch, wenn man sich im Moment intensiv die Zukunft ausmalt und vorhersagt, dann wird das doch auch die Gegenwart verändern, oder?
Ich find das nicht so logisch! Denn wenn du jetzt so handelst, wie es gut für die Zukunft ist, muss es ja nicht gut für die Gegenwart sein. Aber es ist spannend, über die Zukunft nachzudenken. Manchmal träume ich mich in die Zukunft. Und dann ...





Was wäre großartig daran, wenn man die Zukunft vorhersagen könnte?
Was wäre problematisch daran, die Zukunft im Voraus zu wissen?
Es ist eine bemerkenswerte Fähigkeit von uns Menschen, dass wir über die Zukunft nachdenken können. Wir können uns Folgendes genau ausmalen und vorstellen:
•
Was wir morgen tun werden.
• Was morgen passieren könnte.
• Was wir vielleicht in den nächsten Sommerferien tun werden.
• Was wir in 10 Jahren können werden.
•

Wie wir als Erwachsene leben wollen.
• Wer wir sein wollen.
Es ist nützlich, dass wir uns die Zukunft vorstellen können. Wir können schon jetzt planen und Dinge tun, damit diese Zukunft auch wirklich eintritt. Manchmal ist diese Fähigkeit auch nicht nützlich: Wenn uns die Zukunftsvorstellung Angst bereitet oder wir uns zu viele Sorgen machen. Wenn man nur darüber nachdenkt, dass Dinge passieren könnten, die gar nicht gut sind. Dann agieren wir viel leicht gar nicht mehr und hemmen uns somit in der Entwicklung.
Wir stellen uns häufig Fragen über die Zukunft und können sie auch vorhersagen.


Versuch es mit den folgenden Zukunftsfragen, die du im Forschungsbuch beantwortest. Begründe, warum du annimmst, dass die Zukunft so aussehen wird!
•
Wie wahrscheinlich ist es, dass du morgen zur Schule gehen wirst?
• Wie wahrscheinlich ist es, dass morgen die Sonne aufgehen wird?
• Wie wahrscheinlich ist es, dass du morgen perfekt Klavier spielen kannst?
•
Wie wahrscheinlich ist es, dass du in zwanzig Jahren perfekt Klavier spielen kannst?
•
Du kaufst dir einen Lottoschein. Wie wahrscheinlich ist es, dass du damit einen Sechser im Lotto gewinnen wirst?
• Es ist ein heißer Tag im August. Wie wahrscheinlich ist es, dass es am nächsten Tag schneien wird?
• Es ist ein regnerischer Tag im Oktober. Wie wahrscheinlich ist es, dass es am nächsten Tag auch regnen wird?
• Wie wahrscheinlich ist es, dass es morgen Schokolade vom Himmel regnen wird?
•
Wie wahrscheinlich ist es, dass es in zehn Jahren keine Kriege mehr auf der Welt geben wird?
•
Wie wahrscheinlich ist es, dass alle Menschen auf der Welt in 30 Jahren ein gutes Leben führen werden?
Setz dich mit einem anderen Kind zusammen und diskutiert eure Vorhersagen!
• Bei welchen Vorhersagen seid ihr schnell einer Meinung?
•
•


Welche Themen habt ihr länger diskutiert?

Wie unterschiedlich oder gleich habt ihr die Vorhersagen begründet?




Youlaf hat lange über die Zukunft nachgedacht und mit seiner Familie darüber gesprochen. Er hat sich die Ergebnisse aufgeschrieben:
• Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann beziehen wir uns oft auf die Vergangenheit und auf unsere Erfahrungen in der Welt – viele Sachen auf der Welt werden in der Zukunft wahrscheinlich so ähnlich sein wie in der Vergangenheit.



• Wenn wir Vorhersagen über die Zukunft treffen, dann reden wir oft davon, ob etwas wahrscheinlich eintreten wird. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir können oft unterscheiden, ob etwas möglich, unmöglich, wahrscheinlich, unwahrscheinlich usw. ist.
• Je weiter wir in die Zukunft denken, desto unsicherer sind wir, wie diese Zukunft wohl sein mag. Das heißt aber auch, dass es umso mehr Möglichkeiten gibt!
• Selbst wenn etwas unwahrscheinlich ist, kann es trotzdem passieren (z. B. dass man im Lotto gewinnt).

• Wir sind uns nicht immer einig darüber, wie die Zukunft möglicherweise aussehen wird.
Stewa hat sic h auch viele Gedanken über ihre Zukunft gemacht. Sie hatte völlig andere Einfälle als Youlaf: Wie Walentina Tereshkowa werde ich in den Weltraum fliegen. Dort entdecke ich einen Planeten, auf dem Menschen gut leben können. Dieser Planet wird dann dazu beitragen, dass die Probleme auf unserem Heimatplaneten Erde besser gelöst werden können.

•


Welche Vor- und Nachteile hätte es, wenn ein Teil der Erdbevölkerung auf einen anderen Planeten im Weltall auswandern würde?
• Kann diese Auswanderung eine Lösung für die Klima-, Armuts- und Kriegsprobleme auf der Erde sein?


Walentina wurde 1937 in der ehemaligen Sowjetunion (heute Russland) geboren. Seit ihrer frühen Jugend war sie eine begeisterte Fallschirmspringerin. Sie bewarb sich mehrmals für die Kosmonautenschule und konnte 1962 tatsächlich ihre Ausbildung beginnen. Ihren Traum, ins Weltall zu fliegen, konnte sie verwirk lichen! Am 16. Juni 1963 bestieg sie das Raumschiff „Wostok 6“ und begann ihre Reise ins Weltall. Sie war die erste Frau im Kosmos. Mit 26 Jahren umkreiste sie die Erde 48-mal und war insgesamt drei Tage im Weltall. Walentina litt sehr an der �� Weltraumkrankheit und konnte nicht alle Aufgaben perfekt umsetzen. Bis 1982 blieb sie die einzige Frau, die jemals im Weltall war. Heute sehen viele in ihr eine Heldin. 2013 teilte sie auf einer Pres sekonferenz in Russland mit, dass sie zu einem Flug zum Planeten Mars ohne Rückkehr bereit wäre. Der Mars ist ihr Lieblingsplanet. Walentina erhielt für ihre Tätigkeiten und Verdienste für die sowjetische Raumfahrt zahlreiche nationale und internationale Preise und Ehrungen.


Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigen sich mit der Zukunft. Man nennt dies „Zukunftsforschung“. Das ist eine wissenschaftliche Betrachtung von Zukunftsbildern. Die Forschenden beschäftigen sich mit möglichen, wahrscheinlichen und erwünschten zukünftigen Entwicklungen. Dabei gehen sie ähnlich vor, wie du das machst, wenn du über die Zukunft nachdenkst: Sie schauen sich die Welt genau an, wie sie ist und wie sie sich mit der Zeit verändert hat. Sie können dann voraussagen, wie sich die Welt wahrscheinlich oder möglicherweise in der Zukunft verändern wird.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich allerdings bewusst, dass es immer schwieriger wird, die Zukunft vorherzusagen, je weiter entfernt diese Zukunft ist. Auch streiten sie sich und sind nicht immer einer Meinung – es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt sich womöglich weiterentwickeln wird. Das nennt man dann ein „wissenschaftliches Streitgespräch“.
Tipp: Sieh dir einen Wetterbericht an, z. B. im Fernsehen, oder suche dir Wettervorhersagen auf dem Tablet.
•
Wie viele Tage im Voraus wird das Wetter „vorhergesagt“?
• Sagen die unterschiedlichen Wetterinstitute das gleiche Wetter voraus?




•
Gibt es Angaben dazu, wie wahrscheinlich diese Vorhersage ist?
• Warum können wir keinen Wetterbericht für die nächsten drei Monate bekommen?
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ausgerechnet, wie sich das globale Klima in der Zukunft verändern könnte. Sie haben das in der Grafik gezeigt und zwei Möglichkeiten dargestellt: Zum einen, was passieren kann, wenn die Menschen weitermachen wie bisher. Die andere Möglichkeit zeigt eine Kurve, die entsteht, wenn die Menschen ihr Leben auf der Erde verändern.



Arbeite zusammen mit einem anderen Kind.
Schreibe die Antworten auf die folgenden Fragen ins Forschungsbuch:

• Was sagen die beiden Kurven über die Zukunft der Erderwärmung aus?
• Kann die Wissenschaft eine eindeutige Voraussage für die Zukunft treffen?

• Was können die Forschenden mit Sicherheit sagen? Was ist an den Voraussa gen unsicher?




Wir Menschen verändern die Welt. Die Klimakinder haben dies – genau wie du – an vielen Beispielen erarbeiten können und dadurch bewusster wahrgenommen. Für Youlaf ist es immer noch eine wichtige Aufgabe zu klären, wie die Zukunft mit der gelebten Gegenwart zusammenhängt. Er fragt sich, welche Bedeutung das Aus sehen der Zukunft für das Leben heute hat und was die Menschen an ihrem Leben heute verändern sollten. Ellist, Stewa und Mo sind sich sicher, dass es so viele Ideen für ein gutes Leben gibt, dass die Zukunft für die Menschen gesichert ist, wenn diese mehr und mehr umgesetzt werden.
Alle vier sind sich darüber einig, dass die Zukunftsprobleme, die durch das Leben der Menschen heute entstehen könnten, bewältigt werden können. Allerdings müs sen die Menschen diese Probleme bewusster wahrnehmen und sie ernst nehmen. Davon hängt es ab, wie sich das Leben in Zukunft gestaltet.


Stell dir vor, du gehst durch eine Zeitmaschine. Das ist ein Tunnel, durch den du hindurchgehst.
Der Eingang ist das „Heute“ – wenn du hindurchgegangen bist, bist du in der „Zukunft“, 30 Jahre später. Dort triffst du ein Kind, über dessen Leben du gemeinsam mit drei Mitschülern / Mitschülerinnen eine Geschichte schreiben sollst.

In 30 Jahren hat sich die Welt mit Sicherheit verändert. Aber wie? Darüber sollt ihr nachdenken und diese Veränderungen bei der Beschreibung der Geschichte über das Leben des Kindes berücksichtigen. Die Veränderungen können in vielen Berei chen stattfinden, die aber alle etwas mit dem Verhalten der Menschen heute zu tun haben. Alle Lebensbereiche werden von der Entwicklung des Klimas beeinflusst. Die Menschen könnten ab heute alles dafür getan haben, dass sich das Klima nicht weiter erwärmt. Oder sie leben 30 Jahre lang so weiter, wie sie es jetzt tun. Die jeweiligen Folgen müsst ihr erst einmal überlegen und beschreiben.
Lest noch einmal die entsprechenden Kapitel in dem eBook nach und schaut in eure Forschungsbücher.S.90 - 93



Wie entwickeln sich in den nächsten 30 Jahren folgende Lebensbereiche:
Gerechtigkeit zwischen allen Menschen
Rechte von Tieren Mobilität und Reisen
Energieverbrauch und Energiequellen Umgang mit Kleidung


Unsere Ernährung

Die Menschen haben 30 Jahre fast so weitergelebt,wie sie heute leben:
Die Menschen haben viel gegen die Klimaerwärmung getan:
Einigt euch in der Gruppe auf ein Kind, das die Hauptfigur in eurer Geschichte sein soll. Entscheidet, ob es in Szenario 1 oder Szenario 2 lebt. Schreibt dann die Geschichte des Kindes in das Forschungsbuch.
• Wer ist das Kind? Wo und wie lebt es? Wie alt ist es?

•

Was ist für das Kind wichtig? Was sind seine Bedürfnisse? Welche Werte hat es?
• Wie hat sich die Welt um das Kind herum verändert? (Natur, Kleidung, Mobilität, Ernährung oder anderes)
• Wie sieht ein normaler (Schul-)Alltag für das Kind aus?
• Wofür interessiert sich das Kind? Wofür setzt es sich ein?
• Was fehlt dem Kind? Welche Zukunftsträume hat es?
• Welche Probleme in der Umwelt bemerkt das Kind? Welche Lösungen entwickelt es?



Lest die Geschichte der gesamten Lerngruppe vor.
• Diskutiert darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass die Geschichte so passieren wird.
• Hat das jeweilige Kind ein gutes Leben?


• Lebt das Kind in einer Welt, in der ihr auch leben möchtet?
• Handelt es sich dabei um eine Welt, in der ihr nicht leben wollt?
• Kann die erzählte Welt von den Menschen wirklich erreicht werden?
Die Zukunft gestaltet sich nicht von allein. Sie wird beeinflusst davon, was die Menschen tun. Du hast nun Vorstellungen davon, wie eine Zukunft aussehen kann, in der du leben möchtest. Damit diese Zukunft eintritt, sollten die Menschen etwas tun und ihr Verhalten verändern. Viele Menschen erkennen darin aber keinen Sinn oder sie haben keine Freude daran, weil es anstrengend ist, etwas zu verändern.






Deswegen streiten sich Menschen oft darüber, was man tun sollte. Niemand will sich sehr anstrengen oder auf etwas verzichten. Meistens hat man das Gefühl, dass es ungerecht ist, weil andere Menschen sich nicht ändern. Man muss sich am besten auf Regeln und Verhaltensweisen einigen–dann fällt es allen leichter, sich daran zu halten, und niemand fühlt sich ungerecht behandelt.
Stimmt! Darauf hat doch die Wissenschaftlerin Elinor Ostrom hingewiesen. In ihren Forschungen hat sie herausgefunden, dass die Menschen zusammenarbeiten und sich einigen müssen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Es reicht nicht aus, wenn jeder nur an sich denkt. Das war die Geschichte von den Fischern in der 2. Klasse!
Dieses Sprichwort kann dir Mut machen. Denn oft fühlt es sich so an, als wenn du als Kind nichts gegen den Klimawandel und für ein gutes Leben in der Zukunft tun kannst. Das stimmt aber nicht! Gemeinsam in der Lerngruppe könnt ihr die Dinge zusammentragen, die jedes Kind allein machen kann. Sammelt alle Ideen und gestaltet eine große Mindmap, die ihr im Klassen raum aufhängen könnt. So werdet ihr immer wieder daran erinnert und könnt Schritt für Schritt etwas für ein zukünftiges gutes Leben für alle tun.








Kinder haben viele gute Ideen, wie man ein Leben für die Zukunft gestalten sollte. Viele Möglichkeiten habt ihr in der Lerngruppe erarbeitet und in Geschichten festgehalten. Es wäre sehr schade, wenn niemand anderes, vor allem nicht die Erwachsenen, die noch viel mehr für das Klima tun könnten als ihr, davon erfahren würde.

Eine Pressekonferenz ist dafür da, dass eine Person oder eine Institution viele Men schen über ein bestimmtes Thema informiert. Die Journalisten und Journalistinnen haben sich gut vorbereitet und stellen viele, auch kritische Fragen.
Ihr schlüpft bei der Pressekonferenz in die Rolle der Schreibenden, die viel Wissen über verschiedene Zukunftsszenarien haben. Die ein geladenen Menschen sollen eure Fragen zum Klimawandel und zu eurer Zukunft in 30 Jahren beantworten. Die Fragen bereitet ihr in der Lerngruppe vor. Tipps dafür findet ihr im Forschungsbuch.
Nach der Pressekonferenz schreibt ihr dann einen Artikel für die Schulzeitung. Manchmal stellen sich bekannte Politiker / Politikerinnen den Fragen von Kindern. Auch Angela Merkel, die 2005 als erste Frau zum ersten Mal Bundeskanzlerin von Deutschland wurde, hat mit Kindern geredet. Auf einer Kinderpressekonferenz im September 2017 haben 100 junge Reporter und Reporterinnen Angela Merkel Fragen gestellt.

Eine Frage war, was sie gern geworden wäre, wenn sie nicht in die Politik gegan gen wäre. Ihre Antwort: „Eine Astronautin, die um die Erde fliegt und sich das alles mal von oben angucken könnte.“ Einige Kinder stellten ihr kritische Fragen: „Warum gibt es immer noch Energie aus Kohle? Was tun sie für den Klimawandel? Warum gibt es Massentierhaltung?“. Auch hier versuchte Frau Merkel, verständliche Antworten zu geben. Eine zentrale Aussage von ihr war: „Wir arbeiten daran.“ Heute müssen das andere Politiker tun. Es waren zwischenzeitlich Wahlen und Frau Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin.


Das Thema könnte heißen: Unser Leben in 30 Jahren.

Überlegt gemeinsam, wen ihr zur Pressekonferenz einladen könnt! Wem möchtet ihr am liebsten eure Fragen stellen?
Welche Fragen wollt ihr der Person oder den Personen stellen?


Wie soll die Pressekonferenz organisiert werden? Wer übernimmt welche Arbeit?
Tipps dazu findet ihr im Forschungsbuch!

/ Stadträtinnen

verschiedenen
für
für


Eine weitere Möglichkeit, um andere Menschen zu informieren, ist die Erstellung einer Kinder- oder Schulzeitung. Eine Schüler-/Schülerinnenzeitung ist eine Zeit schrift, die Schulkinder für Schulkinder machen. Sowohl die Schreibenden als auch die Zielgruppe sind meist Schüler und Schülerinnen, ehemalige Schulkinder, Lehrer und Lehrerinnen und manchmal auch Eltern. In der Schulzeitung können Schüler und Schülerinnen im Sinne des Grundgesetzes ihre Meinung frei äußern.


Tauscht euch in der Lerngruppe über folgende Fragen aus:
•
Welche Kinderzeitungen kennst du?
• Hast du selbst ein Zeitungsabonnement?


• Gibt es an eurer Schule eine Zeitungsredaktion?

•

Treffen sich Schüler und Schülerinnen zu regelmäßigen Redaktionstreffen?
Ich habe eine sehr spannende Kinderzeitung gefunden, die in Leipzig entsteht.
Sie heißt ��Flippo und man kann sie online lesen. Ich habe erfahren, dass alle interessierten Kinder an den monatlich stattfindenden Redaktionssitzungen teilnehmen können. Sie einigen sich erst auf ein Thema aus Stadt und Gesellschaft, Natur und Umweltschutz, Fake News und gesunde Ernährung oder ähnliches. Dann recherchieren sie und gestalten die Zeitung. Das finde ich richtig cool!

Du hast dich gemeinsam mit den Kindern aus deiner Lerngruppe über lange Zeit mit den Themen rund um den Klimawandel beschäftigt. Du hast dir viel Wissen angeeignet, weißt über die Probleme Bescheid und auch, welche Wege die Menschen einschlagen müssten, um die Erderwärmung aufzuhalten. Du hast dir gemeinsam mit den anderen Kindern Szenarien überlegt, wie das Leben auf der Erde in 30 Jahren aussehen könnte. Das sind spannende Themen für eine Zukunftszeitung, die dann von allen Kindern, Lehrkräften und Eltern deiner Schule gelesen werden können!
So geht es:


1. Schreibe einen Text, der die Informationen beinhaltet, die du weitergeben möchtest.
2. Überlege dir eine Überschrift, die die anderen Kinder neugierig macht.

• Soll die Zeitung auf Papier gedruckt werden? Wo kann das passieren?
• Soll die Zeitung im Internet / auf der Schulwebsite erscheinen? Wer kann dabei unterstützen?



3. Gestalte den Text / die Seite mit passenden Bildern und Zeichnungen.

• Denkt an die verschiedenen Personengruppen in eurem Ort (siehe S. 138, Pressekonferenz).
• Bittet die Schulleitung eurer Schule um eine Schulversammlung, auf der ihr eure Zukunftszeitung vorstellen könnt.
4. Überlege gemeinsam mit allen anderen Kindern in der Lerngruppe:
5. Erstellt eine Liste, wem ihr die Zukunftszeitung zusenden möchtet.










IMPRESSUM
eBook KLIMA.LEBEN | Klasse 4
Herausgegeben vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)
Wilhelm-Buck-Straße 2 01097 Dresden
Bürgertelefon: +49 351 564-20500
E-Mail: info@smekul.sachsen.de

Die Materialien sind im Rahmen der Initiative „Klimaschulen in Sachsen“ entstanden. Die Initiative ist eine gemeinsame Initiative der Sächsischen Staatsministerien für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie Kultus.
Dr. Brunhild Landwehr (Universität Leipzig, Grundschuldidaktik (GSD) Sachunterricht)
E-Mail: Sachunterricht@uni-leipzig.de
Karl Wollmann (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht Naturwissenschaft und Technik (NawiT))
Dr. Brunhild Landwehr (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht)
Dorotheé Bauer (Universität Leipzig, GSD Werken)
Florian Böschl (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Melanie Haltenberger (Universität Augsburg, Didaktik der Geographie)
Dr. Susan Hanisch (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Pauline Kalder (Universität Leipzig, GSD Werken)
Alexandria Krug (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Jörg Mathiszik (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Dr. Victoria L. Miczajka (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Thomas Ottlinger (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Heike Rauhut (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht Sozialwissenschaft)
Elisabeth Wilhelm (Universität Leipzig, ZLS, GSD Sachunterricht und GSD Englisch)
Falk Böttcher (Deutscher Wetterdienst)
Cyndia Hartke, Lüneburg
Genese GmbH, Magdeburg
Kathrin Andreas, Bochum
© Annette Kitzinger, www.metacom-symbole.de

Link
https://greenpeace.berlin/2013/03/ waldkampagne/
Kerstin Dörenbruchpresse@ greenpeace.berlin
(pixabay) 2175767 https://pixabay.com/de/photos/windsackflugplatz-himmel-wind2175767/ herbert2512
84815188 https://stock.adobe.com/de/images/ regenmesser/84815188
58135803 https://stock.adobe.com/de/ images/analoges-hygrometerundthermometer/58135803
160451853

https://stock.adobe.com/de/images/ weather-dial/160451853
(pixabay) 789898 https://pixabay.com/de/photos/ thermometer-temperatur-messung-789898/

136389881
https://stock.adobe.com/de/images/ panoramic-skyline-of-leipzigwithtownhall-and-high-court-at-sunsetgermany/136389718?asset_id=136389881
269685600
https://stock.adobe.com/de/images/ logging-aerial-drone-view-ofdeforestationenvironmental-problem/269685600
Alexandru Strujac
Jakob Fischer
(pixabay)
365538555
https://stock.adobe.com/de/images/heartlove-lake-near-by-leipziggermany/ 365538555
https://pixabay.com/de/photos/elbeelbsandsteingebirge-sachsen171066/
https://stock.adobe.com/de/stock-photo/ baulucke-in-derstadt/158798709
https://stock.adobe.com/de/images/carparking-lot-viewed-fromabove-aerial-view-topview/119623559
https://stock.adobe.com/de/images/lushrainforest-with-morningfog/ 156095781
Simon
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
205841572
https://stock.adobe.com/de/images/ zwei-einsame-schwimmer-imbecken-einesfreibades/205841572
www.gg24.de
92124865
84815188
https://www.istockphoto.com/de/foto/letztewasser-dry-creekgm921248654803724
https://stock.adobe.com/de/images/ soil-erosion-on-a-cultivatedfield-after-heavyshower/87476313?prev_url=detail
(pixabay) 2708311 https://pixabay.com/photos/agricultureharvest-2708311/
255887483 https://stock.adobe.com/de/images/ dragonfly-sitting-on-whiteflowers/255887483
414602122
159679908
https://stock.adobe.com/de/images/c-h-e-mn-i-t-zgermany/414602122
https://stock.adobe.com/de/images/forestfire-wildfire-burning-treein-red-and-orangecolor/159679908?prev_url=detail
219532040 https://stock.adobe.com/de/ images/sturmschaden-im-waldnachorkan/219532040?prev_url=detail

112848695
https://stock.adobe.com/de/images/ waldsterben-totholzborkenkafer/112848695? prev_url=detail
381515249
https://stock.adobe.com/de/images/ wiederaufforstung-durchneuanpflanzung-immischwald/381515249?prev_url=detail
216956927 https://stock.adobe.com/de/images/ ausgetrockneter-flussschwarzeelster/216956927?prev_url=detail
https://stock.adobe.com/de/images/dresdenblaues-wunder-arealduring-inundation-2013elbe-840cm-h/53100917?prev_url=detail
https://stock.adobe.com/de/images/ river-by-abandoned-factoryagainst-cloudysky/319921927?prev_url=detail

Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
26 2 53652073
https://stock.adobe.com/de/ images/hochwasser-2013linzosterreich/53652073?prev_url=detail
27 2 113903915
https://stock.adobe.com/de/images/ pflanzen-auf-einem-feld-nachunwetteruberflutet/113903915?prev_url=detail
27 2 265402889
https://stock.adobe.com/de/images/heavyrains-in-the-midwest-arecausing-flooding-offarm-fields-and-delaying-planting-of-cornandbeans/265402889?prev_url=detail
1 824230852
https://www.istockphoto.com/de/foto/ luftaufnahme-des-%C3%BCberfluteten%C3%A4ckern-nach-sturm-mit-starkregenindeutschland-gm824230852-133458783
2 278669351
https://stock.adobe.com/de/images/lookingdown-at-soybeansplanted-into-a-cereal-ryecover-crop/278669351?prev_url=detail
217638712
886110078
https://stock.adobe.com/de/images/moorse eausgetrocknet/217638712?prev_url=detail
https://www.istockphoto.com/de/foto/ hufeisenkleegelblinggm886110078246103191?
238952727
https://stock.adobe.com/de/images/ schmetterlinge-deutschlandschwarzertrauerfalter/238952727?prev_url=detail
161665292

https://www.istockphoto.com/de/foto/baumtunnel-gm16166529221678580
226068220 https://stock.adobe.com/de/images/ vertrocknetes-maisfeld-imsommerdeutschland/226068220?prev_url=detail
https://stock.adobe.com/de/images/ grossbewasserung-2/69643973?prev_ url=detail

Seite
364799921
Link zur
1012405448
https://stock.adobe.com/de/images/appleplantation-farm-withgreen-trees-and-ripefruits-covered-with-net-against-birds-andotheranimals/364799921?prev_url=detail
https://www.istockphoto.com/de/foto/ rhein-mit-niedrigemwasserstandk%C3%B6lngm1012405448-272719170l
178608978
https://www.istockphoto.com/de/foto/ zugangsrampe-zur-u-bahnparkh%C3%A4userganz-%C3%BCberfallen-hat-vonwatgm178608978-24907966
1 831829448
https://www.istockphoto.com/de/foto/ b%C3%A4ume-pflanzen-mitschutzrohreplantacion-de-arboles-con-tubos-deprotecciongm831829448135335925
1203984368
https://www.istockphoto.com/de/foto/ wohnungen-mit-flachd%C3%A4chernmit-rasen-bedeckt-von-oben-geschossengm1203984368346255502

374701261
https://stock.adobe.com/de/images/ drainage-ditch-aeration-withlawn-greenaltorki/374701261
https://pixabay.com/de/photos/infernofeuer-flamme-flammen-218078/
https://stock.adobe.com/images/ solaranlage-auf-mehrfamilienhaus/6552232
https://www.istockphoto.com/de/ foto/f%C3%A4sser-mit-radioaktivenabf%C3%A4llen-isoliert-auf-weissherstellung-von-kernkraft-undgm1126935527-296855667
https://pixabay.com/de/photos/ stromz%c3%a4hler-strom-zahlenenergie-96863/

https://www.istockphoto.com/de/foto/ ammeter-gm159050005-22645830
Владимир Феофанов
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
1 696071330

https://www.istockphoto.com/de/vektor/ neue-eu-elektro-backofenenergetische-labelgm696071330-128895179
1 537371028
https://www.istockphoto.com/de/ foto/3d-rendering-des-modernenhausinnen-mit-unabh%C3%A4ngigen-energie-stgm53737102895243669
2 427968800
2 368422641
https://stock.adobe.com/de/images/karpaczz-lotu-ptaka-padziernik-2020/427968800
https://stock.adobe.com/de/images/ ronkhausenpumpspeicherwerk-und-glingetalsperre-sauerland/368422641
P.S.DES!GN
1 1197855596
https://www.istockphoto.com/de/foto/ konzept-der-wasserstoffenergiespeicherungaus-erneuerbaren-quellen-windkraftanlagen gm1197855596-342144891
2 96079742
https://stock.adobe.com/de/images/youngwoman-is-hiking-inhighlands-of-altai-mountainsrussia/96079742?prev_url=detail
112963201
https://stock.adobe.com/de/images/terracerice-fields-baliindonesia/112963201?prev_ url=detail
3014467
https://pixabay.com/de/photos/ basteibr%C3%BCcke-s%C3%A4chsischeschweiz-3014467/

83062064
257531049
https://stock.adobe.com/de/images/hotelroom/83062064 krsmanovic
https://stock.adobe.com/de/images/ beautiful-view-of-outdoorswimming-poolarea-with-clear-blue-water-sunbeds-andumbrellaaround-view-of-the-sea-shore-withfigures-of-tourists-summervacation-and-tourismconcept/257531049
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
76 2 330428777
https://stock.adobe.com/de/images/ summer-tourists-crown-st-marks-plaza-in-veniceitaly/330428777
76 2 194293457
https://stock.adobe.com/images/ overcrowded-venice-during-carnival-2018italy/194293457
76 3 (Pexels) 1320686
76 3 (Pexels) 4603275
79 2 229408744
https://www.pexels.com/de-de/ foto/landschaftsfotografie-von-beachresort-1320686/
https://www.pexels.com/de-de/foto/grunesund-gelbes-korallenriff-unter-wasser-4603275
https://stock.adobe.com/de/images/italybeauty-like-a-horror-moviescene-giganticcruise-ship-leaving-venice-venezia/229408744
80 2 47415906
https://stock.adobe.com/de/ images/tropical-island-in-indianoceanmaldives/47415906?prev_url=detail
81 2 329805729
https://stock.adobe.com/de/images/ beautiful-woman-taking-pictureoutdoorswith-a-dslr-camera-young-blonde-womanprofessionalphotographer-taking-pictures-of-abeautiful-nature-surrounding-herwarm-sunnyday-in-lavender-field/329805729
2 120404350

2 422382536
https://stock.adobe.com/de/stock-photo/ writing-on-s-street-inbarcelona/120404350
https://stock.adobe.com/images/happy-boywith-blue-djellaba-takes-notes-in-notebooknext-to-world-map/422382536

2 58226495
https://stock.adobe.com/images/ interior-of-modern-holstein-friesian-cowstable/58226495
1 936943076
https://www.istockphoto.com/de/foto/fleischprobe-im-laborgm936943076256306914
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
103 3 (Pexels) 6546025
104 1 528048348
https://www.pexels.com/de-de/foto/ lebensmittel-mittagessen-mahlzeitvegetarier-6546025/
https://www.istockphoto.com/de/foto/ kleines-m%C3%A4dchenschneiden-zwiebelnauf-dem-k%C3%BCchentresengm52804834892884225
106 1 1319871686
https://www.istockphoto.com/de/vektor/ der-k%C3%BCchenchef-tr%C3%A4gt-einenriesigen-teller-mit-einem-gro%C3%9Fenmehlwurm-darauf-gm1319871686-406610840
alashi 113 1 1129140320
https://www.istockphoto.com/de/vektor/altekleidung-gm1129140320-298169277 laymul
114 1 1268389214
https://www.istockphoto.com/de/vektor/ diy-tasche-aus-hose-silhouette-skizzenhaftesbild-von-handgefertigten-upcyclegm1268389214-372293536
115 2 63765050
https://www.istockphoto.com/ de/vektor/vektor-jeans-elementegm164452337-19168384
115 1 164452337
https://stock.adobe.com/de/images/ beautiful-woman-taking-pictureoutdoorswith-a-dslr-camera-young-blonde-womanprofessionalphotographer-taking-pictures-of-abeautiful-nature-surrounding-herwarm-sunnyday-in-lavender-field/329805729
2 271160740
https://stock.adobe.com/de/images/ second-hand-baby-clothes-in-aboxplaced-on-the-windowsill-to-give-as-a-giftzuverschenken/271160740
2 266180388

https://stock.adobe.com/de/images/secondhand-clothing-vintagefashionon-flea-market-berlin/266180388?prev_ url=detail
2 294493281
https://stock.adobe.com/de/images/eingebasteltes-pferd-ausschwimmnudel-undsocke/294493281?prev_url=detail

Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
118 2 115444235
https://stock.adobe.com/de/images/ sidewalk-library-in-residentialneighborhood/1 15444235?prev_url=detail
121 1 1349609402
https://www.istockphoto.com/de/vektor/ kleidung-sortieren-ein-haufen-kleidung-derzuf%C3%A4llig-auf-dem-boden-liegt-boxenmit-gm1349609402-426122909
131 2 26089879
https://stock.adobe.com/images/tereshkovavalentina-fist-female-in-space/26089879
konstantant 134 2 379221328
https://stock.adobe.com/images/portal-ortime-machine/379221328

138 2 290127841

https://stock.adobe.com/de/images/childrenparticipate-with-amicrophone-recite-poemsrecitation-sing-songs/290127841
METACOM Symbole © Annette Kitzinger, www.metacom-symbole.de
Alle nicht aufgeführten Bilder stammen von den Autorinnen und Autoren selbst.

