
5 minute read
Hohe Ziele, unsichere Konzepte und Irrtümer der Gründerzeit
Dass die NVG- Bewegung mit einem Kleintierzüchterverein begann, darf als Laune des Zufalls verstanden werden, weil man ja einen Trägerverein für das aus der Güterzusammenlegung freiwerdende Land benötigte. Der Gedanke eines integralen Naturschutzes entsprach aber in keiner Weise den Ornithologen, welche von der Gründung bis in die 60er-Jahre das Sagen hatten. Die Vögel spielten die zentrale Rolle, wie in vergleichbaren Naturbewegungen dies Schmetterlinge oder Orchideen waren, Begriffe wie Ökologie, Lebensräume, Biotope oder gar Biodiversität waren kaum bekannt oder ihre Bedeutung noch nicht ins Bewusstsein interessierter Laien gedrungen. Amphibien oder Insekten wurden kaum erwähnt, Ameiseneier (=Larven) nur im Zusammenhang mit der Herstellung von Vogelfutter während des Krieges! Die Vögel waren unter den freilebenden Tieren die lieblichsten Partner der menschlichen Gesellschaft, und für diese musste Lebensraum, Nahrung und Brutmöglichkeiten geschaffen werden. Man dachte sogar innerhalb des Vogelschutzes in Begriffen wie «Nützlinge und Schädlinge», Krähen und Elstern gehörten zu den Letzteren, weil sie sich gelegentlich von Singvögeln ernähren. Bis in die frühen 70er-Jahre gehörte die Beschaffung für Winterfutter zu den Aufgaben der NVG. Der Vogelschutz blieb während 75 Jahren immer ein Sonderressort im Vorstand; andere Spezialaufgaben wurden geschaffen und verschwanden wieder.

Advertisement
Die damalige moderne Landwirtschaft gehörte wohl kaum zu den engsten Verbündeten der NVG, weil Landmeliorationen, maschinelle Bearbeitung und beginnender chemischer Pflanzenschutz als eine aufziehende Gefahr wahrgenommen wurden. So machte Ernst Wiesmann in einer Ansprache kurz nach dem Kriege die Bemerkung, «dass man sich damals (im Kriege) am besten still ins Gras geduckt habe, um nicht die Aufmerksamkeit des schweizerischen Anbaugenerals Wahlen auf sich zu ziehen» Man bedenke: Traugott Wahlen genoss damals in bürgerlichen und besonders bäuerlichen Kreisen oft eine Verehrung, welche diejenige von General Guisan überstieg!

Grütried-Signet aktuell
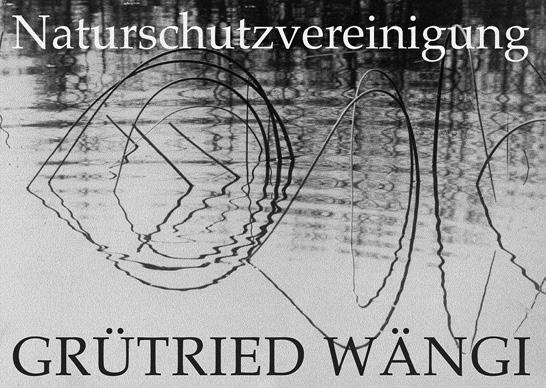
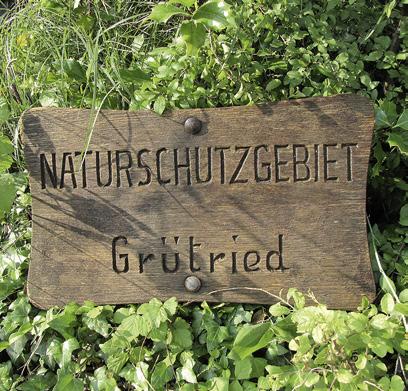
Alte Tafel, ca. 1970
Eine Sonderstellung in der Landwirtschaft hatten die Pomologen (Obstbaumpfleger); ihre Arbeit beeinflusste positiv oder negativ die Lebensgrundlage der Vögel.
Auch die Pflanzenwelt hatte anfangs diesen dienstbar zu sein, ihre Heimat waren damals Baumund Buschwerk. Die etwa drei Hektar grosse Riedfläche war ausser einigen kleinen Randzonen reine Schilf- und Seggenzonen ohne Bäume und Sträucher, solche konnten wegen der jährlichen Mahd zur Gewinnung von Viehstreue nicht aufkommen. Bis zum Kriegsbeginn wurden weit über 1000 Baum- und Buscharten gepflanzt. Da anspruchsvollere Bäume wie Fichten, Tannen und Hainbuchen, Ebereschen und Ahornarten einen Wurzelbereich über dem Wasserniveau verlangten, wurde kleine Dämme aufgeschüttet. Dabei entstanden die Tümpel als Nebenprodukt, welche dann später eine Umdeutung als Amphibienlaichstätten erfuhren! Da aber die Rehe den Jungpflanzen arg zusetzten, wurde das Ried mit einem Gitterzaun versehen, teilweise aber auch mit eng gepflanzten Schlehenhecken. Während einer kurzen Zeit wurde sogar ein Riedwächter eingesetzt, welcher pro Tag zwei Rundgänge ausführen musste, allerdings nicht nur um Rehfrass zu verhindern, sondern Schäden einzudämmen, welche durch «übelgesinnte» Besucher entstanden!
Im Herbst 1936 wurde in den zwei renommierten Blättern, der Neuen Zürcher Zeitung und der Zürcher Illustrierten in Beiträgen unter dem Titel «EIN DORF SCHÜTZT SEIN RIED» auf das mutige Unternehmen in Wängi mit einem Bildbericht hingewiesen und als eines der schönsten Erholungsgebiete so nahe am Sonnenberg empfohlen .

Allerdings so optimistisch wie es in den Zeitungsberichten angekündigt wurde, ging die Entwicklung nicht weiter. Die vielen Jungpflanzen in den Randzonen begannen das Landschaftsbild zu verändern und zudem verwandelte der Wegfall des Streuemähens schon 1938 das Ried in eine «dschungelhafte Wildnis». Zwei auswärtige Initianten regten zudem die Aushebung einer grossen Wasserfläche für die Aufzucht von Enten an. In den bestehenden Tümpeln wurden in speziellen Körben Rhizome von Wasserpflanzen versenkt, Geschenke des Pflanzenzentrums Oeschberg/BE und Hauenstein Rafz. Vom Botanischen Garten Zürich (Prof. Däniker) wünschte man Gelbe Teichrosen (Nuphar luteum). Den Rektoraten der Kantonsschule Frauenfeld und des Seminars Kreuzlingen wurde in Briefen die baldige Eröffnung eines kantonalen botanischen Schulreservates angekündigt, und man bat um mindestens ideelle Unterstützung.
Signet nach erfolgreichem Kauf der Eichenallee von den Gebrüder Walter, verschwindet aber wieder, als keine Jahresberichte mehr gedruckt werden. (NVG)

Gründungssignet nach einem Linolschnitt von Ernst Wiesmann, nur für zwei Jahresberichte verwendet. (NVG)

Offizielles Naturschutz-Signet wird übernommen
Dr. Heinrich Tanner (OMW)


Dr. August Schläfli 1989 (AS)
Dies schien der damaligen Aufsichtsbehörde, der Naturschutzkommission der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft unter der Leitung von Dr. H. Tanner doch mit etwas zu grosser Kelle angerührt. Es folgte ein nicht gerade liebenswürdiger Briefwechsel. Man warf den Wängenern vor, sie wollten eine Parkanlage schaffen, welche sehr wenig mit Naturschutz zu tun hätte! Für damalige Fachleute war jeder menschliche Eingriff in einem Schutzgebiet schädlich, Pflanzen durften nur angesiedelt werden, wenn ihr Vorkommen in früheren Zeiten nachgewiesen werden konnte, was auch heute noch gilt. Dass man es im Grütried damals in Sachen Standorttreue nicht gerade ernst nahm, zeigt noch die heutige Flora: In der oben erwähnten NZZ wird die Wiederansiedlung des Pfeilkrautes lobend erwähnt, welches auch heute im südwestlichen Teil rund um den Klärweiher noch gut gedeiht. Es handelt sich aber um eine amerikanische Art (Sagittaria latifolia)! Auch wurden nicht nur weisse Seerosen (Nymphaea alba) eingepflanzt, sondern rötliche und gelbliche, wie wir diese von den berühmten Bildern von Claude Monet kennen. 1970 wurde dann endlich der letzte Rhododendronstock entfernt!
Heute versteht man die Naturschutzkommission, welche sich über die gar leichtfertige Florenbereicherung beschwerte. Gleichzeitig widersetzte sich diese aber dem Streueschnitt, welchen man einzelnen ehemaligen Riedbesitzern noch erlaubte. Die Folge davon war eine rasante Verbuschung, die noch heute bekämpft werden muss. Die Auseinandersetzungen auch mit andern Gremien gingen so weit, dass J. Debrunner vorschlug, alt Bundesrat Häberlin aus Frauenfeld als Vermittler zwischen den verschiedenen Fronten einzusetzen. Dieser konnte sich dafür nicht erwärmen und mahnte zu einer «vernünftigen Bescheidenheit». Der Zweite Weltkrieg brachte andere Sorgen und drosselte die Naturschutzaktivitäten gewaltig. Zu den menschlichen Versorgungsproblemen kamen noch die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Vogelfutter für die Winterfütterung. Die Aktivitäten in den Schutzgebieten sanken in dieser Zeit auf ein Minimum, und vielleicht war dies eine heilsame Pause für das Unternehmen Grütried .
Eine Generation später war Dr. August Schläfli, neuer Präsident der Naturschutzkommission, glücklicherweise häufigerer Gast im Grütried als seine Vorgänger. Er brachte auf freundlich-diplomatische aber verbindliche Art den Präsidenten und Hauptpfleger Johann Hasler dazu, die Fremdlinge nicht etwa auszurotten, sondern in eines der privaten Feuchtbiotope umzusiedeln, welche damals überall entstanden.

Eichblattkreuzspinne entdeckt am Erlebnistag vom 25. Juni 2011










