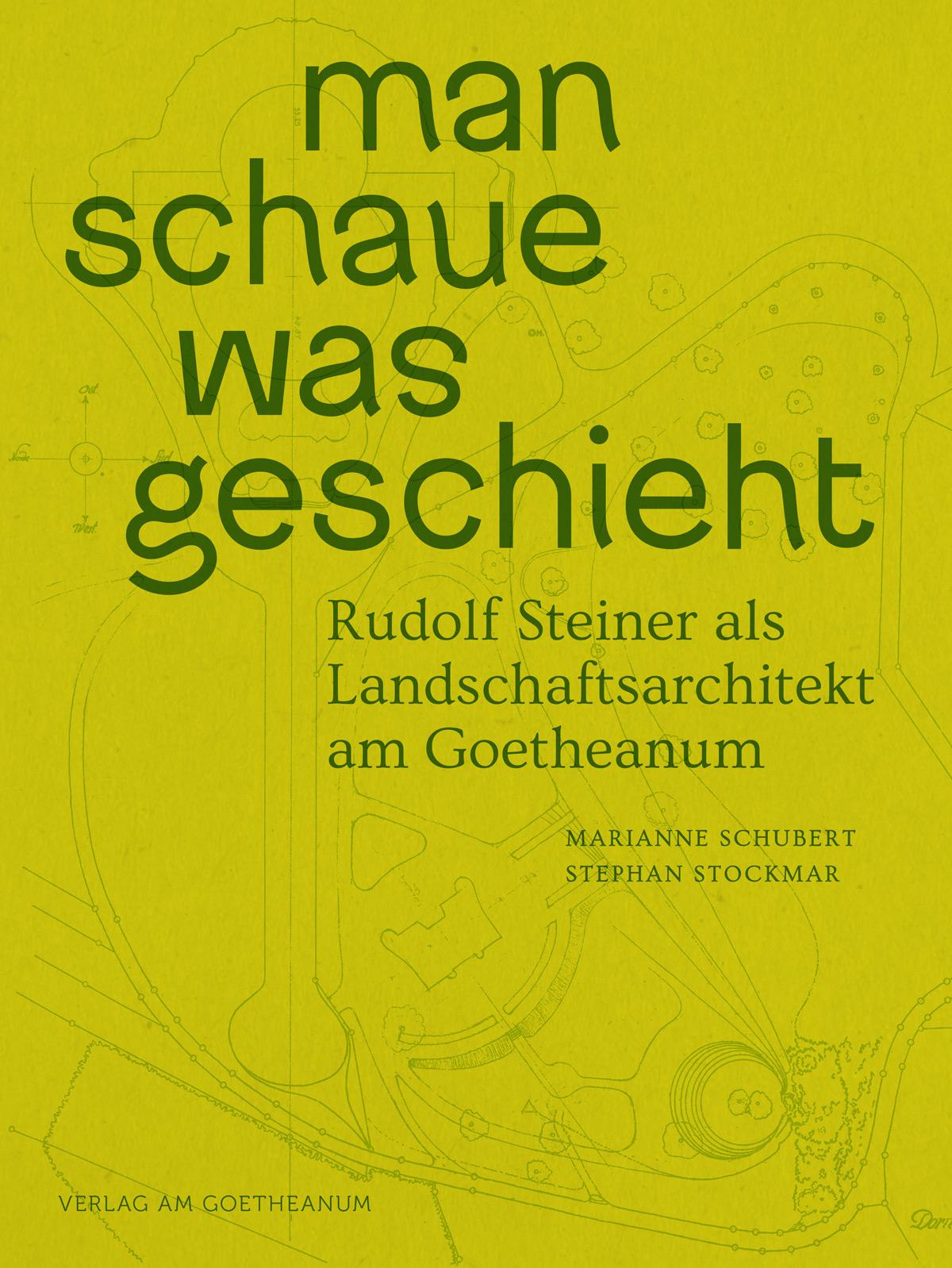
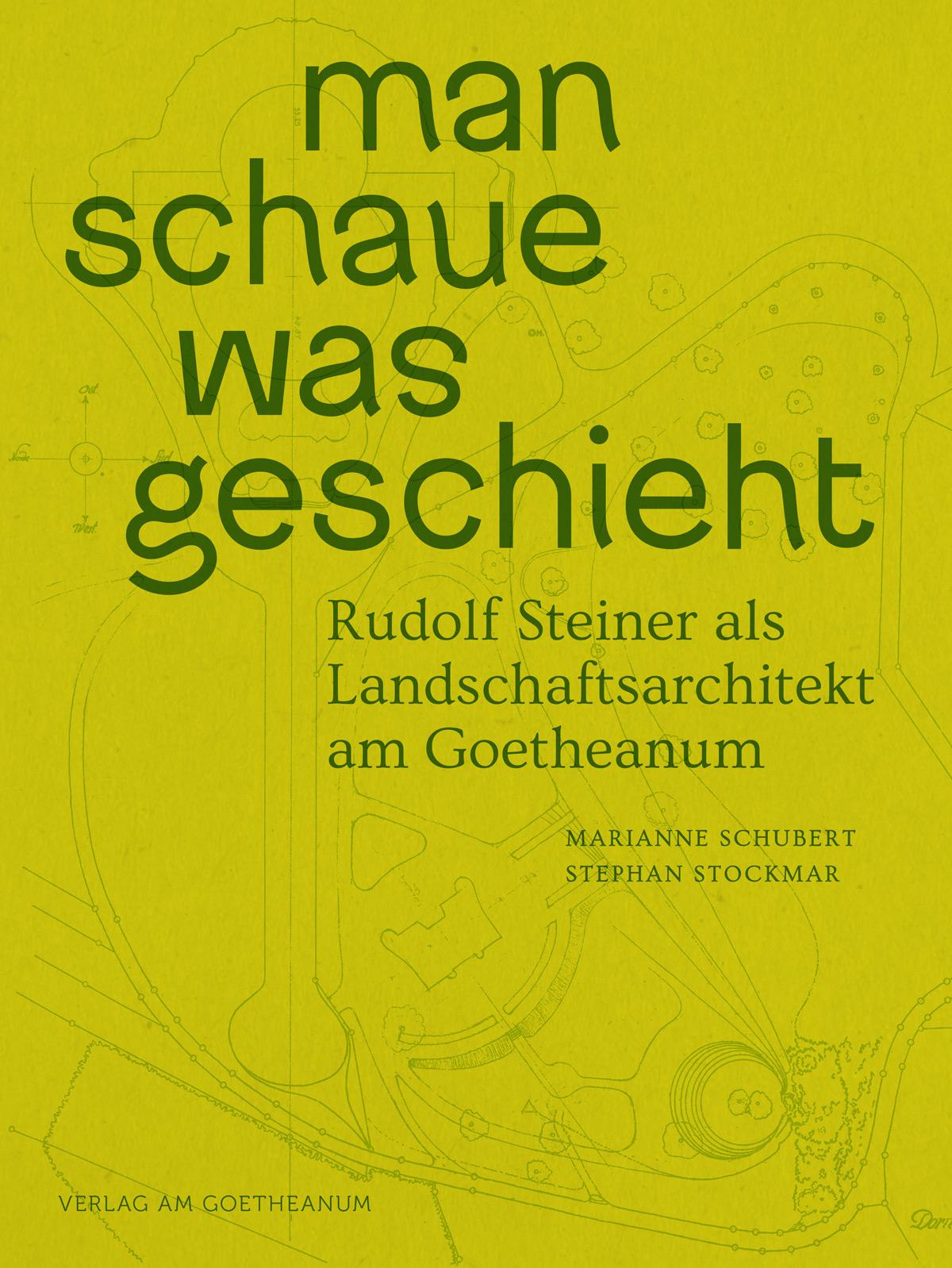
man schaue was geschieht
Rudolf Steiner als Landschaftsarchitekt am Goetheanum
MARIANNE SCHUBERT & STEPHAN STOCKMAR
Mit Beiträgen von RUDOLF KAESBACH
JOHN BERG
HANSJÖRG PALM
HERMANN RANZENBERGER
ALEXANDER SCHAUMANN
CLAUDIA D. SCHLÜRMANN
Der Gartenpark am Goetheanum
Dieses Buch möchte durch Beschreibungen und Bilder den Blick öffnen für ein lebendiges Kunstwerk in der Landschaft. Entstanden vor etwa hundert Jahren, haben sich die Gartenanlagen rund um das Goetheanum immer wieder anders gezeigt. Stärker noch als die Gebäude, der umbaute Raum, waren die Orte im Garten und die Pfanzen selber nicht nur den natürlichen Alterungs- und Witterungsvorgängen ausgesetzt, sondern auch der wechselnden Nutzung durch die Menschen vor Ort. So wurde das Gelände rund um das Goetheanum entsprechend den Erfordernissen und Prioritäten der Zeit angepasst: Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Augenmerk vorwiegend auf dem Gemüseanbau, in den 1980er Jahren auf der Anlage und Erforschung von ökologischer, standortgerechter Bepfanzung. Teile des Geländes wurden je nach Bedarf als Zufahrt und Parkmöglichkeit umgewidmet. In den letzten 30 Jahren hat sich das Bewusstsein für den ästhetischen Impuls Rudolf Steiners geschärft und seine Setzungen in Architektur, Plastik, Malerei und Landschaftskunst erfuhren eine neue Würdigung, das Werk wurde neu angeschaut aus dem Blickwinkel einer anderen Generation.

So war es naheliegend, dass sich die Landschaftsarchitektin Marianne Schubert nach intensiver Beschäftigung mit dem Gelände in den 1990er Jahren und während ihrer Tätigkeit als Leiterin der Sektion für Bildende Künste mit Passion der Erforschung des Gartenparks widmete. Gemeinsam mit dem Biologen und kulturwissenschaftlichen Autoren Stephan Stockmar drang sie dabei in den Archiven immer tiefer in die Hintergründe der Freiraumgestaltung der Goetheanumbauten vor.
Dieses Landschaftskunstwerk ist nicht nur im Hinblick auf seine äußeren Setzungen anfällig – eine überwucherte Bodenskulptur hier, eine geänderte Wegführung, überalterte, gefällte oder ergänzte Baumpfanzungen dort – all das kann nicht nur den Charakter des Ganzen verändern, sondern es wandeln sich dadurch auch die Wahrnehmungsbedingungen der Besucher.
Nur der geschulte und geübte Blick nimmt beim Gang durch den Park Bezüge wahr. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit kann beispielsweise den Ausblick in die Weite in ein Spannungsverhältnis setzen zu dem, was sich in unmittelbarer Nähe befndet, kann eine Kontur der Architektur, ein hervordrängendes Volumen, eine aufgespannte Fläche zusammenschauen mit der Geste der dahinter sichtbaren Landschaft, kann ein Gebäudeensemble als eine sich wandelnde Abfolge von aufeinander bezogenen Formen erleben. Erst der «weiche Blick» bringt Nähe und Ferne in ein Gespräch, lässt die Stimmung wechselnder Himmel mit dem jeweiligen Standort zusammenklingen.
Das alles braucht Zeit und Wiederholung, denn die vielschichtigen Erlebnisse in diesem Garten können sowohl kraftvoll als auch sehr zart sein, gleichen häufg eher Anmutungen und Ahnungen, die sich nur allzu leicht dem weitereilenden Schritt, dem Alltagsbewusstsein, den äußeren Notwendigkeiten unterordnen oder entziehen. Und doch ist es gerade diese Hinwendung zu der ganz eigenen, individuellen Sichtweise, die den Boden für ein imaginatives Schauen bereitet.
Wie jedes Kunstwerk ist auch ein Landschaftsgarten zunächst eine Einladung zum Verweilen und Schauen, zum Verlassen unwillkürlicher Sehgewohnheiten. So wie ein aufgerichteter Stein in der Landschaft zu Zeiten der Megalithkultur eine spirituelle und ästhetisch machtvolle Erfahrung war, so wurden später in den japanischen Gärten des 11. Jahrhunderts die Götter durch kunstvolle Steinsetzungen eingeladen, ihre himmlischen Geflde zu verlassen und ihren Segen der Erde zu
schenken, wie es im Sakuteiki geschildert wird, dem vermutlich ältesten Zeugnis für Gartengestaltung als ästhetischer Prozess.1 Auch der Goetheanum-Landschaftspark kann den äußerlich und innerlich schauenden Besucher auf eine unerwartete und zeitgemäße Erfahrung vorbereiten. Das Gelände kann dann als eine Schwellensituation zur geistigen Welt erlebt werden.
Das Gelände bietet die Möglichkeit, innig einzelne Orte zu befragen und sich dann in der Gesamtschau, in der Bewegung von Ort zu Ort auf eine verändernde, inspirierende Erfahrung einzulassen. Dieser Dialog schließt andere Menschen mit ein; in der Begegnung, im Gespräch, im Zuhören weitet und gründet sich der eigene Standort.
Dem entsprechend kommen in diesem Buchprojekt auch verschiedene Stimmen zu Wort; es stehen unterschiedliche Zugänge und Erfahrungen nebeneinander und bilden im gemeinsamen Klang einen Erkenntnisweg ab.
Mit diesem Buch erscheint ein neues Gesamtbild des Gartenparks am Goetheanum. Er wird in sensiblen Setzungen sichtbar, dem zeitlichen Wandel unterworfen. Seine Räume öffnen sich dem aufmerksamen Blick. In der Hinwendung zu einzelnen Landschafts-Elementen und den Mitmenschen, beim Gehen und Erschauen dessen, was im Wandel der Jahreszeiten und Wetterstimmungen geschieht, können – unverhofft –Momente der Intuition entstehen.
Das Erlebnis von Qualitäten wie Rhythmus, Metamorphose und Wandlung an diesem lebendigen Kunstwerk kann uns in Bewegung bringen und damit die drängenden Gestaltungsfragen unserer Zeit in einem neuen Licht zeigen.
Inhalt
5 Hinwendung: Der Gartenpark am Goetheanum CLAUDIA D. SCHLÜRMANN
10 Einleitung: Man schaue, was geschieht Rudolf Steiner als Landschaftsarchitekt am Goetheanum
MARIANNE SCHUBERT
Das Goetheanumgelände als E rfahrungsraum
18 Ein Rundgang über das Goetheanumgelände in dem von Rudolf Steiner gestalteten Südwestbereich
MARIANNE SCHUBERT
56 Felsli und Südwiesenmäuerchen
STEPHAN STOCKMAR
64 Der Bau und die Landschaft im Gespräch
RUDOLF KAESBACH & STEPHAN STOCKMAR
Stilformen des Organischen
84 Metamorphose – Ein Gleichbleibendes verwandelt sich
HANSJÖRG PALM
90 Rudolf Steiners Bauimpuls – Eine Skizze
ALEXANDER SCHAUMANN
Das
94 Die Konzeption der Anlage auf dem Dornacher Hügel und Zeugnisse ihres Werdens
STEPHAN STOCKMAR
104 Pfanzangaben Rudolf Steiners
MARIANNE SCHUBERT
112 Neue Impulse in der Gartengeschichte
MARIANNE SCHUBERT
118 Zwei Gebäude, zwei Gärten
ALEXANDER SCHAUMANN
Hintergrund und Dokumentation
122 Aus der Stadt in die Landschaft: Ein sich wandelnder Bauimpuls
STEPHAN STOCKMAR
132 Rudolf Steiner und der Dornacher Hügel Geografe und Geschichte
STEPHAN STOCKMAR
148 Äußerungen Rudolf Steiners zur Umgebung der Goetheanumbauten
STEPHAN STOCKMAR
172 Rudolf Steiner als Geländegestalter
HERMANN RANZENBERGER
178 Das Felsli auf dem Dornacher Hügel
PETER KLEEBERG (JOHN BERG)
182 Chronologische Übersicht
STEPHAN STOCKMAR Literatur und Quellen
194 Bemerkungen zur Literatur über das Goetheanumgelände
STEPHAN STOCKMAR
200 Literatur zum Goetheanumgelände und seinen Bauten
202 Literatur zur Geografe und Geschichte von Dornach und Umgebung, zu Biografe und Werk Rudolf Steiners und allgemeine Literatur
203 Schriften und Vorträge Rudolf Steiners, erschienen im Rahmen der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA)
205 Nachweis der Bildquellen
man schaue was geschieht
Rudolf Steiner als Landschaftsarchitekt am Goetheanum MARIANNE SCHUBERT«Wenn die Ideen zu solchen Kunstwerken einmal in der Kultur Nachfolger fnden werden, dann werden die Menschen, die durch die Pforten solcher Kunstwerke gehen und sich beeindrucken lassen von dem, was in diesen Kunstformen spricht, wenn sie gelernt haben, die Sprache dieser Kunstwerke mit dem Herzen, nicht nur mit dem Verstand zu verstehen, dann werden diese Menschen ihren Mitmenschen nicht mehr Unrecht tun, denn sie werden von den künstlerischen Formen Liebe lernen; sie werden lernen, in Frieden und Harmonie mit ihren Mitmenschen zusammenzuleben.»
RUDOLF STEINER, DORNACH, 17. JUNI 1914 1
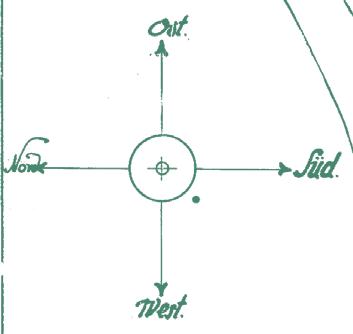
Rudolf Steiner kennt man in seinem künstlerischen Werk als Architekten, Bildhauer, Maler und als Autor von Mysteriendramen und SpruchDichtungen. Dass er auch ein Landschaftskunstwerk um das Goetheanum herum geschaffen hat, ist noch wenig bekannt.
Dieses Werk, das auch Elemente enthält, die man heute als «LandArt» bezeichnen würde, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und es somit stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, ist Anliegen dieses Buches.
Als Landschaftsarchitektin hat mich diese Außenanlage schon in den 1980er-Jahren in ihren Bann gezogen, als ich an der Ausgestaltung des Platzes um den Goetheanumbau herum beteiligt war, und seitdem nicht mehr losgelassen. Ihre Originalität und Schönheit beeindrucken mich immer wieder neu und motivierten mich, ab 2018 mit Stephan Stockmar gemeinsam, an die Arbeit zu gehen.
Das größte Rätsel ist und bleibt: Warum hat sich Rudolf Steiner zu den Außenanlagen so gut wie nicht geäußert? Warum gibt es kaum Fotos von ihrer Entstehung? Wir sind also vor allem auf uns selbst angewiesen, die den Gestaltungen zugrunde liegenden Intentionen zu erkunden.
Gestalterisch überraschten mich als Planerin manche ungewöhnlichen Vorgehensweisen, zum Beispiel:
• Der Hauptzugangsweg zum Bau, den man zu Fuß beschreitet (nicht die asphaltierten Zufahrtsstraßen), ist so angelegt, dass er nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, direkt durch die Wiese zum Bau führt. Er lenkt den Besucher erst einmal weg vom Ziel, dem Goetheanum, das zunächst prächtig zu sehen ist, und gibt den Blick frei in die umliegende Landschaft. Erst dann tritt der Bau wieder in Erscheinung, nun von der anderen Seite her.
• Ein Mäuerchen, das den Hang halten soll, steht nicht einfach so da, sondern steigt allmählich aus dem Boden auf. Erst langsam wird es zu der den Weg begleitenden Stützmauer, verwandelt sich überraschend in die Rückenlehne einer Bank und verschwindet dann mit einem Schwung wieder im Erdreich.
• Weiter aufwärts taucht seitlich des Weges plötzlich ein welliges Bodenrelief in Form eines spitzwinkligen Dreiecks aus dem Erdreich auf, das mit exakt bearbeiteten Steinen gepfastert ist, ohne dass eine Funktion erkennbar ist. Dieses Bodenrelief dient einem anderen Zweck, aber welchem? – Es folgen Rätsel auf Rätsel.
Wenn man die hier vorzufndenden Gestaltungen aus der Geschichte der Gartenkunst zu verstehen sucht, wird deutlich, dass Rudolf Steiner etwas ganz Eigenes, vollkommen Neues geschaffen hat, dass alles aufeinander und auf den zentralen Bau bezogen ist, so dass ein organisches Ganzes entsteht.
In den vielen Jahren der Beobachtung, auf zahlreichen Erkundungsgängen durch die Parkanlage mit den verschiedensten Besuchergruppen, kam ich ins Gespräch mit diesen Gestaltungen. Ich stellte Fragen und manchmal, wie füchtig, erschloss sich mir ein Motiv, oft verschwand es dann aber auch wieder wie hinter dem Schleier eines Geheimnisses. Mit der Zeit verdichteten sich die Deutungsebenen und der Zusammenhang zwischen den einzelnen Kunstwerken wurde mir klarer.
Es werden verschiedene Schichten erkennbar. Der Genius Loci des Dornacher Hügels zeigt sich u. a. auch in der Geologie, der Geomantie, der Vegetation im Jahreslauf, in den Beziehungen der Gestaltungen zur weiteren Landschaft und deren Verbindung zu den Bauten, besonders zum Hauptbau, dem Goetheanum. Steiners Versuch, eine neue Formensprache aus Naturgesetzmäßigkeiten zu entwickeln, wird erlebbar.
Steiners Kunstwerken kann man sich «wie einem vertrauten, geliebten Menschen nähern – wohlwollend ohne Kritiklosigkeit, verständnisvoll ohne Erklärung und mit anhaltender Bereitschaft für neue Erfahrungen. Statt einer rein gedanklichen Erklärung soll der Blick auf die Qualitäten und Prozesse gelenkt werden, die vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein gehoben werden. Geist kommt im Modus aktueller Tätigkeit zur Erscheinung», so Roland Halfen in seinem Buch Kunst und Erkenntnis –Rudolf Steiners «Ästhetik der Zukunft»2 . Jeder Mensch kann die Grenze zwischen dem Sinnlichen und Übersinnlichen ergreifen und im Wechselspiel für die jeweils andere Seite seine Aufmerksamkeit schärfen und seinen Wahrnehmungs- und Erfahrungshorizont dadurch erweitern.
Um die künstlerische Gestaltung der Außenanlage erlebbar zu machen, haben wir die Beschreibung des Geländes in Form eines Rundwegs konzipiert. Beginnend mit dem Südeingang des Goetheanums und endend an seinem Westeingang laden wir ein, einen Weg mit uns zu gehen, bei dem sich Erfahrungsräume öffnen und Geheimnisse entdecken lassen.
Entstehung der Anlage
Die von Steiner entworfenen Außenanlagen sind im Wesentlichen während der Bauzeit des ersten Goetheanums, von 1913 bis zu dessen Zerstörung durch Brandstiftung in der Silvesternacht 1922/23, entstanden. 1924 entwickelte Steiner an genau gleicher Stelle das zweite Goetheanum als skulpturalen Betonbau, der 1928 eröffnet wurde. Wir schauen also auf ein Gelände, das in der Bauzeit des ersten Goetheanums gestaltet wurde und nun mit dem zweiten Bau erlebt wird. Man kann sich fragen, ob der gegenüber dem ursprünglichen Holzbau völlig anders wirkende Neubau nicht auch eine neue Umgebungsgestaltung erfordert hätte. Doch die Beobachtung zeigt, dass die vorhandenen Außenanlagen den Nachfolgebau stimmig aufnehmen und wie für diesen geschaffen zu sein scheinen.
Beiträge zur Genese des Goetheanum-Ensembles
Aufbauend auf den eigenen Erkundungsmöglichkeiten und ausgehend von der wenigen vorhandenen Literatur zum Gelände haben wir versucht, durch eigene Recherchen zu einem tieferen Verständnis von Rudolf Steiners Gartenkunstwerk zu kommen. Wegleitend sind dabei Rudolf Steiners prinzipielle Darstellungen seines im Zentrum der Anthroposophie gründenden Baugedankens und zur Gesamtgestalt des Goetheanum-Ensembles in der Landschaft.
Für die historische Recherche zu diesem Buch haben wir das im Goetheanum lagernde Bauarchiv durchforstet: rund hundert Aktenordner, in denen in Form von Lieferscheinen, Rechnungen, Quittungen, Stundenzetteln und vielem mehr die im Auftrag des Johannesbau-Vereins durchgeführten Arbeiten dokumentiert sind.
Auf dieser Grundlage und in Verbindung mit weiteren Unterlagen, darunter Pläne, Fotos, Briefe und Erinnerungen an die Bauzeit, haben wir eine ausführliche Chronik erstellt. Sie bezieht Angaben Steiners zur Bepfanzung des Geländes ebenso mit ein wie relevante Ereignisse in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft. Damit beschreiben wir zum ersten Mal und ausführlich dokumentiert die genauen zeitlichen Abläufe der Entstehung der Gartenkunstwerke im Zusammenhang mit dem Gesamtensemble.
Des Weiteren wird dargestellt, wie sich der Gedanke für einen eigenen Bau innerhalb der anthroposophischen Arbeit entwickelt hat und schließlich, nach dem Scheitern in München, auf dem Dornacher Hügel realisiert wurde. Diese neue Lage brachte auch die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Geländegestaltung mit sich. Auf die von Rudolf Steiner entworfenen sogenannten Nebenbauten wird nur insofern eingegangen, als sie eine Rolle bei der Geländegestaltung gespielt haben. 3 Dies gilt auch für das östlich des Goetheanums gelegene Haus Schuurman, für das es, abgesehen von der Grenzmarkierung und den Handzeichnungen, zu Steiners Lebzeiten noch keine defnitiven Planungen gab.
Wie stimmig sich die Bauten in den Landschaftsraum einpassen, beschreibt Rudolf Kaesbach, der sich als Architekt und Bildhauer viele Jahre forschend mit der Architektur und ihrer Beziehung zur umgebenden Landschaft befasst hat.
Ein eigenes kleines Kapitel ist Rudolf Steiners Angaben zur Bepfanzung des Geländes an die Gärtnerin Antonie Ritter-Ganz – die «rote Gärtnerin» genannt – gewidmet. Wie sich das Gelände nach Steiners Tod entwickelte und gärtnerisch gestaltet und gepfegt wurde, haben die langjährigen Gärtner am Goetheanum – insbesondere sind hier Benno Otter und Jörg Mensens zu nennen – in dem Buch Gartenpark am Goetheanum dargestellt. 4 Dieses Buch ergänzt die hier vorliegenden Darstellungen bzw. führen diese weiter in die Gegenwart.
Zugunsten der besonderen Betrachtung der Land-Art-Kunstwerke Rudolf Steiners haben wir die weiteren Orte der Parkanlage in ihrer Entwicklung bis heute nur kurz erwähnt.
Die Kunst als Interpretin der Weltgeheimnisse
Rudolf Steiner hat seine künstlerischen Gestaltungen immer als vorläufge Versuche auf dem Weg zu einem neuen Baustil empfunden, um «Formen zu schaffen als Ausdruck des inneren [geistigen] Lebens». 5 Er wollte in Anknüpfung an Goethe «durch die Erkenntnis in der Seele etwas von den Weltinhalten vergegenwärtigen. […] Die Seele ist der Schauplatz, auf dem die Welt ihre Geheimnisse enthüllt.» 6 Und die Kunst ist «die Interpretin der Weltgeheimnisse». 7
In diesem Sinne sind die Bauformen des Goetheanums für Steiner keine naturalistischen Nachahmungen, sondern Ausdruck des Geistigen in der Welt. Von den zusammenklingenden Formen, die aus dem Gespräch zwischen Geistigem und Irdischem hervorgehen und dabei auch die Gesten der umgebenden Landschaft miteinbeziehen, sollte nach Steiner eine heilende und Frieden stiftende Wirkung ausgehen.
Ein großer Dank geht an alle, die uns bei der Arbeit bereitwillig unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Goetheanum-Dokumentation, des Rudolf Steiner Archives und vor allem dem Gärtnerteam am Goetheanum, das mit Kompetenz und Liebe diesen Ort pfegt und weiterentwickelt.
1 GA 286 (1982), S. 64
2 Halfen 2019, S. 243
3 Vgl. hierzu Zimmer 1985
4 Otter / Mensens / Fischer 2009
5 25.11.1905 an Marie von Sivers; GA 262 (1967), S. 72
6 In: ‹Das Goetheanum in seinen zehn Jahren› (1924), in: GA 36, S. 322 f.
7 1887, in: GA 1 (1987), S. 136
