

Inhalt 6
Danksagung 9
TEIL 1
Praktische künstlerische Tätigkeit –Aufbau, Entwicklung und Vertiefung 14
1 Zu diesem Buch 12
2 Wie lässt sich der Kunstunterricht in der Schule begründen? 14
3 Die Mitte fnden 22
4 Goethes Farbenlehre 24
5 Rudolf Steiners Farbenlehre 44
6 Die Farbe Schwarz 55
7 Die Inkarnatfarbe – auch Pfrsichblüt genannt 60
8 Bildbeispiele zu Rudolf Steiners Farbenlehre 68
9 Polaritäten in der Farbenwelt 74
10 Malmaterial und Technik / Farbstoffe und Pigmente 78
11 Herstellen von Malfarben / Fällungen / Schlämmen 91
12 Malen mit Aquarellfarben / Maltechniken / Flüssige Farbe 96
13 Papier 108
14 Pinsel 113
15 Lehrplanübersicht 117
16 Die erste Klasse / Die erste Malstunde 124
17 Farbgeschichten / Farbenklänge (1. und 2. Klasse) 130
18 a Bildmotive in den ersten Schuljahren 152
18 b Bildmotive in den ersten Schuljahren 168
19 Die Gestalt des Menschen 174
20 Farbenklänge: Der zwölfteilige Farbkreis / Zuordnungen zum Tierkreis / Farben der Eurythmiefguren 190
21 Die biblische Schöpfungsgeschichte (3. Klasse) 198
22 Das Malen von Tieren.
Bildaufbau und Bildbeispiele (4. Klasse) 204
23 Bildaufbau Tintenfsch (Oktopus) 213
23a Von der Farbskizze zum ausgearbeiteten Bild 218
24 Malen von Pfanzen. Allgemeine Gesichtspunkte (5. Klasse) 238
25 a Malen von Pfanzen. Bildaufbau und Bildbeispiele 242
26 Bäume 266
27 Malen und Zeichnen (6. und 7. Klasse) 290
28 Malen von Landkarten 302
29 Malerische Gesichtspunkte im Zeichnen (6. – 9. Klasse) 306
30 Chinesische Tuschmalerei 316
31 Kulissenmalen (u. a. für die 8. Klasse) 326
32 Zeichnen und Malen (9. Klasse) 340
33 Malen (10. Klasse) 348
34 Florenz 352
35 Weitere Ausblicke auf die Oberstufe 359
TEIL 2
Erkenntniswege zur Kunst und menschenkundliche Gesichtspunkte bei Goethe und Steiner 361
36 Goethes Weltanschauung 363
37 Goethes Kunstverständnis 369
38 Das Sinnlich-Übersinnliche und seine Verwirklichung durch die Kunst 374
39 Aspekte des Geistigen in seiner Beziehung zum praktischen künstlerischen Schaffen 380
40 Raum und Umraum 385
41 Das Künstlerische und seine Bedeutung für die Entwicklung des Menschenwesens – dargestellt in der Menschenkunde 387
42 Hinweise für die Praxis / Erziehungskunst.
Methodisch-Didaktisches 398
43 Die Welt ist schön 403
44 Der Gleichgewichtszustand zwischen Luzifer und Ahriman 407
45 Entwicklung durch bildnerisches Tun 410
46 Der Lichtseelenprozess 413
47 Die zwölf Sinne im Malen und Zeichnen 418
48 Nachahmung 420
49 Schulungswege in der bildenden Kunst und in der Musik 422
50 Rudolf Steiners künstlerische Impulse / Malen aus der Farbe 425
Anmerkungen 432
Siglenverzeichnis 434
Literaturverzeichnis 435
Bildnachweise 435


Praktische künstlerische Tätigkeit –Aufbau, Entwicklung und Vertiefung

Man sollte ein Verständnis dafür haben, dass man ja auch nicht ein besonderes Malen für die Kinder einzurichten habe; sondern wenn man fndet, dass die Kinder ins Malen in irgendeiner Weise hineinwachsen sollen, dann müssen die Prinzipien aus der lebendigen Malkunst heraus, nicht aus einer pädagogisch besonders zurechtgeschusterten Methode gemacht werden. Es muss das wirklich Künstlerische dann in die Schule hineingetragen werden, nicht ein wiederum verstandesmäßig Ausgedachtes.
Rudolf SteinerZu diesem Buch
Um die künstlerischen Impulse Rudolf Steiners in den Schulen fruchtbar machen zu können, bedarf es einerseits eines Verständnisses für diese Impulse, andererseits des Könnens, welches erarbeitet und erworben werden muss, um einen Zugang zu der Welt der Bildekräfte zu erlangen und dies in praktisch- künstlerische Tätigkeit umzusetzen.
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist in erster Linie, die in den Waldorf- und Rudolf Steiner Schulen tätigen Lehrerinnen und Lehrer zum selbständigen Üben anzuregen. Aus diesem Grund sind nicht nur Beispiele aufgeführt, welche man direkt in die Schulpraxis umsetzen kann, sondern auch solche, welche über das Niveau der üblichen Schülerarbeiten hinausgehen. Die künstlerische Arbeit in den Schulen lebt davon, dass die künstleri-
schen Impulse für das erste Goetheanum und die Waldorfschulen, welche von Rudolf Steiner selbst als bescheidener Anfang verstanden wurden, weiterentwickelt werden. Deshalb ist es für die Lehrkräfte sinnvoll, nicht nur immer und immer wieder die Motive für die bildnerischen Arbeiten der Heranwachsenden von einer Klasse zur nächsten weiterzugeben und sich ausschließlich an Schülerarbeiten zu orientieren, sondern durch das Erleben der Welt der Farben und Formen schöpferisch neue Motive zu entwickeln. Gerade in den Schulen werden auch häufg nur die Arbeiten der Kinder zur Gestaltung von Publikationen herangezogen; eher selten erscheinen in Mitteilungs- und Informationsbroschüren ausgereifte künstlerische Arbeiten der kunstschaffenden Lehrerinnen und Lehrer.
So möchte die vorliegende Arbeit im ersten, praxisorientierten Teil Schritte für den Aufbau, die Entwicklung und Vertiefung im künstlerischen Tun aufzeigen. Sie zeigt Wege von den allereinfachsten ersten Malübungen über eine Kultivierung des Farberlebens bis zum Aufbau von Bildmotiven aus diesem Farberleben heraus und möchte eine Ausbildung der malerischen Handfertigkeit und bildnerischen Fähigkeiten anregen. Es werden entwicklungsorientiert malerische Themenstellungen für die aufeinanderfolgenden Schuljahre dargestellt, bis hin zu Ausblicken auf anspruchsvolle Motive, gestaltet mit neu erworbenen, verschiedenen Maltechniken in der Oberstufe.
Im zweiten Teil wird eine Darstellung der menschenkundlichen, erkenntnismäßigen
und geisteswissenschaftlichen Hintergründe des bildnerisch-künstlerischen Unterrichtes unternommen.
Die Anregungen Rudolf Steiners für die bildende Kunst und die Waldorfschule im Verlaufe seines Lebensganges basieren auf seinen jahrzehntelangen Studien zu Goethes Forschungen als Wissenschaftler und Künstler. In seiner Vorrede zu der zweiten Aufage des Vortrages «Goethe als Vater einer neuen Ästhetik»1 bezeichnete Rudolf Steiner die in diesem Vortrag von 1888 entwickelten Ideen als «gesunden Unterbau der Anthroposophie». So werden in diesem Teil, ausgehend von Goethes Weltanschauung, Rudolf Steiners Anschauungen zur Kunst und Pädagogik aus geisteswissenschaftlicher Sicht dargestellt.

Die sinnlich-sittlichen Wirkungen der Farben
In seinen vielfältigen Studien zur Farbenlehre beschrieb Goethe auch die Wirkung der Farben auf das seelische Erleben und die jeweiligen Gemütsstimmungen, welche durch die verschiedenen Farben und Farbzusammenstellungen hervorgerufen werden. Goethe erforschte diese Stimmungen, indem er ganz in die Wahrnehmung der
764. Die Farben von der Plusseite sind Gelb, Rotgelb (Orange), Gelbrot (Menninge, Zinnober). Sie stimmen regsam, lebhaft, strebend.
Gelb
765. Es ist die nächste Farbe am Licht. Sie entsteht durch die gelindeste Mäßigung desselben …
766. Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft.
767. In diesem Grade ist sie als Umgebung, sei es als Kleid, Vorhang, Tapete, angenehm. Das Gold in seinem ganz ungemischten Zustande gibt uns, besonders wenn der Glanz hinzukommt, einen neuen und hohen Begriff von dieser Farbe, so wie ein starkes Gelb, wenn es auf glänzender Seide erscheint, eine prächtige und edle Wirkung tut.
768. So ist es der Erfahrung gemäß, dass das Gelbe einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei der beleuchteten und wirksamen Seite zukommt.
769. Diesen erwärmenden Effekt kann man am lebhaftesten bemerken, wenn man durch ein gelbes Glas, besonders in grauen Wintertagen, eine Landschaft ansieht. Das Auge wird erfreut, das Herz ausgedehnt, das Gemüt erheitert; eine unmittelbare Wärme scheint uns anzuwehen.
770. Wenn nun diese Farbe in ihrer Reinheit und hellem Zustande angenehm und erfreulich, in ihrer ganzen Kraft aber etwas Heiteres und Edles hat, so ist sie dagegen äußerst empfndlich und macht eine sehr unangenehme Wirkung, wenn sie beschmutzt oder einigermaßen ins Minus gezogen wird. So hat die Farbe des Schwefels, die ins Grüne fällt, etwas Unangenehmes.
einzelnen Farben eintauchte; hierzu schaute er zum Beispiel auf seine Umgebung durch farbige Gläser oder er ließ die Qualitäten eines einfarbig gestalteten Zimmers auf sich einwirken. Einige seiner differenzierten Charakterisierungen der Farben sollen hier als Beispiele aufgeführt werden. (Die Paragraphen sind nummeriert.)
772. Da sich keine Farbe als stillstehend betrachten lässt, so kann man das Gelbe sehr leicht durch Verdichtung und Verdunklung ins Rötliche steigern und erheben. Die Farbe wächst an Energie und erscheint im Rotgelben mächtiger und herrlicher.
773. Alles, was wir vom Gelben gesagt haben, gilt auch hier, nur im höhern Grade. Das Rotgelbe gibt eigentlich dem Auge das Gefühl von Wärme und Wonne, indem es die Farbe der höhern Glut sowie den mildern Abglanz der untergehenden Sonne repräsentiert.
775. Die aktive Seite ist hier in ihrer höchsten Energie, und es ist kein Wunder, dass energische, gesunde, rohe Menschen sich besonders an dieser Farbe erfreuen.
776. Man darf eine vollkommen gelbrote Fläche starr ansehen, so scheint sich die Farbe wirklich ins Organ zu bohren. Sie bringt eine unglaubliche Erschütterung hervor und behält diese Wirkung bei einem ziemlichen Grade von Dunkelheit. Die Erscheinung eines gelbroten Tuches beunruhigt und erzürnt die Tiere.
774. Wie das reine Gelb sehr leicht in das Rotgelbe hinübergeht, so ist die Steigerung dieses letzten ins Gelbrote nicht aufzuhalten. Das angenehme, heitre Gefühl, das uns das Rotgelbe noch gewährt, steigert sich bis zum unerträglich Gewaltsamen im hohen Gelbroten.
777. Die Farben von der Minusseite sind Blau, Rotblau und Blaurot. Sie stimmen zu einer unruhigen, weichen und sehnenden Empfndung.
Blau
778. So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen, dass Blau immer etwas Dunkles mit sich führe.
Rotgelb (Orange) Gelbrot (Zinnober, warmes Rot)780. Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau sehen, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen.
781. Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns fieht, gerne verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht.
782. Das Blaue gibt uns ein Gefühl von Kälte, so wie es uns auch an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet sei, ist uns bekannt.
783. Zimmer, die rein blau austapeziert sind, erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und kalt.
784. Blaues Glas zeigt die Gegenstände im traurigen Licht.
785. Es ist nicht unangenehm, wenn das Blau einigermaßen vom Plus partizipiert. Das Meergrün ist vielmehr eine liebliche Farbe.
Rotblau (Blauviolett)
786. Wie wir das Gelbe sehr bald in einer Steigerung gefunden haben, so bemerken wir auch bei dem Blauen dieselbe Eigenschaft.
787. Das Blaue steigert sich sehr sanft ins Rote und erhält dadurch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seite befndet. Sein Reiz ist aber von ganz anderer Art als der des Rotgelben. Er belebt nicht sowohl, als dass er unruhig macht.
788. So wie die Steigerung selbst unaufhaltsam ist, so wünscht man auch mit dieser Farbe immer fortzugehen, nicht aber, wie beim Rotgelben, immer tätig vorwärtszuschreiten, sondern einen Punkt zu fnden, wo man ausruhen könnte.
789. Sehr verdünnt kennen wir die Farbe unter dem Namen Lila; aber auch so hat sie etwas Lebhaftes ohne Fröhlichkeit.
Blaurot (Rotviolett)
790. Jene Unruhe nimmt bei der weiterschreitenden Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, dass eine Tapete von einem ganz reinen gesättigten Blaurot eine Art von unerträglicher Gegenwart sein müsse.
Rot
792. Man entferne bei dieser Benennung alles, was im Roten einen Eindruck von Gelb oder Blau machen könnte. Man denke sich ein ganz reines Rot, einen vollkommenen, auf einer weißen Porzellan-
schale aufgetrockneten Karmin. Wir haben diese Farbe ihrer hohen Würde wegen manchmal Purpur genannt, ob wir gleich wohl wissen, dass der Purpur der Alten sich mehr nach der blauen Seite hinzog.
794. Wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rote gesehen und dabei unsre Gefühle bemerkt haben, so lässt sich denken, dass nun in der Vereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale Befriedigung nennen möchten, stattfnden könne. Und so entsteht bei physischen Phänomenen diese höchste aller Farbenerscheinungen aus dem Zusammentreten zweier entgegengesetzter Enden, die sich zu einer Vereinigung nach und nach selbst vorbereitet haben.
796. Die Wirkung dieser Farbe ist so einzig wie ihre Natur. Sie gibt einen Eindruck sowohl von Ernst und Würde als von Huld und Anmut. Jenes leistet sie in ihrem dunklen verdichteten, dieses in ihrem hellen verdünnten Zustande.
797. Von der Eifersucht der Regenten auf den Purpur erzählt uns die Geschichte manches. Eine Umgebung von dieser Farbe ist immer ernst und prächtig.
798. Das Purpurglas zeigt eine wohlerleuchtete Landschaft in furchtbarem Lichte. So müsste der Farbeton über Erd‘ und Himmel am Tage des Gerichts ausgebreitet sein.
Grün
801. Wenn man Gelb und Blau, welche wir als die ersten und einfachsten Farben ansehen, gleich bei ihrem ersten Erscheinen, auf der ersten Stufe ihrer Wirkung zusammenbringt, so entsteht diejenige Farbe, welche wir Grün nennen.
802. Unser Auge fndet in derselben eine reale Befriedigung. Wenn beide Mutterfarben sich in der Mischung genau das Gleichgewicht halten, dergestalt, dass keine vor der andern bemerklich ist, so ruht das Auge und das Gemüt auf diesem Gemischten wie auf einem Einfachen. Man will nicht weiter und man kann nicht weiter.
Farbenklänge
Goethe sprach in seinen Ausführungen zu der «sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben» auch darüber, dass die Farben untereinander in ihren verschiedenen Kombinationen sehr
unterschiedliche Wirkungen ausüben. Diese Wirkung zweier Farben aufeinander bezeichnete Goethe je nach Kombination als:
Harmonisch
Die sich im Farbkreis gegenüberstehenden Primär- und Komplementärfarben: Die Komplementärfarben setzen sich zusammen aus je
zwei Primärfarben, so dass in diesen Farbklängen alle drei Primärfarben vorkommen. Es entsteht eine Ganzheit dieser drei Farben.
Die drei Primärfarben Gelb, Rot und Blau klingen zusammen: Gelb und Blau bilden zusammen das Grün.
Charakteristisch
Orange und Blau

Die Primärfarben Gelb und Rot bilden das Orange, dazu kommt das Blau.
Diejenigen Farben, welche im Farbkreis durch eine Farbe getrennt sind: Durch die Gegensätzlichkeit der Farben entsteht eine Spannung, welche jedoch weniger ausgewogen ist als bei den harmonischen Farbklängen. Bei Rot/Blau, Blau/ Gelb und Gelb/Rot fehlt jeweils eine Primärfarbe. Bei Violett/Grün haben wir zwei Anteile Blau und je einen Anteil Rot und Gelb; bei Grün/Orange haben wir zwei Anteile Gelb und je einen Teil Blau und Rot, bei Orange/Violett haben wir zwei Anteile Rot und je einen Anteil Gelb und Blau.


Die Primärfarben Rot und Blau bilden das Violett, dazu kommt das Gelb als dritte Primärfarbe.
Blau und Rot Gelb und Rot

 Rot und Grün
Violett und Gelb
Rot und Grün
Violett und Gelb
Charakterlos
Die Farben, welche im Farbkreis nebeneinander stehen: Rot/Violett, Violett/Blau, Blau/Grün, Grün/Gelb, Gelb/Orange, Orange/Rot.




Bei den folgenden Farbklängen herrscht jeweils eine Farbe stark vor; beim Auftragen und Mischen dieser Farben benötigt man jeweils zwei Anteile einer Primärfarbe und einen Teil der zweiten Primärfarbe.





Beispiel: Violett/Rot: Violett entsteht aus Blau und Rot, also haben wir in diesem Farbklang zwei Anteile Rot und einen Anteil Blau.
 Gelb und Blau
Violett/Rot = Rot + Blau und Rot Blau/Violett = Blau und Rot + Blau
Blau/Grün = Blau und Blau + Gelb
Orange und Grün Grün und Violett Orange und Violett
Gelb/Grün = Gelb und Gelb + Blau
Gelb/Orange = Gelb und Rot + Gelb
Gelb und Blau
Violett/Rot = Rot + Blau und Rot Blau/Violett = Blau und Rot + Blau
Blau/Grün = Blau und Blau + Gelb
Orange und Grün Grün und Violett Orange und Violett
Gelb/Grün = Gelb und Gelb + Blau
Gelb/Orange = Gelb und Rot + Gelb
Aufistung wichtiger gebräuchlicher Farben
Weiße Farben Zinkweiß (Zinkoxid, mineralisches Pigment)

Zinkoxid entstand als Nebenprodukt bei der Herstellung von Messing, wurde aber erst um das Jahr 1800 als Malpigment entdeckt. Es wird durch Verdampfen und durch Oxidation mit heißer Luft gewonnen. Es lässt sich gut in Verbindung mit Pfanzenfarbenpigmenten verwenden.
Titanweiß (Titanoxid, mineralisches Pigment)
Diese Oxidation des Metalles Titan wird durch Schwefelsäure erreicht. Das Pigment wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt und war lange Zeit als Malfarbe problematisch, da es organische Farben ausbleichte. Diese Probleme scheinen inzwischen durch Weiterentwicklungen behoben zu sein. Das Pigment ist sehr stark deckend und deshalb im Zusammenhang mit Aquarellfarben vorsichtig einzusetzen.
Gummigutt (pfanzliches Harz, Pfanzenfarbenpigment)
Goethe benutzte für seinen Farbenkreis das reinste Gelb aus Gummigutt. Gummigutt ist auch heute noch zu haben, allerdings gibt es nur noch sehr wenige Anbieter. Es ist ein reiner, warmer Gelbton, der aus einem pfanzlichen Gummi hergestellt wird. Im Gegensatz zu vielen synthetisch hergestellten Gelbtönen wirkt diese Farbe weder kalt noch giftig. Sie kann sowohl mit dem Blau zusammen zu Grün als auch mit dem Rot zu Orange gemischt werden. Gummigutt wurde früher als Wurmmittel eingesetzt und gilt als leicht giftig.

Nickeltitangelb (Titandioxid mit Nickel und Antimonoxiden, mineralisches Pigment) ist ein neueres, ungiftiges Pigment, welches das (giftige) Neapelgelb koloristisch ersetzt.
Kadmiumgelb (Kadmiumsulfd und Zinksulfd, mineralisches Pigment) besteht aus Kadmiumsulfd und Zinksulfd. Das Metall Kadmium wurde 1817 entdeckt, seit 1849 wird Kadmiumgelb in größeren Mengen hergestellt. Die Kadmiumpigmente können mit anderen Pigmenten ge-

Herstellung (Fällen) von Pfanzenfarbenpigmenten
Material und Werkzeug:
• Pfanzenmaterial von Färberpfanzen wie: Krappwurzel, Goldrute, Zwiebelschalen usw. (Je mehr Pfanzenmaterial verwendet wird, desto kräftiger wird der Farbauszug.)
• Destilliertes Wasser oder gereinigtes Regenwasser
• Alaun
• Soda
• Kochtopf (emailliert oder Chromstahl), bei Gaskocher feuerfestes Glasgefäß möglich
• Porzellanmörser
• Filter oder Tuch
• Sieb
• Rührlöffel
• 250 ml Pfanzenfarbsaft
• Alaunlösung: Ca. sieben Esslöffel Alaun in gleich viel heißem Wasser gelöst
• Sodalösung: Zwei Esslöffel Soda auf 250 ml Wasser
• (Die Mengenangaben sind Richtwerte.)
Das Pfanzenmaterial wird ca. 1/2 Stunde ausgekocht und danach abgesiebt. Alaun wird in Wasser aufgelöst, zugegeben und eingerührt. Das ebenfalls aufgelöste Soda wird vorsichtig hinzugefügt, bis das Ganze aufschäumt. (Der Topf muss genügend groß sein.) Soda und Alaun verbinden sich zu Tonerdehydrat, welches den Farbstoff aufnimmt. Nun gibt man alles in einen Filter oder ein Tuch. Wenn die Flüssigkeit abgelaufen ist, bleibt ein Farbschlamm zurück, welchen man eintrocknen lässt. Wenn er trocken ist, wird er mit dem Mörser fein pulverisiert. So erhält man ein praktisch unbegrenzt haltbares Pfanzenfarbenpigment.
Farben aus Erde Schlämmen
Aus natürlich gefärbten Erden kann man mit Leichtigkeit selber feine Farbpigmente herstellen.
Material:
• Gläser
• Rührstab
• Farbige Erde
• Wasser
a Etwas Erde wird in ein Glas gegeben und mit Wasser aufgefüllt.
b Durch Umrühren lösen sich die feinen farbigen Bestandteile, während die groben Teile, wie Steinchen und Sand, zu Boden sinken.
c Das gefärbte Wasser wird nun rasch in ein anderes Glasgefäß abgegossen, so dass die groben Teile im ersten Glas zurückbleiben.
d Das zweite Glas bleibt nun ruhig stehen; bald sinken die gelösten Farbteile nach unten und bilden schon nach einigen Minuten einen Bodensatz. Wenn man längere Zeit wartet, wird dieser Bodensatz recht dicht und das Wasser darüber klar.
e Das Wasser lässt sich jetzt ohne Farbverlust abgießen.
f Man kann das Erdmaterial mehrmals so schlämmen, bis sich keine Farbteilchen mehr lösen. Wenn diese farbige geschlämmte Erde genügend Tonerdeanteile enthält, so haftet sie sogar ohne Bindemittel auf dem Papier. Das eingetrocknete Pigment lässt sich jedoch mit allen Bindemitteln zu Malfarben weiterverarbeiten.



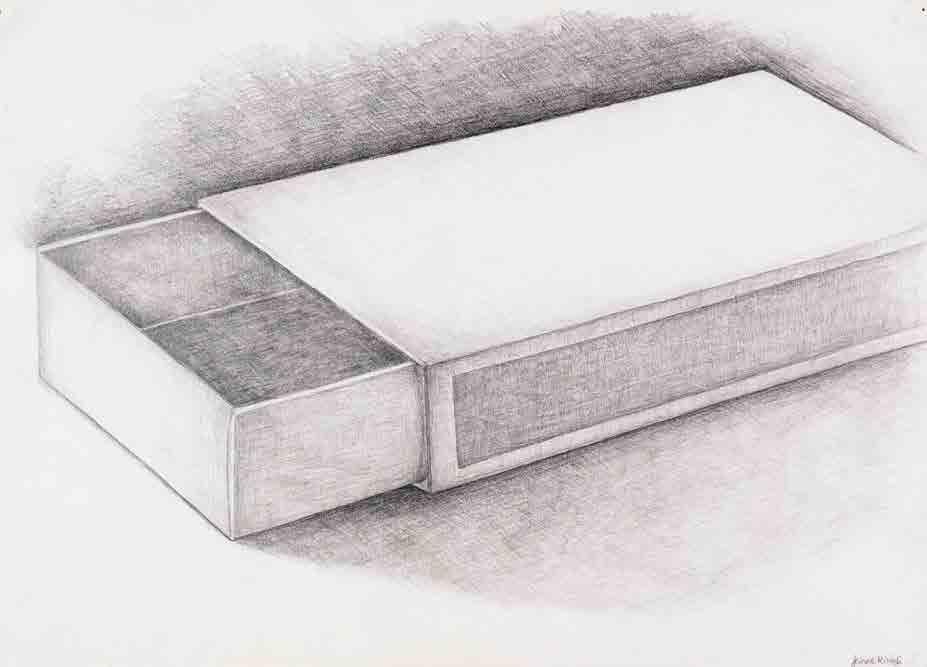
 Schülerarbeit nach Magritte, 10. Klasse
Schülerarbeit nach Magritte, 10. Klasse