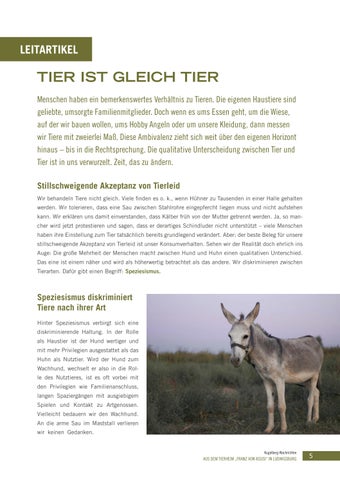LEITARTIKEL
TIER IST GLEICH TIER Menschen haben ein bemerkenswertes Verhältnis zu Tieren. Die eigenen Haustiere sind geliebte, umsorgte Familienmitglieder. Doch wenn es ums Essen geht, um die Wiese, auf der wir bauen wollen, ums Hobby Angeln oder um unsere Kleidung, dann messen wir Tiere mit zweierlei Maß. Diese Ambivalenz zieht sich weit über den eigenen Horizont hinaus – bis in die Rechtsprechung. Die qualitative Unterscheidung zwischen Tier und Tier ist in uns verwurzelt. Zeit, das zu ändern. Stillschweigende Akzeptanz von Tierleid Wir behandeln Tiere nicht gleich. Viele finden es o. k., wenn Hühner zu Tausenden in einer Halle gehalten werden. Wir tolerieren, dass eine Sau zwischen Stahlrohre eingepfercht liegen muss und nicht aufstehen kann. Wir erklären uns damit einverstanden, dass Kälber früh von der Mutter getrennt werden. Ja, so mancher wird jetzt protestieren und sagen, dass er derartiges Schindluder nicht unterstützt – viele Menschen haben ihre Einstellung zum Tier tatsächlich bereits grundlegend verändert. Aber: der beste Beleg für unsere stillschweigende Akzeptanz von Tierleid ist unser Konsumverhalten. Sehen wir der Realität doch ehrlich ins Auge: Die große Mehrheit der Menschen macht zwischen Hund und Huhn einen qualitativen Unterschied. Das eine ist einem näher und wird als höherwertig betrachtet als das andere. Wir diskriminieren zwischen Tierarten. Dafür gibt einen Begriff: Speziesismus.
Speziesismus diskriminiert Tiere nach ihrer Art Hinter Speziesismus verbirgt sich eine diskriminierende Haltung. In der Rolle als Haustier ist der Hund wertiger und mit mehr Privilegien ausgestattet als das Huhn als Nutztier. Wird der Hund zum Wachhund, wechselt er also in die Rolle des Nutztieres, ist es oft vorbei mit den Privilegien wie Familienanschluss, langen Spaziergängen mit ausgiebigem Spielen und Kontakt zu Artgenossen. Vielleicht bedauern wir den Wachhund. An die arme Sau im Maststall verlieren wir keinen Gedanken.
Kugelberg-Nachrichten
AUS DEM TIERHEIM „FRANZ VON ASSISI“ IN LUDWIGSBURG
5