Zukunft auf dem Eis
In Kirgistan sind die Möglichkeiten auf dem Land beschränkt. Dem Puck nachzujagen, eröffnet jungen Frauen Perspektiven.
Seite 8

Strassenmagazin Nr. 549 5. bis 18. Mai 2023 Bitte kaufen Sie nur bei Verkäufer*innen mit offiziellem Verkaufspass davon gehen CHF 3.–an die Verkäufer*innen CHF 6.–
Café Surprise – eine Tasse Solidarität
Zwei bezahlen, eine spendieren.
BETEILIGTE CAFÉS
IN AARAU Schützenhaus | Sevilla IN ALSTÄTTEN SG Zwischennutzung Gärtnerei IN ARLESHEIM Café Einzigartig IN BACHENBÜLACH Kafi Linde IN BAAR
Elefant IN BASEL Bäckerei KULT Riehentorstrasse & Elsässerstrasse | BackwarenOutlet | Bioladen Feigenbaum | Bohemia | Café-Bar Elisabethen | Flore | frühling Haltestelle | FAZ Gundeli | Oetlinger Buvette | Quartiertreffpunkt Kleinhüningen Quartiertreffpunkt Lola | Les Gareçons to go | KLARA | L’Ultimo Bacio Gundeli Didi Offensiv | Café Spalentor | HausBAR Markthalle | Shöp | Tellplatz 3 | Treffpunkt Breite | Wirth’s Huus IN BERN Äss-Bar Länggasse & Marktgasse | Burgunderbar
Hallers brasserie | Café Kairo | Café MARTA | Café MondiaL | Café Tscharni | Lehrerzimmer | Lorraineladen | Luna Llena | Brasserie Lorraine Dreigänger | Generationenhaus Löscher | Sous le Pont | Rösterei | Treffpunkt Azzurro | DOCK8 | Café Paulus Becanto | Phil’s Coffee to go IN BIEL Äss-Bar Inizio | Treffpunkt Perron bleu IN BURGDORF Bohnenrad | Specht IN CHUR Café Arcas | Calanda | Café Caluori Gansplatz | Giacometti | Kaffee Klatsch | Loë | Merz | Punctum Apérobar | Rätushof Sushi Restaurant Nayan | Café Zschaler IN DIETIKON Mis Kaffi IN FRAUENFELD
Be You Café IN LENZBURG Chlistadt Kafi | feines Kleines IN LIESTAL Bistro im Jurtensommer IN LUZERN Jazzkantine zum Graben | Meyer Kulturbeiz & Mairübe Blend Teehaus | Bistro & Restaurant & Märkte Wärchbrogg | Pastarazzi | Netzwerk Neubad | Sommerbad Volière | Restaurant Brünig | Arlecchino IN MÜNCHENSTEIN
Bücher- und Musikbörse IN NIEDERDORF Märtkaffi am Fritigmärt IN OBERRIEDEN Strandbad IN SCHAFFHAUSEN Kammgarn-Beiz IN STEIN AM RHEIN
Raum 18 IN ST. GALLEN S’Kafi IN UEKEN Marco’s Dorfladen IN WIL Caritas Markt IN WINTERTHUR Bistro Dimensione | Bistro Sein IN ZUG Bauhütte Podium 41 IN ZÜRICH Café Noir Zähringer | Cevi Zürich | das GLEIS | Kiosk Sihlhölzlipark Quartiertreff Enge | Quartierzentrum Schütze | Täglichbrot | Flussbad Unterer Letten | jenseits im Viadukt | Kafi Freud | Kumo6 | Sport Bar Cafeteria | Zum guten
Heinrich Bistro
Weitere Informationen: surprise.ngo/cafesurprise
SURPRISE WIRKT
Lebensfreude Zugehörigkeitsgefühl
Unterstützung Exper
Solidaritätsgeste
Entwicklungsmöglichkeiten
Erlebnis
Perspektivenwechsel
tenrolle
Job
Surprise unterstützt seit 1998 sozial benachteiligte Menschen in der Schweiz. Unser Angebot wirkt in doppelter Hinsicht – auf den armutsbetroffenen Menschen und auf die Gesellschaft Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, finanzieren uns ohne staatliche Gelder und sind auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Spenden auch Sie. surprise.ngo/spenden | Spendenkonto: PC 12-551455-3 | IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Kultur
Sozialwerke Information BEGLEITUNG UND BERATUNG STRASSENFUSSBALL CAFÉ SURPRISE
STADTRUNDGÄNGE STRASSENCHOR STRASSENMAGAZIN INS Kurzportraet GzD Layout 1 09 05 17 15:43 Seite 1 INS Kurzportraet GzD Layout 1 09 05 17 15:43 Seite 1
Entlastung
SOZIALE
Von der Peripherie

Statt an den Rand unserer eigenen Gesellschaft in der Schweiz blicken wir in dieser Ausgabe weit über diesen hinaus: An den Rand Europas nach Rumänien und an die Peripherie der den meisten vertrauten Welt: nach Kirgistan in Zentralasien. Uns ist wenig bekannt über die Menschen in diesen Ländern, die weltpolitisch kaum vorkommen. Wir treffen auf Menschen, die an Orten aufwachsen, von denen die meisten fliehen, sobald sie können. Weil sie dort kaum über die Runden kommen, selbst wenn sie hart arbeiten. Und weil die Perspektive fehlt, dass sich dies in absehbarer Zeit ändert.
Vielleicht können sich manche noch an Zeiten erinnern, als auch in der Schweiz die Arbeit beinhart und die Bedingungen schlecht waren und die Jugend floh, sobald sich die Gelegenheit dazu bot? Strassenzeitungsverkäufer Daniel aus Rumänien verkauft in Norwegen das Magazin =Oslo. Manche seiner älteren Kund*innen erzählten ihm davon, dass auch sie in Armut
aufgewachsen seien, ganz so wie viele Kinder in Rumänien heute noch, sagt er in der Reportage aus seinem Heimatdorf. Mehr dazu ab Seite 16.

Auch die Mädchen, die vor der Kulisse des Pamirgebirges Eishockey trainieren, müssen hart arbeiten, wenn sie nicht gerade die Schulbank drücken oder übers Eis flitzen. Wie in Rumänien gibt es auf dem Land in Kirgistan ausser Hausarbeit und bäuerlicher Selbstversorgung nur wenig Möglichkeiten, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Wer kann, geht zum Arbeiten ins Ausland. Dass gerade Eishockey eine zusätzliche Chance auf eine erfolgreiche Zukunft bietet, daran glauben nicht alle Eltern gleichermassen. Gut, dass der Trainer ein Vater aus dem Dorf ist, der sich selbst einen Job schaffen und dem weiblichen Nachwuchs eine sinnvolle Beschäftigung bieten will, ab Seite 8.
8 Zukunftsperspektive
Surprise 549/23 3 Editorial
4 Aufgelesen
Malaria:
neuer Impfstoff
Rechtsstaat adieu
für den heutigen Tag
...
Böög
5 Na? Gut!
Ghanas
5 Vor Gericht
6 Verkäufer*innenkolumne Meditation
7 Moumouni …
studiert den
Die
von
Papa ist endlich wieder mal zuhause
Rumän*innen und Rom*nja in der Schweiz
Ausstellung Erzählen über alles 25 Buch Schutzlos 26 Veranstaltungen 27 Tour de Suisse Pörtner in Wohlen 28 SurPlus Positive Firmen
«Flügel
Yssykköl» 16 Arbeitsmigration
21
22
sind Surprise Impressum Surprise abonnieren
ist ein Genesungsweg» TITELBILD: DANIL USMANOV
29 Wir alle
30 SurprisePorträt «Das ganze Leben
SARA WINTER SAYILIR Redaktorin
Auf g elesen
News aus den über 90 Strassenzeitungen und -magazinen in 35 Ländern, die zum internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen INSP gehören.
Winzige Veränderungen, grosser Effekt
Das in Portland, USA, ansässige Animationsstudio LAIKA ist bekannt für Stop-Motion-Animation. Man darf nicht vergessen: Auch bei dieser Filmtechnik werden 24 Bilder für eine Sekunde Film benötigt. Früher arbeitete man mit Knete und einer Art Auswechseltechnik, wo verschiedene handgeformte Gesichter je nach Stimmung der Figur entsprechend ausgewechselt werden. Um die Physik der Bewegungen zu verstehen, nimmt LAIKA Schauspieler*innen auf, die sich durch die Handlungen der einzelnen Figuren bewegen, während sie entsprechende Kleidungsstücke tragen. Dies wird als Vorlage für die Puppenanimationen verwendet. Und man muss sagen: Die Figuren entpuppen sich so als richtig gute Darsteller*innen.

Weniger Geld für Essen
Armutsbetroffene sind in Deutschland häufig auf Discounter-Ware angewiesen. Nun hat eine Analyse der Verbraucherorganisation Foodwatch herausgearbeitet, dass gerade diese im vergangenen Jahr besonders teuer geworden ist. Die Preise bei den Eigenmarken der grossen Discounterketten sind demnach doppelt so stark gestiegen wie bei Markenprodukten –sie kosteten im Januar 2023 im Schnitt 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Durchschnittlich lag die Inflation bei Lebensmitteln in Deutschland bei 20 Prozent, doppelt so hoch wie die reguläre. Bereits vor dem Anstieg der Preise waren 12,5 Millionen Menschen im nördlichen Nachbarland von Ernährungsarmut betroffen. Oft ist nun auch reine Sättigung nicht mehr gewährleistet, sagt die Landesarmutskonferenz Niedersachsen – ein Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen.
Weniger Platz für Autos
Barcelona ist zwar ein beliebtes Reiseziel, doch Staus, Lärm, Abgase und fehlende Grünflächen machen der Metropole zu schaffen. Nun sollen 503 sogenannte Superblocks entstehen. Mit dem 2016 initiierten Projekt soll dem Klimawandel und den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Durch ein ausgeklügeltes Einbahnstrassensystem und eine radikale Verkehrsberuhigung können rund 60 Prozent der bisher von Autos genutzten Strassen für andere Nutzungen frei werden.

4 Surprise 549/23
MEGAPHON, GRAZ ASPHALT, HANNOVER
REAL CHANGE, PORTLAND BILD: HENRY
Die Puppen können auch Action: «ParaNorman» von Chris Butler (2012).
BEHRENS
Malaria: Ghanas neuer Impfstoff
Jedes Jahr sterben über 600 000 Menschen an Malaria, die grosse Mehrheit davon Kinder im subsaharischen Afrika, schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. in Ghana, wo gut 30 Millionen Menschen leben und Malaria endemisch ist, erkrankten 2021 5,3 Millionen Menschen, geschätzt 12 500 starben. Die Fieberschübe führen zu Blutarmut und können weitere Infektionen auslösen. Auch das Wachstum und die kognitive Entwicklung der Kinder werden beeinträchtigt.
Als erstes Land der Welt hat Ghana nun einen ne uen Impfstoff für Kinder zwischen fünf Monaten und drei Jahren zugelassen – noch bevor die finale Phase-3-Studie veröffentlicht wurde. Dies ist ungewöhnlich. Doch mit 77 Prozent ist die Schutzwirkung von R21/MatrixM, wie der von der Universität Oxford entwickelte Impfstoff heisst, deutlich höher als beim bisher zugelassenen Impfstoff. Und es sollen pro Jahr mehr Dosen hergestellt werden können. Beim Vorgängerimpfstoff sind es 100 000 Dosen. Bei R21/Matrix-M sollen es über 200 Millionen Dosen werden, wie der Impfstoffhersteller ankündigt. Gemäss der WHO benötigen pro Jahr 25 Millionen Kinder je drei Impfstoff-Dosen plus einen Booster ein Jahr später.
Es ist das erste Mal, dass als Erstes ein afrikanisches Land einen wichtigen Impfstoff genehmigt, vor europäischen oder nordamerikanischen Ländern. Seit der CoronaPandemie – und der Erfahrung, als Letztes an die Reihe zu kommen –seien afrikanische Behörden proaktiver, sagt Adrian Hill von der Universität Oxford. LEA
An dieser Stelle berichten wir alle zwei Wochen über positive Ereignisse und Entwicklungen.
Rechtsstaat adieu
Indiens Premier Narendra Modi ist ein ausserordentlich populärer Politiker. Seine Zustimmungswerte stehen nach bald zehn Jahren an der Macht bei 76 Prozent. International wird Indien als grösste und dynamischste Demokratie gefeiert, Modi als glänzendes Beispiel eines erfolgreichen Staatslenkers. Kritiker*innen sehen darin eine Verkehrung der Tatsachen. Der Essayist und Schriftsteller Pankaj Mishra etwa sagte gegenüber dem britischen The Guardian, Indien befinde sich auf dem Weg von einer säkularen Demokratie zu einem autoritären Hindu-Staat. Er spricht von «Gewalt» gegen das soziale Gefüge des Landes und gegen die Institutionen. Die Unabhängigkeit der Medien und der Justiz sei nicht mehr gewährleistet.

Dazu passt der Verleumdungsprozess gegen den führenden Oppositionspolitiker Rahul Gandhi. Er habe den Premierminister anlässlich einer Wahlkampfrede 2019 in einem Atemzug mit mutmasslichen Kriminellen genannt: «Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi – warum heissen eigentlich alle Diebe mit Nachnamen Modi?» Eine provozierende, aber im Wahlkampf kaum aussergewöhnlich angriffige Frage – dennoch wurde Gandhi der Verleumdung schuldig gesprochen und zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt.
Vieles an dem Fall hat einen politischen Beigeschmack. Klage eingereicht hatte ein ranghoher Abgeordneter der Regierungspartei, der mit Nachnamen ebenfalls Modi heisst: Gandhis Aussagen seien für ihn, den
Premierminister sowie alle 130 Millionen Modis in Indien rufschädigend. Zunächst geschah nichts. In Indien stauen sich legendäre 14 Millionen Fälle. Nach einigen Monaten zog Purnesh Modi sein Begehren zurück.
Im Februar dann aber wandte er sich erneut an das Regionalgericht in Gujarat, dem Heimatstaat des Premierministers. Er habe neue Beweise, so der Geschädigte. Womöglich hat die Reaktivierung des Falls aber andere Gründe. Zum Beispiel, dass nun ein enger Verbündeter des Staatschefs an dem Gericht amtet. Aufsehenerregend ist auch das plötzliche Tempo, mit dem die Sache voranging: Kaum einen Monat später folgte die Verurteilung Gandhis, zu ausgerechnet zwei Jahren Freiheitsstrafe. Das ist einerseits das Maximum für den Straftatbestand der Verleumdung – andererseits das Minimum für den Entzug eines politischen Amts. Tatsächlich musste Rahul Gandhi am Tag nach dem Urteil seinen Parlamentssitz räumen – obwohl es noch gar nicht rechtskräftig und der Verurteilte bereits in Berufung gegangen ist. Verräterisch ist auch das Timing: Gerade rückte Gandhi, der gegen Modi kämpfte, diesem auf die Pelle. Es sah ganz so aus, als gelänge es ihm, eine Untersuchung wegen undurchsichtiger Geschäfte zwischen Modi und Gautam Adani zu erwirken – letzterer ist einer der Reichsten der Welt. Vermutet wird Korruption in grossem Stil, es geht um drei Milliarden Dollar. Nun wird gar nichts untersucht. Und sollte Gandhi auch von einem oberen Gericht verurteilt werden, wäre es ihm während acht Jahren verboten, ein politisches Amt auszuüben. Was hiesse: Narendra Modi wäre seinen ärgsten Rivalen bei den Wahlen 2024 bereits los.
Surprise 549/23 5
Vor Gericht
ILLUSTRATION: PRISKA WENGER
Na? Gut!
YVONNE KUNZ ist Gerichtsreporterin in Zürich.
Meditation für den heutigen Tag
Ich mache mir über nichts Gedanken, sondern gehe ganz im Augenblick auf, der aus den unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen zur gleichen Zeit besteht. Jeder Augenblick geht in den nächsten Augenblick über, der neue Wahrnehmungen mit sich bringt. Da ich nicht denke, sondern einfach sinnlich bin, spüre ich eine starke Ruhe und Stille, obwohl die Vögel Geräusche machen – das Zwitschern, der Windstoss des Flügelschlags –, Wasser plätschert und Libellen vorbeifliegen.
Denke an keine Uhrzeit, kein Problem geht durch den Kopf, der Verstand hat sich zur Ruhe begeben und die Sinne sind geöffnet. Es kann in mich eindringen, was in diesem Moment um mich herum geschieht. Eine grosse Ruhe und Entspanntheit breitet sich ohne mein aktives Zutun in meiner Seele aus. Empfinde Erfüllung, Ruhe und Zufriedenheit, weil ich den
Augenblick meines Daseins und die Natur in mich aufnehme. Ohne zu werten. Es existiert kein Gestern, kein Morgen, sondern nur der heutige Tag. Es besteht der Zustand der Meditation und gleichzeitig der Liebe.
Meditation ist Liebe.
Im Zustand der Meditation ist die Liebe mein gesteigertes Gefühl von Sein und Seligkeit.

Es ist schwierig, diesen Zustand mit Worten genau zu beschreiben.
HANS RHYNER, 68, verkauft Surprise in Zug und Schaffhausen und macht Soziale Stadtrundgänge in Zürich. Er hat gelernt, als süchtiger Mensch mittels Meditation besser mit Themen wie Angst, Groll und Selbstmitleid umzugehen.
Die Texte für diese Kolumne werden in Workshops unter der Leitung von Surprise und Stephan Pörtner erarbeitet. Die Illustration zur Kolumne entsteht in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Studienrichtung Illustration.
Verkäufer*innenkolumne
ILLUSTRATION: PABLO BÖSCH
Moumouni …
… studiert den Böög
Ich habe in dieser Kolumne schon öfter über das Thema Privilegien geschrieben. Einen Bereich habe ich bisher jedoch gänzlich ausgespart! Mit Grund. Es han delt sich dabei nämlich um jene Pri‑ vilegien des weissen cis Mannes ab der Mittelschicht, die so unsäglich unver schämt sind, dass sich alle minder Privi legierten dafür in Grund und Boden schämen würden. Beziehungsweise: Sie würden wohl auch gerne dürfen und doch nicht wollen.
Ich meine das ungestrafte Nasebohren und die Mukophagie (griechisch: mukus = Schleim, phagein = essen). Dabei will ich betonen, dass es hier nicht um die Rhinotillexomanie geht, das patholo gische Leiden an zwanghaftem Naseboh ren, sondern um das Privileg dessen, der keine soziale Ächtung zu fürchten hat. Popeln als Machtmissbrauch!
Es mag ja Leute geben, die dieser Ko lumne ankreiden möchten (Achtung: klassische Kreide ist weiss!), dass ich das mit der Hautfarbe und dem Gender zeug übertreibe – aber nun ja: Seit dem Typen im Anzug, der mir im Zug ge genüber sass und genüsslich in der Nase bohrte und bohrte und bohrte, bis er endlich den grossen Schleim erwischte und unter offensichtlicher Beobach tung (ich sah ihm dabei demonstrativ in sein popeliges Antlitz und traf sogar seinen Blick!) den grün grau gelben Nugget betrachtete (ich tat es ihm gleich), ihn dann zu einer gleichmässig runden Kugel rollte und DANN IN DEN MUND NAHM! Seit diesem Typen also, der mir seit nunmehr drei Jahren nicht aus dem Kopf geht, führe ich eine kleine Studie: Wer popelt? Wer isst die Popel? Und wer kommt damit durch? Beobachtungen im öffentlichen Raum
bestätigen: Die einzigen Menschen, die schamlos popeln können, ohne ihre Attribute als seriöse, ernstzunehmende, zivilisierte, angemessen gepflegte und geschätzte Mitglieder dieser Gesellschaft zu verlieren, sind die oben beschriebe nen Typen!

Das letzte Studienexemplar sah ich vor Kurzem an einer Pressekonferenz, an der ich mich bemühte, einen anständigen Eindruck zu vermitteln. Ich sass auf dem Podium und hatte besten Blick auf eine Person in der ersten Reihe, die kritisch unseren Ausführungen über die Abnahme des rassistischen Wandbil des im Schulhaus Wylergut in Bern lauschte und während zwanzig Minuten demonstrativ immer wieder frisch ge angelte Böög zerrieb und an seinen Stuhl schmierte. Nur einem exklusiven Club Männern ist der Böög gegönnt. Warum sonst ist es in Zürcher Zünften, die ja immerhin am Tag des Sechseläuten einen riiiesigen Böög (zu Deutsch: Popel) zelebrieren, ausschliesslich Männern erlaubt, Mitglied zu sein?
Es gibt natürlich Ausnahmen, denen ich wenig neidig die Popelei gönne, wie beim damaligen Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der sich im Stress eines hitzigen Spiels (in dem es aber eben wirklich um alles ging) hinreissen liess, vor einem Millionenpublikum an der WM 2010 in der Nase zu bohren und den Finger dann in den Mund zu stecken. Sofort diagnostizierten ihm unzählige Hobby und Berufspsycholog* innen eine unterbewusste Ausgleichs handlung, um Stress abzubauen – so auch, als er sich kurz darauf vor laufender Kamera mal an die Genitalien, mal an den Po griff, um dann jeweils an der Hand zu riechen. Aber klar – Ausnahme situation! Die Deutschen kamen immer hin ins Halbfinale, weiter als die Itali‑ ener, deren Fernsehsender den Grüsel skandal erst thematisierte.
FATIMA MOUMOUNI will in Wahrheit wohl einfach auch … Und ab dem 30. Juni erscheint Moumounis Kolumne in einem neuen Format. Die Redaktion fragt, Moumouni malt ein Bild.

Surprise 549/23 7
ILLUSTRATION: CHRISTINA BAERISWYL


8 1 2
1 Im Sommer wachsen Kartoffeln. Im Winter trainiert hier das erste Frauen-Eishockeyteam Kirgistans: «Flügel von Yssykköl».
2 Trainiert wird jeden Tag, immer um zwanzig Uhr.
3 Der Trainer, Salamat Abdrakhmanov, ist auch für die Wartung der Ausrüstung zuständig.

Eishockey statt Kartoffeln
Zukunftsp ersp ektive Eine improvisierte Fläche mit Eis kann die Welt bedeuten. Für ein Team junger Frauen in einem Dorf in Kirgistan bietet sie Freiheit, Perspektive und Selbstbewusstsein.
Abends herrscht auf Salamat Abdrakhmanovs Hof reges Treiben. Hier führt der Weg zum Spielfeld. Eine Scheune wird als Lager für die Ausrüstung genutzt. Ein Teambanner an der Wand: «Flügel von Yssykköl». Der Name bezieht sich auf den nahen azurblauen See, einen der Naturschätze Kirgistans. Auf der anderen Seite der Scheune öffnet sich eine andere Welt. Eis glitzert unter Scheinwerfern. Musik schallt aus Lautsprechern. Auch ohne Champions League kann man sich hier wie ein Champion fühlen. Das Briefing beginnt. Abdrakhmanov stellt den Trainingsplan vor. Aufwärmen, ein paar Übungen, dann ein Match. Zwölf Mädchen fahren Slalom zwischen Reifen auf dem Eis, machen ein paar Teamspiele. Dann folgt der eigentliche Match zwischen den in zwei Teams aufgeteilten Spielerinnen. Die Mädchen, in breitschultriger Schutzkleidung, gleiten über die Oberfläche. Eisstaub hängt in der Luft.
«Im Sommer wachsen hier Kartoffeln», sagt die 17-jährige Sezim Abdrakhmanova und klopft mit dem Schläger auf das dicke Eis. Sie ist Salamats Tochter und spielt als Stürmerin für das einzige Frauen-Eishockeyteam Kirgistans. In ihrem Dorf mit dem Namen Otradnoye stehen 320 Häuser, einstöckige Katen mit je einer kleinen Veranda und einem Kachelofen. Im Winter sinkt die Temperatur bis minus zwanzig Grad. Die Felder sind mit Schnee bedeckt. Von den Bergen am Horizont weht ein eisiger Wind. Dort, an der Grenze zu China, erheben sich die Siebentausender des Tian-Shan-Gebirges. Weit näher im Norden liegt Kasachstan, dessen Grenze ist aber weniger augenfällig.
«Flügel von Yssykköl» ist ein Do-ityourself-Team. Nach der Ernte im Herbst ebnet Abdrakhmanov das Feld ein. Wenn der Boden gefroren ist, beginnt er das Feld zu fluten. Drei Tage lang, Tag und Nacht,

Surprise 549/23 9
TEXT EMILIA SULEK FOTOS DANIL USMANOV
KIRGISTAN
Otradnoye
3
giesst er alle zwei Stunden eine weitere Schicht Eis. Die Tore hat er mit dem Nachbarn zusammengeschweisst. Auch die Scheinwerfer an den Bäumen sind ihr gemeinsames Werk. Insgesamt zwanzig Mädchen spielen Eishockey in Otradnoye. Salamat Abdrakhmanov trainiert auch Jungs. «Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Mädchen sind organisiert, sie haben Willenskraft, sie teilen ihre Zeit gut ein», zählt er auf. Die Jungs kämen unregelmässig zum Training. «Sie kümmern sich weniger darum», sagt Abdrakhmanov. «Sie sehen Eishockey nicht als Chance auf ein besseres Leben.» Die Mädchen von «Flügel von Yssykköl» spielen gegen die Jungs aus dem ganzen Land. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Team gewinnt oder verliert. «Wir freuen uns über jedes Tor», sagt Tochter Sezim Abdrakhmanova. «Wir haben andere körperliche Voraussetzungen, aber in Sachen Schnelligkeit, Präzision

1 Der Weg zum Eis führt durch den Hof von Salamat Abdrakhmanov.
2 Im Dorfladen.
3 In der Schule.
4 Mädchen in Otradnoye werden zur harten Arbeit erzogen.
5 Sezim Abdrakhmanova, Stürmerin für «Flügel von Yssykköl».
und Technik stehen wir den Jungs in nichts nach.» Sezim ist eine robuste Teenagerin mit festem Händedruck. Sie war nicht immer so zufrieden mit sich. «Vor ein paar Jahren habe ich nachts trainiert, als alle im Bett waren. Ich wollte abnehmen», gesteht sie. Nun sagt sie: «Wenn ich spielen will, muss ich stark sein. Vielen Mädchen geht es so: Wenn du aufs Eis gehst und diese Kraft spürst, vergisst du die Komplexe. Dein Körper ist cool.»

Mit Schlittschuhen Geld verdienen
Die Einwohner*innen von Otradnoye bauen Weizen und Kartoffeln an, züchten Kühe und Pferde. Damit kann man aber fast nicht überleben. Die meisten Höfe haben nur drei oder vier Hektaren Land. Der Verkauf deckt kaum die finanziellen Aufwendungen. Bis zur Hauptstadt Bischkek sind es vierhundert Kilometer. Die Strasse wurde seit Jahren nicht repariert. Viele kir-
gisische Bauern gehen deshalb zum Arbeiten nach Russland. So war es zumindest vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Und so hat es auch Salamat Abdrakhmanov gemacht. Drei Jahre lang arbeitete er Tag für Tag auf einer Baustelle. «Sie haben mir ein Drittel von dem gezahlt, was sie den Russen geben, aber es hat sich trotzdem gelohnt.» Mit diesem Geld renovierte er sein Haus und schloss es an das Frischwasser- und Abwassernetz an. Hier ist das ein Luxus. Nur die Hälfte der Häuser im Dorf hat fliessendes Wasser. Die Menschen können sich die Investition nicht leisten, und auch die Gemeinde ist zu arm, um sie zu finanzieren.
Nach seiner Rückkehr legte Abdrakhmanov zum ersten Mal eine Eisbahn. «Ich dachte mir: Ich verleihe Schlittschuhe. Die Leute haben Spass, und ich verdiene Geld.» Aber die Idee setzte sich nicht durch. Die Gäste aus den umliegenden Dörfern kamen

10 Surprise 549/23
1 2
zwei oder drei Mal, dann begannen sie sich zu langweilen und sie blieben wieder weg. «Wahrscheinlich hätte ich die Eisbahn nicht wieder gelegt, wenn ich nicht bemerkt hätte, dass meine Kinder sie klasse finden. Also dachte ich mir: Ich mache weiter.» Es gab Schlittschuhe, es gab einen Platz und Wasser im Hydranten – was nicht selbstverständlich ist. Und Abdrakhmanov meldete sich in der Hauptstadt Bischkek für einen Trainerkurs an. Die Eisbahn blieb.
Dass Leidenschaft im Leben wichtig ist, lernte Abdrakhmanov von seinem Vater. Neben der Arbeit auf dem Bauernhof betrieb dieser ein Dorfkino. Das war in den Achtzigerjahren, Kirgistan war Teil der Sowjetunion. Ausser an Propaganda erinnert sich Abdrakhmanov vor allem an Bollywood-Filme, wegen der Musik und der Farben. Als Junge sah er sie aus dem Vorführraum an, wo er seinem Vater bei der Bedienung des Projektors half. «Das war


mein Fenster zur Welt», sagt er. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde die Sowjetrepublik Kirgistan zur unabhängigen Republik Kirgistan. Die ersten Jahre nach der Unabhängigkeit brachten wirtschaftliches Chaos. Kirgistan wollte mittels Reformen so schnell wie möglich zu einer freien Marktwirtschaft übergehen.
Die Zeiten waren hart für die Dorfbewohner*innen. Es fehlte an allem: an Bargeld, Treibstoff für die landwirtschaftlichen Maschinen und an Saatgut für die Felder. Auch im Dorfkino gingen die Lichter aus. Die Geräte wurden gestohlen. Das Gebäude verfiel, wurde von Unkraut überwuchert. Während die Erwachsenen ums Überleben kämpften, breitete sich unter den Jugendlichen Gewalt aus. Die Älteren prügelten die Jüngeren, die Stärkeren die Schwächeren. Salamat Abdrakhmanov war damals ein Teenager, im gleichen Alter wie

seine Tochter Sezim heute. «Junge Menschen brauchen etwas zu tun», sagt er. «Es ist leicht, aus Langeweile und Hoffnungslosigkeit Alkohol und anderen Drogen zu verfallen. Zwar sind die Mädchen zuhause eingebundener und dadurch vielleicht von Suchtmittelabhängigkeiten seltener betroffen, aber auch sie kann es erwischen.»
Ein halbes Jahreseinkommen
Eishockey ist ein teurer Sport. Schlittschuhe, Polster, Helm und alles Übrige für eine Spielerin kosten bis zu 200 000 Som. Das sind umgerechnet gut 2000 Franken –die Hälfte des Jahreseinkommens einer durchschnittlichen Familie im Dorf. Die Ausrüstung des Teams ist deshalb zusammengeschustert. Salamat Abdrakhmanov kauft alles gebraucht. Aber die Sachen halten nicht ewig. Schläger brechen, Kleidung reisst, Pucks werden zu rau zum Gleiten. Früher hatte das Team überhaupt keine
Surprise 549/23 11
3 5 4
«Früher hatte ich nur Träume. Heute habe ich Ziele. Ich schreibe sie auf. Das hilft mir, sie zu erreichen.»
SEZIM ABDRAKHMANOVA
professionelle Ausrüstung. Die Mädchen spielten auf Eiskunstlaufschuhen. Statt Hockeyhelmen trugen sie Bauhelme. Etliche davon hängen noch als Erinnerung in der Scheune. Dann kam Manizha (sprich: Manija mit weichem j wie in Jalousie). Die im Nachbarland Tadschikistan geborene Künstlerin singt feministische Lieder. Am Eurovision Song Contest 2021 trat sie für Russland an, wo sie seit der Kindheit lebt. Ihr Lied «Russian Woman» brachte ihr unter anderem aufgrund ihrer Herkunft nationalistisch-frauenfeindliche Kritik ein. Im Video zu ihrem Hit «Now or never» liess sie die Eishockeyspielerinnen von Otradnoye auftreten. Das Video ging viral. Daraufhin erhielt das Team Unterstützung, auch aus der Schweiz.
Ausserhalb der Eisbahn und ohne die massive Ausrüstung erscheinen die Mädchen buchstäblich einige Nummern kleiner. Sezims Klassenkameradin Gulzat
Ibrayeva ist ein zierliches Mädchen, das auf der Verteidigungsposition spielt. Sie gibt zu, dass die Spielerinnen auf dem Eis unheimlich aussehen können. Der Alltag sieht anders aus. «Körperliche Stärke ist glücklicherweise nicht alles», sagt sie. Auch Gulzat verbringt ihre Zeit gerne mit Hockeyspielen. Nur dass die Zeit knapp ist und ihr Weg zum Eisfeld holpriger, weil ihre Familie dem Sport kritisch gegenübersteht und sie nicht immer gehen lässt. Im Team herrscht in diesem Punkt Einigkeit: «Wer kommen kann, kommt. Und wenn was dazwischenkommt, ist es eben so», sagt sie. Viele Mädchen in Otradnoye hatten vor dem Einzug des Hockeys kein Interesse an Sport. Sie schlossen sich dem Team aus Neugier an. Sie wollten der harten Arbeit im Haushalt entfliehen und sehnten sich nach etwas Neuem. «Flügel von Yssykköl» ist ein Amateurteam, hat aber regelmässig Auswärtsspiele. Manch-
1 Salamat Abdrakhmanov, Trainer des Teams «Flügel von Yssykköl».


2 In der Küche von Nazgul Bayaliyeva, Sezims Mutter (1.v.l.).
3 Die Moschee in Otradnoye. In Kirgistan dominiert die liberale Version des Islam.

4 In Sezims Zimmer.
5 Die Eishockeyausrüstung übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Teams. Die Mädchen spielen mit gebrauchter Ausrüstung.
12 Surprise 549/23
«Junge Menschen müssen sehen, dass es sich lohnt, eigene Wege zu gehen.»
SALAMAT ABDRAKHMANOV
1 2 3
mal sogar in der Hauptstadt Bischkek. Für viele Spielerinnen ist das der erste Ausflug in die grosse Stadt. Selbst nach Karakol, der Hauptstadt der Provinz, fahren sie selten. Hier gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Sie müssten ein Taxi nehmen.
Den Eltern auf dem Hof helfen
Trainiert wird jeden Tag, immer um zwanzig Uhr. Wenn die Mädchen nicht in der Schule sind, müssen sie ihren Eltern auf dem Hof helfen. Erst dann haben sie frei. Trotzdem lassen die Eltern ihre Töchter nicht immer zum Training kommen. In Otradnoye gibt es keine Strassenlaternen. Die Dunkelheit der Nacht wird nur durch die Fenster der Häuser erhellt. Allerdings sperren die Eltern ihren Töchtern den Weg zum Training nicht aus Sorge um ihre Sicherheit. «Mädchen sollen zuhause bleiben», sagt Sezims Teamkollegin Gulzat

Ibrayeva. «Zuhause bleiben und arbeiten», fügt sie hinzu. Ihre Brüder haben mehr Freiraum, sie aber ist den ganzen Tag auf den Beinen. Wasser aus dem Brunnen holen, den Herd anzünden, die Kühe melken und striegeln. Ausserdem Wäsche waschen, kochen und putzen. Im Frühjahr dann auf dem Feld Kartoffeln pflanzen. Viele Familien haben vier oder fünf Kinder. Die älteren Geschwister kümmern sich um die jüngeren. Und wenn die Eltern zur Arbeit ins Ausland gehen, liegt alles auf den Schultern der Töchter. Mädchen werden zur harten Arbeit erzogen, Freizeit ist ein Fremdwort für sie.


«Junge Menschen müssen sehen, dass es sich lohnt, eigene Wege zu gehen», sagt Trainer Salamat Abdrakhmanov. «Setze dir Ziele und kämpfe dafür.» Gulzat Ibrayeva muss um jedes Training kämpfen. Ihre Eltern verbieten ihr, Eishockey zu spielen.

Surprise 549/23
4 5
Die Mutter weist auf Verletzungen hin, von denen es im Team einige gegeben habe. Eishockey ist schliesslich ein Kontaktsport. Eine Spielerin hat sich den Arm gebrochen. Einer anderen wurde von einem Hockeypuck der Brauenbogen verletzt. In den Augen von Gulzats Vater sollte sich eine «gute Tochter» um den Haushalt und nicht um ihre Hobbys kümmern. Aber Gulzat ist entschlossen: Sollte ihr Vater sie doch zuhause einsperren, ist sie bereit, durch das Fenster zu fliehen. Würde sie dafür nicht bestraft werden? Gulzat zuckt mit den Schultern. «Egal. Meine Eltern müssen verstehen, dass ich das Recht habe, meine eigenen Entscheidungen zu treffen.» Obwohl der Trainer mit ihnen darüber gesprochen hat – gebracht hat es wenig.
Die Welt ausserhalb des Hauses ist voller Gefahren, sagt auch Sezims Mutter, Nazgul Bayaliyeva. Und ein Mädchen, das

nach Einbruch der Dunkelheit durch das Dorf geht, ist Gegenstand von Klatsch und Tratsch. Junge Frauen sollen ihren Ruf wahren und früh heiraten. Auch wenn Bayaliyeva das Team ihres Mannes unterstützt, macht sie sich Sorgen: Wird die Tochter einen Mann finden? Wird das Eishockey potenzielle Interessenten abschrecken?
Bayaliyeva hatte nie Schlittschuhe an den Füssen und war anfangs nicht begeistert von der Eisbahn auf ihrem Feld. Inzwischen hat sie akzeptiert, dass auch ihre jüngere, sechsjährige Tochter mit dem Eishockeyspielen beginnt. Das Zimmer der Mädchen ist mit Fotos von Eishockeymannschaften und der koreanischen Fernsehserie «Puck!» behängt. Bayaliyeva hat sich daran gewöhnt. Solange die Mädchen gute Noten in der Schule haben und ihr zuhause helfen, wird sie ihrer sportlichen Leidenschaft nicht im Wege stehen.
Tochter Sezim und ihre Teamkollegin Gulzat denken mit einer Mischung aus Faszination und Angst an die Welt jenseits des Dorfes. Sie machen bald Abitur und wollen gemeinsam in Bischkek studieren. Am liebsten würden sie nach Kanada gehen, nicht nur, weil es die Wiege des Eishockeys ist. «Es ist das sicherste Land für Frauen», meint Gulzat. Wenn die Mädchen auf die Universität gehen, möchten sie ihre sportliche Karriere weiterverfolgen. Sezim träumt davon, für Geld zu spielen. Als Studium hat sie aber Psychologie gewählt. Ihre Mutter fragt zwar: Was ist das für ein Beruf? Aber Sezim glaubt: «Einer mit Zukunft. Die Welt wird immer mehr Psycholog*innen brauchen.» Psychologie hilft auch bei der Arbeit als Trainerin, und langfristig – als Beruf oder Hobby – will Sezim auch junge Leute trainieren. «Früher hatte ich nur Träume», sagt sie. «Heute habe ich mir Ziele gesetzt.
1
Ich schreibe sie auf. Das hilft mir, sie zu erreichen.» In diesem Jahr noch möchte sie drei Medaillen gewinnen, aufs College gehen und Lokomotiv Bischkek beitreten, dem wichtigsten Team der Hauptstadt. Es ist eine Männermannschaft, aber die Eishockeyregeln erlauben einzelne weibliche Spielerinnen. «Hockey hat auch mich gelehrt, an mich selbst zu glauben», sagt Gulzat dazu. «Früher dachte ich, mein Ziel sei es, für immer zuhause zu arbeiten. Heute denke ich auch ans Studieren.» Ihr Traumberuf wäre Anwältin. Der Weg zu diesem Ziel ist lang, aber Gulzat hat keine Angst vor Träumen. «Wenn meine Eltern mir den Weg versperren, laufe ich einfach weg», sagt sie.
Das Tauwetter im Frühjahr
Am Abend findet auf der Eisbahn in Otradnoye ein kleines Ritual statt. Einige Eltern kommen. Auch der Moldo kommt, so wird
das Oberhaupt der muslimischen Religionsgemeinschaft hier genannt. Das Wort leitet sich ab von Mullah. Im dicken Mantel, mit Bart und bestickter Mütze spricht er ein Gebet auf Arabisch und Kirgisisch. Er erhebt die Hände auf die Höhe seines Gesichts und segnet die Versammelten. «Mögen wir uns nächstes Jahr alle wieder hier treffen.» Es ist Saisonende. Tagsüber ist die Temperatur bereits nahe null. Der Moldo, der mit bürgerlichem Namen Melis Meyermanov heisst, interessierte sich schon immer für Sport. In seiner Jugend war er Ringer. «Zu Zeiten des Propheten Muhammad gab es kein Eishockey», schmunzelt der Moldo über die Vorstellung von Eis auf der arabischen Halbinsel. «Im Koran steht aber nicht, dass Frauen keinen Sport treiben dürfen», fügt er hinzu. Der Moldo repräsentiert die liberale Version des Islam, die in Kirgistan dominiert.
«Frauen zu verbieten, Sport zu treiben, ist ein archaisches Relikt», sagt er.
Wenn im Frühjahr das Tauwetter kommt, sinkt die Stimmung im Team. Bald wachsen wieder Kartoffeln auf der Eisbahn. Aufnahmen auf TikTok, Spiele anderer Mannschaften und koreanische Serien halten die Stimmung der Eishockeyspielerinnen den Sommer über aufrecht. Ihr Ehrgeiz treibt sie auch an, zusammen joggen zu gehen, um in Form zu bleiben. «Die ersten Wochen sind die schwersten. Es ist ein harter Entzug vom Eis», sagt Trainer Abdrakhmanov. «Früher war der Winter lang. Dunkel, kalt, langweilig», sagt Sezim. «Jetzt ist er zu schnell vorbei.» Sezim und Gulzat beneiden die Teams aus der Stadt, die das ganze Jahr über trainieren können. «Überall warten die Menschen auf den Frühling, hier ist es umgekehrt», sagt Gulzat. «Wir warten auf den Winter.»

1 Vor dem Training. An der Wand hängen Medaillen, die das Team gewonnen hat.
2 Tauwetter. Am Horizont das Tian-Shan-Gebirge, an der Grenze von Kirgistan zu China.
3 Abschied von der Saison. Die Mädchen freuen sich auf den nächsten Winter.

2 3
Haben sie ihren Vater einmal zuhause, wetteifern Edouard, Matteo und Daniel um dessen Aufmerksamkeit.

Strassenverkäufer auf
Heimaturlaub
Arbeitsmigration Ein Fünftel der rumänischen Arbeitskräfte ist im Ausland beschäftigt. Daniel ist einer von ihnen. Normalerweise verkauft er das Strassenmagazin =Oslo in Norwegens Hauptstadt. Nun begleiten wir ihn in sein Dorf in Rumänien.
16 Surprise 549/23
TEXT UND FOTOS EVEN SKYRUD RUMÄNIEN Brădeni
Die grösseren Häuser in Bradeni wie dasjenige, in dem Daniel und seine Familie leben, säumen die Strasse. Die kleineren, schlichteren liegen abseits der Hauptstrasse, auf der viele aufs Gaspedal treten, besonders wenn sie einen Pferdewagen oder einen alten Traktor vor sich haben. Deswegen muss das Tor zu Daniels Grundstück geschlossen bleiben, denn dahinter spielen die Kinder. Das Tor ist solide und ziemlich neu. «Das alte war total abgenutzt. Eines Tages fiel es meiner Frau beim Öffnen entgegen.» Glücklicherweise sei ihr nichts passiert, sagt Daniel auf dem Weg in den Hof.
Er ist gerade aufgewacht, noch müde von der dreitägigen Busfahrt von Oslo hierher ins Zentrum Rumäniens. Aber der dreijährige Edouard lässt ihn nicht alleine, jetzt, wo der Vater endlich für eine Weile zuhause ist. Edouard und sein älterer Bruder Matteo stehen mit grossen Augen in der Tür. Der jüngste Bruder, der wie sein Vater Daniel heisst, schlafe noch, erzählt uns Mutter Kristina. Sie ist hereingekommen, ohne dass wir es bemerkt haben. Daniel wirft einen Blick auf den riesigen Holzstapel in der Mitte des Hofes. «Die Winter sind kalt hier», sagt er. Nicht so kalt wie in Norwegen, aber Strom ist teuer. Dann zeigt er auf den Hühner- und den Schweinestall. Fünf Schweine. Drei davon Ferkel. Mehr Schweine dürfen die Menschen nicht mehr besitzen, seit 2019 ein Gesetz zur Beschränkung des Viehbestands in Privathaushalten erlassen wurde. Alle Familien in Bra ˘ deni haben fünf Schweine und einen grossen Gefrierschrank. Hühner und Gemüsegärten sind lebensnotwendig.
Daniel hat das Haus 2015 gekauft, ist aber erst vor zwei Jahren eingezogen. Um das Haus instandzusetzen, verkauft er jedes Jahr während etwa zehn Monaten das Strassenmagazin in Oslo. Den grössten Teil des Geldes, das er dort verdient hat, gab er für die Renovierung beider Etagen und den Kauf gebrauchter Möbel aus. Seine Ausgaben in Norwegen hält er möglichst gering. «Wir leben mit drei Männern in einem kleinen Zimmer ausserhalb von Oslo», erklärt er. «Wir kaufen billiges Essen, das wir zusammen zubereiten. Das Einzige, wofür ich Geld ausgebe, ist Rauchen. Ich schicke meiner Frau und den Jungs jeden Monat zwischen 7000 und 10 000 Kronen (ca. 600 bis 800 Schweizer Franken). Das ist mehr, als ich selbst ausgebe.» Was übrig bleibt, spart er. Damit wolle er seinen Kindern einmal eine bessere Zukunft ermöglichen, sagt er.
Viele Väter und Mütter im Ausland
2021 veröffentlichte die NGO Save the Children eine Studie, gemäss der bei etwas mehr als 75 000 rumänischen Kindern ein oder beide Elternteile im Ausland arbeiten. Die Dunkelziffer besonders für ärmere Regionen wie Bradeni im Kreis Sibiu, inmitten der historisch als Transylvanien oder Siebenbürgen bekannten Gegend, liegt noch höher. Allein im Jahr 2022 haben 560 000 Menschen das Land verlassen. In einer Studie aus dem Jahr 2018 gab die Hälfte der befragten Rumän*innen zwischen 15 und 24 Jahren
an, dass sie auswandern wollten. Als wichtigste Gründe nannten sie die unzureichende Versorgung, niedrige Löhne, den Mangel an guten Arbeitsplätzen, politische Instabilität sowie Ineffizienz und weit verbreitete Korruption.
Die Folgen der Emigration zeigen sich deutlich in Bra ˘deni. Daniels Kindheitsfreund Mihai nimmt uns mit auf eine Tour durch das Dorf. Er spannt seine beiden Pferde vor den Karren, mit dem er normalerweise Holz transportiert. Einige der Nachbarskinder steigen mit auf, Daniel ist unser Guide. «Transport ist das einzige Geschäft. Hier kostet alles doppelt so viel wie in der Stadt, also gehen wir nicht so oft einkaufen. Hin und wieder bezahlen wir jemanden, der uns in die nächste Stadt fährt.»
Wir sehen nur wenige Autos unterwegs. Neugierige Dorfbewohner*innen kommen heraus, um zu sehen, wer vorbeikommt. Daniel kennt sie alle. Die alten Frauen, die Männer, die beim Bier auf der Brücke stehen und quatschen. Mütter mit kleinen Kindern. Daniel weist nach rechts und links. «Die Menschen, die in diesem Haus wohnen, arbeiten in Spanien. In dem Haus da arbeitet der Vater in Deutschland. Im nächsten auch Deutschland. Während der Erntezeit pflücken sie dort Gemüse. Hier ist niemand zuhause, die sind ebenfalls alle in Deutschland.»
Alle Häuser, auf die Daniel zeigt, sehen ähnlich aus: vergleichsweise gross, neu gestrichen und in gutem Zustand. Abseits der Hauptstrasse geht es über eine Brücke auf die Schotterpisten. Daniel zeigt auf ein kleines Backsteinhaus hinter einem wackligen Zaun und übersetzt, was sein Freund Mihai, der die Zügel lenkt, soeben gesagt hat: «Hier bin ich aufgewachsen. Zu sechst in nur einem Raum. Das musst du dir mal vorstellen. Sechs Personen schlafen, essen und waschen sich in einem kleinen Zimmer.» Daniel sagt, dass ihm ältere Kund*innen in Norwegen davon erzählt haben, dass sie auch so aufgewachsen seien. «Aber Mihai ist 26, wie ich. Und immer noch wachsen Kinder so auf wie er.»
Nach der Tour bleiben wir vor Mihais Haus sitzen. Man sieht zahlreiche notdürftige Reparaturen am Haus. Die Klamotten der Kinder sind löchrig. Daniel sagt, dass Mihai hart arbeite. Im Gegensatz zu seinem Vater lebe er nicht von minimalen Sozialleistungen, Kleinkrediten und Sozialdiensten. Mihai schaut bei diesen Worten schüchtern zu Boden. «Ich liefere Holz an alle in Bradeni, aber es ist immer noch nicht genug Geld, um meiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen», sagt er. «Ich habe das Haus mit meinen eigenen Händen gebaut, weil ich die Arbeiter nicht bezahlen kann. Wenn ich in der Hochsaison besonders viel arbeite und es schaffe, drei Fahrten pro Tag zu machen, kann ich ungefähr 2500 Kronen (gut 200 Schweizer Franken) pro Woche verdienen. Das deckt Essen, Kleidung und Strom für sechs Personen. Strom ist richtig teuer geworden.» Die Sorge über die gestiegenen Stromund Lebensmittelpreise teilen viele, denen wir im Dorf begegnen. Selbst Rumän*innen mit festen Jobs sagen, es sei unmöglich geworden, ihren Lebensstandard zu halten. Und noch mehr Menschen ziehen in andere EU-Länder.
Surprise 549/23 17
«Hier ist niemand zuhause, die sind alle in Deutschland.»
DANIEL
Für die meisten in Brădeni, die nicht ins Ausland gehen, findet sich kaum Arbeit. Die Tage verbringt man mit Plaudern und einem Bier bei der Brücke.

Fünf Schweine ist die Anzahl, die das Gesetz pro Haushalt erlaubt. Die allermeisten haben genau fünf.

18 Surprise 549/23
Warum bleibt Mihai hier? «Ich würde gerne im Ausland arbeiten, am liebsten in Deutschland, aber mit vier Kindern, darunter einem Neugeborenen, ist das schwierig. Ich glaube nicht, dass meine Frau mich gehen lässt. Aber auch ich möchte, dass meine Kinder besser aufwachsen als ich.»
Fast vier Millionen Menschen aus Rumänien leben im Ausland – diejenigen nicht mitgezählt, die dauerhaft in Nachbarländern wie der Ukraine und Serbien leben. Das entspricht etwa einem Fünftel der Rumän*innen im erwerbsfähigen Alter. Die Mehrheit von ihnen ist in Westeuropa – die meisten in Italien. Seit dem EU-Beitritt Rumäniens 2007 ist ihre Zahl deutlich gestiegen.
Daniel, seine Familie und die meisten seiner Freund*innen in Bradeni sind Rom*nja, sie machen als Minderheit rund drei Prozent der Bevölkerung Rumäniens aus. Die Geschichte der Rom*nja ist bis heute geprägt von Verfolgung, Sklaverei und Diskriminierung. Wie immer wieder in der Schweiz gab es auch in Norwegen eine rassistisch aufgeladene «Bettlerdebatte». Daniel kam 2010 als 14-Jähriger nach Norwegen und lebte mehrere Jahre auf der Strasse, von der Hand im Mund. «Ich habe gebettelt und Flaschenpfand gesammelt. Nach einer Weile bekam ich einen Job in einer Autowaschanlage, doch der war schlecht bezahlt und ich wurde um Lohn betrogen. Trotzdem war ich dankbar für diesen Job. Dadurch war es mir möglich, dieses Haus zu kaufen.»
Kristina und die Jungs haben sich nun dazugesetzt. Auf dem Esstisch stehen grosse Mittagsteller mit Aufschnitt, Käse, Eiern und Grieben. Daniel fragt seine Frau, ob es in Ordnung ist, wenn er ihre gemeinsame Geschichte erzählt. Sie stimmt zu. «Ich war in Norwegen. Acht Monate lang haben wir online Kontakt gehabt. Wir mochten uns und wollten uns treffen. Also vereinbarten wir, dass Kristina zu mir kommen sollte. Ich hatte eine Wohnung in der Ortschaft Blaker gemietet, doch dann verlor ich 2016 meinen Job in der Autowaschanlage und konnte mir die Miete nicht mehr leisten. Als Kristina nach Norwegen kam, lebten wir in einem Zelt ausserhalb von Lillestrøm.» Daniel lacht. «Wir haben fast drei Monate in dem Zelt gelebt. Es war Sommer, aber es hat fast jeden Tag geregnet», sagt er. «Ich habe Flaschen recycelt und Strassenmagazine verkauft. Kristina bettelte auf der Strasse. Dann wurde sie schwanger, also ist Matteo ein bisschen norwegisch. Hergestellt in Norwegen.»
Hier im grossen, ordentlichen Wohnzimmer in Bra ˘deni, mit den überquellenden Tellern auf dem Tisch, kann man sich das nur noch schwer vorstellen. «Das war wirklich hart», erinnert sich auch Kristina, während Daniel übersetzt. «Wo wir wohnten, gab es jede Menge Mücken, und ich bin allergisch gegen Mückenstiche. Ich hatte überall an den Armen und Beinen grosse rote Klumpen. Als ich im zweiten Monat schwanger war, musste ich nach Hause fahren und bei meiner Familie leben. Daniel ist geblieben, um Geld zu verdienen. Wir haben in dieser Zeit, bevor Matteo geboren wurde, viel gestritten.» Daniel nickt.
«Ja, wir haben uns fast getrennt. Es war ein hartes Leben, und wir waren sehr jung. Lange haben wir nicht miteinander gesprochen. Jetzt lieben wir uns. Wir sind zusammen erwachsen geworden, sind stärker geworden.»
Nach dem Mittagessen bringt Daniel uns zu seinen Eltern. Sie wohnen nur drei Minuten entfernt. Neugierige Kinder folgen uns. Das Tor zum Hof ist nicht mehr als ein paar knarrende Bretter, die beinahe auseinanderfallen. Das Haus besteht aus zwei Räumen mit jeweils einer Tür nach draussen. Daniels Mutter ist damit beschäftigt, einen riesigen Topf Tomatensauce zu kochen.
Mit Bier und Smalltalk die Zeit totschlagen
«Das war mein Kinderzimmer», sagt Daniel und setzt sich auf das Bett, das einzige Möbelstück in einem der Zimmer. Die Wände sind kahl, abgesehen von einem selbstgemalten Fussballbild über dem Bett. «Ich bin hier so oft hungrig ins Bett gegangen.» Es dauert eine Minute, bis er wieder aufsteht. Gemeinsam gehen wir in den Hof, um mit seinem Vater zu sprechen. Es gibt billiges Bier aus einer grossen Plastikflasche, die beiden wechseln ein paar Worte, ohne sich anzusehen. Es ist Daniels erster Besuch bei seinen Eltern, seit er angekommen ist. «Mein Vater ist Alkoholiker wie so viele Männer hier. Es ist kein Geheimnis. Eine feste Anstellung hatte er nie. Er mag nicht arbeiten müssen.»
Daniels Vater und dessen Generation wurde massgeblich von den Jahren zwischen der Wende und dem EU-Beitritt Rumäniens geprägt. Es herrschte Massenarbeitslosigkeit und es gab wenig Möglichkeiten, im Ausland Arbeit zu suchen. In Bradeni gibt es eine Menge Männer, die sich Tag für Tag mit Bier und Smalltalk die Zeit totschlagen. Daniel nennt sie «diejenigen, die aufgegeben haben». Der Vater sagt: «Schau her, wir haben hier alles, was wir zum Überleben brauchen. Wir haben Gemüse und Schweine. Wir haben kein Geld, aber wir können es schaffen. Geh und pflücke eine Tomate. Es wird das Beste sein, was du je gegessen hast.»
Es ist tatsächlich eine fantastische Tomate und auch das frisch gebackene Brot im grossen Ofen riecht wunderbar. Es wirkt fast idyllisch. Daniel lächelt verkniffen, als ich das sage. «Es war kein guter Ort, um aufzuwachsen. Er war nicht nett zu meiner Mutter oder zu uns Kindern. Ich besuche ihn, weil er mein Vater ist, nicht weil ich das Gefühl habe, ihm etwas schuldig zu sein.» Als wir uns verabschieden, drückt Daniel seinem Vater eine Handvoll Geldscheine in die Hand. Seine Mutter hat sich bereits abgewendet. Daniel schüttelt den Kopf: «Er bittet mich immer um Geld. Jeder, der noch hier ist und so lebt wie er, tut es. Sie versuchen, ein paar Cent für Zigaretten und Bier zu bekommen. So ist es nun einmal.»
Etwas weiter begrüsst Daniel eine Frau mittleren Alters, umgeben von erwachsenen Kindern und Enkelkindern. Er erzählt uns, dass Utsa – so ihr Name – seit Jahren alleinerziehend ist und die meiste Zeit damit verbracht hat, Beeren, Obst und Gemüse in Deutschland zu pflücken.
Surprise 549/23 19
«Ich möchte, dass meine Kinder besser aufwachsen als ich.»
MIHAI
Ihr altes, verfallenes Haus steht noch, daneben strahlen zwei neue weisse Backsteinhäuser mit kürzlich angeschlossenem Strom. Die Familie habe einen hohen Preis für den neuen Lebensstandard gezahlt, sagt Daniel: «Die älteren Geschwister haben sich um die jüngeren Geschwister gekümmert, andere Verwandte haben sich zusätzlich gekümmert», erklärt er. «Die Kinder haben hier ohne Mutter oder Vater gelebt.»
Aufwachsen bei den Grosseltern
Etwa 300 Kilometer von Bradeni entfernt, in einem Vorort der Stadt Buzau, treffen wir inmitten bekannter Gesichter vom Osloer Strassenmagazin den 20-jährigen Bogdan auf einer Tauffeier. Bogdan ist Rom wie Daniel und spricht fliessend Norwegisch. «Fast jeder hier ist verwandt. Wenn also eine Person ins Ausland geht, folgen ihr die anderen an denselben Ort, um sich sicherer zu fühlen. Deshalb kenne ich hier viele Leute von dort und hier.» Bogdan ist nicht mehr oft in Rumänien. Er begrüsst Freund*innen und Verwandte, übernimmt zwischendurch den Grill und muss sich auch noch für eine Hochzeitsfeier fertig machen, zu der er später am Abend gehen wird. Gleichzeitig erzählt er seine Geschichte. «Als meine Eltern zum ersten Mal nach Norwegen fuhren, war ich sieben», erinnert er sich. «Sie fanden keine Arbeit, lebten vom Betteln. Sie waren damals nur wenige Monate im Jahr in Norwegen. Als ich neun war, fanden sie dort feste Jobs. Dann kamen sie jedes Jahr zu Weihnachten und Ostern für zwei Wochen nach Hause. Den Rest der Zeit waren meine Grosseltern meine Eltern.»
Bogdan ist sich nicht sicher, warum er selbst die Schule abgebrochen hat, will aber erklären, warum so viele rumänische Jugendliche abbrechen. «Wenn du die erste Klasse beginnst und andere rauchen siehst, kannst du in Rumänien in den Laden gehen und selbst Zigaretten kaufen. Wenn deine Eltern nicht da sind, gibt es auch niemanden, der dich bittet, mit dem Rauchen aufzuhören. Genauso ist es mit Alkohol und Drogen.»
«Das Schlimmste war der Elternabend», erinnert sich Bogdan. «Ich schaute mir all die Eltern an und dachte darüber nach, wie lange es dauerte, bis ich meine wiedersehen konnte. Ich erinnere mich auch an meinen zwölften Geburtstag. Ich hielt ständig nach meinen eigenen Eltern Ausschau. Sie wollten kommen, haben es aber am Ende nicht geschafft. Ich habe lange geweint und dann wurde ich wütend. Unglaublich wütend. Als ich dann in die Mittelschule in der Stadt kam, begann ich mehr und mehr zu feiern und in den Häusern meiner Freund*innen in der Stadt zu schlafen.» Mit sechzehn entschied er sich, nach Norwegen zu gehen. Nach zwei Wochen begann er mit der Schule, in sechs Monaten hatte er Norwegisch gelernt und war entschlossen, es in Norwegen zu schaffen. Er lebte bei seiner Mutter und seinem Vater, bis er achtzehn wurde. «Meine Mutter arbeitete in der Reinigung und
mein Vater als Hausmeister. Sie hatten nie Zeit gehabt, die Sprache zu lernen, also wurde ich ihr Dolmetscher.»
Bogdan spricht über all die Sommerjobs und Abendjobs, für die er sich beworben hat, die Vorstellungsgespräche, an denen er teilnahm, und über seine Wut, nie eine Antwort erhalten zu haben. Er erzählt von dem kleinen Taschengeld, das er hatte, und davon, dass er sich anders und ärmer fühlte als seine Mitschüler*innen. «Als ich auf die Sekundarstufe in Oslo ging, verlor ich die Kontrolle. Ohne Job und mit kaum Taschengeld suchte ich nach anderen Wegen, um Geld zu verdienen. Ich wollte die gleiche Markenkleidung wie meine Klassenkamerad*innen haben. Das Schlimmste, was ich getan habe, war, Drogen zu verkaufen. Es brachte mich in grosse Schwierigkeiten, mit Banden, mit der Polizei und mit dem Arbeits- und dem Sozialamt. Ich musste das letzte Schuljahr wiederholen. Ich bin ausgestiegen, nicht nur, weil ich viele Fehler gemacht habe, sondern auch weil ich geheiratet habe.»
Stolz zeigt Bogdan seinen Ehering. Er steht zudem kurz davor, in Norwegen eine Ausbildung zum Klempner zu beginnen. Bevor Bogdan weiterzieht, sagt er noch ein paar Worte über seine Generation: «Es gibt viele Menschen wie mich», sagt er. «Es ist ein massives Problem für Rumänien. Junge Menschen, die sich um nichts kümmern, weil niemand sie disziplinieren oder ihnen beibringen kann, wie man lebt.»
Die Rückfahrt nach Bra ˘ deni dauert vier Stunden. Aus den Autofenstern sehen wir Felder mit vertrocknetem Mais und toten, schwarzen Sonnenblumen. Rumänien litt 2022 stark unter der Dürre. Dies wird weitere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben, genau wie die Massenauswanderung. Zwischen 2000 und 2018 sank die Bevölkerung von 22,4 Millionen auf 19,5 Millionen. 75 Prozent der Abwanderung entfielen auf Arbeitssuchende. Rumän*innen, die im Ausland arbeiten, sind aber auch die grösste Quelle für Investitionen im Land und tragen über drei Prozent des rumänischen BIP bei.
Auf einem Sofa in Bra ˘ deni klettern Edouard, Matteo und Daniel auf ihrem Vater herum. Sie ziehen ein wenig an seinem Bart und klammern sich an ihn. Sie kämpfen darum, ihn zum Lachen zu bringen. Kristina sitzt am grossen Esstisch und wirkt erleichtert darüber, ihren Mann für ein paar Wochen zuhause zu haben. Wie ist es, die Familie zurückzulassen? «Normalerweise sage ich den Kindern, mein Chef in Norwegen habe angerufen und gesagt, dass ich sofort kommen muss», sagt Daniel. «Ich trinke nicht oft, aber ich neige dazu, am Tag meiner Abreise ein paar Gläser zu trinken. Idealerweise gehe ich, bevor die Jungs wach sind. So ist es einfacher.»
Übersetzt aus dem Englischen via Translators without Borders. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von =Oslo / =Norge / International Network of Street Papers
20 Surprise 549/23
«Wenn deine Eltern nicht da sind, gibt es niemanden, der dich bittet, mit dem Rauchen aufzuhören.»
BOGDAN
Das Geld, das Utsa als Saisonarbeiterin in Deutschland verdient, hat den Bau eines Hauses für ihre Grossfamilie ermöglicht. Soeben ist auch der Strom eingezogen worden.


Rumän*innen und Rom*nja in der Schweiz
Laut dem Bundesamt für Statistik betrug der rumänische Anteil an der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung bis Mitte der 2000er-Jahre um die 2000 bis 3000 Personen. Ähnlich wie in Norwegen stieg die Zahl ab etwa 2006 auf heute 34 061 Personen an, mit grossen Zuwächsen ab 2019. Seit Juni 2019 geniesst Rumänien die volle Personenfreizügigkeit zu den gleichen Bedingungen, wie sie für Angehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten. Nicht alle werden zu ständiger Wohnbevölkerung: Beispielsweise wanderten im Jahr 2021 rund 5400 Rumän*innen in die Schweiz ein und 2200 Menschen mit rumänischen Papieren verliessen das Land.
sche, ob sie auch Fries*innen seien, oder an Spanier*innen, ob sie zu den Bask*innen zählten.)
Wie auch in Rumänien werden die rund 50 000 Rom*nja, die permanent in der Schweiz leben, aufgrund rassistischer Grundannahmen stigmatisiert und benachteiligt.
Am Mittagstisch bei Daniel und Kristina zuhause ist das Energielevel hoch. Die Söhne Edouard und Matteo sind immer noch hibbelig, weil Papa endlich wieder einmal da ist.
Wie viele der einreisenden Rumän*innen auch zur Minderheit der Rom*nja gehören, wird allerdings nicht erhoben. (Dies entspräche einer Frage an Deut-
1998 ratifizierte die Schweiz das Übereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten. Sie anerkannte damit die sogenannten «Fahrenden» als Minderheit, was sich auf die nicht-sesshafte Lebensweise und damit auf einen kleinen Bruchteil der stigmatisierten Bevölkerungsgruppen bezieht. Denn über 90 Prozent der Jenischen, Sinti*zze und Rom*nja sind sesshaft. Seit 2016 sind Jenische und Sinti*zze auch als nationale Minderheiten unter ihrem Eigennamen anerkannt. Die Rom*nja haben diesen Status noch nicht. WIN
21
1978 wurde der Comic zur Graphic Novel: «A Contract with God and Other Tenement Stories», so der Originaltitel.

22 Surprise 549/23
Erzählen über alles
Ausstellung Das Cartoonmuseum Basel zeigt Werke des US-Amerikaners Will Eisner. Der Sohn jüdischer Einwanderer*innen verschmolz Zeichung und Literatur zu einer bahnbrechend neuen Form.
TEXT KLAUS PETRUS
Mitte Oktober 1978 – bestimmt goss seit Stunden schon Regen vom dunkelgrauen Himmel herab – erschien, wie nebenbei, ein Buch mit dem Titel «Ein Vertrag mit Gott und andere Mietshausgeschichten». Wie unerhört das in Wahrheit doch war! Denn erstens handelte es sich dabei um einen Comic, der nicht als Cartoon-Heftchen publiziert wurde, sondern in einem renommierten Verlag für Belletristik, und zweitens geschah dies in einem für Comics völlig unüblichen Format (23 x 15 x 1,6 cm) auf sagenhaften 196 Seiten mit Geschichten, die drittens nicht als Teil einer Serie daherkamen (der Standard aller Comics), sondern in sich abgeschlossen waren, welche – und nun könnten noch ein – nein, zwei oder drei – Dutzend weitere Gründe folgen, wieso Will Eisner mit diesem Buch den fast besten Comic aller Zeiten schuf und ihn gleich noch mit einem Label versah, das die Comicwelt alsbald auf ein neues Niveau heben sollte: «Graphic Novel» – formvollendetes Erzählen mit Zeichnungen, der Comic als Literatur!
Diesen unbändigen Ehrgeiz, Comic als Kunst zu etablieren, hatte Will Eisner schon in jungen Jahren. 1905 als Sohn jüdischer Einwanderer*innen aus Osteuropa unter ärmlichen Bedingungen in der Bronx aufgewachsen, machte Eisner bereits als Jugendlicher sein Talent fürs Zeichnen zum erfolgreichen Geschäft: Mit nicht einmal zwanzig gründete er sein eigenes Studio, er scharte bald darauf die Besten des Fachs um sich (Bob Kane zum Beispiel, den späteren Schöpfer von Batman) und erfand Ende der 1930er «The Spirit», einen New Yorker Polizisten, der im blauen Anzug und mit einer Augenbinde im Lone-Ranger-Stil kleine Gauner jagt. Ein Understatement sondergleichen, beherrschten damals doch Superman & Co. mit ihrem Kampf gegen Hitler und Mussolini die Cartoons, aber auch Ausdruck einer politischen Haltung: Übermenschen, ob gute oder böse, seien ihm schon immer ein Greuel gewesen, meinte Eisner in einem Interview.
Ohnehin war «The Spirit», auf den ersten Blick der Held einer Serie, die 1940 startete und 1952 nach 645 Episoden (vorerst) ihr Ende fand, für Eisner bloss ein Aufhänger für alles drumherum: für die Strassen und Hochhäuser, für das Wetter, den Lärm und für all die verarmten, ausgegrenzten Figuren, die bei Eisner, buchstäblich, an den Rändern der Bilder auftauchen, jedoch alles Augenmerk auf sich ziehen. Und weil all dies, das ansonsten in Comics bestenfalls die Kulisse abgibt, für Eisner selber voller Geschichten war, wollte er «The Spirit» unbedingt als Zeitungsbeilage verkaufen, um endlich sieben Seiten pro Ausgabe zu haben, die er mit nur einer Story füllen konnte; üblich waren Comicstrips auf der letzten Zeitungsseite mit zwei oder vier Panels bzw. Bildchen. Fortan setzte Eisner alles aufs Storytelling. «Jeder kann zeichnen», pflegte er zu sagen, «aber Schreiben ist schwierig.» Er begann mit den Panels zu experimentieren, setzte sie mal ins Hoch-, dann ins Querformat, und liess Abfolge, Tempo und Lettering – die Gestalt sowie Grösse der Schrift – allein durch die Geschichte bestimmt werden.
Armer, armer Shnobble
So gelang Eisner schon Ende der 1940er-Jahre Ausserordentliches, ja sogar Perfektes. Wie etwa in der Spirit-Ausgabe vom 5. September 1948 die Geschichte des Gerhard Shnobble, der als Junge entdeckt, dass er fliegen kann, es aber geheim hält und ganz und gar unauffällig ein Leben als Niemand lebt, bis ihm Knall auf Fall gekündigt wird; daraufhin steigt Shnobble auf ein Hochhaus, weil er jetzt aller Welt zeigen will, dass er etwas kann, das niemand sonst vermag: fliegen. Das wahrlich Tragisch-Witzige daran: Auf eben diesem Hochhaus ist «The Spirit» gerade auf Gangsterjagd, derweil Shnobble irgendwo am Bildrand davon träumt, endlich ein Jemand zu sein, sodann zum Flug ansetzt, hinabschwebt und – ganz zufällig – von einer Kugel aus
Surprise 549/23 23
BILDER: WILL EISNER
dem Gewehr des Gangsters, den «The Spirit» kurz darauf niederstreckt, getroffen wird und tot auf dem Bürgersteig aufschlägt. Keiner der Menschen, die das Geschehen beobachteten, hätte daran gedacht, dass dieser bummelige Herr habe fliegen können, steht am Ende der Geschichte geschrieben. Armer, armer Shnobble.
Sieben Seiten pro Story, das war Eisner schliesslich doch zu wenig, und andere Formate standen damals nicht zur Verfügung. Dann lieber aufhören, sagte sich einer der besten Comic-Zeichner. Und gestaltete die nächsten zwanzig Jahre für die US-Armee Aufklärungsbroschüren; nebenher illustrierte er ein 500-seitiges Buch mit Rezepten für Drinks, das ihm richtig viel Geld einbrachte.
Dann, Anfang der 1970er-Jahre, wurde Eisner von einer Handvoll Underground-Comiczeichner*innen wiederentdeckt und in die Szene eingeführt. Was der damals 55-Jährige vorfand, überstieg all seine Erwartungen: neue Formate, keine Beschränkungen seitens Verleger*innen und Produzent*innen, politische Inhalte. Eisner kündigte seinen Job bei der Armee und begann an vier Geschichten zu arbeiten, die 1978 als «Ein Vertrag mit Gott und andere Mietshausgeschichten» erschienen – und, wie schon gesagt, die Comicwelt aufrüttelten.
Ein Erzählband für die Randfiguren
Für Eisner selbst war dies jedoch weder Bruch noch Neuanfang. Was Stil und Erzählweise betrifft, knüpfte er nahtlos bei «The Spirit» an; er wurde bloss radikaler. Die Stilmittel des Film Noir oder des Expressionismus eines Lynd Ward, der zwischen 1929 und 1937 Erzählungen ausschliesslich mit Holzschnitten veröffentlichte, trieb Eisner in den zwanzig Graphic Novels, die er bis zu seinem Tod 2005 noch schreiben würde, endgültig auf die Spitze: schwere, dunkle Schatten, die aus den Panels heraustreten und ganze Seiten füllen, Häuserschluchten aus flüchtigen Strichen, verzerrte Close-ups, tiefe Falten in zerschlissenen Kleidern und ausgezehrten Gesichtern, die Perspektive von oben in diesem Bild, eine von unten im nächsten, Tiefe und Enge in einem, Seite auf Seite. Auch Eisners Protagonist*innen wurden noch mehr zu Randfiguren, selbst wenn sie das Zentrum von Geschichten bilden, die hundert Seiten lang sind. Sie sind oft arm, haben alle Hoffnung verloren, sie sind ins Leben verstrickt und wissen nicht weiter. Manche von ihnen haben keine Namen oder sie sind, aufgrund der sozialen Klasse, der sie angehören –Emigranten, Arbeiterinnen, Tagelöhner –, unsichtbar; ihnen hat Eisner einen Erzählband gewidmet («Invisible People», 1993).

Tatsächlich – und darin besteht nicht bloss ein gradueller, sondern ein grundsätzlicher Unterschied zu «The Spirit» – werden die Themen in Eisners Graphic Novels drastischer, da persönlich und politisch in einem. In «To the Heart of the Storm» (1991) verarbeitet er seine eigene Familiengeschichte und in «The Name of the Game» (2001) die seiner Frau, auch sie eine geflüchtete Jüdin. Beide Erzählbände sind Zeugnisse von gescheiterter Integration, extremer Armut und fortwährender Ausgrenzung. Besonders der latente Antisemitismus wird Eisner bis zu seinem letzten Comic, «Das Komplott» (2005), umtreiben. In andere Geschichten webt er persönliche Schicksale wie den frühen Tod seiner Tochter ein, doch auch diese haben stets eine allgemeingültige, existenzielle Dimension: Als der fromme Rabbi Frimme Hersh in «Ein Vertrag mit Gott» seine Tochter zu Grabe trägt, weiss er nicht mehr, ob er – wie Hiob – Gott noch vertrauen kann oder ihm zürnen soll. Die Figuren in Eisners späten Comics mö-
Der Held ist eher Aufhänger für alles drumherum als klassischer Protagonist: «The Spirit» als Sonntagszeitungsbeilage vom 5. September 1948.
Eisner auf Deutsch
Die «Spirit»-Ausgaben sind fast vollständig in 24 Bänden bei Salleck Publications (2001–2016) erschienen. Die wichtigsten Graphic Novels wurden vom Carlsen Verlag veröffentlicht, u.a. «Ein Vertrag mit Gott», «New York», «Lebensbilder» und «Das Komplott».
gen verloren wirken, die Orte aber geben ihnen Halt – und den Geschichten, die sie beherbergen. Manchmal ist es eine Strasse, welche die Erzählungen zusammenhält, zum Beispiel in «Ein Vertrag mit Gott» (1978), «Dropsie Avenue» (1995) und «Lebenskraft» (1988, Eisners allerbestem Comic), manchmal ein einzelnes Gebäude («The Building», 1978), bisweilen sind es Hinterhöfe, Hydranten oder Kellerfenster.
Tatsächlich kommen einem auf die Frage, woran man einen Eisner erkenne, nicht etwa eine Heldenfigur in den Sinn, weder «The Spirit» noch Frimme Hersh, sondern verrusste Fassaden, Hinterhöfe, Feuerleitern, Mülleimer, feuchte Keller, die träge Luft im Sommer, das nasse Laub im Herbst, der Ehestreit in der Wohnung darüber, die Lustschreie aus der Waschküche, grimmiger Regen, kreischende Kinder und streunende Hunde, aber auch
24 Surprise 549/23
Sieben Seiten pro Story, das war Eisner schliesslich doch zu wenig. Der Auftritt war allerdings prominent: Sonntagsbeilage vom 22. September 1940.

Schutzlos
Buch Auf der Suche nach einem vermissten Mädchen lernen zwei Freundinnen die Welt der obdachlosen Jugendlichen kennen.
Alles fängt mit der Bank im Park an, auf der sich die 14-jährige Amra ausruhen möchte. Aber da sitzt schon ein anderes Mädchen. Schätzungsweise 17, fettiges Haar, rote Flecken am ganzen Körper, am Boden ein Dutzend leere Bierflaschen. Und sie stinkt. Wie eklig, denkt Amra. Doch dann kommt Amras Mutter und bietet dem Mädchen an, bei ihnen zuhause zu duschen. Eine Wildfremde! Amra kann es nicht fassen. Auch nicht, als das Mädchen am nächsten Tag tatsächlich auftaucht und das Badezimmer besetzt. Über acht Stunden lang. Das allerdings macht nicht nur Amra, sondern auch ihre Eltern panisch. Und als das Mädchen endlich geht, schrubbt die ganze Familie das eigentlich saubere Bad nochmal porentief rein. Und dann ab, für zwei Wochen nach Paris. Denn sie können sich sowas leisten.
Nach der Rückkehr wartet eine Überraschung auf Amra. Die Putzfrau hat ein Tagebuch gefunden. Das muss dem fremden Mädchen gehören. Aber wie soll sie es ihr zurückgeben? Sie weiss doch nichts von ihr, weder den Namen noch Adresse oder Telefonnummer. Dennoch beschliesst Amra, sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin Louise auf die Suche zu machen. Hinweise kann nur das Tagebuch liefern. Notgedrungen dringen die beiden in ein fremdes Leben ein.
Die Suche nach dem Mädchen, nach Coco, wird für die Freundinnen zu einer abenteuerlichen, aber auch bedrückenden Reise durch ein unbekanntes Berlin, das Berlin der Obdachlosen. Und sie begreifen, wie schnell man auf der Strasse landen kann. Wie alles, was selbstverständlich und sicher erscheint, eine intakte Familie, ein Job, ein Dach über dem Kopf, oft nur ein Kartenhaus ist. Unter dem Vorwand, einen Artikel für die Schülerzeitung zu schreiben, klappern sie die Stationen ab, die im Tagebuch erwähnt werden. Orte, an denen Jugendliche, die schutzlos, auf sich allein gestellt auf der Strasse leben, schlafen und duschen, zu essen bekommen, sich treffen. Je tiefer Amra und Louise in diese Welt eindringen, desto mehr befürchten sie, dass Coco etwas zugestossen ist.
weiser Witz zuhauf und verstohlenes Schmunzeln hier und da, jedoch gewiss kein Happy End – wenn man denn absieht von Jacob Shtarkahs in der Erzählung «Lebenskraft», der sich, lebensmüde, verzweifelt und schwer im Herzen, nach Hause zu seiner Frau schleppt, die ihn am Esstisch fragt, «Nu, Jacob, wie war dein Tag?», worauf er, durchaus verschämt, antwortet: «Ich habe heute einer Küchenschabe das Leben gerettet.»
«Will Eisner – Graphic Novel Godfather», Ausstellung, bis So, 18. Juni, Di bis So, jeweils 11 bis 17 Uhr, Cartoonmuseum, St. AlbanVorstadt 28, Basel. Der Ausstellungskatalog «Will Eisner – Graphic Novel Godfather» (2021) von Alexander Braun ist zurzeit vergriffen. cartoonmuseum.ch
«Das Mädchen in unserem Badezimmer» ist ein packendes, rundum gelungenes und schön gestaltetes Jugendbuch. Ein Sachbuchkrimi, der Jugendliche mit einer spannenden Geschichte für das Schicksal von Menschen sensibilisiert, an denen man allzu oft achtlos oder peinlich berührt vorbeigeht. Ein Buch, das lehrt, ohne zu belehren. Und das es verdient, von möglichst vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen gelesen zu werden.
CHRISTOPHER ZIMMER
Das Mädchen in unserem Badezimmer, Henrik Hitzbleck (Text), Kerstin Wacker (Illustrationen), Wacker und Freunde Verlag 2022.
CHF 22.90
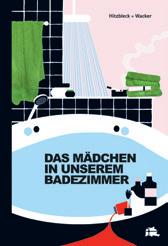
Surprise 549/23 25
FOTO: ZVG
Bern
«auawirleben 2023 – Birth Right», Theaterfestival, Mi, 10. bis So, 21. Mai, Festivalzentrum Grosse Halle, Schützenmattstrasse 7. auawirleben.ch
Zürich
«Abenteuer Stadtnatur», Festival, Do, 18. bis So, 28. Mai, diverse Veranstaltungen; Spaziergang / Lesung

«Amsel, Drossel, spitze Feder!», So, 21. Mai, 17.30 bis 19.30 Uhr, Labyrinthplatz, Zeughausareal, Kanonengasse 18, Anmeldung unter labyrinthplatz.ch/ veranstaltungskalender; abenteuer-stadtnatur.ch
genauer an!». Ausserdem nehmen die Feldornithologin Ruth Grünenfelder und der Autor Ralf Schlatter ihre Zuhörer*innen mit auf einen gemeinsamen Vogelspaziergang, angereichert mit Kurzgeschichten: «Amsel, Drossel, spitze Feder!» Wir weisen genau darauf speziell hin, weil im Juni im Surprise ein Vogeltext von Schlatter erscheinen wird. (Das Bild hier gibt einen Vorgeschmack.) DIF

Ganze Schweiz
«Festival der Natur», schweizweite Veranstaltungen, Do, 18. bis So, 28. Mai. festivaldernatur.ch

Während Theater nun also ein paar Nasen offenbar als zu woke gilt, verausgabt sich auawirleben erklärtermassen umso mehr in die Richtung. Und das geht so: In den Produktionen geht es um Identitäten, um Herkunft und Ankunft, um Utopien, um Selbstbestärkung und immer wieder um Menschlichkeit. Es sei das «wahrscheinlich diverseste und diskriminierungssensibelste Programm, das es am auawirleben je gegeben hat». Gezeigt wird z.B. «Dear Laila» des palästinensischen Installationskünstlers Basel Zaraa, der in Grossbritannien lebt. Als seine fünfjährige Tochter anfing, ihn nach seiner Vergangenheit zu fragen, baute er ein Modell des Hauses aus seiner Kindheit im palästinensischen Refugee Camp Yarmouk in Damaskus – das nun auch wir begehen dürfen. Auch der Grundsatz «aua für alle» wird ziemlich konsequent verfolgt: Mit dem KulturGA für Menschen mit Aufenthaltsbewilligungen der Typen N oder F und mit Schutzstatus S sowie für SansPapiers sind die Vorstellungen kostenfrei, ebenso für Menschen, die sich Theater nicht leisten können (Reservationswunsch an kontakt@auawirleben.ch schicken). Es wird auch an diejenigen gedacht, die sich Gesellschaft wünschen (Pauschalreise buchen!), an Schwerhörige (Übertitel, DSGS) und an im Deutschen nicht Sattelfeste (Zusammenfassungen «einfach gesagt»). Theater kann gesellschaftliche Utopien wahrmachen. Für einen Moment, der vielleicht nachhallt. DIF
Zürich
«Fokus Chancen», diverse Veranstaltungen, bis Do, 29. Juni, Zentrum Karl*a der*die Grosse, Kirchgasse 14. karldergrosse.ch

Das Debattierhaus Karl*a der*die Grosse widmet sich dem Thema Chancen. Das Kunstprojekt «Unsere Chancen» von ZHdK und Sozialzentrum Helvetiaplatz fragt: Was entsteht, wenn sich Sozialhilfebezüger*innen mit «Chancen» befassen? Und in «Wir müssen reden» (Mo, 22. Mai, 19 Uhr) erfahren wir, wie Gemeinderat und Behindertenrechtsaktivist Islam Alijaj das Behindertenwesen umkrempeln will. Auch dabei: die Surprise Stadtführungen «Abwärtsspiralen und Solidarität» (Mi, 31. Mai, 17 Uhr ab Werdplatz) und «Schattenwelten» zu Frauenarmut und psychischer Erkrankung (Sa, 13. Mai, 11 Uhr ab Kirche St. Jakob). DIF
Dornach
«Die Kraft der Musik», Benefizkonzert, Kollekte zugunsten des Surprise Strassenchors, Sa, 13. Mai, 19 Uhr, Klosterkirche Dornach, Amthausstrasse 7.
In einer musikalischen Zusammenarbeit zwischen dem Surprise Strassenchor unter der Leitung von Rhea Hindermann und dem international bekannten Genfer Duo Piano Con Voce und der Flötistin Myriam Hidber Dickinson aus Arlesheim ist das Projekt «Die Kraft der Musik» entstanden. Die Lieder des Konzerts stammen aus Ländern von der Schweiz bis Südafrika, Elemente klassischer Musik (Flöte, Klavier) mischen sich in den Gesang. Musik gibt dem Menschen gerade in ungewissen Zeiten Mut: Kaum ein anderes Ensemble verkörpert dieses Credo besser als der Surprise Strassenchor. DIF
Am «Abenteuer StadtNatur» können die Stadtbewohner*innen ihren alltäglichen Lebensraum neu entdecken . Organisiert wird das Festival vom Verbund Lebensraum Zürich VLZ, gegründet von Grün Stadt Zürich und zahlreichen Vereinen, Politiker*innen, Firmen und Privatpersonen, die sich für Grünräume einsetzen, sie besitzen, nutzen und pflegen. Hier gibt’s zum Beispiel eine gemeinsame Betrachtung des aktuellen Abendhimmels, eine Führung im igelfreundlichen Garten («Jeder Garten kann igelfreundlich sein») oder einen Spaziergang mit dem Titel «Von wegen Unkraut – schau mich doch mal
Dieses Festival hilft, Biodiversität zu verstehen. Es bietet schweizweit Hunderte kostenlose Veranstaltungen zu Natur, Artenvielfalt, Landwirtschaft oder Ökologie: Wanderungen, Exkursionen, Ausstellungen. Spannend sind die Themenschwerpunkte: Vielleicht können wir uns unter «Entsiegeln» als Laien noch relativ wenig vorstellen, aber da scheinen wir recht relevante Entwicklungen bisher verpasst zu haben. Entsiegelung heisst: zurück zu asphaltfreien Flächen. Die Stadt Bern hat vorgelegt, 1000 Quadratmeter Asphaltfläche biodiversifiziert und den «Binding Preis für Biodiversität 2022» erhalten. DIF
26 Surprise 549/23
BILD(1): MOHAB MOHAMED, BILD(2): CHI LUI WONG, BILD(3): FESTIVALDERNATUR.CH
Veranstaltungen
Wir
Sie
365 Tage offen von 8-20 Uhr St. Peterstr. 16 | 8001 Zürich | 044 211 44 77 www.stpeter-apotheke.com grundsätzlich ganzheitlich ANZEIGE
sind für
da.
Pörtner in Wohlen

Surprise-Standort: Migros
Einwohner*innen: 17 340
Anteil ausländische Bevölkerung in Prozent: 41,6
Sozialhilfequote in Prozent: 2,1
Anzahl Vereine: 202
Die Bahnhofstrasse in Wohlen braucht sich in Sachen Bankendichte vor ihrer berühmten Namensschwester in Zürich nicht zu verstecken. Innerhalb weniger Schritte passiert man nicht nur die Filialen der letzten noch bestehenden und der eben untergegangenen Grossbank, sondern auch drei Niederlassungen kleinerer, sympathischerer Banken. Dass darum Wohlen einst der Grossstadt den Rang als Bankenmetropole ablaufen wird, ist trotzdem eher unwahrscheinlich. Ein Wegweiser zeigt, wie das Strohmuseum zu erreichen ist.
Den Rang einer Mode- und Schönheitsmetropole hält Wohlen indessen bestimmt. Fast nirgends dürfte die Dichte an Modegeschäften so hoch sein, zahllose mittlere, kleine und auch winzige Geschäfte für Damenmode, Herrenmode, Damen- und Herrenmode oder Arbeits-
bekleidung stehen zur Auswahl, neben Niederlassungen internationaler Bekleidungsketten. Eine davon, bekannt für Kleider für ultradünne Menschen, befindet sich gleich neben einem Zentrum, das verschiedene Methoden zum Abnehmen anbietet. Das Schaufenster des Kleiderladens ist alles andere als glamourös, sondern geradezu schäbig. Ein paar Kleider an der sprichwörtlichen Stange, daneben drei gesichtslose, magere Schaufensterpuppen, alle in dieselbe Richtung gewandt, vor einem weissen Hintergrund mit Tür, daneben noch ein überdimensioniertes Plakat, das wars.
Vielleicht haben darum die vielen unabhängigen Läden eine Chance, sie heissen «Klick-Mode», «Jeans-Corner» oder «citymode waeber». Wer trotzdem nichts findet, der oder dem steht ein Nähladen
offen: «Näh dich Happy!» Falls es nicht klappen sollte mit dem Selbermachen, findet sich Hilfe in den lokalen Näh- und Schneiderateliers.
Beauty- und Nagelstudios gibt es ebenfalls zuhauf, jede erdenkliche Behandlung steht zur Verfügung, von modernster Technik bis zur Naturmethode. Die Coiffeursalons sind zahlreich und allgegenwärtig, dazwischen haben noch Shops für Mobiltelefone Platz. Schliesslich wollen die Selfies mit den neuen Kleidern, Behandlungen und Frisuren versandt sein.
Geschlossen ist das Fotofachgeschäft, und auch der CBD-Hanfshop sieht nicht aus, als würde er die Türen noch einmal öffnen. Im Geschäft nebenan stehen ein Motorrad und eine Leiter. Ob hier ein Neuanfang gewagt wird oder ein Traum zu Ende geht, ist unklar.
Das gastronomische Angebot wird von Kebab und Pizza dominiert, doch es gibt auch stattliche Gasthöfe wie den Bären oder das Rössli. Die evangelische Kirche bietet Bastelkurse für die Kleinen und Lotto-Nachmittage für die Älteren an. Die Gelateria mit den bunten Stühlen findet noch keine Kundschaft, aufgrund der Bise. Das Haus, das auch das SanghaYoga-Studio beheimatet, ist passend mit Zentralstrasse 47 angeschrieben.
Den Bach, an dem es sich entlanggehen lässt, ist gut versteckt zwischen den Häusern und führt vorbei an einem Hydranten, der eine Wollmütze trägt, und einem Graffiti für den «FC Wohle» ins Einfamilienhausquartier, wo sich Gartenteiche grosser Beliebtheit erfreuen. Doch auch hier gibt es Therapieangebote und Kosmetikstudios mit Parkplätzen, die Tag und Nacht freizuhalten sind. Schönheit schläft nicht in Wohlen.
STEPHAN PÖRTNER
Der Zürcher Schriftsteller Stephan Pörtner besucht Surprise-Verkaufsorte und erzählt, wie es dort so ist.

Surprise 549/23 27
Tour de Suisse
Die 25 positiven Firmen
Unsere Vision ist eine solidarische und vielfältige Gesellschaft. Und wir suchen Mitstreiterinnen, um dies gemeinsam zu verwirklichen. Übernehmen Sie als Firma soziale Verantwortung.
Unsere positiven Firmen haben dies bereits getan, indem sie Surprise mindestens 500 Franken gespendet haben. Mit diesem Betrag unterstützen Sie Menschen in prekären Lebenssituationen dabei auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit.
Die Spielregeln: 25 Firmen oder Institutionen werden in jeder Ausgabe des Surprise Strassenmagazins sowie auf unserer Webseite aufgelistet. Kommt ein neuer Spender hinzu, fällt jenes Unternehmen heraus, das am längsten dabei ist.
Benita Cantieni CANTIENICA®
Arbeitssicherheit Zehnder, Zürich
Gemeinnützige Frauen Aarau
Madlen Blösch, Geld & so, Basel
Breite-Apotheke, Basel
Spezialitätenrösterei derka ee, derka ee.ch
Boitel Weine, Fällanden
Farner’s Agrarhandel, Oberstammheim
Sublevaris GmbH, Brigitte Sacchi, Birsfelden
Kaiser Software GmbH, Bern
InoSmart Consulting, Reinach BL
Maya-Recordings, Oberstammheim
Scherrer & Partner GmbH, Basel
BODYALARM - time for a massage
EVA näht: www.naehgut.ch
TopPharm Apotheke Paradeplatz
AnyWeb AG, Zürich
Cobra Software AG www.cobrasw.ch
Praxis Dietke Becker
Beat Vogel - Fundraising-Datenbanken, Zürich
InhouseControl AG, Ettingen
Beat Hübscher, Schreiner, Zürich
Yogaloft GmbH, Rapperswil SG
unterwegs GmbH, Aarau
Fäh & Stalder GmbH, Muttenz
Möchten Sie bei den positiven Firmen aufgelistet werden?
Mit einer Spende ab 500 Franken sind Sie dabei.
Spendenkonto:
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
Surprise, 4051 Basel
Zahlungszweck: Positive Firma und Ihr gewünschter Namenseintrag
Sie erhalten von uns eine Bestätigung.
Kontakt: Caroline Walpen

Team Marketing, Fundraising & Kommunikation
SURPLUS – DAS NOTWENDIGE EXTRA
Das Programm
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Unabhängigkeit?
Einige unserer Verkäufer*innen leben fast ausschliesslich vom Heftverkauf und verzichten auf Sozialhilfe. Surprise bestärkt sie in ihrer Unabhängigkeit. Mit dem Begleitprogramm SurPlus bieten wir ausgewählten Verkäufer*innen zusätzliche Unterstützung. Sie erhalten ein Abonnement für den Nahverkehr, Ferienzuschlag und eine Grundausstattung an Verkaufskleidung. Zudem können bei finanziellen Notlagen aber auch für Gesundheits- oder Weiterbildungskosten weitere Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. Die Programmteilnehmer*innen werden von den Sozialarbeiter*innen bei Surprise eng begleitet.
Eine von vielen Geschichten
Merima Menur kam 2016 zu Surprise –durch ihren Mann Negussie Weldai, der bereits in der Regionalstelle Bern arbeitete. Zuvor lebten sie fünf Jahre getrennt –er in der Schweiz, sie in Äthiopien. Einige Zeit nach ihrer Ankunft in der Schweiz begann Merima auch mit dem Verkauf des Surprise Strassenmagazins und besuchte einen Deutsch-Kurs, mit dem Ziel selbständiger zu werden und eine Anstellung zu finden. Dank Surplus besitzt Merima ein Libero-Abo für die Stadt Bern und kann somit leichter an ihren Verkaufsort reisen. Surplus gibt der 41-Jährigen ausserdem die Möglichkeit, sich einige bezahlte Ferientage zu gönnen.
Unterstützen Sie das SurPlus-Programm mit einer nachhaltigen Spende
Derzeit unterstützt Surprise 27 Verkäufer*innen des Strassenmagazins mit dem SurPlus-Programm. Ihre Geschichten stellen wir Ihnen hier abwechselnd vor. Mit einer Spende von 6000 Franken ermöglichen Sie einer Person, ein Jahr lang am SurPlus-Programm teilzunehmen.
Spendenkonto:
Unterstützungsmöglichkeiten:
· 1 Jahr: 6000 Franken
·
½ Jahr: 3000 Franken
· ¼ Jahr: 1500 Franken
·
1 Monat: 500 Franken
· oder mit einem Beitrag
Ihrer Wahl.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3 | Vermerk: SurPlus
Oder Einzahlungsschein bestellen: T +41 61 564 90 90 info@surprise.ngo | surprise.ngo/spenden Herzlichen Dank!
T +41 61 564 90 53 I marketing@surprise.ngo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AB 500.– SIND SIE DABEI!
Weitere SurPlus-Geschichten lesen sie unter: surprise.ngo/surplus
In ei g ener Sache
Ausgezeichnetes Surprise
Der Basler Fotograf Roland Schmid hat mit einer Arbeit über die Auswirkungen des Herbizids Agent Orange während des Vietnamkrieges beim diesjährigen Swiss Press Photo Award einen dritten Platz belegt; die Serie wurde als Fotoessay im Surprise 535 veröffentlicht. Ebenfalls auf den dritten Platz kam Surprise-Redaktor Klaus Petrus mit seinen Fotografien von Erntehelfern im Berner Seeland; die Geschichte dahinter hat er im Rahmen unserer Serie «Die Unsichtbaren» in Surprise 538 niedergeschrieben. Schliesslich erhielt Marina Bräm für ihre Infografiken zu den «Unsichtbaren» im Rahmen des Indigo Award zweimal Gold und einmal Silber. Wir gratulieren herzlich!
Imp ressum
Herausgeber
Surprise, Münzgasse 16
CH-4051 Basel
Geschäftsstelle Basel
T +41 61 564 90 90
Mo–Fr 9–12 Uhr info@surprise.ngo, surprise.ngo
Regionalstelle Zürich
Kanzleistrasse 107, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
M+41 79 636 46 12
Regionalstelle Bern
Scheibenstrasse 41, 3014 Bern
T +41 31 332 53 93
M+41 79 389 78 02
Soziale Stadtrundgänge
Basel: T +41 61 564 90 40 rundgangbs@surprise.ngo
Bern: T +41 31 558 53 91 rundgangbe@surprise.ngo
Zürich: T +41 44 242 72 14 rundgangzh@surprise.ngo
Anzeigenverkauf
Stefan Hostettler, 1to1 Media
T +41 43 321 28 78
M+41 79 797 94 10 anzeigen@surprise.ngo
Redaktion
Verantwortlich für diese Ausgabe:
Sara Winter Sayilir (win)
Diana Frei (dif), Klaus Petrus (kp)
Reporterin: Lea Stuber (lea)
T +41 61 564 90 70
F +41 61 564 90 99 redaktion@strassenmagazin.ch leserbriefe@strassenmagazin.ch
#Strassenma g azin «Berührende Stimmen»
Eure Beiträge sind sehr wichtig und ich finde es sehr berührend, dass ihr allen eine Stimme gebt, die sonst in der Gesellschaft kaum gehört werden.
RYM ARYA AGHRABI, Zürich
#546: Auf Noras Strassen
«Angst vor der Zukunft»
Noras Geschichte hat mich sehr berührt. Ich habe eine Tochter mit einem Asperger Syndrom. Nora hat mich sehr an sie erinnert. Da entsteht auch etwas Angst vor der Zukunft.
M. L., ohne Ort
Ständige Mitarbeit
Rosmarie Anzenberger (Korrektorat), Simon Berginz, Monika Bettschen, Christina Baeriswyl, Dina Hungerbühler, Carlo Knöpfel, Yvonne Kunz, Isabel Mosimann, Fatima Moumouni, Stephan Pörtner, Priska Wenger, Christopher Zimmer
Mitarbeitende dieser Ausgabe
Pablo Bösch, Hans Rhyner, Even Skyrud, Emilia Sulek, Danil Usmanov
Wiedergabe von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion. Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.
Gestaltung und Bildredaktion
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik
Druck
AVD Goldach
Papier
Holmen TRND 2.0, 70 g/m2, FSC®, ISO 14001, PEFC, EU Ecolabel, Reach
Auflage
29900
Abonnemente
CHF 189, 25 Ex./Jahr
Helfen macht Freude, spenden Sie jetzt.
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
«Geht unter die Haut»
Ich habe die aktuelle Surprise bei einem freundlichen Herrn in Reinach erworben. Zuhause las ich Noras Geschichte. Der Text geht unter die Haut. Poetisch und gefühlvoll erzählt. Hier ist eine Schriftstellerin am Werk. Ich bewundere ihre Offenheit und schwesterliche Liebe.
Wundervoll ergänzen Priska Wengers Illustrationen die Worte.
CHRISTIAN WUILLEMIN, ohne Ort
Ich möchte Surprise abonnieren
25 Ausgaben zum Preis von CHF 189.– (Europa: CHF 229.–) Verpackung und Versand bieten Strassenverkäufer*innen ein zusätzliches Einkommen
Gönner-Abo für CHF 260.–Geschenkabonnement für:
Vorname, Name
Strasse
PLZ, Ort
Rechnungsadresse:
Vorname, Name
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Datum, Unterschrift
Bitte heraustrennen und schicken an: Surprise, Münzgasse 16, CH-4051 Basel, info@surprise.ngo
Surprise 549/23 29 Wir alle sind Surprise
549/23
«Das ganze Leben ist ein Genesungsweg»
«Ich bin Hans Rhyner, Schlosser von Beruf und ein Frühaufsteher. Meine Eltern hatten einen Bauernhof in Elm, und so wurde meine innere Uhr schon als Kind auf sehr früh gestellt. Meine fünf Geschwister und ich mussten im Stall helfen, bevor wir zur Schule gingen. Auch heute noch wache ich um halb fünf auf und bin hellwach. Anders als früher nehme ich mir Zeit, um langsam in den Tag zu starten. Mein hektisches Leben hat mich gelehrt, dass dies Wunder bewirken kann.
Mein Vater starb am Geburtstag meiner Schwester – am 31. Januar 1971. Ich hatte gerade meine Lehre als Schlosser begonnen. Sein Tod warf mich total aus der Bahn. Ich habe fest an ihm gehangen. Meinen Schmerz versuchte ich mit Alkohol zu verdrängen. Ich begann regelmässig Schnaps zu trinken. Immer wenn ich die Fahne von anderen Personen roch, dachte ich, dass ich ‹dieses Zeugs› eigentlich nicht brauche. Und dennoch kam ich nicht davon los.
Mit 18 Jahren besuchte ich auf Wunsch meiner Mutter einen ‹Alkohol-Fürsorge-Treff›. So kriegte ich gerade noch die Kurve und konnte meine Lehre abschliessen. Auf Rat meines Onkels zog ich nach Zürich, dort gab es mehr anonyme Angebote als im Dorf, wo jeder jeden kennt, wo niemand und doch jeder irgendwie alkoholabhängig ist. In meinem Umfeld war es jedenfalls so.
Die Stadt tat mir gut. Ich hatte eine gute Schlosserstelle, einen guten Lohn und lernte beim Tanzen meine erste grosse Liebe kennen. Mit dieser Frau lebte ich viele Jahre zusammen. Wir hatten eine sehr schöne Beziehung. Sie ermutigte mich immer wieder, regelmässig an die Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen. An diesen ‹Meetings› hörte ich zum ersten Mal, dass Alkoholsucht eine Krankheit ist, die behandelt werden kann, und dass das ganze Leben ein Genesungsweg sein wird.

Auch ich hatte Rückfälle – zwar nicht viele, dafür umso schlimmere. Vor gut 37 Jahren hätte ich mir beinahe das Leben genommen. Ich wurde mit 4,4 Promille ins Spital eingeliefert. Ab 3,5 Promille besteht die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr. Ich hatte grosses Glück. Der Auslöser für meinen Absturz war die Trennung von meiner langjährigen Partnerin. Für sie wurde meine Krankheit eine zu grosse Belastung. Ich war zwar grundsätzlich trocken. Doch wenn ich trank, musste sie mich jeweils aus der Ausnüchterungszelle holen oder ich verschwand für einige Zeit. Die Ungewissheit, wann es das nächste Mal
passieren wird, wurde für sie unerträglich. Ich kann das verstehe – oftmals gehen die Leute, die helfen, zuerst daran kaputt. Das ist nicht fair.
Zum Glück konnte ich trotz einem sechsmonatigen Aufenthalt in einer Entzugsklinik meine Stelle und Wohnung behalten. Als ich ‹raus› kam, dachte ich, dass mir sowas nie mehr passieren wird. Ich ging regelmässig an meine ‹Meetings›, trieb Sport und wechselte mit 38 Jahren nochmals die Stelle. 2008 lernte ich erneut eine Frau kennen. Es war eine schöne, aber gefährliche Beziehung. Zwei nasse Pflaumen geben leider keine trockene Pflaume. Nach einem Jahr stürzten wir gemeinsam ab und wurden eingeliefert. Dieses Mal verlor ich meinen spannenden Job. Ich hatte Mühe, eine feste Stelle zu finden, und arbeitete lange temporär.
2014 begann ich mit dem Surprise-Verkauf. Seit einigen Jahren mache ich auch Soziale Stadtrundgänge durch Zürich. Diese halten mir immer wieder einen Spiegel vor. Es berührt mich, wenn ich Leute sehe, die zur Flasche greifen. Dann bin ich froh, dass ich ehrlich zu mir geworden bin und dadurch gelernt habe, ‹NEIN› zu sagen – zur Flasche und zum gesellschaftlichen Druck. Wenn dennoch Gefühle von Unsicherheit und Selbstmitleid aufkommen, muss ich weg von den Leuten. Dann gehe ich ‹z Berg›, begehe wortwörtlich meinen ‹Genesungsweg› auf dem Uetliberg oder dem Säntis.»
30 Surprise 549/23 Surp rise-Porträt
Hans Rhyner, 68, ist leidenschaftlicher Surprise-Verkäufer in Schaffhausen und Zug, er bietet Soziale Stadtrundgänge an und schreibt Verkäufer*innen-Kolumnen (siehe Seite 6).
FOTO: BODARA
Aufgezeichnet von DINA HUNGERBÜHLER
SURPRISE WIRKT
GEGEN ARMUT UND AUSGRENZUNG

Ermöglichen Sie Selbsthilfe.
Spenden Sie jetzt.
Spendenkonto: Verein Surprise, CH-4051 Basel
IBAN CH11 0900 0000 1255 1455 3
 Bild: Marc Bachmann
Bild: Marc Bachmann
www.surprise.ngo
GESUCHT: DER FAN-SCHAL FÜR DIE NATI 2023!
Surprise nimmt im Sommer 2023 mit zwei StrassenfussballNationalteams am Homeless World Cup in Kalifornien teil – mit Ihrem Schal im Gepäck? Wie in den Jahren zuvor überreichen unsere Spieler*innen zum Handshake handgemachte Fanschals an die gegnerischen Teams. Machen Sie mit!
Der Schal sollte zirka 16 cm breit und 140 cm lang sein, Fransen haben und in Rot und Weiss gehalten sein. Gestrickt, gehäkelt, genäht: alles geht!
ACHTUNG, FERTIG, STRICKEN!

Bitte schicken Sie den Schal bis spätestens 4. Juni 2023 an: Surprise | Strassenfussball | Münzgasse 16 | CH-4051 Basel






































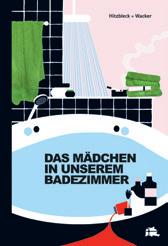









 Bild: Marc Bachmann
Bild: Marc Bachmann
