

Sudetendeutsche Zeitung



Jahrgang 76 | Folge 23 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 7. Juni 2024

HEIMATAUSGABEN IN DIESER ZEITUNG
Sudetendeutsche Zeitung
Sudetendeutsche Zeitung
Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung
Sudetendeutschen Landsmannschaft
HEIMATBOTE
Neudeker Heimatbrief

Heimatbrief


VOLKSBOTE


❯ Ano ruft Sondersitzung ein Abgeordnete streiten über Migration
Bevor am heutigen Freitag in Tschechien die Europawahl beginnt, hat die Oppositionspartei Ano des früheren Premierministers Andrej Babiš am Donnerstag eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses zum Migrationspakt der Europäischen Union durchgesetzt.
Nach einem knappen Jahrzehnt zäher Verhandlungen hatte der Rat der Europäischen Union, also die Vertretung der 27 Mitgliedsstaaten, Mitte Mai eine grundlegende Reform der Asylverfahren in der EU beschlossen. Die tschechische Regierung von Premierminister Petr Fiala hatte sich bei der Abstimmung enthalten und dies damit begründet, daß der Migrationspakt zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht weitgehend genug sei. Das aus zehn Gesetzen bestehende Maßnahmenpaket soll vor allem die Zahlen der Neuankömmlinge senken, Asylverfahren beschleunigen und an die europäischen Außengrenzen verlagern. So sollen Migranten aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von unter 20 Prozent in Lagern an der EU-Außengrenze bis zu zwölf Wochen festgehalten werden, um den Asylantrag zu prüfen und im negativen Fall die Antragsteller ohne ein weiteres Verfahren in ihre jeweiligen Heimatländer zurückzuschicken.
Trotz des verschärften Verfahrens ist die Flüchtlingspolitik in Tschechien weiterhin eines der dominierenden Themen im derzeitigen EU-Wahlkampf. Seine Partei lehne den Migrationspakt ab, erklärte der AnoEuropaabgeordnete Jaroslav Bžoch: „Ich kritisiere, daß wir im Pakt keine strengeren Regeln haben, wie wir die Grenzen schützen und keine strengeren Regeln für die Rückführungspolitik.“
Man werde, so heißt es im Ano-Wahlprogramm zur Europawahl „nicht zulassen, daß die Tschechische Republik den Weg Westeuropas gehe, wo in vielen Städten No-Go-Zonen entstanden sind, in denen die Menschen Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen, und Frauen mit Gewalt bedroht werden“.




❯
Alt-Bundespräsident Joachim Gauck
„Europa darf kein Elitenprojekt sein“
Auf den 50. Paneuropa-Tagen hat Alt-Bundespräsident
Joachim Gauck appelliert, in der Gefahr stärker zusammenzurücken, „weil wir sonst Errungenschaften wie Völkerverständigung, Frieden, Freiheit, Rechtssicherheit und Menschenrechte verlieren würden“.
In seiner Festrede lobte Gauck dabei das nachhaltige Engagement der Paneuropa-Union, deren Präsident in Deutschland der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und langjährige Europaabgeordnete Bernd Posselt ist: „Europa darf kein Eli-
tenprojekt sein, sondern braucht die Verankerung in der Zivilgesellschaft, für die Sie kämpfen“, so Gauck.
Zu den politischen Mandatsträgern, die an den Paneuropa-Tagen in der Kemptener Residenz und auf Schloß Zeil teilnahmen, gehörten Bayerns Europaminister Eric Beißwenger, CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, MdEP Markus Ferber, MdEP Norbert Lins, MdB Mechthilde Wittmann, MdB Sebastian Roloff, der tschechische Ex-Vizeminister Jan Sechter, und MdL Joachim Konrad. Bericht Seite 5
„Macht
den Unterschied“ – Nato-Chef lobt Tschechiens Munitionsinitiative
„Rußland muß begreifen, daß es die Lage nicht aussitzen kann“, hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem informellen Treffen der Nato-Außenminister am vergangenen Freitag in Prag gefordert und eine mehrjährige Finanzzusage der Nato-Länder für die Ukraine angemahnt, und zwar „solange es notwendig ist“.
Zum ersten Mal hat ein NatoAußenministertreffen in der Hauptstadt eines ehemaligen Ostblockstaates stattgefunden. Im Rahmen der ersten Osterweiterung war Tschechien gemeinsam mit Polen und Ungarn vor 25 Jahren am 12. März 1999 dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten. Bei dem Treffen in Prag wurde der NatoGipfel vorbereitet, der im Juli in Washington stattfindet. Sowohl Stoltenberg als auch US-Außenminister Antony Blinken, der direkt von einem Staatsbesuch aus der Republik Moldau nach Prag gereist war, lobten Tschechien als „zuverlässigen und geschätzten Partner der Nato“.
Insbesondere die tschechische Munitionsinitiative, die Staatspräsident Petr Pavel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestartet hatte (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) sei, so Blinken, für die Ukraine „essentiell wichtig“. Es sei ein „außergewöhnliches Engagement, das Tschechien bei der Unterstützung der Ukraine in dieser Notsituation zeige“, lobte der US-Außenminister. Mittlerweile ist es der tschechischen Regierung gelungen, weltweit aus unterschiedlichen Militärbeständen 800 000 Artilleriegranaten zu kaufen und die Finanzierung mit Nato-Partnern, darunter auch Deutschland, sicherzustellen.
Premierminister Petr Fiala erklärte dazu, daß sich bereits 15 Länder an der Munitionsinitiative beteiligen und insgesamt 1,6 Milliarden Euro bereitgestellt haben. Fiala: „Die Ukrainer können in den nächsten Tagen mit den ersten Munitionslieferungen rechnen, und wir gehen davon

Informelles Tre en der Nato-Außenminister in Prag (von links): David Cameron (Großbritannien), Antony Blinken (USA), Mircea Geoană (stellvertretender Nato-Generalsekretär), Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Jan Lipavský (Tschechien) und Generalleutnant Andrew M. Rohling (stellvertretender Vorsitzender des Nato-Militärausschusses; der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Generalleutnant Janusz Adamczak, leitete zeitgleich die 21st IMS-EUMS Directors General Conference in Brüssel mit Spitzenmilitärs der Nato und der EU). Fotos: Nato

aus, daß ab Juni monatlich Zehntausende von Artilleriegranaten an die Ukraine geliefert werden.“
Stoltenberg: „Diese Munition ist von großer Wichtigkeit und macht wirklich den Unterschied.
Daß es schon bald die erste Munitionslieferung geben wird, ist eine sehr gute Nachricht.“
Auch bei der Frage, ob die Ukraine westliche Waffen einsetzen dürfe, um russische Truppen
auf russischem Staatsgebiet auszuschalten, zeigte Tschechien klare Kante. „Die Ukraine muß in der Lage sein, gegen die barbarische Invasion Rußlands zu kämpfen. Und das auch auf russischem Territorium“, betonte Außenminister Jan Lipavský mit Verweis auf das in der UN-Charta verankerte Selbstverteidigungsrecht. Mittlerweile hat auch die Bundesregierung ihren Kurs geändert und zugestimmt, daß Waffensysteme aus Deutschland auch für Ziele in Rußland eingesetzt werden dürfen. Premierminister Petr Fiala unterstrich bei dem Treffen, daß die Tschechische Republik „sich ihrer Verpflichtung gegenüber dem Nordatlantischen Bündnis und der kollektiven Verteidigung sehr bewußt“ sei. „In diesem Jahr haben wir unsere Verpflichtung, zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben, zum ersten Mal seit 2005 erfüllt“, sagte Fiala und kündigte an, daß seine Regierung diese Nato-Klausel auch in den kommenden Jahren einhalten werde.
Der tschechische Regierungschef forderte gleichzeitig ein
stärkeres Engagement der Europäer in der Nato: „Die Tschechische Republik unterstützt alle Maßnahmen, die den europäischen Pfeiler des Nordatlantischen Bündnisses stärken und die euro-atlantische Verbindung ausbauen.“ Bereits am Donnerstag hatte Staatspräsident Petr Pavel Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg empfangen. Pavel, der von 2015 bis 2018 als erster General eines ehemaligen Ostblockstaates Vorsitzender des Nato-Militärausschusses war, zeichnete den Norweger, dessen Amtszeit am 1. Oktober endet, für dessen Verdienste zur Stärkung der Demokratie mit dem TomášGarrigue-Masaryk-Staatsorden dritter Klasse aus. „Das vergangene Vierteljahrhundert war für die Tschechische Republik zweifellos eine Zeit der Sicherheit, Prosperität und Freiheit. Unsere Nato-Mitgliedschaft hat daran einen grundlegenden Anteil. Und aus eigener Erfahrung kann ich hinzufügen, daß an diesem Erfolg auch Sie, Herr Stoltenberg, einen persönlichen Anteil tragen“, so Pavel in seiner Laudatio. Torsten Fricke
Eine kleine, aber dafür sehr interessierte Gruppe von Schülern des Gymnasiums Unterrieden in Sindelfingen (Württemberg) hat unter Führung des Lehrers Benjamin Künstle das Prager Sudetendeutsche Büro besucht, um sich bei Büroleiter Peter Barton über dessen Engagement für Verständigung und Versöhnung zwischen Sudetendeutschen und Tschechen zu informieren.
Zum Inhalt dieses fast zweistündigen Treffens gehörten nicht nur historische Fragen, sondern auch die ausgesprochen menschlichen Aspekte: Barton präsentierte den Besuchern etwas aus

❯ Musikinstrument des Gitarrenbauers Framus aus Bubenreuth erzielt Rekordergebnis
2,85 Millionen US-Dollar
für eine Gitarre von John Lennon
Es ist der höchste Preis, der je für ein Beatles-Instrument bezahlt wurde: Die Hootenanny-Gitarre von John Lennon galt lange als verschwunden, bis sie auf einem Dachboden wiederentdeckt wurde. Jetzt ist das Meisterwerk des Bubenreuther Gitarrenbauers Framus (siehe unten) in der vergangenen Woche in New York von einem nicht genannten Bieter ersteigert worden – zu einem Rekordpreis von 2,85 Millionen US-Dollar.
Als die Beatles 1962 ihre atemberaubende Karriere mit der Unterzeichnung eines Plattenvertrags für „Love Me Do“ begannen und spätestens 1963 der internationale Durchbruch erfolgte, hatten sie bereits einige Jahre als aktive Musiker hinter sich. John Lennon, der legendäre Sänger und Gitarrist, begründete 1956 seine erste Band „The Quarry Men“. Ein Jahr später stieß Paul McCartney dazu, 1958 George Harrison, 1962 Ringo Starr. Schon damals waren Bubenreuther Gitarren bei den jungen englischen Musikern angesagt, von Höfner natürlich und auch von Framus. Nach der Umbenennung der Band 1960 in „The Beatles“ und Lehrjahren in Hamburg und Liverpool war der Siegeszug der Pilzköpfe ab 1962 nicht mehr zu bremsen. Sie prägten die Popkultur bis 1970 wie keine andere Band vor und nach ihnen.
dem Bestand an alten Fotografien, die ein tschechischer Neubesitzer einer Immobilie in Nordböhmen in das Prager Büro gebracht hatte, damit hier versucht wird, die Nachkommen der früheren Besitzer ausfindig zu machen. Für die Schüler aus BadenWürttemberg war es auch interessant zu erfahren, wie sich die Beziehungen zwischen den damaligen und heutigen Bewohnern des Sudetenlandes zukünftig gestalten können. Barton freut sich auf eine Zusammenarbeit mit dem Gymnasium, denn die beiden Institutionen haben sich viel zu sagen. John Lennon mit der Framus-Gitarre „Hootenanny“.
Auszeichnung für Lída Rakušanová

Die Journalistin und Publizistin Lída Rakušanová ist am Samstag in Pilsen mit dem „Preis des 1. Juni“ ausgezeichnet worden, den die böhmische Stadt seit 1993 vergibt. Geehrt werden damit Persönlichkeiten, die sich für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte in Presse, Rundfunk und Fernsehen einsetzen. Rakušanová emigrierte 1968 nach Frankreich und anschließend nach Deutschland, wo sie in München politisches Asyl beantragte. Die Ehrung aus Pilsen erhielt sie unter anderem für ihre Tätigkeit bei Radio Free Europe. In der vorherigen Ausgabe hatte die Sudetendeutsche Zeitung einen bemerkenswerten Leitartikel von Lída Rakušanová zum 74. Sudetendeutschen Tag dokumentiert. In dem Beitrag, der auf IRozhlas.cz, der InternetNachrichtenseiten des Tschechischen Rundfunks, erschienen ist, hatte die renommierte Journalistin die Prager Regierung auffordert, „von tschechischer Seite aus ein klares Signal an die tschechische Öffentlichkeit zur tschechisch-sudetendeutschen Aussöhnung“ zu senden.
Reallöhne steigen erstmals wieder
Die Durchschnittslöhne in Tschechien sind im ersten Quartal dieses Jahres schneller gestiegen als die Verbraucherpreise. Zum ersten Mal seit zwei Jahren gab es damit einen Zuwachs bei den Reallöhnen, berichtet die Nachrichtenagentur ČTK. Dennoch liege die Kaufkraft der Privathaushalte wegen der hohen Inflation weiter unter den Werten von vor der CoronaPandemie.
Umfrage: Ano siegt bei Europawahl
gen acht bis 11 Prozent der Stimmen bekommen. Die Koalition „Stačilo!” (Es reicht!) mit der kommunistischen Partei KSČM an der Spitze soll auf sechs bis acht Prozent bei der EU-Wahl kommen. Die Umfragewerte für das außerparlamentarische Bündnis aus Přísaha (Der Eid) und der Autofahrerpartei Motoristé sobě bewegen sich zwischen 2,5 und 7,7 Prozent.
Rentenreform nimmt erste Hürde Im tschechischen Abgeordnetenhaus wurde am vergangenen Donnerstag in erster Lesung die Rentenreform verabschiedet. Durch die Gesetzesänderung soll etwa das Renteneintrittsalter über die bisherige Obergrenze von 65 Jahren hinaus angehoben werden. Die dreitägige Debatte war dominiert von der Kritik der Oppositionsparteien und dauerte über 32 Stunden reine Sitzungszeit. Die Gesetzesnovelle wird nun weiter im Sozialausschuß beraten. Premierminister Petr Fiala hält die Rentenreform für notwendig, um das Defizit der Rentenkassen auf ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu beschränken. Derzeit machen die Rentenzahlungen etwa ein Drittel des tschechischen Staatshaushaltes aus.
Daniel Křetínský kauft Royal Mail
DDas Modell „Hootenanny“ ist beim Bubenreuther Gitarrenhersteller Framus Mitte der 1960er Jahre nach einem Konzept aus der US-Folkszene, das das gesellige, ungezwungene Konzert in kleinerer Runde beschreibt, benannt worden. 1965 spielte John Lennon bei mehreren Gelegenheiten eine solche zwölfsaitige Framus-Akustikgitarre 5/024 Hootenanny, die mit Stahlsaiten ausgestattet ist. Vor allem bei Studio-Aufnahmen für den Beatles-Film „Help!“ ist die Bubenreutherin zu sehen. Ihr Sound prägte die Ballade „You´ve Got To Hide Your Love Away“. Auch George Harrison spielte sie während der Help!-Sessions. Die Dallas Company in der Londoner Clifton Street, der damalige englische Framus-Vertriebspartner war es, die für sich und Framus die Rechte zur Verwendung des Bildes von John Lennon mit seiner Framus-Gitarre sicherte. Seither kann es für Werbezwekke des Bubenreuther Gitarrenherstellers eingesetzt werden. So wurden auch die Beatles – neben den Rolling Stones – zu offiziellen Werbebotschaftern für Framus.
heute zu astronomisch anmutenden Preisen gehandelt. John Lennons eigene Framus-Hootenanny ist erst vor Kurzem auf einem Dachboden in Südengland wieder aufgetaucht. Sie galt 50 Jahre lang als verschollen. Sie gelangte zunächst in den Besitz des schottischen Musikers Gordon Waller, der sie dem Road Manager seiner Band „Peter and Gordon“ schenkte.
steigert. Der Schätzpreis lag zwischen 600 000 und 800 000 USDollar (etwa 560 000 bis 750 000 Euro), wie das Auktionshaus mitteilte. Tatsächlich wurde die Gitarre nun für 2,85 Millionen USDollar (2,63 Millionen Euro) von einem unbekannten Käufer erworben.
In den aktuellen Umfragen zur Europawahl liegt Ano mit 26 bis 27 Prozent an der Spitze. Das Wahlbündnis Spolu aus KDUČSL, ODS und Top 09 folgt mit 20 bis 22 Prozent. Die Piraten erreichen in den Umfragen zehn bis zwölf Prozent, Stan acht bis 13 Prozent. Die Koalition aus der Rechtsaußenpartei SPD und Trikolora konnte in den Erhebun-
er tschechische Unternehmer und Milliardär Daniel Křetínský setzt seine Einkaufstour fort. Nach dem Einstieg bei ThyssenKrupp (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) greift Křetínský nach dem ehemaligen britischen Staatsunternehmen Royal Mail und hat dem aktuellen Eigentümer International Distributions Services (IDS) ein Übernahmeangebot in Höhe von 3,57 Milliarden britischen Pfund unterbreitet. Das Unternehmen hat der Offerte zugestimmt. Der Vorschlag muß noch von den IDS-Aktionären und der britischen Regierung gebilligt werden. Die Geschichte von Royal Mail geht bis ins Jahr 1516 zurück, als Heinrich VIII. einen „Master of the Posts“ ernannte. Anschließend war das Post-Unternehmen 499 Jahre im britischen Staatsbesitz.
Sudetendeutsche Zeitung
Die Instrumente, auf denen die Fab Four spielten, werden
Nach mehreren Besitzerwechseln wurde die Gitarre von den heutigen Besitzern des südenglischen Anwesens entdeckt und an das Auktionshaus „Julien´s Auctions“ gegeben. Bei Julien´s Auctions wurde im New Yorker Hard Rock Café neben anderen Musikalien mit „ikonischem Anstrich“ auch die wiederentdeckte Hootenanny von John Lennon ver-
Ob und wo die Gitarre zukünftig gezeigt wird, ist ebenfalls unbekannt. Im Bubenreuther Famus-Museum sind zumindest baugleiche Beatles-Instrumente ausgestellt. Neben einem Höfner Paul-McCartney-Beatlesbaß und einer Zenith No. 17, wie sie von Paul McCartney gespielt wurde und wird, ist auch eine baugleiche Framus-Hootenanny im Besitz des Bubenreuther Museumsvereins. Dr. Christian Hoyer
❯ Firmengründer Fred Wilfer flüchtete vor der Vertreibung nach Bayern und baute dort ein Weltunternehmen auf
Schönbach im Egerland nach Bubenreuth
Deutsche und internationale Stars wie Peter Kraus, John Lennon oder Bill Wyman spielten ihre Hits auf Framus-Gitarren und verhalfen dem Unternehmen aus Bubenreuth bei Erlangen in den 1950er und 1960er Jahren zu Weltruhm.
Die Wurzeln von Framus liegen in der Musikstadt Schönbach im Egerland, wo einst Geigen und viele andere Streichund Zupfinstrumente produziert und in alle Welt exportiert wurden. In Waltersgrün bei Schönbach wurde 1917 der spätere Firmengründer Fred Wilfer geboren. Als der Musikinstru-
mentenbauer 1945 von Vertreibungsplänen hörte, faßte er den Entschluß, nach Bayern umzusiedeln. Weil Wilfer von den tschechoslowakischen Behörden als „Antifaschist“ eingestuft worden war, erteilte ihm die US-Militärregierung in Bayern bereits Ende 1945 die Erlaubnis, ein Unternehmen zu gründen. So wurde am 1. Januar 1946 die „Fränkische Musikinstrumentenerzeugung Fred Wilfer KG“ (Framus) in Erlangen aus der Taufe gehoben, die zur zentralen Anlaufstelle für die aus Schönbach vertriebenen Instrumentenbauer wurde. Im März 1946 traf dann der
erste Transport mit Schönbachern in Erlangen ein. Fred Wilfer bemühte sich zusammen mit dem Flüchtlingskommissar um die Unterkünfte. Eine erste Werkstätte konnte im Herbst 1946 im ehemaligen Rad-Lager in Möhrendorf eingerichtet werden. Ende 1948 verlagerte Wilfer die Produktionsstätten ins nahe gelegene Baiersdorf. Seit Ende 1949 kristallisierte sich Bubenreuth als Zentrum für die Ansiedlung der Schönbacher Geigenbauer heraus. Hier errichtete Wilfer eines der modernsten Fabrikgebäude der damaligen Zeit, in das Framus im Sommer 1954 einziehen konnte. Auf
2200 Quadratmetern Produktionsfläche konnten von jetzt an 170 Instrumentenmacher an die Erzeugung von 2000 Instrumenten im Monat gehen. Hinzu kam 1966 der Standort Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz mit Europas größter Gitarrenfabrik. Ende der 1970er Jahre ging Framus in Konkurs. Ursache waren neben innerbetrieblichen und finanziellen Gründen vor allem die billigere Konkurrenz aus Japan. Seit 1995 wird Framus als Marke von Warwick weitergeführt. Der neue Firmensitz befindet sich in Markneukirchen im sächsischen Musikwinkel.
ISSN 0491-4546
Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

gefördert.

❯ Bilanz der Landesausstellung in Regensburg und Prag „Barock! Bayern und Böhmen“ begeistert 150 000 Besucher
50 000 Besucher in Regensburg, 100 000 Besucher in Prag: Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ war ein Erfolg.
Die mehr als 150 Exponate waren zunächst im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg und anschließend im Tschechischen Nationalmuseum in Prag zu sehen. Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Krieg, Siegen und Niederlagen und von einem prächtigen Wiederaufbau im barocken Stil in den Ländern Bayern und Böhmen.
„Diese Ausstellung erinnert uns an die jahrhundertelange



Museumsdirektor Dr. Richard Loibl mit Premierminister Petr Fiala und Ministerpräsident Markus Söder.
Nachbarschaft und die allgemeine historische Verbindung zwischen der Tschechischen Republik und Bayern“, hatte Tschechiens Premierminister Petr Fiala
bei der Eröffnung im Mai in Regensburg gesagt. „Die Landesausstellung dokumentiert die Verbundenheit zwischen Bayern und Tschechien als zwei Länder in der Mitte Europas“, bestätigte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Zumindest virtuell kann die Ausstellung weiter besucht werden, und zwar unter dem Link www.hdbg.de/la2023/
„Oskar Böse ist ein Visionär, der den Mut und die Kraft hatte, Visionen und Konzeptionen durchzusetzen“, hatte die damalige Bundesfrauenreferentin Walli Richter (13.1.1935–3.4.2020) in der Sudetendeutschen Zeitung zum 80. Geburtstag geschrieben. Am 10. Juni wäre der große Sudetendeutsche 100 Jahre alt geworden.
Oskar Böse sei eine Persön-
tschechoslowakischen Staat waren damit vorprogrammiert. –Auch wenn es aus heutiger Sicht in Kenntnis aller späteren Entwicklungen kaum nachvollziehbar ist, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß der 14jährige Oskar Böse im Oktober 1938 gemeinsam mit seinen Eltern in Reichenberg an der Straße stand, um nach dem Münchener Abkommen der Übergabe seiner Heimat an das Deutsche Reich
amtliches Engagement. Er war Mitbegründer und späterer Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Jugend und ihrer Integration in die damalige Deutschen Jugend des Ostens (heute: Deutsche Jugend in Europa), deren Bundesvorsitzender er ebenfalls etwa 15 Jahre war.
Zudem war er über vier Jahrzehnte Mitglied des Bundesvorstands der Sudetendeutschen Landsmannschaft, davon 15 Jah-
gruppen und Minderheiten in Europa, seien sie heimatverblieben oder ebenfalls heimatvertrieben, sowie zu den Völkern im östlichen Mitteleuropa mit dem Ziel des Aufbaus einer neuen Partnerschaft.“
Privat blieb Oskar Böse von Schicksalsschlägen nicht gefeit. Seine Ehefrau Josefine verstarb 2003, Dietmar, der älteste der beiden Söhne, 2014. Seine letzte Ruhestätte fand Oskar Böse
auf dem Bergfriedhof bei Berchtesgaden (Feld 46, Reihe 4, Nummer 8, Am Friedhof 11, Schönau). Hier wird am Montag, dem Geburtstag, eine sudetendeutsche Delegation mit Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, und Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, einen Kranz niederlegen. Torsten Fricke

April 2016 in Düsseldorf.


In Liebe und Dankbarkeit denken wir an Oskar Böse
† 6.4.2016, der am 10. Juni 100 Jahre alt geworden wäre, und an Josefine Böse, geb. Hölzel
† 20.11.2003
In liebevoller Erinnerung Gerald Böse und Familie Dietmar Böse
† 13.12.2014
❯
David Guetta & Co. rocken Tschechien
Tschechiens Festivals sind berühmt als Party-Destinationen.
Auch in diesem Sommer haben sich wieder zahlreiche Weltstars angekündigt. Ein Überblick.
Das „Festival Colours of Ostrava“ im mährischen Ostrau zählt jedes Jahr zu den Top Ten der europäischen Open-Air-Konzerte und findet heuer vom 17. bis 20. Juli statt. Vor der einzigartigen Industriekulisse werden unter anderem Weltstar Lenny Kravitz und der fünffache Grammy-Preisträger Sam Smith auftreten.
Zum Festival „Rock for People“, das vom 13. bis 15. Juni bei Königgrätz stattfindet, kommen The Prodigy, der kanadische Star Avril Lavigne und die Rockband Bring Me the Horizon Im Anschluß lädt Prag vom 20. bis 22. Juni zum „Metronome Festival“ ein. Auf der Bühne stehen die britische Band Kosheen und Raye, eine der am meisten gestreamten Sängerinnen der Gegenwart, die mit Rihanna und
■ Bis Sonntag, 27. Oktober, Sudetendeutsches Museum: „Oskar Schindler – Lebemann und Lebensretter“. Sonderausstellung in der Alfred-Kubin-Galerie. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
■ Freitag, 7., 18.00 Uhr, bis Sonntag, 9. Juni, 12.00 Uhr, Heimatkreis Jägerndorf: Heimatkreistreffen. Anmeldung bei Lorenz Loserth per eMail an LorenzLoserth@googlemail.com Heiligenhof, Bad Kissingen.
■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Krefeld: Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Anmeldung unter Telefon (0 21 51) 3 26 99 70 oder per eMail an werner.appl@ sudeten-kr.de Niederrheinischer Hof, Hülser Straße 398, Krefeld.
■ Samstag, 8. Juni, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Falkenauer Heimatstube in Schwandorf“. Vortrag von Gerhard Hampl. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.
■ Samstag, 8. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Retterin Valeria Valentin“. Filmvorführung in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Generalkonsulat und dem Italienischen Kulturinstitut. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal Hochstraße 8, München.
■ Sonntag, 9. Juni, 9.30 bis 15.00 Uhr, BdV-Bezirksverband Schwaben: Schwäbischer Vertriebenentag. Forum, Theaterplatz 1, Mindelheim.
■ Montag, 10. Juni, 19.00 bis 20.30 Uhr, Südosteuropa-Gesellschaft: „Verhältnis auf dem Prüfstand – Ungarns EU-Ratspräsidentschaft 2024“. Podiumsdiskussion mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Dr. Sonja Priebus, Zoltán Kiszelly und Prof. Dr. Gabor Polyák.
■ Dienstag, 11. Juni, 17.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Es brodelt und kafkat, es werfelt und kischt …“ Vortrag mit Lesung als Streifzug durch die Prager deutschsprachige Literatur. Eintritt frei. Konzertpavillon im Rhododendronpark, Kurstraße, Ostseeheilbad Graal-Müritz.
■ Donnerstag, 13. Juni, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.
■ Donnerstag, 13. Juni, 16.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Oskar Schindler – Lebemann und Le-
Beyoncé zusammenarbeitete.
Alle Heavy-Metal-Fans pilgern zum Festival „Masters of Rock“, das vom 11. bis 14. Juli in ostmährischen Wisowitz stattfindet. Mit dabei sind Judas Priest, Accept, Stratovarius sowie IronMaiden-Sängers Bruce Dickinson Die Dance-Fans werden vom Line-up des Festivals „Beats for love Ostrava“ vom 3. bis 6. Juli in Ostrau begeistert sein. Höhepunkt ist der Auftritt von Weltstar DJ David Guetta. Für den richtigen Beat sorgen außerdem die beste französische DJ, Antoine Clamaran, und das italienische Electronic-Dance-MusicTrio Meduza
Eine Verbindung der Welt der klassischen Musik mit jener des Metal versucht inmitten einer Festung das Festival „Brutal Assault“ vom 7. bis 10. August in Jermer herzustellen, gemeinsam treten dort Cult of Fire und das Bohemian Symphony Orchestra Prague auf. Und vom 28. bis 30. Juni sor-

Vor der einzigartigen Industriekulisse von Ostrau wird Weltstar David Guetta beim Festivals „Beats for love Ostrava“ für die richtigen Beats sorgen. Foto: Festival Beats for love Ostrava
gen auf dem Flugplatz in Tabor beim Festival „Mighty Sounds“ die Punk-Legende Bad Religion
VERANSTALTUNGSKALENDER
bensretter“. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 15. Juni, 11.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Szklarska Poręba. Die Künstlerkolonie Schreiberhau im Riesengebirge. Podiumsdiskussion zur Finissage der gleichnamigen Ausstellung. Campus der Generationen, Schillerstraße 1a, Schwaan.
■ Samstag, 15. Juni, 11.00 Uhr, Stiftung Haus Oberschlesien: „Sommerfest 2024 – drinnen, draußen und umsonst“. Oberschlesisches Landesmuseum, Bahnhofstraße 62, Ratingen.
■ Samstag, 15. Juni, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag mit Thomas Schembera vom Polizeirevier 8 zum Thema Enkeltrick und Telefonbetrug. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.
■ Samstag, 15. Juni, 19.30 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Hans Fallada und der Norden“. Szenische Lesung mit Katharina Groth und Wolfgang Wagner. Haus des Gastes Graal-Müritz, Rostocker Straße 3. Ostseeheilbad GraalMüritz.
■ Montag, 17. Juni, 19.00 Uhr: Vortragsreihe „Böhmen als Ort der Begegnung – Teil 2: Der Frieden kommt aus Böhmen“ von Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. ■ Mittwoch, 19. Juni, 15.30 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Sommerliche Träume unterm Apfelbaum“. Literarischer Nachmittag mit Gerhard Burkard. (Anmeldung unter Telefon (08 21) 31 66 85 50 oder per eMail: ackermanngemeinde@ bistum-augsburg.de AckermannGemeinde, Ottmarsgäßchen 8, Augsburg.
■ Donnerstag, 20. Juni, 16.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Wie schmeckt Heimat“. Zum Tag der Heimat. 16.00 Uhr: Museumspädagoische Führung. 17.00 Uhr: Kulinarische Reise im Sudetendeutschen Museum mit Dr. Amanda Ramm. Abendausklang im Restaurant Bohemia (Selbstzahler, vorherige Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37). Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 21. bis Montag, 24. Juni, „Meeting Brno“ mit dem Brünner Versöhnungsmarsch. Die SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Busfahrt. Anmeldung per Telefax
an (0 89) 48 00 03 96, per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de, oder per Post an SL Bayern, Hochstraße 8, 81669 München. ■ Montag, 24. Juni, 19.00 Uhr, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus: „Wenzel Jaksch (1896–1966) – Biographische Schlaglichter auf einen Sozialdemokraten aus Mitteleuropa“. Buchvorstellung mit Prof. Dr. Michael Schwartz. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.
■ Dienstag, 25. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: „Höhepunkte des deutschen Theaterlebens in Prag vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“. Ringveranstaltung mit Prof. Dr. Herbert Zeman und Dr. Herbert Schrittesser. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (089) 48000348. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.
■ Samstag, 29. Juni, 19.30 Uhr, BdV-Landesverband Hessen: Kulturtagung „Von Heimat(en) und Identität(en) –(Spät-) Aussiedler aus den postsowjetischen Staaten, aus Polen und aus Rumänien“. Eintritt 8 Euro. Theater im Pariser Hof. Spiegelgasse 9, Wiesbaden.
■ Dienstag, 2. Juli, 16.00 bis 18.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Lebendige Erinnerung“. Schreibcafé mit Journalistin und Autorin Gunda Achterhold. Teilnahmegebühr 15 Euro. Anmeldung per eMail an info@sudetendeutsches-museum. de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37, Sudetendeutsches Museum, Treffpunkt Museumskasse, Hochstraße 10, München.
■ Sonntag, 7. Juli, 10.00 Uhr, Heimatkreis Kaaden-Duppau: Marien-Wallfahrt mit zweisprachigem Festgottesdienst. Kapellenberg, Winteritz (Vintířov).
■ Samstag, 13. Juli, 13.00 Uhr, Heimatkreis Komotau und Förderverein Mittleres Erzgebirge – Komotauer Land: Gedenkstunde an der „Gedenkstätte 9. Juni 1945“. Deutschneudorf.
■ Sonntag, 14. Juli, 9.30 bis 23.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: EM-Fußballfinale im Museum. 9.30 bis 14.00 Uhr: Böhmischer Frühschoppen.15.00 bis 18.00 Uhr: Tischkicker-Turnier.18.50 bis 19.00 Uhr: Dokumentarfilm „DFC Prag – die Legende kehrt zurück“ im Adalbert-Stifter-Saal. 19.00 bis 20.00 Uhr: Finale des Kickerturniers. 20.00 bis 23.00: Public Viewing des EM-Finales im Adalbert Stifter-Saal. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.
❯

Filmvorführung im Sudetendeutschen Haus
Retterin Valeria Valentin
und die schwedische Alternative-Rock-Band The Hives für die richtige Stimmung.
■ Sonntag, 27. Juli, 10.00 Uhr, Bund der Deutschen in Böhmen: Heimatmesse anläßlich des Sankt-Anna-Festes mit den vertriebenen Deutschen und dortigen Tschechen. Laurentiuskirche in Luck bei Luditz.
■ Sonntag, 18. August, 11.00 Uhr, Förderverein Wallfahrtskirche Maria Kulm: 25. Egerländer Gebetstag. Wallfahrtskirche, Maria Kulm.
■ Donnerstag, 29. bis Freitag, 30. August, Stiftung GerhartHauptmann-Haus: „Demokratie erwandern – ein Spaziergang durch die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Teilnehmerbeitrag: 140 Euro pro Person (inklusive Übernachtung und Essen). Anmeldung per eMail an kultur@hausschlesien.de oder per Telefon unter (0 22 44) 88 62 31. Haus Schlesien, Dollendorfer Landstraße 412, Königswinter.
■ Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr, Monsignore Herbert Hautmann, Vertriebenenseelsorger der Erzdiözese Bamberg: Vertriebenenwallfahrt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Holger Kruschina aus Nittenau, der 1. Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerkes. Wallfahrtsbasilika Heilige Dreifaltigkeit, Gößweinstein.
■ Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September, Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband: Sudetendeutscher Kongreß. Kloster Haindorf, č.p. 1, Hejnice, Tschechien.
■ Montag, 16. September, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Brücken die verbinden“. Teil 3 der Vortragsreihe mit Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 10, München.
■ Freitag, 18. Oktober, 14.00 Uhr, Heimatverband der Brünner, Kreisverband München: Heimatnachmittag. Gaststätte Zum alten Bezirksamt im HDO, Am Lilienberg 5, München.
■ Freitag, 18. Oktober, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Festveranstaltung. Vortrag der Architekten Christian und Peter Brückner über den Gedenkort zum Olympiaattentat. Freier Eintritt mit anschließendem Empfang. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox. org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München.
■ Montag, 4. November, 19.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Prager Kaffeehäuser“. Teil 4 der Vortragsreihe mit Prof. Dr. Stefan Samerski. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 10, München.
■ Samstag, 8. Juni, 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Retterin Valeria Valentin“. Filmvorführung in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Generalkonsulat. Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München. In seinem Dokumentarfilm erzählt Paolo Tessadri die Geschichte einer Südtiroler Nonne, die während der PinochetDiktatur in Chile Hunderte Menschen vor dem Tod gerettet hat. Die 1937 in Badia geborene Südtirolerin widmete ihr ganzes Leben dem Dienst am Nächsten. Nach ihrem Abitur studierte sie in Irland Philosophie und trat dann in den Orden des heiligen Josef ein, um Nonne zu werden.
1969 ging sie nach Chile und zog sie in die Slums der Stadt, die heute Pudahuel heißt. Hier organisierte sie nach dem Militärputsch vom 11. September 1973 ein Untergrund-Netzwerk gegen das faschistische Regime von Augusto Pinochet Ugarte und mindestens sechshundert Menschen vor Fol-

ter und Tod. Nach offiziellen Schätzungen wurden unter Pinochet 3400 Menschen ermordet und 30 000 Menschen gefoltert. Der Dokumentarfilm, der von der Stiftung historisches Museum des Trentinos geförder wurde, hatte 2013 zum 50. Jahrestages des Militärputsches seine Premiere. Eintritt frei. Anmeldung per eMail an info@ sudetendeutsches-museum.de oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 37.
Kultursommercamp24
■ Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 2. August: Kultursommercamp24 – Deutsch-Tschechische Kinderfreizeit. Veranstaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre aus Deutschland und Tschechien Über 100 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien kommen jedes Jahr auf dem Heiligenhof zusammen. Sie treiben gemeinsam Sport und Spiel, basteln, singen, lernen und vertiefen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen. Damit soll die Verständigung zwischen jungen Deutschen und Tschechen initiiert und verstärkt werden. Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de
Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de



❯
Neue Ausstellung
Vertriebene 1939
■ Dienstag, 18. Juni, 18.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Vertreibung 1939“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Die Ausstellung wird anschließend bis zum 31. Juli gezeigt. Öffnungszeiten: werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr. Die Ausstellung „Vertriebene 1939“ veranschaulicht anhand von 400 Fotografien, Plakaten und Dokumenten die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Zivilbevölkerung, die während des Zweiten Weltkriegs aus den Teilen Polens deportiert wurde, die an das „Dritte Reich“ angegliedert wurden. Die gewaltsamen Zwangsaussiedlungen, Inhaftierungen und Ermordungen von insgesamt 1,5 Millionen polnischer und jüdischer Bürger waren zugleich Teil der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, die in der Errichtung von KZs und im Ho-
locaust mündete. An ihrer Stelle wurden „Volksdeutsche“ aus Ost- und Südosteuropa angesiedelt, denn das Ziel der Besatzer war die völlige Germanisierung der Territorien. In einem Distrikt namens „Warthegau“ sollte eine „blonde Provinz“ als ein Laboratorium zur Züchtung des germanischen Herrenmenschen entstehen. Zu den betroffenen Gebieten gehörten unter anderem die Provinz Posen, ein Teil des Lodzer Gebiets, Pommern, das nördliche Masowien und Schlesien. Den Festvortrag hält Kurator Dr. Jacek Kubiak. Grußworte sprechen Stadträtin Gudrun Lux für die Stadt München, MdL Dr. Petra Loibl als Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Jan M. Malkiewicz, Generalkonsul der Republik Polen in München, und Prof. Dr. Andreas Otto Weber, als Direktor des HDO und Gastgeber.
50. Paneuropa-Tage in Kempten und Zeil mit Alt-Bundespräsident Joachim Gauck
Europa als Kontinent der Freiheit
Zu den Höhepunkten der 50. Paneuropa-Tage der Paneuropa-Union Deutschland in der Kemptener Residenz und in Schloß Zeil haben die Verleihung der Sonderstufe der Paneuropa-Verdienstmedaille an Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, eine Großkundgebung zur Europawahl und die beiden Festgottesdienste mit der evangelischen Dekanin Dorothee Löser sowie mit dem Augsburger Diözesanbischof Bertram Meier gehört. Ein hochrangig besetztes Podium befaßte sich mit der Vernetzung zwischen den Grenzregionen der EU-Mitgliedstaaten, ein Festakt in Schloß Zeil erinnerte an die geistigen und historischen Wurzeln des europäischen Freiheitsgedankens.
Alt-Bundespräsident Joachim Gauck schilderte in seiner Festrede, wie er unter dem Unrechtsregime hinter dem Eisernen Vorhang das Wachsen der europäischen Einigung sehnsüchtig verfolgt habe. Er dankte den Europa-Pionieren in der Paneuropa-Bewegung, die für die Einigung des Kontinents gearbeitet hätten, „als es noch ein ferner Traum war“. Auch heute sei dieser Einsatz unverzichtbar, „denn Europa darf kein Elitenprojekt sein, sondern braucht die Verankerung in der Zivilgesellschaft, für die Sie kämpfen“. Für die Menschen im ehemaligen Ostblock, die jetzt daran mitwirken könnten, sei dies eine „nachträgliche Beheimatung“. Gauck hob hervor, daß „unsere Idee der Vereinigten Staaten von Europa auch für den Balkan gilt“. Nationen, die an historischen Kränkungen litten, suchten oft ihr Heil im Nationalismus. „Deshalb darf man die Nation nicht gegen Europa ausspielen. Eine starke, in sich ruhende Nation braucht nicht die Idee der europäischen Einigung zu bekämpfen.“ Er forderte ein „stärkeres Zusammenrücken Europas in der Gefahr, weil wir sonst Errungenschaften wie Völkerverständigung, Frieden, Freiheit, Rechtssicherheit und Menschenrechte verlieren“ würden.
Der Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, skizzierte den Aufstieg Putins zu einem militärisch aggressiven Diktator seit Ende des 20. Jahrhunderts und bezeichnete Rußland als eine Gefahr, „mit der wir uns noch lange, womöglich generationenlang, auseinandersetzen müssen“. Die Ukrainer kämpften nicht nur für sich, sondern für ganz Europa. Das Ziel der Moskauer Führung sei erklärtermaßen ein Eurasien von Wladiwostok bis Lissabon: „Das werden sie nicht erreichen, wenn Europa fest zusammenhält, aber daß sie so denken, beweist, daß sich Putin bei territorialen Zugeständnissen an ihn in der Ukraine nur ermutigt fühlen und weitermarschieren würde.“ Der ehemalige Europaabgeordnete rief dazu auf, das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat und im Außenministerrat zu beseitigen, eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft mit Europäischer Armee zu gründen sowie Europa durch eine Energie- und eine Ernährungs-Union von Importen aus anderen Kontinenten unabhängig zu machen.
Bischof Bertram Meier rief beim Gottesdienst in der prächtigen Basilika St. Laurentius dazu auf, bei der bevorstehenden Europawahl nicht in Enge und Kleinstaaterei zu verharren, sondern auf den großen Horizont zu schauen. Es gehe nicht nur um ökonomisch-finanzielle Fragen, sondern es gelte auch ein geistig-kulturelles Erbe zu bewahren, das auf jüdisch-christlichen Wurzeln beruhe.
Weichenstellung für Europa
Bei der von der Bundesvorsitzenden der Paneuropa-Jugend Deutschland, Isabella Schuster-Ritter, geleiteten Hauptkundgebung der PaneuropaTage zum Thema Europawahl erklärte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, daß sich die EU auf die großen Fragen wie Krieg und Frieden konzentrieren müsse. Eine strategische Debatte über die Sicherheit Europas sei überfällig, „einschließlich der nuklearen Komponente“. Europa könne auf die globalen Machtspiele Rußlands und Chinas nur als Einheit eine friedenssichernde Antwort geben. Als weitere zentrale Aufgaben für die europäische Integration





nannte Holetschek die Bereiche Migration, Klima, Landwirtschaft und die Verringerung der Abhängigkeit von Medikamenten-Importen aus Asien. Der Präsident der Paneuropa-Union Ukraine, Prof. Ihor Zhaloba, der zwei Jahre lang freiwillig als Frontsoldat gedient hat, warnte vor einer naiven Appeasement-Politik, wie sie der britische Premier Neville Chamberlain 1938 gegen Hitler betrieben habe. Nicht die Demokratie habe damals versagt, sondern es seien „zu kleine Politiker an ihrer Spitze gestanden“. Der internationale Paneuropa-Präsident Alain Terrenoire aus Frankreich kritisierte die Rekolonisierungsversuche Rußlands insbesondere in der Exklave Transnistrien, die auf dem Boden der Republik Moldau liegt, und in Tschetschenien, wo Putin die blutigen Methoden anwende, die er beim sowjetischen Geheimdienst KGB gelernt habe. Die Europäer hätten spätestens nach Putins Angriff auf Georgien mit seinen „wandernden Grenzen“ im Jahr 2008 und 2014 bei der Annexion der Krim auf die russische Expansionspolitik aufmerksam werden müssen. Der französische Politiker forderte Deutschland auf, sein Militärbudget spürbar zu erhöhen und in eine gemeinsame europäische Verteidigung einzubringen.
In seinem Grußwort stellte der schwäbische Europaabgeordnete Markus Ferber fest, daß es bei den bevorstehenden Europawahlen nicht mehr um Wertungen, sondern um „existentielle Fragen und Betroffenheiten“ gehe. So sei China nicht mehr Absatzmarkt, sondern Systemrivale; Präsident Xi besuche in Europa Budapest und Belgrad und befördere die Neue Seidenstraße. Hier sei mehr Europa erforderlich.
Der Landesvorsitzende der Paneuropa-Union Bayern, Dr. Dirk H. Voß, attackierte in seinem Grußwort den „völkisch-nationalistischen Irrsinn“ rechts- oder linksextremer Kräfte. Die Ansicht, Europas Nationalstaaten könnten irgendein Problem allein lösen, bezeichnete Voß als „naive Nostalgie“. Grenzüberschreitende
Vernetzung
Die anschließende Podiumsdiskussion befaßte sich mit der grenzüberschreitenden Vernetzung in Europa.
Der Operndirektor und Chefdramaturg der Bühnen in der Schweizer Bundeshauptstadt Bern, Rainer Karlitschek hob die zentrale Rolle der kulturellen Kooperation, der typisch europäischen Formen von Oper und Theater sowie der politischen Bildungsarbeit hervor, die allesamt nicht finanziellen Kürzungen zum Opfer fallen dürften, weil sie „Europas Geist und Seele zusammenhalten“.
Das Mitglied des SPD-Bundesvorstandes, MdB Sebastian Roloff, setzte sich vehement für eine intensivere grenzüberschreitende Jugendarbeit ein. Europa lebe von gemeinsamen Werten, wie sie die Paneuropa-Union „immer schon visionär hochgehalten hat“.
Der langjährige tschechische Diplomat und Vizeminister für Verkehr, Jan Sechter, der sich jetzt führend in der zentralen Handelskammer in Prag betätigt, verlangte mehr Rückenwind für die Transeuropäischen Netze in Transportwesen, Eisenbahnverkehr, Energiever-
Im Fürstensaal (von rechts) in der ersten Reihe: MdB Mechthilde Wittmann MdB, Milan Horáček, OB Thomas Kiechle, Präsident Alain Terrenoire, Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, Europaminister Eric Beißwenger, Dirk Voß, Generalsekretär Prof. Pavo Barišić, Bischof Franjo Komarica und Prof. Ihor Zhaloba. Am Podium: CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek (links) und MdEP Markus Ferber. Fotos: Johannes Kijas (2), Dagmar Jessat
sorgung und digitalen Verbindungen. Der Präsident der Jungen Alpenregion, Alexander Attensberger, zugleich stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschland, erzählte über die wiederbelebte und erneuerte Arbeit seiner Organisation, die Bayern, die meisten österreichischen Bundesländer, die Ostschweiz, Südtirol, Norditalien und Slowenien zusammenführe. Wichtiger als jede technische Kooperation sei die menschliche Seite der Europäischen Einigung.
Anstelle des durch Hochwasser verhinderten Staatssekretärs Tobias Gotthardt von den Freien Wählern brachte sich der örtliche Landtagsabgeordnete Joachim Konrad auf dem Podium aktiv ein. Er sprach sich dafür aus, die Gesellschaft in Europa nicht nur durch mehr politische und sonstige Bildung zusammenzuhalten, sondern auch durch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Frauen und Männer.
Podiumsleiter war der frühere Bundesvorsitzende der Paneuropa-Jugend Franziskus Posselt
Zukunft Europas im Rittersaal
Einen besonderen Akzent setzte die Paneuropa-Union mit einem Europäischen Festakt, zu dem Fürst Erich von Waldburg-Zeil in sein prachtvolles Renaissanceschloß Zeil bei Leutkirch eingeladen hatte. Der Fürst bekannte sich in seiner Ansprache im Rittersaal zum „Traum von einem vereinten, solidarischen und mutigen Europa, das bereit ist, sich zu verteidigen“. Dieses müsse aber auch „individuell sein und von der Vielfalt von Ländern und von den Eigenheiten innerhalb dieser Länder leben“.
Einer der Hauptredner war der oberschwäbische Europaabgeordnete Norbert Lins, Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses in der Straßburger Volksvertretung. Er griff das Motto der Paneuropa-Tage „Wir sind Freiheit“ auf und meinte, diese sei „in Gefahr wie seit Jahrzehnten nicht mehr“. Es gebe aber auch eine ermutigende Abwehr: „Wladimir Putin hat nicht damit gerechnet, daß wir zusammenstehen und gemeinsam mit Amerika den Freiheitswillen der Ukrainer unterstützen.“
In seinen mitreißenden Ausführungen über die Zukunft Europas erinnerte der internationale Paneuropa-Präsident, Alain Terrenoire aus Paris, daran, daß Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im deutsch-französischen Elysée-Vertrag 1963 versucht hätten, die dynastische Aufteilung des Frankenreiches im Vertrag von Verdun, die die Enkel Karls des Großen vorgenommen hätten, zu überwinden. 2019 hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron das Friedenswerk des Elysée-Vertrages in Aachen weitergeschrieben. Paris und Berlin müßten beim Aufbau einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft eng zusammenarbeiten und auch dafür sorgen, daß sich die Menschen in beiden Ländern besser kennenlernen.
Der Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt, nannte Zeil „ein Zentrum europäischer Geschichte und Kultur“. Dieses Renaissanceschloß, „das weit übers Land schaut“, atme einen europäischen Geist, „der sich nicht in der Geschichte einmauert, sondern bis ins 21. Jahrhundert weiterwirkt“. Posselt zeichnete ein Por-
trait des gleichnamigen Großvaters von Fürst Erich von Waldburg-Zeil (1899–1953), der als Pionier des christlichen Europas zeitlebens für Freiheit, Föderalismus und europäische Einigung eingetreten sei. Ausgehend von der christlichen Naturrechtsidee habe er schon gegen Ende der Weimarer Republik ab 1930 gegen Hitler und den Nationalsozialismus gekämpft und sei damit einer der ersten Widerstandskämpfer gewesen, zu einem Zeitpunkt, als selbst viele Helden des 20. Juli 1944 noch an das Dritte Reich geglaubt hätten. Der Landesvorsitzende der Paneuropa-Union Baden-Württemberg und Vizepräsident der Paneuropa-Union Deutschland, Andreas Raab aus Ulm, beschrieb die geistige und kulturelle Faszination, die von der historischen Landschaft Oberschwaben mit ihrer Ausstrahlung auf Europas Schicksalsströme Rhein und Donau ausgehe. Gemeinsam für die Freiheit Zu Beginn der festlichen Eröffnung hatten der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle, die regionale Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann und Paneuropa-Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas die fast 250 Gäste aus ganz Europa willkommen geheißen.
Zur besonderen Freude von Alt-Bundespräsident Gauck war der Bürgerrechtler und Mitbegründer von Bündnis 90/Die Grünen, Milan Horáček, erschienen. Horáček erinnerte Gauck an philosophische Debatten mit gemeinsamen Weggefährten wie Václav Havel und Fürst Karl Schwarzenberg. Die neue Freiheit im Kant‘schen Sinne sei für Havel nicht selbstverständlich gewesen, sondern eher ein Schock. Dieses besondere Spannungsfeld zwischen den Bürgerrechtlern hinter dem Eisernen Vorhang und jenen, die in einer liberal-freiheitlichen Demokratie gelebt hätten, habe Gauck in seinem Buch „Freiheit“ problematisiert. Bayerns Europaminister Eric Beißwenger dankte „der ältesten europäischen Einigungsbewegung für ihre lange Leidenschaft als große Brückenbauerin für ein Europa, das zusammenhält“. Frieden, Freiheit, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Menschenwürde seien alles andere als selbstverständlich: „Deshalb ist die Europawahl eine Schicksalswahl und keine Protestwahl.“ Der Minister plädierte für eine Stärkung der europäischen Säule der Nato, „denn 80 Prozent der militärischen Kompetenz des Atlantischen Bündnisses liegen heute noch außerhalb der EU, nämlich bei den USA und Großbritannien“. Der internationale Paneuropa-Generalsekretär Prof. Pavo Barišić aus Kroatien beschrieb die historische Entwicklung hin zu einem supranationalen Parlament Europas. Als der Vater Paneuropas, Richard Coudenhove-Kalergi, 1946 aus dem Exil zurückgekehrt sei, habe er an mehr als 4000 Parlamentarier zahlreicher europäischer Länder geschrieben und sie befragt, ob sie für eine Europäische Föderation im Rahmen der Vereinten Nationen seien. Die große Mehrheit der Antworten sei positiv gewesen, was Coudenhove dazu geführt habe, 1947 in Gstaad die Europäische Parlamentarier-Union zu gründen und 1951 den Entwurf einer Europäischen Bundesverfassung vorzulegen.
An Gräbern von Menschen zu stehen, die jünger waren als ich, fand ich immer schon beklemmend. Kürzlich besuchte ich einen Friedhof, auf dem sich fast nur solche Gräber befanden. Das war in Lemberg in der Ukraine. Neben dem städtischen Friedhof wurde nach dem brutalen russischen Angriff am 24. Februar 2022 eine Wiese für die gefallenen Soldaten umgewidmet. Hunderte Gräber mit Fotos der Verstorbenen, jeweils versehen mit der ukrainischen Nationalflagge und der Fahne der jeweiligen Kampfeinheit, liebevoll geschmückt mit Blumen, Kerzen und anderen Zeichen der Erinnerung. Ein ständiges Kommen und Gehen von trauernden Angehörigen: Eltern, Ehefrauen, Kinder. Auf diesem Friedhof sind definitiv zu viele junge Menschen begraben. Eine halbe Stunde streifte ich langsam durch die Grabreihen, und es schnürte mir mehr und mehr den Hals zu. Während meines Besuches fand eine neue Beerdigung statt. Gleich drei Soldaten wurden mit militärischen Ehren begraben. Am Abend desselben Tages sah ich ihre Bilder. Auf dem Rathausplatz von Lemberg stehen nämlich Schautafeln, mit denen der jeweils aktuellen Gefallenen gedacht wird. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt wurde ich von meinen Gastgebern eigens darauf hingewiesen. Noch einmal empfand ich Beklemmung und Bedrückung. Schon lange wollte ich der Ukraine einen Solidaritätsbesuch abstatten. Mit dem Land verbinden mich meine Beziehungen zu unseren ukrainischen Mitbrüdern aus der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen. Jetzt gab es einen besonderen Anlaß hinzufahren, und es war eigentlich ein froher Anlaß. Vor 25 Jahren wollten sechs junge Frauen aus der westlich von Lemberg gelegenen Stadt Nowojaworiwsk eine Ordensgemeinschaft gründen. Sie schlossen sich schließlich der Gemeinschaft der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser an, die seit Jahrzehnten mit uns Redemptoristen in Deutschland und Österreich eng verbunden ist. Der ukrainische Zweig dieser Gemeinschaft wuchs mittlerweile auf 27 Schwestern an. Das Jubiläum wurde groß gefeiert. Den Gottesdienst in der Redemptoristenkirche von Nowojaworiwsk zelebrierte der Großerzbischof der Griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, Swjatoslaw Schewtschuk, mit vier weiteren Bischöfen. Hunderte Gläubige feierten innerhalb und außerhalb der Kirche mit. Anschließend gab es ein großes Festmahl. Freude und Dankbarkeit beherrschten die Atmosphäre. In den Gesprächen zwischendurch konnte ich viel von der Situation der Mitbrüder und der Missionsschwestern erfahren. Die traumatische Erfahrung des Krieges erfordert ihren besonderen seelsorglichen Beistand. Mit ihrem tiefen Glauben, aber auch mit ihrer Lebensfreude und ihrer Energie stärken sie jene Menschen, die zu den Leidtragenden gehören. Das ukrainische Volk und die Christen in der Ukraine – das lernte ich bei meinem Besuch – haben eine große Mission. Sie heißt Hoffnung. Für mich war der Besuch eine starke Motivation, diese Mission weiterhin mit meinem Gebet und meiner Solidarität zu unterstützten.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien-München
Unser Angebot
Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:
jährlich durch Lastschrift
halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift
Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung Gras itzer Heimatzeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)
Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)
Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!
Adresse:
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefon
Geburtsdatum, Heimatkreis
Datum, Unterschrift
Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.
Kontoinhaber
Kontonummer oder IBAN
Bankleitzahl oder BIC
Datum, Unterschrift
Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an
Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 23/2024
Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden
Ende Mai stellte sich Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, langjähriger Europaabgeordneter und gegenwärtig CSU-Listenkandidat bei der Europawahl am 9. Juni, im Bayerischen Hof im oberbayerischen Prien am Chiemsee der Frage „Wohin geht Europa?“.
Veranstalter und örtlicher CSU-Chef Michael Anner junior begrüßte Bernd Posselt mit der Bemerkung, Posselt komme alle fünf Jahre vor den Europawahlen. Posselt konterte, er habe vor 45 Jahren das erste Mal in Prien gesprochen. Damals sei Anner sieben Jahre alt und schon damals Europa das Thema gewesen.
„Europa“, so Posselt, „war immer eine Frage von Krieg und Frieden.“ Bereits 1923 habe Richard Coudenhove-Kalergi, der in Westböhmen aufgewachsen sei, sein programmatisches Werk „Pan-Europa“ geschrieben und 1924 die Paneuropa-Union gegründet, die älteste europäische Einigungsbewegung, die ein Staatenbund von Polen bis Portugal habe werden sollen. „Hätte man auf Coudenhove-Kalergi gehört, wären uns der Krieg, die Vertreibung und die Teilung erspart geblieben.“
Robert Schuman sei der Vater des demokratischen Nachkriegseuropas gewesen. Mit Konrad Adenauer und Alcide De Gasperi hätten drei Christen Europa geeint. Die 1951 gegründete Montanunion sei vor allem ein sozialer Zusammenschluß gewesen. Sie habe Siegern und Besiegten gleichermaßen Zugang zu Kohle und Stahl gewährt und die wirtschaftliche Entwicklung gefördert. Dabei sei allerdings die po-
� Kulturpreisträgerin 2006
litische Entwicklung vernachlässigt worden.
1976 sei die EVP gegründet worden mit dem Belgier Leo Tindemans als erstem Präsidenten, 1979 sei zum ersten Mal das Europaparlament direkt gewählt worden, seit 1999 stelle die EVP
der Kriegsgeneration gewesen. Im Krieg sei Nationalismus selbstverständlich. „Frieden ist das Kostbarste, das uns die ältere Generation hinterlassen hat.“ Aber er müsse immer wieder erarbeitet werden. „Leider gibt es in unseren Schulen wieder Kin-

Alexander Klein, Stellvertretender Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Michael Anner, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Prien, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Leonhard Schleich, langjähriger Leiter der Jugendbegegnungsstätte Haus Sudetenland in Waldkraiburg, und Gabi Schleich, Obfrau der SL-Ortsgruppe Prien und Umgebung. Bild: Nadira Hurnaus
die Mehrheit im Eoropaparlament und seit 2014 sei Manfred Weber Vorsitzender der EVPFraktion. Gegenwärtig kandidiere der Niederbayer Weber als CSU-Spitzenkandidat.
Er, so Posselt, habe das große Glück gehabt, Organisator des Paneuropa-Picknicks am 19. August 1989 an der ungarischen Grenze gewesen zu sein, mit dem die deutsche und europäische Wiedervereinigung begonnen habe. Im Rahmen der demokratisierung Jugoslawiens sei er 1991 in Kroatien gewesen. Dort habe der serbisch-kroatische Krieg geherrscht, und er sei in einem Luftschutzbunker plötzlich Mitglied
der, die Krieg erlebt haben.“ Beispielsweise den von Wladimir Putin geführten Angriffskrieg in der Ukraine. Knapp einen Monat nach der Ernennung Putins zum Ministerpräsidenten habe er, so Posselt, im Europaparlament vor Putin gewarnt. Putin habe die Energie genutzt, um Europa zu zersplittern. Das habe keiner geglaubt, auch nicht der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Die antipaneuropäische Eurasische Bewegung des Alexander Dugin, dem Putin nahestehe, beanspruche den Raum von Wladiwostok bis Lissabon. Am Vortag habe Expräsident und Putinfreund
PERSONALIEN
Dimitri Medwedew Polen gar mit radioaktiver Asche gedroht. Putin finanziere alle europäischen Nationalisten unabhänig von ihrer Couleur, so lange sie antieuropäisch seien. Er versuche mit aller Gewalt, Euopa zu zerlegen. Die Opposition habe er nahezu ausgeschaltet. „Keiner der Oppositionellen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist noch am Leben.“ Putin habe sich am Westen festgebissen, mit der Volksrepublik China verbündet und damit in eine tiefe Abhängigkeit begeben. Die Bedrohung aus dem Osten werde über Putin hinaus andauern. Gegenwärtig stürben die Ukrainer auch für die Deutschen. Deutschland sei zwar nicht Kriegspartei, aber Kriegsziel. Die NATO habe nur eine Zukunft mit den zwei gleichberechtigten Säulen USA und EU. Doch die USA lösten sich seit langem immer mehr von Europa Richtung Pazifik. „Wer den Frieden will, bereite auch den Krieg und die zivile Stärke vor.“ Dafür seien eine europäische Ernährungsunion, eine europäische Energieunion und eine europäische Verteidigungsunion notwendig. Darüber hinaus müsse das Einstimmigkeitsprinzip in der EU überwunden werden.
Nach der Wende sei Europa zwar wirtschaftlich, aber nicht geistig zusammengewachsen. „Wir müssen uns mit den anderen Kulturen und Religionen auseinandersetzten, wir müssen einander verstehen.“ „Europa braucht nicht weniger, sondern mehr Bayern. Und alle Nationalisten sollen zu Hause bleiben“, forderte Bernd Posselt und bat, zur Europawahl zu gehen. Nadira Hurnaus
Ruth Maria Kubitschek
Am 1. Juni starb Ruth Maria Kubitschek, Trägerin des Sudetendeutschen Kulturpreises für Darstellende Kunst 2006, mit 92 Jahren in Ascona in der Schweiz.
Ruth Maria Kubitschek kam am 2. August 1931 im nordböhmischen Komotau zur Welt und hatte vier Geschwister. Um sie vor marodierenden tschechischen Rotgardisten zu bewahrenm, schickte ihre Mutter sie 1945 als 13jährige übers Erzgebirge in die SBZ. Dorthin hatte sich der Vater nach dem Krieg gerettet und später einen Bauernhof übernommen. Ruth wollte aber nicht Bäuerin werden, sondern Schauspielerin. Nach Studien in Halle und Weimar wurde sie an die Bühnen von Schwerin und Ostberlin berufen. 1958 glänzte sie in der Titelrolle der Gerhart-HauptmannVerfilmung „Rose Bernd“. 1959 verließ sie mit ihrem Sohn Alexander aus der Ehe mit Regisseur Götz Friedrich die DDR. Fritz Kortner holte sie an die Münchener Kammerspiele. Hier brillierte sie als Emilia in William Shakespeares „Othello“. Zum populären Liebling avancierte sie Anfang der achtziger Jahre als Filmehefrau von Helmut Fischer in „Monaco Franze – der ewige Stenz“. Als Brauerei-Besitzerin Margot Balbeck überzeugte sie im Film „Das Erbe der Guldenburgs“. Neben wiederholten
Auftritten in Krimi-Serien drehte sie an exotischen Orten als elegante Hotelbesitzerin in der Reihe „Traumhotel“. Kubitschek wanderte auf mythologischen und religiösen Pfaden. Die griechische Mythologie mit ihrer sinnenfreudigen Götterwelt faszinierte sie. In ihrem vielleicht besten Buch „Das Wunder der Liebe“ führt Kubitschek auf einer Kreuzfahrt in die griechische Ägäis. Mit Genugtuung weist sie dabei in Olympia auf die berühmten Wettspiele zu Ehren der Göttermutter Hera hin, die mit ihrem Appell zur Einstellung aller Kriegs- und Kampfhandlungen bis heute beispielhaft sein sollten. Ihr neues Zuhause findet sie allerdings auf der Vulkaninsel Santorin, wo auch fortwährende Erdbeben die griechische Kultur nicht verschütten können. Kubitschek war eine Anhängerin des Urchristentums. Sie glaubte nicht an die Erlösung durch Leiden wie Christus am Kreuz. Die österliche Botschaft der Auferstehung war für sie wichtiger, denn sie heißt Erlösung vom Leiden.

Ihr Leben glich einer Pilgerfahrt über Höhen und Tiefen auf der Suche nach dem Woher und Wohin unseres Daseins. Auf ihrem Unterwegssein begegnete
sie auch den tiefen Wahrheiten der fernöstlichen Religionen mit ihren indischen Wurzeln. Vor allem Buddhas Wiedergeburtslehre hatte es ihr angetan. In „Der indische Ring“ beschreibt Kubitschek die Heirat eines deutschen Mannes mit einer indischen Frau. Die Mentalitätsunterschiede zwischen abendländischer Kultur und morgenländischer Religion führen zu Konflikten, die durch den Glauben an das buddhistische Nirwana aufgelöst werden. Seit Tschernobyl engagierte sie sich beim Umweltschutz. Das Bedrohungsszenario mit dem Raubbau an der Natur führte dazu, daß die Bauerntochter im thurgauischen Fruthwilen eine Wildnis in einen zauberhaften Garten verwandelte. So beschreibt sie in ihrem Buch „Im Garten der Aphrodite“, wie Büsche und Sträucher Blumen schützen. Die Liebe zur Natur bewog die vielseitig Begabte, sich auch der Malerei zu widmen. Ihre Ölbilder und Aquarelle sind gegenständliche Darstellungen, die von der Schönheit des „Paradiso terrestre“ zeugen. Die Malerin war vom Kirschgarten neben ihrem Haus stärker beeinflußt als von den apokalyptischen Vorgängen des 20. Jahrhunderts. Wer den wechselvollen Werdegang der
†
Grenzgängerin aufmerksam verfolgt, erkennt, daß das Leben von Ruth Maria Kubitschek um den Satz kreiste: „Du mußt Deinen Garten bebauen.“ Ernst Mühlemann Volksgruppensprecher Bernd Posselt trauert um eine ungemein beliebte und liebenswürdige Schauspielerin. „Ruth Maria Kubitschek strahlte einen böhmisch-österreichischen Charme aus, der sie so populär machte. Man nannte sie nicht nur ,Spatzl‘ wie in ihrer erfolgreichsten Serie, man fühlte sich bei Begegnungen auf dem Bildschirm und persönlich immer sehr wohl. So leicht sie auftrat, so sehr pflegte sie die sudetendeutsche Kunst der Perfektion. Die Vertreibung hatte in ihr tiefe Spuren hinterlassen, die sie verbarg. Sie blieb aber zeitlebens eine Suchende, die weder physisch noch vom Gemüt her eine Heimat fand. Unseren Kulturpreis erhielt sie auf Vorschlag unseres Landsmannes, des Egerer Verlegers Herbert Fleißner. Obwohl sie wegen Dreharbeiten in Übersee die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen konnte, hielten wir einen freundlichen Kontakt. Ich schrieb ihr zu ihren Geburtstagen, und sie antwortete handschriftlich und herzlich. Wir werden diese große Tochter unserer Volksgruppe in bester Erinnerung behalten.“
Der Schriftsteller Bernhard Setzwein las im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof in München aus „Kafkas Reise durch die Bucklige Welt“. Im neuen Buch des SLKulturpreisträgers 2013 täuschte Kafka seinen Tod nur vor und reist munter von Südtirol durch Österreich nach Bayern. Bei der Lesung moderierte Peter Becher, der Vorsitzende des AdalbertStifter-Vereins. Der Münchener Musiker Michel Watzinger umrahmte die Lesung in dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in München-Giesing, das seit 2004 als Kulturzentrum und Begegnungsstätte dient.
Wir haben schon viele gemeinsame bayrisch-böhmische Abenteuer erlebt“, sagt Peter Becher im Giesinger Kulturbahnhof über Bernhard Setzwein. Der Literaturwissenschaftler stellt seinen dichtenden Kollegen und Freund vor.
Am Vortag des 100. Todestages
Setzwein wurde 1960 in München geboren und studierte Germanistik. 1990 zog er in die Oberpfalz, er lebt heute in Waldmünchen und München. Setzwein ist Autor von Lyrikbänden, Essays, Reisefeuilletons und Romanen. Außerdem verfaßte er Theaterstücke und Radio-Features. Oft befassen sich seine Werke mit dem mitteleuropäischen Kulturraum. „Und sein jüngstes Werk widmet sich Franz Kafka, dessen Todestag sich morgen zum 100. Mal jährt“, beendet Becher seine biographische Einführung.
Kafka kommt nach Giesing

Beide unterhalten sich dann über Setzweins „Kafkas Reise durch die bucklige Welt“. In diesem neuen Roman des SL-Kulturpreisträgers des Jahres 2013 starb Kafka nicht vor 100 Jahren in einem Sanatorium. Vielmehr führt er in den Nachkriegsjahren ein ruhiges Leben in Meran. Von dort begibt er sich sich auf eine aufregende Fahrt durch Südtirol und Österreich bis nach München. Auf seinem Trip begegnet er vielen Persönlichkeiten aus seinem Leben, vor allem Schriftstellern und Künstlern.

Am 3. Juni jährte sich zum 100. Mal der Todestag von Franz Kafka. Aus diesem Anlaß erscheinen viele neue Kafkastudien und -ausgaben. Mit Kafkas letzten Lebensmonaten beschäftigen sich die Studie „Anders leben“ von Kafka-Biograph Dieter Kamping und „Die Herrlichkeit des Lebens“, ein Roman des Schriftstellers Michael Kumpfmüller, der auch kongenial verfilmt wurde.

Setzwein liest daraus ausgewählte und leicht gekürzte Passagen, zunächst einige Seiten nach dem ersten Satz dieses Buches: „Nun hatte es sich der Doktor, immerhin war er schon 78 Jahre alt, doch noch so einzurichten gewußt, daß er sagen
Als Franz Kafka am 3. Juli 1923 vierzig Jahre alt wird, hat er noch elf Monate zu leben. Im Angesicht des Todes gelingt es Kafka überraschend, sein Leben radikal zu ändern. Zum ersten Mal nimmt er seinen Wohnsitz außerhalb Prags, und zwar in Berlin-Zehlendorf. Zum ersten Mal lebt der Dichter mit einer Frau zusammen, und zwar mit der zionistischen Aktivistin Dora Diamant, die er im Urlaub an der Ostsee kennenlernte. Das Paar verlebt einige kostbare Monate gemeinsam in Berlin, wo sich Kafka, wegen seiner Tuberkulose früh pensioniert, nun endlich ganz dem Schreiben widmen kann. So stellt der Kafkaexperte Dieter Lamping („Kafka und die Folgen“, Stuttgart 2017) diese Situation dar. Lamping zeichnet mit zahlreichen Originalzitaten und mit Grafiken von Simone Frieling
konnte: ,Das Leben ist unproblematisch.‘“ Kafka ist in dem „liebenswerten Südtiroler Kleinstädtchen ... untergetaucht“ und arbeitet als Kinokartenkontrolleur. Gleich danach erleben die Zuhörer Kafkas erste Begegnung mit seinem späteren Reisecompagnon. Der polnische Schriftsteller Marek Hłasko läuft –oder fällt – dem „Doktor“, also Kafka, in Meran über den Weg, denn Hłasko wird aus einem Hotel herausgeworfen. Die beiden gehen einen Espresso trinken. Dazu erklingen überraschend passende Zitherklänge. Michel Watzinger gestaltet während der Lesung eine kongeniale musikalische Begleitung mit Zither oder mit dem großen Hackbrett. Er spielt mal Klezmermusik, mal eine Vivaldi-Sonate. Dabei mischt sich seine Saitenstimme oft direkt in die Lesung ein. Sie untermalt, ergänzt und kommentiert mit oft surrealistischen Klängen.
Nachdem „Franciszek“ Kafka und Marek Hłasko mit einem
„geborgten“ Oldtimer, einem Fiat Ollearo, über den Jaufenpaß geschlingert sind, besuchen sie einen Eisenwarenhersteller mit Frau in Graz, die Kafka in Meran kennenlernte. Das Ehepaar Fackler lebt unter dem Grazer Schloßberg, wo es sich quasi versteckt, wie zuvor viele Menschen bei Bombenangriffen. Diesen Schauplatz des Romans habe er als Autor bei der Recherche besucht, wie auch die meisten anderen Örtlichkeiten, erläutert Setzwein. Alles sei detailliert nachzulesen in seinem Blog.
Größen der Literatur
Facklers Enkelin Philomenia, der die beiden Dichter im Schanigarten eines urigen Grazer Beisls bei Bier und Burenwurst gerade begegnet sind, wird sie von nun an begleiten. Sie entpuppt sich als eine Art Vorläuferin von Ingeborg Bachmann, wie Setzwein erläutert. Weitere Größen der Literatur werden Kafka im Buch noch über den Weg laufen.
Kafkas letztes Jahr
Nun geht es zu dritt weiter in die bucklige Welt, eine Region im südlichen Niederösterreich, wo das Trio weitere Erlebnisse hat. Zuerst ist das die Begegnung mit der „Weltmaschin“ von Franz Gsellmann im Weiler Kaag nahe Edelsbach. Bei Gsellmann machen die beiden Protagonisten kurz Halt und lassen sich die Weltmaschine, die es wirklich gibt und die von österreichischen Schriftstellern wie Alfred Kolleritsch und Gerhard Roth bekannt gemacht wurde, einmal live vorführen.
Hier beeindruckt die musikalische Aufführung der Komposition „Jennerwein“ des beliebten Komponisten Florian Burgmayr. Michel Watzinger begeistert mit dem Stück an seinem Hackbrett, das die Lesung untermalt. Im Buch startet Gsellmann seine „Maschin“, was zu einem Kurzschluß und Blackout führt. „Danach war alles in ein endgültiges Schwarz getaucht“, liest Setzwein, und so erlischt plötzlich komplett das Licht im Kulturbahnhof Giesing. Die Gäste im
dichtgedrängten Vortragsraum sind überrascht und begeistert und applaudieren der perfekt inszenierten Vorführung. Bald wird es jedoch wieder hell, und die Reise geht weiter bis zur Station in Wien. Dort trifft Kafka H. C. „Hazeh“ Artmann, mit dem er in den Strohkoffer geht, einen Künstlertreffpunkt. Eine rasende Motorradfahrt schließt sich an, bei der Artmann Kafka auf der Puch zu einem Würstelstand mit seinen Spezialitäten entführt. Dies wird die „schönste Nacht in Kafkas Leben“, liest Setzwein. Am nächsten Morgen starten die Reisenden im Fiat Ollearo über Klosterneuburg und vorbei am Privatsanatorium Kierling –der Ort von Kafkas im Buch nur vorgetäuschtem Tod – in Richtung München. Hier geht es noch einmal hoch her: Hłasko wird nach einem öffentlichen Auftritt mit einer unzüchtigen Lesung im Alten Botanischen Garten verhaftet und wohl in der Psychiatrischen Klinik in München-Haar landen. Und Kafka? „Er würde sich nun unter die Passanten mischen“, liest Setzwein in einer letzten Passage. Kafka verliere sich in der Stadtwelt, schließt der Autor seine Lesung. Mit Peter Becher unterhält er sich noch kurz über den hintergründig-humorvollen Text seines Buches, das auf verschiedenen Zeitebenen spielt, und beginnt dann, den Gästen ihre Bücher zu signieren. Susanne Habel
Setzweins Blog: kafka2024. de/blog/bernhard-setzweinrasantes-roadmovie-mit-kafkaals-beifahrer

Bernhard Setzwein: „Kafkas Reise durch die bucklige Welt“. Lichtung Verlag, Viechtach 2024; 304 Seiten, 25 Euro. (ISBN 978-3-941306-64-6)

sachlich ein Portrait des Ausnahmeschriftstellers und seiner letzten Liebe. In dieser Zeit, so schrieb einst Max Brod, habe er
seinen Freund „wahrhaft glücklich gesehen“ . Auch Michael Kumpfmüller beschäftigt sich mit dieser Zeit

Michael Kumpfmüller: „ Die Herrlichkeit des Lebens“. Kiepenheuer-und-Witsch-Verlag, Köln 2011; 239 Seiten, 18,99 Euro. (ISBN 978346204-326-6)
im Leben Kafkas. Im Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“ wirft er ein helles, fast heiteres Licht auf den berühmten Dichter und zeichnet liebevoll und diskret einen Menschen, der in seinem letzten Jahr die große Liebe findet und sein Leben in die Hand nimmt, um es nur einmal auszukosten. Im Sommer 1923 lernt der tuberkulosekranke Franz Kafka – als Dichter nur Eingeweihten bekannt – in einem Ostseebad die 25jährige Köchin Dora Diamant kennen. Und innerhalb weniger Wochen tut er, was er nicht für möglich gehalten hat. Er entscheidet sich für das Zusammenleben mit einer Frau, teilt Tisch und Bett mit Dora. In Berlin wagt er mit ihr das gemeinsame Leben, mitten in der Hyperinflation der Weimarer Republik. Das Buch wurde vom Regie-Duo Georg Maas und Judith Kaufmann mit dem großartigen Sabin Tambrea – der 1984 in Siebenbürgen zur Welt kam – als Franz Kafka und Henriette Confurius als Dora Diamant verfilmt und startete bundesweit im März in den Kinos. Der berührende und berückende Film ist derzeit immer noch in vielen Kinos zu sehen und auf DVD erhältlich. Susanne Habel �

Ewa Partum: „Change: My Problem Is a Problem of a Woman“ (1974/1979). Fotografien und Plakat zur Performance. Bilder: Uwe Moosburger, www.altrostudio.de
Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) zeigt derzeit „ewa partum. Lovis-Corinth-Preis 2024“, eine Ausstellung mit Werken der polnischen Künstlerin Ewa Partum. Ihr künstlerischer Beitrag ist wegweisend sowohl für die Konzeptkunst als auch für die feministische Kunst. Das KOG ist das erste Museum in Deutschland, das Partums Schaffen eine Einzelausstellung widmet.
Die Ausstellung „ewa partum. Lovis-Corinth-Preis 2024“ ist Ewa Partums erste Solopräsentation in einem deutschen Museum. Seit den 1960er Jahren war Partum Vorreiterin der Konzeptkunst im sozialistischen Polen und prägte die feministische Kunst international. Bereits bevor sie 1982 nach Deutschland emigrierte, vernetzte sie sich über den Eisernen Vorhang hinweg mit Kolleginnen und Kollegen. Mit ihren Performances und Aktionen setzte sich Partum für die Freiheit im gesellschaftlichen wie im politischen Sinne ein. Den Fokus legt sie von Beginn an auf die Stellung der Frau und die Gleichberechtigung von Künstlerinnen.
Der eigene Körper ist meist unbekleidet
Bereits während ihres Studiums wandte sich Ewa Partum –geboren 1945 in Grodzisk Mazowiecki bei Warschau in Masowien – von der Malerei ab. Während ihrer ersten Performance im öffentlichen Raum 1965 nutzte sie die Leinwand nicht zum Malen, sondern legte sich darauf und zeichnete die
� Im Kunstforum Ostdeutsche Galerie: Lovis-Corinth-Preis 2024

„Ost-West Schatten“ (1984). Sammlung der Künstlerin. Courtesy Ewa Partum © VG Bild-Kunst, Bonn 2024. Installationsansichten der Ausstellung „ewa partum. Lovis-CorinthPreis2024“. KOG Regensburg 2024.
Einzelschau von Ewa Partum
Kontur ihres Körpers nach. Der eigene Körper, meist unbekleidet, wurde bei späteren Aktionen und Performances zu ihrem eigentlichen Ausdrucksmittel. Sie deklarierte ihn zum Kunstwerk.
In der Volksrepublik Polen war die Performance- und Konzeptkunst als Alternative zum staatlich vorgeschriebenen sozialistischen Realismus unbekannt. Insbesondere seitens offizieller Stellen blieben Partums konzeptuelle Ansätze oft unverstanden. So wurde sie von der Zensur nicht wesentlich behindert, obwohl sie sich durchaus systemkritisch äußerte. „Ihre Installation ,The Legality of Space‘, die sie 1971 just am Platz der Freiheit in Lodsch verortete, wurde nicht nur stehengelassen, sondern von der Polizei bewacht – als eine Ausstellung von Verkehrsschildern,“ erklärt Direktorin Agnes Tieze, die Partums Ausstellung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie kuratierte.
Die Verbotsschilder hatte sich Partum von der Stadt ausgeliehen und ergänzte sie durch selbstgemachte Transparente mit absurden Slogans wie „Verbieten verboten“. Den Passanten entging die Botschaft allerdings nicht. Partum hatte das Bestreben des Regimes nach absoluter Kontrolle ins Lächerliche gezogen.

„Letters to Milena, Franz Kafka“ (2019). Generali Foundation Collection. Permanente Leihgabe für das Museumw der Moderne Salzburg.
� Lovis-Corinth-Preis im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg an Ewa Partum
Im Jahr 1972 gründete Ewa Partum die Galeria Adres als Plattform, die insbesondere zum Austausch mit anderen Kunstschaffenden diente. Der Name der Galerie – „Adresse“ –verweist auf die „Mail Art“. Der Kontakt per Post war lange Zeit die einzige Möglichkeit, sich auch über den Eisernen Vorhang hinweg zu vernetzen und sich gegenseitig Werke oder Werkdokumentationen zuzusenden und diese dann zu präsentieren. Ihre Galerie, die sie zwischenzeitig wegen der Zensur in ihre Privatwohnung verlegen mußte, nutzte Ewa Partum sowie weitere ähnliche Workshopräume auch für eigene Aktionen und Performances.
Kriegsrecht in Polen 1981
Einen Einschnitt brachte die Verhängung des Kriegsrechts in Polen Ende 1981. Die kommunistischen Machthaber reagierten auf den Widerstand der Bevölkerung und das Streben nach Demokratisierung, die von der Gewerkschaft Solidarność ausgingen. Die Staatsleitung übernahm der Militärrat, Armee und Polizei kontrollierten das Land.
Die Künstler, die die demokratische Bewegung unterstützten, gerieten in die Illegalität. Ewa Partum widmete der Gewerkschaft 1982 die eige-
ne Performance „Hommage à Solidarność“. Ansonsten zog sie sich aber in die innere Emigration zurück.
Nach mehreren Anläufen gelang es ihr 1982, nach West-Berlin zu emigrieren, wo sie seither lebt und arbeitet. In Deutschland knüpfte Ewa Partum an ihre Arbeit an. Sie wiederholte frühere Performances, entwarf aber auch neue und beteiligte sich an Ausstellungen.
Die Regensburger Präsentation versammelt Kunstwerke sowie Objekte, die Partum während ihrer Performances verwendete, Fotomaterial und Filme und macht Partums Schaffen seit den 1960er Jahren bis heute erlebbar.
Touch of a Woman
„Ich habe schon 1971 versucht, in meiner Kunst weibliche Akzente zu setzen,“ betont Ewa Partum im Interview, das im Ausstellungskatalog abgedruckt ist. „My touch is a touch of a woman“, steht auf einem Blatt in Schreibmaschinenlettern. Darüber hat die Künstlerin einen Lippenstiftabdruck gesetzt. Die Arbeit von 1971 gehört zu einer Serie, die sie „poem by ewa“ nannte. Seit Mitte der 1970er Jahre bezeichnet sich Ewa Partum bewußt als feministische Künstlerin.
Bis Sonntag, 8. September: „ewa partum. Lovis-Corinth-Preis 2024“ in Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Straße 5. Dienstag bis Sonntag 10.00–17.00, Donnerstag bis 20.00, an Feiertagen bis 17.00 Uhr. 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.
Eine vierte Preisträgerin in einem halben Jahrhundert
Im Mai eröffnete das Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) die Ausstellung „ewa partum. Lovis-Corinth-Preis 2024“. Die feierliche Überreichung des Lovis-Corinth-Preises an Ewa Partum war Teil der Vernissage. Die polnische Konzept- und Performancekünstlerin ist die vierte Frau in der 50jährigen Geschichte des Preises, deren Lebenswerk mit der Auszeichnung geehrt wird. Ihren Dank sprach die Künstlerin mit einer Aktion aus. Vom Balkon des Kuppelsaals ließ sie die einzelnen Buchstaben des Satzes herunterrieseln und verteilte sie an die Gäste.
Danke, danke, danke für den Lovis-Corinth-Preis 2024“ –während Ewa Partum ihre Dankesworte sprach, streute sie die einzelnen Buchstaben des Satzes vom Umgang des Foyers in die Publikumsreihen. Diejenigen, die sie aufsammeln konnten, durften die signierten Lettern auch als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Großbuchstaben aus weißem Karton sind bezeichnend für Partums Kunst. Seit den 1970er Jahren verwendet sie die im damals sozialistischen Polen von Propaganda-Slogans wohlbe-
kannten Normbuchstaben in ihren Performances. Die Idee war, sie ihrem eigentlichen Zweck zu entfremden und durch das Zerstreuen verschwinden lassen. Bereits Mitte der 1970er Jahre bezeichnete sich Ewa Partum als feministische Künstlerin. Die fehlende Gleichberechtigung von Frauen und insbesondere von Künstlerinnen griff sie immer wieder in ihren Performances und Aktionen auf. Den eigenen Körper – meist nackt –machte sie dabei zum Instrument ihrer Kunst und deklarierte ihn als Kunstwerk. Sie ist nach Katharina Sieverding, Mechthild Frisch und Magdalena Jetelová die vierte Frau, die den Preis erhielt. „Ewa Partum hat es längst bis in die Dauerausstellungen führen-

Verleihung des Lovis-Corinth-Preises Mitte Mai im Kunstforum Ostdeutsche Galerie: Ewa Partum, Laudator Adam Budak, bis vor kurzem künstlerischer Direktor der Nationalgalerie in Prag und jetzt Direktor der Kestner-Gesellschaft in Hannover sowie eines der Jurymitglieder, und Direktorin Dr. Agnes Tieze, ebenfalls Mitglied der Jury. Foto: Uwe Moosburger, www.altrofoto.de
der Museen weltweit geschafft. Ihre Werke sind im MOMA in New York, in der Tate Modern in London, im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in
Madrid, oder in der Neuen Nationalgalerie in Berlin zu finden,“ zählte die Regensburger Bürgermeisterin Astrid Freudenstein in ihrer Begrüßung auf. Das Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie ist jedoch das erste deutsche Museum, das Ewa Partum eine Solopräsentation widmet. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die eine Videobotschaft für den feierlichen Anlaß geliefert hatte, hob die Fotoarbeit „Ost-West Schatten“ aus dem Jahr 1984 hervor. Partum steht darin nackt vor der Berliner Mauer mit den beiden Buchstaben O und W für Ost und West, damals durch den Eisernen Vorhang scheinbar unüberwindbar voneinander getrennt. Roth betonte, daß die Trennung zwar aufgelöst sei, doch sei dieser Zustand keineswegs selbstverständlich.
„Es ist und bleibt eine DauerAufgabe der Politik, das gegenseitige Verständnis zu stärken und das Bewußtsein für ein ge-
meinsames Kulturerbe in Europa wachzuhalten.“ Die Laudatio hielt Adam Budak, Direktor der Kestner Gesellschaft in Hannover und eines der Jury-Mitglieder des Lovis-Corinth-Preises 2024. Partums Kunst verfolgt er bereits lange und ist der Künstlerin auch freundschaftlich verbunden. Ihr Schaffen bezeichnete er als Akt von Selbstbewußtsein, von Selbstinszenierung, aber auch Selbstidentifikation, als Biografie, als Selbstbildnis mit konzeptueller Pose und feministischer Genderthematik. Nach der Preisverleihung gab Agnes Tieze, Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie und Kuratorin der Ausstellung, einen Einblick in die Regensburger Hommage an Ewa Partums Werk. Die Ausstellung im KOG gebe einen Rückblick auf das Schaffen der Künstlerin seit den 1960er Jahren bis heute. „Zu sehen sind Exponate, die im Rahmen ihrer Performances im öffentlichen Raum in Polen und in Berlin entstanden sind: Fotografien, Filme und Installationen.“ Die Ausstellung entstand in Kooperation mit Ewa Partum, Berenika Partum und der Galerie Mathias Güntner in Berlin und Hamburg.

An Fronleichnam fand im bayerisch-schwäbischen Königsbrunn eine Maiandacht in der Stadtpfarrkirche Sankt Ulrich für Vertriebene in und um Augsburg statt. Organisatoren waren Hella Gerber, Augsburger Stadträtin, Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes Augsburg-Stadt und Vorsitzende des Kreisverbandes Augsburg der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Kurt Aue, Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Augsburger Land und Obmann der SL-Kreisgruppe Augsburger Land. Gut gefüllt war die Kirche, als Pfarrer Bernd Leumann die Fahnenabordnungen in das Gotteshaus führte. Hella Gerber begrüßte auch im Namen von Kurt Aue die zahlreichen Gläubigen, unter ihnen der Augsburger Stadtrat Max Weinkamm, Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, Leo Schön, Vizevorsitzender des BdV-Kreisverbandes Augsburger Land, Altstadtrat Heinrich Bachmann in Egerländer Tracht, Dr. Volker Ullrich MdB, Helga Aue, Schriftführerin der SL-Kreisgruppe, Walter Eichler, Archivar der SL-Kreisgruppe, Stellvertretende SL-Kreis- und Ortsobfrau Christa Eichler, Gisela Thiel, Obfrau der SL-Kreisgruppe Augsburg-Stadt, UdV-Bezirksobmann Michael Kuntzer, Anita Donderer von der Neudeker Heimatgruppe Glück Auf, Altbürgermeister Ludwig Fröhlich, Stadträtin Hildegard Fröhlich und Altstadtrat Erwin Gruber. Die Königsbrunner Bläsergruppe, der Chor der Banater Schwaben unter Anika Oster und der Organist Sebastian Maurer begleiteten die Andacht musikalisch. Bild: Peter Bergmann
� SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach/Mittelfranken
Bei der fünften Maiandacht der mittelfränkischen SL-Kreisgruppe Roth-Schwabach am Vertriebenendenkmal im Schwabacher Stadtteil Vogelherd gestaltete Kaplan Sebastian Stanclik den spirituellen Teil.
Die Vertriebenenorganisation bedankt sich mit dieser Andacht alljährlich für den Gedenkstein und die beiden Apfelbäume, die zwei CSU-Landtagsabgeordnete und die Stadt Schwabach zur Erinnerung an das Durchgangslager im Vogel-
herd neben dem Areal platzierten, das ab 1946 erste Anlaufstation für rund 50 000 Vertriebene aus dem Osten, vor allem aus dem Sudetenland, gewesen war. Zur Andacht waren gut 50 Frauen und Männer aus dem Kreis der Vertriebenenorganisationen sowie Einheimische gekommen. Der Volkschor Schwabach steuerte geistliche Lieder bei. Oberbürgermeister Peter Reiß und Landtagsabgeordneter Karl Freller waren ebenfalls zu Gast. Beide betonten in ihren Gruß-

Heller.
� SL-Bezirksgruppe Oberfranken/Bayern
Mitte Mai feierte Monsignore Herbert Hautmann, der Vertriebenenbeauftragte der Diözese Bamberg, eine Maiandacht in seiner Taufkirche in Eger.
Monsignore Herbert Hautmann wurde vor 90 Jahren und seine Schwester Magdalena Dersch vor 89 Jahren in der Egerer Sankt-Nikolaus-Kirche getauft. Damals waren sie tschechoslowakische Bürger mit deutscher Muttersprache. Nach dem Münchener Abkommen kam das Sudetenland zum Deutschen Reich. 1939 annektierten die Nationalsozialisten die sogenannte Resttschechei. 1946 vertrieben
worten die Bedeutung eines geeinten Europa für Frieden und Freiheit auf dem Kontinent und riefen dazu auf, an der Europawahl am 9. Juni teilzunehmen. Freller warnte dabei vor jeder Form von Extremismus. „Das führt ausschließlich zu Gewalt“, so der CSU-Politiker. Reiß betonte, daß man in einem geeinten Europa gemeinsam eine gute Zukunft gestalten könne.

Dieter Heller ist Obmann der SL-Kreisgruppe. Der 86jährige kennt das ehemalige Lager am Vogelherd aus eigener Erfahrung. Nach seiner Vertreibung war er dort 1946 eine Woche lang untergebracht worden. Er dankte Karl Freller, seinem Rother Landtagskollegen Volker Bauer und Peter Reiß als Vertreter der Stadt Schwabach für den würdevollen Gedenkort. Zugleich erinnerte er an die 1954
entstandene Kirche im Vogelherd, die für die dort ansässig gewordenen Heimatvertriebenen ein wichtiger Ort der Begegnung gewesen sei. 2015 ist sie stillgelegt und entweiht worden. Ihre vier Glocken aber tun weiter ihren Dienst. Sie fanden in der Barockkirche Sankt Peter und Paul im nordböhmischen Leitmeritz ein neues Zuhause. Die Kirchengemeinde hatte ihr Gotteshaus aufwendig instandgesetzt. Für neue Glocken aber fehlte das Geld. „So wurde die Spende aus dem Vogelherd als großartiges Geschenk freudig aufgenommen“, schilderte Heller die grenzüberschreitende katholische Kooperation. Die Glokken begleiten die Menschen also nach wie vor in Freud und Leid. Sie erklingen bei Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen und rufen zu Gottesdiensten. Der Gedenkstein im Vogelherd wurde 2018 errichtet. 2019 fand die Maiandacht erstmals statt. Während Corona fiel sie einmal aus. „Sie ist eine feste Einrichtung geworden und wird es hoffentlich auch bleiben“, so Dieter Heller. Nach der Maiandacht gab es Karlsbader Oblaten, und alle blieben noch, um sich gemütlich zu unterhalten. Dies freute die Veranstalter. Natürlich gab es auch eine Kollekte für das Schwabacher Katholische Pfarramt Sankt Sebald.
� SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld/Sachsen-Anhalt Ganz in Weiß
Mitte Mai feierte die sachsenanhaltinische SL-Kreisgruppe Anhalt-Bitterfeld Muttertag. Eine Tradition, die sich aus der Heimat bis in die heutige Zeit erhalten hat.
Auch wenn es in der DDR nicht möglich war, öffentlich im Kreise der Vertriebenen diesen Tag zu begehen, so traf man sich doch heimlich, um die Mütter zu feiern. Das änderte sich nach der Wende und mit der Gründung der SL in Bitterfeld. Seitdem begehen wir diesen Tag alljährlich öffentlich. Auch heuer. Kreisobfrau Anni Wischner begrüßte trotz voranschreitenden Alters und Krankheit doch eine ganze Reihe von Mitgliedern, die wieder den Weg ins Musikhotel Goldener Spatz nach Jeßnitz gefunden hatten. Nach der Begrüßung gab es wieder viel zu erzählen. Anschließend trug Anni Wischner dann einige Muttertagsgeschichten vor wie „Mutter der Vertriebenen“. Sogar im heimatlichen Dialekt wurde ein Gedicht vorgetragen. Es war wieder eine schöne Atmosphäre, in der auch Geburtstagskinder und treue Mitglieder geehrt wurden. Nach all diesen schönen Momenten wur-
den Erdbeertorte und Kaffee gereicht, was diesen ersten Teil des Muttertages abrundete. Die Große Muttertagsgala stand unter dem Motto „Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß“, vorgetragen und moderiert von Angela Novotny. Sie und ihr Sohn Florian boten ein wunderbares musikalisches Programm, in dem auch das Personal mit Franzi und Analena, einer Ukrainerin, eingebunden war. Schlager aus vergangenen Zeiten bis hin zu den aktuellen Hits wurden ebenso dargeboten wie die schönsten Lieder in Erinnerung an Roy Black. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack der älteren Gäste.
Ganz in weiß stellte sich dann Franzi in ihrem Hochzeitskleid vor und brachte mit Florian Tanzeinlagen. Auch Analena sang Solo und später mit Florian im Duett einige Lieder. Das Programm endete mit dem Mutter-undSohn-Duett und dem Lied „Das wird immer so bleiben“. Das war wieder eine gelungene Muttertagsfeier. Ein Dankeschön gilt Kreisobfrau Anni Wischner für die Organisation und dem Team vom Goldenen Spatz für die gastronomische und kulturelle Betreuung. Klaus Arendt

� SL-Kreisgruppe Augsburger Land/Bayerisch-Schwaben Von Feier zu Feier
Die bayerisch-schwäbische SLOrtsgruppe Wehringen beging im Wehringer Fischerheim Mutter- und Vatertag. Eine Woche später besuchte sie mit der SL-Kreisgruppe Augsburger Land den Sudetendeutschen Tag.

Bdie Tschechen die Familie Hautmann mit ihren fünf Kindern aus ihrer böhmischen Heimat. Noch vor der Vertreibung hatten tschechische Finanzbeamte Hautmann dreimal beim Paschen, hochdeutsch Schmuggeln, von Familieneigentumg erwischt und übel zugerichtet. Und nun, fast 80 Jahre später, feierte Herbert Hautmann mit Landsleuten aus Oberfranken, darunter ehemalige Pfarrkinder aus Hof und Naila, sowie Verwandten in seiner Heimat Maiandacht. Mit dem zuständigen Egerer Pfarrer Libor Buček hatte er per Telefon sofort Freundschaft geschlos-
sen. Er lud Buček zu sich nach Gößweinstein ein und hofft auf einen baldigen Besuch, um ihm die schöne Basilika von Balthasar Neumann zeigen zu können.

Leider konnten sie in Eger nicht persönlich zusammentreffen, da Pfarrer Buček in Sandau Gottesdienst feiern mußte. Die Maiandacht verlief traditionell. Die Orgel spielte Heinz Hahn aus Schwarzenbach an der Saale. Es wurde lateinisch und deutsch gesungen. Alle waren angetan von der Feierlichkeit des Gottesdienstes. Hinten standen einige Gäste mit Kindern. Andachtsvoll schauten sie zu und erfreuten sich an den Liedern. Die Maiandacht war allen, auch Monsignore Hautmann und seiner Familie, zu Herzen gegangen. al
ei Kaffee und Kuchen sowie Mundartgeschichten, vorgetragen von Mundartdichter Leo Schön, trafen sich auf Einladung von Kurt Aue, Obmann der SL-Kreisgruppe Augsburg-Land und Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Augsburger Land, zahlreiche Mütter, aber auch ein paar Väter. Aue brachte eine besinnliche Rede zum Muttertag, in der er besonders auf das Leid der Mütter bei der Vertreibung einging, zu Gehör. Im Rahmen der
Zusammenkunft galt es jedoch nicht nur die Mütter und die Väter zu ehren. Die Stellvertretende Kreisobfrau Christa Eichler zeichnete Walter Vocadlo für 60 und Kriemhilde Bergmann für zehn Jahre Treue zur SL mit Ehrenurkunden aus. Am Pfingssonntag zogen Ortsund Kreisgruppe mit ihrer Fahne, die Herbert Kinzel trug, in Augsburg zur Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tages mit Ministerpräsident Markus Söder ein. Kreisobmann Kurt Aue, gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der SL-Landesgruppe, Dr. Volker Ullrich MdB und Andreas Jäckel MdL, Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes Schwaben, waren auch dabei. Helga Aue


� Vortragsveranstaltung der SdJ
Geschichte der Gefühle
Peter Paul Polierer, Gymnasiallehrer und langjähriger Vorsitzender der Sudetendeutschen Jugend – Jugend für Mitteleuropa (SdJ), berichtet über die SdJ-Veranstaltung „Heimweh und Heimreise der Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen: Forschung und erlebnisorientierte Diskussion“ zu Pfingsten in Augsburg.
Viele kennen das ja, daß Geschichte nicht gerade das Lieblingsfach in der Schule ist oder war. Das mag an einer Lehrerin oder einem Lehrer liegen, die oder den man nicht mag, oder eben am Lehrplan selbst.
Zu viele Kriege, Jahreszahlen und Herrscher, die man auswendig lernen muß. Davon abgesehen, daß das so nicht das Wesen von gutem Geschichtsunterricht ist, da eben viel Vergleichendes, Sozial- und Mentalitätsgeschichte vorkommt oder vorkommen sollte. Allerdings offenbarte man uns am Sudetendeutschen Tag einen sehr sympathischen Blick auf die Vergangenheit und die Sichtweise der Sudetendeutschen.
Soňa Mikulová vom MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung stellte ihre Forschungen über „Heimweh und Heimatreisen der Sudetendeutschen und ihrer Nachkommen – Geschichte der Gefühle“ vor. Man hatte den wohl kleinsten Raum in der Messe Augsburg reserviert, deswegen platzte dieser mit mehr als 30 Zuhörerinnen und Zuhörern schier aus allen Nähten. Mikulová ist uns schon seit Jahren gut bekannt, da sie bereits öfters den Sudetendeutschen Tag besuchte und auch für ihre Forschungen nutzte. Die Einführung und Begrüßung erfolgten durch Mario Hierhager, Vorsitzender der SdJ, der selbst zum Thema interviewt worden war und als Psychotherapeut beruflich auch einiges beizutragen hatte.
Soňa Mikulová sagte eingangs, daß dies ihr allererster Vortrag vor nichtwissenschaftlichem Publikum und gleichfalls vom Thema Betroffenen sei. Dann stellte sie das Forschungsprojekt „Emotionale Integration der Sudetendeutschen im Nachkriegsdeutschland“ im Allgemeinen und ihr Projekt im Speziellen vor. Sie erläuterte die unterschiedlichen und oftmals widersprüchlichen Gefühle der Erlebnisgeneration wie Fremdheit einerseits, aber auch Dankbarkeit für die sichere Zuflucht andererseits. Genauso vielseitig wie die Gefühlslagen selbst sei auch der individuelle Umgang damit. Dies liege natürlich auch an ganz verschiedenen Herangehensweisen an sogenannte Heimatreisen.
� Zu Pfingsten in Augsburg
Bilder eines großen Treffens

Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Monika Žárská, Hochschullehrerin an der Karls-Universität für Übersetzungen vom Deutschen ins Tschechische, Irene Novak, langjährige Vorsitzende des Kulturvereins, Peter Sliwka, Mitglied der Bundesversammlung, Lieselotte Ulrich-Beck, ihr Bruder Reinfried Vogler, lanjähriger Präsident der Bundesversammlung, und Radek Novák, Nachfolger von Irene Novak.
Seien diese individuell oder in Form von organisierten Pauschalreisen unternommen worden, wer habe daran teilgenommen und welche Erwartungen habe man damit verbunden. Vor der Samtenen Revolution habe sich beispielsweise folgende absurde Situation ergeben: Vertriebene aus der DDR hätten relativ leicht in den sozialistischen Bruderstaat ČSSR reisen können, sich dort aber nicht als Sudetendeutsche outen dürfen. Für diejenigen, die in der Bundesrepublik gelebt hätten, sei es genau andersherum gewesen.
Nach der politischen Wende in Mittel- und Osteuropa habe sich natürlich wieder alles geändert, insbesondere weil nun viele Angehörige der Bekenntnis- und der Enkelgeneration an solchen Fahrten teilgenommen und wiederum ihre eigenen Sichtweisen und Gefühle eingebracht hätten.
Ziel der Forschung von Mikulová ist also, den Wandel der Zugehörigkeitsgefühle zu der alten Heimat zu erforschen. Hierbei spielen die Orte, die individuellen Erlebnisse, Erinnerungen und emotionale Prozesse die entscheidende Rolle. Die Gefühle der Vergangenheit sollen mit den heutigen verglichen werden. Das stellt somit einen Beitrag zur tschechischen und deutschen Sozialgeschichte dar. Noch ist die Forschung nicht abgeschlossen, weitere Interviews folgen und weitere Quellen werden noch ausgewertet.
Im Anschluß erfolgte eine Diskussion mit dem Publikum. Wie leider so oft in diesem Rahmen wurde gleich bei der ersten Wortmeldung ein Co-Referat gehalten, welches mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hatte. Durch gute Diskussionsleitung konnte aber die Kurve zum Vortrag von Soňa Mikulová wieder genommen werden, und es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion.
Viele Teilnehmer ganz unterschiedlicher Generationen berichteten sehr emotional über ihre Erlebnisse. Die Frage kam auf, was denn die Folge der Arbeit sein sollte. Mikulová zeigte sich sehr optimistisch, daß diese in Form eines Buches und nicht nur in Einzelaufsätzen publiziert werden würde. Hierbei kann die sudetendeutsche Volksgruppe einen großen Anteil leisten, wenn dieses dann über sämtliche Kanäle auch beworben wird. Die Sudetendeutsche Jugend – Jugend für Mitteleuropa freut sich schon sehr auf das endgültige Ergebnis und auch darauf, daß sie Soňa Mikulová wieder am Sudetendeutschen Tag in ihren Reihen begrüßen darf, sehr gern auch in der gemeinsamen Heimat Böhmen und Mähren.

Sie trafen sich schon vor 50 Jahren in der SdJ: Michael Käsbauer, vielfach begabter Kulturschaffender aus der früheren SdJ Niederbayern/Oberpfalz, Hans Knapek, Vorstandsvorsitzender der Stiftung SSBW, seine Frau Karen und Helmut Bungart, ehemaliger Bundesschatzmeister der SdJ.

Brigitta Schweigl-Braun von den Böhmerwäldlern in Heidelberg, Dr. Gernot Peter, Leiter des Böhmerwaldmuseums in Wien, und Monsignore Karl Wuchter, langjähriger Leiter des Sudetendeutschen Priesterwerks a. D.

Erhard Spacek, Heimatkreisbetreuer von Teplitz-Schönau, Helena Päßler, Ko-Vorsitzende der Seliger-Gemeinde, Hansjürgen Gartner, Träger des Großen Kulturpreises 2018, Wolftraud de Concini, neue Kulturpreisträgerin für Literatur, Joachim Lothar Gartner, Träger des Großen Kulturpreises 2018, und Wigbert Baumann, Heimatkreisbetreuer von Trautenau.

Von der Bildungsstätte Heiligenhof im unterfränkischen Bad Kissingen entsandt: Bildungsmanager Ulrich Rümenapp, Bildungsreferent Philipp Dippl und Studienleiter Gustav Binder. Bilder: Nadira Hurnaus

Holger Kruschina, Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks, mit Kolatsche beim Böhmischen Dorffest.

Dr. Andreas Wehrmeyer, Leiter des Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg, Eva Herrmann, neue Trägerin des Kulturpreises für darstellende und ausübende Kunst, SdZ-Kulturredakteurin Susanne Habel und Bundeskulturreferent Professor Dr. Ulf Broßmann.

Am Stand des Kulturverbandes Graslitz: Gisela Forster vom Heimatkreis Graslitz, Pia Eschbaumer, Gemeindebetreuerin von Karlsbad-Stadt, der rasende Erzgebirgsreporter Ulrich Möckel sowie aus Graslitz Jitka Marešová, die Deutschlehrerin Sonja Šimánková und der Geologe und Orgelspieler Dr. Peter Rojík.
Bilder eines großen Treffens


Karoline Baumgartner und Florian Baumgartner, Urenkel des aus Mährisch Schönberg stammenden Journalisten, Diplomaten und Politikers Hans „Johnny“ Klein, besuchen Lorenz Loserth, Träger des Kulturpreises für Volkstumspflege, am Stand des ebenfalls im Altvaterland liegenden Jägerndorf.


Patrik Daghed mit „Sudetendeutscher Zeitung“ und Leonhard Schmied, der männliche Teil des Wischauer Duos „Burgl und Hardl“, mit Akkordeon. Daghed kam in Schweden zur Welt und lebt in Hessen, wo er sich bei der SL engagiert. Seit 20 Jahren ist er beim Sudetendeuschen Tag Stammgast der Wischauer.

Richard Šulko alias Måla Richard an seinem Stand des Bundes der Deutschen in Böhmen. Mit Herzblut leben er und seine Großfamilie das Eghalandrische Erbe, die Mundart, die Bräuche, die Trachten, die Musik und die Kulinarik sowie den katholischen Glauben und tragen sie damit in die Zukunft.

und Bürgermeister von Wiesau, das 1946 ein Grenzdurchgangslager beherbergte, Andreas Schmalcz von der Heimatpflege, Roswitha Theissig, Günther Wytopil, Landschaftsbetreuer Adlergebirge, und Dr. Wolfgang Theissig, Vorstandsmitglied der SL-Landesgruppe Bayern und Obmann der oberbayerischen SL-Kreisgruppe Mühldorf.

Der Theologe, Priester und Kirchenhistoriker Professor Dr. Stefan Samerski und Milan Horáček, MdB a. D., MdEP a. D. und BdV-Präsidiumsmitglied.

Thomas Konhäuser, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, und der Bubenreuther Bügermeister Norbert Stumpf

Günther Wytopil, Landschaftsbetreuer Adlergebirge, und Jan Moravek, ehemaliger Stadtrat von Rokitnitz und jetziger Sekretär des Nationalen Pädagogischen Instituts der Tschechischen Republik.

Daniel Mielcarek, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Sudetendeutschen Museums, und David Heydenreich, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte bei der SL.

„Ade zur guten Nacht“: Nach dem gemeinsam gesungenen Schlußlied beim Böhmische Dorffest am Pfingstsamstag um 24.00 Uhr applaudieren der Böhmerwäldler Martin Januschko, Bundesversammlungspräsidentin Christa Naaß und Ex-SdJ-Vorsitzender Peter Polierer den Musikanten.


Stefan Geißler engagiert sich intensiv für das Projekt „Friedhofsrenovierung im Kreis Friedland“. Hier stellt er sein Projekt vor.
Grundsätze
Inmitten des schweigenden Gedenkens an Verstorbene ruht ein tief verwurzelter Grundsatz: Jeder Mensch hat das unantastbare Recht auf ein Grab, das in Würde und Frieden bewahrt wird. Diese einfache, aber grundlegende Wahrheit bildet das Fundament unserer menschlichen Verbundenheit und erinnert uns daran, daß selbst im Tod Respekt und Achtung geboten sind.
Die Vergangenheit ist nicht bloß ein ferner Schatten, der hinter uns liegt, sondern ein lebendiger Teil unserer Gegenwart und ein Wegweiser für unsere Zukunft. Indem wir die Geschichte verstehen und reflektieren, erlangen wir Einblick in unsere individuelle Identität und unseren Charakter. Die Kenntnis vergangener Ereignisse ermöglicht uns, die Entwicklungen einer Gesellschaft besser zu verstehen und die Wege, die wir als Individuen und als Gemeinschaft betreten, reflektierter zu wählen mit dem Kompaß für eine sozialorientierte und multiple, und damit resiliente sowie prosperierende Gesellschaft. Die noch auf tschechischem Boden befindlichen Gräber der ehemals deutschen Bewohner sind stumme Zeugen vergangener Tragödien. Sie bergen nicht nur die sterblichen Überreste, sondern auch die Identität und Würde derer, die die uns die alltäglich umgebende Leichtigkeit des Lebens mit harter, verschleißender, körperlicher Arbeit mühsam der Natur abgerungen haben. Der Erhalt ihrer Grabstätten und die Rückgabe ihrer Identität sind nicht nur Akte der Anerkennung ihrer Menschlichkeit, sondern auch Schritte auf dem Weg zur Versöhnung und Heilung von Wunden. Der Weg zu einem geeinten, friedvollen und gedeihenden Europa führt über die lebendige Anerkennung der Vergangenheit und den Dialog. Durch offenen Austausch und konstruktive Gespräche können Mißverständnisse abgebaut, Vorurteile überwunden und gemeinsame Werte und Ziele entwickelt werden. Der Dialog eröffnet uns die Möglichkeit, Brücken zu bauen und eine gemeinsame europäische Identität für eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, die von Respekt, Verständnis und Gemeinsamkeit geprägt ist.
Rekonstruktionen
� FriedlandReicenberger Zeitung

Nordböhmi [ e Um [ au
Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


Projekt Friedhofsrenovierung
sichtbarer und kommen so in den Horizont der gegenwärtigen Anwohner.
Vorteile
der geographischen Lage
In der aufwendigen Arbeit der Rekonstruktionen offenbart sich eine bewegende Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Im Sinne der Reflektion von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie durch
In der geographischen Peripherie ist im Detail das sichtbar, was im Großen internationale Geschichte ist. Hier sind Biographien und unternehmerische Entscheidungen explizit freigelegt. Als Beispiele seien erwähnt der Grabstein des Müllers von Weigsdorf, der in imposanter Größe und filigraner Gestaltung die Kolonialisierung von Südafrika bis in den Pazifik exem

das Auffinden von Familienangehörigen.
Mit akribischer, tendenziell archäologischer Präzision werden Grabungen durchgeführt und bauliche sowie künstlerische Rekonstruktionen vorgenommen, um den Bestatteten ihre Identität zurückzugeben. Jedes Grab wird dabei digitalisiert und mit einem Foto des Grabsteins sowie des vollständigen Grabes versehen.
Doch die Arbeit geht weit über das Visuelle hinaus. Durch intensive Archivarbeit und Recherchen werden zusätzliche Informationen zu den Verstorbenen, den ehemaligen Bewohnern gesammelt. Wohnadressen, Bilder ihrer Häuser, Berufe, Sitzplatzschilder in der Kirche sowie Details über Eltern und Kindern werden recherchiert und teilweise sogar mit Fotos publiziert. Es ist ein erfüllender Prozeß, die Menschen der Anonymität, dem Vergessen und der Herabwürdigung zu entreißen und ihre Biographien in eine soziale Tragweite der Zukunft zu überführen.
Diese Publikationen sind für jedermann und ortsungebunden im Internet einsehbar, sogar in Suchmaschinen. Durch die einfache Zugänglichkeit dieser Biographien und ihrer sozialen Kontexte, die zuvor nur Historikern vorbehalten waren, werden die ehemaligen Bewohner nahbarer,
In diesem Sinne besteht unser Projekt der Rekonstruktion der Gräber in den nordböhmischen Kreisen Friedland und Gablonz seit November. Seit Januar sind wir auch handwerklich aktiv, sogar als es zehn Grad Minus kalt war und Schnee lag. Bis Anfang März wurden mehr als 700 Gräber erfaßt und digitalisiert. An circa 50 Gräbern wurden Grabsteine und Portraits aus Porzellan teilweise ausgegraben, teilweise wieder aufgerichtet beziehungsweise die unkenntlichen Inschriften wieder lesbar gemacht. So wurden die Gräber wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt, und die bestatteten Bewohner von Engelsdorf, Wiese und Berzdorf erhielten ihre Identität zurück. Mehrere hundert Gräber wurden bereits oberflächlich und seitlich umgegraben und dabei weitere Grabtafeln geborgen. Ab dem Frühjahr 2024 sollen alle instabilen Gräber saniert und verwitterte oder abhanden gekommene Holzkreuze durch neue ersetzt werden. Holz und Schablonen zur Rekonstruktion der historischen Kreuze wurden bereits angeschafft. Gesucht sind willige Hände mit notwendigen Werkzeugen.
plarisch skizziert, sowie die Gräber, die auf der Suche nach Wasserkraft von der in die Landschaft eingreifenden Industrialisierung zeugen. Die Gegenwart kann dankbar sein für das strukturelle und kulturelle Laissezfaire der lokalen Bevölkerung, welches dazu führte, daß die Graeber der ehemaligen deutschen Bewohner noch heute vorhanden sind. Die Friedhöfe in geographischer Randlage haben den Vorteil, daß sie zum Teil die Zeit überdauerten und unreflektierte Handlungen überstanden. So mancher Friedhof ist bis heute in einem Dornröschenschlaf, in einem stillen Kokon abseits der Gesellschaft – ein sehr wertvoller vergessener Ort.
Die Nähe zu Deutschland verleiht diesen Orten ein erhöhtes Potential kultureller Tragweite. Sie können Touristen und Kulturinteressierte einladen, auf Entdeckungsreise zu gehen und die vielschichtige Geschichte dieser Region zu erkunden. Dies ist eine Einladung, die Schönheit und den Reichtum dieser Kultur und Naturlandschaft zu erkunden, die hier im Herzen Europas im Verborgenen schläft und erweckt werden möchte.
Anspruch
In jeder Situation liegt ein verborgener Schatz. So bieten die
erhaltenen Friedhöfe eine einzigartige Möglichkeit, den europäischen Gedanken vorausschauend zu fördern. Durch die kulturelle Integration dieses Gedankens in unsere Gesellschaft können wir reflektieren und ehrfürchtig über die vielfältige Geschichte Europas nachdenken. Es ist eine Mahnung, die reiche Vielfalt Europas als Chance zu begreifen. Die Geschichtswissenschaft hat längst erkannt, daß in Regionen mit vielfältigen und konkurrierenden Kulturen Kultur und Wirtschaft in besonderem Maße prosperieren. Nun sollte die Praxis nachziehen.
ten. Auf lokaler Ebene streben wir eine Belebung der Bevölkerung an und möchten das Engagement im lokalen Umfeld steigern. Teil dieser Belebung und Kulturintegration ist die Einbindung lokaler Schulen. Die Jugend ist flexibel und trägt maßgeblich zur Gestaltung der Zukunft und damit zum Wohlstand der Region bei. Wenn Denkmale akzeptiert, gepflegt und geschätzt werden und in Kultur und Wirtschaft integriert sind, werden sie erhalten bleiben und zu einem wertvollen Symbol europäischer, humanistischer Entwicklungskultur.

Die Gestaltung der Friedhöfe folgt einem hohen Anspruch, der das Bewußtsein für unsere Vergangenheit schärft. Dies geschieht durch eine gezielte Profilierung, die die Rekonstruktion der Gräber in verschiedene Kategorien unterteilt. Dabei geht es nicht nur um die Stabilisierung des Bauzustands oder die Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens, sondern vor allem darum, den Bestatteten ihre Identität zurückzugeben. Dieser ethische Anspruch spiegelt die Erkenntnis wider, daß Emotionalität ein Schlüssel für individuelle innere Balance, Verständigung, Reflexion und Fortschritt ist.
Möglich ist, daß die Rekonstruktion der Friedhöfe den Anfang einer umfassenden Revitalisierung der Region markiert. Dies schließt die bauliche Stabilisierung weiterer Denkmale, die Organisation von Kulturveranstaltungen und Maßnahmen zur Steigerung der Aufmerksamkeit ein. Ziel ist, die märchenhafte Landschaft und die reiche Kultur wieder ins Bewußtsein der Bevölkerung zu rücken. Ein praktisches Ziel besteht darin, Touristen, Ausflügler und Wochenendausflügler aus der Region und darüber hinaus anzulocken. Viele wissen nicht, welch faszinierende Natur und Kulturlandschaften sie bisher verpaß
Herausforderungen
Die Bewältigung von Verwitterung und Zerstörung ist eine der vordringlichsten Aufgaben, denen wir uns in diesem Projekt stellen müssen. Es erfordert ein behutsames Vorgehen, um die Spuren der Zeit zu beseitigen und die Grabstätten in ihrem Glanz wiederherzustellen. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozeß ist die Publikation der Grabdaten auf Plattformen wie findagrave.com, einem weltweiten genealogischen Portal. Diese Entscheidung basiert auf der Verfügbarkeit und dem langfristigen Bestand der Informationen sowie dem sekundären kommerziellen Interesse des Mutterunternehmens famalysearch.com, das die Nachhaltigkeit des Projekts gewährleistet. Die Arbeit am Grab ist eine Entdeckungsreise. Anfangs weiß man nie genau, was sich unter der Grasnarbe verbirgt, und jede Ausgrabung birgt die Spannung des unbekannten Abenteuers. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, um etwaige Fundstükke nicht zu beschädigen. Fortschrittliche Techniken werden angewendet, um die historischen Stätten zu kartographieren und zu dokumentieren, da in den Archiven oft keine Aufzeichnungen über die Lage und Besetzung der Gräber existieren.
Zu Beginn wird für einen Friedhof der entsprechende Lageplan der Gräber im Archiv gesucht. Auf diesem oder einem von uns angefertigten Lageplan werden die Gräber mit Bestatteten eingezeichnet, und jedes Grab erhält eine Signatur, um jeden Bestatteten in einem Register und auf dem Friedhof direkt finden zu können. Für jedes Grab werden Zustand, Ausgrabung und Rekonstruktion fotografisch festgehalten und auf findagrave.com zu der entsprechenden Grablage publiziert. Eine besondere Herausforderung besteht darin, die lokale Verwaltung und Bevölkerung einzubeziehen. Die Wahrnehmung der deutschen Gräber und Kultur in der Tschechischen Republik hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gewandelt. Die jüngere Generation zeigt zunehmendes Interesse an diesem Thema und engagiert sich bei der Restaurierung von Kirchen, Gräbern und Denkmalen. Durch kontinuierliche Kommunikation und enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Gemeinden streben wir eine umfassende Integration und Akzeptanz des Projekts an, um die kulturelle Bedeutung der Region zu betonen und auszubauen. Die Vertreibung der Deutschen Bevölkerung und Kultur ist in der Politik als Verbrechen anerkannt, die Gräber haben Bestandsschutz und die lokale Bevölkerung, mit der wir uns auf den Friedhöfen als Mittel des verbindenden Dialoges und der Recherche aktiv in Gespräche verwikkeln, bedauert ausnahmslos die vorhandene Zerstörung und oder die Okkupation der Gräber der ehemals deutschen Bewohner. Das Interesse der lokalen Bevölkerung steigert sich sogar in Begeisterung für das Thema der ehemals deutschen Bewohner, was sich in ihrem freizeitlichen Engagement ausdrückt, Kirchen, Gräber und Denkmale zu rekonstruieren. Abermals gesteigertes Engagement ist sichtbar, wenn ein Bürgermeister eine von ihm gefundene Münze mit dem Konterfei Kaiser Franz Josephs als Medaillon an der Halskette trägt. Manch einer ist skeptisch, aber diesem begegnen wir kommunikativ einladend und erklärend mit unserer Begeisterung für die landschaftliche und kulturelle Schönheit dieser Region. Um der Skepsis der Bevölkerung vorzubeugen und um uns auf das maximale Gelingen zu fokussieren, binden wir so kommunikativ und diplomatisch wie mögliche die lokale Verwaltung und Gemeinschaft ein. Das heißt, wir stehen in möglichst engem, wöchentlichem Kontakt mit den Bürgermeistern und Interessierten der Friedhofs oder denkmalbeherbergenden Gemeinden.
Epilog
Tauchen Sie ein in die Naturund Kulturlandschaft im Herzen Europas, die exemplarisch für die spannungsreiche Geschichte, das Potential und die Schönheit Europas steht und doch seit 80 Jahren im Dornröschenschlaf unentdeckt ist. Hier können Sie nicht nur staunen, sondern auch praktisch auf Entdeckungsreise gehen – natürlich unter fachkundiger Anleitung. Vergessen Sie dabei nicht, Ihre Handschuhe mitzubringen, denn jede Ausgrabung rettet ein Stück Kultur und gestaltet die Zukunft eines prosperierenden, multikulturellen Europas.
REICHENBERGER ZEITUNG

� Reichenberg
Kauft sich die Stadt ein Schloß?
Einer der größten Schandflekke von Reichenberg könnte bald verschwinden. Das Rathaus möchte das verfallene Schloß im Stadtzentrum erwerben. „Ich habe mir schon immer gewünscht, daß das Schloß in den Besitz der Stadt kommt“, sagte Oberbürgermeister Jaroslav Zámečník. Petra Laurin berichtet.
Den ursprünglichen einfachen Renaissancebau ließen die Brüder Christoph und Melchior von Redern bereits in den Jahren 1582 bis 1587 errichten, und damit gehörte das Schloß zu den ersten gemauerten Gebäuden der Stadt. In Zukunft könnte dort das Rathaus Teile der Stadtverwaltung unterbringen oder die Kunstgrundschule und Dauerausstellungen der Organisatoren des Animationsfilmfestivals Anifilm ihr ständiges Domizil finden.
Warten auf die richtige Zeit
In den Immobiliendatenbanken steht das Schloß schon län-
ger zum Verkauf. „Wir haben nun offiziell vom Eigentümer des Schlosses ein Angebot erhalten“, bestätigte Adam Lenert, Stellvertretender Bürgermeister für Planung und Immobilienverwaltung. Die Stadt wird für das Denkmal 3,2 Millionen Euro bezahlen. Über die Transaktion wird der Stadtrat in diesem Monat entscheiden. Nach Angaben von Zámečník wird der Kauf nicht zu Lasten anderer geplanter Investitionen der Stadt gehen.
Reichenberger Politiker bemühten sich bereits vor neun Jahren um den Kauf des Schlosses. Als erstes schlug Wirtschaftsbürgermeister Jan Korytář vor, das Schloß zu übernehmen. Er plante den ursprünglichen Sitz der Familie von Redern und später der Familie von Clam-Gallas zu sanieren und in den Räumen eine Ausstellung über die deutsche Geschichte und Kultur, die Reichenberg prägte, aufzubauen. Der Stadtrat war aber mit seiner Idee nicht einverstanden. Der Preis für das Schloß lag damals
bei umgerechnet fast vier Millionen Euro.
Starke Emotionen der Bewohner
Der Prozeß erweckte aber dennoch starke Emotionen. Über den Kauf des Schlosses sollte 2018 in einem Referendum entschieden werden, das aber wegen geringer Beteiligung der Öffentlichkeit ungültig war. Der heutige Eigentümer, Ústí Development, erwarb das Schloß 2006 für 65 Millionen Kronen. Er wollte dort ein Hotel aufmachen, aber geschehen ist nichts.
Das Schloß Reichenberg ist ein klassizistischer Bau, die heutige Gestalt stammt aus dem 18. Jahrhundert. Mehrfache Umbauten begannen nach einem vernichtenden Brand im Jahr 1615. Damals wurden auf Veranlassung der Herrschaftsbesitzerin Katharina von Redern die Kapelle und der Nostitzer Flügel nach einem Entwurf von Jan Arkan von Zittau an das Schloß angebaut. Von großem Wert ist die Kapelle,
die bis heute erhalten geblieben ist.
Ein Umbau des neuen Schlosses im Geist der Romantik zur Sommerresidenz der Familie des Grafen Clam-Gallas erfolgte in den Jahren 1852 bis 1854 durch den Wiener Architekten Friedrich August von Stache (1814–1895) und den Baumeister Heinrich Ferstel (1828–1883).
Im 20. Jahrhundert richtete die weltbekannte Glasexportfirma Skloexport einen einzigartigen Glasmusterraum mit der weltgrößten Glassammlungen im Schloß ein, und gerade diese zerbrechliche Schönheit führte zur Entstehung der stolzen Bezeichnung Gläsernes Schloß. Nach dem Konkurs des Exporteurs im Jahr 2001 wurde die Glasmustersammlung von etwa 20 000 Stück versteigert. Seit langen Jahren ist der Schloßkomplex jedoch nicht zugänglich, bewundern können die Besucher das historische Gebäude im Herzen der Stadt nur von außen. Allerdings lädt der schöne Schloßpark zum Spazierengehen ein. �
Otfried Preußler posthum geehrt
Trotz seines lebenslangen Bemühens um die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen wurde Otfried Preußler (1923–1913), dem deutschen Märchenerzähler aus Reichenberg, zu seinen Lebzeiten in seiner Heimatstadt Reichenberg keine Ehrung zuteil. Eine Auszeichnung kam erst jetzt, wenige Monate nach seinem 100. Geburtstag. Petra Laurin berichtet.
Rund 150 Oldtimer und 30 historische Motorräder kamen zum 12. Schöberbergrennen. 1921 bis 1928 fanden im Schöbersattel die ersten acht Wettbewerbe statt. Die neuzeitlichen Rennen begannen 2021. Das Schöberbergrennen gehört zu den drei ältesten Autorennen mit internationaler Beteiligung in der Tschechischen Republik.
Die Deutschen waren wieder stark vertreten“, berichtet Pavel Bulejko, der Vorsitzende des Nordböhmischen Motorclubs (SKM). Das spektakuläre und für die Zuschauer attraktive Rennen, das an den 100. Jahrestag des ersten Sieges des tschechoslowakischen Fahrers Jindřich Knapp im tschechoslowakischen Wagen Walter 0 erinnert, fand Ende Mai im Erholungsgebiet des Warnsdorfer Teichs statt. Das Hauptrennen startete am letzten Maisamstag. „Vormittags mußten sich die Teilnehmer anmelden“, berichtet Bulejko über die Fahrt mit der besonderen Atmophäre. „Heute geht es nicht mehr um
die beste Zeit. Wichtig ist, daß uns das Treffen Freude macht.“ Sein Wagen ist der fliegende Citroën DS19 von Fantomas.
Die Geschichte des Automobilclubs begann in Rumburg im März 1914, also vor über 110 Jahren. Der Club vereinigte Auto-
um die Verkehrsschilder, die damals fast noch nicht existierten. Er hatte sogar ein Clubhotel unter dem Großglockner.“
Die heutigen Ziele des Vereines, der zum Autoclub der Tschechischen Republik gehört, sind ganz anders. Anstelle von Vor-

fahrer aus dem Schluckenauer Zipfel, und die Mitgliedschaft brachte hohes Ansehen. „Für die Mitglieder gab es günstigere Autoversicherungen, Rabatte auf Zoll sowie auf Autodienstleistungen und -produkte. Der Club kümmerte sich um die Befahrbarkeit auf dem Schöber und anderen Straßen im Winter sowie
teilen haben die fünf Clubmitglieder vor allem mit der Vorbereitung der Rennen zu tun. „Wir wollen an den Vorkriegsruhm der Region erinnern, den heutigen Ruf verbessern und Touristen in unsere Gegend lokken.“
Deswegen finden auf dem Schöber auch Winterrennen
statt. Allerdings fährt man dann nicht mit Autos, sondern nur auf dem Berg neben der Straße auf allegorischen Schlitten mit dem Thema „Historischer Motosport“ und in historischen Kostümen. „Dieses Jahr konnte das Rennen wegen Schneemangels nicht stattfinden“, bedauert Bulejko. Der Schöbersattel/Stožecké sedlo ist 602 Meter hoch und der wichtigste Paß im tschechischen Teil des Lausitzer Gebirges/Lužické hory. Er liegt in der Einsattelung zwischen der Finkenkoppe/Pěnkavčí vrch und dem Schöber/Stožec. Heute überquert die frühere Kaiserstraße als Fernverkehrsstraße 9 von Prag in Richtung Oberlausitz das Lausitzer Gebirge. Die Rennstrecke verlief auf der Fernstraße von der Kreuzung Zum Mythos auf 412 Metern Höhe in Sankt Georgenthal/Jiřetín pod Jedlovou bis zum Schöbersattel auf einer Länge von vier Kilometern. Schließlich fand eine Sonderfahrt über die deutsche Grenze nach Großschönau statt. Petra Laurin
Preußlers Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und erreichten eine Auflage von 50 Mil-

Oberbürgermeister
überreicht Susanne
lionen Exemplaren. Die Regionalbibliothek in Reichenberg hat in ihrer Sammlung 54 Werke von Preußler in deutscher, 23 in tschechischer und vier in slowakischer Sprache. Sie besitzt auch ein wertvolles Originalmanuskript einer Gedichtsammlung von Josef Preußler, dem Vater des Kinderbuchautors. Otfried Preußler wollte sie in den 1990er Jahren von der Bibliothek erwerben. „Die Sammlung war aber im Staatsbesitz, und deswegen war es nicht möglich“, erinnert sich Sekyra. Die Bibliothek ließ damals eine handgebundene Kopie anfertigen und schenkte sie Preußler.
Der Stadtrat von Reichenberg ehrte den Schriftsteller Otfried Preußler Mitte Mai mit einer Medaille „in Erinnerung an seinen Beitrag zur Kultur“. Die Auszeichnung nahm Susanne Preußler-Bitsch, Kulturwissenschaftlerin und Historikerin sowie jüngste der drei Töchter Preußlers, entgegen. „Ich bin überzeugt, daß mein Vater diese Ehre sehr schätzen würde“, sagte sie bei der Zeremonie. Bis vor kurzem war Preußler im heutigen Reichenberg fast unbekannt, obwohl fast jedes tschechische Kind „Die kleine Hexe“ dank der beliebten Fernsehserie „Abendmärchen“ kennt. Das lag an der totalitären Ideologie des Kommunismus. „Es ist wie eine Satisfaktion“, bemerkte Oberbürgermeister Jaroslav Zámečník. In der Stadt unter dem Jeschken könne man, so der Oberbürgermeister, bestimmt noch mehr Deutsche finden, die eine Ehrung verdienten. Preußler, einer der bedeutendsten Kinderund Jugendbuchautoren, starb am 18. Februar 2013 im 90. Lebensjahr im oberbayerischen Prien am Chiemsee. Anläßlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Gründung der Technischen Universität Reichberg (2013) hatte ihn der wissenschaftliche Rat der Fakultät für Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Pädagogik für die Erteilung des Ehrendoktor-Titels nominiert. Doch Preußler starb vor der Auszeichnung. Im Jahr vor seinem 100. Geburtstag wurde Preußlers Werk in einer Ausstellung in Reichenberg und im Kloster Haindorf vorgestellt und bei einer wissenschaftlichen Konferenz mit breitem kulturhistorischen Kontext an ihn erinnert. Der Verein der Deutschen sucht nun finanzielle Unterstützung, um eine Gedenktafel für das Haus, in dem Preußler wohnte, anfertigen zu lassen. Bis heute ist in seiner Heimatstadt keine Straße oder Institution nach ihm benannt worden. Die Wissenschaftliche Regionalbibliothek veranstaltete mehrmals Wanderungen zu Orten, die für Preußler wichtig gewesen waren. Man wanderte zu dem Haus, in dem er am 20. Oktober 1923 zur Welt gekommen war, zu Häusern, in denen er gelebt hatte, oder zur sogenannten Rudolfsschule, der öffentlichen Volksschule an der heutigen 5.-Mai-Straße, die Preußler und vor ihm schon seine Eltern besucht hatten. In dem Schulgebäude spielt die Geschichte „Herr Professoer Klingsor konnte ein bißchen zaubern“. „Das Vorbild für die Lehrerin Ernestine Killian war Preußlers Mutter Ernestine Preußler, das Vorbild von Fachlehrer Josef Teubner war der Vater Josef Preußler“, erklärte Marek Sekyra, der mit seiner Kollegin Franiška Dudková Párysová die Literarische Wanderung vorbereitet hatte.
DEUTSCH GABEL
Heimatkreis und Gemeindebetreuer gratulieren allen treuen RZ-Abonnenten aus dem Kreis Deutsch Gabel, die im Juni Geburtstag, Hochzeitstag, ein Jubiläum oder sonst ein Ereignis begehen. Heimatkreis und Gemeindebetreuer wünschen alles Gute, Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit sowie den Kranken unter uns baldige Genesung.
n Heimatkreis – Geburtstag. Am 25. feiert Rosl Machtolf, Ortsbetreuerin von Hennersdorf (Haus-Nr. 198), Hirschgasse 21, 71397 Leutenbach, ihren 89. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr alles Gute, vor allem aber Gesundheit und Gottes überreichen Segen. Gleichzeitig hoffen wir, daß die Leser der Reichenberger Zeitung noch viele Jahre von ihrem unerschöpflichen Wissen profitieren können. Ihre fundierten Geschichten aus der Heimat „vn dr heme“ sind einzigartig. Bei dieser Gelegenheit dankt der Heimatkreis
auch für die bisherige Unterstützung ganz herzlich.
Othmar Zinner
n Deutsch Gabel – Geburtstage. Am 20. Ida Thum (Witwe von Ernst Thum, Haus-Nr. 64), Richard-Wagner-Straße 41, 82538 Geretsried, 74 Jahre. Othmar Zinner
Helga Hecht
n Zwickau – Geburtstage. Am 7. Reinfried Prokop, KarlMarx-Straße 57, 15366 Hoppegarten, 85 Jahre, und am 17. Siegfried Herrmann, Bergweg 13, 55595 Hargesheim, 99 Jahre. Othmar Zinner
n Kriesdorf – Geburtstag. Am 19. Kurt Elstner (Ndf. 22, Landwirt), Alter Markt 4, 06526 Sangerhausen, 92 Jahre. Christian Schwarz
n Kunnersdorf – Geburtstag. Gerhard Stohl (Haus-Nr. 377), Hasenheide 17, 47918 Tönisvorst, 88 Jahre. Steffi Runge



für die Kreise
Dux, Bilin und Teplitz-Schönau


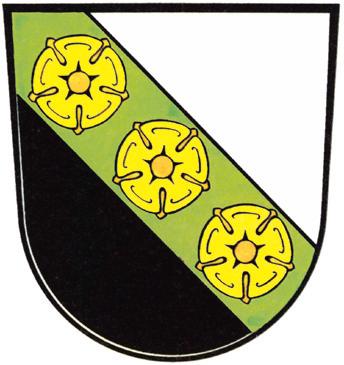

Heimatlandschaft Erz- und Mittelgebirge – Landschaftsbetreuer: Dietmar Heller, Hillenloher Straße 10, 87733 Markt Rettenbach, Telefon (0 83 92) 9 34 72 77, Telefax 9 34 72 78, eMail dietmar.heller@deheller.de. Heimatkreis Bilin –Patenstadt Gerolzhofen; Heimatkreisbetreuer: Dietmar Heller. Internet www.heimatkreisbilin.de. Heimatkreis Dux –Patenstadt Miltenberg; Heimatkreisbetreuer: Klaus Püchler, In den Seegärten 35a, 63920 Großheubach, Telefon (0 93 71) 9 94 01, eMail klauspuechler@web.de. Heimatkreis Teplitz-Schönau – Patenstadt Frankfurt am Main; Heimatkreisbetreuer: Erhard Spacek, Franz-Schubert-Straße 13, 01796 Pirna, Telefon (01 60) 95 32 07 27, eMail erhard. spacek@gmx.de Redaktionsschluß: Freitag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de


95 Jahre Hans Traxler
Ende Mai eröffnete im Caricatura Museum für komische Kunst in Frankfurt am Main die Ausstellung „Die Dünen der Dänen. Das Neueste von Hans Traxler“.
Der Maler, Cartoonist, Illustrator und Kinderbuchautor Hans Traxler feierte am 21. Mai 95. Geburtstag. Er kam in Herrlich nahe Ossegg im ehemaligen Kreis Dux zur Welt. Kurz vor seinem fünften Geburtstag kamen im Schacht Nelson III bei einer Explosion 142 Bergarbeiter ums Leben, derer die Stadt Ossegg regelmäßig gedenkt (➝ SdZ 3/2024). In den 1970er Jahren fiel Herrlich dem Braunkohleabbau zum Opfer. Von dem Grubenunglück hatte Traxler nichts mitbekommen, weil die Familie nach Sangerberg bei Marienbad gezogen war.
1945 verschlug es Traxler nach Regensburg in der Oberpfalz, 1951 nach Frankfurt am Main. Dort arbeitete er zunächst für einen Karikaturendienst des Verlegers Hans A. Nikel, für den auch Chlodwig Poth zeichnete. An der Frankfurter Städelschule, einer Staatlichen Hochschule für bildende Künste, studierte er Lithographie und Malerei. Als Nikel und sein Kompagnon Erich Bärmeier 1962 das Satiremagazin „Pardon“ ins Leben riefen, war Hans Traxler mit von der Partie und wurde ein langjähriger Mitarbeiter. Bereits 1963 gab der Verlag Bärmeier und Nikel Traxlers Buch „Die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Die Dokumentation des Märchens der Brüder Grimm“ heraus. In diesem geht der Aschaffenburger Studienrat Georg Ossegg dem Märchen im Spessart mit der Schaufel auf den archäologischen Grund und weist einen Mord nach. Das Buch schlug hohe mediale Wellen, und Traxlers blanker Unsinn wurde für die reine Wahrheit gehalten. Ein japanischer Gerichtsmediziner bat sogar um die Übersetzungsrechte.
1979 gründeten die Zeichner und Schriftsteller sowie ehemaligen „Pardon“-Mitarbeiter Hans Traxler, Robert Gernhardt, F. K. Waechter, Peter Knorr, Chlodwig Poth, F. W. Bernstein, Eckhard Henscheid und Bernd Eilert die Satirezeitschrift „Titanic“. Diese Gründerväter gehörten und gehören zur Neuen Frankfurter Schule (NFS). Ihr Publikati-

Hans Traxler vor dem Caricatura Museum. Im Hintergrund steht das Wahrzeichen des Caricatura Museums Frankfurt, eine von Hans Traxler gestaltete bronzene Elchskulptur mit Trenchcoat und Hut. Der Sandsteinsockel der Skulptur trägt eine Bronzeplakette mit den Namen der acht Vertreter der Neuen Frankfurter Schule sowie dem von F. W. Bernstein geprägten Wahlspruch „Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche“. Bild: Britta Frenz

Hans Traxlers Portrait von Leo Slezak. Der Heldentenor und Schauspieler Leo Slezak kam 1873 in Mährisch Schönberg im Altvaterland zur Welt und begann seine internationale Karriere in der südmährischen Metropole Brünn. Er starb 1946 im oberbayerischen Rottach-Egern.
onsorgan wurde nach Konflikten mit „Pardon“-Chefredakteur Nikel die „Titanic“. Aufgrund eines Halbsatzes in einem Artikel der „Titanic“ schuf Traxler mit Peter Knorr „Birne“ als Karikatur von Helmut Kohl. Der Name NFS entstand 1981, als für eine Ausstellung von Werken Traxlers, Gernhardt, und Waechters ein Titel gesucht wur-

de. Frankfurt am Main kaufte 2006 rund 7000 Originalzeichnungen von Hans Traxler, Chlodwig Poth, F. W. Bernstein und Robert Gernhardt für ein Mu-

Hans Traxlers Ich-Denkmal steht am Mainufer und wurde 2005 eingeweiht. Das Sandstein-Postament trägt die goldene Inschrift „Ich“. Auf der Rückseite besteigt man den Sokkel über Stufen. Auf der Schautafel daneben steht: „Jeder Mensch ist einzigartig. Das gilt natürlich auch für alle Tiere. Halten Sie das für immer fest. Hier.“ Weitere Traxlersche Ich-Denkmale stehen in Kassel und Bielefeld. Allesamt bieten sie SuperSelfie-Gelegenheiten.




Peter Knorr (Text), Hans Traxler (Zeichnungen): „Birne. Das Buch zum Kanzler. Eine Fibel für das junge Gemüse und die sauberen Früchtchen in diesem unserem Lande“. Verlag Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1983, 40 Seiten. Nur noch antiquarisch erhältlich.
seum für Komische Kunst. Dies eröffnete 2008 als eigenständige Abteilung des Historischen Museums im Leinwandhaus in Frankfurt. Zehn Jahre später entbrannte ein Streit zwischen dem

Museumsleiter und dem Direktor des Historischen Museums über die Zukunft des Caricatura Museums Frankfurt. Der Museumsleiter forderte die von Anfang an geplante Autonomie des Museums. Auch prominente komische Künstler wie Hans Traxler, Peter Knorr, Bernd Eilert und Rudi Hurzlmeier warben für die Eigenständigkeit, die das Kulturamt 2019 bewilligte.
Zu Traxlers Büchern gehören „Der große Gorbi“ (1990) und „Wie Adam zählen lernte“ (1993) sowie Werke von Eugen Roth. 1999 war er der Herausgeber und Illustrator von „Roda Roda. Rote Weste und Monokel“. Im Hanser-Verlag erschienen „Komm, Emil, wir gehn heim!“ (2005), „Franz. Der Junge, der ein Murmeltier sein wollte“ (2009), „Willi. Der Kater, der immer größer wurde“ (2014), „Sofie mit dem großen Horn“ (2015) und „Eddy. Der Elefant, der lieber klein bleiben wollte“ (2017).
Zu seinem 90. Geburtstag fand im Caricatura Museum eine große Ausstellung statt, in der „Mama, warum bin ich kein Huhn?“, Traxlers Erinnerungen an seine Kindheit in einem böhmischen Dorf, im Mittelpunkt standen. Anfang April schrieb Andreas Platthaus in der „F.A.Z.“ „Kurz vor seinem 94. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte Hans Traxler sein jüngstes Buch fertiggestellt, doch niemand wollte es haben. Drei Verlage, allesamt dem Nestor der deutschen Illustratoren seit Jahren verbunden und durch seine Arbeiten gut im Bilderbuchgeschäft, winkten ab. Zu wertkonservativ gestimmt war ihnen offenbar eine Geschichte namens ,Wie die Malerei verschwand‘, die in Wort und Rötelbild die heute nur noch wenig handwerklich bestimmte Künstlerausbildung anprangert.“ Acht Wochen später erschien das Werk bei der Edition Tiamat. Vieles ist zum ersten Mal in der neuen Ausstellung zu sehen. Außerdem wird Traxlers Geschichte „Franz. Der Junge, der ein Murmeltier sein wollte“ als Animationsfilm gezeigt, der noch unveröffentlicht ist und für die Sendung mit der Maus produziert wurde. Nadira Hurnaus
Bis Sonntag, 4. August, Mittwoch bis Sonntag 11.00–19.00 Uhr, Caricatura Museum, Weckmarkt 17, Frankfurt am Main,

Teplitz-Schönau
Es ist bereits gute Tradition, daß der Verein Teplitz-Schönau Freundeskreis besonders talentierten Abiturienten der deutschen Sprache des Gymnasiums in Teplitz eine viertägige Deutschlandreise mit der Bundesbahn schenkt. So auch heuer ende Mai. Jutta Benešová berichtet.
Der Vorsitzende des TeplitzSchönau Freundeskreises, Erhard Spacek, hatte getreu den Statuten des Vereins zur Unterstützung der jungen Generation in diesem Jahr geplant, zwei Mädchen mit Reiseschecks auszuzeichnen. Das Gymnasium wählte dann aber ein Mädchen und einen Jungen aus, gemeinsam das Abenteuer Bahnfahrt durch Deutschland zu unternehmen. Karla Kotyzová und Martin Šimsa waren die Auserwählten, die allerdings bei der Reisescheckübergabe noch mitten in den Abiturprüfungen standen. Deshalb rief Deutschlehrerin Kamila Volfová die beiden während einer Pause in den Prüfungsraum, damit sie die Reise-
schecks von Erhard Spacek entgegen nehmen konnten. Die Beschenkten strahlten vor Freude, und sicher verlieh ihnen die Auszeichnung neue Energie für die noch ausstehenden Prüfungen. Beide dankten Spacek in perfektem Deutsch. Sicher sind diese durch den deutschen Verein alljährlich überreichten Reiseschecks ein besonderer Anreiz für die zukünftigen Abiturienten, sich besonders intensiv mit der Geschichte und Sprache ihres Nachbarlandes zu beschäftigen, um dann ihre Kenntnisse nach dem Abi gleich in der Praxis anwenden zu können. Das Teplitzer Gymnasium pflegt enge Kontakte auch mit Schulen in Deutschland, und gegenseitige Besuche gehören zum Lehrplan und tragen zur gegenseitigen Verständigung der jungen Generation bei. Nicht mehr und nicht weniger soll die Übergabe der Reiseschecks bewirken – Land und Leute in Eigeninitiative kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Wir wünschen Karla Kotyzová und Martin Šimsa gute Fahrt.
TERMINE
■ Sonntag, 16. Juni, 14.00 Uhr: Jahreshauptversammlung des Heimatkreises Dux im Duxer Heimathaus, Duxer Straße 10, 63897 Miltenberg. Auskunft: Klaus Püchler, eMail klauspuechler@web.de



■ Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September: 10. Teplitz-Schönauer Heimattreffen. Donnerstag bis 16.00 Uhr Einchecken im Hotel Prince de Ligne am Schloßplatz, dort Abendessen; 19.00 Uhr Abfahrt nach Eichwald zum Festkonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto. Freitag 9.00 Uhr Abfahrt nach Soborten, dort Besichtigung des alten Jüdischen Friedhofs; Weiterfahrt nach Mariaschein, dort Besichtigung der Wallfahrtskirche der Schmerzhaften Mutter Gottes, Mittagessen in Schützenhaus; Weiterfahrt nach Ossegg, Kranzniederlegung am Denkmal des Grubenunglücks vom 3. Januar 1934; Rückfahrt nach Eichwald, Eröffnungskonzert in der Kirche Santa Maria del‘ Orto anläßlich des Eichwalder Stadtfe-
stes, Abendessen und Rückfahrt ins Hotel. Samstag 9.00 Uhr Abfahrt zum Teplitzer Stadtteil Settenz, Besichtigung der Glashütte Mühlig; Spanferkelessen in der Tuppelburg im Wildgehege Tischau; in Teplitz Besichtigung der Ausstellung „Die sieben Hügel von Teplitz“ in der Schloßgalerie; 19.00 Uhr Abendessen im Stadttheater. Sonntag 8.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, anschließend Heimfahrt. Änderungen vorbehalten. Kostenbeitrag für drei Übernachtungen mit Frühstück, bewachtem Parkplatz, Bus, Mahlzeiten, Besichtigungen, Führungen, Konzert im Einzelzimmer 550 Euro pro Person, im Zweibettzimmer 480 Euro pro Person. Getränke außerhalb des Frühstücks auf eigene Rechnung. Verbindliche Anmeldung durch Überweisung des Reisepreises auf das Konto Erhard Spacek, IBAN: DE 35 7008 0000 0670 5509 19, BIC: DRESDEFF 700. Namen und Anschrift der Reiseteilnehmer angeben oder eMail an erhard.spacek@gmx.de
Dux Ossegg Ladowitz Klostergrab Bilin Teplitz-Schönau Graupen Niklasberg

HEIMATBOTE

FÜR DEN KREIS BISCHOFTEINITZ

Heimatkreis Bischofteinitz – Patenstadt Furth im Wald. Heimatkreisbetreuer: Peter Pawlik, Palnkamer Straße 73a, 83624 Otter ng, Telefon (0 80 24) 9 26 46, Telefax 9 26 48, eMail peter-pawlik@t-online.de, Internet www.bischofteinitz.de. Spendenkonto: Heimatkreis Bischof teinitz, Rai eisenbank Chamer Land – IBAN: DE55 7426 1024 0007 1343 20, BIC: GENODEF1CHA. Heimatbote für den Kreis Bischofteinitz – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Verantwortlich von seiten des Heimatkreises: Peter Pawlik. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Das Phänomen Grenze
Die Erlebnisse von Antonín Hofmeister und Josef Zíka
Das grenzüberschreitende zweisprachige Projekt Hindle wartet auf beiden Seiten der Grenze immer wieder mit interessanten Vorträgen auf, die stets auf großes Interesse stoßen. Dabei wird deutlich, daß gerade die junge Generation in der Tschechischen Republik sich für die Geschichte der Gegend um die bayerisch-böhmische Grenze interessiert. Jüngstes Beispiel ist Kristýna Zimmerovás Vortrag „Das Phänomen Grenze in der Geschichte der Familie von Antonín Hofmeister“ im Zentrum Hindle auf dem Stadtplatz in Taus.

Kristýna Zimmerová studiert an der Westböhmischen Universität in Pilsen Bayerische Studien. Sie interessiert sich für das Leben der Vorfahren an der Grenze. Für ihre Diplomarbeit interviewte sie interessante Leute aus der böhmischen Region. Zu diesen zählte auch Antonín Hofmeister, der insbesondere durch die Organisation von Oldtimer-Fahrten, an der sich oft auch bayerische Fahrzeug-Veteranen beteiligen, kein Unbekannter ist. Wer ihn näher kennt, der weiß auch, daß er über ein bewundernswertes Wissen über die bayerisch-tschechische Grenze zu Zeiten des Eisernen Vorhangs verfügt. Zimmerová stellte zunächst Hofmeisters Vorfahren vor, ging auf die Orte ein, in denen sie gelebt und welche Rolle die Grenze in ihrer Geschichte gespielt hatte. Sie stellte dabei fest, daß sich die Grenze zwischen Bayern und Böhmen in den letzten 100 Jahren am meisten verändert habe. Zu Zeiten von Hofmeisters Großeltern, die in Pasečnice/Paschnitz gelebt hätten, sei die Grenze zwar spürbar, aber durchlässig gewesen, so daß man sich zwischen Bayern und dem Chodenland habe frei bewegen können. Dann seien schlimme Zeiten gekommen. Die Nachbarn von beiden Seiten der Grenze seien mit ihren Armeen Seite an Seite in den Ersten Weltkrieg gezogen, aber offenbar mit unterschiedlichen Erwartungen. Der Krieg habe mit unterschiedlichen Gefühlen geendet, als Gewinner und Verlierer, wobei vor allem die Grenze darüber entschieden habe, wer der Gewinner und wer der Verlierer gewesen sei.
Die durch die Kriegsfolgen und die unterschiedlichen Vorstellungen über die Nachkriegsordnung verursachten Konflikte zwischen Tschechen und Deutschen seien dank der verbesserten Wirtschaftslage zunächst teilweise überwunden worden, doch nach der Verschärfung der Wirtschaftskrise seien die nationalen Probleme mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland mit noch größerer Wucht wieder zutage getreten. Es habe nicht lange gedauert, bis es im Herbst 1938 zu einer heftigen Grenzverschiebung gekommen sei. Am 17. März 1943 kam Antonín Hofmeister in Taus zur Welt. Die Produkte der Firma Hofmeister hatten einen guten Ruf, der auf ihrem Geschäft mit Sattlerwaren und Polstermöbeln beruhte. Hofmeister: Leider habe der Großvater zum Zeitpunkt seiner Geburt nicht mehr gelebt. Nach einem brutalen Verhör durch die Gestapo habe er im Mai 1940 Selbstmord begangen. Im Interview sagte er: „Obwohl mein Großvater wegen der Deutschen Selbstmord beging, haben wir sie immer anständig behandelt. Es war wichtiger, ob er ein guter oder schlechter Mensch war, nicht ob er Tscheche oder Deutscher war.“ Hofmeister erinnerte sich, daß sein Vater während des Kriegs ins oberpfälzische Arnschwang gegangen sei, um dort in der Sattlerei und Polsterei zu arbeiten. Sie
Bahnhof von Taus noch in Erinnerung. Seine Mutter habe ihn im Kinderwagen zu dem Ort gebracht, wo die Deutschen aus dem Lager abgeholt worden seien. Ein Herr Schwarz habe seinem Vater und seinem Onkel bei der Arbeit geholfen, dann habe man gemeinsam am Tisch gegessen. In die Tasche von Schwarz sei noch Essen für die anderen Familienmitglieder im Lager gestopft worden.
Mit der Vertreibung der Sudetendeutschen und dem Bau des Eisernen Vorhangs seien die jahrhundertealten Kontakte zwischen Bayern und Choden abgebrochen. Das Leben der Nachbarn sei auseinander gedriftet, und Grenzdörfer seien verschwunden.
Ende der 1940er Jahre sei es Hofmeister gelungen, als Kind mit seiner Familie den Schwarzkopf und das Grenzgebiet zu besuchen, was bis zur Revolution im Jahre 1989 mit wenigen Ausnahmen während des Prager Frühlings nach dem August-Einmarsch der WarschauerPakt-Staaten 1968 nicht mehr möglich gewesen sei.
tischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Zíka sei schließlich bei einem Schußwechsel getötet worden, ohne daß er selbst einen der Grenzsoldaten getroffen habe. Sein symbolisches Grab befinde sich auf dem Friedhof in Plöß. Die Akte mit dem Codenamen „Šumava“ sei leider vernichtet worden.

Die Grundmauern der Plößer Sankt-Johannes-der-Täufer-Kirche.

Während des Kalten Krieges sei eine andere Art des Schmuggels hinzugekommen, die Flucht von Menschen über die Grenze in den Westen, die ohne Hilfe von innen nicht möglich gewesen wäre. Aber auch damit sei schließlich Schluß gewesen, nachdem der Eiserne Vorhang und die elektrischen Leitungen errichtet worden seien.

hatten geplant, sich nach dem Krieg gegenseitig zu besuchen. Der erste Besuch war jedoch erst nach 1960.
Hindle bedeutet im chodischen Dialekt der Ort zwischen hier und dort. Hindle ist die Region zwischen Pilsen und Regensburg, in der es nicht darauf ankommt, welche Sprache man spricht, sondern daß man sich versteht. Trotz der schwierigen Vergangenheit gibt es viel mehr, was uns eint, als was uns trennt. Hindle ist ein Ort, an dem es keine Grenzen geben muß, wenn wir das wollen und etwas dafür tun.
Durch den Krieg sei das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen zerstört worden. Und die Rache für die Entfesselung sei die Nachkriegsvertreibung der Sudetendeutschen gewesen. Hunderttausende seien nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Bahnhof Taus in Richtung Furth im Wald gezogen. Obwohl Hofmeister damals noch sehr jung war, sind ihm die schrecklichen Szenen auf dem
Hofmeister beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Fall des Wildhüters Josef Zíka, den er als den König des Böhmerwaldes und eines der vielen Opfer des Regimes bezeichnet. Dieser habe ab 1945 als Wildhüter in Plöß/Pleš gearbeitet. Seine ausgezeichneten Kenntnisse des Geländes, seine Kontakte zu den örtlichen Förstern und Wildhütern sowie zu vertriebenen Deutschen aus der Region, von denen sich einige in der Nähe der Grenze niedergelassen hätten, habe er nach dem Krieg für den Schmuggel von Waren genutzt, bevor er sich nach dem Februar 1948 an der Überführung von politischen Flüchtlingen beteiligt habe. Zíka sei bereits im November 1948 unter dem Verdacht des Schmuggels verhaftet worden. Während er zum Verhör eskortiert worden sei, habe er eine Autopanne genutzt, um nach Deutschland zu fliehen. Dort habe er mit dem bri-
Als die Russen im August 1968 den Prager Frühling niederschlugen war Antonín Hofmeister mit einer Beinverletzung in Taus. Er habe trotz Verbots gefilmt, als die Panzer durch die Stadt gefahren seien. An Flucht habe er nicht gedacht, denn Heimat sei Heimat und gute Tauben blieben zu Hause. Die, die das Land verlassen hätten, seien oft aus egoistischen Gründen weggelaufen. Sie seien eher Wirtschaftsflüchtlinge. 1969 habe er die Sattlerei in Arnschwang besucht, wo sein Vater gearbeitet habe. Es sei ihm dabei nicht in den Sinn gekommen, nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Er sei sich sicher gewesen, daß sich die Situation einmal ändern werde. Entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs sei nicht nur an der tschechisch-bayerischen Grenze die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft Grünes Band entstanden. In der Zeit der geschlossenen Grenzen sei er oft über die Grenze gefahren, um das Grüne Band auch von der anderen Seite zu sehen, was oft Fragen der bayerischen Polizei aufgeworfen habe. Die hätten wissen wollen, warum er mit seinem Auto in Grenznähe unterwegs sei. Seine Antwort: „Wenn ich schon nicht von unserer Seite dorthin fahren kann, dann muß ich wenigstens von eurer Seite hinfahren und nachsehen.“ Nach der Sanften Revolution habe er endlich auf seiner Seite an der Grenze entlang fahren können. Die Musik im Autoradio habe sich verändert, es wurde endlich Musik aus der ganzen Welt gespielt. Hofmeister, Besitzer einer Autowerkstatt und in der Lkw-Branche tätig, konnte sich mit Leuten von beiden Seiten der Grenze in der Kneipe in Plöß treffen und über die alten Zeiten reden. „Aber die Zeit schritt unaufhaltsam voran, und die Leute, die sich dort trafen, wurden immer weniger“, erzählte er Zimmerová. In der Folgezeit organisierte er Oldtimer-Treffen, und überall erfreut er sich großer Beliebtheit. Seine Botschaft an die jungen Leute: „Habt mehr Demut und Respekt vor den Älteren. Seid gute Menschen und erinnert euch daran, daß alles bezahlt und erkämpft werden muß. Fragt eure Vorfahren nach ihrer Geschichte, solange noch Zeit ist. Außerdem wünsche ich mir, daß die Welt wieder die Kurve kriegt.“ Und noch eines ist sich Hofmeister sicher: „Ich kann ohne den Bilck zum Schwarzkopf und auf den Turm von Taus nicht leben.“ Karl Reitmeier
Geschichte einer Wüstung
Plöß ist heute ein Gemeindeteil von Weißensulz. Mit 765 Metern über dem Meeresspiegel war der Ort die höchstgelegenen Siedlung im Kreis Bischofteinitz und ist seit den 1960er Jahren eine Wüstung.
Plöß liegt zwischen dem 794 Meter hohen Plösser Berg und dem 863 Meter hohen Plattenberg. Der Ort wurde vor 1600 von deutschen Siedlern gegründet, die von Taus aus böhmisches Land besiedelten. 1606 wurde Plöß erstmals urkundlich erwähnt. 1789 wurde es als Pleß unter der Fideikommißherrschaft Heiligenkreuz aufgeführt. Bei Johann Gottfried Sommer wurde Plöß 1839 als Dorf mit 54 Häusern und 483 Einwohnern erwähnt. Der Name Plöß kommt wohl von Blöße, eine in den Wald gehauene Lichtung. 1913 hatte Plöß 67 Häuser mit 642 Einwohnern. Wenzelsdorf und Straßhütte waren Ortsteile von Plöß. 1930 hatte Plöß 167 Häuser mit 1163 deutschen, acht tschechischen und zwölf ausländischen Einwohnern und 1939 124 Häuser mit 1167 Einwohnern. Plöß war zu dieser Zeit ein beliebter Ausflugsort mit drei Gaststätten, einer Bäckerei, einem Fleischer und einem Schmied. Nach dem Münchener Abkommen kam Plöß zum Deutschen Reich und gehörte bis 1945 zum Landkreis Bischofteinitz. Im Zuge der Beneš-Dekrete wurden ab 1945 alle Deutschen vertrieben. Die meisten Häuser verfielen. Nach der Grenzöffnung 1989 wurden der zerstörte Friedhof samt den Grundmauern der Friedhofskirche Johannes der Täufer restauriert sowie in Sichtweite der Grenze in Friedrichshäng ein Gedenkplatz errichtet. Außerdem wurde 2016 an Stelle der zerstörten Pfarrkirche Maria Hilfe der Christen eine Kapelle eingeweiht. Die alte
Rössler-Villa Nr. 73 ist das einzige erhaltene Gebäude. Zunächst wurde es als Forsthaus genutzt und wird mit dem Schmuggler Josef Zíka (➝ links), einst Förster in Plöß, in Verbindung gebracht. Das Haus wurde nach dem Mauerfall ein Gasthof mit Pension. Die Plösser waren überwiegend Katholiken. Sie wurden vor 1654 von Heiligenkreuz und anschließend von Eisendorf betreut. 1668 entstand auf einer Anhöhe die Johannes-der-Täufer-Kirche. 1787 wurde Plöß eine Filialkirche von Eisendorf und 1851 zur eigenständigen Pfarrei. Wegen Schäden an der Pfarrkirche wurde diese renoviert und 1882 bei der Einweihung eines neuen Friedhofs als Friedhofskirche wiedereröffnet. 1798 wurde in der Ortsmitte eine Kapelle errichtet, die 1870 erneuert wurde. An ihrer Stelle wurde dann eine Maria-Hilfe-der-Christen-Kirche erbaut, die 1906 eingeweiht wurde. Zu Plöß gehören die Wüstungen Dorfmühle, Rappauf, Straßhütte, Wenzelsdorf und Zankmühle. 1892 ist ein Schulhaus erwähnt, das auf Initiative des Freiherrn Kotz von Dobrz errichtet wurde und vier Klassen beherbergte. 1684 wurde in Plöß eine zweite Kapelle erbaut. Seit 1787 war der Ort eine Filiale von Eisendorf, dessen Kaplan dort jeden dritten Sonntag Gottesdienst feierte. 1858 wurde Plöß zur Pfarrei mit Pfarrkirche und Pfarrer erhoben. 1906 wurde eine neue Pfarrkirche eingeweiht. In Straßhütte gab es 1789 bis 1830 eine Glashütte. Wegen der Höhe, des rauhen Klimas und der kargen Böden war die Landwirtschaft schwierig. Dennoch gab es zehn Bauern mit mehr als zehn Hektar Grund und guter Viehwirtschaft. Die übrigen Bewohner arbeiteten als Handwerker oder als Arbeiter im Wald oder in der Umgebung.
WIR GRATULIEREN
Im Juni gratulieren wir herzlich folgendem treuen Abonnenten des Bischofteinitzer Heimatboten und wünschen Gottes Segen.
■ Heiligenkreuz, Haselberg. Am 18. Alois Vogl (Voglwirt), 87 Jahre. Peter Gaag Ortsbetreuer
Ortsbetreuerecke
Herzlich gratulieren wir im Juni Alfred Piwonka, ehemaliger Ortsbetreuer von Semeschitz, am 9. zum 73. Geburtstag; Hans Laubmeier, ehemaliger Ortsbetreuer von Grafenried, Seeg, Anger und Haselberg, am 20. zum 83. Geburtstag und Franz Drachsler, ehemaliger Ortsbetreuer von Plöß/Wenzelsdorf, am 22. zum 100. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, noch viele Jahre in guter Gesundheit und danken für den steten und tatkräftigen Einsatz für unsere Heimat! Peter Pawlik Heimatkreisbetreuer


Heimatbote für den Kreis Ta<au


Heimatkreis Tachau – Patenstadt Weiden in der Oberpfalz. Heimatkreisbetreuer: Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Aubergstraße 21, 83352 Altenmarkt, Telefon (0 86 21) 6 36 27, Telefax 64 75 27, eMail wolf-dieter.hamperl @online.de. Internet www.tachau.de. Tachauer Heimatmuseum: Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Telefon (09 61) 81 41 02, Telefax 81 41 19, eMail museum@tachau.de. Spendenkonto: Heimatkreis Tachau, HypoVereinsbank Nürnberg – IBAN: DE38 7602 0070 0002 0824 54, BIC: HYVEDEMM460. Heimatbote für den Kreis Tachau – Redaktionsschluß: Donnerstag der Vorwoche. Redaktion: Nadira Hurnaus, Baiernweg 5, 83233 Bernau, Telefon (0 80 51) 80 60 96, eMail post@nadirahurnaus.de
❯ Chronik von Rojau über die Jahre des Zweiten Weltkriegs – Teil III und Schluß
Erstkommunion und Kriegsende
Vor wenigen Wochen starb Hermine Bender in Dillenburg. Sie stammte aus Rojau im Nachbarkreis Marienbad. Da sie wußte, daß sich Heimatkreisbetreuer Wolf-Dieter Hamperl für Akanthusaltäre interessiert, schickte sie ihm Fotos von dem Akanthusaltar der Rojauer Pfarrkirche. Dabei lagen Kopien aus der handgeschriebenen Ortschronik von Rojau. Hier der dritte und letzte Teil.
Um 10.30 Uhr war die Löscharbeit im Wesentlichen beendet. Für zweierlei müßten wir – so sagte der Seelsorger am nächsten Tag beim Sonntagsgottesdienst den Seinen – Gott dankbar sein. Dafür, daß kein Menschenleben verloren gegangen sei, denn alles lasse sich wieder ersetzen, nur nicht das Leben. Und dafür, daß kein ungünstiger Wind geweht habe, denn dann wäre der ganze Ort ein Raub der Flammen geworden. Schließlich seien die meisten Häuser mit Schindeln gedeckt und darum bei Funkenflug aufs Äußerste gefährdet. Um so mehr aber sollten diejenigen, die nicht betroffen seien, denen in jeder Weise hilfreich beistehen, die Gott heimgesucht habe. Das sei der beste Dank dafür, daß sie verschont geblieben seien. Alle aber sollten sich bewußt sein: Was Gott tue, das sei wohl getan, auch wenn man es nicht begreifen könne. Die Leiden dieser Welt seien nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die einmal an uns offenbar werden würde. Denen, die Gott liebten, gereichten alle Dinge zum Guten. „Darum wollen wir stets Gottes Kinder sein und bleiben durch die heilig machende Gnade, und wir dürfen ruhig in die Zukunft schauen, was immer auch sie uns bringen mag. Uns kann nichts geschehen, was nicht Gott weiß und zuläßt, er aber ist die ewige Weisheit und Liebe!“ Sonntag, den 22. April, waren die Kinder des 2. und 3. Schuljahres soweit gefördert, daß sie zur ersten heiligen Beichte geführt werden konnten. Die folgende Woche wurde jeden Tag um sieben Uhr früh und um sieben Uhr abends Kommunionunterricht erteilt, um sie so rasch als möglich zum Tisch des Herrn führen zu können. Die Kinder, die schon in den vergangenen Wochen, besonders seit der Schulunterricht eingestellt worden war, regelmäßigen Unterricht in der Kirche erhalten hatten, kamen auch diese letzten Tage fleißig zum Gotteshaus, so daß am nächsten Sonntag, den 29. April, bei der Frühmesse um 8.00 Uhr die Feier ihrer ersten Heiligen Kommunion in derselben Weise stattfinden konnte wie vor zwei Jahren. Gott sei Dank ungestört von feindlichen Fliegern, deren Tätigkeit in den letzten Tagen sehr nachgelassen hatte, da auch die Wehrmachtstransporte auf der Reichsstraße im Wesentlichen vorüber waren. Am selben Sonntag nachmittags konnte auch in Rauschenbach die Erstkommunionfeier stattfinden. Es war keine leichte
Aufgabe, den Kindern, die vier Jahre lang keinen Religionsunterricht genossen hatten, im Laufe weniger Monate die Grundzüge unseres heiligen Glaubens zu vermitteln und ihnen gleichzeitig den Sonderunterricht für die Heilige Beichte und Kommunion zu erteilen. In den zwei Monatsstunden, die zur Verfügung standen, war dies ganz unmöglich. Trotz Eingabe an den Kreisschulrat und Vorgespräche im Regierungspräsidium in Karlsbad war aber nicht zu erreichen, daß der Schulraum für zusätzlichen Unterricht zur Verfügung gestellt wurde. So blieb nichts anderes übrig, als die Kinder mit Zustimmung der Eltern und Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen in der feuchten kalten Kirche in Rauschenbach zu unterrichten. Die Kinder kamen trotz der Kälte –der Unterricht hatte schon im Januar einsetzen müssen – regelmäßig mit Decken zum Einwikkeln und heißen Ziegelsteinen zum Erwärmen der Füße, aber sie waren da und folgten mit erbaulichem Eifer den Worten des Religionslehrers. Zunächst muß-
sollen; infolge des Fliegerangriffs um zwei Uhr kam er erst um vier Uhr dort an, nicht um noch Schule zu halten, sondern mit dem Schulleiter zu besprechen, wann die ausgefallene Stunde nachgeholt werden könne. Kaum hatte er dessen Haus betreten, standen schon Kinder da und meldeten, daß sie noch beieinander seien und fragten, ob noch Religionsunterricht sei. Selbstverständlich wurde diese Frage bejaht. Es war kein kleines Opfer für den Pfarrer von Rojau, monatelang bei jedem Wetter den Weg nach Rauschenbach zu machen, zumal dieser Ort nicht zur Pfarrei Rojau gehörte; der große opferfreudige Eifer der Kinder, die durch jahrelanges Fasten gleichsam geistlich ausgehungert waren, machte dieses Opfer leicht, ja zu einer reinen großen Seelsorgerfreude. Am 29. April um 4.00 Uhr nachmittags schlug auch für sie die frohe Stunde, da sie die schöne Feier der ersten Heiligen Kommunion in einem schön geschmückten Kirchlein feiern durften. Wohl hörte man einmal die Flieger über das Gotteshaus brausen, aber es kam zu kei-
ren Ortes aber war man anderer Ansicht.
Auch in Rojau mußten Panzersperren beim Eingang und Ausgang der Reichsstraße gebaut werden. Der Kampfkommandant, ein junger, fescher Leutnant, der in den letzten Tagen mit einem Soldatentrupp hierher verlegt wurde, erklärte seiner Schar, wer kneife, werde gehängt. Auch wurde bekannt gegeben, jedes Haus, auf dem eine weiße Fahne erscheine, werde niedergebrannt, und alle Männer, die zu diesem Hause gehörten, würden erschossen.

Dorfplatz und Kirche von Rojau.
ten sie an das gemeinsame Beten und Singen gewöhnt werden, damit ehestens mit dem Kindergottesdienst begonnen werden konnte; er wurde ab Januar an jedem letzten Monatssonntag um vier Uhr nachmittags gehalten. Die sieben Kinder, die schon die Sakramente empfangen hatten, kamen dabei zum Tisch des Herrn. Alle aber beteten und sangen dabei, daß sowohl die Einsiedler Organistin als auch der Pfarrer von Einsiedl angenehm überrascht waren. Der Religionslehrer war bei den Kindern und gab zwischen den Gebeten und Liedern kurze Erläuterungen zum Gang der Messe, die auch von den Erwachsenen mit Interesse verfolgt wurden. „Jetzt verstehe ich erst, was die Messe eigentlich ist.“ Diese und ähnliche Äußerungen zeigten, wie notwendig ein solches Verfahren ist und wie dankbar die Leute dafür sind. Diese Dankbarkeit zeigte sich auch dadurch, daß die Leute, besonders die Eltern der Erstkommunikanten, wetteiferten, wer den Religionslehrer nach dem Gottesdienst und nach den Unterrichtsstunden zu Tische laden durfte.
Am 13. April hätte der Seelsoger von Rojau um drei Uhr in der Schule von Rauschenbach sein
ner Störung. Mit Ausnahme der vier Kinder des ersten Schuljahres und eines geistig tief stehenden Knaben des zweiten Jahres vereinigten sich alle mit ihrem Heiland, darunter einige, die schon das letzte Jahr die Schule besuchten. Die bange Frage, die von ihren Müttern wiederholt an den Religionslehrer gestellt worden war, ob es denn möglich sein werde, die Kinder noch in diesem Schuljahr zu den Heiligen Sakramenten zu führen, hatte nun ihre endgültige, frohe bejahende Antwort gefunden. Gott gib, daß alle Erstkommunikanten mit so guter Herzensverfassung zum Tische des Herrn treten wie diese Kinder von Rauschenbach. Es war wirklich die letzte Stunde gewesen, diese Feier noch in verhältnismäßiger Ruhe zu begehen, denn schon am nächsten Sonntag wurde unser Ort von den Amerikanern besetzt. Damit war die äußere Ruhe hergestellt, nicht aber die innere Ruhe und bange Sorge, was nun geschehen werde.
Der Hauptmann, der in der zweiten Hälfte des April als Ortskommandant bei uns waltete, war zwar der Ansicht, daß eine Verteidigung des Ortes Rojau zwecklos sei und nur zu unnötigen Opfern führen würde, höhe-
Der Bittsonntag dieses Jahres, zugleich Herz-Jesu-Sonntag des Monats Mai, der 6. Mai 1945, bedeutete für Rojau das Ende des Krieges. Es ging gut vorüber, obwohl dem Orte Untergang und Gemetzel drohten. Schon vormittags verteilten sich Gerüchte, Marienbad sei schon besetzt. Um 11.00 Uhr war Polengottesdienst mit Generalabsolution und Spendung der Heiligen Kommunion. Die Leute, die beim Brand so eifrig mitgearbeitet hatten, sollten in den kommenden Stunden und Tagen, von denen niemand wußte, wie sie sich gestalten würden, im Seelenfrieden mit ihrem Herrgott entgegenschauen können, nicht weniger als die Hiesigen. [Der folgende Abschnitt ist vollkommen unleserlich.] In manchen Orten der Umgebung war keine Absicht der Verteidigung, und doch wurde der Ort mit Granaten belegt, so in Dreihaken, Silan und Habakladrau. Ähnliches hatte man schon früher aus der Planer Gegend gehört. Kein Wunder, daß darum die Leute aufgeregt wurden, ja noch mehr: Die Frauen rotteten sich zusammen, öffneten die Panzersperren und zersägten die Stämme, so daß eine Wiederschließung unmöglich wurde. „Wir haben schon in verschiedenen Orten mancherlei erlebt, aber so rabiate Weiber wie in Rojau haben wir noch nirgends gefunden“, erklärten nachher die Soldaten. Dann scharten sich einige Frauen mit weißen Fahnen in den Händen zusammen und zogen den anrückenden Amerikanern gegen Abaschin entgegen. Schon suchten Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett den Bürgermeister Alois Pimpl von Nr. 12, ohne ihn zu finden. Schon war militärische Verstärkung im Anmarsch, und laut Kampfkommandant drohte ein furchtbares Strafgericht, als auf der Abaschiner Straße die Spitze der amerikanischen Vorhut sichtbar wurde. Im selben Augenblick gaben die Soldaten die Parole aus „Abhauen!“ und verschwanden. Im nächsten Augenblick war die Panzersperre, die aus den Trümmern der Baumstämme mehr symbolisch als wirksam wieder in der Straßenmitte aufgebaut worden war, von den Männern des Volkssturms beseitigt und eine Abordnung ging mit weißer Fahne den Amerikanern entgegen.
ORTSNACHRICHTEN




Ein Neuhäusler Heimattreffen in vergangenen Zeiten: In der zweiten Reihe von oben steht außen rechts Gerhard Fröhlich, in der unteren Reihe in der Mitte Berta Weis in Tracht.
■ Neuhäusl. Gleich zwei Geburstage gab es zu feiern. Berta Weis, bekannt als Schöllerer Bertel aus Neuhäusl und als Heimatbetreuerin vor meiner Zeit, feierte am 15. Mai in Lahr im Schwarzwald ihren 84. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie. Sie selbst übernahm damals dieses Amt von Gerhard Fröhlich. Der nächste Neuhäusler Jubilar ist Uli Mayer, bekannt als Stummerer Uli. Sein 89. Geburstag am 15. Mai wurde an seinem Wohnort Ried am Starnberger See auch im Kreise seiner Familie gefeiert. Beide Jubilare sind oft in Gedanken bei ihrem geliebten Neuhäusl. Leider ist ihnen die Anreise an ihren Geburtsort aus Altersgründen zu anstrengend geworden. Beide waren bis 2019 regelmäßig noch in ihrem Geburtsort. Herzliche Glückwünsche an beide Jubilare, wir wünschen noch viele gute Jahre.
Abschied nehmen müssen wir von Erika Boller, zuletzt wohn-
haft im südhessischen Münzenberg. Ihr Elternhaus, die MaierVilla, steht noch heute in Neuhäusl und ist seit der Vertreibung bewohnt. Sie und ihre verstorbene Schwester Helga Riehl waren bei den tschechischen Bewohnern jederzeit gern gesehen und bekamen Einlaß in ihre Geburtsstätte. Sie nahmen auch mal das Angebot an, in ihrem ehemaligen Kinderzimmer zu übernachten. Vor allem der Wunsch im Garten ihren Lieblingsbaum zu umarmen, erfüllte sich bei jedem Besuch. Erika verstarb im April im 92. Lebensjahr. Bis zuletzt waren wir telefonisch in Kontakt mit langen Gesprächen. O Herr, gib ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden. Alle genannten Neuhäusler kenne und kannte ich persönlich. Es fällt mir leicht, mich in ihrem Neuhäusl aktiv einzubringen, da meine Mutter dort als Niegl Nanne, geborene Schön, zur Welt kam. Emma Weber Ortsbetreuerin
TERMINE
■ Freitag, 7. Juni, Bayerischtschechischer Stammtisch: 18.00 Uhr im Museumsrestaurant Brot & Zeit in Bärnau; 20.00 Uhr Cocktailabend mit Musik.
■ Sonntag, 16. Juni, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Klaus Oehrlein aus Margetshöchheim, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei
■ Samstag, 22. Juni, 10.00 Uhr, Ujest: Festgottesdienst anläßlich 30jähriges Jubiläum der Errichtung der Kapelle Johannes der Täufer. Andreas Knödl, Sohn des Erbauers lädt alle Ujester, Labanter und Pfraumberger herzlich ein. Auskunft: WolfDieter Hamperl (Kontaktdaten ➝ Impressum oben).
■ Samstag, 6. Juli, 10.00 Uhr, Altzedlisch: 34. Heimatgottesdienst des Kirchsprengels, anschließend Treffen im Pfarrhaus. Auskunft: Sieglinde Wolf, Wettersteinstraße 51, 90471 Nürnberg, Telefon (09 11) 81 68 68 88.
■ Sonntag, 21. Juli, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Peter Fořt aus Graslitz, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
■ Sonntag, 18. August, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg
Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
■ Samstag, 7. September, 19.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Pfarrer Georg Hartl aus Wernberg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.
■ Samstag, 14. September, 18.00 Uhr, Bruck am Hammer: Barockkonzert des Ensembles Alcinelle in der Sankt Jakobuskirche.
■ Sonntag, 20. Oktober, 15.00 Uhr, Haid: Deutschsprachige Pilgermesse in der Loreto mit Weihbischof em. Ulrich Boom aus Würzburg, anschließend Kirchkaffee in der Sakristei.




Betreuerin Heimatkreis Leitmeritz: Yvi Burian, Eugen-Kaiser-Str. 21, 63526 Erlensee, Tel. 06183 8995283, eMail: sudetenburi@gmail.com. Betreuer Wedlitz, Drahobus, Straschnitz, Laden, Julienau, Brzehor: Sven Pillat, OT Chursdorf 44, 07580 Seelingstädt, eMail: svenpillat@gmx.de. Redaktion: Heike Thiele, Eulengasse 16, 50189 Elsdorf, Tel. 02271 805630, eMail: thiele.heike@gmx.de. Redaktionsschluß: 15. Vormonat. Kultur


Aus der alten Heimat/Tschersing
Dank vereinter Anstrengungen konnte die Kirche in Tschersing restauriert werden, dies ist nun gebührend gefeiert worden.
Unter uns gibt es immer mehr Fans des Böhmischen Mittelgebirges. Jeder Hügel, jedes Dorf und jedes heilige Denkmal zeugen davon, daß es sich hier um einen historisch reichen Winkel des böhmischen Landes handelt, jede Ecke bietet ihre historischen oder natürlichen Denkmäler, die hier von früheren Generationen leider unter schwierigen Umständen hinterlassen wurden. Eines dieser Denkmäler ist die Kirche in Tschersing. Interessant ist, daß diese Kirche erst 1936 erbaut wurde und tatsächlich eine der jüngsten in unserer Region ist. Leider zeigten sich bei ihr die Auswirkungen der geringeren Luftfeuchtigkeit und es war eine Rettungsmaßnahme erforderlich.
Tschersing ist im Kataster der Gemeinde Malschen eingetragen, wo es einen sehr aktiven Verein gibt – „Malečovský rozhled“. Der Hauptorganisator Zdeněk Petr beschloß, gemeinsam mit dem örtlichen Verein eine Rettungsaktion zu starten. Er unternahm große Anstrengungen, um die nötige Summe zu beschaffen, aber auch, um sich am Projekt zu beteiligen. Ein Teil der Spenden kam von Freiwilligen, ein Teil mit Unterstützung
Wie es früher war/Straschnitz

Eine schöne Veranstaltung feierte die Tschersinger Kirche

der Kirche und ein Teil mit Unterstützung europäischer Fonds. Zdeněk Petr ist darin kein Anfänger. Dank seiner Aktivitäten und seiner Fähigkeit, andere einzubeziehen, war er es, der in den Menschen den Wunsch erweckte, selbst Hand anzulegen. So entstand vor Jahren der Aussichtsturm „Lucemburkův kopec“ (Luxemburger Hügel) in Pohorsch bei Malschen, wo es unter anderem die einzige schneebedeckte Piste im böhmischen Mittelgebirge gibt. Wer mehr wissen oder sogar zu einem Projekt beitragen möchte:
Juni in Straschnitz
Margarete Semsch erinnert sich an traditionelle Feste Ende Juni und Anfang Juli
In die Zeit der großen Gewitter
fielen die Feste ,,Peter und Paul“
am 29. Juni und „Prokopi“ am vierten Juli. Es war ein farbenprächtiges Bild, wenn die Marienprozessionen von den umliegenden Dörfern in die Kirche einzogen. Es gab Musikanten, kleine

www.malecovskyrozhled.cz
Die Veranstaltung in Tschersing hatte ihren Höhepunkt am Samstag, dem Nachmittag des 04.05.2024. Interessierte versammelten sich dort zur feierlichen Eröffnung der Kirche nach dem Wiederaufbau. Im Inneren fand eine Messe statt, die von Dekan Karel Havelka gefeiert wurde und mit einem wunderschönen, kleinen Konzert des Frauenchors Cantica Bohemica unter der Leitung von Chorleiterin Dominika Valešková endete.
Jungen mit Fähnchen, kleine Mädchen mit Blumenkörbchen, dann die von den großen Mädchen getragene Marienstatue und Vorbeter und Bewohner der jeweiligen Gemeinde. Jedes Dorf war stolz auf „seine Maria“, die das Jahr über bei einem Bauern auf der „gudn Kommar“ (gute Kammer, ein Raum im Haus, der nicht benutzt wurde) stand. Margarete Semsch
Einsenderin: Margarethe Ulber

Draußen wartete eine kleine Zwischenmahlzeit auf Besucher von nah und fern, und die Bewohner von Tschersing auf die Teilnehmer. Im Anschluß an die gesamte Veranstaltung fand die Weihe der nahegelegenen TschubertKapelle statt. Danke an Malschen für die Rettung der Denkmäler, danke an alle, die mitgeholfen haben und danke für die reiche Beteiligung von bis zu achtzig Personen. Bis zu weiteren Rettungen! Ervin Pošvic, Leitmeritz Herzlichen Dank für Ihre Schilderung dieser verdienten Feier! HT
Schwolbn
Franzl, Peppl und die Schwolbn.
Sooht dar Franzl zunn Peppl: „Sisstn du dou die Schwolbn uffn elektrischn Drohte?“ „Nu frailich sah iech die, doss sain doch zahne, die dou sitzn.“ „Nu sisste, du giehst doch aa schunn ai die Schule und konnst bissl rechnn. Wenn iech jetzte mit enna Puschke enne Schwolbe rundaschissn wierde, wieville tejtn dann noche uffn Drohte sitzn?“ „Nu halt imma nouch naine“, soht dar Peppl. Dou locht obba dar Franzl ieban und soht: „Ee Vugl iss rundagefolln, die andan sain furtgefloon.“ G. Pohlai
Der romantischste Dichter
…in der tschechischen Literaturgeschichte ist Karel Hynek Mácha gewesen.
er kennt nicht den Ausruf Hynek, Vilém, Jarmiieses bekannten Autors aus dem legendären Gedicht „Mai“? Karel Hynek Mácha (1810–1836) besetzt in der tschechischen Literaturgeschichte die Position des berühmtesten Dichters. Der Kult um ihn entstand in Leitmeritz, wo er in jungen Jahren verstarb und sein Begräbnis am Tag der geplanten Hochzeit hatte.
In Leitmeritz lebte er gerade fünf Wochen. Seine Heimat hatte er in Prag, wo auch seine werdende Ehefrau Lori und der frisch geborene Sohn Ludvík lebten. Mácha verliebte sich augenblicklich in die Gegend und plante, sich dort mit seiner Familie niederzulassen. In seinen Briefen schilderte er die Aussicht aus dem Fenster seines Zimmers: „Diese Wohnung gönnten mir die Götter zu ihrem Andenken.“ Die Wohnung auf dem Bischofshügel sollte bald zu seiner Sterbekammer werden, denn er starb dort an einer Durchfallerkrankung. Diese zog er sich angeblich zu, als er, dabei helfend ein Feuer zu löschen, durstig von verseuchtem Wasser trank. Während Mácha in Leitmeritz ein unbekannter Rechtsanwärter einer Anwaltskanzlei war, galt er in Prag als Figur der künstlerischen Gesellschaft. Er erregte Aufmerksamtkeit durch seine Gedichte und Zeichnungen, aber auch durch extravagantes Auftreten und hitzköpfiges Verhalten. „Der Zerrissene“, wie ihn Josef Kajetán Tyl bezeichnete, gehörte zu den Wegbereitern der Romantik in der Prosa und der tschechischen Poesie.

abgehalten. 1938, am Vorabend der nationalsozialistischen Okkupation, wurden die Überreste exhumiert und nach Prag überführt.
Nach anthropologischen Untersuchungen wurde im Mai 1939 das zweite Begräbnis Máchas durchgeführt. Nach dem Krieg kehrten Máchas Knochen nicht nach Leitmeritz zurück. Dieser verkörpert heute im Gegensatz zur früheren nationalen Wahrnehmung eher Liebe, Romantik und jugendliche Begeisterung. Martin Krsek, Museum Leitmeritz
Máchas Tod weckte das allgemeine Interesse an seinem Werk und seiner Person nicht sofort, sein Leitmeritzer Grab war nur ein öder, grasbewachsener Hügel. Erst nach zehn Jahren kümmerte sich Karel Havlíček Borovský dann um einen Grabstein. Das verwaiste Grab sollte schließlich Ort eines nationalen Kults werden. Das Motiv hierfür war nicht nur der literarische, sondern eher der nationale Wert. Im Jahr 1861 entstand auf dem Friedhof ein Denkmal. Eine pompöse, jährliche Totenmesse fand ihren Höhepunkt in einer Pilgerwanderung zum Grab und einer Gedenkfeier im Sterbehaus, wo eine Gedenkplatte hing. Die Anfang des 20. Jahrhunderts erstarkenden Konflikte zwischen Tschechen und Deutschen in den Böhmischen Ländern führten zur Überlegung, Máchas Überreste nach Prag zu überführen, „um sie nicht zwischen den Fremden im Norden zu lassen“. Zu dieser Rückführung kam es jedoch nicht. Der Mácha-Kult wurde weiter ausgeweitet, eine Statue im Zentrum von Leitmeritz folgte. 1936 wurde zu seinem 100. Todestag ein monumentales Fest in der Stadt
Humor
Sprüche an Gräbern
Das Buch „Sudetenland, wie es lachte“ von Viktor Aschenbrenner kennt einige Stilblüten.
„Hier ruhst Du, die im Leben mir lieb und treu bewährt, und hat Dein Herz und Deine Hand zu schlagen aufgehört!“ (Kuttenplan bei Marienbad)
„Hier liegt begraben unser Organist. Warum? Weil er gestorben ist! Er lobte Gott in allen Stunden, der Stein liegt oben, er liegt unten.“
„Der Tod riss mich von Dir, Du Weib so brav und bieder, o wein‘ und bet‘ bei mir, dann geh‘ und heirat‘ wieder.“
„Hier ruht mein lieber Herr Gemahl, der Schneider war in Tal. Ich setz‘ dort an seiner Stell‘ die Arbeit fort mit dem Gesell‘.“

„Der Weg zur Ewigkeit ist gar nicht so sehr weit: Um fünfe fuhr ich fort, um sechse war ich dort.“ (am Grab eines Fuhrmanns)
Viktor Aschenbrenner
Einsender: Georg Pohlai
� Wie es früher war/Leitmeritz
Rückblick: In Leitmeritz vor 100 Jahren
Wer in unseren Tagen die Zeitung aufschlägt, das Fernsehen oder das Radio anschaltet, wird fast überschüttet mit negativen Meldungen: Kriegangst, KlimaKrise, Energiemangel, Migrantenflut, Inflationssorgen, Streiks bei Eisenbahn und im Luftverkehr, geplante Steuererhöhungen und mehr.
Wir fürchten folglich um unseren Lebensstandard, unser Wohlergehen, unser freies selbstbestimmtes Schalten und Walten in einer unruhig gewordenen Welt mit zwei Kriegen in nicht allzu weiter Ferne (in der Ukraine und im Nahen Osten). Müssen wir uns indes berechtigt über alles tiefe Sorgen machen und über alles laut klagen? Sind unsere Ansprüche auf ein
immensen Reparationsleistungen verpflichteten Nachfolgestaaten der untergegangenen beiden Kaiserreiche Deutsches Reich und Österreich-Ungarn gehörte und eine etwas ruhigere Zeit durchleben konnte. Wie man sich damals in Leitmeritz verhielt, ist vielleicht nicht uninteressant und beachtenswert. In einer kleinen Chronik des Jahres 1923, die vor sechzig Jahren in einem Heft des „Leitmeritzer Heimatboten“ abgedruckt wurde, findet man zum Beispiel folgendes: „Am 30. Januar: Ein Aufruf des Bürgermeisters Dr. Prochazka an die Bevölkerung von Leitmeritz, für die hungernden Kinder Deutschlands zu spenden. Es wird ein Ausschuß gebildet, dem Vertreter der deutschen politischen Parteien, der
Bahnhof vom Bürgermeister und mehreren Stadträten empfangen und an die Leitmeritzer Pflegeeltern verteilt“. Beim elften April ist schließlich vermerkt: „Zugunsten der hungernden Kinder in Deutschland findet im Stadttheater eine Aufführung des ,Freischütz‘ von Carl Maria von Weber statt [...]“. Bemerkenswert, Hut ab vor dieser Solidarität, und dies umso mehr, als ja doch die Folgen der Inflation in Deutschland das Wirtschaftsleben im benachbarten Nordböhmen auch nicht ganz problemlos voranschreiten ließen. Denn in derselben Aufstellung heißt es nämlich am siebten Februar: „Demonstration der Leitmeritzer Arbeitslosen. Sie zogen vor das Bürgermeisteramt und die politische Bezirksbehörde und forderten eine
� Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
95 Jahre
06.06.1929, Walburga Lubahn, geborene Vogel, früher Wobrok 90 Jahre 22.06.1934, Erna Tobsch, früher Welleschitz 02.06.1934, Christiana Dähnert, geb. Pillat, früher Ruschowan 85 Jahre 03.06.1939, Edeltraut Weishaupt, früher Munker 80 Jahre
28.06.1935, Susanne Doppstadt, geborene Heidrich
24.06.1940, Sigrid Satzenhofer, geborene Hajek 26.06.1940, Günter Pauer
11.06.1941, Werner Vogel Mirschowitz
27.06.1956, Sonnhild Hofmann Molschen
01.06.1935, Gertrud Pallad, geborene Mosik Mutzke
27.06.1944, Gudrun Händler, geborene Wiese, früher Lewin 45 Jahre 28.06.1979, Ing. Denis Barthel, früher Eilenburg 40 Jahre 06.06.1984, Katrin Greußlich, früher Kundratitz

Nordböhmens nunmehr (seit 1918/19) zur neu gegründeten Tschechoslowakei gehörten, sich unübersehbar der deutschen Sprach- und Volksgruppe in Europa zugehörig fühlten und den im neuen Staat jetzt tonangebenden tschechischen Mitbürgern ihr Deutschsein deutlich bekunden wollten. Heißt es doch auch in derselben Chronik weiter zum 16. September: „Gemeindewahlen. In Leitmeritz haben sich angesichts der Bedrohung unserer deutschen ,Sprachgrenzstadt‘ die Deutsche Nationalpartei, die Deutsche Christsoziale Volkspartei, die Deutsche Gewerbepartei, die Deutsch-Demokratische Freiheitspartei und der Bund der Landwirte zu einer Einheitspartei, der ,Deutschen Partei‘ zusammengeschlossen [...]“. Was dann ab 1933/35 (zur Sicherung des deutschen Kulturlebens und gegen die wachsende

Blick vom Langen Hügel bei Leitmeritz, vorne Schüttenitz und ein Teil von Pohorschan (links). Rechts am östlichen Rand Leitmeritz, dahinter Theresienstadt. Links Podivin und Trnovan, gegenüber Potschapl. Foto: Wikipedia, Aktron
Schauen wir doch einmal kurz einhundert Jahre zurück, als Deutschland (und auch Österreich) ebenfalls in tiefen Krisen steckten, nämlich in einer Hyper-Inflation mit wahrhaftig katastrophalen Auswirkungen, wo Lebensmittel unbezahlbar wurden, geleistete Arbeit nicht mehr vergütet werden konnte und Hunger die Menschen schier verzweifeln ließ, wo das, was eben noch etwa eine Mark gekostet hatte, nur wenige Tage später zehnoder schon hundertmal teurer war, das Geld also fast überhaupt nichts mehr wert war! Bedenken wir dabei freilich, daß unsere nordböhmische Heimat als Teil der nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegermächten England, Frankreich und USA neu geschaffenen Tschechoslowakischen Republik nicht zu den zu
führten Haussammlungen durch. Das Ergebnis der Sammlungen sollte zur Hälfte den Kindern des Ruhrgebietes und der Stadt Dresden zukommen. Die Einwohner werden aufgefordert, beim Bürgermeisteramt zu melden, wer notleidende Kinder aus Deutschland auf einige Zeit aufnehmen will. Es wird berichtet, daß in Leipzig die Hälfte aller Kinder unterernährt ist“. Zum sechsten Februar heißt es sodann: „In der Sitzung der Stadtverwaltung von Leitmeritz wird (gegen die Stimmen der tschechischen Parteien) beschlossen, 2.000 Kč zur Unterstützung der Kinder des Ruhrgebiets zu bewilligen. Für den gleichen Zweck spendet die Braubürgerschaft 1.000 Kč“. Zum 27. März steht danach: „400 Dresdner Kinder kommen nach Leitmeritz. Sie werden auf dem
Familienvater. Es wurde auch eine private Hilfsaktion gefordert, wonach die Arbeiter der vollbeschäftigten Betriebe den Lohn einer Wochenstunde für die Arbeitslosen opfern und die Unternehmen den gleichen Betrag beisteuern sollen. Die politische Bezirksbehörde setzte Gendarmerie ein, um die Demonstration aufzulösen.“
Wie soll man sich die hier angezeigte, richtig bemerkenswerte Offenheit der Leitmeritzer aus Nordböhmen für die sozialen Nöte im benachbarten Deutschland und die enorme Hilfsbereitschaft erklären? Man kann da nur Mutmaßungen anstellen. Aber ganz sicher spielte dabei eine große Rolle, daß Leitmeritz sich als eine überwiegend „deutsche Stadt“ betrachtete und daß die Bewohner, obgleich sie als Deutsche
Die Schlammastike und ihre Wurzeln
„Dea hot obba en Massl gehobt!“ hat in Leitmeritz bedeutet: „Der hat Glück/Schwein gehabt!“
Man wandte das Wort dann an, wenn die Sache hätte schiefgehen können, aber schließlich doch gut ausgegangen war. Im Westjiddischen (Wj.) bedeutet der Massel ‚Glück, Dusel, unverdientes Glück‘. Es wird letztlich aus dem babylonischen Akkadisch abgeleitet, wo mazzaltu ‚Standort der Sternengötter, Konstellation‘ bedeutete. Dieses Wort gelangte über die hebräische Mehrzahlform mazzālōt in das talmudisch-hebräische maz ă l ‚Schicksalsstern, Planet, (unverdientes) Glück, Geschick‘. Auch die ältere Westjiddische Form, massel (‚Sternbild, Glück‘), ist bekannt. Mit dem Grundwort Massel ist auch das Wort der (die, das?) Schlamassel gebildet worden und aus dem Westjiddischen über das Rotwelsch im 18. Jahrhundert ins Deutsche gelangt. Die Vorsilbe schla gehört – mit oder auch ohne Kontamination durch mittelhochdeutsches Schlimm – zur hebräischen Verneinungspartikel šälō‘, še‘ lāw, wodurch die Glück verheißende Bedeutung des Wortes Massel in ihr Gegenteil verkehrt wird: ‚Patsche, schlimme Situation, missliche, verworrene Lage‘. In Österreich, wo das neue Wort besonders gern – und zwar ausschließlich als Neutrum – verwendet wurde, entstand daraus eine Weiterbildung, nämlich die Schlamastik, welche dieselbe Bedeutung aufweist wie die Vorgängerform und fast ausschließlich in Österreich im Alltagsgebrauch als Synonym neben ihr Verwendung findet. Ihre Entstehung und Verbreitung im deutschen Südosten hängt damit
zusammen, daß die Nachsilbe -ik ein slawisches Wortbildungssuffix für Nomina Agentis ist. In die Landmundart des Kreises Leitmeritz ist das Wort wahrscheinlich nicht unmittelbar aus Wien gelangt, sondern erst auf dem Umweg über das tschechische šlamastika, dessen jiddischdeutsche Herkunft von der Wissenschaft anerkannt wird. Die Schlammastike (also mit -e) wird deshalb in der Landmundart bevorzugt, aber: „Do sind ma obba in enne bleede Schlammastik nein kumm“, sagte der Leitmeritzer, der in größte Schwierigkeiten geraten war und nicht wußte, wie er sich aus diesem Schlamm herausretten sollte. Auch vamasseln (‚durcheinander bringen, verderben‘) – eindeutig vom anfangs erwähnten Massel abgeleitet – war in Leitmeritz gut bekannt. Erich Hofmann
Farbenprächtige Straße in Leitmeritz. Foto: Rainer Bach
Tschechisierung und zunehmende Ausbildung eines vorwiegend tschechischen Nationalstaates) schließlich mit der Gründung der Sudetendeutschen Heimatfront/ Sudetendeutschen Partei realisiert wurde, deutete sich also hier schon an: Man wünschte sich, auch wenn viele Deutsche unabänderlich in anderen Nationalstaaten (wie eben in Böhmens Sudetengebieten im Tschechoslowakischen Staat) leben müßten, ein Eingebettetsein in eine große deutsche Kultur- und Schicksalsgemeinschaft. Wir erhalten hier also einen Einblick in die Anfänge der von uns Älteren selbst durchlebten Geschichte, die schließlich in der „Heimholung ins Reich“ und danach fatal in II. Weltkrieg und Verlust der Heimat in Böhmen endete Prof.Dr. Eduard Hlawitschka
Auscha 17.06.1930, Heinrich Baudis Bleiswedel 05.06.1935, Herbert Ende 20.06.1943, Ingrid Schaly, geborene Burgemeister Fulda 09.06.1922, Irmgard Queisser, geborene Will Gastorf 29.06.1935, Luitgard Hoffmann 28.06.1936, Franz Brosche Geweihtenbrunn 28.06.1938,Martha Schubert, geborene Hruschka Groß-Tschernosek 15.06.1936, Eva Gündel Gründorf 24.06.1943, Peter Nosovsky Hermsdorf 04.06.1931, Erika Dellit, geborene Tschakert Hlinay 09.06.1937, Margit Hieke Johnsdorf 26.06.1935, Christine Hillebrand,geborene Janich Klein-Tschernosek 15.06.1945, Willi Seemann Kochowitz 26.06.1932, Dipl. Kfm. GeroldPaul Hocke Komotau 21.06.1963, Lubomir Moudry Kottomirsch 30.06.1930, Anna Hünnefeld, geborene Feigl Krscheschitz 08.06.1938, Gudrun Huszar, geborene Peter Kuttendorf 24.06.1937, Herbert Nitschel Leitmeritz 03.06.1925, Walter Mergl 20.06.1927, Margret Wilhelm, geborene Gandek 29.06.1928, Eva Lehmann, geborene Hiekisch 22.06.1933, Ingeborg Leinweber, geborene Kapfer
� Leserbriefe
Georg Pohlai sinniert über Erinnerungen weckende Telefonate.
Ein Telefonat mit Kurt Hammer aus Alt-Thein ist nicht nur heimatlicher Dialekt, sondern auch öfter die Frage: „Weißt Du noch, damals in Mentau?“ (Dies ist auf die Kinderlandverschickung bezogen, die für viele Kinder der NS-Zeit unschöne, häufig grausame Aufenthalte in Lagern und so genannten „Kinderkurheimen“ bedeutete, fern von der Familie. Anmerkung HT ) Über den Mentau-Aufenthalt kamen wir ins Gespräch und so manches „vu daheeme“ wurde aufgefrischt, so auch der Spruch von Kurt: „Seff blaib dou, du wesst doch nie wies Wata ward, s konn renn, s konn schnain, s konn a wieda bessa sain.“ Georg Pohlai
03.06.1926, Helmut Faber Neudörfel
01.06.1937, Herta Großert, geborene Tröster Neuland
28.06.1927, Helga Schielmann, geborene Kühnel Pohorschan
20.06.1935, Gertrud Schimanek, geborene Mildner Pokratitz
02.06.1933, Angelika Tille, geborene Kummer Prosmik
20.06.1930, Helmut Kohlert Radaun
24.06.1963,Heinz Muchan Schelesen
10.06.1941, Erni Freibott, geborene Richter Sebusein
09.06.1931, Erich Babinsky Strzischowitz 16.06.1932, Marie Vogel, geborene Nagel Suttom
26.06.1935, Edith Walter, geborene Lorenz Trzebutschka 13.06.1932, Christine Biedermann, geborene Wagner Tschakowitz
26.06.1945, Rudolf Stark Tschersing 08.06.1931, Marie Schulze, geborene Bernasch 10.06.1931, Lydia Friedrichs, geborene Reichelt Tupadl 15.06.1933, Irmgard Schöbel, geborene Lindner Weisskirchen
10.06.1933, Elisabeth Marquardt, geborene König Werbitz
08.06.1940, Walter Palme Zebus 24.06.1927, Elisabeth Kieser, geborene Kühnel 21.06.1976, Ingmar Barthel Zierde
27.06.1935, Marianne Hüll, geborene Ostermann Zierde 09.06.1943, Amei Weiß, geborene Lübcke unbekannt 01.06.1962, Bertrand Aull
Ein wichtiges Projekt
Ervin Pošvic, Verfasser des Artikels zur Feier nach Restaurierung der Tschersinger Kirche, möchte auf ein neues, wichtiges Projekt auferksam machen.
Ich bin Ervin Pošvic, ein Oldtimer und Landsmann aus Leitmeritz und mein Hobby ist unter anderem die Geschichte unserer Region und die Restaurierung von sakralen Denkmälern. Ich bin Teil einer Gruppe von Malschen-Freunden, die dasselbe tun. Es gibt ein neues Projekt, das in Malschen und Ritschen ins Leben gerufen wurde. Wir hoffen, daß einige von Ihnen gerne an der Verwirklichung dieses Projekts mitarbeiten würden. Januar anno 2023 bildete sich eine Kernarbeitsgruppe, die gerne eine Institution zugunsten verschwundener Dörfer und Siedlungen gründen wollte: Petr Karlíliček, Direktor des Archivs Aussig, Martin Krsek, Leiter der historischen Abteilung des Museums Aussig, Petr Kůstka, Bürgermeister von Malschen und Zdeněk Petr, Vereinsvorsitzender. MUZOOS entsteht durch die Sanierung des bisherigen Kulturzentrums in Rýdeč (Ritschen). Eine interaktive Ausstellung, Touristeninformation und -Unterkunft, Multifunktionsraum, ein Restaurant und mehr soll es geben. Hier finden Sie alle Informationen: https://www.malecovskyrozhled. cz/projekty/muzzos-de/ Ervin Pošvic/HT
� Unseren Toten zum ehrenden Gedenken
15.03.2024 Christine Altkrüger geb. Zada, im Alter von 94 Jahren, früher Molschen
25.04.2024
Edith Heinrich geb. Zada, im Alter
Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe


Betreuer der Heimatkreise – Aussig: Brigitta Gottmann, Hebbelweg 8, 58513 Lüdenscheid, Tel. 02351 51153, eMail: brigitta.gottmann@t-online.de – Kulm: Rosemarie Kraus, Alte Schulstr. 14, 96272 Hochstadt, Tel. 09574 2929805, eMail: krausrosemarie65@gmail.com – Peterswald, Königswald: Renate von Babka, 71522 Backnang, Hessigheimerstr. 15, Tel. 0171 1418060, eMail: renatevonbabka@web.de – Heimatgruppe Graupen, Mariaschein, Rosenthal und Umgebung: Sibylle Schulze, Müggelschlößchenweg 36, 12559 Berlin, Tel. 030 64326636, eMail: sibyllemc@web.de – Redaktion: Karin Wende-Fuchs, Agg 3, 83246 Unterwössen, Tel. 08641 6999521, Mobil 0157 32215766, eMail: aussiger-bote@t-online.de – Redaktionsschluß: jeweils der 15. des Vormonats.
� Die Villenarchitektur als Ausdruck des industriellen Aufstiegs Aussigs um 1900
Aussiger Villen und ihre ehemaligen Bewohner

Aktuell hält Senator und Historiker Mgr. Martin Krsek Vorträge an der Purkyne-Universität zum Thema Villenarchitektur in Aussig. Die Gebäude, teils aristokratischen Schlössern nachempfunden, zeugen vom Aufstieg der neuen führenden Gesellschaftsschicht der Industriellen. Leider sind bei den Bombenangriffen am 17. und 19. April 1945 wertvolle Zeitzeugen der Architektur für immer zerstört worden, aber der Blick auf noch bestehende Bauwerke lohnt sich.
Wien läßt grüßen: Hübls Villa im Jugendstil Die Jugendstilvilla von Anton Hübl stellt eines der wenigen Beispiele für die Wiener Moderne in Nordböhmen dar. Sie wurde von Otto Prutscher, Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule, konzipiert. Sein

Hauptgebiet waren Möbel, Keramik und Schmuck, als Architekt trat er nur zweimal in Nordböhmen in Erscheinung, in Aussig und Jägerndorf. Die Villa hat den Grundriß eines griechischen Kreuzes. Die exponierte Frontseite ist mit einer halbkreisförmigen Veranda mit Halbsäulen ausgestattet. Erbaut wurde die Villa 1924 von Anton Hübl, Besitzer des größten und ältesten Textilwarenversandgeschäftes in ÖsterreichUngarn. Durch seine Niederlas-
� Geburtstage, die man nicht vergessen darf!
85. Geburtstag unserer Brigitta Gottmann
Liebe Brigitta, bitte entschuldige, daß wir Dich nicht schon früher gewürdigt haben, aber ich hatte Dich einfach noch nicht auf 85 geschätzt… Tag und Nacht im Einsatz, aber immer mit einem offenen Ohr für jedes Anliegen, so kennen und lieben wir Dich. Gesundheitlich angeschlagen, bist Du zwar aus der 1. Reihe zurückgetreten, aber noch immer für die Landsmannschaft im Einsatz.
Am 11. April 1939 wurdest Du in Schwaden geboren. Deine Verdienste um die Heimat kann man gar nicht alle aufzählen, aber die Auszeichnungen wie das Große Ehrenzeichen (1993), die Rudolf-Logman-Plakette (2007) und das Bundesverdienstkreuz (2008) sprechen für sich. Wie viele Treffen und Tagungen hast Du in Deinem Leben organisiert und dabei nie Kosten und Mühen gescheut?

Du warst Landesfrauenreferentin der SL-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen (2001-2022), stellvertretende Bundesfrauenreferentin und BDV-Vorsitzende in Deinem Wohnort Lüdenscheid. Auch die Sudetendeutsche Heimatstube entstand 1995 unter Deiner Leitung.

sung in Wien hatte er Kontakt zu dem damals sehr berühmten Otto Prutscher. Nach dem Krieg diente das Gebäude jahrelang als medizinische Notfallstation. Nach Sanierungsund Umbaumaßnahmen ist es heute privater Firmensitz.
Architektur auf höchstem Niveau: Die Villa von Winnar Der Darmstädter Designer, Maler und Architekt Albin Camillo Müller war einer der berühmtesten Architekten seiner Zeit in Böhmen. Im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ entwarf er die 1932 fertiggestellte Villa als repräsentativen Familiensitz von Alois Winnar, Besitzer der Nordböhmischen Gesellschaft für Wasserwerke, zu dessen Prestigeaufträgen etwa die Wasserleitung zur Schneekoppe, dem höchsten Berg Tschechiens, gehörte.
Wir Aussiger verdanken Dir besonders die gesamte Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Gedenkveranstaltung am 31. Juli auf der Benesch-Brücke (seit ein paar Jahren mit Hilfe des Kulturverbandes in Aussig).
Das „Schwodener Bladl“ gibst Du jedes Jahr um die Weihnachtszeit in Eigenregie heraus und es wird von Dir eigenhändig eingetütet und versandt. 1956, mit Deinem Eintritt in die SL-Kreisgruppe Lüdenscheid, wo Du schon bald Aufgaben im Vorstand übernahmst, wurde auch Dein Ehemann Willi, ein echter Sauerländer, vom „Sudetendeutschen Heimatvirus“ angesteckt. Ein paar Jahre später wurde Willi sogar Obmann der Kreisgruppe Lüdenscheid.
Bei allem Engagement kam aber die Familie nie zu kurz, das können Deine Kinder, Enkel und Urenkel bezeugen. Wir wünschen Dir noch viele frohe, gesunde und aktive Jahre!
Herzlichst Karin Wende-Fuchs im Namen aller Deiner Freunde und Wegbegleiter
Das Werk Müllers hatte international Einfluß auf die moderne Architektur. Die Aussiger Villa konzipierte er als einen symmetrischen Bau mit zwei Erkern, in die er ein Herrenzimmer und ein Eßzimmer mit Wintergarten einbaute. Beide Erker boten durch riesige Fensterfronten einen fantastischen Ausblick auf die Burg Schreckenstein und die Ferdinandshöhe. Der Architekt paßte auch die Innenräume sowie die Innenausstattung vollkommen dem äußeren Design an. So entstand eine Zusammenführung aus Neuer Sachlichkeit, geometrischem Spätjugendstil und Art déco zu einer neuen luxuriösen Stilrichtung. Nach 1945 wurde der Bau zum Pionier-Sitz und später zu einer Edelherberge für besondere politische Gäste, unter anderem den Präsidenten der damaligen CSR.

Im Volksmund wurde die Villa „Regierungsvilla“ genannt.
Anläßlich des 90. Geburtstags von Heinz Edelmann am 20. Juni: Die Villa Stará 13 Die Villa von 1925 zählt zum “Historismus“. Das Mietshaus mit vier Wohnungen ist ein typisches Beispiel seiner Zeit und wurde von Architekt H. Herrmann aus Aussig konzipiert. Interessant sind seine Bewohner.
Bauherr Ernst Grüzner war Vor-

Zum 103. Geburtstag von Dr. Johanna von Herzogenberg
Am 26. Juni 1921 erblickte Johanna von Herzogenberg auf Schloß Sichrow in Nordböhmen das Licht der Welt. Sie studierte in Prag Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie mit ihrer Familie nach Bayern vertrieben. Als Autorin zahlreicher kulturhistorischer Publikationen über die böhmischen Länder und langjährige Geschäftsführerin des Adalbert Stifter Vereins arbeitete sie unermüdlich und zielstrebig an der Vermittlung der gemeinsamen Kultur und Geschichte der Deutschen und Tschechen in den böhmischen Ländern und setzte sich für den deutsch-tschechischen Dialog ein.
Ihre Ausstellungen und Bücher sind bis heute Inspiration für Kunst- und Kulturhistoriker und für alle, die sich für das deutsche
Kulturerbe in den böhmischen Ländern und die Verflechtungen der tschechischen und deutschen Kunst, Kultur und Geschichte interessieren. Für ihr Engagement erhielt sie viele Auszeichnungen, das Bundesverdienstkreuz, den Bayerischen Verdienstorden und die Verdienstmedaille der Tschechischen Republik. An ihrem hundertsten Geburtstag wurde in Prag in einer Veranstaltung an sie erinnert, die von ihren tschechischen Freunden und Kollegen initiiert wurde und an der sich auch der Adalbert Stifter Verein in München beteiligte. Johanna von Herzogenberg starb am 20.2.2012 in München.
Quelle: Aus dem Vorwort der Broschüre „Johanna von Herzogenberg (23. 6. 1921 — 20. 2. 2012)
kriegssenator für die Deutschen Sozialdemokraten in der CSR und mußte im Laufe des Krieges als Gegner der Nationalsozialisten aus Aussig fliehen. In das Haus zog die Aussiger Familie Edelmann mit ihrem zwölfjährigen Sohn und wohnte dort bis zur Vertreibung 1946. Heinz Edelmann zog nach London und wurde 20 Jahre später der weltberühmte Zeichner des Trickfilms „Yellow Submarine“ von den Beatles. Heinz Edelmann starb am 21.7.2009 in Stuttgart. kw Quelle: „Villenarchitektur“, Informationszentrum der Stadt Ústí nad Labem. An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei Zdenka Kovarová (Region Ústí), Tomas Okurka und Jiří Preclík (Muzeum města Ústí nad Labem) bedanken, die mich jederzeit bei meiner Arbeit unterstützen. kw

von
Eine der schönsten Erinnerungen:
Die Kinos unserer Kindheit
Kurt Neis und seine Schwester Marianne Appelt, geb. Neis erinnern sich in den Aussiger Boten Juni und Juli 2004 an ihre Kinozeit in Aussig: Anfang der 1920er-Jahre, mit dem Aufkommen der Filmtechnik, damals noch als Stummfilm, war auch die Stunde des Kinos gekommen. Kino war etwas ganz Neues und ein faszinierendes Erlebnis. Einen ganz wesentlichen Schub gab es mit der Einführung der Tontechnik um 1930. Das war auch der Startschuß für die neuen Aussiger Kinos, wie wir sie noch aus unserer Zeit kennen.
Die Aussiger Kinos waren immer recht gut besucht und erfreuten sich einer großen Beliebtheit. Es gab täglich zwei bis drei Vorstellungen in jedem Lichtspieltheater. Kino, das war damals ein neuzeitliches Vergnügen, das über die Möglichkeiten, die das Theater bieten konnte, weit hinausging. Und die Thematik der Spielfilme hatte eine sehr große Bandbreite: Revuefilme, Spielfilme, Liebesfilme, Heimatfilme, Kriminalfilme, Abenteuerfilme, Kriegsfilme, Romanverfilmungen, historische Ereignisse, national orientierte Filme, aber auch Kinder- und Märchenfilme. In dieser Zeit wurde eine neue Kategorie von Künstlern, die Filmschauspieler, hervorgebracht, die für viele Menschen zum Idol wurden. Der Film spielte aber noch eine andere Rolle, nämlich die mit dem Tonfilm aufkommende Entwicklung der Filmmusik. Fast alle Schlager der 1930er und 1940er Jahre sind als Filmmusik entstanden und wurden über die Kinos verbreitet. Ich kenne diese Kinos noch aus persönlichem Erleben und kann mich nach den beiden Bombardements auf Aussig sehr genau daran erinnern, wie die beiden Lichtspielhäuser „Kammerlichtspiele“ und „Elysium-Lichtspiele“ in Trümmern
� Meldungen
Neues vom Eger-Radweg
Die Eger (Ohře) entspringt in Bayern und mündet bei Leitmeritz in die Elbe. Seit Jahren gibt es einen Eger-Radweg, der teils über stark befahrene Straßen und über holprige Feld- und Waldwege führt. Das soll sich ändern. Der

Bezirk Aussig möchte in seinem Bereich eine asphaltierte Trasse bauen und sucht dafür noch Sponsoren. Der erste Abschnitt mit 3,8 km führt von Leitmeritz nach Libochowitz, der zweite mit 5 km von Saaz nach Kaaden. Insgesamt sind 20 Abschnitte zwischen der Egermündung und der Grenze zum Bezirk Karlsbad fertigzustellen. kw Quelle Sächsische Zeitung 6./7.4.2024
Folge 2

� Treffen
Peterswalder-Königswalder Treffen am 11. und 12.5.2024 in Bad Gottleuba
Die Peterswalder Treffen gibt es seit 65 Jahren. Zum sechsten Mal trafen wir uns nahe der alten Heimat in Bad Gottleuba. 2019 kam die Heimatgemeischaft Königswald dazu. Für diese neu vereinigte Heimatgemeinschaft Peterswald-Königswald war es das zweite Treffen.
Der Nebenraum im Gasthof Hillig in Bad Gottleuba war am ersten Tag mit 38 Personen voll besetzt. Die Begrüßungsansprache von Renate v. Babka wurde von unserer Dolmetscherin Jana Krötzsch für die tschechischen Gäste übersetzt. Anschließend schauten wir gemeinsam den Film des MDR vom ersten Peterswalder Treffen 2011 in Peterswald an, sowie den Film der Bergung des sogenannten Sudetenschatzes in Königswald im Jahr 2015. Im Fokus standen das Wiedersehen mit alten Freunden und der Austausch über die gemeinsame alte Heimat. Dazu passend gab es eine kleine Bilderausstellung.
Am 12.5.2024 unternahmen 23 Teilnehmer einen Ausflug mit dem Bus nach Teplitz. Dort empfing uns die befreundete, der Heimatgemeinschaft nahestehende Stadtführerin und Korrespondentin Jutta Benešová. Sie zeigte der Gruppe die interessante Kurstadt Teplitz-Schönau, in der schon Goethe und Beethoven Anfang des 19ten Jahrhunderts zur Kur weilten. Anschließend gab es im Restaurant des Theaterhauses ein Mittagessen mit gemütlichem Beisammensein. Für die perfekte Organisation und die Durchführung des Ausfluges nach Teplitz-Schönau bedanken wir uns herzlich bei Frau Benešová. Zum Abschluß fand man sich in der Königswalder Kirche ein, die von der Gemeinde Königswald extra für uns geöffnet wurde. Der Dank dafür sowie für die organisatorische Unterstützung am 11.5. gebührt Jiří Danhel aus Königswald. Heimatgemeinschaft Peterswald-Königswald Liane Jung Renate v. Babka 2010 endete auch die Zeit für das „Olympia-Kino“.
lagen und mit ihnen markante Gebäude aus der Innenstadt für immer aus dem vertrauten Bild unserer Stadt verschwanden. Nach 1945 waren für uns Deutsche Kinobesuche nicht mehr erlaubt. Filmvorführungen gab es nur noch für Tschechen. Bis auf eine Ausnahme: Jeder noch nicht vertriebene Deutsche wurde gezwungen ins Kino zu gehen, um sich Filme über die „Verbrechen der Deutschen im
Zweiten Weltkrieg“ anzusehen. Diese Filme waren extra dafür dokumentarisch zusammengestellt worden, um so den Deutschen diese Ereignisse in deutscher Sprache vorzuführen. Der Besuch wurde mit einem Stempel quittiert und galt als grundlegende Voraussetzung für den Bezug einer Lebensmittelkarte. Die verbliebenen Filmtheater
Kino-Eintrittskarte

haben zwar das Ende des Krieges überlebt, aber nach und nach sind sie von der Bildfläche verschwunden, mit Ausnahme des Olympia-Kinos. Heute hat Aussig noch vier Kinos und eine Freilichtbühne für Filmvorführungen: die ehemaligen Olympia-Lichtspiele, das „Kleine Kino“ (Neubau) in Lerchenfeld, das „Corso“ (Neubau) in Schönpriesen in der ehemaligen Ludwigstraße, sowie ein Kino im Haus der Kultur (Neubau) in der Großen Wallstraße. Außer dem Stadttheater gibt es noch zwei kleine Theaterbühnen in Schreckenstein (Stand 2004, heute nicht mehr aktuell, die Red.) kw Quelle: Kurt Neis (†) und Marianne Appelt, AB 06/2004 und 07/2004
� Schmunzel-Ecke

WIR GRATULIEREN
Gebirgs-Ullersdorf in CZ 40011 Usti nad Labem, Stará 2467/37.
Touristen werden registriert
In einem Zentralregister sollen ab 2025 alle Touristen, die in Tschechien in einer bezahlten Unterkunft übernachten, registriert werden. Die Online-Datenbank „e-Turista“ speichert Name, Geburtsdatum, Staaatsangehörigkeit und Aufenthaltszweck. Einsicht in die gesicherte Datei erhalten ausschließlich Finanzamt, Statistikamt und Polizei. Unterkunftsbetriebe, die ihre Gäste nicht registrieren, müssen mit Strafen bis zu 100.000 CZK rechnen.
kw Quelle: Der Grenzgänger, April 2024 (Radio Prag) „Becherovka“ wird nach Polen verkauft
Die lebhafte Geschichte unseres beliebten Kräuterlikörs „Becherovka“ ist noch nicht zu Ende. 1807 begann Josef Vitus Becher
Keine „Colloquia ustensia“ mehr in Aussig Seit 1991 fanden in Aussig die von Professor Dr. Karl-Heinz Plattig von der Ackermann-Gemeinde ins Leben gerufenen „Colloquia ustensia“ statt. Der Teilnehmerkreis hat sich in den 32 Jahren stark gewandelt. Gerade jüngere Interessenten aus der Ackermann-Gemeinde und aus dem grenznahen Sachsen kamen seit der Jahrtausendwende zu dem alljährlich im August stattfindenden 14-tägigen Sprach- und Landeskundekurs nach Aussig. Seit 2006 wurde die Sommerakademie auf tschechischer Seite von Kristian Kaiserová und auf deutscher Seite von Christoph Lippert organisiert. Nicht nur Vorurteile konnten durch die intensive gemeinsame Zeit überwunden werden, es entstanden jahrzehntelange Freundschaften! Leider muß aus organisatorischen Gründen auf tschechischer Seite die „Colloquia ustensia“ schon für dieses Jahr abgesagt werden. Als Trost bleibt der Rückblick auf eine lange gemeinsame Zeit. kw Quelle: Sudetendeutsche Zeitung 19.4.2024
mit der Herstellung des berühmten „Karlsbader Becher-Bitters“. Seit 1922 ist die Marke „Becherovka“ geschützt. 1994 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und seit 2001 gehört „Becherovka“ zur französischen „Pernod Ricar“Gruppe. Im Juni 2024 soll nun der Verkauf von „Karlovarská Becherovka“ an die polnische

Unternehmensgruppe „Maspex“ über die Bühne gehen. kw Quelle: Der Grenzgänger, April 2024 (RP)
Immer mehr Falschgeld in Tschechien
Die Zahl der in Tschechien sichergestellten falschen Banknoten und Münzen ist 2023 deutlich angestiegen. Der 2000-Kronen-Schein ist die am häufigsten gefälschte Banknote. Der Gesamtwert der 2023 aufgegriffenen „Blüten“ beträgt laut Tschechischer Nationalbank 5,6 Mio. CZK, das entspricht etwa 220.000 Euro. kw Quelle: Der Grenzgänger, April 2024 (RP)
Aus dem Schicht-Kalender 1928
Schönes wohlgepflegtes Kopfhaar ist eine Zierde für jeden Menschen und wir können uns manches Gesicht gar nicht ohne diesen umrahmenden Schmuck vorstellen. Nun ist aber schönes volles Haar nicht jedem Menschen gegeben und es erfordert große Ausdauer, um zu diesem Schmuck zu gelangen. Dies ist ein Grund mehr, um einer sorgfältigen Haarpflege ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Grundlage dafür bietet das regelmäßige Waschen des Kopfes. Zum Waschen selbst benutze man am besten lauwarmes Wasser und Elida Shampoo, das nicht nur das Haar, sondern auch die Kopfhaut reinigt. Elida Shampoo verhindert die Schuppenbildung und macht das Haar seidenweich und locker. Gerade die jetzige Mode der Damen, kurzgeschnittenes Haar zu tragen, erfordert regelmäßige Pflege. Die Kopfhaut braucht ihre tägliche Massage mit Bürste und Fingerspitzen. Elida Shampoo gibt einen reichen Schaum, der dazu beiträgt, alle Staubteilchen aus dem Haar herauszuspülen.
n 99. Geburtstag: Am 21.6. Elisabeth FRANZ (Gaudek Liese) aus Schönpriesen/Lieben.
n 97. Geburtstag: Am 11. 6. Margarete DOLESCHAL aus Aussig-Kleische, Laubenhäuser. – Am 28. 6. Emma TUCEK geb. Mühle aus Herbitz in 76149 Karlsruhe, Heideweg 2.
n 95. Geburtstag: Am 11.6. Herta LAUERMANN geb. Thume aus Großpriesen, Tel. 05345 1479. – Am 14. 6. Hans Helmut RÖSLER aus Aussig in 90547 Stein, Oberbüchlein 4. – Am 24. 6. Elfriede KÜHNEL (Krauspenhaar Elli) aus Schönwald in 01816 Oelsen, Oelsener Str. 10. – Am 29.6. Franz LAUERMANN aus Großpriesen, Tel. 05345 1479.
n 94. Geburtstag: Am 10. 6. Gretel WALTHER geb. Paul aus Modlan in 06667 Weißenfels, Im Stadtberg 18. – Am 3. 7. Kurt KRAUS aus Großpriesen in 85630 Grasbrunn, Hans-SailerStr. 12.
n 93. Geburtstag: Am 8. 6. Erich FÜSSEL aus Schreckenstein, Franz-Schubert-Str. 3.
n 91. Geburtstag: Am 12. 6. Leopold MARINI aus Salesel in 73527 Schwäbisch Gmünd, Liegnitzer Weg 6.
n 90. Geburtstag: Am 22. 6. Josef WAGNER aus Troschig.
n 89. Geburtstag: Am 14. 6. Roland POTZNER aus Schreckenstein in 78588 Denkingen, Bergstr. 9. –Am 14. 6. Erna SCHWARZ aus
Abbildung: Schicht-Kalender 1928
n 88. Geburtstag: Am 10.6. Martha WASENAUER geb. Heller aus Tellnitz. – Am 16. 6. Dietmar PILZ aus Aussig, Bertagrund in 06217 Merseburg, Zu den Teichen 4.
n 85. Geburtstag: Am 10.6. Rainer KROMPHOLZ aus Schreckenstein in 84155 Bodenkirchen, Tulpenstr. 7.
n 84. Geburtstag: Am 12. 6. Jürgen WILK aus Aussig. – Am 21. 6. Ursula LEHMKUHL geb. Pschenitzka aus Aussig in 19061 Schwerin, Vossens Tannen 65.
n 73. Geburtstag: Am 4. 7. Norbert EBERT (Schwiegersohn von Luise Böhlein, Schuster Liesl aus Schönwald) in 90766 Fürth, Eulenstr. 1 c.
n 71. Geburtstag: Am 9. 6. Renate von BABKA geb. Beil (Eltern aus Peterswald Nr. 193, Beil-Korl) in 71522 Backnang, Hessigheimer Str. 15. – Am 10.6. Karl Heinz KNAUTHE (Sohn von Ilse Nickel) aus Ebersdorf.
