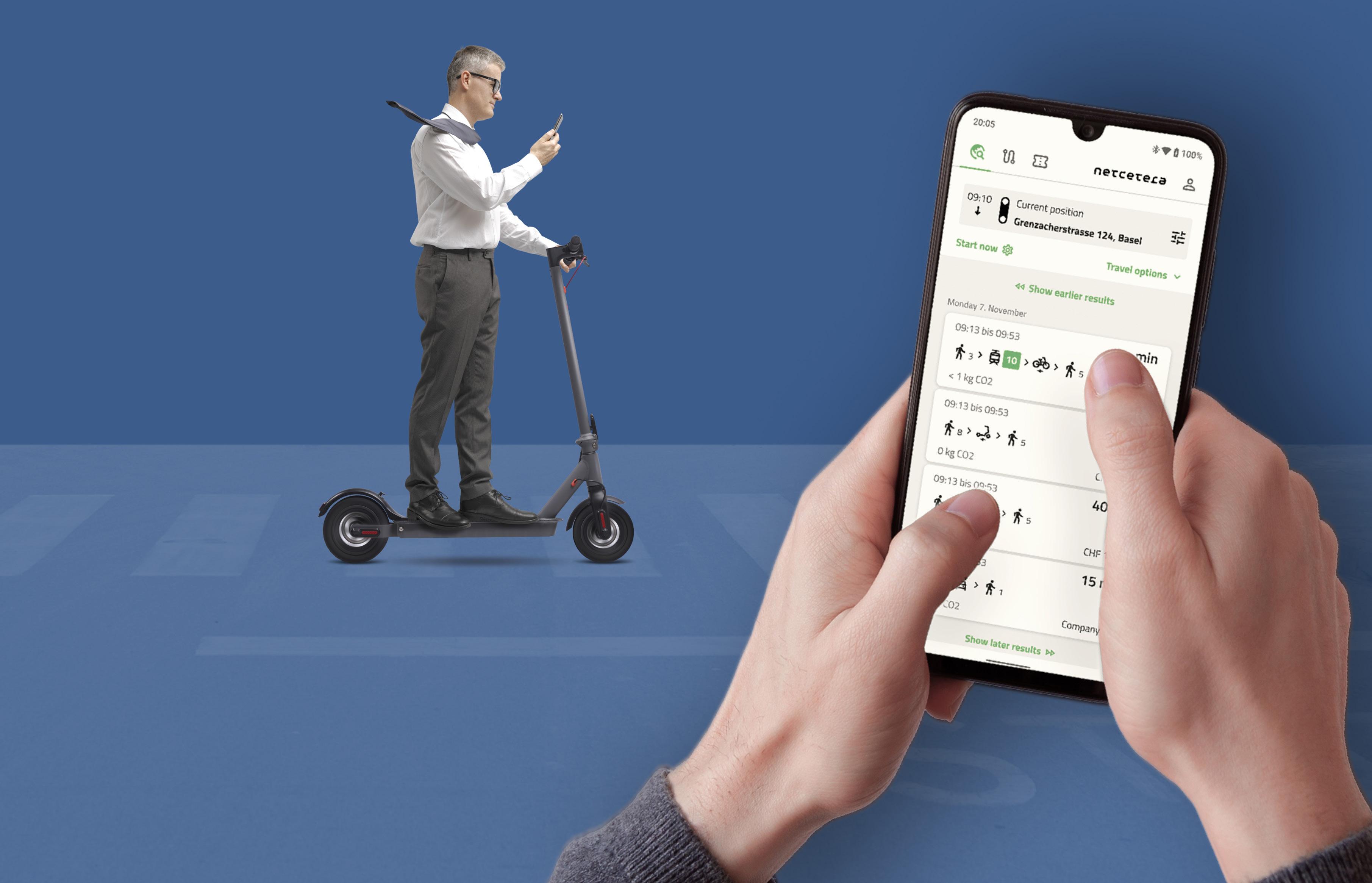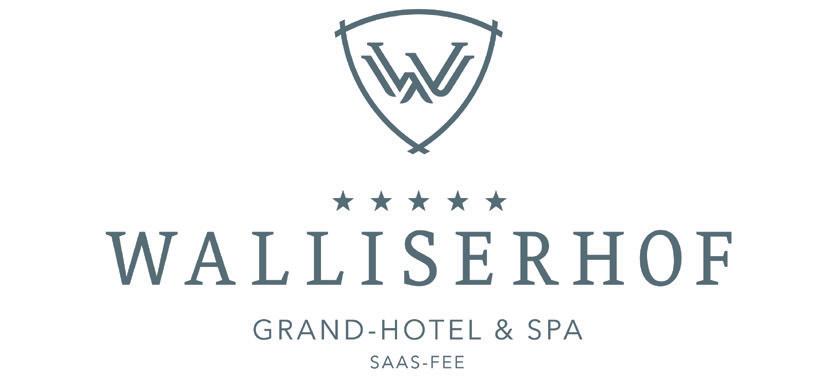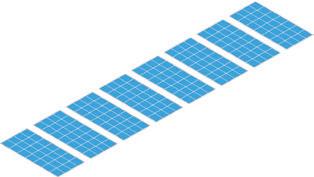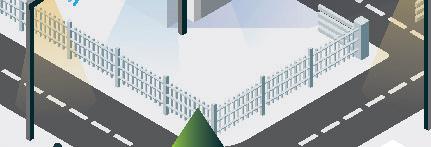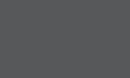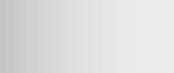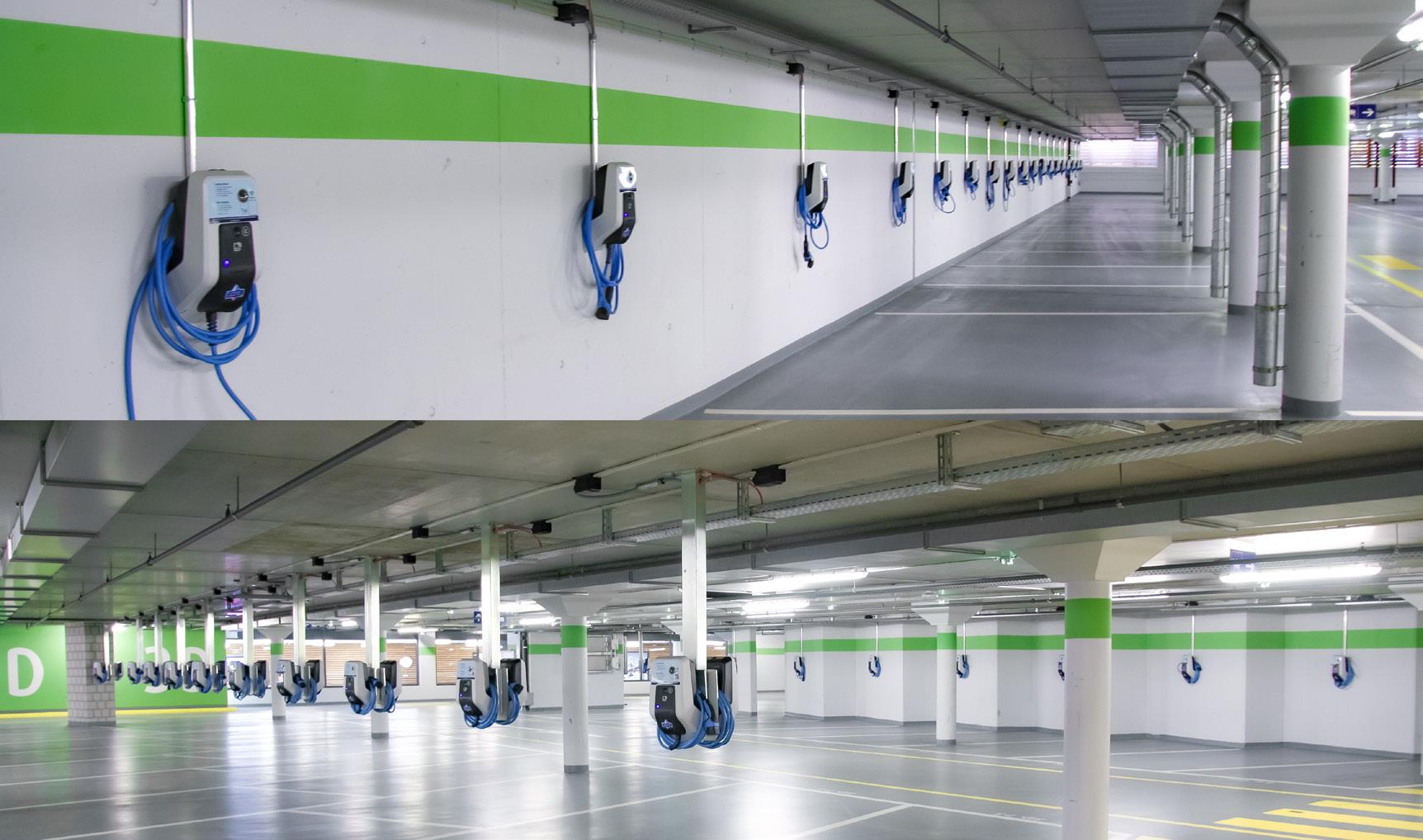MOBILITÄT

Merlin Ouboter
Klein, leicht und elektrisch: Im Interview erzählt Merlin Ouboter, woher die Idee zum Microlino kam und wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte.



Die kontaktlose Autovermietung der Schweiz


#CYBERSICHERHEIT FÜR ALLE Machen Sie den Check unter securitycheck.suissedigital.ch EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
MÄR ‘23 Lesen Sie mehr auf fokus.swiss premium partner weitere info rmationenseite 13
Der Schweizer Mobilitätsverband
Schweizer Mobilität – Welche Wege führen zum Ziel
Die Mobilität befindet sich im Umbruch und das klassische Firmenfahrzeug verliert an Wichtigkeit. Neue Antriebsformen mutieren von klassischem Diesel oder Benzinverbraucher zu fossilfreien Energieverbrauchern. Arbeiten im Homeoffice hat sich etabliert, Onlinemeetings oder Schulungen sind integrierter Bestandteil von nachhaltigen Firmenphilosophien geworden und das tägliche Pendeln reduziert die zukünftig zu berichtenden Ökobilanzen. Welche Mobilitätsformen sind für die Firmen absehbar und was für Mehrwerte kann der Schweizer Mobilitätsverbandes sffv bieten?

Trends bei der Firmenmobilität zeigen auf, dass sich Firmen vom klassischen Firmenfahrzeug distanzieren und sich Richtung einer individuell nutzbaren Mobilitätspauschale annähern. Natürlich werden sich die vielmals beschrifteten Liefer- und Servicefahrzeuge nicht ersetzen lassen, aber die noch eingesetzten «Motivations-Firmenautos», welche keinen wirtschaftlichen Impact haben, werden zunehmend durch alternative Incentives ersetzt werden. Die Strategie von flexibler Mobilität wird sich gegen «Mein Firmenauto/Mein Parkplatz» durchsetzen. Klar nach dem Motto: «Für jeden Anspruch die bestmögliche Mobilitätsform.» Es ist cooler, den Zug zu benutzen, wenn man die Zeit zum Arbeiten nutzen kann oder für die letzte Meile auch einmal auf ein Elektrovelo oder E-Scooter umsteigt. Hierfür werden neue Modelle notwendig werden und auch der steuerliche Aspekt wird neu ausgehandelt werden müssen. Was heisst dies aber alles für die Firmenmobilität? Werden keine Fahrzeuge mehr beschafft werden müssen, sind Abo-Modelle, Carsharing oder Nutzung des öffentlichen Verkehrs das neue Erfolgsmodell. Der Schweizer Mobilitätsverband sffv geht davon aus, dass es eine Kombination sein wird. Neue

Es ist cooler, den Zug zu benutzen, wenn man die Zeit zum Arbeiten nutzen kann oder für die letzte Meile auch einmal auf ein Elektrovelo oder E-Scooter umsteigt.
BRANDREPORT • DRIVING CENTER SCHWEIZ AG
Firmen werden die verschiedenen Verkehrsträger beispielsweise auf einer Firmen-App zugänglich machen und das Abrechnen auch für die Finanzabteilung vereinfachen. In der fragmentierten Anbieterlandschaft ist dies kein einfaches Unterfangen. Für die All-in-One-Lösung aller schweizerischen und europäischen Angebote wird es noch eine Weile dauern. Genau hier kommt der Mobilitätsverband ins Spiel. Die bisherige Strategie: «informieren! vernetzen! unterstützen!» wird weiterhin Bestand haben und das Angebot wird weiter dem Zusammenbringen neuer Modelle und Angebote ausgerichtet. Da das klassische Firmenauto zukünftig vermehrt elektrisch betrieben wird, benötigt es zusätzliche und neue Kompetenzen. Mit der ganzheitlichen Schulung «electrify-now» wird die Ausbildung der verantwortlichen Personen in den Unternehmen berücksichtigt und zusätzliche Fähigkeiten in der Mobilität aufgebaut. Neben den Ausbildungsthemen wird auch die nationale und internationale Vernetzung an Wichtigkeit zunehmen. Verbindungen zu anderen Verbänden und Plattformen wie die Zusammenarbeit mit der Fleet and Mobility Management Fédération Europe (FMFE) sind vorhanden. Die Europäische Zertifizierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM), ist eine länderübergreifende Entwicklung, welche die Mobilitätsstandards messbar macht. In der Schweiz werden die diversen Interessen in der Roadmap Elektromobilität des Bundes zusammengefasst und eine Vielzahl von Initiativen verfolgt. Genau diese Initiativen werden den zukünftigen Mobilitätswandel beflügeln und neue Modelle und Möglichkeiten zur Marktreife führen.

PROJEKTLEITUNG
DAVID KOHLER

COUNTRY MANAGER
PASCAL BUCK
PRODUKTIONSLEITUNG
ADRIANA CLEMENTE
LAYOUT
SARA DAVAZ, JOEL STEINER
TEXT
JULIA ISCHER, KEVIN MEIER, RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN, SMA
TITELBILD
ANDREA ZAHLER / CH MEDIA
DISTRIBUTIONSKANAL
TAGES-ANZEIGER
DRUCKEREI
DZZ DRUCKZENTRUM AG
SMART MEDIA AGENCY.
GERBERGASSE 5, 8001 ZÜRICH, SCHWEIZ
TEL +41 44 258 86 00
INFO@SMARTMEDIAAGENCY.CH
REDAKTION@SMARTMEDIAAGENCY.CH

FOKUS.SWISS
Geübte Verkehrsteilnehmende für sichere Strassen
Seit über 40 Jahren erhöht das Driving Center Schweiz die Verkehrssicherheit. Wie das mit Fahrkursen geht, erklärt Geschäftsführer Hannes Gautschi im Interview.

werden können. Wenn sich jeder Einzelne darin verbessert, wird der Verkehr allgemein sicherer.
Welche Meilensteine gehören zur Firmengeschichte?
Hannes Gautschi, wie können Fahrkurse die Gesamtsicherheit des Strassenverkehrs verbessern?
Das Driving Center ist ein Kompetenzzentrum, das die Förderung von Fahrsicherheit sowie EcoDrive zum Ziel hat. Das Problem heute ist, dass sich immer mehr Verkehrsteilnehmende mit verschiedenen Fahrzeugen den eingeschränkten Platz teilen. Durch die Fahrkurse können die individuellen Fähigkeiten verbessert werden, indem man gefährliche Situationen viele Male trainiert. Denn in einer Notsituation muss es schnell gehen und Skills müssen im Bruchteil einer Sekunde intuitiv abgerufen
1977 wurde aus der Emil Frey Gruppe die Stiftung für sicheres Autofahren gegründet. Schon damals war auch die Antischleuderschule in Regensdorf ASSR Mitglied. Kurz danach entstand das Verkehrssicherheitszentrum Veltheim in einer Kalk-Zement-Grube inklusive Theorieräumen – ein Novum! Eine weitere Neuheit waren die Eco-Drive-Kurse, die erstmals Ende der 1980er-Jahre durchgeführt wurden. Damals sollten insbesondere Chauffeure ihre Lastwagen als Werkzeug ressourcenschonend betreiben können. Heute sind sie für alle gedacht – inklusive E-Autofahrende.
Weil der Landbesitzer der Anlage in Veltheim Eigennutzung seines Geländes beanspruchte, musste der Standort Veltheim aufgegeben werden. Wir haben uns entschlossen den Marktbedürfnissen noch gerechter zu werden und uns entsprechend zu dezentralisieren. So betreiben wir das Driving Center in Safenwil. Dazu kommen die Standorte
der ASSR in Regensdorf und Sennwald sowie Kooperationen mit anderen Anlagen, beispielsweise in Gstaad und Zernez für Winterfahrtrainings und das WAB Zentrum Ulrichen im Oberwallis als auch Rennstrecken für schnelles Fahren. Fahrsimulatoren runden das Angebot ab, um möglichst viele Situationen abbilden zu können.
Welche Philosophie verfolgt das Driving Center?
Um die Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen und die CO2-Emissionen senken zu können, gibt es ein breites Angebot von Kursen für alle Teilnehmerschichten von Neulenker:innen bis Senior:innen, von Motorrad- bis Lastwagenfahrenden. Zur Philosophie gehört auch, dass wir ein professionelles, qualitativ hochstehendes und modernes Institut sind. Und: Die Praxis und ein wenig Spass dürfen nie zu kurz kommen.
Wie wird die Qualität sichergestellt?
Das Driving Center ist ISO 9001 zertifiziert. Ausserdem pflegt man eine enge Zusammenarbeit mit der Quality Alliance Eco-Drive und dem Fonds für Verkehrssicherheit. Regelmässig


finden auch Teilnehmerbefragungen statt, um auf dem neuesten Stand der Bedürfnisse zu bleiben.
Was umfasst das Angebot?
Einerseits gehören die obligatorischen WAB-Kurse für Neulenker:innen und CZV-Kurse für Lastwagenführer:innen zum Angebot. Andererseits bietet das Driving Center auch ein Programm für freiwillige Weiterbildungen an, insbesondere zur Erhöhung der Fahrsicherheit aber auch Eco-Fahrtrainings. Natürlich gehören auch Winter- und Sportfahrtrainings dazu. Dies können Gruppenkurse für individuelle Teilnehmende oder teilweise auch Einzeltrainings sein. Ebenfalls bieten wir Kurse für Profis an, in Form von Fahrlehrerweiterbildungen. Darüber hinaus sind auch Pakete und Firmenevents möglich, zum Beispiel in Verbindung mit Emil Frey Classics.
Weitere Informationen unter drivingcenter.ch
Text Kevin Meier

FOKUS.SWISS
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA 2 EDITORIAL 04 12 06 20
04 Mobilität von morgen 06 Smart Mobility 10 Interview: Merlin Ouboter 12 Smart City 16 Nachhaltige Mobilität 20 Cargo sous terrain
Text Patrick Bünzli Präsident Der Schweizer Mobilitätsverband sffv
Viel Spass beim Lesen! David Kohler Project Manager
FOKUSMOBILITÄT.
LESEN SIE MEHR
Bild iStockphoto/den-belitsky
Hannes Gautschi Geschäftsführer Driving Center Schweiz AG
Tin Altstetten wohnen Sie in einer familienfreund lichen Umgebung und profitieren gleichzeitig von einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Wenn Sie Ihren Traum vom Eigenheim in der Stadt aufs Schönste umsetzen möchten, finden Sie in unserem repräsentativen Stadthaus das perfekte Angebot. Hochwertige Architektur mit elegantem Ausdruck
Die Architektur des Gebäudes fügt sich perfekt in das sich wandelnde Quartier ein. Die äussere Erscheinung des Hauses ist dreiteilig konzipiert mit Betonung der Vertikalität. Der Sockel strahlt mit seiner Lamellenfassade aus jadegrünem Klinker Eleganz aus. Darüber liegt ein lavendelfarbener Gebäudekörper, der bei den Fenstern mit senkrechten Mauerblenden sowie Deckenstirnen aus Klinker geschmückt ist. Zuoberst setzt ein silberfarbenes Schrägdach aus Metall dem Haus die Krone auf. The Fifteen wird mit einer effizienten Erdsonden-Wärmepumpenheizung beheizt, auf dem Dach sorgt eine Photovoltaikanlage für eine gute Energiebilanz.

The Fifteen ist ein typisches Xania-Projekt, das
Wohnen mit kurzen Distanzen
Elegante Eigentumswohnungen in Zürich
che Lebenspläne zugeschnitten. Hier fühlen sich sowohl urbane Familien als auch städtische Paare und Singles zu Hause. Die hellen Wohnräume sind allesamt mit einem Aussenraum verbunden –im Erdgeschoss mit grosszügigen Sitzplätzen und Gartenanteil, in den oberen Geschossen mit gut besonnten Balkonen. Das Raumkonzept ist auf eine Trennung von Tag und Nacht ausgerichtet.
Die Bereiche Wohnen/Essen und Küche sind von den Schlafräumen klar separiert. Die Schlafräume befinden sich meist im Norden. Das Architektenteam hat aber nicht nur auf Wohnlichkeit geachtet, sondern auch ganz praktische Vorzüge eingeplant: Mit Ausnahme der 2.5-Zimmer- Wohnungen verfügen alle Wohnungen über ein separates Reduit für Waschmaschine und Tumbler.
Zürich Altstetten: städtisch und naturnah Das mit Abstand grösste Stadtquartier Zürichs wird immer mehr zum lebendigen Trendgebiet. Hier pulsiert das Leben, und es wimmelt von kleinen Läden, Restaurants, Take-aways und Dienstleistern aller Art. Zürich-Altstetten verbindet urbanes

beiden grossen Einkaufszentren Neumarkt und Letzipark im Nu. Trotz dieser einzigartigen Vielfalt und Dynamik verfügt dieser aufstrebende Zürcher Stadtteil auch über ruhige Wohnquartiere. Eines davon ist das Gebiet zwischen Werdhölzlistrasse und Bachmattstrasse, das zu Recht den Namen «Im Herrlig» trägt.
Die besten Partner für den Innenausbau In den kuratierten Showrooms von Xania in Zürich und von Trendline in Neuägeri entdecken Sie die Designkonzepte unserer Ausbaulinien optisch, haptisch und im Zusammenspiel von Farben und Materialien. Die Zusammenarbeit mit Designbrands von internationalem Renommee ermöglicht es Ihnen, Ihren zukünftigen Lebensraum nach höchs ten Ansprüchen auszugestalten. Dabei können Sie auf beste Beratungsqualität zählen: Ein Ansprech partner begleitet Sie im gesamten Prozess – von der inspirativen Produkt- und Materialpräsentation im Showroom über die genaue Erfassung Ihrer Wün sche und Vorstellungen bis hin zur erfolgreichen, passgenauen Umsetzung in der Wohnung. Die Küchen von Poliform stehen für klare Linien, edle

Die Limmatstadt rangiert in Bezug auf Lebensqualität regelmässig unter den Top 3 in den weltweiten Rankings. Zürich verdankt seine Beliebtheit nicht nur der traumhaften Lage am See und an der Limmat, sondern auch der Einbettung in die Natur und der Nähe zu den Bergen. Der Kantonshauptort zeichnet sich aus durch eine einzigartige Infrastruktur, einen hervorragenden medizinischen Versorgungsstandard sowie ein vielfältiges Bildungs-, Ausbildungs- und Kulturangebot.

Autonomes Fahren: Fünf




vielversprechende Projekte
Weltweit gibt es zahlreiche Unternehmen und Start-ups, die daran arbeiten, die Vorstellung eines selbstständig fahrenden Verkehrsmittels Realität werden zu lassen. «Fokus» verschafft einen kleinen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.
Schon seit längerer Zeit ist die Menschheit davon fasziniert: So hat beispielsweise 2002 der berühmte Regisseur Steven Spielberg in seinem Film «Minority Report» ein selbstfahrendes Auto geschaffen. Genau solche Fortbewegungsmittel sollten heutzutage eigentlich im Strassenverkehr teilnehmen können, wie diverse Wissenschaftler:innen und Expert:innen vor ein paar Jahren voraussagten. Dies ist aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich geworden und die Schlagzeilen über Unfälle, die aufgrund des eingeschalteten Autopiloten passiert sind, häufen sich. Dennoch gibt es momentan einige aussichtsreiche Pilotprojekte.
Selbstständiger Lieferdienst in Ebikon
Seit dem 8. Februar 2023 testen die Migros und Schindler gemeinsam einen selbstfahrenden Lieferdienst im luzernischen Ebikon. Entwickelt und gebaut wurde der sogenannte «Migronomous» vom Startup Loxo. Wie die Migros in einer Pressemitteilung schreibt, können Mitarbeitende von Schindler während der jetzigen Testphase Bestellungen aufgeben, die in der Migros-Filiale in der Mall of Switzerland von Angestellten zusammengestellt und anschliessend in das autonome Lieferfahrzeug geladen werden. Dieses transportiert die bestellten Produkte dann mit maximal 30 km/h zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler. Pro Ladung können höchstens 64 Einkaufstaschen geliefert werden. Das Ziel
dieses Piloten sei es, «vertikale Mobilität mit innovativen, selbstfahrenden Transportoptionen zu verknüpfen. Vernetzte Transportlösungen können Städte lebenswerter und nachhaltiger machen und einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten», wie Christian Studer, Head of New Technologies bei Schindler, gegenüber der Migros sagt.
Autonomes Bussystem in Israel
In vier verschiedenen Regionen Israels werden seit zwei Jahren autonom fahrende Busse im Strassennetz erprobt. Der Staat arbeitet dabei mit den vier Busunternehmen Egged, Dan, Metropoline und Nativ Express zusammen, die gleichzeitig auch die selbstständig fahrenden Busse zur Verfügung stellen. Die Fahrzeuge der ersten zwei sind vor allem für längere Strecken zwischen einzelnen Städten zuständig, die anderen fahren hauptsächlich im Nahverkehr in Südisrael, beispielsweise in Tel Aviv. Wird die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen, sollen die Busse auch weiterhin im öffentlichen Verkehr im ganzen Land eingesetzt werden.
Automatisierter ÖV in Deutschland, Norwegen und der Schweiz
Am 1. Oktober 2022 lancierte die Europäische Union ein Projekt, um ein autonomes öffentliches Verkehrsnetz umzusetzen. Während vier Jahren werden nun in Kronach, Genf und Oslo zusammen mit 23 europäischen Partnern aus den drei Branchen
Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Verkehr
bis zu 45 autonome Shuttles getestet. Diese können mit maximal 60 km/h Personen transportieren, bisher aber jeweils nur am Stadtrand und nicht in den Innenstädten. Wie Projektkoordinator Lars Abeler in einem Interview mit der Deutschen Bahn betont, liegt das Ziel des Projekts vor allem darin, «die Wirtschaftlichkeit autonomer Verkehre zu stärken».
Selbstfahrende Taxis in Phoenix
Vor etwa fünf Jahren startete die Firma Waymo, entstanden aus einer Abteilung von Google, den Testbetrieb von selbstfahrenden Taxis in den Vororten von Phoenix in den Vereinigten Staaten. Der Ort ist für ein solches Pilotprojekt ideal: Zum einen sind es in den USA einzig die Gesetze Arizonas, die autonome Fahrzeuge auf den Strassen erlauben. Zum anderen stimmen die Voraussetzungen. Breite Strassen, die schachbrettartig angeordnet sind, wenige Fussgänger:innen oder Velos und vor allem wenig Niederschlag, der die Sensoren des Autos stören kann. Denn obwohl das Unternehmen auf der Website vom «erfahrensten Fahrer der Welt» spricht, haben die Taxis in unerwarteten Situationen Probleme und blockieren dadurch den Verkehr. Aus diesem Grund sind die «Robotaxis Waymo One» momentan noch von einer vermehrten Nutzung ausgeschlossen. Sie verkehren inzwischen aber auch in Downtown Phoenix und in San Francisco, wo jedoch stets noch ein menschlicher Fahrer oder eine menschliche Fahrerin im Auto sein muss.
Selbstständig fahrende Trucks aus Toronto
Das seit 2021 bestehende Start-up Waabi in Toronto, Kanada möchte einen Schritt weitergehen als andere Hersteller und autonomes Fahren mit künstlicher Intelligenz verbinden. Ein Programm kreiert Simulationen in einer digitalen Welt und ermöglicht es so den Fahrzeugen, mithilfe des Machine Learnings Situationen immer wieder neu einzuschätzen und darauf zu reagieren. Das aus diesen Daten Gelernte hilft den selbstfahrenden Lastwagen, mit den zusätzlich angebrachten Sensoren und Kameras unbekannte oder seltene Gegebenheiten im Strassenverkehr besser meistern zu können. Die Gründerin des Unternehmens ist die spanische Forscherin Raquel Urtasun, die an der EPFL in Lausanne doktorierte. Das Start-up hatte zu Beginn rund 80 Millionen US-Dollar Kapital, namhafte Investoren sind Uber und Kholsa Ventures, welche unter anderem auch an Open AI beteiligt sind. Momentan teste das Unternehmen die Technologie vor allem bei Truckern für Langstreckenfahrten, da die Strassenverhältnisse viel einfacher und weniger komplex seien als in einer Innenstadt, so Urtasun gegenüber 10vor10 . Die Trucks fahren momentan durch mehrere Gebiete in den USA.
Text Julia Ischer
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 4 MOBILITÄT VON MORGEN
Ab iur aut facest percimin cumquis quis doloreria consero int lam, omnit quati volessenis re rae por sunt ea etur as ut opti te net landel eius.
Litem quiatia iuscid et ipicabo rporem dollenda net eum re nobis es molesec erehent faccuptation cum renihil lessectur, nonsedia dolore.
EFC_Inserat_Tagesanzeiger.indd 1 09.01.23 14:13
Bahnhofplatz 2, 5745 Safenwil Utoquai 55, 8008 Zürich
Bild iStockphoto/metamorworks
ANZEIGE
Das Zweitauto ist passé
Mit Enterprise GO werden klassische Autovermietung und Carsharing in einer einzigen, leicht bedienbaren App innovativ miteinander verbunden. So kann das gemietete Auto selbstständig zu jeder Tages- und Nachtzeit an einem der vielen Standorte in der gesamten Schweiz bezogen werden. Enterprise Schweiz will damit Anreize schaffen, in Zukunft auf das eigene (Zweit-)Auto zu verzichten.


Schweizweit zeigt sich zunehmend, welche Herausforderungen die stetig wachsende Mobilität einer modernen Gesellschaft mit sich bringt: Klimaziele, Verkehrsberuhigung oder Parkplatzmangel sind dabei nur einige der städteplanerischen Vorgaben, um diese zu lösen. Gleichzeitig halten neue Mobilitätsangebote Einzug im urbanen Raum – Konzepte, welche Mobilität vor allem als Chance verstehen. Im Fokus der städtischen Mobilitätslösungen stehen dabei flexible Mietmodelle für Fahrzeuge, die je nach Bedürfnis ergänzend zum Zuge kommen – inter- und multimodal.
Enterprise Schweiz präsentiert mit Enterprise GO die Mobilitätslösung für eine urbane und nachhaltige Zukunft – für Privatpersonen, Firmen wie auch die öffentliche Hand.
Einfache Registrierung in der App
Das Angebot von Enterprise GO besteht seit Sommer 2022 und wurde aufgrund hoher Nachfrage kontinuierlich ausgebaut. Partnerschaften mit den SBB, verschiedenen Hotels, Gemeinden und Neubausiedlungen zeugen von einem Konzept, das Anklang findet. Um das Angebot zu nutzen, benötigt man die dazugehörige App, die aus dem Appoder Play Store gratis heruntergeladen und instal-
Da bei Enterprise
individuell bestimmbare Mietdauer gebucht – die Kilometeranzahl ist bei jeder Buchung unbegrenzt. Je nach Bedürfnis können zusätzliche Extras wie Skiträger, Kindersitz oder Schneeketten bestellt werden. Da bei Enterprise GO das Handy als Autoschlüssel fungiert, kann die Miete am angegebenen Startdatum und zur gewählten Zeit einfach in der App gestartet werden und der digitale Schlüssel wird aktiviert, um das Auto zu öffnen. Sobald der Mietzeitraum zu Ende ist, retourniert man das Fahrzeug wieder an einem der jeweiligen Standorte und verriegelt es mit dem Schlüssel in der App.
Zahlreiche Vorteile und Services
Da bei Enterprise GO alles digital ohne Schalter abläuft, können Nutzerinnen und Nutzer das Auto jederzeit beziehen – ob tagsüber oder mitten in der Nacht. Durch die grosszügige Auswahl an neuen Fahrzeugen unterschiedlicher Kategorien und den stabilen, transparenten sowie fairen Mietpreisen ist für jede Person die passende Option dabei. Alle Autos entsprechen zudem den aktuellen Sicherheits- und Umweltstandards und werden regelmässig überprüft, wenn nötig ausgewechselt und nach jeder Miete gereinigt und desinfiziert. Zusätzlich profitiert man von einem Pannenservice, der jeden Tag in der Woche 24 Stunden erreichbar ist.
Über 10 000 Registrierungen in einem halben Jahr
Seit der Lancierung der App letzten Sommer haben sich bereits mehr als 11 000 Personen davon begeistern lassen und nutzen das Angebot von Enterprise GO. Darunter sind einerseits private Verkehrsteilnehmer:innen wie Geschäftsleute, Tourist:innen oder Einheimische als auch Firmen und Akteure der öffentlichen Hand. Ein weiterer Aspekt für dieses breite Spektrum sind die zahlrei-
Zweitauto schrittweise obsolet. Dies entlastet Verkehr, Umwelt und das Portemonnaie. Mittlerweile ist Enterprise GO an über 40 Standorten zu finden. Und in Zukunft?
Enterprise GO lanciert soeben ein nächstes Pilotprojekt mit den SBB, um so die Kooperation weiter auszubauen. Das Unternehmen testet aktuell, wo es an Park-and-Rail-Standorten möglich sein wird, ein Auto hinzubestellen. «Es macht nicht an jedem Bahnhof Sinn, permanent Autos stehen zu lassen. Vielmehr können wir einige dieser schon vorhandenen P+R-Parkplätze für unsere Autos nutzen und diese zum benötigten Zeitpunkt dorthin bringen. Dadurch müssen Menschen, die in der Peripherie leben, kein Zweitauto kaufen», so Marco Venturini. Das Projekt läuft noch bis Ende März, erweist sich aber bereits jetzt schon als grosser Erfolg.
Des Weiteren sieht sich das Unternehmen in Neubausiedlungen mit einer beschränkten Anzahl an Parkplätzen als ideale Lösung. Wenn es nicht für jede Wohnung genügend Möglichkeiten gibt, um die eigenen Autos abzustellen, können Mieter:innen die Enterprise-GO-Fahrzeuge zu jenen Zeiten nutzen, in denen sie sie brauchen und sind nicht auf ein bis zwei Parkplätze pro Person angewiesen.
ist unbestritten und Enterprise GO stellt die Weichen für eine nachhaltige Mobilität in der Schweizer Gesellschaft.
Einige Zahlen und Fakten zum staunen In der Schweiz gibt es momentan über 1,7 Millionen private Zweitfahrzeuge. Dabei wird ein privates Fahrzeug durchschnittlich nur eine Stunde pro Tag genutzt (das Zweitfahrzeug noch deutlich weniger) und steht die restliche Zeit auf einem Parkplatz. Durch den Gebrauch eines Autos von Enterprise GO können ganze elf solcher privaten Fahrzeuge ersetzt werden.
Über Helvetic Motion AG
liert werden kann. Nach Angabe der entsprechenden Zahlungsdaten registriert man sich anhand eines Enterprise-GO-Profils. Dieses wird durch das Hochladen des Führerausweises, der Identitätskarte oder des Passes und eines Selfies verifiziert. Zusätzlich benötigt das Smartphone nur noch genügend Akku und eine aktive Bluetooth-Verbindung.
In wenigen Schritten auf der Strasse Einmal registriert, erhält man Zugriff auf eine vielseitig aufgestellte Fahrzeugflotte – spontan und flexibel. Via App wird das gewünschte Auto für eine
chen Standorte in der ganzen Schweiz, die sich sowohl in Städten als auch an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie grossen Bahnhöfen und Flughäfen befinden.
Zusammenarbeit mit den SBB Neben mehr als zehn weiteren Partnern arbeitet Enterprise GO mit den SBB zusammen und bildet die ideale Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. So deckt Enterprise GO bei einer Reise die individuellen Mobilitätsbedürfnisse für die letzte Meile ab. Das «öffentliche Auto» macht durch seine flexible und spontane Konfiguration das eigene

Auch die Umwelt dankt!
Aufgrund der einzigartigen digitalen Verknüpfung von Autovermietung und Carsharing entspricht Enterprise GO den Bedürfnissen der modernen Mobilität, die individuell miteinander kombiniert werden können. Kund:innen profitieren von günstigen Mietkonditionen und statischen Preisen. Zudem entlastet es den Stadtverkehr und unterstützt eine urbane und nachhaltige Zukunft. Dies ist auch der Fall, weil das Konzept eine echte Alternative zu einem möglicherweise unnötigen und teuren Zweitauto sein kann. Der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer
Die Helvetic Motion AG ist in der Schweiz offizieller Franchisepartner der Marken Enterprise, National und Alamo und bietet eine Flotte von mehr als 2'000 Fahrzeuge sowie über 20 verschiedene Marken zur individuell konfigurierbaren Miete an – ob Stunden, Tages-, Nacht- oder Monatsmiete. Das Unternehmen betreibt zudem am Zürcher Flughafen den Valet Park-Service Speedparking. Mit Hauptsitz in Kloten, vier Standorten für klassische Autovermietung an allen wichtigen Flughäfen und grösseren Städten der Schweiz sowie über 40 selbstbedienten Standorten beschäftigt die Helvetic Motion AG rund 120 Mitarbeiter
Weitere Informationen unter enterprise-go.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
ENTERPRISE RENT-A-CAR, HELVETIC MOTION AG • BRANDREPORT 5 #FOKUSMOBILITÄT
GO alles digital ohne Schalter abläuft, können Nutzerinnen und Nutzer das Auto jederzeit beziehen – ob tagsüber oder mitten in der Nacht.
Text Julia Ischer Bilder zVg
Marco Venturini Geschäftsführer, Helvetic Motion AG
Wie steht es um die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität in der Schweiz?
Aktuell ist von Politiker:innen und in den Medien regelmässig zu vernehmen, dass es zu wenige Ladestationen gäbe. Wie sieht die Situation der öffentlichen Ladeinfrastruktur tatsächlich aus?
Noch vor wenigen Jahren war von den meisten Elektromobilität-Spezialist:innen zu hören, dass eine Ladegeschwindigkeit von 20 kW DC/Gleichstrom, was einer Zuladung von ca. 60 bis 80 km Reichweite pro Stunde entspricht, vollkommen ausreiche. Es wurde angenommen, dass E-Fahrzeuge hauptsächlich in Städten genutzt werden und nur wenig Reichweite benötigen. Heute wissen wir, diese Meinung war komplett falsch! Die modernen E-Fahrzeuge erlauben inzwischen Reichweiten von über 500 km und ermöglichen auch komfortable Langstreckenfahrten.
Es werden in der gesamten Schweiz ständig neue Ladestationen mit immer mehr Leistung gebaut. Im öffentlichen Bereich sind dies vorwiegend DC-Ladestationen mit Leistungen von 150-350 kW. Je nach Fahrzeug kann so eine Reichweite von 300 bis 1000 km pro Stunde geladen werden. Das heisst, dass in kürzester Zeit eine Batterie für mehrere Hundert Kilometer geladen ist. Die Ladegeschwindigkeit wird in Zukunft weiter zunehmen. Erste Hersteller von Ladestationen haben bereits 400-kW-Anlagen lanciert. Sowohl Elektrofahrzeuge wie auch Ladestationen erreichen im Vergleich zu den Ladevorgängen vor einigen Jahren deutlich grössere Leistungsabgaben oder Leistungsaufnahmen. Im E-Lastwagen Bereich werden Ladeleistungen von über einer MW möglich sein.
Bereits jetzt sind die Ladeparks ausreichend gross, werden weiterwachsen und verfügen damit über immer mehr Anschlüsse. Damit gibt es nur sehr selten Engpässe oder Wartezeiten an den Ladestationen. Die meisten Elektroauto-Besitzer:innen laden ihre Batterien an den DC-Schnellladestationen in der Regel nicht voll auf, sondern laden im Durchschnitt 20 bis 25 kWh, was einer Reichweite von 100 km entspricht. Dies hat damit zu tun, dass Ladeevents an öffentlichen Ladestationen bis zu sechs Mal teurer sind als beispielsweise zu Hause, da die Ladeinfrastruktur

BRANDREPORT • OPTEC
amortisiert werden muss. Das heisst, dass E-Autofahrende genau berechnen, wie viel kWh sie benötigen, um nach Hause oder ins Büro zu kommen, um dann dort günstiger laden zu können.

Neben dem Ausbau von bestehender Ladeinfrastruktur wird weiterhin intensiv in neue Projekte investiert. Marktgrössen wie Ionity, Tesla, Groupe E, GoFast und weitere Akteure investieren weiterhin grosse Summen, um der ständig wachsenden Zahl von E-Autos
gerecht zu werden. Laufend werden neue Anlagen gebaut und viele weitere Projekte mit mehr als 20 Ladestationen an einem Standort sind in Planung. Die Motivation dieser Investoren ist unterschiedlich. Einige kommen aus der Fahrzeugindustrie und investieren, um den Kauf eines E-Fahrzeuges attraktiv machen zu können. Andere bauen ein Geschäftsmodell mit dem Verkauf von Charge-Events aus. Das Schweizer Netz an Ladestationen ist bereits sehr dicht: Inzwischen ist es bereits eine Herausforderung, für öffentliche Ladeinfrastrukturstandorte
an attraktiver Lage zu finden. Die meisten Raststätten und Rastplätze auf Schweizer Autobahnen sind bereits ausgerüstet oder an der Umsetzung von Projekten. Verschiedene Firmen suchen deshalb Land neben dem Nationalstrassennetz. Hier muss vielfach zusätzlich Geld für WC-Anlagen und Verpflegungszonen investiert werden. Dabei wird meist auch eine Überdachung gefordert, damit Kund:innen während des Zahlungs- und Registrationsprozesses nicht im Regen stehen müssen. Mit zunehmender Anzahl von E-Fahrzeugen wird das Businessmodel dieser Investoren aufgehen und mehr Geld zur Verfügung stehen, um die Infrastruktur noch kundengerechter zu bauen. Ein Ärgernis der E-Auto-Kundschaft an Ladestationen sind oft überhöhte Roamingtarife. So bezahlen Autofahrer:innen beim Laden in fremden Netzen häufig happige Zuschläge. Inzwischen nimmt der Druck zu, dies zu ändern. Technische Lösungen sind bereits vorhanden: Es ist jedoch nötig, dass sich die Ladenetzbetreiber dazu an einen Tisch setzen und gemeinsam eine kundenfreundliche Lösung erarbeiten. Wie viel Druck die Branchenverbände, Politik oder die Wettbewerbskommission ausüben muss, um die Situation zu bereinigen, bleibt abzuwarten. Eine ähnliche Situation bestand um die Jahrtausendwende im Bereich der Mobilfunkanbieter. Bereits heute geht die Zürich Versicherung mit dem ZVoltApp mit gutem Beispiel voran. Die Zürich Versicherung hat mehrere Ladenetzwerke angebunden und kann so einen schweizweiten Flatrate-Tarif in einem dichten Netz von AC- und DC-Anlagen von attraktiven 49 beziehungsweise 55 Rappen anbieten.
Alle Elektrofahrzeugbesitzer:innen, welche zu Hause eine Ladestation haben, laden ihre Fahrzeuge in der Regel zu Hause oder bei längeren Strecken an öffentlichen Schnellladeinfrastrukturen. Hingegen fehlen Ladestationen für Personen, welche zu Haus nicht die
Möglichkeit haben, zu laden. Dies können Personen sein, welche keinen Parkplatz besitzen und regelmässig in der blauen Zone parkieren oder aber die Verwaltung einer Immobilie bietet seinen Mieter:innen keine Ladeinfrastruktur. Für diesen Personenkreis benötigt es Langzeit-Parkmöglichkeit mit Ladeinfrastrukturen in Gemeinden, in Shoppingzentren und auf öffentlichen Parkplätzen. Bei den DC-Schnellladestationen können viele Fahrzeuge pro Tag beladen werden, da die durchschnittliche Verweildauer weit unter einer Stunde liegt. Bei den AC-Langsam-Ladestationen, benötigt jedoch eine Batterie mehrere Stunden, um geladen zu werden. Das bedeutet, dass maximal zwei bis drei Fahrzeuge pro Tag geladen werden können, was einen rentablen Betrieb solcher Ladestation verunmöglicht und sie für Investoren nicht interessant macht. Hier müssen von der Politik, der Wirtschaft und den Branchenverbänden neue Modelle gefunden werden, um auch diese Ladelösungen anzubieten. Eine solche Möglichkeit könnten Schnellladehubs in Innenstädten und bei Einkaufszentren sein. Während des Einkaufs könnten so Fahrzeuge in kürzester Zeit beladen werden. Mit Reichweiten der E-Fahrzeuge von mehr als 500 km benötigen viele E-Fahrzeugbesitzer:innen keine Ladestationen mehr, da der Schweizer Durchschnitt der Fahrstrecken bei lediglich 38 km liegt. Ein oder zwei Schnellladungen während des Einkaufs würden also für viele Nutzenden von E-Fahrzeugen vollkommen reichen. Trotz einiger Herausforderungen, welche in den kommenden Jahren gemeistert werden müssen, führt heute kein Weg an der Elektromobilität vorbei. Wenn die Schweiz die gesteckten CO2-Ziele erreichen will, ist einer der grossen Hebel der Verkehr, welcher für über 30 Prozent der CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich ist. Die Zukunft gehört der Elektromobilität!
Text Peter Arnet, BKW
Ladestation: Flexibles System statt starre Insellösung
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Doch die Wahl einer passenden Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist alles andere als leicht zu treffen. Glücklicherweise kann man sich auf die Expertise der Optec AG verlassen.
Heute gekauft – morgen obsolet. Das ist der Albtraum aller Konsumentinnen und Konsumenten. «Und auch die Nutzerinnen und Nutzer von E-Fahrzeugen äussern uns gegenüber oft die Furcht, dass sie auf das falsche Produkt setzen könnten», erklärt Tobias Schneider. Er leitet bei der Optec AG, dem Ansprechpartner Nummer eins für das Messen, Analysieren und Optimieren elektrischer Energie, den Bereich «Elektromobilität». Die Kundschaft wünsche sich verständlicherweise Ladeinfrastrukturen, die möglichst viele Jahre funktionstüchtig bleiben. «Und genau dabei können wir sie unterstützen.»
Die Fachleute der Optec AG klären dafür die örtlichen Gegebenheiten ab und führen eine genaue Bedarfsanalyse durch. So ist etwa die Installation
mehrerer Ladestationen in einem Wohnblock oder einem Gewerbebau komplexer als das Anbringen einer Einzelstation an einem Einfamilienhaus. Doch nicht nur der Umfang einer Installation spielt gemäss Tobias Schneider eine entscheidende Rolle bei der Wahl der passenden Ladelösung: «Das Produkt muss ebenfalls Updates unterstützen, damit die Anlage auf dem neusten Stand bleibt.» Es lohne sich daher, bei der Wahl der Komponenten einer Ladestation etwas mehr zu investieren. «Denn anders als bei einer günstigen Insellösung muss man die Anlage dann nicht bereits nach fünf oder zehn Jahren austauschen.»
Die Optec AG berät sowohl Planer, Architekten, Installateure als auch Private zu diesem Thema.
Gemeinsam besser
Eine zukunftssichere Ladestation sollte auch ein guter Teamplayer sein: Denn optimalerweise lassen sich verschiedene Gewerke, wie eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe, damit kombinieren. Auch hier gibt es für Ein- und Mehrfamilienbauten unterschiedliche Lösungen. Die Ladestationen, welche die Optec AG anbietet, lassen sich im Falle eines Einfamilienhauses über
den «Solarmanager» in eine bestehende Umgebung integrieren. Bei grösseren Siedlungen oder Gewerbeliegenschaften hingegen muss oft ein abgesetztes Lastmanagement erstellt werden. «Mit unseren Systemen können wir die Lasten individuell steuern und optimieren, wobei wir auch in diesem Bereich herstellerunabhängig sind», führt Schneider aus.

Generell wird bei der Optec AG Herstellerunabhängigkeit grossgeschrieben. Auf diese Weise gewährleistet man für die Kundschaft maximale Flexibilität und garantiert die Langlebigkeit der gewählten Lösung. «Daher sind bei den Systemen unserer Ladestationen die führenden Hersteller bereits integriert.» Um wirklich sicherzustellen, dass bei der Installation von Ladestationen keine unvorhergesehenen Hürden auftauchen, empfiehlt Tobias Schneider: «Am besten zieht man uns möglichst frühzeitig in ein Bau- oder Sanierungsprojekt mit ein.»
Weitere Informationen finden Sie unter: www.optec.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 6 SMART MOBILITY
Bild iStockphoto/SouthWorks
Es werden in der gesamten Schweiz ständig neue Ladestationen mit immer mehr Leistung gebaut.
Tobias Schneider Leiter E-Mobilität
Die mobile Ladestation, die Barrieren abbaut
Dass der elektrischen Mobilität die Zukunft gehört, ist mehrheitlich unbestritten. Doch sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen sowie die öffentliche Hand tun sich mit der Umstellung auf E-Fahrzeuge oft schwer. Als Mitgrund werden oft die teuren sowie unflexible Ladestationen angeführt. Glücklicherweise hält die BKW Power Grid hierfür eine innovative Lösung parat.
Auf einen Blick: die Vorzüge von mobi-charge
Die mobile Ladestation mobi-charge eignet sich für folgende Einsatzzwecke:


• Für den temporären Einsatz, z.B. an Veranstaltungen
Wir würden eigentlich sehr gerne auf elektrische Fahrzeuge umsteigen, doch unglücklicherweise ist das Laden von ECars und Co. so umständlich. «Solche und ähnliche Argumente hören wir leider immer wieder», meint Dominik Schütz schmunzelnd. Als Leiter Projekte Mittelland der BKW Power Grid arbeiten er und sein Team unter anderem an neuen Energielösungen für den Mobilitätsbereich. Dabei steht auch das Ziel im Fokus, hinsichtlich dem Laden von E-Fahrzeugen aufzuklären und Vorurteile abzubauen. «Und am besten tut man dies bekanntermassen mit konkreten, nützlichen Praxislösungen», führt Schütz aus. Eine solche hat die BKW Power Grid mit «mobicharge» geschaffen – der innovativen, mobilen Plugand-Play-Ladestation für den öffentlichen Raum. Das Gerät ist ein veritabler Gamechanger: «Bisher sah der klassische Ansatz so aus, dass die Ladestationen fix in die bestehende Infrastruktur verbaut werden», erklärt der Experte. Dies führt einerseits zu erheblichen Kosten und erlaubt andererseits nur eine äusserst starre und eindimensionale Nutzung. Mit mobi-charge hingegen haben die Expertinnen und Experten der BKW eine attraktive Alternative geschaffen: Es handelt sich hierbei um ein «steckerfertiges» System, das überall dort eingesetzt werden kann, wo eine entsprechend ausgelegte Stromquelle vorhanden ist.
Überzeugen durch Erfahrung
Wie vielfältig die Anwendungsbereiche der mobilen Ladestation sind, zeigen die diversen Success Cases, die Dominik Schütz und sein Team mit mobi-charge bereits realisieren konnten. «In der Vergangenheit befanden wir uns zum Beispiel im Gespräch mit einer Schweizer Gemeinde, die Interesse an Ladestationen für E-Fahrzeuge geäussert hatte.» Doch angesichts der zu erwartenden Investitionen wollte man von Seiten der Gemeindeverwaltung das Vorhaben vorzeitig beerdigen. Dank mobi-charge konnte man aber die geforderte Ladekapazität anbieten – und dies zu deutlich geringeren Kosten, als die Installation fixer Ladestationen aufgeworfen hätte. «Das verschaffte den Entscheidungsträgerinnen und -trägern der Gemeinde die Möglichkeit, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und das Ladesystem zu einem optimalen Preis zu testen», führt Schütz aus. Auf diese Weise konnte reale Praxiserfahrung gesammelt und in der Bevölkerung Goodwill für das Thema E-Mobilität geschaffen werden. Und genau dies kann später den Weg zum Bau fixer und umfangreicherer Ladestationen ebnen. Die mobi-charge-Ladestation eignet sich auch für den Einsatz auf Wohn- und Firmengrund. Dank des praktischen Plug-and-Play-Systems kann beinahe überall ein Platz für die Station gefunden werden. Dadurch sind die Geräte auch prädestiniert für einen

temporären Einsatz, zum Beispiel im Rahmen von Events. Doch wie sieht es eigentlich mit der Ladeleistung aus? Was, wenn auf einem Platz oder an einem Gebäude nicht die benötigte Netzspannung zur Verfügung steht? «Kein Problem», beruhigt Schütz. «Mit unserer Lösung können wir die Ladeleistung so parametrieren, dass sie den Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Kundinnen entspricht.» Die Expertinnen und Experten der BKW Power Grid verschaffen sich zu diesem Zweck vor Ort einen Überblick über die konkreten Gegebenheiten – und klären dabei auch ab, welche Leistung das vorhandene Netz hergibt. «Dann passen wir die Ladestationen entsprechend an.»
Von der mobilen zur fixen Lösung
In den meisten Fällen werden die mobi-charge-Ladestationen, welche die BKW Power Grid selber in der Schweiz produziert, an die Kundinnen und Kunden vermietet. «Das hat sich in der Vergangenheit bewährt, weil unsere mobilen Anlagen perfekt dafür geeignet sind, um Testprojekte durchzuführen und erste Anwendungserfahrungen zu sammeln», führt Schütz aus. Oftmals werden dann nach einer gewissen Zeit fixe Ladeinfrastrukturen installiert, weil sich die mobilen Systeme bewährt haben. «Und natürlich stehen wir den Projektverantwortlichen auch bei diesem Vorhaben gerne mit Rat und Tat zur Seite», betont der Fachmann. Dabei könne die BKW die gesammelten Erkenntnisse und Daten nutzen, die während des Betriebs von mobi-charge gesammelt wurden. Dies helfe dabei, die optimale, festinstallierte Ladeinfrastruktur zu konzipieren und umzusetzen.
Doch was muss man konkret tun, um von den Möglichkeiten von mobi-charge zu profitieren? «Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Gespräch», erklärt Dominik Schütz. Dabei werden die Bedürfnisse unserer Kundinnen ebenso
abgeklärt, wie die Bedingungen und Möglichkeiten der geplanten Location. In einer nächsten Phase verschaffen sich die BKW-Fachleute einen Eindruck vor Ort und passen die mobi-charge-Ladestationen auf die individuellen Gegebenheiten an. «Und selbstverständlich stehen wir auch während des Betriebs sowie danach zur Verfügung, um Fragen oder Anregungen von Kundenseite zu beantworten.»
mobi-charge@bkw.ch
Über die BKW Gruppe
Die BWK Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen, welches integrierte Gesamtlösungen in den Bereichen Energie, Gebäude und Infrastruktur anbietet. Die BKW ist ein wachsendes Netzwerk und besteht aus über 11’500 Mitarbeitenden in 140 Unternehmen in der Schweiz und Europa. Eine zukunftsfähige Energieproduktion, ressourcenschonende Infrastrukturen sowie umweltschonende Gebäude gehören zum Hauptfokus der Gruppe. Die Expertinnen und Experten beraten Kundinnen und Kunden beim Engineering, bei der Gebäudetechnik und bei einer smarten Energiebeschaffung. Sie planen und realisieren Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte für Unternehmen, Private und die öffentliche Hand.
• Für den Einsatz an Standorten mit saisonal schwankendem Bedarf oder schwankender Frequentierung wie Freibäder oder Bergbahnen
• Zum Sammeln erster Erfahrungen mit E-Ladestationen hinsichtlich Technologie, Kundenbedürfnisse und -volumen
• Zum Bestimmen des optimalen Standortes Mobile Ladestationen stehen bereits in mehreren Gemeinden im Kanton Bern im Einsatz. Die meisten Kunden wollen die Kundenbedürfnisse klären und sehen, ob sich der Teststandort für eine feste Lösung eignet.
Technische Daten der Ladestation:
Anzahl Ladepunkte: 2 bis 10
Leistung: bis zu 22 kW AC (Wechselstrom) pro Ladepunkt
Gewicht: ca. 120 kg
Aufstellfläche: ca. 0,6 m x 0,6 m
Technische Anschlussbedingungen:
Steckdose CEE 32A oder CEE 63A
Mobilfunk (LTE Cat. M1 / 2G / GPRS) oder WLAN
Abrechnung:
Standardlösung gemäss Vorschlag BKW oder oder individuell gemäss Kundenwusch. Freischalten der Ladung mittels RFID-Karte, Smartphone oder Lade-App.
Mietdauer:
• Für Veranstaltungen: 1 bis 4 Wochen
• Für Saison- oder Dauereinsatz: 4 bis 48 Monate
Verfügbarkeit: auf Anfrage
Preis: auf Anfrage
BKW Energie AG Power Grid

Galgenfeldweg 18
3006 Bern
mobi-charge@bkw.ch
Kontaktpersonen
Schütz, Dominik dominik.schuetz@bkw.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA #FOKUSMOBILITÄT BKW POWER GRID • BRANDREPORT 7
Dominik Schütz Leiter Projekte Mittelland, BKW Power Grid
Wenn aufladen genauso schnell geht wie tanken
Die vergleichsweise lange Ladedauer von Elektrofahrzeugen stellte bis anhin immer einen Negativ-Faktor dar, der sich nicht wegdiskutieren liess. Doch dank einer innovativen Technologie macht Brugg eConnect nun ein Schnellladen in ganz neuem Ausmass möglich. Damit eröffnet man neuen Industriezweigen den Weg in die nachhaltige E-Mobilität.
Anhalten, auftanken, weiterfahren. So schnell und einfach geht das Tanken von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren vonstatten. Wer hingegen auf die umweltschonende E-Mobilität setzt, musste bis anhin deutlich mehr Geduld aufbringen: Selbst mit den marktgängigen Schnellladeinfrastrukturen dauert es zwischen 15 und 20 Minuten, um die Batterie so weit aufzuladen, dass man die Fahrt mit einer sinnvollen Reichweite fortführen kann. Die dabei verlorene Zeit ist mit ein Grund dafür, dass verschiedene Industrien bisher vom Sprung in die EMobilität absehen mussten. Hierzu gehören etwa die Baubranche sowie die Landwirtschaft. Aufgrund der ladebedingten «Zwangspausen» war die Wirtschaftlichkeit von E-Flotten in diesen Segmenten schlicht und einfach nicht gegeben. «Doch nun bricht auch für sie die E-Zukunft an», betont Patrick Kern, CEO von Brugg eConnect. Den Grund für diesen Optimismus erfuhren die Besucherinnen und Besucher der Baumaschinenmesse BAUMA kürzlich aus erster Hand. Dort nämlich stellte Brugg eConnect das erste 3000
A Megawatt Charging System (MCS) vor. Als Spezialist für innovative Kabel- und Steckerlösungen hat das in Windisch ansässige Unternehmen einen grossen Beitrag zum Gelingen dieses Projektes geleistet.

Das MCS-System ist auf die Leistungsstufen 350 A, 1000 A und 3000 A und damit für die Nutzung bei grösseren Fahrzeugen ausgelegt. Zum Vergleich: Während bei gängigen Schnellladesystemen rund 15 Minuten ins Land ziehen, bis man weiterfahren kann, lädt das Megawatt Charging System denselben Wagen in weniger als einer Minute auf. Damit habe man hinsichtlich Geschwindigkeit die
Lücke zum Tanken mit fossilen Brennstoffen praktisch geschlossen, sagt Patrick Kern. «Wir machen damit das elektrische Fahren deutlich wettbewerbsfähiger und öffnen so für verschiedene Marktsegmente die Tür hin zu Elektrifizierung und Dekarbonisierung.» Denn dank der enorm kurzen Ladezeit verbessert sich die Wirtschaftlichkeit insbesondere bei grossen Lastfahrzeugen deutlich. Derzeit befindet sich das MCS System noch im Prototypenstatus, doch das Ziel von Brugg eConnect besteht darin, die Technologie möglichst zeitnah verfügbar zu machen.
Kein Dreck, weniger Lärm – eine Win-Win-Situation Gerade die Baubranche könne von der neuen «ExperessLadetechnologie» enorm profitieren: Nebst der Tatsache, dass keine Abgase ausgestossen werden, würden die grossen Baulaster auch deutlich weniger Lärm verursachen. Davon profitiert nebst den Mitarbeitenden auf den Baustellen auch die Anwohnerschaft. In Skandinavien wurden bereits positive Erfahrungen gesammelt mit
BRANDREPORT • MOBILITÄTSVERBAND
Baustellen, auf denen mehrheitlich elektrische Fahrzeuge zum Einsatz kamen. «Doch natürlich wollen wir mit unseren Schnellladestationen die Elektromobilität für alle ermöglichen», betont Patrick Kern. Denn eine AC-Wallbox-Ladestation sei wegen unterschiedlicher Herausforderungen nicht für alle umsetzbar. «Hier leisten wir mit unseren ‹High Power Charging (HPC)›Systemen einen wesentlichen Beitrag. Auch unsere Stecker für PKW-Ladestationen sind nicht einfach nur tolle Produkte, sondern ein Beitrag zur Dekarbonisierung.» So hat Brugg eConnect beispielsweise den ersten HPC-Stecker mit der höchsten Sicherheitsstufe IP69 auf den Markt gebracht. Dieser ist hochrobust gegenüber Druck, extremen Temperaturen und Staub. Er hält es sogar aus, wenn ein LKW darüberfährt. So sorgt der Stecker mit dafür, dass Ladestationen nicht ausfallen.
Historisch gewachsen Dass gerade Brugg eConnect in der Elektromobilität mit innovativen Kabellösungen auftrumpft, ist an sich nicht überraschend, sondern vielmehr eine logische Konsequenz: Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Welt der Baustellen- und Industriekabel. Vor einigen Jahren wurde der Fokus dann auch auf die E-Mobilität und Windenergie gesetzt. Patrick Kern erinnert sich an den Schritt, den er zwar als mutig bezeichnet – aber nicht als gewagt. «Denn obschon wir uns damals in neue Gewässer wagten, wussten wir stets, dass wir uns durch unsere Kundennähe sowie unsere Qualität von der Konkurrenz abheben können.» Dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung über ein so grosses Know-how für Spezialkabel verfügt, war ein weiterer Faktor, der für die neue Ausrichtung sprach. «Darüber hinaus sahen wir bereits damals das grosse Wachstumspotenzial dieser
Ein Lehrgang, der moderne
Corporate-Mobility-Fachleute

beiden Bereiche», erinnert sich der CEO. Heute hat sich die strategische Neuausrichtung als goldrichtig erwiesen. Und auch die Aussichten sind vielversprechend, denn während Elektroautos den Anfang der E-Revolution markierten, folgen nun vermehrt Nutzfahrzeuge wie Lastwagen, Baufahrzeuge, Schiffe und Kleinflugzeuge nach.

Text SMA
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bruggeconnect.com
Über BRUGG eConnect
BRUGG eConnect ist ein junges Unternehmen mit alten Wurzeln. Vor über 125 Jahren durch Gottlieb Suhner gegründet, zählt BRUGG eConnect heute zu einem der führenden Kabelherstellern weltweit. Die 130 Mitarbeitenden entwickeln und fertigen Kabel und Systemlösungen für die Industrie, Windkraftanlagen und E-Mobilität. Dabei bietet BRUGG eConnect heute nicht nur Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen an und verfügt darum über eine dezidierte Fachkompetenz im «Engineer to Order (ETO)»-Kabeldesign.
hervorbringt
Die Dekarbonisierung der Mobilität ist eine von vielen möglichen Massnahmen, um die geforderte Reduktion von CO2-Emissionen umzusetzen. Doch die konkrete Umsetzung wirft bei vielen Flottenverantwortlichen Fragen auf. Der Schweizer Mobilitätsverband sffv liefert die passenden Antworten dazu – im Rahmen seines brandneuen Lehrgangs «electrify – now».
Ralf Käser
Vorstandsmitglied beim Schweizer Mobilitätsverband sffv

Ralf Käser, die Mobilität durchläuft einen Transformationsprozess. Welche Auswirkungen hat dies auf Unternehmen?
Wir vom Mobilitätsverband stellen seit Langem fest, dass hinsichtlich Dekarbonisierung und betrieblicher Mobilität noch immer viele Unklarheiten bestehen. Unternehmen aller Branchen und Grössen fragen sich berechtigterweise, wie sie ihre CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig ihre Mobilitätsbedürfnisse abdecken können. Bisher fehlte es hierzulande an einer einheitlichen Plattform, einem ganzheitlichen Lehrgang sowie an praxistauglichen Tools, die den Flotten- und Mobilitätsverantwortlichen in den Betrieben die notwendige Orientierung hätten bieten können. Durch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern haben wir festgestellt, dass das Wissen sowie die Angebote hierzu sehr fragmentiert sind. Diese Erkenntnis hat uns dazu bewogen, Abhilfe zu schaffen.
Und wie gehen Sie dafür konkret vor?
Wir haben den neuen Lehrgang «electrify – now» ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Industrien haben wir einen Lehrgang kreiert, der sich an die Verantwortlichen von Unternehmensflotten richtet und sie dazu befähigt, die Einführung sowie das Management von Elektrofahrzeugen in Unternehmen erfolgreich umzusetzen.
Welche Herausforderungen werden im Rahmen von electrify – now adressiert?
Bei der Entwicklung der Lehrgangsinhalte standen diverse Fragestellungen im Raum. Tatsache ist: Die
CO2-Reduktion gehört zu den wichtigsten Agendapunkten, sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Kontext. Gleichzeitig handelt es sich bei der Elektromobilität um ein hochgradig komplexes Thema mit vielen Unbekannten, Unsicherheiten und «Halbwahrheiten». Verantwortliche und Mitarbeitende in Unternehmen sind mehr denn je auf fundierte Fachkompetenz sowie Kenntnisse rund um Flotten- und Mobilitätsmanagement im Alltag angewiesen. Genau hier setzen wir an: Die Teilnehmenden sollen dazu befähigt werden, die Dekarbonisierung in ihrem jeweiligen Betrieb erfolgreich voranzutreiben. Dabei werden Fragen behandelt wie: Welche Unterschiede bestehen im Bewirtschaften von normalen und elektrischen Flotten? Welche Finanzierungsformen gibt es? Wie kommt man zu den entsprechenden Fördergeldern?
Und welche Konsequenzen hat der Wandel auf der technischen Ebene? Zudem schaffen wir Orientierung und zeigen auf, wie das aktuelle Angebot an E-Fahrzeugen eigentlich aussieht und worin die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle und Technologien liegen. Mit diesem wichtigen Grundwissen «im Gepäck» sind die Absolventinnen und Absolventen von electrify – now dazu in der Lage, die vermittelten Kompetenzen und Ansätze in ihrem individuellen unternehmerischen Umfeld erfolgreich zu implementieren Und wie vermitteln Sie dieses wichtige Grundwissen? Wir setzen auf den modernen und dennoch bewährten Ansatz des «blended learnings». Die Inhalte werden also primär online vermittelt, damit die Teilnehmenden entsprechend ihrer Vorkenntnisse gewisse Inhalte schneller durcharbeiten oder auf Wunsch auch repetieren können. Einmal im Monat findet zudem ein Webworkshop statt, bei dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, im direkten Austausch mit unseren Fachleuten relevante Themen zu vertiefen. Dabei können sie auch den Dialog mit den anderen Studierenden suchen. Was unseren Ansatz
auszeichnet: Wir bieten eine enorme Menge an relevanten, textunterlegten Videoinhalten an, ebenso wie klassische Nachlesestrukturen, die man ähnlich wie Wikipedia navigieren kann. Diese Tools stehen den Absolventinnen und Absolventen auch nach ihrer Zeit bei electrify – now zur Verfügung. Auf diese Weise helfen wir ihnen dabei, in ihrem sich schnell wandelnden Berufsumfeld am Puls der Zeit zu bleiben.

Zu guter Letzt kann auch während eines Workshops das Erlernte in einem Use Case umgesetzt werden.
Wird eine Abschlussprüfung durchgeführt?
In der Tat. Der Kurs kann jederzeit begonnen werden. Sobald man sich verbindlich anmeldet, wird der sechsmonatige Lernslot geöffnet. Während dieser Zeit erhält man Zugriff auf die angesprochenen Lerntools und Inhalte. Der Abschlusstest dient dann als wichtige Lernkontrolle.
Bei Bestehen erhalten die Absolventinnen und Absolventen die Zertifikation als «E-Fleet-Manager SFFV».
Der Kurs ist ab dem 1. April dieses Jahres verfügbar. Wer sollte sich dafür einschreiben?
Von electrify – now können sehr viele Berufsgattungen profitieren. Wir sehen den grössten Mehrwert bei den Mobilitäts- und Flottenverantwortlichen von
Unternehmen, den Mitarbeitenden der Automobilwirtschaft und des Handels sowie den Mitarbeitenden von Logistik-, Transport und Lieferunternehmen. Aber auch Personen, die bei den Anbietern des öffentlichen Verkehrs angestellt sind, können vom Kurs deutlich profitieren. Denn das Werteversprechen ist universal gültig: Wir bieten mit electrify – now einen Lehrgang sowie eine Lernplattform, die hinsichtlich der Elektromobilität alles abdeckt, was ein Unternehmen benötigt, um die Elektrifizierung zu planen, einzuführen sowie unter ökologischen und ökonomischen Prämissen zu betreiben.
Interview SMA
Weitere Informationen finden Sie unter electrify-now.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA #FOKUSMOBILITÄT 8 BRANDREPORT • BRUGG ECONNECT
Bild iStockphoto/damircudic
Die Mobilitätslösung, die den heutigen Bedürfnissen wirklich gerecht wird
Die Mobilitätsbedürfnisse und -ansprüche der Menschen wandeln sich. Einfachheit, Flexibilität sowie Nachhaltigkeit stehen immer höher im Kurs. Das stellt die Dienstleister in diesem Segment vor neue Herausforderungen. Und auch Betriebe anderer Branchen müssen sich vertieft mit dem Thema «Mobilität» auseinandersetzen. Glücklicherweise stellen die smarten, digitalen Lösungen der Netcetera AG die passenden Werkzeuge bereit, mit denen sich dieser Wandel bewältigen lässt.
ermitteln, das Ticketing abdecken, den Routingservice erbringen und sogar Inhalte von Dritten ausspielen – und das gleich über mehrere Kanäle. «Mit unserem Omni-Channel-Ansatz können wir auf Wunsch vom Haltestellen-Display am Perron bis hin zum Billett-Automaten sämtliche Bildschirme eines Bahnhofs mit Informationen für die Passagiere bespielen.»

Aeschlimann. Dadurch wird es Firmen zum Beispiel möglich, in ihrer Belegschaft attraktive Alternativen zum Pendeln mit dem PW anzubieten. «Das verstehen wir unter einer nachhaltigen Corporate Mobility.»
Oliver Aeschlimann. Darauf basierend wird ein Projekt-Fahrplan erstellt, den man dann gemeinsam mit dem Kundenbetrieb Schritt für Schritt umsetzt.
Möglichst effizient, stressfrei und sicher von Punkt A nach Punkt B gelangen – das ist vereinfacht gesagt die Essenz einer sinnvollen Mobilität. «Doch um diese Art der Fortbewegung anbieten zu können, müssen natürlich diverse Faktoren reibungslos ineinandergreifen», erklärt Oliver Aeschlimann, Head of Products and Market Strategy (Digital Enterprise) bei Netcetera. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und realisiert innovative Softwareund Digitalisierungslösungen in den Bereichen Payment, Banking, Gesundheitswesen, Publishing – und Transport. So setzen unter anderem Mobilitätsanbietende wie Bahn- und Busunternehmen auf die Kompetenzen von Netcetera, ebenso wie Firmen aller Grössen und Branchen, die ihre eigene Mobilität optimieren wollen. «Und gerade im Mobilitätssegment konnten wir unser Angebot in jüngster Zeit sowohl ausbauen als auch schärfen», führt Oliver Aeschlimann aus. Was bedeutet das konkret? «Wir haben im vergangenen Sommer die Lausanner Firma routeRANK akquiriert, deren patentierte Technologie uns die Tür zu multimodalen Mobilitätsplattformen eröffnet hat.» Dabei handelt es sich um digitale Lösungen, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, per Tastendruck eine Reisekette zu erstellen, die verschiedene Mobilitätsmittel und -anbietende optimal miteinander verbindet. Die Technologie erstellt kombinierte Verbindungen zu Fuss, mit dem Velo, dem Auto sowie dem ÖV und macht sie in einer einzigen Transaktion buchbar.
«Dank dem Erwerb des Unternehmens sind wir nun in der Lage, unserer Kundschaft noch breitere, multimodale Angebote zu eröffnen», betont Aeschlimann. Auf diese Weise könne man die Bedürfnisse der Transportunternehmen und ihre Kernprozesse optimal abdecken. Alles auf einer einzigen Plattform
Das Ergebnis: Durch die Integration dieser Services in die Angebotspalette von Netcetera können Transportdienstleistende wie Bahn- und Busunternehmen ihrer Kundschaft nun eine komplette, digitale Journey bieten, die das Ausspielen aktueller Passagierinformationen ebenso erlaubt wie ein kundenorientiertes Ticketing. «Die Herausforderung besteht in diesem Feld natürlich darin, die verschiedenen Mobilitätsanbietenden in einer einzigen Anwendung zu vereinen», sagt Aeschlimann. Die Mobility-as-ServicePlattform von Netcetera ist genau dazu in der Lage: Sie kann die relevanten Daten heranziehen, Standorte
Möglich wird das auch dank der Tatsache, dass Mobilitätsdienstleistende heute nicht mehr wie früher auf hardwaregetriebene Technologie setzen, sondern vermehrt Software als Differenziator im Mittelpunkt steht. «Es hat eine Konsolidierung in der Branche stattgefunden, die eine Standardisierung mit sich bringt und damit viel mehr Flexibilität für alle Beteiligten eröffnet.» Die Netcetera AG, die seit mehr als 18 Jahren Mobilitätslösungen entwickelt, hat diesen Wandel weg von Insellösungen hin zu offeneren, praktischeren Systemen von Anfang an mitgetragen. «Dadurch verfügen wir heute in diesem Segment über tiefgreifende Erfahrung sowie eine
Die Herausforderung besteht in diesem Feld natürlich darin, die verschiedenen Mobilitätsanbietenden in einer einzigen Anwendung zu vereinen.
Business-Exzellenz, die ausser Konkurrenz steht.» Durch die vorhandene Inhouse-Payment Kompetenz kann Netcetera auch integrierte Ticketing-Systeme bereitstellen, die auf Standards der Paymentindustrie beruhen, etwa für kontaktloses Bezahlen.
Corporate-Mobility als Differenzierungsmerkmal
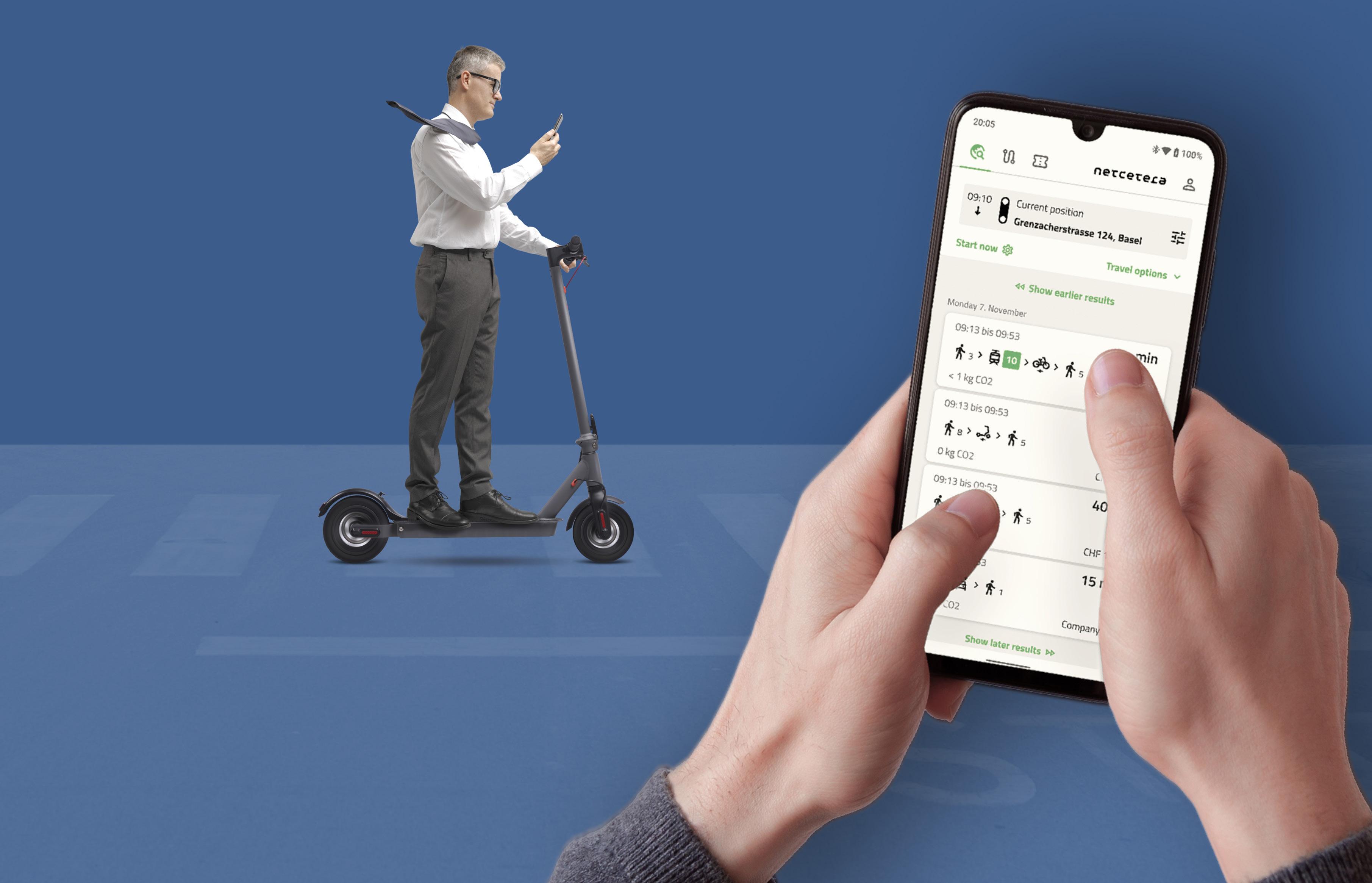
Der Mobility-as-a-Service-Ansatz von Netcetera kommt aber nicht nur den Mobilitätsanbietenden in der Schweiz zugute. «Gleichzeitig können unsere bewährten digitalen Tools auch Unternehmen anderer Branchen dabei unterstützen, ihre eigenen Mobilitätsbedürfnisse besser zu verstehen – und das Mobilitätsverhalten gegebenenfalls anzupassen», erklärt Oliver
Das Feld der unternehmerischen Mobilität wird laut Oliver Aeschlimann künftig stetig an Relevanz gewinnen. «Das hängt zum einen damit zusammen, dass grössere Firmen in Zukunft ihre CO2-Emissionen deklarieren und rechtfertigen müssen», sagt der Experte. Und da eröffnet der Bereich «Mobilität» natürlich enorme Chancen, um die firmeneigene Nachhaltigkeit zu verbessern. Zum anderen ist ein nachhaltiges sowie praktisches Firmen-Mobilitätsangebot wichtig, um die eigene Attraktivität gegenüber den gesuchten Talenten zu steigern. «Die Fachkräfte von heute und morgen legen grossen Wert auf eine Firmenkultur, welche die Aspekte einer umweltbewussten Mobilität berücksichtigt und das Thema nicht einfach an die Mitarbeitenden delegiert», weiss Aeschlimann. Damit wird die Corporate-Mobility auch zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb um Expertinnen und Experten.

Einfachheit ist Trumpf So augenfällig die Vorteile der Corporate-MobilityPlattform von Netcetera auch sind: Gelingt es nicht, die Mitarbeitenden für das Konzept zu begeistern, könnte die Umsetzung ins Stocken geraten. «Darum haben wir darauf geachtet, auch für dieses Segment eine digitale Umgebung zu schaffen, die sich durch eine einfache Nutzungserfahrung auszeichnet – alles in einer App und jederzeit verfügbar», betont Aeschlimann. Ein grosser Vorteil von Netcetera besteht zudem darin, dass man über ein weitläufiges Netz an Partnerunternehmen verfügt. «Wir arbeiten eng mit regionalen und lokalen Mobilitätsanbietenden zusammen und können damit vom ÖV-Ticket bis hin zum E-Bike aus dem örtlichen Fahrradverleih praktisch alles anbieten.» Darüber hinaus können Unternehmen individuelle Reiserichtlinien festlegen, Budgets definieren sowie eine CO2- sowie Kostenübersicht generieren. Und wenn ein Unternehmen keine All-in-One-Lösung für ihre Corporate Mobility benötigt? «Kein Problem», so Aeschlimann: Man kann auch nur einzelne Elemente der Gesamtlösung in Anspruch nehmen, zum Beispiel die Analytics-Dienstleistungen, mit denen sich die Reisebedürfnisse der Mitarbeitenden abbilden lassen.
Persönlicher Kontakt wird grossgeschrieben Sowohl Mobilitätsanbietende als auch Unternehmen anderer Branchen, die von den smarten Mobilitätslösungen von Netcetera profitieren möchten, werden im Rahmen eines ausgiebigen Orientierungsgesprächs an das passende Angebot herangeführt. «Dabei schauen wir mit dem jeweiligen Kundenbetrieb im Detail an, welche konkreten Bedürfnisse bestehen und wie wir diese am besten adressieren können», erklärt
Weitere Informationen finden Sie unter www.netcetera.com
Über Netcetera & routeRANK
Als weltweit tätige Softwarefirma unterstützt die Netcetera AG ihre Kundschaft mit zukunftsweisenden Produkten und individuellen digitalen Lösungen. Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuster Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch bei innovativen Start-ups. Das Technologieunternehmen routeRANK AG (2006) bietet IT-Lösungen im Reise- und Mobilitätssektor an und ist seit 2022 Teil von Netcetera. routeRANK betrachtet den gesamten Weg von Tür zu Tür inklusive der Vielzahl an multimodalen Kombinationen aller relevanten Verkehrsträger wie Bahn, ÖV, P+R, Auto, Mietwagen, Carsharing, Carpooling, E-Bike, Velo und zu Fuss und verarbeitet jährlich über 250 Millionen Routen und verbundene Anfragen.
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
NETCETERA • BRANDREPORT 9 #FOKUSMOBILITÄT
Text SMA Bilder zVg
Oliver Aeschlimann Head of Product & Market Strategy Digital Enterprise
Merlin Ouboter
Merlin Ouboter brachte als einer der Söhne von Wim Ouboter den Microlino auf die Strassen der Schweiz. Mit einer Reichweite von bis zu 230 km zählt der Microlino zu den Vorreitern unter Leichtelektrofahrzeugen. Im Interview mit «Fokus» erzählt uns Merlin Ouboter wie es ist, zusammen mit seiner Familie ein Unternehmen zu führen und wie sich die Mobilität verändern wird.
Merlin Ouboter, Sie sind als Kind bereits in das Familienunternehmen ihres Vaters reingerutscht. Wie fühlt es sich an, jetzt selbst eine wichtige Rolle im Unternehmen zu haben?
Das ist natürlich ein super Gefühl, da wir einen guten Zusammenhalt in der Familie haben. Da mein Bruder auch sehr stark involviert ist, macht es unheimlich Spass mitzuwirken.
Trotz allem fühlt es sich manchmal noch ein wenig unwirklich an, wenn man zurückblickt auf das, was wir die letzten Jahre erreicht haben. Es macht jedoch immensen Spass, an der Vorfront des Mobilitätswandels Entscheidungen zu treffen.
Wie kam die Idee des Microlinos?
Die ersten Schritte hat unser Vater Wim 1996 mit dem Micro Tretroller gemacht, die einen grossen Boom ausgelöst hatten. Dabei war es wichtig, sowohl die Qualität als auch den Aspekt der Innovation voranzutreiben. Dieses Mindset setzt sich durch die ganze Firmengeschichte durch. 2015 haben wir uns überlegt, wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird. Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel Auto man für die tägliche Mobilität wirklich braucht. Durch Zufall sind wir dann auf eine Studie gestossen, die gezeigt hat, dass im Schnitt nur 1,2 Personen im Fahrzeug sitzen, die eine tägliche Distanz von nur rund 35 km zurücklegen. Wir schlossen daraus, dass das normale Auto komplett überdimensioniert ist und durch seine Grösse und Gewicht viel zu viele Ressourcen verbraucht. Um eine Alternative zum klassischen Auto zu finden, haben wir uns auf die Suche nach einem neuartigen Konzept gemacht und sind in unserer Researchphase auf die Kabinenroller der 1950er-Jahre gestossen. An denen wir uns stark orientiert haben. Somit haben wir quasi etwas aus der Vergangenheit recycelt und modernisiert. Das Konzept der Kabinenroller ist zeitlos und funktioniert auch heute noch wunderbar. Was unterscheidet den Microlino von anderen Leichtelektrofahrzeugen?
Der Microlino ist so gesehen kein richtiges Auto, sondern eine Mischung aus Motorrad und Auto. Das spiegelt sich auch in der Zulassung wider – das Fahrzeug hat ein Motorradkennzeichen, dennoch muss man einen Autoführerschein besitzen, um dieses zu fahren. Was uns besonders macht, ist, dass wir der erste Hersteller sind, der eine selbsttragende Karosserie in die Struktur des Fahrzeugs eingeführt hat. Dies bietet die Vorteile einer höheren Sicherheit und Steifigkeit –das war uns besonders wichtig, sodass wir die Qualität höher ansetzen konnten. Oft werden Leichtelektrofahrzeuge nämlich als «fahrender Joghurtbecher» betitelt, da viel Plastik verbaut wird. Dem wollten wir uns bewusst entgegenstellen und hochwertige Materialien
verwenden. Unsere Seitenteile und die Tür bestehen aus Stahl und Aluminium, wie man es vom «normalen» Auto kennt. Dies wertet die Verarbeitung auf. Der Microlino ist etwas mehr Auto als Motorrad! (lacht) Sie leiten zusammen mit Ihrer Familie das Unternehmen. Ist es schwer, mit seinen engsten Familienmitgliedern wichtige Entscheidungen zu treffen?
Wir kennen das bei uns nicht anders, da wir in ein Familienunternehmen reingewachsen sind. Ich bin Jahrgang 1995 und mein Bruder 1994, das heisst, dass wir gerade in der Gründungsgeschichte mit dabei gewesen waren und immer alles mitbekommen haben. Wir haben schon als Kinder die ersten Versuche in Richtung Selbstständigkeit gemacht (lacht). Als wir um die zwölf Jahre alt waren, waren Freestyle-Tricks im Skatepark sehr beliebt, weshalb auch viele mit den Scootern ihr Glück versuchen wollten. So haben wir unsere Scooter verstärkt, da diese für Tricks nicht ausgelegt waren. Dann haben wir Umbaukits in der ganzen Nachbarschaft angeboten und auch kaputte Scooter repariert. Das war ein super Geschäftsmodell, denn wir nahmen die ganzen Ersatzteile immer gratis aus der Werkstatt mit und konnten unsere Umbaukits also zu unschlagbaren Preisen anbieten. Bis unser Vater eines Tages meinte, dass es langsam zu grosse Ausmasse angenommen hatte und er uns die Ersatzteile verrechnete. Da wurde uns schnell bewusst, dass unser
Business-Case mit den Preisen nicht mehr funktionierte – aber Spass gemacht hat es allemal! (lacht)
Momentan profitieren Elektroautos durch das CO2-Pooling in der Flottenemissionsberechnung, warum ist der Microlino davon ausgeschlossen?
CO2-Flotten-Pooling ist europäisch genormt – ganze Herstellerflotten von Fahrzeugen werden bewertet. Es gibt Automarken, die einen Teil Verbrenner und einen Teil Elektrofahrzeuge herstellen. Diese Autos werden zusammengerechnet und ein Schnitt wird berechnet.
Fällt der Schnitt über die zugelassene Norm, werden Strafzahlungen fällig und man muss einen Ausgleich zahlen. Um die zu belohnen, die den Wert einhalten und auch massiv darunter sind, hat man eine Art Umweltzertifikatshandel eingeführt. Unternehmen, die nur Elektroautos herstellen, profitieren, indem sie Zertifikate an andere Hersteller verkaufen und so ihr Unternehmen mitfinanzieren können. Und das passiert in der Realität auch – da gehen sehr hohe Beträge in Millionenhöhe über den Tisch. Wir können gar nicht davon profitieren, da unsere Fahrzeugkategorie davon ausgeschlossen wird, obwohl unser Fahrzeug im Vergleich zu einem normalen E-Auto nur einen Drittel des Footprint hat. Für Newcomer wie uns wäre dies ein riesiger Vorteil, da es extrem schwierig ist, sich im Markt zu etablieren.
Ist der Microlino attraktiver für Tessiner:innen, weil dort die Strassen so eng sind, statt für Leute aus dem Kanton Zürich? Das ist auf jeden Fall eine spannende Überlegung (lacht). Für Menschen aus dem Tessin wäre das natürlich ein grosser Vorteil. Ich denke, das ist auch für Italien eine gute Alternative, da gerade viele Altstädte nicht für grosse Autos gebaut sind und es dann Sinn macht, auf Autos in Grösse des Microlinos umzusteigen. In der Realität ist es natürlich so, dass viele Menschen, die direkt in der Stadt wohnen, gar kein Auto mehr besitzen, da das ÖV-Netz dort gut funktioniert. Jene, die ein wenig ausserhalb wohnen, sind eher auf ein Auto angewiesen.
Welche Features fanden Sie für das Auto besonders wichtig?
Abgesehen vom Konzept war es mir sehr wichtig, dass man das Auto an einer normalen Haushaltssteckdose aufladen kann und dann nur vier Stunden für eine Vollladung warten muss. Ein weiteres cooles Feature ist die Fronttüre, denn sie ermöglicht einem den Microlino durch seine kompakte Grösse querzuparken und direkt vorne auf den Gehsteig auszusteigen. So passen gleich drei Microlinos nebeneinander auf einen Parkplatz. Ein
Ich denke, dass das Thema Micromobility in Zukunft wichtiger wird, da die Nachfrage stetig ansteigt. Da gehört ein Microlino dazu, aber auch ein Lastenfahrrad oder E-Scooter.
wichtiges Anliegen war ebenso, dass wir nicht zu viele Features einbauen: Was ist wirklich notwendig? Was benötigen die Kund:innen wirklich? Das Innenleben sollte so minimalistisch wie möglich gestaltet sein. Daher haben wir auch keine fest verbaute Musikanlage, sondern einen portablen Bluetooth-Speaker, den man auch mal mit an den See nehmen kann und so Platz spart.
Wie sehen Sie die Zukunft Ihres kleinen Flitzers?
Ich denke, dass das Thema Micromobility in Zukunft wichtiger wird, da die Nachfrage stetig ansteigt. Dazu zähle ich alle Fahrzeuge, die unter 750 kg wiegen. Da gehört ein Microlino dazu, aber auch ein Lastenfahrrad oder E-Scooter. Diese Fahrzeugkonzepte werden in den nächsten Jahren einen riesigen Boom erleben und werden nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken sein. In urbanen Regionen müssen wir nachhaltigere, kleinere und platzsparende Mobilitätsformen fördern. Der öffentliche Verkehr ist zwar wichtig, aber wir müssen von der Auffassung wegkommen, dass der ÖV alles ersetzen kann – das funktioniert nicht. Nur auf eine Mobilitätsform zu setzen, ist unmöglich. Es braucht das Zusammenspiel der individuellen Mobilität und des ÖVs, damit der Mobilitätswandel funktioniert.
Wie schneidet der Microlino in Bezug auf die Nachhaltigkeit verglichen mit anderen Elektroautos ab?

Der Microlino verbraucht auf 100 km rund 60 Prozent weniger Energie und produziert weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen in der Produktion als ein herkömmliches Elektroauto. Dies liegt hauptsächlich am Gewicht des Microlinos und der Grösse der Batterie. Je schwerer und grösser das Auto, desto grösser die Batterie, die verwendet werden muss, um die Reichweiten zu erzielen. Der Microlino hat einen Verbrauch von 7 kWh auf 100 km; im Vergleich, ein Elektro-SUV liegt bei gleicher Strecke bei mindestens 19 kWh. In der Schweiz liegen wir energietechnisch auf 100 km sogar noch unter dem Zugfahren, da liegt man bei rund 9 bis 11 kWh. Effizienter gehts eigentlich nur noch zu Fuss oder mit dem Trottinett. Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Zukunft?
Definitiv in der Micromobilitybranche zu wachsen und auch den Microlino über die Europagrenzen hinaus zu bringen. Es wird sicher auch nicht nur beim Microlino bleiben, da wir schon einige Ideen für Produkte haben, die wir produzieren möchten. Ein normales Auto planen wir nicht zu bauen, aber ähnliche Fahrzeugtypen wie der Microlino – auch wenn wir nicht grösser werden.

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 10 PROFILINTERVIEW • MERLIN OUBOTER
Interview Jessica Petz Bilder Microlino AG
«Es braucht das Zusammenspiel der persönlichen Fahrzeuge und des ÖVs, damit der Verkehr funktioniert»
Ein Ort, an dem Körper und Geist gleichermassen zur Ruhe kommen
Saas-Fee ist dank seiner Gletscher eine schneesichere Winterdestination und hat auch in den wärmeren Monaten enorm viel zu bieten. Ein perfekter und luxuriöser Ausgangsort für alle Arten von Ausflügen bietet das Walliserhof Grand-Hotel und Spa Saas-Fee. Insbesondere die Erlebnis-Packages des luxuriösen Hauses eignen sich ideal, um unvergessliche Momente zu schaffen.
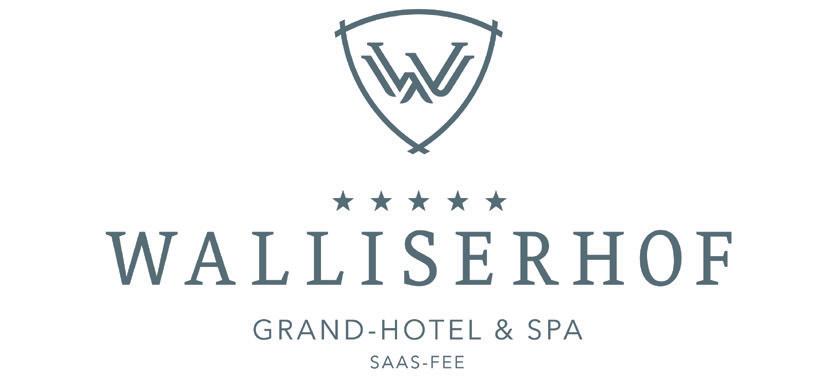


Viele Hotels nehmen für sich in Anspruch, Tradition mit Moderne zu verbinden. Wer zum ersten Mal durch die Türen des Walliserhof Grand-Hotels in Saas-Fee schreitet, erkennt sofort: Hier wird dieser Anspruch tatsächlich sowie vollumfänglich erfüllt. Das ehrwürdige Haus, das auf eine über 130-jährige Geschichte zurückblicken kann, verfügt mit seinen prachtvollen Holzverzierungen und Natursteinelementen über einen einzigartigen, rustikalen Charme. Gleichzeitig fügt sich die hochwertige, moderne Einrichtung perfekt in dieses Bild ein und ergänzt es um neue Facetten. Für Generalmanager Klaus Habegger und sein Team ist die erstklassige Kulisse aber nur ein entscheidender Aspekt des Walliserhof-Erlebnisses: «Unsere Mission erachten wir darin, für unsere Gäste aussergewöhnliche Luxuserlebnisse zu schaffen und für sie einen Ort für Ausgleich und Erholung vom Alltag zu kreieren.» Ein wichtiges Schlüsselelement eines grandiosen Aufenthalts liege im menschlichen Miteinander. «Bei uns stehen daher Herzlichkeit und Aufrichtigkeit stets im Vordergrund», betont Klaus Habegger. Diese authentische Gastfreundschaft schlägt sich unter anderem in zahllosen positiven Gäste-Bewertungen nieder.

Wer im Walliserhof Grand-Hotel und Spa eincheckt, hat die Qual der Wahl: 74 Zimmer und Suiten mit höchstem Komfort laden zum gemütlichen Verweilen und Entspannen nach Wanderungen oder Ski-Abfahrten ein.
Wer im Walliserhof Grand-Hotel und Spa eincheckt, hat die Qual der Wahl: 74 Zimmer und Suiten mit höchstem Komfort laden zum gemütlichen Verweilen und Entspannen nach Wanderungen oder Ski-Abfahrten ein.
Ergänzt wird dieses Angebot durch einen 2100 Quadratmeter umfassenden Spa-Bereich, der mit einer grossen Auswahl an Treatments und kosmetischen Behandlungen
aufwartet. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: Im Hotel befinden sich nicht weniger als drei Restaurants, die von hausgemachter Pasta und Pizza über typisches Schweizer Fondue bis hin zur GourmetKüche mit 13 Gault-Millau-Hauben keine kulinarischen Wünsche offenlassen. «Was auch immer unsere Gäste von einem Aufenthalt in einem Grand-Hotel erwarten – wir bieten es», erklärt Klaus Habegger schmunzelnd.
Ein Paket für unvergessliche Momente Ganz besondere Erlebnisse bieten die verschiedenen «Packages», welche man im Walliserhof buchen kann.
Einen Höhepunkt stellt sicherlich «Ds Wallis im Gfühl» dar, welches bis 31.Oktober dieses Jahres buchbar ist. Was dieses Paket so besonders macht? Das Heubad! Während man in den Genuss einer Ganzkörper-Packung kommt, lässt man die Aromen und Düfte das Wallis auf sich wirken. Der rustikale Charme der Räumlichkeiten sorgt für eine besondere Atmosphäre und Romantik. Die im Paket inbegriffene Teilkörpermassage mit Arvenöl sorgt für perfekte Entspannung. Klaus Habeggers Tipp: «Gerade, wenn man aktive Outdoor-Erlebnisse in der wunderbaren Natur des Saastals genossen hat, gibt es schlicht nichts Entspannenderes, als sich in unserem Heubad niederzulassen.» Das Angebot umfasst zwei Nächte in einer Zimmerkategorie nach Wahl sowie zwei Abendessen in der Genusspension. Das reichhaltige Frühstücksbuffet im Restaurant Cäsar Ritz steht den Gästen ebenso offen wie der Eintritt in die Wellness-Welt. Die Magie des Eises Für alle, die auf der Suche nach neuen Perspektiven sind, eignet sich das Package «Facetten des Saastals» ideal, welches man noch bis 16. April dieses Jahres buchen kann. «Bei diesem unvergesslichen Ausflug werden die Gäste durch unseren Guide Alessandro in die Gletscherhöhlen von Saas-Fee geführt», erklärt der Generalmanager. Ein einzigartiges Erlebnis, denn dabei eröffnet sich den Teilnehmenden ein Blick auf die magische Welt des ewigen Eises. Nach einem grossartigen Tag auf der Piste geniesst
man dann eine wärmende Ganzkörpermassage mit heimischem Murmeltieröl. Und das Beste: Als Andenken gibt es eine Dose der wohltuenden Murmeltier-Kräutersalbe für zu Hause. Das Angebot umfasst drei Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl sowie drei Abendessen im Rahmen der Vier-Gang-Genusspension im Cäsar Ritz. Natürlich sind auch hier das reichhaltige Frühstücksbuffet sowie der Eintritt in die Wellness-Welt inbegriffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.walliserhof-saasfee.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
WALLISERHOF GRAND-HOTEL • BRANDREPORT 11 #FOKUSMOBILITÄT
Text SMA Bilder zVg
Aussenansicht Walliserhof Grand-Hotel Junior Suite
So werden wir uns in den urbanen Räumen von morgen bewegen
Mit dem Begriff «Stadt» verbinden viele Leute Aspekte wie Verkehr, Menschenmassen und Schnelllebigkeit. Doch wie sich zeigt, könnte sich die Stadt der Zukunft gerade dadurch auszeichnen, dass sie Entschleunigung fördert und ein Leben in «kleineren Einheiten» ermöglicht. «Fokus» skizziert ein Bild der Stadt von morgen.
Das Jahr 2023 wird für die Schweiz das Erreichen eines neuen Meilensteins mit sich bringen: In diesem Jahr werden wir aller Voraussicht nach die Marke von neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern knacken. Der Begriff «Neun-Millionen-Schweiz» ist derzeit medial äusserst stark präsent – und löst bei vielen Leuten auch Sorgen aus. Die Wohnungsnot in den Städten, das Ansteigen der Mietpreise sowie die Zunahme des Verkehrs gelten als negative Folgen des Bevölkerungswachstums.
Es ist darum der geeignete Zeitpunkt gekommen, um sich zu fragen, wie eigentlich die Schweizer Städte der Zukunft aussehen könnten. Um dieser Frage nachzugehen, ergibt es Sinn, die grösste Stadt des Landes als Ausgangspunkt für die Überlegungen heranzuziehen.
Und bevor man mögliche Szenarien für die Zukunft skizziert, ist ein kurzer Blick zurück auf die urbane Geschichte Zürichs sinnvoll. Denn wie die Vergangenheit zeigt, erlebte die Limmatstadt in ihrer Geschichte einige Schwankungen: Ein Meilenstein stellt sicherlich die Eingemeindung der Stadt mit ihren umliegenden Gemeinden im Jahr 1893 dar. Dadurch wurde Zürich auf einen Schlag zur Grossstadt mit rund 120 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In den darauffolgenden Dekaden setzte sich die Zuwanderung in die
Stadt fort und so erreichte die Bevölkerung Zürichs im Jahr 1962 mit 440 180 Menschen einen Höchststand.
Gemäss Zürcher Stadtverwaltung liess danach aber die erhöhte Mobilität die Agglomeration auf Kosten der Kernstadt wachsen und die Bevölkerungszahlen in der Stadt wieder sinken. 1997 wurde mit einer Einwohnendenzahl von weniger als 360 000 Personen die Talsohle erreicht. Seither geht es wieder bergauf: 2022 konnte mit 443 037 Einwohnerinnen und Einwohner erstmals die Rekordmarke von 1962 überboten werden.
Diese kleine historische Abhandlung zeigt: Städte sind Veränderungen unterworfen. Interessant ist die Tatsache, dass insbesondere die zunehmende individuelle Mobilität in den 1960er-Jahren zur Folge hatte, dass Menschen die «Flucht» aus der Innenstadt antraten. Heute wiederum führt unter anderem ein verändertes Mobilitätsverständnis dafür, dass urbane Räume wieder als attraktiv gelten: Anstatt zu pendeln und aufs Auto zurückgreifen zu müssen, werden kurze Wege und nachhaltige Fortbewegungsmittel präferiert. Wird sich dieser Trend nun in den kommenden Jahrzehnten noch zusätzlich akzentuieren?
Die Zehn-Minuten-Stadt
Fachleute gehen davon aus, dass dies zutreffen wird. Die Stadt der Zukunft werde mit grosser Sicherheit
BRANDREPORT • ZHAW SCHOOL OF ENGINEERING

menschenzentrierter sein, sprich, den Ansprüchen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner stärker Rechnung tragen. Statt also wie in der Vergangenheit viel öffentlichen Grund für Strassen und Parkplätze zu verwenden, wird das Thema «Nachhaltigkeit» bei der Stadtplanung an Gewicht gewinnen. Konkret dürfte sich das in zusätzlichen Grünflächen niederschlagen sowie einem grüneren öffentlichen Verkehr. Ebenfalls sei davon auszugehen, dass der Quartiergedanke wieder vermehrt in den Fokus rückt. Die Stadt der Zukunft wird laut Meinung von Expertinnen und Experten eine sein, die hochwertigen sowie sicheren Lebensraum bietet und in der die Menschen innerhalb von zehn Minuten alle ihre Bedürfnisse abdecken können. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Zehn-Minuten-Stadt. Egal also, ob man einkaufen möchte, den Park besuchen oder ein Café ansteuern will – alle diese Annehmlichkeiten liegen maximal zehn Minuten entfernt.
Ein weiterer Aspekt der quartiergeprägten Stadt ist die Mischnutzung von Immobilien. Die Stadtplanung der Vergangenheit sah eine klare Trennung von Wohnraum, Arbeitsflächen und Gewerbebauten vor. Dieser Ansatz löste einen hohen Mobilitätsbedarf aus und ist nicht mit dem Prinzip der Zehn-Minuten-Stadt
vereinbar. Dementsprechend dürfte diese strikte Trennung der Objektnutzung künftig aufgebrochen werden. Fluide Nutzungskonzepte sowie die Verschmelzung von Wohn-, Arbeits- und Gewerberäumen sorgen für ein «konzentrierteres» Leben innerhalb der Stadt der Zukunft. Und das Beste: Dank neuer Technologien wird der urbane Raum trotz dieser Verdichtung nicht weniger wohnlich. Waren Städte früher tendenziell eher laut, schmutzig und vom Verkehr verstopft, sorgt die neue und saubere Mobilität dafür, dass städtische Zentren lebenswert werden und bleiben. Die Menschen müssen mitreden Diese Einschätzungen zeigen, dass sich für die Schweizer Städte eine durchaus positive Zukunft abzeichnet. Doch damit eine Stadt auch wirklich menschenzentriert sein kann, müssen die Verantwortlichen die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner ermitteln und adressieren. Dies wiederum setzt voraus, dass ein stetiger Dialog mit der Bevölkerung gepflegt wird. Denn Lebensqualität entsteht nur dann, wenn man auf die Aspekte eingeht, die den Menschen wichtig sind, welche die Stadt mit Leben füllen.
Mit dem Studium Verkehrssysteme die Mobilität der Zukunft
mitgestalten
Wie kann Mobilität nachhaltiger werden und wie können wir den öffentlichen Verkehr weiterentwickeln? Diese Fragen
haben Stephanie Baumann zum Studium der Verkehrssysteme an der ZHAW motiviert. Heute arbeitet sie bei der SBB als Anlagenmanagerin und ist dafür zuständig, dass Reisende an den Bahnhöfen sicher und schnell ans Ziel kommen.

Für das Thema Mobilität hat sich Stephanie Baumann schon vor dem Studium interessiert. Als sie nach der Matura ein Praktikum bei der SBB absolvierte, war ihr klar, dass sie im Bereich öffentlicher Verkehr arbeiten möchte. Bei der Suche nach einem entsprechenden Studium fiel ihr Blick auf die ZHAW und den dort angebotenen Studiengang Verkehrssysteme, den man im Vollzeit- und Teilzeitmodell studieren kann. «An der ZHAW fand ich das einzige Studium, das sich mit der nachhaltigen Entwicklung von Personen- und Güterverkehr als Gesamtsystem beschäftigt», erinnert sich Stephanie Baumann, die Entscheidung war also schnell gefallen. Den Personenfluss an Bahnhöfen steuern Die Entscheidung hat sie bis heute nicht bereut. Nach ihrem Bachelorabschluss im Sommer 2020 trat die ZHAW-Absolventin eine Stelle als technologische Anlagenmanagerin im Bereich Crowd Management bei der SBB in Bern an. «Hier beschäftige ich
mich mit den Personenflüssen an Bahnhöfen mit dem Ziel, dass alle unsere Kundinnen und Kunden sicher von A nach B kommen», erklärt sie ihr Tätigkeitsfeld. Eines der Projekte, an denen sie beteiligt ist, befasst sich mit den Warteorten von Reisenden auf den Perrons. «Personen warten gerne an ungeeigneten Stellen, zum Beispiel an der Längsseite von Rampen und Treppen, da sie sich dort anlehnen können. Diese Flächen sind aber meistens schmal und sollten deshalb nicht zum Warten verwendet werden», erläutert Stephanie Baumann die Problematik. Gesamtüberblick über die Verkehrswelt Mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Studienzeit ist Stephanie Baumann nach wie vor eng vernetzt. Sie arbeiten in verschiedenen Bereichen der Mobilitätsbranche – in der Projektierung, Angebotsplanung oder Marktentwicklung von Verkehrsbetrieben oder bei Logistikunternehmen. Die Inhalte aus dem Studium kann Stephanie Baumann
bei ihrer Arbeit immer wieder gewinnbringend einsetzen. «Wir sammeln und analysieren Unmengen von Daten, die Kenntnisse aus dem Statistik-Unterricht im Studium kann ich daher sehr gut gebrauchen.» Wer sich für Mobilität und Verkehr interessiert, für den sei der Studiengang die richtige Wahl: «Der Bachelorstudiengang vermittelt einen fundierten Gesamtüberblick über die Verkehrswelt», fasst die
ZHAW-Absolventin zusammen. «Und das Jobangebot nach dem Studium ist aktuell so gross wie nie zuvor.»
Infoanlässe Studium Verkehrssysteme Nehmen Sie an einem unserer Infoanlässe zum Bachelorstudium teil und erfahren Sie mehr über das Studium Verkehrssysteme: Samstag, 11. März, Winterthur
Donnerstag, 13. April, online
Anmeldung: www.zhaw.ch/engineering/infotag
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS
12 SMART CITY
Text Marcel Winter, Leiter Infrastruktur Schweiz, Country Manager Schweiz bei AFRY
Bild iStockphoto/ChakisAtelier
Stephanie Baumann, Absolventin Verkehrssysteme
Die Weichensteller für eine nachhaltige Mobilität
Die Reduktion der CO2-Emissionen gehört zu den dringendsten gesellschaftlichen Herausforderungen überhaupt. Die dafür notwendige Dekarbonisierung des Verkehrs wirft viele Fragen auf. AFRY Schweiz liefert die notwendigen Antworten – und setzt dabei auf Erfahrung, Fachwissen sowie modernste digitale Hilfsmittel. «Fokus» sprach mit Marcel Winter, Leiter Infrastruktur der AFRY Schweiz.
Marcel Winter, inwiefern ist AFRY Schweiz im Bereich der Mobilität tätig?

Der Anspruch von AFRY besteht darin, gemeinsam mit unserer Kundschaft nachhaltige sowie moderne Lebensräume zu schaffen und damit Nachhaltigkeit auf allen Ebenen zu fördern. Zu diesem Zweck sind wir auch im Feld der Mobilität in mehrfacher Hinsicht aktiv: So erbringen wir breite, interdisziplinäre Dienstleistungen. Dazu gehören auch Verkehrskonzepte inklusive Knotenberechnungen sowie das Simulieren von Verkehrsflüssen. Ausserdem erbringen wir auch Planungsleistungen zur konkreten Steuerung des Verkehrs: Basierend auf unseren Konzepten und Analysen kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir über Ampelsysteme an neuralgischen Punkten gezielt den Verkehrsfluss steuern. Parallel dazu fokussieren wir uns auch auf den Infrastruktur- und Energiebereich. Dort planen wir beispielsweise sämtliche Aspekte von Bahn- oder Traminfrastrukturen, vom Trasseebau über die Planung von Tunnel, Brücken und gesamte Bahnhöfe inklusive ihrer Ausrüstung hin zur Versorgung mit Energie. Und im Bereich der Strassenverkehrs- und Energieinfrastrukturen sind wir ebenfalls stark vertreten. Nebst den Bauwerken behandeln wir auch sämtliche Umweltaspekte. Sie haben die Lenkung von Verkehrsflüssen angesprochen. Wie kommen Sie zu den dafür notwendigen Daten?
In diesem Zusammenhang spielt natürlich die Digitalisierung eine Schlüsselrolle. Mithilfe moderner Sensorik sowie hoch entwickelten Kameras erfassen wir die Verkehrsströme. Anschliessend werden diese IoT-Daten («Internet of things»-Daten) auf unserer selbst entwickelten digitalen Plattform AFRY e-DAP verarbeitet. Diese erlaubt es uns, komplexe Simulationen durchzuführen und sogenanntes «Predictive Modelling» zu betreiben. Das bedeutet, dass man mithilfe digitaler Modelle faktenbasierte Voraussagen zu realen Ereignissen treffen kann. Diese Werkzeuge machen es uns möglich, Verkehrssteuerungsmassnahmen und -anlagen im virtuellen Raum zu testen und so die bestgeeigneten Massnahmen zu identifizieren.
Können Sie uns mehr zur
IoT-Plattform von AFRY erzählen?

Bei AFRY e-DAP handelt es sich um eine Cloudbasierte Digital-Twin-Web-Plattform, die entweder historische Daten oder Echtzeitfelddaten benutzt, um
unsere Kundschaft bei der effektiven Entscheidungsfindung zu unterstützen. Die grösste Herausforderung besteht dabei darin, die Schnittstellen zu beherrschen, sprich, die Daten aus der realen Welt ohne Sollbruchstellen in unsere digitalen Modelle zu überführen. Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir für unsere Kundschaft, zu der unter anderem die öffentliche Hand gehört. Die Energie- und Mobilitätsfragen, die wir mit AFRY e-DAP adressieren können, sind faszinierend. Ein simples Beispiel: Nehmen wir an, wir wollen im Rahmen eines Projektes die Beleuchtung in Strassentunneln optimieren. Nun können wir unter anderem simulieren, wie praktikabel es ist, wenn bei geringem Verkehrsaufkommen das Licht bei Nicht-Befahren des Tunnels abgeschaltet wird. Oder wir analysieren, ob das Licht mit einem Fahrzeug «mitwandern» soll. Um dies umzusetzen, benötigen wir Sensoren, KI-Programme sowie weitere Hilfsmittel, deren Daten allesamt bei AFRY e-DAP zusammenlaufen. Die aktuelle Diskussion um Mobilität kann nicht ohne das Thema «E-Mobility» geführt werden. Das stimmt, und auch in diesem Bereich bringen wir von AFRY uns ein, unter anderem im Feld der Ladeinfrastrukturen. So haben wir unter anderem gemeinsam mit den Betreibern städtischer Busflotten Projekte umgesetzt, die es dem Betreiber erlauben, die Fahrzeuge im Depot zu laden. Dieses Vorhaben erscheint vielleicht auf den ersten Blick trivial, doch es birgt zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen steht die Frage im Raum, wie man einen dicht-getakteten Tagesbetrieb gewährleisten und dabei die notwendigen Ladezeiten einhalten kann. Um dies zu schaffen, müssen die Fahrzeuge auch unterwegs geladen werden können. Die zweite Challenge betrifft den Betrieb der Busdepots an sich: Diese dienen nun nicht mehr «nur» der Verwahrung und Unterhalt der Fahrzeuge, sondern müssen technisch umgerüstet werden, was eine ganze Reihe an Anpassungen voraussetzt. So müssen etwa die Raumkonzepte und die Energieversorgung neu angedacht sowie neue Brandschutzthemen berücksichtigt werden. Das führt die Depotbetreibenden vor ganz neue Herausforderungen, wobei wir sie natürlich tatkräftig unterstützen. Und wie unterstützt AFRY den Wandel des Individualverkehrs hin zur Elektromobilität?
Hier sind wir vornehmlich bei der Planung und strategischen Erweiterung von öffentlich zugänglichen Infrastrukturen tätig. Dabei kann es sich zum Beispiel um das Ausstatten von Autobahnraststätten oder Tankstellen mit E-Mobility-Ladestationen handeln. Wir unterstützen aber auch Elektrifizierungsinitiativen der Automobilhersteller, die ihre Filialnetze entsprechend ausrüsten und aufwerten möchten. Generell werden wir in den kommenden Jahren erleben, dass immer mehr öffentliche Räume die Möglichkeit bieten werden, E-Fahrzeuge aufzuladen.
Welche weiteren dringenden Themen beschäftigen die Kundinnen und Kunden von AFRY?
Das Thema der Bewilligungen ist ein akutes, besonders dann, wenn ein Kundenunternehmen seine Lösung schnell hochskalieren möchte. Bleiben wir beim Tankstellen-Beispiel: Möchte man sinnvollerweise einen Grossteil oder sogar sämtliche Filialen für die E-Mobilität rüsten, sprechen wir schnell von Dutzenden oder gar Hunderten Standorten. Die technische Umsetzung lässt sich hochskalieren, doch der Bewilligungsprozess durch die politischen Instanzen behandelt jeden einzelnen Standort als individuelles Projekt. Und da je nach Lage eines Tankstellenstandorts andere Regulationen zur Anwendung kommen, stellt dieses Vorgehen noch einen erheblichen Bremsklotz dar.
Basierend auf unseren Konzepten und Analysen kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir über Ampelsysteme an neuralgischen Punkten gezielt den Verkehrsfluss steuern.
Wie kann AFRY hier unterstützen?
Nebst unseren planerischen und strategischen Dienstleistungen nehmen wir unserer Kundschaft auf Wunsch auch solche behördlichen Prozesse ab. Unser Vorteil besteht darin, dass wir 18 Standorte in der Schweiz betreiben und unsere rund 1000 Mitarbeitenden gut verteilt sind. Damit können wir sämtliche Regionen ideal abdecken.
Welche zentralen Themen sehen Sie hinsichtlich Mobilität und Verkehr künftig auf die Schweiz zukommen?
Unsere Verkehrsinfrastruktur wurde stark autozentriert konzipiert und umgesetzt. Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl werden wir entscheiden müssen, ob wir dem Individualverkehr hierzulande überhaupt noch so viel Platz einräumen können. Bevor London 2003 die Citymaut eingeführt hat, lag die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit in Hauptverkehrszeiten bei unter fünf Stundenkilometern. Da stellt sich die Frage, ob sich dieser Verkehrsfluss lohnt, wenn man praktisch gleichschnell zu Fuss unterwegs ist. Solche
datenbasierten Erkenntnisse können dazu beitragen, die Verkehrsdiskussion etwas weniger emotional zu führen, wozu wir ebenfalls gerne unseren Beitrag leisten. Dass die Dekarbonisierung die Zukunft der Mobilität darstellt, erachten wir allerdings als diskussionslos: Behörden und Private werden immer stärker in der Verantwortung stehen, ihre CO2-Emissionen abzusenken. Hier nimmt der Verkehr, Verursacher (ohne Flug- und Schiffsverkehr) von einem Drittel aller Treibhausgase in der Schweiz, eine Schlüsselrolle ein. Nebst dem Personenverkehr stellt auch der zunehmende Warenverkehr auf den Schweizer Stassen und die Feinverteilung in den Städten eine grosse Herausforderung dar. Lösungen wie Cargo sous terrain können diesbezüglich Abhilfe schaffen, an der AFRY seit der ersten Stunde strategisch und in der planerischen Umsetzung massgeblich beteiligt war. Kann die Digitalisierung dabei helfen? Auf jeden Fall, allerdings ist sie eher ein Befähiger statt eines zentralen Treibers. Doch das Potenzial digitaler Ansätze für eine nachhaltigere Mobilität ist enorm. Hier können wir von AFRY uns auf ein weitreichendes und umfassendes Ökosystem stützen. Unsere Technologie- und Industriepartner versorgen uns mit relevanten Informationen und Daten – und diese sind wiederum essenziell, um die stetig komplexer werdenden Zusammenhänge nachvollziehbar und antizipierbar zu machen. Genau dies werden wir in Zukunft tun, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen. Ganz der Mission von AFRY entsprechend.
Über AFRY
AFRY ist ein national und international tätiges Unternehmen in den Bereichen Engineering, Design und Beratung. Weltweit arbeiten engagierte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Infrastruktur, Industrie und Energie daran, nachhaltige Lösungen für zukünftige Generationen zu schaffen. In der Schweiz beschäftigt AFRY 1000 Fachleute, weltweit sind es 19 000. Hierzulande betreibt das Unternehmen 18 Standorte und ist in allen vier Sprachregionen tätig.
Weitere Informationen finden Sie unter www.AFRY.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA AFRY • BRANDREPORT 13 #FOKUSMOBILITÄT
Bild iStockphoto/Scharfsinn86
Marcel Winter Leiter Infrastruktur Schweiz, Country Manager Schweiz bei AFRY
Bidirektionales Laden ist Energiezukunft
Mit der bidirektionalen Ladetechnik wird die überschüssige Batteriekapazität der Elektroautos als Stromspeicher für Gebäude nutzbar. Die Lösung ist nachhaltig, logisch, sinnvoll und praktisch!
Wer ist sun2wheel?
Das Schweizer Start-up sun2wheel AG mit Sitz in Obernau LU und Vertriebsbüro in Liestal BL wurde im Dezember 2020 gegründet. Der Fokus liegt auf dem bidirektionalen Laden, den intelligenten Lade- und Speicherlösungen und dem übersichtlichen Lade- und Verrechnungsmanagement.
Das mittlerweile auf zehn Leute angewachsene Team entwickelt und vertreibt die zukunftsorientierte Lösung im ganzen Schweizer Markt. Das Ziel besteht darin, die Elektromobilität und den Energieverbrauch von privaten Haushalten, Mehrfamilienhäusern und KMUs zusammenzuführen, zu optimieren und das gesamte Stromnetz zu stabilisieren. Die sun2wheel-Lösung wurde bereits vom Bundesamt für Energie BFE erkannt und mit dem Watt d’Or ausgezeichnet. Über 100 Lösungen sind in der Schweiz bereits erfolgreich im Betrieb.
Wie funktioniert das?
Im Grunde genommen geht es darum, die Elektrofahrzeuge nicht nur aufzuladen, sondern den Strom auch wieder zu entnehmen. Das läuft über ein innovatives System, einer bidirektionalen Ladetechnologie. Die Fahrzeuge werden als Zwischensprecher – als Powerbank genutzt. Tagsüber werden die Batterien, idealerweise über eine Photovoltaikanlage, gespeichert und zum gewünschten Zeitraum wieder genutzt. Über die App werden die Bedürfnisse und Gewohnheiten gesteuert, sodass jederzeit die Energie zur Verfügung steht. So wird der Eigenverbrauchsanteil, die Autarkie erhöht und das Stromnetz stabilisiert.

Warum ist das bidirektionale Laden von sun2wheel die Energiezukunft?
• Weil die gigantische Sonnenergie eingefangen, gespeichert und sinnvoll wieder verteilt wird.
BRANDREPORT • JAC
• Weil der Stromverbrauch optimiert wird. Das heisst, die Verwertung des Stroms kann bis zu 70 Prozent gesteigert werden. Das E-Auto ist viermal effizienter als jeder Verbrenner.
• Weil der Einsatz von Batterien des Elektroautos das gesamte Energiesystem unterstützen und entlasten kann.
• Weil der intelligente Einsatz der Autobatterie als Powerbank die Ausnutzung von Marktpreisunterschieden zwischen Stunden und Tagen ermöglicht.
• Weil teure, mit fossilen Brennstoffen betriebene Notstromaggregate vermieden werden können. Weil wir nur gemeinsam das Ziel erreichen und eine stabile Stromversorgung sicherstellen können.
• Weil wir ohne schlechtes Gewissen weiterhin flexibel und mobil sein wollen.
Für wen ist das System geeignet?
Das System ist einsetzbar in Ein- und Mehrfamilienhäusern, im Gewerbe, Industrie, Hotellerie, in der Logistik, im Flottenmanagement etc.
Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) ist genauso möglich wie das moderne Lastenmanagement, welches die Lade- und Entladungsvorgänge automatisch steuert. Alle Daten zur Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch werden übersichtlich dargestellt und machen moderne Elektromobilität erlebbar. Das System ist modular aufbaubar.
Fakten und die Zukunft
• Eine Person fährt in der Schweiz im Durchschnitt knapp 40 km pro Tag. Das Fahrzeug (=Stehzeug) steht durchschnittlich 23 Stunden im Tag herum.
• Heutige Elektrofahrzeuge haben eine Batteriekapazität von weit über 40 kW und

erzielen eine Reichweite von über 600 km. Der Verbrauch eines E-Fahrzeugs beträgt im Schnitt 20 Kilowattstunden auf 100 km.
• Durchschnittlicher Verbrauch eines EFH liegt bei 10 Kilowattstunden pro Tag (ohne Wärmepumpe).
• Die dezentrale Produktion von erneuerbarer Energie nimmt laufend zu, fällt jedoch unregelmässig an. Der Ausgleich und die Stabilisierung von Netzschwankungen sind deshalb wichtig. Die Weiterentwicklung der intelligenten Energienutzung müssen wir zwingend vorantreiben. Haushalte und ganze Flotten können teilnehmen und vorübergehend ungenutzte Batterien monetarisieren.
• Das Umstellen auf elektrische Antriebe ist gegeben. Die Frage ist lediglich, wie schnell. Hauseigentümer und Unternehmen dürfen den wichtigen Sprung auf diesen Zug nicht verpassen.
Die Lösung Sun2wheel bietet die Komplettlösung bestehend aus Ladestationen und Steuerungssoftware an. Dies bringt Kosteneinsparungen, erschliesst das volle Potenzial der Elektrofahrzeuge und macht das System fit für die nachhaltige Zukunft. Mit dem sun2wheel Lastmanagement kann jede Ladestation individuell und nach Wunsch gesteuert werden, (nur Solar, Niedertarif, Boost etc.) ohne den Engpass am Netzanschlusspunkt zu überschreiben und lokal produzierte Energie möglichst gut auszunutzen.
Für das Verwalten in Liegenschaften und von ganzen Flotten wurde das neue Produkt sun2wheel Center entwickelt. Damit kann der ganze Ladenpark überwacht, gemanagt und die Kosten verrechnet werden.
Der Einstieg ist bei sun2wheel auch mit einer einfachen Ladestation möglich. Dieser kann später erweitert und ausgebaut werden. Wir begleiten und beraten unsere Kunden mit ihren wachsenden Bedürfnissen und Möglichkeiten.
Mehr Informationen auf www.sun2wheel.ch
Kontaktaufnahme:
+41 61 927 55 66
hello@sun2wheel.ch
Ein E-Auto, das alle lieben
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Die Wahl des passenden E-Autos fällt vielen Schweizerinnen und Schweizern nicht leicht. Darum hat es sich die Auto Kunz AG zur Aufgabe gemacht, ihren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Beratung und Orientierung zu bieten. Das Gespräch mit den Experten zeigt: Gerade für Familien bieten die E-Autos der Marke JAC diverse Vorteile.
Was zeichnet E-Autos von JAC denn aus?
Kevin Baumann, wie gross ist die Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen bei der Auto Kunz AG?

In den vergangenen Jahren hat das Interesse unserer Kundinnen und Kunden nach elektrisch angetriebenen Autos stetig zugenommen. Das ist natürlich einerseits auf die zunehmende Awareness für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zurückzuführen. Gleichzeitig hat es andererseits auch mit der Tatsache zu tun, dass immer bessere Angebote für E-Fahrzeuge existieren. Die Wagen der Marke JAC sind dafür ein absolutes Musterbeispiel.
Das Gespräch mit den Experten zeigt: E-Autos der Marke JAC begeistern sowohl E-Mobilitäts-Neulinge als auch Familien und deren Kinder. Ein entscheidender Faktor sind sicherlich die Grösse sowie der enorme Komfort der Wagen. Stellt man diese Vorzüge in Relation mit dem vergleichsweise niedrigen Preis, kann man von einem echten Spitzenangebot sprechen. Oder anders gesagt: Man bekommt für sein Geld ganz viel E-Auto. Natürlich kommen hier zusätzlich noch die allgemeinen Vorteile von E-Fahrzeugen zum Tragen: Die Wagen von JAC verursachen keinen Lärm oder keinen CO2-Ausstoss und bieten dafür viel Sicherheit bei vergleichsweise niedrigen Treibstoffpreisen.
Für wen eignen sich die Wagen aus dem Hause JAC besonders?
Vor allem Familien sind ganz angetan von den verschiedenen Modellen. Die Autos sind enorm beliebt bei Einsteigern in die E-Mobilität und Familien mit kleinen Kindern, sie machen bei uns fast 60 Prozent der JAC-Käuferschaft aus. Das verwundert nicht,
denn wie gesagt: Für ein vergleichsweise geringes Budget erhalten sie viel Verlässlichkeit, Sicherheit, Mobilität, Transportkapazität und vor allem Qualität. Zudem möchte ich betonen, dass es sich bei JAC-E-Fahrzeugen nicht «nur» um Vernunftautos handelt: Mit bis zu 193 PS bieten sie auch enormen Fahrspass – was vor allem die Väter begeistert. Jede Familie und jede Kundengruppe ist anders. Wie stellen Sie sicher, dass alle das passende Fahrzeug bei Ihnen finden?
Wir legen grossen Wert auf einen ausgiebigen Beratungsprozess. Unsere Fachleute kennen sich bestens mit allen Marken sowie den verschiedenen Modellen und Klassen aus. Wir sind in der Lage, stets genau die Fahrzeuge zu finden, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zutreffen. Natürlich stehen wir ihnen auch nach dem Verkauf gerne zur Verfügung. Zudem offerieren wir nach drei Jahren oder 30 000 Kilometern den Service kostenlos. Und als Generalimporteur von JAC in der Schweiz sind wir von der Auto Kunz AG zudem die einzige Autogarage, die ein volles Rückgaberecht anbieten kann.
Was bedeutet das genau?
Wer nach dem Autokauf nicht zufrieden ist, kann den Neuwagen auf Wunsch durch ein anderes Modell einer anderen Marke umtauschen. Das ist uns sehr wichtig, denn schliesslich können im Rahmen einer Probefahrt nicht immer alle Aspekte eines Automobils komplett erfasst werden. Da die Zufriedenheit unserer Kundschaft unser zentrales Anliegen darstellt, bieten wir dieses Rückgaberecht an. Wer sogar von noch mehr Flexibilität in Sachen Mobilität profitieren möchte, kann statt eines Kaufs auch ein Auto Abo bei uns in Betracht ziehen.
Wie funktioniert so ein Auto Abo?
Wir von der Auto Kunz AG bieten ein Auto Abo bereits ab einer Laufzeit von drei Monaten an. Das bedeutet, dass man sich in diesem Fall nur für drei Monate zum gewählten Automobil verpflichtet und
eine entsprechende Abogebühr dafür zahlt. Dieses maximal-flexible Angebot eignet sich zum Beispiel perfekt für Leute, die nur im Winter ein Auto benötigen. Die maximale Laufdauer eines Auto Abos beträgt bei uns 36 Monate. Sämtliche Abos der Auto Kunz AG stellen ein «Rundum-sorglosPaket» dar, welches Versicherung, Steuern, Service und Reifen umfasst. Auch eine TCS-Mitgliedschaft ist im Abo inbegriffen. Man muss sich also um nichts mehr kümmern und hat gleichzeitig die monatlich anfallen Kosten vollkommen im Griff. Unser Auto Abo ist mittlerweile zu einer beliebten Alternative zu klassischen Leasingmodellen geworden.
Interview SMA Bilder zVg
JAC-Händler in der Schweiz
- Airbag Garage, Wolfhalden
- Auto Garage Zimmermann AG, Niederwangen
- Auto Kunz AG, Wohlen
- Autogarage Frei GmbH, Dübendorf
- Autohaus Thun-Nord AG, Steffisburg
- Carrosserie Lipp AG, Ruswil
- Carstop GmbH, Wil
- City Garage GmbH, Aarau
- Ernst Schöpfer AG, Schmitten FR
- Garage Heiz AG, Wetzikon
- Garage Riedhauser AG, Zillis
- HS Automobile AG, Guntershausen
- J. Windlin AG, Kerns
Weitere Informationen unter www.jac-schweiz.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA #FOKUSMOBILITÄT 14 BRANDREPORT • SUN2WHEEL AG
Kevin Baumann Manager JAC bei der Garage Auto Kunz AG
Die kleinste Smart City der Welt steht

in Niedergösgen
Wie können Arealbetreiber, Gemeinden und Städte ihren ökologischen Fussbadruck verringern und ihre Infrastrukturen energieeffizienter bewirtschaften? Antworten darauf liefert Bouygues Energies & Services auf ihrem Firmenareal in Niedergösgen. Dort befindet sich die kleinste Smart City der Welt mit elf intelligenten Lösungsansätzen. Damit leistet Bouygues E&S einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.
Städte und Gemeinden sind immer mehr mit den Herausforderungen des Klimawandels und dem demografischen Wandel konfrontiert. Sie sollen effizienter, klimaschonender und lebenswerter werden. Keine einfache Sache. «Hier setzen wir an», erklärt Martin Rumpf, Leiter Smart City von Bouygues E&S. «Wir entwickeln Ideen und Konzepte und zeigen Umsetzungsmöglichkeiten auf, um genau diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
Denn es geht in Zukunft darum, die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit innerhalb der Stadt oder der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.» So werden Energieversorgung, Mobilität und Kommunikationstechniken miteinander vernetzt und treten in Interaktion zueinander, um die Bedürfnisse der Menschen erfüllen zu können. Eine «Smart City» entsteht.


Das Smart-City-Portfolio von Bouygues Energies & Services






























Das Portfolio von Bouygues E&S im Bereich Smart City besteht aus drei Handlungsfeldern:
Smart Energy & Environment beinhaltet nachhaltige Lösungen für den intelligenten und ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt mittels Einsatzes moderner Technologien. Smart Public Security zeigt vernetzte Lösungen auf, welche zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit in den Bereichen Umwelt, Verkehr und Anlagen beitragen und


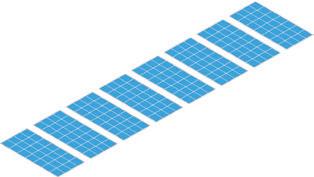































den Alltag erleichtern. Bei Smart Mobility werden Lösungen für eine sauberere, sicherere und effizientere Mobilität und den dazu benötigten Infrastrukturanlagen erarbeitet. Im Zentrum der Handlungsfelder befinden sich Konnektivitätslösungen und Data-Plattformen, welche die notwendigen Informationen der smarten Lösungen und Anwendungen über entsprechende Kommunikationstechnologien bereitstellen und visualisieren.
Ein Besuch in der Smart City in Niedergösgen lohnt sich An elf Stationen auf dem Firmengelände in Niedergösgen zeigen wir aus den verschiedenen Bereichen unseres Portfolios Lösungsansätze für das Erreichen einer Smart City. Wir haben zum Beispiel die ersten begeh- und befahrbaren Fotovoltaik-Strassenpanels installiert. Mit diesen Panels kann man brachliegende Flächen wie Strassen und Plätze zur Energieproduktion nutzen. Sie sind dank einer speziellen Sandwichstruktur rutschfest und befahrbar. Oder wir zeigen auf, wie man Strassenlaternen intelligent und sicher als Ladestationen für Elektroautos und Elektrovelos benutzen kann oder wie das Energiesparpotenzial aussieht, wenn die Lichtquellen nur dann hell leuchten, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Wie wäre es, wenn die Parkplatzsuche in den Städten noch
Haben Sie Beispiele dazu?




































Martin Rumpf, welchen Stellenwert nimmt das Thema Smart Mobility in einer Stadt ein? Mobilität ist die Lebensader einer Stadt! Menschen und Güter bewegen sich tagtäglich von A nach B und legen dabei unterschiedliche Strecken mit verschiedenen Verkehrsmitteln zurück. Die Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum, aber auch die Klimaveränderung wirken sich auf das Mobilitätsverhalten aus. Als Folge von wachsenden Mobilitätsbedürfnissen resultieren Verkehrsüberlastungen, knappe Platzverhältnisse, Hitzeinseln aufgrund der bebauten Flächen oder erhöhte Umweltbelastungen in Form von Feinstaub und CO2-Ausstoss. Hier setzt Smart Mobility an, um diese Herausforderungen mit neuen Konzepten und Lösungen anzugehen.

Wie sieht das konkret aus?









Smart Mobility-Massnahmen haben zum Ziel, die Mobilität effizienter, sicherer, nachhaltiger, aber auch komfortabler und zugänglicher zu gestalten. Das gelingt insbesondere über die Entwicklung und Bereitstellung von neuen Verkehrsangeboten und -infrastrukturen, welche das Mobilitätsverhalten beeinflussen – meist auch mit Einsatz moderner und vernetzter Technologien.

Das können Sharingangebote für Autos, Fahrräder oder E-Scooter an relevanten Verkehrsknotenpunkten sein, vernetzte und übergreifende Informationsdienste für die Nutzung von unterschiedlichen Verkehrsmitteln innerhalb einer Wegstrecke oder alternative Zustellformen von Lieferungen auf der letzten Meile. Auch Bestrebungen des autonomen Fahrens, der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, intelligente Lichtsignalanlagen oder Massnahmen zur Bevorzugung des Langsamverkehrs gehören dazu.
Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Bouygues Energies & Services im Bereich Smart Mobility?





Als Systemintegrator setzen wir auf Lösungen, welche eine sichere, effizientere und nachhaltigere Mobilität ermöglichen. Ein Highlight sind befahrbare Fotovoltaik-Panels, welche auf versiegelten Flächen wie Velound Fussgängerwegen oder Parkplatzzufahrten verklebt werden. Die damit erzeugte erneuerbare Energie kann beispielsweise die Beleuchtung, Schranken oder E-BikeLadestationen versorgen. Mit E-Ladestationen, welche nachträglich an Strassenlaternen angebracht werden, können E-Fahrzeuge mit 3,7 kW geladen werden. Ohne Tiefbauarbeiten lassen sich so schnell und einfach der Ausbau des Ladenetzes vorantreiben oder einen Zusatznutzen für die Kundschaft und Mitarbeitende generieren: Für die Schweiz als Land von Mieter:innen ein willkommener Mehrwert. Elementar für die Sicherheit in der Mobilität ist zudem die Beleuchtungsinfrastruktur. Mittels smarter Lichtsteuerung kann eine bedarfsgerechte Beleuchtung auf Strassen und in Quartieren sichergestellt werden. Dank Bewegungserkennung






















einfacher und schneller sein würde? Dank entsprechendem Technologieeinsatz können unnötige Fahrten vermieden und der Zeitverlust minimiert werden. Einsparungen ermöglichen auch Sensoren in Abfalleimern, die den Füllgrad anzeigen. So weiss man immer ganz genau, wann die Leerung stattfinden muss und der Einsatz von Müllautos kann effizienter gemanagt werden. Überfüllte Mülleimer gehören somit der Vergangenheit an.
oder lichtpunktgenauer Steuerung zum Beispiel bei Fussgängerstreifen können die Sicherheit erhöht und gleichzeitig der Stromverbrauch und Lichtemissionen reduziert werden. Dazu bieten wir auch eine mobile Lichtmessung an, um die aktuelle Beleuchtungssituation im öffentlichen Bereich zu erfassen und allfällige Optimierungsmassnahmen aufzuzeigen. Weitere Möglichkeiten ergeben sich beim Zutrittsmanagement: Mit unterschiedlichen Kontrollsystemen und -techno-






Mehr Informationen zur kleinsten Smart City der Welt sind zu finden unter: www.bouygues-es.ch/smart-city
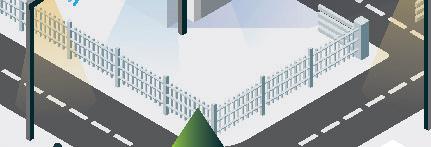
Die Smart-City-Lösungen können auf Voranmeldung via info.enertrans@bouygues-es.com besichtigt werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Areal der Bouygues E&S in Niedergösgen!
Warum ist es wichtig, dass Städte und Gemeinden Smart Mobility-Massnahmen umsetzen?
Geht es um Mobilität, geht es um Menschen. Ohne aktiv tätig zu werden, verstärken sich die eingangs erwähnten Herausforderungen und beeinflussen unseren Alltag. Mit frühzeitig geplanten und umgesetzten Smart-Mobility-Massnahmen können die Qualität des Zusammenlebens entscheidend erhöht sowie ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Ziele der CO2Reduktion bis 2030 bzw. 2050 geleistet werden.
Bouygues Energies & Services:












































































































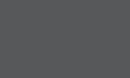










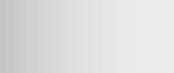




































Bouygues E&S ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen und ist mit rund 100 Standorten in der Schweiz lokal verankert, national tätig und global vernetzt. Wir beschäftigen schweizweit ca. 5000 Mitarbeitende, davon 350 Lernende. Dank unserer weltweiten Erfahrung und unserem regionalen Know-how sind wir Ihr idealer Partner für innovative Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudetechnik, Facility & Property Management, Energieversorgung, Verkehrstechnik, Telekommunikation, Prozessautomation und Smart City.
logien können Strassen- oder Arealzufahrten durch versenkbare Poller oder Toranlagen ge- und entsperrt werden. So lässt sich derselbe Zugang zum Beispiel für Anwohnende ganztägig, aber für Lieferwagen zeitlich beschränkt einrichten. In unserer Smart City in Niedergösgen zeigen wir noch viele weitere Optionen auf.
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
BOUYGUES E&S INTEC SCHWEIZ AG • BRANDREPORT 15 #FOKUSMOBILITÄT
Als Systemintegrator setzen wir auf Lösungen, welche eine sichere, effizientere und nachhaltigere Mobilität ermöglichen.
Martin Rumpf Leiter Smart City von Bouygues E&S
Zahlen und Fakten über die E-Mobilität von morgen
Niemand ist imstande, genau zu sagen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Dennoch können dank verschiedener Trends und Statistiken einige Prognosen aufgestellt werden – auch im Bereich der Elektromobilität. Welche davon sind momentan zentral und was sagen diese aus? «Fokus» klärt auf.
Im Jahr 2020 lagen die CO2-Emissionen des Verkehrs in der Schweiz laut Bundesamt für Statistik bei 13,4 Millionen Tonnen. Dies entspricht etwa 39 Prozent des Gesamtausstosses von Kohlenstoffdioxid aller Schweizerinnen und Schweizer im selben Jahr. Obwohl diese Zahlen in den letzten beiden Jahren etwas gesenkt werden konnten, sind Veränderungen im Mobilitätssektor notwendig – nicht zuletzt, um die Klimaziele von Paris bis 2050 erreichen zu können. Die Elektromobilität ist dabei ein grosser Bestandteil der aktuellen Diskussion. Wie wird sich diese in den nächsten Jahren entwickeln?
Neuzulassungen: 50 Prozent Elektroautos bis in zwei Jahren Weltweit werden Jahr für Jahr neue Rekordzahlen im Verkauf und in der Inbetriebnahme von Elektroautos geschrieben. So wurden zum Beispiel 2022 allein in der Schweiz etwas mehr als 40 000 neue E-Personenwagen in den Strassenverkehr aufgenommen – 4,4 Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Ein Beschleuniger für diesen Anstieg ist die sogenannte «Roadmap Elektromobilität», ein Programm des Bundesamtes für Energie BFE und des Bundesamtes für Strassen Astra. Eines der drei Ziele davon ist es, dass die Hälfte aller bis 2025 in der Schweiz neu zugelassener Autos aufladbar sind. Des Weiteren möchte das Projekt bis dahin 20 000 für die allgemeine Gesellschaft zugängliche Ladestationen schaffen und «das Laden zu Hause, am Arbeitsort oder unterwegs nutzerfreundlich und netzdienlich» machen.
ANZEIGE
Der weltweite Anstieg in dieser Branche Weitet man den Blickwinkel auf die ganze Welt aus, sollen dem BloombergNEF «Electric Vehicle Outlook 2022» zufolge die Verkäufe von E-Fahrzeugen bis 2025 von 6,6 Millionen im Jahr 2021 auf bis zu 20,6 Millionen steigen. Das machen zu jenem Zeitpunkt ungefähr 23 Prozent der weltweit verkauften Fahrzeuge aus. Vorangetrieben wird diese Prognose unter anderem durch den Beschluss der Europäischen Union zum Aus für Verbrennermotoren ab 2035 im gesamten EU-Raum. Spannend an diesen Zahlen sei vor allem, dass drei Viertel davon rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sein sollen und die Anzahl an Hybrid-Fahrzeugen in den nächsten Jahren stagnieren werde, wie BloombergNEF weiter voraussagt.

Reaktionen der Automobilbranche
Selbstverständlich haben auch die Automobilhersteller die Trends und das stark zunehmende Interesse an Elektrofahrzeugen bemerkt und müssen darauf entsprechend reagieren. Aus diesem Grund haben mehrere Produzenten für die nächsten Jahre diverse neue batteriebetriebene Fahrzeugmodelle entwickelt und teilweise bereits vorgestellt. So bringt Mercedes Benz allein im aktuellen Jahr drei neue E-Modelle auf den Markt. Auch Peugeot und der Luxusautomobilhersteller Maserati haben je zwei neue Elektroautos für 2023 geplant. Zudem schrauben zahlreiche Hersteller die Produktion ihrer schon entwickelten E-Fahrzeuge immer höher. Einen Schritt weiter geht zum
ACS WETTBEWERB 2023
Jubiläum 125 Jahre ACS
Jeden Monat haben Sie die Chance, spezielle Preise zu gewinnen und automatisch am grossen Wettbewerb teilzunehmen!
So einfach geht’s:
1. Melden Sie sich auf der Seite acs.ch/jubilaeum an
2. Beantworten Sie die Frage richtig
3. Daumen drücken!
Die Gewinner werden aus allen gültigen Einreichungen ausgewählt und persönlich benachrichtigt.
Beispiel Volvo, indem das Unternehmen bis 2030 die gesamte Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus der Fabrikation streichen möchte. Nicht nur die Zahlen an E-Fahrzeugen zeigen stark nach oben Aufgrund dieses voraussichtlich weltweiten Produktionsanstiegs von E-Fahrzeugen wird auch die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien immer grösser werden. Die führende Nation ist und bleibt laut BloombergNEF China, Europa möchte aber nachziehen und baut deshalb vor allem in Schweden und Norwegen riesige Produktionsstätten für die zunehmende Nachfrage solcher Batterien. Bis im Jahr 2030 könnte der Anteil Europas in der Produktion von aktuell sieben auf 31 Prozent steigen. Unterstützt wird dieser Zuwachs vor allem durch die Forschung, die in den kommenden Jahren grosse Fortschritte in der Technologie und dadurch eine erhöhte Produktionseffizienz ermöglichen wird. Ein weiterer Vorteil davon sei, dass die Batterien immer nachhaltiger hergestellt und recycelt werden können, wie die digitale Plattform für Elektromobilität «Virta» schreibt.
Ein Shift des Interesses
Wie BloombergNEF in seinem aktuellen «Electric Vehicle Outlook» weiter angibt, gibt es eine Verlagerung der Gründe für die genannten Trends. Es sind nicht mehr vor allem die Politik, die zu verfolgende und umzusetzende Ziele vorgibt, sondern vielmehr die
privaten Konsumentinnen und Konsumenten, die ihr Mobilitätsverhalten verändern möchten. Aus zahlreichen Studien geht schon länger hervor, dass batteriebetriebene Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus deutlich weniger Kohlenstoffdioxid ausstossen wie diesel- oder benzinbetriebene Motoren. In der heutigen Welt, die sich vermehrt um den Klimawandel und nachhaltige Lebensweisen dreht, ist ein E-Auto deshalb für viele eine gute Lösung und so ein Grund, weshalb sich das Interesse daran immer mehr steigert.
Des Weiteren sind es aktuelle Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und die Inflation in vielen Ländern der Welt, die dazu führen, dass unter anderem die Preise für Benzin und Diesel sowie die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren höher werden. Daraus resultiert, dass immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher den Kauf eines E-Autos in Betracht ziehen.
Nichtsdestotrotz stehen wir diversen Expert:innen und Studien zufolge in der näheren Zukunft erst am Anfang der Entwicklung und die Zahlen zur E-Mobilität werden auch in den folgenden Jahren exponentiell fortlaufen.
Text Julia Ischer
ACS Wettbewerb März 2023
1. Preis: 1 Package für 2 Personen für den Grand Prix von Barcelona 2023 (inkl. Tickets, Hotel und Flug)

2. Preis: 4 × Geschenkkarte von Migrol im Wert von CHF 50.–
3. Preis: 4 × Tankgutschein von Eni im Wert von CHF 50.–
4. Preis: 1 × MONOPOLY Schweiz –MEGA-Edition mit ACS Spielfeld
Viel Glück beim Mitmachen!
Mehr erfahren: acs.ch/jubilaeum
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 16 NACHHALTIGE MOBILITÄT
Bild iStockphoto/sarawuth702
E-Mobility-Installation:


einfach,
schnell und sicher
Das Flachkabel-System von Woertz bietet eine schnelle und einfache Methode zur Installation einer Ladeinfrastruktur, die zudem energieeffizient und sicher ist und somit ideal für Parkhäuser, Tiefgaragen, Outdoor-Parkplätze und Ladesäulen geeignet ist.
eine vorkonfektionierte Abzweigdose am Flachkabel und verbinden dann diese mit der Ladestation.
Kein Kabel durchtrennen, kein Abisolieren und kein Abmanteln. Einfach nur Zusammenschrauben.
Herr Paris, Ladeinfrastrukturen schiessen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Immer wieder trifft man dabei auf das Flachkabelsystem. Wer oder was steckt da dahinter?
Einfach eine gute Lösung. Das Flachkabel-System ist unsere patentierte Erfindung aus dem Jahre 1972 und wurde seitdem perfektioniert. Es ist Swissness pur. In der Schweiz erfunden. In der Schweiz produziert. Von einem Schweizer Familienunternehmen.
Das Grundprinzip des Flachkabel-System ist, das stromführende Kabel für Kontaktstellen nicht zu unterbrechen und gleichzeitig eine optimale Kontaktierung zu gewährleisten. Elemente inklusive Sicherungen können direkt auf das Kabel aufgesetzt werden, da in einem einzigen Kabel Energie und Daten geführt werden können. Daraus ergeben sich zahlreiche überragende Vorteile in Bezug auf Installationsgeschwindigkeit, Ressourcenschonung und Energieeffizienz für Gebäudeautomation, Brandsicherheit und eben auch E-Mobility.
Sie rühmen die Woertz E-Mobility-Installation als die schnellste und einfachste Methode. Ist das wirklich so?

Ja, das ist so. Es gibt keine schnellere und einfachere Methode. Beim Flachkabel-System montiert man das Flachkabel, mechanisch gesichert mit einer Schraube je Befestigungsbride an der Wand oder der Decke. Überall dort, wo eine Ladestation nötig ist, montiert man in rund drei Minuten
Da eine Dose auch zwei Abgänge haben kann, kann man so in einem Schritt sogar gleich zwei Ladestationen auf einmal installieren. Dies ist gegenüber der klassischen Methode mit Rundkabel sogar viermal schneller. Zwei auf einen Streich.
Auf dem Markt gibt es auch steckbare Varianten mit Flachkabel. Ist das nicht noch schneller?
Die Frage ist eigentlich hinfällig in Bezug auf unsere vorkonfektionierten Abzweigdosen, bei denen das Abgangskabel bereits in der passenden Länge an der Dose angeschlossen ist. Da muss man nicht einmal mehr den Stecker einstecken, da das Kabel schon montiert ist. Steckverbindungen haben aber eine ganz andere Tragweite. Sie sind zusätzliche Kontaktstellen. Kontaktstellen sind immer Schwachstellen. Diese auf das absolute Minimum zu reduzieren, zeichnet ein System aus. Ein Stecker macht nur dort Sinn, wo es keine hohen Ladeströme gibt und häufiges Aus- und Einstecken zu erwarten ist. Das ist hier nicht der Fall. Das Abgangskabel wird normalerweise ein einziges Mal montiert und muss nicht einmal mehr ersetzt werden, wenn die Ladestation ausgetauscht wird. Man schliesst es einfach an die neue Ladestation an. Ein Stecker ist hier wirklich mehr als unnötig und bringt einige gewichtige Nachteile in Bezug auf Energieeffizienz und Sicherheit mit sich. Gerade bei hohen Ladeströmen, wie sie bei einer Ladeinfrastruktur vorliegen, verursachen Steckverbindungen zusätzlichen Widerstand, Spannungsverluste und Fehleranfälligkeit. Hinzu inkludieren sich zusätzliche Kosten für den Stecker im Preis des Kabels und der Abzweigdose.
Geschwindigkeit ist aber nicht alles. Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit und Sicherheit aus?
Das System selbst ist bereits seit Jahrzehnten im Einsatz im öffentlichen Verkehr und der Industrie. Es hat sich bewährt und ist nichts Neues, das extra für E-Mobility erfunden wurde. Es eignet sich einfach optimal für E-Mobility.
Die patentierte Piercing-Kontaktierung unseres Flachkabelsystems ist eine sehr zuverlässige und energieeffiziente Kontaktierungsmethode, insbesondere da die stromführende Hauptleitung niemals unterbrochen wird und dank der physikalischen Merkmale eine optimale Kontaktierung gewährleistet wird.
Das Woertz Flachkabelsystem selbst erfüllt Schutzart IP65 und die höchsten Sicherheitsanforderungen nach Bauprodukteverordnung: B2ca s1 d0 a1. Nicht viele Kabel erfüllen eine solch hohe Klassifikation und Zusatzklassifikation. Diese Klassifizierung beinhaltet im Brandfall die Eindämmung der Flammausbreitung, sowie die Begrenzung der Brandentwicklung und der Wärmefreisetzungsrate. Zudem bestehen keine starke Rauchentwicklung, keine brennenden Tropfen und keine korrosive Gasentwicklung. Kurzum, vom Kabel selbst geht keinerlei Gefahr aus.

Ist das System auch Zukunftssicher?
Und wie sieht es mit der Lebensdauer aus?
Das System ist absolut zukunftssicher. Kabel und Dose kommen aus demselben Haus und erfreuen sich einer Systemgarantie. Sie sind aufeinander abgestimmt. Und auch zukünftige Dosen werden mit dem jeweiligen System kompatibel sein. Da wir alles selbst produzieren, können wir dies gewährleisten und sind nicht von Lieferanten abhängig.
Man kann also getrost in einer Tiefgarage ein Kabel der Wand entlang ziehen und wann immer man an einem Parkplatz eine Ladestation benötigt, eine weitere Anschlussdose bestellen und diese montieren. So muss man nicht gleich von Anfang an jeden Parkplatz ausrüsten, sondern ganz nach Bedarf. Das System ist übrigens kompatibel mit Ladestationen aller Hersteller. Zur Wahl des richtigen Kabels und dem vorausschauenden Blick, stehen unsere Berater zur Verfügung, die allesamt vom Fach sind.
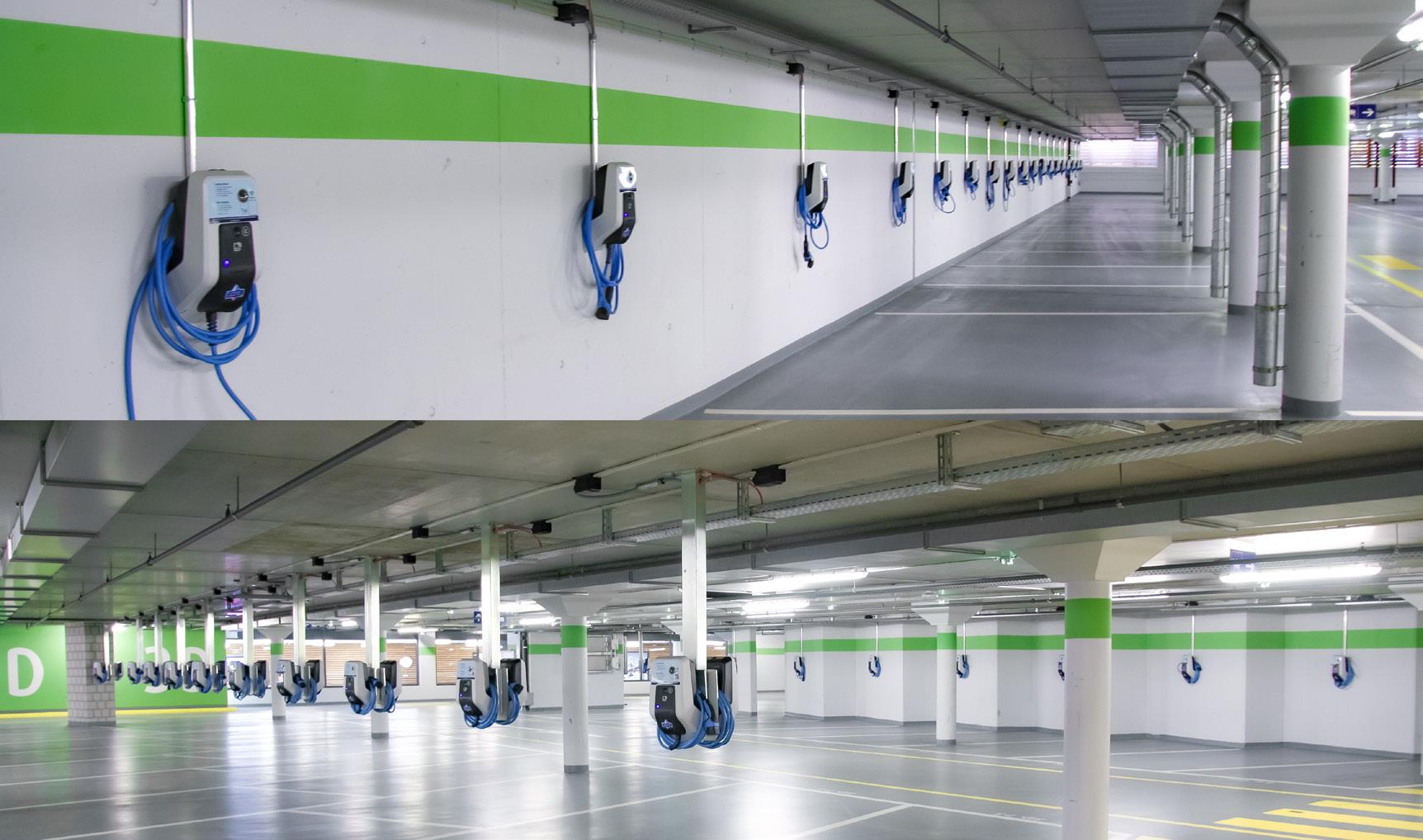
Was die Lebensdauer betrifft, so ist das Flachkabel dank der besseren Wärmeableitung aufgrund seiner Fläche höher belastbar und erfreut sich dadurch einer deutlich höheren Lebensdauer als Rundkabel unter denselben Bedingungen. Das Flachkabel kann auch problemlos aussen bei direkter Sonnenstrahlung eingesetzt werden, da es durch die Beigabe spezieller Stabilisatoren gegen die gefährliche UV-Strahlung geschützt ist und nicht spröde wird. Wo eignet sich die Flachkabelmethode besonders?
Grundsätzlich überall ab einer Grösse von drei Ladestationen. Je grösser, desto effizienter. Ladestationen in Parkhäusern, Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern oder Firmen, Outdoor-Parkplätzen oder auch Ladesäulen, bei denen das Kabel durch Woertz Abflussrinnen geführt werden. Ein besonders interessantes Beispiel ist das Matterhorn Terminal Täsch bei Zermatt im Wallis mit 2100 Parkplätzen. Hier hat die Ferratec Technics AG den vermutlich grössten Ladepark der Schweiz auf die Beine gestellt, der etappenweise noch weiter ausgebaut werden soll. Aktuell sind es 131 Ladestationen, die bei Bedarf auf bis zu 2000 Stationen ausgebaut werden können. Die ganze Installation ist intuitiv bedienbar, verfügt über ein einfaches Abrechnungssystem, einem intelligenten Lastmanagement und ist natürlich mit Flachkabel realisiert. Eine tolle Sache.
Weitere Informationen unter woertz.ch

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA WOERTZ AG • BRANDREPORT 17 #FOKUSMOBILITÄT
Flachkabel Ladepark Matterhorn Terminal Täsch (VS)
Nicolas Paris Leiter Marketing bei Woertz AG
Smartes Management privater Ladenetze für E-Autos
Nach dem Errichten einer leistungsstarken Fotovoltaikanlage haben die Verantwortlichen der Bystronic Laser AG in Niederönz auch betriebseigene Ladestationen mit einem autonomen Netzwerk installieren lassen.
Dessen Zugang und Abrechnung stellt Move myNet sicher, was unter anderem die Grundlage für privilegierte Ladetarife für die Belegschaft und das Entfallen sämtlichen administrativen Aufwands schafft.
Seit die Bystronic Laser AG vor rund 36 Jahren gegründet worden ist, nimmt die Nachhaltigkeit einen zentralen Stellenwert in der Firmenkultur ein. Am Hauptsitz in Niederönz etwa ist es ein Ziel, den Betrieb bis 2025 zu dekarbonisieren, Heizung und Klima also weg von Gas und Öl zu bringen. Ein wichtiger Schritt dorthin war die Installation einer leistungsstarken Fotovoltaikanlage im Jahr 2021, die 550 000 kWh abgibt und die schon in naher Zukunft weiter ausgebaut werden soll. Die Frage, wofür diese beträchtliche Energiemenge Verwendung finden soll, war für Fabian Furrer, Managing Director der Bystronic Laser AG in Niederönz, schnell beantwortet: «Da die Elektromobilität ein wichtiger Teil der Environment Social Governance von Bystronic ist, war uns schnell klar, dass dieser Strom nicht ausschliesslich der Infrastruktur vor Ort, sondern auch den Mitarbeitenden in Form von Ladestationen zugutekommen soll.»
Reduzierte Ladetarife fürs Team
Das Energielösungsunternehmen Helion, das schon die Fotovoltaikanlage installiert hatte, errichtete in der Folge im und vor dem Werkgelände einen Schnelllader Alpitronic (2 x CSS / 1 x Typ 2 AC) und 18 Easee Ladestationen. Letztere befinden sich zu Teilen im Werksgelände und stehen nur den insgesamt 700 Mitarbeitenden zur Verfügung. Die übrigen und der Schnellader sind auf dem Parkplatz vor dem Empfang installiert, wo die Mitarbeitenden und die Kund:innen sie benützen können. Fabian Furrer begründet diese eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten: «Wir haben die Anlage bewusst nicht öffentlich gemacht, weil sich anderenfalls Fragen nach der Haftung und Überwachung gestellt hätten. Zudem wollten wir unseren Mitarbeitenden mit reduzierten





Ladetarifen von Anfang an einen Anreiz für die Elektromobilität bieten.» Helion hat die ganze Anlage technisch bereits so vorbereitet, dass sie von den heute 18 problemlos auf 60 Ladestationen erweitert werden kann. Das wird absehbarerweise dann nötig werden, wenn die Fahrzeugflotte der Bystronic Laser AG, die heute noch mit Benzin betrieben ist, demnächst schrittweise umgestellt wird und die ersten acht batteriebetriebenen Autos erhält.
Motivation für Elektromobilität
Als Partner für Zugang und Abrechnung hat Helion bei der Montage Move Mobility empfohlen, deren Expert:innen in der Folge Move mynet dafür aufgesetzt haben. Diese Ladelösung erlaubt es, den Zugang ausschliesslich für Nutzer:innen des eigenen Netzwerks sicherzustellen, und in der Folge wunschgemäss auch individuelle Ladepreise festzulegen. Dank der Strom-Subvention der Bystronic Laser AG kommen die Mitarbeitenden heute folglich in den Genuss von reduzierten Ladetarifen. Fabian Furrer freut sich darüber, seiner Belegschaft so geschätzte Fringe Benefits und einen grossen Motivationsfaktor bieten zu können. Aber nicht nur das:

«Zusammen mit unserer Investitionshilfe für die private Ladestation zu Hause sind die privilegierten Ladepreise ein grosser Anreiz für den Wechsel auf die Elektromobilität.» Neben dem einfachen Zugang ist die Bystronic Laser AG mit der Lösung von Move aber auch darum zufrieden, weil fürs Abrechnen der Ladekosten keinerlei administrativer Aufwand anfällt. Und weil die Expert:innen von Move anfängliche Kinderkrankheiten mit dem Kartenleser schnell und unkompliziert beheben konnten.
Die Zukunft ist elektromobil Mit der gegenwärtigen Anlage hat die Bystronic Laser AG nach dem Bekunden von Fabian Furrer aber erst einen ersten Schritt in die elektromobile Zukunft getan. 30 Niederlassungen von Bystronic setzen bereits
auf Solarkraft und Elektromobilität, in Deutschland und den USA sind weitere, umfangreiche Projekte nach dem Beispiel von Niederönz geplant. Dank der technologischen Entwicklung ist Fabian Furrer zuversichtlich, dass der limitierende Faktor «mangelnde Reichweite» (die Spezialisten der Bystronic Laser AG müssen für ihre Einsätze oft sehr rasch sehr weite Strecken fahren können) schon in naher Zukunft überwunden ist.
Move Mobility
Die Move Mobility AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Energiedienstleister Alpiq, Primeo Energie, Energie Wasser Bern und Groupe E. Die Mission des Start-ups mit Sitz in Freiburg und Zürich ist es, Fahrer:innen von Elektroautos und Besitzer:innen von Ladestationen ihr –vorher komplexes – Leben massgeblich zu vereinfachen. Das gelingt insbesondere dank einem einheitlichen Preissystem mit fixen Preisen an den eigenen Ladestationen und denjenigen der Partner. Als Anbieter von Gesamtlösungen für Ladeinfrastruktur installiert Move Anlagen aus einer Hand und übergibt sie schlüsselfertig.


Elektrofahrzeuge laden: unkompliziert und übersichtlich
Das Sortiment von schnellladen.ch ist gemacht für alle, die nachhaltig unterwegs sind: Hier finden Kundinnen und Kunden Lade-Equipment und Elektrofahrzeug-Zubehör und werden von Profis umfassend beraten. So einfach geht Nachhaltigkeit.
Damit Unternehmen ihre gesteckten Nachhaltigkeitsziele erreichen, rüsten sie immer mehr Angestellte mit elektrischen
Dienstwagen aus. Nicht immer können diese am Firmenstandort aufgeladen werden, oft geschieht das zu Hause. Damit die Abrechnung der Strombezüge möglichst einfach wird, brauchts eine abrechnungsfähige Wallbox.
Faire Abrechnung: den Dienstwagen
zu Hause laden
Die Keba KeContact P30 Dienstwagen Wallbox von schnellladen.ch erfasst den Strombezug genau und protokolliert diesen – unabhängig davon, ob es sich bloss um ein Fahrzeug oder gleich um mehrere handelt. Die Daten werden anschliessend ganz einfach über eine App oder den Browser abgerufen. Oder aber die Wallbox wird direkt in das Abrechnungssystem des Unternehmens integriert. Die Dienstwagen-Wallbox lässt sich übrigens ganz einfach mit einer Solaranlage koppeln und ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Solarsteuerungen kompatibel. Doch was tun, wenn die Stromversorgung zu Hause eher kritisch ist? Auch hier denkt die Dienstwagen-Wallbox mit und bietet eine unkomplizierte Lösung: Zusammen mit einem Smartmeter überwacht sie den Hausanschluss und stellt immer nur so viel Energie fürs Laden zur Verfügung, dass der Hausanschluss nicht überlastet wird.
Ladestation für viele Plätze: das dynamische Lastmanagement-System
Andere Keba KeContact P30 Ladestationen sind auch für Tiefgaragen mit vielen Parkplätzen geeignet. Die komplexen dynamischen Lastmanagement-Systeme mit bis zu 16, 40 oder 200 Ladestationen lassen sich ganz einfach konfigurieren und abrechnen. Flexibler gehts kaum! Damit der Nachhaltigkeitsgedanke von A bis Z umgesetzt wird, sorgt auch die Herstellung der Wallboxen von Keba: Sie werden 100 Prozent CO2-neutral im österreichischen Linz hergestellt. Wer eine Dienstwagen-Wallbox oder eine andere Wallbox von Keba kauft, profitiert von kantonalen und städtischen Förderungen. So erhalten Käufer:innen im Kanton Zürich beispielsweise einen Zuschuss von 500 Franken.
EV Buddy 11 Smart – einfach, kompakt, vernetzt Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen möchten eine Ladelösung, die sich ins heimische WLAN integriert und aus der Ferne per App steuern lässt – unabhängig davon, ob für zu Hause oder unterwegs. Dafür eignet sich der EV Buddy 11 Smart. Er lässt sich an einer gewöhnlichen 400-Volt-16A-Steckdose anschliessen, wie sie bereits in vielen Garagen vorhanden ist. Mit einer Ladeleistung von 11 kW lässt sich damit jedes Elektrofahrzeug bequem im Nu vollladen. Die Stromstärke stellt man dafür direkt am Gerät ein und regeln damit den Leistungsbezug selbst. Den EV Buddy 11 Smart kann man auch von einem dreiphasigen zu einem einphasigen Modus umstellen – damit ist garantiert, dass eine schonende Ladung mit nur 1,4 kW möglich ist. Besonders bequem: Alle Funktionen sind über die App steuerbar. Noch umweltschonender wird das Laden im Zusammenhang mit einer Fotovoltaikanlage. Der EV Buddy 11 Smart verfügt über eine offene Programmierschnittstelle und ist damit in die Solarsteuerung Solar Manager integriert – dem Schweizer Marktführer für private Solarsteuerungen. So lädt man immer genau

mit der Leistung, die man gerade als Solarstromüberschuss zur Verfügung hat. Gut also für die Umwelt – und das Portemonnaie! Ein weiteres Plus: Der EV Buddy 11 Smart ist mit Kabellängen von 6,5 und 10 Meter verfügbar und wird in Europa produziert.
sparen. Der Typ 2 Bike-Adapter wurde in der Schweiz entwickelt und produziert.
E-Bike laden: mit Adapter über die Ladestation
Eine Wallbox in der Garage, um das Elektroauto zu laden? Aber auch andere Geräte sollen mit Strom versorgt werden wie zum Beispiel ein Staubsauger oder ein E-Bike? Kein Problem mit dem Typ 2 Bike-Adapter. Dieser lässt sich ganz einfach mit der entsprechenden Ladestation verbinden und schon hat man einen Haushaltstecker, an den man beliebige Geräte oder eben ein E-Bike anschliessen kann.

Die Energie wird dabei direkt über die Ladestation bezogen. Wenn man sich also in einem Abrechnungssystem für Mieterinnen und Mieter befindet, wird der bezogene Strom ganz einfach direkt abgerechnet. Auch ein Lastmanagement-System erkennt den Strom und regelt sich entsprechend.
Mit diesem einfachen Adapter kann man sich eine komplizierte – und teure! – Parallelinfrastruktur
schnellladen.ch ist der umfangreichste Schweizer Fachmarkt für Lade-Equipment und Elektrofahrzeug-Zubehör. Neben AC-Ladestationen fürs Zuhause oder den öffentlichen Bereich führt das Unternehmen verschiedene mobile Lade-Einheiten, Standard-Ladekabel, verschiedene Adapter sowie DC-Schnellladestationen oder Geräte für die bidirektionale Ladung. www.schnellladen.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA
#FOKUSMOBILITÄT 18 BRANDREPORT • MOVE MOBILITY SA
• SCHNELLLADEN
BRANDREPORT
GMBH
Bike Adapter EV Buddy 11 Smart KEBA Dienstwagenwallbox
Dank Move
Laser AG
Möglichkeit einer freien Preisgestaltung, aber keinen administrativen Aufwand. (Bild: MOVE Mobility / Eliane Clerc)
myNet hat die Bystronic
die
(Bild: MOVE
Die Ladeanlage der Bystronic Laser AG ist bereits heute so dimensioniert, dass sie morgen problemlos erweitert werden kann.
Mobility / Eliane Clerc)
Zügig das E-Auto aufladen – und gleichzeitig selbst ein bisschen «auftanken»
Eines der gängigsten Argumente, welches von Kritikerinnen und Kritikern der E-Mobilität ins Feld geführt wird, ist die Ladedauer von E-Fahrzeugen. Doch wie die Migrol AG mit ihren modernen Tankstellenstandorten beweist, muss das Laden eines E-Autos weder lange dauern noch verlorene Zeit für die Lenkerinnen oder Lenker darstellen.
Zeit ist relativ. Langeweile ebenfalls. «Und damit unsere Kundinnen und Kunden beim Laden ihres E-Autos so effizient wie möglich bedient werden, setzen wir bei unseren Tankstellenstandorten vermehrt auf Fast-Charging-Stationen», erklärt Alexander Kaufmann, Leiter E-Mobility Produkte bei der Migrol AG. Diese modernen Ladeinfrastrukturen sind dafür ausgelegt, innert kürzester Zeit ausreichend Leistung in die Batterie zu bringen, damit eine schnelle Weiterfahrt bei einer
man die Zeit perfekt nutzen, um selbst ein wenig «aufzutanken». Ob man sich dabei nun die Beine vertritt, einen Happen isst oder einen leckeren Kaffee geniesst – «an unseren Standorten wird jede Ladepause zu einer angenehmen, kleinen Auszeit», betont Alexander Kaufmann schmunzelnd.
Weiter profitiert die Kundschaft von einer einfachen Bezahlmöglichkeit: Nebst Debit- oder Kreditkarte kann auch mit der Migrolcard bezahlt werden. Und Privatkunden können zudem wertvolle Cumulus-Punkte sammeln.
Auch an die Firmenkunden gedacht
sinnvollen Reichweite möglich wird. «Die Ladedauer beträgt zwar auch beim Fast-Charing noch etwa 15 bis 20 Minuten», räumt Kaufmann ein. Doch da alle diese Stationen an Standorten installiert sind, die ebenfalls einen migrolino-Shop umfassen, kann
Die Installation der Fast-Charging-Stationen wird im Rahmen der Elektrifizierungsstrategie der Migrol AG vorangetrieben. Das Unternehmen hat sich dafür ambitionierte Ziele gesteckt: «Wir planen, mittelfristig 100 Standorte mit E-Ladestationen auszurüsten», führt der Bereichsleiter E-Mobility Services Valentin Peter aus. Derzeit beläuft sich deren Anzahl noch auf 20. «Unser Netzausbau wird sich aber nicht nur auf Fast-Charging-Stationen oder auf Tankstellenstandorte beschränken», betont Valentin Peter: Man werde künftig zusammen mit Migros auch geeignete Einkaufsfilialen elektrifizieren. «Als Migros-Tochterunternehmen sind wir natürlich immer daran interessiert, für unsere Kundinnen und Kunden ein komfortables, kombiniertes Angebot zu schaffen.» Mit dieser zunehmenden Elektrifizierung komme man dem Bedürfnis der Kundschaft nach einer «grüneren», umweltschonenderen Mobilität nach.


Der E-Verkehr der Zukunft umfasst natürlich nicht nur Privatfahrzeuge, sondern wird ebenfalls massgeblich von Firmenflotten mitbestimmt. Auch hier unterstützt die Migrol AG ihre Kundschaft direkt: «Ein wesentlicher Vorteil unseres Angebots besteht in unserer bewährten und einfach zu handhabenden Abrechnungslösung.» Die Migrolcard, die von vielen Fahrzeugflotten bereits als Zahlungsmittel verwendet wird, kann ohne Anpassung oder Umschreibung auch für den Bezug elektrischer Energie an den Migrol-Ladestationen genutzt werden. «Wer also schon heute die Migrolcard im Rahmen des eigenen Flottenmanagements nutzt, ist damit perfekt gerüstet für die Zukunft, ohne dafür irgendetwas unternehmen zu müssen», fasst Alexander Kaufmann zusammen. Da die wenigsten Unternehmen ihre bestehende Flotte einfach von heute auf morgen komplett auf E-Cars umstellen können und wollen, werden in den nächsten Jahren immer mehr Mischflotten auf Schweizer Strassen unterwegs sein. Und genau da ermöglicht die Migrol AG mit ihrer Infrastruktur sowie der praktischen Abrechnungslösung einen maximal-einfachen Betrieb.
Die Migrol-Expertinnen und -Experten bringen ihre Elektrifizierungs-Expertise aber nicht nur an den Tankstellenstandorten zum Tragen: Im B2B-Bereich werden auch Immobilien mit modernen Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität versehen. «Wir bieten hier alles aus einer Hand und übernehmen die gesamte Installation sowie die Inbetriebnahme und Stromabrechnung
der Anlagen», führt Alexander Kaufmann aus. Dieses Angebot der Migrol AG richtet sich unter anderem an Hausbesitzerinnen und -besitzer, Stockwerkeigentums-Gemeinschaften, Wohngenossenschaften sowie Immobilienverwaltungen. Natürlich profitieren auch diese Kundinnen und Kunden von der bewährten und nutzerfreundlichen Verrechnungslösung. Text SMA
Über die Migrol AG
Seit ihrer Gründung 1954 spielt die Migrol in der Schweizer Energiebranche eine tragende und prägende Rolle. Mit grossem Innovationsgeist hat sich Migrol eine führende Position erarbeitet. Als Schrittmacherin im Energie- sowie Mobilitätsmarkt hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht, in der jüngeren Zeit tat sich Migrol zudem als pionierhafte Unterstützerin der Elektromobilität hervor.
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung
E-Mobility Services Migrol AG

Soodstrasse 52
8134 Adliswil
e-mobilitaet@migrol.ch
044 495 16 16
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA MIGROL AG • BRANDREPORT 19 #FOKUSMOBILITÄT
© Marco Leisi für Zaptec
Die Zukunft des Güterverkehrs: ganzheitlich, vollautomatisch, unterirdisch
Am Knotenpunkt der Megatrends Mobilität, Konnektivität und Neo-Ökologie befindet sich ein Mammutprojekt in der Entstehung: Cargo sous terrain. Mit den ersten Probebohrungen im Januar beginnt nun die Vision einer unterirdischen Gesamtlogistik, zur Realität zu werden.
Beim Begriff «Mobilität der Zukunft» denken die meisten wohl an den elektrisierten Individualverkehr, selbstfahrende Autos und Shared Mobility. Vergessen wird dabei aber oft, dass auch der Gütertransport grossen Einfluss auf Infrastruktur und Verkehrsverhalten ausüben. Die Schweizer Gesellschaft befindet sich im Wandel. Wir werden individueller, mobiler und nachhaltiger. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung unaufhörlich, sodass sich nicht nur die Ansprüche an die Mobilität ändern, sondern auch die Umstände. Mit anderen Worten: Die Verkehrsinfrastruktur wird in nicht allzu ferner Zeit an ihre Grenzen stossen. Nur den Güterverkehr betreffend geht das Bundesamt für Raumentwicklung ARE von einem Wachstum von plus 37 Prozent aus (Perspektiven des Schweizerischen Personen- und Güterverkehrs 2040).
Gütertransporte auf Strasse und Schiene
Der Gütertransport erfolgt in der Schweiz mehrheitlich über den Strassen- und Schienenweg. Infolgedessen konkurrieren der Personen- und der Warenverkehr um Kapazitäten der öffentlichen Infrastruktur. Trotz der Reduzierung von Engpässen wird der Platz aber knapp. Unter anderem das Bevölkerungs- als auch das Wirtschaftswachstum sorgen dafür, dass Menschen und Güter immer mehr Fläche für sich beanspruchen.
Abhilfe schaffen könnte ein Ausbau der Kapazitäten, doch vieles spricht dagegen, dass Strassen- und Schieneninfrastrukturen mehr Raum einnehmen sollen.
Logistik ganzheitlich gedacht
Eine Lösung könnte sein, die Güter von Strasse und Schiene zu holen oder auf andere Schienen
zu verlagern. Verlaufen die neuen Transportwege im Untergrund, können Ballungszentren mit hohem Güterverkehr effizient mit Logistikzentren und Umschlagplätzen verbunden werden. So die Kernidee von Cargo sous terrain.
Konkret handelt es sich bei diesem Vorhaben um ein unterirdisches Tunnelsystem, das schlussendlich zumindest einen Teil der Schweiz logistisch erschliessen soll: Die Hauptachse soll von Genf über Lausanne, Bern und Zürich bis St. Gallen führen, während davon abgehend weitere Zweigstrecken Thun, Basel und Luzern bedienen. Das Ziel ist, dass kleinteilige Güter störungsfrei zwischen den Stationen fliessen, sodass Wartezeiten an Umladestationen vermieden und Zwischenlager überflüssig werden.
Weitere Komponenten
Das Tunnelsystem transportiert die Güter zwischen sogenannten Hubs. Damit diese Art von Logistik jedoch gesamtheitlich funktioniert, muss eine zweite Komponente hinzugedacht werden: die Feinverteilung innerhalb der Städte. Tatsächlich ist die City-Logistik untrennbarer Bestandteil der Idee von Cargo sous terrain. Denn der flüssige Warenverkehr hängt auch von einer reibungslosen Verteilung auf der letzten Meile ab. KI-Anwendungen sollen hier Abhilfe schaffen, sodass die Güter mit dem geringstmöglichen Ressourcenaufwand von Hub zum Bestimmungsort gelangen.
Dies spricht eine dritte, ebenso wichtige Komponente an: die IT. Cargo sous terrain ist nicht nur ein Logistik-, sondern auch ein grosses Digitalisierungsprojekt.
In Zukunft soll der Betrieb dieser «One Chain»Logistik voll automatisiert ablaufen. Um dies zu ermöglichen, muss erst eine geeignete IT-Infrastruktur aufgebaut und implementiert werden.

Nachhaltigkeit
Der Hauptgrund hinter der Idee von Cargo sous terrain ist schlussendlich die Nachhaltigkeit. Founding Partner Pierre de Meuron beschreibt das Vorhaben auch als Sozial- und Umweltprojekt. Durch die Verlagerung des Güterverkehrs in den Untergrund wird die Belastung von Strasse und Schiene gemildert. Die Frage nach einem Ausbau der Infrastruktur könnte sich erübrigen, wodurch sich die Verkehrsfläche nicht ausbreiten muss. Der niedrigere – oder zumindest gleichbleibende – Flächenbedarf belässt der Landschaft und der Natur ihren Raum. Ausserdem soll Cargo sous terrain ausschliesslich elektrifizierte Fahrzeuge und Transporter nutzen, was sich in einer Senkung von Lärmund CO2-Emissionen niederschlägt: ein grosser Schritt in Richtung dekarbonisierte Logistik.
Grünes Licht vom Bund
Die gesetzliche Grundlage für das Grossprojekt legte das Parlament bereits am 17. Dezember 2021. Cargo sous terrain ist zwar eine privatwirtschaftlich organisierte Aktiengesellschaft, der Bund setzt allerdings die Erfüllung gewisser Bedingungen voraus. Einerseits muss der Grundsatz der Nichtdiskriminierung eingehalten werden. Das heisst, auch Parteien, die nicht finanziell am Projekt beteiligt sind, müssen gleichermassen Zugang zu dieser neuen
Infrastruktur erhalten. Andererseits ist die Mitfinanzierung mit öffentlichen Geldern ausgeschlossen.
Teilprojekte und derzeitiger Stand
Der Zeitplan für Cargo sous terrain ist ambitioniert: Die Gesamtfertigstellung ist auf das Jahr 2045 angesetzt, die in Teilprojekten erfolgen soll. Ab 2031 soll die erste Teilstrecke zwischen Härkingen-Niederbipp und Zürich inklusive zehn Hubs ihren Betrieb aufnehmen. Im Januar 2023 wurde mit Probebohrungen begonnen, um das Gelände zu prüfen und den detaillierten Streckenverlauf zu klären.
Die Kantone Thurgau und St. Gallen haben bereits grosses Interesse an einem Anschluss an Cargo sous terrain angemeldet. Eine Studie zu Durchführbarkeit und Potenzial kam 2022 zum Schluss, dass der unterirdische Güterverkehr in die Ostschweiz sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbar ist. Dasselbe gilt ebenso für die Romandie. Auch für die Komponente der City-Logistik werden erste Erfahrungen gesammelt. Die Stadt Zürich ist mit dem Pilotprojekt Salübox gestartet: An vorerst drei Standorten können alle Lieferdienste Pakete zur Abholung deponieren. Ab diesem Frühjahr wird auch der Päckchenversand für Privatpersonen möglich sein. Das Pilotprojekt soll zeigen, ob Konzepte dieser Art den Bedürfnissen von Bevölkerung und Gewerbe entsprechen und Lieferketten entlasten.
Bachelor of Science in Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung
Planen Sie Lebensräume – Werden Sie Raumplanerin oder Raumplaner
Raumplanerinnen und Raumplaner entwickeln unseren Lebensraum – Sie gestalten die Städte und Gemeinden der Zukunft. Während dem projektorientierten Studium mit realen Projektpartnern ist eine Spezialisierung in den Schwerpunkten Raumentwicklung, Verkehrsplanung oder Städtebau möglich. Das Studium können Sie in Voll- oder Teilzeit absolvieren.
ost.ch/raumplanung

EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 20 CARGO SOUS TERRAIN
ANZEIGE
Text SMA
iStockphoto/Marcus Millo
NEUER ALFA ROMEO TONALE PLUG-IN HYBRID MIT ALLRADANTRIEB Q4 UND 280 PS
MEHR ERFAHREN AUF ALFAROMEO.CH

200.–. *5 Jahre
200’000 Km Garantie – 5 Jahre / 100’000 Km Service A B C D E F G C Tonale_PHEV_296x440_RZ.indd 1 28.02.23 14:36
Alfa Romeo Tonale Veloce 1.3 Plug-in hybrid Q4 280 PS AT6, Energieverbrauch (Fahrbetrieb): 1.5 l/100 km, Benzinäquivalent: 3.6 l/100 km, CO₂-Emissionen (Fahrbetrieb): 34 g/km, CO₂-Emissionen aus der Treibstoff und/oder Strombereitstellung: 25 g/km, CO₂-Zielwert 118 g/km, Durchschnitt der CO₂-Emissionen 129 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: C. Abgebildetes Modell: Alfa Romeo Tonale Veloce 1.3 Plug-in hybrid Q4 280 PS, mit Sonderausstattung, CHF 72
/
KI macht mobil
Wie werden KI-Anwendungen unsere Mobilität verändern? Kommt jetzt das autonome Fahren oder nicht?
Und wie sorgen Daten dafür, dass Verkehrs- und Fahrzeugkonzepte sich selbst verbessern und sicherer werden?
Kennen Sie den: Ein Paar steht an der Strasse und hält ein Taxi an. Das Taxi fährt vor. Beide schauen auf den Fahrer – und lassen das Taxi dann sausen. Wieder rufen sie nach einem Taxi. Ein neues Taxi hält. Beide schauen wieder zum Fahrer – und lassen das Taxi dann sausen. Nach einiger Zeit fragt eine Passantin: «Sagen Sie mal, warum rufen Sie denn immer wieder ein Taxi und nehmen es dann nicht?» Da antwortet das Paar: «Na, wir warten doch auf das Robotaxi von Amazon. Die liefern eigentlich immer sofort.»
Das Robotaxi lässt in der Tat auf sich warten. Was allerdings weniger an der Lieferfreude des grössten Internetversenders liegt als an rechtlichen Schwierigkeiten und auch Sicherheitsbedenken. Erste Robotaxis wurden bereits 2016 in Singapur eingeführt. 2021 zog San Francisco nach und liess schneeweisse GM-Poppys über die Strassen und Highways kurven. Es dauerte zwar nicht lange, bis erste Mobile plötzlich quer standen und Staus verursachten, aber das Geschäftsmodell und die Möglichkeiten für günstige «short distance»-Fahrten wurden immer verlockender.
«Fahrzeuge für die Passagiere»
Amazon kaufte für 1,2 Milliarden Dollar 2020 das Start-up Zoox, das bereits 2013 erste führerlose Taxis
erfand – speziell für die Grossstadt. «Sie müssen sich das so vorstellen», sagte damals ein Ingenieur, «dass wir im Grunde jedes Auto so ausstatten, wie man das von der automatischen Einparkhilfe kennt. Nur scannen unsere Autos eben nicht nur die nächstgelegene Stossstange, sondern auch plötzlich in den Verkehr einfahrende oder die Spur wechselnde Autos, Ampeln, Hindernisse, Fussgänger und vieles mehr.»
Die 3,63 Meter langen und knapp 2 Meter hohen Autos haben verkleinerte Bustüren, die das Einsteigen erleichtern. Darüber hinaus müssen allerdings auch die Zoox-Taxis kommunizieren. Das heisst, sie müssen der Umgebung und den anderen Verkehrsteilnehmern klar machen, wohin sie fahren oder wann sie halten. 120 Kilometer pro Stunde können erreicht werden, wobei Entwickler Jesse Levinson den grossen Vorteil gerade darin sieht, dass die E-Robotaxis auch problemlos in engen Strassen wenden oder tatsächlich bis vor die Haustür fahren können.
«Unsere Fahrzeuge sind für die Passagiere gemacht. Es geht nicht mehr um den Fahrer», so Levinson gegenüber der Digital Initiative der Harvard Business School. «Wenn man sich überlegt, dass allein in den USA jede Familie durchschnittlich zwei Autos
BRANDREPORT • QUALITY ALLIANCE ECO-DRIVE
hat, dann wird klar, warum unsere E-Autos die perfekte Lösung sind, um wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu werden. Es sind auch in dem Sinne keine Autos mehr, sondern Kunden-Beweger.»
Datensammeln für die Sicherheit
Und Levinson ist sich sicher, dass seine Taxis viel präziser fahren können als alle anderen Autos. «Da alle vier Räder sich unterschiedlich drehen können und die Taxis mit über 100 Komponenten ausgestattet sind, die sonst kein anderes konventionelles Auto hat, können wir viel genauer fahren.» Die vielleicht wichtigste Komponente für einen Massenmarkt der Robotaxis ist das automatische Lernen mittels KI. «Die vielen Daten, die wir sammeln, erlauben es unseren Autos, dass sie immer besser und besser werden. Wir testen unsere Autos in San Francisco, Las Vegas und Seattle. Das sind sehr unterschiedliche Gegenden mit teilweise schwierigen Bedingungen.»

Auf dem Future Mobility Summit in Berlin wurden im September gerade die Sicherheitsfragen des autonomen Fahrens heiss diskutiert. Denn «trotz einer positiven Grundhaltung gegenüber der KI-Technologie bereiten mögliche Fehler der autonomen Fahrzeuge vielen Menschen Sorgen». Was sieht der Computer? Wie reagiert
er? Was passiert in Konfliktsituationen? Kurz vor dem Summit verkündete die EU neue Regeln für Fahrassistenzsysteme, die besonders auch das fahrerlose Fahren begünstigen und sogar als entscheidende Initialzündung fungieren sollen.
Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager machte klar, dass im Rahmen der Sicherheitsvorschriften nun «das Thema der fahrzeuggenerierten Daten aufzugreifen» sei, «die einen wesentlichen Input für Reparatur- und Wartungsdienstleistungen liefern». Die EU-Kommission gibt sich, was das halbwegs oder gänzlich autonome Fahren auf Autobahnen und in Städten angeht, fast schon euphorisch. Im Hinblick auf Fahrassistenten, Ereignisdatenspeicher, Spurhaltesysteme und Technologien zur Abschaffung des toten Winkels verkündet die Pressemitteilung stolz: «Ziel der heute in Kraft getretenen Verordnung ist es, Fahrzeuginsassen, Fussgänger und Radfahrer besser zu schützen. Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2038 mehr als 25 000 Menschenleben gerettet und mindestens 140 000 schwere Verletzungen vermieden werden können.» Allzu lange dürfte das Warten auf die neuen Taxis in Europa also nicht mehr dauern.
Text Rüdiger Schmidt-Sodingen
Günstiger, sicherer und nachhaltiger auf der Strasse unterwegs
an E-Autos gesenkt. Reicht dies, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Um mit sofortigem Effekt einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität zu leisten, muss man nicht das ganze Leben auf den Kopf stellen. Ganz im Gegenteil, alle können mit wenig Aufwand und ohne Einschränkungen ökologischer unterwegs sein. Reiner Langendorf, Geschäftsführer der Quality Alliance Eco-Drive, erklärt, wie es gelingt.
Herr Reiner Langendorf, wie hoch ist das Einsparungspotenzial nur durch Fahrstilanpassung?

Natürlich ist es gut, wenn man das Auto weniger benutzt. Doch bereits durch wenige Fahrstilanpassungen lassen sich 10 bis 15 Prozent des Verbrauchs einsparen. In der Schweiz wurden 2021 etwa 6,1 Milliarden Liter Treibstoff verbraucht. Wenn man von den zehn Prozent ausgeht, ergibt das 600 Millionen Liter. Bei einem Preis von zwei Franken pro Liter Kraftstoff entspricht dies 1,2 Milliarden Franken, die pro Jahr eingespart werden könnten. Und dies nur durch kleine Anpassungen der Fahrweise, ohne weniger oder langsamer unterwegs zu sein.
Die CO2-Emissionen werden bereits durch den kontinuierlichen Anstieg der Anzahl
Leider nicht. Ein durchschnittliches Schweizer Auto ist etwa zehn Jahre alt. Bis diese Flotte ersetzt ist, dauert es zu lange. Der Wandel geht zu langsam vonstatten, da wir die Zeit eigentlich nicht haben, die Emissionen herunterzufahren. Insofern sollte man sofort handeln und mit energieeffizienter Fahrweise beginnen. Dafür braucht es keine Investitionen, man muss nicht auf neue Technologien oder Gesetzgebungen warten: Die Eco-Drive-Tipps sind einfach umzusetzen und entfalten eine grosse Wirkung, unabhängig von Fahrzeugmodellen und -antrieben.
Welchen Einfluss können Assistenzsysteme auf die Effizienz haben?
Dass die Technologie fast alles selbst macht, ist ein Trugschluss. Und nicht in allen Fahrzeugen sind alle Assistenzsysteme vorhanden. Stehen sie zur Verfügung, muss man diese einschalten, verstehen und richtig anwenden. Das gilt insbesondere für neue Technologien wie beispielsweise das «Segeln». Klar ist: Die Assistenzsysteme unterstützen die Fahrer:innen. Schlussendlich entscheidet jedoch immer noch der Mensch massgeblich über Energieeffizienz und Sicherheit.
Welche einfachen Tipps zeigen das grösste Einsparungspotenzial?
Das Gewinnbringendste ist, vorausschauend zu fahren und zu antizipieren. Beispielsweise erkennt man rote Ampeln auf diese Weise frühzeitig, kann man das Auto ganz ohne Gas rollen oder eben, mit neueren
Fahrzeugen, segeln lassen. Es lohnt sich auch gleichmässig und mit genügend Abstand unterwegs zu sein und sich so Handlungsspielraum zu schaffen und den Schwung zu nutzen. Bei geschalteten Autos ist es darüber hinaus wichtig, niedertourig zu fahren. Bei Automaten hilft die Eco-Einstellung zu sparen.
Gibt es Dinge, die beinahe unbemerkt Energie verschwenden?
Ja, mehrere. Der Reifendruck spielt eine grosse Rolle. Zu wenig Luft in den Reifen sorgt für mehr Widerstand, wodurch mehr Energie benötigt wird. Pro 0,2 Bar Druck spart man etwa ein Prozent des Verbrauchs ein. Bei der Klimaanlage und dem allgemeinen Gewicht sind noch höhere Einsparungen möglich. Wenn Erstere nur ab einer Aussentemperatur von über 18 °C genutzt wird, verbraucht man bis zu fünf Prozent weniger Treibstoff. In Bezug auf den Ballast korrespondieren 20 kg weniger in etwa einem einprozentig tieferen Ressourcenverbrauch. Wenn Dachträger nach Gebrauch direkt abmontiert werden, lässt sich, auch bei einer leeren Dachbox, auf der Autobahn über 15 Prozent Treibstoff einsparen. Grundsätzlich lautet die Devise: Nur das nutzen, was notwendig ist – von der Zusatzheizung für Sitze, Spiegel und Scheiben, bis hin zu montierbaren Vorrichtungen.
Eco-Drive gibt zwölf praktikable Tipps.
Woher stammen diese?
Diese basieren auf reiner Physik und Motorentechnik. Es geht um die Frage, wie man die Technologie optimal einsetzt und wie der Motor am effizientesten
arbeitet. Dieselben Hinweise liest man bei Automobilverbänden und Reifenherstellern sowie in Handbüchern der Autohersteller. Eigentlich verhält es sich nicht anders als bei einem Velo. Sobald Widerstände, Ballast oder zum Beispiel ein Dynamo dazu kommen, muss man mehr in die Pedale treten. Auch wenn es beim Auto nicht um die eigene Körperenergie geht, wird für all diese Dinge mehr Energie benötigt.
Gelten diese Tipps genauso für E-Fahrzeuge?
Bei E-Autos gelten die meisten Ratschläge genau gleich, Vorausschauen, Schwung nutzen, Gewicht reduzieren, Reifendruck beachten, Hilfssysteme wie Assistenzen und Klimaanlage richtig verwenden. Hinzu kommt, dass man beim Bremsen dank Rekuperation Energie zurückgewinnen kann. Befolgt man diese Tipps, fährt man mit einem Elektroauto nicht nur sicherer und effizienter, sondern erhöht auch die Reichweite. Ein Unterschied betrifft die Luftheizung. Bei einem klassischen Auto wird die Luft durch die produzierte Abwärme, ohne Zusatzenergie, beheizt. In einem E-Auto gibt es keine Abwärme und die Luftheizung geht auf Kosten des Stroms. Deshalb macht es in einem E-Auto Sinn, auf kurzen Strecken die Sitzund Lenkradheizung einzuschalten. Dies ergibt eher ein Wärmegefühl und verbraucht weniger Energie. Wenn man in Besitz eines Hybrid-Autos ist, sollte man ausserdem wirklich elektrisch fahren. Nur so sind diese effizient.
Alle Tipps zur nachhaltigen Fahrweise mit wenig Aufwand unter ecodrive.ch
EINE PUBLIKATION VON SMART MEDIA FOKUS.SWISS 22 INNOVATION
iStockphoto/gorodenkoff
Reiner Langendorf Geschäftsführer Quality Alliance Eco-Drive
UNDER PRESSURETPSM VON AUTEL.
M a x i TPMS ITS600
d a s neue TPMS - un d Se r v i ce - To ol i m H a ndy-Sty l e



D a sMaxiTP M S I T S60i0st e in d ra h t l os e s A ndroid-basi e r te s Tou chsc ree n- Ta bl et , da s v oll stä ndig e T P MS- D iagno se - und S e r vic e funktionen bi etet Das Ta bl et v e r f üg t üb e r e in 5 , 5 - Z oll- Fa rbdi s pl ay und e in e Bluet oo th-Fahrz e ug kommunika t ion s s chni ttste ll e (V C I). D e r I TS600 ka nn a ll e b ek ann te n Se n so re n a k t ivi e re n l e sen und neu le r n e n , T P M S -Sy s temdiagn ose n du rch f üh ren und v i e r allg e m e in e Wa r t ung du rch f üh ren

TPMS-F u n k t i onen :

• A k ti v iert , lie st und le r nt a ll e b ek ann t en S e n so re n n e u
• Verbes se rt e r D iagn o s e sta t usbilds chi r m a u f e in e n Bli ck
• S chn e lles O BDII-N e ule r nen für die meis te n Fa hr ze ug e
• K o pi e ren p e r O B D -Sens o rpr o g rammi e rung f ür s chn e ll e re n Se r v ic e
• Vier MX-Sen s o r- P r o g ra mmm o di; B at ch- P r o g ra mm bi s z u 20 MX- Se
• B e inhal t et ein e d ra htl o se Blue t oo t h- Fa hr ze ug ko mmuni kat i o ns s chni
• L e sen / Lös chen v on T PM S -S ys t e mc o d e s und A n ze ig e n vo n Li ve -D
• K o st e nl o se Wi-Fi-S of t wa re -Updat e s f ür di e g esa m te L e b e n s d a u e r d
E xc lu s i v e S w iss Pa rtne r
Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden| peter.krieg@baumgartner-diagfocus.ch | www baumgar tnerag-diagfocus ch
FREIHEIT HEISST, SICH NICHT FESTLEGEN ZU MÜSSEN.

emilfrey.ch/move