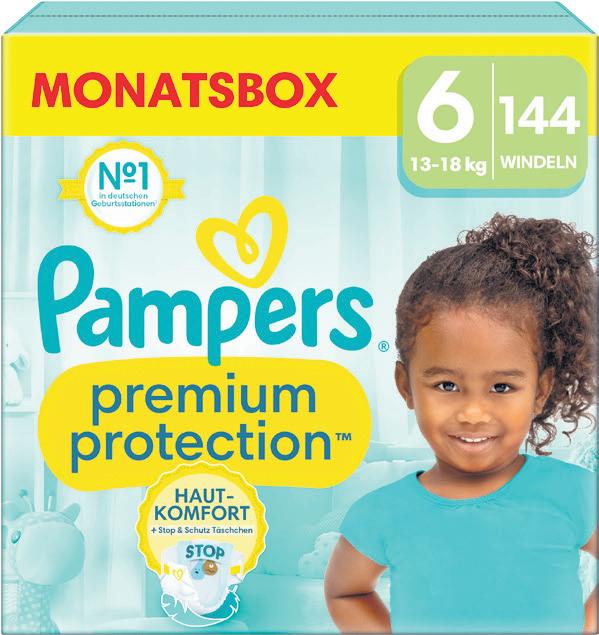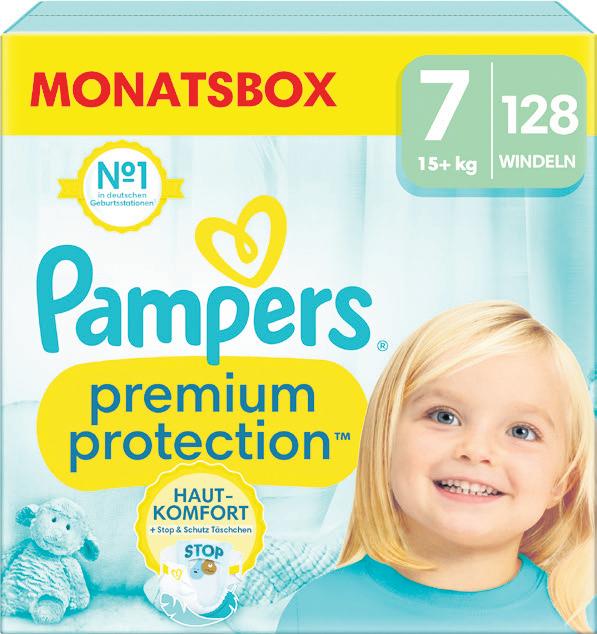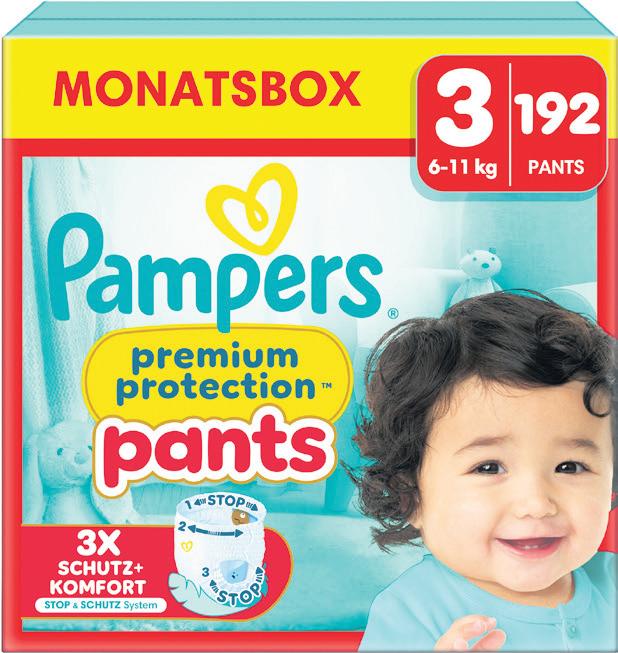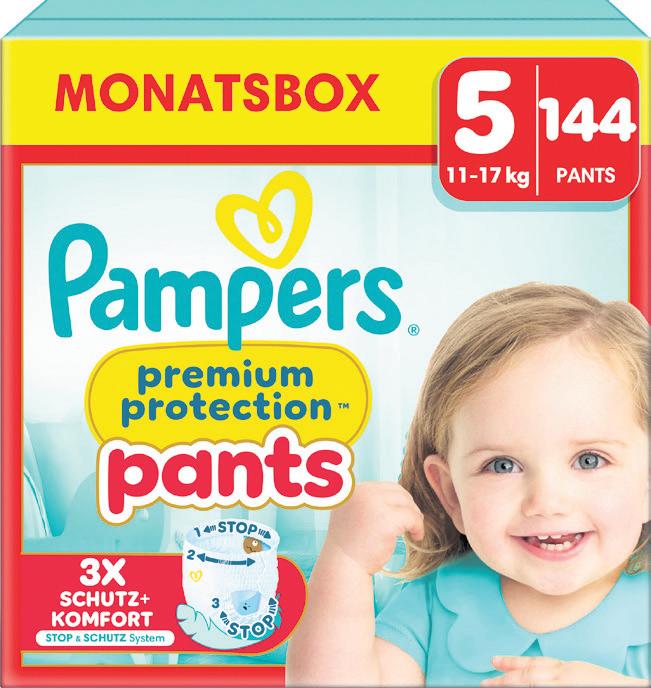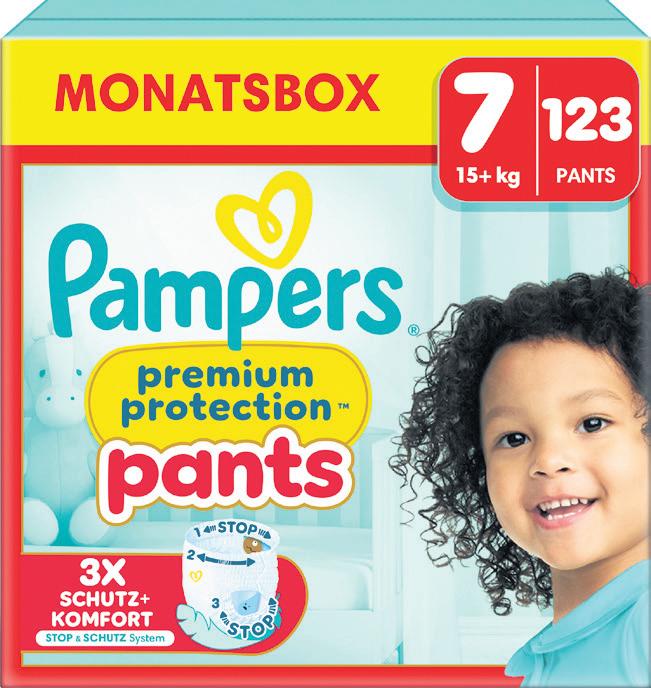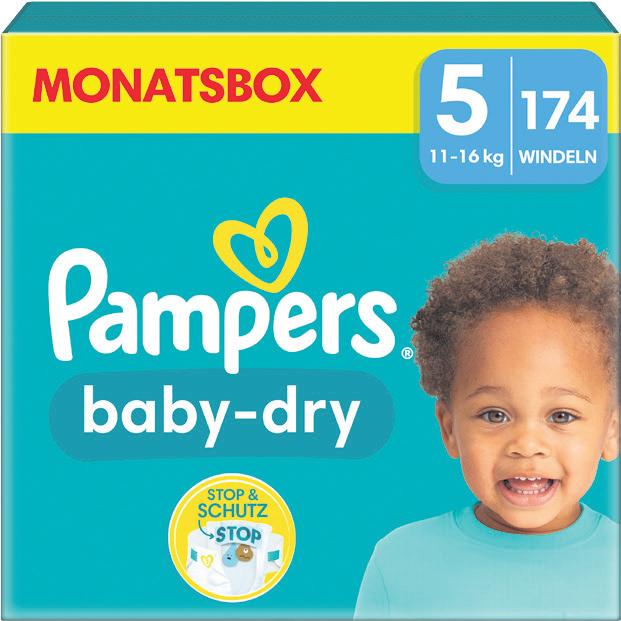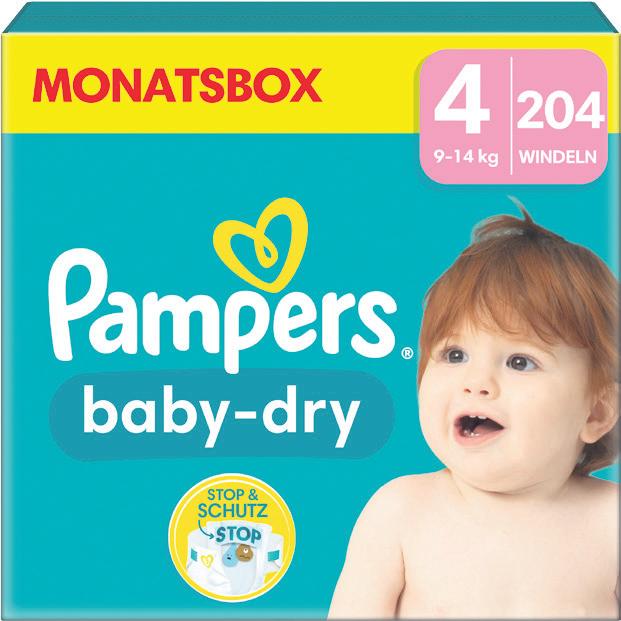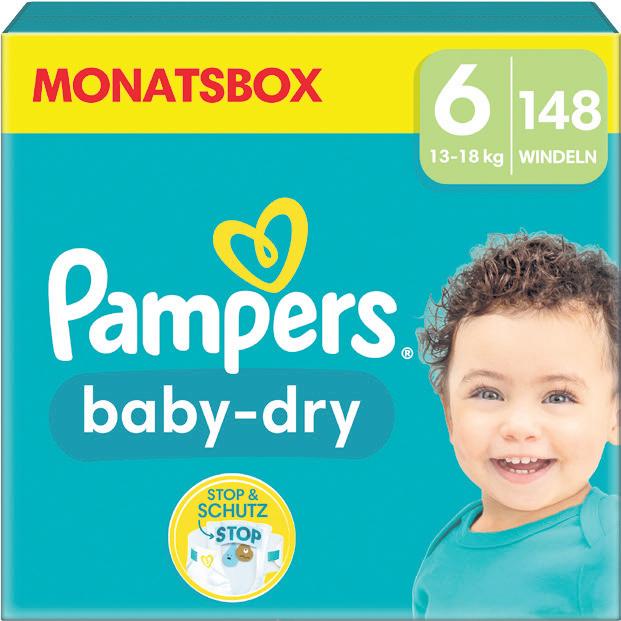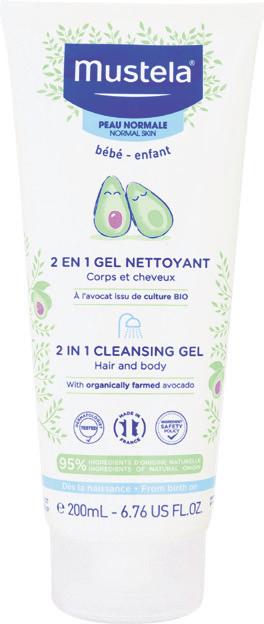Zirkuskunst zwischen Tradition und Moderne: Wie lebt es sich in der achten Generation der Familie Knie?

Tierische Erlebnisse für die ganze Familie im Walter Zoo Gossau SG April ’25


Viele sehen die Familie in einer Krise oder im Zerfall, besonders angesichts rasanter gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen. Doch es gibt eine optimistischere Perspektive: Familie löst sich nicht auf, sondern entwickelt sich weiter. Sie bleibt eine zentrale Säule des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Familie ist mehr als ein Begriff oder eine Institution –sie ist ein flexibles, sich stetig wandelndes Konzept. Was einst als klassische Kernfamilie begann, umfasst heute vielfältige Wahlfamilien mit unterschiedlichen Werten und Lebensrealitäten. Doch das Grundprinzip bleibt: Familie ist der Ort, an dem Menschen Geborgenheit, Unterstützung und Zusammenhalt finden.
Der Wandel der Familie bedeutet nicht ihr Ende, sondern zeugt von ihrer Widerstandskraft. Moderne Technologien und neue Lebensmodelle ermöglichen es, das Konzept Familie neu zu definieren – als einen Raum, der Geborgenheit und Zusammenhalt bietet, aber flexibel genug ist, sich den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Familie bleibt ein zentraler Bestandteil des sozialen Lebens, der sich stetig weiterentwickelt.
Die traditionelle Kernfamilie –ein Modell im Wandel Lange galt die Kernfamilie – Vater, Mutter, Kinder –als Idealbild. Sie bot Sicherheit, aber auch feste Rollen: Der Vater verdiente das Geld, die Mutter kümmerte sich um Haushalt und Kinder. Doch gesellschaftlicher Wandel, Emanzipation und wirtschaftliche Veränderungen haben dieses Modell aufgelockert. Heute sind Doppelverdienerhaushalte, gleichberechtigte Elternschaften und flexible Rollenverteilungen weit verbreitet.
Patchworkfamilien – neue Chancen, neue Herausforderungen
Patchworkfamilien entstehen, wenn Partner mit Kindern aus früheren Beziehungen zusammenfinden. Sie bieten neue Bezugspersonen und ein erweitertes soziales Netzwerk, erfordern aber auch viel Kommunikation und Anpassungsfähigkeit. Unterschiedliche Erziehungsstile, Loyalitätskonflikte und die Integration neuer Familienmitglieder sind Herausforderungen, die Einfühlungsvermögen verlangen. Doch viele Patchworkfamilien zeigen: Nicht die biologische Verbindung, sondern Verständnis und Fürsorge machen eine Familie aus.
Regenbogenfamilien – gelebte Vielfalt Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern sind ein fester Bestandteil der heutigen Gesellschaft. Studien belegen, dass Kinder in Regenbogenfamilien genauso glücklich und gesund aufwachsen wie in traditionellen Familienformen. Dennoch stehen sie
oft vor gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa wenn es um Akzeptanz oder rechtliche Gleichstellung geht. In der Schweiz wurde mit der Ehe für alle ein wichtiger Schritt getan, doch weiterhin bestehen bürokratische Hürden, beispielsweise bei Adoptionen oder der Elternschaftsanerkennung.
Wahlfamilien – Familie als bewusste Entscheidung Immer häufiger bilden sich Familienstrukturen unabhängig von biologischen oder rechtlichen Bindungen.
Wahlfamilien bestehen aus engen Freund:innen, Mitbewohner:innen oder Menschen, die sich gegenseitig Halt und Unterstützung bieten. Gerade in urbanen Regionen oder für Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen Kontakt zur Herkunftsfamilie haben, sind solche Beziehungen essenziell. Sie zeigen, dass Familie nicht nur auf Verwandtschaft beruht, sondern auf Fürsorge, Vertrauen und gemeinsamen Werten.
Ein-Eltern-Familien – Stärke und Herausforderungen
Einzel-Eltern, ob Mütter oder Väter, leisten täglich Grosses. Sie sind nicht nur für die Erziehung und Versorgung der Kinder verantwortlich, sondern müssen oft auch finanzielle Herausforderungen allein bewältigen. Trotz gesellschaftlicher Anerkennung bleiben Einzel-Eltern häufig wirtschaftlich benachteiligt. Flexible Arbeitsmodelle, bessere Betreuungsangebote und gesellschaftliche Unterstützung sind entscheidend, um diesen Familien die gleichen Chancen zu ermöglichen wie anderen.
Polyamore Familien und Co-Parenting –neue Wege des Zusammenlebens Neben traditionellen Familienformen entstehen neue Konzepte. Polyamore Beziehungen, in denen mehrere Menschen familiär oder romantisch verbunden sind, hinterfragen klassische Partnerschaftsideale. CoParenting-Modelle ermöglichen es, Kinder gemeinsam grosszuziehen, ohne eine romantische Beziehung zu führen. Beide Modelle erfordern klare Absprachen und Verantwortung, bieten aber die Chance, Erziehungsaufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und neue Formen familiären Zusammenhalts zu schaffen.
Interkulturelle Familien – Vielfalt leben, Identität gestalten Interkulturelle Familien vereinen verschiedene kulturelle Hintergründe, Sprachen und Traditionen in der Erziehung. Dies bereichert Kinder, die früh eine offene und diverse Sicht auf die Welt entwickeln. Gleichzeitig erfordert es eine bewusste Auseinandersetzung mit Identität, Integration und Erziehungsstilen. Unterschiedliche Werte und soziale Erwartungen können Herausforderungen
darstellen, doch interkulturelle Kommunikation hilft, ein harmonisches Familienleben zu gestalten. Besonders für alleinerziehende Eltern kann die Verbindung verschiedener kultureller Einflüsse eine zusätzliche Dimension in der Erziehung sein.
Die Familie der Zukunft – flexibel, vielfältig, wertbasiert Unsere Gesellschaft wandelt sich – und mit ihr das Familienbild. Digitalisierung, Mobilität und neue Arbeitsformen prägen, wie wir Beziehungen gestalten. Doch der Kern bleibt: Familie ist dort, wo Menschen füreinander da sind. Ob traditionell oder unkonventionell – entscheidend ist die Qualität der Beziehungen. Eine offene Gesellschaft, die diese Vielfalt anerkennt und unterstützt, schafft die Basis für eine starke, zukunftsfähige Gemeinschaft. familleSuisse.ch – da, wo sich Familie trifft Inmitten der Veränderungen, die das Familienkonzept prägen, spielt www.familleSuisse.ch eine zentrale Rolle. Die Plattform bietet vielfältige Angebote für alle Familienformen – von klassischen Kernfamilien bis zu Patchwork- und Ein-Eltern-Familien. Sie stellt praktische Tipps, rechtliche Beratung und Unterstützung für spezifische Lebenssituationen bereit.
Mit dem Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet die Website nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch Beratungsangebote, die Familien helfen, ihre Lebensentwürfe zu gestalten. Zudem fördert sie den Austausch zwischen Familien und unterstützt die Vernetzung, was zu einer gemeinsamen Lösungsfindung beiträgt. www.familleSuisse.ch stärkt so die Familie als Ort der Geborgenheit und Anpassungsfähigkeit und trägt dazu bei, dass das Familienkonzept in seiner Vielfalt lebendig bleibt.
Die Erkenntnis – was wirklich zählt Familie ist keine starre Struktur, sondern wandelbar. Ob Patchwork-, Regenbogen-, Wahl- oder Kernfamilie – jede Form hat ihren Wert. Entscheidend sind Liebe, Verständnis und Unterstützung, nicht die äussere Form. Doch Familie ist mehr als Privatsache – sie bildet das Fundament der Gesellschaft. Starke familiäre Strukturen fördern soziale Stabilität und Verantwortung. Eine Gesellschaft, die Familie in all ihren Formen wertschätzt, schafft eine stabile, resiliente Gemeinschaft. Indem wir diese Vielfalt anerkennen, stärken wir nicht nur Familien, sondern auch die Gesellschaft selbst.
Text Daniel Hersche, familleSuisse.ch
Lesen Sie mehr. 04 Interventionsarme Geburt 08 Einfaches Kochen 10 Interview: Ivan Frédéric Knie 12 Gemeinsam unterwegs 16 Kulturerlebnisse 18 Work-Life-Balance 20 Kindsverlust
Fokus Familie
Projektleitung Nilujan Rajenthiran
Country Manager Pascal Buck
Produktionsleitung
Adriana Clemente
Layout Mathias Manner
Text
Aaliyah Daidi, Cornelia Peltenburg, David Mutz, Sarah Steiner, SMA Titelbild zVg
Distributionskanal Tages-Anzeiger
Druckerei DZZ Druckzentrum AG
Smart Media Agency Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00 info@smartmediaagency.ch redaktion@smartmediaagency.ch fokus.swiss




An dieser Haltestelle musst du leise sein!
Findet die Antworten auf der Karte!
250 weitere Rätsel auf Karten gibts im Buch Karten-Knacknüsse Schweiz. Erhältlich in jeder Buchhandlung. Mehr Rätsel und Infos zum Buch gibt's hier:


Ein Schicksalsschlag kann das eigene Leben und das der Kinder langfristig verändern. Mit einer ganzheitlichen Vorsorge sichern Eltern ihren Nachwuchs gegen die finanziellen Folgen eines möglichen Unfalls oder einer Krankheit ab.

Viele Eltern legen nach der Geburt ihrer Kinder ein Sparkonto an und überweisen regelmässig Geld auf dieses Konto. Damit sollen die Kinder später einmal über ein persönliches Guthaben verfügen, das sie zum Beispiel für die Finanzierung einer Ausbildung oder der Fahrprüfung einsetzen können. Was die meisten Eltern allerdings zu wenig berücksichtigen, ist eine geeignete Absicherung für ihre Kinder gegen die langfristigen Folgen eines möglichen Unfalls oder einer Krankheit. Dies zeigt zum Beispiel das Familienbarometer 2024 von Pax und Pro Familia Schweiz, das jedes Jahr die aktuelle Lebensrealität von Familien in der Schweiz untersucht.
In der Studie gibt rund die Hälfte der befragten Familien an, dass die Vorsorge ihrer Kinder im Risikofall – also bei einer Krankheit oder einem Unfall – unzureichend sei. Ausserdem wissen, je nach Risikoart, zwischen 20 und 25 Prozent der Eltern nicht, wie es um ihre eigene finanzielle Absicherung und die ihrer Kinder steht. Sie gehen davon aus, dass ihre Kinder besser gegen eine langjährige Krankheit oder Invalidität abgesichert sind als sie selbst. In der Realität ist es jedoch meist umgekehrt.
Vorsorgen für den Ernstfall Es ist nachvollziehbar, dass viele Familien sich nicht gerne mit dem Thema Absicherung auseinandersetzen. Der Gedanke daran, dass den eigenen Kindern etwas zustossen könnte oder sie nach dem Tod der Eltern allein dastehen, ist für viele Eltern unerträglich. Und solange alle Familienmitglieder gesund sind, gibt es wenig Anlass, über geeignete Vorsorgemassnahmen nachzudenken. Trotzdem ist es wichtig, sich über mögliche finanzielle Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit zu informieren, denn Schicksalsschläge geschehen ohne Vorankündigung und können weitreichende Konsequenzen haben.
Mit der Kinderversicherung von Pax sind die Kinder jederzeit umfassend abgesichert.
Dazu gehören auch Ereignisse, die später zu einer temporären oder sogar dauerhaften Erwerbsunfähigkeit der Kinder führen können. Für viele Familien bedeutet eine solche neben der grossen emotionalen Belastung auch finanzielle Einbussen. Die aus der Erwerbsunfähigkeit resultierenden Kosten sowie die Folgekosten für beispielsweise Spitalaufenthalte und Therapien belasten das Haushaltsbudget und hinterlassen eine grosse Lücke
in der persönlichen Vorsorge der Kinder. Zwar gibt es in der Schweiz staatliche IV-Leistungen, die einem Kind, das durch eine Krankheit oder einen Unfall invalide wird, als erwachsene Person zustehen. Doch diese sind unzureichend und decken zusammen mit allfälligen Ergänzungsleistungen nur gerade das Existenzminimum. Absichern und gleichzeitig sparen Was also können Eltern unternehmen, um ihre Kinder ganzheitlich abzusichern? Eine gute und überraschend günstige Vorsorgemassnahme bietet die sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung für Kinder und Jugendliche. Sie geht im Ernstfall über die minimalen Sozialversicherungsleistungen hinaus und sorgt für die nötige finanzielle Unterstützung. Die Versicherung kann direkt nach der Geburt der Kinder abgeschlossen werden und eignet sich neben Eltern auch für Grosseltern, Patinnen und Paten oder andere Verwandte, die einen Beitrag an die sichere Zukunft der jüngeren Generation leisten möchten. Bereits mit kleinen monatlichen Beiträgen können sie die Kinder so umfassend absichern. Pax bietet eine Kinderversicherung, bei der sich die Erwerbsunfähigkeitsversicherung mit einem Anlageteil kombinieren lässt. Das heisst, dass zusätzlich zum Risikoschutz mit einem Sparteil gezielt Vermögen für das versicherte Kind aufgebaut werden kann. Für den Sparplan stehen verschiedene Fondsportfolios zur Auswahl, die auch mit klassischen Anlagen zu einem garantierten Zins ergänzt werden können. Nach Ablauf der Versicherung können Eltern sich den Sparteil auszahlen lassen und ihn den Kindern übergeben, damit diese zum Beispiel ein Startkapital ins Berufsleben haben.
Individuelle Lösungen für jede Familie Mit der Kinderversicherung von Pax sind die Kinder jederzeit umfassend abgesichert. Wenn
die erwachsene Person, welche die Beiträge für die Kinderversicherung bezahlt, erwerbsunfähig wird oder stirbt, wird die Versicherungsprämie erlassen. Ausserdem lässt sich der Schutz des Kindes bei Bedarf zusätzlich mit der Absicherung des Erwachsenen kombinieren: Die Erwachsenen können sich über ein Todesfallkapital oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente direkt mitversichern.
Nicht jedes Versicherungsmodell eignet sich für jede Familie oder Lebenssituation. Dank individueller Lösungen und kompetenter Beratung findet bei Pax aber jede Familie den optimalen Versicherungsschutz.
Weitere Informationen unter: pax.ch/kinderversicherung
Der Autor Daniel Mutz ist Vater von zwei Kindern und Leiter Vertrieb & Marketing sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Pax. Pax ist eine genossenschaftlich verankerte Schweizer Vorsorgeversicherung, die mit einfachen und individuellen Vorsorgelösungen überzeugt.
TFO The Family Office AG • Brandreport
Immer mehr Leute bevorzugen die Unabhängigkeit eines erfolgreichen Vermögensverwalters wie der «TFO The Family Office AG».

Von einem unabhängigen Vermögensverwalter betreut zu werden, bietet so manchen Vorteil. Sven Spiess, Geschäftsleiter bei TFO The Family Office, erwähnt etwa die persönliche Beziehung mit der Kundschaft, welche massgeschneiderte Lösungen für den Kunden erst ermöglichen.
Sven Spiess, was heisst denn «massgeschneidert»?
Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse und wird genauso bei uns betreut. Es ist doch enorm wichtig zu verstehen, wie ein Mensch funktioniert, was ihm wichtig ist, um ihm eine beidseitig befriedigende Dienstleistung erbringen zu können.
Dabei sind wir ausschliesslich dem Kunden gegenüber verpflichtet. Da gibt es keinen Verkaufsdruck bei Produkten oder anderweitige Interessenkonflikte.
Unsere Loyalität als aktiver Vermögensverwalter liegt somit ausschliesslich beim Kunden. Denn er ist derjenige, der uns bezahlt. Seine Bedürfnisse zu befriedigen, ist unsere Freude! Hier möchte ich erwähnen, dass wir gerne auch kleinere Kunden bei uns aufnehmen.
Denn gerade diese sind auf eine solide Verwaltung ihrer Gelder angewiesen.
Welche anderen Vorteile ergeben sich?
In der Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Family-Office ergibt sich zudem automatisch ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Kunden,

Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse und wird genauso bei uns betreut.
– Sven Spiess, Geschäftsleiter TFO The Family Office
Wie gehen sie mit der Nachhaltigkeit bei den Anlagen um?
Wichtig sind für uns auch attraktive Anlagen gemäss nachhaltigen Kriterien (ESG). Geld regiert bekanntlich die Welt! Und damit haben wir als Anleger ebenfalls eine Mitverantwortung!
Einem CEO auf die Finger zu klopfen und ihn zu ermahnen, doch bitte nachhaltiger zu arbeiten, nützt nur beschränkt. Geht es aber um den Aktienkurs, so ist seine Motivation ganz anders. Wir wollen dem CEO gar nicht unterstellen, dass ihm die Nachhaltigkeit egal sei. Aber wir legitimieren ihn damit, selbst aktiv zu werden. Den Wert seiner Firma zu optimieren, ist schliesslich seine Kernaufgabe!
Wie fallen die Kunden-Feedbacks aus? Letztlich muss der Leistungsausweis punkto Geldvermehrung stimmen. Es freut uns aber sehr, wenn sich der Kunde auch persönlich beraten und begleitet fühlt. Mein bislang schönstes Kunden-Feedback: «Bei meiner Hausbank dachte ich ständig an Scheinheiligkeit und die hohen Bankerboni. Bei Ihnen fühle ich mich hingegen wie in einer Familie und schätze ihre Ehrlichkeit und Weitsicht.»
Weitere Informationen unter tfo.ch
der Bank (Depotstelle) und dem unabhängigen Vermögensverwalter (Asset-Manager).
Dabei schaut der Vermögensverwalter der Bank auf die Finger und die Bank dem Vermögensverwalter.» Dies erhöht die Sicherheit für den Kunden zusätzlich!
Zum Thema Sicherheit: Wir waren einer der ersten, die eine Lizenz von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht erhielten. Ganz wichtig: Achten Sie darauf, ausschliesslich mit von der Finanzmarktaufsicht bewilligten und überwachten Vermögensverwaltern zu arbeiten!
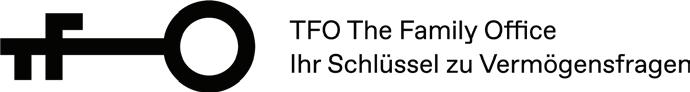
Die Umgebung, in der eine Geburt stattfindet, beeinflusst massgeblich den Verlauf und das gesamte Geburtserlebnis. Eine interventionsarme Geburt ist oft mit weniger Komplikationen verbunden, setzt aber eine gezielte Gestaltung der Geburtsbedingungen voraus. Warum gibt es dennoch so viele medizinische Eingriffe und wie kann ein optimaler Rahmen geschaffen werden, der den natürlichen Geburtsprozess unterstützt?

Die Geburt ist ein zutiefst natürlicher Prozess, der in einer Umgebung stattfinden sollte, in der Sicherheit, Ruhe und Vertrauen an erster Stelle stehen. Eine interventionsarme Geburt bedeutet, möglichst wenige medizinische Eingriffe vorzunehmen –nicht, dass die Sicherheit dadurch gefährdet wird, sondern dass der natürliche Geburtsprozess respektiert und der Körper der Frau in den Mittelpunkt gerückt wird. Dr. med. Tina Bernardi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Belegärztin, betont: «Die Stärkung des Vertrauens in den eigenen Körper sowie in den natürlichen Geburtsprozess ist der erste Schritt zu einer gelungenen Geburt.» Damit liegt der Schlüssel zu einer interventionsarmen Geburt in der Fähigkeit der Schwangeren, sich selbst zu vertrauen und ihre natürlichen Ressourcen zu aktivieren. Aber auch die Geburtshelfer müssen in diese Fähigkeiten und in den natürlichen Geburtsprozess vertrauen können.
Hohe Interventionsrate trotz natürlicher Alternativen In der modernen Geburtshilfe sind medizinische Interventionen häufig geworden. So liegt in der Schweiz die Kaiserschnittrate bei rund 32 Prozent – ein Wert, der deutlich über den von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 10 bis 15 Prozent liegt. Neben dem Kaiserschnitt werden auch Wehenmittel und Saugglocken routinemässig eingesetzt. Oftmals sind es standardisierte Abläufe, starre Hierarchien und der grosse Zeitdruck, die dazu führen, dass der natürliche Prozess zu früh unterbrochen wird. Der natürliche Geburtsprozess benötigt häufig mehr Zeit als die vorgesehenen medizinischen Zeitfenster erlauben, weshalb manchmal Eingriffe zu früh oder unnötig vorgenommen werden. «In stressbelasteten Situationen und bei Unsicherheiten greifen wir zu Interventionen, um Komplikationen zu vermeiden – doch ein entspannter Rahmen kann diesen Druck signifikant mindern und solche Situationen gar nicht erst entstehen lassen», erklärt Bernardi.
Der natürliche Geburtsprozess benötigt häufig mehr Zeit als die vorgesehenen medizinischen Zeitfenster erlauben, weshalb manchmal Eingriffe zu früh oder unnötig vorgenommen werden.
Die Bedeutung einer optimalen Geburtsumgebung Studien belegen, dass eine angenehme und geschützte Umgebung den Geburtsverlauf nachhaltig positiv beeinflusst. Frauen, die sich sicher und wohl fühlen, benötigen deutlich seltener invasive Massnahmen. Besonders wichtig ist dabei der Faktor Zeit: Eine bewusste Reduktion des Zeitdrucks und die Möglichkeit, den natürlichen Rhythmus zuzulassen, können den Eingriffsbedarf deutlich senken. Eine individuelle Eins-zu-eins-Betreuung durch Hebammen, die jeder Gebärenden Geborgenheit und Sicherheit vermittelt und ihr somit den nötigen Raum und die Zeit gibt, den Prozess der Geburt in ihrem eigenen Tempo zu erleben, ist hierbei von entscheidender Bedeutung.
Einige Spitäler setzen bewusst auf eine geborgene, interventionsarme Geburtshilfe. Dabei arbeiten Hebammen und erfahrene Fachärzte Hand in Hand: Während die Hebammen die Gebärende kontinuierlich betreuen

und für eine unterstützende Atmosphäre sorgen, greifen die Ärzte nur bei medizinischen Notwendigkeiten ein. Bernardi sagt: «Die Geburt ist ein physiologischer Prozess, der Zeit und Vertrauen erfordert. Indem wir den natürlichen Ablauf respektieren, können wir operative Eingriffe wirklich nur dann einsetzen, wenn es medizinisch unumgänglich ist, und diese auch meist in Ruhe mit der Gebärenden besprechen.»
Sind doch Interventionen nötig, steht in der Klinik Im Park ein Team aus Narkose- und Kinderärzten jederzeit zur Verfügung, um so auch im Notfall, bei Kaiserschnitten und Geburtskomplikationen maximale Sicherheit zu gewährleisten. Diese Kombination aus sanfter Geburtshilfe, offener Kommunikation und der Möglichkeit einer modernen medizinischen Versorgung bietet das Beste aus beiden Welten.
Vorbereitung und Begleitung Neben der Gestaltung des physischen Rahmens spielt
auch die Vorbereitung werdender Eltern eine wesentliche Rolle. Geburtsvorbereitungskurse, Atemtechniken und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Geburtsmethoden stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele Frauen haben individuelle Vorstellungen – sei es die Wunschposition während der Geburt, der Einsatz alternativer Schmerzmittel oder die Integration von Entspannungsübungen wie Aromatherapie und Massagen. Einrichtungen mit einem interventionsarmen Konzept berücksichtigen diese Wünsche und schaffen ein Umfeld, das von Empathie, Offenheit und Vertrauen geprägt ist. Auch alternative Methoden wie Homöopathie und Akupunktur finden zunehmend Anwendung neben klassischen Verfahren wie der Periduralanästhesie. Abgerundet wird das Konzept einer natürlichen Geburt durch die Einbeziehung von Partnern oder vertrauten Begleitpersonen. Die emotionale Unterstützung während der Geburt – zum Beispiel durch die Begleitung einer Doula – hat sich als positiver Einflussfaktor erwiesen. Diese nicht medizinischen Betreuer:innen schaffen eine Atmosphäre des Wohlbefindens, die es der Gebärenden ermöglicht, sich voll und ganz auf den natürlichen Prozess einzulassen und sind in vielen Geburtsabteilungen inzwischen gern gesehene Gäste. Die natürliche Geburt ist kein veraltetes Konzept und sie steht auch nicht im Widerspruch zur modernen Medizin. Sie ist eine bewusste Entscheidung, die durch eine passende Umgebung und gute Vorbereitung unterstützt werden kann. Das bestätigt auch Bernardi und sagt: «Werdende Eltern sollten sich frühzeitig informieren und ihre Wünsche mit den betreuenden Fachpersonen und dem Spital besprechen, um eine Geburt zu erleben, die sowohl sicher als auch natürlich verläuft».
Text Sarah Steiner
Sie wünschen sich eine Geburt wie in einem Geburtshaus, ohne auf die professionelle medizinische Unterstützung verzichten zu müssen? Dann sind Sie bei uns in der familiären Hirslanden Klinik Im Park genau richtig.
Wir bieten Ihnen neben der 1:1-Betreuung durch Hebammen und Ärzt*innen auch ein klinikinternes Team von erfahrenen Pädiater*innen. Dank des integrierten Operationssaals sind wir zudem optimal auf alle möglichen Situationen vorbereitet.
MACHEN SIE SICH SELBST EIN BILD UND BESUCHEN SIE UNSEREN INFORMATIONSABEND FÜR WERDENDE ELTERN.

Viele Frauen sind überzeugt, dass Zwillings- oder Beckenendlagengeburten automatisch einen Kaiserschnitt bedeuten. Doch das muss nicht immer so sein.
Dr. med. Margaret Hüsler Charles, Chefärztin der Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe am Spital Bülach, erklärt, warum eine natürliche Geburt in vielen Fällen möglich ist, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und warum Erfahrung und Vertrauen eine entscheidende Rolle spielen.

Frau Dr. Hüsler, viele Frauen denken, eine Zwillings- oder Beckenendlage-Geburt bedeutet automatisch einen Kaiserschnitt. Warum ist das nicht immer der Fall? Das ist ein weitverbreitetes Missverständnis. Zwillinge oder Beckenendlagen sind zweifellos anspruchsvolle Geburten, denn es sind Risikogeburten. Bei einer Beckenendlage oder Steisslage liegt das Baby mit dem Po nach unten. Aber auch diese Kinder können durchaus auf natürlichem Weg zur Welt kommen. Was es dafür braucht, ist eine individuelle Beratung, um zu klären, ob eine vaginale Geburt möglich ist. An vielen Orten wird diese Beratung nicht mehr angeboten und entsprechend fehlt es den jungen Ärztinnen und Ärzten an Erfahrung. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine natürliche Geburt sicher durchgeführt werden kann?
Zunächst einmal muss die Frau es wollen. Das ist der wichtigste Punkt. Bei einer Zwillingsgeburt
ist zudem entscheidend, dass der erste Zwilling mit dem Kopf voran liegt. Eine Frühgeburt sollte ausgeschlossen sein, da dies die Risiken erhöht. Das gilt auch bei Beckenendlagengeburten. Zudem prüfen wir mit klinischen Untersuchungen und bei Erstgebärenden mit einem MRI, ob das Becken der Mutter die Geburt zulässt. Die Geburt selbst muss zügig verlaufen –bei Erstgebärenden sollte sie nicht länger als sechs bis sieben Stunden dauern.
Wie erkennt man frühzeitig, ob eine vaginale Geburt möglich ist?
Am besten lässt sich das gegen Ende der Schwangerschaft ab circa der 35. bis 36. Schwangerschaftswoche beurteilen. Eine gute Beratung ist essenziell. Entscheidend ist aber nicht nur die Position der Babys, sondern auch die individuelle Konstitution der Mutter und der Geburtsverlauf.
Warum hat sich das Spital Bülach auf natürliche Geburten bei diesen beiden besonderen Fällen spezialisiert?
Wir bieten diese Geburten an, weil sie für die Mutter viele Vorteile bieten. Eine Frau, die vaginal entbunden hat, kann schneller aufstehen, sich um ihre Kinder kümmern und hat in der Regel weniger Blutungen als nach einem Kaiserschnitt. Wir haben eine gute Infrastruktur inklusive einer Neonatologie mit einem spezialisierten Team. Entsprechend sind wir für alle Situationen gerüstet. Und wir haben ein breites Team – von sehr jungen bis hin zu sehr erfahrenen Hebammen und Ärztinnen und Ärzten. Wir möchten unsere Erfahrung weitergeben und Fachpersonal ausbilden, damit dieses Angebot erhalten bleibt.
Hochdorf Swiss Nutrition AG • Brandreport

enn ein Kind zur Welt kommt, beginnt nicht nur ein neues Leben, sondern auch die Eltern betreten Neuland. In diesen ersten, sensiblen Momenten zählt jedes Detail. Genau hier setzt Bimbosan an: mit hochwertiger Babynahrung, echter Schweizer Qualität und einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse von Babys und Familien.
Seit 1932 steht Bimbosan für Verlässlichkeit, Nähe und Innovation mit einem umfassenden Sortiment an Folgemilchen, Breien und Snacks.
Swissness mit echter Tiefe Bimbosan ist der einzige Hersteller von Babynahrung, der konsequent auf Schweizer Kuhmilch setzt – vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Die Milch wird direkt in den firmeneigenen Produktionsstätten in der Schweiz verarbeitet, was kurze Transportwege, tieferen CO2-Ausstoss und höchste Frische garantiert. Das stärkt nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern auch das Vertrauen der Eltern.
Jedes Kind ist individuell
Jedes Baby ist einzigartig – deshalb bietet Bimbosan massgeschneiderte Lösungen: von kuhmilchbasierten Folgemilchen über Ziegenmilch bis hin zu pflanzenbasierten Produkten. Auch bei besonderen Bedürfnissen wie Koliken oder Allergien stehen spezielle Produkte bereit. Dabei wird empfohlen, die Bedürfnisse vorgängig mit Fachpersonen wie Hebammen oder Kinderärzt:innen zu besprechen.
Mehr als nur Babynahrung
Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Hebammen und Eltern? Enorm wichtig. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Hebammen zusammen – sie sind unsere wichtigsten Partner. Kommunikation und Vertrauen sind das A und O. Die Gebärenden spüren, wenn die Atmosphäre nicht stimmt. Deshalb müssen wir ein sicheres Umfeld schaffen, in dem sich die Frau wohlfühlt.
Welche Techniken oder Massnahmen gibt es, um eine Geburt aus Beckenendlage sicher und schonend zu gestalten? Wichtig ist, dass der Geburtsverlauf kontinuierlich beobachtet wird. Wir wenden die sogenannte «hands-off» Technik an, bei der das Kind ohne Intervention zur Welt kommt. Gelegentlich helfen wir manuell mit den Händen nach. Hier müssen erfahrene Geburtshelfer:innen dabei sein.
Gibt es typische Mythen über Beckenendlagen- und Zwillingsgeburten, die Sie gerne ausräumen würden?
Der grösste Mythos ist schlicht der, dass eine solche Geburt immer nur per Kaiserschnitt möglich ist. Eine vaginale Geburt kann sicherer sein als ein Kaiserschnitt. Tatsächlich ist das Risiko nicht höher, wenn erfahrene Geburtshelfer:innen anwesend sind.
Wann wird doch ein Kaiserschnitt notwendig, obwohl eine natürliche Geburt geplant war?
Es gibt klare Indikationen für einen Kaiserschnitt. Wenn es dem Kind nicht gut geht, sprich die Herztöne schlecht sind, oder die Geburt nicht voranschreitet, dann ist ein Kaiserschnitt die richtige Entscheidung. Bei einer Beckenendlage muss der Geburtsverlauf besonders gut
beobachtet werden. Wenn es zu Problemen kommt, muss ein Kaiserschnitt gemacht werden.
Wie können sich Frauen auf eine vaginale Geburt vorbereiten?
Das gilt für alle Geburten: Frauen sollten fit bleiben, sich gesund ernähren, nicht zu viel zunehmen und ausreichend schlafen. Eine übermässige Gewichtszunahme ist oft problematisch. Bei einem sehr hohen BMI führe ich keine Beckenendlagengeburt durch, weil Komplikationen dann schwerer zu handhaben sind.
Wie unterstützt Ihr Team die Frauen vor und während der Geburt?
Wir bieten eine individuelle Betreuung an, ohne Druck auszuüben. Wenn eine Frau Zweifel hat, erklären wir ihr alle Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass sie sich sicher fühlt und dass sie Vertrauen hat – in uns, aber auch in sich selbst. Die Psychologie nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Auch die Väter spielen eine entscheidende Rolle, doch manchmal sind sie skeptisch. Daher legen wir grossen Wert darauf, die Väter schon früh in die Geburtsvorbereitung zu integrieren, damit sie abgeholt sind und ihre Frau bei der Geburt unterstützen können.
Weitere Informationen unter: spitalbuelach.ch
Was verrät uns der Ultraschall über das ungeborene Kind?
Dr. med. Silke Michaelis spricht über moderne Untersuchungsmethoden und die Kunst, werdende Eltern mit Wissen und Herz zu begleiten.
Welche Untersuchungen sind heute Standard?
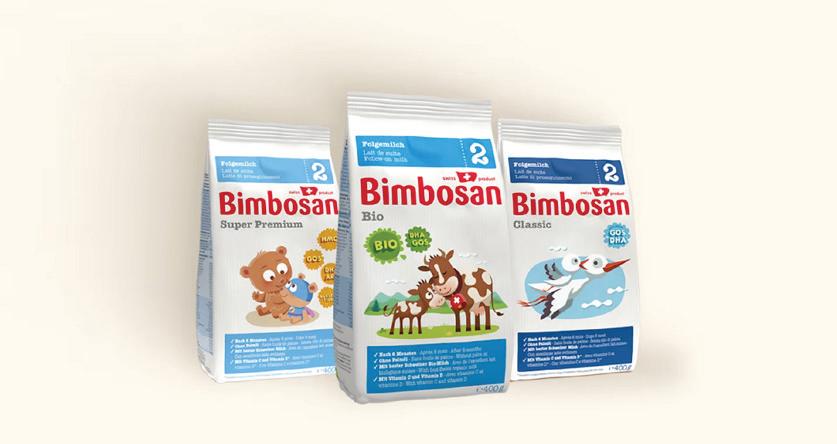
Transparenz ist für Bimbosan essenziell – Eltern sollen genau wissen, was in den Produkten steckt. Als eines der am strengsten regulierten Lebensmittelbereiche garantiert Babynahrung bei Bimbosan höchste Qualität und vollständige Offenheit zu Inhaltsstoffen. Doch das Unternehmen geht weiter: Mit einem persönlichen Kundenservice, einer eigenen Eltern-Community «BimBubble» sowie Podcasts mit Fachpersonen schafft Bimbosan Nähe, Wissen und Unterstützung. Denn Eltern sollen sich verstanden und gut beraten fühlen – ganz gleich, ob sie stillen oder nicht.
Weitere Informationen unter bimbosan.ch

Zwischen der 12. und 13. Schwangerschaftswoche führen wir den Ersttrimestertest durch. Dabei schauen wir uns die Entwicklung des Kindes an und messen dessen Nackenfalte. So lässt sich das Risiko für häufige Chromosomenstörungen – wie Trisomie 21, 18 und 13 – berechnen. In der 20. bis 22. Woche folgt das Organscreening: Wir prüfen die kindliche Entwicklung sowie die Organentwicklung im Detail.
Weshalb sind diese Untersuchungen sinnvoll?
Je früher mögliche Auffälligkeiten erkannt werden, desto gezielter können wir begleiten und das Wohlergehen von Mutter und Kind unterstützen. Bei bestimmten Fehlbildungen braucht es etwa eine spezialisierte Geburtsklinik oder bereits eine Therapie im Mutterleib – zum Beispiel bei einem Herzfehler oder offenem Rücken.
Auch bei drohender Frühgeburt können Interventionen nötig sein.
Wie gehen Sie mit auffälligen Befunden um?
Mit Ruhe, Klarheit und Einfühlungsvermögen. Ich erkläre den Eltern, was wir gesehen haben und was es bedeuten könnte. Ich schlage die nächsten Schritte vor und wir besprechen gemeinsam, welche weiteren Untersuchungen sinnvoll sind. Meine Aufgabe ist es, Orientierung zu geben.
Was sollten Eltern vor einer Untersuchung bedenken?
Die Frage lautet: Was würde ein auffälliges Ergebnis für uns bedeuten? Jede Lebenssituation ist anders und demnach können Entscheidungen unterschiedlich ausfallen. Wichtig ist, dass Eltern gut informiert sind – und sich in ihrer Entscheidung getragen fühlen.

Dr. med. Silke Michaelis ist Leitende Ärztin Frauenklinik am Spital Uster und Spezialistin für pränatale Diagnostik und Geburtshilfe.
Weitere Informationen: spitaluster.ch/eltern

Im Video zeigen unsere Expertinnen das Angebot in aller Kürze.
Der Darm, das grösste innere Organ des Menschen. Er beeinflusst nicht nur die Verdauung, sondern ist auch ein zentrales Element der Nährstoffaufnahme, des Immunsystems, der Psyche und des allgemeinen Wohlbefindens. Ein Ungleichgewicht der Darmflora ist oft die Ursache vieler Krankheiten.
Ein wichtiges Organ
Der Ursprung von vielen Krankheiten liegt oft im Darm, darum ist es sehr wichtig, sich auch richtig darum zu kümmern. Der Darm ist ein Muskelschlauch, der etwa sieben Meter lang ist und somit das grösste innere Organ des Menschen. Er besteht aus Dünn- und Dickdarm. Darin befinden sich Milliarden von Mikroorganismen, die zusammen das Mikrobiom bilden. Dazu gehören Bakterien, Viren, Pilze und andere Mikroben. Das wichtigste Mikrobiom ist das Darmmikrobiom, welches eine bedeutende Rolle für das Immunsystem, die Verdauung und selbst für die psychische Gesundheit spielt. Diese kleinen Helfer spalten die Nährstoffe und stellen die Bestandteile dem Körper bereit.
Der Darm und seine Funktionen Ca. 70 Prozent des Immunsystems befindet sich in unserem Darm – er bildet eine Barriere zwischen der Aussenwelt und unserem Inneren. Die Darmbakterien kommunizieren durch die sogenannte Darm-Hirn-Achse, die auch unsere Stimmung beeinflusst. Das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Drüsen, der Galle, der Bauchspeicheldrüse und dem Darm ist essenziell für eine gute Verdauung. Die Darmbakterien helfen der Darmschleimhaut, gesund zu bleiben, indem sie sie vor Entzündungen schützen. Für die Funktion des Darms sind diese Bakterien unerlässlich. Sie schützen nicht nur vor Entzündungen, sondern auch davor, Unverträglichkeiten zu entwickeln. Dafür muss aber eine grosse Menge und Vielfalt von Darmbakterien vorhanden sein. Wieso der Darm so wichtig ist Vieles, wie beispielsweise Antibiotika, kann die Darmflora aus der Bahn werfen. Antibiotika werden zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Jedoch greifen solche Medikamente nicht nur die krankheitserregenden Bakterien an, sondern auch die

wertvollen Darmbakterien. Auch andere Medikamente können zu Nebenwirkungen im Darm führen. Unser Körper produziert verschiedene Verdauungssäfte, die mithilfe von Millionen Bakterien das Essen zersetzen, Nährstoffe bereitstellen und unbrauchbare Nahrungsbestandteile ausfiltern. Gerät die Darmflora aus dem Gleichgewicht, funktionieren diese Prozesse der Zersetzung und des Transports nicht mehr einwandfrei. Die Folge können Probleme wie Schmerzen, Blähungen, Verstopfungen oder auch Durchfall sein.
Die Darmflora im Ungleichgewicht Es gibt viele Symptome, die auf ein Ungleichgewicht der Darmflora hindeuten. Ein häufiges Symptom sind Verdauungsbeschwerden. Es können jedoch auch Lebensmittelunverträglichkeiten und Heisshungerattacken mit anderen Symptomen in Verbindung stehen. Durch diese Symptome kann beispielsweise die allgemeine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein, was sich durch erhöhte Müdigkeit und Infektanfälligkeit äussern kann.
Brandreport • Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Der Darm wird oft unterschätzt Oftmals ist der Darm nicht das erste, an das man denkt, wenn Beschwerden oder Unwohlsein auftreten. Der Darm wird oft unterschätzt, obwohl er ein zentrales Organ für die Psyche, das Immunsystem und die Nährstoffaufnahme ist. Der Darm mag gerne Rituale, die aber bei jedem Menschen anders sein können. Falls man eine Veränderung bemerken sollte, liegt das wahrscheinlich an einem Ungleichgewicht in der Darmflora. Im Falle von leichten Veränderungen lohnt es sich, einen Blick auf die Ernährung zu werfen. Schon kleine Veränderungen können grosse Verschiebungen in der Darmflora auslösen. Nicht nur die Ernährung, sondern auch Stress kann den Darm beeinflussen. Daher ist es wichtig, nach einem langen und stressigen Tag zu entspannen.
Die Rolle der Ernährung Ungesunde Ernährungsweisen wie zu viel Alkohol, fettreiches Essen und viel Zucker können ungünstige Auswirkungen auf die Darmflora
haben. Hoch verarbeitete Lebensmittel sollten ebenso vermieden werden, da sie oft ungesunde Fette, Zusatzstoffe und künstliche Süssstoffe enthalten. Deswegen ist es besonders wichtig, auf die Ernährung zu achten. Eine gesunde Darmflora wird durch eine vollwertige Ernährung unterstützt. Kleine Anpassungen im Ernährungsplan können schon vieles bewirken. Einige Lebensmittel enthalten von Natur aus viele förderliche Bakterien. Probiotika zum Beispiel sind Zubereitungen aus mehreren guten Bakterienstämmen, die das Wachstum anregen und dabei helfen, die Darmgesundheit zu erhalten. Es gibt rund 400 probiotische Bakterien, die bekanntesten darunter sind die Milchsäurebakterien. Diese sind sehr säuretolerant, wodurch sie den Transport durch den Magen überleben und sich im Darm niederlassen können. Nicht nur Probiotika, sondern auch Präbiotika haben eine gute Wirkung auf den Darm. Darunter versteht man Ballaststoffe, die die Aktivität und das Wachstum der Bakterien im Dickdarm fördern. Gemüse und Vollkornprodukte enthalten darmförderliche Ballaststoffe. Auch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Joghurt unterstützen die normale Darmfunktion. Zur Förderung der Verdauung wird empfohlen, ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich zu nehmen. Zudem ist das gründliche Kauen empfohlen, da die Nahrung so besser verarbeitet werden kann. Durch schlecht zerkleinerte Nahrung wird die Verarbeitung für den Darm erschwert, was zu Sodbrennen und Blähungen führen kann.
Text Aaliyah Daidi
Wohltuendes Essen für den Darm
Vollkornprodukte wie Lein- und Flohsamen
Obst und Gemüse
Wasser und ungesüsster Tee
Kefir und Naturjoghurt
Kimchi
Kombucha
Sauerkraut
Vor knapp 2500 Jahren erkannte Hippokrates, der oft als Vater der modernen Medizin bezeichnet wird, die zentrale Rolle des Darms für unsere Gesundheit. Seine Worte «Der Darm ist der Vater aller Trübsal» erweisen sich heute als erstaunlich weitsichtig. Denn moderne Forschungen bestätigen, dass unser Verdauungssystem nicht nur für die Nährstoffaufnahme zuständig ist, sondern auch massgeblich unser Immunsystem, unsere Psyche und das Risiko für chronische Erkrankungen beeinflusst.

Dr. Timur Liwinski
Wissenschaftler und Leiter Arbeitsgruppe Darm und Psyche

Prof. Undine Lang
Direktorin Klinik für Erwachsene und der Privatklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel
Etwa 70 Prozent unseres Immunsystems befinden sich im Darm – eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie zentral das Verdauungssystem für unsere Gesundheit ist. Eine ausgewogene Darmflora kann nicht nur Entzündungen hemmen, sondern auch die körpereigene Abwehr stärken. Dabei spielt das Mikrobiom eine entscheidende Rolle. Der Begriff beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln – darunter Bakterien, Viren und Pilze. Besonders wichtig ist das Darmmikrobiom, das aus mehreren Billionen Bakterien besteht. Diese winzigen Helfer übernehmen essenzielle Aufgaben: Sie unterstützen die Verdauung, fördern die Nährstoffaufnahme und beeinflussen den Stoffwechsel. Zudem kommunizieren sie über
die sogenannte Darm-Hirn-Achse mit unserem Gehirn und beeinflussen sogar unsere Stimmung – nicht umsonst wird der Darm oft als «zweites Gehirn» bezeichnet.
Wie der Darm unsere Psyche beeinflusst Die Verbindung zwischen Darm und Gehirn erfolgt über mehrere Mechanismen. Ein zentraler Kommunikationsweg ist der Vagusnerv, der Signale in beide Richtungen überträgt. Doch auch hormonelle Botenstoffe und das Immunsystem spielen eine Rolle. Forschende haben herausgefunden, dass das Mikrobiom die Produktion von Neurotransmittern wie zum Beispiel Serotonin und Dopamin beeinflussen kann – Botenstoffe, die für unsere Stimmung und unser Wohlbefinden entscheidend sind.
Dr. Timur Liwinski, Wissenschaftler und Leiter der Arbeitsgruppe Darm und Psyche an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, erklärt: «Der Darm ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Eine angepasste Ernährung könnte deshalb helfen, Depressionen zu lindern.» Liwinski erforscht derzeit den Einfluss der ketogenen Ernährung auf psychische Erkrankungen. Erste Studien deuten darauf hin, dass eine Reduktion von Kohlenhydraten und ein erhöhter Anteil gesunder Fette positive Effekte auf das Gehirn haben könnten. Denn die Ketonkörper, die bei dieser Ernährungsweise verstärkt gebildet werden, wirken offenbar nicht nur entzündungshemmend, sondern unterstützen auch die Energieversorgung des Gehirns.
Professorin Undine Lang, Direktorin der Klinik für Erwachsene und der Privatklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, bestätigt die enge Wechselwirkung zwischen Darm und Psyche: «Wir wissen heute, dass bestimmte Bakterien in unserem Darm zahlreiche Prozesse im Gehirn beeinflussen. Das bedeutet, dass unsere Darmflora direkten Einfluss auf unsere Stimmung haben kann.» Studien zeigen, dass Menschen mit
Depressionen häufig eine veränderte Darmflora aufweisen. Dieser Zusammenhang wird zunehmend untersucht. Eine Untersuchung in Basel ergab, dass probiotische Bakterien depressive Symptome verbessern können.
Der Darm ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Eine angepasste Ernährung könnte deshalb helfen, Depressionen zu lindern.
– Dr. Timur Liwinski; Wissenschaftler und Leiter Arbeitsgruppe Darm und Psyche
«Entscheidend ist, dass sich der Bauch einfach wohl anfühlt» Doch wie erkennt man, ob der eigene Darm gesund ist? Dr. Timur Liwinski betont: «Entscheidend ist vor allem, dass sich die Darmgesundheit im Alltag bemerkbar macht – und zwar in erster Linie dadurch, dass sich der Bauch einfach wohl anfühlt», sagt er. Regelmässige, unkomplizierte Darmentleerung, das Fehlen von Beschwerden wie Blähungen oder Schmerzen sowie eine gute Belastbarkeit im Alltag sind wesentliche Anzeichen.
Viele Menschen leiden jedoch unter Symptomen wie Völlegefühl, chronischen Schmerzen oder Blähungen – oft zusammengefasst unter dem Begriff Reizdarmsyndrom, das laut Studien bis zu jeden dritten Menschen betrifft. Neben den offensichtlichen Verdauungsproblemen gibt es auch subtilere Hinweise auf eine gestörte Darmgesundheit wie entzündliche Prozesse oder das Leaky-Gut-Syndrom – eine geschädigte Darmbarriere, die zu einer erhöhten Durchlässigkeit für Schadstoffe führen kann.
Ein gesunder Darm für ein gesundes Leben Hippokrates’ Weisheit bewahrheitet sich also auch heute: Ein gestörter Darm kann zahlreiche Beschwerden auslösen, während eine gesunde Darmflora Körper und Geist stärkt. Unser Verdauungssystem ist nicht nur für die Nahrungsverarbeitung zuständig, sondern beeinflusst unsere gesamte Gesundheit. Die Erkenntnis, dass unser Darm und unser Gehirn in ständiger Kommunikation stehen, eröffnet neue Perspektiven für die Medizin – insbesondere für die Behandlung psychischer Erkrankungen.
Weitere Informationen unter upk.ch

In Cuxhaven an der Nordsee ist der Himmel unendlich und der Blick weit, die Luft schmeckt nach Salz und der Wind zerzaust die Haare. Über den Deich klettern, den ersten Blick auf die Nordsee oder die Elbe werfen, durchatmen. Ankommen. Im Urlaub, bei sich selbst.
Cuxhaven trumpft auf mit maritimer Geschichte, Einzigartigkeit und Vielseitigkeit: kilometerlange Sandstrände und moderne Promenaden zum Flanieren schlängeln sich an der Nordsee entlang.
Alle paar Stunden fällt sie trocken und es offenbart sich das Wattenmeer: Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist gleichzeitig UNESCO-Biosphärenreservat und Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Direkt am Elbstrand vorbei führt
der Weltschifffahrtsweg und bietet einen hautnahen Blick auf die größten Containerschiffe.
Beim Bummeln durch den Hafen und den Alten und Neuen Fischereihafen mit den Hapag-Hallen zeigt sich das maritime Flair und die reichhaltige Geschichte der Stadt. Direkt ans Meer grenzen der Wernerwald und die dahinter liegenden Küstenheiden und bieten Abwechslung und Erholung beim Waldbaden.

Apropos Entspannung – die gibt’s reichlich im Thalassozentrum ahoi!: Wellenbad mit echtem Nordseewasser und Disco-Rutsche, Fitness, Sauna mit großem Außenbereich und ein großer Thalassobereich mit Wellness und Kuranwendungen.
Entdecke das einzigartig vielseitige Cuxhaven!
LASS DICH BEGEISTERN. Jetzt das aktuelle Urlaubsmagazin bestellen:






Rodrigo Vazquez hat mit seinem raffinierten Menü aus Jakobsmuscheln, Ravioli und Schokoladenmousse 2024 «Masterchef Schweiz» gewonnen. Nun spricht er über seine Inspirationsquellen, die Bedeutung saisonaler Produkte und gibt praktische Tipps – nicht nur für saisonales, sondern auch unkompliziertes, einfaches und gleichzeitig genussvolles Kochen.
Kindheitserinnerungen
Seine Leidenschaft für das Kochen entwickelte sich bereits in seiner Kindheit. Die Erinnerungen an grosse Familientreffen mit gemeinsamen Essen prägten Vazquez. Besonders seine Mutter und Grossmutter waren die treibenden Kräfte in der Küche, während die Männer sich im Wohnzimmer versammelten. Dieses Zusammenkommen und die Bedeutung von Essen als Verbindung zwischen Menschen inspirieren ihn bis heute. Kochen ist für ihn nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine Konstante in seinem Leben, die Genuss, Leidenschaft und Gastfreundschaft vereint.
Die Wichtigkeit der saisonalen Küche
Ein essenzieller Bestandteil seiner Küche ist die Saisonalität seiner Zutaten. An erster Stelle steht für ihn der Geschmack – eine Tomate im Juli schmeckt einfach viel besser als im Dezember. Gleichzeitig sieht er es auch als Verantwortung, den ökologischen Fussabdruck im Hinterkopf zu behalten. Er hinterfragt zum Beispiel, ob es notwendig ist, Spargel aus Mexiko zu kaufen, wenn man nur noch eine kurze Zeit warten muss, bis er in der eigenen Region Saison hat. Zudem erleichtert die saisonale Küche die Entscheidung, was gekocht werden soll, da sie die Auswahl der Zutaten schmälert.
Egal ob ich selber koche oder jemandem über die Schulter schaue, kochen führt zu Leidenschaft, Gastfreundschaft, Genuss und Liebe.
Topinambur, Blumen- und Rosenkohl Momentan ist Topinambur eines von Vazquez’ Lieblingszutaten. Die knollenartige Pflanze erinnert an eine Kartoffel, bietet aber einen intensiveren Geschmack. Ob als Chips oder Püree – sie ist in der aktuellen Saison besonders köstlich. Auch Rosenkohl zählt für ihn zu den meist unterschätzten Zutaten. Viele Menschen hätten in der Kindheit den Rosenkohl verkocht serviert bekommen, weshalb ihm ein schlechter Ruf anhaftet. Doch gut zubereitet – beispielsweise im Ofen gebacken oder in der Pfanne angebraten – entfaltet sich ein ganz anderer Geschmack. Ein weiteres Highlight ist Blumenkohl, mit dem Vazquez immer wieder sein Umfeld überrascht. Von eingelegten Varianten bis hin zu BlumenkohlPanna-Cotta – die Möglichkeiten sind nahezu endlos.
Das sollte man immer zu Hause haben Für Vazquez gehört zu einer gut ausgestatteten Küche eine Vielfalt an Gewürzen, denn ohne die fehlt den Gerichten das gewisse Etwas. Essig in verschiedenen Sorten spielt für ihn ebenfalls eine besondere Rolle. Auch wenn das für viele nicht essenziell erscheint, gibt es den Speisen eine spannende Tiefe.
Einfach ist nicht gleich langweilig Für Rodrigo Vazquez bedeutet einfaches Kochen nicht Langeweile, sondern die Konzentration auf qualitativ hochwertige Zutaten und deren Zubereitung. So würde er beispielsweise grünen Spargel ungern kochen, sondern eher anbraten oder im Ofen backen. Auch wenn der Spargel anders zubereitet wird als sonst, ist es eine einfache Weise, sich ein spannendes Gericht herzurichten. Ein simples, aber überaus exzellentes

Zubereitung
Menü kann aus Büffel-Mozzarella, guten Tomaten, hochwertigem Essig und Olivenöl bestehen. Auch das Spiel mit verschiedenen Geschmacksrichtungen – süss, sauer, bitter, salzig und umami – sowie das Hinzufügen von knusprigen Elementen wie Paniermehl können Gerichte im Handumdrehen aufwerten.
Die drei goldenen Regeln
Freude, Neugier und Lust am Experimentieren sind seine drei goldenen Regeln für gutes und unkompliziertes Kochen. Das Schöne am Kochen ist, dass der Geschmackssinn verschärft und neue Kombinationen ausprobiert werden.
Kulturelle Einflüsse
Die mediterrane Küche hatte schon immer einen starken Einfluss auf die Kochweise von Vazquez. Inzwischen lässt er sich aber auch gerne von der skandinavischen Küche inspirieren. Ihre reduzierte Einfachheit faszinieren ihn und bieten einen spannenden Kontrast zur oft schwereren mediterranen Küche.
Nostalgie in Form von Essen
Ein Gericht mit besonderer Bedeutung für ihn ist «Coniglio», ein Kaninchengericht, das seine Mutter in seiner Kindheit gerne zubereitete. Wann immer Vazquez seine Mutter besucht, wünscht er sich dieses Essen, da es mit Emotionen und Erinnerungen verknüpft ist. Im Laufe der Jahre hat sich seine Küche verändert – sie ist komplexer geworden, da er nun mehr auf Texturen und Geschmacksnuancen achtet.
Text Aaliyah Daidi
Die Butter mit der Milch und einem Ei mischen und mit dem Schwingbesen gut verrühren. Das Mehl, Salz, Backpulver und den geriebenen Alpkäse beifügen. Von Hand leicht zusammenkneten. Den Mürbeteig für 30 Minuten kaltstellen.
Den Mürbeteig auf dem Tisch auswallen und in Streifen in der gewünschten Stick-Grösse schneiden. Je ein geschnittenes Alpkäsestück und einige Kürbiskerne auf die Teigstücke legen und etwas andrücken. Die Sticks auf ein Blech mit Backpapier legen. Das zweite Ei verrühren und die Sticks damit bestreichen.
In den auf 180 °C Umluft vorgeheizten Backofen schieben und für 15–20 Minuten backen.
Die Alpkäsesticks schmecken am besten warm zu einem Salat. Sie können aber auch kalt als Snack für unterwegs oder zum Apéro genossen werden.
Zutaten für 4 Personen
Mürbeteig:
100 g weiche Butter
100 ml Milch
Zwei Eier
250 g Mehl
100 g Alpkäse gerieben
Ein Kaffeelöffel Backpulver
Eine Prise Salz
Spinat-Malfatti
Zutaten
500g frischer Spinat
Salz
Wasser mit Eiswürfeln
120g Parmesan am Stück mit Rinde
1 Ei
125g Ricotta
25g Mehl
Pfeffer, Muskatnuss
1 Knoblauchzehe
3 EL Olivenöl
1 Flasche Tomaten-Passata à 600g
25g Panko
1 EL Butter
Fleur de Sel
Zubereitung
1. Für die Malfatti Spinat in kochendem Salzwasser kurz blanchieren, herausnehmen, in Eiswasser legen. Spinat abtropfen lassen, sehr gut ausdrücken, fein hacken. Käse fein reiben, die Rinde beiseitestellen. Spinat mit Käse, Ei, Ricotta und Mehl mischen. Mit 1/2 TL Salz, Pfeffer und etwas geriebenem Muskat würzen. Ca. 30 Minuten ziehen lassen.
2. Für den Sugo Knoblauch fein hacken. In 1 EL Öl andünsten. Passata dazugeben. Mit 1/2 TL Salz und Pfeffer würzen. Sugo bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten einkochen. Parmesanrinde beigeben, ca. 20 Minuten fertig köcheln.
3. Salzwasser aufkochen. Malfattimasse mithilfe von zwei Löffeln zu Nocken formen. Portionsweise im knapp siedenden Salzwasser ca. 5 Minuten ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausheben, gut abtropfen. Panko in 2 EL Öl in einer Bratpfanne anrösten, herausnehmen. In derselben Pfanne Butter erwärmen, Malfatti darin schwenken.
4. Sugo und Malfatti anrichten. Mit Panko bestreuen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Alpkäse wird im Sommer in 1’300 Alpbetrieben hergestellt; Lassen Sie sich von unseren Kreationen mit wenig Zubereitungsaufwand inspirieren unter schweizeralpkaese.ch/alpkaese-rezepte»
Sticks: 100 g Alpkäse geschnitten Kürbiskerne

Von Windeln, Wäschebergen und ... Verstopfung
Es gibt Tage, da läuft alles rund: Die Znüniboxen sind bereit, die Kinder tragen (fast) passende Socken, und man schafft es sogar, alle Wäsche aus dem Trockner zu holen, bevor sie wieder zerknittert. Und dann gibt’s diese anderen Tage: Wenn sich das Kind mit Laktoseintoleranz beim Kindergeburtstag genüsslich durch den Vanillepudding löffelt („Ich hab nur ganz wenig gegessen, Mama!“), während man selbst versucht, trotz Bauchkrämpfen und Blähbauch die Einkaufsliste nicht im Kopf zu verlieren. Willkommen im ganz normalen Familienwahnsinn – oder wie wir in der Praxis sagen: Willkommen im Reizdarmsyndrom-Club. Mara – zwischen Familienleben und stillem Örtchen Mara, Mutter von zwei lebhaften Kindern (eines davon laktoseintolerant, das andere einfach ... laut), kam irgendwann an ihre Grenzen. Während andere nach dem Abendessen entspannt auf dem Sofa sassen, lag sie mit Wärmflasche im Bett, kämpfte gegen ein Völlegefühl wie nach einem Weihnachtsessen – und das mitten im Juli. Ihre Verdauung hatte offensichtlich eigene Pläne. Nach diversen Untersuchungen stellte ihr Hausarzt schliesslich fest: Reizdarmsyndrom.
Was das bedeutet? Ganz einfach gesagt: Der Darm ist zickig – obwohl medizinisch eigentlich alles in Ordnung ist. Schmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung kommen und gehen, ganz ohne erkennbare Ursache. Stress, Essen, Hormone, das Mondlicht – alles scheint irgendwie mitzureden. Praktisch, wenn man nebenbei noch versucht, den Familientag zu überleben.
Familienzeit trifft FODMAP Reizdarmsyndrom ist eine funktionelle Störung –das heisst: Der Darm sieht bei der Untersuchung gesund aus, aber funktioniert trotzdem nicht so, wie er sollte. Mara litt unter klassischen Symptomen: Völlegefühl, Bauchkrämpfe, Blähungen – und vor allem Verstopfung (medizinisch: Obstipation).
Woran erkennt man eigentlich, dass man wirklich verstopft ist? Nun, wenn der Toilettenbesuch seltener als alle drei Tage stattfindet, der Stuhl hart und klumpig ist und das Ganze eher nach Gymnastik als nach Entspannung klingt, ist der Darm nicht happy. Viele denken, das sei halt „normal“. Aber nur, weil etwas häufig ist, ist es nicht harmlos – und schon gar nicht im Familienalltag, wo die Eltern oft zuletzt an sich denken.
Wenn Hausmittel nicht mehr reichen Natürlich probierte Mara zuerst alles, was man eben so hört: Mehr trinken (30 bis 35 ml pro Kilo Körpergewicht, idealerweise ungesüsst), Leinsamen, Bauchmassage, Toilettenhocker (Tipp: Der Hocker vom Kind tut’s auch), Atemübungen, mehr Bewegung ... Doch nichts half wirklich. Also kam sie zur Ernährungsberatung – endlich, wie sie später sagte.
Hier begann die eigentliche Detektivarbeit. Wir schauten uns alles an: Ihre medizinische Vorgeschichte (Magen-Darm-Spiegelungen, frühere Infektionen), ihre Essgewohnheiten, ihre Stressbelastung, Medikamente, sogar ihre Toilettengewohnheiten. Ja, es gibt tatsächlich eine „Stuhl-Skala“ (die Bristol Stool Chart), mit der wir herausfinden, was genau beim Stuhlgang nicht läuft wie geplant.
Die Diagnose stand fest: Reizdarmsyndrom. Und der Plan war klar: Wir starteten mit einer FODMAP-armen Ernährung. FOD... was?
FODMAPs sind eine Gruppe von schwer verdaulichen Kohlenhydraten (u. a. Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole), die bei empfindlichen Personen im Darm zu Blähungen, Schmerzen und Durchfällen oder Verstopfung führen können. Sie stecken in vielen Lebensmitteln – von Milch über Zwiebeln, Knoblauch, Äpfeln und Pilzen bis hin zu Brot und Pasta.
Die erste Phase dieser Ernährung dauert nur etwa 4–6 Wochen – länger sollte man sie nicht durchziehen, denn sie ist nicht als Dauerernährung gedacht. Danach geht’s ans vorsichtige Austesten: Was vertrage ich – und was nicht?
Das Knoblauch-Drama (und seine Rettung) Mara war entsetzt: Kein Knoblauch?! Keine

«Was viele nicht wissen: Rund 70 % unseres Immunsystems sitzt im Darm. Ja, wirklich! Unser Verdauungssystem ist nicht nur für die Verarbeitung von Nahrung zuständig, sondern auch ein zentraler Bestandteil unserer Immunabwehr.»
Lasagne? Kein Knoblauchbrot?! Aber es gibt eine Lösung: Knoblauchöl. Denn die FODMAPs im Knoblauch sind wasserlöslich – nicht fettlöslich. Das heisst: Du kannst den Knoblauch auslassen, aber das Aroma über Öl herausholen. Mara war selig. Auch für einen adäquaten Ersatz für die Pasta und das Brot wurde gesorgt.
Der Familienalltag verändert sich (zum Besseren!) Nach sechs Wochen war Mara wie ausgewechselt. Keine Bauchkrämpfe mehr, keine Panik vor dem Spielplatzbesuch, keine Wärmflasche unterm Pulli. Sie strahlte – und das zurecht.
In der zweiten Phase testete Mara viel aus, probierte aus, welche Lebensmittel sie wieder einführen konnte, sodass sie wieder eine möglichst grosse Auswahl an Nahrungsmittel hat. Und ja: Einige blieben schwierig (Zwiebeln, Pilze, Aprikosen, zu viel Brot), aber andere vertrug Mara wieder
richtig gut. Wichtig: Sie lernte, auf ihren Körper zu hören – und vor allem, sich selbst ernst zu nehmen.
Und was macht der Sohn mit der Laktoseintoleranz? Auch für ihren Sohn, der auf laktosehaltige Milchprodukte reagiert, fanden wir Lösungen. Laktosefreie Alternativen und Rezepte, Strategien für Kindergarten und Co. Und weil der Alltag ohnehin schon hektisch genug ist, gab es praktische Tipps für stressfreie Küchentage: Omeletten mit Schinken, dunklen Schokoaufstrich statt dem hellen Aufstrich – und eine gut gefüllte Notfallbox im Auto (ja, Snacks retten Leben).
Ein unterschätzter Held: Unser Darm und das Immunsystem Was viele nicht wissen: Rund 70 % unseres Immunsystems sitzt im Darm. Ja, wirklich! Unser Verdauungssystem ist nicht nur für die Verarbeitung von Nahrung zuständig, sondern auch ein zentraler Bestandteil unserer Immunabwehr.
Wenn der Darm nicht im Gleichgewicht ist –etwa durch ein Reizdarmsyndrom oder andere anhaltende Verdauungsbeschwerden – kann das auch die Abwehrkräfte schwächen.
Gerade im turbulenten Familienalltag, wo ständig Schnupfnasen unterwegs sind, ist es umso wichtiger, dass unser „eigenes Abwehrzentrum“ gut funktioniert. Deshalb lohnt es sich, Verdauungsprobleme ernst zu nehmen – nicht nur, um die Lebensqualität zu verbessern, sondern auch um das Immunsystem zu stärken. Ein gesunder Bauch kann bedeuteten: weniger Infekte, mehr Energie, mehr Gelassenheit.
Ein paar Tipps für Kinder und Eltern mit Bauchweh und Verdauungsproblemen
• Toilettenrituale einführen. Klingt komisch –funktioniert aber. Immer zur gleichen Zeit, ohne Eile. Auch für die Kinder ist dies eine gute Idee. Ebenso wichtig: Lassen Sie sich Zeit am ruhigen Örtchen.
Sitzposition prüfen. Ein kleiner Hocker unter den Füssen kann Wunder wirken (für Gross und Klein).
Langsam essen. Nicht einfach – aber sinnvoll. Wer hetzt, schluckt Luft. Wer kaut, hilft dem Bauch.
Stress reduzieren. Okay, leichter gesagt als getan. Aber kleine Auszeiten wirken. Und manchmal reicht schon ein warmes Kirschkernkissen oder eine kleine Atemübung.
• Ballaststoffe clever dosieren. Zu viel auf einmal kann kontraproduktiv sein. Lieber langsam steigern, gut kauen – und viel trinken.
• Pro- und Präbiotika bewusst einsetzen. Naturjoghurt, Sauerkraut, Kefir oder bestimmte Gemüsesorten können die Darmflora unterstützen – je nach Verträglichkeit.
Fazit: Familie bedeutet Chaos –aber kein Grund zu leiden Verdauungsprobleme sind kein Randthema. Sie betreffen viele – auch mitten im Familien- und Berufsalltag. Wichtig ist: Man muss da nicht alleine durch. Eine gezielte Beratung durch Fachpersonen kann Wunder wirken. Nicht mit Hokuspokus, sondern mit nachvollziehbaren, umsetzbaren Tipps, die ins echte Leben passen. Mit Kindern. Und mit Pizza (ja, es gibt Alternativen!). Wenn du dich selbst oder jemanden in deiner Familie in Mara wiedererkennst – mach den ersten Schritt. Stell nicht länger Diagnosen mit Tante Google. Lass dich beraten, individuell, verständlich und ohne erhobenen Zeigefinger.
Denn das Leben ist zu kurz für Bauchkrämpfe beim Legoaufbauen oder verpasste Kinoabende mit Freunden, weil die Verdauung dem Ganzen wieder einmal einen Strich durch die Rechnung macht.
Beratung für alle
Das Ernährungszentrum optiKal in Zug unter der Leitung von Ursula Zehnder ist spezialisiert auf ganzheitliche Ernährungsberatung mit dem Schwerpunkt Darmgesundheit individuelle abgestimmt auf die Bedürfnisse von Eltern, Kindern und der ganzen Familie.
Hast du oder jemand aus der Familie hat auch Probleme mit der Verdauung? Gerne unterstützen wir dich bei der Verbesserung der Darmgesundheit. Möchtest du weitere wertvolle Tipps für die Verdauung? Hier kannst du direkt Kontakt aufnehmen: ernaehrungszentrum-zug.ch
Instagram: @happy_belly_ernaehrung
Ivan Frédéric Knie
Seit über 200 Jahren begeistert die Familie Knie mit ihrer Zirkuskunst und gelebter Tradition. Ivan Frédéric Knie wuchs in dieser besonderen Welt auf – zwischen Manege, internationalen Künstler:innen und Pferden. Im Interview spricht er über seine einzigartige Kindheit, den starken Familienzusammenhalt und die Herausforderung, ein traditionsreiches Familienunternehmen zu bewahren und gleichzeitig neue Wege zu gehen.
Interview Aaliyah Daidi Bild © Nicole Boekhaus
Ivan Frédéric Knie, Sie haben durch Ihr Familienunternehmen eine ganz besondere Kindheit gehabt. Wie würden Sie diese beschreiben?
Ich kann meine Kindheit kaum in Worte fassen. Sie war fantastisch. Ich hatte das grosse Glück, Dinge erleben zu dürfen, die für viele andere Kinder nicht selbstverständlich sind. Wir reisten viel und haben unzählige Orte entdeckt. Als Kind liebte ich Spielplätze und wollte immer neue erkunden.
Eine besonders schöne Erinnerung ist, dass ich viele schöne Freundschaften mit Künstlerinnen, Künstlern und deren Kindern schliessen konnte. Wir haben jedes Jahr 60 bis 70 Künstler und insgesamt über 200 Mitarbeitende – viele von ihnen sind ganze Familien. Dadurch habe ich heute Freunde auf der ganzen Welt und immer irgendwo eine Verbindung, was ein Riesengeschenk für mich ist.
Ich würde meinen zukünftigen Kindern genauso eine wunderschöne Kindheit wie meine wünschen. Ich war schon fast etwas verwöhnt, aber ich hätte es mir nicht anders wünschen können. Es war ein Traum.
Da Sie durch den Zirkus viel reisen, begegnen Sie ständig neuen Menschen und knüpfen somit zahlreiche Kontakte. Würden Sie sagen, dass diese Beziehungen langfristig oder eher vorübergehend sind? Sehen Sie darin eventuell einen Nachteil? Definitiv langfristig. Natürlich telefoniere ich nicht täglich mit all meinen Freunden, aber für mich sind echte Freundschaften die, bei denen man sich auch nach langer Zeit wieder melden kann und alles sofort passt. Natürlich ist das durch Social Media heutzutage einfacher und ich weiss immer, wo meine Freunde sich gerade aufhalten.
Ein Beispiel: Vor ein paar Jahren war ich in den Sommerferien in Las Vegas, einfach um ein paar Freunde zu besuchen und mir Liveshows anzuschauen. Vor Ort habe ich dann festgestellt, dass so viele Bekannte dort leben, dass ich meinen Aufenthalt verlängern musste, um alle zu sehen.
Ich sehe das als grossen Vorteil. Viele Menschen wünschen sich, so viel reisen zu können und so viele Kontakte zu knüpfen. Für mich ist das ein unglaubliches Privileg.
Der Circus Knie ist ein grosses Familienunternehmen, das seit vielen Generationen geführt wird. Wie würden Sie den heutigen Zusammenhalt beschreiben? Unsere Situation ist besonders. Wir leben und arbeiten zusammen und tauschen uns täglich über alles Mögliche aus. Natürlich gibt es – wie in jeder Familie – Meinungsverschiedenheiten. Entscheidend ist, dass wir sie akzeptieren und offen kommunizieren, um dann Kompromisse finden zu können.
Das könnte man mit einer guten Beziehung vergleichen: Man muss sich austauschen, über Probleme reden und zusammen daran arbeiten. Uns gelingt das sehr gut und ich hoffe, dass es für immer so bleibt. Der Zusammenhalt unserer Familie ist etwas ganz Besonderes.
Wie gelingt es Ihnen, eine gute WorkLife-Balance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein harmonisches Verhältnis zu Ihrer Familie zu bewahren? Für mich ist unser Lebensstil normal. Unser Beruf wurde zu unserer Leidenschaft, wir haben unser Hobby zu unserem Job gemacht.
Das könnte man mit Profisportlerinnen und -sportlern vergleichen: Ein Tennisspieler lebt für seinen Sport, trainiert regelmässig und ist immer unterwegs. Genauso ist es bei uns im Zirkus. Selbst in unserer Freizeit überlegen wir, wie wir die Show verbessern könnten. Für mich ist das keine Arbeit, sondern ein grosser Teil meines Lebens und auch das meiner Familie.

erfinden und modern präsentieren, damit der Zirkus auch in Zukunft das Publikum begeistern kann.
Zum
Glück kann ich sagen, dass ich immer Menschen um mich habe, die mich unterstützen – sei es im Team, im
Freundeskreis oder in der Familie.
– Ivan Frédéric Knie
Welche kreativen und logistischen Herausforderungen bringt die Arbeit im Zirkus mit sich? Wie gehen Sie mit unerwarteten Änderungen im Tagesablauf um?
Jede Herausforderung ist anders. Zum Glück kann ich sagen, dass ich immer Menschen um mich habe, die mich unterstützen – sei es im Team, im Freundeskreis oder in der Familie.
Wie empfinden Sie es, Familienmitglieder als Vorgesetzte zu haben? Welche Vorteile und Herausforderungen bringt diese Dynamik mit sich?
Ich sehe meine Mutter nicht nur als Chefin, sondern auch als meine engste Vertraute – genauso wie meinen Grossvater, der früher Zirkusdirektor war. Er hat mich als Künstler geprägt und mir alles über Pferde und Dressur beigebracht.
Meine Familie sehe ich nicht als Vorgesetzte, sondern eher als meine Trainer und Mentorinnen. Wir haben eine sehr offene Kommunikation und wir können uns immer aufeinander verlassen. Nicht alle haben so eine besondere Beziehung zur Familie, dafür bin ich unglaublich dankbar.
Inwiefern beeinflussen andere Zirkuskonzepte Ihr Format?
Ich liebe es, mir andere Shows anzusehen und mich inspirieren zu lassen. Für mich gibt es Konkurrenz in dem Sinne nicht – nur gute und weniger gute Produktionen.
Es ist unglaublich wichtig, dass es weltweit verschiedene Liveshows gibt, damit das Publikum weiterhin begeistert werden kann. Der Zirkus muss sich ständig weiterentwickeln und dabei hilft die Inspiration von anderen Produktionen enorm.
Gibt es Aktivitäten, die Sie auch ausserhalb des Zirkusalltags unternehmen? Und wie gestalten Sie traditionelle Anlässe wie beispielsweise Geburtstage und Feiertage? Ehrlich gesagt, bin ich nicht der grösste Fan von Feier- oder Geburtstagen. Meine Familie legt aber viel Wert darauf und deshalb feiern wir immer zusammen.
An Weihnachten und Silvester kommen nicht nur unsere Familie, sondern auch unsere Künstlerinnen,
Künstler und Mitarbeitenden zusammen, denn sie gehören auch zur Familie. Einige unserer Mitarbeitenden sind schon seit Jahrzehnten bei uns. Das schafft eine starke Verbundenheit.
Wie würden Sie den Alltag in Ihrer Familie beschreiben? Gibt es besondere Gewohnheiten oder Rituale, die Ihrer Familie wichtig sind?
Der Morgen ist immer am wichtigsten, denn er beginnt immer im Stall. Dort kümmern sich 15 Mitarbeitende um unsere 44 Pferde. Mein Grossvater kommt später dazu, denn er ist schliesslich mein Mentor. Obwohl er nicht mehr in der Manege steht, ist er noch immer genauso aktiv hinter den Kulissen wie früher in der Manege, denn der Zirkus ist sein Lebenswerk. Unsere Tage sind durch das Zirkusleben sehr geprägt, aber genau das lieben wir und ich würde es mir nicht anders wünschen.
Der Zirkus hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Wie sehen Sie die Entwicklung des traditionellen Konzepts im Vergleich zu modernen Formaten?
Gibt es interessante Elemente, die Sie gerne integrieren würden?
Meine Mutter und mein Stiefvater sind unglaublich innovativ und setzen sich stark für die Weiterentwicklung des Zirkusses ein.
Der Zirkus hat sich schon immer verändert –genau wie das gesamte Showbusiness. Früher konnte man das gesamte Publikum mit einem einfachen Salto begeistern, doch heute sind durch Social Media, unzählige Videos und Talentshows die Erwartungen viel höher. Durch die Digitalisierung müssen wir uns ständig neu
Wir haben Spezialistinnen und Spezialisten für alle Bereiche im Zirkus, und es gibt immer jemanden, der eine Lösung findet. Kommunikation ist dabei das Wichtigste für uns.
Werden wir Sie zukünftig in der Rolle der Zirkusdirektion sehen? Wie gehen Sie mit diesem Druck um?
Ich hoffe es! Gleichzeitig wünsche ich mir jedoch, dass meine Mutter und mein Stiefvater das Unternehmen noch lange führen können. Ich kann sagen, dass ich mehr Vorfreude als Druck empfinde, einmal die Rolle als Zirkusdirektor übernehmen zu dürfen.
Momentan führt die siebte Generation das Unternehmen. Gibt es bereits Visionen oder Pläne des Zirkusses in der achten Generation? Unser Ziel ist es, die Familientradition fortzuführen. Circus Knie gibt es schon seit dem Jahr 1803 – über 200 Jahre lang! Wir tun alles, dass unser Unternehmen auch in Zukunft bestehen bleibt.
Wenn wir weiter so zusammenarbeiten, dann bin ich davon überzeugt, dass der Zirkus eine grossartige Zukunft vor sich hat.
Zur Person Ivan Frédéric Knie ist der Sohn von Géraldine Knie und Ivan Pellegrini. Er gehört mit seinen zwei Halbgeschwistern und Cousins zu der achten Generation der Knie Familie. Ivan Knie hat eine grosse Leidenschaft für Pferde und Dressurreiten. Durch seine Mutter und seinen Grossvater besteht die Leidenschaft für den Circus Knie noch immer und wird in Zukunft auch von Ivan Knie weitergeführt. Solange Géraldine Knie noch für die Zirkusdirektion verantwortlich ist, begeistert Ivan Knie weiterhin das Publikum mit seiner atemberaubenden Show.
Die digitale Welt ist kein rechtsfreier Raum – und Kinder benötigen darin besonderen Schutz. Eltern tragen Verantwortung. Nicht nur für die reale, sondern auch für die virtuelle Sicherheit ihrer Kinder. Die Kindernothilfe Schweiz unterstützt dabei mit fundierter Aufklärungsarbeit und praktischen Hilfestellungen. Denn: Schutz beginnt mit Bewusstsein.
Digitale Medien sind längst Teil des Familienalltags geworden. Bereits im jungen Alter nutzen Kinder Tablets, schauen Videos auf YouTube oder tauchen in die Welt der sozialen Medien ein. Für viele Eltern stellt sich dabei eine zentrale Frage: Wie kann ich mein Kind in dieser vernetzten Welt wirkungsvoll schützen? Genau diesem Thema widmet sich die Kindernothilfe Schweiz in ihrem Elternratgeber – mit einem klaren Fokus auf Kinderschutz im digitalen Raum. «In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft ist dies ein ebenso aktuelles wie sensibles Thema», sagt Geschäftsführerin Deborah Berra. Denn digitale Technologien sind längst mehr als nur Freizeitbeschäftigung – sie beeinflussen, wie Kinder lernen, spielen und mit der Welt interagieren. Umso wichtiger ist es, ihnen Orientierung zu geben und Schutzmechanismen zu schaffen, die sie nicht einschränken, sondern stärken. Die Herausforderung: Aufwachsen im digitalen Rampenlicht Soziale Netzwerke haben unser Kommunikationsverhalten grundlegend verändert. Was früher im Familienalbum landete, ist heute mit wenigen Klicks für ein breites Publikum sichtbar. Viele Eltern teilen Fotos ihrer Kinder – bei der Geburtstagsparty, beim Spielen oder in Alltagsmomenten. Sie tun dies aus Freude oder Stolz – das ist nachvollziehbar. Doch ein kurzer Klick kann langfristige Folgen haben. Kinder sind keine Content-Produzenten, sondern Persönlichkeiten mit Rechten, die auch im Netz gelten müssen. Und so kann, was gut gemeint ist, unbeabsichtigt zur Gefahr werden. Unachtsam gepostete Inhalte können von Dritten gespeichert, missbraucht oder aus dem Kontext gerissen werden. Die Kindernothilfe Schweiz sieht hier einen wachsenden Aufklärungsbedarf und vermittelt Eltern praxisnahe Tipps für einen verantwortungsvollen Umgang mit Kinderfotos und -daten im Netz. «Die richtige Balance zwischen Offenheit und Schutz zu finden, ist entscheidend, um die Privatsphäre der Kinder zu wahren», sagt Frau Berra.
Fünf Tipps für mehr Kindersicherheit im Netz
Nur bekleidet posten: Kinder sollten nie in Situationen gezeigt werden, die intim oder missverständlich wirken könnten – auch nicht beim scheinbar harmlosen Badespass am Pool. Selbst scheinbar unschuldige Bilder können in den falschen Händen missbraucht werden.
– Keine peinlichen Momente: Kinder haben ein Recht auf Würde. Fotos, die sie blossstellen –beim Weinen, auf dem Töpfchen oder mit verschmiertem Gesicht – gehören nicht ins Internet.
– Vorher fragen: Auch jüngere Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung. Wer sie fragt, ob ein Bild geteilt werden darf, fördert nicht nur ihre Medienkompetenz, sondern auch ihr Selbstwertgefühl.
– Gesichtsschutz bedenken: Nicht jedes Foto muss das Gesicht zeigen. Rückansichten, Schattenbilder oder kreative Perspektiven wahren die Privatsphäre und erzählen trotzdem emotionale Geschichten.
– Privatsphäre-Einstellungen nutzen: Viele vergessen, dass Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. in den Grundeinstellungen oft öffentlich sind. Zugriffsrechte sollten konsequent auf Familie und Freunde beschränkt werden.
Bildschirmzeit – zwischen Kontrolle und Vertrauen Neben Datenschutz ist auch die Bildschirmzeit ein weiteres grosses Thema. Viele Kinder verbringen oft mehrere Stunden täglich mit digitalen Geräten – und Eltern stehen vor der Herausforderung, gesunde Grenzen zu setzen. Die Kindernothilfe empfiehlt daher, handyfreie Zonen im Alltag zu schaffen, etwa bei den Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen. Bewusste Offline-Zeiten helfen dabei, den Medienkonsum zu reflektieren und gemeinsam Alternativen zu gestalten. Das Prinzip «Aus den Augen aus dem Sinn» kann hilfreich sein. Wenn das Gerät ausser Sichtweite liegt – etwa in einer Schublade oder auf einem Regal –, sinkt die Versuchung, es ständig zu nutzen. Dieses Prinzip

Soziale Netzwerke haben unser Kommunikationsverhalten grundlegend verändert. Was früher im Familienalbum landete, ist heute mit wenigen Klicks für ein breites Publikum sichtbar.
sollte für alle gelten, nicht nur für Kinder. Viele Familien regeln dies mit einem Mediennutzungsvertrag. Wer sich nicht daran hält, muss das Gerät abgeben – eine klare, faire Konsequenz. Frau Berra betont: «Es geht nicht darum, digitale Medien zu verbieten, sondern einen gesunden Umgang zu fördern.» Medienpädagogik soll Teil der Erziehung sein – nicht als Kontrolle, sondern als Begleitung. Entsprechend wichtig ist es, dass Eltern selbst mit gutem Beispiel vorangehen.
Wenn Konflikte eskalieren: Triple P als Hilfe zur Selbsthilfe Doch was, wenn die Regeln nicht greifen? Wenn Kinder sich widersetzen, wütend werden oder mit Trotz reagieren? Solche Situationen kennen alle Eltern – und sie stellen dennoch immer wieder eine Herausforderung dar. Auch hier bietet die Kindernothilfe Schweiz Unterstützung. Mit Triple P (Positive Parenting Program) erhalten Eltern praktische Werkzeuge, um den Familienalltag konstruktiv und gelassener zu gestalten.
Triple P ist ein flexibles, auf Positivität ausgerichtetes Erziehungsprogramm, das darauf abzielt, Konflikte zu vermeiden, emotionales Verständnis zu fördern und Kinder zu verantwortungsvollem Verhalten zu befähigen. Es basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und lässt sich flexibel an die individuelle Familiensituation anpassen – vom Alltag mit Kleinkindern bis zu Herausforderungen mit Teenager:innen. «Im Mittelpunkt
steht die Idee, Kinder in ihrer Entwicklung gezielt zu stärken – von der sozialen Kompetenz bis zur Selbstständigkeit», erklärt Frau Berra.
Die fünf Grundregeln von Triple P:
1. Schaffung einer sicheren und interessanten Umgebung. Kinder, die sich langweilen, neigen eher zu problematischem Verhalten. Eine Umgebung, in der sie sich gefahrlos entfalten können, fördert eine gesunde Entwicklung.
2. Förderung einer positiven Lernatmosphäre. Wenn Kinder um Aufmerksamkeit oder Hilfe bitten, ist das eine Chance. Selbst kurze, wertschätzende Zuwendung stärkt ihr Selbstvertrauen.
3. Konsequent sein. Klare Regeln und faire Konsequenzen geben Orientierung. Mit älteren Kindern können Regeln gemeinsam entwickelt und angepasst werden.
4. Realistische Erwartungen haben. Niemand ist perfekt – weder Kinder noch Eltern. Fehler gehören zum Lernen dazu.
5. Auch sich selbst achten. Elternsein ist fordernd. Wer gut für sich sorgt, bleibt gelassener und kann besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
Vom Ratgeber zum weltweiten Schutzschild: Ganzheitlicher Einsatz für Kinder Das Angebot der Kindernothilfe Schweiz ist mehr als nur eine Sammlung nützlicher Ratschläge für den digitalen Alltag. Es spiegelt ein ganzheitliches Verständnis von Kinderschutz wider – einen Schutz, der zwar im eigenen Zuhause beginnt, aber weit über nationale Grenzen hinausreicht. Ob in der Schweiz, in Krisenregionen wie der Ukraine oder in Projekten in Ruanda, Bolivien oder Südafrika – überall steht das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. Ziel ist es, sie zu stärken: durch Bildung, psychosoziale Unterstützung und konkrete Hilfe in schwierigen Lebenslagen.
Die digitale Sicherheit, für die die Kindernothilfe mit ihrem Ratgeber sensibilisiert, ist dabei nur ein Aspekt eines weit grösseren Ganzen. In über 500 Projekten weltweit werden Kinder nicht nur geschützt, sondern zu Akteuren ihrer eigenen Zukunft gemacht. Sie lernen, ihre Rechte zu kennen, sich selbstbewusst auszudrücken und Grenzen zu setzen. Kinderschutz bedeutet dabei nicht nur Prävention, sondern auch Heilung, Entwicklung und Zukunftsperspektiven. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt die Kindernothilfe: lokal verankert, partnerschaftlich organisiert und langfristig ausgerichtet.
Zurück in die Schweiz: Auch hier endet das Engagement nicht beim Ratgeber. Die Kindernothilfe bietet Workshops, Webinare und Schulmaterialien an, um Familien, Lehrpersonen und Fachpersonen zu sensibilisieren. Dabei geht es stets darum, einen sicheren Raum zu schaffen – ob im Klassenzimmer oder im Chatroom. «Wir können Kinder nur dann wirksam schützen, wenn wir ihnen gleichzeitig zutrauen, stark zu sein», sagt Frau Berra und fügt an: «Kinderschutz bedeutet auch: Kindern eine Stimme geben.»
Mehr Informationen zur Arbeit der Kindernothilfe Schweiz unter: www.kindernothilfe.ch

Jetzt spenden:


Inmitten eines oftmals hektischen Alltagsrhythmus mit Verpflichtungen, Terminen und Ablenkungen bietet das gemeinsame Unterwegssein als Familie eine wertvolle Gelegenheit zum Innehalten und zur bewussten Begegnung. Ob auf Ausflügen in der Umgebung oder auf Reisen in der Ferne: Wer gemeinsam aufbricht, stärkt nicht nur das Familienband, sondern schafft auch besondere Erinnerungen. Der Wert des gemeinsamen Unterwegsseins Gemeinsame Ausflüge ausserhalb der gewohnten Umgebung eröffnen neue Perspektiven – nicht nur auf die Welt, sondern auch aufeinander. Für Kinder bedeutet das gemeinsame Unterwegssein oft Abenteuer, für Erwachsene eine Gelegenheit, die Familie abseits des Alltags neu zu erleben und neue Seiten voneinander zu entdecken. Dabei geht es weniger um das Ziel als um das gemeinsame Erleben: Gespräche entstehen beiläufig, gemeinsames Staunen fördert Nähe und kleine Erlebnisse werden zu gemeinsamen Geschichten.
Tipps für Familienausflüge
1. Planung mit Augenmass – Ein Ausflug muss nicht aufwendig sein. Oft reichen ein paar Stunden, ein Ziel mit Abwechslung und etwas Proviant. Wichtig ist, dass alle Bedürfnisse der Familienmitglieder berücksichtigt werden –sowohl Bewegungsdrang als auch Ruhepausen. Wer den Tag nicht zu eng taktet, schafft mehr Raum für Spontaneität und vermeidet unnötigen Stress.
2. Kleine Abenteuer – Es ist nicht immer nötig, lange Reisen oder komplexe Tagespläne zu gestalten. Ein Spaziergang in der Natur, eine Schatzsuche oder ein Besuch auf dem Flohmarkt können ebenso bereichern. Die gemeinsame Aktivität steht im Vordergrund –nicht die spektakuläre Kulisse.
3. Beteiligung schafft Motivation – Wenn alle Altersgruppen mitentscheiden dürfen, steigt die Vorfreude aller. Eine Ideensammlung, bei der auch jüngere Familienmitglieder ihre Wünsche äussern, kann helfen, Ziele zu finden, mit denen sich die ganze Familie identifizieren kann. Dabei geht es weniger um Demokratie im klassischen Sinn, sondern um das Signal: Alle gehören dazu.
4. Pausen und Verpflegung – Essen verbindet auch unterwegs. Ein gemeinsames Picknick, eine Pause mit Aussicht auf die Berge oder ein warmer Kakao auf der Bank können zum Highlight des Tages werden. Ausreichende Verpflegung trägt zur Stimmung bei, vor allem bei jüngeren Familienmitgliedern.
5. Der Einsatz von Technik – Digitale Geräte sind im Alltag allgegenwärtig – Ausflüge können eine Gelegenheit sein, sie bewusst einmal zur Seite zu legen. Wer fotografiert, kann das gezielt tun – etwa für das gemeinsame Familienalbum. Der Fokus aber sollte auf dem Miteinander liegen und nicht auf dem Bildschirm.
Rituale im Familienalltag Viele Familien entwickeln mit der Zeit feste Rituale: einen regelmässigen Sonntagsspaziergang, einen Ausflugstag pro Monat oder ein jährliches Familienwochenende an einem bestimmten Ort. Solche Wiederholungen geben Halt, stärken die Identifikation und schaffen gemeinsame Vorfreude.
Gerade in herausfordernden Phasen können sie ein wertvoller Fixpunkt sein, an dem sich alle orientieren. Sie vermitteln Kontinuität, Verlässlichkeit und das beruhigende Gefühl, Teil eines stabilen Ganzen zu sein. Begegnung auf Augenhöhe
Durch das Unterwegssein begegnen sich Familienmitglieder oft auf andere Weise als im Alltag. Rollen und Gewohnheiten treten in den Hintergrund, während gemeinsame Entdeckungen oder kleine Herausforderungen zusammenschweissen. Ob auf dem Wanderweg, in der Stadt oder beim Ausflug in den Zoo: Das Erleben im Moment schafft eine engere Bindung. Dabei muss nicht alles reibungslos verlaufen.
Auch Unvorhergesehenes – ein falsch gesendetes Navi-Signal, ein Wetterumschwung oder eine spontane Planänderung können zum Teil einer gemeinsamen Erfahrung werden. Oft sind es gerade diese Situationen, die in Erinnerung bleiben.
Ein langfristiges Fundament
Was auf den ersten Blick wie ein einfacher Ausflug wirkt, kann auf lange Sicht einen bedeutenden Einfluss haben. Gemeinsame Erlebnisse wirken über den Moment hinaus – sie fördern nicht nur das Miteinander, sondern stärken emotionale Bindungen und die psychische Widerstandskraft von Kindern. Studien

Herzlich willkommen im 5-Sterne Campofelice Camping Village in Tenero, direkt am Ufer des Lago Maggiore.
Geniessen Sie mit Ihrer Familie die wunderschöne Parkanlage und den langen Privatstrand, relaxen Sie im beheizten Pool, paddeln Sie auf dem See oder machen Sie Ausflüge nach Locarno und Ascona oder in die Täler. Kids erwartet ein riesiger Spielplatz und ein tolles Animationsprogramm! Ob auf dem Campingplatz, im klimatisierten Bungalow oder in unserem frisch renovierten Hotel – im Campofelice erleben Sie traumhafte Ferien im Herzen der Sonnenstube.
27.2.-10.11.2025
zeigen: Kinder, die regelmässig Zeit mit ihren Familien verbringen, entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl, soziale Kompetenzen und mehr Selbstvertrauen. Nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter bleiben viele dieser Erinnerungen lebendig. Ein bestimmter Duft oder alte Familienfotos können Erlebnisse aus der Kindheit wachrufen und oft sind es gerade die kleinen Momente, die besonders im Gedächtnis bleiben. Das gemeinsame Lachen, der Regen beim Picknick, der ungeplante Umweg, der zur schönsten Entdeckung führte. Darüber hinaus hat gemeinsames Unterwegssein auch eine bildungsfördernde Komponente: Kinder lernen nicht nur durch Worte, sondern durch Tun, Beobachten und aktives Mitgestalten. Wer mit der Familie gemeinsam wandert, Karten liest oder Tiere im Zoo beobachtet, verknüpft Lernen mit positiven Erfahrungen und entwickelt oft ein nachhaltiges Interesse an der Welt. Nähe durch gemeinsames Erleben Mit der Familie unterwegs zu sein ist mehr als ein Zeitvertreib – sie ist eine Investition in Beziehungen. Sie fördert Verständnis, stärkt das Gefühl der Gemeinsamkeit und schafft eine gemeinsame Erlebniswelt, auf die man später gern zurückblickt. In einer zunehmend beschleunigten Welt ist es umso wichtiger, Inseln des Miteinanders zu schaffen – sei es durch kleine Ausflüge, Sonntagsspaziergänge oder besondere Reisen. Wer gemeinsam unterwegs ist, entdeckt nicht nur neue Orte, sondern auch ein Stück weit sich selbst und vor allem: einander.
Text Aaliyah Daidi




Wenn das Tal im Westen Österreichs in zartem Grün erblüht, beginnt im Brandnertal die schönste Zeit für Familien.
Dann wird der Berg zur Bühne für gemeinsame Abenteuer, zum Rückzugsort in der Natur und zum Erlebnisraum mit bleibenden Eindrücken. Zwischen Bergwiesen, Themenwegen und Panoramaausblicken vereint das Brandnertal alles, was eine gelungene Auszeit für Gross und Klein ausmacht.
Mit Leichtigkeit nach oben –mit Neugier durchs Tal
Die Bergbahnen Brandnertal machen das Naturerlebnis komfortabel und familienfreundlich. Ob mit der Dorfbahn, der Panoramabahn, der Palüdbahn oder der Loischkopfbahn (Juni–August) – wer ins Tal kommt, schwebt mühelos ins alpine Sommerparadies. Oben angekommen, eröffnet sich ein Wegenetz mit mehr als 190 Kilometern – vom kurzen Naturspaziergang bis zur aussichtsreichen Gipfeltour.
Drei Themenwege für neugierige
Entdecker:innen
Ein besonderes Highlight für Familien sind die drei eigens gestalteten Themenwege, die das Wandern zu einem echten Erlebnis machen: – Der Natursprünge-Weg – neu gestaltet und voller Geheimnisse:
An elf Stationen geht es mit Brandolin, dem schlauen Fuchskind, auf eine abenteuerliche Rätselreise durch die Natur. Mit dem AmulettPass, erhältlich an der Talstation der Dorfbahn, lösen Kinder spannende Aufgaben, um das
Zwischen Bergwiesen, Themenwegen und Panoramaausblicken vereint das Brandnertal alles, was eine gelungene Auszeit für Gross und Klein ausmacht.
zerbrochene Glücks-Amulett zu vervollständigen. Das interaktive Konzept verbindet Spiel, Bewegung und Wissen auf liebevolle Weise – und begeistert sowohl Kinder als auch Erwachsene.
– Der Tierwelten-Weg – auf leisen Pfoten durch die Alpen:
Von der Palüdbahn-Bergstation über den Niggenkopf bis zur Inneren Parpfienzalpe entdecken Familien die Welt von Murmeltier, Steinbock und Co. Auch hier ist Brandolin mit dabei – und versorgt die kleinen Forscher:innen mit einem liebevoll gestalteten Mal- und Rätselbuch, das seit letztem Sommer erhältlich ist.
– Der Barfuss-Weg – Natur mit allen Sinnen erleben: Ohne Schuhe geht es über weichen Waldboden, durch Wiesen und frisches Quellwasser. Der Weg von der Dorfbahn-Bergstation bis zur Alp bietet

ein sinnliches Erlebnis für die ganze Familie –erdend, erfrischend und überraschend intensiv.
Das Abenteuer auf zwei Rädern
Der Bikepark Brandnertal zählt zu den vielseitigsten seiner Art und bietet Fahrspass für alle Levels – von flowigen Trails bis zu anspruchsvollen Downhill-Strecken. Aufgrund der Bauarbeiten für die neue Loischkopfbahn gibt es diesen Sommer ein angepasstes Angebot. Der Zugang erfolgt über Brand, aktuelle Infos zu Strecken und Öffnungszeiten gibt es online. Für die Zukunft ist ein Kinderbikepark mit Förderband geplant – er wird ab dem nächsten Sommer Teil des Angebots sein.
Kulinarische Pausen mit Weitblick
Bewegung an der frischen Luft macht hungrig – im Brandnertal warten zahlreiche Einkehrmöglichkeiten mit regionaler Küche, herzhafter Hüttenkost und süssen Spezialitäten. Besonders beliebt bei Familien ist das Bergfrühstück – angeboten in mehreren Hütten im Wandergebiet, jeweils mit ganz eigenem Charme und kulinarischem Stil. Ob auf der Sonnenterrasse mit Panoramablick oder im gemütlichen Alpbetrieb – Genussmomente sind garantiert.
Viele Produkte stammen direkt von Bauernhöfen der Region – man schmeckt die alpine Qualität und das Bewusstsein für Regionalität in jedem Bissen.
Ein Tal im Wandel – mit Blick auf die Zukunft
Das Brandnertal setzt auf nachhaltige Entwicklung: Mit der neuen Loischkopfbahn, die ab der Wintersaison 2025/26 in Betrieb geht, entsteht eine moderne Zehner-Gondelbahn, die in nur acht Minuten von der Tschengla auf den Loischkopf führt. Die neue Bahn ersetzt veraltete Sessellifte, erhöht den Komfort und unterstützt eine ganzjährige Erschliessung – mit Rücksicht auf Umwelt und Region.
Ein Sommer für alle Sinne
Das Brandnertal ist mehr als ein Urlaubsziel – es ist ein Ort, an dem Familien gemeinsam wachsen, lachen und staunen. Ob beim Rätselwandern mit Brandolin, beim Barfusslaufen im Morgentau oder beim gemeinsamen Frühstück mit Bergblick: Die Mischung aus Natur,

Erlebnis und regionalem Genuss macht den Sommer im Brandnertal zu einer Familienzeit, die bleibt.
Weitere Informationen unter: brandnertal.at
Sommer 2025 im Brandnertal
Sommerbetrieb: – 9.–18. Mai: Wochenendbetrieb (Fr–So) – 23. Mai bis 2. November: täglicher Betrieb, jeweils 09:00–16:45 Uhr
Bergbahnen: Dorfbahn, Panoramabahn, Palüdbahn, Loischkopfbahn (16.06.–24.08.)
Themenwege für Familien:
– Natursprünge-Weg mit Amulett-Pass – Tierwelten-Weg mit Mal- und Rätselheft
Barfuss-Weg – für alle Sinne
Bikepark Brandnertal: – Sonderöffnungszeiten, aktueller Zugang über Brand
Kulinarik: – Sieben Restaurants und Hütten – Bergfrühstück in Frööd, Palüdhütte und Melkboden
Highlights: – interaktive Naturerlebnisse – komfortabler Aufstieg für die ganze Familie – regionale Küche und entspannte Atmosphäre
Die Ferienregion Viamala begeistert mit eindrücklichen Landschaften und vielfältigen Sommeraktivitäten. Ob auf steilen Pfaden durch wilde Schluchten, auf aussichtsreichen Gipfeln oder actionreichen Bike-Trails – hier kommen Natur- und Sportbegeisterte voll auf ihre Kosten.
Wandern – wo Wege Geschichten erzählen Wandern in der Viamala ist mehr als nur Bewegung – es ist eine Reise durch Geschichte und Natur. Die beeindruckende Viamala-Schlucht, die historische viaSpluga oder das abgeschiedene Averstal bieten einzigartige Erlebnisse. Von gemütlichen Spazierwegen bis zu anspruchsvollen Bergtouren gibt es für jedes Niveau die passende Route. Unterwegs laden urige Berggasthäuser zur Rast ein. Wer sich für Geschichte interessiert, entdeckt Spuren vergangener Zeiten – von alten Säumerwegen bis hin zu historischen Brücken, die einst wichtige Handelsrouten verbanden.

Biken – Flow, Panorama und Action Auch auf zwei Rädern bietet die Region unvergessliche Erlebnisse. Flowige Trails, rasante Abfahrten und entspannte Touren machen das Biken in der Viamala besonders abwechslungsreich. Die

Gegend rund um Thusis lockt mit anspruchsvollen Trails, während gemütlichere Routen durch das Schams oder Avers führen – stets begleitet von einem beeindruckenden Alpenpanorama. Zahlreiche Verleihstationen sorgen dafür, dass auch spontane Bike-Abenteuer jederzeit möglich sind.
Sommer in der Viamala Ob Wandern oder Biken – die Viamala verbindet Natur, Abenteuer und Erholung. Spektakuläre Landschaften, geschichtsträchtige Wege und sportliche Herausforderungen warten darauf, entdeckt zu werden. Nach einem aktiven Tag laden gemütliche Unterkünfte und regionale Spezialitäten zum Entspannen und Geniessen ein.
Bilder demateo.com und Ma.Fia.Photography viamala.ch

Im Kulturama entdecken Gross und Klein die Wissenschaft rund um den Menschen verständlich und erlebnisorientiert.
Wie hat sich das Leben auf der Erde entwickelt? Was ist ein Mensch? Wie lernen wir Menschen? Das Kulturama ist ein interessantes Museum in Zürich. Hier wird Wissen erlebnisorientiert und kreativ durch Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen vermittelt.
Fossilien und die Entwicklung des Lebens Echte Fossilien und detailgetreue Rekonstruktionen geben faszinierende Einblicke in die Entwicklung des Lebens. Das menschliche Leben – von der Zeugung bis zum Tod – wird anschaulich dargestellt. Ein interaktiver Erlebnispfad lädt ein, den menschlichen Körper zu erforschen und Wissen spielerisch zu vertiefen.
KULTURAMA Museum des Menschen
Englischviertelstrasse 9
CH-8032 Zürich
+41 44 260 60 44
mail@kulturama.ch

Wie Lernen funktioniert
Die Ausstellung «Wie wir lernen» (Sa / So geöffnet) bietet spannende wissenschaftliche Erkenntnisse und überraschende Fakten rund um das menschliche Lernen.
Leben wie in der Steinzeit Im «Erlebnisraum Steinzeit» erleben Besuchende hautnah, wie unsere Vorfahren lebten. Dabei können sie selbst aktiv werden und alte handwerkliche Techniken ausprobieren.
Öffnungszeiten: Di / Do / Fr, 13–17 Uhr Mi, 13–20 Uhr Sa / So, 13–18 Uhr Vormittags und abends für Gruppen mit Führung n. V.
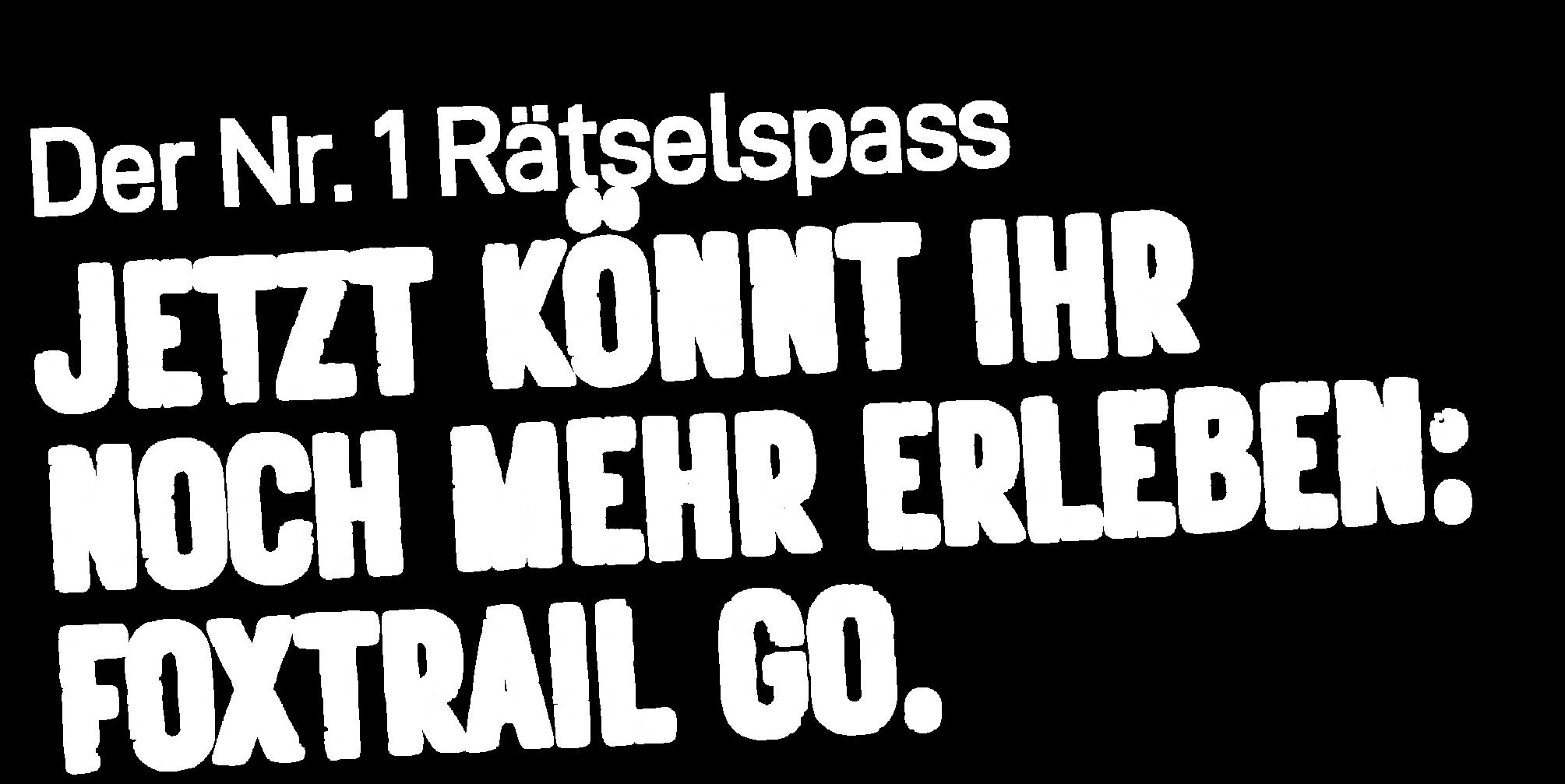
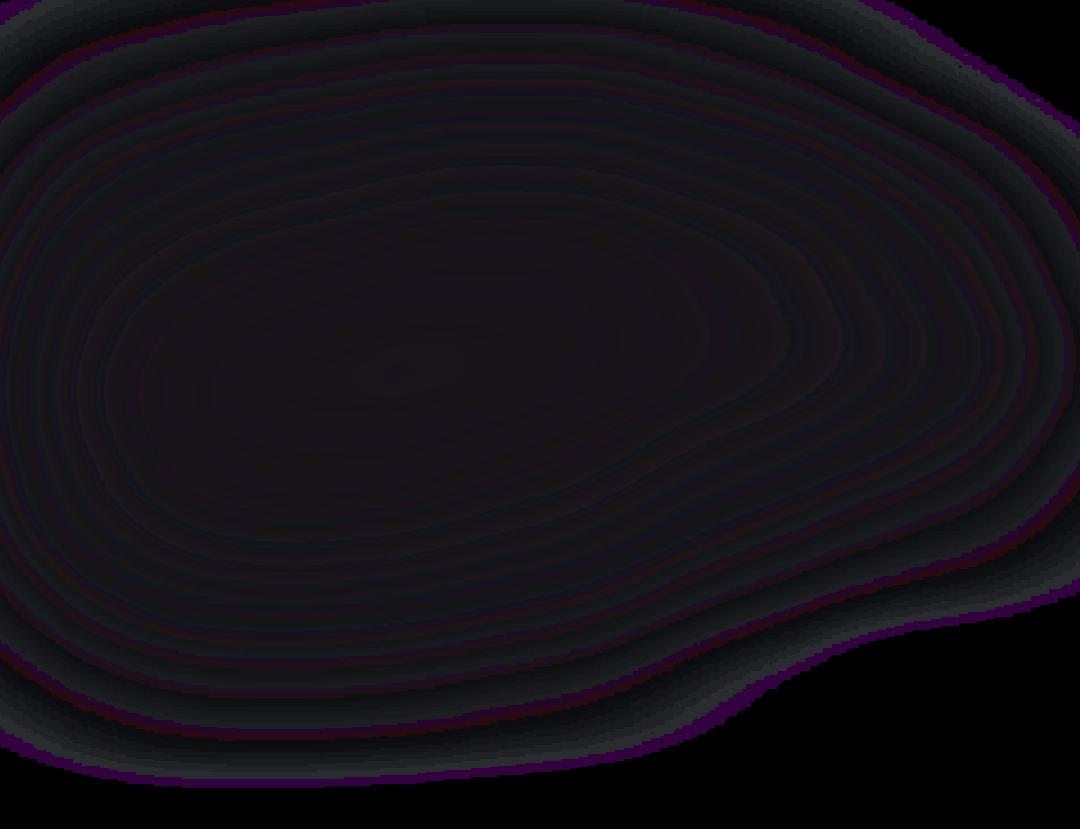
APP SOFORT ERHÄLTLICH:
Knifflige Rätsel, spannende Entdeckungen - das ultimative Outdoor-Erlebnis. Einfach starten, ohne Voranmeldung! go.foxtrail.ch


Erste Zähne, grosse Verantwortung:
So pflegen Sie die ersten Zähne Ihres Kindes richtig!
Der erste Milchzahn ist ein wichtiger Meilenstein im Leben Ihres Kindes –und der Startschuss für eine regelmässige Zahnpflege. Obwohl Milchzähne vorübergehend sind, sind sie entscheidend für die gesunde Entwicklung von Sprache, Kiefer und bleibenden Zähnen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Zähne Ihres Kindes richtig pflegen und gesunde Gewohnheiten für das Leben etablieren.
Zahnpflege ab dem ersten Milchzahn bis zum 2. Geburtstag Zwischen dem 6. und 8. Monat erscheint der erste Milchzahn im Unterkiefer. Insgesamt wachsen 20 Milchzähne. Diese sind Platzhalter für die bleibenden Zähne und unterstützen die Sprachentwicklung. Ab dem Durchbruch des ersten Zahns sollten Eltern mindestens einmal täglich die Zähne des Kindes mit einer weichen Babyzahnbürste und einer milden Kinderzahnpasta putzen. Wir empfehlen eine erbsengrosse Menge von etwa 250 mg Zahnpasta mit einer Fluoridkonzentration von 500 ppm oder 2-mal täglich eine reiskorngrosse Menge bei höherer Fluoridkonzentration.
Integrieren Sie die Zahnpflege in das Abendritual nach dem Stillen oder Schoppen. Vermeiden Sie es, dem Kind nach der Zahnpflege Milch zu geben, da sie Zucker enthält, der Karies fördert. Statt des Daumens sollte ein kieferfreundlicher Nuggi verwendet werden. Spätestens mit drei Jahren sollte das Nuckeln eingestellt werden.
Besuchen Sie den Zahnarzt zum ersten Mal zwischen dem 18. und 24. Monat, um mögliche Zahnprobleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Zahnpflege ab dem 2. Geburtstag Mit etwa zwei Jahren sind die motorischen Fähigkeiten des Kindes so weit entwickelt, dass es spielerisch an die selbstständige Zahnpflege herangeführt werden kann. Führen Sie das Zähneputzen als gemeinsames Ritual durch und motivieren Sie Ihr Kind mit einem Zahnputzlied oder einer Zahnputzuhr.
Mit etwa zweieinhalb Jahren hat Ihr Kind ein vollständiges Milchgebiss. Ein gesundes Milchgebiss ist die Basis für ein gesundes bleibendes Gebiss. Denn gehen Milchzähne durch Karies früh verloren, wachsen die bleibenden Zähne schief nach.
Achten Sie darauf, die Milchzähne zweimal täglich zu putzen – morgens und abends vor dem Schlafengehen. Bei einer Fluoridkonzentration von 500 ppm verwenden Sie etwa eine Bürstenlänge (250–500 mg) Zahnpasta, bei 1000 ppm eine erbsengrosse Menge (rund 250 mg).
Folgen Sie @aktionzahnfreundlich_ch auf Instagram für zahnfreundliche Rezepte, Tipps & Tricks für ein strahlendes Lächeln und vieles mehr.

Aktion Zahnfreundlich Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Mundgesundheit in der Schweiz einsetzt. Der Verein fördert und unterstützt Initiativen rund um die Mundgesundheit. Dazu gehören unter anderem die Förderung von zahnfreundlichem Ernährungsverhalten oder die Vermittlung der richtigen Mundhygiene. Ein zentrale Aufgabe ist die Auslobung zahnfreundlicher Produkte mit dem bekannten Zahnmännchen. Diese Garantiemarke dient als Wegweiser für zahnfreundliches Verhalten und zeichnet Produkte aus, die nach einem weltweit anerkannten wissenschaftlichen Test als zahnfreundlich bestätigt wurden. Mit dem sympathischen Zahnmännchen können sowohl Kinder als auch Erwachsene auf einen Blick erkennen, welche Produkte gut für ihre Zähne sind – ganz ohne die Zutatenliste studieren zu müssen. Für eine bessere Mundgesundheit!
Das Schweizer Schulsystem ist im weltweiten Vergleich sicherlich eines der besseren. Das bedeutet aber keineswegs, dass es erfolgreich ist oder kein Verbesserungspotenzial besteht. Im Gegenteil, hierzulande lauert sogar das Risiko, dass wir an einem mässig guten System festhalten, statt mit Mut und Zuversicht das Ganze neu anschauen. Wie genau solch ein innovatives und zukunftsfähiges System aussehen könnte, erklären Schulgründer Diego De Nicola und Technologie-Experte Roberto Honegger.


Diego De Nicola, wie kamen Sie auf die Idee, eine eigene Schule zu gründen? Das war ursprünglich gar nicht meine Anfangsidee. Mir wurden früh die dringlichen Probleme des heutigen Bildungssystems bewusst und ich erkannte Potenzial für Veränderung. Das ist nicht überraschend, schliesslich musste sich fast jede Branche in den letzten 10 bis 20 Jahren neu erfinden. Warum also sollte dieser Veränderungsdruck ausgerechnet vor dem Schulwesen Halt machen? Das Schulsystem zu revolutionieren, wurde zu meiner Vision. Wenn man sich vor Augen führt, wie wichtig die schulischen Grundlagen für unsere Gesellschaft sind, erscheint mir die fehlende Dynamik in diesem Sektor unverständlich. Doch leider ist es politisch schwierig, umfassenden Wandel ins Schulwesen zu bringen. Darum wollte ich mit der «School of Tomorrow» aufzeigen, dass es eben doch möglich ist. Und wer weiss: Wenn in zehn Jahren unsere Methode den neuen Standard darstellt und es uns nicht mehr braucht, wäre das ein grosser Erfolg!
Bevor wir darauf eingehen, wie diese Methode im Detail aussieht, lassen Sie uns über Probleme des hiesigen Schulwesens sprechen. Wo verorten Sie diese?
Die Institution «Schule» hat in ihrer Geschichte verschiedene Rollen eingenommen und sich von der Zeit der alten Römer über die Epoche der Industrialisierung bis in die Neuzeit gewandelt. Bis zum Internetzeitalter hatte die Schule die Funktion inne, eine Quelle des Wissens zu sein. Frontalunterricht, Repetition und Auswendig-Lernen waren fixe Ankerpunkte. Diese waren essenzielle Fähigkeiten, denn Wissen war nicht überall und einfach zugänglich. Doch mit der digitalen Revolution hat die Schule ihre Stellung als zentrale Stätte des Wissens eingebüsst: Wir haben heute mehr Informationen in der Hosentasche, als der Nasa bei der Mondlandung zur Verfügung stand! Es ist deshalb offensichtlich, dass neue Kompetenzen gefragt sind. Doch leider beharrt das System dennoch oftmals auf überholten Ideen, während immer wichtiger werdende Fähigkeiten wie Social Skills, Mindset, Kreativität oder Selbstwirksamkeit noch in den Anfängen stecken.
Das heutige Bildungssystem ist also nicht mehr zeitgemäss? Wir sehen, dass der heute vorherrschende Unterricht aufgrund seiner Starrheit für viele Kinder unpassend ist und sie oftmals schlecht auf die Zukunft vorbereitet – sogar
bei Kindern, welche gut in der Schule sind. Jedes Jahr leiden mehr und mehr Kinder an Unter- oder Überforderung. Denn bedauerlicherweise passt sich die Schule nicht den Bedürfnissen der Kinder an. Vielmehr wird ihnen abverlangt, ihre Bedürfnisse denjenigen der Schule unterzuordnen. Wenn dies aber ein Kind nicht tut oder tun kann, fällt es oft aus diesem Raster. In diesem Sinne: Ja, das Bildungssystem ist nicht zeitgemäss. Und wichtig: Wir müssen akademischen Erfolg und wahre Vorbereitung auf die Zukunft als zwei unterschiedliche Bereiche anschauen. Kinder, die akademisch den Anschluss verlieren, haben generell wenig Chancen, sogar wenn sie in einem spezifischen Bereich wie Musik, Kunst, Handwerk sehr gut sind. Aber auch Kinder, die akademisch stark sind, leider oft später an der mangelnden Vorbereitung, die sie von der Schule fürs Leben erhalten haben.
Wie handhaben Sie diese Problematik an der School of Tomorrow?
Wir rücken die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Kernkompetenzen wie Eigenverantwortung, Kommunikation, Leadership, Sozialkompetenz, Empathie, Resilienz, Selbstbewusstsein, analytisches Denken und kreatives Handeln bilden das Gerüst und fungieren als solide Basis für die Zukunft. Wir arbeiten stärken- und interessenbasiert. Konkret heisst dies, das Kind lernt schon sehr früh «sich selbst» zu erkennen. Wir haben hierfür eine Methode entwickelt und ein Umfeld geschaffen, welches das Kind ins Zentrum rückt und trotzdem den aktuellen Lehrplan 21 erfüllt –sogar weit über dessen Anforderungen hinausgeht. Die School of Tomorrow ist eine Tagesschule, bietet flexible Start- und Endzeiten, eine Viertagewoche mit optionalem Freitag und sogar Ferien können frei gewählt werden. In altersgemischten Klassen wird zweisprachig in Deutsch und Englisch gearbeitet und personalisierte Lehrpläne für jedes Kind erstellt – denn jedes Kind ist einzigartig. Damit wollen wir nicht nur den veränderten Lerngewohnheiten Rechnung tragen, sondern auch den neuen Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt.
Wie spielen Arbeits- und Schulwelt denn zusammen?
Sie sind äusserst eng miteinander verwoben. Noch heute benötigt man für viele Berufe einen bestimmten Abschluss – ohne diesen hat man keine Chance auf eine Stelle, auch wenn man sich die nötigen Skills anderweitig angeeignet hat. Ich gehe fest davon aus, dass sich dies in Zukunft ändern wird und es viele andere Möglichkeiten geben wird – sowohl für den Einstieg in einen neuen Job wie auch um ein Studium absolvieren zu dürfen. Aktuell wirkt sich der Druck aber bis auf das Primarschulniveau aus. Kinder und Familien leiden oft schon sehr früh. Man muss sich daher fragen, worin der wahre Sinn der Schule besteht und ob wir sie in dieser Form in Zukunft noch benötigen. Persönlich finde ich, dass Schulen definitiv ihre Berechtigung haben, sogar an Wichtigkeit zunehmen. Ihre Aufgaben, Strukturen und Funktionen müssen jedoch neu definiert werden. Soziale Interaktion, Individualität und Kreativität müssen mehr Raum erhalten. Die Schule sollte ein Teil der Gesellschaft sein und der Unterricht muss die Verbindung zur realen Welt besser widerspiegeln.
Bei Übertritten in Studium und Arbeitswelt macht sich unter den Schülern oft Überforderung breit, weil sie nun selbstverantwortlich und freier sind. Das überrascht nicht, das Gleiche stellt man oft auch beim
Wechsel von der Universität in einen Beruf fest. Denn während der Schulzeit hat man selten die Möglichkeit, die individuellen Stärken, Schwächen sowie die eigenen Interessen in der Tiefe zu erforschen. Das ist prekär, denn heutzutage sind die Möglichkeiten so umfassend und unübersichtlich, dass man zwingend Zeit aufbringen sollte, um sich selbst besser kennenzulernen. Zusätzlich kommt dazu, dass viele Berufe, welche die Kinder morgen ausüben werden, heute noch gar nicht existieren. Somit sollten wir die Schule bewusst nicht lediglich darauf ausrichten, der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden – und definitiv nicht, wie so oft, auf die von gestern – sondern effektiv auf die rasant eintreffende Zukunft vorbereiten. Also müssen wir Agilität fördern? Ohne Zweifel. Man geht aktuell davon aus, dass die neuen Generationen in ihrem Berufsleben drei bis vier berufliche Neuorientierungen vollziehen werden, oftmals sogar einen oder mehrere komplette Branchenwechsel. Deshalb finde ich persönlich, dass das Mindset die Basis für eine erfolgreiche und erfüllte Zukunft darstellt. In der School of Tomorrow setzen wir den Hauptfokus genau darauf: Die Entwicklung des Mindsets und einer starken Persönlichkeit. «Fixed Mindset» versus «Growth Mindset» ist zum Beispiel einer dieser wichtigen Eckpfeiler. Erachte ich meine Talente als feste, unveränderbare Eigenschaften? Oder bin ich der Überzeugung, dass ich mich durch Effort in alles Mögliche einarbeiten und damit wachsen kann? Dieses Wachstumsdenken gehört zur neuen Schule, wie ich sie sehe.
Welche etablierten Strukturen gilt es hierfür primär zu überdenken? Da gibt es viele… Um ein einfaches Beispiel zu nennen, würde ich die festgelegte 45-Minuten-Lektion abschaffen. Diese stammt noch aus dem preussischen Schulsystem. Sie war damals anscheinend eingeführt worden, weil sie lange genug ist, um zu indoktrinieren, aber zu kurz, um Möglichkeiten zur tieferen Hinterfragung zu ermöglichen. Es ist ein Mythos, dass man sich nur 45 Minuten lang konzentrieren kann. Wir alle wissen, dass 45 Minuten eine Ewigkeit sind, wenn uns etwas nicht interessiert. Andererseits können wir uns – und Kinder erst recht – stundenlang in eine Materie vertiefen, wenn das Interesse geweckt wurde. Ferner würden Kinder von einer Altersdurchmischung profitieren, indem sie untereinander lernen und lehren. Zudem ist die Benotung von Fächern meines Erachtens ineffizient und bis zu einem gewissen Alter unnötig. Ein Bewertungssystem muss natürlich bestehen, aber kompetenzbasiertes Messen ist hier viel zielführender. So sieht man genau, bei welchen Lücken es anzusetzen gilt und wo Talente oder spezielle Begabungen und Interessen bestehen.
Ein anderer wichtiger Grundsatz, den es meines Erachtens zu revolutionieren gilt, ist das traditionelle und lineare Lernmodell. Erstens ist es für die meisten Fächer und Bereiche (ausser vielleicht Mathe oder gewisse Wissenschaften) absolut unwichtig, in welcher Reihenfolge Wissen erforscht wird. Und zweitens, noch wichtiger, ist im traditionellen System die verfügbare Zeit für ein Thema fix für die ganze Klasse vorgegeben, das Know-how variiert aber massiv. Im Gegensatz dazu ist mit «Mastery Learning», was auch an der School of Tomorrow gelebt wird, die Zeit variabel, jedoch das Lernresultat fix. Konkret heisst dies, im traditionellen Setting erhalten z. B. alle Kinder einen Monat Zeit, um Bruchrechnen zu lernen. Dabei haben Gewisse dies nach einem Tag verstanden und langweilen sich. Andere haben nach
30 Tagen erst angefangen, das Ganze zu verstehen. Mit Mastery Learning individualisiert man die Zeit, stellt aber auch sicher, dass jedes Kind dranbleibt, bis die Materie verstanden wurde. Erst dann gehts weiter. Und auch wenn dies teils länger dauern kann, stellen wir so sicher, dass eine wirklich solide Basis fürs weitere Lernen gegeben ist. Das hört sich super an, tönt jedoch auch nach mehr Komplexität. Kann da Technologie aushelfen? Moderne Technologie gilt ja heutzutage als ein zentraler Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Roberto Honegger, wie beeinflusst diese unsere heutige Gesellschaft? Unser Alltag hat sich durch Technologien wie KI rasant verändert und sie sind kaum mehr wegzudenken. Diese Entwicklungen sind Chancen, die genutzt werden sollten. Unabhängig vom eigenen Wissensstand wird es unabdingbar sein, mit technologischen Hilfsmitteln umgehen zu können. Das bedeutet, dass immer häufiger Arbeitnehmende sich kontinuierlich neu erfinden und praktisch ad hoc Fähigkeiten erwerben müssen. Aus diesem Grund vermitteln wir den Kindern in der «School of Tomorrow» genau dieses «Growth Mindset» und setzen sie den neuesten technologischen Trends aus, um sie darauf vorzubereiten.
Und inwiefern verändert die Technologie die Anforderungen, aber auch die Möglichkeiten an Schulen?
Bildungseinrichtungen müssen sich an die Entwicklungen anpassen und agil bleiben. Die Schülerinnen und Schüler profitieren heute von einer Vielzahl an Informationen und haben auf Knopfdruck Zugang zu Expertenwissen. Diese Entwicklung ist eine enorme Chance, um mehr Gerechtigkeit, Zugänglichkeit und Chancengleichheit zu schaffen. Gleichzeitig kann sie Lehrpersonen massiv unterstützen und entlasten. Dennoch stehen sowohl Schüler und Schülerinnen als auch Erwachsene vor der Herausforderung, diese Informationsflut effektiv, sinnvoll und gewinnbringend zu nutzen. Diese Flut birgt insbesondere Gefahren, wenn man sich ihrer nicht bewusst ist. Als «School of Tomorrow» setzen wir uns daher stets für eine zweckbasierte Verwendung von Technologie ein. Diese Sensibilisierung für den bewussten Umgang mit digitalen Medien stellt grundsätzlich eine neue Herausforderung für Schulen dar. Wir verwenden moderne Apps, Software und Technologien gezielt dann, wenn sie ein persönliches Wachstum fördern –schliesslich braucht man den Hammer auch nur, wenn man einen Nagel in die Wand schlagen will.
Unser Ziel ist es daher, Kindern die Fähigkeit des kritischen Denkens zu vermitteln, damit sie sich als reflektierte Individuen in diesem digitalen Dschungel zurechtfinden können.
So können wir gewährleisten, dass Kinder den Anforderungen von morgen gewachsen sind.
Weitere Informationen unter: schooloftomorrow.ch
Kindergarten, Primar, Sek & Gymi
Kindergarten, Primary, Middle & High School
Zweisprachig Deutsch & Englisch
Bilingual German & English
Tagesschule inkl. Essen
Day school incl. meals
Altersdurchmischt & projektbasiert
Mixed-ages & project based Personalisierter Lehrplan
Personalized curriculum
Persönlichkeitsentwicklung
4-Tage-Woche (Freitag optional)
4-day-week (optional Friday)
Anerkannt vom Kanton ZH
Recognized by the Canton ZH

Sponsored

Jetzt öffnen sich die Blüten, es summt und brummt. Mit dem Erwachen der Natur startet auch die Arbeit der Wild- und Honigbienen. Sie fliegen von Blüte zu Blüte, bestäuben, was uns ernährt und tragen zu einer intakten Natur bei. Doch was im Frühling noch im Überfluss vorhanden ist, wird im Sommer knapp: Viele Pflanzen verblühen, Äcker und Wiesen werden kahl. Für Bienen entsteht eine «grüne Wüste», in der sie kaum Nahrung und Lebensräume finden. Besonders Wildbienen leiden unter dem Schwund geeigneter Lebensräume: Rund die Hälfte steht auf der Roten Liste und gilt als bedroht, 59 der über 600 Arten sind bereits ausgestorben.
BienenSchweiz wirkt dem aktiv entgegen. Mit dem Blühflächenprogramm entstehen neue Lebensräume wie Blumenwiesen und Hecken, die Nahrung und Nistplätze bieten und so die Bienen durch die Saison tragen. Das Blühflächenprogramm ist auf Spenden und auf die Finanzierung durch Unternehmen angewiesen. Mehr als eine Million Quadratmeter konnten bereits aufblühen – dank spendender Menschen.
Mit Spenden schafft die Stiftung für die Bienen neue blühende Oasen in der Schweiz. Im Auftrag der Stiftung berät und unterstützt BienenSchweiz Landwirt:innen, Schulen, Gemeinden und Firmen. Schritt für Schritt sensibilisiert BienenSchweiz die Bevölkerung für die Bedeutung dieser kleinen Bestäuberinnen. Jeder Quadratmeter zählt. Jede Blüte hilft. Jeder Beitrag wirkt.
Erfahren Sie hier mehr und unterstützen Sie uns mit einer Spende an die Stiftung für die Bienen:


«
Ob ein Kind ein Theaterstück besucht, im Kindergarten ein Lied einstudiert oder mit der Schulklasse ein Museum erkundet – kulturelle Bildung findet an vielen Orten statt. Doch oft wird unterschätzt, wie essenziell diese Erlebnisse für die kindliche Entwicklung sind. Dabei ist klar: Kultur ist weit mehr als Freizeitbeschäftigung. Sie ist ein zentrales Element der Bildung – und eine Brücke zu einem tieferen Verständnis der Welt und deren Geschichte.
Wow! Mami, schau mal. So sah eine Küche früher aus!», ruft Sophie durch den Raum. Die Sechsjährige ist mit ihrer Familie im Schaudepot St. Katharinental unterwegs. Die vielen Originalobjekte aus dem 19. Jahrhundert faszinieren die Erstklässlerin. Vor allem, weil ihr Vater ihr erzählt, dass seine Grossmutter all diese Dinge nicht im Museum bestaunte, sondern im Alltag nutzte.
Ein Besuch im Museum ist nichts für Kinder – denken viele Eltern. «Ganz im Gegenteil!», betont Noemi Bearth. Sie ist Museumsdirektorin des Historischen Museums Thurgau und erlebt täglich, wie Kinder mit Neugier und Begeisterung durch die Ausstellungen an den beiden Museumsstandorten Schloss Frauenfeld oder im Schaudepot St. Katharinental gehen. «Sie entdecken die Welt mit allen Sinnen, ob im Rahmen eines Schulangebots oder mit der Familie», sagt sie. Und genau darum ist Kultur – von Musik, Literatur, Kunst, Theater bis eben zum Museumsbesuch – so bedeutsam. Sie bietet Raum für Kreativität und Wissensvermittlung, Ausdruck und emotionale Erfahrungen. «Kulturelle Bildung ist oft der erste und prägendste Zugang eines Kindes zur Welt», bekräftigt Bearth. Man denke nur ans Lieblingsbuch oder das Einschlaflied: Durch Geschichten, Bilder, Klänge und Bewegung begreifen Kinder nicht nur ihre Umwelt – sondern auch sich selbst.
Schon im frühen Alter zeigen sich positive Effekte. Studien belegen: Kinder, die regelmässig mit Musik, Kunst oder Theater in Berührung kommen, verfügen über ein ausgeprägteres Sprachvermögen, bessere soziale Kompetenzen und ein höheres Selbstbewusstsein. Die Unesco bezeichnet kulturelle Bildung sogar als eine der wichtigsten Grundlagen für nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe.
Raum für Fantasie und Empathie Ein Theaterstück, in dem Gut und Böse aufeinandertreffen, ein Bilderbuch, das eine andere Kultur zeigt, ein gemeinsames Lied, das Emotionen weckt oder eben Museumsobjekte, die Geschichte lebendig machen – all das regt die kindliche Fantasie an. Diese Fähigkeit zur Vorstellung ist weit mehr als Spielerei. Sie ist der Nährboden für Empathie, für das Verstehen von Perspektiven und Zusammenhängen, für Kreativität im Denken und Handeln. «Kulturelle Angebote schaffen Erfahrungsräume und Kinder lernen ihre eigene Geschichte zu verstehen», sagt Bearth und ergänzt: «Gerade in einer so schnelllebigen Welt, die zunehmend von Leistungsdruck geprägt ist, bietet Kultur eine selten gewordene Möglichkeit: eine Auszeit und unmittelbares Erleben.»
Kulturelle Formate ermöglichen es Kindern zudem, mit gesellschaftlich relevanten Themen in Berührung zu kommen – sei es Diversität, Umwelt oder Zusammenleben. Kultur vermittelt Werte – und stellt diese
Brandreport • Kantonale Verwaltung Frauenfeld

zugleich infrage. Diese Auseinandersetzung fördert ein kritisches Denken, das in keiner klassischen Schulstunde so lebensnah vermittelt werden kann.
Teilhabe ermöglichen –Gerechtigkeit schaffen
Doch nicht alle Kinder profitieren gleichermassen von kultureller Bildung. Der Zugang hängt oft auch vom sozialen Status der Familie ab. Kinder aus bildungsnahen Haushalten besuchen häufiger Museen, Theater oder Konzerte. Für andere bleibt Kultur ein abstrakter Begriff – und damit auch eine verpasste Chance. Umso wichtiger ist dann eben trotzdem die Rolle der Schule. Der Kanton Zürich etwa sieht in ihr den zentralen Ort kultureller Teilhabe. Mit der Fachstelle Schule+Kultur wurde ein Angebot geschaffen, das Lehrpersonen aller Stufen bei der Kulturvermittlung unterstützt. Auch Programme wie MUSE-E, das künstlerische Aktivität mit Bildung kombiniert, oder die KulturLegi, die Kindern aus armutsbetroffenen Familien vergünstigten Zugang zu Kulturangeboten bietet, setzen hier an. Es gibt Ansätze, diese Hürden zu verringern und niederschwelligen Zugang zu Kultur zu ermöglichen. So bieten manche Gemeinden Kulturangebote direkt in Quartierzentren oder Bibliotheken an – leicht erreichbar und ohne Eintritt. Auch mobile Projekte, wie zum Beispiel Theater auf Spielplätzen, bringen Kultur näher an den Alltag der Kinder. Solche Initiativen zeigen: Wenn strukturelle Barrieren abgebaut werden, steigt auch die Beteiligung. Wichtig scheint dabei vor allem, dass Kinder Kultur nicht nur konsumieren, sondern aktiv mitgestalten und sich als Teil des Geschehens erleben können. Das Schulangebot des Historischen Museums Thurgau beispielsweise zielt genau darauf ab.
Museen als Erlebnisräume
Kultur findet aber nicht nur im Klassenzimmer oder auf der Bühne statt – auch Museen sind lebendige Orte des Lernens. Richtig aufbereitet, werden sie zu faszinierenden Erlebnisräumen. Interaktive Stationen, spielerische Führungen und kindgerechte Ausstellungen lassen Geschichte, Natur oder Kunst greifbar werden. Viele Museen bieten inzwischen spezielle Programme für junge Besucher:innen an, die zum Mitmachen, Fragenstellen und Staunen einladen. Mit Museum für Kinder bieten die Museen Thurgau deshalb im Verbund ein vielseitiges Mitmach-Angebot, um die Museumwelt spielerisch zu erkunden.
Dabei geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern ums tatsächliche Erleben: Wie fühlt sich ein mittelalterlicher Schuh an? Wie roch es früher in einer Apotheke? Was entdecke ich in einem Gemälde, wenn ich ganz genau hinschaue? Solche Momente fördern die Beobachtungsgabe, wecken Neugier und stärken das Selbstvertrauen – weil Kinder merken: Meine Sichtweise zählt.
«Museen sind längst nicht mehr stille Tempel des Wissens. Sie sind Lernorte und Geschichte ein Erlebnis», so Noemi Bearth vom Historischen Museum Thurgau. «Sie sind auch Werkstatt, Bühne, Spielplatz und Dialograum. Wenn sie sich auf kindliche Bedürfnisse und Neugier einlassen, entstehen echte Aha-Momente, die oft weit über den Besuch hinaus nachwirken.» Und sie zeigen: Kultur ist kein trockener, elitärer Stoff für Erwachsene. Sie ist ein Abenteuer für Herz und Verstand –auch und gerade für die Kleinsten unter uns.
Text Sarah Steiner
Vom lustigen Schlossabenteuer bis zur rasanten Zeitreise – das Historische Museum Thurgau macht Geschichte lebendig. Mit kreativen Angeboten für Familien und Kinder gelingt es auf Schloss Frauenfeld und im Schaudepot St. Katharinental, Kultur und Wissen generationenübergreifend zugänglich zu machen.

Das Historische Museum Thurgau versteht es meisterhaft, Vergangenheit mit Gegenwart zu verknüpfen. An gleich zwei Standorten –dem Schloss Frauenfeld und dem Schaudepot St. Katharinental in Diessenhofen – bringt es Besucherinnen und Besuchern die Geschichte auf interaktive, spielerische und emotionale Weise näher. Besonders Kinder und Familien sowie Schulklassen stehen im Zentrum des vielfältigen Vermittlungsangebots.
Im Schloss Frauenfeld gehen junge Besucherinnen und Besucher zum Beispiel gemeinsam mit Leuli, einem
charmanten kleinen Löwen, auf Entdeckungsreise. Als tierischer Schlossbewohner führt er mit spannenden Aufgaben und Rätseln durch die historischen Gemäuer. Ältere Kinder können sich mit einem kniffligen Rätselkartenset auf Spurensuche begeben oder per digitaler Schnitzeljagd das Schloss auf eigene Faust erkunden. Und wer seinen Geburtstag in einzigartiger Atmosphäre feiern möchte, verwandelt sich gemeinsam mit seiner Festgesellschaft in Ritterinnen und Ritter –ein unvergessliches Erlebnis mit Aussicht vom Turm bis hinunter in den geheimnisvollen Waffenkeller.
Bleibende Erinnerungen sind Geburtstagskindern auch im Schaudepot St. Katharinental sicher. Im ehemaligen Kornhaus des Klosters, idyllisch am Rhein gelegen, erleben Kinder die Welt, wie sie früher war, als es weder elektrisches Licht noch Smartphones oder Autos gab. Die Kinder meistern Challenges, die Köpfchen, Geschicklichkeit oder Kraft erfordern. Dies ganz nach dem Motto des Schaudepots St.
Katharinental: mittendrin statt nur dabei. Denn in der schweizweit einzigartigen Sammlung historischer
Alltagsgegenstände der letzten 200 Jahre lässt sich Geschichte hautnah erfahren. Ganz ohne Vitrinenglas bietet sich hier ein ganz besonderes Kultur-Erlebnis.

Doch nicht nur die Dauerangebote sorgen für Begeisterung. Das Museumsteam entwickelt laufend neue Formate, die auf Familien zugeschnitten sind. Ob thematische Führung zu Museumsschätzen, Familien-Rallyes, kreative Workshops oder Mitmach-Angebote – das Programm bleibt in Bewegung. Ein Highlight steht am Muttertag, dem 11. Mai 2025, bevor: Unter dem Motto «S’hät, solang s’hät!» öffnet das Schaudepot St. Katharinental seine Türen für einen besonderen Familienausflug. Eine faszinierende Zeitreise in das Leben unserer Vorfahren, ganz ohne Kühlschrank und Strom, dafür voller spannender Entdeckungen. Mit viel Herzblut, Kreativität und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse junger Besucherinnen und Besucher zeigt das Historische Museum Thurgau, wie Geschichte heute funktioniert: als fesselndes Erlebnis für alle Generationen.
Weitere Informationen unter: historisches-museum.tg.ch
Eine wertvolle Kunstsammlung zusammenzutragen war nie die Absicht von Siegfried Rosengart und seiner Tochter Angela. Und doch präsentiert das Museum Sammlung Rosengart im alten Sitz der Nationalbank in Luzern einzigartige Kunstwerke. Die ehemalige Kunsthändlerin bezeichnet sie als eine «Sammlung des Herzens».

Der Kunsthändler Siegfried Rosengart und seine Frau Sybil mussten acht Jahre lang auf ihr Wunschkind warten. Doch dann war Angela Rosengart endlich da. Ihre ersten Erinnerungen an Kunst sind im Kunstmuseum Luzern zu verorten, wohin ihr Vater sie oft mitnahm. «Während er sich dort mit vielen Leuten unterhielt, stand ich jedoch als kleines Mädchen daneben und wurde wütend, weil er sich nicht mehr mit mir abgab. Nie wieder wollte ich in ein Museum gehen», erinnert sich Angela Rosengart.
Erste Einblicke
Trotz der Tätigkeit ihres Vaters bestand niemals ein Zwang, selbst in der Kunst aktiv zu werden. Erst als er sich durch einen Skiunfall ein Bein brach, musste Angela Rosengart, als 16-Jährige, ihn in seiner Galerie unterstützen. Als kurzfristige Hilfe angedacht, begann Angela Rosengart den Galeriebetrieb zu lieben und wurde zu einer Art «Lehrtochter» ihres Vaters. Kundengespräche, Bilder richtig zu rahmen, Büroarbeiten und sogar Kistenpacken lernte sie von ihm. Sie eignete sich auch an, wie man gute Kunst erkennt. «Schauen, schauen, schauen», sei der Leitspruch ihres Vaters gewesen, «nur wer genau hinschaut und vergleicht, lernt, was Qualität ist.»
Liebe auf den ersten Blick
Im Untergeschoss des Museums Sammlung Rosengart hängt Paul Klees «X-chen» von 1938, das für Angela Rosengart eine besondere Bedeutung hat: Die Zeichnung repräsentiert das Eintauchen in die Kunstleidenschaft. Siegfried Rosengart arbeitete bereits 1945 mit Klees Witwe Lily zusammen, um eine Ausstellung in seiner Galerie zum fünften Todestag Klees zu organisieren. Drei Jahre später, 1948, half Angela Rosengart bei einer erneuten Klee-Ausstellung mit. Ein aufregendes Erlebnis wegen eines möglichen Erwerbs für sie. Sie hatte sich gleich in die Zeichnung X-chen verliebt und ihr Vater ermunterte sie, mit dem Verwalter des Klee-Nachlasses zu sprechen. Beim nächsten Besuch des Verwalters nahm die junge Angela Rosengart ihren ganzen Mut zusammen, sprach ihn an und erzählte von ihrem Wunsch, die Zeichnung zu besitzen. Ihre erste Verhandlung folgte:
«Was verdienst du denn im Monat?» «50 Franken.»
«Und wärst du bereit, einen ganzen Monat zu arbeiten, um diese Zeichnung zu besitzen?»
Angela Rosengart antwortete mit enthusiastischem Nicken.
«Gut, du bekommst sie für 50 Franken!»
Es war der Anfang ihrer Sammlung. So trug die Leidenschaft zur Kunst die ersten Blüten. Im Angesicht des Künstlers Tatsächlich war es nie die Absicht des Vater-TochterGespanns, eine Sammlung zusammenzutragen. Doch die aufmerksamen Beobachter konnten sich von gewissen Bildern einfach nicht trennen. Und so entstand eine Auswahl von rund 300 persönlichen Favoriten.
Unter den Lieblingsbildern finden sich über 130 Werke des spanischen Malers, Zeichners und Bildhauers
Rosengart – aus der Hand des Jahrhundertkünstlers.
Angela Rosengart lernte Picasso durch ihren Vater kennen. Die beiden Männer verband eine Freundschaft seit 1914, die 1949 auf die Tochter übersprang. Sie war 17 Jahre alt, als ihr Vater sie dem Künstler in Paris vorstellte. Eingeschüchtert und stumm stand sie neben ihrem Vater: «Ich wusste, dieser kleine Mann ist der Grösste!» Trotz ihrer Stille hinterliess sie einen bleibenden Eindruck.
Picasso porträtierte in seiner Jugend alle seine Freunde. Erst später wurde es zu einem seltenen Privileg, von ihm gezeichnet oder gemalt zu werden. Ein Privileg, in dessen Genuss Angela Rosengart fünf Male kam. Andere hatten nicht so viel Glück.
Eine Kosmetikfabrikantin bedrängte Picasso immer wieder für ein Porträt. Eines Tages hatte Picasso genug, und befahl ihr, sich zu setzen. Das Resultat glich eher einer Karikatur als einem Porträt.

«X-chen», Paul Klee, 1938
Der Vorfall illustriert Picassos Charakter. Er war spontan, hatte immer Tausende Gedanken im Kopf und liess sich zu nichts zwingen. Er wollte frei sein und nicht das tun, was andere wollten. Bei der Arbeit war er streng, wie Angela Rosengart über ihr Modellsitzen berichtet: «Ich musste still sitzen, durfte nicht reden und einfach seine durchdringenden Blicke aushalten. Hinterher war ich erschöpft. Als hätte ich schwere körperliche Arbeit geleistet.»
Der Tod des Ausnahmekünstlers fühlte sich für Angela Rosengart wie eine Zäsur an. Sie war mit

ihrem Vater an der Côte d’Azur, um am nächsten Tag Picasso zu treffen. Um vier Uhr am Nachmittag vermeldete das Radio, dass er gestorben sei. «Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich weiss noch, dass ich das Gefühl hatte: Jetzt geht ein Abschnitt meines Lebens zu Ende», ruft sich Angela Rosengart den Vorfall ins Gedächtnis. Geschärftes Auge
Im Museum Sammlung Rosengart sind aber nicht nur Werke von Paul Klee und Pablo Picasso zu bestaunen. Genauso haben es Angela Rosengart über 20 weitere Künstler des Impressionismus und der Klassischen Moderne angetan, wie Henri Matisse, Marc Chagall oder Joan Mirò.
Auch mit Marc Chagall waren Siegfried und Angela Rosengart befreundet. Sie und ihr Vater reisten mit ihm sogar nach Rom, um die antiken Stätten zu besichtigen. Die Freundschaft war jedoch eine andere als jene mit Picasso: «Die Gespräche mit ihm waren ganz anders.» Er habe gerne Spässe gemacht, sei ein gelöster Mensch gewesen – aber auch nachdenklich, manchmal beinahe melancholisch. «Es war eine sehr liebevolle Freundschaft.» Bis heute pflegt Angela Rosengart freundschaftliche Kontakte zu den Nachkommen von Marc Chagall.
Kunst für die Öffentlichkeit
Lange Zeit hing die Sammlung in der Wohnung von Angela Rosengart, bis sie beschloss, die Kunstwerke allen zugänglich zu machen und gleichzeitig zusammenzuhalten. Schliesslich bezeichnet sie ihre Sammlung gerne als ihr «Kind». Ein Glücksfall war, dass zu der Zeit das 1924 erbaute Gebäude der Schweizerischen Nationalbank zum Verkauf stand. Einerseits, weil das Gebäude selbst ein Schmuckstück ist – das originale Sitzungszimmer der Bankdirektoren ist noch erhalten und zu besichtigen – und andererseits, weil die Sammlung in Luzern bleiben sollte. «Die Lage ist toll und das kulturelle Angebot für so eine kleine Stadt wie Luzern sehr gross.» Ein Angebot, das durch die Grande Dame selbst weiterwuchs, wofür ihr am 18. September 2024 der Luzerner Regierungsrat den Anerkennungspreis verleihen wird.
Für die Augen aller Kunst hat für Angela Rosengart einen wichtigen Stellenwert. «Als ich jung war, war Kunst etwas für die Elite», erinnert sie sich. Ein Umstand, der sich glücklicherweise geändert hat. Insbesondere die Förderung des Kunstinteresses von Kindern liegt der Stiftung am Herzen: Beim Programm «Kinder führen Kinder» führen sich Sieben- bis Elfjährige selbst in die Kunst ein. Ein Abenteuer ganz ohne Erwachsene!
Ob durch Zu- oder Glücksfälle, die Entstehung des Museums und der Sammlung wirkt schicksalhaft. Sie wurde durch Leidenschaft gelenkt. Zwar kam Angela Rosengart durch den kommerziell geprägten Kunsthandel in diese Welt, doch sie betrachtete die Werke immer mit dem Herzen und nicht nur mit dem Kopf.
Im Museum Sammlung Rosengart können ganzjährig die Werke von Paul Klee, Pablo Picasso, Marc Chagall und weiteren Künstlern des Impressionismus und der Klassischen Moderne bewundert werden.
www.rosengart.ch
Öffnungszeiten
April–Oktober: Täglich 10–18 Uhr (inkl. Feiertage)
November–März: Täglich 11–17 Uhr (inkl. Feiertage)
Anreise
Die Sammlung Rosengart befindet sich an der Pilatusstrasse 10, drei Gehminuten vom Bahnhof Luzern entfernt.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wünschen sich wohl alle. Trotz Fortschritten ist das in den heutigen Rahmenbedingungen immer noch einfacher gesagt als getan. Starre Pläne, die Work-Life-Balance zu verbessern, müssen nicht sein. Eine Übersicht, wie man für die eigene Familie einen guten Weg findet.

Ein Patentrezept für die Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf gibt es nicht. Zum Glück! Denn Familien sind so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der Eltern und ihrer Kinder. Statt eines starren Vorgehens lohnt sich eine Selbstanalyse. Auf dieser Grundlage kann man den Nutzen unzähliger Optionen besser einschätzen und eine erreichbare Vision für die Zukunft definieren. Die folgenden fünf Schritte zeigen Wege auf, wie man mehr Ausgewogenheit ins Familienleben bringt.
Struktur
Ein erster wichtiger Punkt sind passende Strukturen. Die Wohnsituation, Kinderbetreuung und Arbeitssituation können eine gute WorkLife-Balance fördern oder verhindern.
Wohnsituation: Spezifische Bestandteile der Wohnsituation, die es zu beurteilen gilt, sind der Arbeitsweg, der Betreuungsort der Kinder, die Anbindung an den ÖV, Einkaufsmöglichkeiten und Nachbarn. Die Wohnsituation kann nicht immer schnell und einfach optimiert werden. Wenn aber ein Umzug nicht zu verwirklichen ist, kann bereits ein Umstellen oder eine Umnutzung gewisser Räume eine Entlastung bringen.
Die Wohnsituation lässt sich aber auch mit simplen Tricks verbessern. Oberste Priorität, um Stressherde zu reduzieren, hat die Verhinderung von Gefahren. Eine Möglichkeit besteht darin, mindestens einen Raum so einzurichten, dass sich das Kind unbeaufsichtigt aufhalten kann. Dazu gehört, dass sich Kinder nicht an spitzen Kanten verletzen können und sichere Spielsachen selbstständig erreichbar organisiert sind. Auch andernorts erleichtert eine gute Organisation den Alltag. Wenn jedes Ding seinen Platz hat, erübrigt sich langes Suchen. Betreuungsstrukturen: Auch bei den möglichen Betreuungsmöglichkeiten lohnt sich der langfristige Blick. Kindertagesstätten, Tagesfamilien oder die Betreuung zu Hause durch Nannys,
Familien sind so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der Eltern und ihrer Kinder.
Familienmitgliedern und Bekannte haben ihre Vorund Nachteile. Die Qualifikationen des Betreuungspersonals, Unterbrüche durch Ferien oder Alternativen bei Krankheit von Betreuer:innen oder Kindern sollten in die Wahl des Angebots miteinbezogen werden.
Arbeitsplatz: Um die Arbeitsplatzstruktur zu optimieren, muss diese erst verstanden werden. Neben dem Punkt des Arbeitsweges und der verfügbaren Transportmittel kann man sich auch folgende Fragen stellen: Welche Möglichkeiten zu flexiblen Arbeitszeiten, Jobsharing, Betreuungsunterstützung oder Homeoffice bestehen? Welche Erwartungen bestehen vonseiten des Arbeitgebers bezüglich Abendsitzungen und kurzfristiger Termine? Findet man nicht alle nötigen Informationen, ist ein klärendes Gespräch der nächste Schritt. Während eines solchen Austauschs lassen sich gleichzeitig auch Möglichkeiten zur Förderung der Vereinbarkeit ausloten.
Planung
Stress und Mühe kann man vor allem durch eine gute Planung und geklärte Verantwortlichkeiten verhindern. Ein Jahresplan mit Feriendaten, Geburtstagen und sich wiederholenden Aufgaben wie Steuern, Krankenkasse und Geschenkbesorgungen erleichtern die Zusammenarbeit. Monatlich wiederkehrende Angelegenheiten, beispielsweise Rechnungen oder Putzeinheiten, lassen sich auf dieselbe Weise festlegen.
Genauso erhöhen feste wöchentliche oder tägliche Rituale die Sicherheit, den Einbezug aller Familienmitglieder und vor allem auch ein gewisses
Mass an Ruhe: Familienmeetings mit den Kindern, altersgerechte Ämtlipläne, kleine Einheiten von Haushaltsarbeiten und Essenspläne inklusive Einkaufsliste für eine Woche. Bei zeitlichen Engpässen dürfen bei Letzterem ruhig auch Menus vorgekocht oder der Lieferservice eingeplant werden.
Für noch mehr Gelassenheit kann man abends nochmals den Tag Revue passieren lassen und den nächsten planen. Bei Tagesplänen muss man dennoch nicht alles verplanen, sondern Lücken und Puffer bestehen lassen, um diese je nach Bedürfnissen zu nutzen. Und ganz wichtig: Genügend Schlaf einplanen!
Netzwerk
Bei aller Planung kann trotzdem immer wieder Unvorhergesehenes passieren. In solchen Fällen hilft ein verlässliches Netzwerk. Auf welche Lösungen kann ich bei Verspätungen, Krankheit, ungeahnten Arbeitseinsätzen oder Betreuungsausfällen zurückgreifen? Eine Liste mit allen regelmässigen Kontakten im Familien- und Freundeskreis hilft. Bestenfalls ordnet man die Kontaktdaten nach dem Grad an möglicher Unterstützung sowie denkbarer Kurzfristigkeit. Für ausserordentliche Notfälle sollte man auch Kontaktdaten ausserhalb des eigenen Netzwerks wie Notfallnannys oder das Rote Kreuz anfügen. Ist die Liste einmal erstellt und mit den Beteiligten abgesprochen, wird man nicht mehr so schnell aus der Bahn geworfen.
Tools
Beispielsweise erhöhen Familienkalender, Ämtlipläne und Einkaufszettel in der Küche die Sichtbarkeit und
den Einbezug der Kinder. Gleichzeitig besteht für die auf diese Art auch ein Anreiz, selbstständig an der Organisation teilzunehmen. Diese kann man selbst basteln oder kaufen. Ein Beispiel ist das easyfaM Taskboard, das bereits Vorlagen inkludiert, aber auch eigene Anpassungen einfach integrieren lässt. Für digitale Tools gibt es unzählige Optionen, gratis oder kostenpflichtig. Die Vorteile liegen auf der Hand: In Echtzeit kann man einsehen, welche To-dos anstehen oder bereits erledigt wurden. Je nach Alter der Kinder können diese mit der Zeit hinzugefügt werden, sodass sie genauso in die digitale Planung miteinbezogen sind. Besonders zu empfehlen sind Famanice, Cozy Family Organizer (Freiversion nur auf Englisch), FamilyWall oder Bring! für den Einkauf.
Achtsamkeit
Zelebriert als ein Konzept gegen psychische Überlastungen, ist Achtsamkeit auch ein erprobtes Mittel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Ein erster Schritt besteht darin, die Gedanken auf die aktuelle Situation zu fokussieren. Ohne Businessmails auf dem Handy oder Ähnliches gelingt dies einfacher als gedacht. Zudem sollte man stets auf die Energiebalance achten, indem man Wichtiges von Unwichtigem trennt. Es gibt natürlich vieles, was man gerne ändern würde. Doch statt jeden Tag über alle Probleme zu streiten, darf das Motto «Choose your fight» lauten.
Ganz allgemein gesehen vermeidet man einiges an Belastung, wenn man sich von unerreichbaren Idealen und Perfektion verabschiedet. Wichtig für Kinder sind vor allem freudvolle Erlebnisse und eine positive Beziehung zu den Eltern. Wenn die Ressourcen einmal knapp sind, darf man sich trauen, Anfragen abzulehnen und nach Hilfe zu fragen. In besseren Zeiten sind andere froh, wenn man für sie dasselbe tut.
Text Cornelia Peltenburg
Der Verein profawo bietet neben den kids & co Kitas vielfältige Dienstleistungen im Bereich von Vereinbarkeit und Privatleben und unterstützt Firmen und ihre Mitarbeitenden in allen Bereichen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
www.profawo.ch
Entdecke die Kitas von kids & co Zürich.

Wohin mit dem Kind, wenn man einen verbindlichen Termin hat? Wer passt auf, wenn die Familie nicht in der Nähe lebt oder man wegen Überlastung eine Pause braucht und alleinerziehend ist? In Basel gibt es darauf eine Antwort: «Babsy.» «Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind grosszuziehen», heisst es in einem Sprichwort. Eine schöne Vorstellung, in der Grosis die Kinder vom Chindski abholen, während die Eltern arbeiten und das Nachbarschaftsumfeld auf die Kleinen aufpasst, wenn Partnerzeit geplant ist. «Die Realität sieht oft anders aus», sagt Andrea Schöllnast, Vorsitzende des Vereins «Babsy» mit Sitz in Basel. Darum hat sie 2018 den gemeinnützigen und ehrenamtlich arbeitenden Verein für Kinderbetreuung ins Leben gerufen und damit eine Onlineplattform geschaffen, bei der Babysitter und Familien einander finden können. In der App können Sitter und Eltern ein Profil erstellen und werden anschliessend vom Babsy-Team interviewt – so will der Verein sicherstellen, dass es keine Fake-Profile gibt.
Finden sich beide Parteien, fragt der Verein eine kleine Buchungsspende an, alles andere vereinbaren die Sitter und Eltern untereinander. «Wir werden häufig gefragt, warum wir nicht schweizweit verfügbar sind», sagt Schöllnast. «Für Familien mit Migrationshintergrund oder Menschen, die unregelmässige Arbeitszeiten haben, sind wir häufig der letzte ‹Rettungsanker›, um überhaupt der Arbeit nachgehen zu können», fügt sie an. Wie so oft fehle es dem gemeinnützigen Verein an Geldern und Sponsoren, um die Kosten für das Expandieren zu bewerkstelligen. Das Netzwerk in Basel steht auf soliden Beinen und das Feedback ist sehr positiv. Unterstützen kann man den Verein auf vielen Wegen: als Kooperationspartner, Spender:in oder auch als Firmenmitglied. «Dabei übernehmen Unternehmen die Buchungsspende für ihre Angestellten und zeigen damit, dass sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ihrer Mitarbeitenden ernst nehmen», so die Vorsitzende.
Weitere Informationen unter: www.babsy.ch und verein.babsy.ch


Wo Kinder mit zwei Sprachen gross werden, sich Kulturen begegnen und mediterrane Herzlichkeit auf Schweizer Struktur trifft – mitten in Zürich bietet Pasitos einen ganz besonderen Ort zum Wachsen.
ie Stiftung Pasitos betreibt in Zürich eine Kinderkrippe und einen Kindergarten, in denen Kinder von klein auf in ein liebevoll gestaltetes, zweisprachiges Umfeld eintauchen. Spanisch und Deutsch gehören zum Alltag – und das nicht nur sprachlich: Auch die Kulturen beider Länder werden aktiv gelebt – spürbar auch in der warmen, mediterranen Atmosphäre des Hauses. Pasitos setzt auf eine individuelle, kindgerechte Förderung. «Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahr und schaffen ein inspirierendes Lernumfeld», sagt Fátima Villa López, Leiterin von Krippe und Kindergarten bei Pasitos. Das pädagogische Team achtet auf eine fröhliche Atmosphäre und geht gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder ein.
Der Kindergarten wird von zwei Lehrpersonen mit doppeltem Pensum geführt und ist auch für Kinder offen, die vorher nicht in der Krippe waren. Deutsch und Spanisch als Zweitsprache werden motivierend gefördert – durch zusätzliche ausgebildete Sprachlehrerinnen und mit Lektionen für Kinder, die zu Hause wenig oder gar kein Deutsch oder Spanisch sprechen.
Pasitos bietet eine ganztägige Betreuung mit Musik, Sport, Waldtagen und einem integrierten Hort. Die Krippe und der Kindergarten sind nahezu ganzjährig geöffnet. Gekocht wird täglich frisch und ausgewogen in der hauseigenen Küche. Die freie Ferienwahl sowie subventionierte Plätze machen das Angebot besonders familienfreundlich.
Mehr Informationen unter: kindergartenpasitos.ch


Nächster Halt: Mittelalter! Am Rande der verwinkelten Zuger Altstadt steht die historische Burg, umgeben von dicken Mauern und einem Burggraben. Einst wohnten dort mittelalterliche Herrschaften und bedeutende Zuger Familien. Doch nun befindet sich das historische Museum von Stadt und Kanton Zug darin.
Ein Blick in die Zuger Vergangenheit Wer die Brücke zum Burghof überquert und das Museum betritt, begibt sich auf eine Zeitreise. In den thematischen Räumen der Dauerausstellung erwacht Zuger Kulturgeschichte zum Leben: vom französisch inspirierten Landtwing-Kabinett über eine bürgerliche Wohnstube bis hin zu der historisch eingerichteten Schuhmacherei und der Drogerie. Auch Herrschaft und Kriegsführung im Mittelalter kommen nicht zu kurz. Wer sich besonders für diese Zeit interessiert, sollte auf keinen Fall die Sonderausstellung «hûs, stat, fëld – Mittelalter in der Zentralschweiz», welche am 12. November eröffnet wird, verpassen.
Kinder entdecken die Burg Ab 4 Jahren kann mithilfe der Burgtasche das Museum forschend, riechend, singend – also mit allen Sinnen – erlebt werden. Ab 7 Jahren gilt es, die kniffligen Rätsel des Comicmädchens Lili zu lösen. Dabei muss schon auch mal ein Kettenhemd und Ritterhelm anprobiert werden. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht! Ältere Kinder haben die Möglichkeit, eine digitale Schnitzeljagd auf dem Smartphone zu erleben
und befreien dabei Lili aus dem Zeitstrudel. Wer eine Pause vom Entdecken braucht, kann auch einfach im Spielzimmer Zeit verbringen oder im Atelier nach Lust und Laune basteln und malen.

An jedem ersten Mittwoch im Monat ist der Eintritt ins Museum frei und jeden letzten Sonntag (ausser Juli und Dezember) findet die interaktive Erlebnisführung für Familien statt. Weitere Informationen und Veranstaltungen unter www.burgzug.ch

Sponsored
Der Verein Regenbogen Schweiz unterstützt Eltern, die ihr Kind verloren haben – unabhängig vom Alter und der Todesursache. Der Verein zählt rund 25 Selbsthilfegruppen, sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz. Geschwister der Verstorbenen werden in den Gruppen ebenfalls aufgenommen.
Die Treffen finden monatlich statt und bieten einen geschützten Raum für Austausch und Verständnis. Die Betroffenen befinden sich in unterschiedlichen Trauerphasen – manche sind erst kürzlich betroffen, andere schon seit vielen Jahren. Diese Mischung schafft ein tragendes Netzwerk, in dem gegenseitige Unterstützung und Hoffnung wachsen können.
Der Verein Regenbogen Schweiz ist ein rein freiwillig organisierter Verein ohne therapeutischen Anspruch. Die Unterstützung basiert auf persönlicher Erfahrung. Finanziert wird der Verein hauptsächlich durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Der Erstkontakt erfolgt meist über die verteilten Flyer in Spitälern, über die Webseite oder telefonisch mit Frau Eveline Rüegg.
Nach einem unverbindlichen Erstgespräch mit der Gruppenleitung können Eltern eine Selbsthilfegruppe besuchen. Ziel ist es, Trauernde auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und durch die Gemeinschaft wieder Vertrauen ins Leben zu gewinnen. Der Regenbogen des Logos symbolisiert dabei die Verbindung zwischen dem Leben und der Welt, in der die Kinder der Betroffenen nun sind.
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter: 079 489 22 89 info@verein-regenbogen.ch verein-regenbogen.ch

Der Verlust eines Kindes ist eine Erfahrung, die viele betrifft, über die aber kaum gesprochen wird. Die Gesellschaft tut sich schwer, diesen Schmerz zu benennen – und genau das macht es für die Betroffenen umso schwerer. In einem persönlichen Interview erzählt Eveline Rüegg von ihrem Weg durch die Trauer, ihren Herausforderungen und dem, was ihr geholfen hat.

Eveline Rüegg
Diplomierte Sterbe- und Trauerbegleiterin
Ein Trauerprozess, der kaum sein durfte Von aussen scheint sich das Leben nicht wirklich verändert zu haben, doch innerlich ist alles anders. Die Freude auf das Kind schlägt plötzlich um in einen tiefen Fall, der das eigene Weltbild erschüttert. «Der Blick auf das Leben verändert sich», erzählt sie.
Rückblickend ist nicht einmal klar, ob es einen richtigen Trauerprozess gab. Zu oft wurden die Gefühle erstickt durch Sätze wie: «Du bist ja noch jung» oder «Es war ja noch so früh». Aussagen, die trösten sollen, bewirken oft das Gegenteil. «Fünf Monate Schwangerschaft sind für mich nicht früh», betont sie. Ihr Umfeld schwieg oder versuchte, das Geschehene kleinzureden. Vor zwanzig Jahren wurde das Thema noch weniger offen behandelt als heute.
Der Weg zur Akzeptanz
Was wirklich hilft? «Darüber zu reden», sagt sie. Der Austausch mit anderen, die Ähnliches erlebt haben, gibt Halt. Die Akzeptanz der eigenen Trauer, ohne gegen sie anzukämpfen, ist essenziell. Denn es gibt keinen festen Weg für den Umgang mit Verlust – nur den eigenen.
Heute sind die schweren Tage seltener geworden. Doch es gibt Momente, die noch immer schmerzen: Geburtstage, der erste Schultag – Meilensteine, die es nie gab. «Man fragt sich manchmal, wie sein Leben jetzt aussehen würde. Doch die Akzeptanz hilft. Mein Kind gehört zu meiner Geschichte, egal ob es lebt oder nicht.»
Die ersten Wochen: Ein Fiebertraum aus Schmerz und Schuld Nach dem Verlust fühlte sich alles surreal an. «Man funktioniert einfach, weil das Leben weitergeht, obwohl in mir alles stehen geblieben ist.» Hinzu kamen Schuldgefühle: Hatte der eigene Körper versagt? War etwas falsch gelaufen? «Es war ein Vertrauensverlust in meinem Körper und in das, was es bedeutet, eine Frau zu sein.» Der Verlust machte schmerzlich bewusst, wie fragil das Leben ist.
Das gesellschaftliche Schweigen In der Gesellschaft wird über Themen wie Verlust und Tod kaum gesprochen. Wer offen sagt, dass es
ihm schlecht geht, weil er sein Kind verloren hat, erhält oft keine richtige Antwort. «Es war, als hätte ich etwas gesagt, was nicht gesagt werden darf.» Die Trauer blieb oft ungesehen, nicht ernst genommen. «Es sind unsere Kinder. Punkt.» Diese Anerkennung hätte sich Eveline Rüegg damals gewünscht.
Manche Seelen kommen nur kurz auf die Welt, weil sie nur unsere Tränen brauchen, um Frieden zu finden.
– Eveline Rüegg
Heilung in kleinen Schritten
Ein Satz, der Frau Rüegg besonders berührte, kam etwa ein Jahr nach dem Verlust: «Manche Seelen kommen nur kurz auf die Welt, weil sie nur unsere Tränen brauchen, um Frieden zu finden.» Ein Gedanke, der sie noch heute auf ihrem Weg begleitet. Und dann kam auch ein weiteres Kind – ein neuer Lebensabschnitt, der ohne den Verlust nicht möglich gewesen wäre.
Die Veränderung der Trauer
Die Trauer bleibt, aber sie wandelt sich. Sie wird ein Teil des Lebens, ohne alles zu bestimmen. Ihre Kinder bringen Leben ins Haus und mit diesem Leben wird der dunkle Raum doch noch ein bisschen heller. Doch es bleibt ein Platz für das Kind, das nicht da ist. «Es ist nicht schön, dass er so früh gehen musste. Aber daraus sind auch schöne Dinge entstanden, die heute anderen helfen können.»
Erinnerung und Rituale
Der Todestag ist ein stiller Moment des Gedenkens. Eine Kerze brennt, manchmal wird die Erinnerung geteilt –nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um zu zeigen, dass dieser Verlust zum Leben gehört. Keine grossen Rituale, sondern besondere Momente der inneren Verbindung.
Fehlende Unterstützung
Damals war die Unterstützung selten. «Ich habe mich isoliert», sagt sie rückblickend. Doch die
Kinder malten immer wieder Bilder, in denen das verstorbene Geschwisterchen einen Platz hatte. Eine stille, aber bedeutsame Form der Anerkennung.
Das Verhalten der Gesellschaft
Der Umgang mit trauernden Eltern ist für viele eine Herausforderung, denn oft fehlt das Wissen, wie man sich richtig verhält. Doch es sind nicht die perfekten Worte, die helfen – sondern das ehrliche Dasein. Viele Eltern berichten, dass ihr Verlust im Umfeld kleingeredet wurde. Sätze wie «Ihr könnt es ja noch mal versuchen» nehmen der Trauer ihren Raum und lassen Betroffene allein zurück.
Stattdessen hilft es, den Schmerz anzuerkennen. Zuhören, nachfragen und einfach signalisieren: «Ich sehe dich, ich höre dich.» Ein Kind bleibt immer ein Kind – egal, wie lange es gelebt hat. Deshalb bedeutet es trauernden Eltern viel, wenn das verlorene Kind nicht vergessen wird.
Wichtig ist auch, Unsicherheiten offen zu benennen. Ein «Ich weiss nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da» kann mehr bedeuten als gut gemeinte, aber verletzende Floskeln. Wer helfen will, kann auch auf Trauergruppen hinweisen oder einfach anbieten, gemeinsam etwas zu unternehmen – ohne Druck, aber mit Verständnis.
Der Wunsch einer besseren Gesellschaft Heute arbeitet Eveline Rüegg zusammen mit Trauernden. Der Verlust hat sie auf diesen Weg gebracht. «Wir leben nie so intensiv, wie wenn wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen.» Ihre Botschaft an andere: «Trauer hört nicht auf, aber sie verändert sich. Sie wird irgendwann auch eine schöne Erinnerung. Man muss die Trauer umarmen, um Frieden zu finden.» Was kann die Gesellschaft tun? «Aufhören zu schweigen.» Das grösste Geschenk an trauernde Eltern ist nicht immer ein perfektes Wort, sondern einfach da zu sein. «Der Trauer Raum geben» – das ist es, was fehlt. Ein Raum für das, was nicht gesagt wird, aber so dringend gehört werden muss.
Text Aaliyah Daidi
Eveline Rüegg
Eveline Rüegg ist diplomierte Sterbe- und Trauerbegleiterin und auch für den Telefondienst des Vereins Regenbogen verantwortlich. Sie unterstützt und begleitet trauernde Eltern, bietet Kiefertherapie, verschiedene Entspannungs- und Trauerkurse sowie Meditationen an.


Hinterlassen Sie eine gerechte und lebenswerte Zukunft
Mit einem Testament bestimmen Sie, wie Ihr Nachlass zu teilen ist. Sie können Ihre Liebsten begünstigen und kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen.
Mehr erfahren und Testament erstellen. Gerne beraten wir Sie. 061 338 91 36.

Perspektiven für Jugendliche
«Der Tod ist kein Projekt für später» – mit dieser Haltung begleitet Angela Villiger seit zehn Jahren Menschen dabei, ihr Lebensende selbstbestimmt und mit Würde zu gestalten. Ihr Unternehmen life festival bietet mehr als Vorsorge: Sie schafft Raum für Gespräche, Sicherheit – und oft sogar für ein Lächeln.

Das Geburtstagsfest, die Hochzeit, den nächsten Urlaub oder die Karriere – wir planen gerne. Minutiös wird auf jede Kleinigkeit geachtet. Das richtige Kärtchen, die passenden Worte, ja sogar die Schriftart wird nicht dem Zufall überlassen. Planung gibt Struktur, schafft Halt, einen Rahmen – und vermittelt das Gefühl von Sicherheit. Doch wenn es um das eigene Lebensende geht, hört das Planen oft auf. «Weil der Tod nicht planbar ist», sagen manche. Doch das stimmt nur zum Teil. Das Sterben selbst ist oft unvorhersehbar – das Drumherum jedoch lässt sich sehr wohl gestalten. Und das kann entlasten – nicht nur einen selbst, sondern vor allem die Menschen, die zurückbleiben. Denn wer schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, weiss: Sterben ist nicht nur emotional, sondern auch administrativ ein Kraftakt. Der Moment des Abschieds wird häufig überlagert von Fragen, Formularen, Unsicherheit – und Zeitdruck.
Genau hier setzt Angela Villiger mit ihrem Unternehmen life festival an. Seit zehn Jahren begleitet sie Menschen dabei, ihr Lebensende aktiv zu gestalten – bewusst, würdevoll und nach ihren eigenen Vorstellungen. Ein bemalter Sarg mit Wildblumen.
Eine Urne in Fussballform. Ein Abschiedsfest am See, mit Yoga und Grillwürsten. Es sind solche Bilder, die Villiger in ihren Gesprächen entwirft – gemeinsam mit den Menschen, die den Mut haben, sich mit dem Unvermeidlichen auseinanderzusetzen. Sie ist keine klassische Bestatterin. Ihr Metier ist die Gestaltung von Beerdigungen, von Abschiedsfesten, von Lebensabschlüssen. «Ich wünsche mir, dass wir den Tod nicht als Bruch, sondern als Teil des Lebens sehen», sagt sie. Und diese Haltung spürt man in ihrer Arbeit. life festival bietet eine Rundumberatung. Neben der Beerdigungsplanung informiert und unterstützt das Team auch zu Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und Willensvollstreckung. Dabei geht es nicht nur um Formulare – sondern um Geschichten, Werte, Identität. «Viele Menschen atmen regelrecht auf, wenn sie sich mit ihrem eigenen Ende auseinandergesetzt haben», erzählt Villiger. Es bringe Ordnung – im Aussen, aber auch im Innern. Eine ältere Frau sagte ihr einmal nach einem Gespräch: «Ich habe zum ersten Mal seit Jahren wieder durchgeschlafen». Für Villiger sind das die Momente, die zeigen, wie viel Kraft in dieser Arbeit steckt. Die Gespräche finden meist zu Hause statt, in vertrauter Umgebung – mal im Kreis der Familie, mal ganz privat. Es geht nicht nur um den Tod, sondern um das Leben: Was macht es aus? Was zählt wirklich? Wie kann man loslassen, ohne zu verlieren? Besonders bedeutsam ist diese Begleitung für Menschen, die sich für einen begleiteten Suizid entscheiden. Auch hier bietet life festival Unterstützung, Informationen und eine strukturierte Vorbereitung. «Am Tag X soll nichts mehr unklar sein», sagt Villiger. «Das gibt Halt – für
Wenn der Rasen in Form ist, stimmt das Gefühl. Die STIHL-Akkugeräte von Toolster.ch bringen deinen Garten in Schwung – und dich gleich mit. Frühling, wie er sein soll.
Der Frühjahrsputz für den Rasen Sobald es draussen wieder frühlingshaft wird und die Temperaturen dauerhaft über 10 Grad liegen, kann die Rasenpflege losgehen. Der erste Schritt: Aufräumen. Laub, Äste und andere Hinterlassenschaften des Winters solltest du sorgfältig entfernen, damit Licht und Luft wieder an die Grasnarbe gelangen. Unebenheiten im Boden? Kein Problem: Diese lassen sich mit einer Harke oder Schaufel ganz einfach ausgleichen. Wo kahle Stellen zu sehen sind, kannst du jetzt wunderbar nachsäen – die ideale Gelegenheit, um Lücken im Rasen zu schliessen. Eine aufgelockerte Bodenoberfläche hilft den jungen Halmen, sich schneller zu entwickeln und Wurzeln zu bilden. Wenn du deinen Rasen richtig vorbereitest, legst du den Grundstein für ein gesundes Gartenjahr.
Dünger, Kalk & Co.
Ein hungriger Rasen braucht Futter! Ein ausgewogener Frühjahrsdünger unterstützt das frische Wachstum und bringt deinen Rasen in Schwung. Am besten düngst du ein paar Tage nach dem ersten Schnitt – so können die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Danach heisst es: etwa zwei Wochen Geduld haben, bevor erneut gemäht wird. Falls dein Boden etwas zu sauer ist, empfiehlt sich bereits im Februar eine Kalkgabe, damit der Boden wieder ins Gleichgewicht kommt. Eine einfache Bodenanalyse gibt Auskunft darüber, ob das nötig ist. Wenn der Rasen stark verfilzt ist oder sich Moos breitgemacht hat, hilft nur noch eins: Vertikutieren. Diese intensive Pflegekur für den Boden entfernt Rasenfilz, Unkraut und abgestorbene Pflanzenteile. Der ideale Zeitpunkt dafür ist der April, wenn d er Rasen schon ein bisschen Kraft getankt hat. Besonders lehmige oder verdichtete Flächen kannst du anschliessend mit Sand verbessern. Das sorgt für bessere Belüftung und Wasserabfluss – zwei wichtige Faktoren für gesunde Graswurzeln.
Der erste Schnitt des Jahres Jetzt wird's ernst: Der erste Rasenschnitt steht an, sobald das Thermometer dauerhaft über 10 Grad zeigt und das Gras spürbar gewachsen ist. In der Regel ist das ab Mitte März der Fall. Aber Vorsicht: Nur mähen, wenn der Boden trocken ist! Der ideale Start ist ein sogenannter "Säuberungsschnitt" mit frisch geschärften Messern. So verhinderst du, dass die zarten Frühjahrshalme gequetscht oder gerissen werden. Das fördert die Gesundheit der Pflanze und beugt Rasenkrankheiten vor. Die perfekte Schnitthöhe liegt bei 4 bis 6 cm. Im Schatten lieber nicht unter 5 cm gehen, damit der Rasen dort nicht ausdünnt. Gerade bei ersten Mähvorgängen solltest du den Rasen lieber etwas höher lassen, um das Wachstum zu stabilisieren.
die Betroffenen und ihre Angehörigen». Dabei geht es nie um starren Perfektionismus. «Es gibt Spielräume –auch für die Hinterbliebenen. Manchmal muss man Kompromisse finden, wenn der letzte Wille mit den Gefühlen der Familie kollidiert. Aber der Grundgedanke bleibt: der Mensch im Mittelpunkt», erklärt sie.
Die Erfahrung zeigt: Viele ihrer Kund:innen kommen nicht erst im hohen Alter. Eine plötzliche Erfahrung – ein Unfall im Umfeld, eine schwere Diagnose bei Freund:innen – können den Anstoss geben. «Eine 30-jährige Kundin kam zu uns, nachdem ihre beste Freundin gestorben war. Sie war Lastwagenfahrerin, wusste um ihre Verletzlichkeit – und wollte selbst bestimmen, was mit ihr passiert, falls sie einmal nicht mehr urteilsfähig ist», sagt Villiger.
Immer mehr Menschen erkennen, dass Vorsorge nichts mit Schwarzmalerei zu tun hat – sondern mit Verantwortung. Sie wollen für sich selbst sorgen, aber auch für die, die zurückbleiben. Denn nichts ist schwerer, als in der Trauer plötzlich Entscheidungen treffen zu müssen, für die man keine Orientierung hat. Für viele wird die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod zu einem Akt der Selbstermächtigung. Sie bestimmen, wie sie gehen möchten – und was bleibt. Ob Musik, Kleidung oder die Form der Zeremonie: Alles darf, nichts muss. Villiger ist überzeugt: Es sei nicht makaber, sich um seine Beerdigung zu kümmern. Im Gegenteil – es sei ein Akt der Liebe. Zu sich selbst. Und zu den Menschen, die zurückbleiben. Warum aber fällt es uns so schwer, über den Tod zu sprechen? «Unser Hirn tut sich schwer mit dem Unbekannten. Und was nach dem Tod geschieht, darüber wissen wir eben nicht viel», sagt sie. Das
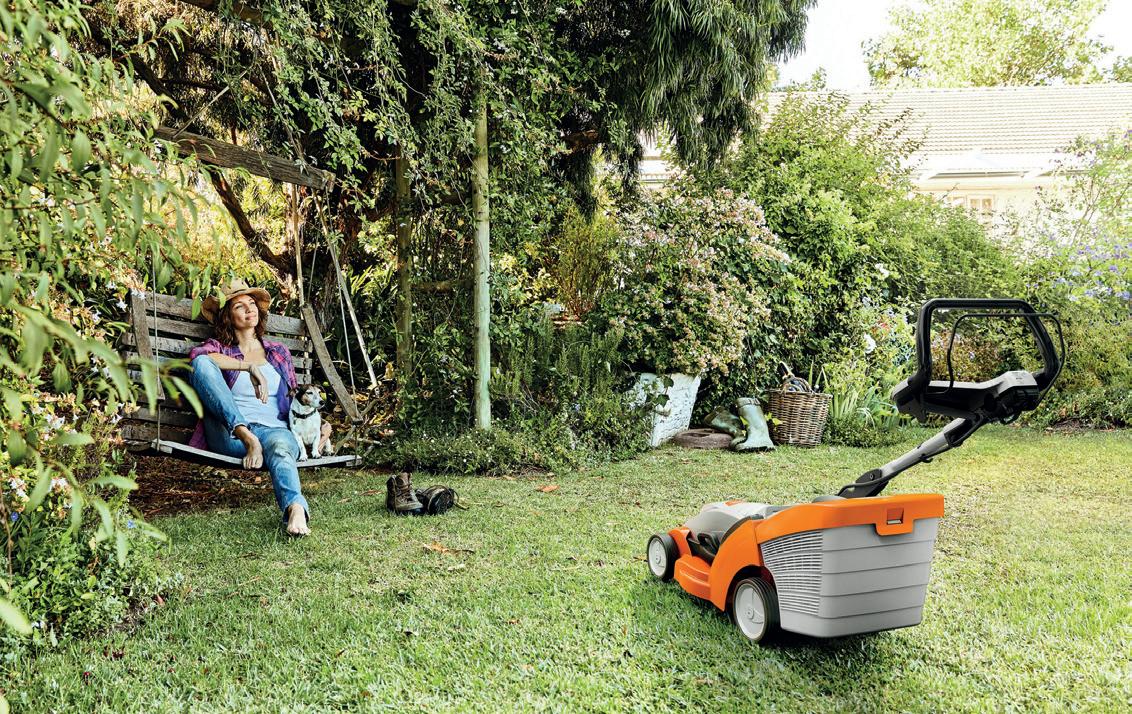
Wie oft und wie kurz?
Regelmässig mähen hält den Rasen vital und widerstandsfähig. Je nach Rasenart und Wetter heisst das:
• Spielrasen: 3–5 cm, einmal pro Woche
• Zierrasen: 2–3 cm, bis zu 2x pro Woche
• Schattenrasen: 5–6 cm, einmal pro Woche
Kräuterrasen: 6–10 cm, nur selten
Blumenwiese: maximal 2x pro Jahr
Wichtig: Nie mehr als ein Drittel der Halmhöhe auf einmal abschneiden. Diese sogenannte 1/3-Regel sorgt dafür, dass das Gras nicht gestresst wird und sich gleichmässig regenerieren kann. So bleibt dein Rasen dicht, gesund und schön anzusehen.
Was tun bei hohem Gras?
Du warst länger nicht im Garten? Kein Problem. Auch stark gewachsener Rasen lässt sich in den Griff bekommen. Schneide hohes Gras am besten in mehreren Etappen und verzichte auf einen Radikalschnitt. Oder greif zur STIHL Motorsense oder einem Freischneider – besonders bei stark vernachlässigten Flächen die bessere Wahl. Eine besonders effektive Methode: die Quadratmethode. Teile die Fläche gedanklich in Abschnitte und arbeite dich systematisch von aussen nach innen vor. So behältst du die Übersicht und erzielst ein sauberes Ergebnis.
Sicher und smart mähen
Beim Rasenmähen kommt es nicht nur auf das richtige Timing an, sondern auch auf eine sichere und clevere Vorgehensweise. Mähe grundsätzlich nur bei trockenem Wetter und fahre dabei quer zum Hang – das sorgt für besseren Halt und mehr Sicherheit. Beginne mit den Rasenkanten und arbeite dich danach systematisch zur Fläche vor. Wenn das Schnittgut feucht ist, empfiehlt sich unbedingt der Einsatz eines Fangkorbs.
Leben sei so schön und Sterben wiederum könne verschiedene Gesichter haben – auch schmerzhafte. Villiger sieht darin auch ein gesellschaftliches Tabu. Eines, über das man viel mehr sprechen müsse –angefangen in der Schule. Tatsächlich zeigen uns Kinder oft, wie natürlich der Umgang mit dem Tod sein könnte. Das Leben geht für sie ganz selbstverständlich weiter. «Meine Neffen – acht und fünf Jahre alt – haben eine tote Biene kremiert. Mit einer kleinen Zeremonie, ganz selbstverständlich. Kein Drama. Kein Tabu. So offen sollten auch Erwachsene darüber reden dürfen», sagt die Beerdigungsplanerin.
Nach zehn Jahren life festival blickt Villiger dankbar zurück – und mit viel Herz nach vorn. Ihre Vision bleibt klar: Einen Raum schaffen für Zuhören, Nachdenken und Gestaltung. Denn vielleicht ist es genau das, was bleibt – wenn alles geht: Das gute Gefühl, vorbereitet zu sein. Für sich selbst. Und für die Menschen, die weiterleben.
Weitere Informationen unter: lifefestival.ch

Vor dem ersten Schnitt: kurzer Mäher-Check
PUBLIREPORTAGE
Bevor du loslegst, nimm dir einen Moment Zeit für die Kontrolle deines Mähers. Gehäuse, Räder und Messer sollten in einwandfreiem Zustand sein. Lass das Messer bei Bedarf schleifen oder austauschen – ein scharfes Messer schneidet sauber und spart Energie. Bei Benzin-Rasenmähern ist ein Ölwechsel ratsam, bei Akkumodellen sollte der Akku vollständig geladen sein. Auch der Luftfilter verdient einen prüfenden Blick.
Ein gut gewarteter Mäher arbeitet effizienter, ist sicherer im Umgang und sorgt für ein gleichmässiges Schnittbild. Am besten planst du die Wartung regelmässig ein – idealerweise vor dem ersten grossen Einsatz im Frühjahr.
Mulchen statt Müll
Beim Mulchmähen bleibt das Schnittgut klein gehäckselt auf dem Rasen liegen. Das hat zwei Vorteile: Es spart das Entleeren des Fangkorbs und führt dem Boden wertvolle Nährstoffe zu. So wird dein Rasen ganz nebenbei natürlich gedüngt. Alternativ kannst du Rasenschnitt auch kompostieren oder als Mulchmaterial in Beeten verwenden. Das spart Ressourcen, Zeit und tut der Umwelt gut.
Rücksicht nicht vergessen
Rasenmähen kann ganz schön laut werden – besonders bei benzinbetriebenen Geräten. Um die Ruhe der Nachbarschaft zu wahren, gelten deshalb feste Zeiten, in denen das Mähen erlaubt ist.
Werktags: 7–12 Uhr & 13–19 Uhr Samstags: 7–12 Uhr & 13–17 Uhr An Sonn- und Feiertagen ist das Rasenmähen nicht erlaubt –ganz gleich, wie hoch das Gras steht.
Fazit
Rasenpflege im Frühjahr ist gar nicht kompliziert. Mit dem richtigen Werkzeug, etwas Know-how und ein bisschen Zeit wird dein Rasen zur grünen Wohlfläche. STIHL und Toolster.ch helfen dir dabei – ob mit Mäher, Motorsense oder cleveren Tipps. Wenn du jetzt aktiv wirst, darfst du dich schon bald über eine sattgrüne Oase freuen, die den ganzen Sommer über Freude macht. Mehr Infos und Produkte findest du auf toolster.ch
Toolster.ch ist autorisierter STIHL-Partner und führt das gesamte STIHLAkku- und Gerätesortiment am Lager. Heute bestellt – morgen gemäht.

Der unverzichtbare Schlafbegleiter für auswärtige Übernachtungen auf Reisen, Ferien oder bei den Grosseltern! Für ein Gefühl wie zu Hause.
• ab 4 - 6 Monaten
• mehr Ruhe & Geborgenheit
• grosse Bewegungsfreiheit
• kein Abdecken
• gute Luftzirkulation
• hoher Qualitätsstandard







Seit 1962 steht ZEWI Switzerland für herausragende Qualität und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Babyprodukte. Als Schweizer Familienunternehmen mit bodenständigen Werten entwickeln wir mit Liebe Produkte, die durch ein verlässliches Sortiment und unseren hohen Qualitätsanspruch überzeugen. Mit unserem klaren Fokus auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit stehen wir Eltern als vertrauensvoller Partner zur Seite – für einen sicheren und liebevollen Start ins Leben ihres Babys.
Mittwoch & Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr Termine jederzeit nach Vereinbarung! 041 784 10 00
in vielen Grössen, Farben & Designs erhältlich! NEU in Cham!
„Ein Baby ist der Anfang von allem – Wunder, Träume und unendlichen Möglichkeiten“, sagt Sergej Leib, Geschäftsführer in dritter Generation. Um die Synergien optimal zu nutzen, haben wir unseren Verkaufsladen samt Outlet direkt im Erdgeschoss des Fabrikgebäudes integriert. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich unsere Kunden besonders beim Babybedarf gerne vor Ort von Qualität, Materialien und Sicherheit überzeugen. Der modern gestaltete Laden befindet sich an der Knonauerstrasse 58 in 6330 Cham und ist Mittwoch und Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Individuelle Termine sind nach Vereinbarung unter 041 784 10 00 möglich.
ZEWI Store & Outlet
Knonauerstrasse 58 6330 Cham family | trust | quality
@zewiswitzerland


Das Museum für Gestaltung Zürich ist weit mehr als nur ein Ort der Bewahrung und Ausstellung von Design. Es ist ein lebendiger Raum, in dem Design diskutiert und zu aktivem Handeln angeregt wird. Unter anderem bieten wir vielfältige Vermittlungsangebote für Kinder und Familien, die spannende Einblicke in gestalterische Themen bieten und zum Experimentieren, Selbermachen und Mitgestalten einladen.
Sparschäler, Knorrli und On-Turnschuhe: Wussten Sie, dass das Museum für Gestaltung Zürich die grösste internationale Designsammlung der Schweiz beherbergt? Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums wurde kürzlich die Dauerausstellung Swiss Design Collection im Toni-Areal eröffnet, die rund 2500 Objekte daraus präsentiert. Doch damit nicht genug: Die Ausstellung lädt Sie ein, selbst kreativ zu werden und zu gestalten.
Teil der Ausstellung ist das Studio. Dort ist das Publikum eingeladen, Design aktiv und mit allen Sinnen zu erleben. Hier können Sie selbst gestalten, Design ausprobieren, Ihr Wissen vertiefen oder einfach entspannen. In der Papierwerkstatt stehen Ideen und Materialien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereit –eine Einladung zum Falten, Experimentieren und Gestalten.
Darüber hinaus bietet das Museum im Jubiläumsjahr im offenen Atelier an der Ausstellungsstrasse jeden Sonntag Gestaltungsideen an, die sich auf die aktuellen Ausstellungen oder die Architektur des Museums beziehen. Die Themen
wechseln monatlich, sodass immer wieder neue kreative Impulse gesetzt werden.
Besuchen Sie das Museum für Gestaltung Zürich als Familie und lassen Sie sich von der Welt des Designs inspirieren! Neu gibt es unter 20 Jahren freien Eintritt.
Heute schon gestaltet?
– Offenes Atelier
Jeden Sonntag von 14:00 bis 16:30 Uhr Für Kinder, Familien, Erwachsene und Jugendliche Im Vermittlungsatelier an der Ausstellungsstrasse 60
– Papierwerkstatt
Für Kinder, Familien, Erwachsene und Jugendliche Während der Öffnungszeiten der Swiss Design Collection
– Kindertour durch die Swiss Design Collection Stuhlgeschichten
Aufgabenbogen für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung
– Parcours durch den Pavillon Le Corbusier Ma Promenade
Aufgabenbogen zum Selberlösen ab 9 Jahren


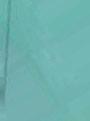
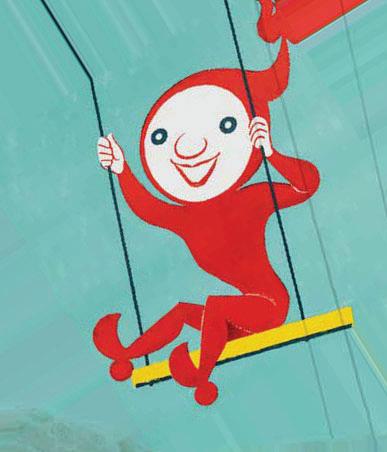

All diese Angebote sowie Workshops für Kinder und Familien und Anmeldungen finden Sie unter: museum-gestaltung.ch