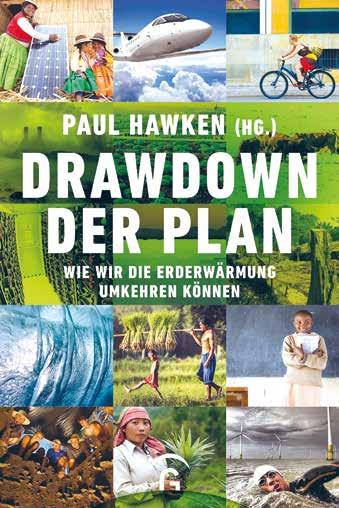
5 minute read
Schaffen wir‘s?
22 |
Text: Eckart Drössler
Advertisement
Das Wachstum der Zukunft heißt Pflanzenwachstum.
Seit Svante Arrhenius 1895 aus den Emissionen der Kohleverbrennung ausgerechnet hat, dass das zusätzliche CO₂ aus der Verbrennung zu einer Atmosphärenerwärmung führen wird, wissen wir um den Treibhauseffekt. Marion King Hubbart, damals Chefgeologe der Shell, später mehrfacher Universitätsprofessor, hat 1956 die Lebenszykluskurve von Ölquellen veröffentlicht und vorausgesagt, dass das Öl zu Ende gehen wird und als Dauerenergieträger nicht geeignet ist. Charles David Keeling ist es gelungen, Ende der 50er Jahre das erforderliche Geld zu bekommen, um den CO₂-Gehalt der nördlichen Hemisphäre zu dokumentieren. Seit 1957 können wir nun den Anstieg des CO₂-Gehaltes in der Atmosphäre an seinen Messreihen sehen. Der Club of Rome hat beim Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft bestellt, ausgerechnet die Volkswagenstiftung hat sie mit einer Million DM mitfinanziert. Dennis Meadows hat 1972 sein Buch „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlicht, das ganze Wissen ging als „Global 2000 Report“ an den Präsidenten der USA: Jimmy Carter. In Österreich wurde in der Folge die Umweltschutzorganisation Global 2000 gegründet. 1981 gab uns die erste „Ölkrise“ zu denken, 2008 die zweite.
Seit dem UN-Klimabericht des IPCC 2004 und deutlich unterstrichen durch den Bericht 2007 wissen wir, dass nicht die Verknappung von Öl den Takt für einen Wandel vorgibt, sondern die Erschöpfung der Atmosphäre, die die Abgase nicht mehr aufnehmen kann, ohne deutliche Veränderungen zu zeigen: die Extreme werden extremer und problematischer, im Mittel führt das zu einer Erwärmung.
Und seit etwa fünf Jahren wissen wir, dass ein Stopp der CO2-Emissionen, so schwer wir uns diesen auch vorstellen können, nicht mehr reicht, um die Klimakatastrophe zu vermeiden, es müssen Aktivitäten starten, die das CO₂ wieder aus der Atmosphäre holen und binden. Kann das noch gelingen? Nach all dem, was in dieser langen Anlaufphase alles nicht geschehen ist? Schauen wir mal, was sich in der Welt so tut. 50 Prozent der Weltkohleförderung braucht China, um unter anderem Billigprodukte für Europa und den Rest der Welt herzustellen. Aber in China ist auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein erwacht und wie zu erwarten, tut sich dort schneller mehr als anderswo. Schon 2015 hat China beschlossen, 1000 Kohlekraftwerke vorzeitig abzuschalten und die zugehörigen Kohleminen zu schließen, die Umstellung läuft in großem Stil. Stattdessen baut China 22 Mega-Solarkraftwerke entlang der nördlichen Ausläufer des Himalaya-Gebirges, eine trockene und sonnenreiche Region, jedes einzelne mit der Leistung eines Atomreaktors. 2016 überholte mengenmäßig der Strom aus der Sonne (inklusive Photovoltaik, die in China expandiert wie sonst nirgendwo) den Strom aus der Kohle. In China gehen täglich mehr neue Elektrobusse in Betrieb, als die Londoner Verkehrsbetriebe in ihrer Flotte haben. Unlängst hat der Hersteller der Londoner Doppeldeckerbusse mit BYD (Build Your Dreams, dem größten chinesischen E-Bushersteller) eine Kooperation gegründet, um den typischen Londoner Doppeldeckerbus mit Elektroantrieb herstellen zu können. Und im vergangenen Jahr hat China mehr Windkraftanlagen in Betrieb genommen als Deutschland seit dem Beginn dieser Entwicklung.
Indien ist der zweitgrößte Kohleverbrenner der Welt. Die Kohle kam hauptsächlich aus Australien. Mit Jahreswechsel 2015 auf 2016 hat Indien die australische Kohle abbestellt. Man will vorerst die eigene Kohleförderung ausweiten, das eingesparte Geld in schwimmende Windparks und große PV-Anlagen investieren (100 GW PV-Leistung zusätzlich bis 2022) und die Kohle dann abschalten. Diesel-Elektrische Züge fahren in Indien inzwischen mit PV-Modulen auf den Dächern der Waggons, um die auf der Fahrt gewinnbare Sonnenenergie zu nutzen und damit den Dieselverbrauch zu senken. Rund eine Milliarde Dollar wird jährlich investiert, um die Beleuchtung der Städte auf LED umzustellen, 20 Millionen Lampen jährlich.
Die norwegische Pensionskasse hat ihr Vermögen aus der Kohleproduktion abgezogen, die staatliche Ölgesellschaft Statoil hat den Auftrag bekommen, im großen Stil in schwimmende Windparks zu investieren und bei den Neuzulassungen privater PKWs haben E-Fahrzeuge die Verbrenner bereits überholt.
Viele kleinere Länder (oder Inseln oder auch Städte) haben zumindest in der Stromversorgung die „100 Prozent Erneuerbar-Marke“ erreicht: Costa Rica, Uruguay, Pacific Islands, El Hierro, Wildpoldsried im Allgäu ist zum Exporteur von Strom aus Biogas, PV und Windenergie geworden. Das sind bestimmt nicht alle.
Seit etwa fünf Jahren wissen wir, dass ein Stopp der CO2-Emmissionen nicht mehr reicht, es müssen Aktivitäten starten, die das CO2 aus der Atmosphäre holen und binden.
Weltweit wurde die PV-Wachstumsrate unterschätzt, Prognosen werden übertroffen, die Zuwachsrate verdoppelt sich alle zwei Jahre, denn PV ist deutlich rentabler als vorhergesagt.
Die großen Automobilhersteller geben laufend kund, wann sie die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einstellen wollen, zuletzt haben die konservativen General Motors das Ende der Verbrenner mit 2035 datiert. Sogar Großbritannien will ab 2030 keine Verbrenner mehr zulassen, ist damit vielen anderen Ländern gefolgt. Coca Cola Deutschland will seine Flotte bis 2025 komplett auf E-Fahrzeuge umgestellt haben. UPS betreibt dazu sogar eigene Entwicklungen für elektrische Leicht-LKW für Ballungsräume.
Und in Österreich sind in den letzten beiden Jahren unter grüner Regierungsbeteiligung hinter der turbulenten Corona-Kulisse Beschlüsse gefasst worden, die in den 20 Jahren davor nicht gelungen sind. Wir spüren das in der Energieberatung, die Nachfrage lag 2020 um den Faktor 3 höher als der Mittelwert der Jahre 2016 bis 2018, in der aktuellen Hochrechnung für 2022 um den Faktor 5 höher als 2016-18.
Auch in Vorarlberg fallen große und wichtige Entscheidungen, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft: Das Bauunternehmen Tomaselli Gabriel hat in einem Streich alle Bauleiter-Fahrzeuge auf E-Autos umgestellt, damit 30 Prozent des Dieselverbrauchs reduziert. Die Firmen Kräutler Elektroantriebe in Lustenau und Bauschlosserei Kalb in Dornbirn erzeugen 80 Prozent des Jahresstrombedarfs über PV am eigenen Gebäude. 11er in Frastanz gewinnt aus den Kartoffelschalen, die zuvor Abfälle waren, im eigenen Reaktor Biogas und betreibt damit die LKW-Flotte. Dies um auch einige wenige heimische Beispiele mit großer Wirkung zu nennen, stellvertretend für viele weitere. Wir wissen aber: das ist nicht genug. Was tut sich im Bestreben, das überschüssige CO₂ wieder aus der Atmosphäre zu holen? Es gilt, CO₂ aus der Atmosphäre zu gewinnen und auf verschiedene Arten möglichst langfristig zu binden. Holzbau ist ein gutes Beispiel, Vorarlberg hat eine lange Tradition und hohes Niveau darin. Die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen (NAWAROs) für Dämmung ist der nächste logische Schritt. Begonnen hat es in Schweden, kein Wunder, Svante Arrhenius war ja Schwede, wenn er auch eine Zeitlang bei Ludwig Boltzmann an der TU Graz gewirkt hat. Schweden hat 1903 ein strenges Forstgesetz beschlossen und in den letzten 100 Jahren die Waldfläche trotz intensiver Nutzung fast verdoppelt. Seit 1994 gibt es ein zusätzliches, gleichrangiges Gesetz, dass auch die Artenvielfalt verbessern soll.
Peking litt in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts an rund 50 Tagen im Jahr an Staub, der aus der Wüste Gobi in die Stadt getragen wurde. Man hat einen Waldgürtel angepflanzt und heute ist die Zahl der Tage mit Wüstenstaubbelastungen in der Stadt auf 0,5 pro Jahr gesunken: Dank >>









