

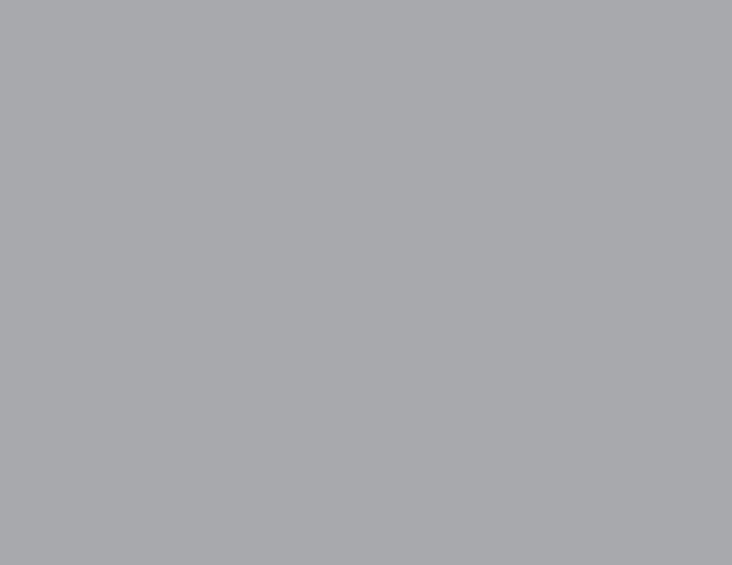






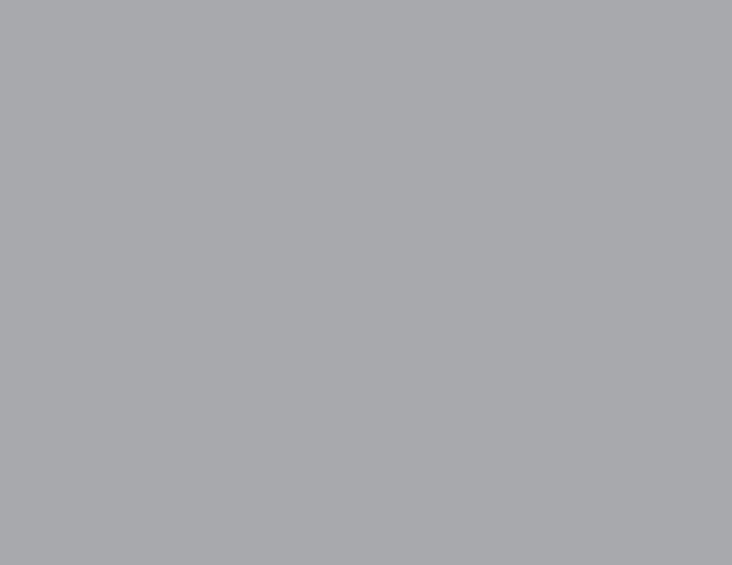





















Gesundheit, Glück und Wohlbefinden hängen nicht einfach vom Zufall oder von den Genen ab. Sie gründen auf dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren und Prinzipien. Die meisten davon können wir aktiv und massgeblich beeinflussen. NewstartPlus, ein modernes, international bekanntes, wissenschaftlich bewährtes und ganzheitlich angelegtes Gesundheitskonzept, fasst sie anschaulich zusammen. Jeder ein-
zelne Buchstabe von Newstart Plus steht für ein Prinzip, das einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit, Glück und Lebensqualität hat. NewstartPlus entfaltet seine volle Kraft im Zusammenwirken aller zwölf Prinzipien. In jeder Ausgabe beleuchtet «Leben und Gesundheit» eines davon. NewstartPlus lädt Sie ein, neu zu starten und das Plus für Ihr Leben zu entdecken.


Exercise
Belebt Körper, Seele und Geist!
Es gibt kaum etwas, was Ihre Gesundheit und Lebensqualität so ganzheitlich fördert wie körperliche Aktivität. Bewegung trainiert die Muskeln, bringt den Kreislauf in Schwung, ist gut für das Gehirn, fördert den Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem, steigert das Selbstwertgefühl, belebt soziale Beziehungen und verleiht ganz nebenbei ein gutes Aussehen. Bewegung wirkt gegen Herzerkrankungen, Zuckerkrankheit,


Brust- und Darmkrebs, Verstopfung, Osteoporose, Demenz, psychische Störungen und andere Leiden. Regelmässigkeit ist dabei wichtiger als die Intensität. Bewegung ist allgemein leicht auszuführen, kostengünstig und (praktisch) frei von schädlichen Nebenwirkungen. Mit Recht haben weise Menschen bereits vor Jahrhunderten Bewegung als Universalheilmittel bezeichnet. Bewegung belebt und macht glücklich.
«Nur



Kennen Sie Menschen, die stets rasch begeistert sind? Meist bringen sie viele Ideen mit sich und lieben Abwechslung. Wo andere erst nachdenken, sind solch fröhliche und meist gut gelaunte Leute schon drei Schritte weiter. Allerdings tun sie sich nicht selten schwer damit, dass andere ihre Gedanken und Ideen nicht auf Anhieb verstehen und sich nicht sogleich mit ihnen auf den Weg machen. Ein anderer Typ Mensch ist der eher zurückhaltende, bescheidene, der meist mit Wenigem zufrieden ist. Hat dieser sich mit einer Idee erst einmal angefreundet, ist er schwer wieder davon abzubringen. Er zeichnet sich aus durch grosse Beständigkeit. Hat man einen solchen Menschen an seiner Seite, kann man sich ganz grossen Herausforderungen stellen, denn die Treue dieses Begleiters ist gewiss.
Beide Charaktere haben etwas gemeinsam: sie sind in Bewegung. Der eine tut gleich drei Schritte auf einmal, muss dann jedoch meist ein bis zwei Schritte wieder zurücktreten. Der andere tut seine Schritte einen um den anderen. Keinen zu viel, vielleicht ab und zu einen zu wenig.
Welche Beschreibung trifft besser auf Sie zu?
Auch wenn Sie sich in keinem der beiden «Typen»
zu 100 % wiederfinden, dürfen Sie glücklich darüber sein, wie Sie sind. Jeder Mensch ist ein Individuum mit Stärken und Schwächen, aber wir alle sind umgeben von Menschen, die uns ergänzen, ausgleichen und in den unterschiedlichsten Lebenslagen unterstützen. Dafür sollten wir viel mehr dankbar sein. Es ist eine Freude, dass es Menschen gibt, die spontan vorangehen und andere, die sich durch diesen Motivationsschub anstecken lassen und das vorgeschlagene Projekt in Angriff nehmen. Wo dem «Ideengeber» vielleicht schon allmählich die Luft ausgeht, tritt der «Beständige» ein und führt die Sache zu einem guten Ende. Gemeinsam kann so grosses erreicht werden. Was für ein Glück ist es, Schritte tun zu dürfen und damit in Bewegung zu sein. Nicht nur körperlich, sondern ganzheitlich, also auch geistig, geistlich und seelisch. Wie gut, wenn wir uns in unserer Einzigartigkeit annehmen können und gleichzeitig mit anderen Menschen beweglich und bewegt unterwegs bleiben.
Mit der vorliegenden Ausgabe zum Schwerpunktthema «Bewegung» wünsche ich Ihnen in diesem Sinn viel Freude und vielseitige Anregungen, in allen Lebensbereichen Schritte zu tun.


Inhaltsverzeichnis
Schwerpunkt:
Bewegung
Abgucken erwünscht – so kommen wir in Bewegung!

Mosaik
Kurz und aktuell informiert
Interview
Interview mit Schwingerkönig
Matthias Sempach
Lebensweisheiten
Ein paar Tropfen Lebensweisheit
ADRA
«Markttag in Bewegung»
Familiengeschichte
Von Vorsicht und Weitsicht

Staunen und entdecken
Unterwegs mit 1 670 km/h
Praxisfenster
Zu Risiken und Nebenwirkungen …















Exklusivinterview mit Schwingerkönig



Alltagstipps
Wenn der Schmutz Staub ansetzt …
Rezepte
Frühstück fertig los …
Unsere Heilpflanzen
Huflattich – hilfreich gegen Husten
Denksport
Preisrätsel und Sudoku
Kinderseite
Zeitungshut
Körperwunder
Immer in Bewegung – der Herzmuskel
Fitness
Obere Extremität –Koordination, Kraft und Beweglichkeit

Gehirnjogging oder Jogging fürs Gehirn


Kursangebote – Vorträge
Impressum




Kolumne
Schwung fürs Leben
Vorschau
Lebensweisheit
Je mehr du in Bewegung bist …









... Kinder sollten nicht angeleitet werden mit Essen zu spielen.
Frau F. aus Sissach
Rückmeldung dazu:
Frau F. hat durchaus recht. In einer Zeit, da viele Menschen keine Nahrungsmittel haben, soll mit Essen nicht gespielt werden! Bei der Kinderseite mit dem Artikel «Bananenschliffli ahoi» (S. 43) von der Januar – Februar 2014 Ausgabe, waren nur die Segel als Bastelanleitung gedacht. Das Bananenschiffli sollte ein gesundes «Dessert» für Mami und Papi sein, und war nicht zum Spielen gedacht.
Aktuell leiden weltweit 44 Millionen Menschen an Demenz. Im Jahr 2030 werden es 76 Millionen sein, und 2050 wird sich ihre Zahl nochmals verdoppelt haben – auf 135 Millionen. Diese Zahlen hat Alzheimer’s Disease International (ADI) veröffentlicht.
Mit ihrem Sondergipfel vom Dezember 2013 stellten die G8-Staaten das Thema Demenz in den Mittelpunkt. Folgendes soll u. a. gemeinsam angepackt werden:
• bis 2025 sollen Heilmittel und Therapieformen gefunden werden

«Leiden» Sie unter kalten Füssen? Ein einfacher Tipp lautet: Kniesocken. Hosen liegen im Gegenteil zum Oberschenkel nicht eng am Unterschenkel. Dadurch entsteht eine Kältezone, welche die Wärmezufuhr zu den Füssen unterbricht. Mit Kniesocken wird diese Kältezone überbrückt, sodass nun auch die Füsse warm bleiben. Probieren Sie es aus, es wirkt! Dasselbe Prinzip gilt für die Unterarme und Hände. Darum bei kühlen Tagen die Ärmel der Bluse oder des Pullovers bis zu den Handgelenken ziehen, damit auch die Unterarme bedeckt sind. Auch im Frühling empfiehlt es sich, noch darauf zu achten, dass alle Gliedmassen gleichmässig und möglichst mit bequemer Kleidung anliegend bedeckt sind. Die Mode bringt es mit sich, dass zu kurze Shirts immer öfter die Nieren freilegen. Auch hier gilt es, ein möglichst eng anliegendes Kleidungsstück möglichst aus Baumwolle bis zur Mitte des Gesässes zu tragen.
Um die Durchblutung in den unteren Extremitäten intensiv anzuregen, empfiehlt sich das Wechselbad. Das warme Bad 36–42 °C; das kalte Bad 12–15 °C. Tauchen Sie beide Füsse zuerst 5 Minuten lang in das warme Wasser, danach 10–15 Sekunden lang in das Kalte. 3 bis 5 Mal wiederholen und mit kaltem Wasser abschliessen. Füsse mit einem in kaltem Wasser eingeweichten Tuch abreiben und Wollsocken anziehen. Dies können Sie bis zu 3 Mal am Tag durchführen.
Ein letzter Tipp, um warme Füsse zu bekommen: Unternehmen Sie einen Spaziergang von 30 Minuten! red/sf
• der Betrag zur Demenzforschung soll deutlich erhöht werden
• Erhöhung der Anzahl der Menschen, die an klinischen Studien teilnehmen
• Schaffung eines internationalen Aktionsplanes für Demenzforschung
• Austausch von Informationen und Daten aus der Demenzforschung unter den G8-Staaten.
• Alle öffentlich finanzierten Daten aus der Demenzforschung sollen so schnell wie möglich auch öffentlich zugänglich gemacht werden.
Az/alzheimer/www.gov.uk

Mosaik
Die Rubrik «Mosaik» in «Leben und Gesundheit» ist eine Plattform für kurze interessante Texte, Bilder und Informationen. Auch Sie als Leserin oder Leser können zu Wort kommen bzw. Bilder einsenden. Nutzen Sie die Kontaktadresse: «Leben und Gesundheit», Mosaik, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen oder die E-Mail-Adresse: redaktion@lug-mag.com
In enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Verwaltung für Umwelt sowie mit der Handelskammer von Luxemburg (clc) hat Valorlux im Januar 2004 die Aktion «ÖkoTasche» ins Leben gerufen, um Einweg-Einkaufstüten soweit wie möglich zu vermeiden und Rohstoffe einzusparen. Zu diesem Zweck hatten das Umweltministerium und Valorlux ein freiwilliges Abkommen unterzeichnet, das 2008 und 2012 um jeweils fünf Jahre verlängert wurde. Im Jahr 2012 wurde die «Öko-Tasche» von der Europäischen Kommission als Vorbild für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bezüglich der Abfallvermeidung ausgewählt. 475 Millionen Einwegtüten weniger wurden 2004–2013 in Umlauf gebracht. Die Öko-Tasche ist jederzeit gratis umtauschbar, sollte sie einmal beschädigt sein. valorlux.lu

Humor
«Die neuen Laufschuhe werden die ersten Tage etwas drücken», sagt der Verkäufer. «Das macht nichts. Ich wollte sowieso erst nächste Woche mit dem Joggen beginnen».
für

Amarant (Amaranthus caudatus) war bereits vor langer Zeit für die Azteken und Inkas in Mittelamerika eine wichtige Pflanze. Sie gehört nicht, wie oft vermutet wird, zu den Getreidearten, sondern zu den Fuchsschwanzgewächsen, von denen es auch in Europa einige Arten gibt. Die Pflanze bildet grosse Fruchtstände, die viele kleine, gelbe bis rötliche, hirseähnliche Samen enthalten. Sie ist wärmebedürftig, stellt aber nur wenige Ansprüche an den Boden. Es gibt eine Vielzahl von Sorten, von denen einige im biologischen Landbau genutzt werden. Vorteilhaft für die Ernährung ist die Eiweisszusammensetzung der Samen. Sie weisen einen relativ hohen Gehalt an Lysin und Methonin auf. Diese beiden Aminosäuren kommen im Getreide nur in geringen Mengen vor. Für Vegetarier ist Amarant daher eine gute Eiweissquelle. Die Samen enthalten auch Kalzium, Eisen und Zink. Die Verwendung in der Küche kann verschiedenartig erfolgen. Die Samen lassen sich für Suppen und Aufläufe verwenden. Durch intensive, trockene Hitze können die Körner auch gepoppt werden, wodurch sie einen nussartigen Geschmack entwickeln. Amarant-Mehl lässt sich aus unbehandelten oder gepoppten Amarant-Samen herstellen. Da es kein Klebereiweiss enthält, eignet es sich nur beschränkt zur Herstellung von Brot und anderen Backwaren. grk
und was dabei zu beachten ist:
• Die Länge der Stöcke sollte für Anfänger 0,66 Mal und für Fortgeschrittene 0,7 Mal die Körpergrösse betragen.
• Die Stöcke sollten möglichst nahe am Körper geführt werden.
• Der Stock sollte mit der gegenüberliegenden Ferse aufsetzen und am Ende der Bewegung diagonal zurückgeführt werden.
• Die Hände sollten den Stock nicht zu fest greifen, damit dieser leicht nach vorne schwingen kann.
• Oberkörper, Hüfte und Schultern sollten entspannt und locker sein und natürlich mitschwingen.
• Ein Bein soll immer am Boden sein – mit den Zehen abdrücken und dabei die Hüfte nach vorne bewegen.
• Ein Spezialschuh ist nicht nötig. Achten Sie jedoch auf ein gutes Profil und darauf, dass der Schuh der Witterung angepasst ist.
• Die Kleidung soll bequem und atmungsaktiv sein. Wenn Sie mehrere Lagen anziehen, können bei steigender Körperwärme auch Teile ausgezogen werden.
• Starten Sie langsam: Empfohlen sind drei Trainingseinheiten pro Woche mit einer Dauer von jeweils 15 Min. Mit der Zeit können Sie die Länge der Märsche beliebig steigern.
Fehlt Ihnen die Motivation, alleine «durchzustarten», gibt es bestimmt einen Nachbarn oder einen Freund, der Ihrer Aufforderung zum gemeinsamen Marsch dankbar nachkommt. red/sf




DR. MeD. RueDi BRODBecK Hausarzt / Psychosomatiker, Alchenflüh, CH
Über die erstaunlich vielseitigen, positiven Auswirkungen regelmässiger körperlicher Aktivität.
Wenn ich an einem dunklen Wintermorgen merke, dass ich Mühe habe, aus dem warmen Bett und in die «Gänge» zu kommen, hilft mir eine kurze, intensive Bewegungseinheit auf meinem Cross-Trainer. Spätestens nach der folgenden Dusche fühle ich mich völlig wach, neu belebt, leistungsfähig. Wenn ich an einem Sommerabend von einem langen Praxistag müde und erschöpft bin und trotzdem noch einen Spaziergang entlang dem
nahegelegenen Fluss mache, mit meiner Frau zu einer kurzen Ausfahrt mit dem Tandem aufbreche oder im See schwimmen gehe, dann fühle ich, wie die Last des Tages schwindet; ich komme wieder zu mir selber, fühle mich neu belebt. Manche behaupten, Sport sei Mord. Ich erlebe ihn als wohltuend. Entspringt dies bloss subjektiver Wahrnehmung, oder ist mehr daran? Leben Langläufer wirklich länger – oder sehen sie bloss älter aus? Oder – noch
schlimmer – sterben sie bloss gesünder?
Ein Blick in die Medizingeschichte
In der Geschichte der Medizin wurde schon früh die Bedeutung von körperlicher Aktivität für die Gesundheit beschrieben. Erste Berichte stammen aus der Zeit um 2500 v. Chr. Im alten China wurden gezielt körperliche Bewegungsübungen zur Förderung der Gesundheit
eingesetzt. Die wohl bekanntesten Ärzte der Antike, Hippokrates (460–370 v. Chr.) und Galen (129–210 n. Chr.), haben beide aufgrund der gesundheitlichen Vorteile körperliche Aktivität sowohl vorbeugend empfohlen als auch therapeutisch verschrieben. Im 19. Jahrhundert behauptete der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche: «Wer sich stets zu viel geschont hat, der kränkelt zuletzt an seiner vielen Schonung», und Ellen White, eine amerikanische Gesundheitsreformerin, ergänzte: «Es sterben mehr Menschen aus Mangel an körperlicher Bewegung als an Überanstrengung. Bewegungsmangel ist die Ursache vieler Krankheiten.» Die moderne wissenschaftliche Medizin hat ihre Wurzeln ebenfalls im 19. Jahrhundert. Es dauerte allerdings bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, bis eine erste Studie auf einen entgegengesetzten Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem Auftreten von Krankheiten hingewiesen hat. Der Vergleich zweier Berufsgruppen zeigte, dass die körperlich aktiven Schaffner der berühmten (roten) Londoner Busse deutlich weniger Herzinfarkte erlitten als ihre körperlich weniger aktiven Chauffeure. Ähnliche Untersuchungen, z. B. der Vergleich zwischen Schalterbeamten der Post und Briefträgern, bestätigten diesen Zusammenhang. Was weiss man heute? Wirkt Bewegung, und wenn ja, wie? Wie viel benötigt man? Gibt es auch ein Zuviel?
Muskeln, Knochen und Gelenke
Der primäre Wirkungsort von körperlichem Training sind die Muskeln. Es ist allgemein bekannt, dass es nicht nur zu einer Volumenzunahme kommt, sondern auch zu einem Gewinn an Kraft und Ausdauer. Dies kommt durch Anpassungsvorgänge innerhalb des Muskelgewebes zustande. Es werden mehr Muskel-
fasern vom sogenannten Typ-1 oder S-Fasern gebildet. Im Vergleich zu den Typ-2 oder F-Fasern enthalten diese eine grössere Zahl von Mitochondrien (den Kraftwerken der Zellen), diese werden besser mit Blut versorgt (mehr Kapillaren), sie sind leichter in der Lage, Fettsäuren abzubauen, können mehr Sauerstoff aufnehmen und länger ihre hohe Leistung erbringen. Gemäss neuen Erkenntnissen steuert Bewegungstraining über regulatorische Prozesse auch den Abbau alter und verbrauchter und den Aufbau neuer Mitochondrien und verbessert somit deren Qualität. Wer seine Muskeln trainiert, erhält sie tatsächlich jung! Die Wirkung auf Knochen und Gelenke ist ebenfalls günstig. Der Knochen wird fester und die Gelenksfunktion bleibt länger erhalten, was auch für bereits vorgeschädigte Gelenke (z. B. Arthrose in Hüften und Knien) gültig ist. Ein (adaptiertes) Bewegungstraining wird deswegen bei Muskel-, Knochen- und Gelenkserkrankungen empfohlen, speziell auch bei rheumatoider Arthritis, Fibromyalgie und Osteoporose.
wechsel
Eine sitzende Lebensweise oder körperliche Inaktivität gilt heute hinter Zigarettenrauchen, hohem Blutdruck und erhöhtem Cholesterin als vierter grosser Risikofaktor für die Entwicklung der koronaren Herzkrankheit. Diese Risikofaktoren gilt es zu eliminieren. Folgerichtig ist deshalb ein angepasstes körperliches Training aus der Behandlung von Herz-Kreislauf- oder Lungenpatienten nicht mehr wegzudenken. Der Herzmuskel wird dadurch gestärkt, die Atemmuskulatur und Atemmechanik werden verbessert. Nur ein Teil des gesundheitsfördernden Effekts von Bewegung ist durch direkte Anpassungen im Bereich des Herzmuskels (wie oben beschrieben)
und durch die verbesserte Blutzufuhr zu erklären. Ein wesentlicher Teil der günstigen Wirkung erfolgt durch Veränderungen im Bereich des Stoffwechsels. Das Muskelgewebe beeinflusst nämlich über rund 400 verschiedene hormonähnliche Botenstoffe, sogenannte Myokine, auch die Funktion anderer Gewebe. Zusätzlich beeinflusst Bewegung auch wichtige epigenetische Mechanismen, die den Aktivitätsgrad unserer Gene steuern. In der Summe führt dies zu folgenden Veränderungen:
• bessere Regulation des Zuckerhaushalts, erhöhte Insulinsensitivität, bessere Einstellung bei manifester Zuckerkrankheit Typ 2
• günstigere Zusammensetzung des Fettgewebes, Reduktion des Bauchfetts und verbesserte Gewichtskontrolle
• verbesserter Fett- und Cholesterinstoffwechsel, Verminderung des gefährlichen LDL-Cholesterins und der Triglyceride, Erhöhung des schützenden HDL-Cholesterins
• Reduktion systemischer Entzündung
• Senkung des (erhöhten) Blutdrucks
• bessere Funktion des autonomen Nervensystems, bessere Darmtätigkeit
• besserer Blutfluss, verminderte Blutkoagulation (Verklumpung), bessere Endothelfunktion (bessere Funktion der inneren Oberflächen-Zellen der Blutgefässe, was vor vorzeitigem Altern schützt).
Alle diese Effekte zusammen bewirken, dass körperliche Aktivität bei der Arbeit oder in der Freizeit das Risiko für tödliche oder nichttödliche Herzinfarkte um praktisch die Hälfte verringert. Möchten Sie auf ein so wirksames «Medikament» verzichten?
• bessere Darmtätigkeit
• bessere Funktion des vegetativen Nervensystems
• stärkere Knochen
• bessere Gelenksfunktion
• gesteigertes seelisches Wohlbefinden
• weniger Angst und Depression
• bessere Wahrnehmung und besseres Gedächtnis
• qualitativ besserer Schlaf
• langsamerer Rückgang der geistigen Fähigkeiten im Alter
• Stärkung des Nervensystems
• Blutdruck
• bessere Durchblutung des Herzens
• bessere Herzfunktion
• Sinken des Triglycerinspiegels
• mehr HDL
• weniger LDL
• niedrigerer Blutdruck
• geringere Gefahr von Blutgerinnseln
• bessere Funktion des Endothels
(Endothel = Zellschicht, welche die Blutgefässe auskleidet)
• bessere Glukose-Homöostase
• bessere Insulin-Empfindlichkeit
• weniger Bauchspeck
• bessere Gewichtskontrolle
Was für das Herz gut ist, schützt auch das Gehirn. So erstaunt es nicht, dass regelmässige körperliche Aktivität auch viel zum seelischen Wohlbefinden und zum Stressabbau beiträgt. In der Therapie der meisten psychischen Erkrankungen ist ein günstiger Effekt von körperlicher Aktivität gut nachgewiesen, insbesondere bei Depressionen, Angststörungen, Phobien, Posttraumatischen Belastungsstörungen, Schizophrenie, Nikotinabhängigkeit und Essstörungen. Bemerkenswert finde ich, dass bei den häufigen Angststörungen und Depressionen die Bewegungstherapie von verschiedenen Autoren als gleich wirksam beurteilt wird wie eine Standardtherapie mit Medikamenten und/oder Psychotherapie. Wirksam ist Bewegung auch in der Vorbeugung und Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder anderen Demenzen.
Regelmässiges Training verbessert die sogenannten kognitiven Funktionen wie Gedächtnis, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Sprache. Wie Bewegung aufs Gehirn wirkt, ist noch nicht völlig geklärt. Gesichert gilt eine Normalisierung von bei Krankheiten erniedrigten Spiegeln von BDNF (brain-derived neurotrophic factor), einem für das Gehirn wichtigen Wachstums- und Schutzfaktor. Bewegung führt zu einer Verbesserung der neuronalen Plastizität, der Fähigkeit der Nervenzellen neue Verbindungen einzugehen, was eine Voraussetzung für sämtliche Lern- und Gedächtnisprozesse und auch für den Erhalt einer guten Stimmung ist. Zudem fördert Bewegung auch die Neurogenese, die Bildung neuer Nervenzellen. Weitere Mechanismen, die zur verbesserten Stimmung und Funktion beitragen, sind das Ausschütten von Botenstoffen wie Serotonin und Endorphinen. Die letzt-
• weniger Schmerzen
• weniger Sucht / Abhängigkeit
• Stärkung der Mitrochondrien
• bessere Fettsäuren-Verbrennung
• bessere aerobische Kapazität
• bessere Funktion des Immunsystems
• weniger Krebserkrankungen
• besseres Therapieansprechen
• weniger systemische Entzündungen
genannten Mechanismen sind wahrscheinlich für die günstige Wirkung von Bewegung bei Schmerzerkrankungen verantwortlich.
Krebs und Immunsystem
Ein regelmässiges körperliches Training stärkt auch das Immunsystem. Dies kann an einer nach dem Training auftretenden Verbesserung vieler einzelner Parameter des Immunsystems nachgewiesen werden. Noch wichtiger scheint mir jedoch das verminderte Auftreten von Krebserkrankungen zu sein. Besonders deutlich ist dies bei Dickdarmkrebs (– 25 %) und bei Brustkrebs (– 12 %). Es gibt auch Arbeiten, die auf ein vermindertes Auftreten von Krebs im Bereich von Prostata, Gebärmutter, Eierstöcken, Bauchspeicheldrüse und Lungen hinweisen. Wahrscheinlich übt Bewegung einen generell schützenden Effekt aus. Das zur Erzielung eines nachweisbaren Effekts notwendige
Bewegungsausmass bezüglich Dauer und Intensität scheint aber je nach Erkrankung unterschiedlich zu sein. Als Wirkmechanismen werden direkte zelluläre Effekte im Zusammenhang mit der Tumorentstehung, das Immunsystem stimulierende und hormonelle Effekte (veränderte Ausschüttung von Geschlechts-, Wachstums- und anderen Hormonen), Stoffwechseleffekte und die Stimulierung einer besseren Abwehr gegen die schädliche Wirkung von freien Radikalen angesehen. Körperliches Training schützt nicht nur vor dem Auftreten von bösartigen Erkrankungen, sondern beeinflusst auch deren Verlauf. Es verbessert die Ansprechrate der durchgeführten Therapien, macht diese verträglicher und vermindert das Auftreten von Rückfällen. Zusätzlich werden gefürchtete Krankheitssymptome oder Therapienebenwirkungen wie Muskelschwäche oder chronische Müdigkeit günstig beeinflusst. Wie die gesunde Ernährung stellt regelmässiges körperliches Training heute bei Krebserkrankungen eine wichtige unterstützende Behandlung dar und sollte von keinem Betroffenen vernachlässigt werden.
Risiken und Nebenwirkungen
Ich erinnere mich: Herr L. erlitt auf der Langlaufloipe einen tödlichen Herzinfarkt. Herr B. verstarb auf einer leichten Wanderung nach kurzem Unwohlsein. Kannten vielleicht auch Sie jemanden, der während einer körperlichen Aktivität verstorben ist? Gibt es nicht trotz all der erwähnten Vorteile auch erhebliche Nachteile? Eine vor Jahren durchgeführte Umfrage des Deutschen Sportbundes ergab, dass innerhalb eines Jahres insgesamt 47 Mitglieder während der sportlichen Tätigkeit verstorben waren. Dies entsprach 0,0003 % der Sporttreibenden. Wesentlich gefährlicher
war mit 81 Todesfällen die Hinund Rückfahrt. Am gefährlichsten war aber mit 110 Todesfällen das Zuschauen. Nichtstun kann gefährlich sein! Tatsächlich kann es während des Sports zu plötzlichen Herztodesfällen kommen. Bei jungen Menschen trifft dies Sportler sogar häufiger als Nicht-Sportler. Allerdings kommt dies sehr selten vor und meistens wegen einer angeborenen, vorher nicht erkannten Herzerkrankung. Insgesamt besteht aber kein Zweifel: Männer und Frauen profitieren von zunehmender körperlicher Aktivität und Fitness. Je 1000 kcal pro Woche verbrauchter Bewegungs energie reduziert sich das relative Sterberisiko um 20 % bis 35 %. Allerdings gilt es hier zu berücksichtigen, dass die «Dosis-Wirkungs-Kurve» zunehmend flacher wird. Ab einem bestimmten Aktivitätsgrad (etwa 3500 kcal / Woche) ist kein zusätzlicher Gesundheitseffekt mehr zu erwarten.
Körperliche Inaktivität ist eine Ursache vieler Krankheiten. Das «Universalheilmittel» regelmässige Bewegung trägt zur Verminderung des Krankheitsrisikos, zur Therapie vieler Erkrankungen, zur Verlängerung der Lebenserwartung, zum Erhalt der Selbstständigkeit im Al-
ter und zum generellen Wohlbefinden bei.
«Für Bewegungsmuffel: Muss Bewegung immer Spass machen? Nein, denn Bewegung ist Therapie. Therapie muss nicht Spass machen.» Die Dozentin, die dies während einer medizinischen Fortbildung behauptete, forderte auf, es wie bei Medikamenten zu machen. «Täglich die entsprechende Dosis! Niemand kommt auf die Idee, die ganze Wochendosis an bloss ein oder zwei Tagen zu schlucken.» Untrainierte Menschen sollten es zu Beginn langsam angehen. Der Nutzen wird stärker von der Regelmässigkeit bestimmt als von der Intensität. Wer nicht mehr sprechen kann, ist zu schnell, wer noch singen kann, eher zu langsam unterwegs. Während akuten Erkrankungen, Fieber, aktiven Gelenksentzündungen oder wenn Bewegung die Schmerzen wesentlich verschlimmert, sollte pausiert werden. Täglich ein flotter Spaziergang von einer halben Stunde (3 km) bringt bereits 50 %, eine ganze Stunde etwa 90 % des möglichen Nutzens. Für Inaktive wirkt sich jede körperliche Bewegung vorteilhaft aus. Regelmässig, am besten täglich durchgeführt, ist die Wirkung auf Lebensqualität und Lebensdauer noch ausgeprägter. Bewegung belebt!





BeTTina WeRneR
Physiotherapeutin und Mitarbeiterin beim Deutschen Verein für Gesundheitspflege (DVG), Stuttgart, D
–so kommen wir in Bewegung!
Kennen Sie das auch noch aus Ihrer Schulzeit? Man schreibt eine Klassenarbeit, hat sich mehr oder weniger gut vorbereitet und verspürt doch den grossen Drang, beim Nachbarn abzugucken. Wehe aber, wenn man vom Lehrer erwischt wird! Dann gibt es einen Verweis, eine schlechte Note und eine Meldung an die Eltern. Da heisst es, gut zu überlegen, ob man diese Folgen in Kauf nimmt oder nicht doch lieber ehrlich und selbstständig seine Arbeit schreibt.
Warum also diese Überschrift?
Sollen Sie doch zum Abgucken animiert werden?
Meine Antwort lautet aus vollem Herzen: JA.
Kinder – meine Vorbilder Ich bin ein grosser Fan von Kindern. Sie anzuschauen und zu beobachten bereitet mir riesige Freude. Als meine eigenen Kinder ganz klein waren, hätte ich stundenlang sitzen können, um das Spiel ihrer kleinen Finger und Zehen zu beobachten. Spä-
ter amüsierte ich mich köstlich, wenn meine Tochter auf allen vieren durch den Garten robbte oder die Jungs mit Feuereifer auf ihren kleinen Laufrädern um die Wette fuhren. Ich beobachtete sie beim Bauen von Baumhütten und lachte laut, wenn sie ihre Kaninchen im Zickzacklauf wieder einfangen wollten.
Sie bauten sich die tollsten Gefährte aus Kinderwagenunterteilen und alten Zinkbadewannen, Flösse aus Holz und Seilen. Sie spielten mit Topfdeckeln,
Decken und Tüchern Zirkus, veranstalteten mit einem wassergefüllten Schlauchboot Seeschlachten auf der Wiese, und im Winter wurden mit ganzer Hingabe die schönsten Schneehöhlen gebaut.
Ja, Kind müsste man sein!
Als Kind ist man ständig in Bewegung. Das fängt beim Windelwechsel schon an. Von wegen schön brav still liegen!
Strampeln mit den Beinchen ist doch viel schöner! Kinder sind neugierig, erwartungsvoll, abenteuerlustig und begeisterungsfähig. Kinder hüpfen vor Freude, rennen, klettern, schaukeln, springen und toben. Sie fassen an, fühlen, riechen, hören, sehen, rangeln, balancieren und testen aus. Kinder brauchen keine Massen an Spielzeug, sondern ganz alltägliche Dinge wie Wäscheklammern, Pappe, Kartons, Luftballons, Töpfe, Decken, Tücher, alte Klamotten … Mit ihrer Fantasie bauen sie sich ihre Welt und erobern gleichzeitig ihre Umwelt. Sie denken nicht an Gesundheit und Fitness und haben auch nicht den Wunsch, einen schönen, trainierten Körper zu besitzen. Sie bewegen sich einfach aus dem Grund heraus, weil sie Freude und Spass dabei erfahren wollen. Und genau das ist absolut «abguckwürdig»!
Seien Sie nicht zu erwachsen, sondern bleiben Sie ein ganzes Stück Kind
Bewegung ist in jedem Altersabschnitt ein wahres Wundermittel. Schon zehn Minuten Bewegung am Tag hebt die Stimmung. Je mehr Sie sich bewegen, desto mehr körpereigene Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, werden freigesetzt. Serotonin macht gute Laune und vermindert Angstgefühle. Noradrenalin stärkt das Selbstbewusstsein und Dopamin beeinflusst unser körpereigenes Belohnungssystem, sodass Glücksgefühle entstehen. Ganz nebenbei werden auch noch Stresshormone abgebaut.
Durch Bewegung können wir unseren Körper bewusst erleben und lernen, besser mit ihm umzugehen. Balancieren auf der Bordsteinkante des Fussweges, auf einem umgestürzten Baumstamm oder auf einer gedachten Linie stärkt das Körpergleichgewicht. Das Schwingen eines Hula-Hoop-Reifens um die Hüfte fördert die Beweglichkeit. Die Fortbewegung mit einem Hüpfball macht Spass und trainiert die Gesäss- und Beinmuskulatur. Sich mit verbundenen Augen in der eigenen Wohnung zurechtzufinden, sensibilisiert die innere Wahrnehmung und stärkt die Bewegungssicherheit. Es gibt unendlich viel zu entdecken und zu erforschen. Eine kindliche Lebenseinstellung (nicht zu verwechseln mit kindisch) bereichert und macht froh. Das Leben wird bunter, reicher, staunenswerter und fröhlicher. Probieren Sie es aus!
Unser Körper – ein Wunder – will bewegt sein
Unser Körper ist auf das Wunderbarste für Bewegung eingerichtet. Er besteht aus ei-
nem ausgeklügelten System von miteinander arbeitenden Knochen, Muskeln, Bändern und Gelenken. Etwa 650 Muskeln stehen in Wechselwirkung mit 206 Knochen und sind für jede Bewegung unseres Körpers verantwortlich. Es herrscht ein perfektes Zusammenspiel. Der Körper geht immer davon aus, dass alle Muskeln, Knochen, Bänder usw. gebraucht werden. Wenn man aber den ganzen Tag sitzt und keinen Sport treibt, verordnet man seinem Körper ein «Sparprogramm». Alles, was nicht benutzt wird, baut er ab, weil es vermeintlich nicht benötigt wird. Das heisst: Die Muskeln verlieren ihre Kraft, ihre Länge und ihre Dehnbarkeit. Das wiederum beeinträchtigt die Körperstatik und kann zu entsprechenden Folgebeschwerden führen. Tägliche Bewegung dagegen erhöht die Spannung und Geschmeidigkeit der Muskeln. Der Muskelaufbau wird gefördert und somit das Knochengerüst vor Fehlbelastungen bewahrt. Eine kräftige Muskulatur kann die Knochen und Gelenke optimal abstützen.

Plus, plus, plus ...
Ein weiterer Vorteil regelmässiger Bewegung liegt darin, dass dadurch das Herz stärker und leistungsfähiger wird und vergrössert werden kann. Ein durch Training grösseres Herz ist gesünder und kräftiger. Bewegung intensiviert auch die Atmung. Zwerchfell und Zwischenrippenmuskeln arbeiten verstärkt. Die Lunge kann sich mehr ausdehnen und wird somit tiefer belüftet. Es wird mehr Sauerstoff aufgenommen. Dadurch steigt der Sauerstoffgehalt des Blutes an. Das wiederum fördert die Sauerstoffversorgung der Muskulatur und erhöht die Leistungskraft des Körpers und des Geistes. Die Ausdauer wird gefördert, Konzentrationsfähigkeit und Körperbewusstsein verbessern sich, Stimmung und Selbstwertgefühl steigen an und die individuelle Kreativität verbessert sich. Beweglichkeit macht mobil, der Alterungsprozess verlangsamt sich und das Wohlbefinden steigt. Und nicht zuletzt hält eine starke Muskulatur unter der Haut auch die Gesichtszüge glatt und frisch. Das ist der Traum aller und vollzieht sich ganz ohne Botox. Sicher: Es ist nicht leicht, den «inneren Schweinehund» zu überwinden und sportlich aktiv zu werden. Wer aber für einen Ausgleich zu seinem Berufsalltag sorgt, wird schnell vielfältige Veränderungen an seinem Körper erleben. Die wohltuende Wirkung eines scheinbar kleinen Pensums an regelmässiger Bewegung ist so umfassend und tiefgreifend, dass man sehr bald ihren Wert zu schätzen weiss.
Wie schaffe ich den ersten Schritt?
Wichtig sind die ersten Schritte, sozusagen der «Anstoss» für den Körper. Wer seinen Körper in Schwung gebracht hat, dem fällt das Weitermachen leichter, denn es braucht nicht mehr so viel Energie, um in Schwung zu bleiben. Das früher so schwere Aufraffen weicht
über kurz oder lang der Freude an der Bewegung. Erfahrungsgemäss macht Bewegung allein nicht so viel Freude. Auch in diesem Punkt können wir von den Kindern lernen. Sie suchen sich Freunde und gehen gemeinsam ans Werk. Es liegt also nichts näher, als sich Gleichgesinnte zu suchen und gemeinsam die Freude an der Bewegung zu erleben. Dazu braucht man nicht unbedingt ein Fitnessstudio mit hohen Preisen. Machen Sie es wie die Kinder und werden Sie erfinderisch! Es gibt viele Bewegungsarten, die fit halten. Man muss sich nicht für eine einzige Art entscheiden, denn Abwechslung bringt auch hier neue Freude. Wofür man sich auch entscheidet, wichtig ist die Regelmässigkeit. Nicht die einmalige Kraftanstrengung bringt Erfolg, sondern die kleineren Bewegungseinheiten. Es ist also besser, dreimal in der Woche zu «trainieren», als alle drei Wochen eine grosse Kraftanstrengung hinter sich zu bringen. Und zum Schluss benötigt man auch ein Päckchen Geduld, denn der Körper muss sich mit der neuen Situation vertraut machen. Sichtbare und spürbare Erfolge stellen sich erst nach einigen Wochen ein. Bis dahin gilt: Eifern Sie den Kindern nach und betrachten Sie Bewegung nicht als Pflicht, sondern als Freude, Spass und Abenteuer.
Und noch einmal: Kinder als Vorbilder
Lassen Sie sich ermutigen, eine Bestandsaufnahme Ihres Tagesablaufes und Lebens vorzunehmen und etwas mehr «Kind» darin zu verpacken. Lassen Sie sich nicht von Erwachsenen abhalten, auch wenn Sie von ihnen belächelt werden. Pablo Picasso sagte einmal: «Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.»
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, dass Sie sich mit Freude bewegen, zu Entdeckern und Abenteurern werden und das
einzigartige Wunderwerk, das Gott Ihnen mit Ihrem Körper geschenkt hat, bis ins Alter geniessen können.

Halten Sie Ausschau nach möglichen und unmöglichen Gelegenheiten, um mehr Bewegung in Ihren Alltag zu bringen. Hier einige Anregungen:
• Wie wäre es mit einem kleinen Wadentraining beim Zähneputzen oder Telefonieren? Dazu müssen Sie nur im Wechsel von den Zehenspitzen zu den Fersen wippen und zurück.
• Oder was halten Sie vom Türrahmensport, bei dem Sie mit den Händen seitlich oder oben gegen den Türrahmen drücken und so Ihre Arm- und Rückenmuskulatur kräftigen?
• Und wer sagt, dass man Treppen nur vorwärts hinaufsteigen kann? Probieren Sie es doch einmal rückwärts aus!
• Sehr bekannt unter Verliebten ist das «Fusseln» unter dem Tisch. Dies kann man auch für die Allgemeinheit erweitern, indem man gegenseitig die Füsse seitwärts aneinander drückt und die Beine anspannt, in dem Sinn: Wer ist der Stärkere?
• Sogar im Auto, beim Warten vor der roten Ampel, kann man seinen Beinen Gutes tun, indem man mit den Zehen «Klavier» spielt oder mit den Füssen Kreise schreibt (aber Vorsicht Verkehr!).
• Und nicht zuletzt ist ein abendlicher Spaziergang um den Häuserblock bei Amselgesang etwas Wunderschönes.


WOlFGanG RYTZ
Freier Sportjournalist, Zetzwil, CH
Exklusivinterview für «Leben & Gesundheit» mit Schwingerkönig Matthias Sempach (Alchenstorf)
Schwingen ist die urtypische Schweizer Zweikampfsportart mit einer jahrhundertelangen Vergangenheit. Seit mehr als 200 Jahren wird der «Hosenlupf» im Sägemehl in fast unveränderter Form gepflegt. 1895 wurde der Eidgenössische Schwingerverband gegründet, der die Traditionen hochhält und moderne Einflüsse abdämpft. Alle drei Jahre kommt es beim Eidgenössischen Schwingfest zur Kür eines neuen Königs. Matthias Sempach ist der 33. Schwingerkönig seit der Verbandsgründung. Er triumphierte am 1. September 2013 vor 52‘000 Zuschauern in Burgdorf. Im folgenden Interview gibt er Auskunft über die Königsbürde und Hintergründe seines Erfolges.
Rytz: Wie kommt der einzige König der Schweiz nach einem halben Jahr mit seinem «Amt» zurecht?
Sempach: Soweit geht es mir gut, ja sehr gut. Mein Umfeld unterstützt mich grossartig, und ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen.
Rytz: Wie und wieviele Stunden trainieren Sie?
Sempach: Mein Trainingsplan besteht in der Aufbauphase aus vier Einheiten Schwingen/Technik und drei Einheiten Kraft/Kondition pro Woche. Hinzu kommen Regeneration und gelegentlich Massage sowie aktive Erholung wie beispielsweise Biken.
Rytz: Haben Sie sich auch schon in anderen Sportarten versucht?
Sempach: Früher spielte ich während eines Jahres beim FC Koppigen Fussball. Aber ich glaube, dass mein Talent im Schwingsport grösser ist.
Rytz: Wie wichtig ist ein vielseitiges Training für einen Schwinger?
Sempach: Das ist sehr wichtig. Wenn ich im Zweikampf einen Schwung ausführen will, braucht es den ganzen Körper. Deshalb muss ein Schwinger vom Nacken bis zu den Waden austrainiert sein. Aber die beste körperliche Verfassung nützt nichts, wenn man nicht weiss, wie man Schwingen muss.
Rytz: Wie und wie lange wärmen Sie sich vor einem Schwingfest auf?
Sempach: Ich wärme mich am Morgen während einer halben Stunde mit einem leichten Ganzkörpertraining auf. Vor den weiteren Gängen genügen dann fünf Minuten. Dabei schaue ich, dass ich ins Schwitzen komme und der Puls hoch geht.
Schwingerkönig Matthias Sempach mit Sieger-Muni

Schlussgang zwischen Stucki und Sempach
Rytz: War es seit Ihrer Zeit als Jungschwinger klar, dass Sie einmal ein Spitzenschwinger werden?
Sempach: Seit mich das Schwingfieber mit sieben Jahren gepackt hat, war es für mich klar, dass ich es bis an die Spitze schaffen will. Meine Gesundheit war die wichtigste Voraussetzung dafür, dass ich dieses Ziel erreicht habe.
Rytz: Waren Sie schon immer ein Bewegungsmensch, oder hätten Sie auch eine musische Richtung einschlagen können?
Sempach: Die musische Richtung liegt mir weniger, obwohl ich bis zur neunten Schulklasse Sänger in einem Jodlerchörli war. Ich singe heute noch gerne unter der Dusche. Aber meine Blockflötenlehrerin war damals kaum enttäuscht, als sie erfuhr, dass ich meine Herausforderungen künftig im Sport suchen werde.
Rytz: Welchen Rat geben Sie Menschen, die Mühe haben, sich der Gesundheit zuliebe sportlich zu bewegen?
Sempach: Ich würde ihnen vor allem ans Herz legen, kleine Etappenziele zu setzen. Ein Spaziergang nach dem Abendessen oder die Treppe statt den Lift nehmen, sind erste Schritte in die richtige Richtung. Später

kann das Mitmachen an einem Volkslauf ein Ziel sein. Die Freude an der Bewegung kommt mit der Zeit von alleine.
Rytz: Sie trainieren seit ein paar Jahren in Magglingen auch mit der weltbesten Kugelstösserin, der Neuseeländerin Valerie Adams. Was können Sie von ihr lernen, was lernt sie von Ihnen?
Sempach: Wir profitieren voneinander. Sie lässt sich durch meine Motivation anstecken. Ich habe fast nie Motivationsprobleme im Training. Hingegen lasse ich mich von ihr anspornen, weil sie zum Teil Übungen mit mehr Gewicht ausführt als ich. Zudem feuern wir einander immer wieder an, gesteckte Ziele zu erreichen.
Rytz: Was tun Sie für Ihren Körper, für Ihre Gesundheit, wenn Sie auf einer Ihrer längeren Auslandreisen weilen?
Sempach: Ich mache gelegentlich ein paar Liegestütze im Hotelzimmer, um den Kreislauf anzuregen und etwas ins Schwitzen zu kommen. Auf langen Flügen schaue ich, dass ich beim Notausgang sitze, damit ich meine langen Beine bewegen kann.
Rytz: Können Sie sich vorstellen, am Meer zwei Wochen Badeferien zu geniessen und nur zu faulenzen?
Sempach: Uh nein, das ist nicht mein Ding. Das würde ich höchstens zwei bis drei Tage aushalten. Ich bin nicht der Ferientyp, sondern der Reisevogel. Es treibt mich immer weiter, ich will ein Land, dessen Kultur und Essen kennenlernen und mit den Einheimischen sprechen. Am liebsten besuche ich Landwirtschaftsbetriebe im Ausland. Ein Hotelresort mit Hunderten von Sonnenbrand geplagten Feriengästen meide ich.
Rytz: Wie gefährlich ist Schwingen? Hatten Sie schon einmal einen Unfall oder eine schwere Verletzung?
Sempach: Schwingen ist nicht ungefährlich. Allerdings sieht es schlimmer aus, als es ist. Wir üben die Falltechnik ständig. Unsere Rücken- und Nackenmuskulatur ist dafür trainiert. Verletzungen an Knien und Schultern gibt es trotzdem regelmässig. Ich selber darf nicht jammern. Mit Ausnahme einer kleinen Meniskusverletzung bin ich bis jetzt von Verletzungen verschont geblieben.
Rytz: Müssen Sie nach Ihrer Karriere mit Spätfolgen rechnen?
Sempach: Ich strebe im Training an, die Gewichte korrekt zu stemmen und meinem Körper genügend Erholung zu bieten, um Spätfolgen vorzubeugen. Dass sich gewisse Gelenke stärker abnützen, ist mir bewusst. Der Sport bringt mir aber so viel, dass ich das in Kauf nehme.
Rytz: Sie sind bald 28 Jahre alt. Wie lange wollen Sie schwingen? Was sind Ihre Ziele bis zum Abschluss der Karriere?
Sempach: Wenn ich gesund bleiben darf, würde ich gerne noch fünf bis sechs Jahre schwingen. Dabei freue ich mich in der bevorstehenden Saison auf die Bergfeste und den Kilchberger Schwinget als Höhepunkt. Längerfristig ist die Titelverteidigung 2016 in Estavayerle-Lac das grosse Ziel.
Rytz: Haben Sie Vorstellungen, was Sie nach Ihrer Laufbahn im Sägemehl unternehmen werden?
Sempach: Ich möchte gerne auf Klubebene dem Schwingen etwas zurückgeben und in irgend einer Funktion tätig sein.
Rytz: Doping war Ende letzten Jahres ein Thema. Ist das Schwingen stark gefährdet? Wie sorgen Sie vor, dass Sie immer «sauber» sind? Wie oft wurden Sie schon kontrolliert?
Sempach: Ich werde regelmässig kontrolliert und versuche immer, wenn ich ein Medikament einnehme, dies via Antidoping-App zu checken. Das braucht sehr viel Selbstdisziplin.
Rytz: Warum ist im Schwingen die Kollegialität so ausgeprägt? Was ist der Grund, dass Christian Stucki Sie in Burgdorf nach der Schlussgangniederlage so innig umarmte?
Sempach: Das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann dies nicht in einem Satz beantworten. Aber diese Kameradschaft im Schwingen macht unseren Sport einfach so besonders.
Rytz: Wie viele Schwingfeste bestreiten Sie in diesem Jahr? Was unternehmen Sie, dass Ihnen Christian Stucki den Sieg in Kilchberg nicht wie vor sechs Jahren wegschnappt?
Sempach: Ich habe meinen Schwingfestplan 2014 noch nicht definitiv fixiert. Meinen schönsten Sieg erreichte ich in Burgdorf. Von daher glaube ich, dass ich die Schwingfeste ab jetzt mehr geniessen kann und nichts mehr zu verlieren habe. Wenn ich aber bis zum Kilchberg gesund bleibe und es tatsächlich für den Schlussgang reicht, wäre das eine schöne Zugabe nach dem Königstitel. Der Beste soll gewinnen.
Interview: Wolfgang Rytz
Partner von Matthias Sempach (Stand 10.01.2014): Emmentaler Switzerland, Toyota, Avesco CAT, Jakob-Markt, Bschüssig, Melior, Schweizer Bauer, fox sports management

Portrait Matthias Sempach
Der aktuelle Schwingerkönig Matthias Sempach wird im April 28 Jahre alt. Er wiegt bei einer Grösse von 194 cm 110 kg. Er wuchs im oberaargauischen Alchenstorf auf, wo er noch heute wohnt. Nach der Ausbildung zum Landwirt lernte er als zweiten Beruf Metzger. Im Schwingen arbeitete er sich nach dem Einstieg beim Nachwuchs sukzessive an die Spitze vor. Er gewann seinen ersten Kranz bei den «Grossen» mit 17 Jahren. Den Aufstieg zu den «Bösen» realisierte er mit dem eidgenössischen Kranzgewinn 2007 in Aarau. Im Jahr 2008 stand er beim Kilchberger Schwinget, einem Kräftemessen der 60 besten Sägemehlathleten des Landes, gegen den Seeländer Hünen Christian Stucki im Schlussgang. Nach einem «Gestellten» (= Unentschieden) musste er sich mit Rang 2 begnügen. 2013 war er in der Emmental-Arena in Burgdorf nicht zu bremsen. Er gewann alle acht Gänge und besiegte zuletzt auch Christian Stucki, der noch grösser und schwerer ist als der Oberaargauer Kraftbrocken.
Matthias Sempach bezeichnet die Viehzucht als Hobby, was erklärt, warum er den Siegermuni in Burgdorf behalten hat, statt ihn für gutes Geld zu verkaufen. Das Aushängeschild des Schwingklubs Kirchberg legt seine Konkurrenten vorzugsweise mit den Schwüngen «Brienzer», «Übersprung» und «Kurz» auf den Rücken. Schon 80 Mal liess er sich von einer Ehrendame einen Kranz aufsetzen. (wr)





DR. KaRl-heinZ OBeRWinKleR Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Kärnten, A
Eine kleine Philosophie des (Rad)sports
Leben ist Bewegung, und Sport ist Leben …
An einem jener heissen Sommertage, die «Sommermenschen» wie ich so lieben, sind mein Sohn Florian und ich mit unseren Rennrädern unterwegs. Etwas mehr als 150 Kilometer wird der Radcomputer am Ende anzeigen. Von Kärnten aus, wo wir wohnen, sind wir ins benachbarte Friaul hinübergefahren. Drei Pässe haben wir schon hinter uns, als wir uns Paularo nähern, einem Dorf, das versteckt in den Bergen und am Fusse des Passo di Lanza liegt. Dieser wird der letzte grosse Anstieg für heute sein, der schwerste zwar, aber auch der schönste. Längst habe ich zu diesem Zeitpunkt meinen Kopf «freigefahren», frei von Stress, Belastungen und Sorgen, längst «fliegen» meine Gedanken, längst geniesse ich es auf jedem Meter und mit allen Sinnen unterwegs zu sein. Denn:
Herausforderungen begegnen ist Leben in Bewegung
Da, der Wegweiser: Passo di Lanza, 15 km. 1088 Höhenmeter sind zu überwinden. Eine grosse Herausforderung! Aber kein Grund, zurückzuschrecken oder umzudrehen. Im Gegenteil. Ich betreibe diesen Sport schon so lange, dass ich weiss, wie schön es ist, mit dem Fahrrad zu einer Einheit zu verschmelzen. Vor allem aber kenne ich das Hochgefühl, das dadurch entsteht, dass nicht nur mein Körper arbeitet. Ich bewältige diese Herausforderung als Einheit: Mein Körper, meine Seele und mein Geist. Alle «drei» arbeiten auf Hochtouren zusammen, harmonisch und auf ein Ziel gerich-
Dr. Karl-Heinz Oberwinkler (r) und sein Sohn Florian Oberwinkler (l)

tet. Kaum anderswo spüre ich das, was ich als Mensch im umfassenden Sinn bin, so intensiv wie hier. Schon allein deshalb, weil mein Körper in meinem Arbeitsalltag als Arzt kaum gefordert ist. Nur geistig zu arbeiten macht deshalb meine Seele oft müde. Auf dem Rad hingegen wird sie frei.
«Aller Anfang ist schwer»
Knapp 500 Meter weiter beginnt der Anstieg, und gleich ziemlich schwer. Die schmale Strasse, gerade breit genug für ein Auto, schraubt sich auf den ersten zwei Kilometern in «giftigen» Rampen nach oben. Dafür aber gewinnt man schnell an Höhe und hat bald schöne Ausblicke auf das Dorf und das Tal. «Aller Anfang ist schwer», sagt das Sprichwort. Das gilt auch, wenn man beginnt, Sport zu betreiben. Die ersten Male sind die schwersten, wenn man als noch Untrainierter nach weni-
gen Metern schon keucht wie eine Dampflokomotive; wenn man schon nach fünf Minuten nassgeschwitzt ist; wenn die Muskeln brennen und die Gelenke schmerzen; wenn noch zwei Tage lang der Muskelkater regiert. Gerade diese verflixten ersten Male verleiten viele dazu, den Sport gleich wieder aufzugeben. Wer aber durchhält, erlebt wie ich am Passo di Lanza, dass er schnell «an Höhe gewinnt». Sein Leben erhält eine neue Perspektive. Und bald, das mag ich fast garantieren, wird er sie nicht mehr missen wollen.
Dieses abseits gelegene Bergsträsschen wird ausserhalb des Wochenendes kaum befahren. Darum begegnen uns nur ganz wenige Autos. Aber nicht nur einmal meine ich in den Gesichtern der Insassen eine stumme Frage zu lesen: «Warum tun sich die zwei Kerle das an?» Am

liebsten möchte ich dann zurückfragen: «Warum tut ihr euch das nicht an?» Denn es gibt viel zu viele gute Gründe, Sport zu betreiben. Erstens, weil es Freude macht. Schlicht und einfach. Sich als ganzen Menschen zu empfinden ist ein grossartiges Gefühl. Zweitens: Sportliche Bewegung ist gesund. Als Krankenhausarzt werde ich wohl bis zu meiner Pensionierung den unphysiologischen Belastungen von mehreren Nachtdiensten pro Monat ausgesetzt sein. Obwohl ich sehr gerne arbeite, ist das ungesund. Es schadet mir. Um diese Schäden abzumildern, zu begrenzen und im besten Fall sogar auszugleichen, muss ich mein Leben «drum herum» möglichst gesund gestalten. Gerne will ich erreichen, was die Medizin eigentlich zum Ziel haben sollte: möglichst jung (an Lebenskraft) zu sein, möglichst alt (an Jahren) zu werden. Dazu braucht es all das, was das NewstartPlus-Konzept enthält: regelmässige Bewegung bzw. sportliche Betätigung. Sport als Vorbeugung. Das ist sein langfristiger Effekt auf die Gesundheit. Es gibt aber, und das ist der dritte Grund, warum man sich Bewegung antun sollte, auch einen schnell wirksamen Effekt.
Bewegung verhilft mir zu jenem körperlich-geistig-seelischen Wohlbefinden, mit dem die WHO den Begriff «Gesundheit» definiert. Ungezählte Male habe ich erlebt, wie ich eine Fahrt mit dem Rad beginne und beende. Vorher: verspannt müde, geistig ausgelaugt, gestresst, unrund. Nachher: entspannt müde, geistig frisch, Stress abgebaut, manchmal voller neuer Ideen, zufrieden, einfach glücklich.
Natur ist Leben
Immer wieder ändern sich die Blickwinkel, während wir auf unseren Rädern höher steigen. Da ist der Wald zu meiner Rechten, da sind steile Abhänge zu meiner Linken. Ab und an gluckert ein Bächlein den Hang hinunter. Aus dem Wald heraus erreichen wir eine Alm, und der Blick schweift weiter in die Ferne, höher und höher. Ich sehe die beeindruckenden Berggipfel ringsumher. Bewusst und unbewusst nehme ich die Schönheit der geschaffenen Natur wahr, sauge sie ein. An meinem Arbeitsplatz besteht meine Umwelt aus Sessel, Schreibtisch, Computer, Untersuchungsstuhl und Ultraschallgerät – keine Natur. Die findet sich nur auf den zwei Bildkalendern, die an der
Wand hängen, und in Form der Orchidee auf dem Fensterbrett. Daher ist für mich Bewegung an der frischen Luft am schönsten, denn sie erlaubt es mir, die Natur zu erleben.
Auf den letzten fünf Kilometern wird der Pass noch einmal richtig schwer. Es gibt mehrere Abschnitte mit 18 Steigungsprozenten, jeweils mindestens dreihundert Meter lang. Mit dem, was wir zu diesem Zeitpunkt schon in den Beinen haben, tut das noch einmal richtig weh. Streckenweise werden wir sehr langsam. Jetzt gilt es, eine eiserne Regel zu beachten: um jeden Preis in Bewegung bleiben! Weiterfahren! Nur nicht absteigen! Man kommt sonst nicht mehr ins Fahren, ausser man dreht um und fährt zurück bis zu einem flacheren Wegstück. Entspricht dies nicht dem Leben? Wird da nicht der (Rad)sport ganz besonders zu einer Metapher? Denn im Leben ist es ja auch notwendig, in Bewegung zu bleiben. Und das gilt längst nicht nur für unseren Beruf, nicht nur für die Bereitschaft, ständig Neues zu erlernen, sich neues Wissen und neue Fähigkeiten anzueignen. Es geht nicht
nur um das, was wir in Materielles ummünzen können. Nein, dieses Prinzip gilt noch viel mehr für unsere «Karriere als Menschen». Eigentlich sollten wir nicht bleiben, wo wir sind, und verharren in dem, wie wir sind. Wir sollten als Menschen charakterlich wachsen, bessere Menschen werden, ohne uns zu fragen, was uns das denn bringt. Ist das nicht das wichtigste aller Trainingsziele?
Gemeinschaft ist Leben
Und dann sind wir oben angekommen. Eine weitere Welle von Freude durchströmt mich. Geschafft, aber noch nicht am Ziel. Wir wollen ja noch nach Hause. Und da fehlen uns noch 60 Kilometer. Diese sind zwar überwiegend «flach», aber wir sind auch schon lange unter-
wegs. Jetzt wird es besonders wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Der, der vorne fährt, macht «Führungsarbeit». Der dahinter fährt in dessen Windschatten – im Sog – und spart so seine Kräfte. Nach einiger Zeit wird abgewechselt. Jetzt kann sich der, der bisher führte, ausruhen. So kommt die Gruppe schneller ans Ziel als ein Einzelner. Zusammenhalt, Zusammenarbeit, das Aufeinander-Achten, das sind auch im Leben Kernkompetenzen, denn wir sind und bleiben soziale Wesen.
Wir fahren durch Tarvis, bald ist Kärnten wieder erreicht. Da, am Strassenrand! Das ist doch … Ist er es wirklich? Ja. Da bummelt ein ehemaliger Studienkollege von mir

durch den Ort. Mehr als 15 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. «Hey, Bernhard, kennst du mich noch?» Auch er fährt leidenschaftlich gern mit dem Rennrad. Fast eine halbe Stunde lang reden wir darüber, was sich im Leben so getan hat, seit sich unsere Wege trennten, und wohin uns unsere «Routen» geführt haben. Wie sich doch alles verändert hat! Da spüre ich ganz stark und übermächtig, dass Leben bedeutet, stets unterwegs zu sein, ob wir es wollen oder nicht.
Florian und ich kommen schliesslich zu Hause an. Müde, aber sehr glücklich.
LOSLASSEN: Etwas niederlegen können, ohne es als Niederlage betrachten zu müssen.
Henriette Wilhelmine Hanke
Nur mit leeren Händen kann man nach Neuem greifen.
Unbekannt
Loslassen kostet weniger Kraft als Festhalten, und dennoch ist es schwerer.
Detlev Fleischhammel

«Eine Pusteblume wird niemals versuchen, ihre Schirmchen festzuhalten.»
Helga Schäferling


oder Jogging fürs Gehirn Gehirnjogging



Manuel Reinisch Studiert Medizin in Graz, A
Den meisten Menschen macht es Freude, ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Sport trainiert die Muskeln, Fastenkuren dienen der Entschlackung und Schönheitsbehandlungen verfeinern die «Fassade». Doch wie in aller Welt bekommt man das Gehirn auf Vordermann?
Gehirnjogging – der Weg zum Erfolg?
Der Gehirnjogging-Markt boomt seit Jahren. Spätestens seit der mitteleuropäischen Einführung von Sudoku im Jahr 2005 klingen die Begriffe «Gedächtnistraining», «kognitive Flexibilität», «Konzentrationsvermögen» und «Merkfähigkeit» in aller Ohren. Wo es früher in den Zeitungen lediglich das mittlerweile schon altmodische Kreuzworträtsel gab, befinden sich heute Logicals, Kakuro, Hyper Sudoku und andere Erfindungen der Gehirnakrobatik. Gerätselt und trainiert werden kann heute nicht nur auf Papier, sondern auch online und sogar mit dem Smartphone. Die Produzenten versprechen den Kunden eine rasante Steigerung der Gehirnleistung und des Merkvermögens. Schliesslich wachsen die Muskeln des Körpers durch deren Betätigung, und das muss wohl auch auf das Gehirn zutreffen. Doch stimmt das wirklich?
Müssten Schüler und Studenten, die tagtäglich lernen, dann nicht die wortwörtlich grössten Köpfe haben?
Wissenschaftler haben herausgefunden: Das Gehirn wächst zum grössten Teil nicht mit der kognitiven, sondern mit der körperlichen Betätigung. Demnach verliert das Gehirnjogging nicht komplett seinen Stellenwert. Doch wenn jemand wirklich an Gehirnleistung zunehmen will, greife er oder sie lieber zu den Sportschuhen.
Aerob versus Anaerob
Für die nähere Betrachtung ist ein kurzer Blick in die Welt der Muskulatur unerlässlich. Prinzipiell spricht die Sportphysiologie von zwei Arten der körperlichen Betätigung: aerober und anaerober. Vereinfacht gesagt, heisst aerob «mit Sauerstoff» und anaerob «ohne Sauerstoff». Jede lebende Zelle des Körpers verwendet für die Energiegewinnung Sauerstoff. Muskelzellen brauchen je nach Belastung mehr oder weniger davon. Schon bei niedriger Belastung schlägt das Herz schneller, und die Blutgefässe weiten sich, um den arbeitenden Muskel mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Allerdings stossen die Anpassungsmechanismen bei zunehmender Belastungssteigerung an eine natürliche Grenze, die sogenannte «anaerobe Schwelle» oder «Laktatschwelle». Diese Schwelle kennzeichnet den Punkt, an dem der ausgelieferte Sauerstoff für die Muskelzelle nicht mehr ausreicht und diese einen zusätzlichen Energielieferanten zuschalten muss. Das geschieht jedoch nicht ohne Nachteil für die Zelle. Daher ist das nur für eine begrenzte Zeit möglich.
In der Summe lässt sich aerobe Bewegung mit Ausdauersport und anaerobe mit Kraftsport umschreiben. Demnach fallen Radfahren, Schwimmen, Spazierengehen und Laufen eher in die erste Gruppe, zu je-
ner Betätigung, die problemlos über längere Zeit durchgehalten werden kann. Die persönliche anaerobe Schwelle ist ein individueller Wert und hängt sehr vom Trainingszustand und von der körperlichen Veranlagung ab. Eine einfache Berechnung dieser Schwelle findet sich am Ende des Artikels.
In erster Linie fürs Gehirn Es lässt sich schwer beurteilen, welches Organ das wichtigste im Körper ist. Zweifellos würde sich jedoch das Gehirn in den oberen Rängen einordnen, wenn nicht sogar den ersten Platz einnehmen. Eine Niere, eine Leber oder ein Herz kann unter Umständen transplantiert werden, aber nicht ein Gehirn. Dr. John J. Ratey, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, hat in seinen Studien herausgefunden, dass sich regelmässige aerobe Bewegung in erster Linie auf das Gehirn auswirkt. Ein schöner, durchtrainierter Körper und kräftige Muskeln sind lediglich ein positiver Nebeneffekt. Welche Auswirkungen hat Sport nun auf das Gehirn?
Viele wissenschaftliche Studien aus jüngster Vergangenheit belegen den Zusammenhang von Ausdauerbewegung und Gehirnplastizität. Zum Beispiel stoppt aerobe Bewegung nicht nur den Abbau des Gehirns, der bis zu 0,5 % jährlich betragen kann, sondern trägt im Gegenteil zu Gehirnwachstum
Hinterhauptslappen
Hippocampus –an der Innenseite der Schläfenlappen
Kleinhirn
Scheitellappen

bei. In einer Studie1 an 50-jährigen und älteren Menschen konnte gezeigt werden, dass ein Jahr regelmässige sportliche Betätigung den Hippocampus bis zu unglaublichen 2 % wachsen liess. Fraglich bleibt jedoch, ob der Abbau des Gehirns eine Folge des Alters oder der Trägheit ist.
Diese und ähnliche Effekte traten ausschliesslich bei aerober Bewegung auf und konnten bei anaerober Bewegung nicht nachgewiesen werden. Ausserdem beschränkte sich die Studie auf eine Untersuchungszeit von nur einem Jahr. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wachstumsrate in den nächsten Jahren verringert.
Was ist der Hippocampus?
Der eine oder andere denkt vielleicht an ein Seepferdchen. Zu Recht. Denn das lateinische Wort Hippocampus heisst auf Deutsch «Seepferdchen». Nichtsdestotrotz hat der menschliche Hippocampus wenig mit diesem Tierchen zu tun, ausgenommen die Tatsache, dass seine optische Form sehr an ein Seepferdchen mit einem eingerollten Schwanz erinnert. Ungeachtet dessen ist der Hippocampus (oder besser gesagt die Hippocampus-Formation) ein Teil des limbischen Systems, das sich in einem der vier grossen Hirnlappen, dem Schläfenlappen, befindet. Das limbische System erfüllt verschiedene Aufgaben bzw. Teilaufgaben
Stirnlappen
Schläfenlappen
der Emotionsverarbeitung, des Triebverhaltens und des Gedächtnisses. Der Hippocampus als zentrales «Schaltzentrum» dieses Gebildes ist vor allem für die Informationsüberführung vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zuständig. Ohne Hippocampus wären demnach Lernen, Erinnerungsvermögen oder Merkfähigkeit nicht möglich. Folglich wirkt sich eine Volumensteigerung positiv auf diese kognitiven Tätigkeiten und Fähigkeiten aus. Gehirnjogging ist gut – körperliches Joggen jedoch unschlagbar.
Noch mehr des Guten
Als wäre dies nicht schon genug, haben Wissenschaftler neben den positiven Wirkungen auf das Gehirn noch weitere Vorzüge der regelmässigen Bewegung entdeckt. Ihnen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit des gesunden Altwerdens bei körperlich aktiven Personen um das Siebenfache erhöht. Gesundes Altwerden umfasst: Abwesenheit von Krankheit, geistige Gesundheit, geistliches Wohlbefinden und ein gesundes soziales Umfeld.
Eine Anekdote am Rande
Nach all diesen grossartigen Resultaten bleibt nur noch die Frage: Und wie setze ich das um? Muss ich jetzt jeden Tag laufen gehen? Was, wenn ich nicht so der sportliche Typ bin? An dieser Stelle sei eine kurze Anekdote erzählt:
Schritt für Schritt
Ein hoher Gipfel wird nicht in einem Sprung bezwungen, sondern in vielen kleinen Schritten. Folgende sieben praktische Tipps geben Anregung für regelmässige körperliche Betätigung:
1. Alltäglichkeiten nutzen: Treppen steigen, Fahrrad fahren, Gymnastik vor dem Fernseher, Spaziergang während der Telefonate ...
2. Regelmässigkeit einführen: Einmal pro Woche mit aktiver Bewegung beginnen und auf drei bis viermal pro Woche steigern. Lieber viermal 45 Minuten als einmal 3 Stunden trainieren. Leichte Anstrengung am besten täglich.
3. Ruhepausen einplanen: Nach starker Anstrengung –etwa nach einem längeren Ausdauerlauf – braucht der Körper Zeit zur Regeneration.
4. Freude bewahren: Sollte an einem Tag die Motivation fehlen, lieber auf morgen verschieben, aber dann auch wirklich tun. ☺
5. Gemeinschaft suchen: Gemeinsame Bewegung kann mehr Freude bereiten und fördert die Regelmässigkeit durch gegenseitige Verbindlichkeit.
6. Gute Ausrüstung: Eine angemessene Ausrüstung ist sowohl für die Freude am Sport als auch für die gesunde Durchführung von Belastungsübungen wichtig.
7. Eine optimale Trainingsintensität hat man dann erreicht, wenn man sich nebenbei noch mühelos unterhalten kann.

Maximalpuls, Trainingspuls und anaerobe Schwelle

Nachfolgende Formeln sind für den Start in einen «bewegten» Lebensstil sehr hilfreich:
Der Maximalpuls ist die maximale Anzahl an Herzschlägen pro Minute, die ein Mensch unter Anstrengung erreichen kann. Er lässt sich grob mit folgender Faustregel berechnen: 220 minus Lebensalter.
Die anaerobe Schwelle ist die höchstmögliche Belastungsintensität, welche die Muskelzelle noch gut und über längere Zeit bewältigen kann. Diese Schwelle ist sehr individuell, kann aber annähernd mit folgender Formel berechnet werden: Maximalpuls x 85/100. Vereinfacht gesagt: Wenn einem die Puste ausgeht, hat man die anaerobe Schwelle überschritten.
Der Trainingspuls ist die Anzahl an Herzschlägen pro Minute, die eine optimale Steigerung der Ausdauer bewirkt und problemlos über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Er lässt sich grob mit folgender Formel berechnen: Maximalpuls x 75/100.
Als Medizinstudent hatte ich unlängst das Vorrecht, einen erfahrenen Arzt in seiner täglichen Routine zu begleiten. Wir machten einen Hausbesuch bei einem Patienten im mittleren Alter. Durch eine schwere Krankheit war dieser innerhalb kürzester Zeit bettlägerig geworden und musste fortan sogar über eine Magensonde ernährt werden. Im Grunde genommen konnte er selbst nicht mehr viel zu einem gesunden Lebensstil beitragen. Aber er hatte einen starken Willen und eine herzensgute Frau, die ihn sehr unterstützte. Nach ärztlicher Verordnung fuhr ihn seine Frau, dank einem mobilen Bett, täglich in den Garten, in den Sonnenschein und an die frische Luft. Sie mixte frische Früchte in seine Ernährung UND er bewegte sich täglich für einige Minuten, da er selbst nicht mehr aufstehen konnte, mit einem Bettfahrrad. Bis heute gibt es noch keine gesicherte Diagnose seiner schwerwiegenden Krankheit, aber sein Zustand bleibt zumindest stabil. Nicht jeder hat das Privileg einer solchen Versorgung, aber jeder kann zur täglichen aeroben Bewegung beitragen.
Ergebnis
Regelmässige körperliche Bewegung stoppt den Gehirnschwund, fördert das Hippocampus-Wachstum und steigert die Gedächtnisleistung. Die besten Ergebnisse für diese Steigerung erreicht man mit einem Training unterhalb der anaeroben Schwelle. Zudem zeigen wissenschaftliche Studien vermehrt, dass selbst ein kleiner Fortschritt in den Bewegungsgewohnheiten zu positiven Resultaten führen kann.
Aber das Beste kommt zum Schluss: Das Alter spielt für den Zeitpunkt des Beginns keine Rolle! Heute ist der beste Tag, um dem Gehirn etwas Gutes zu tun.


MOniKa STiRniMann
Mitarbeiterin von ADRA Schweiz, Zürich, CH
Heute ist etwas los: Der Lastwagen steht schon halbgefüllt in der Einfahrt. Einige starke Männer schleppen Kisten aus dem Keller herauf und verstauen diese im Lkw. Einige Frauen sind bemüht, die zerbrechlichen Dinge zu verpacken, damit auch wirklich nichts zu Bruch gehen kann. Die Laderampe wird hochgezogen, und los geht die Fahrt Richtung Stadtzentrum. Dort angekommen – das gleiche Spiel, aber in umgekehrter Reihenfolge: Alles wird ausgeladen und auf dem schon bereitstehenden Marktstand und auf viele Tische verteilt. Was da alles zum Vorschein kommt: wunderschöne selbstgestrickte Pullover, Kap-
ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. Der deutsche Name lautet Adventistische Entwicklungsund Katastrophenhilfe. ADRA Schweiz ist als Hilfswerk ZEWO zertifiziert und Partner der Glückskette. Der Sitz der Schweizer Sektion des weltweiten Werkes ist in Zürich.





pen, Schals und Socken, feine hausgemachte Konfitüren, lustige Bastelartikel und vieles mehr. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch unter den Flohmarktgegenständen gibt es wohl fast nichts, was ein Sammlerherz nicht höher schlagen lässt. Kaum richtig aufgebaut, finden sich bereits die ersten Käufer ein. Alles will eingehend betrachtet sein, bevor man sich schliesslich zum Kauf entscheidet. So manches Gespräch kommt hier in Gang. Man lernt sich kennen und tauscht sich nicht nur über Socken und Konfitüre aus. Ältere und jüngere Kundschaft findet sich ein. Manche kommen nur, weil sich hier jemand Zeit für ein Gespräch nimmt und dadurch die Einsamkeit ein wenig vergessen werden kann … Es ist eine anstrengende Aufgabe, die hier verrichtet wird: Aufbauen, verkaufen, aufmerksam die Gespräche verfolgen, aufpassen, damit nichts «von allein den Stand verlässt», Waren
auffüllen, den ganzen Tag stehen, abbauen, die nicht verkaufte Ware zurück in den Keller verfrachten, Kassensturz – und sich dann über das Ergebnis freuen oder auch einmal enttäuscht sein. Das alles gehört eben zu einem wortwörtlichen «Markttag in Bewegung». Müde, aber zufrieden fallen am Abend alle in den wohlverdienten Schlaf. Wozu das alles? Wieso leisten Menschen immer wieder solch ehrenamtlichen Dienst? Wieso nehmen sie diese Art «Bewegung» auf sich? Sie tun es, um Menschen in Not zu helfen. Sie wollen etwas Positives bewegen. Sie bewegen sich selber und damit auch andere, um der immer grösser werdenden Armut überall auf der Welt zu begegnen. ADRA Schweiz ist sehr dankbar für alle freiwilligen Mitarbeiter, die mit den verschiedensten Aktionen in Bewegung sind und damit ein starkes Zeichen der Nächstenliebe setzen und gleichzeitig der Gleichgültigkeit trotzen.













MaRia SchÖB




«Ich brauche keinen Helm – ich kann Fahrrad fahren!», ruft Dany und braust davon.
Zehn Sekunden später ist er schon um die nächste Hausecke verschwunden. Kurz darauf höre ich einen Knall ... Ich renne zur Stelle, wo ich Dany vermute. In Hundertstelsekunden wirbeln die schlimmsten Bilder durch meinen Kopf. Beim Unglücksort grinst mir Dany ins Gesicht. Er ist in einer Mülltonne gelandet. Bananenschalen, Abfall und Plastiktüten haben sich auf ihm und um ihn herum verteilt. Es stinkt gewaltig.
«Von wegen, du kannst Fahrrad fahren! Ab sofort gibt es keine Diskussion mehr wegen des Helms, klar? Und jetzt räumst du diese Sauerei auf.» –«Ja, Mami», murmelt er kleinlaut.
Bin ich übervorsichtig geworden? Kleine Unfälle gehören doch zum Grosswerden. Wenn ich so höre, wie ängstlich manche Eltern sind, dann tun mir die Kinder Leid. Sie müssen ständig per Handy erreichbar sein. Schon die Kleinsten tragen manchmal eine Art GPS bei sich, damit die Eltern sie immer «orten» können, oder noch schlimmer: Die Kinder dürfen nicht mal in die Schule laufen – nein, sie werden bis vor die Türe gefahren!
Wir hatten früher doch viel Spass auf dem Schulweg, weil der alte Herr Pfister meist auf dem Bänklein vor seinem alten Haus sass und uns mit dem Gehstock drohte, wenn wir mal wieder einen Apfel vom Baum
pflückten. Aber eigentlich wussten wir, dass wir das nicht durften. Manchmal stritten meine Freundinnen und ich uns auf dem Nachhauseweg. Aber wir haben uns auch immer wieder versöhnt. Oft zwar erst nach Tagen hartnäckigen Schweigens, aber irgendwann mussten wir uns ja wieder den neusten Klatsch erzählen. Ausserdem hatten wir den Grund für den Streit längst vergessen. Haben junge Mütter früher auch ständig Feuchttüchlein bei sich getragen, um den kleinen Wonneproppen im Sandkasten dauernd zu putzen, nur weil er vielleicht ein paar Sandkörner in den Mund oder einen Wurm in die Hosentasche gesteckt hat? Dass «so saubere» Kinder öfter krank sind, hat doch einen Grund! Überhaupt waren unse-

re Eltern auch nicht ständig dabei, wenn wir draussen gespielt haben. Wenn es abends dunkel wurde, wussten wir auch so, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen.
Leider sind die Kinder heute anderen, grösseren Gefahren ausgesetzt als früher. Trotzdem nützt doch dieses Überbehüten nichts. Wie sollen Kinder lernen, Streitigkeiten unter sich auszumachen, wenn sich Erwachsene sofort einmischen und im schlimmsten Fall die Eltern und Lehrer beschimpfen, statt die eigenen Frechdachse die Folgen ihres Handelns spüren zu lassen. Früher hat es doch meistens gereicht, wenn wir mal ohne Nachtessen ins Bett mussten oder vom eigenen Taschengeld – sofern man überhaupt welches bekam – die kaputte Fensterscheibe beim Nachbarn bezahlen mussten, um zu lernen, was sich gehörte und was nicht.
«Mami, wo bist du mit deinen Gedanken? Kannst du mir helfen, hier aufzuräumen?» –«Ja klar, kann ich! Ich hole nur schnell ein paar Handschuhe für uns – oder, nein warte. Wir packen den ganzen Abfall einfach wieder in die Tonne. Hände waschen können wir zu Hause.»
Die Hände haben übrigens noch für ein paar Tage irgendwie seltsam gerochen – trotz Seife. Vielleicht wären Handschuhe doch besser gewesen ...








ThOMas NYFFeleR
Dipl. Physiotherapeut FH, Steinhausen, CH







Mit modernen Geräten lässt sich eine gezielte Bewegungstherapie durchführen.
Laut Bundesamt für Gesundheit sind Personen, die sich regelmässig körperlich betätigen, nicht nur gesünder, sondern auch gesundheitsbewusster und fühlen sich allgemein besser. Zudem belegen moderne Erkenntnisse, dass Bewegung die Lebensqualität eindeutig hebt.
Zusammenspiel Bewegung und Ruhe
Die «heilenden Kräfte» in der Bewegungsmedizin entfalten sich erst vollständig, wenn nach den allgemeingültigen Wirkprinzipien von Anspannung und Entspannung trainiert wird. Darum benötigt der Körper nach getätigter Bewegung Ruhe. Das Wechselspiel zwischen Aktivität und Ruhepausen ist sehr bedeutend. Bei gewissen Krank-
heitszuständen liegt die Kunst, Bewegung als Heilmittel einzusetzen, gerade darin, zwischen den einzelnen Bewegungsausführungen genügend lange auszuruhen. Mehr als ein Drittel der Patienten, die eine Physiotherapiepraxis aufsuchen, akzeptieren Bewegung als Heilmittel nur dann, wenn in erster Linie das «Ausruhen» zwischen der Bewegungsausführung betont wird und zum Zug kommt.
Ganzkörperliche Rhythmen und was tun bei Einschränkungen?
Damit Bewegung als Heilmittel greift, sollte – wenn möglich – immer in bestimmten Rhythmen trainiert werden. Dies erleichtert das Lernen und Speichern von neuen Bewegungsabläufen. Besonders geeignet sind Aktivitäten, die ganzkörperliche Rhythmen enthalten wie Joggen, Rennen, Wandern,
Nordic Walking, Langlauf, Skifahren, Schwimmen, Fahrradfahren, Klettern und Tanzen. Für Menschen mit Einschränkungen im Bereich des Bewegungsapparates, z. B. beim Älterwerden, ist es besonders schwierig, genügend körperliche Bewegung zu bekommen. Dies muss jedoch nicht zum Nachteil werden, denn für diese Menschen bieten sich Hilfsmittel an wie z. B. spezielle Ganzkörper-Bewegungsgeräte. Diese helfen um …
• Steifigkeit zum Verschwinden zu bringen
• Zittern zu reduzieren
• wieder Sicherheit beim Gehen und Treppensteigen zu erlangen
• ernsthafte Gelenk- und Muskelschmerzen zu beseitigen
• nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen
• zunehmend eingeschränkte Bewegungen wieder zu aktivieren
• geistige Funktionen zu verbessern und aufrechtzuerhalten
• die Fitness zurückzugewinnen
• den Blutdruck zu verbessern
• sauerstoffreiches Blut in alle Körperteile zu bringen
• mehr Energie für die täglichen Aufgaben zu haben.
Die oben genannten modernen Hilfsmittel helfen ausserdem auch bei …
• Rückenschmerzen
• Knie-, Hüft- und Schultergelenkserkrankungen
• Erkrankungen wie Parkinson, Schlaganfall, Sprachstörung, multipler Sklerose, Schädel-Hirn-Trauma, Kleinhirnverletzung, zerebraler Kinderlähmung, Blasenund Darmstörung, Störung der Sexualfunktion sowie Rückenmarksverletzung und Schädigung peripherer Nerven.
Warum Rhythmen?
Ein kleiner Abstecher in die neusten Forschungsergebnisse über den Bau und die Funktionsweise von Nervensystemen zeigt: Beim Menschen besteht im Gegensatz zu Säugetieren die Besonderheit, dass das Rückenmark etwa auf Höhe der ersten Lendenwirbel endet und von da an nur noch Nervenfäden nach unten ziehen. Die untersten Nervenfäden steuern vorwiegend die Blasen- und Darmfunktion, Sexualfunktionen und die Zehen. Dort konnte wegen der guten Platzverhältnisse mit Platinelektroden die exakte Funktionsweise der Nervenzellen gemessen und somit dokumentiert werden, dass sie sich rhythmisch organisieren.
Wie funktioniert die rhythmische Organisation des Nervensystems?
Haut-, Muskel- und Gelenkfühler produzieren, wenn sie bewegt werden bzw. Druckoder Zugkontakt bekommen, körpereigenen Strom. Klopft man auf eine Hautstelle, laufen die durch die Fühler erzeugten Stromsignale zum Rückenmark und werden von da zum Gehirn umgeschaltet, sodass eine Reaktion erfolgen kann. Das ursprüngliche Signal wird aber in der inneren grauen Substanz des Rückenmarks auch zu benachbarten Nervenzellen geleitet, und diese geben das Signal ihrerseits an Nachbarzellen weiter. Bilden sie räumlich einen Kreis, kommt es dazu, dass die erste Zelle, die das empfangene Signal ins Gehirn und zu den Nachbarzellen geleitet hat, von der letzten Nachbarzelle des Kreises wiederum einen Impuls erhält. Man spricht von einem «Schaltkreis», der sich gebildet hat. Die Signale sind in «Schwingung» und geben ihrerseits Impulse an benachbarte Zellen weiter, sodass viele koordinierte Schaltkreise, so genannte «Netzwerkschwin-
gungen», entstehen. Diese laufen sich immer besser ein und verfestigen sich somit zuerst im Kurzzeit- und später im Langzeitgedächtnis des Bewegungserinnerungsvermögens. Diese Schwingungskreise sind den Nerven-Netzwerken, die die Bewegung erzeugen, vorgelagert. Sie stehen mit diesen durch die beschriebenen Mechanismen, nämlich Rhythmuskoppelungen, wiederum in engem Kontakt. Das bekannteste Nervennetzwerk ist übrigens der natürliche Schrittmacher des Herzens, der primäre rhythmische Taktgeber der Herzaktion: der Sinusknoten. Er erzeugt die elektrischen Impulse und bringt den Herzmuskel zum Schlagen.
Aktivität beeinflusst das Zentralnervensystem!
Alle Nervennetzwerke können durch körpereigene Aktivitäten beeinflusst werden, wenn sie durch die körpereigenen Fühler Impulse erhalten. Hüpfen oder schnelles Gehen bewirkt durch die oben angedeuteten Koppelungsmechanismen, dass die Netzwerke schneller schwingen, woraus sich eine höhere Körperspannung ergibt. Langsames Gehen oder Stehen und Ruhen bewirkt, dass die Netzwerke langsamer schwingen und die Körperspannung schlaffer wird. Bei Krankheitszuständen, die ein «Zittern» oder «Schütteln» hervorrufen, schwingen die Netzwerke parallel und nicht gegeneinander. Bei «Lähmungen» schwingen sie gar nicht. Bei Krämpfen und Schmerzen schwingen sie wild durcheinander.
Wie wird man Schmerzen und Muskelkrämpfe, die durch Aktivität ausgelöst wurden, wieder los?
Oft verspürt man frühmorgens Schmerzen im Nacken-, Rücken- oder Schulterbereich. Viele Menschen kommen von selber darauf, sich am Morgen
heiss abzuduschen (Wirkprinzip: Wasseranwendung). Man kann die Wirkung verstärken, wenn man – sobald man sich an die Wärme gewöhnt hat – die Temperatur des Wassers mit dem Mischregler ein wenig erhöht. Das Ganze wird drei bis vier Mal wiederholt, bis der Schmerz nachlässt. Man erzwingt dadurch u. a., dass die erwärmten Hautpartien und die darunter liegende Muskulatur durch das körpereigene Blut gekühlt werden und dadurch vermehrt Sauerstoff zugeführt wird. Die verspannte Muskulatur löst sich. Man fühlt sich «leicht» und nicht mehr «schwer». Die Wärmefühler der Haut haben zudem Signale gesendet, die beruhigend auf das Zentralnervensy stem wirken. Die Nervennetzwerke schwingen jetzt langsamer. Man fühlt sich «entspannt».
Ein anderes Beispiel: Wenn die Beschwerden lokal sind, z. B. ein einseitiger stechender Schmerz im Lendenbereich, kann er oft mit Hilfe eines Föhns und einer Haarbürste innert Minuten gelindert werden. Das Föhnen des Beschwerdebereiches ist eine Heissluftanwendung (Thermotherapie) und das gleichzeitige Bürsten dieses Bereiches eine Art Massage (passiv durchgeführte Bewegung). Es werden gleichzeitig die Thermo- und die Mechanorezeptoren stimuliert. Dabei kommt es zu einer Rückkoppelung mit dem Nervensystem. Durch die daraus resultierende Lockerung der Muskulatur fühlt man sich danach «leichter». Eine gute Variante ist die Kombination von heissem Wasser und Bürste. Selbst schwere Erkrankungen, die z. B. Lähmungen, Sprachverlust, Zittern oder Schüttelungen einschliessen, können mit Bewegung therapiert werden. Dazu dienen die Erkenntnisse, die oben beschrieben worden sind.
Wir haben Heilung erfahren
Folgende zwei Erfahrungen verdeutlichen den Gewinn an Lebensqualität und die heilende Wirkung einer konsequenten Umsetzung von Bewegung:
B. W. segelte nach seiner Pensionierung einige Jahre lang regelmässig mit seiner Partnerin in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei. Er erlitt auf seiner letzten Reise einen Riss der grossen Schlagader im Brustraum, der unter dramatischen Umständen in der Türkei erfolgreich operiert werden konnte. Es zeigte sich, dass sein Rückenmark einem Sauerstoffmangel ausgesetzt gewesen war, der querbeet nahezu sämtliche Nervenzellen zerstörte. Als er nach der Narkose aufwachte, konnte er weder Finger und Arme noch Rumpf und Beine fühlen oder bewegen. Er stellte fest, dass er vollkommen gelähmt war. Man teilte ihm mit, dass er Tetraplegiker sei. Er erlebte vonseiten der türkischen Ärzte viel persönliche Anteilnahme. Sobald er transportfähig war, wurde er nach Hause geflogen und in eine schweizerische Universitätsklink eingewiesen. Dort erholte sich sein Rückenmark teilweise durch Spontanheilung, und er konnte seine Arme und Finger wieder bewegen und fühlen. Nach sechs Monaten Aufenthalt war er zwar erfolgreich für ein Leben im Rollstuhl als komplett gelähmter Paraplegiker vorbereitet, den halben Rumpf und seine Beine würde er jedoch künftig weder fühlen noch bewegen können. Man machte ihm klar, dass sein Zustand so bleiben werde. Doch die Sehnsucht nach dem Segeln blieb. Aber als Segler benötigt man funktionierende Beine. Intensiv wurde im Internet recherchiert. Schliesslich kontaktierte er einen Spezialisten für bewegungsmedizinische Therapien. Danach wurde zu Hause eine Ganzkörpertrainingseinrichtung installiert. Über fünf Jahre lang wurde nebst halbtägigem abwechslungsreichem Erlernen der Gehbewegungen zweimal wöchentlich eine Physiotherapie besucht. Dort wurden Gehbewegungen im Stehen eingeübt. Erfolge zeigten sich in
einem erneuten Gewinn an Körpergefühl, zuerst in der Tiefe des Rumpfes und der Beine, später an der Oberfläche. Unter dem Einfluss des Trainings gewannen die gesunden Extremitäten und Rumpfanteile an Kraft, dann kehrte im gesamten Rumpf und in den Beinen die Bewegungsfähigkeit teilweise zurück. Nach dreieinhalb Jahren war er fähig, mit einem Rollator in der Wohnung zu gehen. Dieser musste noch ein wenig von der Partnerin gezogen werden, aber die Beine konnte der Mann bereits alleine bewegen. Nach vier Jahren konnten die Knie mehrere Minuten lang an der Sprossenwand kontrolliert gestreckt gehalten werden. B. W. begann jetzt mit Beinschienen und Stöcken ausserhalb seiner Wohnung zu gehen, wobei er sich jeweils an einem Geländer anlehnte, um regelmässig auszuruhen. Derzeit kann er sich 800m mit seinen Schienen und dem Rollator fortbewegen. Geplant ist, zuerst das tragfähigere Bein von der Beinschiene zu befreien, um danach ohne die Beinschienen auszukommen. B. W. hat einen starken Willen und eine Partnerin, die ihn kräftig unterstützt. Von Monat zu Monat gibt es kleine Fortschritte. Man kann hoffen, dass die beiden es schaffen und ihr Ziel, wieder zu segeln, erreichen.


Erfahrung 2
P. H. erlitt als 69-Jähriger ohne eigenes Verschulden einen schweren Fahrradunfall, als er gewohnheitsmässig seine körperliche Leistungsfähigkeit trainierte. Er wurde in die Luft geschleudert und zog sich u. a. eine Rückenmarkverletzung mit Querschnittlähmung unterhalb des 7. Brustwirbels zu. Ihm und seinen Angehörigen wurde nach einigen Wochen mitgeteilt, die Verletzung sei komplett und er sei jetzt auf ein Leben im Rollstuhl angewiesen. Er konnte unterhalb seines Brustkorbbereiches nichts mehr fühlen und bewegen. Wäre das Rückenmark nur zu 50 % verletzt gewesen, hätte die Chance bestanden, in einem Zeitraum von sechs Monaten bis höchstens zwei Jahren durch konsequentes Üben wieder gehen zu können. P. H. erlernte während seiner erfolgreichen Rehabilitation alles, was für ein Leben im Rollstuhl nötig ist, aber auch die Fähigkeit, wieder selbstständig Auto zu fahren. Dies genügte ihm jedoch nicht. Bereits in der Klinik kontaktierte er einen Spezialisten für medizinische Bewegungstherapie. Er wollte mehr Körperfunktionen zurückgewinnen, denn er hatte gehört, dass das bei konsequenter Umsetzung von Bewegung als Heilmittel möglich sei. Er begann noch während des

Fragen zum Artikel?
Bewegung heilt! Sollte dieser Artikel Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich gerne mit Fragen an tnyff@bluewin.ch wenden.
Klinikaufenthaltes mit einem speziellen Gerät zu üben, das systematisch und Millisekunden genau sämtliche Körperbewegungen durchspielt. Er konnte dieses mit seinen gesunden Armen betätigen. Dabei machte er die Erfahrung, dass sich innert weniger Tage seine Darmtätigkeit verbesserte. Weiter nahm er an einer Studie teil. Diese zeigte, dass einige Wochen nach der Verletzung über einen Zeitraum von sechs Monaten unterhalb der Verletzung das Rückenmark und die verletzten Nerven weitgehend verschwanden. Es bestand nämlich durch die unfallbedingte Abtrennung keine Verbindung mehr zu den ernährenden Zellkörpern. Und dennoch erlebt er heute, wie durch halbtägiges konsequentes Ausführen von bestimmten Bewegungen sein Körpergefühl von der Verletzungsstelle bis zu den Oberschenkeln zurückkehrt. Er kann seinen Rumpf immer besser bewegen und seine Beckenund Oberschenkelmuskeln teilweise betätigen. Auch er macht die Erfahrung, dass der Mensch seine Körperfunktionen durch bestimmte rhythmische Bewegungen zumindest teilweise zurückgewinnen kann. Hätte er nicht beharrlich die körperliche Bewegung als Heilmittel angewandt, hätte sich sein Zustand nicht mehr verbessert. Es
gilt als gesichert, dass nach einer Rückenmarkverletzung nach drei Monaten die natürliche spontane Regeneration des Körpers aufhört – es sei denn, man übt ein, was man wieder beherrschen will. Dabei benutzt man Bewegungen, wie sie Kinder bei ihrer natürlichen Bewegungsentwicklung einsetzen. Die körperlichen Fortschritte kommen dabei beim Menschen in erster Linie durch Umlernen und nicht durch Nachwachsen von Nerven zustande. P. H. übt täglich mehrmals auf seinem Ganzkörpertrainer. Er kann mit Hilfe einer Sprossenwand und von Kniepolstern aufstehen und dabei fühlen, wie ihn seine Muskeln während des Aufstehens tragen. Er benutzt mittlerweile Gehschienen, mit denen er auf einem Sprungbrett hüpft und seine Schrittlänge auf einem sogenannten «Air-Walker» vergrössert. Er geht einige Schritte mit einem Rollator oder auf einem Laufband, bringt die Beine von allein nach vorne und versucht dabei, Druck auf seine Knie und Füsse auszuüben, was von Monat zu Monat besser gelingt. Diese körperlichen Verbesserungen kamen zustande, weil im Körper Reserve-Mechanismen vorhanden sind, die durch körperliche Bewegung aktiviert bzw. freigeschaltet werden können.

Staunen und entdecken


STePhan FReiBuRGhaus,
Chefredaktor «Leben und Gesundheit»

Spiral Galaxie

Erde und Sonne
Unser modernes Leben gerät zunehmend in Bewegung und leider wirft dieses Tempo immer öfter auch Menschen «aus der Bahn». Wenn wir unsere Erde betrachten und zum Sternenhimmel aufblicken, ahnen wir, dass unser Planet und wir selbst nur ein winziger Teil in einem gigantischen Kosmos sind.
War Ihnen schon jemals bewusst, wie schnell sich unsere Erde um die eigene Achse dreht? Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Äquator. Dort sind Sie mit einer Geschwindigkeit von rund 1670 km/h unterwegs, denn in 24 Stunden legen Sie die Strecke des gesamten Erdumfangs von 40’075 km zu-
rück! Aber die Erde rotiert nicht nur um sich selbst, sondern sie kreist auch ständig um die Sonne. Die mittlere Geschwindigkeit, mit der sie die Sonne umrundet, beträgt 29,78 Kilometer pro Sekunde, das sind atemberaubende 107’208 km/h!
Die Sonne ist rund 149,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Damit ist sie so weit weg von uns, dass das Sonnenlicht mehr als 8 Minuten benötigt, um die Erde zu erreichen. Der Stern, der uns am nächsten steht – Proxima Centauri im Sternbild Zentaur – ist etwa 40 Billionen Kilometer von uns entfernt. Die Entfernungen im Weltraum sind so riesig, dass wir sie nicht in Kilometern, sondern in Lichtjahren messen. Ein Licht-
jahr ist die Entfernung, die das Licht mit einer Geschwindigkeit von fast 300’000 Kilometern pro Sekunde in einem Jahr zurücklegt. Das Licht von Proxima Centauri braucht über vier Jahre bis zur Erde. Wollten wir in einer Weltraumkapsel mit einer Geschwindigkeit von 30’000 Kilometern in der Stunde zu diesem Stern fliegen, würden wir dort niemals ankommen, weil wir über 150’000 Jahre unterwegs wären.
Dank des Einsatzes des Hubble-Weltraumteleskopes sind wir zu gewaltigen Einsichten gelangt. Astronomen schätzen, dass heute mindestens 175 Milliarden Galaxien von der Erde aus sichtbar gemacht wer-


Milchstrasse

Buchtipp zum Thema

Bestelladressen:
www.advent-verlag.ch
Taschenbuch
144 Seiten
Format 11 x 18 cm
durchgehend farbig illustriert
Preis:
CHF 6.00 / € 3.90

www.toplife-center.at www.adventistmedia.de
den können. Sie fragen sich, wie viele Sterne das sind? Wenn man die ca. 200 Milliarden Sterne unserer Galaxie als einen Durchschnittswert für alle Galaxien nimmt, wären es 35’000 000’000’000’000’000’000 Sterne (35 Trilliarden). Wenn Sie versuchen wollen, sich unter dieser Zahl etwas Konkretes vorzustellen, nehmen Sie, wenn Sie das nächste Mal an einem Strand sind, eine Handvoll Sand. Nach Schätzung der Astronomen gibt es im Universum mehr Sterne als Sandkörner an sämtlichen Stränden der Welt zusammen. Die Menge der Sterne, die Sie am nächtlichen Himmel sehen können, ist demgegenüber vergleichbar mit einer Handvoll Sand.
Schon oft habe ich erlebt, dass es wohltuend sein kann, die Augen zum Himmel zu heben. Dann denke ich darüber nach, dass unsere Erde in einem unbegrenzt riesigen Universum beständig und verlässlich ihrem vorbestimmten Lauf folgt, und auch die Lebensbedingungen auf unserer Erde eingebunden sind in einen wohlgeordneten Kosmos.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, warum aus dem «Aufblicken» Zuversicht und Hoffnung werden kann, dann empfehle ich Ihnen gerne die hier abgebildete Broschüre «unfassbar!».


DR. MeD. RueDi BRODBecK Hausarzt / Psychosomatiker, Alchenflüh, CH
… lesen Sie den Beipackzettel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.» So endet jeder Werbespot. Aber erfahren Sie so auch die Wahrheit?

Frau Gehrig* erhielt von ihrem Zahnarzt im Rahmen seiner Behandlung für wenige Tage ein häufig verabreichtes, entzündungs- und schmerzhemmendes Medikament. Dieses Medikament verursacht häufig Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Nach wenigen Tagen erschien Frau Gehrig wegen Unwohlsein und Erbrechen in meiner Praxis. Das Medikament hatte zu einem akuten, vollständigen Nierenversagen geführt. Eine Behandlung im Krankenhaus, viel Angst und Unsicherheit und regelmässige Kontrollen waren die Folge. Frau Gehrig hat Glück gehabt. Es geht ihr wieder gut, wenn sich auch ihre Nieren nicht vollständig erholt haben.
Ist der Umgang mit Nebenwirkungen … Nebenwirkungen sind ein leidiges Thema medizinischer Behandlungen. Patienten und Ärzte gehen ganz unterschiedlich damit um. Etwas überspitzt ausgedrückt, gibt es unter den Ärzten den grosszügigen, etwas forschen Typ, der sich nicht darum zu kümmern scheint. Er verordnet allerlei Medikamente, gegen dieses und jenes, oft die neusten, manchmal auch Kombinationen. Wenn es nötig ist, kennt er auch ein Mittel gegen die durch seine Therapie verursachten Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite gibt es den zurückhaltenden, vorsichtigen Typ. Er wägt vor jeder Verordnung Risiken und Nutzen gut ab,

klärt die Patienten hinreichend über die erwarteten Wirkungen und möglichen Nebenwirkungen auf und berücksichtigt nach Möglichkeit auch medikamentenfreie Therapiemöglichkeiten.
… eine Frage der Persönlichkeit?
Ähnlich ist es auch auf der Patientenseite. Da sind diejenigen, die gegen jede Befindlichkeitsstörung eine medikamentöse Therapie wollen. Sie stellen kaum Fragen, lesen den Beipackzettel nie und tun einfach, was der Arzt sagt, ausser es wirkt nicht sofort. Dann nehmen sie nämlich auch gerne mal eine doppelte Ration. Auf der anderen Seite sind die ängstlichkritischen Patienten. Bereits in der Sprechstunde stellen sie eine Menge Fragen über jedes vorgeschlagene Medikament, über die häufigen und seltenen Nebenwirkungen und auch über die möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Bevor sie dann eine erste Dosis einnehmen, lesen sie noch aufmerksam den Beipackzettel und recherchieren auch auf einschlägigen Seiten im Internet. Oft finden sie dort abschreckende Erfahrungsberichte, und wenn sie bis jetzt den Mut noch nicht völlig verloren haben, rufen sie noch einmal an, um sich zu vergewissern, dass …

Wie informieren Sie sich?
Zu welchem Typ gehören Sie? Ich vermute, Sie sind da irgendwo zwischendrin, vielleicht etwas mehr auf dieser oder jener Seite. Wie informieren Sie sich über Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen? Lesen Sie den Beipackzettel? Verstehen Sie diesen auch? Ist er überhaupt für Sie geschrieben? Viele meiner Kollegen sind überzeugt, dass Beipackzettel weniger für Patienten als für Juristen verfasst sind. Sie scheinen eher der Abwehr möglicher Klagen als echter Aufklärung zu dienen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker? Wird er Ihnen die «Wahrheit» sagen? Kennt er denn diese überhaupt?
Die häufigen Nebenwirkungen sind natürlich meistens gut bekannt. Von «häufig» spricht man in der Regel, wenn die Nebenwirkung in mindestens 1 % der Anwendungen auftritt, «sehr häufig», wenn es mehr als 10 % sind, «sehr selten», wenn weniger als 0,01 % betroffen sind. Fast alle Medikamente können die Leber belasten, Kopfschmerzen verursachen, Magen-DarmBeschwerden auslösen oder zu Blutbildveränderungen führen. Wassertreibende Medikamente verschlechtern den Zucker oder lösen gar einen Gichtanfall aus, Blutdruckmedikamente können zu Impotenz führen, Betablocker die Blutfette negativ beeinträchtigen und Depressionen auslösen, Antidepressiva (vor allem ältere) das Herz angreifen und Cholesterinsenker Muskelkrankheiten oder Diabetes verursachen.
Fortlaufend erscheinen allerdings neue Medikamente auf dem Markt. Diese sind zwar vor dem Markteintritt bereits anhand von Studien bezüglich ihrer Wirkungen / Nebenwirkungen untersucht worden. Seltene Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten werden aber immer wieder erst bei einer breiten Anwendung der Medikamente auf dem Markt erkannt. Ich habe es wiederholt erlebt, dass mit viel Aufwand lancierte Medikamente, die bereits über einen grossen Marktanteil verfügten, wegen unerwünschter Wirkungen wieder vom Markt zurückgezogen werden mussten. Entspricht nicht hier das, was man aktuell weiss, bloss dem heutigen Stand des Irrtums? Ganz besonders schwierig wird es, wenn mehrere Medikamente im Spiel sind. Bestimmt verfügen wir über gewisse Erfahrungswerte bezüglich gegenseitiger Wechselwirkungen. Fachleute gehen aber davon aus, dass man nie sicher voraussagen kann, was passiert, wenn fünf oder mehr Medikamente zusammentreffen. Ich wage gar nicht daran zu denken, wie oft dies auch bei meinen älteren Patienten der Fall ist.
Es war gut bekannt, dass das Medikament, das Frau Gehrig abgegeben wurde, schwere Nierenfunktionsstörungen verursachen kann. Allerdings kommt dies nur sehr selten vor. Wenn Sie persönlich von einer solch schweren Nebenwirkung betroffen wären, wäre es für Sie dann hilfreich, dass mindestens 9999 andere dieses Medikament gut vertragen haben?
Gibt es Alternativen?
Da mir solche Überlegungen nichts helfen, frage ich mich immer, ob eine medikamentöse Behandlung wirklich nötig ist. Wie würde der Spontanverlauf aussehen? Gibt es weniger gefährliche Alternativen?
Nicht alle Behandlungen verursachen übrigens gefähr-
liche Nebenwirkungen. Eine amerikanische Forschergruppe hat den Einfluss einer intensiven Lebensstilumstellung auf Herzkreislauferkrankungen und Krebs untersucht. Dabei ist es ihr gelungen, nicht nur zu zeigen, dass Lebensstiländerungen wirken, sondern auch wie. Sie fördern die Gesundheit über epigenetische Mechanismen, also über regulatorische Effekte im Zellkern. Bei Patienten mit Prostatakrebs bewirkten eine sehr fettarme pflanzliche Ernährung, täglich mindestens 30 Minuten körperlicher Aktivität und gezieltes Stressmanagement bereits nach drei Monaten im Prostatagewebe Veränderungen im Bereich von etwa 500 Genen. Der Leiter dieser Gruppe meint, dass es an der Zeit sei, dass Lebensstilmassnahmen nicht nur vorbeugend, sondern auch therapeutisch genutzt werden. Und die Nebenwirkungen seiner «Therapie»? Gewichtsreduktion, verbesserte Blutfettwerte, Senkung des erhöhten Blutdrucks und ein nachweislich besseres seelisches Wohlbefinden. Welche Art Nebenwirkungen ziehen Sie vor?
*Name geändert



EDiTh NiGG-SchÖB
Polygrafin,
Hausfrau, Merenschwand, CH
... ist es höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Hier fi nden Sie nützliche Tipps, um dem Schmutz Herr (und Frau) zu werden!
Staub überall
Wenn die Sonne ins Zimmer scheint und ihre Strahlen auf den Boden wirft, erkennt man darin unzählige, winzig kleine Staubpartikel.
Egal wie oft man abstaubt –der Staub kommt immer wieder.
Da nützen auch die teuersten Tücher mit antistatischer Wirkung nicht viel.

Zwar bekommt man im Handel Staubsauger, die auch die Luft im Raum reinigen können, aber über kurz oder lang ist der Staub doch wieder da. Wenn Tiere im Haushalt leben, kommen noch Haare und Dreck von draussen dazu.
Also bleibt uns nichts anderes übrig, als immer und immer wieder – gern oder ungern – den Putz- oder Staublappen in die Hand zu nehmen.
Staubwischen – 4 Tipps
1. Feuchte Lappen nehmen den Staub besser auf als trockene und er wird nicht aufgewirbelt. Ein wenig Spülmittel ins Wasser geben und den nassen Lappen gut auswringen.
2. Luftbefeuchter verbessern nicht nur das Raumklima, auch die Staubbildung wird eingedämmt.
3. Zuerst Staub wischen und erst anschliessend den Boden saugen.
4. Pflanzen binden den Staub und reinigen die Luft. Vor allem Blumen mit haarigen Blättern ziehen die Staubpartikel an. Aber nicht vergessen: Auch die Pflanzen brauchen Pflege.
Der richtige Staubsauger Staubsauger erleichtern die Hausarbeit. Wenn das Gerät allerdings zu schwach ist, kann Staubsaugen zu einer sehr lästigen Pflicht werden.
Achten Sie auf eine gute Motorenleistung, vor allem, wenn auch Tiere im Haushalt leben.
Der Aktionsradius beim Saugen sollte möglichst gross sein. Lange Stromkabel sind also von Vorteil.
Das Teleskoprohr muss auf ihre Körpergrösse anpassbar sein, um Rückenschmerzen zu vermeiden.
Die meisten Staubsaugeraufsätze werden selten genutzt. Aber eigentlich leisten sie gute Dienste. Besonders die speziellen Bürsten für Stoffmöbel und die verschiedensten Bodenbeläge. Die Saugleistung muss gut regulierbar sein, dann können auch Vorhänge mal kurz gesaugt werden.
Frühlingsputz kann auch Spass machen
Vielleicht möchten Sie nicht alleine putzen? Dann holen Sie sich Hilfe und bieten ebenfalls Hilfe an. Zu zweit macht es doppelt Spass. Allerdings sind klare Anweisungen wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Zwischendurch eine Pause einlegen und einen Schwatz halten – dann kann man frisch gestärkt weiter herumwirbeln.
Mit Musik geht das Putzen viel leichter von der Hand.
Bequeme, abgetragene Kleidung ohne lange Ärmel –man bekommt auch so warm genug – sind auch ein Schutz vor Unfällen. Genauso wichtig sind sichere Trittleitern.
Bereits vor Beginn sollte man alle benötigten Putzutensilien bereitstellen.
Arbeitet man systematisch von Raum zu Raum, ist man effizient. Immer von oben nach
unten putzen, also immer den Boden am Schluss in Angriff nehmen.
Stauraum gewinnen
Oft wird beim Putzen der Wunsch grösser, unnötig herumstehende Dinge versorgen zu können. Um auch in kleinen Wohnungen mehr Stauraum zu finden, braucht es manchmal etwas Fantasie. Aber ein Chaos lässt sich mit folgenden Ideen beseitigen:
1. Den Kleiderschrank durch einen begehbaren Schrank ersetzen. Ein Kleiderschrank ist selten gross genug und meistens reicht er in der Höhe nicht bis zur Decke. Man kann einen Teil des Raumes mit Schiebetüren vom Rest abtrennen und im neu gewonnenen Raum Kleiderstangen und Holzregale anbringen.
2. Im Wohnzimmer kann zum Beispiel ein Teil mit einem Podest versehen werden und der neu gewonnene Raum mit herausziehbaren Schubladen (auf Rädern) bietet viel zusätzlichen Platz. Ausserdem macht ein Podest den Raum interessanter und gestaltungsreicher.
3. Stauraum ist in kleinen Küchen wichtig. Wenn es zwischen Oberschränken und Decke noch Platz hat, kann man diesen mit hübschen Kartonschachteln versehen. Dort aber nur Dinge aufbewahren, die man nicht täglich braucht.
4. Im Schlafzimmer schaffen Hochbetten zusätzlichen Raum (z. B. für einen Arbeitsplatz. Allerdings sollte die Raumhöhe entsprechend sein, um sich beim Erwachen nicht den Kopf anzuschlagen.
5. Auch Treppen bieten idealen Stauraum. Je nach Standort kann man massgefertigte Regalböden einbauen oder auch einfach ein passendes Bücheroder Kellerregal hineinstellen.


Parkett kann besonders umweltfreundlich geputzt werden, wenn man Schwarztee ins Putzwasser gibt. Aber Fachleute empfehlen spezielle Reiniger, die auch das Ausbleichen verhindern. Parkett nur feucht wischen, nicht nass und sofort nachtrocknen.
Laminat nur mit klaren Wasser feucht wischen. Flecken können mit Spiritus entfernt werden.
Linoleum ist ein sehr widerstandsfähiges Material. Bei starker Verschmutzung kann man ein paar Tropfen Terpentin verwenden. Danach sofort mit klarem Wasser nachspülen und den Boden mit Spezialwachs einreiben.
Marmor reinigt man am einfachsten mit Seifenwasser. Ist er stärker verschmutzt, kann man etwas Salmiak ins Wasser geben. Anschliessend den Marmor mit Bienenwachs verwöhnen. Zitronensaft sollte man nicht verwenden, weil die Säure die Oberfläche beschädigen kann.












UTe EGGleR Gesundheitsberaterin, Wünnewil, CH
«Frühstücke wie ein Kaiser, iss zu Mittag wie ein Bürger und zu Abend wie ein Bettelmann.» Dieses Sprichwort ist sicher vielen bekannt. Und tatsächlich haben Studien gezeigt, dass ein ausgewogenes, vollwertiges Frühstück leistungsfähiger, weniger nervös und weniger unfallgefährdet macht. Nach einem vollwertigen Frühstück können Kinder sich besser konzentrieren und zeigen allgemein bessere schulische Leistungen.
Ein gutes Frühstück enthält mindestens ein Drittel des täglichen Kalorienbedarfs. Wird das Frühstück aus Vollkornpro-
dukten, Früchten, Samen und Nüssen zubereitet, beginnt der Tag schon mit einer «Nährstoffbombe». Ausserdem eignet sich die Anwendung des zitierten Sprichwortes auch sehr gut zum Abnehmen!
Damit Sie Ihr Frühstück abwechslungsreich und vollwertig gestalten können, übermitteln wir Ihnen hiermit einige nicht so alltägliche Rezepte wie «Granola», «Pancakes» oder einen leckeren «Kokosaufstrich» (ohne Zucker). Guten Appetit!






Granola Pancake Deluxe Fruchtsauce Pflaumenaufstrich Kokosaufstrich








500 g Haferflocken
100 g Mandeln
100 g Kokosflocken
100 g Sonnenblumenkerne
100 g Sesam, ungeschält, gemahlen
100 g Kürbiskerne, gehackt
100 g Leinsamen, gemahlen
250 g Datteln
400 ml heisses Wasser
1 Datteln und heisses Wasser im Mixer pürieren.
2 Dattelmus mit restlichen Zutaten in Schüssel gut vermischen.
3 Auf zwei mit Backpapier ausgelegte Bleche locker verteilen und bei 120 °C 25 Min. backen. Granola umrühren und weitere 20 Min. backen. Nach dem Abkühlen sollte das Granola trocken sein.
4 Mit Sojadrink, Mandeldrink oder Milch servieren. Dazu passt Obstsalat.
Optional: Rosinen nach dem Backen daruntermischen. Granola ist in einem verschlossenen Behälter mehrere Wochen haltbar.
1 reife Banane
300 g Beeren (z. B. Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Brombeeren) frisch oder gefroren
Früchte im Mixer pürieren, über Pancakes giessen. (Beeren können durch beliebige Früchte ersetzt werden.)
Kokosaufstrich
100 g Kokosflocken
130 g Datteln
200 ml heisses Wasser
1/2 TL Vanille
1 Datteln, Wasser und Vanille im Mixer pürieren.
2 Kokosflocken daruntermischen und abkühlen lassen.
Im Kühlschrank aufbewahren.
Pancake Deluxe ergibt ca. 12 Pancakes
275 g Vollkorn-Dinkelmehl
80 g Kokosflocken
2 TL Backpulver
1/8 TL Muskat
1/4 TL Zimt
1/8 TL Salz
300 ml Kokosnussmilch
1 TL Vanille
2 EL Agavedicksaft
300 ml Wasser
Olivenöl
1 Trockene Zutaten in Schüssel vermischen.
2 Flüssige Zutaten ausser Olivenöl vermischen und unter die trockenen Zutaten mengen.
3 Beschichtete Pfanne mit wenig Olivenöl bestreichen und ca. Ø 12 cm grosse Pancakes in Pfanne formen und bei mittlerer Hitze beidseitig goldbraun backen. Warm servieren.
Die Pancakes können nun mit Nussmus (Erdnuss-, Haselnuss- oder Mandelmus) und Bananenstückchen, Nussmus und Apfelmus, Nussmus und Obstsalat oder Nussmus und Fruchtsauce belegt werden.
200 g Pflaumen, getrocknet und entsteint
Orangensaft
Zimt
1/2 TL Vanille
1 Pfl aumen in Schüssel mit Orangensaft bedecken und über Nacht einweichen.
2 Pflaumen, Orangensaft und Vanille im Mixer pürieren und mit Zimt abschmecken.
Im Kühlschrank aufbewahren.











































DR. MeD. J. D. PaMPlOna-ROGeR
Praktizierender Arzt und Autor, Spanien / Schweiz

Obwohl gegen die innerliche Verwendung von Hufl attich Bedenken aufgekommen sind, ist der vernünftige Gebrauch dieser Pfl anze zur Linderung von Husten und Halsbeschwerden ohne grosse Gefahren möglich.
Der lateinische Name «tussilago» bedeutet «Hustenunterdrücker». Die Blätter und die voll geöffneten Blütenköpfchen wurden lange Zeit in Europa und China zur Behandlung von Atemwegsbeschwerden verwendet. Durch die analytische Chemie wurden jedoch Spuren von Pyrrolizidin-Alkaloiden entdeckt. Diese können Leberschäden, einige von ihnen sogar Leberkrebs verursachen. Aus diesem Grund wurde die Verwendung von Huflattich infrage gestellt. Bei richtiger Verwendung kann er jedoch auch heute noch sicher und wirkungsvoll eingesetzt werden.
Nicht in allen Pflanzen findet sich die gleiche Konzentration von giftigen Stoffen. Bei Wildpflanzen sind die Konzentrationen meist höher. Kultivierte Arten, aus denen man medizinische Präparate herstellt, enthalten nur sehr niedrige bis keine nachweisbaren Mengen von Alkaloiden. Bei der mit dem Namen Tussilago farfara (Wein) bezeichneten Art, welche in Österreich und Deutschland gezüchtet wurde, lassen sich keine Pyrrolizidin-Alkaloide nachweisen.

Hauptinhaltsstoffe:
Schleim bittere Glycoside
Tannine
Triterpene
gesättigte PyrrolizidinAlkaloide
Es gibt zwei Arten von Alkaloiden: gesättigte und ungesättigte. Gesättigte Pyrrolizidin-Alkaloide, z. B. Senkirkin, sind Lebergifte und möglicherweise krebserregend. Ungesättigte Pyrrolizidin-Alkaloide wie z. B. Tussilagone üben keine schädigende Wirkung auf die Leber aus, sie stimulieren die Blutgefässe des Herzens und die Atmungsorgane. Einige Pflanzenarten enthalten nur sehr wenige oder gar keine Pyrrolizidin-Alkaloide. In den Blütenköpfchen finden sich die gleichen Stoffe wie in den Blättern, aber zusätzlich noch Karotinoide. Die Pyrrolizidin-Alkaloide, sowohl die gesättigten wie auch die ungesättigten, sind vermehrt vorhanden (etwa 3 x mehr).
Wirkungen:
Hustenstillend: Huflattich vermindert die Häufigkeit und Intensität des Hustens.
Auswurffördernd: Huflattich stimuliert die Bewegung der feinen Härchen in den Atemwegen. Diese Bewegung ermöglicht die Ablösung und das Aushusten von Schleim, der sich in den Atemwegen befindet. Anregend: Huflattich wirkt stimulierend auf Herz und Lunge.


Wissenschaftlicher Name: Tussilago farfara L.
Familie: Asteraceae
Deutsche Synonyme: Brandlattich, Pferdefuss Englischer Name: Coltsfoot
Botanische Beschreibung:
Winterharte, krautartige Blütenpflanze, 10 bis 20 (30) cm hoch.
Die Pflanze bildet im Frühling gelbe Blütenköpfchen, die aus Zungen- und Röhrenblüten zusammengesetzt sind. Diese sitzen auf Stängeln mit kleinen Blattschuppen. Die grundständigen, herzförmigen Blätter erscheinen erst nach der Blüte. Sie sind oberseits hellgrün, auf der Unterseite weissfilzig behaart.
Geografische Verbreitung:
In Nord- und Osteuropa sowie Nordasien beheimatet. In Nord- und Südamerika wurde die Pflanze als Heilpflanze eingeführt.
Vorkommen:
In feuchten Gebieten, an Strassenrändern, vorwiegend im Bergland.
Verwendete Pflanzenteile:
Die Blätter können, möglichst blanchiert, Salaten beigefügt werden. Früher benutzte man vorwiegend die Blütenköpfchen und die Wurzeln. Dies wird heute wegen des hohen Gehalts an giftigen Pyrrolizidin-Alkaloiden, die sich vor allem in Wildpflanzen finden, nicht mehr empfohlen.
Husten
Die Schleimstoffe des Huflattichs bedecken die Schleimhäute der Atemwege mit einer beruhigenden Schicht, die den Hustenreiz lindert. Huflattich wirkt auch bei Husten, der von einem Lungenemphysem oder von Silikose (Staublunge) ausgelöst wird.
Bronchitis
Huflattich beschleunigt den Heilungsprozess einer geschädigten Schleimhaut.
Halsschmerzen
Huflattich schützt die Rachen-Schleimhäute und lindert akute und chronische Halsschmerzen.
Heiserkeit
Huflattich beruhigt Schleimhautentzündungen im Rachenbereich.
Hautprobleme
Traditionell wird Huflattich benutzt, um die Heilung von Wunden und Geschwüren zu beschleunigen. Die Anwendung sollte aber nicht auf offene Wunden erfolgen.
Innerlich
Kräutertee (Zubereitung ): 2 oder 3 Mal täglich 1 Tasse trinken. Nicht länger als 6 Wochen in einem Jahr, es sei denn, der Tee ist garantiert frei von leberschädigenden Pyrrolizidin-Alkaloiden.
Flüssiges Extrakt (Zubereitung ): 0,6 bis 2 ml 2 oder 3 Mal pro Tag.
Sirup (Zubereitung ): 2 bis 8 ml, 2 oder 3 Mal pro Tag.
Zubereitungsarten:
Äusserlich
Umschläge mit frischen Blättern (Zubereitung ): Anwendung auf die verletzte Haut ein- oder zweimal pro Tag.
Tee aus Huflattich-Blättern oder -Blüten: Man giesst 150 ml kochendes Wasser auf 5 g gehackte frische Blätter (ungefähr ein Esslöffel voll) oder auf 2 g getrocknete Blätter (ungefähr ein Teelöffel voll) und seiht nach 10 Minuten ab. Flüssigkeitsauszug: als pharmazeutische Zubereitung erhältlich.
Sirup: als pharmazeutische Zubereitung erhältlich. Umschlag mit frischen Blättern: Man zerdrückt eine Anzahl frischer Blätter, bis man eine Art Brei erhält.

Warnhinweise:
Obwohl die wilden Huflattichpflanzen eine gewisse Menge an giftigen Pyrrolizidin-Alkaloiden enthalten können (etwa 0,01 % vom Trockengewicht), besteht keine Gefahr von Vergiftungen, wenn Huflattich wie angegeben verwendet wird. Die Konzentration von Alkaloiden in Kräutertees ist gering. Zudem kann das Risiko von Leberschäden vernachlässigt werden, wenn man pyrrolizidinfreie Huflattich-Zubereitungen benutzt.
Vorsichtsmassnahmen:
Vermeiden Sie es, Huflattich-Tee länger als 4 Wochen infolge zu trinken oder länger als 6 Wochen, verteilt auf ein Jahr, es sei denn, der Tee ist garantiert pyrrolizidinfrei. In diesem Fall kann Huflattich ohne zeitliche Begrenzung verwendet werden.
Lassen Sie im Verdachtsfall einen Leber-Funktionstest machen.
Wenn Sie Herzprobleme haben oder unter Bluthochdruck leiden, verwenden Sie Huflattich nur mit Bedacht. Vermeiden Sie die äusserliche Anwendung bei offenen Wunden.
Kontraindikationen:
Lebererkrankungen Schwangerschaft und Stillzeit: In dieser Zeit sollte Huflattich nicht verwendet werden.
Säuglings- und Kinderzeit: den Gebrauch vermeiden.
Allergie auf Korbblütler: Auch Menschen, die auf Ambrosia, Kamille und andere Korbblütler allergisch reagieren, sollten Huflattich meiden.
Das Deutsche Bundesgesundheitsamt (BGA) regelt die Sache folgendermassen: «Huflattich ist die einzige Pflanze, die ungesättigte Pyrrolizidin-Alkaloide enthält und innerlich angewendet werden darf. Die Anwendungszeit soll aber 4 bis 6 Wochen nicht überschreiten.»



WAAGRECHT – Zeile für Zeile
Dt. für Tumbler • Wassertier • weibl. Vorname • nur eine/r • Skisportdisziplin • fertig gekocht • Notruf • Kübel • Fragewort • Bewohner der CH-Hauptstadt • franz. Artikel • bei etwas • Nebenfluss des Mains • Teil des Baums • Abk. Mittwoch • Abk. f. Alabama • mittlere Frauenstimme • Abk. Orientierungslauf • neuer Stern • Abk. Ukraine • Huftier • engl. Luft • franz. ich • schuppenloser Fisch • Inschrift am Kreuz Jesu • Saiteninstrument • jap. Gesellschafterin • Papageienart • weitergegebener Vermögensteil • Abk. Leutnant • Abk. für e. CHKanton • nicht out • wenn, dann • Einfall • Pers. Pronomen • engl. Artikel • Abk. Junge Union • nicht hinten • Abk. gegebenenfalls • Auto zur Personenbeförderung gegen Bezahlung
Jede Farbe steht für die neben dem Rätsel aufgeführten Buchstaben. Welche es jeweils sind, müssen Sie anhand der Fragen herausfinden. Ansonsten löst man das Rätsel wie ein Kreuzworträtsel. Viel Vergnügen. Die rot eingerahmten Felder ergeben das Lösungswort.
SENKRECHT – Spalte für Spalte Hauptstadt Österreichs • arab. Land • Gewinn • alttest. Name für Gott • Abk. Naturschutzgebiet • Tür, Entrée • lat. über • alt. russ. Herrscher (Mz.) • Gefängnisaufenthalt • Engel • heiter, beschwingt • CH-Wettersendung • nicht Flut • Zeugnisnote • Abk. Neue Zürcher Zeitung • Abk. Tantal • sibir. Fluss • schweiz. für Umzug • Ausflug • Abk. Allgemeine Ortskrankenkasse • Schwur • engl. an • defekte Stelle im Stoff • ital. Artikel • nicht Nein • europ. Kleinmünzen • Kristallart • Scherz • Untergeschoss • Holzpflock • vergleichsweise, ziemlich • Hetze • Vorname des Schauspielers Sharif • Abk. Donnerstag • engl. Öl • Ureinwohner Amerikas • ewig • Abk. Nichtraucher • franz. in • Nahrungsmittellager • richtig, nicht gelogen
Lösungswort Farbfelderrätsel:
Lösungen: Rätsel Nr. 5 (Jan./Feb) «Bewusst essen», Sudoku «256».
Gewinner: Rätsel Nr. 4: Frau L. Herrmann, Orpund, und Frau C. Walter, Tobel.
Bei jeder Ausgabe verlosen wir unter den richtigen Einsendungen zwei Gutscheine im Wert von CHF 50.–, gültig zum Bezug von Artikeln aus dem Angebot des Advent-Verlages. Wenn Sie auch das Sudoku lösen und uns die drei farbig hinterleg-
ten Zahlen nennen, erhöht sich Ihr Gewinn auf CHF 65.–. (Angestellte des Verlages und der Druckerei sind ausgenommen.)
Bitte senden Sie die Lösung auf einer Postkarte bis zum 10. April (Poststempel) an unsere Adresse:
Leben und Gesundheit
Rätsel, Leissigenstr. 17 CH-3704 Krattigen
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Denksport.



Hanna FReiBuRGhaus Kleinkind- und Horterzieherin i.A., St. Peter, A
Du kannst diesen Zeitungshut nicht nur auf dem Kopf verwenden, sondern auch um dich zu bewegen. Um ein Spiel daraus zu machen, werden Zeitungsbälle erstellt. Hierzu einfach Zeitungsblätter zusammenknüllen.
































Den Zeitungshut mit dem Spitz nach unten zeigend in einer Hand halten. Mit der anderen Hand den Zeitungsball nach oben werfen und versuchen, diesen mit dem Zeitungshut aufzufangen. Dieses Spiel kann auch zu zweit gespielt werden. Eine Person wirft, und die andere Person versucht zu fangen. Ist der Hut voll, wird gewechselt.
































Die Spitze des Zeitungshutes nach innen knicken, sodass dieser von alleine am Boden steht. In beliebiger Entfernung aufstellen und versuchen, mit den Zeitungsbällen hineinzuwerfen. Bei diesem Spiel können beliebig viele Personen mitmachen.
1. 5 Zeitungsseiten aufeinanderlegen. Je grösser die Seiten, um so grösser wird am Ende der Hut.














2. An der Mittellinie zusammenfalten.




3. Bögen längsseits drehen und erneut in der Mitte falten und wieder aufklappen. Die off enen Blattkanten liegen unten.



4. Das rechte obere Eck wird zur Mittellinie gefaltet.



5. Bögen wenden und erneut das obere Eck zur Mittellinie falten.





6. Die Hälfte der Zeitungsblätter des unteren Randes nach oben falten.



7. Bögen erneut wenden.



8. Die übrig bleibenden Seiten des unteren Randes wieder nach oben falten.



9. Die überstehenden Ecken des Randes nach hinten innen falten.


10. Dann die hinteren überstehenden Ecken darüber falten, sodass nur noch ein Dreieck zu sehen ist. Mit Klebestreifen diese letzten zwei Faltungen fi xieren.











































































































Hanna KlenK Gesundheitsberaterin, Krattigen, CH
Körperliche Bewegung ist das A und O des menschlichen Lebens. Trotzdem brauchen unsere Organe auch genügend Ruhe. Doch auch wenn wir schlafen, ist einer immer in Bewegung, unser Herzmuskel. Er ist der wichtigste Teil des Organismus und arbeitet unermüdlich bis zum Tod.

Was?
Der Herzmuskel myocard (lat.) bildet den grössten Teil des Herzens oder der «Blutpumpe». Am 23. Tag nach der Zeugung fängt das Herz des Fötus im Mutterleib zu schlagen an. Am Tag der Geburt hat es schon mehr als 40 Millionen Mal gepumpt. Im erwachsenen Menschen werden pro Minute annähernd 5 Liter Blut befördert. Dieser Vorgang wird durch das vegetative Nervensystem gesteuert und läuft unbewusst ab. Fällt ein erhöhter Bedarf an, wenn etwa beim Anblick einer geliebten Person
«Herzklopfen» einsetzt oder das 5. Stockwerk zu erklimmen ist, kann das Volumen bis auf 25 Liter pro Minute erhöht werden. Äussere Einflüsse üben also zusätzlich eine Wirkung auf diesen Muskel aus. Die linke Herzkammer erbringt die Hauptpumpleistung. Es wird geschätzt, dass Kinder über etwa 6 Milliarden Herzmuskelzellen verfügen. Im Laufe des Lebens nimmt diese Zahl kontinuierlich ab. Ältere Menschen verfügen noch über 2–3 Milliarden Zellen.
Wo?
Der Herzmuskel liegt schräg im Brustraum. Die Herzspitze befindet sich auf der linken Seite, deshalb ist der Herzschlag dort besser zu spüren.
Funktion:
Das Herz ist ein Hohlmuskel. Zieht es sich zusammen, wird das Volumen im Inneren verringert. Es besitzt einen schlingenförmigen, vernetzten Aufbau. Spezielle quergestreifte Muskelfasern sind in ein System eingebunden, das die Synchronisation des schnellen und kräftigen Zusammenziehens ermöglicht. Die einzelnen Herzmuskelzellen sind durch sogenannte Glanzstreifen miteinander verbunden. Für die Impulsübertragung sind die darin liegenden Gap Junctions verantwortlich. Sie stabilisieren einen Zellverband, übertragen die
Kraft und dienen als Ankerverbindungen. Stellen Sie sich dafür zwei nebeneinanderliegende Zellen vor. Ihre Membranen (die Zellhäute) werden von ZellKanälen durchquert. Dadurch werden die Zellen in einem Abstand von 2 bis 4 Nanometern, also 0,000004 mm, zueinander fixiert. Diese unvorstellbar kleine Lücke wird durch Proteinkomplexe überbrückt, welche auf diese Weise die Kommunikation ermöglichen. Schon diese Vorgänge sind derart kompliziert, dass ihre Beschreibung das ganze Magazin füllen könnte. Besondere Herzmuskelzellen übernehmen die Grundsteuerung der Herzaktion. Sie bilden das Erregungsbildungssystem. Spezialisierte Herzmuskelfasern leiten Impulse an die Arbeitsmuskulatur. Hier sind keine Nervenfasern beteiligt. Kurzfristige Blutdruckschwankungen erfordern eine Anpassung der Herzmuskeltätigkeit. Ein Beispiel dafür ist der Übergang von einer sitzenden zu einer stehenden und gehenden Haltung. Die Anpassung erfolgt über den sogenannten Frank-Starling-Mechanismus. Dieser ist ein autonomer Regelkreis im Herzen. Je grösser das Volumen des einströmenden Blutes ist, desto mehr wird auch ausgestossen. Sind die vom Herzen wegführenden Gefässe verengt oder verstopft, muss daraufhin das Schlagvolumen vermindert wer-
Obere Hohlvene
Lungenarterien
Lungenvenen
Rechter Vorhof
Rechte
Segelklappe
Rechte
Herzkammer
Untere Hohlvene

Aorta
Lungenarterie
Rechte Taschenklappe
Lungenvenen
Linker Vorhof
Linke Segelklappe
Linke Herzkammer
Bauchschlagader blauer Bereich – sauerstoff armes Blut roter Bereich – sauerstoff reiches Blut
den. Das Herz kann nicht mehr effizient arbeiten. Ist der Rückfluss zum Herzen sehr gering, sinkt bei vermindertem Blutauswurf aus dem Herzen der Blutdruck ab. Wenn zum Beispiel jemand in der Sonne steht, versackt das Blut in den weiten Beinvenen. Dem Menschen wird schwindelig und er kollabiert.
Zusammenspiel im Körper
Um die Tätigkeit des Herzmuskels zu beschreiben, muss der ganze Blutkreislauf in Betracht gezogen werden. Um alle Körperteile mit Sauerstoff und Nährlösung zu versorgen sowie Stoffwechsel- und Abfallprodukte zu entsorgen, pumpt der Herzmuskel das Blut durch die Lunge und den ganzen Körper. Auch Botenstoffe wie Hormone, Zellen der Körperabwehr und Teile des Gerinnungssystems benutzen diese «Strassen» –die Blutgefässe. Zu diesen gehören die Arterien, die vom Herzen wegführen, und die Venen, welche zurückleiten. Arterien haben dabei hohen Druck auszuhalten und verfügen über eine dicke Gefässwand.
Das Herz enthält vier Räume in zwei Hälften, je einen Vorhof und eine Kammer. Die rechte Herzhälfte versorgt den Lungenkreislauf, die linke pumpt das Blut in den Körperkreislauf.
Um die Blutversorgung zu jedem Zeitpunkt, unabhängig von Umgebungs- und Belastungsbedingungen, aufrechtzuerhalten, werden Herzaktion und Blutdruck reguliert. Je nach Bedürfnis wird dabei die Blutmenge auf ruhende und aktive Organe verteilt. Ist zum Beispiel der Verdauungstrakt nach dem Essen stark gefordert, müssen andere Bereiche gedrosselt werden. Nicht alle Organe können gleichzeitig mit der maximalen Blutmenge versorgt werden.
Das Herz pumpt pro Minute etwa das gesamte Blutvolumen 1x durch den Körper. Die Vorhöfe werden innerhalb eines Herzzyklus gefüllt. Gleichzeitig werfen die Kammern ihren Inhalt in die Arterien aus. Danach entspannt sich die Kammermuskulatur, die Segelklappen öffnen sich und das Blut wird durch den Druckabfall in den Kammern aus den Vorhöfen, welche sich zusammenziehen, angesogen. Danach zieht sich die Kammermuskulatur zusammen, der Druck steigt an, die Segelklappen schliessen sich, die Taschenklappen werden geöffnet und das Blut kann ausströmen (Systole). Während der Entspannungsphase (Diastole) schliessen sich die Taschenklappen und verhindern somit einen Rückfluss.
Plus
Das tut dem Herzen gut
• Bewegung: Täglich 30 Minuten oder 3 Mal pro Woche 40 Minuten intensive Bewegung erhält das Herz gesund. Die Herzkranzarterien werden dabei erweitert, und der Herzmuskel wird besser durchblutet.
• Blutdruck kontrollieren: Regelmässige Kontrollen ermöglichen gezielte Massnahmen zur Regulierung des Blutdrucks.
• Herzgesund essen: Wenig gesättigte Fette, wenig Salz und Zucker, kein Fleisch. Dafür viel frische Früchte, Gemüse, Nüsse und Vollkornprodukte.
• Musik hören: Eine umfassende Studie bei Herzinfarktpatienten hat die positive Wirkung auf Blutdruck und Herzfrequenz, auf Angst und Schmerzen belegt.
Minus
Das tut dem Herzen nicht gut Herz-Kreislauferkrankungen sind in unseren Breitengraden für etwa 40 % der Todesfälle verantwortlich. Die moderne Medizin ist in der Lage, 90 % der Patienten, die mit einem Herzinfarkt in die Notfallstation eingeliefert werden, zu retten. Das Risiko, einen solchen lebensbedrohenden Zustand zu erleiden, kann durch persönliche Lebensgewohnheiten vermindert werden. Deshalb Vorsicht mit
• Stress und Belastungen.
• Nikotin: Rauchen verengt die Arterien und vermindert die Durchblutung des Herzmuskels.
• Koffein: Koffeinhaltiger Kaffee und Tee erhöhen Blutdruck und Adrenalinspiegel, begünstigen die Verhärtung der Arterien und erschweren deren Ausdehnung, erhöhen den Cholesterin- und Homocysteinspiegel.


SiMOn BenZ
Physiotherapeut, Buchs AG, CH
Ohne dass wir uns dieses Wunderwerks überhaupt bewusst sind, vereinen unsere Arme alles, was es braucht, um im Alltag alle Anforderungen zu meistern. Doch diese Körperteile müssen sorgsam gepfl egt werden, denn mit zunehmendem Alter können wesentliche Funktionen eingeschränkt werden.
Das Schultergelenk ist ein kompliziert aufgebautes Gelenk mit einem grossen Oberarmkopf, welcher auf einer wesentlich kleineren Gelenkspfanne (Schulterblatt) aufliegt. Somit ist das Gelenk knöchern, wenig gesichert und besitzt zudem eher schwache Bänder. Die Stabilisierung des Gelenkes wird daher hauptsächlich von der Muskulatur übernommen. Gelingt dies nicht, kann es zu Ausrenkungen (Luxationen) kommen. Der Vorteil dieser Verhältnisse ist, dass das Schultergelenk das beweglichste Gelenk des Körpers ist und somit die Grundlage einer optimalen Armfunktion darstellt. Dazu kommt, dass erstaunlicherweise der Arm nur über das Schulterblatt auf dem Oberkörper abgelegt und über Muskelschlingen befestigt ist. Die einzige knöcherne Verbindung zum Rumpf ist das kleine Gelenk vom Schlüsselbein zum Brustbein.
Funktion
Diese enorme Flexibilität der Schulter kommt uns im Alltag sehr entgegen: Ein Glas aus dem oberen Küchenregal herausnehmen, sich am Rücken kratzen oder den Tennisschläger schwingen bis hin zum Toilettengang – das alles ist dadurch möglich. Meist fallen uns diese Zusammenhänge erst auf, wenn
wir die Bewegungen aufgrund einer Verletzung oder sonstiger Einschränkungen nicht mehr ausführen können. Die Hauptfunktion der oberen Extremität besteht zusammenfassend darin, die Hand im Raum zu positionieren, um z. B. zu essen, etwas zu ergreifen oder uns abzustützen. Nicht zu vergessen ist dabei, wie wichtig die Arme für unser Gleichgewicht sind. Sie werden beim Balancieren als Gegengewichte eingesetzt.
Die Abnahme der Funktion der oberen Extremität kann vielfältige Ursachen haben, so z. B. eine gelenkzerstörende Arthrose, Sehnenrisse oder auch Trägheit und Kraftverlust. Ein gewisser Rückgang an Koordination im Alter ist normal, da mit fortschreitendem Alter auch Sensoren in Muskeln, Sehnen und Gelenken abnehmen, die für die Steuerung und Koordination wichtig sind. Daneben nimmt auch die Leitungsgeschwindigkeit der Nerven ab, wodurch eine gezielte Steuerung der Bewegung verringert wird. Dieser Rückgang verläuft aber in der Regel sehr langsam. Mit Training kann das vorhandene Potenzial an Beweglichkeit, Koordination und Kraft besser ausgeschöpft und der Rückgang deutlich verlangsamt werden.
Beim Üben baut ein System auf das andere auf. Beachten Sie daher die folgende Prioritätenliste:
1. Eine möglichst gute Schulterbeweglichkeit erhalten
a. Beobachten Sie eine deutliche Abnahme Ihrer Schulterbeweglichkeit, sollte die Ursache dafür abgeklärt werden.
b. Koordination und Kraft können nicht aufgebaut werden, wenn keine Grundbeweglichkeit vorhanden ist.
2. Koordination der Arme fördern
a. Sind keine Schmerzen oder sonstigen Einschränkungen vorhanden, können Sie an der Koordination arbeiten.
b. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Gymnastik und Sportgruppen, Schwimmen, Tischtennis, Badminton bis hin zu Handarbeiten.
3. Kraftaufbau der Arme für den alltäglichen Gebrauch
a. Vor allem bei abgeschwächter Muskulatur ist dies wichtig, ansonsten steht die Koordination im Vordergrund.
b. Krafttraining für die Arme sollte nicht mehr als 2–3x pro Woche durchgeführt werden.
Übungen
Beweglichkeit
1. Maximale passive Beweglichkeit bei schmerzhafter Schulter
a. Ausgangslage: Vor einer Ablagefläche (Tisch, Stuhllehne o. ä.) stehen. Die Hände auf die Ablage stützen.
b. Ausführung: Rückwärts gehen, ohne Gewicht auf die Hände zu legen. Die Hände verlassen dabei ihren Ort nicht. Gehen Sie so weit, wie es Ihre Schulterbeweglichkeit zulässt.
c. Wiederholungen: 5–10x
d. Serien: 1–3x


2. Maximale aktive Beweglichkeit
a. Ausgangslage: Aufrechter Sitz. Die Arme hängen parallel neben dem Körper.
b. Ausführung: Die Hände zur Decke strecken, sodass die Daumen nach hinten gedreht sind. Die Bewegung ausführen, bis Sie nicht mehr weiter

Extremitäten
Obere Extremität: Schultergürtel (Schulterblatt und Schlüsselbein), Oberarm, Unterarm und Hand.
Untere Extremität: Beckengürtel (Beckenknochen und Kreuzbein, Steissbein), Oberschenkel, Unterschenkel und Fuss.
bewegen können. Die Spannung kurz halten und wieder zurück in die Ausgangslage kommen.
c. Wiederholungen: ca. 10x
d. Serien: 1–3x
Koordination
1. Arm-Hand:
a. Ausgangslage: Sitzend oder stehend. Die linke Hand ist zu einer Faust geschlossen, der Arm ist über der rechten Leiste gestreckt. Die rechte Hand ist offen, und die Finger sind gespreizt. Der Arm ist in die Höhe gestreckt, diagonal zur gegenüberliegenden Leiste. Die Daumen sind maximal nach hinten gedreht.
b. Ausführung: Der linke Arm bewegt sich in die Position des rechten Armes, und gleichzeitig bewegt sich der rechte Arm in die Position des linken Armes.
c. Bewegungstempo: Langsam beginnen und nach Möglichkeit erhöhen.
d. Dauer: ca. 30 Sekunden
e. Serien: 2–4x

2. Feinmotorik Hand:
a. Sammeln Sie einhändig Münzen ein und behalten Sie dabei die Münzen in derselben Hand.
Kraft
1. Wand-Liegestützen
a. Ausgangslage: Die Hände sind schulterbreit an einer Wand abgestützt. Die Füsse sind einen kleinen Schritt von der Wand entfernt.
b. Ausführung: Mit dem Brustbein zur Wand bewegen, der Oberkörper bleibt dabei stabil (es darf keine Banane geben). Danach stossen Sie sich wieder von der Wand
weg, bis die Arme ganz gestreckt sind.
c. Wiederholungen: 10–15x
d. Serien: 2–3x
e. Varianten: Zur Erschwerung nehmen Sie die Füsse weiter von der Wand weg oder stützen sich auf einem tieferen stabilen Gegenstand oder ganz auf dem Boden ab (= normale Liegestützen).
2. Kraftübung mit PET-Flaschen a. Nehmen Sie eine 0,3 bis 1 Liter PET-Flasche und füllen Sie diese mit Wasser oder Sand. Älteren Personen rate ich, zuerst nur mit dem Armgewicht zu beginnen.
b. Ausgangslage: Sitzend. Die Gewichte oder Fäuste (ohne Gewichte) befinden sich etwa auf Stirnhöhe, die Ellenbogen sind abgespreizt etwa auf der Höhe der Ohren.
c. Ausführung: Die Gewichte gleichzeitig in die Höhe stemmen.
d. Wiederholungen: 10–15x
e. Serien: 2–3x
f. Variation: Jeweils nur mit einem Arm, dabei muss der Oberkörper gerade bleiben und darf sich nicht zur Seite neigen.
g. Bemerkung: Weniger ist oftmals mehr. Beginnen Sie deshalb mit kleinen Gewichten, ansonsten besteht die Gefahr einer schlechten Ausführung und daraus folgender Verletzungen.

Haben Sie Fragen zum Artikel oder zum Thema Bewegung allgemein? Dann schreiben Sie bitte an: redaktion@lug-mag.com




Schweizerische Liga Leben und Gesundheit | www.llg.ch
Rund-um-Gesund
Was: 12-Tage Lebensstil-Programm inkl. Gesundheits-Check.
Kursleitung: Jenny und Remo Fischer
Wo: Sonnmatt Bergpension und Gesundheitszentrum, Schwand 2588, 9642 Ebnat-Kappel
Termin 1: 31.8. – 11.9.2014
Termin 2: 16. – 27.11.2014
Kosten: 12-Tage-Programm ab 1930.–Paare pro Person ab 1830.–Infos und Anmeldung: +41 (0)71 993 34 17, www.bergpension.ch
Fit und Gesund-Expo
Expo: Sie erhalten eine Momentaufnahme Ihrer persönlichen Gesundheit, und wir zeigen Ihnen konkrete Wege für eine vorteilhafte Zukunft.
Wo: Migros Paradies, 4123 Allschwil
Termine: 17.–20. März 2014, 14.00–18.00 Uhr
Kosten: Eintritt frei!
Information: +41 (0)61 401 41 65, elsbeth.schwyn@llg.ch
Das Leben entrümpeln. Befreit durch Entsorgung!
Referent: Günther Maurer, LLG-Gesundheitsberater, Seelsorger
Vortrag: Jede Menge «Gerümpel» sammelt sich schnell einmal im Haus, aber auch in unserem Innenleben an. Entrümpelung schafft Platz, Übersichtlichkeit und Freiräume. Wann: Donnerstag, 10. April 2014, 19.00–20.30 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Rümelinbachweg 60, 4054 Basel
(Adventhaus gegenüber Hallenbad Rialto)
Kosten: Eintritt frei!
Information: +41 (0)61 401 41 65, elsbeth.schwyn@llg.ch
Vergeben lernen – Ihrer Gesundheit zuliebe
Referenten: Telma Witzig, M.A., Psychologin, Psychotherapeutin. Wolfgang Witzig, D.Min., Seelsorger, Vergebungstrainer
Seminar: 7 Abende, jeweils donnerstags, 24. Apr., 1., 8., 15., 22., 29. Mai, 7. Juni, 19.00–20.30 Uhr
Wo: Seminarraum, Rümelinbachweg 60, 4054 Basel
Kosten: 140.– (Paare 220.–)
Anmeldung und Informationen: +41 (0)61 401 41 65, elsbeth.schwyn@llg.ch
Nein sagen ohne Schuldgefühle
Jeder Mensch braucht «heilsame Grenzen». Wie entdeckt man sie?
Referent: Wolfgang Lepke PhD, Seelsorger und Vergebungstrainer
Seminar: 5 Abende, jeweils mittwochs, 12., 19., 26. März, 2., 9. April, 19.30–21.00 Uhr
Wo: Seminarraum der Liga Leben und Ge-
sundheit, Cramerstrasse 11, 8004 Zürich
Kosten: 120.– (Paare180.–)
Anmeldung und Information: +41 (0)41 787 05 00
Keine Angst vor der Angst
Was Angst macht. Was Angst mit uns macht. Welche Macht Angst hat.
Referent: Daniel Zwiker, Psychotherapeut ASP Vortrag: Mittwoch, 19. März 2014, 19.30–21.00 Uhr
Wo: Seminarraum LLG Schleusenweg 3, 2502 Biel (Adventgemeinde beim Stadtpark)
Kosten: Eintritt frei!
Information: René Pieper, +41 (0)79 309 39 67
Live-Gesundheitsberatung auf Star-TV
Was: Gesundheitssendung mit Telefonberatung Wo: Star-TV
Wann: Jeden Mittwoch, 10.00–12.00 Uhr
Berater im Studio: Barbara Witzig, MA, Gesundheitsberaterin und Seelsorgerin. Dr. med. Ruedi Brodbeck, Hausarzt und Psychosomatiker.
Gratisnummer: 0800 987 605 Fragen können jederzeit auch schriftlich an lebenundgesundheit@llg.ch gestellt werden.
Infarkt der Seele! Leben zwischen Ansporn und Überforderung
Referent: Günther Maurer, LLG-Gesundheitsberater, Seelsorger
Wann: Dienstag, 29. April 2014, 19.30 Uhr
Wo: Stadler-Huus, Seminarraum LLG, Choller 35, 6300 Zug
Kosten: Eintritt frei!
Information: +41 (0)79 429 95 44, thomas.nyffeler@llg.ch
7 Wege zu einem gesteigerten Selbstwert
Referent: Christian Frei, M.A. Wann: Montag, 14. April 2014, 19.30 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Lyssachstrasse 12, 3400 Burgdorf
Information: +41 (0)76 527 44 20, kaethi.brand@llg.ch
Nein sagen ohne Schuldgefühle –Ja sagen ohne Bitterkeit
Referenten: Elsbeth Brodbeck, Gerald Ströck
Wann: jeweils Montags, 5.5. – 2.6.2014, 19.30 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Lyssachstrasse 12, 3400 Burgdorf
Information: +41 (0)76 527 44 20, kaethi.brand@llg.ch
Nein sagen ohne Schuldgefühle –Ja sagen ohne Bitterkeit
Referentin: Barbara Witzig, MA Wann: jeweils Montags, 5.5. – 2.6.2014, 19.30 Uhr
Wo: 3x3-Halle, Stationsweg 6, 5502 Hunzenschwil
Information: +41 (0)76 565 59 09, barbara.witzig@llg.ch
Die Heilkraft der Vergebung entdecken
Referent: Dr. med. Ruedi Brodbeck
Wann: Dienstag 1. April 2014, 19.00 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Rümelinbachweg 60, 4054 Basel
Information: +41 (0)61 401 41 65, Elsbeth Schwyn, basel@llg.ch
PEP 4 Teens
Referent: Christan Frei, M.A. Wann: 22., 29. April, 6., 13., 20. Mai 2014
Wo: Familien- und Gemeinschaftszentrum, Gigerstrasse 2a, 5734 Reinach
Information: +41 (0)61 401 41 65, Elsbeth Schwyn, basel@llg.ch
Herausforderung Erziehung
An der Oberfläche kratzen (Verhalten steuern) oder lebensprägende Werte vermitteln?
Referent: Christan Frei, M.A.
Wann: Donnerstag, 3. April 2014, 19.30–21.00 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Schadaustr. 26, 3604 Thun
Kosten: Eintritt frei, freiwilliger Unkostenbeitrag
Information: +41 (0)76 348 39 19, ralph.waespi@llg.ch
Wer bin ich?
Die eigene Persönlichkeit entdecken: Charakterzüge, Erbanlagen, Gesellschaftseinflüsse.
Referentin: Telma Witzig, Psychologin und Pädagogin
Wann: Mittwoch, 7. Mai 2014, 19.30 Uhr
Wo: Seminarraum LLG, Schleusenweg 33, 2502 Biel
Ein NEIN zur rechten Zeit
Referentin: Monica Kunz, Supervisorin, Mediatorin, Coach BSO
Wann: Dienstag, 25. März 2014, 19.30 Uhr
Wo: Berufsbildungszentrum (BBZ), Hintersteig 12, 8200 Schaffhausen
Kosten: Eintritt frei!
Information: +49 7745 488 93 84, michael.urbatzka@llg.ch



Österreichische Liga Leben und Gesundheit | www.llg.at
Hilfe bei Depression
Für Betroffene und Angehörige
Referent: Dr. Michael Kerzendorfer (Psychiater)
Vortrag: Samstag, 26. April 2014, 17.00–19.30 Uhr
Wo: Grünauerstrasse 20, 4020 Linz (Nähe Designcenter)
Kosten: € 8,–
Anmeldung und Information: +43 (0)664-4238613, Wolfgang Meiser, linz@llg.at
Wie bitte?
Umgang mit Hörproblemen
Referent: Dr.med. Claus Despineux (HNO Facharzt)
Vortrag: Samstag, 24. Mai 2014, 18.00–19.30 Uhr
Wo: Grünauerstrasse 20, 4020 Linz (Nähe Designcenter)
Kosten: € 8.–
Anmeldung und Information: +43 (0)664-4238613
Wolfgang Meiser, linz@llg.at
Fit in den Frühling
Entlasten Sie Ihren Körper, damit Sie voller Energie ins Frühjahr starten können
Referenten: Monika Fuchs, Medizinische Heilmasseurin, Lebens- und Sozialberaterin i.A. und Esther Neumann, Mag. der Ernährungswissenschaften
Zwei Seminarabende: Sonntag, 30. März 2014, 19.00–21.00 Uhr; Sonntag, 6. April 2014, 19.00–21.00 Uhr
Wo: Gesundheitszentrum Mistelbach der Liga Leben und Gesundheit, Wiedenstraße 14, 2130 Mistelbach
Kosten: € 15,– pro Abend
Anmeldung und Information: +43 (0)664 440 33 95, www.llgmistelbach.at
Gesundheitsclub
Thematische Abende in Salzburg. Clubabend: Sonntag, 16. März 2014, 17.00–18.30 Uhr
Brot-Tipps vom Bäckermeister Albert Frauenlob Clubabend: Sonntag, 20. April 2014, 18.00–19.30 Uhr
Survival-Tour mit Inge Waltl Clubabend: Sonntag, 18. Mai 2014, 18.00–19.30 Uhr
Facelifting mit Wildpflanzen mit Inge Waltl Wo: Adventhaus, Franz-Josef-Strasse 17, 5020 Salzburg
Kosten: € 3.– pro Abend Anmeldung und Information: +43 (0)676 833 22 635
Gesundheitsclub
Thematische Abende in Wien. Im Frühjahr/Sommer 2014 beschäftigen wir uns mit den acht Schlüsseln zur Gesundheit und führen unseren beliebten «Gartenclub» weiter
Clubabend: Sonntag, 9. März 2014, 17.00–19.00 Uhr
Gartenarbeit; schriftliche Unterlagen und praktische Anleitungen, mit Monika Fuchs
Clubabend: Sonntag, 23. März 2014, 17.00–19.00 Uhr
Gesund bleiben – aber wie?
Die acht Schlüssel zur Gesundheit in Theorie und Praxis.
Dr. Lydia Schlatter
Clubabend: Sonntag, 13. April 2014, 17.00–19.00 Uhr
Gartenarbeit; schriftliche Unterlagen und praktische Anleitungen, mit Monika Fuchs
Clubabend: Sonntag, 4. Mai 2014, 17.00–19.00 Uhr
Gartenarbeit; schriftliche Unterlagen und praktische Anleitungen, mit Monika Fuchs
Wo: «die Perle», 1230 Wien, Anton-Baumgartner-Strasse 8 Kosten: € 5.– pro Abend
Information: http://www.health-club.at oder unter Tel. +43 (0)680 20 920 73 (Gertraud Brandtner)
Themenabende 2014
Was: Treffpunkt Wien Mitte
Lebensnahe Themen für alle!
Wo: Seminarraum der LLG, Landstrasser
Hauptstrasse 21, 1030 Wien
Vortrag: Montag, 3. März 2014, 18.15–20.00 Uhr
Referentin: Mag. Thullner Monika MONGOLEI-Land der endlosen Steppen und Nomaden
Entdecken Sie dieses wenig bekannte Land voll unberührter landschaftlicher Schönheit und seine faszinierende Kultur!
Vortrag: Mittwoch, 7. Mai 2014, 18.15–20.00 Uhr
Referent: Dr. Michael Kerzendorfer Selbstmitleid überwinden!
Kommen auch Sie im Leben zu kurz, fühlen Sie sich vernachlässigt, zurückgesetzt, nicht ernst genommen?
Kosten: Eintritt frei!
Anmeldung und Information:
+43 (0)676 833 22 402
Endlich Frei –das Nichtraucherseminar
In 7 Tagen zum Nichtraucher! Ihr Wille wird gestärkt und die Entzugserscheinungen abgefangen.
Referent: Mag. Ewald Karl Jurak Wann: 10., 12.–16. und 24. März, 19.00–20.30 Uhr
Wo: «Die Perle» – biblisches Lebensstilzentrum, 1230 Wien, Anton-BaumgartnerStrasse 8
Kosten: € 70,– inkl. Kursunterlagen
Anmeldung und Information:
+43 (0)1 31 99 333 71 (Fr. Kerschbaum) Mo–Do 9–15 Uhr
Telefonische Anmeldung erforderlich bis 6. März 2014
Gesundheit erleben – Newstartprogramm persönliche Betreuung, Gesundheitscheck, div. Workshops und Vorträge.
Leitung: N. Sigel und Dr. H. Pischler
Wo: Country Life Gesundheitszentrum Mattersdorferhof, Mattersdorf 10, 9560 Feldkirchen/Kärnten
Termine 2014: NSP 1: 16. – 27. März; NSP 2: 27. April – 8. Mai; NSP 3: 18. - 29. Mai; NSP 4: 15. - 26. Juni; NSP 5: 6. - 17. Juli (Familiennewstart); NSP 6: 27. Juli – 14. Aug. (18 Tagesprogramm); NSP 7: 14. - 25. Sept.; NSP 8: 12. - 23. Okt.; NSP 9: 2. - 13. Nov.
Kosten: ab € 640.- (pro Person, Basis Doppelzimmer)
Infos und Anmeldung: +43 (0)42 77 23 37, office@countrylife.at, www.countrylife.at
Impressum
Zweimonatliches Magazin für ganzheitliche Gesundheit nach dem NewstartPlus® Konzept 85. Jahrgang Nr. 1, Jan./Feb. 2014 www.lug-mag.com
Herausgeber und Verlag:
Schweiz: Advent-Verlag Zürich, Zweigstelle Krattigen, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen, Tel. +41 33 654 10 65, Fax +41 33 654 44 31, E-Mail: info@advent-verlag.ch, www.advent-verlag.ch, PC 30-19342-9 und Österreich: Top Life Wegweiser-Verlag, Prager Stasse 287, A-1210 Wien, Tel. +43 (0)43 1 2294 000, E-Mail: info@toplife-center.com
Partnerorganisationen: Schweizerische Liga Leben und Gesundheit, www.llg.ch Deutscher Verein für Gesundheitspflege, www.dvg-online.de
Österreichische Liga Leben und Gesundheit, www.llg.at
Redaktion: Chefredaktor Stephan Freiburghaus (SF), redaktion@lug-mag.com
Redaktionsteam: Heidi Albisser, Christian Alt M.A., Dr. med. Ruedi Brodbeck, Dagmar Dorn, Christian Frei M.A., Gunther Klenk, Dominik Maurer, Günther Maurer. Layout: mapro.ch | Ilona Würgler Bezugsbedingungen:
Schweiz: Zweijahresabonnement, 12 Ausgaben: CHF 119.–www.lug-mag.ch
Österreich: Zweijahresabonnement, 12 Ausgaben: € 97,–www.lug-mag.at
Deutschland: Zweijahresabonnement, 12 Ausgaben: € 89,–www.lug-mag.de
Alle Preise inklusiv Versandkosten Schriftliche Bestellungen aus Deutschland an: Advent-Verlag, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen Ausgabe für Sehbehinderte und Blinde: In Braille: Blindendienst, Postfach 110, CH-4802 Strengelbach
Audio: Blindenhörbücherei der Stimme der Hoffnung, Sandwiesenstr. 35, D-64665 Alsbach-Hähnlein, Tel. +49-6257-50653 35
Inserate: Bitte verlangen Sie unsere Dokumentation. Inseratenschluss ist in der Regel acht Wochen vor dem Erscheinungsmonat.
Druck: Jordi Medienhaus, 3123 Belp, www.jordibelp.ch
Auflage: 11 000 Exemplare
Weitere Informationen zu diesen- und weiteren Angeboten finden Sie unter www.llg.ch oder www.llg.at
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine Haftung übernommen. Kein Teil dieses Heftes darf ohne Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form vervielfältigt werden.



Mag. Claudia Flieder, freie Redaktorin, Wien, A
Wie haben Sie den heutigen Tag begonnen? Mit ein wenig Körpergymnastik noch im Bett, mit Schwung – oder doch eher als «Schlafmütze», muffelig und schlecht gelaunt? Haben Sie heute schon das Fenster geöffnet, tief durchgeatmet und sich so richtig ausgestreckt? Sie werden sehen, auf diese Weise fällt Ihnen der Tagesstart leichter. Bewegung ist für uns Menschen ausserordentlich wichtig – darüber haben Sie in dieser Ausgabe ja schon einiges erfahren. Doch wie sieht das eigentlich mit der Bewegung für unsere «grauen Zellen» aus? Bringen wir frische Luft und neuen Schwung auch in unsere Gedanken? Oder tauchen wir gedanklich immer tiefer ab?
Etwas, was unsere Gedanken stark beeinflusst, ist der «Mainstream». Gemeint ist der Zeitgeist. Bloss nicht unangenehm auffallen! Und genau hierin übernimmt man Sichtweisen anderer. Zugang dazu haben wir vielerorts: In den Medien tun Stars und Sternchen gerne ihre Meinung kund und legen damit womöglich einen Trend vor. Bei der Mode ist es ähnlich: Wer will nicht «in» sein und mithalten können? Doch übernommene Meinungen sind eben nicht die eigenen. Wäre das nicht ein Experiment wert: herauszufinden, was Sie und ich, was wir eigentlich wirklich meinen, denken, wovon wir überzeugt sind? Haben wir unsere Standpunkte geprüft und so Bewegung in das Einerlei der gängigen Sichtweisen gebracht? Auch die geistige Bewegung will gelernt sein! Es tut
gut, sich mit einer Vertrauensperson, einem guten Freund, einer lieben Freundin auszutauschen und auf diese Weise neue Standpunkte kennenzulernen, an denen die eigenen geprüft werden. Doch vielleicht haben wir gar keine Zeit dazu. Es scheint uns immer wieder, als würde die Zeit so rasch verfliegen, als drehten wir uns in einem Hamsterrad von Aufgaben und Pflichten und kämen gar nicht mehr zum Leben. Gerade da ist es wichtig, wieder das Eigene zu entdecken. Wie möchte ich meine Zeit gestalten, verbringen, einteilen, nützen? Was sind wirklich meine Prioritäten? Lassen Sie frischen Wind in Ihre Planungen wehen. Setzen Sie auf «Bewegung» bei der Gestaltung Ihres Alltags. «Bewegung ist Leben», sagt ein bekanntes Sprichwort. Wenn wir nicht feststecken wollen, müssen wir uns bewegen – körperlich, aber auch geistig. Es tut gut, einen Raum von Zeit zu Zeit ordentlich durchzulüften. Wie viel mehr brauchen wir frische Luft in unserem Leben, in unserem Denken! Da gehören so manche alten Gewohnheiten und Meinungen überdacht und neu bewertet. Vielleicht auch die Sache mit dem Glauben. Habe ich mich schon einmal auf den Weg gemacht, den Gott der Bibel zu suchen und kennenzulernen? Oder lebe ich auch in Glaubenssachen von der Meinung anderer?
Haben Sie Mut zur Bewegung – wo auch immer Sie gerade stehen. Ein weises Wort sagt: «Man kann neue Ufer nur erreichen, wenn man den Mut hat, die alten zu verlassen.»
Herzlichst
Ihre



Die nächste Ausgabe erscheint Mitte Mai 2014
Schwerpunkt: Wasser
Wasser – ein natürliches Wundermittel
Ob Wassertreten, Güsse, Wickel und Packungen, Abreibungen, Bäder oder Dämpfe, Wasser ist ein Multiheilmittel. Leider ist in unserer schnelllebigen Zeit vieles in Vergessenheit geraten, oder aber wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, diese hilfreichen Methoden anzuwenden. Dem möchten wir entgegentreten und Sie mit den vielseitigen Wasseranwendungen aus der Hydrotherapie neu begeistern.
Aus Abfall Neues machen
Unter der Rubrik «Alltagstipps» erfahren Sie in der kommenden Ausgabe, was aus Abfall Kreatives hergestellt werden kann. Ob alte Tassen oder Stoff reste, Joghurtgläser oder Blechdosen, alles lässt sich nutzen. Schluss mit Langeweile – hin zum Abfall.
«Leben und Gesundheit» für Blinde kostenlos
• in Brailleschrift
Verein Blindendienst, Postfach 110, CH-4802 Strengelbach
• auf CD oder Kassette Blindenhörbücherei der Stimme der Hoffnung, Sandwiesenstr. 35, D-64665, Alsbach-Hähnlein, Tel. 0049-6257-50653 35










Kostbares Wasser!
Und wie steht es mit der Ökologie?
Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Wasser ungenutzt ins Waschbecken läuft, bis das ersehnte heisse Wasser die Hände berührt? Dass Wüsten im Vormarsch sind oder mehr als 2,2 Millionen Menschen jährlich an Krankheiten sterben, die auf verunreinigtes Wasser zurückgehen, kümmert uns in Stuttgart, Wien oder Zürich kaum. Was ist tatsächlich dran an der globalen Wasserkrise? Wie können wir mithelfen, Wasser zu sparen und den Wert dieses kostbaren Gutes wieder neu schätzen zu lernen?
















