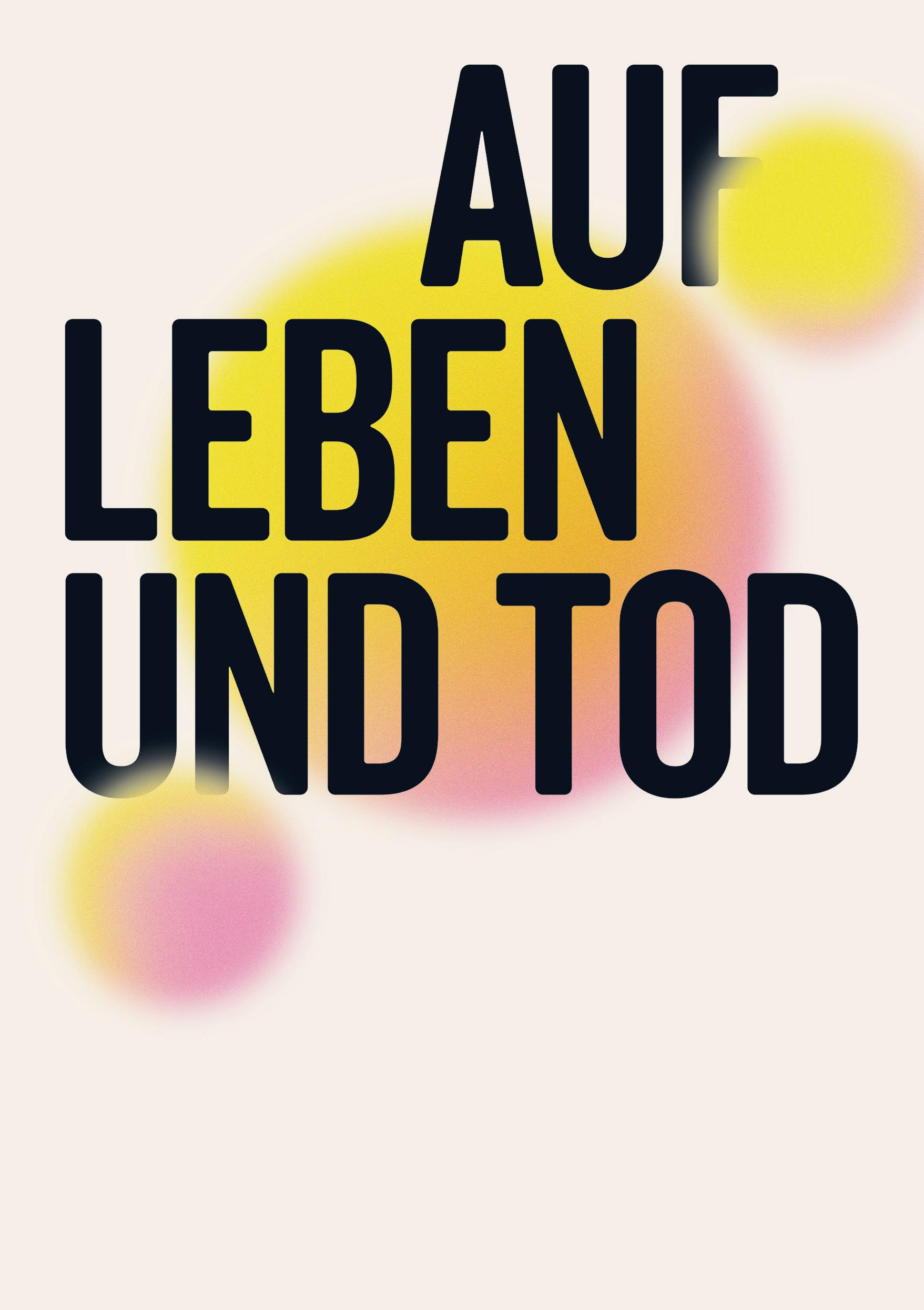

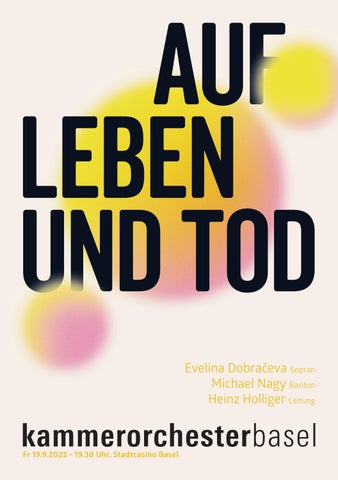
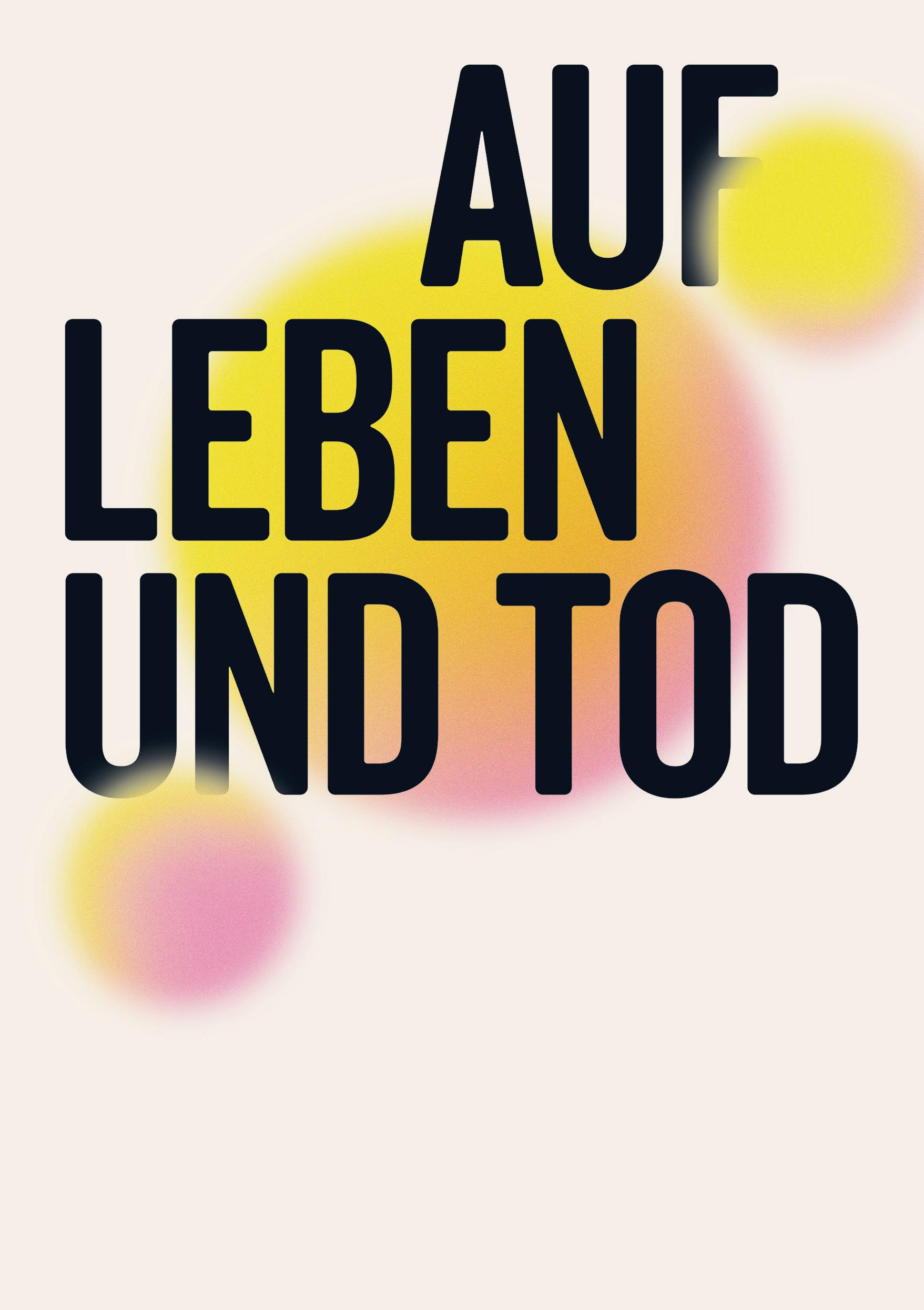

Greater chemistry is a promise. A promise to ourselves and to the world. To never stand still. To reflect achievements. It’s a promise to strive for a future worth living, for harmonious coexistence, and for greater solutions with a greater impact, Greater chemistry – between people planet. That is our purpose. That is how we are measured.
Programm
Fr 19.9.2025 – 19.30 Uhr, Stadtcasino
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Grosse Fuge für Streicher in B-Dur, op. 133, in der Fassung von Matthias Arter
Ouvertura: Allegro
Fuga: (Allegro)
Meno mosso e moderato
Allegro molto e con brio
Meno mosso e moderato (Wiederaufnahme)
Allegro molto e con brio (Wiederaufnahme)
Allegro (Coda und Schlussteil) 20'
Dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)
Sinfonie Nr. 14 in g-Moll für Sopran, Bass und Kammerorchester, op. 135
I. De profundis. Adagio (Federico García Lorca)
II. Malagueña. Allegretto (Federico García Lorca)
III. Loreley. Allegro molto (Guillaume Apollinaire nach Clemens Brentano)
IV. Der Selbstmörder. Adagio (Guillaume Apollinaire)
V. Auf Wacht. Allegretto (Guillaume Apollinaire)
VI. Sehen Sie, Madame! Adagio (Guillaume Apollinaire)
VII. Im Kerker der Santé. Adagio (Guillaume Apollinaire)
VIII. Antwort der Saporoger Kosaken an den Sultan von Konstantinopel. Allegro (Guillaume Apollinaire)
IX. An Delwig. Andante (Wilhelm Küchelbecker)
X. Der Tod des Dichters. Largo (Rainer Maria Rilke)
XI. Schlussstück. Moderato (Rainer Maria Rilke) 55'
Konzertende ca. 20.50 Uhr
Bitte beachten Sie: dieses Konzert wird ohne Pause gespielt.
Dieses Konzert wird von SRF 2 Kultur aufgezeichnet.
Rahmenprogramm
Ein Festival über die Freiheit der Kunst in Diktaturen 15. – 19. September 2025, Stadtcasino Basel
18.00 Uhr Hans Huber-Saal
Vortrag zum 50. Todestag von Schostakowitsch
Dr. Boris Belge, Musikhistoriker. Autor «Klingende Sowjetmoderne», Universität Basel
18.30 Uhr Hans Huber-Saal
Podiumsgespräch
«Russische und sowjetische Musik –ein Spannungsfeld für Kulturschaffende»
Dr. Boris Belge
Heinz Holliger, Dirigent
Dr. Karen Kopp, Dramaturgin MDR
Moderation: Elisabeth von Kalnein, SRF
Die Biografie von Heinz Holliger finden Sie auf Seite 7 im Heftteil «Philosophen und Poeten».
Die ausführlichen Biografien der Künstler:innen und des Kammerorchester Basel lesen Sie auf unserer Website:
Die Kurzbiografien entstanden mit Hilfe von KI (perplexity.ai)
Einfache Sprache
Sie hören heute zwei Musikstücke:
1. Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge.
Eine Fuge ist eine besondere Technik, Musik zu schreiben.
Die Fuge ist wie ein musikalisches Gespräch.
Dabei wird dieselbe Melodie nacheinander von verschiedenen Stimmen, also den Instrumenten, wiederholt.
Es entsteht ein Klangteppich:
Die verschiedenen Stimmen sind miteinander verwoben.
Beethovens Fuge war ursprünglich für ein Streichquartett komponiert.
Wir spielen eine Fassung mit mehr Instrumenten.
Es spielen auch die Bläser mit.
2. Dmitri Schostakowisch: 14. Sinfonie.
Diese Sinfonie ist eine Vertonung von 11 Gedichten.
Das heisst, die Gedichte wurden in Musik übersetzt.
Die Gedichte handeln von Tod, Gewalt und Unfreiheit.
Die Besetzung ist ungewöhnlich.
Es gibt Celesta, Xylophon, Röhrenglocken.
Ausserdem singen eine Sopranistin und ein Bass.
Die Gesangstexte werden auf Russisch gesungen.
Viele Werke Schostakowitschs sind auch politisch.
Er lebte in Russland als dort Stalin an der Macht war.
Stalin bestrafte die Komponisten, die nicht so komponierten, wie er es wollte.
Das Kammerorchester Basel setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein. Ein Text in einfacher Sprache ist Teil davon.

Besetzung
Evelina Dobračeva Sopran
Michael Nagy Bariton
Heinz Holliger Leitung
Kammerorchester Basel
Flöte
Isabelle Schnöller
Oboe
Matthias Arter
Klarinette
Markus Niederhauser
Fagott
Andrea Matés Pro
Horn
Konstantin Timokhine
Simon Lilly
Adrian Weber
Daniel Bard
Matthias Müller
Elisabeth Kohler
Nina Candik
Regula Schär
Antonio Viñuales
Eva Miribung
Tamás Vásárhelyi
Valentina Giusti
Fanny Tschanz
Viola
Katya Polin
Carlos Vallés García
Anne-Françoise Guezingar
Stefano Mariani
Immer informiert über alle Konzerte und Aktivitäten des Kammerorchester Basel mit unserem Newsletter. Mit diesem QR-Code zur Anmeldung:
Stand 28.8.2025, Änderungen vorbehalten
Violoncello
Christoph Dangel
Georg Dettweiler
Laura Brandão Alvares
Kontrabass
Peter Pudil
Benedict Ziervogel
Alexander Wäber
Tilman Collmer
Nadia Belneeva


Name:
Evelina Dobračeva
Instrument: Gesang – Sopran
Ausbildung: Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Professor Norma Sharp, Snezana Brzakovic und Professorin Julia Varady.
Gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel gespielt: Dies ist das erste Projekt.
Mein Gesang: Ich betone technische Aspekte wie eine präzise klassische Gesangstechnik. So kann ich von lyrischen zu dramatischen Passagen mit grosser Flexibilität und Sicherheit wechseln.
Letzte Aufnahme: 2018 Rubensteins Moses unter der Leitung von Maestro Michail Jurowski.
Name: Michael Nagy
Instrument: Gesang – Bariton
Ausbildung: Michael begann bereits als Kind bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben zu singen und studierte Gesang, Liedgestaltung und Dirigieren bei Rudolf Piernay, Irwin Gage und Klaus Arp in Mannheim und Saarbrücken.
Gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel gespielt: Dies ist das erste Projekt.
Mein musikalischer Glücksmoment: Frei nach Victor Hugo: Musik drückt oft das aus, was Worte nicht fassen können, aber worüber zu schweigen unmöglich ist. Sie vermittelt Inhalte, Emotionen, Stimmungen und Gefühle, die weit über die Grenzen der Sprache hinausgehen.
Die «Grosse Fuge» ist eine jener Kompositionen, die von Kenner:innen und Liebhaber:innen geschätzt und nach Möglichkeit gemieden werden. Die Uraufführung war kein Erfolg und Beethovens Beschimpfung des Publikums, das nichts begriffen hat, ist legendär. Der Sinn meiner Bearbeitung ist der Versuch einer klingenden Interpretation des Werkes, auch einer Ehrenrettung, die es möglich machen soll, das Werk im Moment des Erklingens in all seinen Facetten zu erfassen und sogar geniessen zu können!
In seinen beiden Originalversionen – für Streichquartett (op. 133) bzw. für Klavier zu vier Händen (op. 134) – stösst Beethoven immer wieder an Grenzen des Ambitus und des Klanges, auch an Grenzen der Unterscheidbarkeit und Ausformung der einzelnen Stimmen. Um ein unmittelbares Erleben und Verstehen der rhetorischen Differenzierung und Deutlichkeit der einzelnen Themen und Motive zu ermöglichen, habe ich grossen Wert auf Klangfarben und klare dynamische und artikulatorische Unterschiede gelegt. So vergrössert meine neue Instrumentierung mit sieben verschiedenen Blasinstrumenten sowohl den Tonumfang als auch die Registrierungsmöglichkeiten und überwindet so die Monochromität beider Originalfassungen. Darüberhinaus habe ich die Dynamik und – speziell in den Übergängen – die Agogik ausgearbeitet, um diese einleuchtend zu gestalten, da und dort durchaus mit dem Ziel eine gewisse Atemlosigkeit von Beethovens Originalversionen zu vermindern. Mir war es ein Anliegen, die beiden grossen Fugenkonstrukte (1. und 3. Satz) anders klingen zu lassen als die beiden Teile, die eben keine Fugen sind, nämlich das langsame Meno mosso e moderato (zwischen den beiden Fugen) sowie am Ende das Finale mit dem Gassenhauer-Thema, welches das Werk in ausgelassener Kehrausstimmung enden lässt.
Beethoven wollte sein Publikum übrigens durchaus bei der Hand nehmen: Er komponiert zu Beginn und zwischen den einzelnen Abschnitten Vor- und Rückschauen des musikalischen Geschehens und baut damit reflektierende Momente ein. So gesehen habe ich lediglich den Ball des Komponisten aufgenommen und gehe den von ihm vorgezeichneten Weg zwei oder drei Schritte weiter.
Nach zwei Herzinfarkten liegt Dimitri Schostakowitsch Anfang 1969 mit Besuchsverbot im Krankenhaus. Es geht ihm überhaupt nicht gut, das perfide Katz-und-Maus-Spiel des stalinistischen Staatsapparats, der ihn seit Jahrzehnten beutelt, ihn mal als Staatskünstler hofiert, mal mit Angriffen, Drohungen und öffentlichen Demütigungen überschüttet, nagt an seiner Seele. Um sich die Zeit zu vertreiben, liest er Gedichte und konzipiert eine neue Sinfonie: elf Sätze auf elf düstere, schwarze, abgründige Gedichte von Guillaume Apollinaire, Wilhelm Küchelbecker, Federico García Lorca und Rainer Maria Rilke: Der Tod ist überall präsent in der 14., der vorletzten Sinfonie Schostakowitschs und er kommt in verschiedenen Gestalten und in verschiedenen Situationen daher: als Mord und Selbstmord, Krieg, Liebe und Tod, Tod im Kerker, Machtlosigkeit des schöpferischen Geistes im Angesicht des Todes, Tod als Erlösung, Allmacht des Todes. Und so ist auch die Musik mal grell, mal fratzenhaft, mal nachdenklich, traurig oder verzweifelt. So ungewöhnlich die Sinfonie formal ist, so speziell ist auch ihre Besetzung: ein Kammerorchester mit Streichern, Celesta und Schlagwerk mit Xylophon, Röhrenglocken, Holzblock und Trommeln. Dazu eine Sopranistin und ein Bass, die abwechselnd singen und sich erst im letzten Satz zu einem Duett verbinden.
Das Problem dieser Sinfonie ist, dass sie sich mit dem Tod beschäftigt. Das passt nicht zur Staatsdoktrin des sozialistischen Realismus, der Jubel und vertonte gute Laune will. Und so greift Schostakowitsch, wie so oft, zu einem Trick: In einem Interview für die Prawda leugnet er die tragische Dimension und erzählt, die 14. Sinfonie sei dem «Kampf um die Befreiung der Menschheit» gewidmet, mehr noch: man müsse stets ehrlich leben und fortschrittlich denken, um die sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und: es klappt. Die Uraufführung der Sinfonie (vorsichtshalber als öffentliche Probe und nicht als Premiere angekündigt) ruft keine offiziellen Proteste hervor.
Florian Hauser
Herr Holliger, Sie haben sich lange und oft mit Schumann beschäftigt, arbeiteten zehn Jahre mit dem Kammerorchester Basel an der Gesamteinspielung der Schubertsinfonien. Franz Schubert, haben Sie einmal gesagt, war von Anfang an einer Ihrer Lieblingskomponisten. Warum?
Bei Schubert entdecke ich in jeder Sekunde Neues. Auch vielleicht Dinge, die ich schon längst geahnt hatte, aber noch nie so klar gesehen habe. Er geht zum Beispiel unendlich sensibel mit dem Einschwingvorgang eines Tons um. Bei Beethoven hat man oft ein ganz klares, angeschnittenes Sforzato mit harten Einsätzen. Und bei Schubert hat es eben diese berühmten Schubert-Akzente, die er selbst von Hand immer wieder anders bezeichnet. Schubert hatte eine unglaublich visionäre Kraft in der Harmonik, und er hat Mut gehabt, so unkonventionell mit der Form umzugehen. Er kann das Zeitgefühl völlig aufheben, so dass eine Sekunde eine Ewigkeit ist oder eine Ewigkeit nur eine Sekunde dauert.
Warum kombinieren Sie Schuberts Fünfte mit Schoecks Elegie, was haben die beiden Stücke miteinander zu tun?
Das hat zum einen praktische Gründe: Schoeck hat ein kleines Kammerorchester als Begleitung, und die fünfte Sinfonie auch: nur eine Flöte, keine Klarinetten und Blechbläser – und dann ist der Kontrast interessant: Schuberts lichtüberflutete Musik, daneben die Elegie, die melancholisch, aber nie wehleidig ist, sondern zwielichtig. Eine Musik, die ganz nach innen geht. Es ist aber ebenfalls eine Musik, in der die Zeit aufgehoben wird. 24 Lieder, fast immer im gleichen Tempo, immer in den gleichen zwielichtigen Farben, dass man eigentlich meint, es sei immer wieder das gleiche Lied, aber in einer immer neuen Fassung. Es ist wie ein Labyrinth, ein harmonisches Labyrinth. Und alles eingetaucht in ganz dunkle Farben.
Den zweiten Teil des Interviews finden Sie auf S. 8 im Heftteil «Philosophen und Poeten». Einfach Programmheft umdrehen.

Das Kammerorchester Basel ist ein guter Partner und hat viele Freund:innen.
Dmitri Schostakowitsch: 6. Satz aus der 14. Sinfonie.
Dieser Satz scheint auf den ersten Blick nicht so düster zu sein, denn es erönt ein spöttisches Lachen. Aber auch hier wird über Vergänglichkeit und Liebesverlust berichtet, worüber der beschwingte Dialog zwischen Sopran und Xylophon nur kurz hinwegtäuscht.
Zum Hörbeispiel
Neben dem Hörbeispiel ist auch dieses Programmheft über den QR-Code abrufbar.
Moderne: Musik in der Stalinzeit (1937 – 1953)
Komponisten in der Sowjetunion arbeiteten unter strengen Einschränkungen. Die Künstler:innen sollten den Menschen im Sinne des kommunistischen Staates dienen.
Stalin mochte patriotische Lieder und Musik mit einfachen Melodien. Komponisten, deren Musik dem nicht entsprach, weil sie beispielsweise introspektiv und komplex war, standen unter permanenter Beobachtung und wurden in Zeitungen diffamiert. Verhaftung, Arbeitsverbot, Berufsverbot oder schlimmstenfalls Hinrichtung oder Deportation in Arbeitslager waren nur eine Note entfernt.
Fuge
Eine Fuge basiert auf polyphoner Mehrstimmigkeit. Dabei wird ein musikalisches Thema von mehreren Stimmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auf verschiedenen Tonhöhen aufgegegriffen.
L. v. Beethoven sagte über die Fuge: «Eine Fuge zu machen ist keine Kunst… aber die Phantasie will auch ihr Recht behaupten, und heut’ zu Tage muss in die alt hergebrachte Form ein anderes, ein wirklich poetisches Element kommen».
Das Kammerorchester Basel spielt auch ohne Dirigent:in.
Herzlichen Dank
Presenting Sponsor
Clariant Foundation
Sponsor
Novartis
Konzertsponsoren
Primeo
Produktsponsoren
Garage Keigel
Hotel Teufelhof
Interbit
Remaco
Bider & Tanner
Medienpartner
Radio SRF 2 Kulturclub
bz Basel
Freunde
Freundeskreis Kammerorchester Basel
Les amis passionnés
Ungenannte Mäzene und Förderer
Förderpartner
Stiftung Kammerorchester Basel
GGG Basel
Ernst Göhner Stiftung
H. & M. Hofmann-Stiftung
Öffentliche Beiträge
Abteilung Kultur Basel-Stadt
Wir danken Transnational Giving Europe für die Unterstützung des heutigen Konzerts.
Mit freundlicher Unterstützung von

In Kooperation mit
Geniessen Sie mit einem Ticket zu einem Stadtcasino-Konzert des Kammerorchester Basel vor dem Konzert ein Abendessen im Der Teufelhof Basel. So geht's: Sie reservieren vorab selbstständig einen Tisch im Teufelhof (ab 18 Uhr). Dort gibt es einen Hauptgang für pauschal CHF 50.– pro Person. Zudem erhalten die Gäste gegen Vorzeigen der Tickets ein kostenloses ApéroGetränk. Sie sitzen entweder im Atelier oder in der Bar Zum Teufel (nach Verfügbarkeit). Gegen 19.00 Uhr machen Sie sich auf den Weg ins Stadtcasino, sind rechzeitig zum Konzertbeginn dort und verbringen einen schönen Konzertabend.