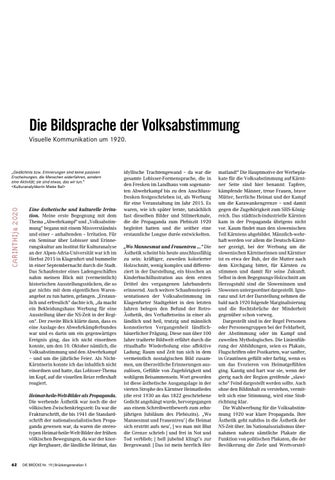Die Bildsprache der Volksabstimmung Visuelle Kommunikation um 1920.
CARINTHIja 2020
„Gedächtnis bzw. Erinnerungen sind keine passiven Erscheinungen, die Menschen widerfahren, sondern eine Aktivität; sie sind etwas, das wir tun.“ <Kulturanalytikerin Mieke Bal>
Eine ästhetische und kulturelle Irrita tion. Meine erste Begegnung mit dem Thema „Abwehrkampf“ und „Volksabstimmung“ begann mit einem Missverständnis und einer – anhaltenden – Irritation. Für ein Seminar über Lobisser und Erinnerungskultur am Institut für Kulturanalyse an der Alpen-Adria-Universität war ich im Herbst 2015 in Klagenfurt und bummelte in einer Septembernacht durch die Stadt. Das Schaufenster eines Ladengeschäftes nahm meinen Blick mit (vermeintlich) historischen Ausstellungsstücken, die so gar nichts mit dem eigentlichen Warenangebot zu tun hatten, gefangen. „Erstaunlich und erfreulich“ dachte ich, „da macht ein Bekleidungshaus Werbung für eine Ausstellung über die NS-Zeit in der Region“. Der zweite Blick klärte dann, dass es eine Auslage des Abwehrkämpferbundes war und es darin um ein gegenwärtiges Ereignis ging, das ich nicht einordnen konnte, um den 10. Oktober nämlich, die Volksabstimmung und den Abwehrkampf – und um die jährliche Feier. Als NichtKärntnerin konnte ich das inhaltlich nicht einordnen und hatte, das Lobisser-Thema im Kopf, auf die visuellen Reize reflexhaft reagiert. Heimat-heile-Welt-Bilder als Propaganda. Die werbende Ästhetik war noch die der völkischen Zwischenkriegszeit: Da war die Frakturschrift, die bis 1941 die Standardschrift der nationalsozialistischen Propaganda gewesen war, da waren die stereotypen Heimat-heile-Welt-Bilder der frühen völkischen Bewegungen, da war der knorrige Bergbauer, die ländliche Heimat, das
62
DIE BRÜCKE Nr. 19 | Brückengeneration 5
idyllische Trachtengewand – da war die gesamte Lobisser-Formensprache, die in den Fresken im Landhaus vom sogenannten Abwehrkampf bis zu den Anschlussfresken festgeschrieben ist, als Werbung für eine Veranstaltung im Jahr 2015. Es waren, wie ich später lernte, tatsächlich fast dieselben Bilder und Stilmerkmale, die die Propaganda zum Plebiszit 1920 begleitet hatten und die seither eine erstaunliche Longue durée entwickelten. „Wo Mannesmut und Frauentreu ...“ Die Ästhetik scheint bis heute anschlussfähig zu sein: kräftiger, zuweilen kolorierter Holzschnitt, wenig komplex und differenziert in der Darstellung, ein bisschen an Kinderbuchillustration aus dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts erinnernd. Auch weitere Schaufensterpräsentationen der Volksabstimmung im Klagenfurter Stadtgebiet in den letzten Jahren belegen den Befund der RetroÄsthetik, des Verhaftetseins in einer als ländlich und heil, trutzig und männlich konnotierten Vergangenheit ländlichbäuerlicher Prägung. Diese nun über 100 Jahre tradierte Bildwelt erfährt durch die ritualhafte Wiederholung eine affektive Ladung; Raum und Zeit tun sich in dem vermeintlich nostalgischen Bild zusammen, um überzeitliche Erinnerungen auszulösen, Gefühle von Zugehörigkeit und wohligem Beisammensein. Wort geworden ist diese ästhetische Ausgangslage in der vierten Strophe des Kärntner Heimatliedes (die erst 1930 an das 1822 geschriebene Gedicht angehängt wurde, hervorgegangen aus einem Schreibwettbewerb zum zehnjährigen Jubiläum des Plebiszits). „Wo Mannesmut und Frauentreu’ | die Heimat sich erstritt aufs neu’, | wo man mit Blut die Grenze schrieb | und frei in Not und Tod verblieb; | hell jubelnd klingt’s zur Bergeswand: | Das ist mein herrlich Hei-
matland!“ Die Hauptmotive der Werbeplakate für die Volksabstimmung auf Kärntner Seite sind hier benannt: Tapfere, kämpfende Männer, treue Frauen, brave Mütter, herrliche Heimat und der Kampf um die Karawankengrenze – und damit gegen die Zugehörigkeit zum SHS-Königreich. Das städtisch-industrielle Kärnten kam in der Propaganda übrigens nicht vor. Kaum findet man den slowenischen Teil Kärntens abgebildet. Männlich-wehrhaft werden vor allem die Deutsch-Kärntner gezeigt, bei der Werbung um die slowenischen Kärntnerinnen und Kärntner ist es etwa der Bub, der die Mutter nach dem Kirchgang bittet, für Kärnten zu stimmen und damit für seine Zukunft. Selbst in dem Begegnungs-Holzschnitt am Herzogstuhl sind die Sloweninnen und Slowenen untergeordnet dargestellt. Ignoranz und Art der Darstellung nehmen die bald nach 1920 folgende Marginalisierung und die Rechtsbrüche der Minderheit gegenüber schon vorweg. Dargestellt sind in der Regel Personen oder Personengruppen bei der Feldarbeit, der Abstimmung oder im Kampf und zuweilen Mythologisches. Die Linienführung der Abbildungen, seien es Plakate, Flugschriften oder Postkarten, war sanfter, in Grautönen gefüllt oder farbig, wenn es um das Evozieren von Heimatgefühlen ging. Kantig und hart war sie, wenn der gierig nach der Region greifende „slawische“ Feind dargestellt werden sollte. Auch ohne den Bildinhalt zu verstehen, vermittelt sich eine Stimmung, wird eine Stoßrichtung klar. Die Wahlwerbung für die Volksabstimmung 1920 war klare Propaganda. Ihre Ästhetik geht nahtlos in die Ästhetik der NS-Zeit über. Im Nationalsozialismus übernahmen nahezu sämtliche Plakate die Funktion von politischen Plakaten, die der Bevölkerung die Ziele und Wertvorstel-