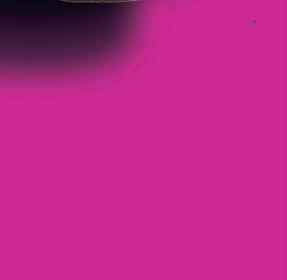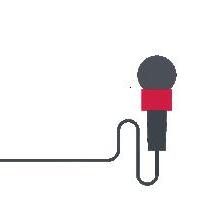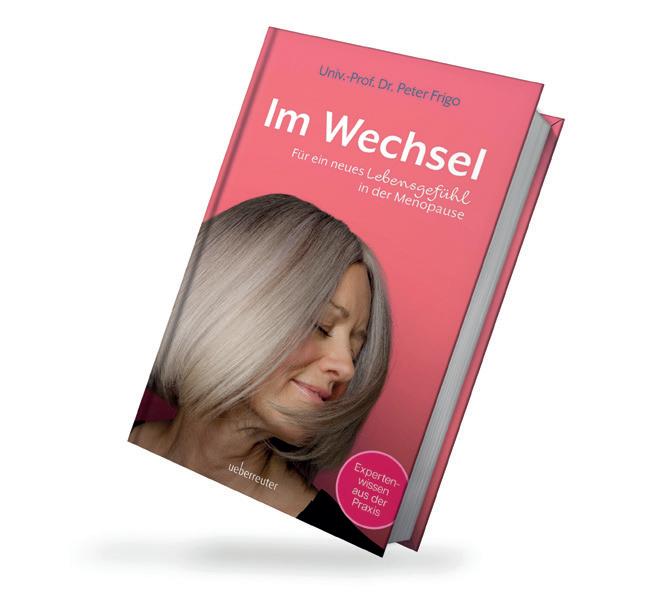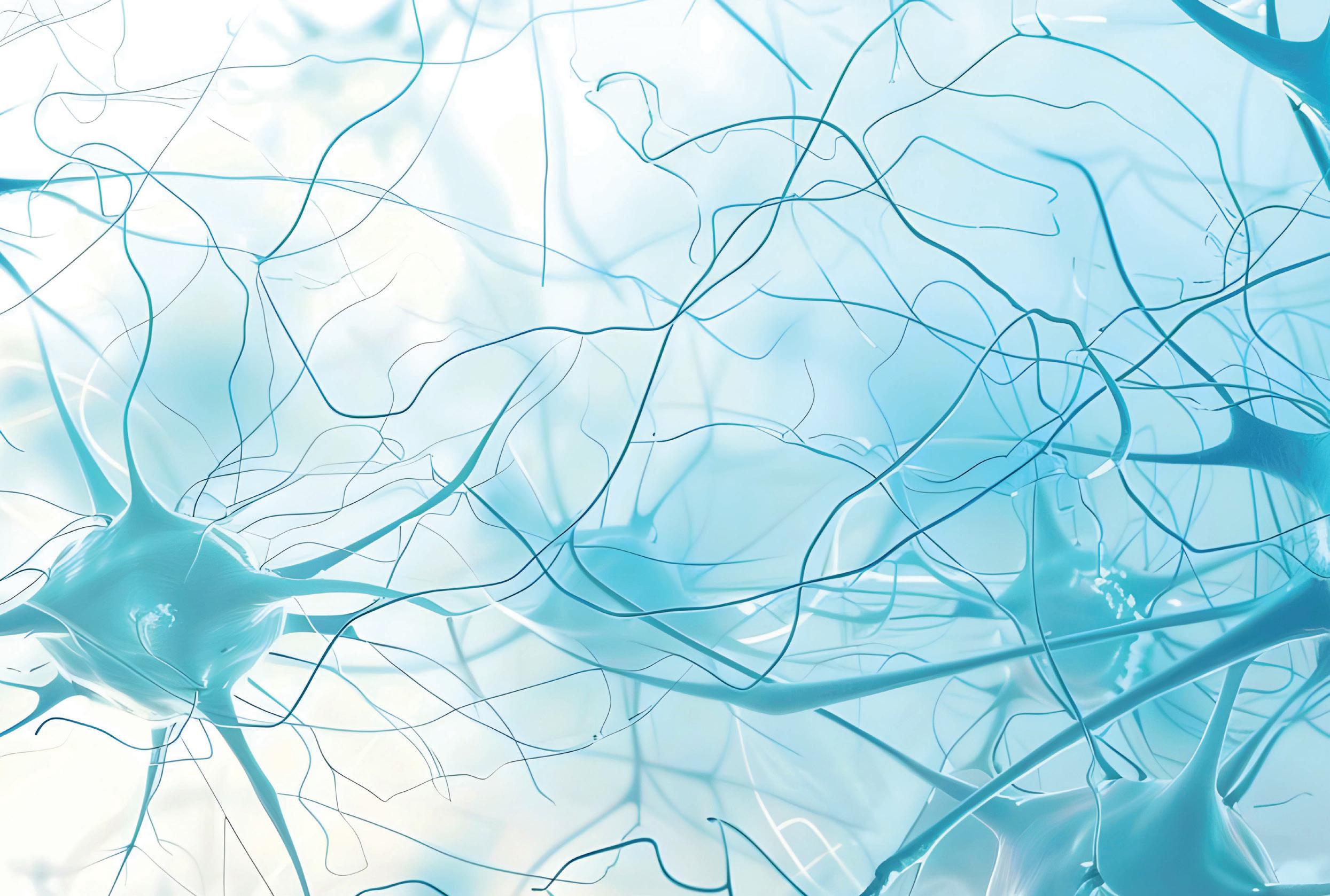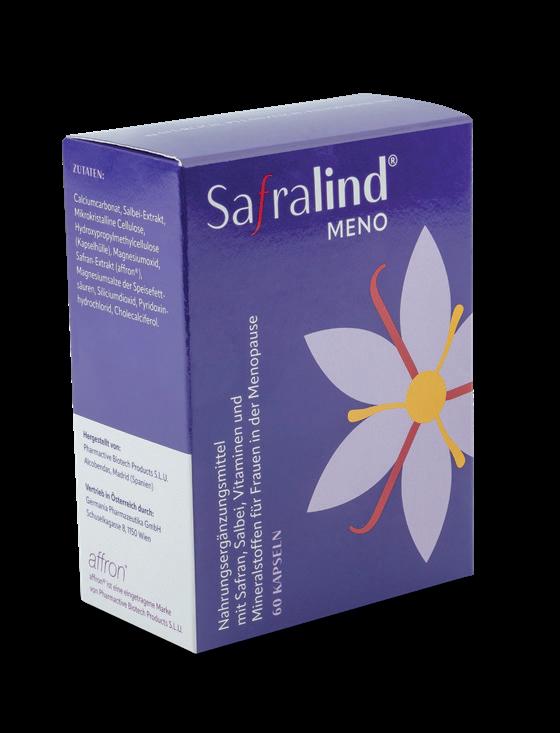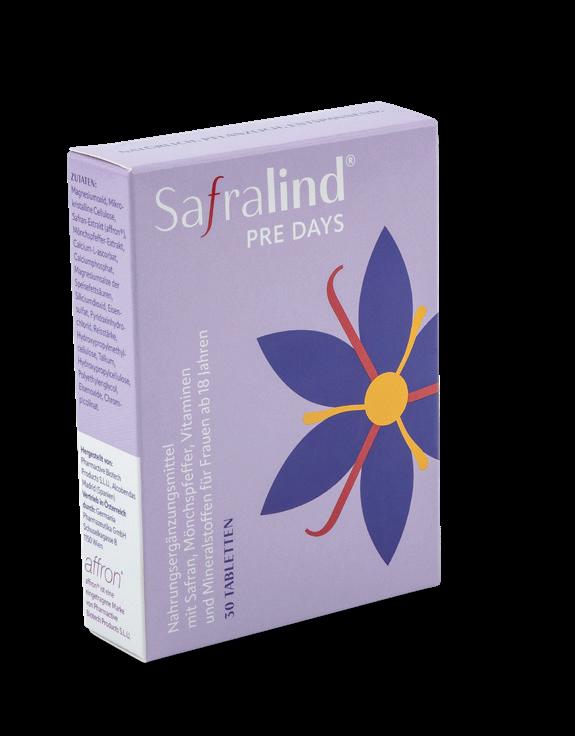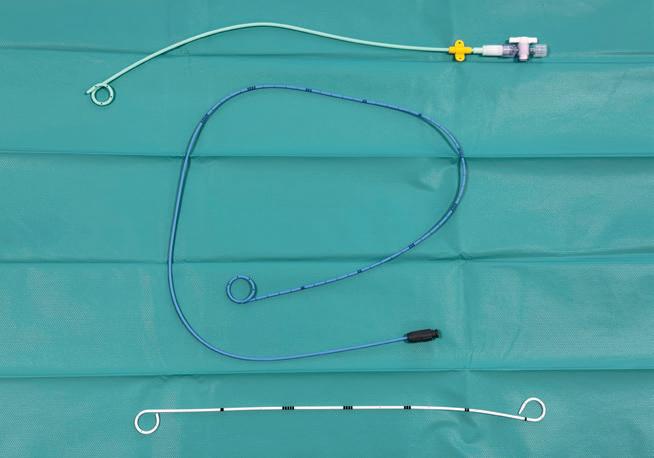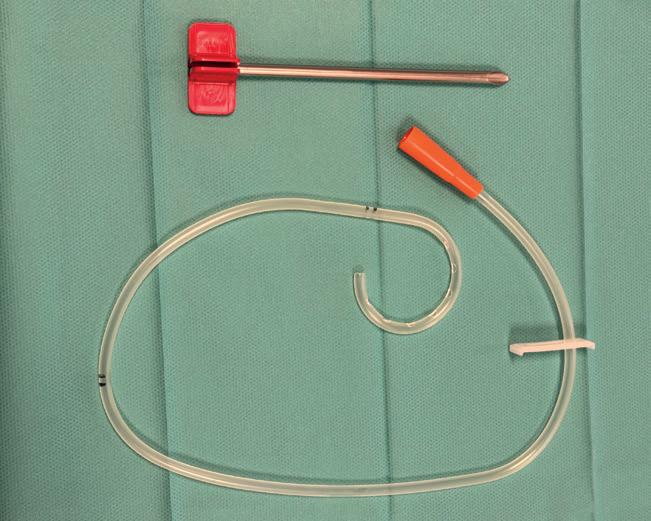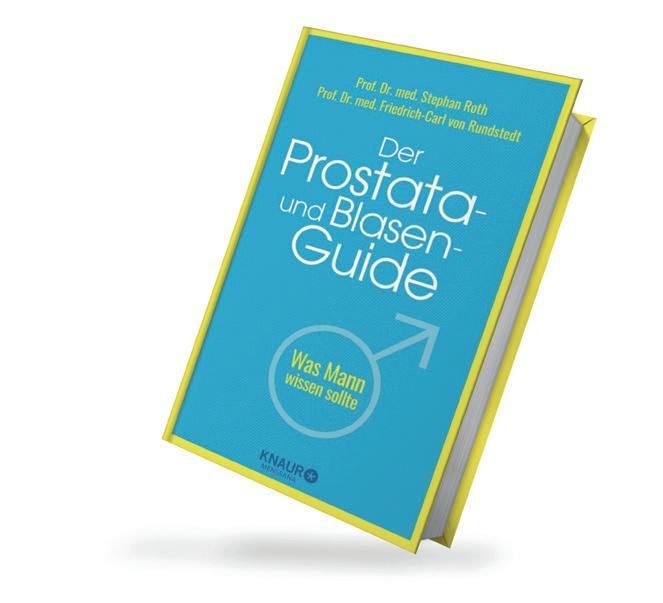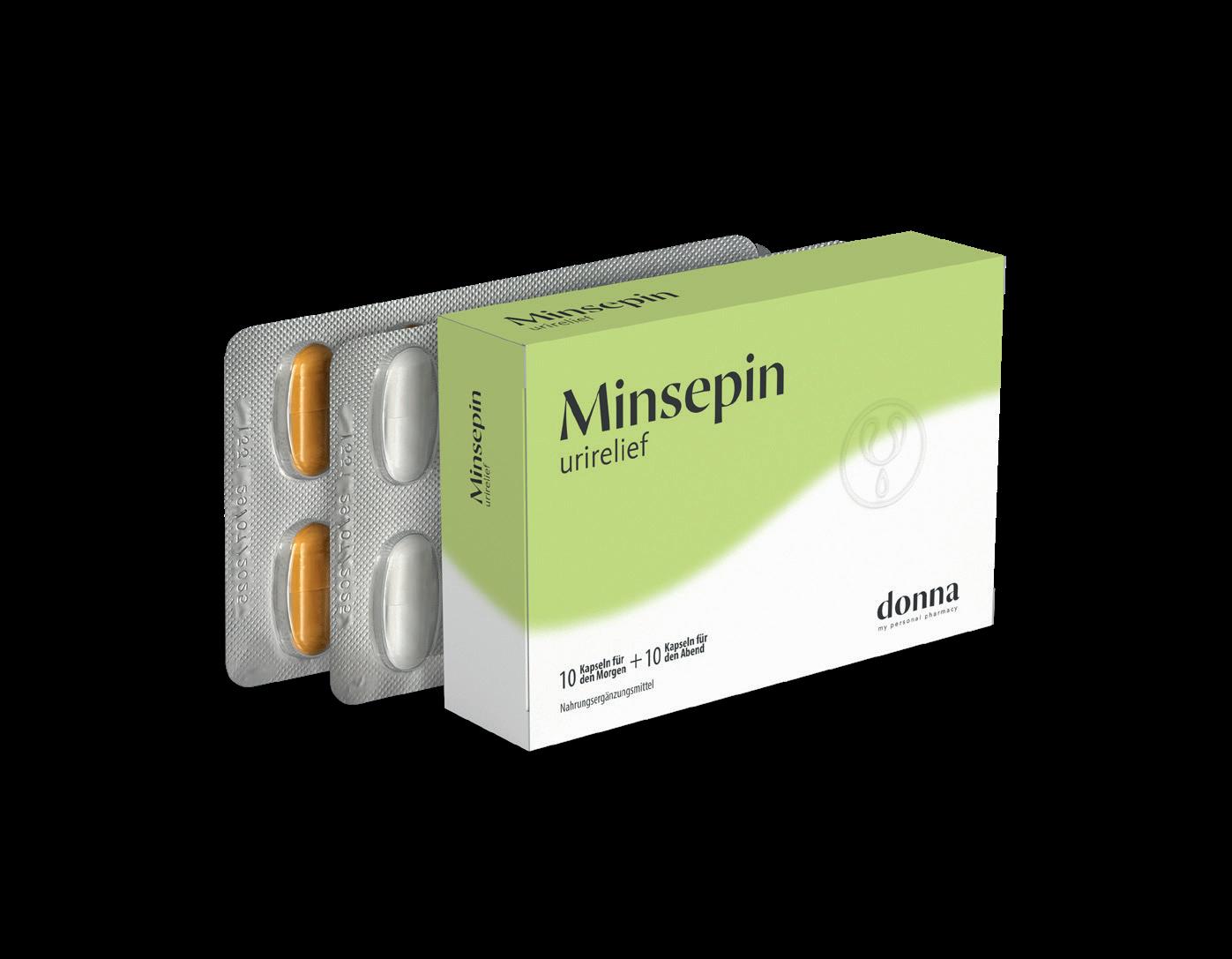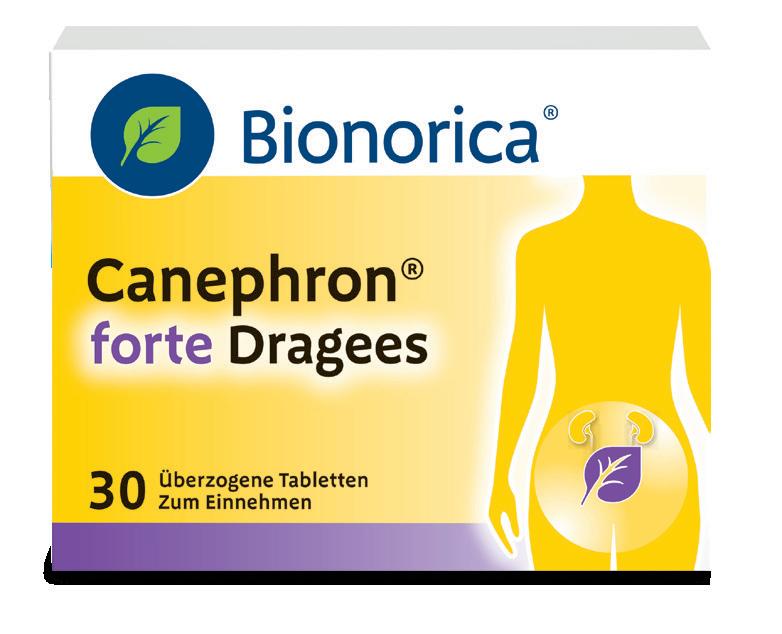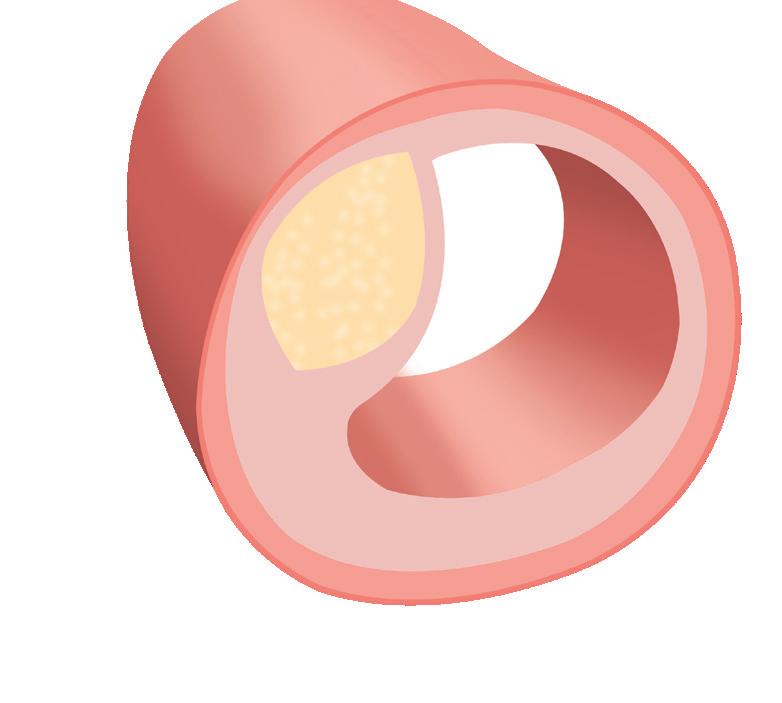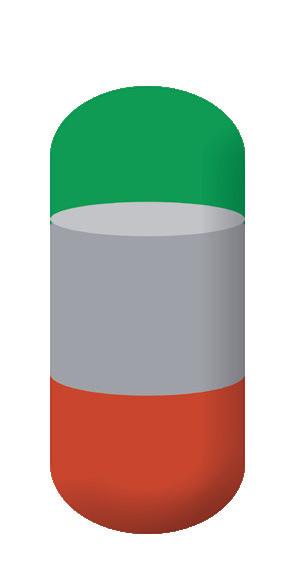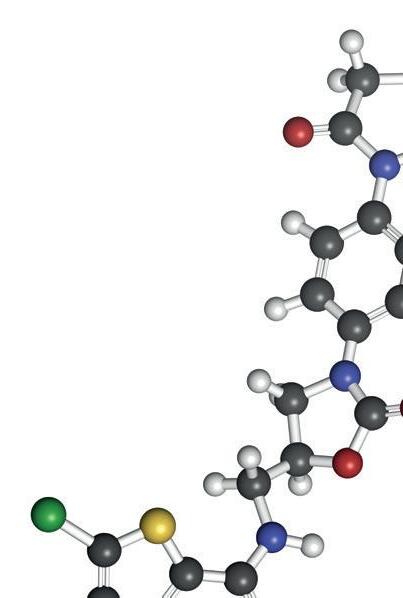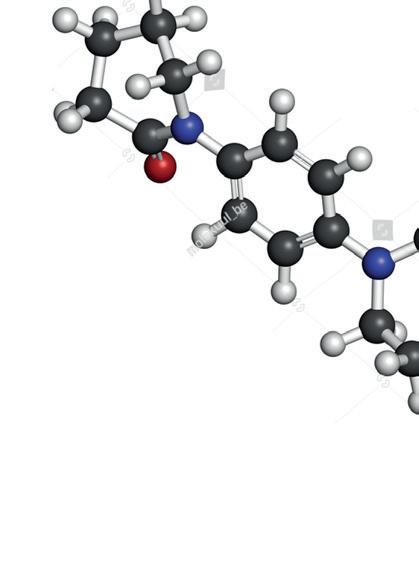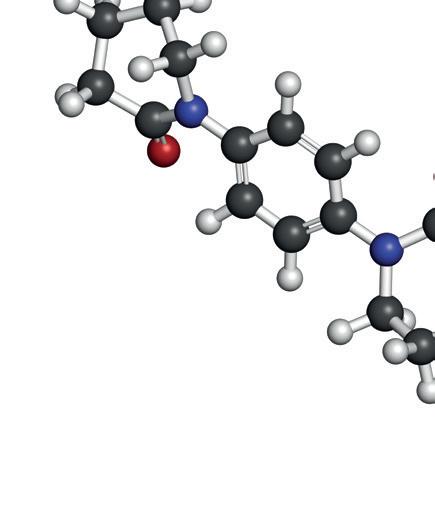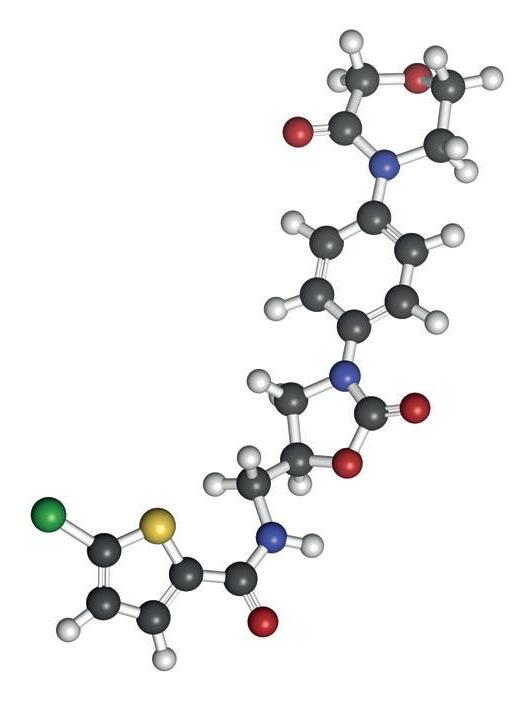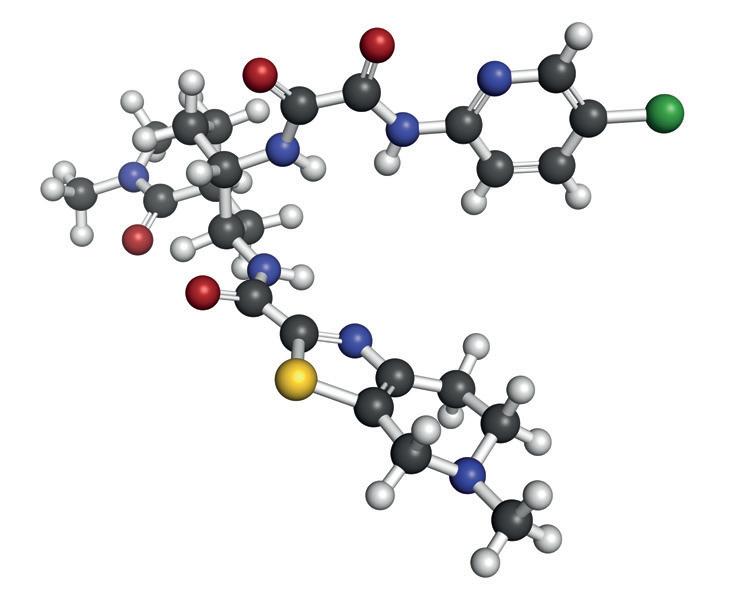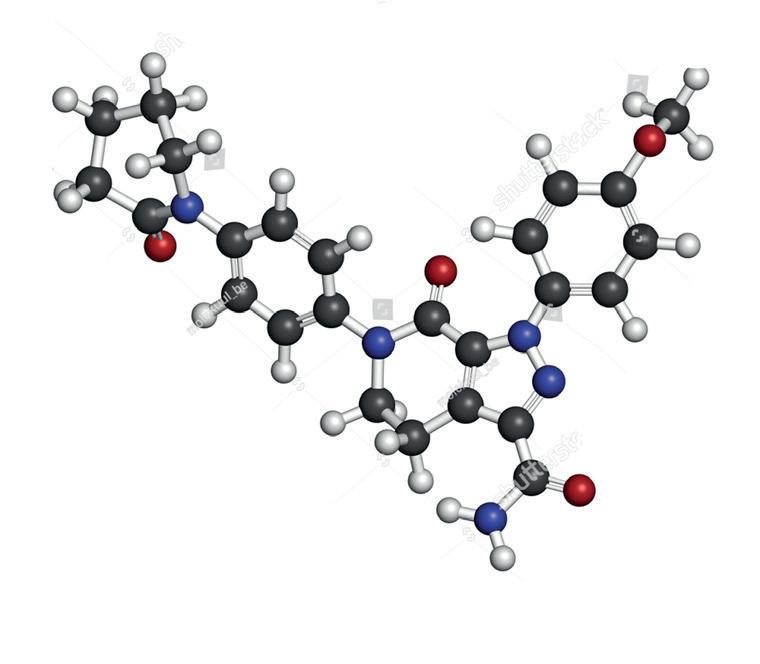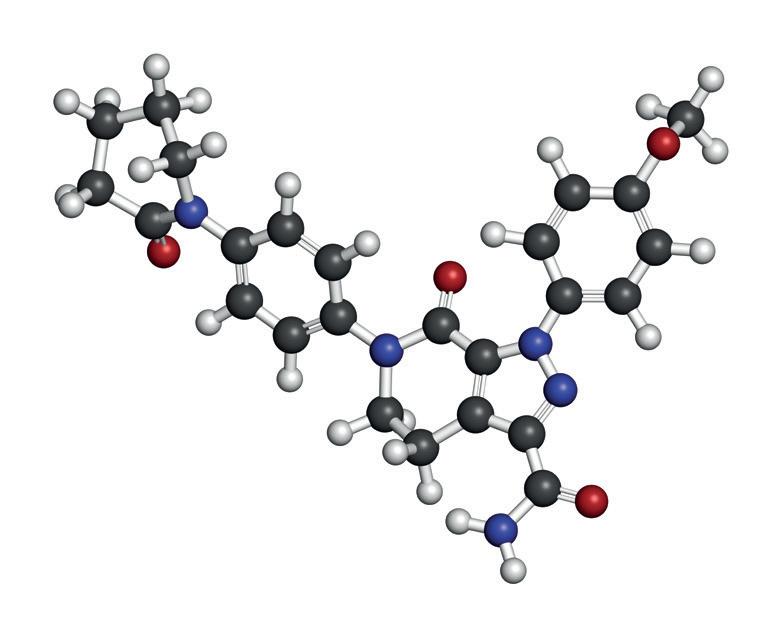Nachhaltigkeit –ICF-Klassifikation –Genderaspekte

06/2024 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie Dossier Diätetik:
Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien
urologischer Patient:innen Reisemedizin: 24 Länder in Asien betroffen Praxiswissen: Katheter & Co Japanische Enzephalitis PFLANZENBASIERT ESSEN ALS THERAPIE?
Gesund.at Versorgung
Weniger suchen, mehr wissen.
Ihr
Begleiter im medizinischen Berufsalltag.
Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug – verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen.
Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder?
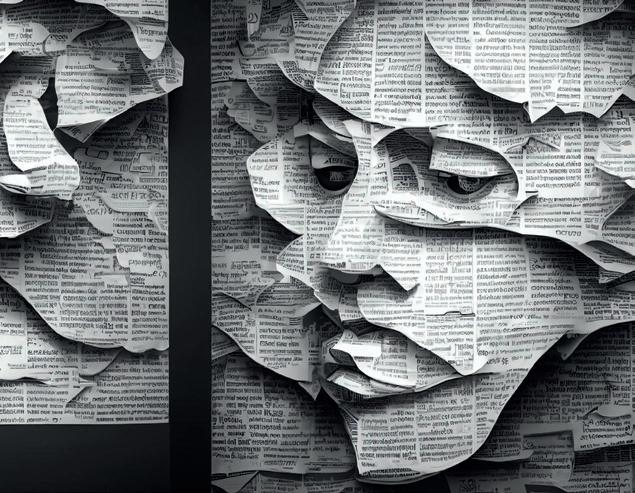

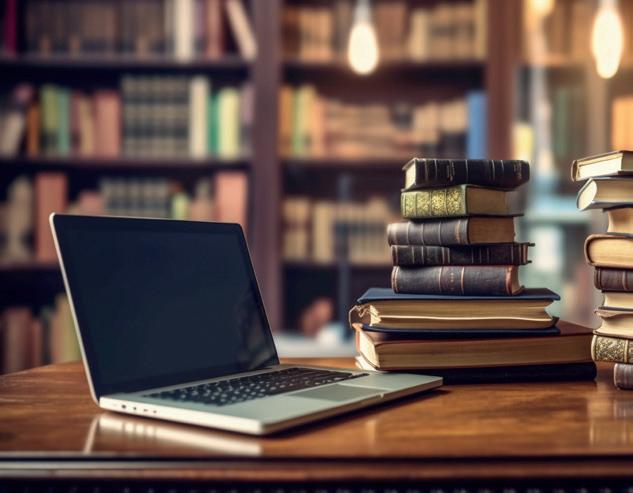

Daily Doc News
Wir senden Ihnen jeden Tag die wichtigsten News aus der Branche frei Haus
Sagen Sie JA zum Wissensvorsprung
DFP-Fortbildungen
Wir ermöglichen Ihnen, jederzeit und von überall DFP-Punkte zu sammeln.
Starten Sie JETZT Ihre Weiterbildung
Fachartikel
Wir liefern Ihnen Aktuelles aus Medizin, Pharmazie und Standespolitik.
Entdecken Sie GLEICH die neuesten Artikel
Kongresskalender
Wir präsentieren Ihnen alle wichtigen Branchen-Events auf einen Blick.
Erfahren Sie, WANN sich Ihr Fachbereich trifft



© stock.adobe.com/Yulia Furman, SdecoretMockup © stock.adobe.com/Vasilii © stock.adobe.com/Mediaparts © stock.adobe.com/Creative Clicks © stock.adobe.com/Stockgiu Gesund.at

Hier geht es zur Anmeldung:



NEU!

Fokus auf Vielfalt
Mit dem europäischen Klimagesetz hat sich die EU zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die gesamte Lebensweise – inklusive der Lebensmittelauswahl und Ernährung – soll umgestellt werden, damit auch künftige Generationen ein gesundes und menschenwürdiges Leben führen können.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat ihre Empfehlungen bereits angepasst: Neben gesundheitlichen Aspekten der täglichen Ernährung werden erstmals auch die Faktoren Umwelt und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dabei hat man sich an der Planetary Health Diet der EAT Lancet Commission von 2019 orientiert. Hülsenfrüchte, Nüsse, Gemüse und Obst bilden mengenmäßig die Basis (75 Prozent). Tierische Produkte wie Fleisch, Wurst, Eier und Milchprodukte sollen gemäß den neuen Empfehlungen deutlich zurückhaltender verspeist werden. Die Resonanz ist allerdings nicht durchwegs positiv. Die Deutsche Akademie für Präventivmedizin (DAPM) bemängelte etwa, dass Aspekte des Klimaschutzes teilweise über gesundheitliche Belange der Bevölkerung gestellt worden seien.
Individuelle Gesundheit & Biodiversität
In Österreich ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) damit beauftragt, die Ernährungspyramide entsprechend zu überarbeiten. Ersten Informationen zufolge soll es zusätzlich zur omnivoren auch eine vegetarische Pyramide geben und die Veröffentlichung noch 2024 erfolgen.
Das forum. ernährung heute (f.eh) rät, zusätzlich auf eine bunte Vielfalt am Teller zu setzen – mit etwa 30 verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln pro Woche. Dies lasse sich mit ein wenig Aufmerksamkeit leicht spielerisch erreichen –so Geschäftsführerin Mag.a Marlies Gruber in einer Aussendung: „ Neben genießerischen bringt das auch gesundheitliche Vorteile: Eine abwechslungsreiche Kost ermöglicht eine gute Nährstoffversorgung sowie ein vielfältiges Darmmikrobiom, was eher mit Normalgewicht verbunden ist.“ Ein weiterer Bonus sei, dass man mit einer abwechslungsreichen Ernährung ebenso zu einem nachhaltigen Ernährungssystem beitrage, denn indirekt erhöhe man die Artenvielfalt im landwirtschaftlichen Anbau und fördere damit eine ökologischere und resilientere Produktion. Unter dem Motto: „Was wir essen, bleibt bestehen.“
Ein breites Themenspektrum
Auch in unserer aktuellen Ausgabe der Hausärzt:in liegt ein Fokus auf dem Ernährungsbereich. Denn dieser ist für sich schon äußerst vielfältig: Neben medizinischen und ökologischen Aspekten sind etwa Qualitätsnormen in der Diätetik oder Genderunterschiede beim Abnehmen wichtige Praxisthemen. In den Sommermonaten fällt vielen Menschen eine Ernährungsumstellung leichter!
Eine spannende Lektüre wünscht Ihre
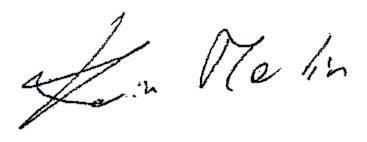
Mag.a Karin Martin
Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at
AKTUELL

Das Österreichische Akademische Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) bietet Mediziner:innen regelmäßig eine ernährungsmedizinische Weiterbildung in Form des ÖÄK-Diplom Ernährungsmedizin an, das mit 90 fachspezifischen DFP-Punkten approbiert wird.
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm.
Themenauszug: Adipositas, Diabetes mellitus, Metabolisches Syndrom, angeborene Stoffwechselstörungen, gastrointestinale Erkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Bulimie/Anorexie, Ernährung bei Krebs, Osteoporose, Ernährung und Sport, Ernährung im Alter, Ernährung von Säuglingen, Ernährung der Schwangeren und Stillenden, alternative Ernährungsformen, Psychologie, Karies usw. Ausbildungszyklus III/2024 – Termine:
• Seminar 1: 27./28.09.2024
• Seminar 2: 18./19.10.2024
• Seminar 3: 22./23.11.2024
• Seminar 4: 13./14.12.2024
• Seminar 5: 17./18.01.2025
• Seminar 6: 14./15.02.2025 + Prüfung
Veranstaltungsort: Europahaus Wien, Linzer Straße 429, 1140 Wien, Tel.: 01/5766677, europahauswien.at Infos & Anmeldung: ÖAIE, Tel.: 01/4026472, Website: oeaie.org, E-Mail: office@oeaie.org.
4 Juni 2024 Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit
© shutterstock.com/victoriaKh
medizinisch
08 Schwierige Erreger
Clostridioides difficile im Mittelpunkt des Interesses
10 Adipositas als Darmkrebsgefahr Drei Studien analysieren verschiedene Einflussfaktoren
20 „Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen“ Expert:innen warnen vor alarmierender Unterversorgung bei Schmerzbehandlung
DIÄTETIK
24 Gefäße im Klimastress Hitze beeinflusst das Herz-Kreislauf-System
22 „Das eigene Risiko kennen“ Vorhofflimmern und Hypercholesterinämien als stille Gefahren, die sich aber mit guter (Primär-)Prävention in den Griff bekommen lassen
26 Verunreinigte Atherome Epidemiologische Studie zeigt: Durch Mikro- und Nanoplastik kann das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse steigen
27 Hilfe bei Spastizität Die Wahl der medikamentösen Therapie
28 Rheuma betrifft mehr als nur die Gelenke Die Mortalitätsrate liegt, je nach Erkrankung, um 25 bis 325(!) Prozent über jener einer Vergleichspopulation

Reiseapotheke für den HNO-Bereich: Besondere Hinweise für Patient:innen mit Allergien.

Das Japanische-Enzephalitis-Virus ist in Ost- und Südostasien endemisch, wurde aber auch schon außerhalb isoliert.
12 Pflanzenbasiert essen als Therapie? Von Konsumverstopfung, Decision Fatigue und modernen Lehrkonzepten
16 Die neue Norm in der Diätologie In Österreich soll eine ICF-Klassifikation implementiert werden
18 Gendermedizin: Warum brauchen wir das? Frauen und Männer unterscheiden sich in puncto Ernährung voneinander, aber: Ist der Umgang mit dem eigenen Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?
pharmazeutisch
48 Schutz fürs Gehör Tipps für einen gesunden HNO-Bereich im Urlaub
52 Fernöstliche Virologie Ein Verwandter des FSME-Virus ist Enzephalitis-Haupterreger in Asien
54 Anaphylaxie-Update Was im Fall eines Schocks zu tun ist
59 Die Top-Antidiarrhoika nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA dossier
30 „Das Wesentliche ist die Enttabuisierung“ Vorurteile und aktuelle Entwicklungen in der Therapie des klimakterischen Syndroms
32 Zyklusgebundene Beschwerden Neue Einblicke in die Neurophysiologie durch EEG-Studien
33 DFP Praxiswissen: Katheter und andere Kunststoffableitungen Grundlagen der Versorgung urologischer Patient:innen
38 Plötzliche Drangepisoden Bei Männern und Frauen unterschiedlich –die schwache Blase
40 Wenn das Unkomplizierte kompliziert wird Antibiotikaresistenzen erschweren die Behandlung von Harnwegsinfekten
60 Herz aus dem Takt ÖKG Jahrestagung 2024: Aktuelle Erkenntnisse aus der Rhythmologie
61 SPRECHStunde Umstellung auf NOAK – was ist zu beachten?
63 Termine Aktuelle Kongresse und mehr
63 Impressum extra
Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis © shutterstock.com/AI
52
6 Juni 2024
48
© shutterstock.com/Igor Link
Schwierige Erreger
Clostridioides difficile im Mittelpunkt des Interesses

Serie GASTRO/HEPAR

Hausärzt:in medizinisch 8 Juni 2024 © stock.adobe.com/TopMicrobialStock
Risikofaktoren für eine CDI2
Durchzuführen ist eine zeitnahe, sensitive Diagnostik in Bezug auf C. difficile bei Personen mit nosokomialer Diarrhö sowie bei ambulanten
Patient:innen mit akuter Diarrhö und insbesondere folgenden Risikofaktoren:
� aktuelle oder stattgehabte Antibiotikatherapie innerhalb der letzten drei Monate
� stattgehabte CDI innerhalb der letzten zwölf Monate
� hohes Lebensalter (über 65 Jahre)
� aktuelle oder stattgehabte Hospitalisierung innerhalb der letzten drei Monate bzw. Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen des Gesundheitssystems
� Z. n. Stammzell- oder Organtransplantation
� chronisch entzündliche Darmerkrankung
� chronische internistische Komorbiditäten
Quellen:
1 Manthey CF et al. (2023), Editorial, siehe: dgvs.de/leitlinien/gi-infektionen
2 S2k-Leitlinie Gastrointestinale Infektionen der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) Version 2.0 – November 2023, AWMF-Registernummer: 021-024.
3 Wilking H et al., Epidemiol Infect 2013;141:2365-75.
4 Lübbert C, Dtsch Arztebl 2019; 116(29-30): [24].
5 Lynen Jansen P et al., Z Gastroenterol 2014;52:549-57.
6 ages.at , Krankheitserreger von A bis Z, Clostridioides difficile (Stand: 23.05.2024).
Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:
Hausärzt:in medizinisch 9 Juni 2024 INFO

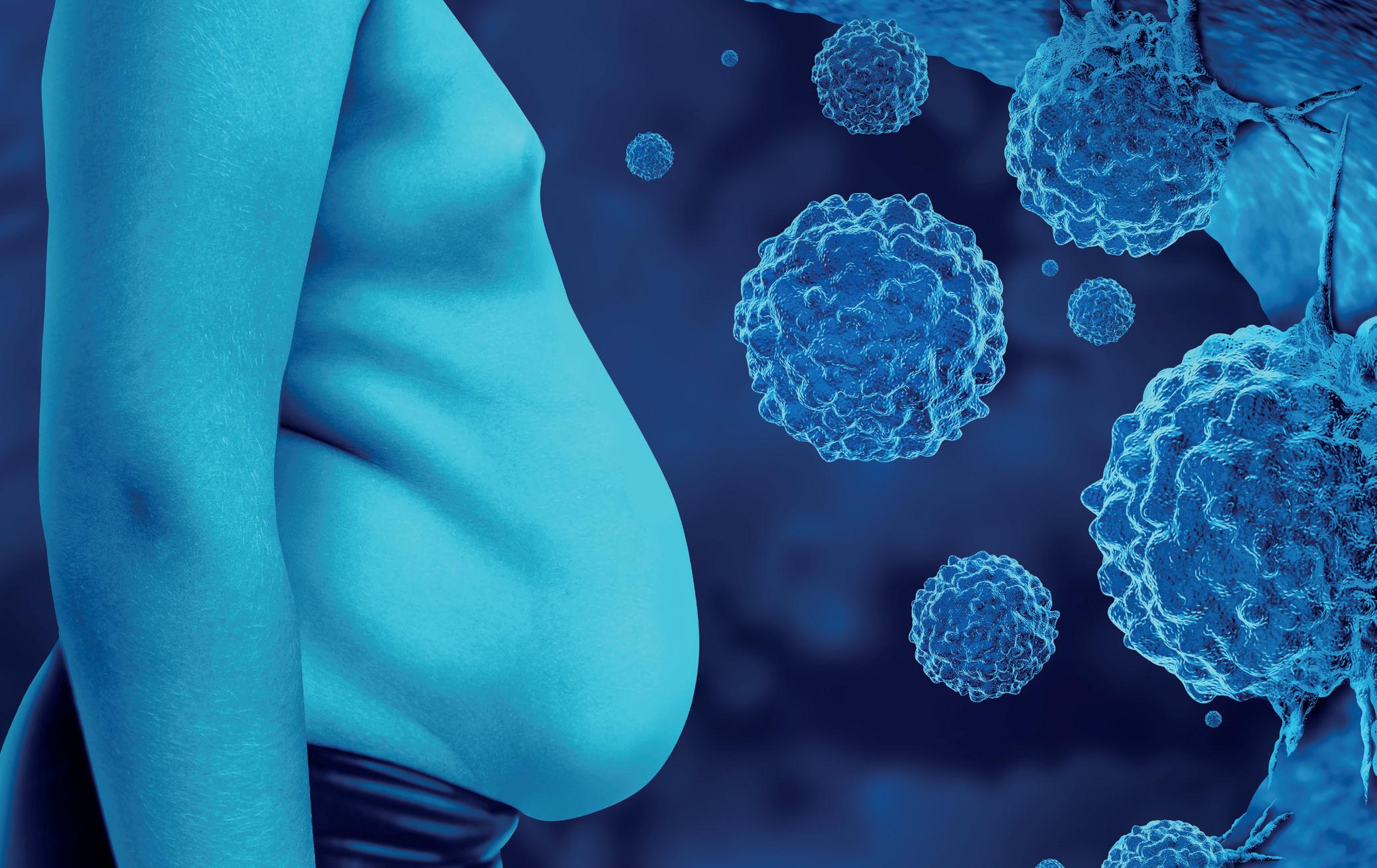
Adipositas als Darmkrebsgefahr
Drei Studien analysieren verschiedene Einflussfaktoren
Das kolorektale Karzinom (KRK) ist die dritthäufigste Krebsart und die zweithäufigste Todesursache bei Krebs. Klar ist, dass Personen mit Übergewicht oder Adipositas, also mit einem BodyMass-Index ≥ 25 kg/m2, ein höheres Erkrankungsrisiko haben.
„Für die Auswirkungen verschiedener Adipositasformen auf das kolorektale Karzinom sind unterschiedliche Signalwege als Ursache möglich.“
Unterschiede in Fettverteilung
Ob sich einzelne Adipositassubtypen unterschiedlich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, an Darmkrebs zu erkranken, ist noch nicht geklärt. Daher untersuchte eine Studie1 unter anderem vier Körperformphänotypen: Von Body-Mass-Index, Größe, Gewicht,
Taille-Hüft-Verhältnis (WHR) sowie Taillen- und Hüftumfang leiteten die Studienautor:innen vier Adipositasformen ab. Die Grundlage lieferte eine Datenbank aus dem Vereinigten Königreich (UK-Biobank) mit 329.828 Teilnehmer:innen, darunter 3.728 Darmkrebsfälle. Die verschiedenen Typen teilten die Expert:innen in PC1-4 ein. Der erste PC beschreibt eine allgemein fettleibige Körperform. PC2 charakterisiert große Personen mit geringem Taille-Hüft-Verhältnis. Personen mit vermehrter Fettansammlung in der Bauchregion gehören zu PC3. Der athletische Typ mit einem hohen BMI und Gewicht, jedoch mit kleinem Taillenund Hüftumfang ist PC4 zugeordnet.
Erwartbares Ergebnis
Für die Forscher:innen war Folgendes interessant: ob und wie sich die verschiedenen Körperformen auf das KRK-Risiko auswirken. Aufgrund früherer Erkenntnisse vermutete man, dass Personen mit einer generalisierten Adipositas (PC1) und jene mit einer Fettansammlung, die vorwiegend den Bauch betrifft (PC3), ein höheres Ri-
siko hätten, Darmkrebs zu entwickeln. Das Ergebnis dieser Studie war keine große Überraschung – auch hier bestätigte sich dieser Verdacht. PC1 und PC3 erhöhten das Gesamtrisiko in Bezug auf Darmkrebs, unabhängig von der Lokalisation (proximales/distales Kolon und Rektum) und dem Geschlecht.
Die Rolle der Gene
Eine weitere Beobachtung im Rahmen jener Arbeit: Bei Personen mit generalisierter Adipositas (PC1) könnten hirngewebsspezifische Gene für das erhöhte Darmkrebsrisiko verantwortlich sein. Bei jenen mit übermäßiger Fettansammlung in der Bauchregion (PC3) fand man fettgewebsspezifische Gene, die in Verbindung mit dem kolorektalen Karzinom stehen. Es könne also verschiedene kausale Signalwege zwischen den Subtypen und Darmkrebs geben, vermuten die Studienautor:innen. Die Erkenntnis gewann man aus genomweiten Assoziationsstudien mit 460.198 Teilnehmer:innen der britischen Biobank, in denen 3.414 genetische Varianten in den vier Körperformen identifiziert wurden.
Hausärzt:in medizinisch 10 Juni 2024
© stock.aobe.com/freshidea
Serie GASTRO/HEPAR
„Ein hoher BMI in den jungen Jahren könnte für Männer mit einem größeren Darmkrebsrisiko verbunden sein als für Frauen.“
Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten für die Entwicklung individualisierter Strategien zur Krebsprävention von wesentlicher Relevanz sein.
Geschlechtsspezifische Abweichungen
Eine weitere Studie2 untersuchte unter anderem, ob die Auswirkungen von Adipositas auf das KRK-Risiko bei Männern und Frauen verschieden sind. Interessanterweise konnte ein Unterschied zwischen den Geschlechtern festgestellt werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein höherer BMI das KRK-Risiko bei Männern stärker erhöht, während eine größere WHR die Darmkrebswahrscheinlichkeit bei Frauen deutlicher steigen lässt. Hierfür wurde eine geschlechtsspezifische Mendel‘sche Randomisierung durchgeführt (58.221 Fälle und 67.694 Kontrollen).
Gefahr
für die Jüngeren
Zuletzt ist eine Metaanalyse3 erwähnenswert, welche erhob, wie sich Adipositas in jungen Jahren auf das KRKRisiko im Erwachsenenalter auswirkt. Die Studienautor:innen analysierten 15 Studien mit mehr als 4,7 Millionen Teilnehmer:innen, wobei sie Männer und Frauen getrennt voneinander betrachteten. Das Ergebnis dieser Arbeit: Ein hoher BMI in jungem Alter steht mit einem um 39 % erhöhten Darmkrebsrisiko bei erwachsenen Männern in Verbindung, bei den Frauen war die Wahrscheinlichkeit um 19 % erhöht. Alle Studien jener Metaanalyse untersuchten den Zusammenhang zwischen dem BMI vor dem 25. sowie nach dem 34. Lebensjahr und dem KRK-Risiko. Der BMI im jüngeren Alter wurde jedoch nicht immer aufgezeichnet, weswegen die Studienautor:innen auf erinnerte Angaben zurückgreifen mussten. Dadurch könnten sich Fehler in die Metaanalyse eingeschlichen haben. Zudem inkludierte die Arbeit nur Personen aus der westlichen Bevölkerung. Wichtig sei es, dass zukünftige Forschungen auch nichtwestliche Bevölkerungsgruppen miteinbezögen, um die Auswirkungen besser und umfassender zu untersuchen, so das Fazit der Expert:innen.
Mara Sophie Anmasser
Literatur:
1 Peruchet-Noray L et al., Sci Adv. 2024 Apr 19;10(16):eadj1987.
2 Bull CJ et al., BMC Med. 2020 Dec 17;18(1):396.
3 Garcia H, Song M, Rev Panam Salud Publica. 2019 Jan 4;43:e3.
Hausärzt:in medizinisch 11 Juni 2024
Pflanzenbasiert essen als Therapie?

GASTAUTOR: Klaus Nigl, M.A. Studiengangsleitung Diätologie, FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH, Campus Gesundheit am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Eine Therapie ist eine Heilbehandlung – also steht eine Erkrankung oder Dysfunktion im Zentrum. Wir therapieren überwiegend das kranke Individuum und bedienen uns dabei aufgrund unserer naturwissenschaftlichen Orientierung schnell diverser Messungen, Labordaten, Kalorienund Nährwertberechnungen, SOPs und Leitlinien – in der Hoffnung, dass das kranke Individuum das versteht, wohlwollend und dankbar aufnimmt und umsetzt.
Dass das kranke Individuum mit einer kranken Gesellschaft und einer kranken Umwelt in Verbindung steht, ist uns vielleicht bewusst, aber es fehlt oft an Ressourcen, um uns damit zu beschäftigen. Für das kranke Individuum aber wäre
Von Konsumverstopfung, Decision Fatigue und modernen Lehrkonzepten >
ebenjene Einbettung der individuellen (Ernährungs-)Therapie in seine soziale Umwelt ein wesentlicher Faktor für Erfolg und Therapieadhärenz.
In diesem Artikel geht es also nicht vordergründig um Möglichkeiten der Therapie des Individuums, sondern um das Aufzeigen therapeutischer Anknüpfungspunkte in Bezug auf Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Geschichte der Nachhaltigkeit
Werfen wir vor diesen Anknüpfungspunkten einen Blick auf die Geschichte der Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit ist ein vergleichsweise modernes Konzept, dessen Ausgangspunkt war die RioKonferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992. Unsere heutigen Vorstellungen von nachhaltiger, „r ichtiger“ Ernährung –fleischarm, pflanzenorientiert, regional, saisonal, zudem wenig verarbeitet und aus fairer Produktion – gibt es schon länger: Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Hand in Hand mit den sozialen Veränderungen ging eine Veränderung der Lebensgewohnheiten, die mit mehr Zucker, Weißmehl, Fleisch und Alkohol verbunden war. Die aufkommenden Zivilisationskrankheiten sensibilisierten für den Verzicht auf Fleisch. Damals waren die ökologischen Auswirkungen des hohen Fleischkonsums allerdings noch völlig unbekannt. Durch die beiden Weltkriege und insbesondere die Hungersnot im Ersten Welt-
Hausärzt:in dossier 12 Juni 2024
© shutterstock.com/AI
© S. Beiganz
Mutterkraut –die Migräne-Prophylaxe
Mutterkraut wird bereits seit Jahrzehnten
erfolgreich zur Behandlung migräneartiger Kopfschmerzen eingesetzt.
NNeben Studien, die den klinischen Nutzen von Mutterkraut bei Migräne wissenschaftlich belegen, konnten mittlerweile auch Wirksubstanz und pharmakologische Zielstrukturen vollständig aufgeklärt werden. Das enthaltene Parthenolid ist in der Lage, im Akutfall die Stärke der Begleitsymptome wie Übelkeit und Erbrechen zu senken und die Anfallshäufigkeit deutlich zu reduzieren. Das macht Mutterkraut zum Mittel der Wahl in der Migräneprophylaxe.
Migräne auf molekularer Ebene
Die Ursache, der bei Migräne typischen Kopfschmerzen, ist ein fehlgesteuerter Prozess, der zur Vasodilatation großer Gefäße in den Gehirnhäuten führt. Migränetrigger aktivieren dabei bestimmte Ionenkanäle (TRPA1) in der Membran der Trigeminusneuronen wodurch es zu einer gesteigerten Freisetzung des Neuropeptids „Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP)“ kommt. CGRP wiederum wirkt über die Aktivierung der Adenylatcyclase und der Proteinkinase A gefäßerweiternd und bedingt damit den pulsierenden, meist einseitigen Kopfschmerz. Deshalb kommt diesem Neuropeptid eine Schlüsselrolle in der Entstehung von Migräneattacken zu.1–3
Mutterkraut senkt die Anfallshäufigkeit Parthenolid als Wirksubstanz von Mutterkrautpulver führt über eine Interaktion mit TRPA1 zu einer verminderten Freisetzung von CGRP4 und dadurch zu einer Hemmung der fehlgesteuerten Vasodilatation. Eine Reduktion der Anfallshäufigkeit von Migräneattacken ist die Folge, wie in mehreren placebokontrollierten Doppelblindstudien gezeigt wird.5–7 Die Anwendung von Mutterkrautpulver über die Dauer von 6 Monaten reduzierte die Migräneattacken
weniger Anfälle gegenüber Placebo
FAKTEN
Dr. Böhm®
Mutterkraut forte
Inhaltsstoffe
1 Filmtablette enthält: 200 mg Mutterkraut als gepulverte Droge (Tanaceti parthenii herba).
Indikation
Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Vorbeugung von migräneartigen Kopfschmerzen (Migränekopfschmerz)
Dosierung
Erwachsene: 1-3 mal täglich eine Filmtablette. Zu Beginn der Therapie wird empfohlen mit 1 Filmtablette zu starten.
Mutterkraut
Abb: Signifikante Abnahme (p< 0,02) der Häufigkeit von Migräneattacken pro Monat.
der Patienten um 67 % (Abb. 2). Darüber hinaus traten die charakteristischen Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Erbrechen deutlich seltener auf.7
Fazit
Mutterkraut reduziert die Häufigkeit von Migräneattacken und führt im Akutfall zu einer deutlichen Verbesserung der Begleiterscheinungen. Das enthaltene Parthenolid greift auf molekularer Ebene sehr früh in die Migränekaskade ein und bewirkt eine verminderte Vasodilatation cerebraler Gefäße. Durch die Langzeiteinnahme von Mutterkraut kann migräneartigen Kopfschmerzen vorgebeugt und damit die Akutmedikation reduziert werden.
1Peck KR, Smitherman TA, Baskin SM. Traditional and alternative treatments for depression: implications for migraine management. Headache 2015;55 (2):351–5.; 2Goldberg LD. The cost of migraine and its treatment. The American journal of managed care 2005;11 (2 Suppl):S62-7.; 3Haberer T. 030-057l_S1_Therapie-der-MigraeneattackeProphylaxe-der-Migraene_2023-01.; 4Materazzi S, Benemei S, Fusi C et al. Parthenolide inhibits nociception and neurogenic vasodilatation in the trigeminovascular system by targeting the TRPA1 channel. Pain 2013;154 (12):2750–8.; 5 Diener HC, Pfaffenrath V, Schnitker J, Friede M, Henneicke-von Zepelin H-H. Efficacy and safety of 6.25 mg t.i.d. feverfew CO2-extract (MIG-99) in migraine prevention--a randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled study. Cephalalgia : an international journal of headache 2005;25 (11):1031–41.; 6 Pfaffenrath V, Diener HC, Fischer M, Friede M, Henneicke-von Zepelin, H H. The efficacy and safety of Tanacetum parthenium (feverfew) in migraine prophylaxis--a double-blind, multicentre, randomized placebo-controlled dose-response study. Cephalalgia : an international journal of headache 2002;22 (7):523–32.; 7Johnson ES, Kadam NP, Hylands DM, Hylands PJ. Efficacy of feverfew as prophylactic treatment of migraine. British medical journal (Clinical research ed.) 1985;291 (6495):569–73.
Sollten sich nach 2-monatiger Anwendung keine optimalen Ergebnisse eingestellt haben, kann auf 2-3 Filmtabletten erhöht werden. Die tägliche Dosis von 600 mg darf nicht überschritten werden.
Packungsgröße
60 Filmtabletten
PZN 5521488
AVP: € 24,901 (inkl. Mwst.)
1 Unverbindliche Preisempfehlung
Facts
• Zur langfristigen Vorbeugung von migräneartigen Kopfschmerzen
• Rein pflanzlich, keine Gewöhnungseffekte
• Ideal auch für Triptan-Verwender, um die Häufigkeit der Akutmedikation zu reduzieren

IM PROFIL ADVERTORIAL NEU!
(%) Placebo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Anfallshäufigkeit/Monat
* -67%
* p < 0,02
„Patient:innenzentrierte Therapie ist gut, stellen wir dabei aber nicht (immer nur) die Pathologie in den Vordergrund. Ein Blick über unseren
Tellerrand und den der Patient:innen verheißt manchmal gute
Anknüpfungspunkte!“
„Planetary Health Diet“ nach Vorgaben der EAT-Lancet-Kommission. Quelle: sv-group.at

krieg wurden alternative Ernährungs konzepte auch politisch aufgewertet, u. a. durch die Nationalsozialisten. Die Vollwerternährung erfuhr in den 1970er Jahren einen weiteren Aufschwung, einer ihrer Verfechter war Max Otto Bruker, er integrierte die Vollwerternährung erfolgreich in die therapeutische und allgemeine Krankenverpflegung in seinen Kliniken. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vollwertlehre begann in Gießen Mitte der 1970er Jahre. Claus Leitzmann und Karl von Körber sind uns in diesem Zusammenhang ein Begriff. Sie erweiterten die ernährungswissenschaftliche und ökologische Perspektive um die Dimensionen Gesundheit, Soziales und Ökonomie.
Überbordender Lebensstil in heutiger Zeit
Heute müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nach wie vor in einer kolonialfossilen Umgebung leben – mit einer massiven Vergrößerung des ökolo-
rungsweise beiträgt. Die kolonialfossile Umgebung wirft manches wie einen Bumerang zurück: Ein Aspekt ist der Kunststoffanteil in vielen Lebensbereichen. Trotz zahlreicher positiver Aspekte stellt die Langlebigkeit dieser Verbindungen eine Herausforderung dar. Ewigkeitschemikalien sind per- und polyflourierte Alkylverbindungen. Sie kommen als Bestandteil von Pestiziden in der Produktion pflanzlicher Lebensmittel zum Einsatz oder verleihen beschichteten Pfannen eine fettabweisende Wirkung. Das Problem: Sie können noch langlebiger sein als viele Kunststoffe.
Der Umweltökonom Niko Paech hat den Begriff der Konsumverstopfung als Ausdruck unseres überbordenden Lebensstils geprägt. Es geht in der Folge – also sozusagen bei ihrer Therapie – keineswegs darum, Verzicht zu üben, sondern vielmehr darum, die Konsum-
NACHBERICHT
das lässt sich ange sichts der aktuellen Daten aus Ernährungsberichten durchaus auch auf den Ernährungsbereich anwenden.
Der Begriff Decision Fatigue kommt aus der Wirtschaft und meint Entscheidungsmüdigkeit. Er bedeutet dort, dass der Geist nach einer längeren Zeit der Entscheidungsfindung ermüdet. Werden beispielsweise viele Auswahlmöglichkeiten auf einmal präsentiert, sind Nutzer:innen verleitet, den kognitiv einfacheren Weg zu gehen und sich für Bekanntes zu entscheiden. Mit dem schier unermesslichen Angebot beim Lebensmitteleinkauf können wir unseren Patient:innen also nicht verdenken, dass sie mit unseren Empfehlungen angesichts solcher Regale auch eine Decision Fatigue entwickeln und dann doch wieder zu jenen Lebensmitteln greifen, die ihnen zwar vertraut, aber oft wenig gesundheitsorientiert bzw. nachhaltig sind.
Der Gastautor war Vortragender zum Thema beim 41. Ernährungskongress des Verbands der Diaetolog*innen Österreichs am 14. und 15. März 2024 in Wien.
Hausärzt:in dossier 14 Juni 2024
Werte einer Postwachstumsgesellschaft
Wie können wir unsere Patient:innen also motivieren und sie im Rahmen der Therapie begleiten? Wie können wir in diesen Prozess Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. pflanzenbasiertes Essen) integrieren? Hier lohnt sich ein Blick über den Tellerrand in die Wirtschaft – Motivation und Kaufanreize spielen schließlich auch dort eine wesentliche Rolle.
Degrowth oder Postwachstum ist eine Wirtschaftsweise und Gesellschaftsform, die das Wohlergehen aller zum Ziel hat und die ökologischen Lebensgrundlagen erhält. Diese erfordert eine grundlegende Veränderung unserer Lebenswelt und einen umfassenden kulturellen Wandel. Anstelle von „höher, schneller, weiter“ gelten hier die gemeinsamen Werte einer Postwachstumsgesellschaft wie Achtsamkeit, Solidarität und Kooperation. Subsistenz beziehungsweise das Prinzip Selbstversorgung wird durch eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung und gemeinnützige Arbeit realisiert. Die Definition des sozialen Status ändert sich massiv: vom leistungs- und kapitalgetriebenen American Dream of Life hin zum Nicht-Haben als Ziel.
Gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise
Um alle Menschen dieser Erde bis zum Jahr 2050 nachhaltig und gesund zu ernähren, ist eine grundlegende Ver-
änderung unserer Landwirtschaft und Ernährungsweise nötig. Die „ Planetary Health Diet“ liefert einen allgemeingültigen Referenzrahmen für eine gesunde und umweltgerechte Ernährungsweise. Sie hat sich als flexibel und für viele Menschen umsetzbar erwiesen. Ein großer Pluspunkt ist, dass viele Ernährungsstile, aber auch kulturelle Traditionen und individuelle Vorlieben darin Platz finden.
Die Teaching Kitchen ist ein Reallabor für den Erwerb wesentlicher Lebenskompetenzen. Hier werden Life Skills trainiert, Studierende lernen unter anderem, wichtige Kulturtechniken praktisch anzuwenden. Durch die Integration eigener Rezepte in das Lehrkonzept entsteht ein enger Bezug zu den direkten Lebenswelten der Teilnehmenden und der Transfer der Inhalte in den Alltag wird erleichtert. Es gibt also was zu tun!
Quellen:
Albrecht J, Pioniere der nachhaltigen Ernährung. In: VFED, 1. Auflage 2023. Bender U, Die „Mahlzeitendiktatur“.
In: ErnährungsUmschau 2/2024.
Paech N, Vom grünen Wachstum zur Postwachstumsökonomie. Warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine zukunftsfähige Option ist. In: Institut für Forstökonomie 2012, ife.uni-freiburg.de Paech N, Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. In: oekom 2012. Paech N, Suffizienz und Subsistenz: Therapievorschläge zur Überwindung der Wachstumsdiktatur. In: oekom 2013, konzeptwerk-neue-oekonomie.org Ellrott T et al., Innovatives Planetary Health Konzept. In: VFED 2023.
Rosenau N et al., University Students as Change Agents for Health and Sustainability – A Pilot Study on the Effects of a Teaching Kitchen-Based Planetary Health Diet Curriculum. In: Nutrients 2024, 16, 521.
INFO
Das „Planetary-Health-Konzept”
� Die EAT-Lancet-Kommission hat eine Strategie für Landwirtschaft und Ernährung erarbeitet, die die Gesundheit der Menschen und der Erde gleichermaßen schützen soll.
� Orientiert an Flexitarier:innen: Um die „Grenzen des Planeten“ nicht zu überschreiten, soll der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen in etwa verdoppelt und der Verzehr von Fleisch und Zucker halbiert werden.
� Neben der veränderten Ernährungsweise muss die Lebensmittelproduktion verbessert und Lebensmittelabfälle stark reduziert werden.
� Gemäß dem Report ist es auf diese Weise machbar, bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen auf der Erde gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören.
Quelle: eatforum.org
Hausärzt:in dossier 15 Juni 2024
<

Die neue Norm in der Diätologie
In Österreich soll eine ICF-Klassifikation implementiert werden

GASTAUTORIN:
Dr.in Gabriele Gäbler, MSc
DIAETOLOGIE
AUSTRIA, Verband der Diaetolog*innen Österreichs, Ressort Wissenschaft, Forschung und Entwicklung Hausärzt:in
Der Nachweis der Wirksamkeit von Interventionen und damit die OutcomesEvaluation und Forschung aufgrund von Routinedaten (Real-Life-Setting) gewinnen im Gesundheitswesen immer mehr an Bedeutung.1,2 Einerseits können solche routinemäßig erhobenen Daten zum Beantworten von konkreten Fragestellungen, andererseits fürs Benchmarking und Entwickeln von Best-PracticeModellen herangezogen werden.3 Dafür muss jedoch die Vergleichbarkeit dieser Gesundheitsdaten gegeben sein.4 Die Verwendung eines standardisierten Prozesses und einer standardisierten Terminologie für die Dokumentation verbessert die Vergleichbarkeit der gesammelten Daten.5,6
Hauptklassifikationen der WHO
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte die „I nternational Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) als Mehrzweckklassifikation für unterschiedliche Disziplinen, mit dem Ziel, eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes und dessen Kontextfaktoren zur Verfügung zu stellen.7 Als solche soll sie in Kombination mit der „International Classification of Diseases“ (ICD) verwendet werden.8 Für die Klassifikation von Interventionen im Ge-
sundheitswesen ist eine dritte Hauptklassifikation der WHO, die „I nternational Classification of Health Interventions“ (ICHI), vorgesehen.9 Diese wurde entwickelt, um die Situation der Patient:innen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfassen und die wichtigsten Bereiche des Gesundheitssystems abzudecken.10 Besagte Klassifikationen dienen als Referenzsystem zur Unterstützung der klinischen Praxis und des Datensammelns auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, auf individueller (Mikro-), institutioneller (Meso-) und sozialer (Makro-)Ebene.11 Die ICF kann von unterschiedlichen Gesundheitsberufen wie Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen und Logopäd:innen zur Dokumentation des therapeutischen Prozesses eingesetzt werden. Diätolog:innen, die auch einem gesetzlich anerkannten Gesundheitsberuf angehören, der zur Gruppe der gehobenen medizinisch-technischen Dienste in Österreich12 gehört, verwendeten die ICF bis dato nicht, da diese kaum relevante Begrifflichkeiten enthielt und somit für die Dokumentation des diätologischen Prozesses unzureichend war.13
Vielschichtige Implementierungsstrategie
In den Niederlanden wurde vom Verband der niederländischen Diätolog:in-
nen (NVD; engl. „ Dutch Association of Dietitians“) in Zusammenarbeit mit dem Dutch Institute of Allied Health Care die ICF um spezifische diätologische Kategorien (ca. 900) erweitert.14 Im Rahmen eines Dissertationsprojektes wurde die ICF-Diätetik als deutsche Übersetzung für Österreich validiert.15 Eine multizentrische Studie13 und eine Fokusgruppenstudie16 zeigten, dass die Integration der ICF-Diätetik in den diätologischen Prozess möglich ist und eine österreichweite Implementierung der ICF-Diätetik positiv bewertet wird. Für die Umsetzung braucht es jedoch eine vielschichtige Implementierungsstrategie.16
Der Verband der Diaetolog*innen Österreichs verfolgt seit 2018 eine solche mehrschichtige Strategie, um die ICFDiätetik als ersten Teil einer diätologischen Fachsprache zu implementieren. Das Implementierungsziel ist die Anwendung der ICF-Diätetik zur Dokumentation und Evaluierung. Die Strategie sieht eine Umsetzung der Implementierung in zwei Phasen vor.
Erste Phase: Qualitätsoptimierung
In der ersten Phase ging es vor allem darum, die Qualität der ICF-Diätetik zu optimieren und die äußeren Rahmenbedingungen für die Implementierung zu
16 Juni 2024
© privat
dossier
„Eine standardisierte Sprache wird unerlässlich sein, einerseits für die Qualitätssicherung, andererseits für den Nachweis der Wirksamkeit von Interventionen.“

schaffen. Es wurde der diätologische Prozess als Qualitätsstandard neu beschrieben.17 Er gilt seither als Grundlage für das einheitliche methodische Handeln in der diätologischen Praxis. Außerdem wurden der Qualitätsstandard und die ICF-Diätetik in die Lehre aller Fachhochschulen in Österreich aufgenommen und es werden regelmäßig Seminare und Workshops zum Thema angeboten.
Zweite Phase:
Forcieren und Unterstützen
Die zweite Phase der Strategie umfasst das Forcieren und das Unterstützen des eigentlichen Implementierungsprozesses in den einzelnen Gesundheitseinrichtungen und den freiberuflichen Praxen. Eine wichtige Rahmenbedingung für diese Implementierung ist, dass sie im Rahmen des Qualitätsmanagements als Führungsaufgabe gut geplant durchgeführt wird.
Herausforderungen und Perspektiven
Der Status quo der Implementierung – sowohl des diätologischen Prozesses als auch der ICF-Diätetik – wurde 2023 durch eine österreichweite Umfrage unter Diätolog:innen evaluiert. Diese ergab für den diätologischen Prozess zu über 60 % eine hohe oder sehr hohe Implementierung. Im Unterschied dazu
weist die ICF-Diätetik nur zu 24 % eine hohe oder sehr hohe und zu 31 % noch keine Implementierung auf.18 Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da die zweite Phase der Implementierungsstrategie offiziell erst im April 2024 startete – nach Abschluss eines internationalen ICF-DiätetikUpdate-Prozesses. Als Ergebnis des Updates liegt die einheitliche deutsche ICF-Diätetik 4.0 vor. Eine erfolgreiche Implementierung dieser standardisierten diätologischen Terminologie erfordert ihre Integration in die elektronischen Informationssysteme. Dafür benötigt es noch geeignete Lösungen.
Die ICD für medizinische Diagnosen ist bereits im Gesundheitssystem elektronisch integriert. Die allgemeine Verwendung aller WHOKlassifikationen zur Dokumentation (neben der ICD auch der ICF und der ICHI) würde nicht nur die
interprofessionelle Zusammenarbeit fördern, sondern auch eine Grundlage für gemeinsame Outcomes-Evaluationen und gemeinsames Forschen schaffen. Das alles hat zum Ziel, sowohl die Qualität der Behandlung als auch die Therapieergebnisse der Patient:innen zu optimieren.
Referenzen:
1 Porter ME et al., N Engl J Med, 2016;374(6):504-6.
2 Vanherle K et al., Clin Nutr, 2018; 37(6 Pt A):2206-16.
3 Hiesmayr M et al., PLoS One, 2015;10(5):e0127316.
4 Guidelines on Minimum/Non- Exhaustive Patient Summary Dataset for Electronic Exchange In Accordance with the Cross-Border Directive 2011/24/EU.
5 Swan WI et al., J Acad Nutr Diet, 2017;117(12): 2003-14.
6 Vreeman DJ, Richoz C. Physiother Res Int, 2015;20(4):210-9.
7 WHO, ICF 2005.
8 Escorpizo R et al., BMC Public Health, 2013;13:742.
9 Donada M et al., Stud Health Technol Inform, 2018;247:895-9.
10 World Health Organization Family of International Classifications: definition, scope and purpose. 2007.
11 Stucki G, Bickenbach J. Eur J Phys Rehabil Med, 2017;53(1):139-43.
12 BGBI. Nr. 460/1992. MTD-Gesetz.
13 Gäbler G et al., Clin Nutr, 2019;38(2):791-9.
14 Gäbler G et al., J Acad Nutr Diet, 2018;118(1): 13-20.e13.
15 Gäbler G, MedUni Wien, 2018. resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubmuw:1-21174
16 Gäbler G et al., BMC Health Serv Res, 2019. doi: 10.1186/s12913-019-4600-5
17 Gäbler G, Hofbauer A (Hrsg.), Der Diaetologische Prozess. 2020.
18 Domnanich S, Med Uni Graz, 2023. abrufbar unter: tinyurl.com/2p8epr9r
Bezirk Mödling
Praxisübernahme mit modernem Praxisgebäude und eleganter Villa zum Wohnen im Süden von Wien.

Übergeben wird eine lukrative Wahlarztpraxis mit großem Patientenstamm mit den Schwerpunkten Bewegungsapparat, ganzheitliche Allgemein- und Sportmedizin.
Modernes Praxisgebäude und elegante Villa in exquisiter Ausstattung inkl. großem Wellnessbereich und Indoorpool.
Praxis: € auf Anfrage
Gebäude: € 2,300.000,- (die beiden Gebäude stehen auch separat zum Verkauf/Praxisübernahme nicht zwingend)
Für detaillierte Informationen freuen wir uns auf Ihre geschätzte Kontaktaufnahme unter: klebl@klebl-immobilien.at oder +43 664
500 71 02, Frau Klebl.

Hausärzt:in dossier
© shutterstock.com/Shutter.B
< <
BEZAHLTE ANZEIGE
Hausärzt:in
Gendermedizin: Warum brauchen wir das?
Frauen und Männer unterscheiden sich in puncto Ernährung voneinander, aber: Ist der Umgang mit dem eigenen Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?

GASTAUTORIN:
Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner
Ausbildungsbeauftragte der ÖÄK
Gendermedizin untersucht Geschlechtsunterschiede. Sie hat sich aus Frauengesundheit und Männergesundheit entwickelt und wurde um den Bereich Diversity erweitert. Die Hauptgruppen sind neben Geschlecht, Alter, sexueller und religiöser Orientierung auch Ethnie, Kultur sowie Behinderung und chronische Erkrankungen. Gendermedizin heißt, dass alle medizinischen Angebote darauf geprüft werden, ob sie den einzelnen Diversitygruppen entsprechen.
Frauen wurden anfangs einfach ausgeblendet
Die ersten Themen innerhalb der Gendermedizin waren Medikamente und das Herz. Am Anfang der Frauengesundheitsbewegung stand der Kampf um die Testung der Medikamente auch an und für Frauen. Davor wurden Medikamente entweder wie bei der „Physicians Study“ nur an Männern getestet, oder jedenfalls hauptsächlich an Männern, und alle Daten zusammen ausgewertet. Dies wurde zwischenzeitlich durch eine Änderung der Zulassungsbestimmungen gesetzlich geregelt. Als Resultat müssen Hersteller der Zulassungsbehörde für alle neuen Medikamente Tests an Frauen und Männern sowie getrennte Auswertungen vorlegen. Bezüglich der Chancenungleichheit beim Zugang zur Kardiologie zeigten zahlreiche Studien eine Unterversorgung von Frauen auf, auch bekannt als Yentl-Syndrom. Es wurden viele Awarenessaktionen wie der Frauenherztag „Go Red“ mit Unterstützung der Medien durchgeführt.
„Die typische Frau“ gibt es nicht
Trotz dieser Erfolge zeigte sich, dass Gendermedizin eine Querschnittsmaterie ist. Das heißt: Alle medizinischen Angebote sind auf Unterschiede zu untersuchen und bei Bedarf verschiedene Angebote für alle Gruppen zu erarbeiten. Das klingt sehr aufwändig, ist aber notwendig, da es nicht „die Frau“ gibt. Frauen können ein Alter von 18 bis 98, ein Gewicht von 45 kg bis 145 kg haben etc. Eine pauschale Dosierungsempfehlung wie 1 x 1 Tablette ist inakzeptabel. Menschen unterscheiden sich und brauchen deshalb auch individuelle medizinische Angebote. Groß war anfangs das Echo auf die sogenannte Personalisierte Medizin, was den Wunsch nach maßgeschneiderten medizinischen Angeboten für jede einzelne Person aufkommen ließ.
Quantitativ vor qualitativ in der Medizinforschung
Ein Problem ergibt sich durch ein Gebot, wonach alle Angebote evidenzbasiert zu sein haben. Der Goldstandard ist prospektiv, multizentrisch und doppelblind. Inzwischen liegen zu einzelnen Fachgebieten unterschiedlich viele wissenschaftliche Arbeiten vor, die meisten wohl zu Geschlechtsunterschieden in der Kardiologie. Bei den Diversitygruppen gibt es als größtes Problem die Fallzahl. Die Medizinforschung arbeitete hauptsächlich quantitativ – mit großen Fallzahlen und genauer Statistik. Viele der Diversitygruppen, besonders die sexuelle Orientierung betreffend, sind zahlenmäßig klein. Dazu kommt, dass nur Geschlecht und Alter in den Krankengeschichten dokumentiert sind. Selbstverständlich gibt es qualitative Forschungsansätze, aber die Drittmittel sowie die Publikationsmöglichkeiten in Fachzeitschriften sind auf quantitative Forschung ausgerichtet.
NACHBERICHT

Auch Männer können benachteiligt sein
Frauengesundheit und in der Folge auch Männergesundheit hatten folgende Frage(n) als Hauptthema: „Gibt es Defizite beim medizinischen Angebot für ein Geschlecht?“ und „Was wird zusätzlich gebraucht?“ Es war schon lange bekannt, dass Krankheiten zu einem unterschiedlichen Prozentsatz mit verschiedenen Symptomen, Behandlungserfolgen und unterschiedlicher Mortalität auftreten. Gendermedizin untersucht die Ursachen und hofft, dadurch für das benachteiligte Geschlecht, und das sind je nach Krankheit sowohl Frauen als auch Männer, neue Ansätze für Prävention, Therapie oder Rehabilitation entwickeln zu können. Die Frage bleibt: Was sind die größten Geschlechtsunterschiede? Eine Antwort wäre die unterschiedliche Lebenserwartung von Frauen und Männern weltweit. Mittlerweile weiß man, dass sogar bei Tieren die Lebensspanne von Weibchen
Die Gastautorin war Vortragende beim 41. Ernährungskongress des Verbands der Diaetolog*innen Österreichs am 14. und 15. März 2024 in Wien.
18 Juni 2024 © shutterstock.com/AI © privat
dossier
und Männchen variiert. Das menschliche Immunsystem unterscheidet sich bei Frauen und Männern zwar kaum, aber die Hormone beeinflussen es stark. Das führt dazu, dass Frauen über ein „stärkeres“ Immunsystem verfügen und Infektionen sowie Tumorerkrankungen meist besser bewältigen, allerdings häufiger an Autoimmunerkrankungen, Allergien wie auch Unverträglichkeiten leiden und oft über Nebenwirkungen von Medikamenten berichten, was die Compliance massiv reduziert.
Ist das Gewicht der größte Geschlechtsunterschied?
Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Woran zeigt sich in der Praxis der größte Geschlechtsunterschied? Was wird fast bei jedem Ärzt:innengespräch thematisiert? Die Antwort lautet: das Gewicht. Es ist nicht so, dass Männer Idealgewicht und Frauen Übergewicht haben. Statistik Austria zeigt regelmäßig auf, dass mehr Männer übergewichtig sind als Frauen. Aber der Umgang mit dem Gewicht unterscheidet sich massiv. Fast alle Frauen planen permanent, ihr Gewicht zu reduzieren und Abmagerungskuren zu machen – meist allerdings ohne Erfolg, zumindest ohne dauerhaften. Sie kämpfen ständig und erleben ein wiederholtes Scheitern. Häufige Aussagen unserer Patientinnen sind: „Ich nehme schon vom Rezeptelesen zu“, „Ich esse nie das Abendessen, ich muss es nur für die Familie vorkosten“, „Ich kann keine Tabletten nehmen, davon nehme ich zu“ usw. Männer sind da viel gelassener und planen viel seltener Abmagerungskuren – meist nur aus ernsten medizinischen Gründen wie etwa nach einem Herzinfarkt oder weil eine – meist orthopädische – Operation ans Abnehmen geknüpft wird.
Unterschied zwischen Geschlechtern größer als zwischen
Jung und Alt
Ein Grund ist das Aussehen, das Frauen fast immer zu „Verbesserungen“ und häufig auch zum Abnehmen motiviert. Männer zeigen diesbezüglich viel mehr Selbstsicherheit. Dieser unterschiedliche Umgang mit dem Gewicht spiegelt sich auch in den Essgewohnheiten wider. Mehr Frauen als Männer ernähren sich vegan oder vegetarisch und achten auf eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Bei Essstörungen und Untergewicht überwiegen laut Statistik Austria die Frauen. Bei den Jüngeren zeigen sich erst geringe Angleichungen, was Essstörungen sowie veganes und vegetarisches Essen betrifft. Das gilt auch für ästhetische Maßnahmen wie Kosmetikagebrauch oder kleinästhetische Eingriffe, beispielsweise eine Laserbehandlung. Die ästhetisch-plastischen Eingriffe dominieren nach wie vor bei Frauen.
Zusammenfassend ist Gendermedizin notwendig, um Daten für alle – Frauen und Männer sowie sämtliche Diversitygruppen – zu erhalten. Darauf aufbauend, also „evidence-based“, können somit jeder einzelnen Person bessere medizinische Maßnahmen angeboten werden. <

1
2 3
EINFACH ZU SCHULEN einfach für Ihre Patienten – einfach für Sie
EINFACHE HANDHABUNG dank intuitiver Funktionen
EINFACH ZUVERLÄSSIG durch Überprüfung auf über 200 Störsubstanzen1
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2024 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3 1. Accu-Chek Instant System Evaluation. Roche Diabetes Care. 2020.
EINFACH MESSEN EINFACH INSTANT
JETZT BESTELLEN UNTER 01/277 27-355
„Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen“
Expert:innen warnen vor alarmierender Unterversorgung bei Schmerzbehandlung*

Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld zum 30. Kongress der Österreichischen Schmerzgesellschaft wurde die aktuelle Situation in Bezug auf Schmerzmittel in Österreich beleuchtet, die laut den anwesenden Expert:innen alarmierend sei, etwa infolge einer Unterversorgung mit Analgetika. Aus diesem Grund fordern die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) sowie die Österreichische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR), dass Schmerzmittel kontinuierlich und regelmäßig verfügbar sein müssen.
Thematisiert wurde auch das Medikament Pregabalin, das unlängst in den Medien in Verruf geraten sei und als „gefährlich“ sowie vermeintlich „tödlich“ bezeichnet wurde. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Leiter der Sektion Schmerz der ÖGARI, stellte diesbezüglich klar: „ P regabalin gehört zu den Antikonvulsiva und wird oft zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, Fibromyalgiesyndromen und anderen chronischen Schmerzzuständen eingesetzt“, erklärte der Experte. „ A ktuelle Medienberichte sind zu hinterfragen, da in den vorliegenden Berichten weder demographische Daten noch Begleiterkrankungen erhoben wurden.“
Laut Prof. Likar wäre ein Verzicht auf Pregabalin „fatal“, da es eine wichtige
Rolle im Schmerzmanagement einnehme: „ Neben der schmerzhemmenden Wirkung ist es auch angstlösend und verbessert die Schlafqualität. Zwei wichtige Eigenschaften, um die Lebensqualität chronischer Schmerzpatient:innen zu verbessern.“
Auch OÄ Dr.in Waltraud Stromer, PastPräsidentin der ÖSG, sprach über die Herausforderungen in der Versorgung mit Analgetika, ohne die keine leitlinienkonforme Schmerztherapie möglich wäre. „ Dieser Mangel führt dazu, dass wir uns immer öfter von den leitlinienkonformen Standardtherapien entfernen müssen“, beklagte die Expertin. „ Es geht hier nicht nur um die Linderung von Schmerzen, sondern um die Wahrung der menschlichen Würde und das Recht auf eine qualitativ hochwertige Versorgung.“
Unerträglicher Leidensdruck
Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Präsident Elect der ÖGPMR sowie der ÖSG, hob ebenfalls die Notwendigkeit einer suffizienten Schmerztherapie hervor: „Ohne angemessene Schmerzlinderung können Patient:innen Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bewältigen, ihren Beruf auszuüben und normale tägliche Aktivitäten auszuführen “ Mögliche Folgen wären Stress, Angstzustände, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken, mahnte der Experte.
Außerdem könne ein plötzlicher Mangel an Schmerzmitteln den Leidensdruck unerträglich machen und Entzugserscheinungen auslösen, die eine Reihe unangenehmer Symptome zur Folge haben könnten wie Übelkeit, Schlafstörungen, Angstzustände sowie ernsthafte gesundheitliche Komplikationen. „ Eine adäquate Schmerzbehandlung bedingt eine adäquate Versorgung mit Schmerzmitteln“, betonte Prof. Crevenna. Es sei wichtig, dass die Patient:innen am beruflichen sowie sozialen Leben und an Freizeitaktivitäten teilnehmen könnten, aber dafür müssten sie schmerzfrei sein. Andernfalls käme es zu einer Dekonditionierung und einer Rückzugsspirale, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen könnten.
Ao. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Eisner, ÖSG-Präsident und Präsident des 30. Schmerzkongresses, erläuterte, dass die Coronapandemie die vorhandenen Defizite bezüglich der Lieferprobleme und der Verlagerung der Medikamentenproduktion aus Europa nach China und Indien aufgezeigt hätte. „I n Anbetracht des anhaltenden Mangels an wichtigen Opioiden und der sich verschärfenden Versorgungssituation müssen wir auf nationaler Ebene strategische Lösungen entwickeln“, forderte Prof. Eisner. „ Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium, dem Hauptverband und den Sozialversicherungen ist dabei unerlässlich.“
20 Juni 2024 Hausärzt:in medizinisch
© shutterstock.com/funnyangel
Österreich unter den Schlusslichtern
Prof. Likar ging auf die Problematik ein, dass es sich für die Pharmakonzerne aufgrund der auf dem Markt vorhandenen Generika nicht mehr rentiere, ihre Produkte in Österreich zu verkaufen. Anders sehe die Situation etwa in Deutschland aus, wo es keinen Medikamentenmangel gebe, da das Nachbarland den Herstellern mehr bezahle. Österreich sei hinsichtlich der finanziellen Ausgaben für Medikamente unter den Schlusslichtern. „L eistung muss auch einen Preis und einen Wert haben dürfen“, brachte es Prof. Eisner auf den Punkt. „Wir können nicht Ramschmedikamente verabreichen. Dann höre ich auf als Arzt zu arbeiten.“
„Die Industrie hat bereits reagiert und einiges an Produktion nach Europa zurückgebracht“, zeigte sich Prof. Eisner zuversichtlich. Laut den Expert:innen seien jedoch langfristige Lösungen und nachhaltige Systemänderungen notwendig, um eine kontinuierliche und sichere
Medikamentenversorgung gewährleisten zu können. Die Expert:innen richteten ihren Appell an die österreichische Politik, vor allem auch an den Hauptverband und die Sozialversicherungsträger, die hier dringend handeln und die Versorgungssicherheit sowie die regelmäßige Lieferung notwendiger Medikamente vor wirtschaftliche Interessen stellen müssten. Nur so könne die Lebensqualität der Patient:innen sichergestellt werden.
Ohne Originalpräparat müsse ein Ersatzmedikament verabreicht werden, das u. U. aufgrund einer anderen Dosierung eine andere Wirkung bzw. Wirkungsdauer hätte. Das könne zu massiven Problemen und Komplikationen führen. Als Beispiele nannte OÄ Stromer die transdermalen Pflaster oder diejenigen Analgetika, die bei einer Trigeminusneuralgie zur Anwendung kämen. „ Sind diese Medikamente nicht lieferbar, müssen wir rotieren“, so OÄ Stromer. „ Der Patient ist in dieser Phase gefährdet, diesen horrenden Schmerz wieder zu erleiden.“
Hausärzt:in
„Dieser Mangel führt dazu, dass wir uns immer öfter von den leitlinienkonformen Standardtherapien entfernen müssen.“
OÄ Dr.in Waltraud Stromer
Abschließend hob Prof. Likar das Fortbildungsangebot in Österreich hervor, das ausgebaut wurde und mittlerweile neben Schmerzdiplomkursen sowie einer digitalen Fortbildungsreihe („ Pain Updates“) auch ein Schmerzzertifikat umfasst. „Wenn wir eine bessere Ausbildung haben, haben wir eine bessere Versorgung“, schlussfolgerte der Experte.
PA/JuF
* PK „Schmerzmittel müssen kontinuierlich verfügbar sein“, am 5.6.2024 im Vorfeld des 30. Wissenschaftlichen Kongresses der Österreichischen Schmerzgesellschaft, vom 6.-8.6.2024 im Congress Center Villach.
medizinisch
„Das eigene Risiko kennen“
Vorhofflimmern und Hypercholesterinämien als stille Gefahren, die sich aber mit guter (Primär-)Prävention in den Griff bekommen lassen

Prim.a Dr.in Anna Rab, Leiterin der Abteilung für Innere Medizin I mit Schwerpunkt Kardiologie, Nephrologie und Notfallmedizin, Kardinal Schwarzenberg Klinikum, und Privatordination in Klagenfurt, im Interview.
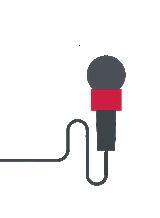

Hausärzt:in medizinisch 22 Juni 2024 © shutterstock.com/CalypsoArt
© privat
Quellen:
1 Statistik Austria, 2022; Sterblichkeit nach Todesursachen seit 1980.
2 Lima CEB et al., Ann Noninvasive Electrocardiol 2016; 21(3): 246-255.
3 Hindricks G et al., Eur Heart J 2021; 42(5): 373-498.
4 Rizas KD et al., Nat Med 2022; 28(9): 1823-1830.
5 Werhahn SM et al., ESC Heart Fail 2022; 9(1): 100-109.
6 Manrique-Acevedo C et al., Int J Obes (Lond) 2020; 44(6): 1210-1226.
7 Newman W et al., Br J Sports Med 2021; 55(21): 1233-1238.
8 Czypionka T et al., Institut für Höhere Studien: Research Report 2022.
9 heartscore.org
10 Mach F et al., Eur Heart J 2020;41(1): 111-188.
11 Mancia G et al., 2023; ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.
12 Jug B et al., Wien Klin Wochenschr 2009; 121: 700-706.
13 SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration, Eur Heart J 2021; 42(25): 2439-2454.
14 SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration, Eur Heart J 2021; 42(25): 2455-2467.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
NT-proBNP ist laut einer Studie sowohl bei Patient:innen mit VHF und struktureller Herzkrankheit (im Median 1.944 vs. 1.390 pg/ml) als auch bei jenen mit VHF, aber ohne eine solche Herzkrankheit (im Median 1.093 vs. 172 pg/ml) erhöht. VHF fungiert als unabhängige Determinante erhöhter
NT-proBNP-Werte.12
• SCORE2 und SCORE2-Older People (OP), welcher auch die Altersgruppen von 70 bis 89 Jahren abdeckt, eignen sich gut zur approximativen Einschätzung des individuellen Risikos, kardiovaskuläre Events zu erleiden.13,14
• Für Österreich gilt mit 100 bis < 150 kardiovaskulären Todesfällen pro 100.000
Einwohner:innen ein moderates Risiko als Ausgangsbasis für die Berechnungen, die hier vorgenommen werden können: heartscore.org13,14
Risikoregionen
Niedriges Risiko
Moderates Risiko
Hohes Risiko
Sehr hohes Risiko
Einteilung in 4 Risikoregionen nach standardisierter kardiovaskulärer Mortalität13


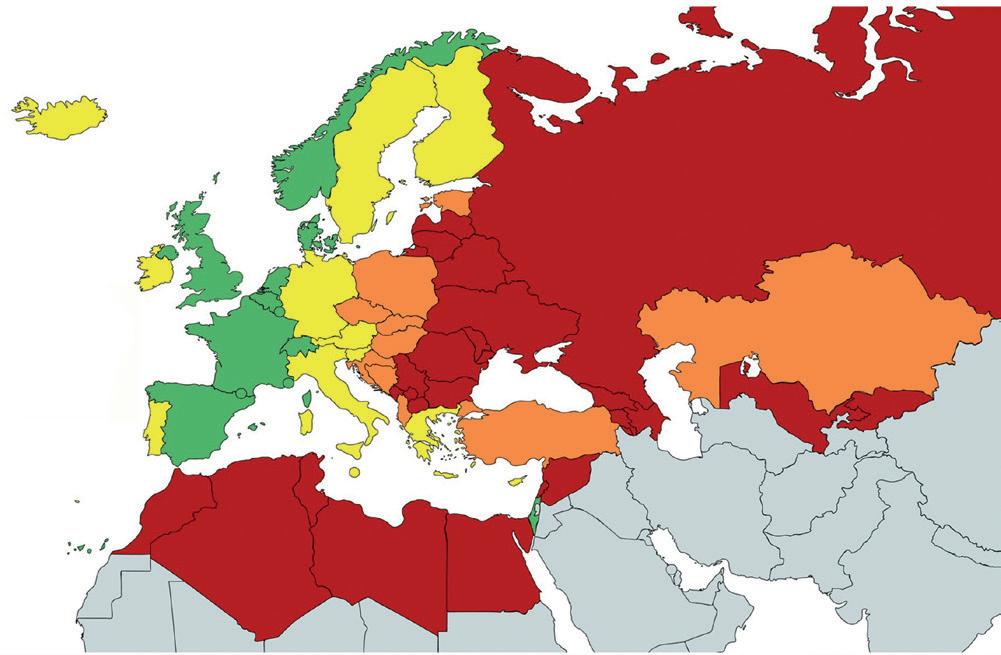
Hausärzt:in medizinisch 23 Juni 2024
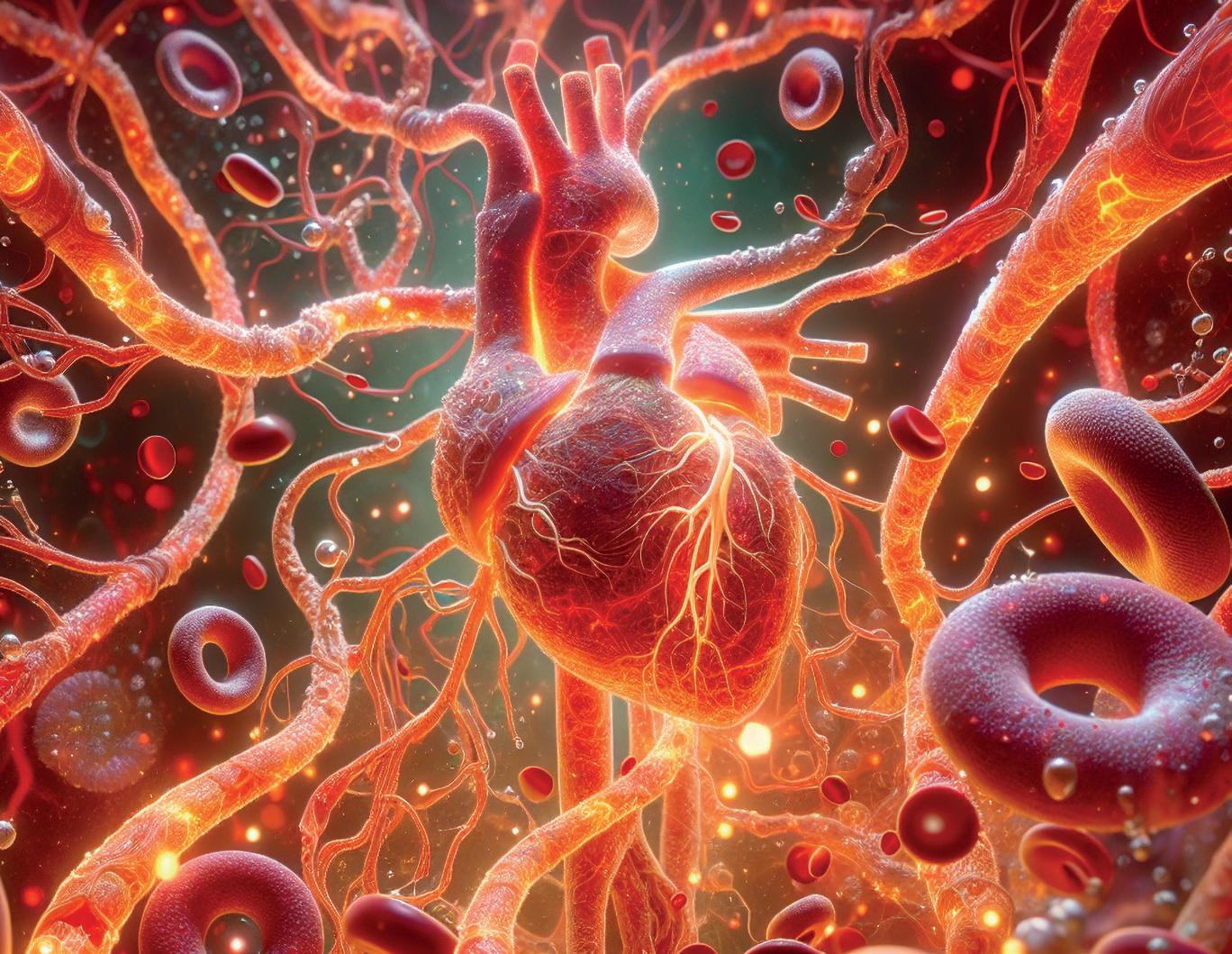
Die steigenden Temperaturen infolge des Klimawandels machen vor allem Menschen mit Gefäßerkrankungen zu schaffen und wahrscheinlich wird die Anzahl der Betroffenen durch die Hitze zukünftig wachsen. Weiters sind Temperaturschwankungen mit einer erhöhten kardiovaskulären Erkrankungsschwere und Mortalität verbunden. Hinzu kommt, dass viele dieser Patient:innen bereits unter Vorerkrankungen leiden, die ihre Wärmeregulation beeinträchtigen. Fortgeschrittenes Alter, Medikamente und geringere Mobilität, welche es erschweren, an kühlere Orte zu gelangen, könnten dies verstärken. Die Folgen sind oft gravierend: Sie reichen von Bewusstseinsstörungen bis hin zu Herzrhythmusstörungen und Synkopen. Überdies werden Bypass- und Gefäßverschlüsse bei Betroffenen wahrscheinlicher.
Harmlose und gefährliche Beinödeme
Ein nicht seltenes Problem im Sommer stellen, vor allem für Frauen, Beinödeme dar. Bei Hitze sind diese meist darauf zurückzuführen, dass die Gefäße dilatieren, das Blut langsamer zirkuliert und die Venen durchlässiger werden, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Bei länger andauernden, plötzlichen oder einseitigen Schwellungen müssen andere Ursachen wie eine allgemeine
Überwässerung, etwa durch eine Herzbzw. Niereninsuffizienz oder einen Eiweißmangel, ausgeschlossen werden. Eine einseitige, schmerzhafte Beinschwellung kann auf eine Thrombose hinweisen, was rasches Handeln erfordert. Oftmals steckt hinter den Ödemen jedoch lediglich Bewegungsmangel.
Hitze und Tod
Sowohl österreich- als auch weltweit wird sichtbar, dass hohe Temperaturen nicht nur zu gefahrlosen Ödemen und lästigen Varizen führen. Im Jahr 2023 war die Woche mit den meisten Sterbefällen in Österreich im August und oft fiel Hitze mit einer steigenden Mortalität zusammen.1 Laut einer Studie, die 750 Standorte in 43 Ländern miteinbezog, sind weltweit jährlich mehr als fünf Millionen Todesfälle auf Extremtemperaturen zurückzuführen.2 In erster Linie sind Patient:innen mit kardialen Vorerkrankungen wie arterieller Hypertonie, koronarer Herzerkrankung oder Schlaganfall vulnerabel. Hitze führt also nicht nur zu harmlosen Venenproblemen, sondern beeinflusst auch das arterielle System. Um ein Beispiel zu nennen: Die häufigste Schlaganfallform ist der ischämische Insult. Durch hohe Temperaturen kommt es besonders bei älteren Personen, die ohnehin oft wenig trinken, zu einer Dehydratation. Sie erhöht die Vis-
kosität des Blutes, wodurch das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls steigt.
Versorgungsstrukturen anpassen
Gäbe es die globale Erderwärmung nicht, wären all diese Probleme geringer. Laut der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. (DGG) braucht es, um den gesundheitlichen Risiken des Klimawandels zu begegnen, etwa eine Krankenhausreform: Notwendig seien Hitzeschutzpläne mit Handlungsempfehlungen z. B. für das sichere Erkennen von Risikopatient:innen, für eine kontrollierte Flüssigkeitszufuhr und für eine Anpassung der Medikation sowie die Einrichtung von Abkühlmöglichkeiten, so die Experten in einer Aussendung. Die meisten Kliniken und Praxen müssten sich auf die Veränderungen noch vorbereiten und bauliche Schritte setzen. Wie so oft gilt: Prophylaktische Vorkehrungen treffen, anstatt sich später den Folgen zu widmen. Das deutsche Gesundheitswesen ist laut den Experten für 5,2 Prozent der landesweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit bis zu 25 Prozent habe die Chirurgie einen relevanten Anteil am Ressourcenverbrauch der Kliniken. Durch das Angebot von Videosprechstunden, die die Anzahl der Autofahrten reduzierten, durch die Nutzung von wiederverwendbaren Produkten oder kleineren OP-Sets für weniger große Eingriffe sowie durch Mülltrennung könnte sich die CO2-Bilanz vieler Krankenhäuser verbessern. Weiters steuere eine Diät mit weniger Fett, Zucker, Fleisch und industriell verarbeiteten Lebensmitteln nicht nur der Erderwärmung entgegen, sondern wirke sich auch positiv auf Gefäßkrankheiten aus. Betroffene über die Vorteile für ihre Gesundheit sowie für das Klima aufzuklären, könnte deren Motivation für eine pflanzenbasierte Ernährung steigern.3 Wichtig seien eine gute Vorbereitung der Gefäßpatient:innen und die Begleitung beim Umgang mit den klimatischen Veränderungen.
Mara Sophie Anmasser Quellen:
1 Statistik Austria (2023).
2 Zhao Q et al., Lancet Planet Health. 2021 Jul;5(7): e415-e425.
3 klimawandel-gesundheit.de/planetary-health/ ernaehrung
Hausärzt:in medizinisch 24 Juni 2024
© shutterstock.com/AI
Verunreinigte Atherome
Epidemiologische
Studie zeigt: Durch Mikro- und Nanoplastik kann das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse steigen
„Während alle Augen auf die Klimakrise gerichtet waren, verschärfte sich die Plastikkrise heimtückisch“, macht der Epidemiologe Prof. Philip J. Landrigan, MD, MSc, Boston College, in einem Editorial aufmerksam.1 Plastikverschmutzung ist weltweit sogar in den entlegensten Winkeln anzutreffen – sie erstreckt sich von Bauernhöfen bis in Wüsten, von Berggipfeln bis in die Tiefsee, von den Tropen bis in die Arktis.² Im menschlichen Körper wurde Mikro- und Nanoplastik (MNP) bereits in zahlreichen Geweben nachgewiesen, z. B. in dem von Lunge, Plazenta, Darm, Leber, Milz und Lymphknoten.3,4 Vergangenes Jahr erfolgte auch ein Nachweis im Blut sowie im Herzen – einem Organ, das prinzipiell keine direkte Verbindung zur Umwelt hat.4
Eine im Frühjahr erschienene Ausgabe des New England Journal of Medicine beinhaltet nun eine Studie, die gezeigt hat, dass Mikro- und Nanoplastik mit unter in atherosklerotischen Läsionen der Blutgefäße enthalten ist. sei eine „bahnbrechende Entdeckun so Prof. Landrigan. Die Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf die menschliche Gesundheit waren bislang wenig untersucht. Mit der Publikation von Marfella et al. gebnisse einer epidemiologischen Stu die zur Verfügung, die aufzeigen, welche gesundheitlichen Folgen die zunehmen de MNP-Exposition haben könnte.
Erhöhte Entzündungsmarker
Die Forscher:innen von der Universität Kampanien „Luigi Vanvitel apel führten eine pros pektive, multizentrische Beobachtungsstudie mit Patient:innen durch, die aufgrund einer hoch gradigen, asymptoma tischen Karotisstenose einer Endarteriekto mie zugeführt wurden.
Insgesamt 304 Proband:innen konnten in die Studie eingeschlossen und 257 Personen über durchschnittlich 33,7 Monate nachbeobachtet werden. Die exzidierten Karotisplaques wurden auf elf verschiedene MNP untersucht.5
Bei 150 Patient:innen (58,4 %) ließ sich Polyethylen nachweisen, die mittlere Menge betrug 21,7 µg/mg Plaquegewebe. Polyvinylchlorid war bei 31 Patient:innen (12,1 %) messbar – in einer mittleren Menge von 5,2 µg/mg Plaquegewebe. Außerdem brachten elektronenmikroskopische Aufnahmen zutage, dass die MNP-Partikel nicht nur im amorphen Plaquematerial vorhanden waren, sondern auch innerhalb der Makrophagen. In Bezug auf die Entzündungsmarker IL-18, IL-1beta, IL-6 und TNF-alpha zeigte sich eine Korrelation zwischen ihrer Konzentration und der MNP-Menge in den Atheromen.5
Der primäre Endpunkt
FOKUS UMWELT MEDIZIN
Ein nichtletaler Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall oder Tod jeglicher Ursache trat im Nachbeobachtungszeitraum bei 7,5 % der Patient:innen ohne nachweisbares MNP auf, hingegen bei 20 % der Personen mit gemessenem MNP. Die adjustierte Hazard Ratio von 4,53 mit einem 95-%-Konfidenzintervall von 2,00 bis 10,27 ist signifikant (P < 0,001).
Laut den Autor:innen belegen die Studienergebnisse zwar keine Kausalität, jedoch zeigten sie ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei Personen mit MNP in Karotisplaques nach 34 Monaten Follow-up auf.5 Prof. Landrigan gibt zu bedenken, dass die aktuelle Untersuchung dringende Fragen aufwerfe, etwa: Sollte MNP-Exposition als kardiovaskulärer Risikofaktor betrachtet werden? Welche weiteren Organe könnten gefährdet sein? Wie können wir die Exposition reduzieren? Und was können Mediziner:innen und Vertreter:innen anderer Gesundheitsberufe tun? Dem Arzt und Epidemiologen zufolge besteht der erste Schritt darin, anzuerkennen, dass Kunststoffe potenziell erhebliche Risiken bergen. Patient:innen sollten ermutigt werden, ihren Plastikgebrauch zu reduzieren, insbesondere Einwegprodukte betreffend. Der eigene Verbrauch bzw. jener der eigenen Institution sei zu hinterfragen. Letztlich gelte es, das sich in Entwicklung befindliche „Global der Vereinten Nationen

 Anna Schuster, BSc
Anna Schuster, BSc
Landrigan PJ, N Engl J Med. 2024 Mar 7;390(10):948-950. MacLeod M et al., Science. 2021 Jul 2;373(6550):61-65. Landrigan PJ et al., Ann Glob Health. 2023 Mar 21;89(1):23. Yang Y et al., Environ Sci Technol. 2023 Aug 1;57(30):10911-10918. Marfella R et al., Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events NEngl J Med. 2024 Mar 7; 390(10):900-910.
Landrigan P et al., Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2274-2276.
Hausärzt:in medizinisch 26 Juni 2024
©
Hilfe bei Spastizität
Die Wahl der medikamentösen Therapie

EXPERTIN:
Univ.-Prof.in Dr.in
Michaela M. Pinter Leiterin des Departements für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Universität für Weiterbildung Krems
„Die Behandlung einer Spastizität nach Schlaganfall ist abhängig von der Läsionshöhe – zerebral oder spinal – und von der Verteilung der Spastizität über den Körper: fokal, multifokal, segmental und generalisiert“, hält Univ.-Prof.in Dr.in Michaela M. Pinter, Leiterin des Departements für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Universität für Weiterbildung Krems, fest. Eine individuelle NutzenRisiko-Abwägung sei bei der Wahl der medikamentösen Therapie zwingend notwendig.
In den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) von 2023* werden zentral wirksame antispastische Medikamente wie Baclofen, Tizanidin, Tolperison, Clonazepam sowie THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) nur dann empfohlen, wenn physikalische Maßnahmen zu keiner suffizienten Kontrolle der Spastizität führen. Limitierend bei diesen Substanzen sind die systemischen Nebenwirkungen wie Sedierung, Antriebsverminderung, Ver schlechterung kognitiver Defizite und Schwächung funktionell relevanter Muskeln. „ I nsofern werden die oralen Antispastika, auch als Kombinationsbehandlung, bei generalisierter spastischer Tonuserhöhung mit dem Therapieziel eingesetzt, einschießende Spasmen zu reduzieren, die aktiv-passive Mobilisierung zu verbessern und
die Pflege der Betroffenen zu erleichtern“, weiß Prof.in Pinter.
BoNT A als Leitlinienempfehlung
Die Behandlung mit Botulinumtoxin A (BoNT A) wird laut DGN-Leitlinien bei fokaler, multifokaler und segmentaler spastischer Tonuserhöhung empfohlen, wenn eine funktions- oder alltagsrelevante spastische Bewegungsstörung vorliegt bzw. wenn die spastische Tonuserhöhung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sekundärkomplikationen wie Kontrakturen führt. „Vor einer Behandlung mit BoNT A sind mit den Betroffenen und deren Angehörigen sowohl aktive als auch passive Therapieziele klar und nachvollziehbar zu definieren, um falsche bzw. zu hohe Erwartungen und daraus resultierende Enttäuschungen zu vermeiden“, gibt die Expertin zu bedenken.
* Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:





DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
� Der angeführte Behandlungs-Algorithmus – bei fokaler bis segmentaler Spastizität ist BoNT A indiziert, bei generalisierter Spastizität sind oral bzw. intrathekal applizierte antispastische Medikamente zu erwägen – sollte in der therapeutischen Strategiefindung berücksichtigt werden.
- Laut den DGN-Leitlinien ist die Behandlung mit BoNT A aufgrund eines besseren Nutzen-Risiken-Verhältnisses der Therapie mit oraler antispastischer Medikation vorzuziehen.
- Durch gezielte Applikation von BoNT A werden die Spastizität und die damit einhergehenden Schmerzen reduziert und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert.














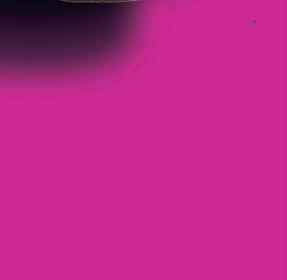
Indiziert ist BoNT A im Bereich der oberen Extremität bei adduzierter, innenrotierter Schulter, bei flektiertem Ellbogen, bei proniertem Unterarm, bei flektiertem Handgelenk und beim spastischen Faustschluss; im Bereich der unteren Extremität bei Hüftbeugerspastik, Adduktorenspastik, flektiertem Kniegelenk, Spitzfuß und spastischen Zehenkrallen. „ Neben der Identifikation der im spastischen Bewegungsmuster involvierten Muskeln und der adäquaten BoNT A Dosis, ist die gezielte anatomische Lokalisation der zu injizierenden Muskeln mit Elektromyographie (EMG), Stimulationskontrolle oder Ultraschall für einen optimalen Behandlungserfolg essenziell“, erklärt Prof.in Pinter. Wichtig sei, die Höchstdosis nicht zu überschreiten, da sonst systemische Nebenwirkungen, wie eine generalisierte Schwäche auch nicht injizierter Muskeln, auftreten können. „ A lternativ kann die intrathekale Gabe von Baclofen – durchaus in Kombination mit BoNT A – in Erwägung gezogen werden.“
KaM Hausärzt:in medizinisch 27 Juni 2024
Mangione
Rheuma betrifft mehr als nur die Gelenke
Die Mortalitätsrate liegt, je nach Erkrankung, um 25 bis 325(!) Prozent über jener einer Vergleichspopulation1
Im Vorfeld der Jahrestagung der europäischen Rheumatologie-Gesellschaft (EULAR) vom 12. bis 15. Juni in Wien, lud die Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR) zu einer Pressekonferenz ins Café Landtmann.* „R heuma ist nicht nur eine Gelenkerkrankung älterer Menschen, sondern ein Überbegriff für über 400 verschiedene Diagnosen und kann in jedem Lebensalter auftreten“, hob Assoc.-Prof.in Dr.in Helga LechnerRadner von der Abteilung für Rheumatologie am AKH Wien einleitend hervor. „Der Erkrankungsbeginn vieler entzündlich rheumatischen Erkrankungen liegt im jungen Erwachsenenalter“, führte die Leiterin der Sektion Wissenschaft der ÖGR weiter aus.
„Burden of disease“
Je nach Art kann die entzündliche Systemerkrankung lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge oder Niere betreffen und diese auch irreversibel zerstören. Darüber hinaus kommt es durch den chronischen Entzündungsprozess mitunter zu weitreichenden gesundheitlichen Folgen. „ So ist etwa das Herzinfarktrisiko eines Patienten mit Rheumatoider Arthritis bis zu 63 % und das einer Patientin mit Systemischem Lupus um bis zu 98 % höher als das der Vergleichspopulation“, hielt Prof.in LechnerRadner fest. Rheumapatient:innen haben ein dreifach erhöhtes Risiko, Lymphome oder Zervixkarzinome zu entwickeln, bis zu 60 % mehr Lungenkrebs oder 40 % mehr Melanome.2-5 Durch die Schwere der Erkrankung und die einhergehenden Komorbiditäten ist die Mortalitätsrate deutlich höher als in einer Vergleichspopulation – je nach Erkrankung um 25 bis 325(!) %.1 Dieser Mortality-gap sei bei jüngeren Patient:innen und Frauen noch dramatischer, so die Expertin. „ Eine frühe Diagnose und adäquate Behandlung sind daher unerlässlich, um die Belastung für die einzelne

Patient:in, als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, zu verringen.“ Wie die Diagnose Diffuse systemische Sklerodermie ihren Alltag als berufstätige alleinerziehende Mutter veränderte und welche Einschränkungen und Hürden dadurch in der Bewältigung von Alltagssituationen auftraten, schilderte in der Folge Patientin Ariane Schrauf. Ihr Weg bis zur richtigen Diagnose und Therapieeinleitung im Alter von 42 Jahren war sowohl physisch als auch psychisch sehr belastend, zumal die Erkrankung derzeit nicht heilbar ist. Die Patientin sprach jedoch sehr gut auf die Therapie an, wodurch sich ihre Lebensqualität rasch und deutlich verbesserte. „ Zusätzlich wollte ich aktiv etwas gegen meine Bewegungseinschränkungen tun, so bin ich aufs Radfahren gekommen“, erzählte sie. Radsport sei für sie ein wichtiges Element der Selbstbestimmung und neben therapeutischen Übungen eine wertvolle Ergänzung ihrer medikamentösen Behandlung geworden.
Awareness & Bedarfsplanung
„I n den letzten beiden Jahrzehnten ist in der Rheumatologie ein außergewöhnlicher Wissenssprung gelungen. An den Meilensteinen der Forschung sind österreichische Wissenschaftler:innen maßgeblich beteiligt“, betonte Univ.-Prof.
Dr. Daniel Aletaha, Leiter der Klinischen Abteilung für Rheumatologie am AKH Wien. Als Ausdruck dieser internationalen Kompetenz stelle Österreich mit ihm heuer bereits zum zweiten Mal in der Geschichte den Präsidenten der EULAR und dürfe den jährlichen Kongress nach fast 20 Jahren wieder in Wien austragen. „ Darauf können wir sehr stolz sein!“
Dank der Forschung kommt heute ein großes Portfolio hochwirksamer Medikamente zum Einsatz. „ Für die Früherkennung und die frühe Therapie braucht es noch mehr Awareness für rheumatologische Erkrankungen und ausreichend gut ausgebildete Rheumatolog:innen sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich“, gab Priv.-Doz.in Dr.in Valerie Nell-Duxneuner, Präsidentin der ÖGR, last but not least zu bedenken. Derzeit stünden für die rund 300.000 Rheuma-Patient:innen nur knapp 300 Rheumatolog:innen zur Verfügung, von denen viele in den kommenden Jahren in Pension gehen würden. Hierauf müsse in der Bedarfsplanung unbedingt geachtet werden, damit auch in Zukunft alle Betroffenen im solidarischen Gesundheitssystem Zugang zu den notwendigen Therapien erhalten.
KaM
* PK „Brennpunkt Rheuma“ der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation, am 4.6.2024 im Café Landtmann, Wien.
Literatur:
1 Dadoniene J et al., Int J Environ Res Public Health. 2021;18(23):12338.
2 Clarke AE et al., Semin Arthritis Rheum. 2021;52(6):1230-41.
3 Ladouceur A et al., Curr Opin Rheumatol. 2019;31(6):678-81.
4 Simon TA et al., Arthritis Res Ther. 2015;17(1):212.
5 Beydon M et al., Lancet Reg Health Eur. 2023;35:100768.

Lesen Sie das Exklusiv-Interview mit den ÖGR-Expertinnen zum Thema Rheumapatient:innen bei niedergelassenen Ärzt:innen online auf Gesund.at:
Hausärzt:in medizinisch 28 Juni 2024
© Welldone Werbung und PR GmbH/APA-Fotoservice/Juhasz
Die Expert:innen (v. l. n. r.): Prof. Daniel Aletaha, Ariane Schrauf, Präs.in Valerie Nell-Duxneuner, Prof.in Helga Lechner-Radner.
Gesund.at
GYNÄKOLOGIE / UROLOGIE

Beleidigte Blase
Inkontinenz thematisieren und therapieren
Immer wieder Infekte
Menopause managen Was tun gegen Keime im Urin?
Interview mit Prof. Peter Frigo
DIALOG
© shutterstock.com/AI
„Das Wesentliche ist die Enttabuisierung“
Vorurteile und aktuelle Entwicklungen in der Therapie des klimakterischen Syndroms
HAUSÄRZT:IN: Welche Vorurteile bestehen nach wie vor rund um die Behandlung von klimakterischen Beschwerden?
Prof. FRIGO: Zu Beginn der Hormontherapie wurde quasi jede Frau in der Menopause mit Hormonen behandelt. Das hat sich 2002 durch die WHI-Studie und auch die Million Women Study relativiert. Seitdem sind das erhöhte Brustkrebsrisiko einer Östrogentherapie und auch das relativ geringe Risiko einer Progesterontherapie bekannt. Wichtig ist jedenfalls eine sorgfältige Anamnese. Im Zweifelsfall sollte man vorsichtig sein – z. B. einen BRCATest veranlassen und nur kaum oder sehr eingeschränkt Hormone verordnen. Generell führten diese Studien zu einer Verunsicherung und waren eine deutliche Ermahnung zur Vorsicht und gründlichen Aufklärung über die Hormonersatztherapie. Eine Folge war auch die Indikationseinschränkung, sodass eine Hormontherapie nur beim schweren klimakterischen Syndrom angewendet werden sollte. Die einzige Ausnahme ist eine primäre Ovarialinsuffizienz. Ansonsten sollte die moderne Hormontherapie zeitlich begrenzt erfolgen, da wir wissen, dass das Mammakarzinomrisiko nach fünf und nach zehn Jahren deutlich steigt. Eine Hormontherapie von unter fünf Jahren rund um die Menopause gilt als ideal.
Was unterscheidet die moderne von der früheren klassischen Hormontherapie? Früher wurden Hormontherapien als Anti-Aging-Mittel oder Knochenschutz angesehen. Das hat sich relativiert, da es mittlerweile andere Osteoporosemedikamente gibt, allen voran Vitamin D – und dem Altern kann man am besten mit gesunder Ernährung und Sport trotzen. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Gewicht: 10 Kilo Übergewicht erhöhen das Brustkrebsrisiko deutlich mehr als jede Hormontherapie.
Bei welchen Beschwerdemustern reichen zunächst sanfte Mittel aus der Apotheke?
Gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche können Salbeiextrakte und Östrogenersatzpräparate wie Soja, Rotklee oder Traubensilberkerze helfen. Bei Schlafstörungen hat sich Baldrian bewährt, der quasi ein natürliches Valium ist. Lavendelöl wird auch gerne angewendet, wobei die Wirkung nicht so stark ist. Besonders bei Einschlafstörungen wird Melatonin in der internationalen Dosierung von 3 mg empfohlen. Bei Durchschlafstörungen hat sich die Serotoninvorstufe 5-Hydroxytryptamin (5-HAT) als hilfreich erwiesen, wobei ein echtes Schlafmittel bei Durchschlafstörungen fast nicht ersetzbar ist. Das klassische „Schlafmittel“ aus der Hormonecke ist das Progesteron. Ein Mangel beginnt manchmal bereits mit 40 Jahren und kann ebenfalls zu Schlafstörungen führen. Hier kann man mit bioidentem Progesteron arbeiten, in Tablettenform, als 3-prozentige Progesteroncreme oder als Vaginalsuppositorium, das vor allem zwischen 40 und 50 Jahren – in der sogenannten Perimenopause – wirksam ist.
Warum sind individuelle Hormonrezepturen wichtig?
Die Wiener Medizinische Schule oder Wiener Hormonschule hat seit den Anfängen der Hormontherapie immer den Hormonstatus analysiert und ein Blutbild gemacht: zu Therapiebeginn und dann nach einigen Wochen bis Monaten. Diese großen Studien, die uns mehr oder weniger die Hormontherapie ausreden wollten, wurden allesamt mit Patientinnen durchgeführt, die ein sehr starkes Östrogen bekommen haben, ohne dass man je geschaut hat, ob sie tatsächlich einen Mangel haben.
Wann sollte ein Hormonstatus erstellt werden?
Gemäß internationalem Standard am 3. bis 5. Zyklustag bei einem regelmäßigen Zyklus oder bei besonderen Fragestellungen wie Kinderwunsch zur Ovulation. In der Menopause kann der Hormonstatus zu jedem Zeitpunkt erhoben werden.

Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo, Leiter der Hormonambulanz an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH Wien, Gründungsmitglied der Österreichischen Menopausegesellschaft, im Gespräch.
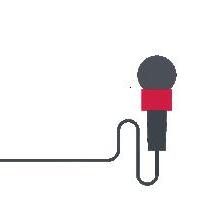
Wann können bioidente Hormone eine gute Alternative sein? Und wie umstritten ist der Begriff an sich eigentlich?
Ich finde, der Begriff ist ein bisschen irreführend, aber ich würde trotzdem sagen, man weiß, was damit gemeint ist, nämlich: zurück zur Natur, zur reinen Substanz, zur Natürlichkeit. Es wird versucht, möglichst natürliche Substanzen und möglichst wenige Hormone zu verwenden.
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Im Wechsel Für ein neues Lebensgefühl in der Menopause
Von Peter Frigo
Carl Ueberreuter Verlag 2023
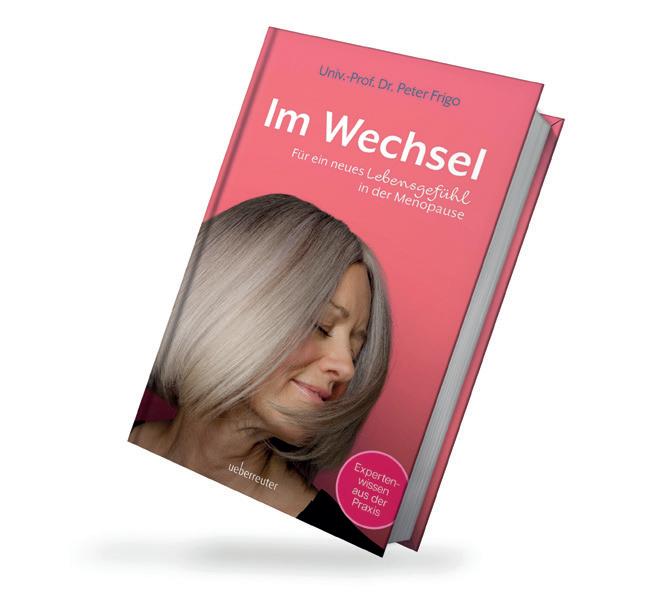
Hausärzt:in DIALOG Gyn/Uro 30 Juni 2024
© Sabine
Hauer
Was sollten Ärzt:innen in Bezug auf das Window of Opportunity wissen und den Patientinnen kommunizieren?
Das Zeitfenster, in dem eine Hormontherapie das Herzinfarktrisiko reduzieren kann, gibt es in den Jahren vor oder direkt nach der Menopause. Es ist wichtig, diese Chance zu nutzen, aber auch die Therapie abzubrechen, wenn Risikofaktoren wie eine Arteriosklerose auftreten. In dem Zeitraum ist eine Hormontherapie sinnvoll, aber wenn eine Frau eine Koronarstenose hat und einen Stent braucht, sollte man relativ bald mit den Hormonen aufhören.
Wie kann sich die Kombination von Schulmedizin und Alternativmedizin gestalten?
Ärzt:innen sollten für beide Ansätze offen sein und individuell behandeln. Die Lösung ist, beides zu kombinieren, z. B. nimmt man gegen die Schlafstörung Ampaladran und gegen die Hitzewallungen Östrogen – eine gute Kombination, da Soja die Brust sogar ein bisschen schützt.
Sie haben bereits einige klimakterische Beschwerden aufgezählt. Sind Regelschmerzen in den Wechseljahren noch ein Thema?
Ja, in der Pre- oder Perimenopause können Regelschmerzen durch Progesteronmangel auftreten. Zuerst fällt das Progesteron ab, in der Menopause das Östrogen. Ebenjener Progesteronabfall verursacht diese Wallungen, führt zu Schlafstörungen und zu PMS. Es kommt zu einer Regelintervallverkürzung, sodass die Blutungen öfter vorkommen und stärker sind. Auch die Schmerzen können intensiver sein, bis sie dann unregelmäßig werden und irgendwann aufhören. Die Behandlung erfolgt mit Gestagengaben, mit denen die Beschwerden ganz gut aufgefangen werden.
Wie sieht die Zukunft im Bereich der Behandlungsmöglichkeiten aus?
Die Medikamente werden immer besser. Ein neues Östrogen, das nur in der Schwangerschaft gebildet wird, das Estetrol, wird bereits in einer neuen Antibabypille verwendet. Es scheint, dass mit diesem Östrogen das Thrombose-, aber auch das Brustkrebsrisiko deutlich niedriger ist. Studien dazu fehlen jedoch noch.
Und dann gibt es die Kinaseinhibitoren, die gezielt gegen Hitzewallungen eingesetzt werden können, sich aber noch in der Testphase befinden.
Was möchten Sie den Hausärzt:innen abschließend mitgeben?
Ich glaube, das Wesentliche beim Thema klimakterisches Syndrom ist die Enttabuisierung – sowohl im Arztgespräch als auch im privaten Bereich. Wenn Frauen sich offen aussprechen können, wie es ihnen geht, bringt das manchmal vielleicht sogar mehr als die beste Hormontherapie. Viele Frauen, die Beschwerden haben, landen in einer medizinischen Abteilung mit Langzeit-EKG, wo man am Ende zu der Erkenntnis gelangt, dass es tatsächlich Wechselbeschwerden sind.
Das Interview führten Mag.a Ines Pamminger, BA und Justyna Frömel, Bakk. MA.
Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar.


MIKRONÄHRSTOFFKOMBINATION
für
hormonelle Balance im Wechsel
- 125 mg Isoflavone davon 10 mg Equol - 100 % vegan und hormonfrei - nur 1 Kapsel täglich - in Österreich entwickelt
die
gynial.com/menogynial 353IV1I112023
Zyklusgebundene Beschwerden
Neue Einblicke in die Neurophysiologie durch EEG-Studien
Menstruationsbedingte Stimmungsschwankungen (engl. „Menstrually-related mood disorders“, MRMD) umfassen kognitivaffektive oder somatische Symptome, von denen man annimmt, dass sie durch die schnellen Schwankungen der Ovarialhormone in der Lutealphase des Menstruationszyklus ausgelöst werden. Darunter fallen das Prämenstruelle Syndrom (PMS), die Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS) und die Prämenstruelle Exazerbation (PME) bestehender psychiatrischer Erkrankungen.
Neurophysiologische Veränderungen
Ein internationales Forschungsteam befasste sich in einer kritischen Literaturstudie1 mit vorliegenden Elektroenzephalografie-Ergebnissen bei menstruationsbezogenen Stimmungsstörungen.
MRMD mit EEG. Die geringe Anzahl sowie die Variabilität in der Methodik erschwerten den Vergleich der Ergebnisse.
Die Befunde zur frontalen Asymmetrie in der Alphafrequenz waren aber relativ konsistent: Zwei von zwei Studien6,8 kamen zu dem Ergebnis, dass eine niedrigere anteriore Alphaasymmetrie im Ruhezustand mit MRMD verbunden ist, während eine andere Studie3 auf den lutealphasenspezifischen Effekt hinwies.
Eine Arbeit9 konzentrierte sich auf die EEG-Merkmale der Stressreaktivität bei PMS, wobei die Probandinnen mit PMS eine höhere Alphapower und stärkere negative Affekte im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten.
Hinsichtlich des zirkadianen Rhythmus wiesen drei Studien2,4,5 auf generalisierte Unterschiede in den Schlafdynamiken hin, die unabhängig vom Menstruationszyklus mit MRMD verbunden sind, was
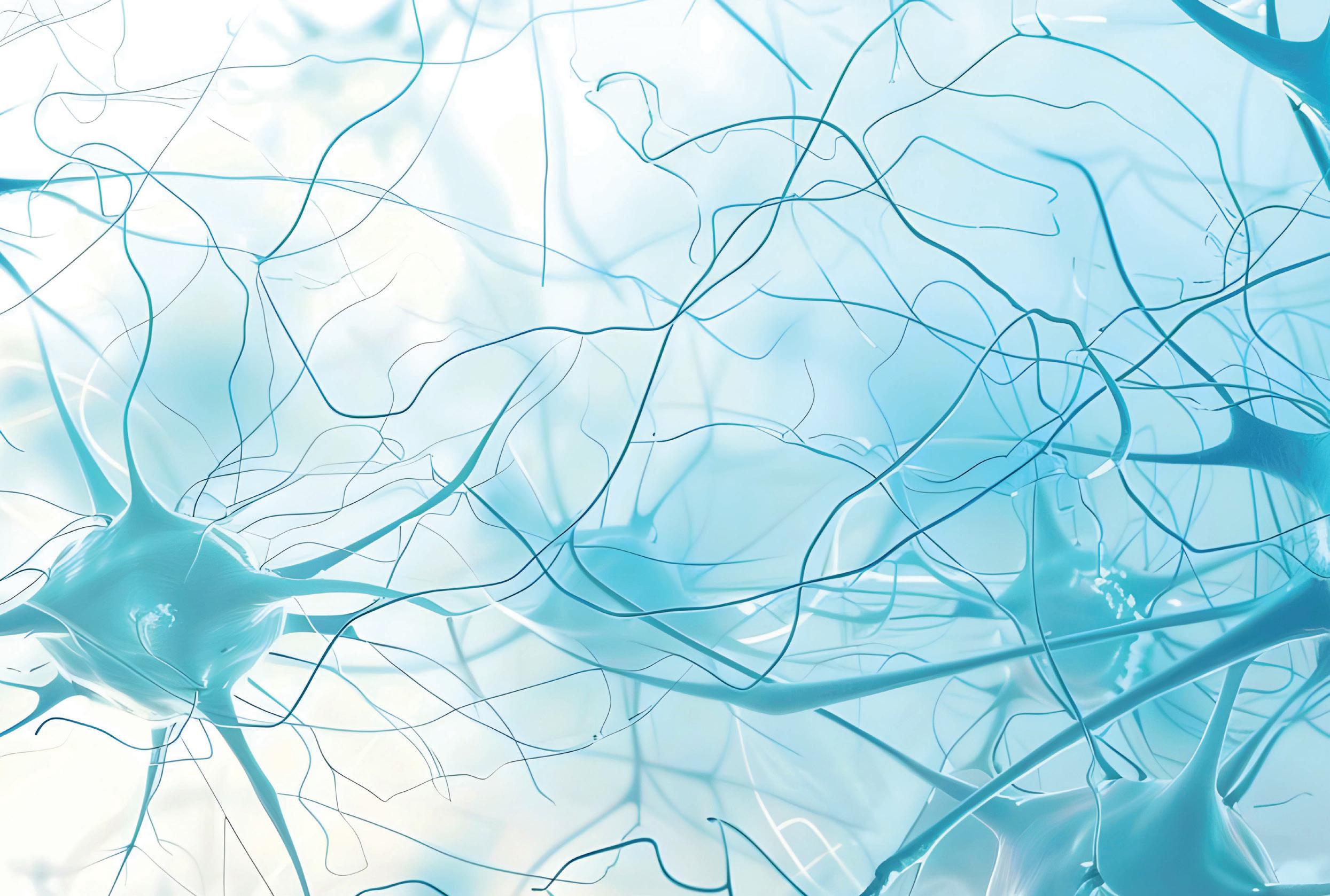
auf eine allgemeine neurophysiologische Veränderung bei MRMD schließen lässt.
Klinische Implikationen
Laut den Studienautor:innen liefern EEG-Befunde wertvolle Einblicke in die neurophysiologischen Grundlagen von MRMD. Sie könnten als diagnostisches sowie prognostisches Instrument dienen, um spezifische EEG-Muster zu identifizieren, die mit Stimmungsschwankungen korrelieren.
Justyna Frömel, Bakk. MA
Quellen:
1 Kaltsouni E et al., Front. Neurosci. 72 (2024), p. 101120.
2 Parry BL et al., Psychiatry Res., 85 (1999), pp. 127-143.
3 Baehr E et al., Int. J. Psychophysiol., 52 (2004), pp. 159-167.
4 Baker FC et al., Sleep, 30 (2007), pp. 1283-1291.
5 Baker FC, Colrain IM, J. Sleep Res., 19 (2010), pp. 214-227.
6 Accortt EE et al., J. Affect. Disord., 128 (2011), pp. 178-183.
7 Lin IM et al., J. Obstet. Gynaecol. Res., 39 (2013), pp. 998-1006.
8 Deng Y et al., Motiv. Emot., 43 (2019), pp. 883-893. Liu Q et al., Neuropsychiatr. Dis. Treat., 13 (2017), p. 1597.
Wieder im Gleichgewicht ~ mit Safralind. Meine Tage im Gleichgewicht ~ mit Safralind.
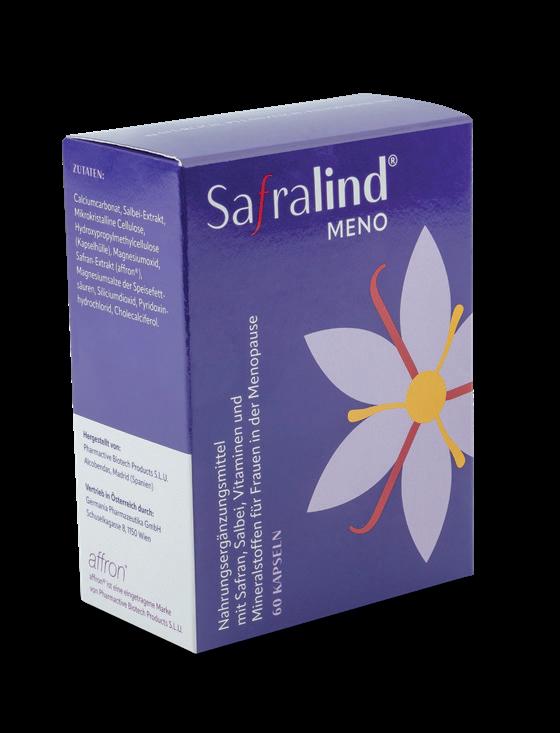
Nahrungsergänzungsmittel mit Safran, Salbei, Vitaminen und Mineralstoffen für Frauen in der Menopause


NEU! Jetzt in Ihrer Apotheke! safralind.at

Nahrungsergänzungsmittel mit Safran, Mönchspfeffer, Vitaminen und Mineralstoffen für Frauen ab 18 Jahren
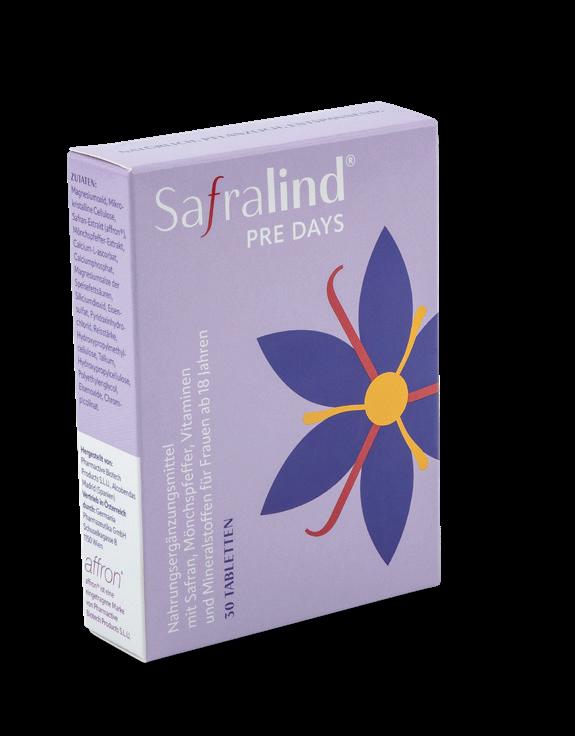
© stock.adobe.com/ Ян Заболотний
INSKOMBI_0923 NATÜRLICH. PFLANZLICH. ENTSPANNEND.
DIALOG
Hausärzt:in
Gyn/Uro

Praxiswissen:
DFP-Punktesammler
Katheter und andere Kunststoffableitungen
Grundlagen der Versorgung urologischer Patient:innen
GASTAUTOREN-TEAM:


Grundkenntnisse bezüglich urologischer Katheter und anderer implantierter Kunststoffableitungen spielen eine wichtige Rolle bei der Betreuung von urologischen Patient:innen in der hausärztlichen Praxis. Der Einsatz dieser Medizinprodukte stellt eine vorübergehende oder langfristige Maßnahme zur Behandlung verschiedener Erkrankungen der ableitenden Harnwege dar. Eine korrekte und kontinuierliche Versorgung durch Hausärzt:innen entlastet Facheinrichtungen und erkennt frühzeitig Komplikationen, welche eine Hospitalisierung notwendig machen.
Nachfolgend beschäftigen wir uns genauer mit diesem in die Patient:innen eingebrachten Fremdmaterial, erklären die Gründe für seine Verwendung und mögliche Auswirkungen auf die Patient:innen. Im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung mit größeren Anteilen älterer Patient:innen sollten die Grundlagen der Versorgung mit Kathetern bekannt sein.
Blasenkatheter
Blasenkatheter dienen der Drainage des unteren Harntrakts und werden
aus Polyvinylchlorid (PVC), Latex oder Silikon hergestellt. Die Anlage erfolgt unter aseptischen Bedingungen und unter Zuhilfenahme eines sterilen und mit Lokalanästhetikum versetzten Gleitmittels. Die Katheter unterscheiden sich in Material, Form und Anordnung der Drainage-Augen. Neben der geraden Nelatonspitze weisen die Tiemann- und die Dufourspitze ein abgeknicktes Ende auf. Die Kathetergrößen werden in Charrier (CH, Charr., auf Englisch auch „ French“) angegeben und beschreiben den Außendurchmesser des Katheters. Ein Charrier beträgt 0,33 mm.
Einmalkatheter
Einmalkatheter dienen der sterilen Uringewinnung (bei Frauen), der Durchführung einer diagnostischen Untersuchung des unteren Harntrakts (im Rahmen einer Zystographie oder Urodynamik) sowie der Verabreichung von intravesikalen Therapien, z. B. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) oder Mitomycin-Therapien beim Blasenkarzinom. Die Einmalkatheterisierung wird bei Blasenentleerungsstörungen fallweise von den Patient:innen selbstständig nach Anleitung durchgeführt. Bei Frauen werden kürzere Einwegkatheter mit Nelatonspitze verwendet, bei Männern hingegen längere Katheter mit Dufour- oder Tiemannspitze, um den unterschiedlichen Harnröhrenlängen der Geschlechter zu entsprechen.
Transurethraler Dauerkatheter
Die Indikationen zur dauerhaften Katheteranlage durch die Harnröhre sind vielfältig: Harnblasenentleerungsstörungen,
Verletzungen des Harntrakts, schwere Infektionen, Flüssigkeitsbilanzierung u. v. m. Im Gegensatz zum Einwegkatheter besteht der Dauerkatheter aus einem ZweiWege-System. Neben der Urindrainage gibt es einen zusätzlichen Kanal. Über einen kleinen Ballon im Bereich der Spitze kann der Katheter mittels Füllmediums in der Harnblase blockiert werden. Auch hierzu eignen sich Katheter mit Nelatonspitze für Frauen und mit Dufour- bzw. Tiemannspitze für Männer. Der transurethrale Dauerkatheter sollte alle vier bis sechs Wochen gewechselt werden.
Transurethraler Spülkatheter
Zur Vermeidung einer Blasentamponade bei Makrohämaturie (akut oder postoperativ) ist die Anlage eines Spülkatheters durch die Harnröhre vorübergehend notwendig. Diese speziellen Katheter weisen ein Drei-Wege-System auf. Über den zusätzlichen Kanal kann die Blase mit einer physiologischen Spüllösung permanent gespült werden. Die Methode setzt ein stationäres Setting voraus.
Mögliche Komplikationen
Verletzungen der Harnröhre können durch Schleimhautfalten oder bereits bestehende Strikturen infolge einer Katheteranlage verursacht werden. Darauf hat die Dauer der Katheterliegezeit keine unmittelbare Auswirkung. Jede Katheterisierung kann unabhängig von der Liegezeit über entstehende Mikrotraumen zu dauerhaften Schädigungen der Harnröhre führen. Narbige Verengungen entstehen jedoch gehäuft nach längeren Katheterliegezeiten. >
Schnellzugriff zum Literaturstudium: Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zur Fortbildung auf Gesund.at
Hausärzt:in DFP 33 Juni 2024
OA Dr. Clemens Mayr, FEBU Abteilung für Urologie, Ordensklinikum Linz
© Ordensklinikum Linz (2)
Ass. Dr. Felix Mayrhauser Abteilung für Urologie, Ordensklinikum Linz
Infektionen am liegenden Dauerkatheter sind von großer Relevanz für das Gesundheitssystem. Dauerkatheterträger:innen entwickeln mit einer Rate von etwa 3-10 % pro Katheterisierungstag eine Bakteriurie. Davon zeigen 10-25 % Symptome einer klinisch relevanten Harnwegsinfektion. Als Faustregel gilt: Die Bakteriurie allein ist bei immungesunden Katheterträger:innen nicht behandlungswürdig, treten hingegen Symptome auf, dann ist antibiotisch zu behandeln. Die intraluminale Keimaszension kann durch eine hygienisch korrekte Katheterhandhabung zwar minimiert werden, jedoch können Keime auch außen, entlang des natürlichen Biofilmes des Katheters (extraluminal), in die Harnblase aufsteigen und klinisch relevante Infektionen verursachen. Dieser Biofilm wird bereits wenige Stunden nach Katheteranlage durch körpereigene Proteine und Makromoleküle bzw. bakterielle Kolonisation gebildet. In manchen Fällen kommt es dadurch auch zur Verstopfung des Katheterlumens mit konsekutivem Harnverhalt trotz liegenden Katheters.1,2
Suprapubischer Dauerkatheter
Der suprapubische Katheter stellt die invasivste Form der Blasenkatheterisierung dar und erfordert einen chirurgischen Eingriff, der in der Regel von Urolog:innen vorgenommen wird. Unter meist ambulanter Lokalanästhesie erfolgt die perkutane Anlage des Katheters über die Bauchdecke. Abgesehen vom Notfall, ist neben einer ärztlichen Aufklärung auch das vorübergehende Pausieren von Gerinnungshemmern notwendig. Die suprapubische Katheterisierung verhindert Harnröhrentraumata sowie die Bildung von Strikturen und reduziert die Häufigkeit einer katheterassoziierten Bakteriurie (zumindest vorübergehend).
Im Vergleich zur transurethralen Katheterisierung bietet die suprapubische Katheterisierung einen höheren Tragekomfort und ermöglicht weiterhin normale Entleerungsversuche (z. B. Blasentraining). Es existieren verschiedene Arten von suprapubischen Kathetern, wobei vor allem kurze Silikonkatheter mit Nelatonspitze und Ballonblockade verwendet werden. Bei Kathetern ohne Ballon-
blockade ist eine Annaht außen an der Haut notwendig.
Die Wechselintervalle entsprechen zeitlich denen des transurethralen Katheters. Speziell die ersten Wechsel sollen durch eine Fachabteilung erfolgen. Im Verlauf granuliert der Gang zwischen Blase und Bauchdecke und ein Wechsel kann problemlos in der Hausarztpraxis durchgeführt werden.
Harnleiterschienen
Als Harnleiterschienen bezeichnet man Katheter zwischen Nierenbeckenkelchsystem und Harnblase. Der im klinischen Einsatz häufig gebrauchte Begriff Schiene ist somit umgangssprachlich, da es sich eigentlich um ein dünnes, sehr flexibles Kunststoffrohr handelt. Diese Schienen sollen den Harnabfluss über den Harnleiter sicherstellen. Als Synonyme werden auch Ureter- oder Harnleiterkatheter, -stent, -splint, Double-J, auch Doppel-J oder nur DJ, Pigtail usw. verwendet.
Indikationen zur Anlage
Die Indikationen zur Anwendung einer inneren Harnleiterschienung sind vielfältig. Sie stellt ein bewährtes therapeutisches Konzept bei der Behandlung der akuten bzw. chronischen Harnstauung dar. Ursächlich für akute Obstruktionen sind vor allem Harnsteine. Chronische Obstruktionen werden häufig durch fortgeschrittene Tumorerkrankungen oder narbige Veränderungen im Harnleiter hervorgerufen. Allgemein dient die Harnableitung der Gewährleistung des Harnabflusses, der Erhaltung der Nierenfunktion, der Linderung von Schmerzen und der Verhinderung von Infektionen.
Als weitere Indikation ist die kurative Schienung nach operativen Eingriffen im Bereich des Harntraktes (z. B. nach plastisch-rekonstruktiven Operationen am oberen Harntrakt oder auch nach Nierentransplantation) zu erwähnen. Außerdem erfolgt die Schienung elektiv vor endourologischen Eingriffen. Das sogenannte „ P re-Stenting“ bei Patient:innen mit Harnsteinen soll eine Weitstellung des Harnleiters bewirken und so einen erfolgreichen Folgeeingriff zur Bergung der Steine ermöglichen.
Abb. 1

Abb. 2
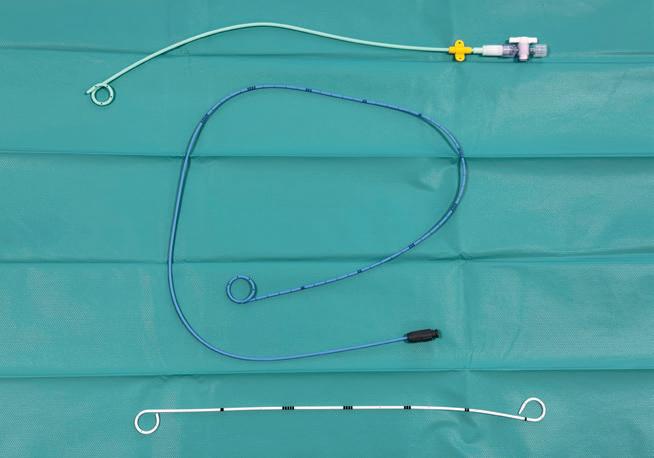
Abb. 3
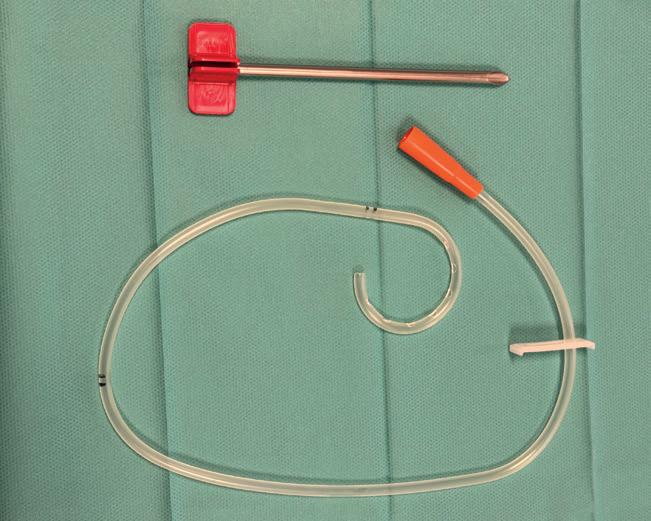
Abb. 1: Einmalkatheter für Frauen mit gerader Spitze, DK mit gerader Spitze, DK mit Tiemannspitze, Spülkatheter (Drei-Weg-System) mit Dufourspitze (von oben nach unten).
Abb. 2: Nephrostomiekatheter, Mono-J-, Double-J-Katheter (von oben nach unten).
Abb. 3: Suprapubischer Dauerkatheter (ohne Ballonblockade) mit Anlagedorn.
Anlageverfahren
Der Eingriff erfolgt endoskopisch und vorwiegend unter Allgemeinnarkose, Sedoanalgesie und auch unter Lokalanästhesie (insbesondere bei Frauen). Zystoskopisch werden zuerst die Harnleiterostien identifiziert. Röntgenkontrolliert und unter Zuhilfenahme von Kontrastmittel werden der betroffene Harnleiter und das Nierenbecken in einer retrograden Pyelographie (RPG) dargestellt. Dann wird ein dünner Draht über den Harnleiter ins Nierenbecken vorgeschoben. Über den liegenden Draht wird die Harnleiterschiene platziert (SeldingerPrinzip). Während sich nach Entfernung des Drahtes ein Ende im Nierenbecken aufrollt, rollt sich das distale Endstück in der Harnblase auf – von den zwei eingerollten Enden leitet sich der Name „Dop-
Hausärzt:in DFP 34 Juni 2024
© Ordensklinikum Linz
pel-J“ bzw. Pigtail ab. Komplikationslose Anlagen dauern oft nur wenige Minuten.
Sonderfall „ M ono-J“
In manchen Fällen ist es notwendig, den Harn aus der Niere vorübergehend direkt auszuleiten und die Harnblase zu umgehen. Der sogenannte „ Mono-J“ hat nur ein eingerolltes Ende, wird direkt durch die Harnröhre ausgeleitet und an einem transurethralen Dauerkatheter befestigt. Patient:innen mit Urostoma, zum Beispiel nach einer operativen Entfernung der Harnblase, können (je nach Harnableitung) auch dauerhaft mittels „ Mono-J“ versorgt werden.
Komplikationen/Nebenwirkungen
In seltenen Fällen kommt es intraoperativ zu Verletzungen des Harnleiters oder der Niere. Postoperativ werden vor allem Infekte, Inkrustationen und Dislokationen beobachtet. Reizsymptome in Zusammenhang mit der Stentimplantation sind häufig und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. In ca. 40 % der Fälle berichten Patient:innen mit Harnleiterschienen über erhöhten Harndrang, erhöhte Miktionsfrequenz, Inkontinenz, Hämaturie, Blasen- oder Flankenschmerzen. Für die irritative Symptomatik ist vor allem der liegende Fremdkörper ursächlich. Flankenschmerzen bei liegendem Stent sind die Folge einer fehlenden Ventilfunktion der Ostien und eines daraus resultierenden Urinrückflusses in Richtung Niere. Der Anstieg des intrapelvinen Drucks äußert sich letztlich in Schmerzen im Bereich des betroffenen Nierenlagers. Diese treten während der Blasenentleerung und selten auch während der Blasenfüllung auf. Die genannten Beschwerden wirken sich bei 60 % der betroffenen Patient:innen negativ auf deren Lebensqualität aus und werden als Einschränkung im Alltag wahrgenommen.3
Umgang mit einer Harnleiterschiene
Bei liegender Harnleiterschiene ist eine leichte Blutbeimengung im Urin nicht ungewöhnlich, da die Schiene in der Niere, im Harnleiter und in der Blase durch mechanische Reizung zu Schleimhautirritationen/-verletzungen führen kann. In diesem Fall sollte initial die Trinkmenge gesteigert werden. Bei
ausgeprägten, andauernden Blutbeimengungen sollte jedoch eine fachärztliche Vorstellung erfolgen. Alphablocker (z. B. Tamsulosin), Anticholinergika (z. B. Trospium) und nichtsteroidale Antirheumatika werden im Allgemeinen gut vertragen und können die Reizsymptome reduzieren.4 Anhaltende und schmerzmittelresistente Schmerzen im Bereich der geschienten Niere sind mögliche Folgen einer verstopften Harnleiterschiene. Hier sollte eine Begutachtung mit Sonographie an einer urologischen Abteilung durchgeführt werden, um zu klären, ob die Durchgängigkeit weiterhin gegeben ist. Kommt es hingegen zu Fieber und/oder Schüttelfrost bei liegender Harnleiterschiene, sollte unmittelbar die Kontaktaufnahme mit einer Fachabteilung erfolgen. Symptomatische Infekte bei liegendem Fremdkörper bedürfen in vielen Fällen einer antibiotischen Therapie unter stationären Bedingungen sowie fallweise eines Schienenwechsels. Besteht eine asymptomatische Situation, können die Harnleiterschienen drei bis sechs Monate im Körper verbleiben, bevor sie gewechselt werden müssen.
Perkutane Nephrostomie (PCN)
Die perkutane Nephrostomie ist ein Verfahren, mit dem das Nierenbeckenkelchsystem direkt drainiert und zugänglich gemacht wird. Mittels Ultraschalls und Röntgens wird ein Drainagekatheter direkt durch die Haut in das Nierenbecken eingeführt. Im Anschluss wird der Katheter mit einer Naht an der Haut fixiert oder mittels Ballonblockierung im Nierenbeckenkelchsystem platziert. Die Anlage kann sowohl in Lokalanästhesie als auch unter Allgemeinnarkose erfolgen. Die Indikationen zur perkutanen Harnableitung sind denen der inneren Harnleiterschienung ähnlich. Die PCN kommt vorwiegend bei Versagen der retrograden Sondierung zum Einsatz. Nephrostomiekatheter sollen alle sechs bis acht Wochen an einer urologischen Fachabteilung gewechselt werden.
Asymptomatische Bakteriurie
Patient:innen mit transurethralen Dauerkathetern, suprapubischen Ka-
thetern oder Nephrostomiekathetern entwickeln unweigerlich eine asymptomatische Bakteriurie. Ursächlich ist vor allem die universelle Bildung eines Biofilms entlang eines Fremdkörpers. Dies gilt auch für Personen mit liegenden Harnleiterschienen.
Patient:innen mit asymptomatischer Bakteriurie profitieren weder von einer Screening-Untersuchung noch von einer prophylaktischen antibiotischen Behandlung. Im Gegenteil, der unnötige Einsatz von Antibiotika bei asymptomatischen Katheterträger:innen kann zur Steigerung der Resistenzbildung beitragen. Diese Resistenzbildung gegen Antibiotika ist verantwortlich für ca. 35.000 Todesfälle jährlich in Europa und wird von der WHO als eines der Top 10 der globalen Gesundheitsrisiken angesehen. Hier müssen wir als Behandler:innen wesentlich vorangehen und bisherige antrainierte Verhaltensweisen deutlich überdenken. Vor einem unkomplizierten Dauerkatheterwechsel ist eine asymptomatische Bakteriurie nicht behandlungswürdig. Im Rahmen eines endourologischen Eingriffes hingegen oder bei immunkompromittierten Patient:innen kann eine asymptomatische Bakteriurie jedoch einen behandlungsbedürftigen Faktor darstellen – im Zweifel sollte eine urologische Fachabteilung kontaktiert werden.5
Quellen:
1 Chenoweth CE et al., Infect Dis Clin North Am. 2011.
2 Leuck AM et al., J Urol. 2012.
3 Geavlete P et al., J Med Life. 2021.
4 Koprowski C et al., J Endourol. 2016.
5 EAU Guidelines UTI. Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023.
Weitere Literatur bei den Verfassern.
DFP-Pflichtinformation
Fortbildungsanbieter: Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin
Lecture Board:
Dr.in Johanna Holzhaider
2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich
OA Dr. Stephan Doblhammer Abteilung für Urologie, LK Korneuburg, Niederösterreich
Hausärzt:in DFP 35 Juni 2024
<
Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze
Urologische Katheter und andere implantierte Kunststoffableitungen dienen der Drainage der Harnwege oder zur Bilanzierung der Harnausscheidung.
Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos bei liegendem Dauerkatheter sollte die Indikation zur Katheteranlage streng gestellt werden.
DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN
Etwa 40 % aller Patient:innen mit liegenden Harnleiterkathetern weisen irritative Miktionsbeschwerden auf.
Patient:innen mit Katheter oder anderen urologischen Kunststoffableitungen und einer asymptomatischen Bakteriurie sollten nicht mit einer prophylaktischen Antibiose behandelt werden.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf Gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung.
Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.
Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als ScanDokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 31. Dezember 2024. Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter Gesund.at (DFP Fortbildungen).
DFP-Fragen zu
Jetzt onlineTeilnahme möglich:

„Praxiswissen: Katheter und andere Kunststoffableitungen“
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.
Welche Aussage trifft zu? (1 richtige Antwort)
Eine Urinkultur sollte standardmäßig bei asymptomatischen Dauerkatheterträger:innen durchgeführt werden.
Die Leukozyturie bei asymptomatischen Dauerkatheterträger:innen ist alleiniger Indikator für die Etablierung einer antibiotischen Therapie.
Übelriechender, trüber Harn stellt bei asymptomatischen Dauerkatheterträger:innen eine Indikation zur antibiotischen Therapie dar.
Eine asymptomatische Bakteriurie kann ein Risikofaktor für eine Infektion bei bevorstehenden endourologischen Eingriffen sein.
Ein suprapubischer Dauerkatheter … (3 richtige Antworten)
... kann im Verlauf in der Hausarztpraxis gewechselt werden.
… sollte anfänglich an einer urologischen Fachabteilung gewechselt werden.
… weist einen schlechteren Tragekomfort auf als der transurethrale Dauerkatheter.
… sollte alle vier bis sechs Wochen gewechselt werden.
Patient:innen mit Harnleiterschiene … (2 richtige Antworten)
… können bei irritativen Miktionsbeschwerden von Tamsulosin, Diclofenac und Trospium profitieren.
… sollten bei Blutbeimengungen im Harn auf eine verminderte Trinkmenge achten.
… sollten alle drei bis sechs Monate einen Schienenwechsel erhalten (bei Dauerversorgung).
… sollten bei minimalen Blutbeimengungen sofort in ein Spital überwiesen werden.
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!
Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:
NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:
Name
Anschrift PLZ/Ort
E-Mail
Hausärzt:in DFP 36 Juni 2024
1 2
3
BdA-KONGRESS WIEN Vorankündigung

Programm:
Ernährung & Selbstmedikation
Florian Prinz, MSc
Ordinationsführung
Barbara Weber
Die Zukunft der Suchtbehandlung
Dr. Arkadiusz Komorowski
Telemedizin & Künstliche Intelligenz
Dr. Martin Hasenzagl
KI und Anwendungssoftware im Management von chronischen Erkrankungen
Vortragende:r tba
Neuigkeiten aus dem e-card System
Vortragende:r tba
Kabarett mit Martin Moder, PhD
Ordination der Zukunft
Von der künstlichen Intelligenz in der Medizin bis zum Praxismanagement
Samstag, 12. Oktober 2024
Hotel Savoyen
Rennweg 16
Wien 1030
Kosten
Mitglieder: 75 €
Nicht-Mitglieder: 95 €





Anmeldung
arztassistenz.at/fortbildung/ termine-im-ueberblick/bdatermine/tagungen-kongresse/ 10-bda-kongress-wien
6 BdA Fortbildungspunkte
10 Jahre Jubiläum




© BdA/nikoshimedia + KI

Plötzliche Drangepisoden
Bei Männern und Frauen unterschiedlich –die schwache Blase
Sprechen Frauen über eine zu schwache Blase, meinen sie oft den unkontrollierten Urinverlust bei körperlichen Anstrengungen. Anders ist dies beim Mann, denn ein Urinverlust ohne vorherigen Drang – also etwa beim Husten oder Springen –ist bei Männern selten und tritt fast nur nach operativen Eingriffen auf. Vielmehr spricht man beim Mann von einer schwachen Blase, wenn der Harndrang plötzlich und wie beim „Blitzpinkeln“ kaum unterdrückbar einschießt.
GASTAUTOREN-TEAM:

Prof. Dr. Friedrich-Carl von Rundstedt Klinikdirektor der Urologie an der HeliosUniversitätsklinik in Wuppertal
Schuld ist nicht die Prostata allein

Prof. Dr. Stephan Roth Ärztlicher Leiter der Helios-Universitätsklinik für Urologie in Wuppertal
Ob für solche „P inkelattacken“ ausschließlich die Prostata verantwortlich ist, lässt sich nicht kurz und knapp beantworten. Diese Frage hat bereits Tausende von Wissenschaftlern beschäftigt. Unabhängig von jenen scheinbar unklaren Störungen gibt es jedoch auch eindeutige Gründe, warum eine Blase gereizt sein kann. Diese reichen von Urolithiasis über einen Tumor bis hin zu neurologischen Erkrankungen wie dem Morbus Parkinson. Ein Auslöser kann allerdings die Prostata sein. Denn ist diese vergrößert oder so eng gewachsen, dass sich die Blase nicht mehr normal entleeren kann, kommt es zur Hypertrophie des Blasenmuskels. Diese Verdickung des Blasenmuskels kann dann zu Störfeldern mit einer verminderten Durchblutung oder falschen Verschaltungen von Nerven

führen. Ähnlich den Arrhythmien des Herzens können plötzliche Drangepisoden der Blase die Folge sein.
Wenn es an der Prostata liegt
Es gibt einige Anzeichen, die auf die Prostata als Ursache für eine „nervöse“ Blase deuten. Dann kann man das Organ je nach Schweregrad der Symptome medikamentös, interventionell oder operativ behandeln. Ein Hinweis für ein Problem mit der Prostata kann sein, wenn Männer von einem abgeschwächten Harnstrahl berichten. In diesem Fall ist nachzufragen, wie sich dies in der Nacht äußert. Viele Männer mit Prostataengen beschreiben, dass der Harnstrahl nachts auffällig schlecht sei. Die Ursache ist der „eingeschlafene“ Blasenmuskel, der erst „wach“ werden muss, um die Prostataenge zu überwinden. Dieses versteckte Zeichen einer obstruktiven Prostata ist in der Literatur wenig beschrieben. Einen wichtigen Hinweis liefert der Restharn. Dieser ist allerdings ein häufiges und von vielen Einflussfaktoren abhängiges Phänomen. Deshalb sollte die Messung mehrmals erfolgen. Wesentlich ist zudem, sich den Blasenmuskel bei voller Blase anzusehen. Ist er hypertroph oder hat er divertikelartige Ausstülpungen, gilt dies als ein Zeichen für Obstruktion. Von einer Hypertrophie spricht man, wenn der Muskel bei einer Blasenfüllung von 250 ml mehr als 2 mm Muskelstärke aufweist.
Wenn die Prostata nicht die Ursache ist
Auch die Blase altert: Normalerweise ist der Hohlmuskel der Blase extrem dehnungsfähig und kann circa einen halben Liter Urin speichern. Mit zunehmendem Alter verliert der Blasenmuskel aber seine Dehnungsfähigkeit und aus der Blase als einem großen Softball wird ein kleiner steifer Fußball. Problem „Rentnerblase“: Eine Erfahrung aus dem Alltag der urologischen Sprechstunde ist, dass
die Probleme mit dem Blasendrang oft kurz nach dem Rentenbeginn zunehmen. Liegt es daran, dass Rentner auf einmal Zeit haben, bei dem geringsten Blasendruck die Toilette aufzusuchen? Aber dadurch wird die Blase nicht mehr trainiert und gedehnt. Betroffene sollten zu Hause das Urinvolumen messen, das in der Blase noch Platz hat. Oft sind es nur 200 ml, also nur noch die Hälfte des normalen Volumens. Im Alter scheidet man nachts mehr Urin aus, denn auch die Nieren altern. Der komplizierte Vorgang der Konzentration des Urins unterliegt ebenfalls Alterungsphänomenen. So weiß man, dass ein älterer Mensch nachts ungefähr doppelt so viel Urin ausscheidet wie in jungen Jahren. Wenn diese Urinmenge dann in einer verkleinerten Blase gespeichert werden muss, müssen viele in der Nacht häufiger aufstehen. Unabhängig vom Alter gibt es viele Männer, die eine kleine Prostata ohne jeden Restharn haben und trotzdem über den ständigen und blitzartigen Harndrang klagen. Das kann viele Ursachen haben (siehe Infobox).
Verschiedene Behandlungsoptionen
Bei einer nachgewiesenen zu kleinen Blasenkapazität von unter 200 bis 250 ml Volumen sollten die Betroffenen ein Blasentraining durchführen, um die Blase wieder zu vergrößern. Ein Hinauszögern der Entleerung dehnt die Blase allmählich wieder. Wichtig ist allerdings, eine ausreichende Entleerung der Blase sicherzustellen. Zu pflanzlichen Substanzen, die von vielen Männern eingenom-
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Der Prostata- und Blasen-Guide
Von Stephan Roth und Friedrich-Carl von Rundstedt
Knaur MensSana 2023
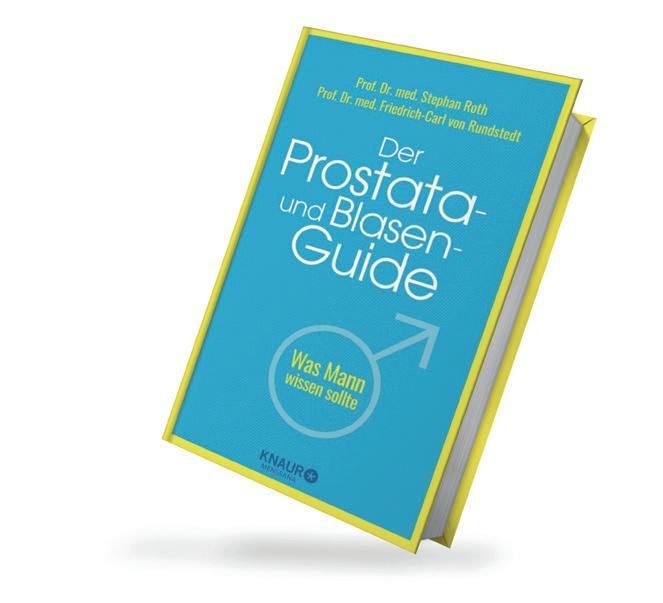
Hausärzt:in DIALOG Gyn/Uro 38 Juni 2024
© Helios Universitätsklinikum Wuppertal/Jakob Studnar © shutterstock.com/Andrew Rybalko
men werden, gibt es keine seriösen klinischen Studien. Hier kann die sogenannte New-York-Regel angewendet werden. New Yorker Urolog:innen empfehlen, Phytotherapeutika für einige Wochen auszuprobieren und bei Erfolglosigkeit ein zweites und drittes Präparat zu testen. Im Falle einer fehlenden Besserung sollte zu klinisch geprüften Substanzen gewechselt werden (die ja auch von der Kasse bezahlt werden – im Unterschied zu den Phytotherapeutika).
Blasendämpfende Medikamente greifen in die autonome Steuerung der Blase ein. Man kann den blasenstimulierenden Parasympathikus mit Anticholinergika hemmen. Es ist jedoch wichtig, den Patienten mitzuteilen, dass diese oft erst nach zwei bis vier Wochen ihre Wirkung entfalten. Alternativ kann man heute den blasenhemmenden Sympathikus medikamentös mittels der Substanz Mirabegron aktivieren und eine Blasensedierung erzielen.
Leider wenig bekannt ist die Neuromodulation. Diese Nervus-tibialis-posterior-Stimulation geht auf die traditionelle chinesische Akupunktur zurück. An einem Punkt an der Innenkante des Schienbeins, eine Handbreit oberhalb des Innenknöchels, werden Klebeelektroden mit einem batteriebetriebenen Impulsgeber verbunden und täglich für eine halbe Stunde über zwölf Wochen stimuliert. Bei rund 60 % der Betroffenen kommt es zu einer Besserung der Drangbeschwerden der Blase mit zum Teil anhaltendem Effekt. Bei der Botoxtherapie wird stark verdünntes Botulinumgift in den Blasenmuskel gespritzt, sie ist mittlerweile eine Standardbehandlung. Die Injektion an zehn bis 30 Stellen erfolgt in Kurznarkose mithilfe einer Blasenspiegelung. Auch wenn Botulinumtoxin bei Mann und Frau gleich wirkt, ist das besondere Problem die Prostata. Denn wächst die Prostata obstruktiv, besteht das Risiko, dass der Blasenmuskel so geschwächt wird, dass es zur Harnverhaltung kommen kann.
Fazit
Die überaktive Blase des Mannes und das damit verbundene „Blitzpinkeln“ müssen dringend von der fast automatischen Zuordnung zu einer zu großen oder zu engen Prostata befreit werden. Es wurden leider viel zu viele Männer operiert, deren Drangbeschwerden der Blase auch durch andere Maßnahmen hätten gebessert werden können. >
Gründe für eine Drangblase auch ohne vergrößerte Prostata
� Überaktiver Blasenmuskel („Krampfanfälle der Blase“)
� Gestörte Blasenschleimhaut („Allergie auf Giftstoffe im Urin“)
� Störungen im Kontrollzentrum Gehirn nach einem Schlaganfall, bei Morbus Parkinson oder Multipler Sklerose
� Übergewicht
� Psychische Störungen (Stress, Angst oder Depressionen)
� Androgenmangel
� Magen-Darm-Störungen
Hausärzt:in medizinisch 39 Juni 2024 INFO
Wenn das Unkomplizierte kompliziert wird
Antibiotikaresistenzen erschweren die Behandlung von Harnwegsin fekten

Entzündungen des Urogenitaltrakts stellen die häufigste bakterielle Infektion dar und sind ein häufiger Grund für eine Antibiotikaeinnahme. Wegen ihrer Anatomie sind Frauen ungleich öfter betroffen als Männer. Etwa 60 % haben zumindest einmal im Leben eine Harnwegsinfektion, bei 4-10 % der Frauen ist sie rezidivierend.¹
Von harmlos bis lebensbedrohlich
Es wird zwischen komplizierten und unkomplizierten Harnwegsinfekten unterschieden. Als unkompliziert gilt die Entzündung bei jungen, nicht schwangeren Frauen, die keine anatomischen oder physiologischen Anomalien der >
INFO
Risikofaktor Spermizide
Manche Frauen haben wesentlich häufiger Harnwegsinfekte als andere. Die Ursachen dafür können vielfältig sein und sind nicht restlos geklärt. Ein Risikofaktor kann jedenfalls die Verhütungsmethode sein. Nachgewiesen ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen spermizidbeschichteten Kondomen bzw. Diaphragmen und Harnwegsinfektionen. Dieser entsteht vermutlich dadurch, dass Spermizide die Scheidenflora stören, und so die Kolonisierung der Vulva durch E. coli begünstigen.
Hausärzt:in DIALOG Gyn/Uro 40 Juni 2024 © shutterstock.com/AI
Mehr als nur D-Mannose
Unterstützt Tag und Nacht mit nur 2 Kapseln
Exklusive und patentierte natürliche Inhaltsstoffe

die Harnwegsgesundheit und hilft bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen.*
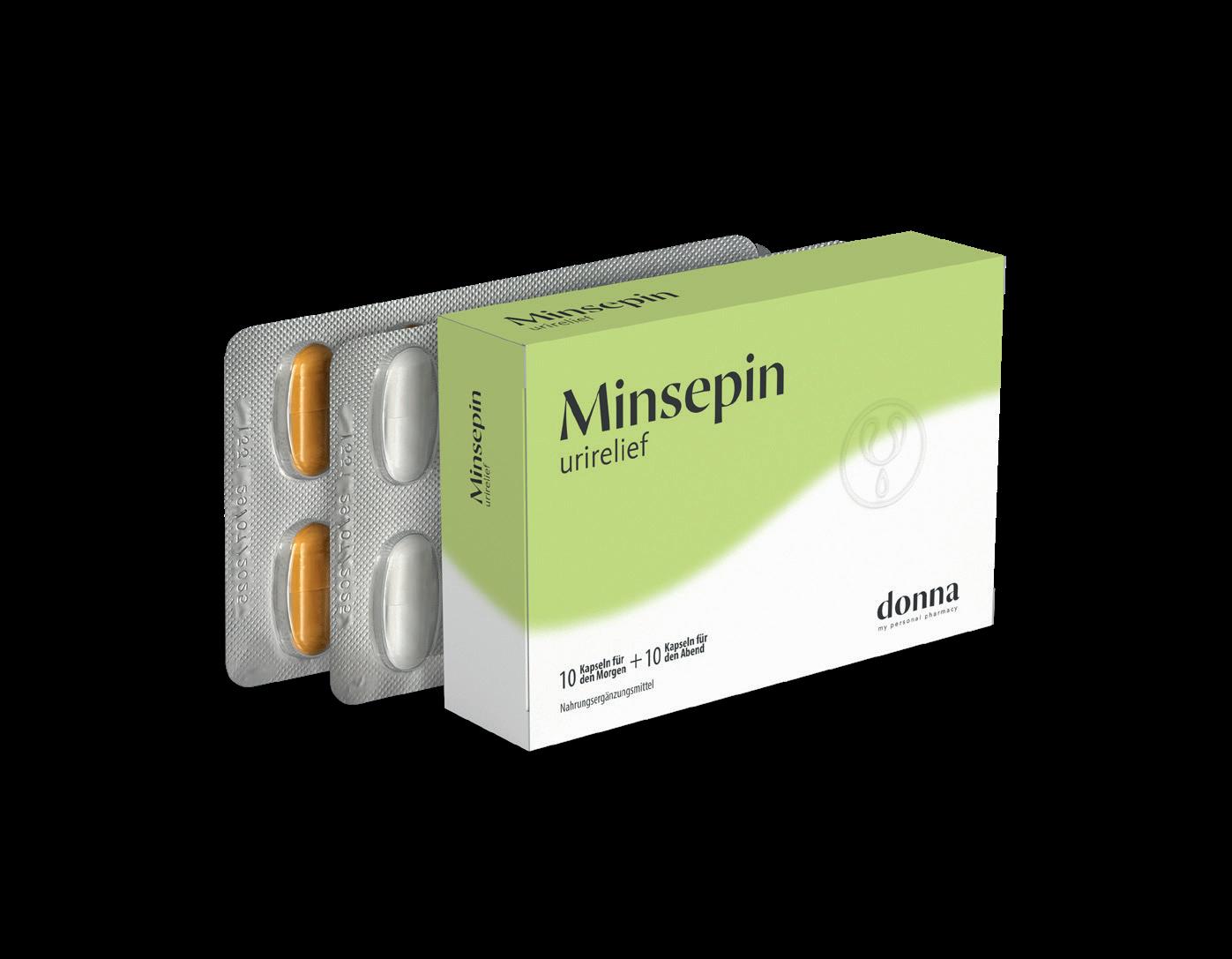
Unterstützt
Erhältlich in Apotheken. Vegan Glutenfrei Laktosefrei Zuckerfrei * Indische Berberitze (Berberis aristata) unterstützt die Gesundheit der Harnwege. | Ein Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. NEU WEG MIT DEM HARNWEGSINFEKT www.minsepin.at AT-MIN-0524-002 Benutzerinformation
Harnwege haben. Bei Männern wird immer von einer komplizierten Infektion ausgegangen.
Unkomplizierte Harnwegsinfekte sind grundsätzlich einfach zu behandeln. Antibiotika sind indiziert, etwa ein Drittel der Patientinnen genest auch ohne sie innerhalb einer Woche. Die Mehrheit benötigt aber eine antibakterielle Therapie zur Besserung der Symptome, in seltenen Fällen kann es ohne Behandlung auch zu einer Pyelonephritis oder Sepsis kommen. In Zeiten fortschreitender Antibiotikaresistenzen zeichnet sich hier langsam ein Problem ab. Die richtige Anwendung ist deshalb von großer Bedeutung. So sollten Antibiotika mit einem allzu breiten Wirkspektrum nicht routinemäßig verwendet werden, nicht nur, weil sie dem körpereigenen Mikrobiom schaden, sondern auch, weil sie die Entstehung resistenter Erreger fördern. Auch das einst ausgiebig verschriebene Fluoroquinolon ist inzwischen kontraindiziert. Die Resistenzanteile sind bei jenem
Breitbandantibiotikum bereits sehr hoch, außerdem kann es zu schweren, manchmal langanhaltenden Nebenwirkungen in multiplen Organsystemen führen.2
In der S3-Leitlinie3 zum Thema wird empfohlen, bei der Wahl des Antibiotikums die lokale Resistenzsituation zu berücksichtigen. Allerdings werden mikrobiologische Analysen routinemäßig nur bei komplizierten Fällen durchgeführt. Daten zur Lage bei den wesentlich häufigeren unkomplizierten Entzündungen fehlen also.
Resistenzlage klären
Um die Datenlage in diesem Bereich zu verbessern, wurde von 2019 bis 2021 eine deutschlandweite Querschnittstudie mit dem Titel „Red Ares“ durchgeführt, in der die Resistenzanteile ausgewählter Erreger von unkomplizierten Harnwegsinfekten bezüglich aller in der S3-Leitlinie empfohlenen Antibiotika untersucht wurden.4
INFO
Unkompliziert vs. kompliziert – was sind die Unterschiede?
Eine genaue Definition gibt es nicht. Die Unterscheidung existiert in erster Linie, um einschätzen zu können, wie gefährlich die Harnwegsinfektion für die betroffene Person ist. Als unkompliziert gelten Fälle, die leicht behandelbar sind und bei denen keine unmittelbare Gefahr einer Ausweitung besteht. Expert:innen ziehen die Grenze zwischen den beiden Typen deshalb an unterschiedlichen Stellen. Dennoch gibt es im Wesentlichen einen Konsens darüber, was als unkomplizierter, und was als komplizierter Harnwegsinfekt gelten soll.
Unkomplizierte Harnwegsinfektion: Zystitis oder Pyelonephritis bei prämenopausalen, erwachsenen, nicht schwangeren Frauen. Es liegen keine Anomalien der Harnwege und keine Komorbiditäten vor, die zu schwerwiegenden Folgen führen könnten.
Komplizierte Harnwegsinfektion:
Bei Kindern, Männern, postmenopausalen Frauen und Schwangeren wird im Allgemeinen automatisch von einem komplizierten Infekt ausgegangen. Männer sind etwa anatomisch wesentlich besser vor Harnwegsinfekten geschützt als Frauen. Wenn es dennoch zu einer HWI kommt, ist die Wahrscheinlichkeit deshalb hoch, dass eine Komorbidität vorliegt, die diese begünstigt. Bei Schwangeren finden physiologische Veränderungen statt, wie zum Beispiel die Entspannung der Harnwege, die das Risiko einer Ausweitung der Infektion erhöhen. Beispiele für Anomalien und Komorbiditäten, die für eine komplizierte Harnwegsinfektion sprechen:
� Obstruktion des Urinflusses (z. B. durch eine Prostatahyperplasie)
� Schlecht eingestellter Diabetes
� Chronische Nierenerkrankungen
� Immunschwäche
� Kürzliche Operation des Harntrakts
Die gemessenen Resistenzanteile unterschieden sich je nach Erreger, regional aber nur geringfügig. Besonders interessant: Die Resistenzanteile betreffend Fosfomycin liegen durchschnittlich bei unter 2 %, obwohl dieses zu den am häufigsten verschriebenen Antibiotika gehört. Es dürfte die Verbreitung von Resistenzen also nicht fördern. Tatsächlich wiesen fosfomycinresistente Isolate keine multiplen Resistenzen auf und besaßen auch keine plasmidischen Resistenzgene. Bei Zweite-Wahl-Antibiotika hingegen liegt keine bessere Resistenzsituation vor als bei jenen erster Wahl. In Österreich fehlen extensive Studien zur Resistenzlage bei unkomplizierten Harnwegsinfekten noch weitgehend. Abhilfe schaffen kann die Identifikation von Risikofaktoren für Resistenzen ohne mikrobiologische Diagnose anhand von Patient:inneneigenschaften. Laut einem im Journal of Global Antimicrobial Resistances veröffentlichten Artikel gehören zu diesen das Alter (erhöhtes Risiko ab 55 Jahren), rezidivierende Harnwegsinfekte, bestehende chronische Krankheiten, eine unlängst erfolgte Antibiotikaeinnahme, eine Hospitalisierung innerhalb der letzten sechs Monate, eine kürzlich unternommene Reise in ein Land mit einer hohen Rate antimikrobieller Resistenzen und eine Urinkultur aus dem vergangenen Jahr, die eine bestehende Resistenz gezeigt hat.5
Weil Antibiotikaresistenzen auf dem Vormarsch sind, wird auch hier nach nicht antimikrobiellen Alternativen gesucht. Tatsächlich gibt es einige vielversprechende pflanzliche Arzneien – ob sie Antibiotika vollständig ersetzen können, ist aber noch nicht geklärt. Analgetika hingegen zeigen in Studien eine schlechtere Wirkung als Antibiotika.
Felicia Steininger
Quellen:
1 Fille M, Journal für Urologie und Urogynäkologie/ Österreich, 2020.
2 EMA/175398/2019, Quinolone- and fluoroquinolonecontaining medicinal products – referral.
3 AWMF, S3-Leitlinie zum Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen (HWI), Register-Nr. 043-044, 2024.
4 Klingeberg A et al., Deutsches Ärzteblatt 2024; 121:175-81.
5 Wagenlehner F et al., Journal of Global Antimicrobial Resistance 2022; 28:18-29.
Hausärzt:in DIALOG Gyn/Uro 42 Juni 2024
Raus aus dem Blasenstress mit Canephron® forte: Wirkt
Leitlinien-
4-fach bei akutem unkompliziertem Harnwegsinfekt
Rosmarin, Tausendgüldenkraut und Liebstöckel lindern Beschwerden wie Brennen, Schmerzen und Krämpfe und spülen Bakterien aus
Symptomorientierte Therapie gemäß S3-Leitlinie mit Canephron® forte1 Entsprechend der kommenden S3-Leitlinie geht es im Wesentlichen darum, die klinischen Symptome binnen Tagen zum Abklingen zu bringen. Dabei sollte die alleinige symptomatische Therapie, zum Beispiel mit Canephron® forte (= BNO 1045), als Alternative zur antibiotischen Behandlung erwogen werden.
Geballte 4-fach Wirkung2
Canephron® forte vereint die Wirkstoffe von Rosmarinblättern, Tausendgüldenkraut und Liebstöckelwurzel und bietet ein breites Wirkspektrum. Canephron® forte wirkt:
Antiphlogistisch: Brennen beim Wasserlassen lässt nach.
Analgetisch: Schmerzen beim Urinieren werden gelindert.
Spasmolytisch: Krämpfe im Unterleib werden schwächer.
Antiadhäsiv: Bakterienanheftung wird gehemmt, die Keime werden leichter ausgespült.
Auf Augenhöhe mit Antibiotika4
In klinischen Studien bei Patientinnen mit unkomplizierten Harnwegsinfektionen zeigte sich, dass Canephron® forte mit Antibiotika auf Augenhöhe ist.4,5 Mit dem 4-fach Wirkomplex hilft Canephron® forte rasch und effektiv bei Blasenentzün-

dungen.3 Sollte ein Antibiotikum verschrieben worden sein, kann ergänzend dazu Canephron® forte empfohlen werden. Die Einnahme von Canephron® forte für weitere drei Monate, nach Ende der Antibiotikatherapie, zeigte eine deutlich niedrigere Rate an wiederkehrenden Harnwegsinfekten. In der Kombinationstherapie traten um 73 % weniger rezidivierende Harnwegsinfekte auf.6
Das Mikrobiom schonen Ein Vorteil von Canephron® forte ist – im Vergleich zur antibiotischen Therapie – die Mikrobiomschonung. Viele unerwünschte Wirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, Allergien oder vaginale Pilzerkrankungen entstehen durch Verschiebungen der körpereigenen bakteriellen Besiedlung. Mit Canephron® forte bleibt das Mikrobiom weitgehend unbeeinflusst.
Geballte 4-fach Wirkung gegen den Harnwegsinfekt

Empfehlung für Canephron® forte, weil ...
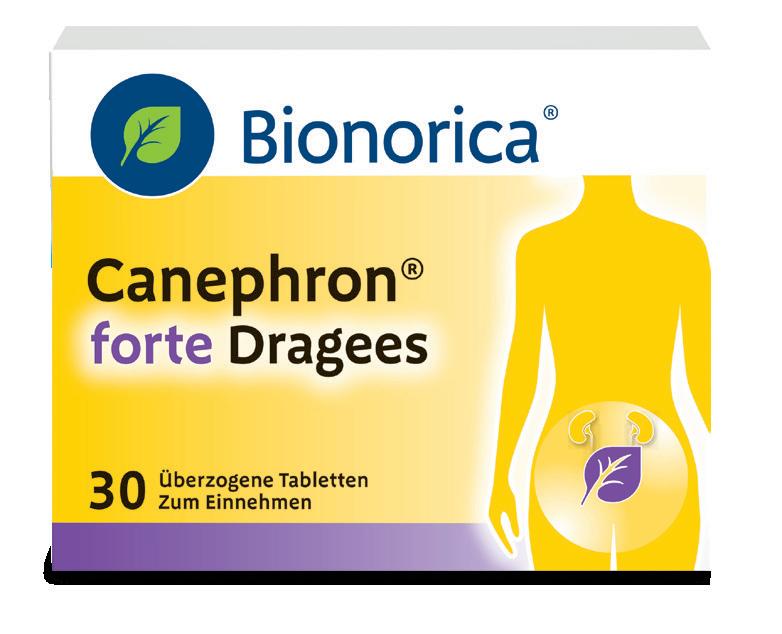
S3-Leitlinienempfehlung 1 Wirkung: schmerzlindernd, krampflösend, entzündungshemmend, bakterienausspülend 3 Auf Augenhöhe mit Antibiotikum 4,5 Gute Verträglichkeit und Mikrobiom schonend
1. Kommende interdisziplinäre AWMF S3-Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Konsultationsfassung 2024. 2. Fachinformation Canephron® 3. Die pharmakologischen Eigenschaften der Pflanzen sind durch in vitro, in vivo und ex vivo Untersuchungen in der Literatur belegt. 4. Wagenlehner F. M. et al. 2018 Non antibiotic herbal therapy (BNO 1045) versus antibiotic therapy (fosfomycon trometamol) for the treatment of acute lower uncomplicated urinary tract infections in women: A double-blind, parallel-group, randomized, multi-centre, non-inferiority Phase III Trial. Urol Int. 2018; 101(3):327-336. doi:10.1159/000493368. Epub 2018 Sep 19
5. Höller M. et.al.: Treatment of Urinary TractInfections with Canephron® in Germany: A Retrospective Database Analysis. Antibiotics 2021, 10, 685. https://doi.org/10.3390/antibiotics10060685. 6. Ivanov D. et al. (2004): Therapeutic effects of Canephron® in treatment of urinary tract infections in diabetes II type patients with metabolic syndrome, Zdorov’ya Ukrainy (Health of Ukraine), 21 (106). Fachkurzinformation
Seite Traditionell pflanzliches Arzneimittel, dessen Anwendung bei unkomplizierten Harnwegsinfekten ausschließlich auf langjähriger Verwendung beruht. BNO-AT_CAN-31_5/2024
siehe
Dosierung Erwachsene & Jugendliche ab 12 Jahren: 3 x täglich 1 Dragee
Canephron® forte Nicht antibiotische Therapiestrategie
Empfehlung AWMF 1
HARNWEGSINFEKT
BEZAHLTE ANZEIGE
64.
UNTERSTÜTZT VON DR. BÖHM®
Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Phytotherapie und Mikronährstoffen

Maga. pharm.
Susanne Lesch
Research and Development Scientist
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Omega-3-Fettsäuren –Stars unserer Zeit
IM FANCLUB: HERZ, GEFÄSSE – UND VIELE MEHR!
Mittlerweile sind EPA und DHA längst keine „Sternchen“ mit kleiner Fangemeinde mehr, sondern genießen eine Art Kultstatus. Betrachtet man die zahlreichen, sehr unterschiedlichen, positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit ist der Hype um diese essenziellen Omega-3-Fettsäuren mehr als gerechtfertigt. Am besten erforscht ist sicherlich ihr Potential erhöhte Blutfettwerte zu senken, insbesondere bei Hypertriglyceridämie mit der daraus resultierenden Risikoreduktion für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wissenschaftlich belegt sind darüber hinaus eine entzündungshemmende Wirkung, Blutdrucksenkung und eine verbesserte Gehirnfunktion. Entscheidend für diese Wirkungen von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, das zeigt die Studienlage, ist eine ausreichend hohe Konzentration.
Neben Kohlenhydraten und Proteinen zählen Fette als dritte große Gruppe zu den Makronährstoffen und dienen dem Körper als Energielieferanten. Ernährungsphysiologisch sind aber nicht die Fette, sondern vielmehr die am Glycerin veresterten Fettsäuren von Interesse. Omega-3-Fettsäuren reihen sich neben den für die Gesundheit potenziell schädlichen, gesättigten Fetten, als mehrfach ungesättigte Fettsäuren in diese Gruppe ein. Die wichtigsten Vertreter sind α-Linolensäure (ALA), Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). Im Körper haben Omega-3Fettsäuren eine große Bedeutung weil sie einen wichtigen Bestandteil in der
Zellmembran bilden und bei Bedarf zu Botenstoffen mit hormonähnlicher Wirkung, den sogenannten Eicosanoiden (Prostaglandine, Leukotriene etc.) abgebaut werden.1
Omega-3- und Omega-6Fettsäuren im Vergleich Abhängig von der Ausgangssubstanz (Omega-3- oder Omega-6-Fettsäure) entfalten die Metaboliten entgegengesetzte Effekte (Abb. 1). Eicosanoide aus Omega-6-Fettsäuren (z. B. Arachidonsäure oder Linolsäure) werden oftmals als „schlecht“ bezeichnet, da sie entzündungsfördernde und plaquebildende Eigenschaften aufweisen. Dagegen
Die Wirkung von Omega-3- vs. Omega-6-Fettsäuren
Omega-6Fettsäuren Omega-3Fettsäuren
Entzündung
Bronchien (Erweiterung)
Blutdruck (Gefäßverengung)
Thrombozytenaggregation
Blutfette*
Abb. 1: Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren haben entgegengesetzte Wirkungen im Körper.
*Wirkung von Omega-3-Fettsäuren auf die Blutfettwerte: Triglyceride↓, LDL-C↓ und oxLDL↓, HDL↑
UPDATE
SCIENTIFIC
BEZAHLTE ANZEIGE
entstehen aus den Omega-3-Fettsäuren α-Linolensäure, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure die „guten“ Eicosanoide, welche antithrombotisch, antiatherogen, antihypertensiv und antiinflammatorisch wirksam sind.2,3
Sowohl Omega-3-, als auch Omega-6Fettsäuren haben demnach bedeutende, aber in ihrer Funktion, gegensätzliche Wirkungen. Von „gut“ oder „schlecht“ kann nur dann die Rede sein, wenn im Körper ein Missverhältnis vorliegt. Durch die moderne, westliche Ernährung werden meist zu große Mengen Omega-6-Fettsäuren aufgenommen und das Gleichgewicht in Richtung entzündlicher Prozesse verschoben. Das Idealverhältnis der zugeführten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sollte bei 1:5 oder darunter liegen. In Europa liegt es aktuell jedoch bei 1:20 und ist somit viel zu hoch.4,5
Bedeutung für das Herz-Kreislauf-system Plaquebildung und dadurch bedingte Verengung der Gefäße (Atherosklerose) steht im direkten Zusammenhang mit kardiovaskulären Folgeerkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt. Neben den direkten antithrombotischen, antientzündlichen und plaquestabilisierenden Eigenschaften der

Omega-3-Fettsäuren, wirken sich die aus ihnen gebildeten Botenstoffe zusätzlich günstig auf die Blutfettwerte, allen voran die Triglycerid-Spiegel aus. Der Plaquebildung in den Gefäßen wird dadurch auf mehreren Wegen entgegengewirkt. Da sie darüber hinaus auch noch antihypertensiv wirken und die Fließeigenschaft des Blutes verbessern, gelten Omega-3-Fettsäuren als besonders effektiv in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.6
Abnahme des Triglyceridspiegels durch Omega-3-Fettsäuren
Gesamt In Statintherapie
Wissenschaftliche Datenlage zu Omega-3-Fettsäuren
Triglyceridwerte werden signifikant gesenkt Erhöhte Triglyceridwerte (>150 mg/dL) betreffen etwa 15-20 % der europäischen Bevölkerung und sind ein bedeutender Risikofaktor für die Entstehung einer Atherosklerose.7 Oberstes Ziel ist es durch eine Reduktion erhöhter Triglycerid-Spiegel Ablagerungen in den Gefäßen abzuwenden. Hierbei unterstützen Omega-3-Fettsäuren, indem sie die körpereigene Triglycerid-Produktion in der Leber verringern. Im Dosierungsbereich von 1-4 g EPA und DHA pro Tag wird eine durchschnittliche Senkung des Triglyceridspiegels um 20-30 % beobachtet.8–10
Wissenschaftlich bestätigt wird diese Omega-3-induzierte Reduktion durch eine erst kürzlich erschienene Metaanalyse mit mehr als 72.500 Probanden. Aus den vorliegenden 90 randomisierten, Placebo-kontrollierten Studien kann man bei Dosierungen von 1-4 g/Tag eine signifikante, dosisabhängige Senkung der Triglycerid-Spiegel ableiten (Abb. 2).11
SCIENTIFIC UPDATE – OMEGA 3
Abb. 2: Lineare Abnahme der Triglycerid-Konzentration durch Supplementierung von EPA und DHA in einem Dosierungsbereich von 1-4 g/Tag.
Abnahme
Omega-3-Fettsäuren
50 0 -50 -100 -150 -200 0 1 2 3 4 BEZAHLTE ANZEIGE
der Triglyceride[mg/dL]
[g/Tag]
Gesamtcholesterin ohne HDL-C (= non-HDL-C*)
4 g Olivenöl (Placebo) + Statin
2 g Omega 3 + Statin
4 g Omega 3 + Statin
*LDL, VLDL
% Abweichung von Basiswert während 6-wöchiger Anwendung
Abb. 3: Dosisabhängige Verbesserung des Lipidprofils durch zusätzliche Einnahme von Omega 3 zu einer bestehenden Statin-Therapie im Vergleich zu Placebo.
Omega-3-Fettsäuren optimieren die Statinwirkung Statine sind der Goldstandard zur Behandlung erhöhter Cholesterinwerte. Durch die Hemmung der HMG-CoAReduktase bewirken sie eine verminderte körpereigene Cholesterin-Synthese, ohne dabei die Triglyceridwerte zu beeinflussen. Um jedoch ein gesundes Lipidprofil zu erreichen, bedarf es daher einer zusätzlichen Reduktion der Triglyceride. Diesen Effekt erreicht man, indem die Statintherapie durch eine Omega3-Supplementierung ergänzt wird.12 Die Überlegenheit einer solchen Kombinationstherapie wird durch eine klinische Studie mit 647 Teilnehmern bestätigt. Die Verum-Gruppe erhielt neben ihrer bestehenden Statin-Medikation zusätzlich 2 bzw. 4 g Omega-3-Fettsäuren, die Placebogruppe reines Olivenöl. Man beobachtete eine dosisabhängige Senkung der Triglycerid- und nonHDL-Cholesterinwerte (LDL+VLDL). Außerdem bewirkte eine höhere Omega3-Dosis einen Anstieg des „guten“ HDL-Cholesterins (Abb. 3).13
Zusätzliche Gabe von Coenzym Q10 unterstützt den Effekt noch weiter Statine bewirken durch die EnzymInhibition neben einer Senkung der Cholesterinwerte auch die Reduktion der körpereigenen Coenzym-Q10-Synthese als unerwünschten Nebeneffekt.14 Ein wesentlicher Prozess bei der Entstehung von Plaques in den Blutgefäßen ist die
Oxidation von LDL zum sogenannten oxLDL durch freie Radikale. Coenzym Q10 verhindert als Radikalfänger diesen Schritt und wirkt damit antiatherogen (Abb. 4).15 Sinken die Coenzym Q10-Spiegel aufgrund einer Statintherapie bleibt dieser protektive Effekt aus. Durch die Dreifachkombination (Statine, Omega 3, Coenzym Q10) werden somit nicht nur die Nebenwirkungen der Statine verringert, sondern die Therapie um die Omega-3 bedingte Triglyceridsenkung und die direkte antiatherogen Wirkung des Coenzym Q10 erweitert und optimiert.16,17
Weitere positive Effekte der Omega-3 Fettsäuren Senkung des Blutdrucks: Studien belegen einen blutdrucksenkenden Effekt
von EPA und DHA vor allem bei höheren Konzentrationen. Die Wirkung verschiedener Omega-3-Dosierungen wurde in einer Metaanalyse, die insgesamt 71 Studien und 4.973 Teilnehmer umfasste, untersucht. Insgesamt beobachtete man eine signifikante Senkung der systolischen (p < 0,0001) und diastolischen (p < 0,01) Blutdruckwerte. Im Dosierungsbereich von 2 bis 3 g EPA und DHA pro Tag zeigte sich die stärkste Wirkung.18
Verbesserte Gehirnfunktion: DHA ist mit mehr als 40 % die mengenmäßig am häufigsten im Gehirn vorkommende Fettsäure und essenzieller Bestandteil neuronaler Strukturen. Darum wird sie in besonders hohem Ausmaß während der fötalen Gehirnentwicklung und in den ersten Lebensmonaten benötigt. Omega-3-Fettsäuren sind jedoch nicht nur in dieser Entwicklungsphase bedeutend, sondern leisten in allen Lebensabschnitten durch eine verbesserte Gehirndurchblutung und Signalübertragung sowie entzündungshemmende Wirkung einen essenziellen Beitrag für eine gesunde Gehirnfunktion.19,20 So verringern Dosierungen von etwa 1 g DHA täglich den geistigen Abbau und das Auftreten von Demenz um rund 20 %.21
Antiinflammatorische Wirkung: eine häufige Ursache für Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder etwa neurodegenerative Veränderungen
Plaque
CoQ10
oxLDL
LDL-Cholesterin
Freies Radikal
Inaktives Radikal
Schaumzelle
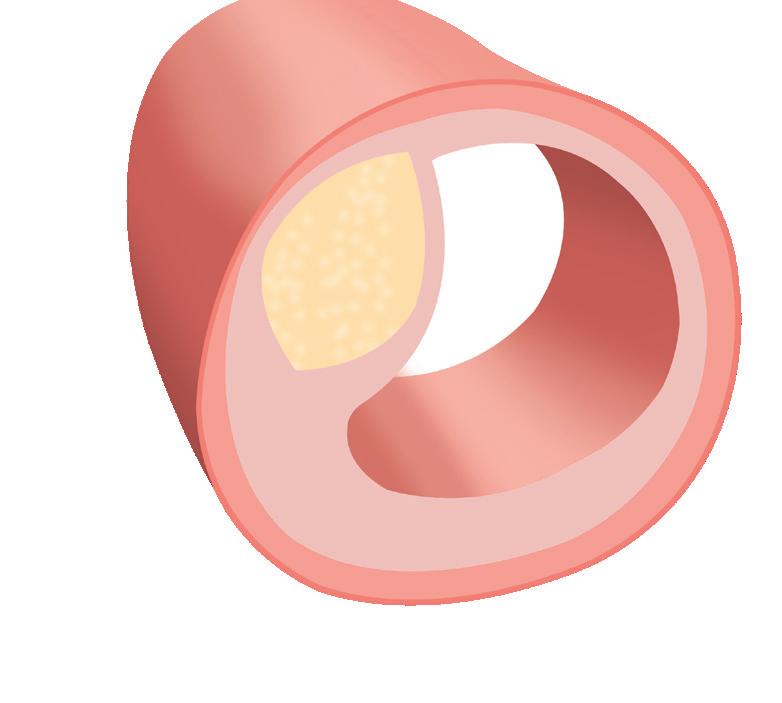
Lumen
Endothel
Abb. 4: Das im Blut vorliegende LDL-C lagert sich im Endothel ein, wo es durch freie Radikale oxidiert wird (oxLDL) und eine Entzündungsreaktion hervorruft. In weiterer Folge kommt es zur Bildung von Schaumzellen, arteriosklerotische Plaques entstehen und führen zu einer Gefäßverengung. Endogene, lipophile Antioxidantien wie etwa Coenzym Q10 können LDL-C vor Oxidation schützen. Ist es bereits zu einer Plaquebildung gekommen, wirken Omega-3-Fettsäuren stabilisierend und entzündungshemmend.
SCIENTIFIC UPDATE – OMEGA 3
Triglyceride -5,9 -14,6 -20,6 -0,9 -3,9 -6,9 +2,6 +2,2 +3,3
HDL-C
BEZAHLTE ANZEIGE
Zugelassener EFSA Health-Claim Täglich erforderliche Aufnahmemenge
EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei.
EPA und DHA tragen zur Erhaltung normaler Blut-Triglyceridspiegel bei.
EPA und DHA tragen zur Erhaltung eines normalen Blutdrucks bei.
DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei.
DHA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.
Abb. 5: Zugelassener EFSA Health-Claim zu EPA und DHA
sind stille Entzündungen (silent inflammations). Diese werden deshalb als „still“ bezeichnet, weil die klassischen Symptome einer Entzündungsreaktion ausbleiben und Betroffene meist nur zufällig über den Laborbefund davon erfahren. Die Entzündungswerte sind dabei latent erhöht, da sie vermehrt im viszeralen Fettgewebe gebildet werden.
In einer Übersichtsarbeit untersuchte man die entzündungshemmende Wirkung von Omega-3-Fettsäuren bei bestehender Herzinsuffizienz. Dabei wurde eine signifikante Senkung der Entzündungsmarker IL-6 (p < 0,0001) und TNF-α (p < 0,0005) beobachtet.22 Als besonders aussagekräftig gilt der hochsensitive Marker hs-CRP. Dieser wird herangezogen, um das Risiko für die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen abschätzen zu können. In einer randomisierten, Placebo-kontrollierten Studie (n=46) konnte gezeigt werden, dass die 8-wöchige Einnahme von 720 mg EPA und 480 mg DHA täglich zu einer signifikanten Reduktion (p < 0,02) des hs-CRP-Markers führt.23
mind. 250 mg/Tag
mind. 2 g/Tag
mind. 3 g/Tag
mind. 250 mg/Tag
mind. 250 mg/Tag
EFSA bewertet folgende Funktionen positiv
Zahlreiche Effekte der Omega-3-Fettsäuren wurden von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertet. Die zugelassenen Aussagen zu Omega-3-Fettsäuren in Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln werden in Abb. 5 aufgelistet. Wie aus der Tabelle ersichtlich sind die erforderlichen Mengen an EPA und DHA zum Teil sehr hoch und der Bedarf kann über die Ernährung kaum gedeckt werden. Um die gewünschten Dosen von 1-4 g supplementieren zu können, eignen sich vor allem Fischölkonzentrate (z. B. in Kapseln), die gegenüber Fischöl aus der Flasche einen weitaus höheren Anteil an EPA und DHA aufweisen. Denn unerwünschte gesättigte Fettsäuren, die im Fischöl enthalten sind, werden beim Ankonzentrieren abgetrennt und durch die wertvolle Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure ersetzt (Abb. 6).
Die natürliche Triglyceridform – und das ist für die Bioverfügbarkeit wichtig –bleibt dabei erhalten.24, 25
Fazit
Omega-3-Fettsäuren als wichtiger Bestandteil der Ernährung sind zu Recht die Stars unserer Zeit oder viel mehr unserer Gesundheit. Sie wirken wissenschaftlich erwiesen antihypertensiv, antiinflammatorisch und plaquestabilisierend und reduzieren damit das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen. Mit Statinen kombiniert können sie ihr volles Potential ausspielen und tragen durch die Senkung der Triglyceride wesentlich zum Therapieerfolg bei. Werden sie supplementiert, ist vor allem auf hohe EPAund DHA-Mengen zu achten, die durch hochwertige Fischölkonzentrate leicht zu realisieren sind.
Patentierte Fischölkonzentrate
andere ungesättigte Fettsäuren gesättigte Fettsäuren

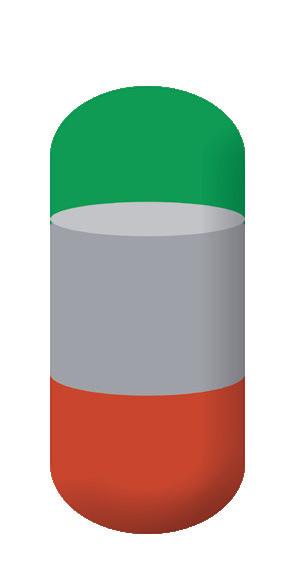
Abb. 6: Gereinigte Fischölkonzentrate weisen einen deutlich höheren Gehalt an EPA und DHA auf als Fischöl, bei gleichzeitig geringerem Anteil an unerwünschten gesättigten Fettsäuren.
References: 1 Hahn A, Ströhle A, Wolters M, Behrendt I, Heinen D. Ernährung: Physiologische Grundlagen, Prävention, Therapie. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2016.; 2 Drenjančević I, Pitha J. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids-Vascular and Cardiac Effects on the Cellular and Molecular Level (Narrative Review). IJMS. 2022;23(4). doi:10.3390/ijms23042104.; 3 Bercea C-I, Cottrell GS, Tamagnini F, McNeish AJ. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and hypertension: a review of vasodilatory mechanisms of docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid. Br. J. Pharmacol. 2021;178(4):860-877. doi:10.1111/bph.15336.; 4 Simopoulos AP. An Increase in the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio Increases the Risk for Obesity. Nutrients. 2016;8(3):128. doi:10.3390/nu8030128.; 5 D-A-CH-Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 2. Aufl. Neustadt an der Weinstraße: Neuer Umschau Buchverl; 2015.; 6 Nayda NC, Thomas JM, Delaney CL, Miller MD. The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid intake on blood levels of omega-3s in people with chronic atherosclerotic disease: a systematic review. Nutr Rev. 2023;81(11):1447-1461. doi:10.1093/nutrit/nuad020.; 7 Parhofer KG, Laufs U. The Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia. Dtsch Arztebl Int. 2019;116(49):825-832. doi:10.3238/arztebl.2019.0825.; 8 Bornfeldt KE. Triglyceride lowering by omega-3 fatty acids: a mechanism mediated by N-acyl taurines. J Clin Invest. 2021;131(6). doi:10.1172/JCI147558.; 9 Skulas-Ray AC, Wilson PWF, Harris WS, et al. Omega-3 Fatty Acids for the Management of Hypertriglyceridemia: A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2019;140(12):e673-e691. doi:10.1161/CIR.0000000000000709.; 10 Leslie MA, Cohen DJA, Liddle DM, Robinson LE, Ma DWL. A review of the effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on blood triacylglycerol levels in normolipidemic and borderline hyperlipidemic individuals. Lipids Health Dis. 2015;14:53. doi:10.1186/s12944-015-0049-7.; 11 Wang T, Zhang X, Zhou N, et al. Association Between Omega-3 Fatty Acid Intake and Dyslipidemia: A Continuous Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2023;12(11):e029512. doi:10.1161/JAHA.123.029512.; 12 Choi HD, Chae SM. Comparison of efficacy and safety of combination therapy with statins and omega-3 fatty acids versus statin monotherapy in patients with dyslipidemia: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(50):e13593. doi:10.1097/MD.0000000000013593.; 13 Maki KC, Orloff DG, Nicholls SJ, et al. A highly bioavailable omega-3 free fatty acid formulation improves the cardiovascular risk profile in high-risk, statin-treated patients with residual hypertriglyceridemia (the ESPRIT trial). Clin Ther. 2013;35(9):1400-11.e1-3. doi:10.1016/j.clinthera.2013.07.420.; 14 Mollazadeh H, Tavana E, Fanni G, et al. Effects of statins on mitochondrial pathways. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2021;12(2):237-251. doi:10.1002/jcsm.12654.; 15 Tsai K-L, Chen L-H, Chiou S-H, et al. Coenzyme Q10 suppresses oxLDL-induced endothelial oxidative injuries by the modulation of LOX-1-mediated ROS generation via the AMPK/PKC/NADPH oxidase signaling pathway. Mol Nutr Food Res. 2011;55 Suppl 2:S227-40. doi:10.1002/mnfr.201100147.; 16 Qu H, Guo M, Chai H, Wang W-T, Gao Z-Y, Shi D-Z. Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2018;7(19):e009835. doi:10.1161/JAHA.118.009835.; 17 Tóth Š, Šajty M, Pekárová T, Fedačko J, Spišáková K, Pella D. Complementary effect of combination of statins with coenzyme q10 and omega-3 fatty acids in patients with combined dyslipidemia. Atherosclerosis. 2015;241(1):e207. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.986.; 18 Zhang X, Ritonja JA, Zhou N, Chen BE, Li X. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Intake and Blood Pressure: A Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2022;11(11):e025071. doi:10.1161/JAHA.121.025071.; 19 O' Donovan F, Carney S, Kennedy J, et al. Associations and effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids on cognitive function and mood in healthy adults: a protocol for a systematic review of observational and interventional studies. BMJ Open. 2019;9(6):e027167. doi:10.1136/bmjopen-2018-027167.; 20 Dighriri IM, Alsubaie AM, Hakami FM, et al. Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Brain Functions: A Systematic Review. Cureus. 2022;14(10):e30091. doi:10.7759/cureus.30091.; 21 Wei B-Z, Li L, Dong C-W, Tan C-C, Xu W. The Relationship of Omega-3 Fatty Acids with Dementia and Cognitive Decline: Evidence from Prospective Cohort Studies of Supplementation, Dietary Intake, and Blood Markers. Am J Clin Nutr. 2023;117(6):1096-1109. doi:10.1016/j. ajcnut.2023.04.001.;22 Prokopidis K, Therdyothin A, Giannos P, et al. Does omega-3 supplementation improve the inflammatory profile of patients with heart failure? a systematic review and meta-analysis. Heart Fail Rev. 2023;28(6):1417-1425. doi:10.1007/s10741-023-10327-0.; 23 Mortazavi A, Nematipoor E, Djalali M, et al. The Effect of Omega-3 Fatty Acids on Serum Apelin Levels in Cardiovascular Disease: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Rep Biochem Mol Biol. 2018;7(1):59-66.; 24 Dyerberg J, Madsen P, Moller JM, Aardestrup I, Schmidt EB. Bioavailability of marine n-3 fatty acid formulations. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2010;83(3):137-141. doi:10.1016/j.plefa.2010.06.007.; 25 Schuchardt JP, Hahn A. Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013;89(1):1-8. doi:10.1016/j.plefa.2013.03.010.
SECHS MARKENZEICHEN FÜR QUALITÄT:
SCIENTIFIC UPDATE – OMEGA 3
gesättigte Fettsäuren andere ungesättigte Fettsäuren EPA + DHA 20 % 29 % 51 % Fischöl EPA + DHA
>80 % 0,2 % 15 %
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail: science@apomedica.com BEZAHLTE ANZEIGE
Schutz fürs Gehör
Tipps für einen gesunden HNO-Bereich im Urlaub


GASTAUTORIN:
Mag.a Dr.in Gabriele
Kerber-Baumgartner
Apothekerin, dipl. TEM-Praktikerin, Naturpraktikerin, Mykotherapeutin, Kremsmünster apotheke-hofwiese.at
Endlich ist der Sommer da! Für viele bedeutet das, den langersehnten Urlaub anzutreten. Sie nutzen die Zeit, um zu entspannen, neue Abenteuer zu erleben, zu sporteln oder die Welt zu erkunden. Oft denken Kund:innen bei der Vorbereitung auf eine Urlaubsreise an Durchfall oder Sonnenbrand. Einerlei, ob sie an den Strand fahren, Berge erklimmen oder historische Städte erkunden: Während man sich auf die Entdeckung neuer Orte konzentriert, ist es auch wichtig, das Gehör und den Nasen-Rachen-Raum nicht zu vernachlässigen, um Beschwerden zu vermeiden.
Bereits auf der Hinreise sind Ohren und Rachen gefährdet und das unabhängig davon, ob man mit Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug ankommt: Wegen der Austrocknung und Kühlung der Schleim-
häute durch Klimaanlagen besteht das Risiko eines akuten Infekts des HNOBereichs. Dabei lässt sich die Klimatisierung leicht moderater einstellen oder das Gehör durch eine dünne Haube schützen. Im Flugzeug muss ferner an die Notwendigkeit des Druckausgleichs gedacht werden. Neben Kaugummikauen können abschwellende Nasensprays und spezielle Ohrstöpsel (Regulation des Druckausgleichs mittels Spezialfilter) hilfreich sein. Kinder sollten während des Start- und Landevorgangs etwas essen bzw. trinken und Säuglinge gefüttert werden, damit eine Druckanpassung gewährleistet ist. Eine Hals- und Rachenentzündung kann ebenfalls durch trockene, klimatisierte Luft verursacht werden. Weitere Faktoren sind Temperaturveränderungen im Gebirge, Staub in der Stadt, Sand und pathogene Keime. Ein solcher Infekt führt zu Halsschmerzen und Schluckbeschwerden, die den Erholungswert des Urlaubs erheblich mindern. Da das Risiko besteht, dass sich die Entzündung verschlimmert und zu Komplikationen wie einer Mittelohr-
oder Mandelentzündung führt, zahlt es sich aus, schon vorab Hals und Rachen zu pflegen. Geeignete Lutschtabletten wirken befeuchtend und schützend. Im Akutfall bieten sich Rachensprays auf Basis von Salbei an, außerdem kann zu entzündungshemmenden Schmerzmitteln gegriffen werden.
INFO
Reiseapotheke für den HNO-Bereich
� Lutschtabletten (befeuchtend oder entzündungshemmend und ev. desinfizierend)
� Rachenspray/Gemmomazerat der Schwarzen Johannisbeere
� Nasentropfen (reinigend und abschwellend)
� Ohrentropfen (reinigend)
� diverse Formen des Ohrenschutzes
� entzündungshemmende Schmerztabletten
Hausärzt:in pharmazeutisch 48 Juni 2024
© shutterstock.com/Igor Link
© Violetta Wakolbinger

Unbeschwert baden und tauchen
Endlich am Urlaubsort angekommen, sehnen sich viele im Sommer nach einem Sprung ins erfrischende Nass. Unsere Ohren wappnen sich zwar durch Fett und einen niedrigen pH-Wert gegen eindringendes Wasser, allerdings: Egal, ob wir am Meer, im See oder Pool baden – beim Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen dringt wiederholt Wasser in den äußeren Gehörgang ein. Unsere natürliche Barriere wird stark beansprucht. Fast jede:r kennt zudem das Gefühl, wenn dieses Wasser dann im Ohr regelrecht „stecken bleibt“ In der Folge kann es zu einer „ Badeotitis“ kommen, die durch Veränderungen des pH-Wertes im Ohr und eingeschwemmte Bakterien verursacht wird. Vorhandenes Ohrenschmalz quillt durch das Wasser auf, bietet Keimen einen guten Nährboden und begünstigt eine Entzündung. Disponierte Personen oder Menschen mit Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus sollten sich überschüssiges Fett bereits im Vorfeld von einer Mediziner:in entfernen lassen. Für alle anderen empfehlen sich reinigende Ohrentropfen, die zumeist mit Essigsäure und Alkohol auf natürlicher Basis eine leichte Desinfektion erzielen und zudem die Entfernung des Wassers aus dem Gehörgang erleichtern. Eine tägliche Anwendung genügt. Wattestäbchen, die in vielen Hotels sogar gratis verfügbar sind, dürfen keinesfalls zur Ohrreinigung verwendet werden. Sie drücken Keime und Ohrenschmalz tiefer in das Ohr hinein, ein Pfropf kann sich bilden. Außerdem kann das Trommelfell gereizt oder verletzt werden.
Hausärzt:in pharmazeutisch 49 Juni 2024 <

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.
y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at
Wartezimmer TV
Besondere Vorsicht bei Allergien
Vor allem bei Kindern und Menschen mit Allergien besteht zudem das Risiko, an einer akuten Mittelohrentzündung zu erkranken. Da der Weg zwischen Rachen und Mittelohr bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen kürzer und enger ist, schwillt dieser leichter zu. Bei Allergiker:innen wird die Symptomatik durch die Grunderkrankung verstärkt. Dies kann bereits durch einen einfachen Schnupfen passieren – oder durch Reizungen der Schleimhaut, etwa durch Sand, Bestandteile des Wassers oder Allergene. Da das Sekret in der Folge nicht abfließen kann, fungiert es als idealer Nährboden für Keime. Unbedingt in die Reiseapotheke gehören daher entzündungshemmende Schmerzmittel. Sie bewirken eine Abschwellung des Gewebes. Auch abschwellende Nasentropfen und Sprays können zweckdienlich sein, sind jedoch vor einem Tauchgang kontraindiziert. Zur Vorbeugung werden darüber hinaus reinigende und pflegende Nasensprays eingesetzt, ferner bieten sich pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel an, beispielsweise das Gemmomazerat der Schwarzen Johannisbeere, um ein Anschwellen zu vermeiden. Lutschtabletten und Tropfen, die die Zusammensetzung des oralen Mikrobioms verbessern, stärken die natürliche Abwehr im HNOBereich.
Schutz vor
Lärm und Sonne
Last, but not least sollte an den Schutz vor Lärm und Sonne gedacht werden. Der Lärmpegel an Urlaubsorten kann hoch sein, sei es durch Straßenlärm, laute Musik in Clubs oder Aktivitäten wie Konzerte und Wassersport. Zu starke Lärmexposition schädigt das Gehör und führt im Extremfall zu vorübergehendem oder sogar dauerhaftem Hörverlust. Bei Veranstaltungen mit Lärmentwicklung sind daher Ohrstöpsel oder ein Gehörschutz zu tragen. Nicht vergessen sollte man, auf die Haut um die Ohren und die vorstehende Nase regelmäßig Sonnencreme aufzutragen. Verschiedene Stoffe aus der Nahrung sowie Nahrungsergänzungsmittel mit Betacarotin, Vitamin E, Polypodiumleucotomos-Extrakt und Asthaxanthin können die Haut schon vor dem Urlaub und beim Sonnenbad unterstützen, einen optimalen Schutz aufzubauen. Nichtsdestotrotz ist im Urlaub ein Hut oder eine Kappe empfehlenswert, um die Ohrmuscheln vor übermäßiger Sonnenexposition zu bewahren.
Komplikationen hintanhalten
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können Beschwerden im Hals-Rachen-Raum während des Urlaubs auftreten. Wenn sich Schmerzen, ein Druckgefühl, Juckreiz oder Hörprobleme einstellen, ist es nötig, eine Ärzt:in zu konsultieren oder zumindest telefonisch Kontakt mit der Hausärzt:in aufzunehmen. Eine frühzeitige Behandlung kann Komplikationen vermeiden! <
Hausärzt:in pharmazeutisch 51 Juni 2024

Fernöstliche Virologie
Ein Verwandter des FSME-Virus ist Enzephalitis-Haupterreger in Asien
Das FSME-Virus kennt hierzulande jedes Kind. Und das zurecht, denn Österreich ist eines der am stärksten betroffenen Gebiete Europas. In Asien ist das von Zecken übertragene Virus ein kleineres Problem – die meisten Fälle viraler Gehirnentzündung gehen dort vom Japanische-Enzephalitis-Virus aus, über das auch Reisende Bescheid wissen sollten.
Häufig bleibende Schäden
Das Japanische-Enzephalitis-Virus sitzt in den Speicheldrüsen infizierter Mücken der Gattungen Culex und Aedes und wird beim Stich auf den Menschen übertragen. Das Virus nutzt dabei das Immunsystem des Wirts für seine Zwecke: Es infiziert bevorzugt dendritische Zellen in der Haut, die dann – ihrer Funktion entsprechend – weitere Zellen des Immunsystems anlocken. Mit diesen gelangt das Virus ins lymphatische System und in die Lymphknoten bis hin zur Milz, wo die Infektion systemisch wird. Wenn innerhalb der ersten Tage eine humorale Immunantwort stattfindet, können die Viruszellen noch eliminiert
werden, sonst überwinden sie die BlutHirn-Schranke und die Infektion geht in die zweite, gefährliche Phase über.1 Wie bei FSME verlaufen die meisten Fälle mild bis asymptomatisch, eine:r von 250 Betroffenen entwickelt eine Enzephalitis. Die Gehirnentzündung zeigt sich an den typischen Symptomen – Fieber, Erbrechen, Bewusstseinseinschränkungen –, verläuft häufig aber wesentlich schwerer als die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Letalität liegt altersabhängig bei bis über 30 %, 30-50 % der Überlebenden tragen bleibende Schäden davon.2 Zum Vergleich: 1 % der FSME-Fälle enden tödlich, wenige Erkrankte entwickeln bleibende Behinderungen.3
Das Japanische-Enzephalitis-Virus ist in Ost- und Südostasien endemisch, wurde aber auch schon außerhalb isoliert – so insbesondere in Australien, wo es nach sporadischen Infektionen in den Jahren davor 2022 zu einem Ausbruch mit 45 dokumentierten Infektionen und sieben Todesfällen kam.4 Wie bei vielen Infektionskrankheiten hat die Erderwärmung auch hier einen negativen Einfluss auf den Menschen. Mit den steigenden Tem-
peraturen vergrößern sich die Moskitopopulationen und deren Verbreitung. Das birgt die Gefahr einer Ausweitung der Endemiegebiete.
Antivirale Therapien fehlen
Der Erreger der Japanischen Enzephalitis gehört genau wie jener der FSME zu den Flaviviren, gegen die es bis heute keine kausalen Therapien gibt. Die Entwicklung eines antiviralen Medikaments ist herausfordernd, weil dieses die BlutHirn-Schranke überwinden und im Zentralnervensystem wirken können müsste. Einige Wirkstoffe funktionieren zwar in vitro und in vivo, zeigen im Menschen aber keinen Effekt. In der Behandlung können bislang also nur Symptome gemildert und die Immunantwort unterstützt werden. Effektiver ist deshalb die Prävention. Reisende sollten Mückenstiche jedenfalls vermeiden – Expositionsprophylaxen wie Moskitonetze, lange Kleidung und Insektensprays werden empfohlen. Außerdem sind mehrere gut wirksame Impfungen verfügbar. In Österreich zugelassen ist ein inaktivierter Ganzvirus-
52 Juni 2024
pharmazeutisch
Hausärzt:in
© shutterstock.com/AI
impfstoff. Die Seroprotektionswerte liegen für Erwachsene bei 93 % bis 100 %, für Kinder und ältere Erwachsene (über 65 Jahre) bei ungefähr 65 %.5 Zur Impfschutzdauer fehlen aber belastbare Daten. Antikörper gegen FSME scheinen die Immunantwort auf den Impfstoff positiv zu beeinflussen. Der Einfluss dieses Umstands auf die Impfeffektivität muss noch untersucht werden. Die Arzneimittelsicherheit gilt als sehr hoch.
Ob Reisende sich impfen lassen sollten, hängt von der Aufenthaltsdauer und dem Reisestil ab. Als Hauptvektor für den Menschen wirkt neben Stechmücken das Schwein, ein Reservoirwirt des Virus. In landwirtschaftlich genutzten Gebieten – insbesondere in der Nähe von Reisfeldern und Schweinezuchten – ist das Ansteckungsrisiko also besonders hoch. Hauptübertragungszeit des Virus ist in gemäßigten Gebieten der Sommer, in tropischen Gebieten die Regenzeit.5
In Endemiegebieten werden bevorzugt attenuierte Lebendimpfstoffe verwendet. In Österreich sind diese nicht zugelassen, die Herstellung inaktivierter Impfungen ist vergleichsweise teuer, weshalb sie vor Ort häufig nicht verfügbar sind. Außerdem ermöglichen Lebendimpfstoffe eine Langzeitimmunität.6
Alle verfügbaren Impfungen basieren auf dem Virusstamm GIII. Aktuell sind fünf Genotypen des Virus bekannt, die alle zum selben Serotyp gehören. Die Kreuzprotektion ist deshalb im Allgemeinen sehr hoch. Gegen den phylogenetisch ältesten Stamm GV ist die Seroprotektion aber reduziert. Dieser tritt sehr selten auf
und war jahrzehntelang ruhend, konnte sich in den vergangenen Jahren aber in Südkorea als dominanter Genotyp etablieren und wurde auch in Malaysia und China isoliert. Immunisierte Personen können sich ebenfalls mit GV infizieren. In Anbetracht des Risikos einer Verbreitung wird an neuen Impfungen gearbeitet, die vor allen Genotypen schützen.7
Felicia Steininger
Quellen:
1 Srivastava K et al., Vaccines 2023; 11(4):742.
2 RKI – Impfungen A-Z – Schutzimpfung gegen Japanische Enzephalitis (abgerufen 04.06.2024).
3 AGES – Krankheitserreger von A bis Z – FSME (abgerufen 04.06.2024).
4 Khan A et al., Annals of Medicine and Surgery 2024; 86(3):1540-1549.
5 Impfplan Österreich 2023/2024 Version 2.0.
6 Chokephaibulkit K et al., Expert Review of Vaccines 2016; 15(2):153-166.
7 Lee A et al., Journal of Microbiology and Biotechnology 2022; 32(8):955-959.
Hausärzt:in pharmazeutisch 53 Juni 2024
Anaphylaxie ist eine schwerwiegende, potenziell tödliche allergische Reaktion. Die Prävalenz wird auf 0,05 bis 2 Prozent geschätzt.1 Hervorgerufen wird sie zumeist durch Immunglobulin E,2 jedoch gibt es auch nichtimmunologische Ursachen, wie etwa Wärme oder Kälte, UV-Strahlung, bestimmte Medikamente, Alkohol oder körperliche Anstrengung. Bei der sogenannten idiopathischen Anaphylaxie kann kein Auslöser identifiziert werden.
Bezeichnend für die Anaphylaxie ist das rasche Auftreten der Symptome. Typischerweise treten die Beschwerden wenige Minuten bis Stunden nach dem Allergenkontakt auf. Zu den kausativen Agenten zählen überwiegend Wespenund Bienengift, bestimmte Lebensmittel sowie Schmerzmittel und Latex.3 Bei Kindern wird eine Anaphylaxie meist durch Lebensmittel hervorgerufen, vor allem durch Erdnüsse, andere Nüsse, Meeresfrüchte, Fisch, Milch, Eier und Sesam. Bei Erwachsenen hingegen sind Insektenstiche und Medikamente die häufigeren Auslöser.4
Die Diagnose basiert primär auf klinischen Manifestationen mit Berücksichtigung mehrerer Systeme. Eine Beteiligung der Haut wird bei 80 bis 90 Prozent,
eine Beteiligung des Respirationstrakts bei 70 Prozent, eine Beteiligung des Gastrointestinaltrakts sowie des kardiovaskulären Systems zu je 45 Prozent der Betroffenen beobachtet.³
Belastende Faktoren
Welche Therapiemaßnahmen primär einzuleiten sind, ist abhängig vom Schweregrad der anaphylaktischen Reaktion (siehe Tabelle). Die Ausprägung des Schocks wiederum kann von verschiedenen Umständen beeinflusst werden. Zu den endogenen Faktoren zählen Alter und Geschlecht sowie Begleiterkrankungen, wie etwa Mastozytose, Asthma oder Schilddrüsenerkrankungen. Als exogene Faktoren gelten Medikamente wie Betablocker, ACE-Hemmer sowie NSAID und durch den Lifestyle bedingte Gegebenheiten wie körperliche oder psychische Belastungen.5
Akuttherapie

Als Therapie der Anaphylaxie kommen sowohl medikamentöse als auch allgemeine Maßnahmen wie Sauerstoffgabe
KLASSIFIZIERUNG ANAPHYLAKTISCHER REAKTIONEN
Grad Haut- und subjektive Allgemeinsymptome Abdomen Respirationstrakt Herz-KreislaufSystem
I Juckreiz, Flush, Urtikaria, Angioödem – – –
II Juckreiz, Flush, Urtikaria, Angioödem
III Juckreiz, Flush, Utrikaria, Angioödem
IV Juckreiz, Flush, Urtikaria, Angioödem
Nausea, Krämpfe, Erbrechen
Rhinorrhö, Heiserkeit, Dyspnoe
Erbrechen, Defäkation
Erbrechen, Defäkation
Tachykardie (Anstieg > 20/min), Hypotension (Abfall > 20 mmHG systolisch), Arrhythmie
Larynxödem, Bronchospasmus, Zyanose Schock
Atemstillstand
Kreislaufstillstand
oder Volumensubstitution zum Einsatz. Die 2021 überarbeitete Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie gibt dafür im Wesentlichen eine einheitliche Behandlungsempfehlung.6 Patient:innen, deren Reaktionen sich nicht ausschließlich auf Haut und Schleimhaut beschränken, werden demnach intramuskulär mit Adrenalin behandelt. Epinephrin-Injektoren stehen je nach Körpergewicht in unterschiedlichen Dosierungen zur Verfügung. Indiziert ist ein Autoinjektor für Personen nach einer früheren Anaphylaxie, bei denen der Auslöser nicht sicher vermeidbar ist – etwa Insektenstiche –, oder für Personen, die ein generell erhöhtes Anaphylaxierisiko aufweisen. Zu den additiven Maßnahmen zählt das umgehende Absetzen eines Notrufs sowie die adäquate Lagerung der Patient:in. Bei Personen, die kardiovaskuläre Symptome und einen herabgesetzten Blutdruck aufweisen, ist es sinnvoll, die Beine hochzulegen. Menschen mit respiratorischen Beschwerden sollten eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen, um die Atmung nicht zusätzlich zu erschweren.7
Nach Adrenalin-Injektion und Sauerstoffversorgung wird für die Applikation weiterer Medikamente und für die Volumensubstitution ein intravenöser Zugang gelegt. Zudem können Antihistaminika und Kortikosteroide gegeben werden. Patient:innen, die wegen einer schweren anaphylaktischen Reaktion mit Adrenalin behandelt wurden, sollten danach noch mindestens acht Stunden stationär überwacht werden, da es >
Hausärzt:in pharmazeutisch 54 Juni 2024 © shutterstock.com/Visual Generation
zu einer biphasischen Reaktion kommen kann. Dann ist eine weitere Adrenalin-Injektion nötig.
Nach der Aktuttherapie
Von Bedeutung ist die Aufklärung über die Vermeidung von Lebensmitteln, insbesondere bei jüngeren Patient:innen mit Lebensmittelanaphylaxie. Wichtige Themen sind Kreuzallergien und die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln. Zudem sollten Betroffene respektive deren Eltern beraten werden, auf welche Lebensmittel sie alternativ zurückgreifen können.
Personen, die auf bestimmte Antibiotika empfindlich reagieren, sollten eine Liste mit alternativen Präparaten erhalten. Sie können diese Liste ihren Ärzt:innen vorlegen, wenn eine Antibiotikatherapie erforderlich ist. Zudem benötigen Personen mit Anaphylaxie eine umfassende Aufklärung über das richtige Verhalten im Notfall und eine Einschulung zur richtigen Anwendung des AdrenalinAutoinjektors. Für Menschen, die überempfindlich auf Insektenstiche reagieren, ist eine Aufklärung über die Vermeidung von Stichen wichtig. Sie sollten beispielsweise blumig duftende Parfums oder bunte Kleidung meiden, da diese Hautflügler anziehen. Für diese Patient:innengruppe kann eine spezifische Immuntherapie sinnvoll sein. Sie bietet nach Einleitung der Behandlung einen sehr guten Schutz, muss aber als Erhaltungstherapie in regelmäßigen
INFO
Bestandteile eines Notfallsets zur Soforthilfe für Patient:innen6
Adrenalin-Autoinjektor zur intramuskulären Applikation, gewichtsadaptiert:
> 7,5-25 kg KG oder > 15-20 kg KG
> 25-50 kg KG oder > 30-50 kg KG
> 50 kg KG
150 µg*
µg*
µg*
H1-Antihistaminikum: nach Patient:innenalter oder -präferenz oral als Flüssigkeit oder (Schmelz-)Tablette.
Die Dosis des jeweiligen Antihistaminikums kann bis auf das Vierfache der Einzeldosis erhöht werden.
Bei Dimetinden-Tropfen kann analog eine gewichtsadaptierte Dosierung der I.-v.-Formulierung für die orale Anwendung empfohlen werden.
Glukokortikoid: nach Patient:innenalter und -präferenz rektal oder oral (als Flüssigkeit oder Tablette) mit 50-100 mg Prednisolonäquivalent. Bei bekanntem Asthma bronchiale oder vorheriger Reaktion mit Bronchospasmus zusätzlich:
ß2-Adrenozeptoragonist, 2 Hübe.
Bei zu erwartender oberer Obstruktion der Atemwege (Larynxödem) zusätzlich: inhalatives Adrenalinpräparat mit Sprühkopf für Arzneimittelfläschchen (extra von der Apotheker:in anfordern).
Hinweis: Ein Notfallset zur Soforthilfe sollte einen Anaphylaxiepass mit schriftlicher Anleitung zur Anwendung der Bestandteile enthalten.
* Zulassung je nach Autoinjektorpräparat.
300
500 – 600
300 –
Hausärzt:in pharmazeutisch 56 Juni 2024
Abständen – alle vier bis sechs Wochen – bis zu fünf Jahre lang erfolgen, um diesen Schutz aufrechtzuerhalten.9
Allergiepatient:innen auf Reisen
Für Personen mit Allergien fallen die Reisevorbereitungen aufwändiger aus, deren Urlaubsfreude kann somit etwas gedämpft werden. Um diesen Menschen einen möglichst stressfreien Urlaub zu ermöglichen, können Ärzt:innen und Apotheker:innen ihren Patient:innen – abgesehen von den nötigen (Notfall-)Medikamenten und einem Allergiepass – auch einige hilfreiche Tipps mit auf die Reise geben. Anhand einer von der European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) erstellten Checkliste ist auf einen Blick ersichtlich, worauf Menschen mit Allergien im Urlaub achten sollten. Diese ist auf ecarf-siegel.org* abrufbar. Auf dieser Website sind zudem aktuell 205 Beherbergungsbetriebe in Österreich und Deutschland angeführt, die das
ECARF-Siegel tragen. Hotels und Pensionen in neun europäischen Urlaubsländern, die sich auf die Bedürfnisse von Gästen mit unterschiedlichen Allergien eingestellt haben, sind auch auf der Website allergiehotel.info* zu finden. Für Menschen mit allergischer Rhinitis hat das aha! Allergiezentrum Schweiz eine Liste von Links zu Pollenwarndiensten zu einigen europäischen Urlaubsländern und den USA zusammengestellt. Diese ist auf pollenundallergie. ch/polleninformationen/pollen-imausland* abrufbar.
Menschen mit Lebensmittelallergien können mitunter mit Speisekarten Probleme haben. Im Allergie-Wörterbuch des ÖAMTC sind etwa 100 verschiedene Lebensmittel in zehn Sprachen aufgelistet und diese können mit „ Ich bin allergisch gegen “ in der jeweiligen Landessprache kombiniert werden. Zu finden ist dieses Wörterbuch zum Download auf oeamtc.at/ thema/reiseplanung/allergie-woerterbuch-16179570*
Margit Koudelka

* zuletzt abgerufen am 14. 06. 2024
Literatur:
1 Lieberman P et al., Ann Allergy Asthma Immunol. 2006 Nov;97(5):596-602.
2 Simons FE, J Allergy Clin Immunol. 2010 Feb; 125(2 Suppl 2):S161-81.
3 Greenberger PA, Immunol Allergy Clin North Am. 2007 May;27(2):273-93, vii-viii.
4 Worm M et al., Dtsch Arztebl Int. 2014 May 23;111(21):367-75.
5 Simons FE, Allergy Clin Immunol. 2009 Oct; 124(4):625-36; quiz 637-8.
6 Ring J et al., Allergo J. 2021;30(1):20-49.
7 Simons FE et al., Allergy. 2007 Aug;62(8):827-9.
8 Dhami S et al., Allergy. 2017 Mar;72(3):342-365.
9 Dhami S et al., Allergy 2017; 72 (3): 342–65.
Hausärzt:in pharmazeutisch 57 Juni 2024 © shutterstock.com/Visual Generation
Hausärzt:in fachkurzinformation 58 Juni 2024
Die Top-Antidiarrhoika nach Menge und Wert
Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead
IQVIA
Austria

• Die Kategorie der Antidiarrhoika (ausschließlich registrierte Arzneimittel) erzielt in den öffentlichen Apotheken und Hausapotheken im MAT April 2024 mit 2,5 Mio. Packungen 11,2 Mio. Euro Umsatz FAP.
• Der entsprechende Markt sinkt aktuell im Vergleich zum Vorjahr um -1,8 % nach Menge und um -0,3 % nach Wert. Im Jahr davor hingegen betrug das Absatzwachstum 17,6 % und das Umsatzwachstum 26,5 %.
• 85,4 % aller Packungen sind rezeptfrei, und Lactobacillus acidophilus ist der am häufigsten verwendete Wirkstoff vor Loperamid und Enterococcus faecalis
© Heuschneider-Platzer
Handelsname
Marktanteil nach Menge (Prozent)
Marktanteil nach Wert (Prozent)
Hersteller/Vertrieb
ANTIBIOPHILUS 25,4 % (1) 21,4 % (1) Germania Pharmazeutika
BIOFLAIR 23,4 % (2) 20,5 % (2) Sanova Pharma
IMODIUM 15,1 % (3) 16,5 % (3) Johnson & Johnson
ENTEROBENE 9,1 % (4) 4,2 % (8) Ratiopharm
OMNIFLORA 6,1 % (5) 5,3 % (7) GSK-Gebro
CARBO-MEDICINALIS 5,6 % (6) 6,3 % (4) Sanova Pharma
HIDRASEC 4,8 % (7) 5,6 % (6) Gebro Pharma
YOMOGI 3,5 % (8) 2,2 % (10) Emonta
TANNALBIN 1,8 % (9) 3,5 % (9) Medicopharm
HYLAK 1,5 % (10) 0,9 % (14) Ratiopharm
• Die Top-10-Produkte nach Menge machen 96,2 % des Gesamtabsatzes aus. Antibiophilus (Germania Pharmazeutika) liegt nach Einheiten an erster Stelle, gefolgt von Bioflair ® (Sanova Pharma) und Imodium® (Johnson & Johnson).
• Die Top-10-Produkte nach Wert umfassen 91,3 % des Gesamtumsatzes. Auch nach Umsatz führt Antibiophilus vor Bioflair ® und Imodium®

* Quelle: IQVIATM DPMÖ sell-out Österreich, Verkäufe der öffentlichen österreichischen Apotheken sowie Großhandelslieferungen an ärztliche Hausapotheken, ATCKlassen A07B Intestinale Adsorbenzien/Antidiarrhoika, A07F Mikroorganismen bei Diarrhoe, A07H Motilitätshemmer, A07X Sonstige Produkte bei intestinalen Funktionsstörungen, ausschließlich registrierte Arzneimittel aus dem Warenverzeichnis I, Absatz/Menge in Einheiten, Umsatz/Werte in Euro, bewertet zum Fabrikabgabepreis (FAP), Wachstum vs. Vorjahr, MAT April 2024 (Mai 2023 bis April 2024 kumuliert).
Stand: April 2024
Hausärzt:in pharmazeutisch 59 Juni 2024 <
Herz aus dem Takt
Österreichische Kardiologische Jahrestagung 2024: Aktuelle Erkenntnisse aus der Rhythmologie
Die heurige Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG)* bot eine Plattform für über 800 Expert:innen, um neueste Forschungsergebnisse und innovative Behandlungsmethoden zu diskutieren. Einen Schwerpunkt stellte dabei die Rhythmologie dar. Jährlich würden in Österreich rund 120.000 Menschen aufgrund von Herzrhythmusstörungen hospitalisiert, machte Univ.-Prof. Dr. Daniel Scherr, Präsident Elect der ÖKG, im Rahmen einer Pressekonferenz am dritten Kongresstag aufmerksam.
Ereignisse verhindern und behandeln Univ.-Prof. Dr. Helmut Pürerfellner, zukünftiger Präsident der European Heart Rhythm Association, betonte: „Wir möchten, dass Pulsmessen bei Patient:innen über 65 Jahre zur Routine wird und zu ihrem Alltag gehört wie das Zähneputzen “ Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, beteiligt sich die ÖKG an der europaweiten Infokampagne #Pulsday, die praktische Anleitungen und Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse bietet. Auf der Jahrestagung wurden zudem Wearables präsentiert, die mithilfe von KI-Algorithmen zukünftig das Erkennen von Herzrhythmusstörungen erleichtern werden. Über Vorhofflimmern sprach OA Priv.-Doz. Mag. Dr. Lukas Fiedler, Direktor des interventionellen Bereichs im LK Wiener Neustadt, und stellte neue Leitlinien zur Schlaganfallprophylaxe vor: „ Sie bieten klare Empfehlungen für die Wahl und Dosierung von Antikoagulanzien “ Darüber hinaus wurden innovative Behandlungsansätze wie der minimalinvasive Vorhofohrverschluss und die Pulsed Field Ablation am Kongress thematisiert.
OÄ Dr.in Dagmar Burkart-Küttner, Leiterin der Rhythmus- sowie der Schrittmacher- und AICD-Ambulanz
am Hanusch-Krankenhaus in Wien, beleuchtete Kammerrhythmusstörungen – und den plötzlichen Herztod als Folge: „ Ein gesunder Lebensstil kann das Risiko erheblich senken “ Hypertonie, Diabetes, Rauchen, Übergewicht und familiäre Vorbelastung gehören zu den Risikofaktoren. Außerdem hob die Expertin Fortschritte bei implantierbaren Defibrillatoren hervor. Österreichische Kliniken nehmen hierbei eine führende Rolle ein und können den Patient:innen die neuesten Gerätemodelle anbieten.
PA/AS
EXKLUSIVE INTERVIEWS

Die Expert:innen (v. l. n. r.): Prof. Daniel Scherr, Prof. Helmut Pürerfellner, OÄ Dagmar BurkartKüttner, OA Lukas Fiedler, Prof. Lukas Motloch.
Die RegionalMedien Gesundheit waren auf der ÖKG-Jahrestagung 2024 und haben Expert:innen zu verschiedenen kardiologischen Fragestellungen vor Ort interviewt. In der Mediathek von Gesund.at stehen die kompakten Videos zur Verfügung. Nachfolgend eine Übersicht mit ausgewählten Key-Messages.
Univ.-Prof. Dr. Lukas Motloch, Klinikum Salzkammergut, über Blutverdünnung: XRisikoscores wie der CHA2DS2-VASc- und der HAS-BLED-Score sind seit über zehn Jahren in Erprobung, außerdem gibt es neue, die sowohl das Schlaganfall- als auch das Blutungsrisiko vorhersagen könnten.
OA Mag. Dr. Lukas Fiedler, LK Wiener Neustadt, zur Schlaganfallprävention: XVerschiedene interventionelle Techniken zum Verschluss des Vorhofohrs können das Schlaganfallrisiko von Patient:innen, die keine Antikoagulation vertragen, drastisch senken.
OÄ Dr.in Dagmar Burkart-Küttner, Hanusch-Krankenhaus in Wien, zum plötzlichen Herztod: XBei Personen mit hochgradig reduzierter Pumpfunktion etwa kommen präventiv implantierbare Defibrillatoren zum Einsatz – hochspezielle, hochtechnische Geräte, die heute sehr gute Algorithmen haben.
Univ.-Prof. Dr. Andreas Zirlik, Med Uni Graz, zur Trikuspidalklappe: XDie Trikuspidalklappeninsuffizienz wurde über die letzten zwei Jahrzehnte doch etwas vernachlässigt, weil wir noch nicht die Toolbox hatten, sie adäquat auch interventionell mit niedrigem Risiko anzugehen.
Univ.-Prof. Dr. Axel Bauer, Med Uni Innsbruck, zum chronischen Koronarsyndrom: XMan unterscheidet die symptomatische Indikation zur Revaskularisation von prognostisch relevanten Indikationen wie Hauptstammerkrankungen, einer proximalen LAD-Stenose oder einem großen ischämischen Areal.
Hier geht es zur Mediathek auf Gesund.at:
NACHBERICHT
* Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG), 29. Mai bis 1. Juni 2024, Salzburg Congress.
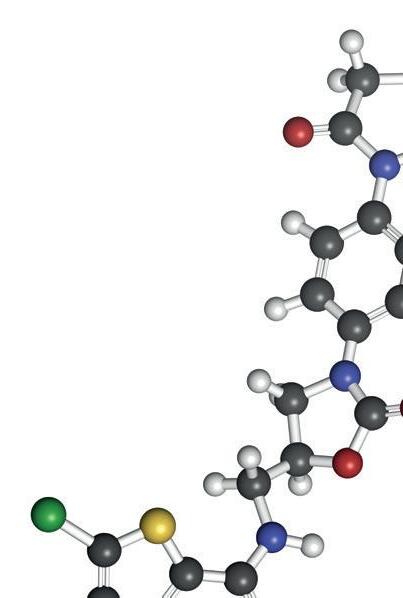
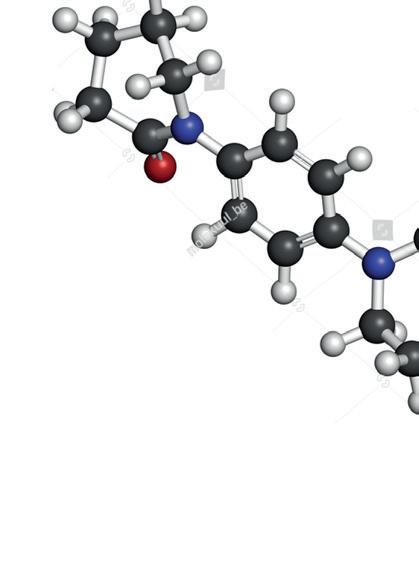
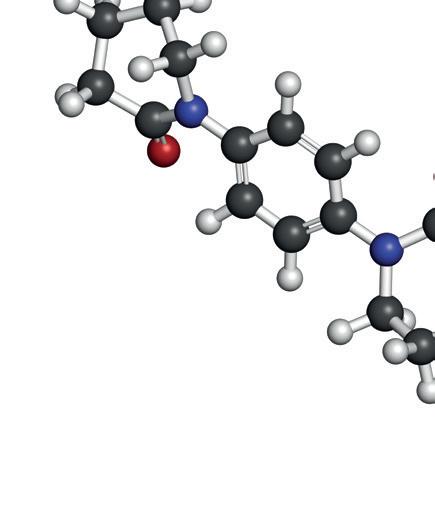
Hausärzt:in extra 60 Juni 2024
© Lukas Fahrner
SPRECHStunde
Patient:innen-Fragen kompetent beantworten
„Umstellung
auf
NOAK –was ist zu beachten?“
Georg C. (62) ist von nichtvalvulärem Vorhofflimmern betroffen. Die Umstellung von einem VKA auf ein NOAK zur Prävention von Schlaganfall/systemischer Embolie ist bereits abgesprochen. Der Patient möchte wissen, wie das weitere Vorgehen ist …
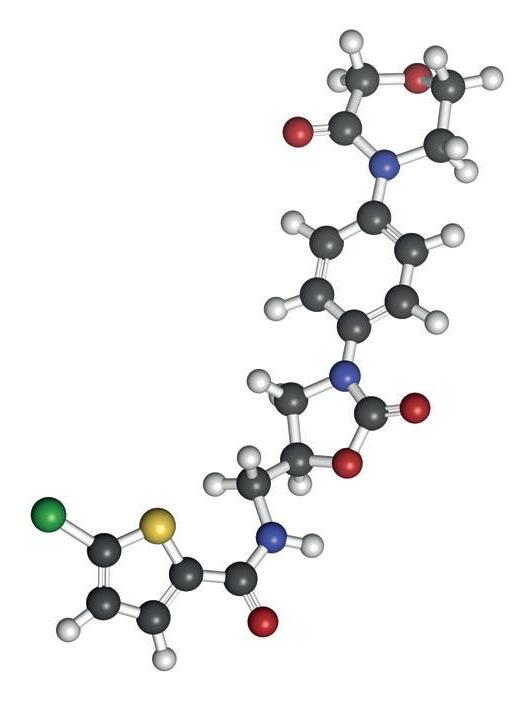
Doz. REINDL: Einleitend sei festgehalten, dass eine Umstellung von Vitamin-K-Antagonisten (VKA) auf neue orale Antikoagulanzien (NOAK) bei Patient:innen mit nichtvalvulärem Vorhofflimmern (VHF) grundsätzlich zu empfehlen ist. Aufgrund des im Vergleich zu VKA besseren Sicherheitsprofils der NOAK (niedrigere Rate schwerwiegender Blutungen) – bei gleicher Wirksamkeit in Bezug auf Schlaganfallprävention – sprechen sich die geltenden nationalen und internationalen Leitlinien einheitlich für NOAK als First-LineTherapie aus.1 Eine Ausnahme von dieser Regel könnten ältere, gebrechliche Patient:innen darstellen. Die im Jänner 2024 publizierte „ F RAIL-AF “ - Studie zeigte, dass bei diesem sehr vulnerablen Patient:innenkollektiv (Alter > 75 Jahre plus erhöhter Groningen Frailty Index) eine Umstellung von VKA auf NOAK mit erhöhten Blutungsraten verbunden ist, weshalb bei dieser speziellen Gruppe eine Beibehaltung der VKA-Therapie gerechtfertigt erscheint.2 Bei valvulärem VHF (mechanische Herzklappe/
mittel- bzw. hochgradige Mitralstenose) ist der VKA nach wie vor Mittel der Wahl.1
Da bei der überwiegenden Mehrheit der Patient:innen mit nichtvalvulärem VHF eine Umstellung auf NOAK anzustreben ist, sieht man sich häufig mit der Frage nach dem richtigen Vorgehen konfrontiert. Konkret sollte nach Absetzen des VKA eine engmaschige tägliche Kontrolle der „I nternational Normalized Ratio“ (INR) erfolgen, wonach sich der anschließende Beginn der NOAK-Therapie richtet. Für die verschiedenen NOAK-Substanzen gibt es unterschiedliche Umstellungsempfehlungen.3,4 Apixaban und Dabigatran sollten eingeleitet werden, sobald die INR unter 2.0 gefallen ist. Edoxaban sollte ab INR 2.5 initiiert werden, für Rivaroxaban ist bereits ein Beginn ab INR 3.0 empfohlen. Die Patient:innen sollten darüber aufgeklärt werden, dass diese Umstellungsphase mit einem gering erhöhten Risiko sowohl für Blutungen als auch für Thromboembolien assoziiert ist. Hierbei sei aber auch betont, dass das günstigere Sicherheitsprofil der
EXPERTE: Priv.-Doz. Dr. Martin Reindl, PhD
Universitätsklinik für Innere Medizin III Innsbruck, tirol kliniken

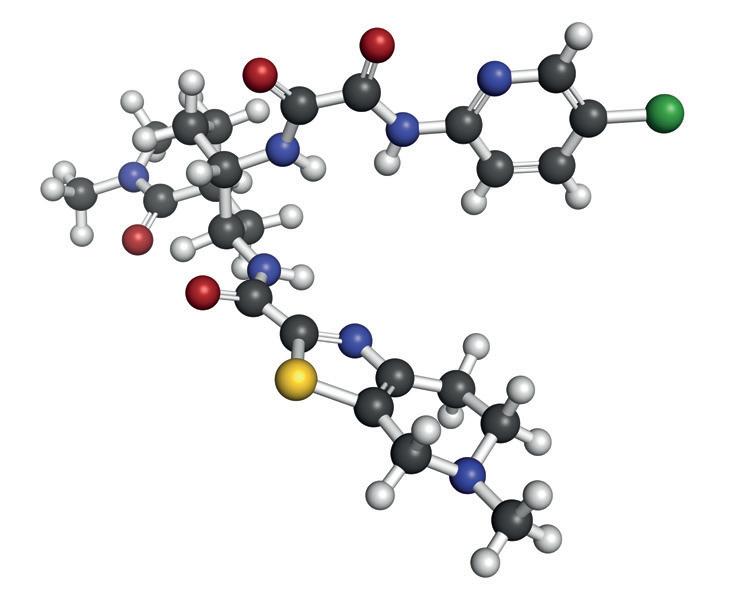
bevorstehenden NOAK-Dauertherapie dieses kurzfristig erhöhte Risiko klar rechtfertigt. Hinsichtlich der NOAK-Dosierung gelten die konventionellen Schemata für VHF mit den bekannten Dosisreduktionsempfehlungen.1
Literatur:
1 Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E et al., 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021;42:373-498.
2 Joosten LPT, van Doorn S, van de Ven PM et al., Safety of Switching From a Vitamin K Antagonist to a Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant in Frail Older Patients With Atrial Fibrillation: Results of the FRAIL-AF Randomized Controlled Trial. Circulation. 2024;149:279-289.
3 Guimarães PO, Kaatz S, Lopes RD, Practical and clinical considerations in assessing patients with atrial fibrillation for switching to non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in primary care. Int J Gen Med. 2015;8:283-291.
4 Steffel J et al., 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation, EP Europace, Volume 23, Issue 10, October 2021, Pages 1612–1676, doi.org/10.1093/europace/euab065
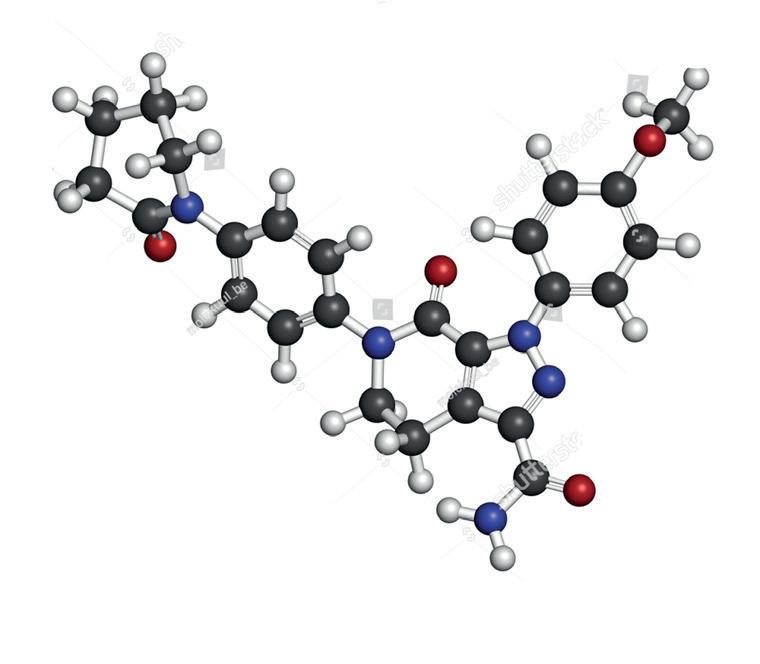
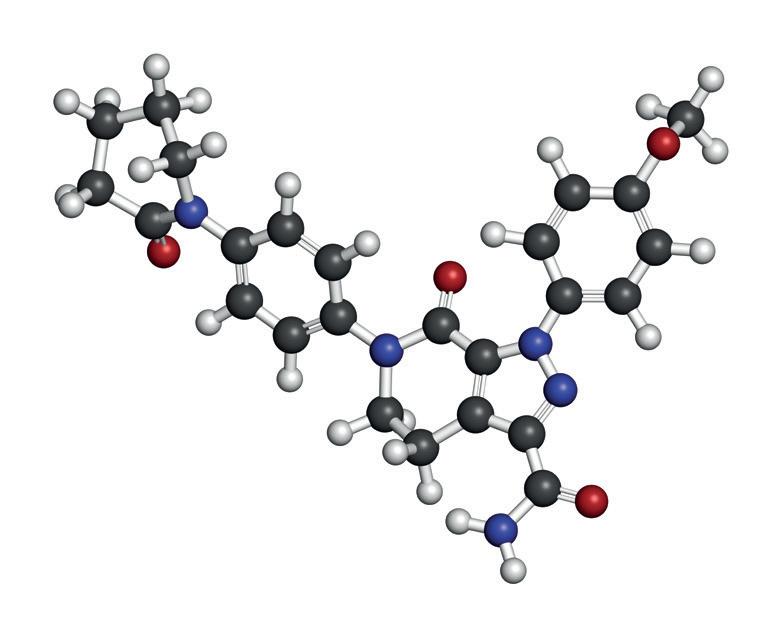
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE1-4
� Die überwiegende Mehrheit der Patient:innen mit nichtvalvulärem VHF und laufender VKA-Therapie sollte auf ein NOAK umgestellt werden.
- Ältere, gebrechliche Patient:innen scheinen von einer Umstellung nicht in gleichem Ausmaß zu profitieren.
- Im Rahmen der Umstellung soll, nach Absetzen des VKA, die NOAK-Therapie INR-basiert wie folgt initiiert werden:
• Apixaban und Dabigatran: Start bei INR < 2.0,
• Edoxaban: Start bei INR ≤ 2.5,
• Rivaroxaban: Start bei INR ≤ 3.0.
Hausärzt:in extra 61 Juni 2024 © privat
© shutterstock.com/Archiv
© shutterstock.com/ StudioMolekuul

Ihr Unternehmen.
Ihre Zukunft.
Mit der Unternehmer:innenmilliarde der Volksbank schaffen wir gemeinsam neue Chancen für Ihr Unternehmen. Erfolg fängt an, wo man vertraut.
Hausärzt:in fachkurzinformation
VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. www.erfolgistteamwork.at
Frank Dach, beraten durch die VOLKSBANK WIEN

TERMINE
22.08.2024
Webinarreihe Junge Neuropädiatrie
Autismus-SpektrumStörungen und ADHS
Ort: Online (Tirol Kliniken)
11.-14.09.2024
68. Österreichischer HNO-Kongress
Ort: Congress Center Baden & Online
26.-28.09.2024
48. Jahrestagung der ÖGP (Pneumologie)
Ort: Wiener Hofburg
IMPRESSUM
Kongresse und mehr
25.-31.08.2024
27. Ärztetage Velden
Ort: Veranstaltungszentrum Velden
14.09.2024
Burgenländischer Ärztetag 2024
Ort: Lisztzentrum Raiding
19.10.2024
Workshop der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz (ÖKG-Fortbildung)
Ort: Lakeside Spitz in Klagenfurt
Herausgeber und Medieninhaber: RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at. Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler. Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Margit Koudelka, Felicia Steininger, Mara Sophie Anmasser, Justyna Frömel, Bakk. MA.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier. Produktion & Grafik: Angie Kolby. Cover-Foto: shutterstock.com/AI.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärzt:innen.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
26.-30.08.2024
28th Budapest Nephrology School
Ort: Semmelweis University Budapest & Online
18.-20.09.2024
55. Jahrestagung der ÖGIM (Innere Medizin)
Ort: Salzburg Congress
Weitere Infos und Veranstaltungen finden Sie in unserem Kongresskalender unter:
Wichtig
gesund.at/ kongresskalender
Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Ratgeber sorgfältig. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig und aktuell ist bzw. sich seit dem Druck keine Gesetzesänderung ergeben hat.
Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: (01) 501 65 0
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.arbeiterkammer.at
In unserem Fachmagazin setzen wir auf genderneutrale Sprache. Verwendet wird der Doppelpunkt – als beste Symbiose aus Leserlichkeit und Inklusion. Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf die gänzlich orthografisch/ grammatikalisch korrekte Schreibweise. Etwa geben wir bei Artikeln und Pronomen jeweils nur eine Variante an – jene, die zur längeren Variante des gegenderten Wortes gehört. Weitere Informationen siehe: meinmed.at/kommunikation/genderneutrale-sprache/2688 issuu.com/hausarzt/docs/ha_2023_12/3 (Hausärzt:in 12/23, Editorial, S. 3)
Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie bereit: wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere Bestellmöglichkeiten:
■ EMail: mitgliederservice@akwien.at
■ Bestelltelefon: (01) 501 65 1401
Artikelnummer 456
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum
Hausärzt:in extra 63 Juni 2024
Aktuelle
Hausärzt:in fachkurzinformation 64 Juni 2024
Gesundheitsreform in Umsetzung
Fix geregelt: Öffentliches Impfprogramm erweitert, ELGA gestärkt
Bund, Länder und Sozialversicherung haben am 7. Juni die konkrete Umsetzung der Gesundheitsreform vereinbart. Auf Bundesebene beschließen die Partner gemeinsam ein Jahresarbeitsprogramm.

Insgesamt stehen 14 Mrd. Euro aus dem Finanzausgleich bis 2028 für Reformen zur Verfügung. Klare Regeln für den Einsatz der Mittel enthält der Zielsteuerungsvertrag. Konkrete Projekte wie zusätzliche Kassenstellen, längere Öffnungszeiten, die Einrichtung von Spezialambulanzen oder der Ausbau der Primärversorgung werden auf Landesebene geregelt. Beschlossen wurde auch, dass die Influenzaimpfung ab der Saison 2024/25 kostenlos wird, ebenso die HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr. Zudem finanziert der Bund weiterhin die COVID-19-Imp-
fungen in der Saison 2024/25. Weitere Impfungen sollen folgen. Eine Priorisierung wird bis Ende 2024 erarbeitet. Für das Impfprogramm stehen pro Jahr 90 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung. Mit 51 Mio. Euro pro Jahr sollen Digitalisierungsmaßnahmen finanziert werden, etwa der Auf- und Ausbau telemedizinischer Angebote, der Ausbau der Gesundheitsberatung 1450, die Weiterentwicklung von ELGA sowie eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten.
Quelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)
Unterschiedliche Sicherheitsprofile
Intravenöse Eisentherapie: Hypophosphatämie vermeiden
In Österreich stehen an intravenösen Präparaten mit dreiwertigem Eisen niedermolekulare Komplexe von Eisen(III)hydroxid-Saccharose sowie die höhermolekularen Komplexe Eisen(III)-Carboxymaltose (Fe-CM) und Eisen(III)Derisomaltose (Fe-DI) zur Verfügung. Die beiden letzteren ermöglichen die einmalige Applikation von bis zu 1.000 mg Eisen im Vergleich zu maximal 200 mg bei den niedermolekularen Präparaten. Sie erlauben den raschen Ausgleich eines Eisendefizits bei gleichzeitig geringem Risiko in Bezug auf Hypersen-
sitivitätsreaktionen. Allerdings kann sich bei diesen höhermolekularen Präparaten gelegentlich als unerwünschte Wirkung eine Hypophosphatämie manifestieren.1-3
Das Risiko einer in der Regel asymptomatisch (und damit unerkannt) verlaufenden Hypophosphatämie ist bei Gabe von Fe-CM im Vergleich zu Fe-DI deutlich erhöht. Vor allem für Patient:innen, die wegen ihrer Grunderkrankung häufiger intravenöser Eisensubstitution bedürfen – etwa Personen mit chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen – oder für jene mit Risikofaktoren für eine Hypophosphatämie (wie Vitamin-D-Mangel, niedrige Serumphosphatspiegel, erhöhtes PTH, Therapie mit Denosumab oder Bisphosphonaten) stellt derzeit Fe-DI die Therapieoption mit dem besseren Sicherheitsprofil dar. 3
Literatur:
1 Pharmainfo XXXIII/2/2018.
2 Richards T et al., Ann Med 53, 274, 2021.
3 Boots JMM & Quax RAM. Drug Safety 45, 1019, 2022. Quelle: Pharmainformation, Jg. 39/Nr. 1, S. 1-2, März 2024
65 Juni 2024 Hausärzt:in informativ
© BMSGPK / Waaijenberg
v. l. n. r.: Peter Hacker, Mag.a Christine Haberlander, Johannes Rauch, Peter Lehner.
Hausärzt:in fachkurzinformation 66 Juni 2024
Forschungsinteresse Darm
pegaso® Baby: ein Supplement für Säuglinge
Je größer das Wissen über unseren Darm, desto spannender die Bedeutung des Mikrobioms für die ersten Lebensjahre und sein möglicher Einfluss auf das weitere Leben in Gesundheit. Jüngste Studien zielen deshalb darauf ab, auch das frühkindliche Mikrobiom zu modulieren. Dabei beschäftigt man sich vor allem mit der Erforschung der Darm-Hirn-Achse. Im Einklang mit den Erkenntnissen wurde kürzlich, im Mai 2024, eine spezielle Kombination aus Milchsäurebakterien, Kamillenöl und Olivenöl auf den Markt gebracht: pegaso® Baby – die Nahrungsergänzung mit pa-
tentiertem Verschluss und Dosierung für Säuglinge bereits ab der Geburt. Darin enthalten sind die besterforschten Mikroorganismen Lactobacillus reuteri sowie Lactobacillus acidophilus Lactobacillus reuteri kommt bereits in der Muttermilch vor. Bei einem intakten Mikrobiom sind beispielsweise Phasen einer Ernährungsumstellung von milder Symptomatik. Wenn sich beim Baby allerdings Verdauungsbeschwerden durch diverse Symptome äußern, kann dies auch ein Zeichen für Veränderungen im Darm bzw. Dysbiosen sein. Sofern Hausmittel nicht
Welt-Allergie-Woche
Heuer unter dem Zeichen Lebensmittelallergien
Die Welt-Allergie-Woche (23.-29. Juni 2024) macht heuer auf das Thema Lebensmittelallergien aufmerksam. Ziel ist es, die Früherkennung und Behandlung von Nahrungsmittelallergien zu fördern und das Bewusstsein für deren Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität der Patient:innen zu schärfen. Lebensmittelallergien sind potenziell lebensbedrohliche allergische Reaktionen auf ein oder mehrere Lebensmittelallergene. Betroffen sind bis zu 10 % der Bevölkerung im ersten Lebensjahr. Die Prävalenz von Lebensmittelallergi-
en und die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen lebensmittelbedingter Anaphylaxie haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen.1-3
Die Vermeidung von Allergenen ist nach wie vor der Hauptpfeiler der Behandlung, ebenso wie der Zugang zu Notfallmedikamenten für akute allergische Reaktionen bei versehentlicher Exposition.3 Lebensmittelallergien haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensqualität der Patient:innen und ihrer Familien. Früherkennung einer Nahrungsmittelallergie,

ausreichend unterstützen, kann ein Supplement mit Milchsäurebakterien gezielt in Betracht gezogen werden. pegaso® Baby ist ein für Babys und Kinder geeignetes Nahrungsergänzungsmittel in Form einer oralen Suspension. Nähere Informationen: schwabe.at/pegaso-baby Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Quelle: Schwabe Austria GmbH
Identifizierung spezifischer Allergene sowie die Patient:innenaufklärung tragen zu einer wirksamen Behandlung und Risikominderung bei. Da es außerdem eine komplexe Wechselwirkung zwischen allergischen Erkrankungen gibt, sollten Patient:innen mit Lebensmittelallergien auch auf andere allergische Erkrankungen wie atopische Dermatitis oder allergische Rhinitis untersucht werden.1-3
Literatur:
1 Yang L et al., Front. Immunol. 2020; 11:1907.
2 Tsuge M et al., Children. 2021; 8:1067.
3 Peters RL et al., Pediatr Allergy Immunol. 2021; 32:647-657. Quelle: Viatris Austria GmbH
67 Juni 2024 Hausärzt:in informativ
PEG_Hausärztin_PR1400_2405_F AT-EPI-2024-00008-06-2024
und forte Femalen® für Frauen in den
Wechseljahren
Verbesserung der Wechseljahresbeschwerden anhand Fragebogen und visuellen Analogskalen*
nächtliches Schwitzen -62% -55% -56%
Hitzewallungen -68%

Reizzustände -60%
Schlafprobleme
Müdigkeit
Æ 96 % der Anwenderinnen sind zufrieden
Tägliche
Verzehrsmenge und Anwendung

Zusammensetzung
Femalen® forte: 1 Kapsel täglich
Femalen®: 2 Tabletten täglich
Tägliche Verzehrsmenge
Femalen® forte
1 Kapsel
Femalen® 2 Tabletten
Pflanzenpollenextrakt 320 mg 320 mg
Vitamin E 10 mg 10 mg
Wichtig: Empfehlen Sie, in den ersten 2 Monaten Femalen® oder Femalen® forte ohne Unterbrechung einzunehmen, damit die Eigenschaften der enthaltenen Stoffe voll zur Entfaltung kommen können. Eine Daueranwendung ist bedenkenlos möglich.
* Druckmann, Lachowsky, Elia; Genesis 2015; 183:10-13
Offene klinische Multicenter-Studie, 324 Frauen - 90 Gynäkologen, 2 Tabletten tgl., 3 Monate Nahrungsergänzungsmittel für Frauen in den Wechseljahren mit Pflanzenpollenextrakt und Vitamin E. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen. AT/Femalen/2023002




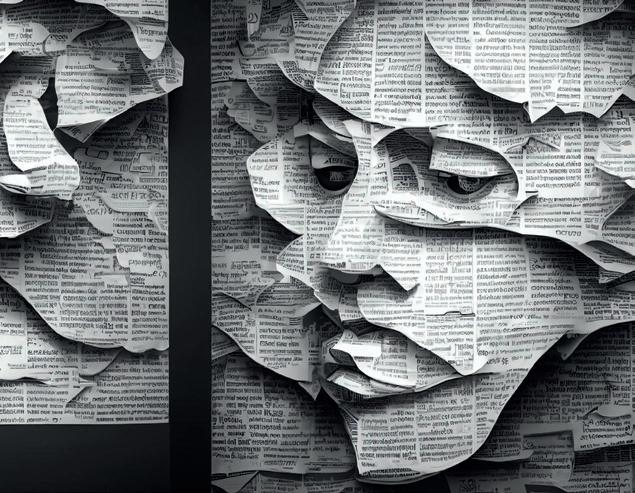

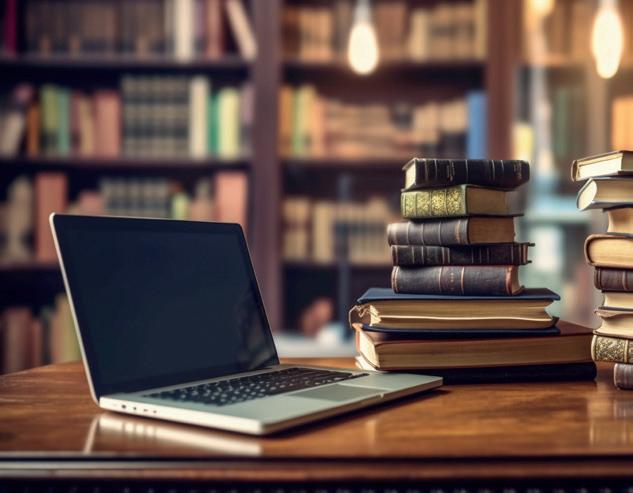









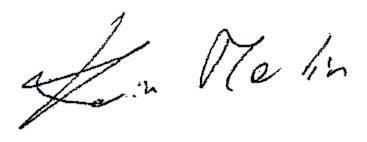





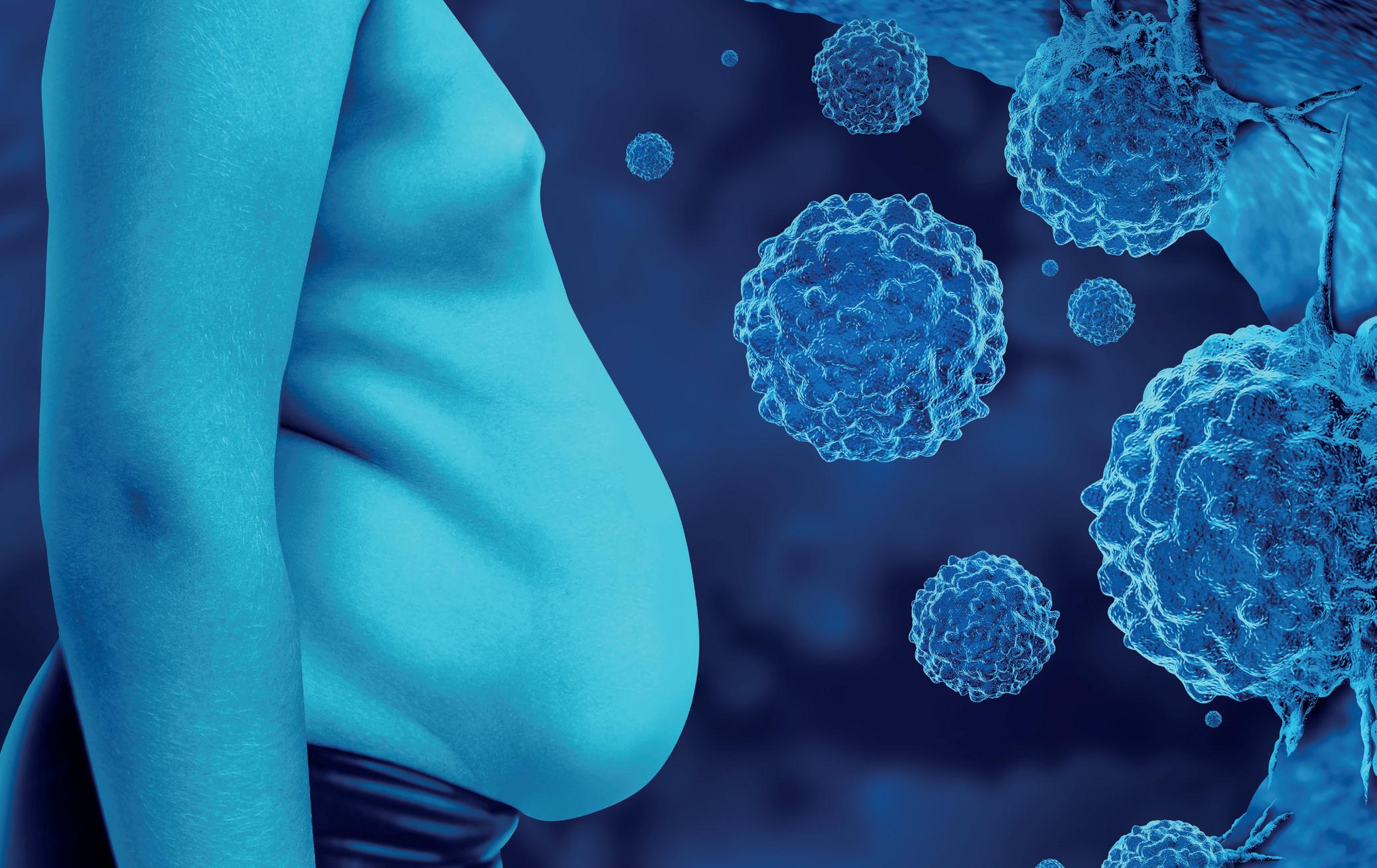














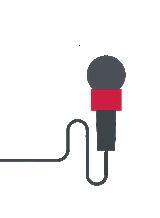



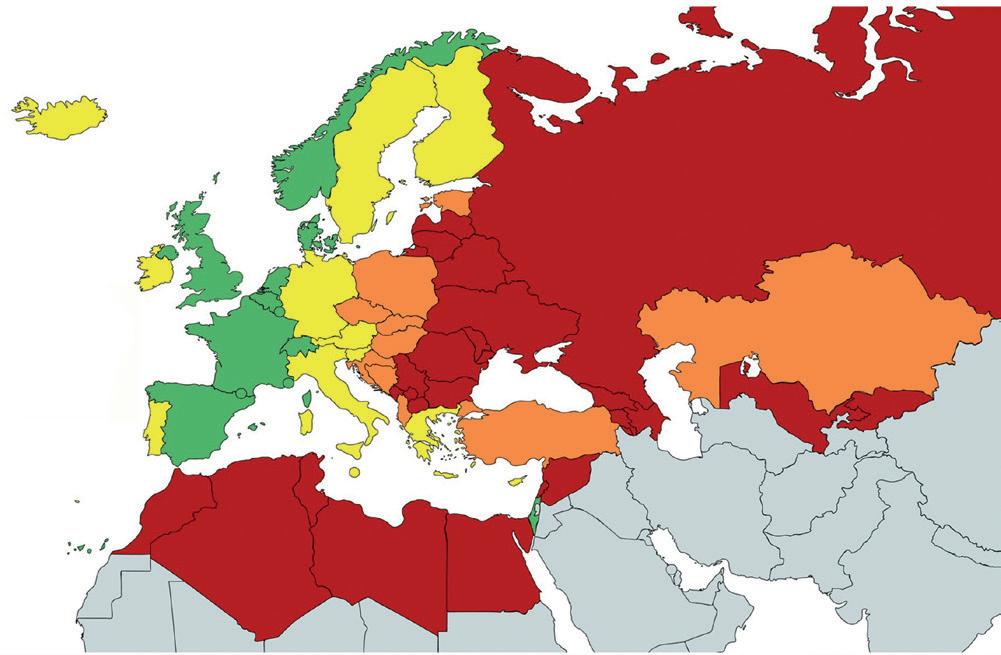
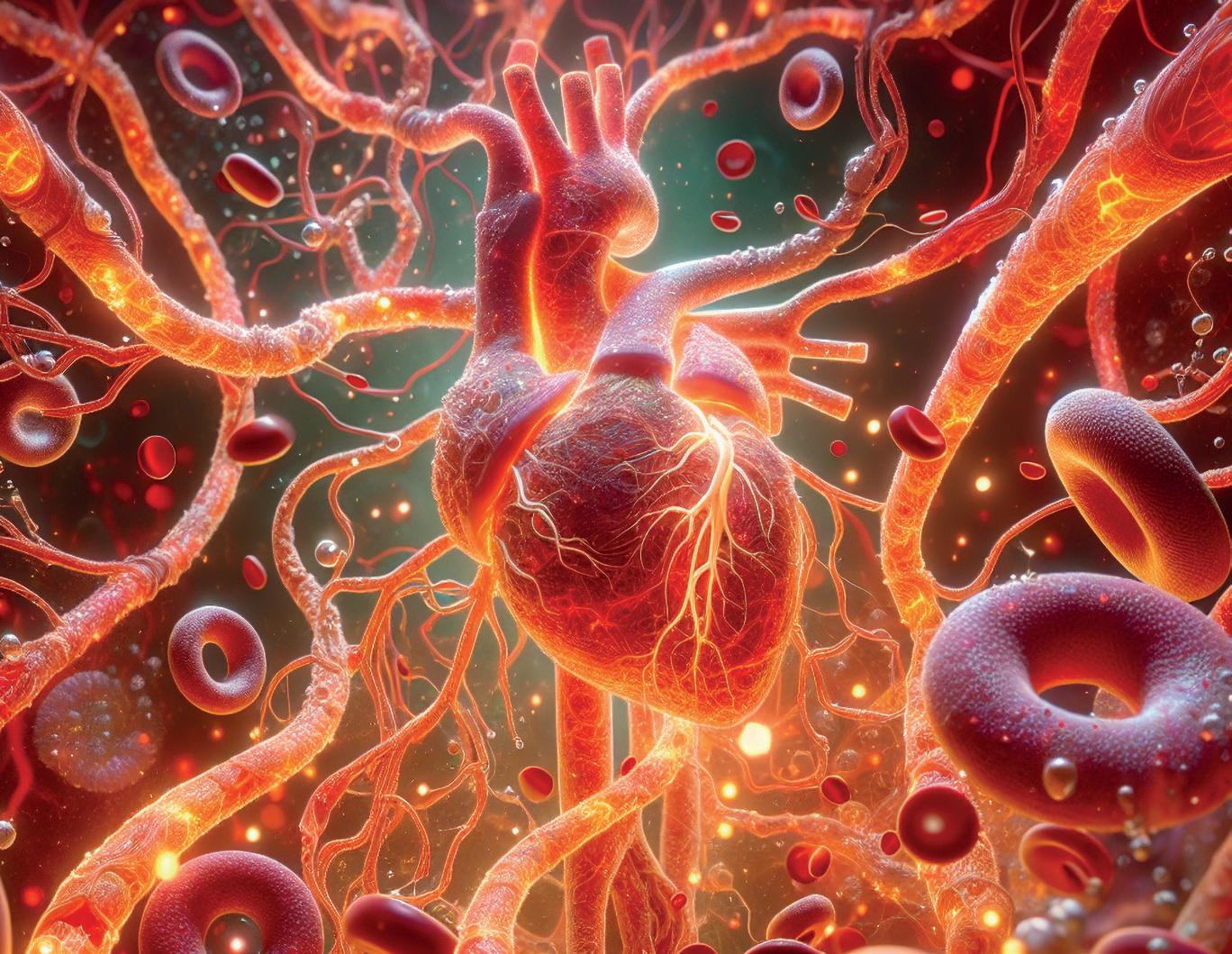

 Anna Schuster, BSc
Anna Schuster, BSc