


Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch Formverändert Praxiswissen: Kinderund Jugendrehabilitation
Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche






Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch Formverändert Praxiswissen: Kinderund Jugendrehabilitation
Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche


Zu Christi Himmelfahrt spielte Ö3 den ganzen lieben Tag lang Hits der 80er-Jahre. Zugegeben, ich höre diese Songs nach wie vor mit Freude. Und ja, ich erinnere mich gerne an die Zeit meiner Jugend zurück. Auch wenn damals meinem Gefühl nach bei Weitem nicht alles besser war als heute. Beispiel Drogen, weil sich diesem Thema die Coverstory unserer druckfrischen Ausgabe der Hausärzt:in widmet. Sowohl Liedertitel wie „Ganz Wien (… ist heut auf Heroi n“) als auch der Film und das Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ begleiteten uns Teenager in den 1980er-Jahren und flößten uns durchaus Respekt ein, vor allem in Hinblick auf harte Drogen wie Heroin. Die Punk- und Drogenszene war für uns damals in Wien vorrangig am Karlsplatz „sichtba r“. Auf unseren Ausflügen mit der Bim in Richtung Kärntner Straße beäugten wir sie dezent neugierig. Gefürchtet haben wir uns nicht wirklich. Man wurde beim Vorbeigehen maximal um ein paar Schillinge angeschnorrt. Und dafür waren wir als 15-/16-Jährige sicher nicht die Hauptzielgruppe.
Erschreckend ist: Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre starben laut Medienberichten pro Woche zwischen zehn und 14 Personen am Karlsplatz an einer Drogenüberdosis. Zu dieser Zeit gab es noch keine Substitutionstherapie. Durch die Einrichtung einer Schutzzone und die Übersiedelung der Beratungsstelle in die Nähe der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße kam es schließlich zu einer weitgehenden Verdrängung der „Junkies“ weg vom Zentrum, mehr in die Peripherie.
Unter dem Motto „Wien zwischen Drogensucht und Obdachlosigkeit“ werden heute übrigens eigene Stadtrundgänge in der Gegend rund um den Karlsplatz angeboten, bei denen Guide Martin Einblicke bietet, wie er – vom Land kommend – auf den Straßen der Bundeshauptstadt „mit Drogen und Alkohol durchs Leben glitt, um schließlich an Ersatzdrogen hängenzubleiben“.
Schüler:innen können sich bei Suchtpräventionsvorträgen intensiv mit der Problematik Drogenabhängigkeit auseinandersetzen (wienernimmerland.at).
Das Thema Sucht hat natürlich nicht an Relevanz verloren. Dass es der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zufolge (emcdda.europa.eu) heute so viel Kokain und Heroin in Europa am Markt gibt wie nie zuvor, hat mich aber doch überrascht. Nach Cannabis zählt Kokain zu den am häufigsten verwendeten Drogen. Mit einer geschätzten Verbreitung von 6,2 Prozent bei Erwachsenen soll Österreich sogar noch über dem EU-Durchschnitt liegen. Heroin ist das am häufigsten konsumierte illegale Opioid in Europa und auch die Droge, die für einen Großteil der mit illegalem Drogenkonsum verbundenen Gesundheitsbelastung verantwortlich ist. Im Vergleich zu früher kommt in manchen Ländern mittlerweile aber synthetischen Opioiden eine bedeutendere Rolle zu.
Unsere aktuelle Titelgeschichte beschäftigt sich mit Suchterkrankungen in der ärztlichen Praxis (ab S. 12). Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle psychiatrischer Komorbiditäten. Denn nicht selten wird ein Substanzkonsum als „Selbstmedikation“ eingesetzt: etwa Alkohol bei Angstsymptomen oder Kokain im Kontext der AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung. Ein spannendes Detail: Ca. 50 Prozent der Patient:innen mit einer Suchterkrankung erfüllen laut unseren Gastautor:innen die Kriterien einer ADHS, wobei eine adäquate Behandlung häufig auch mit einer Reduktion des Substanzkonsums einhergeht. Im ersten Teil unseres Themenschwerpunkts stehen Alkohol, Benzodiazepine und Opioide im Mittelpunkt: Welche Besonderheiten sind in puncto Diagnose, Entwöhnung und Behandlung zu beachten? In einem geplanten zweiten Teil wird der Fokus auf Psychostimulanzien und Verhaltenssüchten liegen.

Eine spannende Lektüre nach dieser kurzen Zeitreise wünscht Ihnen
Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at
Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at
06 Reisediarrhoe muss nicht sein Mit einigen Maßnahmen lässt sich das Risiko senken
09 Ein bidirektionaler Zusammenhang Psychosomatische Aspekte bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
16 „Die Neurobiologie hinter der Angst“ Angsterkrankungen aus Sicht der Psychiatrie und der Neurowissenschaft
18 Therapieansprechen auf Triptane
Migräne: Rezente Studie identifiziert Unterschiede in Wirksamkeit und Verträglichkeit
20 Hürden der Versorgung überwinden
Die ÖDG will sich mit dem niedergelassenen Bereich intensiver vernetzen
21 Gut leben – trotz spastischer Bewegungsstörung

Wundversorgung: Noch Luft nach oben im österreichischen Gesundheitssystem.
22 „Eine gute Orientierungshilfe“ Ein WORDRAP zur Praxisrelevanz der Leitlinie „Sekundärprophylaxe des ischämischen Schlaganfalls“
24 Operieren? Und wenn ja, wie? Die Behandlung chronisch venöser Insuffizienz
26 Das individuelle Risiko bestimmt die Therapie Die neue Österreichische
Osteoporose-Leitlinie: Teil 2
28 Forschung in vollem Gange Pulmonale Hypertonie – die Lebensqualität und Lebenserwartung Betroffener steigern
30 Formverändert
Die Sichelzellerkrankung ist auch in Mitteleuropa auf dem Vormarsch
12 Kreislauf der Abhängigkeit Suchterkrankungen in der Praxis: Eine wirksame Behandlung erfordert multidimensionale Ansätze
DIALOG Pädiatrie
34 Alarm in Babys Darm Abdominalschmerzen bei Kindern: vorbeugen, diagnostizieren und behandeln
38 Der Traum vom Trockenwerden … Primäre Enuresis nocturna: differenzierte Diagnostik und sorgfältige urotherapeutische Beratung
41 DFP Praxiswissen: Kinder- und Jugendrehabilitation in Österreich Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche – von Onkologie bis Mental Health
46 „Auch nicht neurologische Manifestationen beachten“ Früherkennung der Friedreich-Ataxie
48 Gestörter Eisenstoffwechsel Mangelerscheinungen ernst nehmen
51 Kindern Schmerzen ersparen Wann Analgetika ihre Berechtigung haben
52 Psyche im Ausnahmezustand Wie „Gesund aus der Krise“ Kindern und Jugendlichen hilft, Probleme hinter sich zu lassen
54 Hausstaubmilbenallergie erhöht Asthmarisiko Studie aus Deutschland bestätigt Prädiktoren für langfristige Atemwegsprobleme
56 Wunden als Stiefkind des Gesundheitssystems Eine Ludwig-BoltzmannForschungsgruppe zeigt Missstände auf
58 Pollen und Unwetter: Eine potenziell gefährliche Kombination Verstärkte Belastung für Asthma- und Allergiepatient:innen bei Gewitter
60 Die kleinen Helfer der Allergene Bakterien dienen als Adjuvantien bei Hausstaubmilbenallergie
61 Die Top-Lipidregulatoren nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA
62 SPRECHStunde „Sportwissenschaftliche Beratung wegen Sozialer Medien obsolet?“
64 Termine Aktuelle Kongresse und mehr
67 Entlastend fürs Gesundheitssystem Expert:innendiskussion zum Ausbau des öffentlich finanzierten Impfprogramms
64 Impressum extra
Mit einigen Maßnahmen lässt sich das Risiko senken


Sie sind im Normalfall nicht gefährlich, dafür aber umso lästiger: Magen- und Darmerkrankungen im Urlaub. Laut Daten des US-amerikanischen Center for Disease Control (CDC) sind 30-70 % der Reisenden davon betroffen. Dabei ließe sich das Erkrankungsrisiko mit einigen Vorsichtsmaßnahmen deutlich verringern.1
Dass diese Zahlen so hoch sind, ist nicht verwunderlich. Denn bei Tourist:innen haben endemische Erreger bekanntlich leichtes Spiel, weil Erstere im Gegensatz zu den Einwohner:innen keine Antikörper gegen sie haben. Darüber hinaus sind gastrointestinale Pathogene in vielen Urlaubsdestinationen weiter verbreitet als hierzulande, weil ihnen der schlechtere Standard der Abwassersysteme, Trinkwasserversorgung und Sanitäranlagen sowie unterbrochene Kühlketten die perfekten Bedingungen bieten. Die große Mehrheit der Pathogene stellen Bakterien dar (80-90 %), unter ihnen führend ist wiederum das enterotoxigene E. coli, gefolgt von Campylobacter jejuni, Shigella spp. und Salmonella spp. Fälle mit viralen Erregern machen etwa 5-15 % aus. Das historisch am weitesten verbreitete Rotavirus ließ sich durch die routinemäßige Immunisierung eindämmen, das hochinfektiöse Norovirus hingegen, das nicht nur über Lebensmittel, sondern auch direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ist notorisch für Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen verantwortlich.1
Weil eine Reisediarrhoe für gewöhnlich mild verläuft und selbstlimitierend ist, erübrigt sich eine medikamentöse Behandlung häufig. Der Durchfall sollte nach drei bis sieben Tagen von selbst abklingen. Nur bei anhaltendem, schwerem Durchfall sind Antibiotika nötig, wobei diese bei manchen Erregern, etwa Salmonella, nicht wirksam sind. Antimikrobielle Medikamente sollten daher nur verabreicht werden, wenn der Erreger bekannt ist. Auch nicht-antibiotische Arzneien sind verfügbar, so etwa Bismutsubsalicylat, ansonsten bieten sich Antimotilitätsmedikamente an, um Durchfall und Erbrechen symptomatisch zu lindern.2
Das größte Risiko bei Reisedurchfall geht vor allem in heißem Klima vom Flüssigkeitsverlust aus. Die Dehydratation nimmt zwar meist keine gefährlichen Ausmaße an, dennoch sollte sofort mit dem Flüssigkeitsersatz begonnen werden. Bei leichtem bis mittelschwerem Durchfall sind Fleischbrühe oder Bouillons ausreichend, bei schweren Fällen sollten orale Ersatzflüssigkeiten (Oral Rehydration Solution, ORS) gegeben werden, die eine besonders hohe Salzund Kohlenhydratkonzentration haben. Die Standardmischung der WHO ist als Pulver rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und kann also schon ins Urlaubsland mitgenommen werden. Bei Bedarf kann die Patient:in das Pulver selbst in nicht kontaminiertem Wasser lösen und trinken. Intravenöse Rehydratation ist damit nur noch sehr selten notwendig.3
Prävention ist der beste Schutz
Bekanntlich gibt es Risikogruppen, für die eine Reisediarrhoe gefährlich werden kann. Darunter fallen etwa Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Personen mit Darmentzündungen. Auch die Einnahme von Antazida wirkt sich negativ aus. Viele gastrointestinale Erreger sind nämlich sensitiv gegen Magensäure, diese bietet daher einen guten Schutz gegen Infektionen. Für besonders gefährdete Personen kann auch eine prophylaktische Antibiotikagabe sinnvoll sein. Grundsätzlich ist davon allerdings abzuraten. Denn langfristig zerstören Antibiotika die Darmflora und damit eine wichtige körpereigene Barriere gegen Pathogene. So erhöht sich das Infektionsrisiko in Bezug auf resistente Stämme. Menschen, die auf diese Prophylaxe angewiesen sind, müssen deshalb immer auch ein zweites Medikament mit einem alternativen Wirkstoff mitnehmen, um diesen notfalls wechseln zu können. In jedem Fall gilt, dass sich Reisende am besten durch Vorbeugung schützen. Gegen die meisten dieser Pathogene gibt es keine Impfung, deshalb sollten bestimmte Hygienemaßnahmen befolgt werden: Idealerweise wird jeglicher Kontakt mit lokalem Wasser vermieden. Es sollte also kein Leitungswasser getrunken werden, Nahrungsmittel, die mit lokalem Wasser gewaschen wurden, sollten gekocht oder geschält und um Lebensmittel von Straßenhändler:innen generell ein Bogen gemacht werden. Hat man keine Gelegenheit, sich vor
dem Essen die Hände zu waschen, kann man sich mit Desinfektionsmitteln behelfen.1
Die Welt erlebt aktuell eine in den letzten Jahrzehnten beispiellose Choleraepidemie. Zwischen 2021 und 2023 haben sich die Fallzahlen verdreifacht, selbst in Ländern, in denen es seit Jahren keine Cholerafälle mehr gab, tritt die Krankheit nun wieder auf.4 Die Lage ist so dramatisch, dass inzwischen ein weltweiter Impfstoffmangel herrscht.5 Für Tourist:innen ist das Risiko, sich mit Cholera zu infizieren, aber verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit liegt laut Österreichischem Impfplan bei 1 : 3 Millionen.6 Die meisten Choleraausbrüche finden derzeit nämlich in Kriegsgebieten oder anderweitig politisch sehr instabilen Regionen wie zum Beispiel Syrien, Somalia oder Haiti statt, die nicht unbedingt zu beliebten Reisedestinationen zählen. Und auch wenn man im Urlaub einmal in ein Choleragebiet geraten sollte, ist das Ansteckungsrisiko sehr gering, für eine Infektion ist nämlich ein großes Inokulum erforderlich. Grundsätzlich lässt sich Cholera außerdem sehr gut behandeln, sodass der Flüssigkeitsverlust meist keine gefährlichen Ausmaße annimmt. Es ist für Urlaubsreisende also nicht notwendig und auch nicht empfohlen, sich vor Reiseantritt gegen Cholera impfen zu lassen. Der in Österreich verfügbare Impfstoff Dukoral ist in erster Linie für die Verwendung in Flüchtlingsunterkünften und im
Rahmen von Katastropheneinsätzen vorgesehen.7
Am besten schützen können sich Urlaubende mit den allgemeinen Maßnahmen gegen Reisediarrhoe, auf der Website des ECDC (European Center for Disease Control) sind außerdem aktuelle lokale Choleraausbrüche angeführt.8
FeliciaSteininger
Quellen:
1 Connor B, CDC Yellow Book 2024.
2 Bush L et al., MSD Manual, Apr 2022.
3 Cellucci M, MSD Manual, Apr 2023.
4 WHO, External Situation Report n. 9, 07.12.2023.
5 Pawar P, Science, 27.02.2024.
6 Impfplan Österreich 2023/2024.
7 ages.at/mensch/krankheit/krankheitserregervon-a-bis-z/cholera#c7247
8 ecdc.europa.eu/en/cholera/threats-and-outbreakscholera

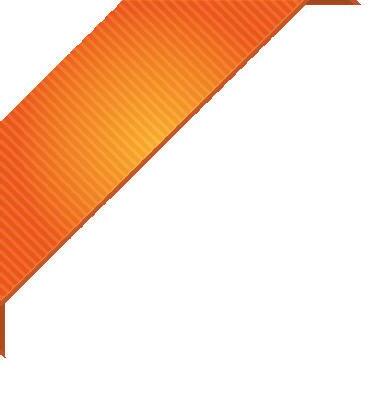
GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Mag.a Bettina Keip
Klinische und Gesundheitspsychologin, Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik, MedUni Wien

Ao. Univ.-Prof. Dr. Clemens Dejaco Leiter der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik, MedUni Wien
Beeinflussen Psyche und chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) einander? Die Antwort lautet: Ja. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen betreffen nicht nur den Körper – in Form von Entzündungen im Verdau-
ungstrakt, Schmerzen und Durchfällen –, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit. Dies beginnt in der Regel schon in jenem Moment, in dem Betroffene die Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa erhalten.
Nach der Diagnosestellung empfinden viele Patient:innen zunächst Überforderung, Verzweiflung, Angst und Kontrollverlust. Viele Fragen kommen auf, die sowohl die körperliche Gesundheit als auch den psychosozialen Lebensalltag betreffen: Was bedeutet chronisch – ein Leben lang oder unheilbar? Wie wird mein soziales Umfeld (Partner:in, Freund:innen, Arbeitgeber:in) darauf reagieren? Bin ich noch ausreichend leistungsfähig für Kinder, Karriere und Sport? Die Belastungen bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen sind vielfältig. Sie beinhalten neben der Wahl der Ärzt:in und der geeigneten Therapie auch die Auseinandersetzung mit tabuisierten und schambehafteten Beschwerden wie Blähungen, vermehrten Stuhlgängen, Stuhlinkontinenz und Toilettensuche. Zudem besteht häufig die Sorge, selbst etwas falsch gemacht zu haben, bis hin zu ausgeprägten Schuldgefühlen. Nicht selten kommt es zu krankheitsbedingten Unterbrechungen bzw. einem Abbruch der Ausbildung oder Berufstätigkeit und in der Folge zu finanziellen Problemen und sozialem Rückzug.
Ungefähr ein Drittel der Betroffenen weist aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit CED sogar Symptome von posttraumatischem Stress auf. Ausschlaggebend hierfür sind die Schwere des Krankheitsverlaufs, die
„Ungefähr ein Drittel der Betroffenen weist aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit CED sogar Symptome von posttraumatischem Stress auf.“
Anzahl der Krankenhausaufenthalte und Operationen sowie die Erfahrungen, die Patient:innen im Rahmen ihres stationären Krankenhausaufenthalts machen. Besonders die Notwendigkeit einer Ileostomie-Operation, eines ileoanalen Pouchs oder eines Aufenthalts auf der Intensivstation erhöhen das Risiko in Bezug auf posttraumatischen Stress.1
Aber nicht nur die körperliche Erkrankung hat Einfluss auf das Wohlbefinden
und die Lebensqualität der Betroffenen. Umgekehrt hat auch das psychische Befinden Einfluss auf den Körper und den Krankheitsverlauf. Die Darm-HirnMikrobiom-Achse stellt die biologische Grundlage der Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche dar. Aktuelle Studien beschäftigen sich mit der Rolle der Darm-Hirn-Mikrobiom-Achse im Rahmen des Verlaufs von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und beschreiben einen bidirektionalen Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen (Angsterkrankungen und Depression) und CED sowie einen Einfluss von subjektivem Stresserleben auf den Verdauungstrakt.2-4 Unter Beteiligung der Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, des autonomen und des enterischen Nervensystems kann psychischer Stress unter anderem das Immunsystem beeinflussen, Entzündungen begünstigen und die intestinale Epithelbarriere verändern.5,6
Mehr als ein Drittel der CEDPatient:innen weisen Symptome einer Angsterkrankung oder Depression auf. Studien zeigen: Einerseits erhöht eine aktive CED das Risiko, eine Angsterkrankung zu entwickeln, andererseits beeinflusst eine vorhandene Angsterkrankung oder Depression den Verlauf der CED negativ. Das Vorliegen einer Angsterkrankung bzw. Depression steht in Zusammenhang mit einem erhöhten Bedarf an Eskalation der medikamentösen Therapie, einer erhöhten Hospitalisierungsrate, einer vermehrten Anzahl von Besuchen in der Notaufnahme sowie einem höheren Risiko aktiver klinischer Krankheitsschübe, kürzerer Remissionsphasen und operativer Eingriffe.2-4,7,8 Ebenso wird ein Konnex zwischen psychologischen Faktoren wie Angst, Depression und subjektivem Stresserleben und der Nonadherence bezüglich der notwendigen medikamentösen Therapie beschrieben.9-11
Die Beobachtung des Zusammenwirkens von Körper und Psyche hat im Be-
Gastautor Prof. Dejaco war Vortragender bei der Fachtagung Psychosomatik, 12. April 2024, Landesklinikum Baden-Mödling.
reich der Gastroenterologie bereits eine lange Geschichte. Schon 1930 wurde ein Zusammenhang zwischen emotionalen Störungen und dem Beginn der Symptome von Colitis ulcerosa beschrieben.12 Die Annahme einer spezifischen prämorbiden Krankheitspersönlichkeit bei CED – rigide, ängstlich, zwanghaft, affekt- und aggressionsgehemmt etc. – ist jedoch weder zeitgemäß, noch konnte diese in kontrollierten Studien verifiziert werden. Sie führte allerdings zu einer Stigmatisierung Betroffener. Bis heute gültig ist stattdessen das – auf Prof. George Engel (1977) zurückgehende – biopsychosoziale Modell, welches das Befinden eines Menschen als Ergebnis der Wechselwirkungen körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren in seiner Lebenswelt versteht. Psychosoziale Faktoren können demnach potenziell in jeden Krankheitsprozess einfließen und Prädisposition, Beginn und Verlauf einer Erkrankung beeinflussen.13
Literatur:
1 Taft TH et al., Inflammatory bowel diseases 25.9 (2019): 1577-1585.
2 Mikocka-Walus A et al., JGH Open 4.2 (2020): 166-171.
3 Fairbrass KM et al., Gut 71.9 (2022): 1773-1780.
4 Barberio B et al., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 6.5 (2021): 359-370.
5 Mawdsley JE, Rampton DS, Gut 54.10 (2005): 1481-1491.
6 Brzozowski B et al., Current neuropharmacology 14.8 (2016): 892-900.
7 Mittermaier C et al., Psychosomatic medicine 66.1 (2004): 79-84.
8 Sauk JS et al., Clinical Gastroenterology and Hepatology 21.3 (2023): 741-749.
9 Calloway A et al., Digestive Diseases and Sciences 62.12 (2017): 3563-3567.
10 Nahon S, European Psychiatry 26.S2 (2011): 2221-2221.
11 Wang L et al., Patient preference and adherence 14 (2020): 917.
12 Murray CD, Am J Med Sci 180 (1930): 239-248.
13 Psychosomatik in der Gastroenterologie und Hepatologie. Ed. Gabriele Moser. Wien New York: Springer, 2007.
Spezialambulanz
Das biopsychosoziale Modell bildet die Grundlage der Arbeit an der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik der Medizinischen Universität Wien. Im Rahmen des Projekts „PsyIBDCare“ wurde dort im Jahr 2023 eine psychosomatische Anlaufstelle für Patient:innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen etabliert. Betroffene können von ihrer behandelnden Fachärzt:in zugewiesen werden. Auf eine psychosomatische Erstexploration folgen zwei bis drei supportive klinisch-psychologische/psychotherapeutische Beratungstermine. Je nach Bedarf können diese zu bis zu zehn klinisch-psychologischen bzw. psychotherapeutischen Behandlungsterminen, diagnostischem Biofeedback oder bauchgerichteter Gruppenhypnose ausgeweitet werden.
Sollte eine längerfristige oder intensivere psychosomatische Begleitung indiziert sein, werden die Betroffenen beim Wechsel in den niedergelassenen oder stationären Bereich unterstützt. Das Angebot der Spezialambulanz für Gastroenterologische Psychosomatik versteht sich – im Sinne einer integrierten Psychosomatik –als Ergänzung zur bereits bestehenden fachärztlichen Betreuung.
Nähere Informationen: innere-med-3.meduniwien.ac.at
GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriele Fischer FÄ für Psychiatrie und Neurologie, Univ.-Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie und Zentrum für Public Health, MedUni Wien

DDr. Arkadiusz Komorowski FA für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Univ.-Klinik für Psychiatrie & Psychotherapie, MedUni Wien
Suchterkrankungen bzw. Substanzgebrauchsstörungen führen zu großer individueller und auch familiärer Belastung sowie zu dramatisch hohen (indirekten) volkswirtschaftlichen Kosten. Kennzeichnend ist der chronische Therapieprozess, der Geduld und Verständnis – vor allem aber Professionalität – erfordert. Suchterkrankungen betreffen das gesamte Spektrum der Medizin, wobei das „biopsychosoziale“ Modell einen Rahmen für das Verständnis dieser Entitäten bietet. Auf neurobiologischer Ebene spielen insbesondere Veränderungen im dopaminergen Belohnungsempfinden, in der limbischen Emotionsverarbeitung und im Stresssystem eine zentrale Rolle. Dabei wird die Balance jener Systeme gestört und somit das Lust- und Belohnungserleben beeinträchtigt.
Für die Diagnose einer Suchterkrankung sind u. a. ein Verlust der Kontrolle über Beginn, Menge und Dauer des Konsums sowie das Vorhandensein von Craving relevant. Zusätzlich spielen neuroadaptive Veränderungen wie Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen eine Rolle. Typisch ist, dass ein Konsum trotz auftretender Probleme fortgesetzt und anderen Interessen, Vergnügungen sowie Verpflichtungen vorgezogen wird. Ein Paradigmenwechsel der WHO hat mittlerweile dazu geführt, dass auch substanzungebundene Abhängigkeiten, etwa die Glücksspielstörung und die Computerspielsucht, in der ICD-11
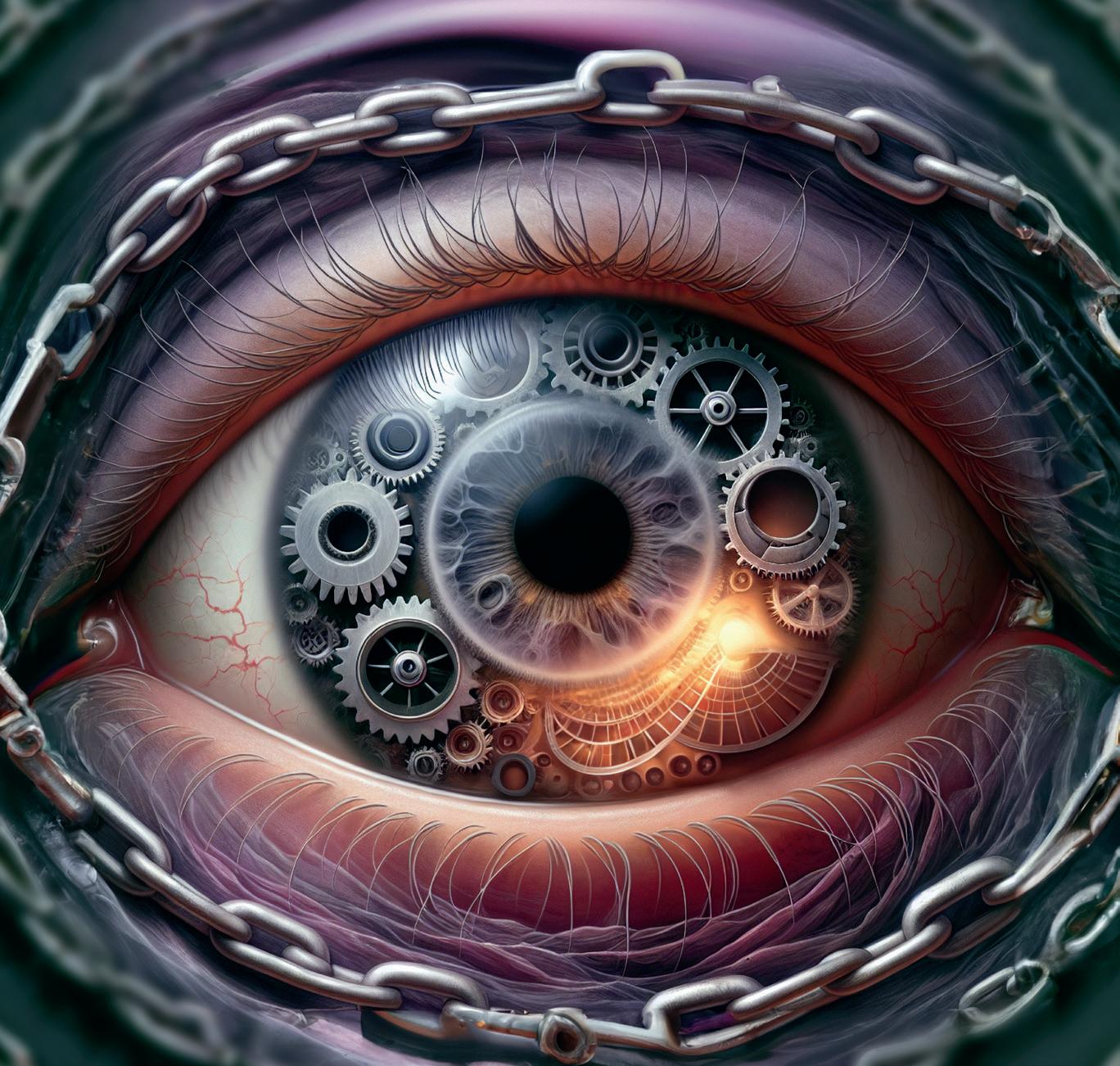
berücksichtigt werden. Rückfälle sind jedenfalls ein integraler Bestandteil des Behandlungspfades – das Ziel besteht darin, diese in Intensität und Frequenz zu reduzieren (siehe Abbildung, S. 14).
Psychiatrische Störungen können entweder einer Suchterkrankung vorausgehen oder durch diese begünstigt werden. Bei Patient:innen mit einer Substanzgebrauchsstörung zeigen sich gehäuft depressive Symptome und – meist unterdiagnostiziert – bipolare Störungen. Nicht selten dient ein Substanzkonsum dabei als „ Selbstmedikation“, beispielsweise Alkohol bei Angstsymptomen oder Kokain im Kontext der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Ca. 50 % der Patient:innen mit einer Suchterkrankung erfüllen die Kriterien einer ADHS, wobei
eine adäquate Behandlung häufig mit einer Reduktion des Substanzkonsums einhergeht. In Ordinationen empfiehlt sich daher ein ADHS-Screening bzw.
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Sucht
Neue Erkenntnisse und Behandlungswege
Von Gabriele Fischer und Arkadiusz Komorowski Reihe Gesundheit. Wissen.
MedUni Wien im MANZ Verlag 2023
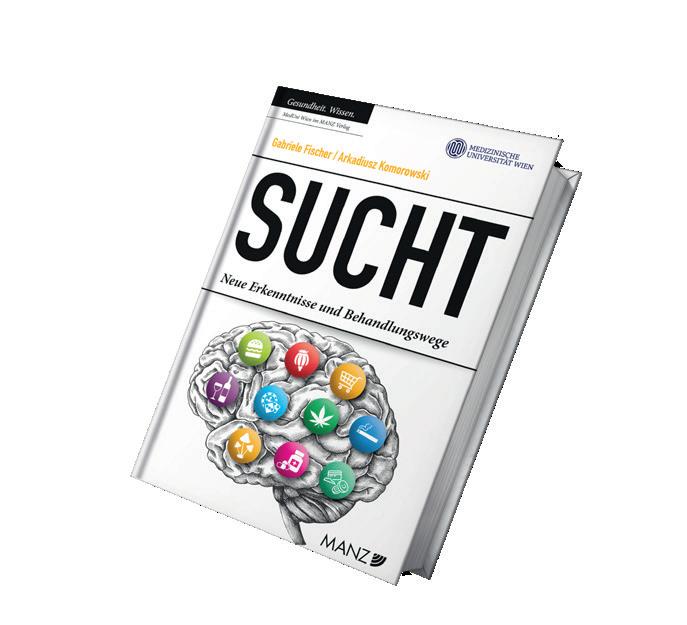
u. U. eine Zuweisung zur klinischen Psychologie für eine umfassendere Testdiagnostik. Ein exzessiver Substanzgebrauch kann psychotische Reaktionen hervorrufen, die nach dem Absetzen der Substanz in der Regel wieder abklingen. Patient:innen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis und einer komorbiden Suchterkrankung weisen dagegen meistens eine schlechtere psychosoziale Integration und einen schwereren Verlauf auf.
Häufig kommt es im Laufe des Lebens als Folge eines Substanzkonsums zu somatischen Begleiterkrankungen. Zum Beispiel besteht oftmals ein starker Zigarettenkonsum*, was sich u. a. in einer erhöhten Sterblichkeit bzw. Folgeerkrankungen wie COPD und Krebserkrankungen widerspiegelt. Daher ist eine umfassende und multidisziplinäre Herangehensweise entscheidend, um eine wirksame Prävention und Behandlung sicherzustellen. Es gilt: Die Stabilisierung von Suchterkrankungen ist ein fortlaufender – oft lebenslanger – Prozess.
Alkohol
Alkohol führt einerseits zu einer erhöhten Freisetzung von Dopamin im Striatum und weist andererseits einen durch GABA-Rezeptoren vermittelten sedierenden Effekt auf. Männer sind häufiger von einer Alkoholabhängigkeit betroffen, jedoch steigt die Prävalenz bei Frauen kontinuierlich. Der regelmäßige Konsum von mehr als vier Standardgetränken pro Tag bei Männern und von mehr als zwei bei Frauen birgt erhebliche Risiken (ein Standardgetränk entspricht ca. 3 dl Bier oder 1 dl Wein), auch wenn gelegentlich gesundheitliche Vorteile durch geringe Mengen Alkohol diskutiert werden. Etwa 15 % der österreichischen Bevölkerung entwickeln im Laufe des Lebens eine Alkoholabhängigkeit und bis zu 20 % der Menschen mit Alkoholabhängigkeit weisen gleichzeitig eine Abhängigkeit von anderen Substanzen auf. Zudem erfüllt über ein Drittel der Betroffenen irgendwann im Leben die Kriterien für eine Major Depression.
Entzug und Therapie
Eine Entzugsbehandlung konzentriert sich hauptsächlich auf die Entgiftung, die oft stationär erfolgen muss. Anschließend sollte Betroffenen eine mehrwöchige Entwöhnungstherapie angeboten werden, um die langfristige Abstinenz zu fördern. Ein langjähriger Alkoholkonsum kann zu schwerwiegenden neurologischen Komplikationen wie der Wernicke-Enzephalopathie und dem KorsakowSyndrom führen, die durch Gedächtnis- und Bewegungsstörungen sowie Verwirrtheit gekennzeichnet sind. Die Therapie der Alkoholabhängigkeit erfordert zumeist eine Vitamin-B1-Zufuhr und eine pharmakologische Therapie zur Verringerung des Cravings – z. B. mit Naltrexon bzw. Nalmefen. Neben (sozio-)therapeutischen Ansätzen wie dem Motivational Interviewing oder der Verhaltenstherapie ist jedenfalls die Behandlung psychiatrischer Komorbiditäten zentral. >
Die Wirkung von Benzodiazepinen bzw. Z-Substanzen beruht hauptsächlich auf der Verstärkung der hemmenden Wirkung von GABA-Rezeptoren im Gehirn. Neben dem Risiko einer Überdosierung geht eine langfristige Einnahme von Tranquilizern mit einer Abnahme von kognitiven, motorischen und sensorischen Leistungen einher. Generell bestehen kaum Indikationen, die eine Dauerverordnung rechtfertigen – das Risiko einer Abhängigkeit steigt mit längerer Anwendungsdauer und höherer Dosierung. Selten sind paradoxe Effekte wie sensorische Überempfindlichkeit oder motorische Unruhe zu beobachten. In Norwegen konnte außerdem gezeigt werden, dass es durch eine Reduktion der Benzodiazepinverschreibungen zu einer Verminderung von Hüftfrakturen um 13 % kam. Während sich die Abhängigkeitsprävalenz in der Bevölkerung Österreichs aufgrund fehlender Daten kaum beziffern lässt, fällt auf, dass fast 70 % der Verschreibungen von Benzodiazepinen Frauen betreffen. Besondere Vorsicht ist geboten, da die Kosten von Benzodiazepinen gering sind und gefährdete Patient:innen zum Teil nach einer Ausstellung auf Privatrezepten fragen. In der Gruppe der Benzodiazepinkonsument:innen kommt es dadurch schnell zum soge-
nannten Doctor Shopping – dabei kann der Verschreibungsüberblick gänzlich verloren gehen. Eine Umstellung von Benzodiazepinen mit raschem auf solche mit langsamerem Wirkungseintritt reduziert zumindest die Gefahr einer Überdosierung. Es kann aber ebenso eine Low-Dose-Dependence entstehen, bei der keine wesentliche Toleranzentwicklung auftritt und Betroffene über Jahre hinweg eine unverändert geringe Dosis einnehmen. Die Indikation für eine Benzodiazepintherapie sollte daher regelmäßig reevaluiert werden.
Besonderheiten bei der Entwöhnung Im Falle einer Benzodiazepinabhängigkeit wird hauptsächlich eine schrittweise Reduzierung – ggf. im stationären Setting – über mehrere Wochen bis Monate angestrebt. Ein akutes Absetzen wird nicht empfohlen, da dies neben Entzugssymptomen wie Unruhe und Schlaflosigkeit zu Krampfanfällen führen kann. Die dauerhafte Entwöhnung ist jedenfalls ein langwieriger Prozess. Zuletzt werden alternativ vermehrt Z-Substanzen wie Zolpidem, Zopiclon oder Zaleplon verordnet, für die ein teils höheres Sicherheitsprofil und – speziell für Zopiclon – auch ein geringeres Abhängigkeitspotential beschrieben werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte Patient:innen in Opioiderhaltungstherapie (OET) gelten, denen häufig simultan Benzodiazepine – oft in zu hoher tägli-
Erfolgreicher Entwöhnungsversuch
Entwöhnungsversuch
Aktiver Konsument
Misslungener Entwöhnungsversuch
Erfolgreiche Entwöhnung
Rückfall
Abbildung: Kreislauf der Abhängigkeit. Mit einer spezialisierten, multiprofessionellen Therapie wird eine längerfristige Stabilisierung angestrebt.
„Trotz des Risikos einer erhöhten Sterblichkeit nimmt
mehr als die Hälfte der Patient:innen in Opioiderhaltungstherapie gleichzeitig Benzodiazepine ein – meist ärztlich verordnet.“
cher Dosierung – verschrieben werden. Wird gleichzeitig noch das Antikonvulsivum Pregabalin verordnet, bewirkt dies eine Erhöhung der Gesamtmortalität durch Überdosierungen.
Aufgrund ihrer analgetischen Wirkung sind Opioide aus der Medizin nicht mehr wegzudenken, können aber bei unkontrolliertem Konsum eine Abhängigkeit nach sich ziehen. Wenn psychiatrische Komorbiditäten vorliegen, insbesondere ein früherer Substanzmissbrauch, Persönlichkeits- oder affektive Störungen, beträgt das Abhängigkeitspotenzial bis zu 30 %. Erfreulicherweise sinken die Konsumraten von „i llegalen“ Opioiden in der EU (Österreich eingeschlossen) über die letzten Jahre – aktuell liegen sie unter 1 %.
Der Konsum sowohl von exogenen Wirkstoffen wie Morphin oder Heroin als auch von endogenen Peptiden, etwa Endorphinen und Enkephalinen, führt klinisch vorübergehend zu intensivem Wärmegefühl und Euphorie, gefolgt von einer tiefgehenden Entspannung über mehrere Stunden. Durch intravenöse Injektionen steigt das Risiko in Bezug auf Infektionserkrankungen (u. a. Hepatitis/ HIV) oder Spritzenabszesse. Das unsachgemäße Injizieren von aufgelöstem retardiertem Morphin kann zudem Embolien verursachen. Obwohl das Risiko einer erhöhten Sterblichkeit bekannt ist, nehmen über 50 % der Patient:innen in OET gleichzeitig Benzodiazepine ein –meist ärztlich verordnet.
Opioiderhaltungstherapie und additive Behandlung
Die OET gilt seit Langem als etablierte evidenzbasierte Behandlungsmethode. Sie umfasst neben Methadon (Razemat bzw. purifizierte Version) und retardierten Morphinen auch Buprenorphin. Kommt es durch Methadon zu QT-Verlängerungen, sollten retardierte Morphine verordnet werden. Von Buprenorphin existiert sowohl eine sublinguale Applikationsform als auch ein Depotpräparat, das von Patient:innen grundsätzlich positiv angenommen wird und suchtmedizinisch zu begrüßen ist. Der tägliche Besuch in der Apotheke entfällt, zudem reduziert sich durch eine Depotgabe das Risiko tödlicher Überdosierungen in Risikopopulationen.
In den letzten Jahren hat sich erfreulicherweise die Verabreichung von Naloxonspray etabliert, das von Ersthelfer:innen einfach über die Nase appliziert werden kann. Dennoch sind die Verschreibungen nach wie vor gering, wiewohl Österreich sich bei den drogenassoziierten Todesfällen im oberen Drittel der EU bewegt.
Zu Beginn ist es außerdem hilfreich, sozialarbeiterische Unterstützung zu gewährleisten, und im Einzelfall kann eine Psychotherapie bzw. eine klinisch-psychologische Behandlung – speziell die Verhaltenstherapie – den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Nach der Stabilisierung der Patient:innen sollte unbedingt eine Abklärung psychiatrischer Komorbiditäten erfolgen. Empfohlen wird ggf. eine simultane Behandlung – im Fall von ADHS beispielsweise die additive Verordnung von Psychostimulanzien.
Eine erfolgreiche Behandlung erfordert nicht nur eine professionelle ärztliche Diagnostik von Suchterkrankungen und psychiatrischen Komorbiditäten, sondern auch eine dauerhafte Lebensstilveränderung der Betroffenen. Rückfälle gehören zum Behandlungsverlauf und dürfen nicht als persönliches Versagen betrachtet werden. Ein Behandlungszugang muss wohnortnah möglich sein – gibt es keine Fachärzt:innen für Psychiatrie oder Klinischen Psycholog:innen im Nahbereich, ist die Methode der digitalen Medizin zu favorisieren.
* Aus Platzgründen wurde auf die Diskussion über Nikotin und Cannabis verzichtet.
Literatur bei den Verfasser:innen (siehe auch Buchtipp bzw. das im Werk enthaltene Literaturverzeichnis).

VORSCHAU
Psychostimulanzien (Kokain, Amphetamine) und Verhaltenssüchte: Lesen Sie mehr darüber in einer kommenden Ausgabe der Hausärzt:in <
EINFACH ZUVERLÄSSIG durch Überprüfung auf über 200 Störsubstanzen1 1 2 3
EINFACH ZU SCHULEN einfach für Ihre Patienten – einfach für Sie
EINFACHE HANDHABUNG dank intuitiver Funktionen
„Die Neurobiologie hinter der Angst“
HAUSÄRZT:IN: Welche Rolle spielt die Neurobiologie generell bei psychiatrischen Erkrankungen und im Konkreten bei Angststörungen?
Doz.in BARTOVA: Wir können die Entstehung bestimmter psychiatrischer Erkrankungen wie der Angsterkrankung oder der Depression mit dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (auch: Diathese-StressModell, Anm. d. Red.) erklären, welches das Zusammenspiel von genetischen Faktoren (z. B. familiäre Prädisposition) und Umweltfaktoren (z. B. die individuelle berufliche und familiäre Situation, der sozioökonomische Hintergrund) betont. Diese können die Entwicklung bzw. den Verlauf psychiatrischer Erkrankungen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Alle im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen auftretenden Beschwerden lassen sich sehr gut neurobiologisch erklären. Als Beispiel: Wenn ein Patient mit einer Angsterkrankung seine unterschiedlichen Symptome beschreibt und über eine Sorgenspirale berichtet, nervös und unruhig ist, möglicherweise auch unter Durchschlafstörungen und verschiedenen körperlichen Begleitbeschwerden leidet, kommt es im Gehirn zu einer Dysbalance in verschiedenen Neurotransmittersystemen. Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, GABA und Glutamat spielen hier eine große Rolle. Die verschiedenen Therapien, die bei Angsterkrankungen zum Einsatz kommen, beeinflussen genau diese Botenstoffsysteme. Auf der klinischen Ebene sehen wir eine Besserung der Symptome, die darauf beruht, dass die Dysbalance einer Harmonie weicht. Auf der funktionellen und strukturellen Ebene beobachten wir Veränderungen in Gehirnnetzwerken, die unter ande-
rem in die Emotionsregulation involviert sind. Zudem wurden wiederholt Veränderungen in der Neuroplastizität beschrieben. Durch eine rechtzeitige und adäquate Therapie konnte wiederholt eine Normalisierung bzw. Verminderung dieser pathologischen neurobiologischen Veränderungen beobachtet werden.
Was genau passiert in dem Fall im Gehirn und im Körper?
Ein wichtiger struktureller Befund wäre etwa ein vermindertes Volumen des Hippocampus, da diese Gehirnregion auch relevant für das Gedächtnis und die emotionale Verarbeitung ist. Auf der funktionalen Ebene sehen wir, dass es zu einer veränderten Kommunikation zwischen den Gehirnnetzwerken kommt, beispielsweise dem sogenannten Default Mode oder dem frontoparietalen Netzwerk. Diese Erkenntnisse können wir dank des Neuroimagings, sprich der verschiedenen computergestützten Bildgebungsverfahren wie der Magnetresonanztomographie, gewinnen. Der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Umweltund genetischen Faktoren wird in Form epigenetischer Veränderungen sichtbar. Das Immunsystem und die sogenannte Stressachse, bestehend aus Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde, sind auch bedeutend bei Angsterkrankungen sowie depressiven und auch körperlichen Erkrankungen wie dem Metabolischen Syndrom mit Adipositas, Diabetes oder Herzerkrankungen. Letztere gehören zu den häufigsten somatischen Komorbiditäten bei Depressionen und Angsterkrankungen.
Stichwort Praxisrelevanz: Warum ist dieses Wissen so bedeutend für Hausärzt:innen?

Dieses Wissen ist nicht nur sehr wichtig für das Verständnis der jeweiligen psychiatrischen Erkrankung, sondern auch für deren

Priv.-Doz.in DDr.in Lucie Bartova Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Wien, im Interview.
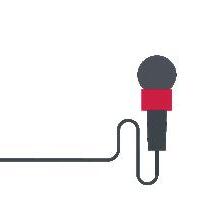
Behandlung. Wenn man von voll ausgebildeten manifesten Angsterkrankungen spricht, dann ist die medikamentöse Therapie essenziell. Ich bin eine große Befürworterin der Psychotherapie, die aber allein – ohne medikamentöse Behandlung – häufig nicht ausreicht. Daher ist es meistens notwendig, beide Therapien zu kombinieren. Bei einer ausgeprägten Angsterkrankung würde ich auf jeden Fall empfehlen, medikamentös zu beginnen, damit man die Symptome, die anfangs sehr bedrohlich und unangenehm für die Patient:innen sein können, in den Griff bekommt. Wenn es den Patient:innen dann schon besser geht, können diese auch mit den psychotherapeutischen Inhalten viel mehr anfangen, als wenn sie akut belastet sind und einen hohen Leidensdruck verspüren. Die gute Nachricht ist, und das möchte ich betonen: Wenn man psychiatrische Erkrankungen adäquat behandelt, haben Betroffene fast immer eine sehr gute Prognose – und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit. Das Entscheidende dabei: Sie müssen eine adäquate Behandlung erhalten, die idealerweise frühzeitig initiiert wird.
Wie sieht diese im Detail aus?
Eine adäquate Therapie sollte mit sogenannten neueren oder modernen Antidepressiva durchgeführt werden. Von den zahlreichen Substanzklassen scheinen die SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) und auch die SNRI
(Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) die wirksamsten zu sein. Wichtig ist hierbei ein individueller Zugang: Man sollte immer auf die einzelne Person, deren Beschwerden und die Umstände eingehen, etwa darauf, welche psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen vorhanden sind, auf das Alter, den BMI – und natürlich ist auch das jeweilige pharmakologische Wirkprofil zu berücksichtigen, um die führenden Symptome gezielt zu bekämpfen und potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden.
Pflanzliche Wirkstoffe wie Lavendel sind bei Angststörungen auch ein Thema und in der Leitlinie angeführt.1 Bei welchen Patient:innen ist diese Therapie anwendbar? Der Einsatzbereich der Phytotherapie sind die sogenannten subsyndromalen oder milden Ausprägungen. Sie haben bereits eine Substanz genannt, das Lavendelölpräparat bzw. Silexan. Sie wurde in den letzten 20 Jahren in hochqualitativen Studien untersucht, sodass es eine hohe internationale Evidenz gibt, die auch durch Metaanalysen erfasst wurde. Silexan ist sehr wirksam und gleichzeitig gut verträglich im Falle von Patient:innen mit Angsterkrankungen sowie einer unipolaren Depression und auch bei assoziierten Beschwerden, die sehr häufig sind – beispielsweise verschiedenen psychosomatischen Beschwerden wie Verspannungen, Schmerzsyndromen oder Herzklopfen. Die Patient:innen realisieren oft gar nicht, dass sie an einer Angsterkrankung leiden, und nehmen in erster Linie die körperlichen Beschwerden wahr, die sie häufig erstmals zum Arzt führen. Hausärzt:innen kommt hierbei eine enorm wichtige und klinisch relevante Bedeutung zu, da sie sehr oft die ersten Ärzt:innen sind, die Patient:innen mit Angsterkrankungen und psychiatrischen Erkrankungen aufsuchen. Wenn es sich vordergründig um keine voll ausgeprägte Angsterkrankung oder Depression handelt, kann man mit einer Phytotherapie, insbesondere mit Silexan, beginnen. Die Standarddosierung beträgt 80 Milligramm einmal täglich in der Früh. Sollte es nach zwei Wochen zu einer Besserung kommen, könnte man bei dieser Therapie bleiben. Wenn nicht, würde ich die Dosierung erhöhen: auf zweimal täglich – einmal in der Früh, einmal am Abend, für weitere zwei Wochen. Nach einem Monat erfolgt eine Evaluation. Wenn bis dahin keine zufriedenstellende Besserung eintritt, würde ich auf jeden Fall konventionelle Antidepressiva wie SSRI oder SNRI in das Behandlungskonzept einbeziehen.
Wie sollten Hausärzt:innen mit Patient:innen bei Verdacht auf eine psychische Erkrankung verfahren? Betroffene sollten in einem ersten Schritt immer an Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin überwiesen werden, um möglichst schnell eine richtige Diagnose und in der Folge eine adäquate Behandlung zu erhalten. Zwischenzeitlich kann bereits mit einer Phytotherapie begonnen und nach etwaigen somatischen Ursachen, beispielsweise einer Schilddrüsenfunktionsstörung, gesucht werden.
Das Interview führte Justyna Frömel, Bakk. MA.
Literatur:
1 Bandelow B et al., 2021. S3-Leitlinie 051-028, Behandlung von Angststörungen.
Migräne: Rezente Studie identifiziert Unterschiede in Wirksamkeit und Verträglichkeit
Migräne nimmt unter den häufigsten Erkrankungen den sechsten Platz ein – weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen davon betroffen. Die moderaten bis starken Kopfschmerzen mit neurovaskulärem Ursprung inklusive ihrer unangenehmen Begleiterscheinungen weisen einen Häufigkeitsgipfel zwischen 35 und 45 Jahren auf, wobei Frauen doppelt so oft darunter leiden wie Männer.1 Erfahren die Patient:innen durch (Kombinations-) Analgetika oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) keine Linderung ihrer Symptomatik, sollten laut Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie2 Triptane eingesetzt werden. Diese sind den zuvor genannten Analgetikaklassen hinsichtlich der Schmerzfreiheit der Behandelten, die zwei Stunden nach der Einnahme beurteilt wird, überlegen.2 Allerdings gibt es Unterschiede im Ansprechen auf diese spezifischen Migränetherapeutika und auch eine effektive bzw. ineffektive Triptanbehandlung war lange nicht eindeutig definiert. Rezente Publikationen bringen Licht in jene Themen.
Die European Headache Federation (EHF)3 definiert eine effektive Behandlung wie folgt: Innerhalb von zwei Stunden nach Einnahme der Medikation tritt ein Zustand des Wohlergehens ein, der für mindestens 24 Stunden anhält und sich entsprechend im Rahmen von drei Kriterien manifestiert:

• Verringerung der Kopfschmerzen von schwer oder moderat zu mild oder abwesend,
• fehlende oder minimale Störung durch nicht schmerzhafte migränebezogene Symptome,
• keine nennenswerten arzneimittelbedingten unerwünschten Ereignisse.3
Durch eine Evaluierung jeder Medikamenteneinnahme in einem Schmerztagebuch können Ärzt:innen gemeinsam mit den Patient:innen herausfinden, ob es sich um Triptanresponder bzw. -nonresponder handelt. Werden mindestens drei von vier konsekutiven Migräneattacken mit demselben Triptan erfolgreich behandelt, besteht ein Ansprechen auf die Therapie – ansonsten handelt es sich um Nonresponder bezüglich des verab-
TABELLE: ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE BEWERTUNG DES THERAPIEANSPRECHENS3 1.
reichten Triptans (siehe Tabelle). Erfolgt kein Ansprechen auf zwei verschiedene Triptane, spricht die EHF von triptanresistenten, bei drei oder mehr ineffektiven Triptanen (wovon zumindest eines subkutan verabreicht wurde) von triptanrefraktären Patient:innen.3
Eine rezente Analyse von Daten aus dem Kopfschmerzregister der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG)4 beziffert nun auch, wie es um das Ansprechen auf Triptane bestellt ist. Von 2.248 Patient:innen waren 42,5 % Nonresponder in Bezug auf ein Triptan – oder mehrere wirkten bei ihnen nicht, wie die Autor:innen weiter aufschlüsselten. 13,1 % der Studienteilnehmer:innen galten als triptanresistent und 3,9 % als triptanrefraktär. Diejenigen, die nicht auf Triptane ansprachen, hatten signifikant häufigere und schwerere Migräneattacken und damit einhergehende Einschränkungen als jene, bei denen die Arzneimittel Wirkung zeigten.4
Dank der erhobenen Daten können auch genauere Angaben darüber gemacht werden, welche Triptane besonders wirksam und verträglich sind. Der größte
Anteil der Patient:innen, bei denen ein Ansprechen eintrat, nahm folgende Arzneimittel ein – mit einer Ansprechrate von jeweils mehr als 40 % (siehe Grafik):
• Zolmitriptan (nasal)
• Eletriptan
• Sumatriptan (subkutan)
• Zolmitriptan (oral)
Die größten Probleme bezüglich der Verträglichkeit traten bei Sumatriptan (oral) auf, in puncto Wirksamkeit bei Sumatriptan (nasal).4
Die Studienautor:innen weisen darauf hin, dass Migränepatient:innen besondere Aufmerksamkeit bräuchten, da jene, die nicht auf eines oder mehrere Therapieangebote ansprächen, mit starken Einschränkungen zu kämpfen hätten. Die Optimierung der Behandlung akuter Attacken inkludiert die Erinnerung daran, dass die Therapie früh und in ausreichender Dosierung erfolgen muss. Zudem sollte ein Triptan mit hoher Wahrscheinlichkeit eines
PROZENTSATZ DES THERAPIEANSPRECHENS AUF EINZELNE TRIPTANE4
% Responder
Zolmitriptan (nasal) 45,1%
Eletriptan 43,1%
Sumatriptan (subkutan) 42,9%
Zolmitriptan (oral) 41,6%
Rizatriptan 38,9%
Naratriptan 35,6%
Sumatriptan (oral) 31,4%
Almotriptan 27,7%
Sumatriptan (nasal) 20,5%
Frovatriptan* 10,8%
der Patient:innen
* Die Daten zum Therapieansprechen erscheinen bei Frovatriptan artifiziell niedrig, was mit der hohen Rate an Therapieabbrüchen zusammenhängt, welche die Autor:innen auf Probleme hinsichtlich Erstattung und Verfügbarkeit zurückführen.
Ansprechens gewählt werden. Zeigen mehrere Triptane keine Wirkung, kann die Gabe der erst 2022 in Europa zugelassenen Ditane oder Gepante erwogen werden.4
Quellen:
1 Pehlivanlar E et al., ACS Pharmacol Transl Sci 2024; 7: 951-966.
2 Diener HC et al., Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, S1-Leitlinie, 2022; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.
3 Sacco S et al., The Journal of Headache and Pain 2022; 23: 133.
4 Ruscheweyh R et al., The Journal of Headache and Pain 2023; 24: 135.
Die Österreichische Diabetes Gesellschaft will sich mit dem niedergelassenen Bereich intensiver vernetzen
Die heurige Frühjahrstagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG), vom 12.-13. April 2024 in Villach, galt dem Motto „ Diabetes im Tauziehen zwischen Innovationen und Ressourcen“ So wurden einerseits die neuesten Technologien und Therapieansätze vorgestellt, andererseits die zunehmenden Einschränkungen im Versorgungssystem diskutiert.
Thema waren etwa automatisierte Insulinpumpen und Smartpens, die die abgegebenen Insulineinheiten automatisch dokumentieren. Zukunftstherapien, wie ein einmal wöchentlich zu spritzendes Insulin, eine zweimal jährliche Blutdrucktherapie oder eine einmalige Infusion, die zu einem lebenslang niedrigen Cholesterinspiegel durch eine Gentherapie führt, wurden beleuchtet. Ebenso stand die gesellschaftlich relevante Problematik Adipositas zur Debatte. Ein Paradigmenwechsel in der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 zeichnet sich ab: Aufgrund vieler neuer Substanzen sind nie dagewesene Ergebnisse in der Gewichtsreduktion zu erzielen. Daher wird es in Zukunft umso mehr heißen: Diabetesmanagement = Gewichtsmanagement.
Fortschritte
Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching, MBA, Präsident der ÖDG und Abteilungsvorstand der 5. Medizinischen Abteilung mit Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie der Klinik Ottakring in Wien, erklärt: „I n der Diabetologie gelingen große technologische und therapeutische Fortschritte, die Leben verlängern und die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes verbessern können. Gleichzeitig stoßen wir immer öfter an Grenzen in der Versorgung der Patient:innen. Das beginnt bei der aktuell eingeschränkten Verfügbarkeit

von wichtigen Diabetestherapien und endet in der Personalknappheit unserer Gesundheitssysteme. Als neuer ÖDGVorstand legen wir einen starken Fokus auf die konstruktive Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholdern im Gesundheitswesen. Dazu fand auch ein Treffen zwischen ÖDG-Vertreter:innen und der Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich ‚wir sind diabetes‘ im Rahmen der Frühjahrstagung statt.“
Prof. Fasching führt weiter aus: „I nsbesondere soll die Vernetzung mit dem niedergelassenen Bereich, einschließlich Primärversorgungseinheiten (PVEs), Internist:innen und Allgemeinmediziner:innen, forciert werden. Dazu gehört auch, verstärkt niedergelassene Ärzt:innen für diabetesrelevante Zusatzausbildungen zu gewinnen. Dies ist entscheidend für eine integrierte Versorgung von Menschen mit Diabetes.“ Priv.-Doz.in Dr.in Gersina Rega-Kaun, erste Sekretärin der ÖDG und Leiterin der Lipidambulanz an der 5. Medizinischen Abteilung der Klinik Ottakring, ergänzt: „ Diabetes ist eine der großen Gesundheitsherausforderungen in unserem Land. Da jede zehnte erwach-
NACHBERICHT
sene Person in Österreich an Diabetes erkrankt ist, werden in jeder Ordination für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin und auch in jeder PVE Menschen mit Diabetes behandelt. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft will den aktuellen Wissensstand zur Erkrankung vermitteln und alle Behandler:innen dabei unterstützen, Menschen mit Diabetes optimal zu versorgen.“
Als ein geeignetes Tool zur Vernetzung sieht die ÖDG das Disease Management Programm (DMP) „T herapie Aktiv – Diabetes im Griff “ Dieses soll in Kooperation und im Austausch mit den Gesundheitskassen ausgebaut und für Ärzt:innen sowie Menschen mit Diabetes attraktiver werden, damit jeder Mensch mit Diabetes die Chance hat, im Rahmen dieses Programmes betreut zu werden. Ein Ausschuss der ÖDG überarbeitet daher das DMP – dabei geht es etwa auch um Schulungsangebote für Betroffene. Die Vorsorge, um Folgen des Diabetes zu vermeiden bzw. rechtzeitig zu entdecken und einer Therapie zuzuführen, steht dabei an vorderster Stelle.
PA/AS
40. Frühjahrstagung der ÖDG, 12.-13. April 2024, Congress Center Villach.

EXPERTE:
OA Dr. Klemens
Fheodoroff
Neurologe an der Gailtal-Klinik Hermagor
Das Leben mit einer spastischen Bewegungsstörung stellt Patient:innen und Pflegende vor große Herausforderungen. In 15 Prozent der Fälle beeinträchtigt die Spastizität Betroffene so schwer in Funktion, Aktivitäten und Teilhabe, dass sie als behandlungsbedürftig angesehen wird. „I n frühen Stadien sind vor allem die ziehendkrampfartigen Schmerzen und die Bewegungseinschränkung belastend. In späteren Stadien stehen die anhaltenden Fehlstellungen im Vordergrund, die durch eine Behandlung verbessert werden könnten“, erklärt OA Dr. Klemens Fheodoroff, Neurologe an der GailtalKlinik Hermagor. „L eider schenken sowohl niedergelassene Ärzt:innen als auch Therapeut:innen der Spastizität zu wenig Aufmerksamkeit.“
Da eine Spastizität oft erst drei bis sechs Monate nach dem Schlaganfall auftritt, wäre eine multiprofessionelle Nachsorge notwendig. Doch diese wird nur selten von der Akutoder Rehaklinik initiiert. Folglich müssen sich die Hausärzt:innen trotz fehlender zeitlicher Ressourcen und fehlender Vergütung meist selbst ums Koordinieren eines multiprofessionellen Teams (Physio- und Ergotherapie, BotulinumToxin-Behandlung etc.) sowie um die Betroffenen und ihre Angehörigen kümmern. „I nsbesondere bei vorhandener Rest-Bewegungskontrolle ist die Zuweisung zu erfahrenen
INFO
Was bedeutet die Entwicklung einer Spastizität für die Patient:innen?
Bei Hausärzt:innen zum Thema werden können:
� Steifheit (erhöhter Muskeltonus)
� Schmerzen
� Beeinträchtigung der Selbstversorgung und Mobilität – erhöhter Pflegebedarf
� Verlust der Feinmotorik, Einschränkungen in der Funktion/ADL
� Verringerte Gesamtmobilität
� Scham und Stigma, niedriges Selbstwertgefühl wegen
� • unwillkürlicher Bewegungen,
� • Fehlhaltungen der Extremitäten
� Verminderte Lebensqualität
� Dauerhafte Behinderungen (Kontrakturen)
� Stimmungsschwankungen und Depressionen
� Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit –erhöhte finanzielle Belastung
Therapeut:innen wichtig“, hebt OA Fheodoroff hervor. „ Die Betroffenen können diese Bewegungskontrolle durch ein geeignetes Übungsprogramm ausbauen und damit der zunehmenden Verkrampfung entgegenwirken “ Ist keine Bewegungskontrolle vorhanden, können die Patient:innen nur in geringem Umfang durch sorgsame Lagerung und Dehnung gegen die Verkrampfung ankämpfen. „Zu berücksichtigen ist dabei auch der Muskelabbau in den gelähmten Körperteilen, der die Beweglichkeit weiter einschränken kann“, gibt der Experte zu bedenken. „Wirklich wirksam sind in diesem Stadium nur Botulinum-Toxin-Injektionen in die betroffenen Muskeln, die die Verkrampfung und damit verbundene Missempfindungen für einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten reduzieren und die aktive Bewegungskontrolle – sofern vorhanden – freisetzen können.“ Damit werde sozusagen ein „therapeutisches Fenster“ eröffnet, in dem es möglich ist, an der Bewegungskontrolle zu arbeiten.
VORSCHAU Hausärzt:in 6/2024: „Therapieziele bei Spastizität –Expert:innensuche“.


















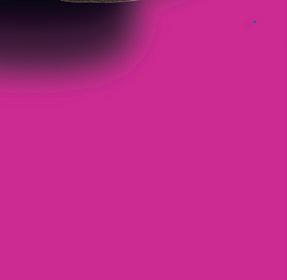
Als dringend notwendig erachtet es OA Fheodoroff, dass die Hürden bei der Zuweisung und Kostenerstattung in einzelnen Bundesländern abgebaut werden. „ Auch sollte die Spezialisierung bzw. Ausbildung von Neurolog:innen, Rehabilitationsmediziner:innen und Therapeut:innen gefördert werden“, hält er fest. „ Mehrere Studien haben bestätigt, dass die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patient:innen durch die Botulinum-Toxin-Behandlung zunimmt.“
KaM
Literatur beim Experten.
„Eine
Ein WORDRAP zur Praxisrelevanz der Leitlinie
„Sekundärprophylaxe des ischämischen Schlaganfalls“1 – mit Fokus auf Vorhofflimmern als Ursache
Häufigkeit von Schlaganfallrezidiven
OA FIEDLER: Der Literatur ist zu entnehmen, dass Patient:innen, die einen Schlaganfall erlitten haben, in der Folge ein – um bis zu 20 Prozent – höheres Risiko haben, erneut einen solchen zu erleiden. Statistisch besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Vorhofflimmern (VHF), das nicht adäquat behandelt wird.2 Risiko-Scores wie der CHA2DS2VASc-Score berücksichtigen dies bei ihren Auswertungen.3 Hat sich bereits ein Schlaganfall ereignet, sollten also die Alarmglocken bei den behandelnden Ärzt:innen läuten.
Praxisrelevanz von Leitlinien
Die deutsche S2k-Leitlinie „ Sekundärprävention des ischämischen Schlaganfalls“ bietet, in leicht verständlichem wissenschaftlichem Jargon, einen guten Überblick, wie bei unterschiedlichen Patient:innenfällen vorgegangen werden sollte.1 Wie alle Leitlinien ist sie aber recht kompakt. Deshalb kann es bei spezifischen Fragen trotzdem sinnvoll sein, spezialisierte Kolleg:innen zu Rate zu ziehen.
Shared Decision-Making
Die unterschiedlichen Fachrichtungen, die sich mit einem Schlaganfall befassen, etwa Neurologie und Kardiologie, sollten möglichst homogen und verzahnt arbeiten, um niemanden zu übersehen. Die echte Vorsorge gegen den Schlaganfall passiert im Grunde in der niedergelassenen Praxis. Die praktische Ärzt:in bzw. die Internist:in kann durch gezielte Fragen antizipieren, wie hoch das Schlaganfall-(Rezidiv-)Risiko ist, bestehende Grunderkrankungen detektieren und behandeln und prophylaktische Maßnahmen einleiten.1
Zusammenspiel von Ursachen und Risikofaktoren
Von der gefäßbedingten Schlaganfallproblematik sind meist Patient:innen mit Metabolischem Syndrom betroffen, bei VHF-Patient:innen ist das zwar auch möglich, aber das Spektrum möglicher Ursachen viel breiter.4 Auch Herzklappenerkrankungen und exzessive sportliche Betätigung können zum Beispiel VHF begünstigen.5,6 Die Genetik spielt ebenfalls eine Rolle. Die Risikofaktoren und Ursachen können also zum Teil überlappend sein, zum Teil stark divergieren.7
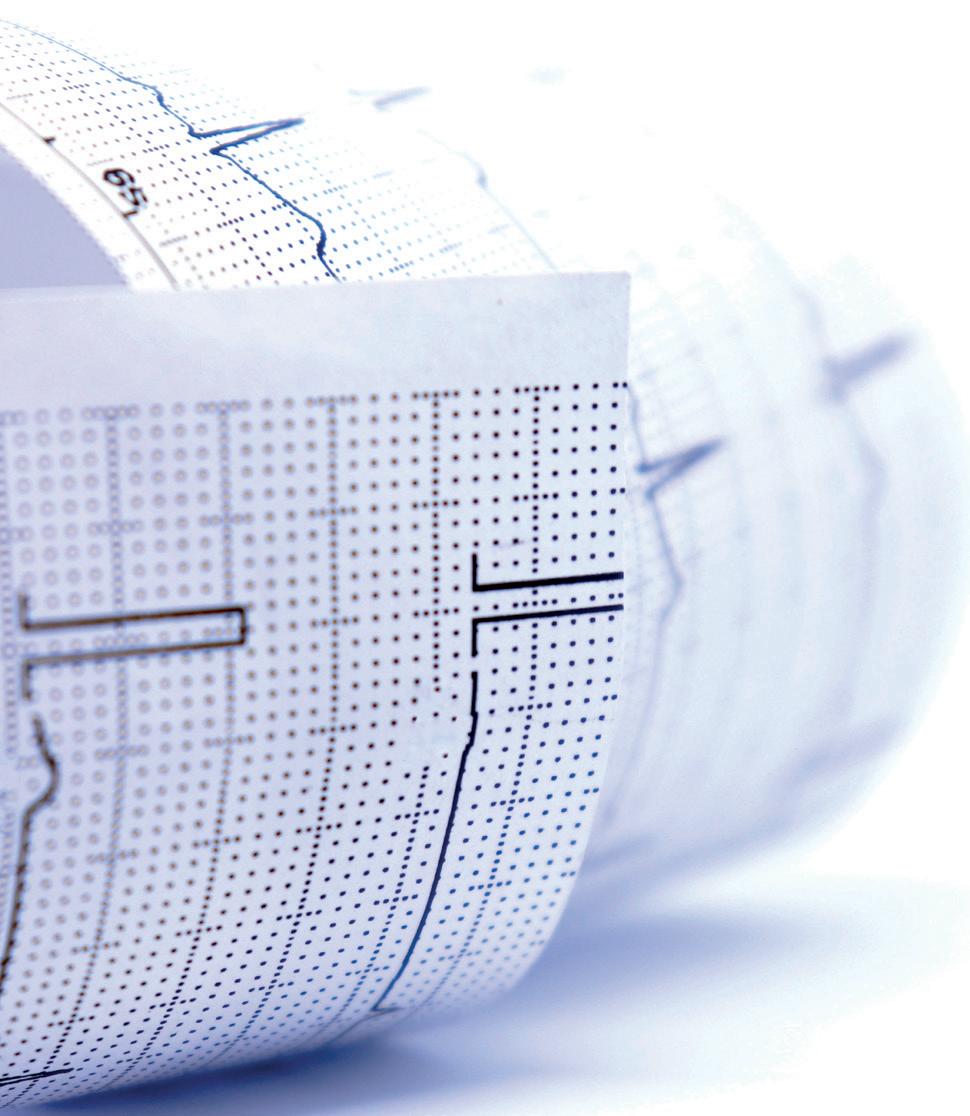
(Aktive) Suche nach Vorhofflimmern
Diese ist aus meiner Sicht als Rhythmologe und Internist sehr wichtig, zumal 80 Prozent der VHF-Episoden zunächst asymptomatisch sind.8 Die Suche sollte im Verdachtsfall möglichst strukturiert erfolgen. Mit implantierbaren Loop-Rekordern ließe sich heute jede Episode detektieren. Allerdings ist diese Therapie kostspielig.9 Mit dem CHA2DS2-VAScScore können Risikopatient:innen herausgefiltert werden.3 Welche Therapien möglich sind, kann mit der Kardiolog:in geklärt werden. Eine erste wichtige

OA Dr. Lukas Fiedler, Abteilung für Innere Medizin –Kardiologie und Nephrologie, LK Wiener Neustadt, im Wordrap-Interview.
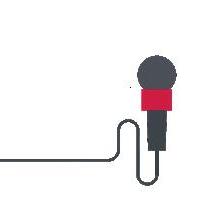
Maßnahme in der allgemeinmedizinischen oder internistischen Praxis ist die Behandlung der Grunderkrankungen.
Stellenwert von ThrombozytenAggregationshemmern (TAH)
TAH haben laut aktueller Studienlage beim Schlaganfall durch Vorhofflimmern keinen Stellenwert. Sie stehen in den Guidelines sogar in der Kategorie „Don’t do it“. Als medikamentöse Prophylaxe werden orale Antikoagulanzien empfohlen.1 Oft kommen Patient:innen mit der Frage, ob sie nicht „nur ein Aspirin“ nehmen könnten. Aber das reicht im Fall von VHF nicht aus – das gilt es klar zu kommunizieren! TAH haben dafür einen hohen Stellenwert in der Prophylaxe von arteriell verursachten Schlaganfällen, Stichwort Carotisplaques.
NOAK in der Sekundärprävention
Hat man früher auf Blutverdünner wie Marcumar gesetzt, so gelten heute die neuen direkten oralen Antikoagulanzien (NOAK) bei der Indikation Schlaganfall durch VHF als potenter und sicherer. Vorteile ebenjener sind: Sie sind gut untersucht. Sie müssen nicht spiegelkontrolliert werden. Sie sind für die Patient:innen einfach einzunehmen. Und mit der Einnahme geht ein niedrigeres Hirnblutungsrisiko einher als bei Marcumar 10
Dyslipidämie in der allgemeinmedizinischen Praxis
Eine positive Wirkung der Statine auf kardiovaskuläre Ereignisse bei Dyslipidämie gilt als gesichert.11 Statine sind wahrscheinlich die am besten untersuchten Medikamente überhaupt. Trotzdem gibt es immer noch eine große Skepsis wegen möglicher Nebenwirkungen, wenngleich nur eine sehr kleine Gruppe von Patient:innen davon betroffen ist. Die Therapie ist jedenfalls einen Versuch wert. Auch die modernen Injektionstherapien können hilfreich sein, wenn es darum geht, die Blutfettlast zu reduzieren.12
Intensive LDL-C-Senkung
Es kann nicht schaden, einmal im Jahr die Blutfette der Patient:innen zu kontrollieren. Der Zielwert für das LDLC sollte bei Risikopersonen möglichst tief angesetzt werden, bei sehr hohem Risiko durchaus unter 50 mg/dl und eine Senkung des LDL-C Ausgangswertes um mindestens 50 %.11 Ein Argument dafür könnte sein: Es gibt eine gewisse Gruppe junger, gesunder, sportlicher Menschen, die diese Statine, die die Kranken regelmäßig ablehnen, aus Longevity-Gründen einnimmt. Weil sie hofft, so länger zu leben … Um die Therapieziele zu erreichen, können Kombinationstherapien das Mittel der Wahl sein.13
Individuelle Zielblutdruckwerte
Auch ein niedriger Blutdruck ist eine wichtige Säule der Schlaganfallprophylaxe. Gefäßschädigungen werden aufgehalten oder stabilisiert. Der Zielwert ist bei Risikopersonen unter 130 zu 80 mmHg angesetzt. Studien zeigten bei diesem niedrigen Grenzwert die besten Ergebnisse. Je besser der Blutdruck eingestellt ist, desto länger lebt man – auch das kann man den Patient:innen kommunizieren.8 Der Blutdruck sollte aber natürlich nicht so niedrig eingestellt sein, dass man davon Nebenwirkungen wie Schwindel bekommt.
Geriatrisches Assessment
Die Patient:innen werden erfreulicherweise immer älter. Dadurch entstehen allerdings viele geriatrische Problematiken. Viele Senior:innen sind von Nierenerkrankungen betroffen, sie nehmen diverse Medikamente ein. Das muss man bei der Verordnung von Gerinnungshemmern und bei der Dosierung beachten. Man wird eher auf solche setzen, die über die Leber ausgeschieden werden. Grundsätzlich gibt es aber gute Daten dafür, dass blutverdünnende Medikamente auch bei Patient:innen in höherem Alter sicher sind.14 Überschätzt wird oft die Fragilität. Alle denken sofort an den alten Menschen, der stürzt und dann verblutet. Dieses Risiko ist für die Blutverdünnung fast zu vernachlässigen. Von Marcumar wissen wir: Man müsste mehr als 300 Mal stürzen, dass etwas passiert.15 Das heißt, die Fragilität im Auge behalten – ja. Aber einen Patienten deshalb nicht blutverdünnen – nein.
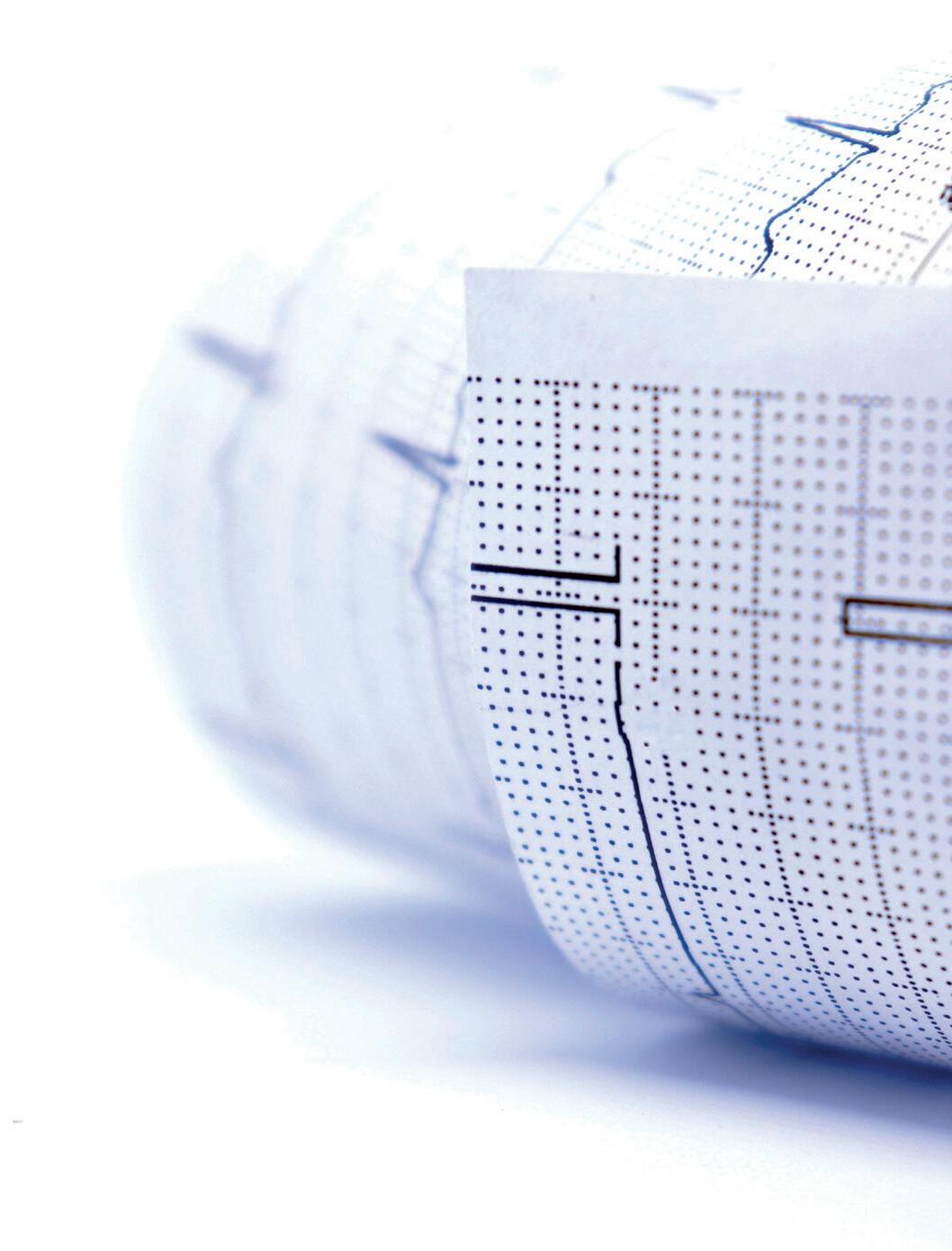
Literatur:
1 Hamann GF, Sander D, Röther J et al., Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke: Teil 1, S2k-Leitlinie, 2022, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie.
2 Stahmeyer JT et al., Häufigkeit und Zeitpunkt von Rezidiven nach inzidentem Schlaganfall, Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 711-7.
3 noak-therapie.de/cha2ds2-vasc-score-berechnen
4 2021 EHRA Practical Guide on the Use of NonVitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation.
5 noak-therapie.de/vorhofflimmern
6 Adukauskaite A, Stühlinger M, Vorhofflimmern beim Sportler: Häufigkeit, Diagnose und Therapie. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2023 Mar;34(1):39-44.
7 Haverkamp W et al, Alternative Behandlungsverfahren bei Vorhofflimmern. Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2023 Mar;34(1):59-65.
8 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
9 Mittal S et al., Long-term ECG monitoring using an implantable loop recorder for the detection of atrial fibrillation after cavotricuspid isthmus ablation in patients with atrial flutter. Heart Rhythm. 2013 Nov;10(11):1598-604.
10 Einecke D, NOAK sind sicherer als Phenprocoumon. MMW – Fortschritte der Medizin 161, 79 (2019).
11 ESC/EAS Pocket Guideline Dyslipidämien: Version 2019.
� Vorhofflimmern (VHF) erhöht das Risiko ischämischer Schlaganfälle um das Vier- bis Fünffache.1
- Die Sekundärprophylaxe ist umso wichtiger – es gilt, Rezidive und Folgeschäden des Schlaganfalls hintanzuhalten.
- Aufgabe der Hausärzt:innen ist es, Risikopatient:innen zu identifizieren und auf die richtige Therapieschiene zu bringen. Dabei können sie sich der Leitlinie1 bedienen oder die Patient:innen spezialisierten Kolleg:innen zuweisen.
- In jedem Fall notwendig ist die Detektion und konsequente Behandlung von bestehenden Grunderkrankungen und Risikofaktoren.
- Als medikamentöse Prophylaxe werden bei Schlaganfallpatient:innen mit Vorhofflimmern orale Antikogulanzien unter Berücksichtigung des CHA2DS2-VASc-Scores empfohlen.
12 Overbeck P, Prognoseverbesserung durch Lipidsenker Inclisiran: „Erste Einblicke“. CV 23, 9–10 (2023).
13 Masana L et al., Reasons Why Combination Therapy Should Be the New Standard of Care to Achieve the LDL-Cholesterol Targets. Curr Cardiol Rep. 2020 Jun 19;22(8):66.
14 Diener H, Grond M, Antikoagulation bei alten Menschen nach Einführung der Antidota. Geriatr Rep 16, 28–30 (2021).
15 Shoeb M, Fang MC, Assessing bleeding risk in patients taking anticoagulants. J Thromb Thrombolysis. 2013 Apr;35(3):312-9.
Hier geht es zur Leitlinie:

EXPERTIN:
Dr.in Brigitte
Obermayer, MBA
Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie und leitende
Oberärztin im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Operieren? Und wenn ja, wie?
Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) ist die Folge anhaltender oder rezidivierender ungünstiger hämodynamischer Bedingungen, vor allem in den unteren Extremitäten. Eine überwiegend stehende oder sitzende Lebensweise vieler Menschen – insbesondere in den Industrienationen – beeinträchtigt den venösen Rückfluss des Blutes zum Herzen. Das venöse Blut verlässt seinen normalen antegraden Flussweg und fließt
durch die Venen in ein bereits gestautes Bein zurück. Dadurch erhöht sich der Druck auf das Endothel der venösen Gefäße. Die Folge sind inflammatorische Prozesse, die häufig mit Ödembildung einhergehen. Der Mechanismus dahinter: Der erhöhte Gewebedruck aktiviert Leukozyten und Thrombozyten, die Entzündungsmediatoren freisetzen und die Endothelbarriere zerstören. Plasma und Wasser können
dann in das Interstitium austreten und ein Ödem bilden. Die CVI führt unbehandelt zu charakteristischen Hautveränderungen – der Lipodermatosklerose – an den Beinen, die schließlich zu Hautulzerationen führen.1
Klinische
Keine Anzeichen von Venenerkrankungen
Ektatische oder retikuläre Venen* Varikosis*
Ödem
Hautveränderungen durch venöse Stase
(z. B. Pigmentierung, Verhärtung, Lipodermatosklerose)
Hautveränderungen durch venöse Stase und geheilte Ulzeration
Hautveränderungen durch venöse Stase und aktive Ulzeration
* Kann idiopathisch, also ohne chronische venöse Insuffizienz, auftreten. Quelle: msdmanuals.com, abgerufen am 10.04.2024.
Die Behandlungsmodalitäten zielen darauf ab, den venösen Klappenrückfluss zu reduzieren und dadurch den daraus resultierenden pathologischen Entzündungsprozess zu hemmen. Die Kompressionstherapie mit Pumpen, Bandagen und/oder abgestuften Kompressionsstrümpfen ist die Grundlage der Therapie. Pflanzliche Präparate, etwa mit Extrakten von Rotem Weinlaub oder Rosskastaniensamen, können die Entzündungsreaktion bei venöser Hypertonie reduzieren. Das Herbal Medicinal Product Committee bezeichnet die Wirkung beider Pflanzen bei CVI als „medizinisch anerkannt“ 2 Pharmakologische Wirkstoffe wie Diuretika und topische Steroidcremes können Schwellungen und Schmerzen reduzieren, stellen jedoch keine langfristige Therapieoption dar.
Wann eine OP indiziert ist
Endovaskuläre und chirurgische Techniken zur Behandlung des primären und sekundären venösen Klappenrefluxes verbessern nachweislich die venöse Hämodynamik, fördern die Heilung venöser Geschwüre und verbessern die Lebensqualität der Patient:innen. Die neueren endovaskulären Behandlungen von Krampfadern mittels Lasers, Radiofrequenzablation und chemischer Schaumsklerotherapie sind vielversprechend.
„Die Chirurgie kommt dann ins Spiel, wenn die Hauptvene, also die Vena saphena magna, oder die Vena saphena parva betroffen ist. Wenn die Klappenfunktion in der Leiste bzw. in der Kniekehle nicht mehr funktioniert, das Blut aus dem tiefen Beinvenensystem herausgepresst wird und sich dadurch die oberflächlichen Venen erweitern, dann ebenfalls“, erklärt Dr.in Obermayer. „ Auch bei Vorliegen von Entzündungszeichen, etwa Knöchelschwellungen, geht die Therapiewahl eher in Richtung Operation.“
Durch operative Eingriffe wird der Überdruck in den oberflächlichen Venen beseitigt, indem man diese Verbindung trennt, oder mittels Strippings, indem man das Gefäß aus der Haut herauszieht. Eine weitere Option ist die Behandlung der oberflächlichen Hauptvene von innen mit Hitze – entweder mit Laser oder mit Radiofrequenz. Dadurch wird ein Gefäßverschluss bewirkt. Mit einer Schaumverödung will man dasselbe erreichen. „ Dazu wird unter Ultraschallkontrolle Sklerosierungsschaum direkt in das Gefäß injiziert, was eine Entzündungsreaktion hervorruft und dann ebenfalls einen Gefäßverschluss bewirkt“, so die Chirurgin. Grundsätzlich gilt: Je weniger fortgeschritten die CVI ist, desto weniger invasiv muss der Eingriff sein. Die neueren Methoden, bei welchen mit Hitze von innen gearbeitet wird, sowie die VNUSClosure Therapie sind der Crossektomie bzw. der Stripping-Methode grundsätzlich überlegen. Allerdings darf das Gefäß nicht allzu weit sein, damit die Hitze das gesamte Endothel noch errei-
chen kann. „Wir reden hier von einem Durchmesser in der Leiste von ungefähr 1,5 Zentimeter. Wenn die Erweiterung über dieses Maß hinausgeht, ist es nicht mehr sinnvoll, von innen mit Hitze zu behandeln“, erklärt die Chirurgin. Dann bleibt als Alternative noch die Crossektomie bzw. das Stripping. „ Auch wenn ein insuffizienter Seitenast ganz knapp vor der Einmündung in das tiefe Beinvenensystem vorhanden ist, sollte man eher mit einer Crossektomie behandeln“, ergänzt Dr.in Obermayer. In jedem Fall ist eine genaue Abklärung mittels Sonografie des tiefen Beinvenensystems unumgänglich. „ Nur weil eine Patient:in erweiterte Venen am Bein hat, muss nicht zwangsläufig eine Venenerkrankung vorliegen. Es muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden“, so die Fachärztin.
Margit Koudelka1 Renner R et al., J Dtsch Dermatol Ges. 2009 Nov;7(11):953-61.
2 arzneipflanzenlexikon.info , abgerufen am 10.04.2024.

GASTAUTOR:
Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz
President elect der Österr. Gesellschaft für Knochen und Mineralstoffwechsel (ÖGKM), Vorsitzender der Österreichischen Osteoporose-Leitlinien-Kommission
Osteoporosebedingte Frakturen stellen ein bedeutendes und wachsendes nationales Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Um Patient:innen vor der ersten Fraktur zu schützen und gemäß einer Basiserhebung des Frakturrisikos (FRAX) diagnostische und therapeutische Ziele zu definieren, wurde die neue Österreichische Osteoporose-Leitlinie erarbeitet, die auf rezenten wissenschaftlichen Daten und internationalen Quellen basiert. Das individuelle Frakturrisiko sollte bei jeder Patient:in im Alter von 50+ mit klinischen Risikofaktoren* mittels FRAX berechnet und – wenn indiziert – eine prophylaktische osteologische Therapie eingeleitet werden.
Die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) ist eine zweidimensionale Bildgebungstechnologie, die entwickelt wurde, um die Knochenmineraldichte (KMD) des gesamten menschlichen Skeletts und auch spezifisch für Prädilektionsstellen osteoporotischer Frakturen zu messen. Seit den frühen 1990er-Jahren basieren die diagnostischen Kategorien „normal, Osteopenie und Osteoporose“, wie sie von einer WHO-Arbeitsgruppe empfohlen werden, auf diesem Konzept. Jene Kriterien dürfen jedoch nicht mit einem individuellen Frakturrisiko oder einer individuellen Therapieentscheidung gleichgesetzt werden.
Die DXA-Messungen der SchenkelhalsKMD werden in FRAX® verwendet. Die Wirbelsäule ist aufgrund der hohen Prävalenz degenerativer Veränderungen,
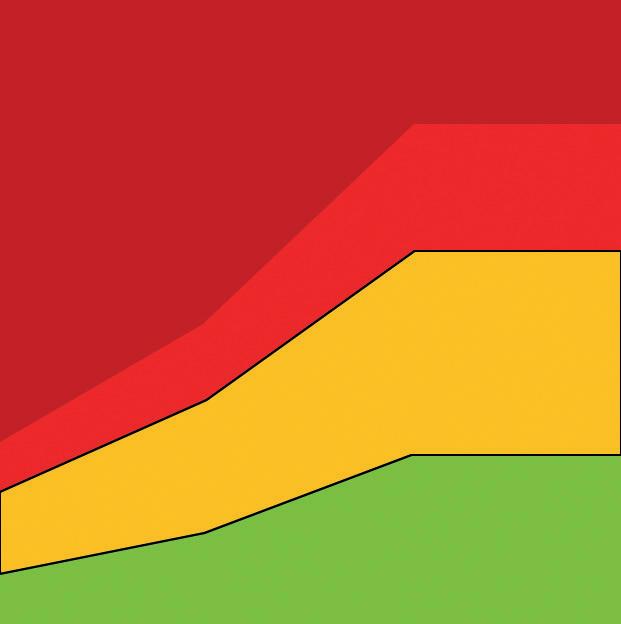
Alter (Jahre) sehr hohes Risiko
hohes Risiko
mittleres Risiko (KMDMessung durchführen) niedriges Risiko (Lebensstilberatung)
Behandlungsschwelle (bevorzugt osteoanabol)
obere Assessmentschwelle
Behandlungsschwelle (bevorzugt antiresorptiv)
untere Assessmentschwelle
Abbildung 1: Das FRAX-Risikomodell in Halbdekaden mit den vier entsprechenden Risiko- und Interventionsschwellen, basierend auf dem Österreichischen Risikomodell (siehe: oegkm.at). 50 55 60 65 70 80 90
die den KMD-Wert durch Artefakte in der Messung erhöhen, nicht immer eine anatomische Lokalisation für die Risikobewertung oder für die Diagnose von Osteoporose bei älteren Menschen.
Das absolute Frakturrisiko hängt von Alter und Lebenserwartung sowie vom aktuellen relativen Risiko ab. Der Zeitraum von zehn Jahren deckt die wahrscheinliche anfängliche Dauer der Behandlung und ihre Vorteile ab, die bei Abbruch der Behandlung fortbestehen können. Kürzere Zeithorizonte – z. B. ein, zwei oder fünf Jahre – sind für die Einstufung des Risikos nicht hilfreich. FRAX basiert auf länderspezifischen Frakturdaten. Die österreichischen Kohorten wurden im Jahr 2022 aktualisiert und validiert.
Für die Ersteinschätzung der 10-JahresFrakturwahrscheinlichkeit vor Durchführung einer DXA steht eine auf die österreichische Bevölkerung kalibrier-
NACHBERICHT
Quelle: Modifiziert nach Dimai HP et al., Arch Osteoporos. 2022 Nov 11;17(1):141.
te Version von FRAX zur Verfügung. Wenn das Frakturrisiko in den gelben Bereich fällt, wird zusätzlich eine DXAMessung empfohlen.
Danach erfolgt die Zuordnung zu einer der Risikokategorien – sowohl bei Männern als auch bei Frauen unter Verwendung der österreichspezifischen Schwellenwerte (siehe Abbildung 1):
• niedrig,
• hoch g primär antiresorptive Therapie,
• sehr hoch g primär osteoanabole Therapie.
Die Interventionsschwellen für Männer und Frauen sind so festgelegt, dass sie dem Risiko einer Frau gleichen Alters mit einer prävalenten Fraktur entsprechen. Männer und Frauen mit sehr hohem Frakturrisiko (dunkelroter Bereich in FRAX) sollten bevorzugt an ein auf Osteoporose spezialisiertes Zentrum bzw. zu Spezialist:innen überwiesen werden, um die Indikation und Möglichkeit einer (primären) osteoanabolen Therapie abzuwägen. Unabhängig davon ist eine niedrig traumatische Fraktur – unabhängig von DXA und FRAX – immer eine absolute Behandlungsindikation! Besonderes Augenmerk wird auf die
Die neue Leitlinie wurde am 32. Osteoporoseforum, 18. bis 20. April 2024, St. Wolfgang, vorgestellt und ist open access abrufbar (oegkm.at, PubMed).
Störung/Dysbalance des Remodelings Fraktur/erhöhtes FRAX-Risiko
Vitamin D: 800 IE/Tag
Kalzium: 1.000 mg/Tag**
Proteine: 0,8 bzw. 1 g/kg/KG (< 65 bzw. > 65 Jahre)**
abrupt gewichtsbelastetes Training („Impact Training“) und Krafttraining
MHT
SERM
Bisphosphonate
Denosumab antiresorptive Medikamente
** vorzugsweise über die Ernährung
osteoanabole Medikamente
Teriparatid
Abaloparatid
Romosozumab dual wirksame Medikamente
Abbildung 2: Behandlungsoptionen bei Osteoporose. Abkürzungen: MHT Menopausale Hormontherapie, SERM Selektiver Estrogenrezeptor-Modulator, KG Körpergewicht (Sollgewicht).
Rezentheit gelegt. Das Risiko einer Folgefraktur ist kurz nach einer Fragilitätsfraktur am höchsten (imminentes Frakturrisiko).
Antiresorptive Therapien: Zu ihnen zählen die Menopausale Hormontherapie (MHT), Selektive Estrogenrezeptor-Modulatoren (SERM), Bisphosphonate und Denosumab. Empfohlen werden diese Therapien bei hohem Frakturrisiko (FRAX: roter Bereich). Die Behandlung erfolgt langfristig, da Osteoporose eine chronische Erkrankung darstellt.
Alle
Anwendungsgebiete mehrfach durch Studien belegt:
Immunsystem
• Herz-Kreislauf
• antiviral
• antioxidaiv prebiotisch
• Kognition
• Recovery
Anabole Therapien: Etwa Teriparatid, Romosozumab oder Abaloparatid sind bei sehr hohem Frakturrisiko als Primärtherapie empfohlen (FRAX: dunkelroter Bereich). Im Anschluss an eine solche Therapie ist eine langfristige antiresorptive Behandlung notwendig. Medikamentös induzierte Kieferknochennekrosen (MRONJ): Das Risiko, unter einer antiresorptiven Osteoporosetherapie spontan eine MRONJ zu entwickeln, liegt bei 0,05 %. Nach invasiven zahnärztlichen Eingriffen steigt das Risiko auf etwa 1 %. Zahnärztliche Eingriffe wie das Setzen dentaler Implantate sind unter Berücksichtigung des erhöhten Risikos einer MRONJ möglich. Invasive
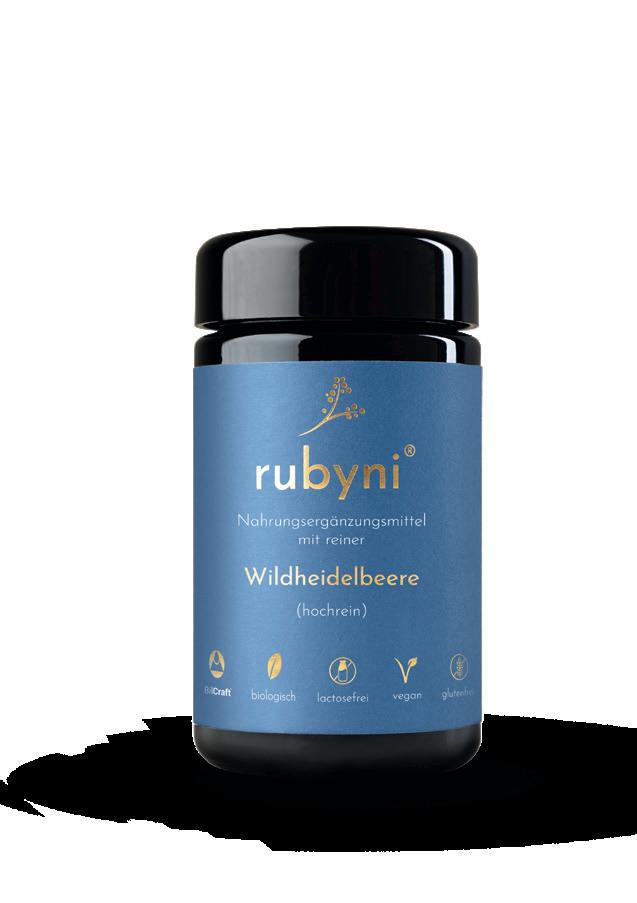
Verfahren sollen unter antibiotischer Abschirmung und speicheldichtem Wundverschluss erfolgen. Von der Verabreichung von Bisphosphonaten i. v. innerhalb von zwei Monaten nach Zahnextraktion ist Abstand zu nehmen. Einen Überblick über die pharmakologische Therapie sowie die nichtmedikamentösen Behandlungsoptionen gibt Abbildung 2. <
* Für nähere Informationen zu klinischen Risikofaktoren, Definition, Prävalenz, nichtmedikamentösen Therapiemaßnahmen und Empfehlungen auf nationaler Ebene siehe:
Die neue Österreichische Osteoporose-Leitlinie: Teil 1, Hausärzt:in 04/24 und auf Gesund.at:

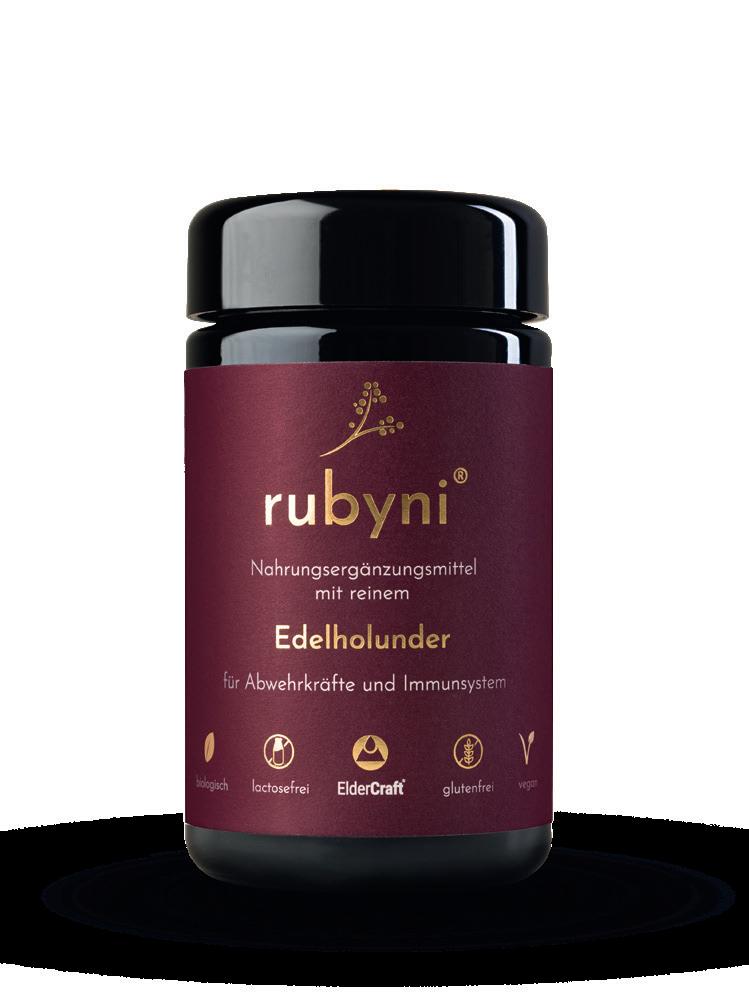
Natürliche Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Beeren-Extrakten




Am 5. Mai war Welt-Lungenhochdruck-Tag (pulmonale Hypertonie, PH). Eine Studie postuliert, dass diese Krankheit mit einer geschätzten Prävalenz von 50-70 Millionen Betroffenen und somit fast 1 % der Weltbevölkerung nicht mehr als selten betrachtet werden sollte.1 Häufig ist die Diagnose schwierig und langwierig. Beispielsweise vergehen durchschnittlich mehr als zwei Jahre bis zum Untersuchungsergebnis, wobei die meisten Betroffenen bei Erstdiagnose bereits fortgeschritten erkrankt sind.2 Weiters geht eine pulmonale Hypertonie, die in Verbindung mit kardiovaskulären und respiratorischen Erkrankungen auftritt, mit deutlich erhöhter Morbidität und Mortalität einher. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein für dieses Krankheitsbild zu schaffen.
Die Bezeichnung pulmonale Hypertonie fasst ein Spektrum von Erkrankungen zusammen, die den Blutdruck im Lungenkreislauf erhöhen. Wenn der pulmonal arterielle Mitteldruck (mPAP) in Ruhe dauerhaft über 20 mmHg liegt, spricht man definitionsgemäß von einer PH. Prinzipiell unterscheidet man die seltene (z. B. idiopathische) pulmonal arterielle Hypertonie (PAH), die chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH) und die pulmonale Hypertonie durch bestehende Grunderkrankungen (z. B. Herz- oder Lungenerkrankungen).²
In frühen Stadien bleibt die Erkrankung häufig asymptomatisch. Im Verlauf können unter anderem Dyspnoe bei Anstrengung oder beim Vorwärtsbeugen, Müdigkeit und rasche Erschöpfung, Palpitationen, Hämoptysen, Übelkeit, Gewichtszunahme oder Synkopen (während oder kurz nach körperlicher Anstrengung) auftreten. Langfristig entwickelt sich häufig eine Hypertrophie oder Dilatation des rechten Herzens, welche unbehandelt meist zu einer Herzinsuffizienz führen.2
Wenn die diagnostischen Mittel einer allgemeinmedizinischen Praxis (Anamnese, körperliche Untersuchung, EKG, Abnahme der natriuretischen Peptide BNP/NT-proBNP, O2-Sättigung) ausgeschöpft worden sind und die Symptome auf eine PH oder Herzerkrankung hindeuten, sind eine Echokardiographie und eine Spiroergometrie (CPET, kardiopulmonaler Belastungstest) hilfreich. Ist die Wahrscheinlichkeit für Lungenhochdruck groß, sollte an ein PH-Zentrum überwiesen werden. Dort findet eine umfassende Untersuchung inklusive Rechtsherzkatheter statt, der als Goldstandard zur Bestimmung hämodynamischer Parameter gilt. Vermutet man hingegen eine Lungenerkrankung, haben Untersuchungen wie Blutgasanalyse, Lungenfunktionstest,
Röntgen/CT des Thorax oder CPET Vorrang. Wenn man keinen Hinweis auf eine andere Ursache findet und Risikofaktoren für eine PAH oder eine CTEPH gegeben sind, ist ebenfalls eine Überweisung an ein Spezialzentrum notwendig. Generell gilt: Bei Warnsignalen oder bei Verdacht auf eine PAH oder CTEPH sollten Patient:innen umgehend („fast track“) an ein PH-Zentrum weitergeleitet werden.²
Die Leitlinien empfehlen für die Risikostratifizierung bei Diagnosestellung das Drei-Strata-Modell. Hier werden so viele Faktoren wie möglich berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt auf der WHOFC (World-Health-Organization-Funktionsklasse), der 6-Minuten-Gehstrecke, der Art der Erkrankung, BNP/NTproBNP und der Hämodynamik liegt. Während des weiteren Verlaufs wird dazu geraten, das Vier-Strata-Modell anzuwenden, welches eine weitere Einteilung des intermediären Risikos in intermediär niedrig und intermediär hoch beinhaltet (siehe Tabelle).²
In der Regel erfolgt eine gezielte Behandlung nur bei der PAH (medikamentös) und bei der CTEPH (chirurgische pulmonale Endarteriektomie und lebenslange Antikoagulation). Bei allen
anderen Formen steht die Therapie der Grunderkrankung im Fokus. „ Die Behandlung von Lungenhochdruck hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz dramatisch verändert. Als ich 1984 mit dem Studium fertig war, gab es gar nichts für Lungenhochdruck“, erinnert sich Univ.Prof.in Dr.in Irene M. Lang, Leiterin der Ambulanz für Lungenhochdruck am
Wiener AKH.3 Heute hingegen stehen verschiedene Wirkstoffklassen für die Therapie der PAH zur Verfügung. Dazu zählen etwa Prostazyklin-Analoga, Prostazyklin-Rezeptoragonisten, Endothelin-Rezeptorblocker, Phosphodiesterase-5-Inhibitoren, Guanylatzyklase-Stimulatoren oder Kalzium-Antagonisten. Dabei gelte es, möglichst früh
VIER-STRATA-RISIKOSTRATIFIZIERUNGSMODELL
Prognoseparameter niedriges Risiko
zugewiesene Punkte
Risiko intermediär hohes Risiko hohes Risiko
Das Risiko wird berechnet, indem die Summe aller Punkte durch die Anzahl der Variablen dividiert und auf die nächste ganze Zahl gerundet wird.
Abkürzungen: 6MWD = 6-Minuten-Gehstrecke; BNP = B-Typ natriuretisches Peptid; NT-proBNP = N-terminales pro-brain natriuretisches Peptid; WHO-FC = World-Health-Organization-Funktionsklasse.
* WHO-FC I und II werden mit 1 Punkt bewertet, da beide mit einem guten Langzeitüberleben assoziiert sind. Adaptierte Version aus folgender Quelle: Pocketleitlinie Pulmonale Hypertonie (Vers. 2022), Deutsche Gesellschaft für Kardiologie.
mit einer medikamentösen Therapie zu beginnen, die mehrere Wirkstoffklassen abdecke, unterstreicht Prof.in Lang.³ Bei PAH-Patient:innen – gerade in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium – mit intermediär hohem oder hohem Sterberisiko ist laut aktuellen Leitlinien eine frühzeitige Behandlung mit einer Dreifachtherapie ratsam, die parenterale Prostazyklin-Analoga inkludiert.² Vergangenes Jahr erschien außerdem eine Phase-III-Studie über einen Aktivin-Rezeptorinhibitor als weitere Therapieoption.4
Mara Sophie Anmasser
Literatur:
1 Corris PA, Seeger W, Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020 May 1;318(5):L992-L994.
2 leitlinien.dgk.org/2023/pocket-leitlinie-pulmonalehypertonie-version-2022
3 selpers.com/lektion/behandlung-deslungenhochdrucks-spezifische-therapie (Univ.-Prof. in Dr. in Irene Lang, 2019).
4 Hoeper MM et al., STELLAR Trial Investigators, N Engl J Med. 2023 Apr 20;388(16):1478-1490.
Hier geht es zur aktuellen Leitlinie:
Noch ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass niedergelassene Ärzt:innen in ihrer Praxis mit einem Fall von Sichelzellkrankheit konfrontiert werden. Endemisch ist jene in den tropischen Zonen Afrikas, im Mittleren Osten, in weiten Teilen Indiens, in der Osttürkei und örtlich begrenzt in Griechenland und Süditalien.1 „Auch in Mitteleuropa können wir jedoch davon ausgehen, dass die Prävalenz im Zuge der globalen Migration stetig steigen wird“, gibt Prof. Dr. Christian Sillaber, Univ.-Klinik für Innere Medizin I, MedUni Wien, zu bedenken. Für hämatologische Zentren und das Gesundheitssystem bringe das mit sich, dass zusätzliche Kapazitäten notwendig werden: „Es braucht die spezielle Erfahrung mit diesen Patient:innen“, so der Experte.
Unter dem Begriff Sichelzellkrankheit („sickle cell disease“, SCD) werden Erkrankungen zusammengefasst, die pathophysiologisch durch das Sichelzellhämoglobin (Hämoglobin S, HbS) verursacht werden. Definitionsgemäß beträgt der HbS-Anteil am Gesamthämoglobin über 50 %. Genetisch liegt dem HbS eine Aminosäuresubstitution an Position 6 der β-Globin-Kette zugrunde, wo eine Glutaminsäure durch Valin ersetzt ist. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Formen der SCD: Das HbS führt zu einer verminderten Löslichkeit des Hämoglobins. Insbesondere unter hypoxischen Bedingungen kommt es zu einer charakteristischen molekularen Formveränderung desselben und in der Folge zur namensgebenden Formveränderung der roten Blutkörperchen. Die pathologischen Erythrozyten haben eine verkürzte Lebenszeit und führen über Endothelschäden zu rezidivieren-
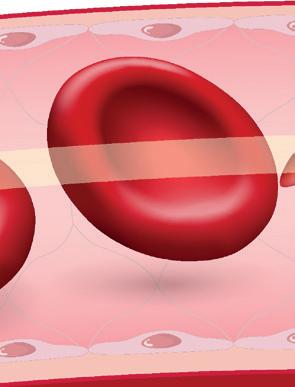



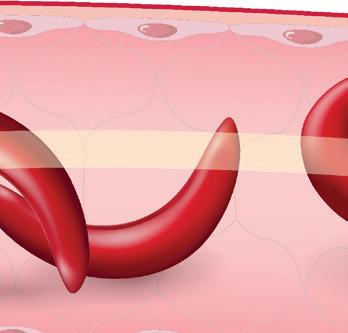

den Gefäßverschlusskrisen mit akuter und chronischer Organinsuffizienz sowie zur hämolytischen Anämie.2
Klinische Manifestationen
„Vor der Geburt ist typischerweise alles in Ordnung, erst zirka drei Monate nach der Entbindung können Kinder symptomatisch werden“, erklärt Prof. Sillaber. „Wir sehen sehr unterschiedliche Symptome bei Kindern versus Erwachsenen “ So treten das Hand-Fuß-Syndrom, eine Infektionsneigung und die akute Milzsequestration vornehmlich bei Kleinkindern auf. „ Bei Erwachsenen hingegen liegt oft eine Asplenie vor“, so der Experte. „ Ein Leitsymptom sind Schmerzkrisen, ohne dass eine Ursache gefunden wird.“ Ebenso ist der Schweregrad der Erkrankung variabel. Das Spektrum reicht von fast asymptomatischen Verläufen, die weit ins Erwachsenenalter hinein andauern, bis zur schwersten Multiorganerkrankung, welche bereits im jungen Kindesalter beginnt. Eine spezifische Diagnostik sollte bei Patient:innen aus Risikoländern bei folgenden Befunden bzw. klinischen Manifestationen veranlasst werden:2
• Positive Familienanamnese
• Hämolytische Anämie
• Rezidivierende Schmerzen im Skelettsystem
• Unklare schmerzhafte Schwellung von Händen und Füßen bei Kleinkindern
• Ausgeprägte Anämie ggf. mit Schocksymptomatik samt ausgeprägter Splenomegalie bzw. fehlender Retikulozytose
• Ungeklärte schwere Infektion „Idealerweise erfolgt bereits in der frühen Kindheit eine Anbindung an ein erfahrenes Zentrum wie in Wien
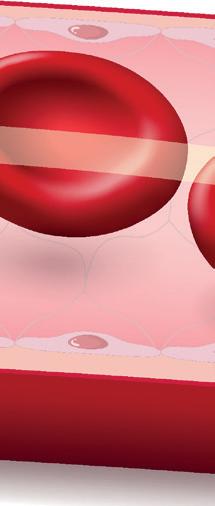
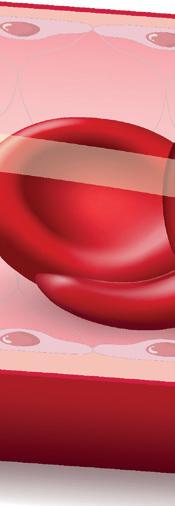

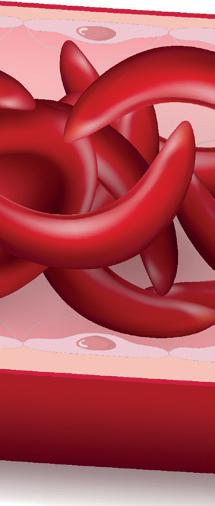
das St. Anna Kinderspital“, hält Prof. Sillaber fest. „ Neben der Standardtherapie – Hydroxyurea und besonders in Notfällen der Erythrozytenaustausch, zu dem nur ganz wenige Zentren in Österreich in der Lage sind – kommen experimentell auch eine konventionelle Stammzelltransplantation und neue genetische Therapien zur Anwendung “ Zur Behandlung der hämolytischen Anämie kann ab dem Alter von zwölf Jahren der Wirkstoff Volextor allein oder zusammen mit Hydroxyurea verordnet werden.
Wichtig seien die Identifizierung sowie eine entsprechende genetische Beratung, die von der Klientel auch wirklich verstanden werden, gibt der Experte abschließend zu bedenken. „ Die ethnische Herkunft spielt dabei eine wichtige Rolle “ In Hinblick auf die Vererbung der monogenetischen Erkrankung gelte es zu bedenken: „ Die gesunden Überträger sind völlig gesund, gehen deshalb eigentlich nie zum Arzt, und wenn sie es doch tun, dann findet man in den Standardblutabnahmen nie einen Hinweis darauf, dass sie Überträger der Sichelzellkrankheit sind “ Bei familiärem Risiko könne eine HämoglobinElektrophorese durchgeführt werden. Die SCD ist durch eine vollständige Abwesenheit von HbA bei gleichzeitigem Nachweis von HbS charakterisiert (bei einigen Genotypen auch von einer 2. Variante, z. B. HbC).
KaM
Literatur:
1 Kunz JB et al., Pediatr Blood Cancer 2020, 67(4):e28130. 2 AWMF-Leitlinie 025/016: Sichelzellkrankheit: sichelzellkrankheit.info/behandlungsleitlinie
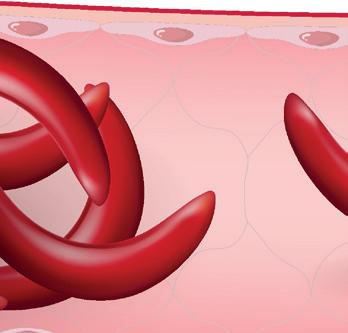
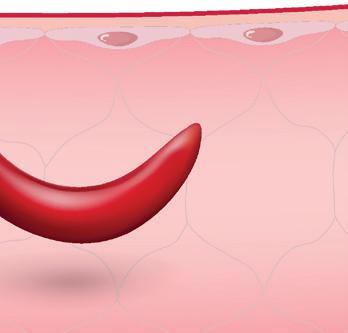




Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug –verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen. Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder?







Abdominalschmerzen bei Kindern: vorbeugen, diagnostizieren und behandeln
Kleinen Kindern fällt es meistens schwer, sich richtig auszudrücken und genau zu erklären, was oder wo es sie schmerzt. Ihr Verhalten, die Form ihres Bauches oder ihre Defäkation können auf Abdominalschmerzen hinweisen. Zudem gelingt es Kindern häufig noch nicht, ihre Beschwerden richtig zu lokalisieren, und auch Eltern erkennen nicht immer gleich, was dem Nachwuchs fehlt. In diesen Fällen sind kleine Kinder meist weinerlich oder weinen gar über mehrere Stunden hinweg, ziehen ihre Beine an oder krümmen sich vor Schmerzen.1
Laut Dr.in Theresa Popp von der Abteilung für Kinderund Jugendheilkunde am Ordensklinikum Linz kommt der Abdominalschmerz im Kindesalter sehr häufig vor und das aus den unterschiedlichsten Gründen: Obstipation, eine Nahrungsmittel- oder Glutenunverträglichkeit, psychosomatische Leiden, ein Reizdarm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Infekte sind mögliche Ursachen. „ Durchfall kann ein Symptom sein, welches mit Bauchschmerzen in Zusammenhang steht. Aber auch das Gegenteil, sprich Verstopfung, wenn seit Tagen überhaupt kein Stuhl abgesetzt wird“, erklärt die Pädiaterin.1 „ H in und wieder kann in diesem Fall auch das Abdomen ausladend bzw. der Bauch sehr aufgebläht sei n“
Hausmittel können helfen, aber Vorsicht!
Dr.in Popp empfiehlt Eltern im Fall von Abdominalschmerzen bei ihren Kindern auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten: Tees, Wasser, Säfte und eine wärmende Suppe wären hierfür gut geeignet.1 Achtung: Bisher wurde Fencheltee oft und gerne zur Behandlung von Blähungen und Bauchschmerzen bei Säuglingen empfohlen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) warnte jedoch bereits im Mai 2023 in einem öffentlichen Statement2 vor dem krebserregenden Inhaltsstoff Estragol
in medizinischen Kräuterprodukten, wobei explizit Schwangere und Kinder unter vier Jahren als Risikogruppe definiert werden: Diese sollten keine Produkte mit Estragol zu sich nehmen, da die enthaltene Menge je nach Hersteller variiert und sich die erlaubte Tagesdosis somit nur schwer kontrollieren lässt. Neben genügend Flüssigkeit können auch sanfte Bauchmassagen im Uhrzeigersinn, Kirschkernkissen oder Wärmflaschen empfohlen werden.1 Dr.in Popp: „Wenn das Kind Appetit hat und etwas essen möchte, sollte auf eine fettarme Schonkost und generell auf eine ballaststoffreiche, ausgewogene Ernährung geachtet werden.“
Zentrale Rolle des Mikrobioms
Die Bedeutung des Mikrobioms für die kindliche Entwicklung zeigt sich bei Untersuchungen der Muttermilch. Je nach Stillzeitphase verändert sich deren Zusammensetzung dynamisch: Sie ist individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kindes und enthält eine Vielzahl an
Nährstoffen, bioaktiven Stoffen (Hormone, Enzyme, Antikörper, komplexe Zucker, microRNAs) und lebenden Zellen (Laktozyten, Stammzellen, Phagozyten, Leukozyten). An der Med Uni Graz wird die Rolle dieser sogenannten Humanmilch Oligosaccharide (HMO) und deren antientzündliche sowie antiinfektive Effekte auf das Baby erforscht. Auch das Mikrobiom im Darm, das Immunsystem oder metabolische Prozesse können von den HMO profitieren. 3
Besondere Vorsicht ist bei Frühgeborenen geboten, da diese sehr anfällig für Infektionen sind. Vor allem ist hier die Entwicklung einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEC) zu nennen: der häufigste gastrointestinale Notfall bei Neugeborenen. Diese Erkrankung betrifft sieben bis elf Prozent der Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm – und steht mit einer Sterblichkeitsrate von 30 Prozent in Verbindung.4
Wissenschafter:innen der Med Uni Graz untersuchten gemeinsam mit Kolleg:innen der TU München und des Quadram Institute in Großbritannien, wie die NEC-Rate durch prophylaktische Maßnahmen unter drei Prozent gehalten werden kann. Dabei ist die Kombination aus Muttermilch und Bifidobacterium entscheidend. Die Studienautor:innen betonen die Bedeutung der frühzeitigen Unterstützung des Darmmikrobioms von Frühgeborenen und zeigen, dass präventive Maßnahmen die Entwicklung eines widerstandsfähigen mikrobiellen Ökosystems fördern können, was das Infektionsrisiko bei gefährdeten Frühgeborenen verringert.4
Quellen:
1 PA Ordensklinikum Linz, 02.04.2024, ordensklinikum.at
2 Public statement on the use of herbal medicinal products containing estragole. 2023, ema.europa.eu
3 Symposium: Humanmilch Oligosaccharide in der Schwangerschaft am 09.06.2022, medunigraz.at
4 Neumann CJ, Mahnert A, Kumpitsch C et al., Nat Commun 14, 1349 (2023).


pegaso ® Baby unterstützt Babys Bäuchlein dank der Kombination aus Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus und Kamille ab dem ersten Tag an.
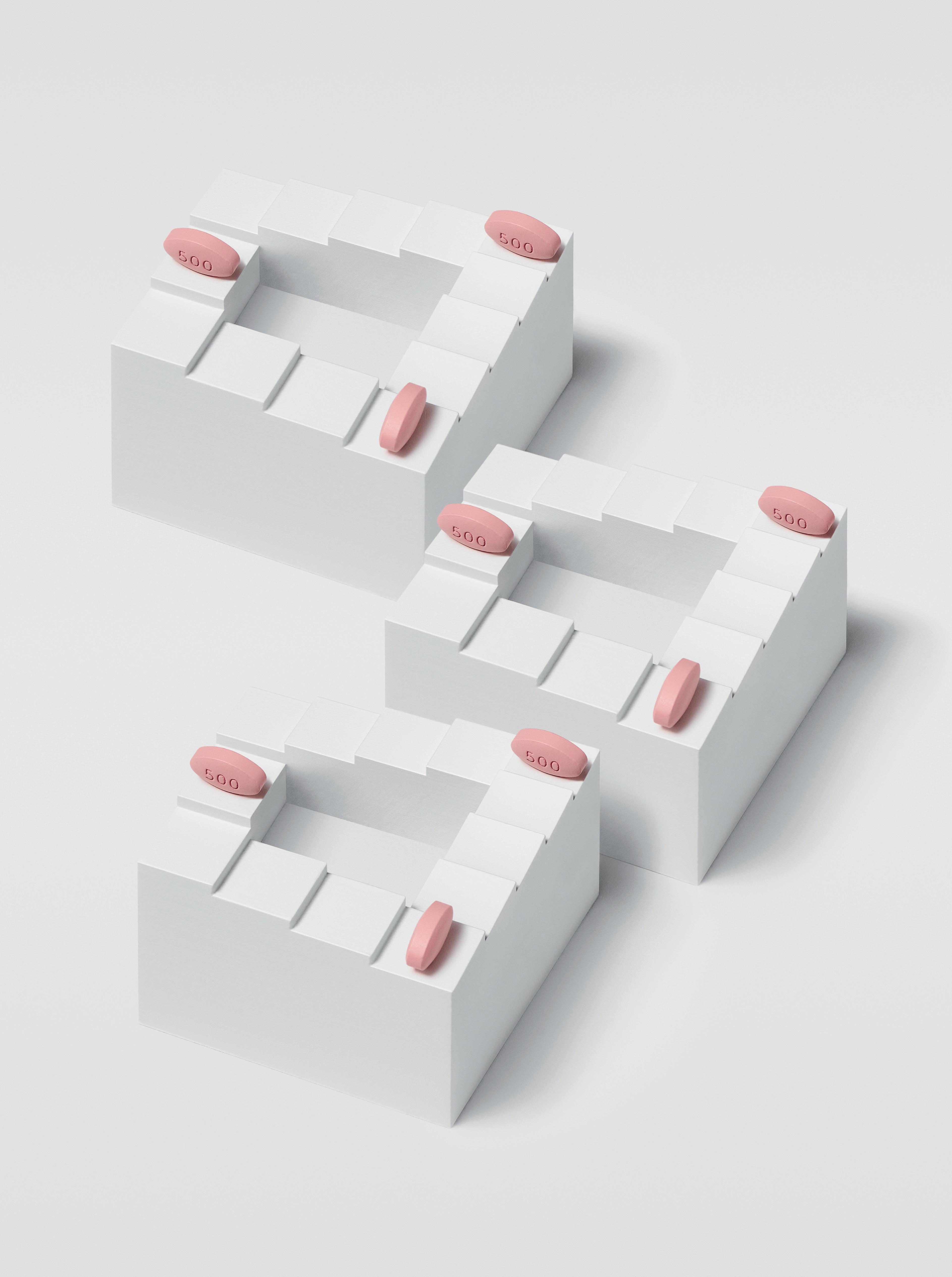
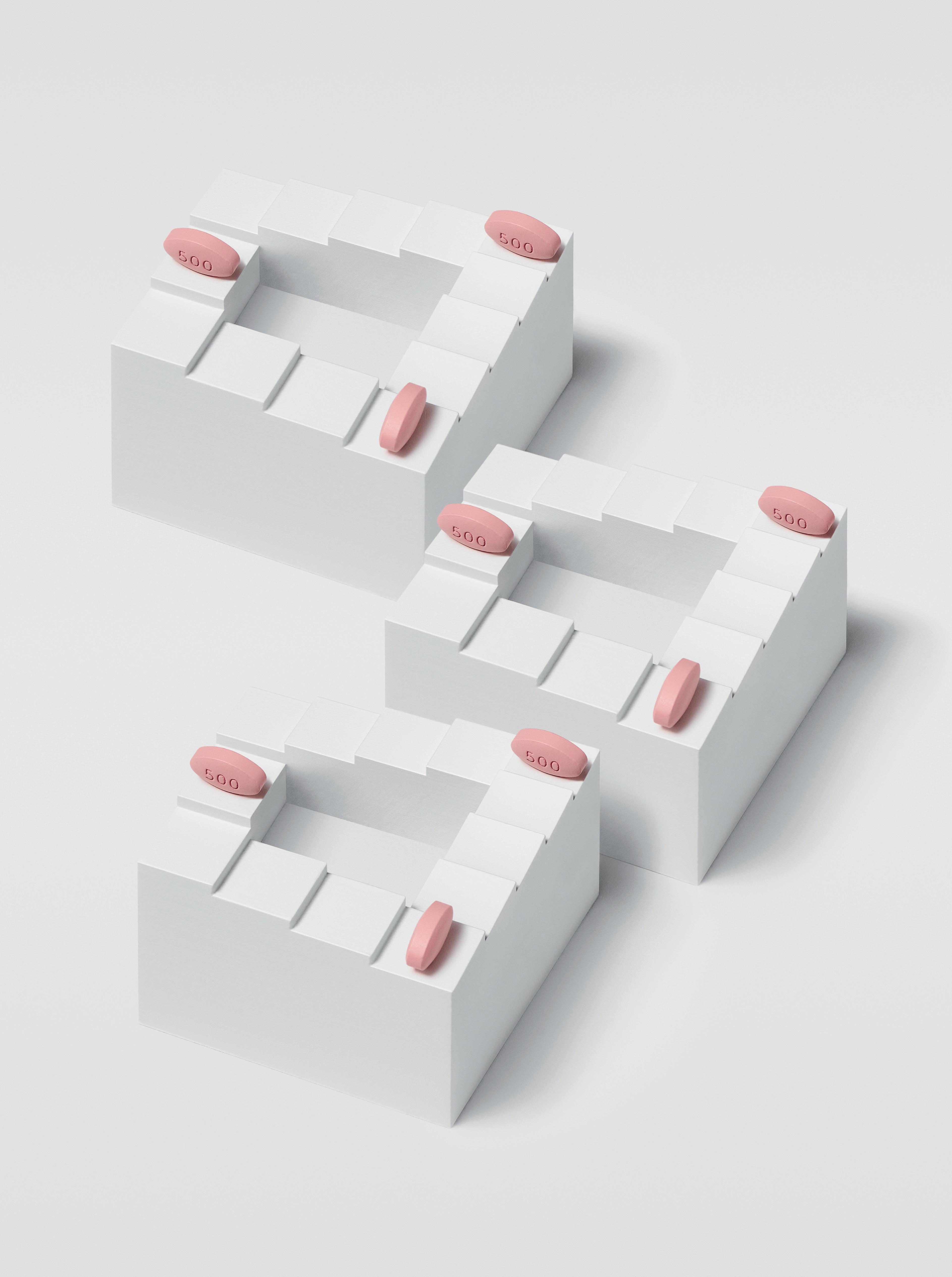
Ein Loop beginnt nahtlos und zuverlässig immer wieder von vorne.
So geht Präzision in Serie und Gesundheit für alle.
Primäre Enuresis nocturna: Eine differenzierte Diagnostik und sorgfältige urotherapeutische Beratung als Basis des Therapieerfolgs
Die primäre Enuresis nocturna gehört zu den häufigen Störungen des Kindesalters. Im Alter von sieben Jahren nässen etwa 10 % der Kinder im Schlaf ein, Jungen sind häufiger davon betroffen. Wenn ein Elternteil in der Nacht lange eingenässt hat, hat das Kind ein erhöhtes Risiko, ebenfalls spät trocken zu wer-
EINTEILUNG DER ENURESIS NOCTURNA
den. In der Praxis spielt die Abgrenzung einer monosymptomatischen (MEN) von einer nicht-monosymptomatischen Enuresis (Non-MEN) eine wichtige Rolle (siehe Tabelle).1
Die Enuresis ist im Wesentlichen als Reifungsverzögerung mehrerer Steuerungszentren für die Blasenentleerung im
Enuresis nocturna (primär/sekundär) � Primäre Enuresis: das Kind ist bisher nie länger als 6 Monate trocken gewesen � Sekundäre Enuresis: Enuresis nach trockener Phase von mehr als 6 Monaten
Monosymptomatische Enuresis nocturna (MEN)
Nicht-monosymptomatische Enuresis nocturna (Non-MEN)
Einnässen im Schlaf ohne Hinweise für eine Blasenfunktionsstörung, ohne Inkontinenz am Tag
Einnässen im Schlaf mit Hinweisen für eine Blasenfunktionsstörung mit/ohne Inkontinenz am Tag (z. B. überaktive Blase, dyskoordinierte Miktion)
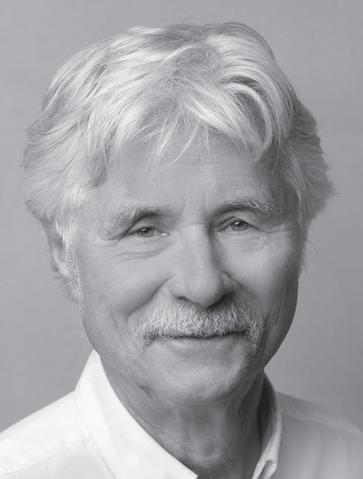
GASTAUTOR: Dr. Eberhard Kuwertz-Bröking ehem. OA des Univ.Klinikums Münster, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrische Nephrologie
Zentralnervensystem zu verstehen.2 Eine besondere Bedeutung hat die Arousaldysfunktion: Der Reiz der vollen Blase wird nicht durch eine adäquate Aktivierung des Arousals beantwortet. Die Kinder schlafen auffällig tief („Tiefschlafenuresis“). Bei einer Subgruppe von Kindern findet sich eine noch nicht ausgereifte zirkadiane Rhythmik der ADH-Sekretion mit nächtlicher Polyurie. Ein echter ADH-Mangel besteht nicht. Die Spontanheilungsrate in Zusammenhang mit physiologischen Reifungsprozessen liegt bei etwa 15 % jährlich.
Komorbiditäten beachten
Zu den Begleiterkrankungen einer Enuresis zählen vor allem eine Obstipation, psychische Störungen –etwa ADHS, Störungen des Sozialverhaltens – und umschriebene Entwicklungsstörungen. Allerdings zeigen Kinder mit primärer MEN nur eine gering erhöhte Rate psychiatrischer Begleit-erkrankungen. Emotionale Belastungen, Schamgefühl, Traurigkeit, Unglücklichsein und niedriges Selbstwertgefühl stellen jedoch häufige Folgen dar. Die Lebensqualität der ganzen Familie kann deutlich be-
einträchtigt sein, vor allem bei etwas älteren Kindern.
Zur leitliniengerechten Diagnostik gehören ein standardisierter Anamnesefragebogen, ein Blasentagebuch (Trink- und Miktionsprotokoll über mindestens zwei Tage) und ein 14-Tage-Protokoll über Einnässen und Darmentleerung. Ein Anamnesegespräch, eine körperliche Untersuchung, eine Sonografie von Nieren und Harnwegen sowie eine Bestimmung der Rektumweite und des Restharns werden empfohlen. Invasivere urologische Untersuchungen sind nur sehr selten erforderlich.3,4
Bei Diagnose einer Non-MEN mit Nachweis einer Blasenfunktionsstörung oder einer Obstipation müssen letztere Störungsbilder primär behandelt werden, bevor man sich der nächtlichen Problematik zuwendet. Grundlage der Enuresistherapie ist eine Beratung, die sich an Inhalten der Urotherapie orientiert. Diese wiederum lehnt sich an Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie an.3,4 Das Kind und die Eltern werden über die Entwicklung und Funktion der Harnblase, die Blasenentleerung und die Ursachen des Einnässens im Schlaf informiert. Dabei benutzt man einfache Bilder oder Modelle, z. B. einen Luftballon als Modell der Harnblase, einfache Skizzen zur Anatomie und zur Zusammenarbeit von Kopf und Blase. Die Motivation der Kinder und Eltern, die therapeutischen Ratschläge zu beherzigen, ist wesentlich für den Therapieerfolg, der allerdings in vielen Fällen Geduld erfordert. Ein „ Sonne-Wolken“Kalender kann zu Beginn hilfreich sein. Häufig sind allerdings weitere Therapieangebote sinnvoll.
„Jedes Kind mit Enuresis möchte trocken werden und braucht Unterstützung und Geduld.“
Die Apparative Verhaltenstherapie (AVT, „K lingelhose“) mit einem Weckapparat wird vor allem bei der primären MEN empfohlen. Ein Therapieerfolg stellt sich bei 50-80 % der Kinder nach acht bis zehn Wochen ein. Rückfälle werden bei 15-30 % der Betroffenen in den ersten sechs Monaten nach Behandlung beobachtet. Dabei werden etwa zwei Drittel der Kinder trocken und schlafen die Nacht durch, ein Drittel der Kinder wird rechtzeitig wach und sucht die Toilette auf.
Die Regeln für die Anwendung eines Weckapparates sind unbedingt zu beachten. So wird eine ausführliche Beratung und Demonstration des Weckgerätes angeraten. Auch hier sollten das Kind und die Eltern eine ausreichende Motivation zur aktiven Mitarbeit mitbringen.3
Die Behandlung mit Desmopressin –einem ADH-Analogon – hat ihre Berechtigung, wenn Kinder und Eltern eine AVT ablehnen oder wenn ihre familiäre Situation diese nicht zulässt, ebenso wenn sich die Familie nach einem Aufklärungsgespräch aktiv für eine medikamentöse Behandlung entscheidet und/oder wenn ein sehr hoher Leidensdruck besteht, der eine rasche Besserung der Symptomatik erfordert. Aus klinischer Sicht profitieren am ehesten Patient:innen, die nur einmal in der Nacht einnässen und bei denen die Blasenkapazität normal oder geringfügig vermindert ist. Kritische Situationen wie Klassenfahrten oder Urlaubsreisen können bedarfsorientiert überbrückt werden. Nach Medikamenteneinnahme am Abend darf eine Trinkmenge von 250 ml nicht überschritten werden – aufgrund des Risikos einer Hyponatriämie mit zerebralen Anfällen. Etwa 70 % der Kinder sprechen rasch auf die Behandlung an: 30 % sind volle, 40 % partielle Responder und 30 % Nonresponder. Bleibt der Therapierfolg aus, sollte die Behandlung beendet werden.3
Die Enuresis ist nur selten Ausdruck einer psychischen Störung. Aber Kinder mit Enuresis sind ratlos und haben oft resigniert, wenn sie trotz aller Bemühungen einnässen. Betroffene nässen nicht mit Absicht ein. Sie entwickeln Schuldgefühle. Jedes Kind mit Enuresis möchte trocken werden und braucht Unterstützung und Geduld. Schimpfen und Bestrafungen sind nicht hilfreich. Auch kleine Fortschritte sollten belohnt werden.
Die Grundlage der Behandlung einer primären Enuresis nocturna ist ein kindund elterngerechtes Gespräch über die Ursachen des Einnässens im Schlaf. Aufklärung, Entlastung, Abbau von Schuldgefühlen und die Entwicklung von Behandlungsstrategien stehen im Mittelpunkt. Abhängig von klinischen Befunden, der familiären Situation, der Motivation des Kindes und der Eltern kann eine Behandlung mit einem Weckapparat oder Desmopressin angeboten werden.
Literatur:
1 Gontard A, Kuwertz-Bröking E (2019): The diagnosis and treatment of enuresis and functional daytime urinary incontinence: Dtsch Ärztebl Int 116: 279-85.
2 Kuwertz-Bröking E, Gontard A (2016): Enuresis nocturna. Monatsschr Kinderheilkd 164: 613-628.
3 Interdisziplinäre S2k-Leitlinie: Enuresis und nicht-organische (funktionelle) Harninkontinenz bei Kindern und Jugendlichen. AWMF-Registernummer 028-026, Version: 31.5.2021.
4 Konsensusgruppe Kontinenzschulung im Kindes- und Jugendalter, Kuwertz-Bröking E, Bachmann H, Steuber Chr (2017): Einnässen im Kindes- und Jugendalter. Pabst Science Publishers, Lengerich.
Einnässen im Kindes- und Jugendalter Manual für die standardisierte Diagnostik, (Uro-) Therapie und Schulung bei Kindern und Jugendlichen mit funktioneller Harninkontinenz
Von Eberhard Kuwertz-Bröking, Hannsjörg Bachmann & Christian Steuber Pabst Science Publishers
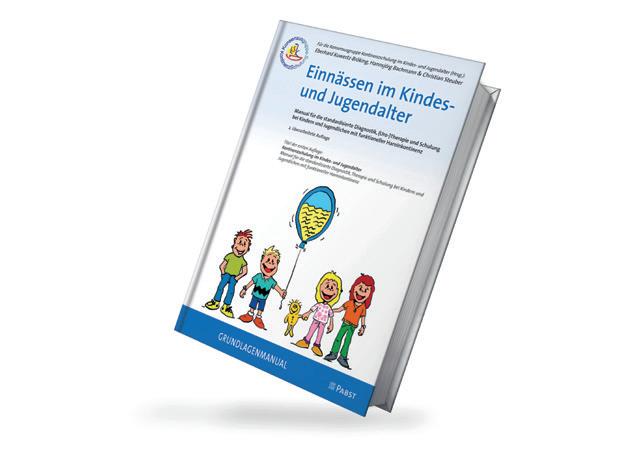
INFO
Auf der Homepage der Konsensusgruppe Kontinenzschulung (KgKS e.V.) finden sich diagnostische Hilfsmittel (Fragebögen und Protokollsysteme) sowie eine Elternbroschüre zur freien Verfügung: kontinenzschulung.de
Vielfältige Angebote und Indikationsbereiche – von Onkologie bis Mental Health

DFP-Punktesammler
GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Prim. Dr. Robert Weinzettel Ärztlicher Direktor, kokon Reha für junge Menschen, Rohrbach-Berg © kokon (2)

Dr.in Liesa J. Weiler-Wichtl Klinische Psychologin, Leitung Psychosoziale Reha, kokon Rohrbach-Berg
© kokon

Schnellzugriff zum Literaturstudium: Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zur Fortbildung auf Gesund.at
Seit Anfang 2019 hat sich in Österreich die Rehabilitation für Kinder und Jugendliche flächendeckend mit unterschiedlichen Schwerpunkten etabliert. kokon betreibt eine Einrichtung in Rohrbach-Berg (OÖ) und eine in Bad Erlach (NÖ), weitere Einrichtungen sind in Wildbad Einöd (ST), in Wiesing (T), in Judendorf-Straßengel (ST) sowie in St. Veit im Pongau (S) vorhanden. Sie decken die Rehabilitation der Phase 2 ab. Diese schließt an die akute Behandlung an und soll dabei helfen, die Patient:innen wieder alltagsfit zu machen. Eine Besonderheit stellt reKiZ in Salzburg dar: Es handelt sich um eine Rehaeinrichtung der Phase 1 für die Frühremobilisation. Sie inkludiert etwa auch eine Intensivstation für schwerkranke Kinder und Jugendliche.
Es gibt vier verschiedene Indikationsbereiche: u Mobilisierende Indikationen: Orthopädie, Neurologie, Kinder- und Neurochirurgie v Herz-Kreislauf- und pulmologische Erkrankungen w Onkologische Erkrankungen sowie Erkrankungen des Stoffwechselsystems und des Verdauungsapparates x Mental Health und Psychosoziale Reha: Entwicklungs- und Sozialpädiatrie, psychosoziale Gesundheit bei Kindern mit chronischen Erkrankungen Einen groben Überblick über die Verteilung der Indikationen bzw. Schwerpunkte in den jeweiligen Zentren gibt die Tabelle (siehe S. 42). Diese kann jedoch lediglich als Richtlinie verstanden werden. Eine
Behandlung alleiniger Indikationen bieten u. a. die Standorte Rohrbach-Berg mit Herz-Kreislauf-/pulmologischen Erkrankungen und der Subspezialisierung Neurodermitis sowie St. Veit mit der Onkologie an. Um der Komplexität der Erkrankungsverläufe und der notwendigen Individualisierung gerecht zu werden, entwickelt sich die Kinder- und Jugendreha in Österreich stetig weiter. So enthalten die jeweiligen Websites aktuelle Informationen zu den spezifischen Unterschieden in den Subindikationen.
Ganz allgemein kann Kinder- und Jugendreha entweder als eine am Kind bzw. Jugendlichen orientierte oder als >
eine an der Familie orientierte Rehabilitation angeboten werden. In der kinderund jugendorientierten Rehabilitation stehen das Kind bzw. der Jugendliche mit seiner Erkrankung sowie psychosoziale Themen im Fokus. Auch eine Rehabilitation von Geschwisterkindern ist im Rahmen der Psychosozialen Reha möglich. Diese bedarf ebenso eines Rehabilitationsantrages und dessen Bewilligung durch die Sozialversicherung. Sämtliche Angebote im Rehaalltag orientieren sich an den Themen der betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen. Die Familienmitglieder als Begleitpersonen können und sollten dabei im Rahmen von Schulungen und Begleitgesprächen zur Entlastung sowie zur Aufrechterhaltung der Therapiemotivation einbezogen werden. Anders verhält es sich mit der familienorientierten Rehabilitation, bei der das gesamte System Familie in den Rehabilitationsprozess eingebunden ist. So können alle Familienmitglieder ihren Bedürfnissen entsprechend individualisierte Therapieangebote erhalten, die über Begleitgespräche hinausgehen. Dabei ist die Onkologie derzeit (noch) die einzige Indikation, bei der die sogenannte familienorientierte Rehabilitation, kurz FOR, angeboten wird.
Einen ersten positiven Schritt in Richtung Erweiterung der Familienorientierung stellt die Elternfreistellung dar, die seit 1.11.2023 möglich ist. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Freistellung von der Arbeit für die Begleitung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr auf Reha. Die Freistellung gilt für einen Zeitraum von bis zu vier Wochen. Dies soll Kinder und Jugendliche dabei unter-
stützen, notwendige Rehamaßnahmen in Anspruch zu nehmen und als wertvollen Baustein im Krankheitsmanagement und damit im Gesundungsprozess zu nutzen. Sicherlich bedarf es hier zukünftig weiterer Entwicklungen, um den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen und der daraus resultierenden Komplexität (Familiensystem, Entwicklungsfaktoren, Belastung der Eltern und Geschwister u. Ä.) gerecht zu werden.
In die sogenannte unbegleitete Reha werden Jugendliche ab 14 Jahren ohne Begleitpersonen aufgenommen und innerhalb ihrer Gruppe u. a. von Sozialpädagog:innen begleitet. Diese jugendorientierten Angebote fördern die Selbstständigkeit, entlasten das Familiensystem und erweitern die Gesundheitskompetenzen im Umgang mit der eigenen Erkrankung. Sie unterstützen bei der Integration als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
Wann sollten Ärzt:innen und andere Gesundheitsberufe an eine Zuweisung junger Patient:innen zu einer Reha denken? Immer dann, wenn nach akuter Krankheit oder im Verlauf einer chronischen, bei Kindern nicht selten aber auch angeborenen Erkrankung der Bedarf besteht, durch intensive Therapie eine Besserung zu erfahren. Die Reha will Kinder und Jugendliche unterstützen, damit sie mit oder sogar trotz ihrer Erkrankung eine möglichst wenig eingeschränkte Teilhabe am (Schul-) Alltag, am Leben der Familie oder der Freund:innen erreichen und im Zuge ih-
Indikation Ort
Mobilisierende Indikationen
Herz-Kreislauf-/pulmologische Erkrankungen
Onkologische Erkrankungen/Erkrankungen des Stoffwechselsystems und Verdauungsapparates
Mental Health/Psychosoziale Reha mit verschiedenen
Schwerpunkten: psychosoziale Gesundheit, Entwicklungs- und Sozialpädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie
rer Entwicklung ihren Platz in der Gesellschaft finden können. Bei Kindern und Jugendlichen ist demnach ehebaldigst an eine Reha zu denken, um Entwicklungsfenster entsprechend zu nutzen und positive Entwicklungswege zu ermöglichen.
Die Reha mit dem Ziel der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von biopsychosozialer Gesundheit umfasst damit ein breites Spektrum von Möglichkeiten, z. B.:
• physische Erholung nach einer Operation oder einem Unfall und Verarbeitung des Erlebten im Sinne der Prävention von Traumatisierungen aufgrund invasiver Maßnahmen
• Regeneration nach hoher psychosozialer Belastung aufgrund der eigenen Erkrankung
• Regeneration nach hoher psychosozialer Belastung aufgrund eines erkrankten Geschwisterkindes g Entlastung des Familiensystems
• Sensibilisierung für und Verbesserung bzw. Wiederherstellung von psychischer/psychosozialer Gesundheit und Wohlbefinden bei chronischer Erkrankung (bei den Betroffenen selbst oder stellvertretend bei Geschwistern, Eltern etc.)
• (Wieder-)Eingliederung in den (Schul-/Berufs-)Alltag durch Förderung schulischer Fertigkeiten und sozialer Kompetenz sowie neuropsychologische Therapie
• Unterstützung einer altersentsprechenden Entwicklung
• Verbesserung des Krankheitsbildes, der Gesundheitskompetenz und des Selbstmanagements im Umgang mit der eigenen Gesundheit und Krankheit
Bad Erlach, Judendorf, Rohrbach-Berg, Wiesing
Rohrbach-Berg
St. Veit im Pongau
Bad Erlach, Rohrbach-Berg, Wildbad, Wiesing
Tabelle: Verteilung der Indikationen bzw. Schwerpunkte in den jeweiligen Zentren.
Die Kombination von intensiver multiprofessioneller Therapie und therapierelevanten Schulungen ist für alle bereits erwähnten Erkrankungen geeignet, nicht nur für schwere oder komplexe. Dabei gilt es zu beachten, dass physische Rehabilitationsziele oftmals durch psychosoziale ergänzt werden müssen bzw. sogar im Vordergrund stehen können: der Umgang mit veränderten Lebenssituationen, chronischen oder psychiatri-
schen Erkrankungen im Familiensystem, möglichen kognitiven, emotionalen oder sozialen Einschränkungen, ein Erwachsenwerden mit chronischen Erkrankungen (Transition) und viele mehr. Nicht zu vernachlässigen sind hierbei die zunehmenden Belastungen im Alltag von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Unsicherheiten, Kriegsmeldungen, der Pandemie und ihren Folgen etc. Sie erfordern es, frühzeitig Maßnahmen zu setzen, die das psychosoziale Wohlbefinden bzw. die Gesundheit aufrechterhalten bzw. wiederherstellen.
Das spezifische Antragsformular findet man unter sozialversicherung.at – Antrag Kinder und Jugendliche auf Rehabilitationsaufenthalt (Stand: 02/2018). Es bietet sich an, in Bezug auf Rehaziele, -zeitpunkt und -motivation die entsprechenden psychosozialen Teams und/ oder Netzwerke bzw. Vereine etc. in die Antragstellung einzubeziehen. Dadurch können Familien im Rahmen der Antragstellung auch bei sozialrechtlichen Fragen, der Entwicklung einer Therapiemotivation und dem Abbau von Hindernissen optimal begleitet werden sowie Kinder und Jugendliche ehebaldigst eine Reha in Anspruch nehmen.
Voraufnahmeprozess
Der ausgefüllte Antrag wird an die zuständige Sozialversicherung gesandt. Hier ist es zielführend, aktuelle Informationen
zur Erkrankung in jedweder Form mitzusenden – etwa rezente Arztbriefe, (neuro-) psychologische Befunde und Gutachten oder Kontaktadressen für eine Kontaktaufnahme bei Zustimmung der Familien im Hinblick auf ein entsprechendes Schnittstellenmanagement. Denn nach der Bewilligung durch die Versicherung müssen von Seiten des Rehazentrums eine Einteilung der Patient:innen und eine Planung des Rehaablaufes erfolgen. Je genauer die Informationen, die der Rehaklinik vorliegen, desto gezielter kann das Therapieangebot geplant und desto effektiver die Zeit von drei bis fünf Wochen genutzt werden.
Wichtig: Die aktuellen Leistungsprofile sehen größtenteils Gruppentherapien vor. Daher ist in der Rehaberatung und -planung die Information über die Gruppenfähigkeit der Patient:innen wesentlich. Im Zweifelsfall sollte man dies direkt mit dem Rehazentrum klären, was letztlich den Patient:innen ungemein dabei hilft, zu einer treffsicheren Therapie zu kommen und Frustration zu vermeiden.
Bei einem ärztlichen Aufnahmegespräch samt klinischer Untersuchung –im Idealfall im interdisziplinären Setting gemeinsam mit Bezugstherapeut:innen und/oder Klinischen Psycholog:innen –werden die Rehaziele und der konkrete Therapieplan festgelegt. Zentrumspezifisch erfolgen dann noch weitere Aufnahmeuntersuchungen in den jeweiligen
Notwendigkeit einer zielgenauen Zuweisung: Fallbeispiel
Der siebenjährige Emil wurde im Alter von drei Monaten einer klappenerhaltenden Vollkorrektur einer Fallot´schen Tetralogie zugeführt. Das postoperative Ergebnis ist perfekt, es bestehen bis auf eine geringe Restpulmonalklappenstenose keine weiteren Residuen. Konotrunkale Fehlbildungen sind oftmals mit einem Mikrodeletionssyndrom 22q11 assoziiert, welches verschiedene Krankheitsverläufe hervorrufen kann. Bei Emil kam es zu einem kognitiven Entwicklungsrückstand mit Intelligenzminderung und aggressiven Verhaltensmustern aufgrund einer Überforderungsproblematik. Würde man Emil nun in der Indikation HKE zuweisen, wäre der Fokus bei drei Wochen Rehadauer auf Physiotherapie und je nach Bild auf Logopädie, Ergotherapiegruppen etc. gerichtet. Sein Problem liegt aber im entwicklungspädiatrischen bzw. psychosozialen Bereich. In ebendieser Indikation kann eine Reha über fünf Wochen stattfinden, bei der konkret auf psychosoziale Ziele eingegangen wird. Der Rehaplan könnte z. B. beinhalten:
� differenzierte entwicklungspsychologische Untersuchung zur zielgenauen Behandlungsplanung
� intensive Ergotherapie und andere Inhalte der Psychosozialen Reha
� Förderung der Selbstregulation und Aufmerksamkeit
� Förderung der altersentsprechenden sozialen Kompetenz
� Entwicklung eines altersgerechten Spielverhaltens
� begleitende Erziehungsberatung zur Umsetzung/Konsolidierung der erlernten Strategien im Alltag
Therapiebereichen sowie im psychosozialen Bereich.
Das Therapieangebot ist verpflichtend für alle Rehazentren in den Leistungsprofilen festgelegt und hängt von der jeweiligen Indikation ab. Die angewandten Therapieinhalte werden an die Patient:innengruppen angepasst und realistische Ziele abgeleitet, sodass diese während des Aufenthaltes erreicht werden können. Die Therapien müssen je nach Indikation in einem bestimmten Zeitraster gemacht werden. Insgesamt werden für die reine Therapie jeweils 150 Minuten pro Tag an fünf Tagen eingeplant – ergänzt mit Heilstättenschule, sozialpädagogischer Begleitung im Alltag und gesundheitsförderlichen Freizeitangeboten.
Schon vor Ende der Rehabilitation findet im Zentrum ein entsprechendes Entlassungsmanagement statt. Auch dieses erfolgt im interdisziplinären Setting sowie unter Einbindung der Familie und ggf. des Umfelds wie der Schule, des Sportvereins etc. – im Sinne der Nachhaltigkeit, damit ein Wiederankommen im Alltag gelingen kann und erlernte Strategien auch umgesetzt bzw. bei Bedarf in anschließenden Therapien weiterverfolgt werden können.
Literatur:
S2k-Leitlinie 023-031: Familienorientierte Rehabilitation (FOR) bei Herz- und Kreislauferkrankungen und spezielle Rehabilitation im Jugend- und jungen Erwachsenenalter.
Sperl W, Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Paediatr. Paedolog. Austria 52, 256–263 (2017).
Lamsal R, Ungar WJ, Impact of growing up with a sibling with a neurodevelopmental disorder on the quality of life of an unaffected sibling: a scoping review. Disabil Rehabil. 2021 Feb;43(4):586-594.
Weitere Literatur bei den Verfasser:innen.
Fortbildungsanbieter: kokon – Kinder-Reha Rohrbach-Berg
Lecture Board:
Dr.in Johanna Holzhaider
2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich
Prim.a Prof.in Dr.in Jutta Falger Ärztliche Direktorin, kokon Bad Erlach, Niederösterreich
In Österreich steht Rehabilitation für Kinder und Jugendliche flächendeckend mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung.
Sechs Einrichtungen decken die Phase-2- und eine die Phase-1-Rehabilitation ab.
Es gibt vier Indikationsbereiche:
Mobilisation, Herz-Kreislauf- und pulmologische Erkrankungen, Onkologie und Erkrankungen des
Stoffwechselsystems/Verdauungsapparates sowie Mental Health und Psychosoziale Reha.
Die Rehabilitation kann entweder als eine kinder- und jugendorientierte oder als eine familienorientierte Reha bei onkologischen Indikationen stattfinden.
Bei Kindern und Jugendlichen ist früh an eine Reha zu denken, um Entwicklungsfenster zu nutzen und positive Entwicklungswege zu ermöglichen.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen.
Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet.
Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf Gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.
Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als ScanDokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. November 2024. Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter Gesund.at (DFP Fortbildungen).

Jetzt onlineTeilnahme möglich:
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.
Wie lange dauert eine Reha für Kinder und Jugendliche in Österreich? (1 richtige Antwort)
3 Wochen.
4 Wochen.
5 Wochen.
Ihre Dauer hängt von der Indikation ab.
Welche Indikationen ermöglichen eine familienorientierte Reha? (1 richtige Antwort)
Alle Indikationen.
Mental Health.
Mental Health & Mobilisierende Indikationen.
Onkologie.
Bei welchen Indikationen profitieren Kinder und Jugendliche von psychosozialen Angeboten während der Reha? (1 richtige Antwort)
Mental Health.
Bei allen Indikationen.
Onkologie.
Psychosoziale Angebote sind kein Teil einer Reha.
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch! Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse: NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:
Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail

Von der künstlichen Intelligenz in der Medizin bis zum Praxismanagement
Samstag, 12. Oktober 2024
Hotel Savoyen
Rennweg 16
Wien 1030
Kosten
Mitglieder: 75 €
Nicht-Mitglieder: 95 €
arztassistenz.at/fortbildung/ termine-im-ueberblick/bdatermine/tagungen-kongresse/ 10-bda-kongress-wien
6 BdA Fortbildungspunkte
10 Jahre Jubiläum









„Auch
Je früher eine Friedreich-Ataxie erkannt wird, desto länger können Betroffene ihre
Selbstständigkeit bewahren
Im pädiatrischen Setting sind es meist die Eltern, die eine neu aufgetretene Unsicherheit des Gangs oder ein verändertes Schriftbild bei ihren Kindern bemerken – mögliche Anzeichen einer Friedreich-Ataxie (FA). Diese seltene autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung ist durch eine chronisch fortschreitende spinozerebelläre Degeneration gekennzeichnet. Über das zentrale und periphere Nervensystem hinaus wirkt sich die FA auch auf das muskuloskelettale System, das Myokard und das endokrine Pankreas aus. Um die Lebensqualität der Betroffenen bestmöglich zu erhalten, ist eine frühzeitige Diagnose entscheidend, betont OA Dr. Wolfgang Nachbauer, PhD, vom Zentrum für seltene Bewegungsstörungen Innsbruck, im Interview mit der Hausärzt:in
HAUSÄRZT:IN: In den meisten Fällen zeigen sich erste Krankheitszeichen zwischen dem 5. und 25. Lebensjahr, jedoch werden sie oft jahrelang nicht erkannt. Wann sollte bei Kindern an eine FA gedacht werden?
OA NACHBAUER: Betroffene Kinder erscheinen gegenüber ihrer Altersnorm zunehmend ungeschickter – im Sport-
unterricht fallen sie durch Gleichgewichtsstörungen und Tollpatschigkeit auf. Manchmal verschlechtert sich ihre Leistung, beispielsweise beim Fußballspielen. Koordinationsstörungen können sich aber auch in einer unleserlichen Schrift äußern. Wissen sollte man, dass es bereits im Kindesalter eine nicht neurologische Manifestation der FA gibt. Es kann sein, dass die kleinen Patient:innen mit Kardiomyopathie bei Internist:innen vorstellig werden oder mit skelettalen Deformationen wie Skoliose oder Hohlfuß bei Orthopäd:innen. Vor allem, wenn es keine andere Erklärung für diese Krankheitsbilder gibt, sollte eine FA in Erwägung gezogen werden.
Wie sollten niedergelassene Ärzt:innen bei klinischem Verdacht auf eine FA weiter vorgehen?
Mögliche Patient:innen müssen an eine Ambulanz für Bewegungsstörungen oder an spezialisierte Neurolog:innen überwiesen werden. Für die Bestätigung der Diagnose ist ein spezifischer Gentest zur Bestimmung der GAA-TriplettExpansion im Frataxin-Gen auf beiden Allelen erforderlich.
Seit Kurzem steht mit Omaveloxolon erstmals eine ursächliche Behandlung zur Verfügung, welche die Progression der Erkrankung verlangsamt – das Medikament ist allerdings erst ab 16 Jahren zugelassen. Wie sollte die Behandlung betroffener Kinder bis dahin aussehen?
Bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch keine Daten zu diesem Medikament, weshalb dieses für unter 16-Jährige derzeit nicht empfohlen werden kann. Grundlage für die Zulassung war die dreiteilige „ MOXIe“- Studie, bei welcher der Wirkstoff an Patient:innen im Alter zwischen 16 und 40 Jahren getestet wurde.
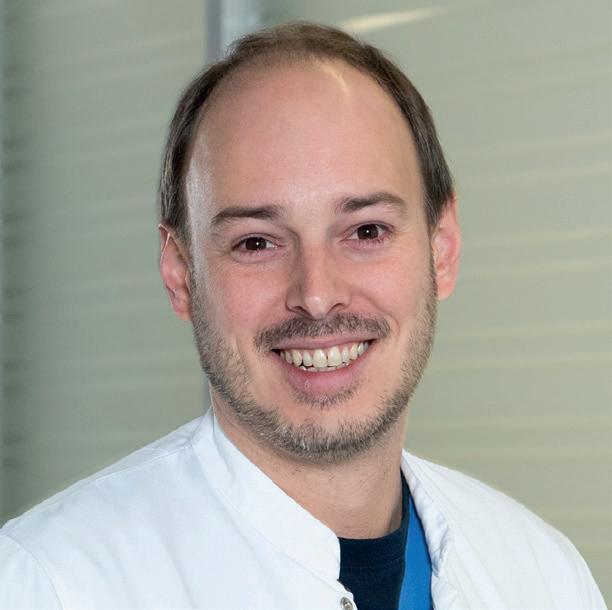
Wolfgang
PhD, Co-Leiter des Zentrums für seltene Bewegungsstörungen, Univ.-Klinik für Neurologie, Med Uni Innsbruck, im Gespräch.
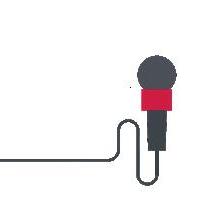
Daher ist bei Kindern der Fokus auf eine neurorehabilitative Therapie zu legen. Idealerweise sollte mehrmals pro Woche Physio-, Ergo- und logopädische Therapien stattfinden. Durch gezieltes Training kann die Haltung der Kinder verbessert und ihre Muskulatur gestärkt werden. Ziel ist es vor allem, die Funktionalität der Extremitäten so gut und so lang wie möglich zu erhalten und Begleiterscheinungen wie etwa Skoliose möglichst zu verhindern.
Neben den körperlichen Einschränkungen kommt es im Laufe der Erkrankung oft zu Komorbiditäten wie Kardiomyopathie oder Diabetes. Worauf gilt es im Hinblick auf Kontrolluntersuchungen zu achten? Aufgrund der Multisystembeteiligung erfordert die Behandlung der FA einen multidisziplinären Ansatz. Komorbiditäten wie eine Herzbeteiligung oder orthopädische Manifestationen sollten nach den allgemein gültigen Guidelines behandelt werden. Unerlässlich sind dabei regelmäßige kardiologische Kontrollen in Form eines jährlichen EKGs und Echokardiogramms zur Evaluierung der Herzfunktion. Auf das frühe Erkennen eines Diabetes mellitus sollte durch ein entsprechendes Screening geachtet werden – mindestens einmal jährlich ist der HbA1c-Wert zu bestimmen.
Das Interview führte Mag.a Sylvia Neubauer.
© Martin Vandory
Global betrachtet stellt Unterernährung die Hauptursache für einen Eisenmangel dar, doch im europäischen Raum entsteht ebenjener meist durch eine Fehlernährung mit eisenarmen Lebensmitteln, sodass geschätzte 10-15 % der Kinder in Europa eine Sideropenie aufweisen.1 Bei Patient:innen mit eisenrefraktärer Eisenmangelanämie ist die Konzentration von Hepcidin im Urin normal bis deutlich erhöht – im Gegensatz dazu bei Patient:innen mit alimentär bedingtem Eisenmangel stark erniedrigt bzw. fehlend. Im Einzelfall muss auch die sehr seltene idiopathische pulmonale Hämosiderose differentialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden.2
Priv.-Doz. Dr. Jörg Jahnel, Abteilungsvorstand der Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Klagenfurt, untermauert in einer Aussendung die Wichtigkeit von Eisen für die kindliche Entwicklung: „ Das frühzeitige Erkennen und die Behandlung von Eisenmangel bei Kindern ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Gesundheit zu schützen. Als Pädiater:innen ist es unsere Verantwortung, die Aufklärung über Eisenmangel zu fördern und Eltern zu ermutigen, auf die Symptome zu achten.“
Als Kernsymptom einer Anämie gilt bekanntlich die Blässe. Dazu kommen oft Müdigkeit, Lern- und Konzentrationsschwächen. Patient:innen mit seltenen genetisch determinierten Formen können auch eine positive Familienanamnese aufweisen. Im Rahmen einer körperlichen Untersuchung sind folgende
Merkmale auffällig: Mundwinkelrhagaden (Perlèche), Haarausfall, Koilonychie (beim Kind seltene löffelförmige Deformität von Finger- und Zehennägeln bei schwerem chronischem Eisenmangel) sowie eine glatte, atrophische Zunge. Im Extremfall kann es auch zur Pica – einer Essstörung, bei der ungenießbare Substanzen gegessen werden – kommen.2
Ein Eisenmangel entsteht häufig bei Säuglingen und Kleinkindern, deren wachstumsbedingter Eisenbedarf im Verhältnis zum Eisengehalt in der Nahrung viel größer ist. Eine alimentäre Eisenmangelanämie entwickelt sich bei Reifgeborenen meist jenseits des 6.-12. Lebensmonats, bei Frühgeborenen auch schon eher.1 Bereits die unzureichende Eisenversorgung der Mutter während der Schwangerschaft kann für die spätere Sideropenie des Kindes verantwortlich sein, weshalb der Eisenhaushalt der Mutter beobachtet werden sollte. Stillkinder profitieren prinzipiell von einer eisenhaltigen Beikost (ab ca. dem 5. Lebensmonat), da sich der Eisengehalt in der Muttermilch nachweislich verringert.¹ Größere Kinder sollten eisenreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreideprodukte und grünes Blattgemüse auf dem Speiseplan haben, um ihre Reserven aufzufüllen. Darüber hinaus kann die Eisenversorgung verbessert werden, indem man eisenreiche Lebensmittel gezielt mit solchen kombiniert, welche die Aufnahme dieses Spurenelements fördern (z. B. Vitamin-C-reiche Nahrungsmittel) und gleichzeitig den Verzehr von absorpti-
onshemmenden Lebensmitteln meidet (z. B. Ei und Milchprodukte).³
Zur Abklärung einer vermuteten Anämie bei Kindern wird in der Regel nach erfolgter Anamnese und einer körperlichen Untersuchung ein Blutbild erstellt, das eine Messung der Hämoglobinkonzentration enthält. Zusätzlich werden die Anzahl der Erythrozyten, ihre Größe und ihr Hämoglobingehalt untersucht, um Hinweise auf die Ursache der Anämie zu erhalten. Auch die Anzahl der Retikulozyten, die gerade aus dem Knochenmark ins Blut gelangen, kann für die Ursachenfindung hilfreich sein.4
„Durch rechtzeitige Diagnose, angemessene Behandlung und Präventionsmaßnahmen können wir dazu beitragen, schwerere Mangelzustände zu vermeiden“, betont Prim. Jahnel. „ Bei der Eisensupplementierung bei Kindern spielt die Verträglichkeit des Präparates und die Flexibilität in der Anwendung, vor allem im Hinblick auf die Einnahme zu Milchprodukten, eine maßgebliche Rolle. Die besten Erfahrungen wurden mit dreiwertigen Eisenpräparaten gemacht “ Nicht frühgeborene Kinder mit normalem Eisenstatus sollten keine prophylaktische Eisengabe erhalten bzw. ist diese sogar kontraindiziert, da sie nachteilige Effekte auf das Wachstum haben kann.2 Justyna Frömel, Bakk. MA
Literatur:
1 Aggett PJ et al., 2002. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 34(4):p 337-345.
2 Behnisch W et al., 2021. S1-Leitlinie 025-021, Eisenmangelanämie.
3 Ernährung bei Eisenmangel, gesundheitskasse.at
4 Kunz J, 2011. Eisenmangelanämie, kinderblutkrankheiten.de

Einfach sucrosomal.
SEHR GUTE
VERTRÄGLICHKEIT
DANK SUCROSOMALER
TECHNOLOGIE
HOHE BIOVERFÜGBARKEIT
EINFACHE EINNAHME
DANK BEWÄHRTER
DOSIERHILFE
WOHLSCHMECKEND, KEIN METALLISCHER NACHGESCHMACK

NR. 1 IN DER APOTHEKE*
3+ JAHRE
www.oleovital.at

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.
y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at

Laut der Deutschen Schmerzgesellschaft leidet jedes fünfte Kind einmal pro Woche unter Schmerzen – am häufigsten sind Cephalgien, gefolgt von Bauch- und Rückenschmerzen.1 Die Prävalenz steigt sowohl in Deutschland als auch in einigen anderen Ländern.2 Schmerzen bei Kindern können eine Indikation für Paracetamol oder Ibuprofen darstellen. Grundvoraussetzung ist, dass die Ursache erkannt und wenn nötig kausal therapiert wird. Analgetika haben zum Ziel, dem Kind unnötiges Leid zu ersparen. Bei Halsweh etwa kann es sinnvoll sein, diese 30 Minuten vor der Mahlzeit zu verabreichen, um das Schlucken zu erleichtern.
Bei Bedarf können Ibuprofen und Paracetamol abgewechselt werden, um die Tagesmaximaldosis nicht zu überschreiten, wobei auf die genauen Dosierungs-
anweisungen und auf die Einhaltung des 6-Stunden-Intervalls stets geachtet werden soll. Metamizol wird in der Pädiatrie nicht empfohlen, und dass für Acetylsalicylsäure aufgrund der Gefahr des Reye-Syndroms eine strenge Kontraindikation besteht, ist vermutlich allen Mediziner:innen bekannt. Häufig erleben Ärzt:innen, dass Eltern mit der medikamentösen Schmerztherapie ihres Kindes zögern. Die Verabreichung von Naturheilmitteln hingegen ist mit weniger Hemmung verbunden. Jedoch sind hierzu die Daten für Kinder oft nicht verlässlich. Viele Produkte enthalten zu viel Zucker oder sogar Alkohol.
Eltern sollten auf die richtige Dosierung der Schmerzmittel aufmerksam gemacht werden, da sie häufig dazu tendieren, zu niedrig zu dosieren. Jedoch ist die richtige


Menge essenziell. Hier lautet die Devise: „ganz oder gar nicht“ – „ein bisschen“ hilft nicht. Bei Fieber hingegen wird weniger gezögert, zu Medikamenten zu greifen, da man dieses im Gegensatz zum Schmerz messen kann. Prinzipiell gilt es, eine antipyretische Therapie ab einer Temperatur von ≥ 39,5 °C einzuleiten. Ein Kind, das auch bei höherem Fieber gutgelaunt ist, muss nicht zwingend medikamentös versorgt werden. Andersherum kann es sich bei nur leicht erhöhter Temperatur so erschöpft fühlen, dass es von der Medikation profitiert.
Quellen:



Mara Sophie Anmasser
1 schmerzgesellschaft.de/patienteninformationen/ besonderheiten-bei-schmerz/schmerz-bei-kindern
2 Krause L et al., Bundesgesundheitsbl 62, 1184–1194 (2019).




Wie das Projekt
„Gesund aus der Krise“ Kindern und Jugendlichen hilft, Probleme hinter sich zu lassen
GASTAUTORINNEN-TEAM:

a.o. Univ.-Prof.in Dr.in
Beate Wimmer-Puchinger Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer Psycholog:innen (BÖP) und Leiterin von „Gesund aus der Krise“

Mag.a Barbara Haid, MSc Präsidentin des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP), Kooperationspartnerin von „Gesund aus der Krise“

Die Coronapandemie war für viele Menschen eine schwierige Zeit. Neben den bekannten Risikogruppen traf diese Krise jedoch vor allem Kinder und Jugendliche. Die notwendigen Maßnahmen, etwa Lockdowns oder Schulschließungen, beeinträchtigten den Entwicklungsprozess junger Menschen und erschwerten ihnen den Zugang zu Bildung sowie den Kontakt zu Gleichaltrigen (Kulcar, Walter, Kreh, Fischer & Juen, 2020). Auch Konflikte in den eigenen vier Wänden traten aufgrund von Homeschooling und Homeoffice vermehrt auf. Zudem spielte die abnehmende körperliche Aktivität der vulnerablen Gruppe eine entscheidende Rolle. So stellte man fest, dass die körperliche Bewegung während der Pandemie signifikant zurückging, während sich die Bildschirmzeit verlängerte. In diesem Zusammenhang erkannte man auch, dass die physische Aktivität mit der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQoL – „Health-related quality of life“) positiv korrelierte (Wunsch et al., 2021). Die Lebensqualität und Zufriedenheit von Kindern und Jugendlichen sanken insofern, als sie sich weniger bewegten und stattdessen mehr Zeit mit ihren Handys und vor Bildschirmen verbrachten. Die Folge: In Europa litt während der Pandemie jede:r Zweite zwischen zehn und 17 Jahren unter psychischen Problemen, ohne die notwendige Hilfe zu erhalten (Curie et al., 2009).

Mag.a Helene Wimmer Klinische und Gesundheitspsychologin am Universitätsklinikum Tulln, Projektkoordinatorin von „Gesund aus der Krise“
Viele Kinder und Jugendliche leiden bis heute, rund vier Jahre nach Beginn der Pandemie, an psychischen Belastungen wie Ängsten und psychischen Auffälligkeiten, die zwar geringer sind als in der ersten und zweiten Lockdownphase, jedoch ausgeprägter als vor der Pandemie. So haben drei von zehn Kindern und Jugendlichen eine geringe Lebensqualität, während es vor der Coronakrise zwei von zehn waren. Zudem fühlen sich Heranwachsende, neben den Auswirkungen der Pandemie, nun zusätzlich durch neue Krisen wie die Energiekrise, den Ukrainekrieg und den Klimawandel belastet. Der empfundene Kontrollverlust führt zu Angst und Unsicherheit. Genau das betrifft diejenigen Kinder und Jugendlichen, die von „Gesund aus der Krise“ betreut werden. Hier erhalten sie Unterstützung und gemeinsam kann daran gearbeitet werden, die persönliche Situation in einem ersten Schritt zu reflektieren, um anschließend im unmittelbaren Umfeld stabilisierende Strukturen zu etablieren.
Junge Menschen beweisen gerade gegenüber Erziehungsberechtigten oder Medizin- sowie Lehrpersonal schauspielerisches Talent und verstecken ihre psy-
chischen Probleme gekonnt. Umso wichtiger ist es, über mögliche Warnsignale Bescheid zu wissen, um sie zu erkennen und im Bedarfsfall entsprechende Maßnahmen zu setzen. Eine emotionale Überforderung der Kinder und Jugendlichen kann für Eltern, Pädagog:innen und Hausärzt:innen unter anderem an folgenden Symptomen erkennbar sein: Rückzug in Form von „geistiger Abwesenheit“, nächtliches Einnässen, erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme und Leistungseinbrüche in der Schule bis hin zu Schulverweigerung. Außerdem können Schlafprobleme, verminderte Freizeitaktivitäten, häufige Bauchoder Kopfschmerzen ohne medizinisch erklärbare Ursache und Veränderungen im Ess- oder Affektverhalten vorkommen – beispielsweise sehr lange Phasen von Niedergeschlagenheit oder auch häufiger Wechsel von Stimmungshochs und -tiefs. Das Äußern von Ängsten rund um Krieg oder Klimawandel sowie das mehrmalige Betonen der Sinnlosigkeit von Tätigkeiten oder des Lebens im Allgemeinen sollte ebenfalls hellhörig werden lassen und ernst genommen werden.
Ein weiteres Warnsignal ist übermäßiger Medienkonsum. Bilder von Kriegssituationen, Nachrichten über Suizidversuche
oder Infomaterial zu neuen Krisen können traumatisieren. Unabdingbar ist dabei, das Gespräch mit den Betroffenen zu suchen. Sollten Kinder und Jugendliche von sich aus darüber erzählen, sollte ihnen viel Aufmerksamkeit geschenkt und versucht werden, im Gespräch zu bleiben. Auch sollte die Nutzung neuer Medien nicht per se negativ beurteilt werden. Eine Differenzierung, wozu und wie oft diese genutzt werden, ist von Bedeutung: Dienen sie der Information oder kreativen Zwecken, spricht man von positiven Effekten. Geht es jedoch um reines „konsumierendes“ Verhalten, beispielsweise um exzessives „ Z ocken“ ohne zeitliche Begrenzung, kann dies zu suchtähnlichen Symptomen führen.
Werden derartige Auffälligkeiten bemerkt, sollte man nicht zögern und Expert:innen hinzuziehen. Erfahrungen zeigen, dass eine früh und rasch organisierte professionelle Hilfe in wenigen Beratungseinheiten eine Stabilisierung bewirken kann oder für Betroffene zumindest eine deutliche Entlastung bedeutet.
Ebenjene professionelle Hilfe bietet das Projekt „Gesund aus der Krise“ – und zwar mit Erfolg, wie die Ergebnisse des ersten Projektverlaufs belegen. So zeigte sich bei den mehr als 8.000 Kindern und Jugendlichen, die innerhalb von durchschnittlich elf Tagen an „Gesund aus der Krise“ vermittelt wurden, eine mehr als 92-prozentige Erfolgsquote in puncto Verbesserung und Stabilisierung ihrer psychosozialen Situation. Psychische Probleme können somit überwunden werden, sofern die richtige Unterstützung vorhanden ist. <
Rasche, niederschwellige, kostenlose und wohnortnahe Hilfe „Gesund aus der Krise“ wird vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) gefördert und vom Berufsverband Österreichischer Psycholog:innen (BÖP) in enger Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) umgesetzt. Das Projekt bietet für Betroffene bis 21 Jahre kostenlos bis zu 15 klinisch-psychologische, gesundheitspsychologische und psychotherapeutische Beratungen und Behandlungen im Einzel- oder Gruppensetting an. Klinische Psycholog:innen, Gesundheitspsycholog:innen und Psychotherapeut:innen mit mehrjähriger Arbeits- und Fortbildungserfahrung im Kinder- und Jugendbereich beraten und behandeln in 25 Behandlungssprachen kostenfrei, österreichweit, in städtischen sowie ländlichen Regionen. In der Servicestelle werden Klient:innen rasch mit Betreuer:innen zusammengebracht, unter Berücksichtigung von Wohnortnähe, Sprache, Alterspräferenz und dem von Klient:innen gewünschten Geschlecht der betreuenden Person.
Kontaktdaten:
Details zu „Gesund aus der Krise“ unter gesundausderkrise.at; info@gesundausderkrise.at sowie über die kostenlose Servicenummer 0800 800 122 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr.
Studie aus Deutschland bestätigt Prädiktoren für langfristige Atemwegsprobleme1

Etwa ein Drittel aller Asthmapatient:innen erleidet in den ersten Lebensjahren mindestens eine obstruktive Atemwegserkrankung, wobei viele im Alter von drei bis acht Jahren symptomfrei werden.2,3 Dennoch entwickeln einige Kinder mit obstruktiver Bronchitis später im Leben ein persistierendes Asthma. Frühe Anzeichen wie eine Atopie, eine familiäre Anamnese allergischer Erkrankungen, eine allergenspezifische Sensibilisierung gegenüber ganzjährigen Allergenen wie jenen der Hausstaubmilbe (HDM) oder eine Nahrungsmittelallergie gegen Hühnerei sowie eine bronchiale Hyperreagibilität (BHR) gelten als prognostische Marker für die Entwicklung von Asthma.4,5
Methacholintest in der Asthmadiagnostik
Da etwa 70 % der Asthmapatient:innen vor dem 5. Lebensjahr betroffen sind, gibt es erhebliche Herausforderungen bei den üblicherweise angewendeten diagnostischen Methoden – aufgrund des Alters und der Compliance.6 Louis et al. zeigten, dass der Methacholintest (MCT) in der Asthmadiagnostik vergli-
chen mit der Reversibilitätstestung in einer Routineumgebung bei Erwachsenen weit überlegen ist.7 Da die meisten Kinder mit Asthma in den anfallsfreien Intervallen eine normale Lungenfunktion aufweisen, kann lediglich die Provokationstestung eine BHR unter realen Bedingungen aufzeigen.8,9 Typischerweise lässt sich ein früher Abfall von FEV1 im Vergleich zu gesunden Personen belegen. Dabei wird die Bestimmung von PD20 heutzutage häufiger verwendet als die von PC20.10,11
unbekannt
Laut Studien ist das frühe Vorhandensein einer BHR selbst bei asymptomatischen Personen ein Prädiktor für Asthma im späteren Leben.12,13 Darüber hinaus stellt eine Sensibilisierung gegenüber HDM einen hochgradig prädiktiven Faktor für persistierendes Asthma dar.14-16 Die Entwicklung von BHR bei Kleinkindern mit und ohne allergische Sensibilisierung ist jedoch weniger bekannt. Ziel der Studie des Universitätsklinikums Frankfurt war es, die Entstehung von BHR bei
Kleinkindern in einer realen Umgebung zu beleuchten.
Donath et al. untersuchten in dieser nichtinterventionellen retrospektiven „Real Life Study“ die Entwicklung einer BHR als Prädiktor für Asthma bei 198 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren – diese wurden in zwei Gruppen unterteilt: in eine ohne allergische Sensibilisierung (n = 110) und in eine mit vorhandener allergischer Sensibilisierung (n = 88). Beide Gruppen wurden auf BHR gescreent und die Gruppe mit allergischer Sensibilisierung zusätzlich auf HDM hin überprüft. Darunter waren 95 Kinder (43 Mädchen und 52 Buben, 47 ohne und 48 mit allergischer Sensibilisierung) von einer schweren BHR betroffen. Am Ende der Nachbeobachtung erlitten die jungen Patient:innen in Gruppe 2 häufiger eine schwere BHR als jene in Gruppe 1 –schwere BHR-Gruppe 1: n = 5 (10,6 %) vs. Gruppe 2: n = 21 (43,8 %), p = 0,004. 89 % in Gruppe 1 hatten beim letzten MCT nur eine leichte bis mäßige oder
keine BHR – verglichen mit 56,2 % in Gruppe 2 (p < 0,001).
Von den 48 HDM-allergischen Patient:innen (Gruppe 2) waren 28 (58,33 %) am Ende der Beobachtungszeit polysensibilisiert, während 20 monosensibilisiert waren. Die polysensibilisierten Kinder litten an Allergien gegen Gräser- und Birkenpollen (n = 20), gegen Katzenschuppen (n = 17), gegen Hundeschuppen (n = 7) und gegen Alternaria (n = 4). Es gab keinen signifikanten Unterschied in Bezug auf die BHR zwischen den mono- und polysensibilisierten HDMPatient:innen. Das Alter und die Dauer der letzten Beobachtung waren jedoch bei den monosensibilisierten Kindern signifikant niedriger. Der exhaltierte Stickstoffmonoxid(eNO)-Wert war bei den Polysensibilisierten größer, was auf eine höhere Krankheitslast und -schwere hinweist (9 ppb vs. 26 ppb; p < 0,001; Normalbereich < 25 ppb). Das eNo dient als Marker für bronchiale Entzündungen.
47 Patient:innen (49,5 %) nahmen vor dem ersten MCT keine Medikamente ein. Drei Monate vor Ende der Nachbeobachtung war die Asthmatherapie ungefähr gleich verteilt. Bei n = 46 Patient:innen (48,4 %) wurde keine Therapie durchgeführt. In der Follow-up-Phase erhielten insbesondere die HDM-Patient:innen signifikant häufiger Asthmamedikamente (inhalative Kortikosteroide und langwirksame Antagonisten) als Kinder ohne HDM (14,9 % vs. 37,5 %; p = 0,019).
Die Ergebnisse zeigen laut den Studienautor:innen, dass Kleinkinder ohne allergische Sensibilisierung ihre schwere BHR bis zum Schulalter mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 89 % verlieren, während bei Kindern mit einer HDMAllergie eine schwere BHR wahrscheinlich bestehen bleibt und das Risiko
somit erhöht ist, im späteren Leben an Asthma zu erkranken. Diese Erkenntnisse könnten dabei helfen, prädiktive Marker für die Asthmaentwicklung bei Kleinkindern mit HDM-Sensibilisierung und damit von Hochrisikopatient:innen durch Methacholin- und Allergietests zu identifizieren und eine gezielte Überwachung sowie eine frühzeitige Intervention zu ermöglichen, um das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern.
Justyna Frömel, Bakk. MALiteratur :
1 Donath H et al., Severe bronchial hyperresponsiveness along with house dust mite allergy indicates persistence of asthma in young children. Pediatric Allergy and Immunology, Dez 2023, doi.org/10.1111/pai.14047
2 Martinez FD et al., 1995 Jan 19;332(3):133-8.
3 Sears MR, 1998 Nov:28 Suppl 5:82-9; discussion 90-1.
4 Fuchs O et al., 2017 Mar;5(3):224-234.
5 Jackson DJ et al., 2016 Mar;137(3):659-65; quiz 666.
6 Chung HL, 2022 Dec;65(12):574-584.
7 Louis et al., 2020 Feb;8(2):618-625.e8.
8 Coates AL, 2017 May 1;49(5):1601526.
9 Schulze J et al., 2012 May;106(5):627-34.
10 Schulze J et al., 2009 Dec;103(12):1898-903.
11 Dell SD et al., 2015 Mar;12(3):357-63.
12 Sears MR et al., 2003 Oct 9;349(15):1414-22.
13 Rasmussen F et al., 2002 Sep;34(3):164-71.
14 Ulrik CS et al., 1996 Nov;90(10):623-30.
15 Illi S et al., 2006 Aug 26;368(9537):763-70.
16 Busse WW, 1994 Nov;150(5 Pt 2):S77-9.
Eine Ludwig-Boltzmann-Forschungsgruppe zeigt Missstände auf
Expert:innen weisen immer wieder auf die schlechte Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden in Österreich hin. Wie groß das Problem wirklich ist, ist allerdings unbekannt, denn es gibt keinerlei belastbare Zahlen zum Thema. Die Forschungsgruppe „ A lterung und Wundheilung“ der Ludwig-BoltzmannGesellschaft hat sich nun vier Jahre lang dem Thema gewidmet. Das Projekt kulminiert im Juni in einer zweitägigen öffentlichen Veranstaltung.
Erstmals Bericht über Versorgungslage
In dem recht unkonventionellen Team arbeiteten Natur- mit Sozialwissenschafter:innen zusammen und auch Künstler:innen wurden eingebunden. Denn: „C hronische Wunden sind kein rein medizinisches Problem. Sie haben eine tiefgreifende soziale Komponente, von sozialen Auswirkungen eines Lebens mit Wunde bis zu den komplexen menschlichen Interaktionen im Zuge ihrer Behandlung“, wie es auf der Website der Forschungsgruppe heißt. Partner des Projekts sind unter anderem die AUVA und das Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien. Eines der Ergebnisse ist ein Bericht über die Versorgungslage von Menschen mit chronischen Wunden im österreichischen Gesundheitssystem. Darin wird erstmals ein Überblick über die Epidemiologie, die Versorgungsstrukturen und deren Leitung in Österreich geschaffen. Die Autor:innen weisen aber auch darauf hin, dass aufgrund der schlechten Datenlage kein genaues Bild habe gezeichnet werden können. Herausgestrichen wird hingegen die zentrale Rolle, die Allgemeinmediziner:innen in der Versorgung spielen. Sie seien meist die erste Anlaufstelle für Patient:innen und stellten auch die Erstdiagnose. Häufig seien sie außerdem für die Wundversorgung zuständig, deren Aufwand in der Kostenabrechnung nicht korrekt abgebildet werde.1
Auch künstlerische Gestaltung war Teil des Projekts. In der Kampagne

„Tanzende Füße“ versuchten die Forscher:innen, das öffentliche Bewusstsein für chronische Wunden und deren Prävention zu schärfen sowie die Sensibilität für die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu erhöhen. Weil die meisten chronischen Wunden an den Füßen und Beinen entstehen, erstellte das Team eine Website zum Thema Fußgesundheit. In einem Workshop mit Choreograf:innen und Tanzgruppen entstanden außerdem fünf Tanzvideos. Diese sollen die Rezipient:innen zu einem freudvolleren Umgang mit dem eigenen Körper inspirieren.2
„Wunde Punkte“
Unter diesem Titel veranstaltet die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft am 7. und 8. Juni ein Forum nicht nur zum Thema chronische Wunden (siehe Tipp): In Vorträgen und Workshops werden verschiedene Aspekte der Gesundheitsversorgung diskutiert, zum Beispiel die sensible Kommunikation von Ärzt:innen mit Patient:innen und die Einbindung von Betroffenen in deren eigenen Behandlungsprozess.
Wie auch schon in den Forschungsprozess fließt in das Veranstaltungs-
programm einiges Künstlerische ein. Neben einer Tanzperformance gibt es Workshops zu künstlerischer Forschung und dazu, wie Wissenschafts- und Gesundheitskommunikation durch Designmethoden neu gedacht werden kann. Für Pflegefachkräfte und Physiotherapeut:innen ist die Veranstaltung als Fortbildung anerkannt.
Bekanntlich müssen alle Wunden – auch akute – regelmäßig gereinigt und neu verbunden werden. Zuerst sollte dabei immer eine aktive periodische Reinigung erfolgen. Wenn keine Infektion besteht, kann eine wirkstofffreie Elektrolytlösung verwendet werden, bei Verdacht auf Infektion und bei stark verschmutzten Wunden sowie Kratz- oder Bissverletzungen braucht es hingegen ein Antiseptikum. Antibiotika sind indiziert, wenn die Gefahr einer Sepsis besteht. Chronische Wunden werden grundsätzlich nach demselben Prinzip gereinigt, allerdings ist das Infektionsrisiko hier besonders hoch. Deshalb ist eine vollkommen sterile Arbeitsweise notwendig. Wenn das avitale Gewebe nicht vollständig durch mechanische Reinigung entfernt werden kann, ist ein Debridement unumgänglich, bei dem das abgestorbene oder entzündete Gewebe mit Pinzette oder Skalpell entfernt wird. Dabei sollte auf eine angemessene Schmerztherapie geachtet werden.
Akute oberflächliche Verletzungen erfordern meist keine passive periodische Reinigung (PPR), bei chronischen Wunden kann sie aber je nach Fall in Betracht gezogen werden. PPR-Mittel können die Heilung unterstützen, die Häufigkeit der Verbandswechsel verringern und Schmerzen lindern. Letzteres trifft vor allem auf Hydrogele zu, die einen physiologischen Feuchtigkeitsgehalt der Wunde sicherstellen. Ein feuchtwarmes Milieu ist der Wundheilung nämlich zuträglich, ausgespülte Zelltrümmer und Keime werden von der Wundauflage gebunden. Die Wirkung von Hydrogelen ist besser untersucht als jene vieler anderer PPR-Mittel.
Die Wundauflage sollte grundsätzlich wirkstofffrei sein, außer es besteht eine Infektion. Bei starken Schmerzen sind auch ibuprofenhaltige Verbände eine Option. Gegen intensive Geruchsbildung können Kohlekompressen helfen.
Im Normalfall heilen oberflächliche Wunden innerhalb einiger Wochen ab. Wenn sich nach vierwöchiger Behand-
Wunde Punkte –
Das Forum zu chronischen Wunden und darüber hinaus
Hier geht´s zur Anmeldung:
lung keine Heilungstendenz zeigt, spricht man von einer chronischen Wunde. Ursache der Wundheilungsstörung kann zum Beispiel eine chronisch venöse Insuffizienz oder periphere arterielle Verschlusskrankheit sein. Zur Heilung muss die Grunderkrankung behandelt werden. Die Therapie fällt unterschiedlich aus und erfordert Fachpersonal, deshalb sollte von Beginn an multiprofessionell gearbeitet werden.3
Felicia SteiningerQuellen:
1 Schneider C et al., 23.05.2022. DOI: 10.5281/zenodo.6406108.
2 show.lbg.ac.at/tanzende-fuesse
3 AWMF, S3-Leitlinie zu Lokaltherapie schwer heilender und/oder chronischer Wunden, Register-Nr. 091-001, 2023.
INFO
Die drei Phasen der Wundheilung
� Tag 1-4: Exsudationsphase –Blutstillung und Reinigung
� Tag 2-14: Granulationsphase –Aufbau von Granulationsgewebe
� Tag 3-21: Epithelisierungsphase –Ausreifung, Narbenbildung und Epithelisierung
Bei chronischen Wunden können die Zeiträume der Heilungsphasen stark abweichen. Sie sind je nach Patient:in unterschiedlich. Dies sollte bei der Wundversorgung berücksichtigt werden.
Verstärkte Belastung für Asthma- und Allergiepatient:innen bei Gewitter
Extreme Wetterereignisse häufen sich aufgrund klimatischer Veränderungen auch in Regionen, in denen sie bisher selten waren. Das wirkt sich auf die Gesundheit der Menschen aus, so unter anderem auf jene von Personen mit Asthma bronchiale oder allergischer Rhinitis. Bei Asthmapatient:innen können Gewitter und starke Regenfälle zu einer Exazerbation führen, sodass es zu einem Anstieg der Besuche in den Notaufnahmen und Krankenhauseinweisungen kommt.1
Bestimmte meteorologische Bedingungen können zu gewitterbedingtem Asthma („T hunderstorm-Asthma“) führen. Typischerweise betrifft es Menschen, die an Aeroallergien – etwa gegen Pollen und Pilzsporen – leiden. Pollenkörner, die unter gewöhnlichen Umständen im oberen Respirationstrakt verbleiben,
gelangen bei Gewitter in höhere Luftschichten und zerfallen durch Aufwinde in kleinere Partikel. Abwinde transportieren diese wieder zurück auf den Boden, sie gelangen so in die unteren Atemwege und verursachen akutes Asthma.2
Der bislang bedeutendste Vorfall war ein schweres Gewitter am 21. November 2016 in Melbourne, Australien. Binnen 30 Stunden wurden 8.500 Patient:innen in Notfallambulanzen eingeliefert, zehn von ihnen verstarben.3 Untersuchungen ergaben zudem, dass gewitterbedingtes Asthma nicht nur für Menschen mit vorheriger Asthmadiagnose ein Problem darstellt. Von 85 untersuchten Patient:innen im Erwachsenenalter in

Melbourne hatten rund 60 Prozent bis zu diesem Ereignis noch keinen Asthmaanfall. Bei 99 Prozent von ihnen lag jedoch eine Pollenallergie vor.4
Vorfälle dieser Art sind vor allem aus Australien bekannt, aufgrund klimatischer Veränderungen könnte es jedoch auch in Europa zu vermehrten Fällen von Gewitterasthma kommen.5 Dies stellt natürlich eine große Belastung für das Gesundheitssystem dar, deshalb ist es wichtig, die Risikogruppen zu identifizieren. Dazu zählen Patient:innen mit allergischer Rhinitis mit hohem serumspezifischem Immunglobulin-E-Level. Sie können von einer Allergen-Immuntherapie profitieren. Ebenso ist es von Bedeutung, die Compliance der Betroffenen bei der Therapie mit inhalativen Kortikosteroiden (ICS) zu verbessern und eine Single-Inhaler-Maintenanceand-Reliever-Therapie (SMART) in Erwägung zu ziehen. Damit erhöhen die Patient:innen bei verstärkter Symptomatik ihre Steroiddosis und sind besser vor Exazerbationen geschützt.6 Zudem sollten sie an Risikotagen Aufenthalte im Freien möglichst vermeiden. Diese Tage vorherzusagen ist natürlich nicht einfach. Eine Orientierung bietet jedoch die Pollen+ App, die seit vergangenem Jahr zusätzliche Informationen über das Asthmawetter und eine Unwetterwarnfunktion beinhaltet. Diese kann auf polleninformation.at heruntergeladen werden.
Margit KoudelkaLiteratur:
1 Luedders J et al., Immunol Allergy Clin North Am. 2024 Feb;44(1):35-44.
2 Chatelier J et al., J Inflamm Res. 2021 Sep 8; 14:4537-4550.
3 Thien F et al., Lancet Planet Health. 2018 Jun;2(6):e255-e263.
4 Lee J et al., Respir Med. 2017 Nov;132:146-148.
5 Price D et al., J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Apr;9(4):1510-1515.
6 Harun NS et al., J Asthma Allergy. 2019 May 6; 12:101-108.

Bakterien dienen als Adjuvantien bei Hausstaubmilbenallergie
Hausstaubmilben gehören zu den wichtigsten Allergieauslösern, und ihre Prävalenz ist steigend. Das liegt nicht zuletzt an der modernen Bauweise: Abgedichtete Fenster behindern den Luftaustausch und erhöhen die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Unter diesen Bedingungen fühlen sich die Hausstaubmilben besonders wohl. Grund genug, die Tiere genauer zu untersuchen. Die Allergene der Hausstaubmilbe befinden sich in deren Kot und werden von Menschen mit der Raumluft eingeatmet. Dabei werden aber auch andere Substanzen, so etwa symbiotische Bakterien und deren Produkte, übertragen, die als Adjuvantien agieren können. Ein Team an der Medizinischen Universität Seoul untersuchte deshalb das Mikrobiom des Spinnentiers und dessen Einfluss auf die allergische Reaktion. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Frontiers in Allergy veröffentlicht.1
Gegenstand der Untersuchung waren die beiden häufigsten Vertreter der Milbe Dermatophagoides farinae und D. pteronyssinus. Dabei taten sich bedeutende Unterschiede auf: Während in ersterem vor allem Enterococcus faecalis und Bartonella spp.-Zellen gefunden wurden, ließen sich in letzterem generell kaum Bakterien nachweisen. Das liegt vermutlich daran, dass D. pteronyssinus wesentlich mehr Pilze beheimatet, vorherrschend darunter Aspergillus penicillioides, der bekanntlich antibakterielle Eigenschaften hat. Das Mikrobiom der Hausstaubmilbe dürfte die allergische Pathogenese nicht unwesentlich beeinflussen. Denn die Lipo-
polysaccharide (LPS) in der Zellwand gram-negativer Bakterien sind ein bekannter Auslöser von Entzündungsreaktionen. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass mit Bakterien kolonisierte Hausstaubmilben in Atemwegsepithelzellen eine stärkere Sekretion der proinflammatorischen Cytokine IL-6 und IL-8 verursachen als solche ohne Bakterien, obwohl sich die Allergenkonzentration nicht signifikant unterschied. LPS ist außerdem mit der Entwicklung und dem Schweregrad von allergischem Asthma assoziiert, und bakterielle Antigene generell mit der Entwicklung diverser allergischer Krankheiten.
Je nach Hersteller wurden in Hausstaubmilbenextrakten unterschiedliche Konzentrationen von Bakterien und LPS nachgewiesen. Den Wissenschafter:innen zufolge könnten diese Diskrepanzen sowohl in der experimentellen Anwendung als auch auf die Allergenimmunotherapie unbeabsichtigte Auswirkungen haben, nicht zuletzt deshalb, weil die immunologische Rolle des Mikrobioms längst nicht vollständig geklärt ist. Die Herstellung von Extrakten mit niedrigeren Bakterienkonzentrationen könnte deshalb von Vorteil sein, vorausgesetzt, dass die Effektivität einer Therapie dadurch nicht gemindert wird.
Felicia Steininger Quelle: 1 Myung-hee Y et al., Front. Allergy 2023, doi.org/10.3389/falgy.2023.1240727

• Die Kategorie der Lipidregulatoren (ausschließlich registrierte Arzneimittel) erzielt in den öffentlichen Apotheken und Hausapotheken im MAT März 2024 mit 11,7 Mio. Packungen 156,1 Mio. Euro Umsatz FAP.
• Der entsprechende Markt steigt aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 %
© Heuschneider-Platzer
nach Menge und um 22,9 % nach Wert. Im Jahr davor betrug das Absatzwachstum 9,2 % und das Umsatzwachstum 29,8 %.
• 80,8 % aller Packungen sind Generika, und Atorvastatin ist der am häufigsten verwendete Wirkstoff vor Rosuvastatin, Ezetimib/Rosuvastatin und Simvastatin.
• Die Top-10-Produkte nach Menge machen 50,8 % des Gesamtabsatzes aus. Ezerosu® (G.L. Pharma) liegt nach Einheiten an erster Stelle, gefolgt von Atorvastatin +Pharma und Ezeato® (G.L. Pharma).
• Die Top-10-Produkte nach Wert umfassen 73,8 % des Gesamtumsatzes. Repatha® (Amgen) führt vor Praluent®
(Sanofi-Aventis) und Leqvio® (Novartis Pharma) das Umsatzranking an. Nach Menge sind die drei Produkte auf dem 27., 38. und 82. Rang zu finden.
* Quelle: IQVIATM DPMÖ sell-out Österreich, Verkäufe der öffentlichen österreichischen Apotheken sowie Großhandelslieferungen an ärztliche Hausapotheken, ATCKlasse C10 Lipidregulatoren/Antiarteriosklerotika, ausschließlich registrierte Arzneimittel aus dem Warenverzeichnis I, Absatz/Menge in Einheiten, Umsatz/Werte in Euro, bewertet zum Fabrikabgabepreis (FAP), Wachstum vs. Vorjahr, MAT März 2024 (April 2023 bis März 2024 kumuliert). Handelsname
In Kooperation mit

März 2024
EXPERTE: Mag. Heinz Bédé-Kraut Sportwissenschafter in Kitzbühel, bede-kraut.at

Patient W. (43) war vor einer Woche bei der Vorsorgeuntersuchung. Beim heutigen Beratungsgespräch wird seine Präadipositas (BMI 28) thematisiert. Herr W. bekundet, schon länger abnehmen und wieder fitter werden zu wollen. Früher sei er viel gelaufen, aber das sei ja schlecht für die Knie. Die Hausärztin empfiehlt eine sportwissenschaftliche Beratung, damit ein individualisierter Trainingsplan erstellt werden kann. Herr W. winkt allerdings ab: In den Sozialen Medien und Co stünden doch ausreichend Informationen und Trainingstipps zur Verfügung. Die Medizinerin lässt sich nicht beirren und schildert am Beispiel „ Laufen und Knie “ , wie viele Fitnessmärchen, -gerüchte und -unwahrheiten kursieren …
Mag. BÉDÉ-KRAUT: In meiner täglichen sportwissenschaftlichen Praxis höre ich häufig interessante Fragestellungen rund um optimales Training. Oft braucht man einiges an Überzeugungskraft, um zu vermitteln, was sinnvoll und richtig ist – und was nicht. Äußerst hartnäckig sind manche Glaubenssätze und Meinungen. Wenn Training oder das Abnehmen diskutiert wird, hat fast jeder ein paar schlaue Tipps parat. Dazu kommen die Botschaften der Fitnessinfluencer in den Sozialen Medien: Das Netz ist voll mit Bloggern, die kostenlos Motivationstipps, Workoutvideos und Fitnessideen anbieten. Doch was ist wahr und was falsch an den Behauptungen?
Laufen ist nicht gut für meine Knie. Nicht das Laufen selbst kann Gelenkbeschwerden verursachen, sondern nur die falsche Technik, gepaart mit zu hoher Intensität und falschem Ehrgeiz. Eine zu un-
regelmäßige Durchführung, ein zu schneller Start mit zu großen Schritten und muskuläre Dysbalancen sind oft weitere Gründe, weshalb die Gelenke schmerzen. Oder auch das falsche, alte Schuhwerk kann schuld an Fehlbelastungen der Fuß-, Knie- oder Hüftgelenke sein. Wer übergewichtig ist oder eine alte Sportverletzung hat, sollte seinen Körper zuerst mit flottem Gehen und begleitendem Krafttraining an das Laufen heranführen.
Jedes Training muss mit Stretching beginnen.
Nein, am Anfang sollte ein Aktivieren und Aufwärmen stehen, zum Beispiel mit Mobilisationsübungen wie leichter Schwunggymnastik, einem Warm-up auf dem Crosstrainer oder Rudergerät. Ob man überhaupt vor einem Training dehnen muss, hängt von der Sportart ab. Bei Sportarten mit geringem Impact wie Nordic Walking ist ein Vorab-Stretching nicht nötig. Spielt man aber etwa Fußball oder Tennis, wo man schnelle Bewegungen macht und abrupt abbremst, ist
Ernährung und Sport
Von Angelika Kirchmaier, Heinz Bédé-Kraut, Corinna Welser, Ronald Newerkla
Tyrolia 2023
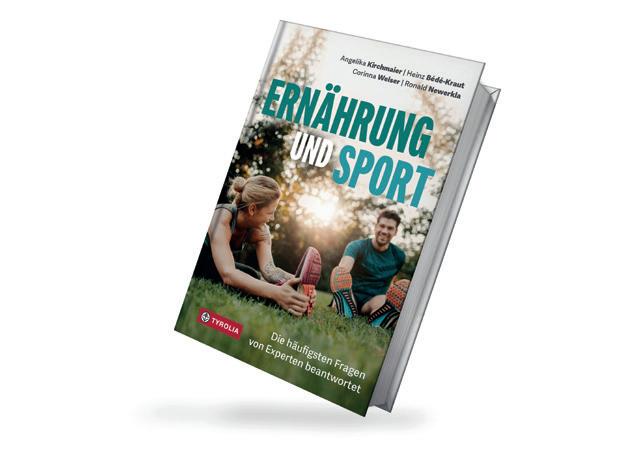
nach einer Aktivierungsphase ein kurzes, aktives Dehnen mit spezieller Intensität und Pausengestaltung sinnvoll.
Sport muss auch wehtun.
Falsch! Wenn es schmerzt, sendet der Körper eindeutige Signale aufzuhören. Eine Pause und Physiotherapie sind angesagt. Wer Schmerzen dauerhaft ignoriert, provoziert chronische Verletzungen und Entzündungen. Knorpelschäden und im schlimmsten Fall irreversible Abnützungen können die Folge sein.
Muskelkater ist ein Zeichen für gutes Training.
Schmerzende Muskeln nach dem Training bedeuten nur eines: Man hat sich übernommen. Bei Muskelkater entstehen nämlich durch Überanstrengung Mikrotraumen im Muskelgewebe. Die Dehnungsschmerzen sind also kein Indikator für Muskelwachstum, sondern für Überlastung.
Wer Kraft trainiert, bekommt große Muskelberge. Ob man dazu neigt, Muskeln aufzubauen, ist eine Typ- und Geschlechterfrage. Eine Frau hat hormonell bedingt normalerweise keine Muskelberge zu befürchten. Prinzipiell gilt es zu beachten: Ein Maximalkrafttraining, also schwere Gewichte mit wenigen Wiederholungen zu stemmen, regt die Muskelbildung mehr an, als leichte Gewichte mit vielen Wiederholungen zu heben (Kraftausdauertraining).
Wer schwitzt, hat keine gute Kondition. Hier trifft oft das Gegenteil zu. Sportler:innen haben eine bessere Thermoregulation, da die Muskeln leistungs-
fähiger sind. Deshalb geben sie bei Belastung häufig sogar mehr Schweiß ab als unsportliche Menschen. Wie viel man schwitzt, hängt von der Intensität des Trainings ab, außerdem liegt es an den Genen, wie schnell und viel wir transpirieren. Ein Zeichen von mangelnder Kondition ist dies also nicht. Die Schweißproduktion ist zudem von unterschiedlichen Bedingungen wie der Anzahl der Schweißdrüsen, dem Klima, der Raumtemperatur und dem Körpergewicht abhängig. Wer schwerer ist, gerät generell schneller ins Schwitzen.
Gymnastik oder Krafttraining reduziert Fett von Problemzonen.
Sogenanntes „Spot Reducing“ körperlicher Problemzonen wie Bauch, Beine, Po funktioniert nicht! Der Körper kann nicht differenzieren, wo er beim Training das Fett abnehmen soll und wo nicht. Die Abfolge, in der Fettdepots abgebaut werden, ist individuell und hormonell festgelegt. Allerdings lässt sich gezielt Muskulatur aufbauen, was einen erhöhten Grundumsatz zur Folge hat. Bei Frauen verschwindet häufig der Speck am Oberkörper schneller als an Hüften und Po. Subkutanes Depotfett wird hauptsächlich mit einer intelligenten Kombination von variablem Ausdauer-, Krafttraining und gesunder, optimierter Ernährung abgebaut.
Nur einmal pro Woche Fitnessstudio bringt nichts. Einmal ist auf jeden Fall besser als keinmal. Um ein gewisses sportliches Niveau zu halten, reicht das wöchentliche Training aus und sorgt so dafür, dass die Lust an der Bewegung nicht verlorengeht. Besonders Anfänger können ihre Fitness bereits mit einem einstündigen Training pro Woche messbar steigern. Durch eine Kombination von Kraft- und Ausdauertraining wird die Leistungsfähigkeit gesteigert sowie die intra- und intermuskuläre Koordination deutlich verbessert, der Blutdruck sinkt, Cholesterinwerte können sich normalisieren und das allgemeine Wohlbefinden steigt. Bei vielen ändert sich auch das Essverhalten.
Ausdauersport ist der beste Weg, um abzunehmen. Nicht richtig! Krafttraining ist genauso gut und wertvoll. Beim Herz-Kreislauf-Training verbrennt man je nach Geschlecht, Körpergewicht, Sportart und Intensität ca. 300 bis 800 Kilokalorien pro Stunde, beim Krafttraining fast ebenso viele. Aber es gilt, zwischen den Sätzen und Übungen nur kurz zu pausieren (30 bis 60 Sekunden lang), damit der Puls nicht zu weit sinkt und der Stoffwechsel nicht zu langsam wird. Um abzunehmen, ist es wichtig, Kraft- und Ausdauertraining zu kombinieren.
Sport reicht, um schlank zu werden. Stimmt nicht! Wer trotz Sport weiterhin ungesund isst und trinkt, weil er denkt, er habe mit Sport nun genug für den Fettabbau getan, der irrt. Nur wer weniger Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht, wird auf Dauer abnehmen. Und da die ungesunden Lebensmittel und Getränke meist eine Unmenge von Kalorien haben, muss zusätzlich zum Sport die Ernährung bewusst umgestellt werden, um die Fettdepots im Körper anzugreifen und abzubauen. <
08.06.2024
Sedoanalgesie & Notfallmanagement in der gastrointestinellen Endoskopie
Ort: Klinik Landstraße in Wien
18.06.2024
Reisemedizin/ Reiseimpfungen
Ort: Webinar (Österreichische Akademie der Ärzte)
29.06.-01.07.2024
EAN 2024 (Neurologie)
Ort: Messukeskus Expo Plaza (Helsinki) & Online
12.-15.06.2024
57. ÖGGH Jahrestagung (Gastroenterologie und Hepatologie)
Ort: Salzburg Congress
20.-21.06.2024
Grazer Gefäß- und Gerinnungstage 2024 –Sailersymposium
Ort: LKH Univ.-Klinikum Graz
08.-12.07.2024
FOBI 2024 (praktische Dermatologie und Venerologie)
Ort: Internationales Congress Center München
Herausgeber und Medieninhaber: RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at. Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler. Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Margit Koudelka, Felicia Steininger, Mara Sophie Anmasser, Justyna Frömel, Bakk. MA. Lektorat: Mag.a Katharina Maier. Produktion & Grafik: Angie Kolby. Cover-Foto: shutterstock.com/AI.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at. Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at. Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG. Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärzt:innen.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
13.-16.06.2024
EHA 2024 (Hämatologie)
Ort: IFEMA Madrid & Online
28.-29.06.2024
haut+PRÄVENTION –Jahrestagung 2024
Ort: Medizinische Universität Graz
Weitere Infos und Veranstaltungen finden Sie in unserem Kongresskalender unter:
Wichtig
gesund.at/ kongresskalender
Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Ratgeber sorgfältig. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig und aktuell ist bzw. sich seit dem Druck keine Gesetzesänderung ergeben hat.
Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: (01) 501 65 0
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.arbeiterkammer.at
In unserem Fachmagazin setzen wir auf genderneutrale Sprache. Verwendet wird der Doppelpunkt – als beste Symbiose aus Leserlichkeit und Inklusion. Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf die gänzlich orthografisch/ grammatikalisch korrekte Schreibweise. Etwa geben wir bei Artikeln und Pronomen jeweils nur eine Variante an – jene, die zur längeren Variante des gegenderten Wortes gehört. Weitere Informationen siehe: meinmed.at/kommunikation/genderneutrale-sprache/2688 issuu.com/hausarzt/docs/ha_2023_12/3 (Hausärzt:in 12/23, Editorial, S. 3)
Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie bereit: wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere Bestellmöglichkeiten:
■ EMail: mitgliederservice@akwien.at
■ Bestelltelefon: (01) 501 65 1401
Artikelnummer 456
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum

Abbildung (v. l. n. r.): Prof. Marcin Czech PhD, MD, MBA, Mag. Jakob Hochgerner, Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, Andreas Huss, MBA, Präs.in LAbg. Ingrid Korosec, Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch.
Im Rahmen des Finanzausgleichs haben sich die Partner des österreichischen Gesundheitssystems auf den Ausbau des öffentlich finanzierten Impfprogramms verständigt. Aus diesem Anlass diskutierten im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Wien* Expert:innen sowie Vertreter:innen aller Systempartner darüber, welche As-
pekte ausschlaggebend sind, damit die beschlossenen 90 Mio. Euro jährlich zielgerichtet, zeitnah und effizient der impfwilligen Bevölkerung zugutekommen. Insbesondere Erwachsenenimpfungen sind aktuell Großteils privat zu finanzieren. In einem ersten Schritt wurde die Influenza-Impfung für die Saison 2023/24 im Rahmen eines öffentlichen Impfprogrammes allen in Österreich lebenden Personen stark vergünstigt zugänglich gemacht. Der österreichische Impfplan empfiehlt darüber hinaus jedoch weitere Immunisierungen für Erwachsene, die noch auf eine Finanzierung warten, wie etwa die Gürtelrose-Impfung. Hier ein paar interessante Statements der Teilnehmenden:
„Wir müssten einfach ausrechnen: Was kosten uns die Erkrankungen im Jahr, die vermeidbar wären? Dann wissen wir, wie viel wir ausgeben sollten.“
Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, Mitglied des Nationalen Impfgremiums
„Ziel muss es sein, alle im Impfplan empfohlenen Impfungen in ein Impfprogramm überzuführen.“
Andreas Huss, MBA, ÖGK-Obmann
„Wir müssen die Senior:innen dann auch motivieren, die Impfungen anzunehmen.“
LAbg. Ingrid Korosec, Präsidentin Österreichischer Seniorenrat
„Es braucht einen transparenten, evidenzbasierten Entscheidungsprozess, der klar legt, wo der höchste medizinische Benefit erzielt wird.“
Priv.-Doz.in Mag. a Dr. in Maria Paulke-Korinek, PhD, Abteilung Impfwesen, BMSGPK
„Das ‚frische Geld‘ sollten wir auch für neue Impfungen verwenden.“
Mag. Jakob Hochgerner, Direktion für Soziales und Gesundheit, Amt der Oö LReg PA/Red
* Podiumsdiskussion „Öffentliches Impfprogramm: Next steps“, GlaxoSmithKline, 25. April 2024, Britische Botschaft Wien.
Die Ursachen für Demenz sind vielfältig und nicht immer eindeutig geklärt. Fest steht aber: Eine Hörminderung zählt schon ab mittlerem Alter zu den größten Risikofaktoren einer Demenz. Grundsätzlich ist der Zusammenhang zwischen Demenz und Hörverlust schon länger bekannt. „Fehlende akustische Reize können die Entstehung einer Demenz begünstigen oder den Verlauf beschleunigen“, heißt es etwa in einem Merkblatt der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Die Achieve-Stu-
die1, welche von Forscher:innen der Johns Hopkins University und sieben weiteren Institutionen durchgeführt wurde, gilt als eine der umfangreichsten internationalen Studien. Sie kommt zum Ergebnis: Bei älteren Patient:innen mit erhöhtem Demenzrisiko wurde der Verlust des Denkund Gedächtnisvermögens dank ihrer Hörgeräte in einem Zeitraum von drei Jahren um rund 48 Prozent verlangsamt. Hörakustikexperten empfehlen daher einen regelmäßigen Hörtest zur Vorsorge.

„Hören ist nicht nur eine Leistung des Gehörs, sondern vor allem des Gehirns. Ein gutes Gehör wirkt sich daher auch positiv auf die geistige Fitness aus“, sagt Hörakustikexperte Lukas Schinko, CEO von Neuroth und selbst ausgebildeter Hörakustik-Meister.
Referenz: 1 Lin FR et al., Lancet. 2023 Sep 2;402(10404):786-797.
Quelle: Neuroth International AG
OLEOvital® EISEN JUNIOR punktet durch gute Verträglichkeit
Bislang war die Compliance bei herkömmlichen oralen Eisenpräparaten oft wenig zufriedenstellend. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine patentierte Eisenformulierung, das sogenannte sucrosomale Eisen, auch bekannt unter der Marke OLEOvital Eisen, am Markt durchgesetzt. Für Kinder gibt es ein eigens konzipiertes Produkt: OLEOvital® Eisen Junior* für Kinder ab 3 Jahren.** Es handelt sich um ein Pulver zur Zubereitung einer 30-ml-Suspension mit beigepackter Dosierhilfe. Die täglich empfohlene Verzehrmenge ist 1 ml à 7 mg Eisen.
Dank der sucrosomalen Technologie überzeugt OLEOvital® Eisen Junior durch seine gute Verträglichkeit (keine gastrointestinalen Irritationen) und eine hohe Bioverfügbarkeit. Es verursacht keine Verfärbungen von Zähnen oder Stuhl und die Einnahme erfolgt unabhängig von der Tageszeit sowie den Mahlzeiten, sodass man es problemlos auch zusammen mit Milchprodukten einnehmen kann. Zudem hat es keinen metallischen Nachgeschmack, sondern schmeckt sahnig-süß.

* früherer Produktname: OLEOvital Eisen Tropfen.
** Die Gabe und Dosis bei Kindern unter 3 Jahren liegt im Ermessen der Ärzt:in. Quelle: Fresenius