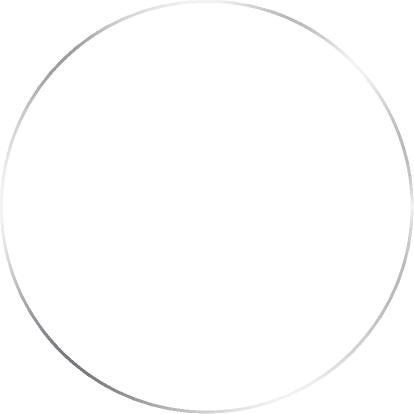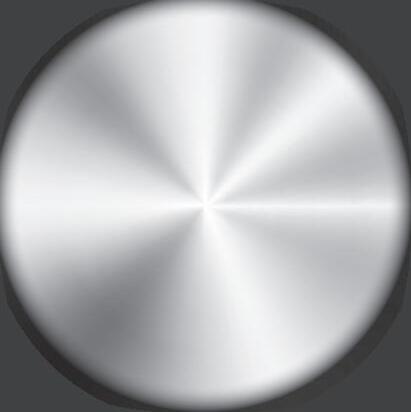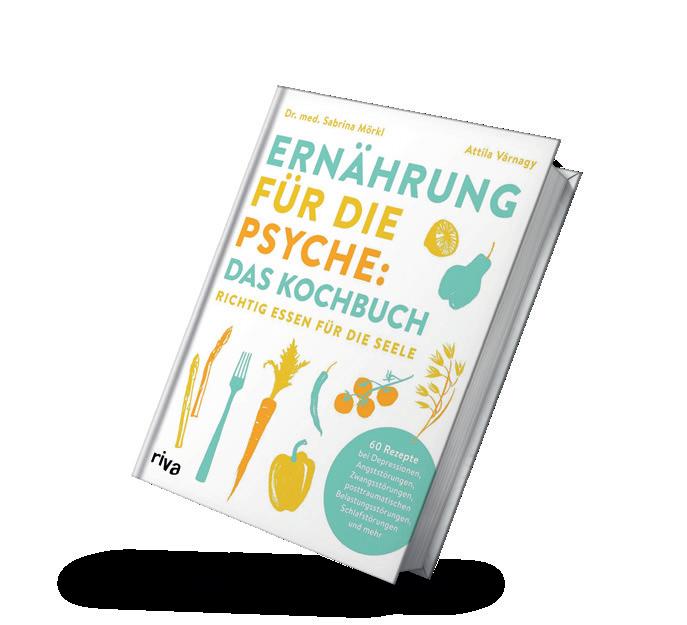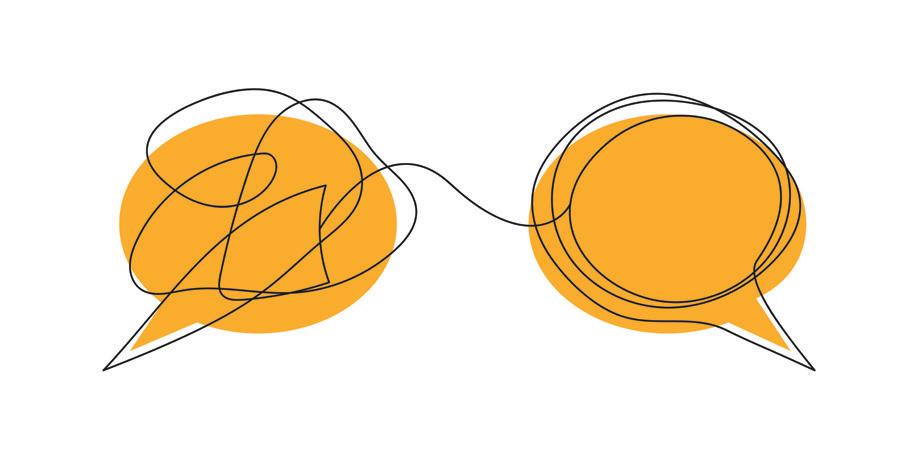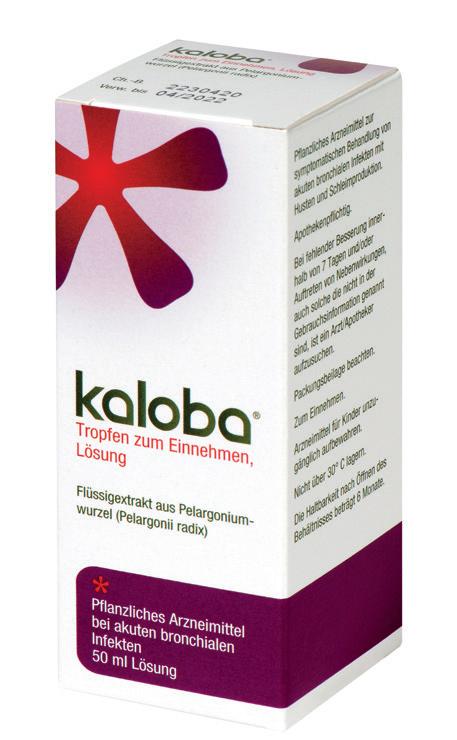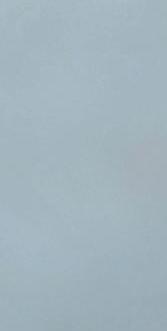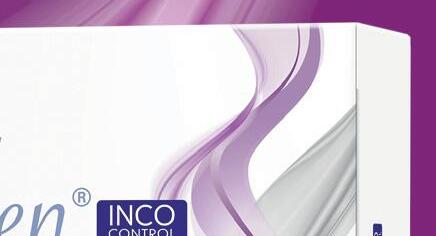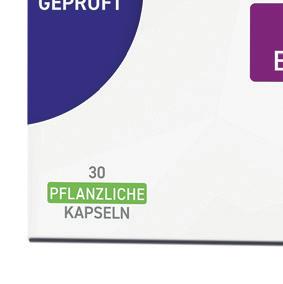Wenn
Häufig

03/2024 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie
KRANKSEIN AUCH
LEISTBAR?
zum Thema
Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien Zurück zur ursprünglichen Anatomie des Knies Update Endoprothetik
IST
KÜNFTIG
Podiumsdiskussion
Zwei-Klassen-Medizin
unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache
die
heilt
Wunde nicht

Apropos soziale Rezepte
„Die junge Frau atmet schwer, kann kaum schlafen und durchläuft Phasen tiefer Traurigkeit“, schreibt Mag. Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich, in einem Kommentar.* Medizinisch sei sie gut versorgt. Aber das Schreckliche, das sie habe erleiden müssen, habe sich in ihren Körper eingeschrieben. Ein Kollege, der das Anamnesegespräch führt, findet heraus, wie wichtig der traumatisierten Patientin Musik ist. Er fragt sie, ob sie nicht in einem Chor singen wolle, und vermittelt ihr einen Platz. Tatsächlich empfindet sie das gemeinsame Singen – bei dem es auch ums richtige Atmen, Luftholen und „ ZumKlingen-Bringen“ geht – als sehr befreiend. Sie fühlt nach langem wieder Freude, obwohl sie im ersten Moment zögerlich war.
Aus der Forschung zu den sozialen Determinanten der Gesundheit wisse man heute, dass psychosoziale Maßnahmen die Lebensqualität um bis zu 70 Prozent verbessern könnten – und auch einen bedeutenden Anteil an der Genesung hätten, fährt Mag. Schenk in seinem Kommentar fort. Ärzt:innen könnten ein „soziales Rezept“ ausstellen. Das Singen im Chor könne ebenso ein solches sein wie ein Theaterbesuch oder ein selbst organisiertes Angebot im Grätzel.
Ärzt:in überweist zum „Linkworker“







Finanzierung und Organisation. Das gelte es zu überwinden. Erste Ergebnisse aus Pilotversuchen zeigen Mag. Schenk zufolge, dass soziale Rezepte Angst, Überforderung, Einsamkeit und Ohnmacht reduzieren.
Auf Gesundheits- und Sozialleistungen zugreifen
Warum gebe ich diesen Kommentar hier wieder? Der Inhalt hat mich beim Lesen berührt und an unsere aktuelle Titelgeschichte erinnert. Auch darin geht es um die Ermöglichung einer besseren Zusammenarbeit von Ärzt:innen und Vertreter:innen anderer Gesundheits- und Sozialberufe. Nicht zuletzt, um die Ärzt:innen in überfüllten Kassenpraxen zu entlasten und die Wartezeiten für die Patient:innen hinunterzuschrauben. Die aktuelle Gesundheitsreform sieht noch keine „Linkworker“ vor, möchte aber zumindest in Primärversorgungseinrichtungen ein besseres Teamwork ermöglichen. Aus Sicht der Ärztekammer sollte das Angebot nicht an Zentren gebunden sein. Um eine Zwei-Klassen-Medizin hintanzuhalten, müssten vielmehr alle Kassenmediziner:innen, also auch jene in Einzelpraxen, auf Gesundheits- und Sozialdienstleistungen für ihre Patient:innen zugreifen können. Gute Lösungen wären oft so einfach. Es bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung nicht einmal mehr an gesetzlichen und strukturellen Hürden scheitert.
Eine spannende Lektüre und einen guten Start in den Frühling!
Ihre




Jede fünfte Patient:in suche die Hausärzt:in nicht in erster Linie wegen eines medizinischen, sondern wegen eines sozialen Problems auf. Da gehe es um Einsamkeit, um finanzielle Not oder Arbeitslosigkeit, weiß der Sozialexperte. Die Verschreibung könne auch die Beantragung von Sozialleistungen oder die Verbesserung der Wohnsituation beinhalten. Dort, wo es „ Social Prescribing“ gebe, könne ein „Linkworker“ eingesetzt werden, der die Vermittlungsarbeit leistet. Verlinken heiße verbinden: Die Ärzt:in überweist zum Linkworker, der dann mit der Patient:in die konkrete soziale Verschreibung entwickelt und organisiert.























Das österreichische Sozialstaatmodell trenne traditionell „C ure“ von „C are“, das Medizinische vom Sozialen. Diese Spaltung führe zu sich gegenüberstehenden Systemen in














































* MO-Magazin für Menschenrechte 1/24.






























Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at












Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit
© shutterstock.com/ornavi
medizinisch politisch
06 Das schwache Herz im Fokus
Aktuelle Leitlinienempfehlungen der ESC – erstmals auch für die Kardiomyopathie
10 Wenn die Wunde nicht heilt
Häufig unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache
13 Der Schlaganfall und seine Komplikationen
Die Schlüsselrolle der Hausärzt:innen als Casemanager:innen
17 DFP Praxiswissen:
Update Endoprothetik
Kinematisches
Alignment in der Knieendoprothetik – zurück zur ursprünglichen Anatomie
21 Ein Kreuz, das Viele tragen
Bei funktionellen Rückenschmerzen ist „Überbehandlung“ kontraproduktiv
26 So verliert der Darm an Reiz
Das Reizdarmsyndrom erkennen und durch eine FODMAP-Diät die Therapie unterstützen
28 Rot, gelb, grün –mit dem Ampelprinzip gegen Sodbrennen Asthma, Husten oder Ohrenschmerzen?
Reflux als Ursache wird oft nicht erkannt
30 Verträglich(er) kombiniert Adjuvante Misteltherapie bei spezifischer Immuntherapie
32 Allergiegeplagte Sexualität Über die Beziehung zwischen atopischen Erkrankungen und sexueller Dysfunktion
Reizdarmsyndrom: Welche Lebensmittel zu meiden sind.

THEMA DES MONATS
14 Ist Kranksein auch künftig leistbar?
Ein Expert:innengespräch zum Thema Zwei-Klassen-Medizin
© shutterstock.com/Alkema Natalia


Chronische Wunden:
36 Pollensaison im Anflug Allergien in Europa, die Pollensituation in Österreich und neue Testmethoden
39 Oben Segen, unten Fluch Bodennahes Ozon schadet der Gesundheit – durch die Klimaerwärmung wird es immer mehr
41 Nicht nur eine Frage der Anatomie Sexualhormone und die Inzidenz von Harnwegsinfekten
42 Die Top-Antihypertonika nach Menge und Wert Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA
extra
43 Ernährung, Darm-GehirnAchse und Psyche
Nutritional Psychiatry: Der Blick über den Tellerrand, Teil 1
46 SPRECHStunde „Sprachtherapie bei Demenz?“
48 Leitthema Atemnot ... ... beim 23. Consensus Meeting der AG Herzinsuffizienz
49 Das Akne-Stigma Laut Studie sind Vorurteile weit verbreitet
51 Termine Aktuelle Kongresse und mehr
51 Impressum
Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis
©
39
Das Übel an der Wurzel packen.
shutterstock.com/AI
Bodennahes Ozon: Die Konzentration des Luftschadstoffs steigt, was u. a. die Lungen- und Herzfunktion beeinflussen kann.
4 März 2024
10 24 26
Ihr Begleiter im medizinischen Berufsalltag.
Yulia Furman, SdecoretMockup
©





NEU! Gesund.at Hier geht es zur Anmeldung:
Ihr Arbeitsalltag ist stressig genug –verlieren Sie nicht auch noch Zeit mit der Suche nach medizinischen Informationen oder Terminen. Mit Gesund.at haben wir ein Portal geschaffen, das Ihnen diese Arbeit abnimmt. Selbstverständlich haben wir auch an Weiterbildung gedacht, so können Sie ab sofort DFP-Punkte auch unterwegs sammeln! Klingt gut, oder? stock.adobe.com/
Weniger suchen, mehr wissen.
GASTAUTOR:INNEN-TEAM:

Ass. Dr.in Christina Pöschl
Abt. f. Kardiologie, Angiologie & Interne Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen

OA Dr. Christian Ebner
Abt. f. Kardiologie, Angiologie & Interne Intensivmedizin, Ordensklinikum Linz Elisabethinen


Hausärzt:in medizinisch 6 März 2024 © shutterstock.com/AI Serie KARDIO/ANGIO
©
Susanne Huber
© KH der Elisabethinen, Linz
Das schwache Herz im Fokus
Aktuelle Leitlinienempfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie – erstmals auch für die Kardiomyopathie
Neue Erkenntnisse zur Therapie der Herzschwäche erwartete das Publikum auch im vergangenen Jahr beim „Herzinsuffizienz-Update“, veranstaltet vom Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz*. Fachärzt:innen präsentierten unter der Leitung von OA Dr. Christian Ebner die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet. Dabei lag der Fokus auf den 2023 überarbeiteten Leitlinien für Herzinsuffizienz sowie den erstmals veröffentlichten Richtlinien zur Kardiomyopathie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC).
Vom Off-Label-Gebrauch zum Leitlinienstandard
Bedeutende Publikationen wie die EMPEROR-PRESERVED- und die DELIVER-Studie haben die Wirksamkeit von Empagliflozin und Dapagliflozin bei Patient:innen mit Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter bzw. erhaltener linksventrikulärer Auswurffraktion (HFmrEF und HFpEF) nachgewiesen.1,2 Eine Metaanalyse dieser Studien, präsentiert am europäischen Kardiologiekongress in Barcelona 2022, zeigte eine 20%ige relative Risikoreduktion für kardiovaskulären Tod bzw. Hospitalisierungen durch Herzinsuffizienz bei Anwendung von Dapagliflozin bzw. Empagliflozin. In den aktualisierten ESC-Leitlinien gilt daher ab sofort die Therapie mit einem SGLT2-Hemmer als Klasse-I-Empfehlung bei HFmrEF oder HFpEF.3 SGLT2-Hemmer bieten nun – erstmals auch leitliniengetreu – eine vielversprechende Behandlungsoption für die HFpEF.
„Die Fantastischen Vier“ der HFrEF-Therapie
In der Therapie der Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Pumpfunktion (HFrEF) sind SGLT2-Hemmer bereits seit 2021 in den Leitlinien verankert. Sie stellen mit den ACE-
Hemmern/ARNI, den Betablockern und Mineralkortikoidantagonisten vier wirksame Substanzgruppen dar. Im Vergleich zu den Leitlinien aus dem Jahr 2016 werden diese vier Substanzgruppen nun als gleichwertig angesehen. Es gibt keine Vorgabe oder Präferenz, mit welchem der Präparate begonnen werden sollte. Dies ist individuell zu entscheiden, optimal wäre ein rascher Beginn mit allen vier Substanzen.4
Die STRONG-HFStudie betonte die Bedeutung einer schnellen Aufdosierung der oralen Herzinsuffizienztherapie nach Diagnosestellung. Diese Vorgehensweise zeigte nach 180 Tagen signifikante Vorteile in Bezug auf Gesamtmortalität und Rehospitalisierungen aufgrund von Herzinsuffizienz.5
Die Leitlinien aktualisieren daher 2023 die Empfehlung einer raschen Aufdosierung noch vor Krankenhausentlassung, die in sorgfältigen Nachuntersuchungen in den ersten sechs Wochen nach Entlassung durch niedergelassene Fachoder Hausärzt:innen weitergeführt werden soll. Dabei sollte v. a. auf Symptome der Herzinsuffizienz, Blutdruck, Herzfrequenz, Kaliumspiegel und Nierenfunktionspara-
meter geachtet werden.3 Eine Herausforderung besteht sicherlich darin, diesen Ansatz auch im extramuralen Bereich zu verfolgen.
Hausärzt:in medizinisch 7 März 2024
> Fachkurzinformation siehe Seite 50
Empfehlungen bei Eisenmangel
Als Komorbidität von Herzinsuffizienz wird im Update 2023 der Eisenmangel aufgegriffen. Die Behandlung von Eisenmangel bei symptomatischen Patient:innen mit HFrEF oder HFmrEF wird ebenfalls als Klasse-I-Empfehlung ausgesprochen, da diese zu einer Linderung von Herzinsuffizienzsymptomen und einer verbesserten Lebensqualität führt. Unter Eisenmangel verstehen die Leitlinien eine Transferrinsättigung unter 20 % oder ein Serumferritin unter 100 μg/L.6
„Eine frühzeitige und intensive Betreuung unterstützt das langfristige Wohlbefinden unserer Patient:innen maßgeblich. Genau das ist unser Ziel.“
Hinblick auf seine potenziellen Vorteile für Patient:innen mit HFpEF und Adipositas untersucht. Dabei zeigten sich vielversprechende Perspektiven: Die Patient:innen profitierten von verringerten HF-bezogenen Symptomen, einer größeren Belastungsbreite und einem stärkeren Gewichtsverlust im Vergleich zur Placebogruppe.9
Neue KardiomyopathieGuideline
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Präsentation der erstmals im Jahr 2023 erschienenen Kardiomyopathie-Leitlinien der ESC4. Eine wichtige Änderung stellt die Einteilung der Kardiomyopathien in nun fünf definierte Phänotypen dar. Zu den altbekannten hypertrophen, dilatativen, restriktiven und arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathien (ARVC) kommt die Nichtdilatative Linksventrikuläre Kardiomyopathie (NDLVC) als eigenständige Gruppe hinzu. Diese inkludiert Patient:innen mit nichtischämischer linksventrikulärer Narbenbildung oder Fettgewebsersatz ohne Dilatation des linken Ventrikels. Eine globale oder regionale systolische linksventrikuläre Dysfunktion kann, muss aber nicht damit einhergehen.
Patient:innen mit milder oder kontrollierter arterieller Hypertonie. Zudem geben sie mitunter Aufschluss über die Risikostratifizierung hinsichtlich eines plötzlichen Herztods, indem sie sogenannte „ Hochrisikogene“ identifizieren. Ebenso profitieren Angehörige mit einer positiven Familienanamnese potenziell von diesen Tests, wenn mögliche präventive Maßnahmen aufgrund der genetischen Veranlagung ergriffen werden können.4 Obwohl die genetische Testung meist kontrovers diskutiert wird, ermöglicht sie einen entscheidenden Schritt in Richtung personalisierter Medizin.
Fazit und Ausblick
Der stetige Wandel der Herzinsuffizienztherapie stellt das medizinische Personal vor große Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig vielfältige Optionen zur Verbesserung der Patient:innenbehandlung. Alle Interessierten, die heuer aus erster Hand informiert werden möchten, sind herzlich eingeladen, am 08. November 2024 im Park Inn Hotel in Linz an unserem jährlichen Herzinsuffizienz-Update teilzunehmen.
Literatur:
1 Anker SD et al., N Engl J Med 2021; 385(16):1451-1461.
Die „Abnehmspritze“ unter der Lupe
Bereits eine Framingham-Studie aus dem Jahr 2002 zeigte: Adipositas ist mit einem erhöhten Risiko einer Herzinsuffizienz vergesellschaftet.7 Insbesondere wird vermutet, dass ein stärkerer Bezug zur HFpEF besteht.4 Etwa 60 bis 80 % aller HFpEF-Patient:innen sind übergewichtig.8 In diesem Kontext zieht die neu zugelassene „ Abnehmspritze“ auch die Aufmerksamkeit der Spezialist:innen für Herzinsuffizienz auf sich. Der Wirkstoff Semaglutid, der zur Gruppe der Antidiabetika zählt, wurde in der STEP-HF-Studie vor allem im
In der Diagnostik rückt die kardiale Magnetresonanztomographie in den Vordergrund. Sie gilt ab sofort neben ausführlicher Anamnese, EKG, Echokardiographie und Labortest als Klasse -I-Empfehlung bei Verdacht auf eine Kardiomyopathie.
Kontrovers: genetische Tests
Auch die Frage „Wen sollte man genetisch testen?“ wird viel diskutiert. Eine umfassende Beratung der Patient:innen und ihrer Angehörigen vor einer geplanten Testung ist ausschlaggebend, um sie bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Genetische Tests können vor allem in der Diagnostik nützlich sein – beispielsweise im Falle eines hypertrophen Kardiomyopathie-Phänotyps bei
2 Solomon SD et al., N Engl J Med 2022; 387(12): 1089-1098.
3 McDonagh TA et al., Eur Heart J 2023; 44(37): 3627-3639.
4 Arbelo E et al., Eur Heart J 2023; 44(37):3503-3626.
5 Mebazaa A et al., Lancet 2022; 400(10367):1938-1952.
6 Graham FJ et al., Eur J Heart Fail 2023; 25(4):528-537.
7 Kenchaiah S et al., N Engl J Med 2002; 347(5):305-13.
8 Obokata M et al., Circulation 2017; 136(1):6-19.
9 Kosiborod MN et al., N Engl J Med 2023; 389(12): 1069-1084. Hier geht es zu den aktuellen Leitlinien:
Update der ESC-Guideline Herzinsuffizienz:
ESC-Guideline Kardiomyopathie:
NACHBERICHT
* Gastautorin Dr.in Christina Pöschl war Vortragende beim „Herzinsuffizienz-Update 2023“ am 3. November 2023, veranstaltet vom Ordensklinikum Linz Elisabethinen.
< Hausärzt:in medizinisch 8 März 2024
Wenn die Wunde nicht heilt
Häufig unterschätzt: Gefäßerkrankungen als Ursache


255.000 Österreicher:innen leiden unter chronischen Wunden, jährlich kommen 68.000 Personen hinzu. Die Behandlungskosten werden hierzulande auf 1,22,2 Milliarden Euro geschätzt. Rund 61 % der Betroffenen erhalten in Österreich keine regelgerechte Behandlung. Chronische Wunden sind nicht nur ein Problem, das weit verbreitet und kostenintensiv ist, sondern Patient:innen sind auch oftmals von Schmerzen geplagt und leiden unter psychischer Belastung.¹
Häufig gehen chronische Wunden mit einem langen und komplizierten Krankheitsverlauf einher und erfordern einen hohen Pflegeaufwand.
Ursächliche Therapie
Für die Therapie muss, wie bei anderen Gesundheitsproblemen auch, die Ursache ermittelt werden. Mehr als zwei Drittel aller chronischen Wunden sind auf Erkrankungen des arteriellen, venösen oder lymphatischen Gefäßsystems zurückzuführen. Häufig wird die Ursache jedoch nicht erkannt, was eine regelgerechte Behandlung unmöglich macht. Die Therapien der verschiedenen Erkrankungen weisen nämlich große Unterschiede auf. So erfolgt die Behandlung der pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) durch Re-
vaskularisierung, die des Ulcus cruris venosum durch Kompression und jene des diabetischen Fußsyndroms durch Druckentlastung. Diese Methoden basieren auf wissenschaftlicher Evidenz. Andere Methoden, etwa Kaltplasma, Wachstumsfaktoren, Hämoglobinspray oder Fischhaut, werden zwar oft zur Unterstützung der Heilung eingesetzt, jedoch konnte die Wirksamkeit hinsichtlich einer beschleunigten Wundheilung bei den meisten nicht nachgewiesen werden. Auch wenn die wissenschaftliche Datenbasis für die lokale Wundbehandlung unzureichend ist, ist eine Vielzahl der „modernen“ Wundprodukte
Hausärzt:in medizinisch 10 März 2024
© shutterstock.com/AI
KARDIO/ANGIO
Serie
wie Unterdruckverbände, Alginate, Wundgele, PU-Schaumverbände oder Wundgaze für die Lokaltherapie chronischer Wunden unentbehrlich. Wundauflagen schützen nicht nur vor äußeren Einflüssen und nehmen Wundsekret auf, sie unterstützen auch Wundheilungsprozesse, regulieren den Feuchtigkeitsspiegel, verringern Wundgeruch, binden pathogene Erreger und wirken antiinfektiös.
Ausreichende Evidenz ist hingegen für das Gehtraining zur Behandlung der pAVK gegeben, die mit weltweit 200 Millionen Betroffenen zu den am weitesten verbreiteten Angiopathien zählt. Jene schonende Methode ermöglicht neben einer leitlinienkonformen Therapie der Hypertonie und Dyslipidämie ein besseres Behandlungsergebnis. Für den medikamentösen Therapieerfolg ist nämlich die Lebensstilmodifikation mit Gehtraining, aber auch Nikotinentwöhnung entscheidend. Durch das Training können Patient:innen längere Gehstrecken schmerzfrei zurücklegen. Kommt es zu keiner Verbesserung der Mobilität, stehen invasive Verfahren wie die kathetergestützte Gefäßdehnung oder offen-chirurgische Methoden zur Verfügung.²
Verbesserungswürdige Versorgungsmöglichkeiten
Neben Dermatolog:innen und Chirurg:innen sind ausgebildete Wundmanager:innen für die Versorgung zuständig. Die Situation ist allerdings herausfordernd. Es mangelt an Wundambulanzen und kassenunterstützten Ordinationen mit Schwerpunkt Wundmanagement. Außerdem werden die Behandlungskosten oft nicht oder nur zu einem kleinen Teil von der Krankenkasse übernommen.¹ Die jährlichen Kosten liegen durchschnittlich in einem fünfstelligen Bereich pro Patient:in, wären jedoch bei rechtzeitiger Intervention und leitlinienkonformer, koordinierter Versorgung größtenteils vermeidbar.² Optimal wäre es, wenn durch Präventionsstrategien, Gesundheitsförderung und Stärkung der Gesundheitskompetenz Wunden verhindert würden und eine Behandlung gar nicht vonnöten wäre.³
Initiative für optimale Versorgung der Patient:innen
Die Initiative „Wund?Gesund!“ ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die bestmögliche Versorgung der Patient:innen mit geeigneten Medizinprodukten. Patient:innen sind aufgrund von fehlendem Wissen über Therapiemöglichkeiten oftmals überfordert, es mangelt an qualitätsgeprüften Informationen im Internet, an Kompetenzzentren sowie an Personen, die sich auf Wundmanagement spezialisiert haben und im häuslichen Umfeld Patient:innen versorgen können. Jene Initiative erkennt die Probleme und will diesen beikommen. Die Sprecher:innen von Wund?Gesund!, Mag.a Martina Laschet und Mag. Philipp Lindinger, betonen, dass Patient:innenpartizipation ein Schlüsselfaktor sei. Um Patient:innen- sowie Angehörigenbeteiligung zu fördern und Projekte umzusetzen, gründeten beispielsweise die Österreichische Plattform Patient:innensicherheit und das Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety einen Patient:innenbeirat.³
Fazit
Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2 oder Adipositas begünstigen die Entstehung chronischer Wunden. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung immer älter wird und insbesondere Personen höheren Alters zu den Betroffenen zählen. Initiativen wie die vorgestellten wollen den steigenden Zahlen von Patient:innen mit chronischen Wunden bei gleichzeitigem Mangel an Kompetenzzentren entgegenwirken. Denn die Aufklärung und optimale Versorgung der Patient:innen ist in Österreich noch ausbaufähig und bedarf daher weiterhin großer Aufmerksamkeit.
Mara Sophie Anmasser
Quellen & weiterführende Informationen: 1 selbsthilfe-wunde.at , gefaessforum.at 2 gefaesschirurgie.de 3 wund-gesund.at
Hausärzt:in medizinisch 11 März 2024
Hausärzt:in
Inteferenztests bei Blutzuckermesssystemen
Warum es wichtig ist, ein breites Spektrum von Substanzen auf Interferenzen zu testen
Die Ergebnisse der Blutzuckerselbstmessung (SMBG) werden häufig verwendet, um die Blutzuckerkontrolle von Menschen mit Diabetes zu beurteilen und bei Therapieentscheidungen, z. B. hinsichtlich der Dosierung von Insulin, zu unterstützen. Allerdings können einige Medikamente, die Patient:innen aufgrund von Begleiterkrankungen verschrieben werden, die Blutzuckermessungen beeinflussen. Abweichungen bei den Blutzuckermessungen können zu nicht erfassten oder falschen Hypo- oder Hyperglykämie-Ereignissen führen und wichtige Entscheidungen zur Diabetestherapie verfälschen.1
Die Blutzuckermesssysteme Accu-Chek® Guide und Accu-Chek® Instant wurden auf über 200 Substanzen1 getestet und übertreffen damit die internationalen Testanforderungen.
Weltweit anerkannte Organisationen für Leistungsrichtlinien, wie das Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), die Food and Drug Administration (FDA) und die Internationale Organisation für Normung (ISO), verlangen von den Herstellern von Blutzuckermessgeräten,

die Auswirkungen von 24 verschiedenen potenziell störenden Substanzen zu testen. Studien zeigen jedoch, dass angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Therapien und neuen Medikamentenklassen, die Prüfung anhand von Leistungsrichtlinien alleine möglicherweise keine ausreichende Gewähr für die Patient:innensicherheit darstellt.1,2
Alle Richtlinien nennen zu prüfende Stoffe, aber erwarten auch von den Herstellern, dass sie eine kontinuierliche eigene Risikoanalyse durchführen, um mögliche potenzielle andere Störfaktoren und/oder neue Störfaktoren zu identifizieren, und fortlaufend Tests mit neuen Substanzen vornehmen. Roche z. B. testet eine Liste von über 200 Substanzen für ihre SMBGSysteme Accu-Chek ® Guide und AccuChek® Instant – einschließlich Interferenzen, die aus Hinweisen aus der Literatur oder von Kunden stammen, und neuen Substanzen, wie SGLT2-Hemmern.
Am Ball bleiben
Störende Substanzen können eine bedeutende Fehlerquelle für Messungen sein und so eine Gefahr für Patient:innen darstellen. Bei Roche Diabetes Care bedeutet unser Engagement für die Blutzuckermessung,
umfangreiche Tests gegen potenziell störende Substanzen durchzuführen, um das Risiko einer Beeinträchtigung der Genauigkeit der Ergebnisse zu reduzieren.1 Wir erweitern stetig unsere Interferenztestungen, um auch neue und aufkommende Therapien – einschließlich Natrium-Glukose-Transportprotein-2(SGLT2)-Inhibitoren, die bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes zur Anwendung kommen – auf Störungen zu testen.1,2 Zu den getesteten Medikamenten gehören unter anderem:1
• SGLT2-Hemmer & andere orale Antidiabetika,
• Psychopharmaka,
• Antihypertensiva,
• Wirkstoffe gegen Fettstoffwechselstörungen,
• Antiarrhythmika.
Erfolgreiche Therapie ermöglichen
Die umfangreichen Interferenztests der Systeme Accu-Chek ® Guide und AccuChek® Instant schließen eine Verfälschung der Ergebnisse durch 99 % der über 200 getesteten Substanzen aus und ermöglichen Ihren Patient:innen eine verlässliche Messung ihres Blutzuckers. Diese ist die Grundlage einer erfolgreichen DiabetesTherapie.1,2,*

JETZT KOSTENLOS BLUTZUCKERMESSGERÄTE FÜR IHRE PRAXIS BESTELLEN!
www.accu-chek.at/accu-chek-bestellformular
Substanzen mit Störpotenzial: Ascorbinsäure: Genauigkeitsgrenzwert > 5 mg/dL; Xylose: Genauigkeitsgrenzwert > 10 mg/dL.
Referenzen:
Hauss O, Hinzmann R, Huffman B, Drug interference in self-monitoring of blood glucose and the impact on patient safety: we can only guard against what we are looking for. J Diabetes Sci Technol. 2022; 0(0).
doi:10.1177/19322968221140420.
Mills K, Roetschke J, Patients with SGLT2 inhibitor therapy can reliably measure their blood glucose without interference issues when up-to-date potentiometric and amperometric blood glucose measurement systems are used. J Diabetes Sci Technol. 2022;16:261-263.
ACCU-CHEK , ACCU-CHEK GUIDE und ACCU-CHEK INSTANT sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2023 Roche Diabetes Care accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | Engelhorngasse 3 | 1210 Wien
BEZAHLTE ANZEIGE
informativ
© privat
Der Schlaganfall und seine Komplikationen
Die Schlüsselrolle der Hausärzt:innen als Casemanager:innen

EXPERTE:
Univ.-Prof. Dr. Gottfried Kranz Ärztlicher Direktor im Neurologischen Rehabilitationszentrum „Rosenhügel“
Das Schicksal Schlaganfall ereilt jedes Jahr etwa 20.000 bis 25.000 Menschen in Österreich. „ Apoplexie ist damit eine der häufigsten Ursachen für eine permanente Behinderung im Erwachsenenalter – und hat einen großen epidemiologischen Impact auf die Bevölkerung“, hebt Univ.Prof. Dr. Gottfried Kranz, Ärztlicher Direktor im Neurologischen Rehabilitationszentrum „Rosenhügel“, hervor.
In der Akutbehandlung habe es – ebenso wie in der Sekundärprophylaxe – in den letzten Jahren zukunftsweisende Entwicklungen gegeben, beispielsweise innovative Medikamente betreffend.
Die heimische Schlaganfall-Akutversorgung sei im internationalen Vergleich bereits auf einem hohen Niveau. Trotzdem habe der Grundsatz „Time is Brain – Anruf 144!“ nicht an Relevanz verloren.
Von der Akut- bis zur chronischen Versorgung
„Das Outcome nach Schlaganfall hängt auch davon ab, wie gut und schnell die Allge meinheit reagiert, denn nicht immer ist sofort eine Ärzt:in vor Ort“, gibt der Experte zu bedenken. Sehr hilfreich sei der FAST-Test (siehe Abb.). „ H ausärzt:innen nehmen eine Schlüsselrolle bei der Wissensver mittlung rund um das The ma Schlaganfall ein“, so Prof. Kranz. „Und es kommt ihnen eine essenzielle Bedeutung bei der chro-
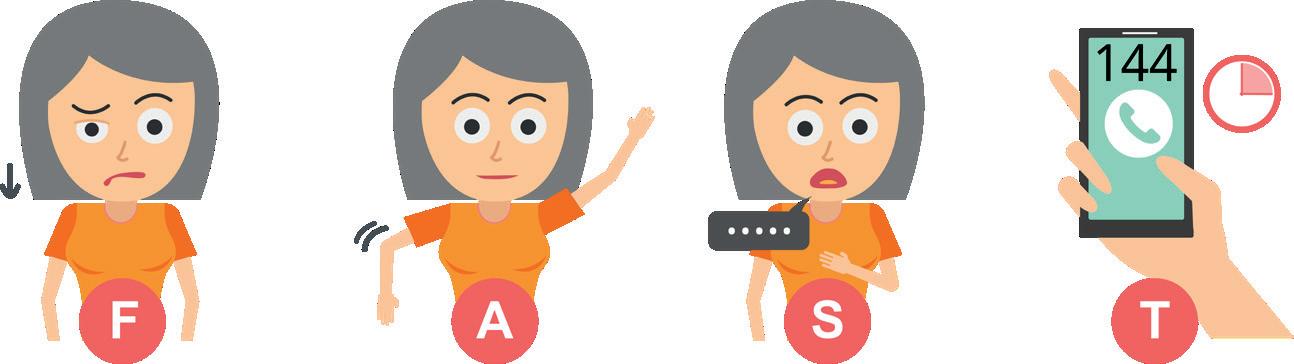
Entsteht beim Versuch zu lächeln eine Grimasse?
Können beide Arme angehoben werden, ohne dass ein Arm wieder nach unten fällt?
Ist die Sprache beeinträchtigt, kann ein Satz nicht richtig gesprochen werden?
Hat eine Person bei einer dieser Aufgabe Probleme, zählt jede Minute, Anruf 144!
nischen Versorgung Betroffener nach der Spitalsentlassung zu “ Ein besonderes Augenmerk sei dabei etwa auf mögliche Komplikationen nach der Akutbehandlung zu legen, wie die Prä-
VORSCHAU Hausärzt:in 4/2024: „Spastizität nach Schlaganfall ist häufig – worauf Hausärzt:innen achten sollten“
vention eines sekundären Schlaganfalls, ADL/Mobilitätsprobleme, Spastizität, Schmerzen, Inkontinenz, Depression/ Stimmungsschwankungen und/oder kognitive Probleme.
Auf Entwicklung
einer Spastizität achten
















Noch zu wenig im allgemeinen Bewusstsein verankert ist: Bis zu 43 Prozent der Patient:innen entwickeln infolge des Schlaganfalls innerhalb von Wochen bis Monaten nach dem Akutereignis eine Spastizität. Bei fast 50 Prozent davon wird die Diagnose von Allgemeinmediziner:innen gestellt.1 Die frühzeitige Identifizierung und Behandlung kann nicht nur etwaige Komplikationen reduzieren, sondern auch Alltagsfunktionen verbessern und die Unabhängigkeit der Betroffenen fördern.2 Auch hierbei komme den Kolleg:innen in den Allgemeinpraxen eine Schlüsselrolle zu, resümiert Prof. Kranz.




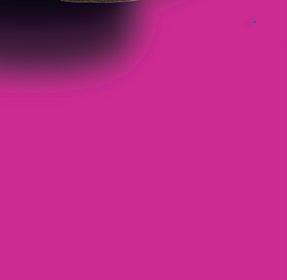
KaM © shutterstock.com/Tuaklom
1 Rakers F et al., Dtsch Arztebl Int 2023;120: 284-5. 2 Wissel J et al., Neurology 2013; 80:S23-S19. Hausärzt:in medizinisch 13 März 2024
Literatur:
Ist Kranksein auch künftig leistbar?
Ein Expert:innengespräch zum Thema Zwei-Klassen-Medizin
Wirkt die Gesundheitsreform dem Ärztemangel entgegen und bringt sie Verbesserungen in der medizinischen Versorgung? Oder steuern wir weiter auf eine Zwei-Klassen-Medizin zu? Diesem brisanten Thema widmete sich eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionsrunde am 27. Februar, veranstaltet von den RegionalMedien Austria gemeinsam mit der Hausärzt:in (siehe TIPP, Seite 16). Mit dabei waren: Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch, ÖGK-Obmann Andreas Huss, Ärztekammerfunktionärin und Hausärztin Dr.in Naghme KamaleyanSchmied sowie Gesundheitsökonom Dr. Ernest Pichlbauer.
Die aktuelle Gesundheitsreform hat ja zum Ziel, das in seinen Ansätzen gute, aber in den vergangenen Jahren stark ausgehungerte österreichische Gesundheitssystem wieder „aufzupeppeln“ und somit fit für die Zukunft zu machen. Die teils sehr hitzige Diskussion konzentrierte sich auf aktuelle Herausforderungen wie die langen Wartezeiten für Termine in Kassenordinationen, den veralteten Leistungskatalog, die Spitalslastigkeit des Systems u. Ä. m.
„Das ist die größte Gesundheitsreform der letzten dreißig Jahre, und sie wird Dinge in Bewegung bringen.“
BM Johannes Rauch
Spitäler bevorzugt …
Auch wenn die Anzahl der Ärzt:innen pro Kopf in Österreich im europäischen Vergleich gut sei, könne die Mangelsituation bei Mediziner:innen mit Kassenvertrag mittlerweile nicht mehr weggeredet werden, hob BM Rauch sinngemäß hervor. „Wir haben deshalb versucht, – gegen alle Widerstände –eine Gesundheitsreform zustande zu

bringen, die die Situation verbessert. Das dauert. Pro Jahr kommt jetzt etwa 1 Milliarde Euro mehr ins System: unter bestimmten Voraussetzungen. Und es bekommen auch die Kassen mehr Geld – 300 Millionen Euro pro Jahr –, um mehr Leistungen anbieten zu können “ Zu einer Entlastung des Systems sollen zudem der Grundsatz „ Digital vor ambulant vor stationär“ sowie der Ausbau der Vorsorge beitragen. „ Die Gesetze sind beschlossen, die Rahmenbedingungen geschaffen, das Geld ist da. In den nächsten Monaten geht es ums Verhandeln des Zielsteuerungsvertrags und ums Umsetzen“, so der Minister weiter. Leider nicht zu stemmen gewesen sei eine Finanzierung des Spitals- und des niedergelassenen Sektors aus einer Hand. Dafür bräuchte es eine Verfassungsreform.
„Wenn man sieht, wie viel Geld in den niedergelassenen Bereich investiert wurde – und wie viel im Vergleich in den Spitalsbereich, ist das ein sehr großes Ungleichgewicht. Da müsste man nachbessern“, fand Dr.in KamaleyanSchmied klare Worte. Die Standesvertreterin weiß, wie schwierig es aktuell ist, Mediziner:innen für das Kassensystem zu begeistern. Trotz Terminmanagements seien daher in den bestehenden Ordinationen hohe Frequenzen und lange Wartezeiten an der Tages-
„Primärversorgung ist nicht an ein Zentrum gebunden, sondern an die Ärzt:in.“
Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied
14 März 2024 Hausärzt:in politisch
© firefly.adobe.com/AI
„Diese Reform ist keine Reform – es ändert sich an den Strukturen nichts.“
Dr. Ernest Pichlbauer
ordnung. Die Ärztekammer habe sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man dem entgegenwirken könne. Der Merksatz laute: „ Auf geht‘s in eine gute Gesundheitsversorgung!“: Neben der Attraktierung des Arztberufes brauche es endlich eine Flexibilisierung, welche moderne Arbeitsmodelle, Telemedizin und interdisziplinäre Praxen fördert, sowie eine Verankerung von Spitalsauslagerungen. „L etzteren muss aber jedenfalls Geld folgen, sonst kann es sich nicht ausgehen, dass wir im niedergelassenen Bereich viele Spitalsleistungen übernehmen können!“, stellte die Allgemeinmedizinerin klar. Auch müsse endlich der Leistungskatalog modernisiert werden.
Apropos Hausarztzentrierung
Obmann Huss bestätigte die Nachbesetzungsprobleme. Er betonte aber, dass nur bestimmte Regionen Österreichs betroffen seien. In Wien – Döbling etwa fänden sich sofort sieben bis zehn Bewerber:innen. Im Waldviertel oder Südburgenland sei es schwierig. Mit Einführung der e-card sei den Menschen der Zugang zu den Fachärzt:innen erleichtert worden, gab der Kammerfunktionär zu bedenken. 25 Prozent der Menschen in Österreich hätten heute keine Hausärzt:in mehr. „ Das ist nicht gut für das Gesundheitssystem und schon gar nicht für die Menschen, die von einer Fachärzt:in zur nächsten pilgern “ In einem hausarztzentrierten Gesundheitssystem würden automatisch die kassenfachärztlichen Ordinationen und die Spitalsambulanzen entlastet. In entlegenen Regionen könnten das Einzelpraxen sein. In Ballungszentren seien Primärversorgungszentren effizienter. In diesen würden Mediziner:innen durch Vertreter:innen
anderer Gesundheitsberufe entlastet. Die Patient:innenbegleitung durch das System könnte idealerweise durch die Gesundheitshotline 1450 digital unterstützt werden. „ A n einem österreichweit einheitlichen Honorar- und Leistungskatalog arbeiten wir momentan mit der Ärztekammer“, so Huss weiter. Hierfür werde es in den kommenden Jahren jedenfalls zusätzliche finanzielle Mittel brauchen.
Mehr als Sprechblasen?
„Die Reform – ich glaube das weiß jeder – ist keine Reform“, gab sich Dr. Pichlbauer wenig optimistisch. „ Es ändert sich an den Strukturen nichts. Zusätzliche Geldflüsse, die Stärkung des Hausarztsystems, all das höre ich seit 20 Jahren. Das erste Konzept einer hausarztzentrierten Primärversorgung habe ich 2002 für die niederösterreichische Ärztekammer erarbeitet. Es wurde von allen Seiten abgeblockt.“ Für den Gesundheitsökonomen ist aus dem Reformpapier auch nicht ersichtlich, dass >
Hausärzt:in politisch 15 März 2024
Hausärzt:in

die Patient:innenströme besser gelenkt werden. „1450, in allen Ehren, ist für die Akutversorgung. Man muss proaktiv anrufen. Wir haben ein großes Problem mit der Versorgung chronisch kranker Menschen“, stellte er klar. „ Auch über diesen einheitlichen Leistungskatalog diskutieren wir schon seit 20 Jahren .. “
BM Rauch entgegnete: „ Das sind keine leeren Papiere oder Sprechblasen, die da verabschiedet wurden.“ Durch konkrete Gesetze und Rahmenbedingungen sei vielmehr eine Verbindlichkeit hergestellt worden, die es zuvor nicht gegeben habe. „Ich würde Sie bitten, die Dinge so zu lesen, wie sie sind. Das ist die größte Gesundheitsreform der letzten dreißig Jahre, und sie wird Dinge in Bewegung bringen. Die Primärversorgungszentren z. B. ermöglichen uns eine völlig neue Qualität der Versorgung. Das ist moderne Gesundheitspolitik.“
Gesundheitsdienstleistungen auch für Einzelpraxen
Dr.in Kamaleyan-Schmied war wichtig festzuhalten, dass Primärversorgung nicht an ein Zentrum gebunden sei, sondern an die Ärzt:in. „Um zum Thema Zwei-Klassen-Medizin zurückzukommen: Von 120 PVE könnte jede in voller Ausstattung 10.000 Patient:innen versorgen, insgesamt 1,2 Millionen Menschen. Was ist mit den anderen 8 Millionen? Sollen die schlechter ver-
sorgt werden?“, fragte sie. „Warum kann nicht jede einzelne Kassenärzt:in Zugriff auf Gesundheitsdienstleister haben – Sozialarbeiter:innen, dipl. Wundmanager:innen … Das wäre flächendeckend relativ leicht umzusetzen. Die Gründung einer PVE ist doch relativ umständlich “ Mit der Ermöglichung solcher „ PVE light“ käme allen Bürger:innen das gleiche Angebot zugute: „Vor allem chronisch Kranke brauchen eine wohnortnahe Ärzt:in, in deren Ordination sie etwa mit dem Rollator kommen und dort an einem Ort die bestmögliche Behandlung erhalten.“
Viele leisten sich eine Zusatzversicherung
Sowohl Minister Rauch als auch Obmann Huss meinten, dass sie nichts gegen noch flexiblere Praxismodelle hätten. Huss betonte jedoch, dass ihm garantierte Öffnungszeiten wie die der PVE wichtig seien. Und er verwies auf die neu eröffneten Diabeteszentren für Menschen mit der chronischen Stoffwechselerkrankung. Auch der Kammerfunktionär hielt Dr. Pichlbauers Kritik entgegen, dass es einfach sei, aus dem Wohnzimmer heraus zu erklären, was hilfreich und gut wäre, wenn es dann aufgrund unterschiedlicher Interessen nicht umsetzbar sei: „Ich habe aufgehört, über bundesstaatliche Fragen zu diskutieren“, so der ÖGK-Obmann.
„In einem hausarztzentrierten Gesundheitssystem werden Facharztpraxen automatisch entlastet.“
Obmann Andreas Huss
„Ich orientiere mich an den Möglichkeiten, die gegeben sind “ Dass man in den nächsten Jahren weiter über die Finanzierung reden müsse, sei keine Frage. Aber er habe schon mit verschiedenen Minister:innen zusammengearbeitet – so viel wie jetzt sei noch nie weitergegangen.
Deutlich pessimistischer blieb der Gesundheitsökonom. Die private Medizin werde, wegen der Systemfehler, die seit Jahrzehnten nicht behoben wurden, in Zukunft massiv weiterwachsen, meinte er abschließend. „ M ittlerweile leisten sich 30 Prozent der Bevölkerung eine Zusatzversicherung. Daran sieht man, wie gering das Vertrauen ins öffentliche System ist “
Ein trauriges Schlusswort, eine insgesamt sehr spannende Diskussion.
MJB/KaM
TIPP

Runde der Regionen –die Livediskussion zum Nachhören: gesund.at/eventberichte oder meinbezirk.at/tag/runde-der-regionen
16 März 2024
© Roland
Ferrigato
Die Teilnehmenden (v. li. n. re.): Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Ärztekammer für Wien, Dr. Ernest Pichlbauer, Gesundheitsökonom, Mag.a Karin Martin, Chefredakteurin der Hausärzt:in, Mag.a Maria Jelenko-Benedikt, Chefredakteurin der RegionalMedien Austria, Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch und Andreas Huss, ÖGK-Obmann.
politisch
Praxiswissen: Update Endoprothetik
Kinematisches Alignment in der Knieendoprothetik –zurück zur ursprünglichen Anatomie


DFP-Punktesammler

Schnellzugriff zum Literaturstudium: Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zur Fortbildung auf gesund.at
Bei fortgeschrittener Arthrose stellt die endoprothetische Versorgung des Kniegelenkes nach Ausschöpfung der konservativen Maßnahmen den Goldstandard dar. Nichtsdestotrotz ist die Zufriedenheit der Patient:innen nicht so hoch wie nach dem endoprothetischen Ersatz des Hüftgelenkes. Dies liegt unter anderem an dem komplexen Bewegungsmuster des Knies. Aufgrund dessen wurden in den vergangenen Jahrzehnten neue Operationstechniken entwickelt. Sie zielen darauf ab, die physiologischen Achsen des Kniegelenkes
wiederherzustellen, um so ein optimales Bewegungsmuster des Gelenkes nach der Operation zu erreichen.
Eine Technik, die in den letzten Jahren wegen ihrer guten Ergebnisse an Bedeutung gewonnen hat, ist das kinematische Alignment. Es wurde 2006 erstmals vorgestellt und durchgeführt. Bei der präoperativen Planung werden die jeweilige präarthrotische Gelenklinie und die Beinachse des Kniegelenkes berücksichtigt und im Rahmen der Operation rekonstruiert.
Anatomie und Kinematik des Kniegelenkes
Das Kniegelenk ist das nach Fläche größte Gelenk des Menschen und wird durch die Artikulation des Femurs mit der Tibia und der Patella gebildet. Biomechanisch gesehen, handelt es sich um ein Drehscharniergelenk (Trochoginglymus) mit fünf Freiheitsgraden. Interessant sind die kinematischen Eigenschaften des Kniegelenkes (Kinematik = Bewegungslehre). Die Bewegung im
Hausärzt:in DFP 17 März 2024
© shutterstock.com/KI
© Klinikum Wels-Grieskirchen
GASTAUTOR: Prim. Prof. Dr. Björn Rath Abteilung für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Klinikum Wels-Grieskirchen
>
Bereich des medialen Kompartiments erfolgt anhand eines „ball in socket“Mechanismus. Das bedeutet, dass hier eine Kongruenz zwischen dem Femur (konvex) und der Tibia (konkav) besteht, was eine Stabilität während des gesamten Bewegungsablaufes mit sich bringt (Abbildung 1). Auf der lateralen Seite zeigt sich ein konvexes distales Femur, das mit einem konvexen Tibiaplateau artikuliert, sodass es bei der Beugung des Kniegelenkes zu einem Nachhinten-Gleiten (Translation/„roll back“) des Femurs kommt. Diese unterschiedlichen Mechanismen auf der Innen- und Außenseite ermöglichen das große Bewegungsausmaß des Kniegelenkes bei zugleich vorhandener Stabilität.

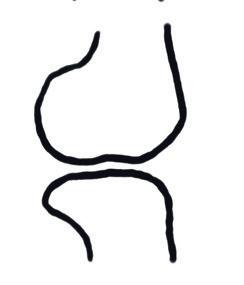
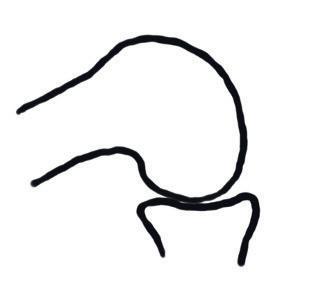
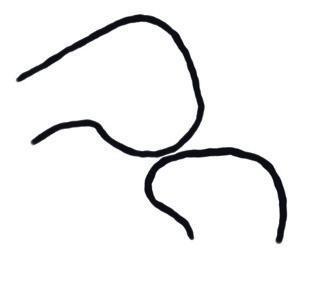
Abbildung 1: Die Bewegungsmechanismen auf der Innen- und Außenseite des Kniegelenkes unterscheiden sich („ball in socket“ vs. Translation/„roll back“ des Femurs bei der Beugung).
Die Rotationsachsen
Der Bewegungsablauf des Kniegelenkes erfolgt um drei Rotationsachsen, die alle ihr Zentrum im Bereich des Femurs haben (Abbildung 2):
• longitudinale Achse (Drehpunkt im medialen Bereich des Kniegelenkes)
• 1. transversale Achse (Flexion/ Extension der Tibia um das Femur)
• 2. transversale Achse (Flexion/ Extension der Patella um das Femur)
Die longitudinale Achse ist der Rotationspunkt im medialen Kompartiment des Kniegelenkes zwischen dem Femur und der Tibia. Die beiden transversalen Achsen stellen die Rotation der Tibia und der Patella um das Femur bei der Extension/Flexion dar.
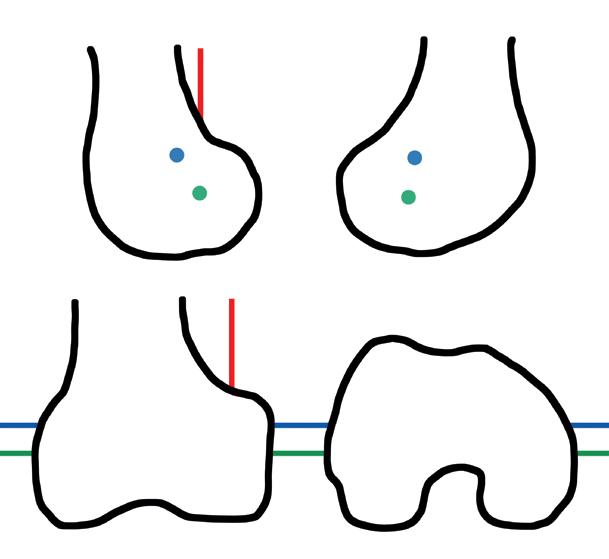
Abbildung 2: Der Bewegungsablauf des Kniegelenkes erfolgt um drei Rotationsachsen.
Ausrichtungstechniken im Wandel
Des Weiteren ist die Bandstabilität während der Streckung und während der Beugung des Kniegelenkes im medialen und lateralen Kompartiment unterschiedlich. Bei der Streckung zeigt sich medial und lateral eine straffe Bandsituation, wohingegen in der Beugung eine straffe Bandsituation medial und eine laxe Bandsituation lateral vorliegt. Dies ist von enormer Bedeutung für Bewegungsumfang und -muster, da hierdurch u. a. ein Hinknien bzw. Sitzen auf den Unterschenkeln erst ermöglicht wird.
Der Goldstandard in der Knietotalendoprothesen(KTEP)-Operation war in den letzten Jahrzehnten das mechanische Alignment. Hierbei wird eine radiologisch gerade Beinachse angestrebt. Dem zu Grunde liegt der Gedanke, dass es bei einer geraden Beinachse zu einer ausgeglichenen Belastung der implantierten Knieprothese kommt und somit frühzeitige Lockerungen reduziert werden. Jedoch ließ sich in den letzten Jahren in mehreren Studien nachweisen, dass ein größerer Anteil der Bevölkerung keine gerade Beinachse hat – an-
hand dieser Erkenntnis wurden neue Ausrichtungstechniken entwickelt und in den Fokus gerückt.
Ziel dieser Techniken ist es, jene ursprüngliche Ausrichtung und Anatomie des Kniegelenkes wiederherzustellen, die bei der Patient:in vor der arthrotischen Veränderung vorlag. Dementsprechend erfolgt eine patient:innenspezifische Versorgung. Unter diesen Gegebenheiten ist auch die im vorherigen Abschnitt skizzierte Anatomie und Kinematik des Kniegelenkes rekonstruiert, was einen möglichst physiologischen Bewegungsablauf zuwege bringt.
Das kinematische Alignment
Jene Ausrichtungstechnik, mit der das spezifische präarthrotische Alignment der Patient:innen angestrebt wird, ist das kinematische Alignment. Die drei Rotationsachsen des Kniegelenkes sollen entsprechend wiederhergestellt werden, um den natürlichen Bewegungsablauf des Kniegelenkes zurückzuerlangen. Demgemäß wurde eine Operationstechnik in den 2000er Jahren eingeführt und kontinuierlich weiterentwickelt.
Patient:innenindividuelle Vorgehensweise Wie erfolgt nun die Rekonstruktion des ursprünglichen Kniegelenkes? Hierzu werden MRT-Bilder von Kniegelenken ausgewertet und die Gelenkknorpeldicke im Bereich des Femurs und der Tibia ermittelt. Bei einer Varusgonarthrose ist der Knorpelbelag des medialen Kompartimentes aufgebraucht. Bei einer Valgusgonarthrose handelt es sich um einen Knorpelverlust des lateralen Kompartimentes. Die chirurgische Vorgehensweise beim kinematischen Alignment berücksichtigt den Knorpelverlust. Die Ausrichtung der entsprechenden Sägeschnitte im Bereich des Femurs und der Tibia erfolgt durch die Berechnung der Prothesen- und Knorpeldicke. Das bedeutet, dass auf der destruierten Seite 2-3 mm weniger Knochen reseziert wird, um den bestehenden Knorpelverlust auszugleichen. Durch die Anwendung dieses Prinzips wird in allen Kompartimenten die ursprüngliche Gelenklinie
Hausärzt:in DFP 18 März 2024
© Prof. Rath
und Ausrichtung der Rotationsachsen wiedererlangt. Hierfür wurde ein spezielles Instrumentarium entwickelt, das die präzise Einstellung ermöglicht. Somit erfolgt bei der kinematischen Technik immer eine patient:innenindividuelle Versorgung bzw. KTEP-Implantation. Während beim mechanischen Alignment nach der Knochenresektion ein Weichteilrelease durchgeführt wird (u. a. Abschieben der Kapsel, teilweise Ablösung der Kollateralbänder an ihrem Ansatz/Ursprung), um eine ausgeglichene Bandspannung zu bewirken, ist dies beim kinematischen Alignment nicht der Fall. Die Rekonstruktion der präarthrotischen Anatomie wird über die patient:innenindividuellen Sägeschnitte erreicht. Man spricht daher auch von der „t rue-measured resection“ Die Varus- oder Valgusstellung des Kniegelenkes bzw. der Beinachse entspricht der ursprünglichen Beinachse der Patient:innen und wird bewusst wiederhergestellt und nicht verändert. Man geht davon aus, dass durch die Rekonstruktion der präarthrotischen Situation auch die Kinematik des Kniegelenkes wiederhergestellt und dadurch ein optimaler Bewegungsablauf ermöglicht wird.
Optionale Sicherheitszonen
Häufig diskutiert wird die Frage, ob die Wiederherstellung der ursprünglichen Anatomie „i mmer“ forciert werden sollte. Dies gilt nur, wenn vor der Operation keine Fehlstellung bestand – z. B. aufgrund eines Knochendefektes, einer vorherigen Operation etc. Zudem sollte keine Bandinstabilität vorliegen. In diesen Fällen kann u. a. das restriktive kinematische Alignment angewendet werden, das die ursprüngliche Ausrichtung des Kniegelenkes unter der Einhaltung von Sicherheitszonen wiederherstellt.
Klinisches Outcome
In bisherigen Studien zeigte sich bei den Patient:innen eine schnelle Rehabilitationsphase mit einem zügigen Übergang zu Aktivitäten des alltäglichen Lebens und sportlicher Betätigung. Außerdem wurde festgestellt, dass die Patient:innen einen großen Bewegungsumfang bei gleichzeitig sehr stabiler Gelenksituation haben. In aktuellen Studien (Review,
© Prof. Rath

Abbildung 3: Röntgenbilder nach KTEPImplantation (kinematisches Alignment). Links: Aufnahme des Kniegelenkes. Rechts: Ganzbeinstandaufnahme desselben Kniegelenkes.
Metaanalysen) ließen sich auch nach über 15 Jahren sehr gute klinische Ergebnisse des kinematischen Alignments dokumentieren, was zusätzlich für den Erfolg dieser Technik spricht.
Postoperatives Röntgenbild
Wichtig ist bei dieser Operationstechnik, auch die niedergelassenen Kolleg:innen in den Behandlungsvorgang einzubeziehen. Sie sollten mit dem Prinzip und der Vorgehensweise vertraut sein. Allein die Beurteilung des postoperativen Röntgenbildes kann ansonsten teilweise für Verwirrung sorgen, da die Gelenklinie hier nicht horizontal erscheint und eine nicht optimale Prothesenorientierung
angenommen werden könnte. Diese Darstellung in kurzen (nicht das ganze Bein betreffenden) Röntgenbildern ist allerdings korrekt. Interessanterweise spiegelt sich die Rationale der Implantationstechnik in der Ganzbeinstandaufnahme wider. Hier zeigt sich die Tibiakomponente und somit auch die Gelenklinie orthograd zum Boden (Abbildung 3).
In Ganganalysen ließ sich zudem nachweisen, dass die Tibiakomponente beim kinematischen Alignment geringeren Kräften ausgesetzt ist und ergo auch keine früheren Lockerungsereignisse zu erwarten sind.
Zusammenfassung und Ausblick
Die Technik des kinematischen Alignments bei der KTEP-Implantation stellt ein Verfahren dar, bei der die patient:innenspezifische, präarthrotische Anatomie wiederhergestellt wird. Hierzu wird während der Operation der vorhandene Knorpeldefekt ausgeglichen und die Gelenklinie und Beinachse der Patient:in wieder in ihre ursprüngliche (physiologische) Situation gebracht. Auch wenn sich in klinischen Studien nach 10 und 15 Jahren bereits sehr gute Ergebnisse dieser Technik zeigten, sind weitere langfristige Ergebnisse abzuwarten, um die bisherigen guten Resultate weiter zu verifizieren.
<
Literatur beim Verfasser.
DFP-Pflichtinformation
Fortbildungsanbieter: Klinikum Wels-Grieskirchen
Lecture Board:
Dr.in Johanna Holzhaider
2. Vizepräsidentin der OBGAM; Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich
Dr.in Astrid Pinsger-Plank, MSc FÄ für Orthopädie und Traumatologie, Schmerzkompetenzzentrum, Bad Vöslau/Niederösterreich
Hausärzt:in DFP 19 März 2024
Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze
Das kinematische Alignment stellt eine Ausrichtungs- bzw. Operationstechnik bei der KTEP-Implantation dar, die als Zielsetzung die Wiederherstellung der ursprünglichen physiologischen Anatomie des Kniegelenkes hat.
Das Kniegelenk hat medial einen „ b all in socke t “ - Mechanismus und führt eine Translation auf der lateralen Seite durch.
Die drei Rotationsachsen (1 x longitudinal, 2 x transversal) definieren den Bewegungsablauf des Kniegelenkes und werden bei dem kinematischen Alignment rekonstruiert.
DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN
Während der Operation erfolgt die Ausrichtung durch die Rekonstruktion des Knorpeldefektes mittels eines speziellen Instrumentariums.
Das sehr gute klinische Outcome bei den Patien:innen nach dieser Operation zeigt sich in der aktuellen Literatur. Mit den niedergelassenen Kolleg:innen sollte das kinematische Alignment besprochen werden.
Die postoperativen Röntgenbilder müssen gemäß der angewendeten Operationstechnik interpretiert werden.

So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet. Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf gesund.at und meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung. Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.
Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als ScanDokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. September 2024.
Unsere aktuellen Fortbildungen finden Sie unter gesund.at (DFP Fortbildungen).
DFP-Fragen zu „Praxiswissen: Update Endoprothetik“
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.
Welche Zielsetzung hat das kinematische Alignment? (1 richtige Antwort)
Erreichen einer geraden Beinachse.
Rekonstruktion der ursprünglichen (präarthrotischen) Gelenklinie/Beinachse.
Schaffung eines „ ball in socke t “ - Mechanismus im lateralen Kompartiment.
Wiederherstellung der drei transversalen Achsen.
Welche Angaben zur Anatomie des Kniegelenkes treffen zu? (2 richtige Antworten)
Medial besteht ein konkaves Tibiaplateau.
Lateral kommt es zu keiner Translation bei der Flexion.
Es bestehen drei Rotationsachsen.
Es gibt zwei longitudinale Rotationsachsen.
Die operative Umsetzung des kinematischen Alignments erfolgt durch … (1 richtige Antwort) 3
… die Umstellung der Gelenklinie.
… die Berücksichtigung der ursprünglichen Knorpeldicke und deren Ausgleich.
… ein Weichteilrelease.
… die gerade Ausrichtung der Beinachse.
Jetzt onlineTeilnahme möglich:
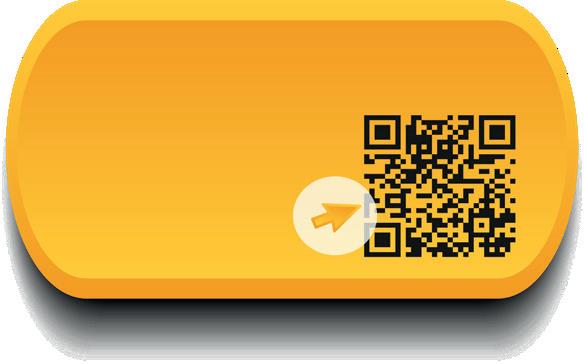
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!
Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:
NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben:
Name Anschrift
PLZ/Ort
E-Mail
Hausärzt:in DFP 20 März 2024
1
2

Ein Kreuz, das Viele tragen
Bei funktionellen Rückenschmerzen ist „Überbehandlung“ kontraproduktiv
Chronische Rücken- und Kreuzschmerzen sind längst zur Volkskrankheit avanciert. Mehr als jede:r Dritte über 60, aber auch etwa ein Fünftel aller unter 60-Jährigen ist betroffen, Frauen häufiger als Männer.1 Sogar Kinder werden mitunter als neue Risikogruppe genannt. Am 15. März wurde deshalb zum 23. Mal der Tag der Rückengesundheit begangen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab im Dezember des vergangenen Jahres erstmals eine Leitlinie zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen heraus.2
Ein Wohlstandsleiden
In modernen Industrienationen verbringen viele Menschen die meiste Zeit sitzend. Auf so viel Ruhe ist der menschliche Körper aber nicht ausgelegt, denn unsere Physis ist immer noch an die Lebensbedingungen der Urzeit angepasst, also an viel ausdauernde Bewegung. Deshalb hat die Wirbelsäule bekanntlich die Form einer doppelten S-Kurve, die sie ähnlich einer Feder wirken lässt. Durch Muskulatur und Bänder wird sie gehalten, die Bandscheiben gleichen Bewegungen aus und puffern. Sie alle ermöglichen das aufwändige Zusammenspiel der Strukturen bei gleichzeitiger Stabilität und Beweglichkeit.
Dafür muss das System aber regelmäßig bewegt und trainiert werden. Wer lange in einer Position verharrt, büßt an Muskelkraft ein und die Koordination mit den anderen Körperteilen verschlechtert sich. Außerdem verliert man das Bedürfnis, sich zu bewegen. Der Körper gewöhnt sich praktisch an die Fehlhaltung und nimmt sie nicht mehr als schädlich wahr. So entstehen für gewöhnlich Muskelverspannungen und unspezifische bzw. funktionelle Rückenschmerzen.3
WHO empfiehlt Bewegungstherapie
Diese funktionellen Rückenschmerzen machen etwa 80 % der Fälle aus.4 Sie sind normalerweise nicht bedrohlich, denn sie haben keine primär fassbare organische Ursache, etwa einen Bandscheibenvorfall. Meist besteht bei Rückenbeschwerden also keine akute Gefahr. Deshalb warnt der Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin von MedUni Wien und AKH Wien, Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, vor einer
Hausärzt:in medizinisch 21 März 2024
© shutterstock.com/Anatoly Maslennikov
>
„Ü berbehandlung“ Gewöhnlich könnten die Schmerzen mit konventionellen, konservativen Maßnahmen in den Griff bekommen werden.
Für eine effektive Therapie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist neben der 2018 veröffentlichten nationalen Leitlinie nun auch eine WHO-Leitlinie verfügbar. Dort werden etwa Massage und Akupunktur als kurzfristig erleichternd wirkende Mittel empfohlen. Nachhaltig sind sie allein aber nicht, denn die Patient:innen neigen dazu, in die alten Fehlhaltungen zurückzufallen, sodass die Schmerzen bald wieder auftreten. Bewegungs- und Trainingstherapie sollte daher das Mittel der Wahl sein. Sie fördert die Koordination und kann Haltungsfehler korrigieren, im Normalfall führt sie innerhalb von sechs Wochen zum Erfolg. Für die Richtlinie der WHO wurde eine Reihe unterschiedlicher Sport- und Bewegungsarten geprüft, darunter Krafttraining, Yoga, Pilates, Gymnastik und andere. Keine der Methoden unterschied sich in ihrer Effektivität signifikant von den anderen. Es wird daher empfohlen, das
WAS HILFT BEI RÜCKENSCHMERZEN?
Therapieprogramm den persönlichen Präferenzen der Teilnehmer:innen anzupassen.
Eine kontroversere Methode ist die Manipulation und Mobilisation der Wirbelsäule („Spinal Manipulative Therapy“; SMT), bei der durch ruckartige Stöße Gelenke über ihre normalen Bewegungsgrenzen hinaus gedehnt werden. Bisher gibt es nur wenige Studien zur Wirkung dieser Therapieform, in den WHO-Empfehlungen wird ihr aber kurzfristige Effektivität attestiert. Es kann hier zu moderaten Nebenwirkungen kommen. Das Risiko, schwerwiegende Komplikationen wie Knochenbrüche zu erleiden, ist grundsätzlich gering, die SMT sollte aber jedenfalls nur von geschultem Personal vorgenommen werden.
Ein umfassenderes Therapieprogramm ist der Biopsychosoziale Ansatz, bei dem physische, psychologische und soziale Behandlungen gemeinsam angewandt werden. Abhängig vom jeweiligen Programm werden damit gute, auch langfristige Erfolge erzielt. Patient:innen profitieren hiervon vor allem auch psychisch, etwa in Hinblick auf Stress.2
Wirkung X kurzfristig langfristig
Bewegungstherapie: die einzige Methode, die eine nachhaltige Wirkung zeigt, keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf die gewählte Sportart.
Akupunktur: sicher, zeitigt kurzfristige Verbesserungen, ist allein aber nicht nachhaltig.
Massage: kurzfristige Verbesserungen, unmittelbar nach der Behandlung kann es zu verstärkten Schmerzen kommen.
Manipulation der Wirbelsäule: kurzfristige Verbesserungen, mögliche Kontraindikationen (z. B. Osteoporose) müssen beachtet werden. Die verwandten Methoden Chiropraktik und Osteopathie wurden nicht getestet.
Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID): wirken gut, sind aber keine langfristige Lösung, da sie die Symptome nur maskieren.
Therapeutischer Ultraschall: keine signifikanten Verbesserungen feststellbar.
Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS): kein signifikanter Unterschied zwischen Treatmentund Kontrollgruppe feststellbar.
Biopsychosoziale Therapie: Wirkung abhängig vom jeweiligen Programm, kann sich auch positiv auf die Psyche auswirken.
Empfehlungen für die Behandlung von Rückenschmerzen laut WHO-Leitlinie.
Gymnastik in der Notaufnahme
Eine fachärztliche Diagnose wird empfohlen, wenn sich der Zustand nach sechs Wochen Behandlung nicht bessert oder wenn bestimmte Hinweise vorliegen, die auf Strukturstörungen oder Entzündungen hindeuten, etwa Fieber oder Nervenausfälle. Hier schaffen bildgebende Verfahren dann Klarheit. Als Ursache für diese spezifischen Rückenschmerzen kommen eine Fraktur, ein Bandscheibenvorfall, Osteoporose, aber auch ein Tumor oder eine Infektion infrage. In solchen schwerwiegenderen Fällen kann ein chirurgischer Eingriff notwendig sein.
Selbst nach einer Operation wird jedoch versucht, die Patient:innen so schnell wie möglich wieder zu mobilisieren.
„ Die aktive Komponente ist bei der Behandlung oft entscheidend“, sagt Prof. Dr. Hagen Schmal, Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Leiter der Sektion Wirbelsäulenchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg. „Wir überlegen sogar, Krankengymnast:innen direkt in der Notaufnahme einzusetzen. Dort sollen die Patient:innen dann möglichst nicht komplett liegen, sondern zum Beispiel halb sitzen.“
Aus demselben Grund rät Prof. Crevenna in moderaten Fällen von einer Krankschreibung ab: „ Die Betroffenen sollen nicht durch Bettruhe in eine kontraproduktive Inaktivität gedrängt werden. [Sie] sind darüber zu informieren, dass Bewegung die Schmerzsituation sogar verbessert.“
Felicia Steininger
Quellen:
1 Statistik Austria, Österreichische Gesundheitsbefragung 2019.
2 WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain. 2023.
3 Geraedts P, Physiotherapeutisches Training bei Rückenschmerzen. 2018.
4 Schürer R, Public Health Forum. 2016; 2(24):143-146. doi.org/10.1515/pubhef-2016-0034
Hier geht es zur WHO-Leitlinie:
Hausärzt:in medizinisch 22 März 2024

y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.
y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at
Wartezimmer TV

So verliert der Darm an Reiz Das Reizdarmsyndrom erkennen und durch eine FODMAP-Diät die Therapie unterstützen

EXPERTIN:
Dr.in Karoline Horvatits Internistin mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährungsmedizin, Zentrum für Leber-, Magen- und Darmgesundheit
GASTROMEDICS in Eisenstadt

Lange Zeit galt der „nervöse Magen“ als eingebildete Krankheit. Mittlerweile ist das Reizdarmsyndrom (RDS) jedoch als valide Diagnose anzusehen. Es ist zudem einer der häufigsten Gründe für die Konsultation einer Gastroenterolog:in. Schätzungen zufolge ist rund ein Fünftel der Bevölkerung davon betroffen, Frauen circa doppelt so häufig wie Männer. Bei etwa der Hälfte aller Menschen mit gastrointestinalen Beschwerden sind diese auf das RDS zurückzuführen. „Entscheidend ist, dass die Erkrankung erkannt wird und eine Diagnose zuverlässig gestellt werden kann. Die aktuelle Leitlinie1 hilft uns hier und gibt einen Pfad hinsichtlich einer effizienten und sinnvollen Ausschlussdiagnostik vor“, so die Internistin und Darmexpertin Dr.in Karoline Horvatits aus Eisenstadt. Erst wenn andere gastroenterologische Erkrankungen wie Colitis ulcerosa oder eine Lebensmittelintoleranz ausgeschlossen werden können, gelangt man zur Diagnose RDS. „Besonders wichtig erscheint mir, dass die unnötige Wiederholung verschiedener Diagnostik vermieden wird“, meint die Fachärztin. Durch neue Erkenntnisse in Bezug auf pathophysiologische Mechanismen, etwa eine gestörte

INFO
FODMAP in Kürze
Das Reizdarmsyndrom ist eine häufige und für Patient:innen sehr belastende Erkrankung mit multifaktorieller Genese. Sowohl die Therapie als auch die Ernährungsempfehlungen werden individuell an die Patient:in angepasst. Mittlerweile ist eine von Ernährungsfachkräften angeleitete Low-FODMAPDiät eine etablierte Therapie zur Behandlung des Reizdarmsyndroms. Sie kann zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen führen. Ziel der angeleiteten individualisierten FODMAP-Diät ist, die Einschränkungen in der Nahrungsmittelauswahl für die Patient:in so gering wie möglich zu halten und die individuell verträgliche Menge verschiedener FODMAPs zu ermitteln. Eine ausführliche Auflistung empfohlener bzw. zu meidender Lebensmittel finden Sie auf meinmed.at/2328
26 März 2024 Hausärzt:in medizinisch
© picturepeople
© shutterstock.com/KI
© shutterstock.com/Alkema Natalia
Darm-Hirn-Achse, eine beeinträchtigte Schleimhautbarriere oder eine gestörte Motilität der Verdauungsorgane sowie eine Hyperästhesie im Verdauungstrakt, werde das RDS zusehends besser verstanden, woraus sich auch neue Therapieansätze ergäben.
„Im Speziellen profitieren Patient:innen mit dominierenden abdominellen Schmerzen, Blähungen und Diarrhoen von dieser Ernährungsform.“
Reizdarmsyndrom, eine Frage des Typs
Je nachdem, welche Beschwerden überwiegen, werden Menschen mit RDS in Diarrhoe- und Obstipationstypen eingeteilt, wobei es auch Mischtypen gibt. Das RDS ist eine komplexe Erkrankung und die Ursachen sind oft multifaktoriell. „Bei rund 50 Prozent der Patient:innen vom RDS-Diarrhoetyp liegt dem Leiden ein gestörter Gallensäuremetabolismus zugrunde. Aufgrund übermäßiger Ausscheidung von Gallensäuren im Darm kommt es zu einer unzureichenden Resorption am unteren Ende des Dünndarms und somit zu einer vermehrten Ausscheidung im Stuhl. Das hat letztlich eine chologene Diarrhoe zur Folge“, erklärt Dr.in Horvatits. Zudem ist die Motilität beim RDS-Diarrhoetyp deutlich erhöht, was den Patient:innen manifeste Beschwerden bereitet. Im Gegensatz dazu ist die Kolontransitzeit beim Verstopfungstyp deutlich verlangsamt. Obstipation ist die Folge. „Diese Unterscheidung ist besonders wichtig, da die Therapie beim RDS vor
allem symptomorientiert ist“, betont die Spezialistin. Behandelt werde das RDS medikamentös und psychotherapeutisch.
Ungünstige Lebensmittel eliminieren
Eine Säule der Behandlung stellen diätische Maßnahmen dar. Bei etwa 70 Prozent der Betroffenen führt eine FODMAP-arme Ernährung zu einer Besserung der Symptomatik. „Im Speziellen profitieren Patient:innen mit dominierenden abdominellen Schmerzen, Blähungen und Diarrhoen von dieser Ernährungsform. Bei Patient:innen mit dominierender Obstipation ist eine FODMAP-arme Ernährung ebenfalls möglich, eine zu erwartende Besserung der Symptome ist aber etwas geringer im Vergleich zu anderen RDS-Formen“, weiß Dr.in Horvatits. FODMAP steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das Grundprinzip dieser Diät besteht darin, auf bestimme Zuckerbestandteile, auf die Patient:innen mit Reizdarmsyndrom vermehrt reagieren, weitgehend zu verzichten. Diese Zuckerarten werden im Darm nur ein-
geschränkt absorbiert, ziehen Wasser in den Darm und werden von den Darmbakterien vergärt, was Gase produziert. Dies kann wiederum zu vermehrten Symptomen wie Abdominalschmerzen, Flatulenzen und Diarrhoe führen. „Im ersten Schritt der Diät findet eine Elimination der Nahrungsmittelgruppen über sechs bis acht Wochen statt. Im Anschluss erfolgt eine sukzessive Wiedereinführung der einzelnen FODMAP-Gruppen. Je nach Verträglichkeit einzelner FODMAPGruppen und FODMAP-Mengen wird diese individuell an die Patient:in angepasst“, erklärt die Expertin.
Oft beinhaltet diese Diät unter anderem das Meiden von Nahrungsmitteln mit Fruktose (enthalten vor allem in Äpfeln, Wassermelonen, Mangos und Birnen) sowie Polyolen wie Sorbitol (hauptsächlich in Steinobst) und Mannitol (besonders in Karfiol und Pilzen). Die Polyole werden vermehrt künstlich als Süßungs- und Feuchthaltemittel in stark prozessierten Lebensmitteln und Süßwaren eingesetzt. Auch Fruktosesirup wird oft als Süßungsmittel verwendet.
Laktose kann ebenfalls zu abdominellen Beschwerden führen. „Die etwas längerkettigen Zucker Fructo- und Galactooligosaccharide (FOS bzw. GOS) sind sehr oft für diverse Symptome des RDS verantwortlich. Bei den FOS-haltigen Lebensmitteln sind vor allem Knoblauch und Zwiebeln sowie die Getreidesorten Weizen, Roggen und Gerste die Übeltäter“, so Dr.in Horvatits. Bei den GOS-haltigen Lebensmitteln sind hauptsächlich Bohnen, Erbsen sowie Cashews und Pistazien zu nennen. Eine Elimination dieser Nahrungsmittel im Rahmen der FODMAP-Diät führt bereits häufig zur deutlichen Linderung der Beschwerden.
Margit Koudelka
Referenz: 1 Layer P et al., Z Gastroenterol. 2021; 59(12):1323-415.
Hausärzt:in medizinisch 27 März 2024
© Weinwurm Fotografie
Hausärzt:in
Rot, gelb, grün – mit dem Ampelprinzip gegen Sodbrennen
Asthma, Husten oder Ohrenschmerzen?
Dahinter kann Reflux stecken; die Ursachen werden oft nicht gleich erkannt

EXPERTE:
Univ.-Doz. Dr. Martin Riegler Ärztlicher Leiter der Refluxordination, Wien, refluxordination.at
Jede:r dritte Erwachsene in Europa, Nordamerika und Japan leidet unter Reflux. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind stark und rund 50 Prozent leicht betroffen. Dr. Martin Riegler widmet sich in seiner Refluxordination in Wien ausschließlich und ganzheitlich der Refluxkrankheit: „Unserer Erfahrung nach dauert es oft zwei bis drei Jahre, bis sich Betroffene Hilfe suchen “ Wie viele von ihnen das tatsächlich tun und wie viele nicht, ist mangels wissenschaftlicher Studienlage nicht belegt. Zudem wird oft die Ursache nicht gleich erkannt. Wenn eine Patient:in häufig mit Husten, Heiserkeit oder Räuspern zu kämpfen hat, kann Reflux der Grund dafür sein, da der Rückfluss von Mageninhalt nicht nur die Speiseröhre entzündet – auch die Schleimhäute im Mund sowie jene der Ohren können betroffen sein, sodass Reflux Beschwerden im Kiefer- oder Ohrenbereich und sogar in der Lunge verursachen kann. Die meisten, die unter Asthma leiden, haben ebenfalls Reflux. Wird dieser behandelt, lassen sich auch die asthmatischen Beschwerden deutlich verringern. Solche Zusammenhänge sind vielfach nicht bekannt.
Refluxtagebuch hilfreich
Bei der Diagnose ist es vor allem wichtig, den Betroffenen ganz genau zuzuhören, wenn sie ihre Krankheitsgeschichte erzählen und die Symptome beschreiben. „ Das ist unumgänglich und dauert oft bis zu einer halben Stunde“, betont
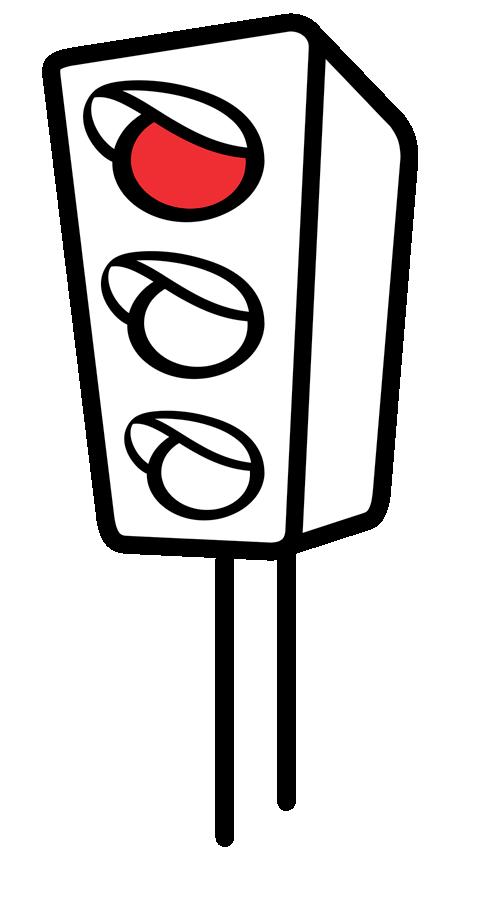

Dr. Riegler, „dabei sollen Art, Schwere und Häufigkeit der Beschwerden geklärt werden, weiters die Frage, wie sehr dadurch die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Patient:innen beeinträchtigt werden.“ Für die Selbsteinschätzung und als wertvolle Informationsquelle im Ärzt:innengespräch könnte ein Refluxtagebuch hilfreich sein, in dem die Beschwerden samt Stärkegrad notiert werden. Danach erfolgt eine Gastroskopie und im dritten Schritt eine Druck- und Refluxmessung.
Die erste Therapiemaßnahme bei Sodbrennen ist eine Ernährungsumstellung, wobei Nahrungspausen vermieden werden sollten – kleine Snacks haben oft eine große Wirkung. Dabei essen Betroffene am besten zwischen den Hauptmahlzeiten alle ein bis zwei Stunden eine halbe Salatgurke, einen halben sauren Apfel oder drei Radieschen – jeweils mit Schale. So nimmt der Reflux samt Beschwerden ab. Als zweite Maßnahme können, falls erforderlich, zusätzlich Protonenpumpenhemmer verordnet werden, um akute Beschwerden zu behandeln und zwischenzeitlich weitere Untersuchungen zur Abklärung durchführen zu können.
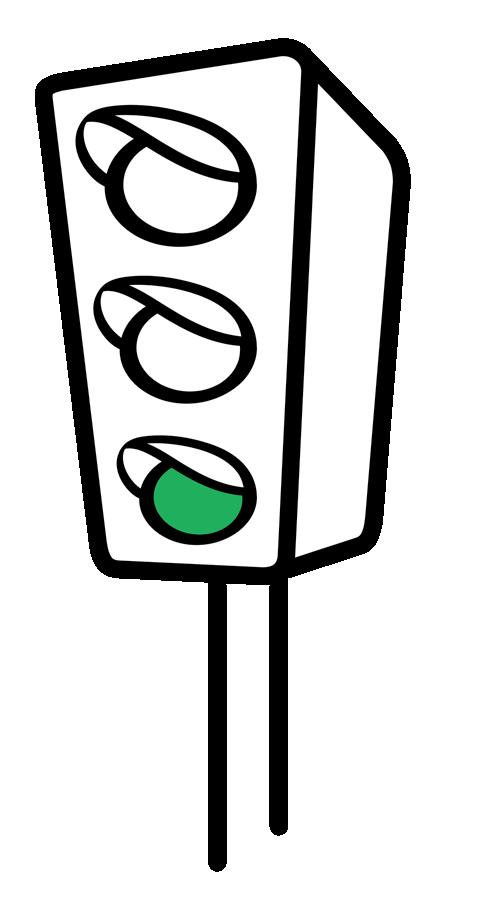
Die drei Ampelphasen
Dr. Riegler und die selbst an Reflux erkrankte Köchin Andrea Grossmann entwickelten zusammen die AntiReflux-Ampeldiät, mit deren Hilfe Refluxsymptome im frühen Stadium fast vollständig beseitigt oder auch im fortgeschrittenen Stadium verlässlich minimiert werden können. Beim Ampelprinzip geht es im Grunde darum, auf konzentrierten Zucker zu verzichten, bis die Beschwerden nachlassen. Diese Anti-Reflux-Ernährung besteht
HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Genussvoll essen bei Reflux & Sodbrennen Mit 60 neuen Rezepten nach dem Ampel-Prinzip
Von Andrea Grossmann und Martin Riegler Kneipp Verlag 2023
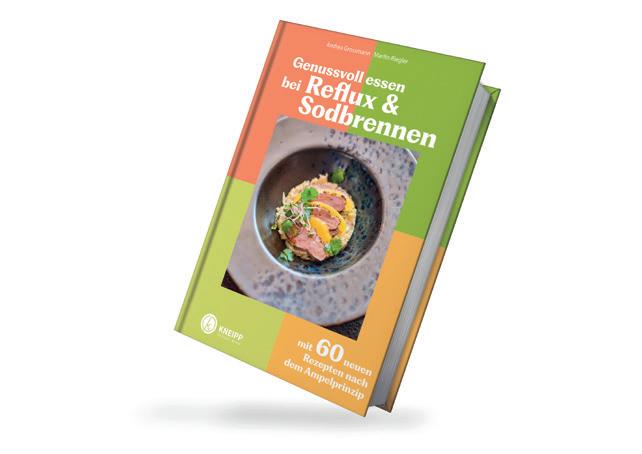
X
medizinisch 28 März 2024 Fachkurzinformation siehe Seite 50
© shutterstock.com/Mark Rademaker
aus drei Phasen: der roten, der gelben und der grünen Phase. In der ersten Phase (rote Phase) wird jede Form von schlechtem oder konzentriertem Zucker beziehungsweise konzentrierte Kohlenhydrate weggelassen. Konzentrierter Zucker versteckt sich etwa in Milch, Smoothies und Joghurtdrinks, in Avocado, Marillen, Nüssen oder auch in Müsliriegeln, Süßstoffen (wie Kandisin) oder Geschmacksverstärkern (wie Glutamat). Entscheidend ist, in der roten Phase das Hungern zu vermeiden. Jede Stunde wird eine Kleinigkeit zur Reinigung der Speiseröhre gegessen, beispielsweise ein säuerlicher Apfel oder eine Salatgurke. Die rote Phase dauert etwa acht bis zehn Tage. Wenn sich durch die Umstellung die Beschwerden etwas gebessert haben, beginnt die gelbe Phase und es kommen neue Zutaten hinzu: Kleine Mengen von Lebensmitteln, die konzentrierten Zucker enthalten, sind erlaubt. Diese Phase dauert 20 Tage. Danach dürfen die Patient:innen ihren Speiseplan erweitern und kommen in die grüne Phase, was bedeutet: Sie essen ihre Wunschkost.
Reflux langfristig reduzieren
Durch die beiden Hauptmaßnahmen während der Diät (Weglassen von konzentriertem Zucker und Vermeiden von längeren Essenspausen) kann der Reflux deutlich vermindert werden. Dr. Rieglers Tipp: Man sollte auch nach der Diät die Gewohnheit beibehalten, jede Stunde ein Stück Apfel, Gurke oder Radieschen zu essen. Treten erneut Beschwerden auf, geht man wieder eine Stufe zurück – das wäre der dauerhafte Weg. Falls die Beschwerden nicht vergehen, kann zusätzlich ein Magensäureblocker eingenommen werden. Prinzipiell können alle Refluxpatient:innen die Ampeldiät umsetzen, außer Personen, die einen sehr stark ausgeprägten Rückfluss haben. In diesen Fällen sollte zeitnah eine Operation in Betracht gezogen werden. Zudem ist die Anti-Reflux-Ernährung nicht für jene geeignet, die noch keine exakte Abklärung durchlaufen haben.
Dr. Riegler ist von seiner Methode überzeugt und zieht eine positive Bilanz: „I n unseren Händen funktioniert es mit der Ernährungsumstellung in 80 Prozent aller Fälle. 15 Prozent der Betroffenen benötigen eine Ernährungsumstellung plus ein- bis zweimal pro Woche einen Magensäureblocker. Bei lediglich fünf Prozent ist eine Operation zu empfehlen beziehungsweise erforderlich, um den Reflux in den Griff zu bekommen “ Dabei unterstreicht Dr. Riegler, dass niemand Angst haben müsse: „ Es ist ganz einfach, ohne Reflux durch den Tag zu kommen, und die Beschwerden lassen sich wunderbar beseitigen. Die Speiseröhre ist ein wenig wie die Wiener Mentalität: Sie lässt sich Zeit – das heißt, genügend Zeit, um einzugreifen und durch Therapie und Lebensstil Positives zu bewirken “ Wichtig sei nur, dass Patient:innen nicht allzu lange warteten und sich Hilfe suchten. Immerhin ginge es darum, an Lebensqualität und Wohlbefinden zu gewinnen – und das wiederum bedeute Gesundheit.
Justyna Frömel, Bakk. MA
NEU


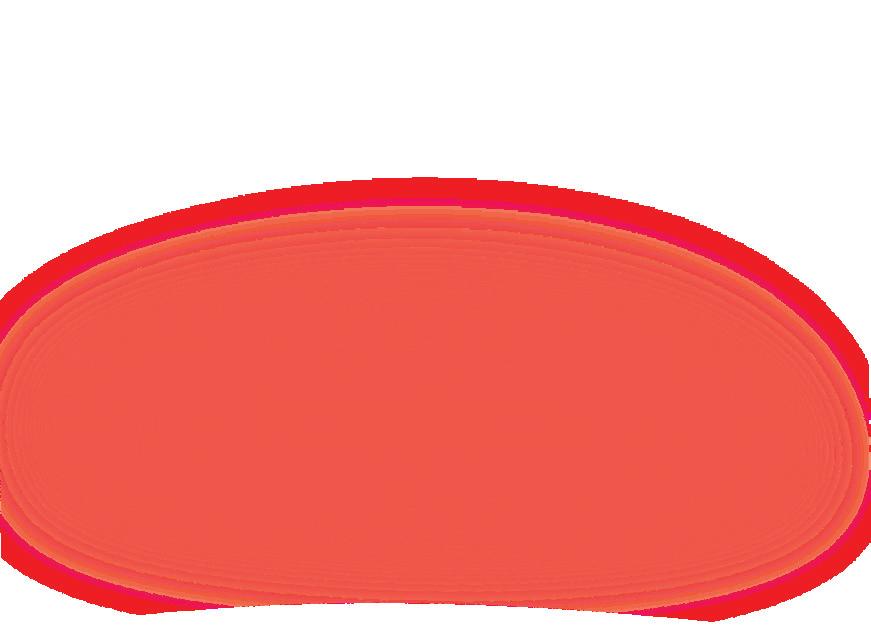
✔ Neutralisiert schnell überschüssige Magensäure durch mineralische Säurepuffer
✔ Beruhigt und schützt die Speiseröhre durch einen Schutzfilm aus wertvollen Polysacchariden des Feigenkaktusextrakts

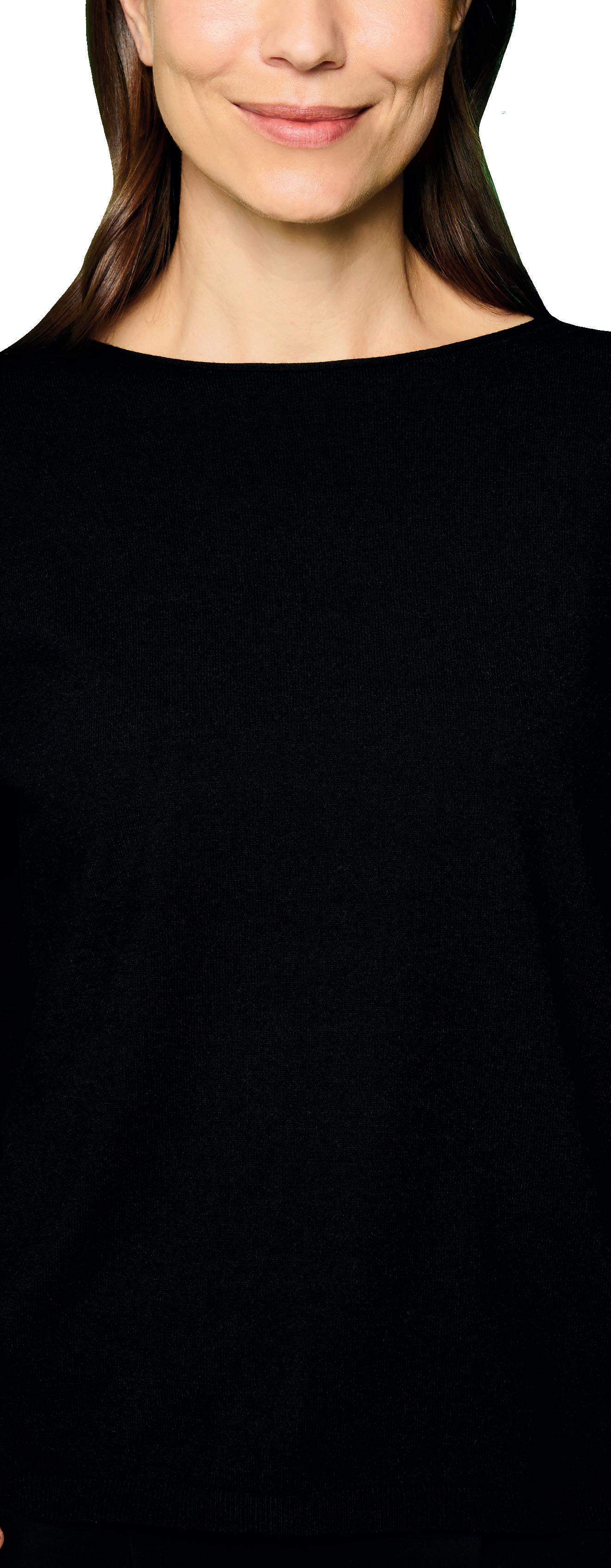
Medizinprodukt REL_2311_F
Verträglich(er) kombiniert
Eine adjuvante Misteltherapie kann unerwünschte Autoimmuneffekte der spezifischen Immuntherapie vermindern
Das Lungenkarzinom gilt weltweit als Krebserkrankung mit der höchsten Mortalität – trotz neuester tumorspezifischer Therapiemöglichkeiten. Die Mehrzahl der Patient:innen leidet im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf unter krankheitsbezogenen Beschwerden, welche die Lebensqualität deutlich einschränken. Somit ist eine Suche nach weiteren Therapiekonzepten erforderlich, um Betroffene im Rahmen der Immuntherapien besser unterstützen zu können. Im Live-Webinar „M isteltherapie mit ISCADOR:Interaktion mit Immun-CheckpointInhibitoren“ (ICI) wurden neueste Erkenntnisse präsentiert, wie ICI in Kombination mit einer Misteltherapie wirken und inwiefern Patient:innen davon profitieren.*
Checkpoint-Inhibitoren in der Tumortherapie
Wie bei allen Krebsarten hängen die Überlebensaussichten eng mit dem Tumorstadium bei Erstdiagnose zusammen. Da Lungenkrebs lange Zeit völlig symptomlos verläuft, weist rund die Hälfte aller Patient:innen zum Diagnosezeitpunkt bereits ein metastasiertes Krankheitsstadium auf. Die häufigste histologische Entität beim Lungenkarzinom ist die Gruppe der nichtkleinzelligen Karzinome (NSCLC) – sie macht circa 85 % aller Krebserkrankungen der Lunge aus. Nach Diagnosestellung beträgt das mittlere Überleben weniger als ein Jahr und das Fünf-Jahres-Gesamtüberleben liegt zwischen 10 und 15 %. In den letzten Jahren wurden vielfältige neue Therapieoptionen zur Behandlung des NSCLC zugelassen. Durch die Gabe von ICI ist es nun seit kurzer Zeit möglich, bei einigen Patient:innen eine zeitweise Remission respektive

Krankheitsstabilität zu erzielen. Zur Behandlung des metastasierten NSCLC zugelassen sind die Substanzen Nivolumab und Pembrolizumab. Deren Wirkung beruht auf der Aufhebung des TumorEscape-Phänomens. Tumoren nutzen Checkpoints, um die gegen sie gerichtete Immunabwehr außer Kraft zu setzen. Checkpoint-Inhibitoren blockieren inhibitorische Immuncheckpoints und triggern dadurch die intrinsische AntiTumor-Immunantwort von T-Zellen. „ Bildhaft gesprochen wird die Bremse des Immunsystems entsichert“, erklärte Dr. Christian Grah, Leitender Arzt des Lungenkrebszentrums am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, im Webinar. Konsekutiv kommt es zu einer Reaktivierung des Abwehrsystems. Immuncheckpoint-Inhibitoren können jedoch auch autoimmune Nebenwirkungen induzieren – praktisch jedes Organsystem kann betroffen sein.
Keine Sicherheitsbedenken
Dass die Misteltherapie die Verträglichkeit einer Chemotherapie verbessern und krankheits- und therapiebedingte Symptome lindern kann, ist klinisch gut belegt. Unklar war bislang, welchen Effekt eine selektive Blockade einzelner Funktionen des TumorEscape-Phänomens durch die Behandlung mit einem ICI und Mistelextrakten hat. Ein Review von Fuller-Shavel et al. zu integrativen onkologischen Therapien beschreibt die Ergebnisse der Mistel.1 Er kommt zu dem Schluss, dass Studien zur Misteltherapie bei Patient:innen, die mit ICI behandelt werden, keine Sicherheitsbedenken ergeben haben.
Aus der Forschung sind zytotoxische sowie modulierende Effekte der Mistel auf das Immunsystem bekannt – unter anderem kommt es unter einer Misteltherapie zu Aktivierungen von tumorantigenpräsentierenden Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen, B-Lymphozyten) sowie zu einer Stimulierung von tumorspezifischen Lymphozyten. „Unklar war bis jetzt, ob unerwünschte Wirkungen durch eine Kombinationstherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren verstärkt werden oder seltener vorkommen“, hielt der Facharzt für Innere Medizin in seiner Keynote fest. Eine Real-World-Data-Studie aus der Versorgungsforschung, bei der eine Patient:innengruppe mit fortgeschrittenem und metastasiertem Lungenkarzinom bzw. Melanom nur ICI erhielt und die andere zusätzlich eine Misteltherapie, ermittelte in beiden Gruppen die Nebenwirkungsrate. Feststellbar war, dass die zusätzliche Misteltherapie die Nebenwirkungsrate von ICI nicht verändert. „A lle bisherigen Untersuchungen machen uns dahingehend Mut, die
Hausärzt:in medizinisch 30 März 2024
shutterstock.com/AI
©
Mistel mit Checkpoint-Inhibitoren zu kombinieren“, so Dr. Grah. „ I n Bezug auf die immunvermittelten Nebenwirkungen sehen wir kein stärkeres Signal – sondern tendenziell ein schwächeres “ Auf dem deutschen Krebskongress 2018 wurden beispielsweise Sicherheitsdaten von 15 Patient:innen mit fortgeschrittenem oder metastasieredem Lungenkarzinom vorgestellt. Diese erhielten entweder Nivolumab (n = 7) oder Nivolumab mit Mistel. Es zeigte sich eine halbierte Nebenwirkungsrate bei der kombinierten Nivolumab-Mistel-Gabe (37,5 %) versus die alleinige Nivolumab-Gabe (71,4 %).
Misteltherapie vermindert Autoimmuneffekte
Mit der PHOENIX-III-Kohorte ICI + Misteltherapie liegen nun erstmals
prospektive Daten zur Kombinationstherapie vor.2 In die Studie waren Patient:innen beiderlei Geschlechts (Durchschnittsalter: 69 Jahre) mit einem NSCLC im Stadium IV nach UICC eingeschlossen, die in der ersten oder in der Folgelinie eine Therapie mit ICI sowie eine Misteltherapie begonnen haben. „Wir haben Betroffene untersucht, die keine Chemotherapie erhielten – sprich Patient:innen, die eine hohe Expression des Markers PDL1 hatten. Wir haben außerdem auch sehr kranke Patient:innen in die Studie eingeschlossen“, weist Studienleiter Dr. Grah auf einen Aspekt hin, der eher ungewöhnlich für eine solche Beobachtungsstudie ist.
Im Vergleich zu einer ähnlichen Studienpopulation ist die Ansprechrate der Patient:innen aus der PHOENIXIII-Studie höher. Gleichzeitig ist die Inzidenz immunmediierter Nebenwir-
NACHBERICHT
kungen (irAEs) auffällig niedriger als in anderen publizierten Studiendaten dieser Therapieform ohne Misteltherapie. Durch die kombinierte Behandlung mit Mistel kann insbesondere die Entwicklung einer Pneumonitis gebremst werden. Alle Ergebnisse weisen auf die hohe Sicherheit dieser dualen Immuntherapie und ein gutes Ansprechen darauf mit stabiler Lebensqualität hin. Aktuell zur Publikation eingereichte Real-World-Data-Auswertungen deuten auf eine signifikante Verlängerung der Überlebenszeiten durch die additive Therapie aus ICI und Mistelpräparaten hin – mit konkreten Ergebnissen ist im Frühjahr 2024 zu rechnen.
Mag.a Sylvia Neubauer
Quellen:
1 Fuller-Shavel N et al., Integrative Oncology Approaches to Supporting Immune Checkpoint Inhibitor Treatment of Solid Tumours. Curr Oncol Rep. 2024 Feb;26(2):164-174.
2 Grah C et al., Erste Teilstudie zur Anthroposophischen Komplextherapie (PHOENIX III), 2022.
* Live-Webinar Misteltherapie mit ISCADOR: Interaktion mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren, FFF-Fortbildungsforum Naturheilkunde, 16. Februar 2024.
31 März 2024 Hausärzt:in medizinisch
Allergiegeplagte Sexualität
Über die Beziehung zwischen atopischen Erkrankungen und sexueller Dysfunktion

Sowohl allergische Erkrankungen als auch sexuelle Dysfunktionen sind weit verbreitet und schränken die Lebensqualität Betroffener mitunter stark ein. Der potenzielle Zusammenhang zwischen den beiden Entitäten sei bislang nicht ausreichend erforscht worden, geben Chiang et al. in einer aktuellen Publikation zu bedenken.1 So verfolgten sie in ihrem „ Scoping Review“ das Ziel, die vorhandenen Daten zu analysieren und neue Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen.
Insgesamt zwölf Beobachtungsstudien konnten in die Analyse eingeschlossen werden. Die Stichprobengrößen reichten von dutzenden bis hin zu fast 300 Personen; fünf Untersuchungen rekrutierten nur Frauen, drei ausschließlich Männer und vier inkludierten beide Geschlechter. Alle Studien beinhalteten eine Kontrollgruppe und fokussierten sich auf die Frage, inwiefern eine eingeschränkte sexuelle Funktion mit allergischen Erkrankungen korreliert. Sechs
Artikel befassten sich näher mit Asthma, zwei mit Urtikaria und atopischer Dermatitis sowie vier mit Rhinitis.
Beispiel Rhinitis
Exemplarisch werden hier die Untersuchungen und ihre Ergebnisse in puncto allergischer Rhinitis (AR) angeführt. Eine Studie evaluierte Lebensqualitätsparameter, und bei Patienten mit AR wurde ein niedrigerer mittlerer Score bezüglich sexueller Funktion festgehalten als bei Kontrollpersonen.2 Drei weitere Studien untersuchten, welchen Effekt eine AR-Therapie auf die Sexualität hat – gemessen anhand des Female Sexual Function Index (FSFI) und des International Index of Erectile Function (IIEF). Im Vergleich mit gesunden Männern hatten allergisch erkrankte einen signifikant schlechteren IIEF-Wert, und dieser verbesserte sich wiederum signifikant durch die Gabe von intranasalen Kortikosteroiden.3 Eben-
so konnte in einer Untersuchung von Cakan et al. eine Therapie mit lokalen Antihistaminika und Glukokortikoiden den zuvor bedeutend niedrigeren IIEF5-Score signifikant erhöhen.4 Ein relevanter Unterschied der sexuellen Scores sowohl bei Männern als auch bei Frauen zeigte sich in einer Studie von Kirmaz et al.: Die FSFI- und IIEF-Werte bei Personen mit symptomatischer allergischer Rhinokonjunktivitis waren signifikant niedriger als bei behandelten Patient:innen und Kontrollpersonen.5 Schlussfolgerung: Kollektiv betrachtet deuten die Studienergebnisse auf eine inverse Assoziation zwischen sexueller Funktion und der Schwere von allergischen nasalen Erkrankungen hin.1
Mögliche Pathomechanismen
Laut den Review-Autor:innen sind weitere Untersuchungen erforderlich, um jene komplexe Beziehung besser zu verstehen. Diskutiert wurden als potenzielle zugrunde liegende Faktoren:
• Inflammation,
• hormonelle Veränderungen,
• psychologische Aspekte,
• Schlafstörungen,
• allergische Reaktionen im Zusammenhang mit sexuellem Verhalten,
• sozioökonomischer Status,
• Medikamentengebrauch.
Trotz insuffizienter Forschung in Bezug auf die genauen Pathomechanismen gab das vorliegende „ Scoping Review“ Einblick in die klinischen Implikationen von allergischen Erkrankungen und sexuellen Dysfunktionen – „i n der Hoffnung, damit Management und Evaluation der beiden wichtigen und quälenden Gesundheitsprobleme unterstützen zu können “¹
Anna Schuster,
BSc
Literatur:
1 Chiang TY et al., The Relationship between Allergic Disease and Sexual Dysfunction: A Scoping Review. Int Arch Allergy Immunol. 2024;185(1):20-32.
2 Mohammad J et al., J Clin Diagn Res. 2018; 12(6): MC01-MC04.
3 Jalalia MM et al., Revue Francaise d'Allergologie. 2020; 60(2):55–60.
4 Cakan D et al., Med Bull Haseki. 2022; 60:234-239.
5 Kirmaz C et al., Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Dec;95(6):525-9.
Hausärzt:in medizinisch 32 März 2024
© shutterstock.com/AI
Pollensaison im Anflug
Ein Überblick über die Pollensituation in Österreich, die verschiedenen Allergien in Europa und wie man die Therapie optimiert
Zusätzlich zu Hausstaubmilben, Gräsern oder Tierhaaren tritt mit dem Frühling noch eine weitere Belastung für Personen mit einer Allergie, nämlich durch Pollen, auf. Die Freude darüber hält sich bei Betroffenen in Grenzen, vor allem aufgrund der Tatsache, dass Personen mit Allergie zu Beginn der Pollenzeit besonders empfindlich sind und bereits auf geringe Allergiemengen in der Luft reagieren.
Frühe Blüte von Esche und Birke
Die Saison der winterresistenten Purpurerle, welche die pollenfreie Zeit des Jahres auf nur zwei Monate verkürzt, ist für 2023/2024 längst vorüber. Mit der Hasel und der Erle startete die heurige Pollensaison. Die Auswirkungen dieser Frühblüher sind nun in den meisten Landesteilen kaum noch relevant. Rekordverdächtig früh blühte dieses Jahr die Esche im Osten Österreichs. Besonders an trockenen, sonnigen Tagen ist mit mäßigem bis starkem Pollenflug in ganz Österreich zu rechnen. Durch den frühen Start ist allerdings auch ein vorzeitiges Belastungsende möglich. Ende März könnten bereits Personen, die gegen Eschenpollen allergisch sind, aufatmen. Durch die milden Temperaturen wird auch ein verfrühter Beginn der Birkenblüte erwartet – er wäre bereits in der dritten Märzwoche möglich.¹
Die pollenfreie Zeit im Jahr beträgt zwei Monate. Besonders zu Beginn der Pollensaison reagieren Menschen mit Allergie empfindlich.

Sensibilisierungen variieren europaweit
Doch auch eine Vielzahl anderer Substanzen kann Allergien auslösen. Eine umfassende Analyse² untersuchte Sensibilisierungsprofile von 2.800 Kindern in Nord-, West-, Süd- und Mitteleuropa. Ihr Ergebnis: Je nach Region, Klima, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zeigten sich Unterschiede in der Empfindlichkeit gegen verschiedene Allergene. So wurde festgestellt, dass in den meisten europäischen Regionen die Sensibilisierung in Bezug auf das Gräserpollenallergen und Hauptallergen der Katze dominiert. Im Gegensatz dazu variiert die Empfindlichkeit gegen das Allergen der Hausstaubmilbe je nach Region und ist im Norden am geringsten. Fruchtallergene zählen in Süd- und Mitteleuropa zu den vorherrschenden Allergieauslösern. Wespenund andere Insektenallergene dominieren wiederum in Nord-, West- und
Mitteleuropa, nicht jedoch in Südeuropa. Nur in wenigen Regionen kommen Sensibilisierungen in Hinblick auf Erdnussallergene vor. Die Studie belegte auch, dass Kinder, die in heißen und trockenen Regionen eines Landes aufwachsen, weniger als halb so häufig Sensibilisierungen aufweisen, als Mädchen und Buben in Gebieten mit moderatem Klima.
Neue Testmethode entwickelt Wie kam man zu diesem Ergebnis? Unter der Leitung des Forschungsteams um Univ.-Prof. Dr. Rudolf Valenta vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien wurde in Kooperation mit dem Karolinska-In- >
Hier geht es zu Informationen über den aktuellen Pollenflug:
Hausärzt:in pharmazeutisch 36 März 2024
Hausärzt:in
stitut in Stockholm und der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems mithilfe einer neu entwickelten Testmethode ein umfassender europäischer Allergieatlas erstellt. Bei neun verschiedenen Kohorten aus unterschiedlichen geografischen Regionen in Nord-, West-, Zentral- und Südeuropa wurden IgESensibilisierungsmuster analysiert. Blutproben von 2.855 Kindern im Alter von 1 bis 16 Jahren wurden untersucht. Mittels einer neuen Testmethode (Allergen-Microarray), die hinsichtlich des Umfangs und der Sensitivität den bisher verfügbaren diagnostischen Test überlegen ist, konnten 176 Allergenmoleküle abgedeckt werden. So erkannte man die regionalen Unterschiede in der Sensibilisierung gegenüber Allergenen. Diese Erkenntnisse sind Grundlage für Präventionsstrategien sowie für neue Diagnoseund Therapieverfahren bei Allergien in Europa.
Allergenimmuntherapie
für höhere Lebensqualität
Neben den Präventionsmaßnahmen und der symptomatischen Behandlung stellt die kausale Therapie einen wichtigen Baustein dar, um die Lebensqualität von Menschen mit Allergien zu verbessern. Die Allergenimmuntherapie (AIT) in Form von Tabletten ist die modernste und wirksamste Art, um eine respiratorische Allergie zu behandeln. Alternativ stehen auch die orale Gabe von Tropfen und die sublinguale oder subkutane Verabreichung zur Verfügung. Menschen, die auf Pollen allergisch reagieren, sollten vor der Saison mit der Therapie beginnen.
App verhilft zum Therapieerfolg
Wichtig ist, die Präparate täglich für drei Jahre anzuwenden. Sonst kann das Immunsystem keine Toleranz gegenüber den Allergenen entwickeln. Genau dieser Umstand ist für das Versagen vieler Therapieversuche verantwortlich. Hier kann die kostenlose MyTherapy-App mit dem personalisierten Allergiemodul eine Hilfe sein. Für alle Patient:innen, die mit Itulazax, Gralax oder Acarizax behandelt werden, ist dieses Tool verfügbar. Neben der Erinnerungsfunktion in Hinblick auf Medikamenteneinnahmen, Arzttermine oder neue Rezepte stellt die App unter anderem Informationen und Tipps zur Allergie bereit. Um das Allergiemodul zu nutzen, müssen User:innen den QR-Code des Medikaments einscannen oder die Chargennummer eingeben.
Mithilfe der App erschafft man optimale Bedingungen, um die Therapietreue der Patient:innen mit Allergien zu fördern. Im besten Fall erzielt die Behandlung letztendlich bei einer nur zweimonatigen pollenfreien Phase im Jahr eine allergiefreie Zeit von zwölf Monaten.
Mara Sophie Anmasser
Quellen:
1 polleninformation.at 2 Kiewiet MBG et al., Allergy. 2023 Jul;78(7):2007-2018. pharmazeutisch 38 März 2024
Oben Segen, unten Fluch
Bodennahes Ozon schadet der Gesundheit –durch die Klimaerwärmung wird es immer mehr

Der flüchtige Stoff ist in erster Linie durch das „Ozonloch“ bekannt, das sich Ende des 20. Jahrhunderts lange in den Schlagzeilen hielt. Durch das Verbot von FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) erholt sich die stratosphärische Ozonschicht mittlerweile, und das Thema ist längst aus den Medien verschwunden. Nun aber verlangt das bodennahe Ozon nach Aufmerksamkeit, denn die Konzentration des Luftschadstoffs steigt – eine Entwicklung, die durch die Erderwärmung vorangetrieben wird und damit bis Ende des Jahrhunderts für eine gefährlich hohe Ozonbelastung sorgen könnte.
Ozon schädigt die Lungenfunktion
In der Stratosphäre fängt die Ozonschicht bekanntlich einen Teil der UV-Strahlung ab und ist daher für die menschliche Gesundheit, insbesondere in Bezug auf Hautkrebs, unerlässlich. Wird das Gas
allerdings eingeatmet, ist es gefährlich. Ozon stellt eines der stärksten Oxidationsmittel überhaupt dar, es kann mit fast allen Verbindungen reagieren. Daher wirkt es im Körper gewebeschädigend, es reizt die Atemwege und schränkt die Lungenfunktion ein. Bei erhöhtem Atemvolumen, zum Beispiel durch körperliche Anstrengung, dringt es tief in das Lungengewebe ein und kann Entzündungen hervorrufen, die sich nicht mehr vollständig zurückbilden. Deshalb steigt das Risiko, Atemwegserkrankungen zu entwickeln, bei längerer Belastung erheblich.1 Epidemiologische Studien stellen außerdem einen Zusammenhang zwischen Ozonkonzentration und erhöhten Herzinfarktraten her. Eine in der Region Augsburg durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Herzinfarkthäufigkeit pro 10 Mikrogramm zusätzliches Ozon je Kubikmeter um 3,41 % zunimmt (95-Prozent-Konfidenzintervall [1,33 Prozent, 5,53 Prozent]).2 >
Hausärzt:in pharmazeutisch 39 März 2024
© shutterstock.com/AI
© Umweltbundesamt, Jahresbericht der Luftgütemessungen in Österreich, 2022
Hitzewellen fördern Ozonbildung
Anders als die meisten Luftschadstoffe wird Ozon nicht emittiert, stattdessen bildet es sich aus Vorläufersubstanzen neu. Von Stickoxiden (NO x) lässt sich durch UVB-Strahlung ein Sauerstoffatom abspalten (= Photolyse), das dann an molekularen Sauerstoff binden kann. Auf diese Weise entsteht Ozon. Das allein führt noch nicht zu erhöhten Ozonmesswerten, denn der Vorgang kann auch in der entgegengesetzten Richtung ablaufen, sodass Ozon zerfällt und das Stickoxid regeneriert wird.
Eine Reihe menschengemachter Umstände verschiebt das Reaktionsgleichgewicht aber in Richtung des Ozons. Einerseits sind das die Temperatur und die Sonneneinstrahlung. In der Photolyse wird Energie verbraucht. Die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen und die stärkere UV-Strahlung fördern so die Bildung von Ozon.
Andererseits spielt die Menge von Stickoxiden eine Rolle. Denn je mehr Stickoxide vorhanden sind, desto mehr
Ozon kann gebildet werden. Erstere entstehen außer durch Blitzschläge nur durch die Verbrennung von Biomasse und waren daher vor der Industriellen Revolution in der Atmosphäre kaum vorhanden.
Ähnliches gilt für Kohlenmonoxid und flüchtige Kohlenwasserstoffe wie etwa Methan, deren Emissionen in den letzten zweihundert Jahren bekanntlich ebenfalls drastisch gestiegen sind. Sie können zu Peroxidradikalen oxidiert werden, die selbst wieder mit dem in der Ozonbildung entstandenen Stickstoffradikal reagieren können. So wird das Stickoxid ohne Ozonverbrauch regeneriert.
Das Zusammenspiel all dieser Prozesse hat zur Folge, dass die Ozonkonzentration seit Mitte des 20. Jahrhunderts kontinuierlich zunimmt. 3
Spitzenbelastung gesunken
Die Kontrolle der Ozonkonzentrationen ist in Österreich im Ozongesetz festgelegt. Sie werden an 107 Stationen gemessen und täglich – zum Teil auch stündlich – vom Umweltbundesamt veröffentlicht, da die Werte stark schwanken. Es wird zwischen der Informationsschwelle (180 µg/m 3 als Einstundenmittelwert) und der Alarmschwelle (240 µg/m 3 als Einstundenmittelwert) unterschieden.4 Die Informationsschwelle wurde im Jahr 2022 an sechs Tagen überschritten, die Alarmschwelle zuletzt 2015. Dabei muss beachtet werden, dass die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wesentlich niedriger sind (100 µg/m 3 als Achtstundenmittelwert und 60 µg/m³ über sechs Monate). 5 Diese Werte wurden im selben Jahr an allen Messstellen überschritten. Tatsächlich ist die Ozonspitzenbelastung in Österreich wie auch in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten jedoch stark gesunken. So wurde der Informationsgrenzwert im Jahr 1992 an 43 Tagen überschritten, der Alarmgrenzwert 13 Mal. Im Jahresbericht der Luftgütemessungen des Umweltbundesamts wird diese Entwicklung damit erklärt, dass die Emissionen von Stickoxiden in Europa in den vergangenen Jahrzehnten rückläufig gewesen seien. Vor allem die Einführung von Katalysatoren zur Reinigung von Autoabga-
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Ozon
Natur- und Kulturgeschichte eines flüchtigen Stoffes
Von Evi Zemanek (Hrsg.)
Oekom Verlag 2023
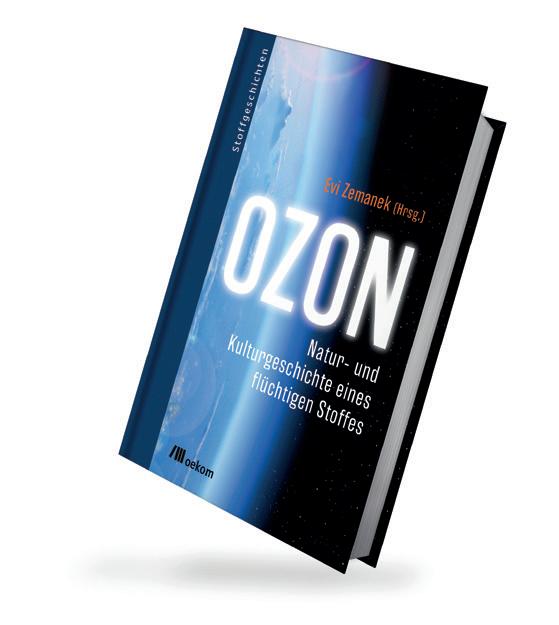
sen, die die wichtigste Quelle für Stickoxide darstellen (2021: 44 %, Industrie 20 %, Landwirtschaft: 14 %), sei hier ausschlaggebend gewesen.
Gleichzeitig lag aber der Jahresmittelwert um drei Prozent über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Die Hintergrundkonzentration von Ozon ist also gestiegen. Der Einfluss der Sonneneinstrahlung lässt sich an den Messwerten des Hitzejahres 2003 beobachten. In jenem Jahr war nicht nur die Gesamtbelastung höher als in jedem anderen Jahr dieser Periode, es fanden auch die meisten Informations- und Alarmschwellenüberschreitungen statt. 3
Wie soll auf den Ozonanstieg reagiert werden?
Darauf hat der bayrische Meteorologe Prof. Dr. Stefan Emeis eine klare Antwort: „Nur eine gleichzeitige drastische Reduktion von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen in der […] Luft kann die ungewollte Bildung von bodennahem Ozon deutlich reduzieren. Realistischerweise kann das nur nach einer vollständigen Defossilisierung des Verkehrs erwartet werden.“
Das schreibt er in dem von Medienwissenschaftlerin Prof.in Dr.in Evi Zemanek herausgegebenen Buch „Ozon. Naturund Kulturgeschichte eines flüchtigen Stoffes “ Dort weist Dr.in Elke Hertig, Geografin und Professorin für Regionalen Klimawandel und Gesundheit, auch auf die Schlüsselrolle hin, die das medizinische Personal hier einnimmt. Ärzt:innen müssten mit der Thematik vertraut sein, damit bei kombinierten Hitze-Ozon-Ereignissen die richtigen Therapien zur Verfügung stünden. Sie fordert deshalb Schulungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen von bodennahem Ozon und deren Zusammenhang mit hohen Temperaturen.1
Quellen:
1 Zemanek E (Hrsg.), Ozon. 2023: 104-126; 254-267.
2 Hertig E et al., Atmosphere 2020, 11, 1271. doi.org/10.3390/atmos11121271
3 Umweltbundesamt, Jahresbericht der Luftgütemessungen in Österreich, 2022.
4 BGBl. Nr. 210/1992: 210. Bundesgesetz: Ozongesetz.
5 WHO Global Air Quality Guidelines, 2021.
Felicia Steininger
Bildung von Ozon und Regeneration von NO 2 durch Peroxidradikale.
40 März 2024
Hausärzt:in pharmazeutisch
Nicht nur eine Frage der Anatomie
Sexualhormone und die Inzidenz von Harnwegsinfekten
Die Inzidenz von Harnwegsinfektionen ist in vielen Lebensphasen stark geschlechtsabhängig. Allerdings ändern sich die Infektionsraten im Laufe des Lebens bei Frauen und Männern, was darauf hindeutet, dass begleitende Veränderungen des Sexualhormonspiegels eine Rolle bei der Reaktion auf eine Infektion spielen könnten. Unter den Infektionskrankheiten weisen Harnwegsinfekte (HWI) einen der größten geschlechtsspezifischen Unterschiede auf. So ist bei prämenopausalen Frauen die Wahrscheinlichkeit, einen HWI zu erleiden, 20 bis 40 Mal höher als bei gleichaltrigen Männern. Diese Tatsache ist jedoch nicht ausschließlich auf die anatomischen Unterschiede – also den geringeren Abstand zwischen Anus und Harnröhrenöffnung bzw. die kürzere Urethra der Frau – zurückzuführen.
Am deutlichsten äußern sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Anfälligkeit für HWI bei postpubertären Menschen bis zum 50. Lebensjahr: also in jener Zeit, in der die Östrogenspiegel bei Frauen bzw. die Testosteronspiegel bei Männern am höchsten sind. Vor allem bei Frauen nimmt die Inzidenz von HWI nach der Pubertät zu, wenn der Östrogenspiegel ansteigt. Darüber hinaus korreliert eine Schwangerschaft, die durch einen hohen Östrogenspiegel gekennzeichnet ist, stark mit einer hohen Inzidenz von Harnwegsinfekten und rezidivierenden Infekten. Bei Männern im Erwachsenenalter hingegen ist das Risiko, einen HWI zu entwickeln, dann am geringsten, wenn deren Testosteronspiegel am höchsten ist. Fallen die Östrogen- respektive Testosteronspiegel nach der Meno- bzw. der Andropause, steigt die Inzidenz bei beiden biologischen Geschlechtern, sodass Männer nahezu gleich stark gefährdet sind, einen HWI zu entwickeln. Bei Männern, bei denen eine Infektion auftritt, sind die Gefahr einer Chronifizierung sowie die Morbidität und Mortalität aufgrund eines komplizierten HWI erhöht. Insgesamt deuten diese auffälligen Korrelationen darauf hin, dass Sexualhormone die Wahrscheinlichkeit, einen HWI zu entwickeln, respektive die Reaktion auf eine Infektion beeinflussen.

 Margit Koudelka
Margit Koudelka
Literatur:
Deltourbe L et al., Mucosal Immunol 15, 857–866 (2022).
Vidaillac C et al., mBio. 2020 Sep 29; 11(5):e01774-20.
Ingersoll MA, PLoS Pathog. 2017 Dec 28; 13(12):e1006688.
Lipsky BA, Ann Intern Med. 1989 Jan 15; 110(2):138-50.
Hausärzt:in pharmazeutisch 41 März 2024
© shutterstock.com/Derariad
Die Top-Antihypertonika nach Menge und Wert
Marktanalyse von Beatrix Linke, Country Lead
Austria bei IQVIA

• Die Kategorie der Präparate bei Hypertonie/Herzinsuffizienz (ausschließlich registrierte Arzneimittel) erzielt in den öffentlichen Apotheken und Hausapotheken im MAT Jänner 2024 mit 34,9 Mio. Packungen 188,9 Mio. Euro Umsatz FAP.
• Der entsprechende Markt sinkt aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % nach Menge und steigt um 0,9 % nach Wert. Im Jahr davor betrug das Absatzwachstum 2,6 % und das Umsatzwachstum 3,1 %.
• 61,9 % aller Packungen sind Generika, und Bisoprolol ist der am häufigsten verwendete Wirkstoff vor Candesartan und Amlodipin.
• Die Top-10-Produkte nach Menge machen 24,9 % des Gesamtabsatzes aus. Der Betablocker Concor® COR (Merck) liegt nach Einheiten an erster Stelle, gefolgt von Concor® (Merck) und Nomexor® (Menarini), zwei weiteren Betablockern.
• Die Top-10-Produkte nach Wert umfassen 32,7 % des Gesamtumsatzes. Der RAS-Hemmer Entresto® (Novartis) führt vor Concor® (Merck) und Exforge
boso medicus exclusive
Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige

HCT® (Novartis), einem Kombinationspräparat, das Umsatzranking an.
In Kooperation mit

Quelle: IQVIATM DPMÖ sell-out Österreich, Verkäufe der öffentlichen österreichischen Apotheken sowie Großhandelslieferungen an ärztliche Hausapotheken, ATC-Klassen C02 Antihypertonika, C03 Diuretika, C07 Betablocker, C08 Calciumantagonisten, C09 Renin-Angiotensin-System-Hemmstoffe (ausschließlich registrierte Arzneimittel aus dem Warenverzeichnis I), inkl. Verquvo®, exkl. Produkte aus anderen Klassen mit Indikationserweiterung im Bereich Hypertonie/Herzinsuffizienz, Absatz/Menge in Einheiten, Umsatz/Werte in Euro, bewertet zum Fabrikabgabepreis (FAP), Wachstum vs. Vorjahr, MAT Jänner 2024 (Februar 2023 bis Jänner 2024 kumuliert).

So individuell wie die Gesundheit.
boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.
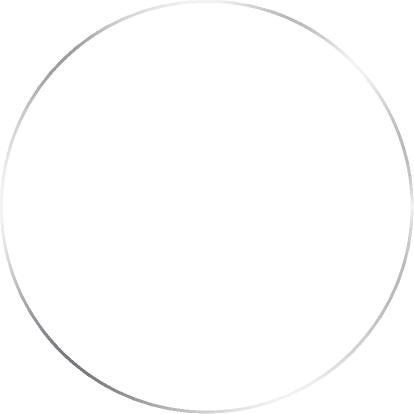
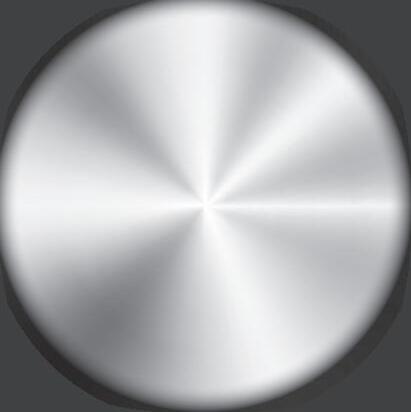
BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Österreich Handelskai 94–
Hausärzt:in pharmazeutisch
| www.boso.at boso medicus exclusive Oberarm-Blutdruckmessgerät Medizinprodukt Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel. <
96 | 1200 Wien
Handelsname Marktanteil nach Menge (Prozent) Marktanteil nach Wert (Prozent) Hersteller/Vertrieb CONCOR COR 4,6 % (1) 1,8 % (6) Merck CONCOR 3,2 % (2) 2,4 % (2) Merck NOMEXOR 3,0 % (3) 1,5 % (8) Menarini BISOPROLOL SANDOZ 2,6 % (4) 0,7 % (36) Sandoz ITERIUM 2,2 % (5) 2,2 % (4) Servier CANDAM 2,2 % (6) 2,2 % (5) Genericon Pharma LASIX 2,0 % (7) 1,1 % (20) Sanofi-Aventis LISINOPRIL GENERICON 1,8 % (8) 1,2 % (12) Genericon Pharma RAMIPRIL - 1 A PHARMA 1,7 % (9) 0,9 % (28) 1 A Pharma CANDESARTAN +PHARMA 1,7 % (10) 1,1 % (16) Pluspharma ENTRESTO 1,0 % (25) 16,0 % (1) Novartis Pharma EXFORGE HCT 1,0 % (28) 2,4 % (3) Novartis Pharma Stand: Jänner 2024 © Heuschneider-Platzer

Ernährung, Darm-Gehirn-Achse und Psyche
Nutritional Psychiatry: Der Blick über den Tellerrand, Teil 1

Nutritional Psychiatry, ein relativ junges Fachgebiet an der Schnittstelle von Ernährungswissenschaft, Psychiatrie und Psychosomatik, gewinnt zunehmend an Bedeutung in der medizinischen Forschung und Praxis.
„A lle psychischen Erkrankungen sind metabolische Erkrankungen“, meint Prof. Dr. Christopher Palmer, Psychiater in Harvard.
GASTAUTOR:INNEN-TEAM DER MED UNI GRAZ:

Priv.-Doz.in DDr.in
Sabrina Mörkl Klinische Abteilung für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie
© Opernfoto Graz

MMag.a Dr.in Sonja Lackner Lehrstuhl für Immunologie und Pathophysiologie am Otto Loewi Forschungszentrum
OMNi-LOGiC®
HUMIN:
Bei unspezifischen Diarrhöen sowie zur Bindung von Schadstoffen und Toxinen
Im Alltag ist der Mensch oft schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt. Schwermetalle sowie Rückstände aus Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln können den Organismus belasten und negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Darmmikrobiom haben. Dies äußert sich unter anderem in Form von unspezifischen Diarrhöen und gastrointestinalen Beschwerden.
Bindung belastender Stoffe
Huminsäuren stellen eine innovative Lösung für dieses Problem dar. Dabei handelt es sich um natürliche Abbauprodukte von Pflanzen, die überall in der Natur vorkommen. Die in OMNiLOGiC® HUMIN* enthaltenen Huminsäuren haben die Fähigkeit, Schadstoffe und Toxine im Darm fest an sich zu binden. So sorgen sie dafür, dass diese mit dem Stuhl ausgeschieden werden.
Schutzfilm über Darmepithel
© Opernfoto Graz

Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Jolana WagnerSkacel Leitung der Abteilung für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie
© Furgler Graz
Im Gegensatz zu Aktivkohlepartikeln erreichen die speziellen Huminsäuren vom Typ WH67® in OMNi-LOGiC ® HUMIN alle Bereiche der Darmoberfläche und legen sich so als schützender Film über die Darmepithelzellen. Dadurch stellen sie die bei einer Durchfallerkrankung beanspruchten, peripheren Nervenenden ruhig und beschleunigen die Wiederherstellung einer physiologischen Darmfunktion. Sie dichten außerdem die Schleimhäute ab und verhindern damit, dass Schadstoffe in das Blutsystem eindringen. Darüber hinaus verdrängen sie Krankheitserreger und haben einen entzündungshemmenden Effekt.
www.omni-biotic.com

BEZAHLTE ANZEIGE
* Medizinprodukt
© shutterstock.com, firefly.adobe.com/AI >
Tatsächlich ist es so: Nimmt man alle derzeit verfügbaren Studien zusammen, lässt sich keine einzige psychische Erkrankung monokausal auf die Dysfunktion eines Signalweges, eines Rezeptors, oder auch nur einer Gehirnregion zurückführen. Nichtsdestotrotz ist vor allem die pharmakologische Therapie oftmals noch so aufgebaut, dass sie monokausal und ausschließlich im Gehirn behandeln will. Multifaktorielle Erkrankungen bedürfen jedoch einer multifaktoriellen, ganzheitlichbiopsychosozialen Sichtweise. Stoffwechselvorgänge und das Mikrobiom bestimmen, wie gut wir Nahrung aufnehmen, wie Enzyme arbeiten, wie gut Neurotransmitter hergestellt werden, Mitochondrien funktionieren und Entzündungen in Schach gehalten werden. Alle diese Bausteine sind essenziell für ein gut funktionierendes Nervensystem und eröffnen neue Zugänge in der Behandlung psychischer Erkrankungen jenseits der Neurotransmitter-Wiederaufnahmehemmung und Beschränkung des Wirkkreises auf das Gehirn.
Veränderungen im Mikrobiom
Studien zeigen, dass Menschen mit psychischen Störungen oft eine andere Zusammensetzung des Darmmikrobioms aufweisen als psychisch gesunde Personen. Diese Unterschiede wurden bei Menschen mit einer Vielzahl von psychischen Erkrankungen beobachtet, darunter Depressionen, bipolare Störungen, Essstörungen, Angststörungen, Schizophrenie, und auch bei psychosomatischen Beschwerden wie dem Reizdarmsyndrom. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Veränderungen im Mikrobiom nicht typisch für einzelne psychische Krankheiten sind, sondern vielmehr transdiagnostische Bedeutung haben und auf eine allgemeine Verbindung zwischen Darmund psychischer Gesundheit hinweisen. Mittels einer Stuhlprobe kann deshalb weder eine psychische Erkrankung diagnostiziert werden, noch lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen geben. Die Art und Weise, wie unsere Ernährung und das Darmmikrobiom die Neurotransmission beeinflus-
sen, ist vielfältig und komplex. Zum einen können die im Darm lebenden Bakterien selbst Neurotransmitter wie Serotonin, Acetylcholin, GABA und Dopamin produzieren. Zum anderen spielen sie eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Gleichgewichts dieser Botenstoffe im Körper. Ein Schlüsselelement in der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn ist der Vagusnerv, der durch neu entdeckte, spezialisierte Zellen namens Neuropods, die Informationen in Millisekunden vom Darm zum Gehirn weiterleiten können, eine direkte Signalübertragung ermöglicht. Unsere Forschungsgruppe konnte kürzlich aufzeigen, dass eine größere Diversität im Darmmikrobiom mit einer besseren Funktion des Vagusnervs korreliert. Zudem ist das Darmmikrobiom entscheidend für die Immunfunktion und wirkt als epigenetischer Regulator. In diesem Kontext konnte nachgewiesen werden, dass ein Multispeziesprobiotikum positive Auswirkungen auf die Genexpression von Interleukin-6 hat, was die tiefgreifenden Wechselwirkungen zwischen Ernährung, Darmgesundheit und unserem gesamten Körperbetrieb unterstreicht.
Neurotransmittersynthese
Für die Synthese der wichtigen Neurotransmitter Dopamin und Serotonin sind spezifische Nährstoffe entscheidend. Tyrosin, eine Aminosäure, ist direkt an der Produktion von Dopamin beteiligt, während Tryptophan, eine weitere essenzielle Aminosäure, als Vorläufer der Synthese von Serotonin dient. Diese Aminosäuren sind in proteinreichen Lebensmitteln enthalten. Darüber hinaus spielen bestimmte Vitamine und Mineralstoffe eine unterstützende Rolle im Syntheseprozess dieser Neurotransmitter. Die Vitamine B6 und D etwa sind für die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin notwendig, während Eisen, Zink und Magnesium die Funktion von Enzymen unterstützen, die an der Produktion von Dopamin und Serotonin beteiligt sind. Omega-3-Fettsäuren können ebenfalls die Gehirnfunktion und die Neurotransmitteraktivität positiv beeinflussen. Eine ausgewogene Ernäh-
rung, die reich an diesen Nährstoffen ist, kann somit zur optimalen Synthese und Funktion von Dopamin und Serotonin beitragen, was für die Regulierung der Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden essenziell ist.
Entzündungsreaktionen
Wenn Entzündungen im Körper vorliegen, kann dies zu signifikanten Veränderungen im Tryptophan-KynureninStoffwechsel führen, was wiederum tiefgreifende Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit haben kann. Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure, die der Körper nicht selbst produzieren kann; sie muss daher über die Nahrung aufgenommen werden. Tryptophan ist ein Vorläufer sowohl des „Wohlfühlhormons“ Serotonin als auch des Schlafhormons Melatonin.Im Normalzustand wird ein Teil des Tryptophans in Serotonin umgewandelt, was für die Regulierung von Stimmung, Appetit und Schlaf wichtig ist. Der andere Teil kann über den Kynurenin-Weg metabolisiert werden, der verschiedene bioaktive Metaboliten produziert, die in zahlreichen biologischen Prozessen, einschließlich der Immunregulation, eine Rolle spielen.
Bei Entzündungen im Körper wird die Aktivität des Enzyms Indolamin2,3-Dioxygenase (IDO) erhöht, das den Abbau von Tryptophan zu Kynurenin
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Ernährung für die Psyche: Das Kochbuch
Von Sabrina Mörkl und Attila Várnagy
Verlag Riva
2023
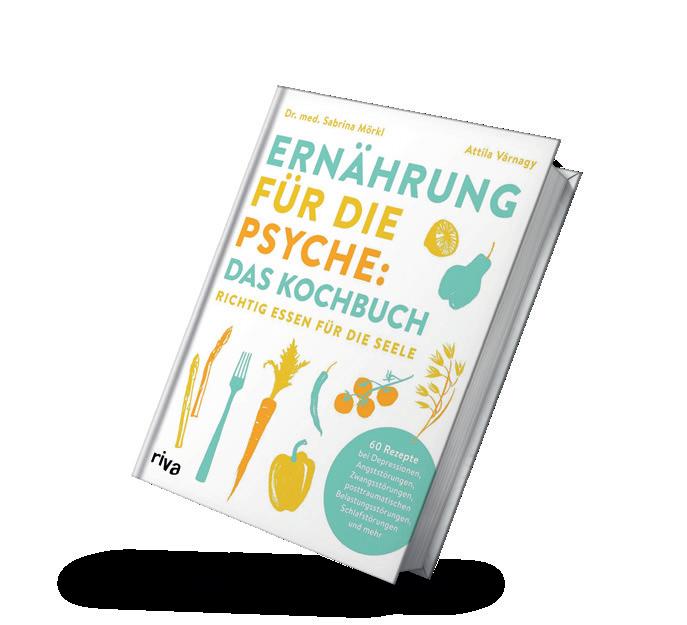
Hausärzt:in extra 44 März 2024
katalysiert. Diese Verschiebung führt dazu, dass mehr Tryptophan in Kynurenin und Quinolinsäure statt in Serotonin umgewandelt wird. Das bedeutet, dass weniger Serotonin verfügbar ist, was zu Stimmungsschwankungen und anderen Symptomen führen kann, die mit einem Serotoninmangel verbunden sind. Dazu zählen Depressionen oder Angstzustände.
Die Erhöhung des Kynurenin-Levels kann auch neurotoxische Effekte haben, da einige Kynurenin-Metaboliten wie Quinolinsäure neurotoxisch sind und zur neurodegenerativen Schädigung beitragen können. Gleichzeitig kann eine erhöhte Kynurenin-Konzentration das Immunsystem beeinflussen und zu einer weiteren Entzündungsreaktion führen, was einen Teufelskreis aus Entzündung und Tryptophan-KynureninStoffwechselveränderung erzeugt.
Zerebrale Insulinresistenz
Zerebrale Insulinresistenz spielt eine zunehmend anerkannte Rolle bei der
Entstehung und dem Verlauf psychischer Erkrankungen. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine gestörte Insulinsignalgebung im Gehirn eine Schlüsselverbindung zwischen metabolischer Dysfunktion und Stimmungsregulation darstellen könnte. Patient:innen mit Stimmungsstörungen zeigen ein erhöhtes Risiko metabolischer Dysfunktionen, wobei die Koexistenz beider Zustände typischerweise mit einem schwereren Krankheitsverlauf und schlechteren Behandlungsergebnissen verbunden ist. Insulinsignalwege im Gehirn, die durch lokal ausgeschüttetes Insulin und weit verbreitete Insulinrezeptorexpression vermittelt werden, spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der metabolischen Homöostase sowie bei der Regulierung neurotropher und synaptischer Plastizitätsprozesse, die für die Stimmungsregulation entscheidend sind. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Insulinresistenz, charakterisiert durch ein auffälliges Triglyzerid-HDL-Verhältnis, Prädiabetes und
Adipositas, das Risiko, eine Major Depression zu entwickeln, in einer 9-jährigen Follow-up-Periode signifikant erhöht. Zudem wird angenommen, dass Insulinresistenz bei 52 Prozent der Patient:innen mit einer bipolaren Erkrankung vorhanden ist und die Morbidität bei einer bipolaren Störung nach Beginn der Insulinresistenz um das Zwölffache erhöht. Das deutet darauf hin, dass Insulinresistenz den Krankheitsverlauf modifizieren kann. Diese Erkenntnisse unterstützen die Hypothese, dass eine Insulinresistenz ein testbarer und behandelbarer modifizierender Faktor in der Neuroprogression ist und die Umkehrung der Insulinresistenz bei einigen Patient:innen ein effizientes Mittel zur Erreichung der Remission sein könnte. <
VORSCHAU
Nutritional Psychiatry, Teil 2: Ernährungsformen bei psychischen Erkrankungen

natürlich im Griff.

Hausärzt:in extra
www.omni-biotic.com Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Hinweise der Gebrauchsinformation.
OMNi-LOGiC® HUMIN • Ideal bei unspezifischen Diarrhöen und gastrointestinalen Beschwerden • Bindet Schadstoffe und Toxine
Durchfall
SPRECHStunde
Patient:innen-Fragen kompetent beantworten
„Sprachtherapie bei Demenz?“
Bei einer 65-jährigen Patientin wurde vor einem Monat eine beginnende Demenz diagnostiziert. Sie ist wohnselbständig und kommt im Alltag auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zurecht. Ihr Mann ist fürsorglich, beide managen die Gedächtnis- und Orientierungsprobleme gut. Gespräche seien aber schwieriger geworden, bekundet der Ehemann. Die Patientin gibt Wortfindungsstörungen an und sagt, dass sie sich in Gesprächen teils nicht mehr zurechtfinde. Sie möchte ihre Kommunikation und Sprache möglichst aufrechterhalten und fragt, ob man da etwas tun könne.
Prof. STEINER: Die kurze Antwort: Eine Demenzdiagnose ist kein Anlass, nichts zu tun. Etwas genauer gesagt, sind drei gleichzeitig zu gehende Wege sinnvoll: medikamentöse Therapie, logopädische Behandlung, Beratung und Unterstützung. Anhaltende Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten stellen die prägnantesten Prädiktoren für kognitivmnestische Minderungen dar. Als Ärzt:in sollte man der Patient:in also erst einmal trauen, wenn sie über Sprachschwierigkeiten klagt. Für Störungen wie Versprecher und lange Wortsuche, Satzbauprobleme sowie Defizite bei der Aufmerksamkeit und der Aufrechterhaltung des roten Fadens in Gesprächen ist das subjektive Monitoring deutlich sensibler als das des Gegenübers bzw. der kommunizierenden Umwelt. Das altbekannte Screening, welches in einer ersten Phase der Demenzdiagnostik zum Einsatz kommt, der MiniMentalState, beinhaltet hauptsächlich eine Sprachprüfung.
Erste Säule: medikamentöse Therapie
Eine Unterstützung durch Medikamente lohnt sich. Man muss aber wissen, dass die Wirkung allgemeine Verbesserungen zeitigen soll, etwa in puncto Durchblutung und Stimmung, aber keine spezifischen. Das Anliegen unserer Patientin wird demnach pharmakologisch nur indirekt bearbeitet. Aufmerksamkeit und Verhalten werden allerdings positiv beeinflusst. Wenn die exekutiven Funktionen des Gehirns aufrechterhalten oder verbessert werden, können auch Sprachabruf und Kommunikation profitieren. Wichtig ist, dass Betroffene, Angehörige und Ärzt:innen im Gespräch bleiben, damit Dosierung, Wirkung und Nebenwirkungen kontrolliert werden. Diese können nämlich individuell unterschiedlich sein. Die „k lassischen“ Medikamente bei Demenz sind Neuroleptika, Antidementiva und Psychopharmaka.
Folgende Eckpunkte sind wichtig:
• Die Diagnose Demenz sollte fachärztlich gesichert sein. Cave: Hirnleistungsstörungen können immer auch Teil einer Depression sein.
• Im Zweifel die Niedrigdosierung wählen, „start low, go slow“ und zunächst so wenig verschiedene Medikamente wie möglich einsetzen.
• Der Maßstab für Indikation und Dosierung ist die subjektiv erfahrene Verbesserung der Lebensqualität der Patient:in.
• Nach festgelegten Intervallen sollten die Beteiligten Bilanz ziehen.
• Ein umsichtiger Umgang mit Kommunikations- und Verhaltensstörungen kann als Alternative zur Indikation oder Dosierungserhöhung angesehen werden.
EXPERTE:
Prof. Dr. Jürgen Steiner em. Studiengangsleiter der Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, Schullogopäde in Zürich*

Zweite Säule: logopädische Behandlung
Für ein differenziertes Bild der Probleme und Ressourcen in puncto Sprachlichkeit ist die Logopädie zuständig. Das schließt Verstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben und digitale Kommunikation ein. Der Behandlungserfolg hängt hauptsächlich von der Motivation der primär Betroffenen ab, außerdem von der Art der Demenz mit typischem oder atypischem Verlauf sowie vom Verständnis und Support der Umwelt. Soziale Teilhabe von Menschen mit Demenz erfolgt wesentlich über Kommunikation und ist das entscheidende Gegengewicht zur Depression. Ebendiese zu erleiden, laufen sowohl die primär als auch die sekundär Betroffenen Gefahr. Eine gut geführte, patient:innen- und umfeldzentrierte Behandlung trägt dazu bei, ein positives Selbst zu bewahren. Der Weg: niveauangepasstes Lesen und Schreiben, fortgeführte Benutzung digitaler Medien und Coaching des gelingenden Gesprächs trotz des Schattens der Demenz. Für den letztgenannten Bereich braucht es beide Dialogpartner:innen. Indikationskriterien für Logopädie: Die primär betroffene Person
• hat die erste Schockphase nach Mitteilung der Diagnose überwunden,
• ist ausreichend orientiert, störungsbewusst und leidend,
• ist von sich aus motiviert,
• hat einen Lern- und Bildungslebenslauf,
• kämpft um ihre Wohnselbständigkeit. Nicht alle Faktoren müssen zutreffen; Demenzform, -stadium und Alter haben keinen Einfluss auf die Indikation.
46 März 2024 Hausärzt:in extra © HfH/privat
© shutterstock.com/Archiv
Chsherbakova
Das Ziel: Aufrechterhaltung des Selbst
Die Vorgehensweisen der Logopäd:innen unterscheiden sich. Unabhängig von der Methode sollte nach den Grundwerten Einbezug, Ebenbürtigkeit und Würdigung der Ressourcen gehandelt werden. Mit allen Aktionen wird angestrebt, den substanziellen Verlust auszugleichen, der mit dem Verlust von Selbst-Wahrnehmung, -Erfahrung, -Kontrolle, -Bewusstsein, -Sicherheit und -Vertrauen nur rudimentär umschrieben ist. Die Beachtung des Lebenskontextes hat einen größeren Stellenwert als eine belastende (Test-)Diagnostik, die es auch im Rahmen anderer Hirnschädigungen zu dosieren gilt. Die Evidenzdiskussion über Logopädie bei Demenz ist müßig, da individuelle Lebensläufe auf individuelle Krankheitsverläufe treffen und es nicht um Verbesserung, sondern um Aufrechterhaltung geht. Erfolgsmitteilungen aus der Logopädie könnten darin bestehen, dass das abbestellte Zeitungsabonnement reaktiviert oder der Schreibtisch als Ort für Lektüre, Recherche, Schreibtätigkeit, Digitalität wiederbelebt wurde. Ein Arbeiten mit lebensbedeutsamen Texten im Sinne der KODOP-Therapie nach Steiner 2010 ist besonders sinnstiftend.
Ressourcen-Scouts
Aber auch die sekundär Betroffenen sind einzubeziehen. Bestenfalls gibt die Therapie Impulse für ein Selbst-Gewahrsein bezüglich hilfreicher Steuerungen im Gespräch (Kommunikation und Kooperation: langsamer, informationsarmer, stressfreier). In einer so verstandenen Logopädie geht es nicht um Üben, sondern um Empowerment, was wir mit Ermächtigung übersetzen können. Eine chronischprogrediente Erkrankung impliziert keineswegs eine Dauertherapie. Die Logopädie sollte im Modus einer befristeten Intervalltherapie beauftragt werden. Die Logopäd:in kann sich mehr als Coach und als Ressourcen-Scout verstehen. Oft werden die verbliebenen Ressourcen von den Betroffenen und von der Umwelt gleichsam unterschätzt. Wenn sie im Impliziten verborgen sind, ermöglicht die Therapie, sie explizit zu machen und auf einem angepassten Niveau zu stärken. Genau dies ist mit Erfolg gemeint.
Dritte Säule: Beratung und Unterstützung
Es ist nicht die Aufgabe der Ärzt:in, ausführlich zu beraten. Kennen sollte man aber die ersten Anlaufstellen wie die Österreichische Alzheimer Gesellschaft und den Berufsverband logopädieaustria. Unter logopaedieaustria.at/ logopaedin-suche lassen sich in freier Praxis tätige Therapeut:innen finden, etwa nach Orten und Behandlungsschwerpunkten gefiltert.
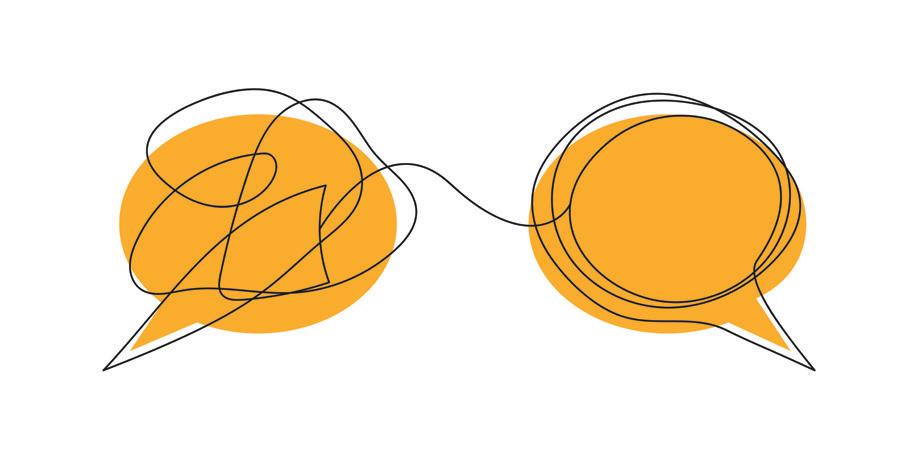
©
Hausärzt:in extra 47 März 2024 <
* Der Experte verfasst neben Fachwerken wie „Sprachtherapie bei Demenz“ (Ernst Reinhardt Verlag) auch Belletristik und weist unsere Leser:innen auf seinen zweiten Roman hin: „Es geht um nicht weniger als um die Liebe, das Leben und den Tod. Suchen Sie bei Amazon nach Jürgen Steiner, ‚Der fünfte Tag im Leben von Leon dem Teemeister‘ Dort gibt es das E-Buch zum symbolischen Preis. Ich freue mich auch über Ihre Bewertung.“ shutterstock.com/Yuliya
Leitthema Atemnot …
… beim 23. Consensus Meeting der AG Herzinsuffizienz
Am 27. Jänner 2024 fand das 23. Consensus Meeting der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) in Wien statt.* Fünf Fachvorträge behandelten das Thema Atemnot bei Herzinsuffizienz, moderiert von Univ.-Doz. Dr. Martin Hülsmann, AKH Wien, und Priv.-Doz. Dr. Deddo Mörtl, Universitätsklinikum St. Pölten.
Notfallmedizin
Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Christoph Testori von der MedUni Wien präsentierte die Diagnosealgorithmen für akute Atemnot in der Notfallmedizin. Die Häufigkeit der zugrunde liegenden Ursachen variiert je nach Art der medizinischen Einrichtung: In Krankenhaus-Notaufnahmen treten vermehrt COPD (16 %), Herzinsuffizienz (16 %), Pneumonie (9 %) und Herzinfarkte (5 %) auf, während im niedergelassenen Bereich akute Bronchitis (25 %) und Infektionen der oberen Atemwege (10 %) häufiger sind.1 Zur Ersteinschätzung kritisch kranker Patient:innen wird das ABCDE-Schema verwendet, das Airway (Atemweg), Breathing (Atmung), Circulation (Kreislauf), Disability (neurologischer Zustand) und Exposure (Exposition) umfasst, gefolgt von einer genauen Notfallanamnese.² In der Notfalldiagnostik kommen verschiedene technische Hilfsmittel wie EKG, Biomarker und bildgebende Verfahren – auch mit sehr schnellem Einsatz von CT oder Herzkatheter – aufgrund ihrer leichten Verfügbarkeit zur Anwendung.1,3
Im niedergelassenen Bereich verschieben sich nicht nur die Ursachen für Atemnot, sondern auch die verfügbaren diagnostischen Mittel. Hier sind Anamnese, Status und Stethoskop neben Ultraschall und Biomarkern weiterhin entscheidend für die Primärdiagnostik. Die Kombination von Biomarkern wie natriuretischen Peptiden (bei Herzin-
suffizienz), Troponinen (bei akutem Koronarsyndrom) und D-Dimer (bei Lungenembolie) ermöglicht eine schnelle differenzialdiagnostische Einschätzung.4-6 Basierend darauf wird eine vorläufige Arbeitsdiagnose formuliert, die erst dann zu spezifischen weiteren diagnostischen Maßnahmen und Behandlungen wie Koronarangiographie und Thorax-CT veranlasst.
Weitere Vorträge
Die anderen Themen des Consensus Meetings im Überblick:
• Lebensqualität: Doz. Mörtl unterstrich die enge Verbindung zwischen Lebensqualität und Symptomen bei Herzinsuffizienz.
• Lungenhochdruck: Priv.-Doz. Dr. Christian Gerges, PhD (MedUni Wien) widmete sich der pulmonalen Hypertonie und ihrer Verbindung mit Atemnot.
• Herzinsuffizienz: Dr.in Henrike Arfsten, PhD (MedUni Wien) diskutierte die komplexe Natur von Atemnot bei Herzinsuffizienz, die durch erhöhte Füllungsdrücke, Volumensretention, neurohumorale Reaktionen und Veränderungen im kardialen Stoffwechsel verursacht wird.
• Klappenerkrankungen: Dr. Andreas Strouhal (Krankenhaus Hietzing in Wien) behandelte Herzklappenerkrankungen wie Aortenstenose und Mitralinsuffizienz, die häufig mit Atemnot einhergehen.
Gastautor: Dr. Noel G. Panagiotides (MedUni Wien)
Literatur:
1 Berliner D et al., Dtsch Arztebl Int. 2016;113(49): 834-844.
2 Perkins GD et al., Resuscitation. 2021 Apr;161:1-60.
3 Michalke JA, World J Emerg Med. 2012;3(2):85-90.
4 McDonagh TA et al., Eur Heart J. 2021;42(36): 3599-3726.
5 Collet JP et al., Eur Heart J. 2021;42(14):1289-1367.
6 Konstantinides SV et al., Eur Heart J. 2020;41(4): 543-603.
NACHBERICHT

Lesen Sie den Artikel in voller Länge mit der Zusammenfassung aller Vorträge der Veranstaltung online auf Gesund.at:
* 23. Consensus Meeting der Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz der ÖKG, 27. Jänner 2024, Novotel Wien Hauptbahnhof.
Hausärzt:in extra 48 März 2024
© shutterstock.com/AI
Das Akne-Stigma
Laut Studie sind Vorurteile weit verbreitet
Menschen mit Akne, vor allem im Gesicht, leiden unter ihrer Erkrankung – das ist wissenschaftlich belegt. Eine aktuelle US-Studie zeigt nun die andere Seite – nämlich, wie die Gesellschaft auf Personen mit Akne reagiert. Dermatolog:innen des Brigham and Women’s Hospital in Boston konnten darlegen, dass es sich bei dieser Einschätzung nicht bloß um eine subjektive Wahrnehmung handelt. Das Forscher:innenteam ließ Fotos von vier Erwachsenen (jeweils zwei Männer und Frauen mit heller oder dunkler Hautfarbe) digital bearbeiten. Mit dem Original ergab das zwölf Fotos, darunter Porträts mit leichter oder schwerer Akne und die aknefreien Originalporträts.
Hautfarbe spielt eine Rolle
Jede Proband:in erhielt ein Porträtfoto und wurde gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 1.357 Studienteilnehmer:innen (Alter: Ø 42 Jahre; 918 weiblich, 439 männlich; mehrheitlich hellhäutig mit hohem Bildungsniveau) nahmen an der Onlineumfrage teil, bei der sie unter anderem gefragt wurden, ob sie sich mit der abgebildeten Person anfreunden oder zu einem „Date“ verabreden würden, ob körperlicher Kontakt für sie ein Problem wäre und ob sie sich vorstellen könnten, der Person einen Job anzubieten. Die Antworten belegen, dass die Befragten in den meisten Fällen auf Distanz gehen würden. Dabei gab es keine Unterschiede bezüglich des Geschlechts, wohl aber in Hinblick auf die Hautfarbe: Dunkelhäutige Menschen erleben häufiger soziale Distanz, wenn sie unter Akne leiden.
Wie Akne beurteilt wird
Die Befragten erachteten Personen mit schwerer Akne als eher unhygienisch sowie unattraktiv und stuften sie häufiger als unintelligent, unsympathisch, unreif und nicht vertrauenswürdig ein. Dabei wurde ersichtlich, dass Teilnehmer:innen, die selbst Akne haben oder zu einem früheren Zeitpunkt daran litten, weniger Berührungsängste hinsichtlich Betroffener zeigten. Die Studienergebnisse bestätigen zudem, dass Personen mit Akne stigmatisiert und vermutlich auch im Arbeitsleben benachteiligt werden.

Justyna Frömel, Bakk. MA
Quelle: Shields A et al., Evaluation of Stigma Toward Individuals With Acne, JAMA Dermatology, 2024;160(1):93-98.
© shutterstock.com/Pewara Nicropithak Hausärzt:in extra 49 März 2024
TERMINE Aktuelle Kongresse und mehr
18.04.2024
EoE – eosinophile Ösophagitis (ÖGGH-Fortbildung)
Ort: Gesellschaft der Ärzte in Wien – Billrothhaus
27.04.2024
3. Oberösterreichischer Rheumatag
Ort: Schlossmuseum Linz
13.-16.05.2024
38. Jahrestagung der ÖGHMP (Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin)
Ort: Salzburg Congress
IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber:
18.-19.04.2024
Schmerzkongress und Workshop Moorheilbad Harbach
Ort: Franz Himmer Kongressund Veranstaltungszentrum
02.-04.05.2024
31. Atherosklerose Jahrestagung
Ort: Parkhotel Billroth –St. Gilgen
16.-18.05.2024
EADV Symposium (Dermatologie und Venereologie)
Ort: Hilton Conference/Business Centre in St. Julian’s, Malta
RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Margit Koudelka, Felicia Steininger, Mara Sophie Anmasser, Justyna Frömel, Bakk. MA.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Angie Kolby.
Cover-Foto: firefly.adobe.com/AI.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärzt:innen.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
26.-27.04.2024
Kärntner Internistentage „Innere Medizin am See“ 2024
Ort: Hotel Werzer Astoria in Pörtschach
04.-05.05.2024
26. Substitutions-Forum
Ort: Schlosshotel Mondsee
Weitere Infos und Veranstaltungen finden Sie in unserem Kongresskalender unter:
Wichtig
gesund.at/ kongresskalender
Selbstverständlich erarbeiten wir alle Inhalte unserer Ratgeber sorgfältig. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig und aktuell ist bzw. sich seit dem Druck keine Gesetzesänderung ergeben hat.
Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen. Bei individuellen Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung: (01) 501 65 0
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.arbeiterkammer.at
In unserem Fachmagazin setzen wir auf genderneutrale Sprache. Verwendet wird der Doppelpunkt – als beste Symbiose aus Leserlichkeit und Inklusion. Zugunsten der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf die gänzlich orthografisch/ grammatikalisch korrekte Schreibweise. Etwa geben wir bei Artikeln und Pronomen jeweils nur eine Variante an – jene, die zur längeren Variante des gegenderten Wortes gehört. Weitere Informationen siehe: meinmed.at/kommunikation/genderneutrale-sprache/2688 issuu.com/hausarzt/docs/ha_2023_12/3 (Hausärzt:in 12/23, Editorial, S. 3) Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden. Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum
Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie bereit: wien.arbeiterkammer.at/publikationen
Weitere Bestellmöglichkeiten:
■ EMail: mitgliederservice@akwien.at
■ Bestelltelefon: (01) 501 65 1401
Artikelnummer 456
Hausärzt:in extra 51 März 2024
Der Nasenspray mit 2-fach-Power
RyaltrisTM (Mometasonfuroat/Olopatadin) bei allergischer Rhinitis
RyaltrisTM Nasenspray ist eine fixe Dosiskombination aus Mometasonfuroat und Olopatadin zur Behandlung mäßig bis stark ausgeprägter Nasensymptome bei allergischer Rhinitis.1 Mit RyaltrisTM werden nicht nur die klassischen Symptome, wie Niesen, Juckreiz der Nase, nasale Verstopfung und Rhinorrhoe wirksam bekämpft2-4, sondern es wird auch die Lebensqualität Ihrer Patient:innen bei der kurz-2,3 und langfristigen4 Anwendung gesteigert. RyaltrisTM wirkt schnell, innerhalb von 15 Minuten2,3, und zeigt in der Langzeitanwen-
dung über 52 Wochen ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil.4
RyaltrisTM ist die rasche und wirksame Therapie zur Verbesserung der Symptome und der Lebensqualität bei allergischer Rhinitis2,3. RyaltrisTM Nasenspray wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Die empfohlene Dosis beträgt zwei Sprühstöße in jedes Nasenloch zweimal täglich, morgens und abends.1
Antivirale, antibakterielle & schleimlösende Wirkung
Kaloba® bekämpft Ursache und Symptome bei Bronchitis und Erkältung
Der in Kaloba enthaltene Extrakt aus der Kapland-Pelargonie lindert nicht nur Erkältungs- und Bronchitis-Symptome, sondern bekämpft nachweislich auch deren Ursache mit seinem DreifachWirkmechanismus.
Präparate aus der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) versprechen oft viel, doch Pelargonium ist nicht gleich Pelargonium. Ihr besonderer Dreifach-Wirkmechanismus ist ausschließlich für EPs® 7630 nachgewiesen. Der ausschließlich in Kaloba® enthaltene Extrakt wirkt nicht nur lindernd auf typische Symptome, sondern bekämpft die häufigsten Auslöser der Erkältung: die Viren. In über 30 klini-
Referenzen:
1 Fachinformation RyaltrisTM
2 Gross GN et al., Ann Allergy Asthma Immunol 2019;122(6):630-638.e3.
3 Hampel FC et al., Allergy Asthma Proc 2019;40(4):261-272.
4 Segall N et al., Allergy Asthma Proc 2019;40(5):301-31.
RyaltrisTM sollte nicht angewendet werden, wenn eine unbehandelte lokale Infektion der Nasenschleimhaut vorliegt, wie z. B. Herpes simplex, und bei Patient:innen, die kürzlich eine Nasenoperation oder ein Trauma erlitten haben, bis eine Heilung eingetreten ist.1



Quelle: A. Menarini Pharma GmbH
schen Studien mit 10.000 Teilnehmenden, unter denen auch 4.000 Kinder waren, konnte EPs® 7630 zeigen, dass der pflanzliche Wirkstoff Pathogene wie Influenza-A-Viren, Humane Coronaviren, Adenoviren und Rhinoviren hemmt.1 EPs® 7630 ist für Erwachsene sowie für Kinder ab einem Jahr in Form von Tropfen und Sirup geeignet. Der Extrakt wird in aufwändigen Verfahren aus den von Hand geernteten Wurzeln der Pelargonium gewonnen, die zu einem bestimmten Erntezeitpunkt ihre optimale Wirkstoffkonzentration enthalten. Der so entstehende Extrakt von standardisierter, gleichbleibender Qualität wirkt nicht nur direkt antiviral, sondern ver-
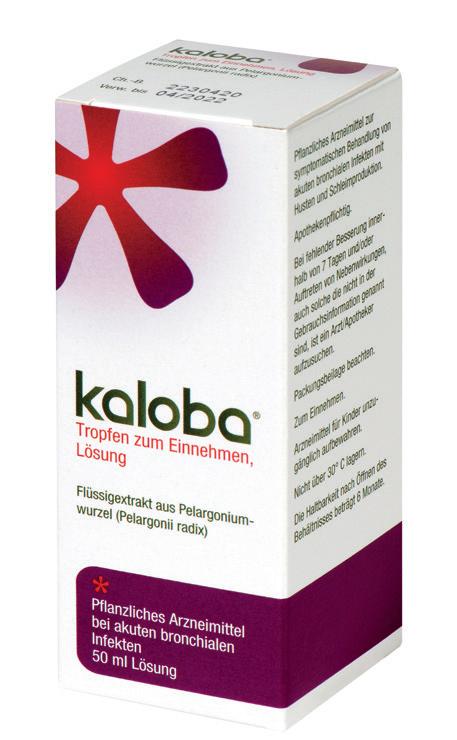
hindert durch seine zusätzlich antibakterielle Wirkung das Anhaften von Bakterien2 und damit die Entstehung von komplizierten Superinfektionen. Gleichzeitig wirkt EPs® 7630 schleimlösend3 und unterstützt damit den Abtransport der Krankheitserreger aus dem Körper. Bei Bronchitis zeigte sich überdies eine Verkürzung der Krankheitsdauer von zwei Tagen im Vergleich zur Placebogruppe4.
Referenzen:
1 Michaelis M et al., Phytomedicine 2011; 18:384-386.
2 Conrad A et al., Phytomedicine 2017; 14 (Suppl.VI): 46-5.
3 Neugebauer P et al., Phytomedicine 2005; 12: 47–52.
4 Matthys H et al., Phytomedicine 2003; 10 (Suppl.4): 7-17.
Quelle: Schwabe Austria GmbH
55 März 2024 Hausärzt:in informativ AT-RYA-26-10-2023 Fachkurzinformation siehe Seite 54
KAL_PR1400_10_2021 Fachkurzinformation siehe Seite 54,55


















Stark und sicher durch den Alltag




Femalen Inco ControlZur Stärkung der Blasenfunktion





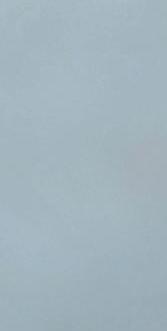






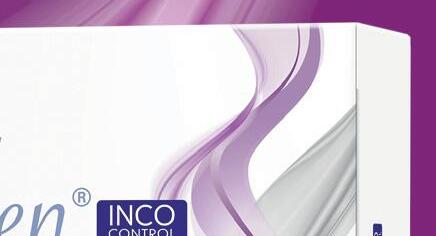





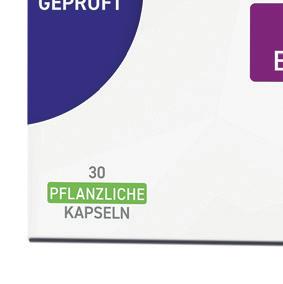
Viele Frauen sind von Blasenproblemen betroffen. Häufiger Harndrang sowie unkontrollierter Harnverlust schränken die Lebensqualität betroffener Frauen stark ein. Femalen Inco Control lindert Blasenprobleme mit einer einzigartigen Wirkstoffkombination aus dem patentierten schwedischen Pollenextrakt (UriCyTonin® Komplex), Kürbiskernextrakt und Vitamin E (Zellschutz).
> Nur 1x täglich > Pflanzliche Kapsel > Wissenscha lich geprü e Formel > Keine hormonelle oder phytoöstrogene Wirkung > Allergene Bestandteile der Pollenschale sind entfernt

Minus
€ 2 auf jeden Kauf
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen. ** Palacios S, Ramirez M, Lilue M, Vega B. Evaluierung von Femaxeen® für die Kontrolle der Harninkontinenz bei Frauen. Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie. Maturitas. 2020;133:1-6. Nahrungsergänzungsmittel Wirksamkeit durch Studie belegt Aktion gültig von 1.3. - 30.6.2024
AT/Femalen/2024003





































































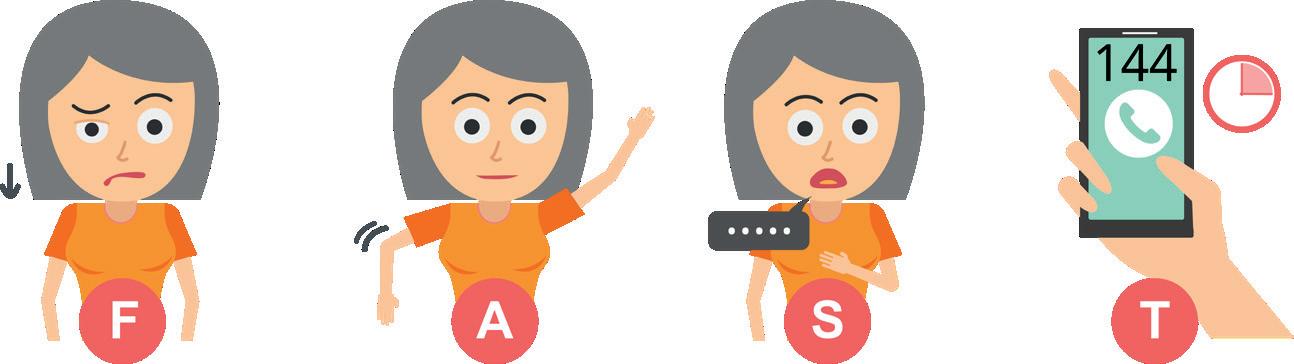



















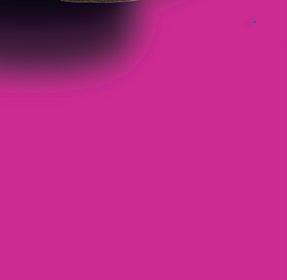







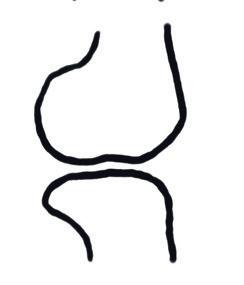
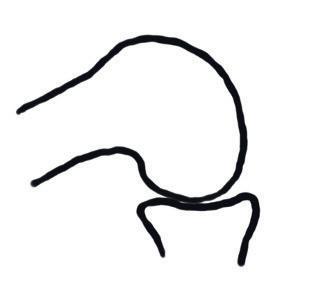
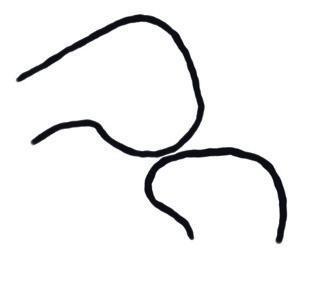
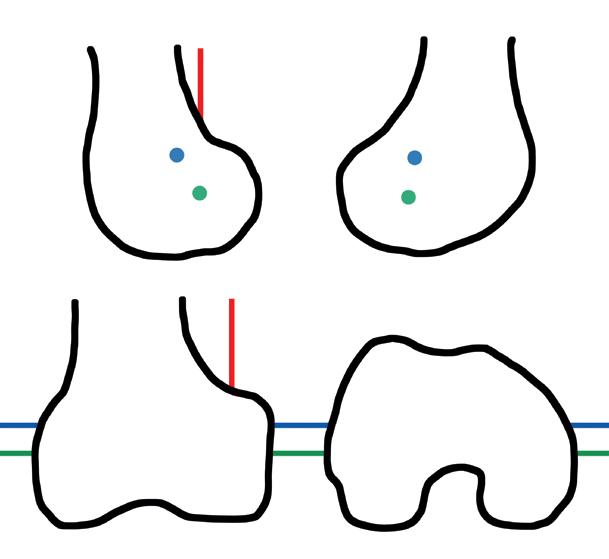


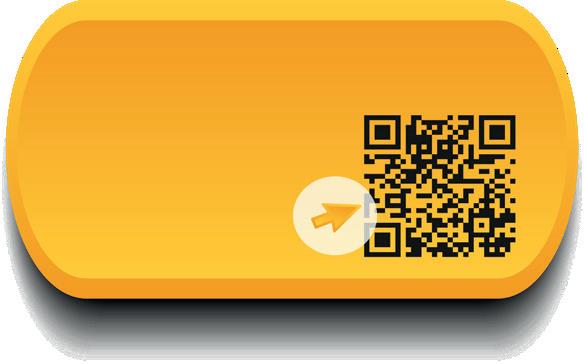






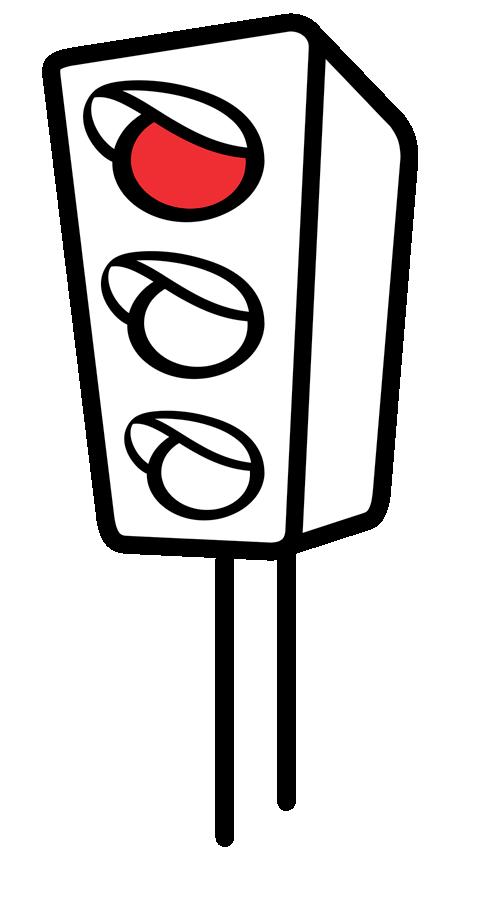

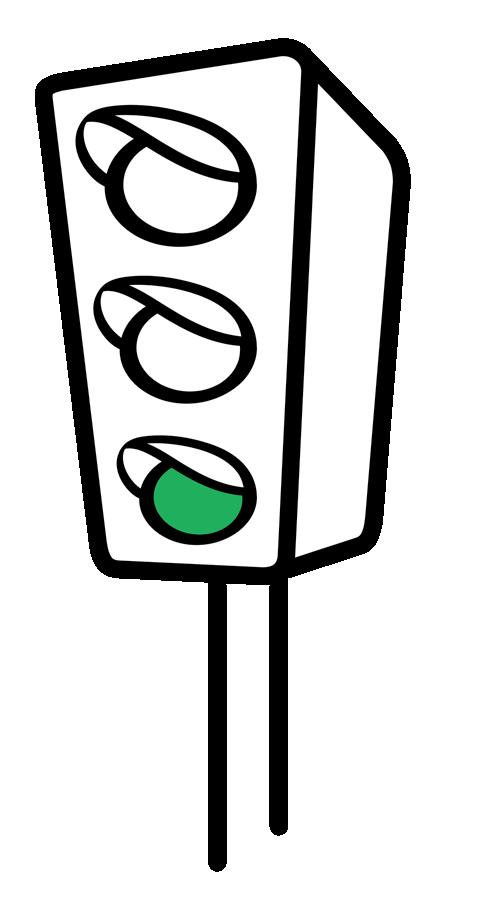
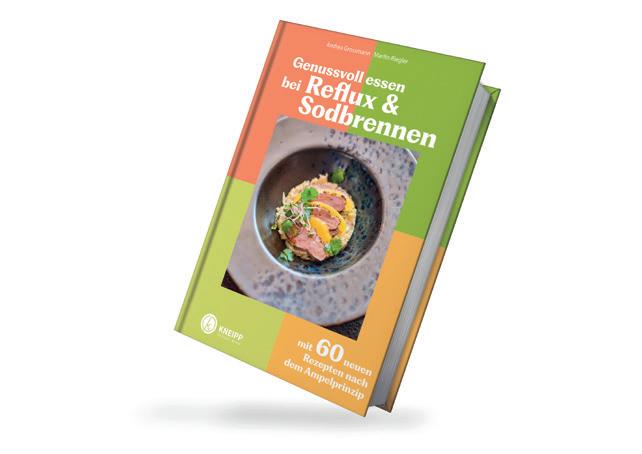


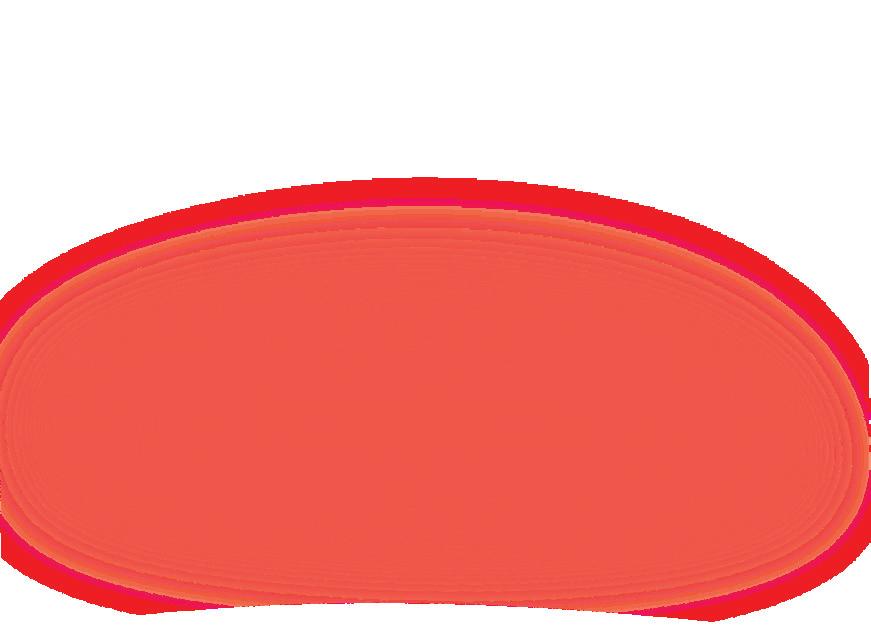

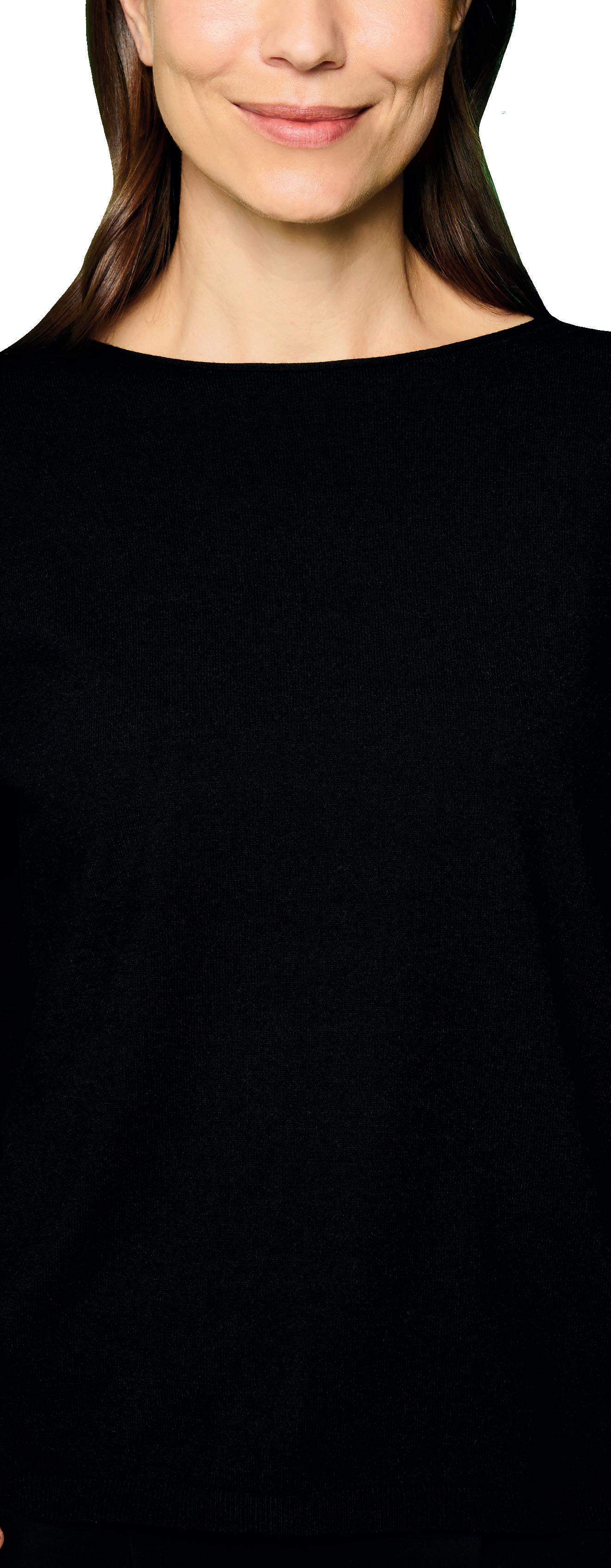




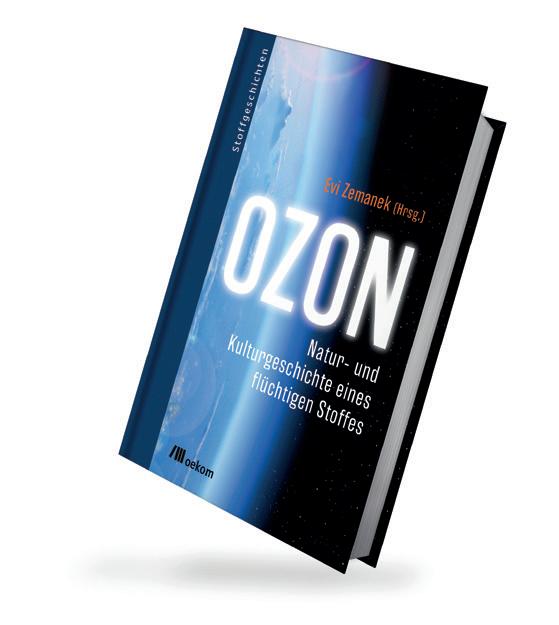

 Margit Koudelka
Margit Koudelka