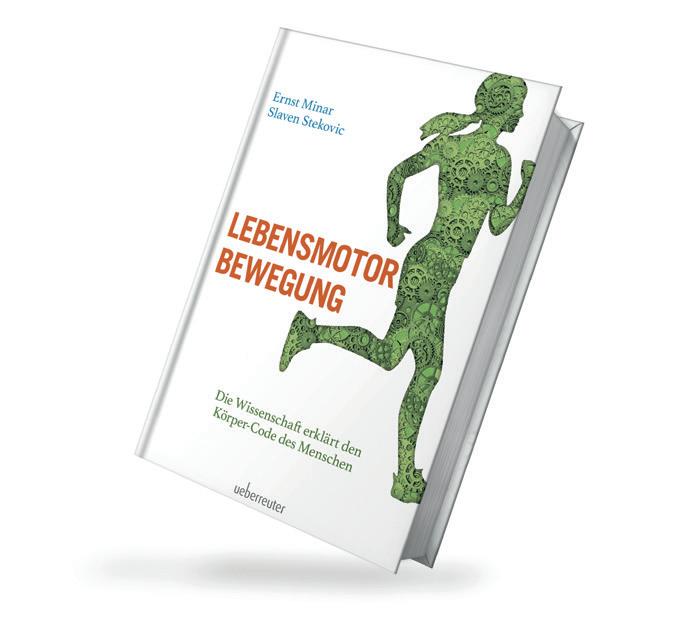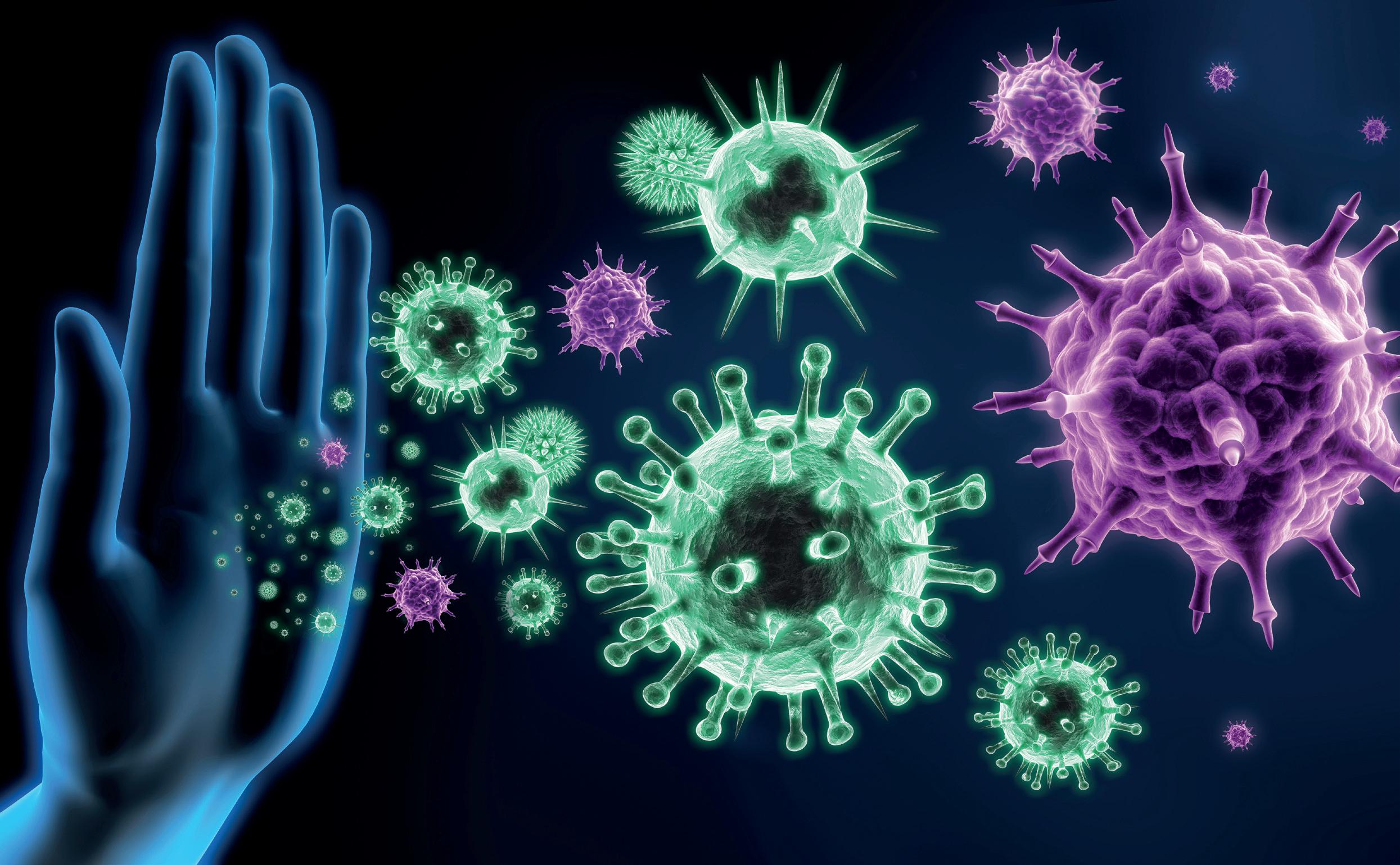Konzentrationsstörungen ein Schnippchen schlagen
Regelmäßig
07-08/2023 Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie


DER DIABETOLOGIE Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien
Themen auf
FRISCHER WIND IN
Die Young Diabetologists greifen innovative
Mindestens 5.000 Schritte, über den Tag verteilt bewegt
Schlau gewachsen
Vorankündigung
Samstag, 07. Oktober 2023, 08:30 - 17:00 Uhr
Hotel Savoyen, Rennweg 16, Wien 1030
Kosten
Mitglieder: 75 €
Nicht-Mitglieder: 95 €
Anmeldung
https://www.arztassistenz.at/fortbildung/ termine-im-ueberblick/bda-termine/ tagungen-kongresse/8-bda-kongress













6 BdA Fortbildungspunkte
BdA-KONGRESS WIEN

Personalisierte Medizin: Hintergrundwissen für die Ärzt:in-Assistenz


© shutterstock.com/ADragan
Mode- und neues Zauberwort: Attraktivierung
In den Redaktionen geht es im Juli/August meist etwas weniger heiß zu als im restlichen Jahr, Stichwort Sommerloch. Wobei die Betonung auf „meist“ und „etwas“ liegt. Denn oft stehen – wie auch in diesem Jahr – etliche Sonderproduktionen an, die es vor dem Herbst zu finalisieren gilt. Trotzdem ist die Sommerzeit für unser Team auch Urlaubszeit und damit essenziell, um Sonne und Energie zu tanken (siehe Foto). Der Herbst verspricht gesundheitspolitisch heiß zu werden. Die Finanzausgleichsverhandlungen sollen abgeschlossen werden. Ob gegenüber den Ländern, der Ärztekammer, der Gesundheitskasse oder anderen Stakeholder:innen: Man kann Bundesminister Johannes Rauch nicht vorwerfen, konfliktscheu zu sein oder keine echten Systemverbesserungen zu wollen. Zu hoffen bleibt, dass eine Einigung gelingt, dass also künftig wirklich deutlich mehr Geld in den Gesundheitsbereich fließt. Und dass tatsächlich, wie von der Bundesregierung im Paket zur Gesundheitsreform Ende Juli angekündigt, spürbare Verbesserungen für die Bevölkerung kommen werden, wie mehr Kassenstellen, eine bessere Prävention und der Ausbau der psychosozialen Versorgung.

Was macht Kassenmedizin attraktiv?

Die Attraktivierung des niedergelassenen Bereichs scheint zum Mode- und neuen Zauberwort geworden zu sein. So fordert die Österreichische Gesundheitskasse, dass die Bundesregierung auch unterstützend eingreifen müsse, um
die versprochenen neuen Kassenstellen mit den Sozialversicherungen schnell auf den Weg zu bringen und sie „entsprechend zu attraktivieren“. Ein einheitlicher und ausgebauter Leistungskatalog sei das Gebot der Stunde. Skurril nur, dass die Ärztekammer schon 2021 ein Konzept für einen solchen vorgelegt und seither beklagt hat, dass es unbeachtet blieb … Seitens der Ärztekammer ist man mit den Plänen des Gesundheitsministers nicht durchgehend d’accord, gesteht der Regierung aber auch zu, „den Ernst der Lage zumindest erkannt“ zu haben. 100 neue Kassenarztstellen sollen ja mit einem Startbonus leichter besetzbar werden. Geld allein werde aber nicht ausreichen, um „d ie Kassenmedizin zu attraktivieren“, so die Standesvertretung in einer Aussendung. Als Beispiele bringt sie – abgesehen vom einheitlichen Leistungskatalog – flexiblere Verträge und eine bessere Honorierung der Gesprächsmedizin. Primärversorgungszentren könnten nicht alle Probleme lösen. Zudem gebe es mittlerweile in vielen Fachbereichen Besetzungsprobleme.
Mehr Anziehungskraft auch für Fachgebiete
Die einzelnen Gesellschaften sind also ebenso gefordert, ihre Fächer zu attraktivieren, um dem Nachwuchsmangel zu begegnen. In der aktuellen Titelgeschichte der Hausärzt:in zeigen wir am Beispiel der Diabetologie auf, wie es gelingen kann, junge, an der Fachrichtung interessierte Mediziner:innen zu vernetzen und zu unterstützen, ja ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Diabetologie von morgen mitzugestalten.

Starten Sie gut und motiviert in den Herbst, die Natur hat im Spätsommer eine besonders magische Anziehungskraft!

Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit
Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at
3 Juli/August 2023 © privat
Unser Hausärzt:in Redaktionsteam (v. l. n. r.): Margit Koudelka, Angie Kolby, Ines Pamminger, Anna Schuster und Karin Martin.
medizinisch
06 Eine Frage der Menge? Nahrungsmittelintoleranzen und -allergien: bei rezidivierenden Bauchschmerzen hin zur richtigen Diagnose und Therapie
10 Tierisch gefährlich Serie Tropenmedizin, Teil 2: Wie vorgehen, bei Unfällen im Wasser oder mit Tieren?
18 „Verhängnisvolles Trio“ Der Zusammenhang zwischen Diabetes, Herzund Nierengesundheit und die Herausforderung in der Therapie
20 Mindestens
5.000 Schritte, über Tag verteilt Wie auch regelmäßige Bewegung – also nicht nur Sport –gesund hält
22 Opportunistische Infektionen

Risikomanagement bei immunsuppressiver Therapie
pharmazeutisch
25 Schlau gewachsen Konzentrationsstörungen mit Hilfe der Naturheilkunde ein Schnippchen schlagen
28 „Indikationen & Interaktionen stets berücksichtigen“
Traditionelle Europäische Heilkunde für Patient:innen mit Herzbeschwerden
30 Oftmals unterschätzt Erhöhtes Risiko RSVassoziierter Hospitalisierungen im Alter – erste Zulassung eines Impfstoffs für ältere Erwachsene
32 10
JUNGE DIABETOLOGIE
12 „Frischer Wind“
Die Young Diabetologists greifen aktuelle und innovative Themen auf
16 SPRECHStunde „Prävention nach Gestationsdiabetes?“
extra
31 Onkologische Versorgung sicherstellen
Expert:innen fordern, Cancer Nurses in Österreich zu etablieren
Ärztliche Herausforderungen in den Tropen.
IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber:
Umweltmedizin: Anpassung als Selektionseffekt.
RegionalMedien Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka, Marcel Toifl.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Angie Kolby.
Cover-Foto: shutterstock.com/cezarksv.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Claudia Szkutta, claudia.szkutta@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
32 Arzt Sicht Sache „Temperaturextreme gefährden die Volksgesundheit“

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte bzw. gänzlich orthografisch/grammatikalisch korrekte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden.
Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke.
Offenlegung: gesund.at/impressum
Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis
dossier
© unsplash.com/George Stewart
©
shutterstock.com/Tom Wang
Juli/August 2023 4


53. Kongress für Allgemeinmedizin 23.25. November 2023, Stadthalle Graz Medizin in Bewegung © vermed. Quelle: Adobe Stock, pickup ... und Befinden Vom Befund ... Programmanforderung vermed G.m.b.H., St. Peter-Pfarrweg 34/11/47, 8042 Graz Tel.: 0316 / 42 60 82, office@vermed.at v e r m e d www.stafam.at 2023 Ausschließlich ONLINEANMELDUNG www.stafam.at
Eine Frage der Menge?

Nahrungsmittelintoleranzen und -allergien: bei rezidivierenden Bauchschmerzen hin zur richtigen Diagnose und Therapie

Wenn Menschen auf bestimmte Inhaltsstoffe von Lebensmitteln mit Beschwerden wie Durchfall, Blähungen bzw. Windabgängen reagieren, kommen als Ursache dafür Unverträglichkeiten im Rahmen einer gastrointestinalen Erkrankung oder ein veränderter Umgang des Körpers mit diesen Substanzen in Frage. Intoleranzen finden trotz ihrer Häufigkeit kaum Beachtung in der ärztlichen Aus- und Fortbildung. Daraus können Diagnose- und Behandlungsfehler, zu strenge oder falsche Diäten, höhere Kosten für die
Lebensführung, eine Einschränkung der Lebensqualität und eine Malnutrition resultieren.
Bei Intoleranzen handelt es sich um dosisabhängige Unverträglichkeiten, nicht um dosisunabhängige Nahrungsmittelallergien! Intoleranz wird durch die gleichzeitige Einnahme anderer Nahrungsmittel, durch Lebensumstände (z. B. Stress oder Trauer) sowie durch andere begleitende Erkrankungen (z. B. ein Reizdarmsyndrom, Gallensteine oder eine entzündliche Darmerkrankung) beeinflusst.
Hausärzt:in medizinisch Juli/August 2023 6 © shutterstock.com/BlurryMe
Serie
„Bei Intoleranzen handelt es sich um dosisabhängige Unverträglichkeiten –im Gegensatz zu dosisunabhängigen Nahrungsmittelallergien.“
GASTRO
Laktose- und Fruktoseintoleranz berücksichtigen







Bei einer Laktoseintoleranz kann der Verzehr von Milchprodukten sowie von Nahrungsmitteln, welche Laktose als Zusatzstoff enthalten, – abhängig von der zugeführten Menge sowie von anderen begleitend eingenommenen Nahrungsmitteln – zu Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall führen. Ein wichtiger Cofaktor sind vorbestehende Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, beispielsweise ein Reizdarmsyndrom. Laktose muss, bevor sie verdaut werden kann, vom Enzym Laktase im Dünndarm in ihre Bestandteile Glukose und Galaktose zerlegt werden. Bei einem Mangel an Laktase gelangt der Milchzucker in ungespaltener Form in den Dickdarm und wird dort von Bakterien zu Gasen (unter anderem Wasserstoff) abgebaut. Symptome entstehen üblicherweise nur, wenn mehr als 10 g Laktose zugeführt werden, was dem Laktosegehalt von ¼ Liter Milch entspricht.



Der menschliche Dünndarm hat physiologisch nur eine sehr begrenzte Kapazität, Fruchtzucker (Fruktose), Birkenzucker, Sorbit sowie einige andere Kohlenhydrate und Zucker aufzunehmen. Das dafür zuständige Transportsystem GLUT5 kann allerdings durch die gleichzeitige Einnahme von Glukose stimuliert werden. Fruktose wird von der Nahrungsmittelindustrie gerne zum Süßen verwendet, da die relative Süßkraft höher ist als jene von Haushaltszucker (Saccharose). Dadurch wird GLUT5 im Dünndarm überlastet. Die Fruktose gelangt daher unverdaut in den Dickdarm und wird dort von der Darmflora abgebaut. Infolgedessen können Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit oder Durchfall auftreten. Auch hier liegt der Intoleranz häufig ein Reizdarmsyndrom zu Grunde. Die Intoleranz wird mit Hilfe eines validierten Fragebogens oder mit der CarboCeption-App nachgewiesen. Diese beiden diagnostischen Hilfsmittel wurden an den Medizinischen Universitäten Graz und Wien entwickelt und entsprechen den Vorgaben der im Jahr 2022 veröffentlichten











Endlich wieder genießen!









Kohlenhydratintoleranzen können mit Hilfe einer App nachgewiesen werden.

















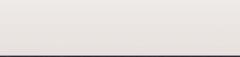









© privat
Nahrungsmittelunverträglichkeit?
auf natürliche Weise beim Abbau von Histamin, Laktose und Fruktose!
Infos unter www.alles-essen.at 980_SCI_1221
GASTAUTOR: Univ.-Prof. Dr. Heinz Hammer Medizinische Universitätsklinik Graz, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie
Hilft
Weitere
> © zVg
* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinprodukts informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
Europäischen Leitlinie. Die CarboCeption-App wird auch vom Verband der Diaetologen Österreichs für die Diagnosestellung einer Kohlenhydratintoleranz in seiner aktuellen FODMAP-Beratungsrichtlinie empfohlen.
Tests und ihre Aussagekraft
In dieser Leitlinie wurde auf die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen der mittels Atemtests feststellbaren Malabsorption und der mittels Symptombefragung nachweisbaren Intoleranz hingewiesen. Der alleinige Nachweis einer Malabsorption durch einen H2Atemtest hat keine Relevanz. Ein positiver Test ohne Symptommessung bietet keine ausreichende Erklärung für die Symptome, die zur Zuweisung des Patienten geführt haben. Er ist somit auch kein ausreichender Grund für eine Diättherapie oder für eine Behandlung mit Nahrungsergänzungsmitteln, z. B. mit Laktasepräparaten oder XyloseIsomerase. Nur die Ergebnisse der Intoleranzmessung, nicht aber die Ergebnisse des Atemtests sind für die kausale Zuordnung der Symptome und für den Entschluss zu einer Therapie relevant. Mit dem H2-Atemtest oder dem Laktase-Gentest kann die mangelhafte Aktivität der Laktase belegt werden. Ohne gleichzeitigen Nachweis des Zusammenhangs mit der Entwicklung von Symptomen haben diese Tests allerdings keine therapeutische
Relevanz. Entscheidend für die Empfehlung der Durchführung einer Diättherapie oder der Verwendung von medikamentösen Hilfsmitteln wie Laktasepräparaten oder D-Xylose-Isomerase bei Fruktoseintoleranz ist der Nachweis des Zusammenhangs zwischen der Zufuhr dieser Kohlenhydrate und der Entstehung von Symptomen. Ein vollständiges Vermeiden von Laktose bzw. Fruktose ist nicht notwendig.
Bei Nahrungsmittelallergien vollständige Vermeidung
Allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel werden durch das körpereigene Immunsystem ausgelöst. Bei Erwachsenen treten sie am häufigsten bei Pollenallergikern mit respiratorischen Symptomen auf. Ursache kann eine Kreuzallergie in Bezug auf Pollen und Nahrungsmittel sein. So ist das Eiweiß in Birkenpollen ähnlich aufge-

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
baut wie das Eiweiß in manchen Steinobstsorten. Es kann daher beim Birkenpollenallergiker sowohl durch das Einatmen von Polleneiweiß als auch durch den Verzehr der kreuzreagierenden Steinobstsorten zu allergischen Symptomen kommen. Die Diagnose erfolgt mittels Allergietests. Die Therapie besteht in einer vollständigen Vermeidung der allergieauslösenden Substanz. Wenn dies nicht gelingt, muss die Behandlung der Symptome durch Medikamente erfolgen. Ursächlich lässt sich eine Allergie nur durch eine Immuntherapie (Hyposensibilisierung) bekämpfen. Dabei wird dem Patienten über einen Zeitraum von mehreren Jahren unter ärztlicher Aufsicht der allergieauslösende Stoff in kleinen Mengen verabreicht, die langsam gesteigert werden. So wird die Körperabwehr „i mmu n“ gegen das Allergen und die allergische Reaktion bleibt aus.
Anamnese und Diättagebuch bestimmen die Abklärung einer vermuteten dosisabhängigen Nahrungsmittelintoleranz und einer dosisunabhängigen Nahrungsmittelallergie. Leitsymptome einer Kohlenhydratintoleranz sind Blähungen und Schmerz.

Die Ergebnisse der Intoleranzmessung, nicht aber die Ergebnisse der Atemtests, sind für die kausale Zuordnung der Symptome und für den Entschluss zu einer Therapie relevant.
Die Abklärung eines Verdachts auf Intoleranz gegenüber Kohlenhydraten (Laktose, Fruktose, Birkenzucker, Ballaststoffe usw.) kann mit Hilfe der CarboCeption-App erfolgen.
33. Jahrestagung der MKÖ
Blase, Darm & Sex: Tabus finden – Tabus brechen
Linz 13. – 14. Oktober 2023


Seminarhaus Auf der Gugl
Information: www.kontinenzgesellschaft.at/jahrestagung
VERANSTALTER
Medizinische Kontinenzgesellschaft
Österreich – MKÖ
www.kontinenzgesellschaft.at
TAGUNGSPRÄSIDIUM
OÄ Dr. Sophina Bauer
FÄ für Urologie u. Andrologie, Universitätsklinik
für Urologie & Andrologie Salzburg
Dr. Kira Sorko-Enzfelder
FÄ für Allgemeinchirurgie u. Viszeralchirurgie, KH der Barmherzigen Schwestern Wien
Hausärzt:in medizinisch 8 Juli/August 2023
<
Foto: ©bowie15(iStock)
Österreichische Gesundheitskasse Präventivangebote für einen gesunden Rücken
Um mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen, braucht es einen gesunden Rücken. Daher setzt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im Herbst auf kostenlose Angebote zum Thema Rückengesundheit für Versicherte. Diese können im Patientengespräch als präventive Maßnahme mitgegeben werden.
Dass Bewegung dem Körper guttut, wissen die meisten Patientinnen und Patienten – doch in der Praxis führen mangelnde Bewegung und falsche Belastung oft schlussendlich in die Arztpraxis. Um hier frühzeitig anzusetzen, bietet die ÖGK ab September zahlreiche präventive Angebote zur Stärkung der Rückengesundheit. Zielgruppe sind Menschen mit leichten Rückenbeschwerden oder entsprechenden Risikofaktoren. Die Palette reicht von Gruppenkursen über Webinare und Bewegungsberatungen bis hin zu Übungen für zuhause. Die Angebote basieren auf sportwissenschaftlichen Empfehlungen, mit dem Ziel, Rückenproblemen entgegenzuwirken, und ersetzen keine ärztliche bzw. therapeutische Behandlung.
Gemeinsam bewegen: Gruppenkurse
Bei „Beweg' dich - Gesunder Rücken“, dem Bewegungsprogramm der ÖGK, wird an zwei Tagen pro Woche über 14 Wochen hinweg in der Kleingruppe trainiert. Das Programm zielt darauf ab, eine langfristige und individuelle Verhaltensänderung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bewirken. Regelmäßige Bewegung kann Rückenbeschwerden vorbeugen und entgegenwirken. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist online möglich.
Online Unterstützung nutzen: Webinare und sportwissenschaftliche Beratung
Ab Mitte September veranstaltet die ÖGK wöchentlich Webinare, in denen es um die Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit – speziell für die Rückengesundheit –geht. Neben grundlegendem Wissen und Bewegungsempfehlungen stehen auch konkrete Übungen für ein gesundheitsorientiertes Training und individuelle Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Fokus. Jedes Webinar dauert 90 Minuten und wird von Sportwissenschafterinnen bzw. Sportwissenschaftern der ÖGK geleitet. Die Termine sind auf 20 Personen begrenzt, um einen interaktiven Austausch zu ermöglichen.
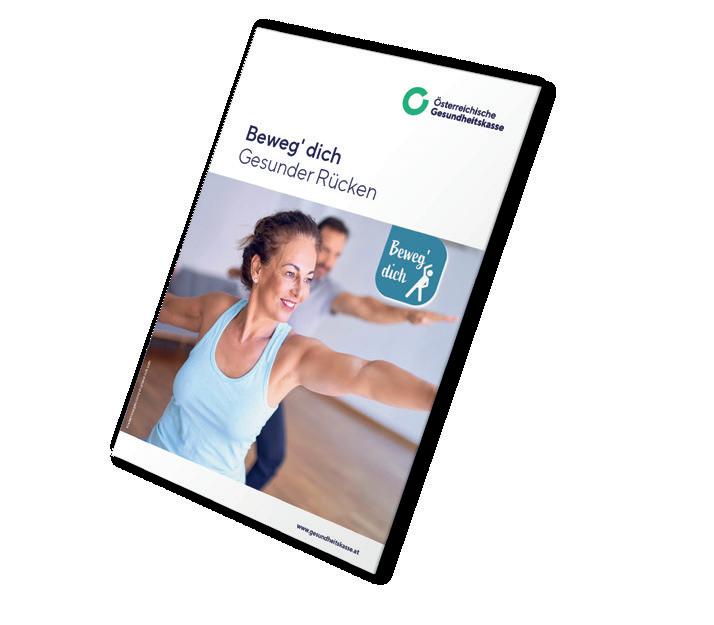
bei den Webinaren und online Bewegungsberatungen auf die Wissensvermittlung gelegt.
Zuhause trainieren:
Umfassende Übungsbroschüre
� Alle Angebote, Details und Termine zum Thema „Gesunder Rücken“ finden Sie unter gesundheitskasse.at/ruecken

� Für individuelle Anfragen bzw. eine Broschürenbestellung nutzen Sie gerne die E-Mail-Adresse gesunderruecken@oegk.at.
Zeitgleich startet erstmals das Angebot der individuellen Bewegungsberatung. Die Beratungen erfolgen online durch Sportwissenschafterinnen und Sportwissenschafter der ÖGK. Interessierte können dafür einen Termin über die Website buchen und ihre persönliche Situation bzw. Fragen im Einzelgespräch behandeln. Schwerpunkte sind das individuelle Bewegungsverhalten, eventuelle bereits bestehende Rückenprobleme und bewegungsbezogene Lösungsstrategien bzw. Tipps. Die Bewegungsberatung ist eine niederschwellige Anlaufstelle für alle, die an Bewegung interessiert sind und endlich damit starten oder einfach wieder einsteigen wollen. Während es sich beim „Beweg dich –Gesunder Rücken“-Kurs um aktive Bewegungseinheiten handelt, wird der Fokus
Wollen Patientinnen und Patienten eigenständig an ihrer Rückengesundheit arbeiten, bietet die ÖGK die Übungsbroschüre „Gesunder Rücken“ auch zum Bestellen oder Herunterladen auf ihrer Website an. Die Broschüre enthält allgemeine Informationen zum Thema Rückengesundheit sowie zahlreiche Übungen für einzelne Muskeln oder ganze Muskelgruppen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Sie zeigt, wie Kraft und Beweglichkeit einfach trainiert und gleichzeitig Koordination und Gleichgewicht verbessert werden können.
<
GRATIS-BROSCHÜRE
Juli/August 2023 9
INFO
© Foto-Flausen
ZUM DOWNLOAD Hausärzt:in informativ BEZAHLTE ANZEIGE
Tierisch gefährlich
Serie Tropenmedizin, Teil 2: Wie vorgehen, bei Unfällen im Wasser oder mit Tieren?
Als Insel- und Taucherarzt kommt man oft zu Tauchunfällen. Dabei ist es „egal“, welche Art von Tauchunfall vorliegt (DCS I oder II, AGE …). Alle Betroffenen werden primär gleichbehandelt: Sicherung und regelmäßige Kontrolle der Vitalfunktionen sowie wiederholte Kontrolle/Dokumentation (Zeugen ihre Telefonnummern selbst notieren lassen), korrekte Lagerung, sofortige normobare Sauerstoffgabe, Eigen- und Fremdanamnese, neurologischer Status, Auskultation der Lungen. Falls ein Pneumothorax vorliegt, gilt es, diesen jedenfalls vor dem Abflug mit dem Hubschrauber zu entlasten. Wenn die Patientin/der Patient es noch selbst kann, kann man sie/ihn trinken lassen, wenn nicht, sind eine Infusionstherapie und eventuell ein Blasenkatheter notwendig. Der Abtransport sollte möglichst erschütterungsfrei mit dem Hubschrauber im Tiefflug erfolgen – oder mit dem Schiff kreuzend (beim „ Stampfen“ gegen die Wellen verschlechtert sich der Zustand des Patienten rasant). Eine hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) sollte möglichst rasch angestrebt werden. Daher: Voranmeldung im geeigneten Zielkrankenhaus. NICHT empfohlen sind: Acetylsalicylsäure, Heparin oder Kortikosteroide.
Zu bedenken ist: Immersion, also das Eintauchen des Körpers in Wasser, kann gerade beim morgendlichen Baden
eines kardial vorgeschädigten Patienten zu Problemen führen: Allein das Stehen bis zum Hals im Wasser bewirkt bis zu einem Liter Mehrdurchblutung des Herzens.
Aufgrund der Umgebungstemperatur spielt die Thermoregulation eine zentrale Rolle, v. a. bei Kindern oder bei Vorerkrankungen wie Morbus Parkinson. Dabei kann eine Überwärmung ab 42,2 Grad Celsius wegen der neurologischen Veränderungen bereits ein tödliches Maximum darstellen, wohingegen bei Unterkühlung ein wesentlich größerer Wechsel des Temperaturbereichs überlebbar ist.
Bei Ertrinkungsunfällen sollte man großzügig Sauerstoff geben und relativ frühzeitig mit der Intubation beginnen, aber zurückhaltend mit der Volumentherapie sein. Eventuell ist eine Magensonde sinnvoll, falls man reanimieren muss. Vergleiche Kinderreanimation: Zuerst 5 x beatmen, dann gleich wie immer die Herzdruckmassage: Beatmung im Wechsel – also 30 x 2 –fortführen.

Gefahrenquelle Tiere
Sehr häufig ist man in tropischen Ländern mit Tierverletzungen konfrontiert. Um diese möglichst zu vermeiden, sollte man grundsätzlich Kleidung und Schuhe immer vor dem Anziehen sowie

Toilettensitze – ein beliebter Aufenthaltsort von Spinnen – prüfen, d. h. ausschütteln bzw. abklopfen.
GASTAUTOR: Dr. Bernhard Haberfellner Facharzt für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin und Arzt für Allgemeinmedizin in Linz, tropenarzt.at
Fast alle meiner Patienten mit Bissverletzungen haben irgendwo hineingegriffen, ohne vorangegangene Blickkontrolle. So passieren Schlangenbisse meist beim Feuerholzsuchen, beim Herausholen der Zeitung aus dem Briefkasten usw. Vorsicht ist vor allem nach starken Regenfällen und in der Dämmerung geboten: Man sollte dann immer mit einer Lampe unterwegs sein! Bei einem längeren Leben in den Tropen ist es ratsam, Nagetiere vom Wohnort fernzuhalten, weil diese Schlangen anlocken. Sich Schweine als Haustiere zu halten ist dagegen günstig, weil sie Schlangen fernhalten. Bei der Giftwirkung von Schlangen unterscheidet man hämatotoxische Effekte wie Zahnfleischbluten, Hämoptoe, Hämaturie von neurotoxischen wie Ptosis, Doppelbildern, Lähmung der Atemmuskulatur. Zudem können Zytokine zu starken Gewebenekrosen und Schwellungen führen, die eventuell eine Fasziotomie notwendig machen. Niemals sollte man ein Torniquet anbringen oder an der Bissstelle eine Inzision vornehmen, ebenso wenig
Hausärzt:in medizinisch 10 Juli/August 2023
© unsplash.com/George Stewart
© privat
an der Bissstelle saugen oder Salben, Pasten oder Kräuter auftragen. Sinnvoll ist es nach einem Schlangenbiss, möglichst die Schlange zu identifizieren (zu fotografieren) und sich zurückzuziehen, nach dem Motto: RUHE und Wärme. Die betroffene Extremität sollte hochgelagert und immobilisiert werden. Ringe, Armbänder und Uhren sollten rasch entfernt und der Patient wie ein „rohes Ei“ in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Mitführen von Immunseren ist in der Regel irreal.
Die Tollwut wird in der Regel absolut unterschätzt und der Ratschlag, keine Tiere auf Reisen zu streicheln oder zu füttern, erscheint mir realitätsfern. In meiner Linzer Praxis erreichen mich ständig Anfragen aus aller Welt – von Reisenden, die gebissen worden sind. Ein klassisches Szenario ist nicht der „t ierkraulende Tourist“, sondern ein Reisemitglied, das sich von seiner Gruppe entfernt hat und hinter einem Busch von einem überraschten Mungo gebissen worden ist. Bei dieser zu 100 %
letalen Erkrankung haben wir zwar nach Bissen ein relativ niedriges Risiko, an Tollwut zu erkranken. Die Häufigkeit von Tierbissen bei Reisenden ist aber tatsächlich enorm hoch. Und die geringe Zeitgrenze bei Ungeimpften für eine simultane postexpositionelle Prophylaxe von aktiven und passiven Impfungen (Immunglobulinprophylaxe) ist in der Regel nicht einhaltbar.
Sehr häufig sehe ich Tropenrückkehrer – ebenso wie Touristen in den Tropen –mit Ektoparasitosen wie der Fliegenmadenerkrankung/Myiasis, dem Hautmaulwurf/Larva migrans cuatanea oder Sandflöhen/Tungiasis usw. Bei der durchzuführenden Exstirpation sollte immer auf einen ausreichenden Tetanusimpfschutz geachtet werden.

Sonstige Gefahren vor Ort
Naturkatastrophen in den Tropen – etwa Tsunamis oder Zyklone – werden in ihrer Wucht oft stark unterschätzt.
INFO
Auf sozialen Einsätzen
Wer in sozialen Einsätzen arbeitet, wird vor Ort wieder mit komplett anderen medizinischen und organisatorischen Herausforderungen konfrontiert.
� Bei der medizinischen Arbeit ist oft eine geeignete Triage notwendig, um bei den Patienten, die oft tagelange Fußmärsche in Kauf nehmen, um einen Arzt sehen zu können, die akutesten Fälle rasch herauszufischen. An Hilfsmitteln hat man meist nicht viel mehr als Otoskop, Stethoskop und Ophthalmoskop, Pulsoxymeter, Lampe, Thermometer zur Verfügung, was auch einen Teil des Reizes dieser Arbeit ausmacht.
� Mit der „Rolling Clinic“ (Geländewagen, bestückt mit Arzt, Übersetzerin und Fahrer) kommt man in sehr entlegene und traumhaft schöne Gebiete, die man als normaler Tourist kaum erkunden würde. Und man kommt mit den jeweiligen Kulturen in Kontakt, wie es einem sonst nicht möglich wäre.
� Die Koch- und Heizweise (offenes Feuer in Hütten mit Rauchbelastung von Klein auf) ruft häufig Exazerbationen bei COPDBetroffenen hervor.
� Durchfälle sind aufgrund der geringen Hygiene so häufig wie bei uns in vorigen Jahrhunderten, hier sind therapeutisch v. a. Flüssigkeit und Elektrolyte wichtig. Zu beachten sind, wenn man sich für eine Antibiose entscheidet, die sehr unterschiedlich ausgeprägten Resistenzsituationen.
� In Slum-Gebieten ist man mit Mangel- und Fehlernährung (Marasmus, Kwashiorkor) konfrontiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine zu rasche Kalorienzufuhr leicht zu Komplikationen, dem „RefeedingSyndrome“, führen kann. Diese Patienten mit oft mangelhaftem Impfstatus leiden häufig an Begleitinfektionen.

� Obwohl man es in sehr armen Regionen nicht primär erwarten würde, nehmen hier auch das Metabolische Syndrom und Depressionen weltweit extrem stark zu.
� Zusätzlich spielt bei sozialen Einsätzen natürlich die Kriminalität zum Teil eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es ist ratsam, sich dahingehend gut vorzubereiten.
NACHBERICHT
Kokosnüsse, häufig eher mit Südseefeeling und Ferienstimmung assoziiert, stellen eine ernstzunehmende Gefahr für Urlauber dar: Durch herunterfallende Nüsse sterben jährlich unzählige Touristen oder werden ernsthaft verletzt.
Bei den Nahrungsgiften unterscheidet man zwischen Tieren, die an sich giftig sind, etwa dem Kugelfisch, und Tieren, die giftig werden. Letztere sind Raubfische, die am Ende der Nahrungskette stehen und somit bestimmte Algenformen (Dinoflagellaten) anreichern. Eine relativ häufige Fischvergiftung stellt Ciguatera dar. Typisch dafür sind ein metallischer Geschmack und ein umgekehrtes Warm-kalt-Empfinden.
Bei Badeurlaubern kommen Nesselverletzungen häufig vor. Wichtig ist in dieser Situation, den Verunfallten nie mit Süßwasser abzuwaschen, weil das sonst Reaktionen hervorrufen kann, die bis hin zum anaphylaktischen Schock reichen können: Aus der Reizung der Qualle resultiert das Abschießen eines Mini-Stiletts und dadurch das Injizieren von Gift.
Der Gastautor war Vortragender zum Thema „Notfälle in den Tropen“ bei der 25. Linzer Reisemedizinischen Tagung, 14. bis 16. April 2023.
Hausärzt:in medizinisch 11 Juli/August 2023
<
© privat
„Frischer Wind in der Diabetologie“
Die Young Diabetologists greifen aktuelle und innovative Themen auf

12 Juli/August 2023
© shutterstock.com/cezarksv Hausärzt:in dossier
Der neu gegründete Ausschuss „Young Diabetologists“ (YD) stellte sich bei einem Symposium der 50. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG) im November 2022 in Salzburg erstmals vor. Inzwischen konnten die YD weitere Mitglieder gewinnen, sich bei der Frühjahrstagung im Mai 2023 in Innsbruck mit Vorträgen über den „kniffligen Fall und die Leitlinien“ positionieren, Arbeitsgruppen bilden und Aktionspläne definieren. Ihr oberstes Ziel: Vernetzung und Unterstützung von jungen Ärzt:innen mit Interesse an der Diabetologie. Im Interview mit der Hausärzt:in spricht Gründungsmitglied OA Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer von der Medizinischen Universität Graz über die Ambitionen, Pläne und thematischen Schwerpunkte der Young Diabetologists.
zu attraktivieren, ist mit Sicherheit ein starkes Motiv für die Gründung. Jungmediziner:innen brauchen gerade am Anfang ihrer Karriere ein Netzwerk, in dem sie sich wohlfühlen und in welchem sie sich auch beruflich verwirklichen können. Von den verschiedenen Möglichkeiten, sich als YDMitglied konstruktiv einzubringen –sei es wissenschaftlich, gesellschaftlich oder persönlich –, können nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch die gesamte österreichische Diabetologie profitieren. Nicht zuletzt bewirkt frischer „junger“ Wind in einer florierenden und stark positionierten Diabetesgesellschaft, dass innovative und aktuelle Themen aufgegriffen werden, welche bis dato möglicherweise unterrepräsentiert waren.
ckereinstellung assoziiert, dass übliche Ambulanztermine zur Blutzuckereinstellung nicht mehr wahrgenommen werden (müssen).
OA Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer, Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Med Uni Graz, im Gespräch.
HAUSÄRZT:IN: Was hat Sie und Ihre Kolleg:innen dazu bewogen, die Young Diabetologists zu gründen?
Doz. ABERER: Der gedankliche Anstoß, die YD zu gründen, kam vom ÖDG-Vorstand. Die Intention wird durch viele Aspekte gerechtfertigt: Weltweit und auch in Österreich steigt die Diabetesprävalenz enorm und die zukünftige adäquate Versorgung von Menschen mit Diabetes setzt eine entsprechende ärztliche Verfügbarkeit und fachliches Vermögen voraus. Die Diabetologie durch die Formation der YD als Sprachrohr für junge Ärzt:innen
Die YD fokussieren sich ja auf Themen wie Technologie und Artificial Intelligence (siehe INFO) ... Genau. Gewählt wurden vor allem Themenschwerpunkte, die stetig an Bedeutung gewinnen. Sie sind sehr große Schlagworte in der Diabetologie, die nicht alle gleichzeitig von Tag eins an neu erfunden werden können. Jedoch begegnen sie uns als YD in der täglichen Praxis und es besteht eine wesentliche intrinsische Ambition, hier neue Prozesse mitzugestalten. Bereits beim ersten Symposium der YD im Rahmen der Jahrestagung der ÖDG 2022 haben wir mit der Diabetesökologie und dem „Loopen“ Themen aufgegriffen, welche die Diabetologie von morgen zunehmend beeinflussen werden.
Was macht das „Loopen“ zu einem besonderen Thema?* Menschen mit Typ-1-Diabetes, welche eine „künstliche Bauchspeicheldrüse“ haben, sind eine spezifische Zielgruppe der YD. Sie verwenden Medizinprodukte zur Insulintherapiesteuerung, die als einzelne Komponenten – also Sensor und Pumpe – zwar lizenziert, in ihrer Kombination unter Verwendung eines Algorithmus jedoch noch nicht zugelassen sind. Diese Therapie des sogenannten „Loopens“ erfordert ein sehr tiefes technisches und medizinisches Verständnis, ist jedoch in den meisten Fällen mit einer derart guten Blutzu-
Damit sind Bedenken verbunden?
Ja, einerseits befürchten Looper:innen, dass eine gewisse Ablehnung von Ärzt:innen gegenüber der Therapie besteht, da sie nicht lizenziert ist. Andererseits fehlt es ärztlichem Personal oft an technischem Verständnis, um die Behandlung zu evaluieren. Nachdem der Diabetes mellitus Typ 1 trotz einer guten Blutzuckereinstellung oft mit diabetischen Komplikationen und kardiovaskulären Risikofaktoren einhergeht, ist es bedenklich, wenn Ambulanzbesuche
INFO
Die Young Diabetologists
Im Jahr 2022 gründeten Dr.in Antonia-Therese Kietaibl, Klinik Ottakring in Wien, Dr. Michael Schranz, Univ.-Klinikum Salzburg, Dr.in Lisa Frühwald, Klinik Ottakring, und OA Priv.-Doz. DDr. Felix Aberer, Med Uni Graz, den jüngsten ÖDG-Ausschuss. Dr.in Kietaibl und Dr. Schranz fungieren aktuell als Vorsitzende.
Wichtige Themenschwerpunkte der YD:
� Ökologie und Diabetes
� Technologie und Artificial Intelligence

� Transitionsphase
� Schulung und Prävention
� Psychologie des Diabetes
Termin: Das zweite Vernetzungstreffen der YD wird von 22. bis 23. September 2023 in Salzburg stattfinden.
Weiterführende Informationen und Vorstellungsvideo: oedg.at/ausschuesse_youngdiabetologists.html
13 Juli/August 2023 Hausärzt:in dossier
© privat
>
„Die Formation der YD als Sprachrohr für Jungmediziner:innen soll die Diabetologie attraktivieren.“
y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc Wartezimmer TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at
14 Juli/August 2023
TV
Wartezimmer
vermieden werden. Die YD wollen gerade dieser Population mit einem offenen Ohr begegnen und auch von ihr lernen. So wurden auf die Jahrestagung 2022 vier Looper:innen eingeladen, die in einer Podiumsdiskussion sehr offen über ihr Leben mit Diabetes und dem „Loopen“ berichteten.
Welche weiteren Initiativen und wissenschaftlichen Projekte wurden gestartet?
Mehrere Projekte sind bereits konkretisiert, stecken zum Teil allerdings noch in den Kinderschuhen. Ein schon definiertes Vorhaben ist zum Beispiel die medizinische Betreuung von Camps für Kinder und Jugendliche mit Typ1-Diabetes. Gemeinsame Aktivitäten von betroffenen jungen Menschen sind enorm wichtig für das Selbstwertgefühl und langfristig für die metabolische Kontrolle. An der Vernetzung dieser jungen Menschen wollen die YD arbeiten, denn nicht nur die Patient:innen, sondern auch das Betreuungspersonal lernt durch diese Erfahrungen dazu. Praxisorientiertes Wissen zu diabetologischen Themen jungen ärztlichen Kolleg:innen zu vermitteln ist eine weitere Intention der YD. So wurde bereits eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, welche zukünftig auf verschiedenen Kanälen Fortbildungen anbieten soll. Viele andere Ideen befinden sich noch im Anfangsstadium und werden Stück für Stück konkretisiert.
Ein Ziel der YD ist AwarenessSchaffung. In welchen Bereichen besteht hierfür Ihrer Ansicht nach der größte Bedarf?
Das Leben mit Diabetes geht mit einer meist lebenslangen Therapie einher, was eine gute Therapieadhärenz und Kontrolle erfordert. Bedauerli-
cherweise stellt das Offenlegen einer Diabetesdiagnose in vielen Fällen immer noch eine individuelle Barriere für die Patient:innen dar. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass eine Diabeteserkrankung in der Gesellschaft nach wie vor mit ungesundem Lebensstil, Übergewicht und Bewegungsmangel assoziiert ist. Gerade junge Menschen mit Typ-1-Diabetes leiden unter diesem Stigma und verstecken ihre Erkrankung. Das führt nicht nur zu einer psychischen und sozialen Beeinträchtigung, sondern möglicherweise auch zu irreversiblen gesundheitlichen Folgeschäden. Unterschiedlichste Aktivitäten und Kampagnen der YD sollen die Awareness in der Bevölkerung steigern, um Menschen mit Diabetes vom Stigma ihrer chronischen Erkrankung zu befreien.
Im Video „Die Young Diabetologists stellen sich vor“ (siehe INFO) betonen Sie, dass die YD sehr gute Verbindungen zu anderen ÖDGAusschüssen und zum ÖDG-Vorstand haben. Mit welchen Vorteilen geht das insbesondere für Jungmediziner:innen einher?
Gerade als Jungmediziner:in hat man oft berufliche Vorstellungen und Ziele, die ohne ein gewisses Netzwerk nicht umgesetzt bzw. erreicht werden können. Zum Teil mangelt es an Kontakten oder Interdisziplinarität, und monetäre Mittel sind limitiert. Den YD wird im Rahmen ihrer Projekte, Symposien und weiteren Aktivitäten innerhalb und außerhalb der ÖDG eine Bühne geboten, die hilfreich bei der individuellen Integration in die diabetologische Landschaft sein kann. Seien es Forschungsprojekte, die im Team besser umsetzbar sind, sei es
eine finanzielle Unterstützung für konkrete Vorhaben oder die Beteiligung an verschiedensten Aktivitäten der YD: Das Spektrum der Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung ist weitgreifend.
Welche Forderungen bzw. Wünsche möchten Sie abschließend noch mitteilen?
Die YD sind keine Institution, die Forderungen an die Politik, Ärzt:innenschaft oder Krankenkassen stellen wird. Dafür gibt es die gut strukturierte und erfolgreich arbeitende ÖDG. Die YD werden dennoch mit definierten Ambitionen und Wünschen an die ÖDG herantreten und gemeinsam wollen wir an der diabetologischen Zukunft in Österreich arbeiten.
Das Interview führte Anna Schuster, BSc.
*
Vorschau: Lesen Sie im Herbst mehr zum Thema „Loopen“ im Artikel Echt smart – über Pumpen, Pens & Co.: Innovative Therapiesysteme und Devices in der Diabetologie.


Hausärzt:in dossier
„Gewählt werden vor allem Themenschwerpunkte, welche die Diabetologie von morgen zunehmend beeinflussen werden.“
SPRECHStunde
Patient:innen-Fragen kompetent beantworten
EXPERTIN:
Dr.in Lisa Frühwald
 5. Med. Abt. für Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring, Wien, Gründungsmitglied der Young Diabetologists
5. Med. Abt. für Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring, Wien, Gründungsmitglied der Young Diabetologists
„Prävention nach Gestationsdiabetes?“
Patientin Sidonie M. (36) hat vor eineinhalb Jahren ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht. Im Rahmen der Schwangerschaft wurde ein Gestationsdiabetes (GDM) diagnostiziert, der diätologisch ausreichend therapiert war. Präkonzeptionell bestand bereits eine Adipositas (BMI 32 kg/m2). Nun ist die Patientin erneut schwanger (13. SSW). Den empfohlenen oralen Glukosetoleranztest (oGTT) zwei Monate nach der ersten
Geburt hatte sie nicht in Anspruch genommen. Sie erkundigt sich bei ihrer Hausärztin, was nun zu beachten sei ... Dr.in FRÜHWALD: Bei der besagten Patientin bestehen gleich mehrere Risikofaktoren für die neuerliche Entwicklung eines GDM: Gestationsdiabetes in der Anamnese, Adipositas, Alter > 35 Jahre. Somit sollte bereits vor der 20. SSW – am besten im Rahmen der Erstvorstellung – auf einen präexis-
DM
Therapie siehe Kapitel präkonzeptioneller DM
Schwangerschaft
Erstvorstellung: Hohes Risiko?
(vorangehend: GDM, IGT, IFG, habitueller Abortus, Kind > 4500 g, Totgeburt, Fehlbildung, Diabetessymptome, Adipositas, Metabolisches Syndrom, vaskuläre Erkrankung, T2DM bei Verwandten ersten Grades, Ethnizität mit hohem Risiko, Alter > 35 Jahre)
Klinischer Verdacht? (Makrosomie, Glukosurie, Diabetessymptome)
möglichst früh (1. Trimenon)
sofort
DM?
GDM?
GDM-Screening: Alle Frauen (außer bei bekanntem GDM, DM)
24.-28. SSW
tenten Diabetes mellitus mittels einer Nüchtern-/Spontanglukosemessung, einer HbA1c-Bestimmung und/oder Durchführung eines 75-g-oGTT getestet werden. Aufgrund der nachweislich positiven metabolischen Auswirkungen auf Mutter und Säugling wird empfohlen, postpartal eine Stilldauer von mindestens drei Monaten einzuhalten. Weiters ist vier bis zwölf Wochen nach der Geburt ein 2-h-75-g-oGTT obligat. Grenznein
HbA1c, NüBG oder SpontanBG, ev. oGTT DM-Diagnose anhand von Standardkriterien GDM-Diagnose
oGTT (75 g): venöses Plasma: Glukose (mg/dl)
nüchtern: ≥ 92
1 h: ≥ 180
2 h: ≥ 153 ab 1 Wert = GDM ja
16 Juli/August 2023 Hausärzt:in dossier © privat
© shutterstock.com und RegionalMedien Gesundheit
Therapie
Keine
Therapie GDM?
werte T2DM: nüchtern
≥ 126 mg/dl, 2-h-Glukose
≥ 200 mg/dl; gestörte Glukosetoleranz: nüchtern

100-125 mg/dl, 2-h-Glukose 140-199 mg/dl. Bei Normalbefund sollten in der Folge alle zwei Jahre die Nüchternglukose und ein HbA1c bestimmt sowie ggf. ein oGTT durchgeführt werden. Nach GDM besteht im Vergleich zu glukosetoleranten Schwangeren ein siebenfach erhöhtes Risiko, T2DM zu entwickeln. Postpartal steht somit die Lebensstilmodifikation im Vordergrund, also Gewichtsreduktion bei Übergewicht, ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität. Zu berücksichtigen ist auch das erhöhte kardiovaskuläre Risiko nach GDM. Insofern ist die Behandlung weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren relevant, etwa einer arteriellen Hypertonie oder einer Hyperlipidämie.

Versorgung verbessern
Derzeit nimmt nur ein geringer Anteil der GDM-Patientinnen postpartale oGTT-Kontrollen wahr. Diabetologische Ambulanzen, Gynäkolog:innen und Hausärzt:innen sollten durch ausführliche Schulung und Beratung an der Bewältigung dieses Versorgungsproblems arbeiten. Oft fehlt es an leicht verständlichem und einfach zugänglichem Infomaterial für Patientinnen. Frauen mit Migrationshintergrund sind wegen sozialer und sprachlicher Faktoren besonders stark betroffen. Ein Anliegen der Young Diabetologists ist u. a. das Thema Prävention und Schulung. Wir wollen auf diese Probleme in unserem Alltag aufmerksam machen und planen, Schulungsvideos zu praxisnahen Themen zu erstellen.
Literatur bei der Expertin.
ICH
Meine Patienten können:

1. Accu-Chek Blutzuckermessgerät* mit der mySugr App** verbinden.
2. Messwerte automatisch übertragen und zusätzliche Informationen hinzufügen.
3. Analysen & Reports ansehen, und z.B. als PDF per E-Mail teilen oder ausgedruckt mitnehmen.
* Accu-Chek Mobile benötigt einen Adapter [kostenlos erhältlich auf www.accu-chek.at].


** mySugr Pro ist in Verbindung mit einem Accu-Chek Blutzuckermessgeräte KOSTENLOS [statt € 27,99 jährlich].

17 Juli/August 2023
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK MOBILE und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2023 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3
SCHLUSS MIT HANDGESCHRIEBENEN TAGEBÜCHERN.
EMPFEHLE MYSUGR UM DEN ÜBERBLICK ZU BEHALTEN!
Simone hat Typ-2 Diabetes. Sie ist mySugr Fan.
<
© shutterstock.com/y.s.graphicart
„Oft fehlt es an leicht verständlichem und einfach zugänglichem Infomaterial für Patientinnen.“
„Ein sehr gefährliches Trio“
Der Zusammenhang zwischen Diabetes, Herz- und Nierengesundheit und die Herausforderung in der Therapie
Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG),

Die Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus Typ 2 wirkt sich auf alle Organe des menschlichen Körpers aus. In besonderem Ausmaß betroffen sind das Herz und die Nieren. Eine optimale Diabetestherapie berücksichtigt von Beginn an diese Organe und kann so für Jahrzehnte zu einer längeren Lebenserwartung und besserer Lebensqualität beitragen. Die Hausärzt:in sprach darüber mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz und Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG).
HAUSÄRZT:IN: Inwieweit beeinflusst Diabetes mellitus Typ 2 auch die Herzgesundheit der Patient:innen?
Prof. CLODI: Diabetes ist bekanntlich eine chronische, sehr gefährliche Erkrankung. Erhöhte Blutzuckerspiegel verändern viele Strukturen im Körper, auch die des Herzens. Wir wissen, dass fast 80 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit Diabetes im Lauf der Jahre strukturelle Veränderungen im Bereich des Herzens entwickeln, wobei sich die eingeschränkte Herzfunktion oft in Form einer diastolischen Dysfunktion äußert. Ebenso sind die großen Gefäße betroffen. Patienten mit Diabetes erleiden sehr viel häufiger Myokardinfarkte.
Welche Rolle spielt Diabetes für die Funktion der Nieren?
Circa ein Drittel bis die Hälfte aller Patientinnen und Patienten, die sich
Entwicklungen in der Diabetestherapie
Die Behandlung des Diabetes hat sich über die Zeit gewandelt, was auch gut an den aktualisierten Leitlinien der ÖDG erkennbar ist: Zusätzlich zum Blutzucker hat über die Jahre die multifaktorielle Therapie mit Beachtung der Risikofaktoren wie Cholesterin oder Blutdruck an Bedeutung gewonnen – auch dank neuer Medikamente wie der RAS-Inhibitoren, Antikoagulanzien, Statine und PCSK9-Hemmer. Jetzt befindet sich die Medizin am Beginn der personalisierten, individualisierten Therapie mit neuen Antidiabetika mit Zusatznutzen. Mittlerweile stehen Diabetesmedikamente zur Verfügung, die nicht nur den Blutzucker senken, sondern gleichzeitig auch günstige Auswirkungen auf das Herz hinsichtlich der Arteriosklerose oder Herzinsuffizienz sowie auf die Nieren haben. Dies führt erwiesenermaßen zu einer höheren Lebenserwartung und besserer Lebensqualität. Voraussetzung ist jedoch, dass eine Diabeteserkrankung rechtzeitig erkannt und konsequent therapiert wird.

Neue ÖDG-Leitlinien: oedg.at/pdf/OEDG-Leitlinien-2023.pdf
Quelle: ÖDG
18 Juli/August 2023 Hausärzt:in medizinisch
©
ProMed
© shutterstock.com/SewCreamStudio
im Gespräch.
INFO
einer chronischen Nierenersatztherapie, einer Dialyse, unterziehen, benötigen diese aufgrund eines Schadens durch Hyperglykämie. Die erhöhte Glukose bewirkt direkte toxische Schädigungen der kleinen Gefäße, aber auch beispielsweise direkt an den Podozyten und anderen Organstrukturen in der Niere, welche schlussendlich zu einer Destruktion der Nierenfunktion und zu einem Nierenschaden führen.
Inwiefern ist die Kombination von Diabetes und chronischer Niereninsuffizienz mit der Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen verbunden?
Diese drei Erkrankungen des Zuckerstoffwechsels, der Niere und des Herzens stellen sozusagen ein sehr gefährliches Trio dar. Diabetes verursacht Nierenschäden und Herzinsuffizienz, aber Nierenfunktionseinschränkungen führen durch viele andere nicht ausgeschiedene Substanzen ebenso zu toxischen Veränderungen im Körper und so zu einer Herzleistungsschwäche und Koronarsklerose.
Was bedeutet dies für die Therapie bzw. inwieweit kann ein optimales Diabetesmanagement auch Herz und Nieren schützen?
Die Grundsäule jeder optimalen Therapie bei Diabetes mellitus ist die Optimierung der Glukosestoffwechsellage. Ist der Stoffwechsel nahezu normal eingestellt bzw. therapiert, treten die durch Diabetes verursachten Schäden nicht bis nur selten auf. Das heißt, eine ideale Diabetestherapie führt zu einem optimalen Schutz von Herz und Nieren. Nicht vergessen sollte man vor allem bei Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes auch die Therapie der Hypercholesterinämie sowie der Hypertonie. Eine zentrale Rolle in jeder Therapie spielt körperliche Aktivität. Hier gibt es sehr
gute Daten, wonach Patienten, die sich ausreichend bewegen, deutliche kardiovaskuläre und renale Benefits erzielen.
Was können Patient:innen selbst zu ihrer Herz- und Nierengesundheit beitragen?
Wie bereits erwähnt: Optimierung der Diabetes-, Cholesterin- und Blutdrucksituation sowie Bewegung. Wichtig ist
zudem, dass die Patienten ihre Befunde regelmäßig und rechtzeitig kontrollieren und bei Abweichungen von Normwerten mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen, um die optimale Therapie zu bekommen.
Das Interview führte Margit Koudelka.
Herz
& Nieren Check für Ihre Diabetes-Therapie!
Hoher Blutzucker schädigt Herz und Nieren
Lassen Sie Ihre Werte regelmäßig
überprüfen
Das Herz wird doppelt belastet
Minimieren Sie Ihr Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen.
Schwache Nieren schädigen das Herz
Fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt und lassen Sie Ihre Diabetestherapie regelmäßig auf Herz und Nieren prüfen.
„Herz & Nieren Check“ ist eine Initiative der Österreichischen Diabetes Gesellschaft: Folgende Laborwete sollten bei allen Menschen mit Diabetes regelmäßig bestimmt werden: HbA1c, Albumin/Kreatinin-Ratio, eGFR und NT-pro-BNP.

Hausärzt:in medizinisch
Mindestens 5.000 Schritte, über Tag verteilt
Wie auch regelmäßige Bewegung – also nicht nur Sport – gesund hält




Braucht „der moderne Mensch“ weniger Bewegung als dessen Vorgänger, um gesund zu bleiben? In der medizinischen Praxis werden seit Jahrzehnten mindestens 10.000 Schritte pro Tag als „Weg zur Gesundheit“ empfohlen. In den vergangenen Jahren wurden allerdings erste wissenschaftliche Hinweise veröffentlicht, wonach sogar 5.000 Schritte täglich für einen Erwachsenen genügen, um die Gesundheit zu verbessern. Viele feierten diese Studienergebnisse, denn 10.000 Schritte sind für die meisten im Alltag schwer zu erreichen. In Wahrheit gibt es aber keinen Grund zum Feiern. Der durchschnittliche Einwohner in den
entwickelten Ländern bewegt sich dank neuer Technologien und Lebensweisen deutlich weniger als Menschen vor einem halben Jahrhundert. Deswegen genügen schon kleinere Veränderungen (z. B. 5.000 Schritte pro Tag), um die gesundheitliche Situation der Bevölkerung zu verbessern. Unter dem Strich stellt das eine Niederlage für die Menschen des 21. Jahrhunderts dar. Wir sitzen im Auto, bei der Arbeit, zuhause und im Urlaub – somit begehen wir alle „ Selbstmord in Zeitlupe“. Dass Sport und Bewegung gesund sind, ist bereits seit der Antike bekannt. Nach diesen alten Erkenntnissen wird aber selten im Alltag gehandelt. Einige schaffen es, zwei- bis dreimal pro Woche kleinere Sporteinheiten einzubauen. Die restlichen Tage werden trotzdem in einer sitzenden Position verbracht – also in einem Zustand, der den Organen und dem Stoffwechsel nicht guttut. Vielen ist nicht bewusst, wie sehr der Bewegungsmangel im Alltag Nieren, Leber, Herz, Gehirn und die Gesundheit im Allgemeinen beeinflusst. Daher ist klar: Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Eine aktive Lebensweise besteht nicht nur aus den gelegentlichen Ausflügen in das Fitnesszentrum, sondern auch aus alltäglichen Bewegungseinheiten, die über den Tag verteilt sind.
Muskelaufbau als Anti-AgingMaßnahme
Einige wissenschaftliche Studien bestätigen, dass es ab dem 60. Lebensjahr einen Zusammenhang zwischen Muskelmasse oder Muskelkraft und Gesundheit gibt – unabhängig davon, ob von kardiovaskulären, neurodegenerativen oder von Erkrankungen des Bewegungsapparates die Rede ist. Die degenerativen Prozesse, die zum altersbedingten Muskelabbau führen, beginnen schon in den frühen 30ern. Es ist bewiesen, dass diejenigen, die in ihren 30ern und 40ern das Muskelaufbau-Training praktiziert haben, auch im späten Alter dem Abbau der Muskelmasse deutlich leich-
ter entgegenwirken können. Das heißt aber nicht, dass jemand, der diese frühe Chance verschlafen hat, nichts mehr für den Körper tun kann. Studien aus den letzten Jahren zeigen deutlich, dass sogar die 80-Jährigen, die nie Sport getrieben haben, von regelmäßigen Sport- oder Bewegungseinheiten (z. B. regelmäßigen Spaziergängen und Dehnübungen) profitieren.
Stoffwechselregulation
Das „w ichtigste“ Organ bei der Bewegung, wenn es so etwas überhaupt gibt, ist die Muskulatur. Neben ihrer moto-
Hausärzt:in medizinisch 20 Juli/August 2023
©
shutterstock.com/Chan2545
rischen Funktion wurde in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt die metabolische Natur der Muskeln untersucht. Abgesehen von der Verstoffwechslung der Kohlenhydrate, spielt der Umgang mit den freien Sauerstoffradikalen (ROS) in der Muskelaktivierung eine wichtige Rolle für den ganzen Körper. Bei der Muskelaktivierung wird vermehrt die zelleigene antioxidative Abwehr (z. B. Expression der Superoxid-Dismutase 2) aktiviert, wodurch indirekt auch der Fettstoffwechsel moduliert wird. Diese Stoffwechselveränderung erhöht die metabolische Flexibilität im Rest des Körpers und unterstützt die Funktion der Betazellen im Pankreas. Dadurch lässt sich zumindest teilweise die Vorbeugung metabolischer Erkrankungen durch körperliche Aktivität erklären.
Ganzer Körper profitiert von Bewegung
Sprechen wir von Sport und Bewegung, denken die meisten ausschließlich an die Muskeln. In der Realität ist der ganze Körper an der Bewegung beteiligt und profitiert davon. So sorgt die Aktivierung des Atmungsapparates für die ausreichende Sauerstoffversorgung im Körper während der körperlichen Aktivität. Dabei wird die Atmungsmuskulatur gestärkt, wodurch eine regelmäßigere und tiefere Atmung auch in Ruhephasen erreicht wird. Einerseits ermöglicht die Regulation des Blutdrucks durch die Endothelmuskulatur in den Blutgefäßen eine effizientere Versorgung der Muskeln mit Nährstoffen. Andererseits wird dadurch die Flexibilität der Blutgefäße drastisch erhöht, wodurch das Risiko, kardiovaskuläre Erkrankungen zu erleiden, reduziert wird. Die Verstoffwechslung der Fette in der Leber sorgt für ausreichend Energie während der körperlichen Aktivität. Durch diese Stoffwechselumstellung kann aber auch die hepatische Fettakkumulation reduziert werden. Dank des Effekts lässt sich bei Patientinnen und Patienten mit Fettleber eine 30%ige Verringerung der Fettakkumulierung bereits nach acht Wochen regelmäßiger moderater Trainingseinheiten erzielen.
Fazit
Neben der direkten Stoffwechselregulation werden bei der Muskelaktivierung durch Training oder Bewegung auch zellfreie Nukleinsäuren in die Blutbahn freigesetzt. Dadurch wird zum Teil die Fettverbrennung aktiviert. Darüber hinaus führen manche dieser zellfreien DNAs zu erhöhter Neuroplastizität und Makrophagenaktivierung. Dieser potenzielle Mechanismus soll für die positiven Effekte der körperlichen Aktivität verantwortlich sein und wird daher für das Schmerzmanagement und für die Tumorzellenbekämpfung vorgeschlagen.
Die positiven Effekte der körperlichen Bewegung auf die Gesundheit erstaunen nur wenige. Oft ist es aber überraschend, wie einfach es sein kann, mit der leichten bis moderaten – aber regelmäßigen – Bewegung die Gesundheit aller Organe zu verbessern. Daher sollte diese nicht nur als Mittel zur Reduktion der Kör-
permasse, sondern auch als eines der wichtigsten Instrumente zur Gesundheitserhaltung gesehen werden. Die Kontinuität, nicht die Intensität ist dabei in den Vordergrund zu rücken. Somit wird hoffentlich die körperliche Aktivität in jeden Therapie- und Prophylaxeplan aufgenommen.
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Lebensmotor Bewegung
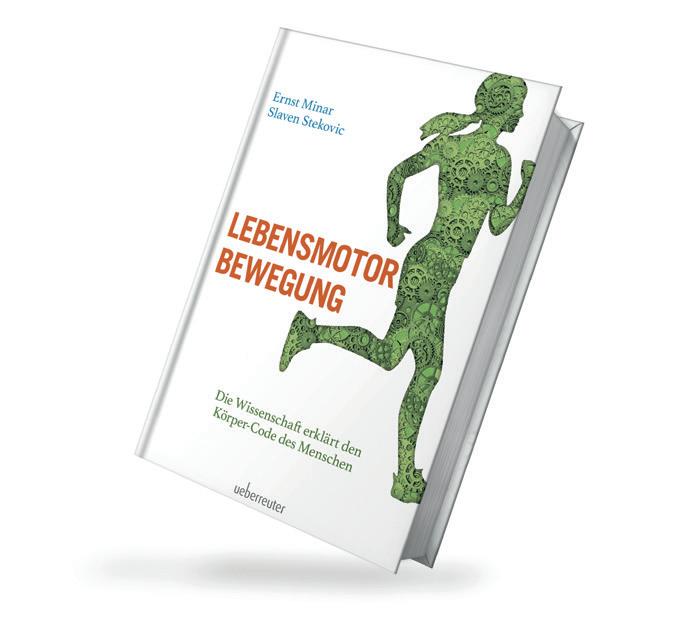

Hausärzt:in medizinisch 21 Juli/August 2023
GASTAUTOR: Dr. Slaven Stekovic, MBA Molekularbiologe und Wissenschaftler in den Bereichen Langlebigkeit, Alterung und altersassoziierte Erkrankungen, Karl-FranzensUniversität, Graz
© privat
Von Ernst Minar und Slaven Stekovic Carl Ueberreuter Verlag 2022
<
„Eine aktive Lebensweise besteht nicht nur aus gelegentlichen Ausflügen ins Fitnesszentrum, sondern auch aus alltäglichen Bewegungseinheiten, die über den Tag verteilt sind.“
Opportunistische Infektionen
Risikomanagement bei immunsuppressiver Therapie
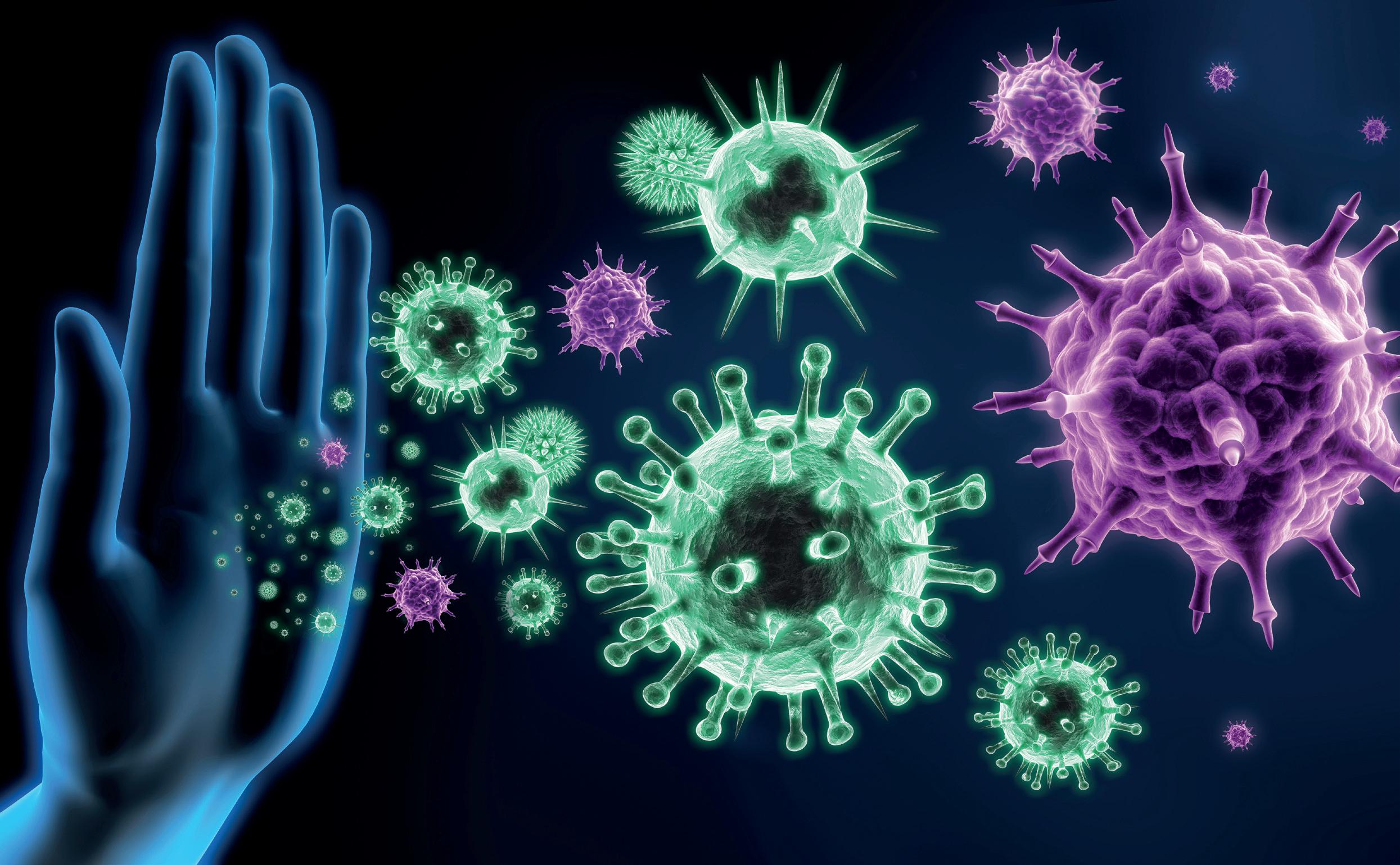
Welche Infektionen sind bei Immunsuppression zu erwarten? Den Hauptanteil machen Infektionen aus, die auch bei Immunkompetenten am häufigsten vorkommen. Hierzu zählen Harnwegsinfekte, respiratorische Infekte sowie Hautinfektionen mit den typischen Krankheitserregern. Es finden sich jedoch vermehrt Resistenzen gegenüber Antibiotika bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten. Eine weitere Gruppe von Erkrankungen sind Reaktivierungen von früheren Infektionen unter Immunsuppression, z. B. Herpes Zoster oder Mykobakteriosen. Neben den Krankheitserregern, die für alle Menschen eine Gefahr für Infektionen darstellen, kommen bei Immunsupprimierten auch einige andere dazu – etwa Pneumocystis
jirovecii , Toxoplasma und das Zytomegalievirus (CMV).
Richtungweisende Faktoren
Der Einfluss einer immunsuppressiven Therapie auf die Infektion mit bestimmten Krankheitserregern ist meist nicht eindeutig vorhersehbar. Prinzipiell begünstigt eine verminderte humorale Immunantwort Infektionen durch Bakterien mit Kapsel (Pneumokokken, Meningokokken), außerdem das Auftreten einer Hepatitis-BReaktivierung. Unter Neutropenie treten vermehrt Infektionen mit endogenen Bakterien, Candida und Nocardia auf, während T-Zell-Defekte insbesondere zu Infektionen mit intrazellulären Organismen führen. Hierzu
GASTAUTORIN: OÄ Dr.in Eva Rath Leiterin der Abteilung für Rheumatologie und Immunologie, Mein HanuschKrankenhaus, Wien

AKTUELL
Das Vorgehen bei latenter Tuberkulose und Biologikatherapien wird im Consensus Statement der Österreichischen Gesellschaften für Rheumatologie und Rehabilitation, Pneumologie, Infektiologie, Dermatologie und Gastroenterologie zum Umgang mit latenter Tuberkulose bei Therapien mit biologischen oder „targeted synthetic DMARDs (disease modifying anti-rheumatic drugs)“ praxisnah erläutert. Der Consensus ist via Open Access verfügbar.
Publikation: Rath E et al., Z Rheumatol 82, 163–174 (2023). doi.org/10.1007/ s00393-022-01274-6

22 Juli/August 2023
© Budiono Nguyen
© shutterstock.com/peterschreiber.media
zählen Mykobakterien, Pneumocystis, Aspergillus und Herpesviren (CMV). Glukokortikoide spielen eine beträchtliche Rolle in der Entstehung von Infektionen. Die Beeinflussung der Infektabwehr ist dosisabhängig. Als Grenzwert für ein hohes Infektionsrisiko gilt eine Tagesdosis ab 40 mg Prednison. Eine Dosis unter 7,5 mg Prednison pro Tag birgt ein geringeres Infektionsrisiko. Als risikoerhöhende Faktoren kommen die Kombination mit anderen immunsuppressiven Medikamenten, das (höhere) Patientenalter sowie die Dauer der Behandlung dazu. Hauptsächlich finden sich unter Steroidtherapie gewöhnliche bakterielle und virale Infekte, aber auch Herpes Zoster sowie Infektionen mit Staphylokokkus aureus und Candida . Zusätzlich besteht ein erhöhtes Risiko, Infektionen mit Mykobakterium tuberculosis und Pneumocystis jirovecii zu entwickeln.
Bei den sonstigen immunsuppressiven Medikamenten kann man eine grobe Unterteilung in hohes, mittleres und geringes Infektionsrisiko vornehmen. Das höchste Infektionsrisiko bedingt –insbesondere in Kombination mit Glukokortikoiden – Cyclophosphamid. Mit einem ebenfalls beträchtlichen Risiko gehen Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil, Methotrexat, Leflunomid, TNF-Blocker, anti-IL6, Abatacept, JAK-Inhibitoren und Rituximab einher. Die Dosis und eine zusätzliche Therapie mit Glukokortikoiden haben hierbei natürlich auch einen entscheidenden Einfluss. Unter RituximabTherapie findet sich ein erhöhtes Risiko einer Hepatitis-B-Reaktivierung,
hinsichtlich einer Tuberkulose besteht unter Rituximab kein erhöhtes Risiko.
Im Gegensatz dazu ist unter TNFBlocker-Therapie das Tuberkuloserisiko um das bis zu Vierfache erhöht. JAK-Inhibitoren steigern das Risiko eines Herpes Zoster.
Pneumocystis-Pneumonie
Der den Pilzen zugeordnete Pneumocystis jirovecii ist der Verursacher der Pneumocystis-Pneumonie. Ein besonderes Risiko besteht die ersten sechs Monate nach Organtransplantation, bei prolongierter Neutropenie, verringerten CD4-Zellen (HIV), intensiver Immunsuppression, reduzierter zellmediierter Immunität, hohem Steroidbedarf sowie bei einer Kombination von Steroid und zytotoxischen Substanzen. Die Pneumonie führt zu Husten, Atemnot und Hypoxämie. Das Thoraxröntgen zeigt oft eine geringe Pathologie, eventuell diffuse bilaterale Infiltrate. Im Labor werden meist Beta-D-Glucan sowie eine Erhöhung der LDH nachgewiesen. In der Computertomographie finden sich Milchglas-, manchmal auch zystische Veränderungen. Die Diagnose erfolgt über den Keimnachweis aus der bronchoalveolären Lavage. Zur Therapie wird in erster Linie Cotrimoxazol (15-20 mg/kg KG Trimethoprim pro Tag) verwendet. Begleitend wird eine Steroidtherapie von etwa 60 mg Prednisolon täglich gegeben. Nach etwa sieben Tagen ist eine klinische Verbesserung zu erwarten, die Behandlung soll für etwa 21 Tage in therapeutischer Dosierung fortgesetzt werden.
Für die Prophylaxe einer Pneumocystis-Pneumonie bei immunsuppressiver Therapie im Rahmen von Rheumaerkrankungen gibt es keine Richtlinien. Allgemein wird jedoch meist bei Kombination von Glukokortikoiden und Cyclophosphamid eine Prophylaxe gegeben. Auch bei einer Prednisondosis von > 20 mg/ Tag für mehr als einen Monat und zusätzlichem immunsuppressivem Medikament ist eine Prophylaxe sinnvoll. Die Cotrimoxazol-Dosis beträgt dabei 160/800 mg dreimal pro Woche oder 80/400 mg täglich.
Tuberkulose und latente TBI
In Österreich wurden im Jahr 2020 388 Fälle von Tuberkulose gemeldet, das entspricht einer Inzidenz von 4,4 auf 100.000 Einwohner, welche weltweit gesehen extrem niedrig ist. Zur Diagnose der Tuberkulose ist der Erregernachweis in (Ziehl-Neelson-)Färbung, Kultur oder PCR notwendig. Indirekte Nachweise sind ein typisches Muster im Thoraxröntgen, ein positiver IGRA („I nterferon Gamma Release Assay“, z. B. Quantiferon) oder Tuberkulinhauttest.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Auch bei Immunsupprimierten sind seltene Infektionen selten.
Bei unzureichendem Ansprechen auf eine empirische Therapie oder bei atypischem klinischem Bild – z. B. deutlicher Hypoxie bei kaum vorhandenem Infiltrat – sollte man an die seltenen Ursachen denken.
Kortison in Abhängigkeit von Dosis und Dauer bleibt ein großer Risikofaktor.
Ein Consensus zum Vorgehen bei latenter Tuberkulose und Biologikatherapien wurde rezent publiziert.
Bei der latenten Tuberkuloseinfektion (LTBI) kommt es zur Persistenz vitaler Tuberkulosebakterien im Organismus nach einer Infektion. Die infizierte Person ist klinisch gesund und nicht ansteckend. Der IGRA oder Tuberkulinhauttest ist positiv, eine Tuberkuloseerkrankung ausgeschlossen. Die Prävalenz der LTBI beträgt weltweit ca. 25 %, in Österreich schätzt man sie auf ca. 3-5 % der Bevölkerung. Verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen immunologischer Kontrolle und bakterieller Aktivität zu Ungunsten der Immunität, kann sich aus der LTBI eine Tuberkulose entwickeln (Reaktivierung). Da insbesondere für die Therapie mit TNF-Blockern die Gefahr einer Tuberkulosereaktivierung bekannt ist, wurde rezent ein österreichweiter Consensus zum Vorgehen im Falle einer LTBI beim Einsatz von Biologikatherapien erzielt (siehe AKTUELL). Dieser stellt die wichtigsten Punkte zu Screening und präventiver Therapie bei LTBI klar.
Hausärzt:in medizinisch 23 Juli/August 2023
<
Rezeptstudie
Österreichischer Verschreibungsindex
Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches
Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.
FÜR WEITERE FRAGEN:
+43 (0) 664 8000 2237
Alexa Ladinser
alexa.ladinser@iqvia.com
+43 (0) 664 8000 2237
Lidia Wojtkowska
medicalindex@iqvia.com
0800 677 026 (kostenlos)
weltweit
Weltweite Studie zu indikationsbezogenen Verordnungen!
anonym
Sichere und anonyme Datenübermittlung 1x/Quartal.

flexibel
Flexibler Zugriff auf ein bedienerfreundliches Online-Tool.
120 €
Bis zu 120 € pro Stunde Aufwandsvergütung
Hier scannen um sich zur Teilnahme zu registrieren.
Schlau gewachsen
Konzentrationsstörungen mit Hilfe der Naturheilkunde ein Schnippchen schlagen
GASTAUTORIN: Dr.in Petra Zizenbacher Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilärztin und Ganzheitsmedizinerin in Wien, naturheilzentrum.at

In allen Lebensphasen kommen Konzentrationstörungen oder Gedächtnisverlust vor. Kindern und Jugendlichen fällt es oftmals schwer, sich zu konzentrieren. Sie zappeln herum –ruhig zu sitzen, fokussiert zu spielen oder zu lernen ist ihnen fast unmöglich. Erwachsene jeden Alters können in Erschöpfungszustände
geraten. Schlafstörungen, Gedächtnisverlust, Überforderung oder Konzentrationsstörungen sind Folgen davon. Eine Vielzahl von Pflanzen vermag es, die Hirnleistung zu verbessern. Damit die Phytotherapie den Menschen optimal unterstützen kann, sollten allerdings die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.

Positive Lernerfahrungen
Erinnern Sie sich noch an Weihnachten, als Sie ein Kind waren? Oder an eine besondere Begegnung mit Ihrer Lieblingsoma/Ihrem Lieblingsonkel? Vielleicht
hat der Onkel mit Ihnen zu besonderen Anlässen den Kirtag besucht und Sie durften Ringelspiel fahren ... Haben Sie noch Situationen aus Ihrer Kindheit im Gedächtnis, in denen Sie stundenlang das Schaukeln, Lesen oder lustige Spiele genossen haben? Oder wenn im Urlaub die Zeit viel zu schnell verging: Flutsch, war die schöne Zeit schon wieder vorbei ... Angenehme Erlebnisse kann man zumeist leicht erinnern. Jene, die unangenehm waren, werden entweder verdrängt oder können zu Angststörungen führen und Schlafstörungen begünstigen. Psychologinnen und Psychologen haben längst herausgefunden, dass
Hausärzt:in pharmazeutisch 25 Juli/August 2023
©
>
stock.adobe.com/Matyfiz
© Budiono Nguyen
positive Erlebnisse und stärkende, wertschätzende Rückmeldungen dabei helfen, Konzentrationsstörungen zu vermeiden. So können Gedächtnis und Lernerfolg leicht gesteigert werden. In der Tierdressur weiß man: Ein Leckerli wirkt Wunder. Lob erhöht den Lernerfolg, Ruhe nach der Trainingseinheit trägt dazu bei, das Erlernte zu behalten. Bei Menschen ist es ganz ähnlich.
Fragwürdiges Multitasking
Wahrscheinlich ist es jedem schon einmal passiert: Man möchte etwas tun, und noch bevor man das Geplante umsetzen konnte, kam es zu einer Ablenkung durch ein Telefonat, ein Gespräch oder Ähnliches. Erst viel später merkt man, dass einem ein Vorhaben „entfallen“ ist. Ablenkung stellt eine Hauptursache für Unfälle oder Fehler dar, die bei der Ausführung einer Tätigkeit entstehen. Multitasking zu beherrschen, sagte man z. B. Napoleon nach. Er soll mehrere Tätigkeiten gleichzeitig und fehlerfrei erledigt haben. Fast jeder ist heutzutage ein „Multitasker“: schnell das Frühstück herrichten, den Stundenplan der Kinder überprüfen, allfällige Unterschriften tätigen, den eigenen Arbeitstag vorbereiten und vieles mehr. Alles gleichzeitig. Noch vor ein paar Jahren gab es in jedem Büro Fachpersonal, welches sich um Organisatorisches und Koordination kümmerte. Heute sind etliche berufstätige Menschen sich selbst Sekretär, Koordinator, Kontroller etc. Alles gleichzeitig zu machen ist anstrengend, laugt aus und führt zu Erschöpfung.
Hormonelle Turbulenzen
Oft sieht man Mütter mit Kindern, die während des Spazierganges telefonieren. Bei Tisch sitzen sich Paare häufig gegenüber und jeder ist mit seinem elektronischen Gerät beschäftigt. Die meisten Menschen – ja sogar Kinder – sind auf verschiedenen Informations- und Sozialkanälen aktiv. „Hast du schon auf Telegram, Facebook, Instagram etc. gelesen, was passiert ist?“ So hechelt man vielem hinterher. Unter Stress kommt es zu hormonellen Turbulenzen. Adrenalin- und Cortisolspiegel steigen. Dies führt auf Dauer zu
Stoffwechselstörungen wie Diabetes. Eine Hypertonie wird ebenfalls begünstigt. Chronische Erkrankungen, z. B. Rücken-, Kopf-, Gelenkschmerzen und Sehschwäche, um nur einige zu nennen, können entstehen.
Um Stress, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen etc. zu vermeiden, empfehlen sich diverse Maßnahmen für den Alltag. In jeder Woche sollte es etwa Zeiten – idealerweise Tage –geben, in denen kein elektronisches Gerät verwendet wird. Sport im Allgemeinen und Bewegung an der frischen Luft im Besonderen entspannen den Körper und klären den Kopf. Zwei bis drei Mal pro Woche sollte man sich Zeit für körperliche Aktivität nehmen. Vollwertkost und der Genuss von Obst und Gemüse, möglichst mehrmals täglich, versorgen den Körper mit genügend Vitaminen und Nährstoffen.
Regenerierender Schlaf
„Narrenkastl schau‘n“, also absichtslos z. B. in den Himmel blicken, entspannt Augen und Nerven. Noch vor ein paar Jahrzehnten wurde Mittagsruhe gehalten. Die Geschäfte waren geschlossen, es wurde gemeinsam gegessen, anschließend geruht. In Japan wird dies noch heute getan. Das sogenannte „Powernapping“, sprich nach dem Essen für eine kurze Zeit die Augen schließen und ruhen, gehört zur dortigen Lebenskultur. Will man die Konzentrationsfähigkeit steigern, sollte man darauf achten, ausgeruht zu sein und vor und nach Lernphasen für Entspannung zu sorgen. Im Schlaf ordnet das Gehirn die Tageseindrücke und Gefühle. Fehlt erholsamer Schlaf, werden Konzentrationsstörungen tagsüber begünstigt. Vor dem Schlafengehen empfiehlt es sich, nur gute Gespräche zu führen oder sich positive Filme anzusehen. Ein Streitgespräch oder ein Thriller vor der Ruhezeit verhindert tiefen Schlaf. Hingegen wirkt ein Fußbad vor dem Schlafengehen entspannend, reinigend und wohltuend. Denn die Fußsohlen sind Reflexzonen, die den gesamten Körper widerspiegeln. Über sie kann er schädliche Stoffe ausscheiden. Trinkt man dabei noch eine Tasse Kräuteraufguss oder Honigmilch, schläft man besser.
Pflanzliche Unterstützung
Die Naturheilkunde bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Hirnleistung zu steigern. Walnüsse haben eine ähnliche Form wie das Gehirn. Schon die Signaturenlehre wertete dies als ein Zeichen für jenes Einsatzgebiet. Präparate aus Blättern und Früchten des Ginkgobaumes helfen dabei, die Konzentration zu verbessern. Seit der Antike weiß man: Honig beruhigt. Honigmilch, löffelweise vor der Nachtruhe genossen, entspannt und man schläft leichter ein. Dafür wird ein Löffel Honig in warmer Milch oder Reismilch aufgelöst und diese Mischung langsam getrunken. Erprobte Heilpflanzen sind etwa Baldrian und Hopfen. Ihre Kombination wird von vielen Menschen erfolgreich als Einschlafhilfe genützt. Mit Kräutern befüllte Kissen duften, entspannen und beruhigen. Lavendel, Zitronenmelisse, Kamille, Eberraute und viele andere werden seit jeher dafür herangezogen. Zitronenmelisse wirkt beruhigend aufs Herz und eignet sich sehr gut als Schlaftrunk. Welche natürlichen Hilfen man auch nützt – Dauertherapien sollten vermieden werden. Zum Beispiel kann man vor dem Schlafen abwechselnd Melisse, Lindenblüte, Kamille oder Johanniskraut als Aufguss trinken. In jeder Lebensphase profitiert man von einer anderen Pflanze. Richtig eingesetzt, helfen die Schätze der Natur uns Menschen.
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp

Naturheilkunde für die ganze Familie
Von Petra Zizenbacher
Freya Verlag
26 Juli/August 2023
Hausärzt:in pharmazeutisch
<
27 Juli/August 2023
„Indikationen & Interaktionen stets berücksichtigen“
Traditionelle Europäische Heilkunde für Patient:innen mit Herzbeschwerden
Um 1900 hat Dr.in Anna FischerDückelmann – eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum mit Medizinstudium – das Buch „ Die Frau als Hausärztin“ geschrieben. Dieses galt noch in den 1960er-Jahren als naturheilkundliches Standardwerk. Dr.in Christina Dückelmann, MSc, aHPh ist eine Nachfahrin der engagierten Medizinerin und will in ihre Fußstapfen treten, wenn es darum geht, der „sanften Medizin aus der Natur neben der Schulmedizin einen Platz einzuräumen“

Als Expertin und Koordinatorin für Klinische Pharmazie und angewandte Pharmakologie an der PMU spezialisierte sie sich unter anderem auf kardiologische Fragestellungen. Im Interview mit der Hausärzt:in spricht die Apothekerin über die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von alternativen Heilmethoden bei Herzbeschwerden.
HAUSÄRZT:IN: Inwiefern hat Sie
Ihre Vorfahrin, Dr.in Anna FischerDückelmann, Autorin des Buches „Die Frau als Hausärztin“ , zu Ihrem beruflichen Werdegang inspiriert?
Dr.in DÜCKELMANN: Ich habe Pharmazie studiert und sehr bald in meinem Berufsleben die Klinische Pharmazie entdeckt, die mich – aus einer Medizinerfamilie stammend – sehr fasziniert hat. Die Arbeit mit den Arzneimitteln im Kontext der Erkrankungen gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten an Patientinnen und Patienten war für mich sinnstiftend. Da ich selbst keine Freundin einer übersteigerten Medikation bin, gefällt mir der Ansatz meiner Vorfahrin, die Methoden der Traditionellen Heilkunde als Ergänzung zur Schulmedizin einzusetzen und auszuschöpfen. Meine Entscheidung, mich zusätzlich zur Schulmedizin intensiv mit der Traditionellen Europäischen Heilkunde zu beschäftigen, ist also sicher auch auf ihren Einfluss zurückzuführen.
Wo sind bei der Anwendung von traditionellen Heilmethoden zur Behandlung herzschwacher Patient:innen die Grenzen zu ziehen? Allein in Österreich wurden 2018 rund 24.000 Personen wegen Herzinsuffizienz – einer chronischen und lebensbedrohlichen Erkrankung – stationär im Krankenhaus aufgenommen.1 Erste Anzeichen
Dr.in Christina Dückelmann, MSc, aHPh Klinische Pharmazeutin an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU), Schnittstellenmanagerin PMU/ Landesapotheke, im Gespräch.
einer Herzschwäche, beispielsweise Erschöpfung, Kurzatmigkeit oder geschwollene Beine, werden leider oftmals als typische Altersbeschwerden falsch gedeutet. Wenn hier nicht richtig diagnostiziert und in der Folge leitliniengerecht behandelt wird, haben die Betroffenen eine sehr viel schlechtere Prognose. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Stadium der Herzinsuffizienz die Patientin/der Patient ist, aber der Einsatz der traditionellen Heilmethoden kann bei dieser Erkrankung wenn überhaupt nur als Ergänzung von – mit Schulmedizin und traditioneller Heilkunde vertrautem –Fachpersonal empfohlen werden.

Hausärzt:in pharmazeutisch
© privat
© shutterstock.com/Marina Lohrbach Juli/August 2023 28
Inwiefern kommt die Heilpflanze
Fingerhut heute noch bei Herzpatient:innen zum Einsatz?
Fingerhut ist aufgrund der Herzglykoside eine giftige Pflanze mit einer schmalen therapeutischen Breite. Das heißt, sehr wenig von diesen Herzglykosiden kann sehr viel bewirken – bzw. können gravierende Nebenwirkungen auftreten. Die Heilpflanze Fingerhut kommt als standardisiertes Präparat in der Schulmedizin bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit bestimmten supraventrikulären tachykarden Herzrhythmusstörungen – insbesondere Vorhofflimmern – zum Einsatz. Bei Herzinsuffizienz spielt sie in den aktuellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie nur mehr eine untergeordnete Rolle als Reservemedikament. Sie kann bei symptomatischen Personen angewendet werden, um das Risiko einer Krankenhauseinweisung zu reduzieren, oder auch als Alternative zu Betablockern bei Tachykardien. Einen Einfluss auf die Mortalität hat sie allerdings nicht.2
Wie kann die Traditionelle Europäische Heilkunde die Beschwerden bei „ Altersherz “ lindern?
Weißdorn ist ein universelles Herzmittel, das traditionell bei funktionellen, organischen und degenerativen Erkrankungen des Herzens angewendet wird. Bei beginnender altersbedingter Leistungsverminderung des Herzens –mit Symptomen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit bei Belastung – kann aufgrund langjähriger Erfahrung auf dem genannten Anwendungsgebiet zu
Weißdornpräparaten gegriffen werden, zum Beispiel in Form von Tropfen oder Tabletten. Allerdings nur dann, wenn eine ärztliche Abklärung stattgefunden hat, um keine Fehlbehandlung zu riskieren.3 Laut der HMPC-Monographie der EMA von 20164 darf Weißdorn nämlich nur mehr bei nervösen Herzbeschwerden und nicht mehr bei Herzinsuffizienz bis zum Stadium NYHA II eingesetzt werden. In jedem Fall empfehle ich unbedingt Präparate mit standardisiertem Wirkstoffgehalt bzw. Droge-ExtraktVerhältnis aus der Apotheke. Wichtig für die Wirkung sind vor allem die Flavonoide und Procyanidine. Ohne Wirkung keine Nebenwirkung: Auch wenn es keine Studien zu Wechselwirkungen mit anderen Präparaten gibt, sollten –je nachdem welche Begleitmedikation verwendet wird – die Vitalparameter regelmäßig überwacht werden.
Bei welchen Beschwerden kann die Phytotherapie noch helfen?

Pflanzen mit entwässernden Eigenschaften wie Birke oder Brennnessel können bei Wasseransammlungen unterstützend als Tee getrunken werden. Dabei ist immer auf die zugeführte Trinkmenge zu achten. Im Gegensatz zu Diuretika führt die Phytotherapie nicht zu Elektrolytentgleisungen. Die auch als „Herzkraut“ bekannte Melisse oder die angstlösende Passionsblume können mit ihrer ausgleichenden, beruhigenden Wirkung ebenfalls als Tee, in Form von Tropfen, Dragees, Tabletten oder Kapseln entlastend eingesetzt werden, wenn die Herzbeschwerden psychisch bedingt sein könnten. Bei der Anwendung die-
ser Arzneipflanzen sollte unbedingt eine medizinische oder pharmazeutische Fachperson hinzugezogen werden, die das Wirkprofil genau kennt.
Generell sind Ruhe und moderate Bewegung, eine ausgewogene, nährstoff-, mineralstoff- sowie vitaminreiche Ernährung, wenig Alkohol und Entspannungsmethoden wie Meditation zu empfehlen.
Welche Wechselwirkungen können beim Einsatz von Heilpflanzen auftreten?
Heilpflanzen, die wie der Fingerhut Herzglykoside enthalten – zum Beispiel das Adonisröschen, die Meerzwiebel, das Maiglöckchen, Strophantus oder auch der Oleander –, gelten als giftig und sollten daher nicht ohne ärztliche Beratung und Verschreibung bei Herzbeschwerden eingesetzt werden. Es kann zu Wechselwirkungen wie Bradykardie oder Elektrolytentgleisungen mit einer Vielzahl von Medikamenten kommen, etwa mit Betablockern, Entwässerungsmedikamenten, Antiarrhythmika, Glukokortikoiden und Kalzium.
Das Gespräch führte Mag.a Ines Pamminger, BA.
Referenzen:
1 Statistik Austria, Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2018. ISBN 978-3-903264-42-7.
2 Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. N Engl J Med. 1997 Feb 20;336(8):525-33.
3 Monografie der Kommission E zu Crataegi cum flore, BAnz Nr. 133 vom 19.07.1994.
4 European Union herbal monograph on Crataegus ssp., folium cum flore. 05.04.2016, EMA/ HMPC/159075/2014.
Hausärzt:in pharmazeutisch
29 Juli/August 2023
Oftmals unterschätzt
Erhöhtes Risiko RSV-assoziierter Hospitalisierungen im Alter –erste Zulassung eines Impfstoffs für ältere Erwachsene
Das Respiratorische Synzytial-Virus ist ein weltweit verbreitetes EinzelstrangRNA-Virus aus der Familie der Pneumoviridae, welches sich über Tröpfchen- und Schmierinfektion verbreitet. „I nfizierte Personen sind in der Regel drei bis vier Tage lang ansteckend“, erklärte Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin, Karl-Landsteiner-Institut für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie, bei einem Pressegespräch in Wien.* „ Ä ltere Erwachsene können das Virus – wie bei allen Infektionskrankheiten – länger ausscheiden.“
Große Krankheitslast bei Älteren
für Influenza eine Therapie gebe, auch wenn diese nicht optimal sei, stehe eine für RSV bei Erwachsenen nicht zur Verfügung. Daher sei man froh über die Zulassung des weltweit ersten RSV-Impfstoffs für Erwachsene ab 60 Jahren durch die Europäische Kommission (siehe Kasten).
Impfung als Hoffnungsträger
EXPERTE:
Bei den meisten Menschen verursacht RSV erkältungsähnliche Symptome. Es kommt während des gesamten Lebens wiederholt zu Infektionen, nicht nur in der Kindheit. Schwere Krankheitsverläufe sind insbesondere bei Säuglingen und älteren Erwachsenen bzw. Personen mit Grunderkrankungen möglich. So kann RSV z. B. eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma oder eine Herzinsuffizienz verschlimmern und gravierende Folgen wie Pneumonie, Hospitalisierung und den Tod zeitigen. In Europa führt RSV bei Erwachsenen über 60 Jahre jährlich zu mehr als 270.000 Krankenhauseinweisungen und etwa 20.000 Todesfällen im Spital.1-2
Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin, Karl-LandsteinerInstitut für Lungenforschung und Pneumologische Onkologie

Saisonale RSV-Epidemien treten in der Regel im Spätherbst und Winter auf und dauern zwei bis maximal fünf Monate an. Die Zirkulation von Viren – und damit die Saisonalität vieler Erkrankungen – habe sich durch COVID-19 allerdings stark verändert, führte der Experte weiter aus: Niemand wisse genau, wie es weitergehe. „Die Impfung ist ein Meilenstein, auf den wir jahrzehntelang
hingearbeitet haben“, resümierte Prim. Valipour. „Die Studiendaten stimmen uns zuversichtlich. Nun gilt es die Ärzteschaft vor der kommenden Saison zu informieren.“ Die ersten Studienergebnisse sind im Februar 2023 im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden.4 KaM
* Fach-Pressegespräch „Zulassung Arexvy, der erste RSV-Impfstoff“ der Firma GSK, 26. Juni 2023, Wien.
Literatur:
1 Savic M et al., Influenza and other Respir Viruses 2023; 17(1):e1303.




2 Tseng HF et al., J Infect Dis. 2020;222(8):1298-1310.
3 Ambosch A et al., J Clin Virol 2023 Apr;161:105399.
4 Papi A et al., Engl J Med 2023 Feb 16;388(7):595-608.
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
� Die Europäische Kommission hat den adjuvanten RSV-Totimpfstoff Arexvy im Juni 2023 für die aktive Immunisierung von Erwachsenen ab 60 Jahren zur Prävention von RSV-bedingten Erkrankungen der unteren Atemwege zugelassen.
� In Österreich soll der Impfstoff ab September für die nächste RSV-Saison verfügbar sein. Empfehlungen für den angemessenen Einsatz stehen noch aus.
� Die Zulassung basiert auf den positiven Daten der Phase-III-Zulassungsstudie AReSVi-006. In dieser erzielte der Impfstoff eine Gesamtwirksamkeit von 82,6 % bei 60-jährigen und älteren Erwachsenen sowie eine Wirksamkeit von 94,6 % bei älteren Erwachsenen mit mindestens einer chronischen Grunderkrankung wie Asthma, COPD, kardiovaskulären Erkrankungen und Diabetes.
Die klinische Belastung durch RSVInfektionen sei somit in etwa mit jener durch Influenza zu vergleichen, betonte Prim. Valipour. Ja, RSV-Patientinnen und -Patienten seien sogar im Schnitt länger hospitalisiert als Personen mit Influenza A/B. 3 Und während es
� Der Impfstoff wurde generell gut vertragen. Die am häufigsten beobachteten unerwünschten Ereignisse waren Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Myalgie, Kopfschmerzen und Arthralgie. Diese waren im Allgemeinen leicht bis mittelschwer.
� Untersucht wurde bislang die Wirksamkeit in der ersten RSV-Saison, also eine einmalige Impfung. Daten zu den Saisonen 2 und 3 und damit zu jährlichen Impfungen folgen erst. In der ersten Saison zeigte die Impfung sowohl gegen RSV-A als auch gegen RSV-B eine hohe Wirksamkeit.
Hausärzt:in pharmazeutisch 30 Juli/August 2023
© shutterstock.com/Kateryna Kon
Onkologische Versorgung sicherstellen
Expert:innen fordern, Cancer Nurses in Österreich zu etablieren
„Die Anzahl der zu versorgenden Krebspatient:innen wird sich bis 2040 vermutlich verdoppel n“, macht Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe, PastPräsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO), im Positionspapier Cancer Nurse – Drehscheibe der Krebsversorgung1 aufmerksam. Absehbar ist: Die personelle Ausstattung mit onkologischen und hämatologischen Fachexpert:innen wird damit nicht Schritt halten können. Renommierte Spezialist:innen schlagen daher Alarm. Denn die Vorlaufzeiten, um neue Berufsbilder zu etablieren und neue Kräfte auszubilden, seien klarerweise sehr lang. „Wir als Expert:innen haben darum ein Forderungspapier erarbeitet, in dessen Zentrum das Berufsbild der ‚Cancer Nurse‘ steht“, erklärt Harald Titzer, BSc, MSc, DGKP, Präsident der Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen in Österreich (AHOP). „I nternational ist dieses längst etabliert. Nur Österreich hinkt deutlich hinterher.“
Attraktive Ausbildung und Karriere erforderlich
Das Positionspapier wurde bei einer Pressekonferenz* Ende Juni in Wien präsentiert. Zu den Autor:innen zählen
neben Prof. Hilbe und Titzer, DGKP, u. a. Mag.a Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- & Krankenpflegeverbands (ÖGKV), Franziska Moser, BA, MA, Pflegedirektorin Uniklinikum Salzburg, und Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe. Cancer Nurses könnten auf Basis einer spezifischen Ausbildung jene kontinuierliche und individuelle Begleitung bieten, die den Anspruch einer zeitgemäßen personalisierten Medizin erfüllt. Mag.a Potzmann: „Die laufenden Fortschritte der Medizin in der Krebstherapie bedingen, dass wir bei der Betreuung und Nachsorge der betroffenen Patient:innen mit neuen Ansätzen nachziehen – anstatt zu versuchen, irgendwie mit den bestehenden Ressourcen und Ausbildungen auszukommen “ Cancer Nurse Daniela Haselmayer, BSc, MSc, DGKP, erläutert mit Blick auf die Praxis: „ K rebspatient:innen benötigen zwischen den Behandlungsterminen Ansprechpersonen, die sie durch den vielschichtigen Versorgungsprozess begleiten und mit ihnen zwischen intramuralem Bereich und extramuralem Angebot navigieren .“
Konkret richten die Autor:innen des Forderungspapiers vier Anliegen an die Politik:
• Die Cancer Nurse soll im Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) festgeschrieben werden, inkl. struktureller Vorgaben für die unterschiedlichen Versorgungsebenen in der Onkologie.
• Eine gestufte Spezialisierung zur Cancer Nurse soll im § 17 GuKG (Spezialisierungen) gesetzlich verankert werden, mit gleichzeitiger Aufhebung einer Ausbildungsverpflichtung innerhalb von fünf Jahren nach Aufnahme der Tätigkeit.
• Die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer sollen vereinheitlicht werden – durch Erweiterung der Verordnung über Sonderausbildungen für Spezialaufgaben in der Gesundheitsund Krankenpflege (GuK-SV).
• Schließlich gilt es, Fachkarrieren in Anlehnung an eine Führungskarriere im Pflegebereich zu etablieren – auch durch eine angemessene Gehaltseinstufung.
Potenzial nutzen
Pflegedirektorin Moser resümiert: „Mit der GuKG-Novelle 2016 gibt es ein klares Bekenntnis zur tertiären Ausbildung in der Pflege. In allen Bundesländern wurden Bachelorstudiengänge für die Gesundheits- und Krankenpflege etabliert, in etlichen schon weiterführende Masterstudiengänge für Advanced Practice Nursing “
So ist auch eine weitere Qualifikation als Advanced Cancer Nurse möglich, die ein Bindeglied zwischen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis darstellt. Laut der Expertin geht es nun darum, dass das Potenzial jener auf Bachelorund Masterniveau ausgebildeten Pflege auch direkt in der klinischen Patient:innenversorgung ankommt.
* Pressekonferenz „Forderungen zur Etablierung der Cancer Nurse in Österreich“, 21. Juni 2023, Webinarstudio 7Vorne, Wien, sowie per Livestream. Veranstaltet von OeGHO und AHOP. Moderation: Walter Voitl-Bliem, MBA, OeGHO-Geschäftsführer.

Literatur:
1 OeGHO & AHOP Positionspapier Cancer Nurse. Download unter: oegho.at/service/oeghoahop-positionspapier-cancer-nurse
Hausärzt:in extra 31 Juli/August 2023
AS
Der Klimawandel ist in der Realität und in unseren Köpfen angekommen. Wir merken ihn an den schmelzenden Gletschern, der kürzeren Schneebedeckungsdauer, den längeren Trockenperioden, den heftigeren Starkregenereignissen und den häufigeren und intensiveren Hitzewellen. Wir spüren es und können es beobachten. Aber ist uns auch schon klar, dass dies erst der Anfang ist? Selbst wenn wir ab heute keine Treibhausgase mehr produzieren würden, ginge der Klimawandel wegen der Trägheit der Systeme noch viele Jahrzehnte weiter. Und dabei ist es mehr als unwahrscheinlich, dass wir – weltweit – tatsächlich kurzfristig zu radikalen Einschränkungen und Emissionsminderungen fähig sein werden. Der Alpenraum ist von der Erwärmung stärker betroffen als die Welt im globalen Mittel. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe: Die nächsten großen Meeresflächen, die sich langsa-
mer erwärmen als der Erdboden und daher ausgleichend wirken, sind von den Alpen vergleichsweise weit entfernt. Das Klima der Alpen ist beinahe schon kontinental. Und die Alpen haben immer noch zumindest zeitweise eine Schneebedeckung. Dieser Schnee reflektiert einfallende Strahlung sehr effizient. Wird die Schneebedeckung kleiner und seltener, nimmt die Reflexion ab und die Erwärmung noch stärker zu. In Wien ist die Jahresdurchschnittstemperatur in den letzten 50 Jahren seit 1970 um ca. 2 °C gestiegen. Gleichzeitig hat auch die Variabilität der täglichen Durchschnittstemperatur pro Jahr zugenommen. Eine höhere Variabilität erschwert die Anpassung an die sich ändernden Verhältnisse.
Vielfältige Folgen
Der Haupttreiber des Klimawandels sind anthropogene Treibhausgase, welche die Abgabe langwelliger Infrarotstrahlung reduzieren. Damit steigt die Energie im System und somit nicht nur die durchschnittliche Temperatur, sondern auch das Risiko verschiedener anderer Extremwetterereignisse. Bei den Gesundheitsauswirkungen denken wir spontan zuerst an Hitze. Es hat schon seine Berechtigung, höhere Temperaturen mit Hitze zu assoziieren. Aber die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sind vielfältiger: Das Schmelzen von Gletschern und Permafrostböden führt zu einer Destabilisierung von Berghängen. Trockenheit und Hitze setzen den Schutzwäldern zu, die damit anfälliger für Krankheiten und Käferbefall werden. Pflanzen, die unter Stress geraten, reagieren mit der Produktion von mehr

NACHBERICHT
und stärker allergenen Pollen. Gestörte Ökosysteme erleichtern das Einwandern von giftigen und allergenen Tieren und Pflanzen. Höhere Temperaturen beschleunigen den Vermehrungszyklus von Krankheitsvektoren. Änderungen von Temperatur und Niederschlagsmustern beeinflussen die atmosphärische Chemie sowie Transportvorgänge und damit die Schadstoffkonzentrationen. Hohe Temperaturen wirken sich auf die Qualität von Trinkwasser und die Haltbarkeit von Lebensmitteln aus. Im reichen Mitteleuropa können wir uns mit technischen Mitteln gegen die meisten dieser Gefahren schützen: Eine etablierte Diagnostik und Therapie verhindert, dass Malaria wieder in Mitteleuropa heimisch wird, strengere und engere Kontrollen der Trinkwassersysteme garantieren die Wasserqualität, Kühlvorrichtungen verringern den Lebensmittelverderb. Trotzdem treffen uns zunehmend Katastrophen wie Hochwässer, Felsstürze und Hangrutschungen. Technische Schutzbauten haben oft an einem anderen Ort, etwa unterstromig am Flusslauf, unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Klimawandel ist also längst nicht nur eine Frage von technischen Schutzmaßnahmen und davon, wie wir uns an Hitzewellen gewöhnen können.
Verhängnisvoller Leistungsabfall
Die Auswirkung von extremen Temperaturen auf den Menschen ist allerdings von all diesen Wirkmechanismen am besten erforscht. Wir besitzen natürlich ein ausreichendes physiologisches Verständnis von der Temperaturregulation
Der Gastautor war Vortragender zum Thema Temperaturrekorde bei der 68. Fortbildungstagung der Österreichischen wissenschaftlichen Gesellschaft für prophylaktische Medizin und Sozialhygiene, 6. bis 9. März 2023, Bad Hofgastein.
Hausärzt:in Arzt Sicht Sache 32 Juli/August 2023
„Temperaturextreme gefährden die Volksgesundheit“
© MedUni Wien
Der nachweisbare Mechanismus der Anpassung auf Bevölkerungsebene ist aus ethisch-moralischer Sicht durchaus kritisch zu hinterfragen
FOKUS UMWELT MEDIZIN
OR Priv.-Doz. Dr. Hanns Michael Moshammer, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Zentrum für Public Health, MedUni Wien.
des Körpers. Darüber hinaus gab es in den letzten Jahren immer mehr Feldstudien, welche die Auswirkung von Hitze und fallweise auch von Kälte auf die Volksgesundheit untersuchten. Als Wirkungsmaße dienten Zahlen von Todesfällen oder Krankenhausaufnahmen für eine Reihe von Diagnosen. Ebenso wurden an kleineren Stichproben von Schüler:innen, Student:innen oder Arbeiter:innen die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf die mentale und physische Leistungsfähigkeit untersucht.
Grundsätzlich stellen sowohl extrem niedrige als auch extrem hohe Temperaturen einen Stressfaktor dar. Bei gesunden Menschen findet man eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Zum Beispiel sollten Proband:innen mentale Aufgaben bei steigender Temperatur lösen – zuerst sahen wir eine raschere Beantwortung der Fragen bei gleichzeitiger Erhöhung der Fehlerrate, später kam es auch zu einer Abnahme der Arbeitsgeschwindigkeit. Bei körperlich anstrengender Arbeit bewirken hohe Temperaturen eine raschere Erschöpfung. Wenn nicht rechtzeitig eine Pause eingelegt und der Elektrolyt- und Flüssigkeitsverlust adäquat ausgeglichen wird, können in der Folge körperliche Schäden auftreten. Insbesondere die gestörte Erholung im Schlaf durch zu hohe nächtliche Temperaturen wirkt sich schlecht auf die Leistung am Folgetag aus.
Wenn das Menschen betrifft, die Kraftfahrzeuge lenken oder Maschinen bedienen oder aber Patient:innen betreuen müssen, kann dies durchaus auch indirekt gravierende gesundheitliche Konsequenzen haben.
Dynamik des Sterberisikos
Menschen mit Vorerkrankungen, alte Leute – allenfalls mit psychischen oder
physischen Einschränkungen, eventuell alleinstehend –, aber auch Kleinkinder, die noch nicht für sich selbst sorgen können, sind gegenüber extremen Temperaturen besonders empfindlich. In Zeitreihenstudien wurde weltweit und auch von uns an der MedUni Wien wiederholt gezeigt, dass das Risiko zu sterben deutlich von der Temperatur abhängt. Selbst nach der Kontrolle von saisonalen Effekten und Epidemien erhöhen tiefe Temperaturen langfristig (etwa, indem man das 14-Tage-Mittel betrachtet) das Sterberisiko bzw. die Anzahl der Todesfälle pro Tag. Dieser Effekt ist beinahe linear und ohne klare Schwelle.
Hohe Temperaturen hingegen wirken unmittelbar und am gleichen Tag: Oberhalb einer Schwelle kommt es zu einem fast linearen Anstieg der Todesfallzahlen mit der immer höher werdenden Temperatur. Wo diese Schwelle liegt, hängt von den „üblichen“ Temperaturen ab, die in einer Region herrschen – sie ist in Stockholm niedriger als in Rom oder sogar in Linz höher als im Waldviertel. Auch im Zeitverlauf

beobachteten wir eine Änderung jener Schwelle: In Wien ist sie im Laufe von 50 Jahren parallel zur Erhöhung der jährlichen Durchschnittstemperaturen ebenfalls um ca. 2 °C gestiegen.
Ein Selektionseffekt
Wir sehen also deutliche Hinweise für eine Anpassung. Diese erfolgt jedoch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Einerseits gibt es eine physiologische Anpassung, bei der sich das Kreislaufsystem, die Schweißzusammensetzung und der Elektrolythaushalt auf die Umgebungsbedingungen einstellen. Andererseits gibt es Verhaltensänderungen, etwa in Bezug auf Ernährung, Bekleidung, Sportausübung, Tagesrhythmus (Mittagspause!) und Aufenthalt in der Sonne oder im Schatten. Nicht zuletzt werden bauliche, technische und gesellschaftliche Anpassungsmaßnahmen getroffen. Jede dieser Anpassungsarten unterliegt einer eigenen zeitlichen Dynamik und nicht alle können mit dem Klimawandel Schritt halten. Ein wichtiger Aspekt der scheinbaren „A npassung“ der Bevölkerung ist aber in Wahrheit ein Selektionseffekt: Vulnerable Personen, die bereits in der ersten Hitzewelle gestorben sind, können nicht mehr von den folgenden Hitzewellen betroffen sein. Damit wird die Gesellschaft als Ganzes resilienter. Dieser deutlich nachweisbare Mechanismus der Anpassung auf Bevölkerungsebene ist jedoch aus ethisch-moralischer Sicht durchaus kritisch zu hinterfragen: Können wir als Gesellschaft es uns leisten, die vulnerabelsten Mitglieder „ z urückzulassen“?
<
Hausärzt:in Arzt Sicht Sache
© shutterstock.com/Tom Wang









































































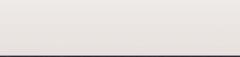













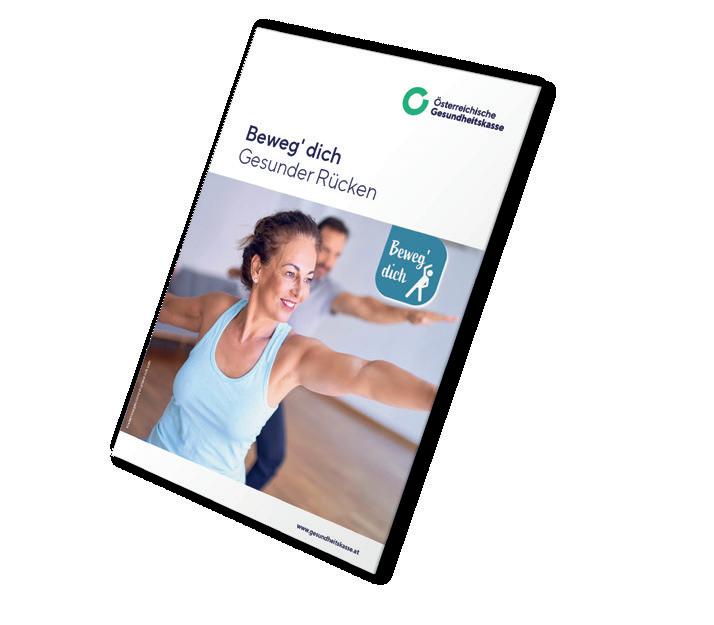









 5. Med. Abt. für Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring, Wien, Gründungsmitglied der Young Diabetologists
5. Med. Abt. für Endokrinologie, Rheumatologie und Akutgeriatrie, Klinik Ottakring, Wien, Gründungsmitglied der Young Diabetologists