ZEIT IST HIRN
Handlungsbedarf bei (Sekundär-)
Prävention und strukturierter Nachsorge in der Neurologie


Handlungsbedarf bei (Sekundär-)
Prävention und strukturierter Nachsorge in der Neurologie

Wie das Gehirn sowohl angeborene als auch erworbene Schäden bis zu einem gewissen Grad kompensieren oder gar reparieren kann, ist faszinierend. Das gilt bekanntlich selbst für kleine Schlaganfälle, die es unbemerkt ausbügelt. Unsere „ Denkzentrale“ ist großartig – aber auch anfällig. Umso wichtiger sind effektive Therapien, wenn z. B. degenerative Krankheiten Nervenzellen schädigen und Gewohnheiten, Sprachfähigkeiten oder das Gedächtnis nachhaltig beeinträchtigen. In unserer aktuellen Titelgeschichte ab Seite 16 widmen wir uns neuen Erkenntnissen und Therapiemöglichkeiten in der Neurologie, die bei der 20. ÖGN-Jahrestagung in Bregenz präsentiert wurden. Eine spannende Aussage von Pastpräsident Prof. Dr. Thomas Berger: Sich für die Neurologie zu interessieren, werde für (angehende) Mediziner:innen dann „sexy“, wenn man auch tatsächlich etwas für die Patient:innen tun könne. So habe die Entwicklung spezifischer Therapeutika bei der Multiplen Sklerose einen Boom in der Neurologie mit sich gebracht. Bei demenziellen Erkrankungen ist gegenwärtig keine Heilung in Sicht. Trotzdem tut sich eine Menge. Nicht umsonst lautet das Motto der 4. internationalen Demenz-Konferenz der Donau-Universität Krems unter der Leitung von Prof.in Dr.in Stefanie Auer „ Dementia on the move“ Im Mittelpunkt der Expert:innenvorträge und Workshops steht am 27. und 28. April u. a. die sich wandelnde Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen – lesen Sie mehr darüber ab Seite 20.
Apropos Lesen: Über die Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hat sich auch die Betrachtungsweise der Beschäftigung mit Büchern drastisch verändert. Bis hinein ins 20. Jahrhundert war die Ansicht weit verbreitet, dass zu viel lesen dem Gehirn schade. So lautet ein Zitat des Physikers Albert Einstein (18791955): „Viel Lesen nach einem bestimmten Alter lenkt den Geist von seinen kreativen Aktivitäten ab. Jeder Mann, der zu viel liest und sein eigenes Gehirn zu wenig benutzt, verfällt in faule Denkgewohnheiten.“
Ihren Höhepunkt hatten Debatten um Lesewut, Lesesucht und gefährliche Romane im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), ebenfalls Physiker sowie ein Meister des Aphorismus, stammt das Zitat: „ Das viele Lesen ist dem Denken schädlich. Die größten Denker, die mir vorgekommen sind, waren gerade

unter allen den Gelehrten, die ich kennen gelernt, die, die am wenigsten gelesen hatten. Ist denn Vergnügen der Sinne gar nichts?“
Ein weiteres Zitat möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es noch 1991(!) vom Schweizer Autor Erich von Däniken in „ Die Augen der Sphinx“ zu Papier gebracht wurde: „ Es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, dass sie wie neu sterben, und andere, die ihr Gehirn nur zum Lesen und nie zum Denken verwenden.“
Heute belegen zahlreiche Studien: Nicht lesen, sondern nicht lesen ist gefährlich. Drei Beispiele*: Einer Erhebung an der University of Sussex zufolge kann das Lesen den aktuellen Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken. Das Herz beruhigt sich, die Anspannung nimmt ab.
Regelmäßiges Bücherlesen kann wahrscheinlich auch das Risiko einer Demenz senken. Die Erkrankungsrate war in Studien bei intellektuell aktiven Menschen geringer. Die Wissenschafter:innen gehen davon aus, dass durch häufiges Lesen zumindest ein Teil der Alterserscheinungen des Gehirns bei den verbalen Fähigkeiten kompensiert werden kann.
Ja, selbst die Lebenserwartung betreffend gibt es positiv stimmende Ergebnisse: Eine US-Studie konnte mit mehr als 3.600 Teilnehmenden über zwölf Jahre aufzeigen, dass eifrige Leser:innen von Büchern im Durchschnitt 23 Monate länger lebten als Personen, die keine Bücher lasen.
Damit wäre auch die Frage beantwortet, warum es sinnvoll ist, unsere aktuelle Ausgabe der Hausärzt:in oder ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und … in das Lesen einzutauchen!
Viel Freude damit wünscht
Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at
* Literatur:
Lewis D et al., Galaxy Stress Research. Mindlab International, Sussex University, UK, 2009. Benke C et al., Demenz und Lebensstil. psychopraxis. neuropraxis 23, 45–48, 2020. Bavishi A et al., A chapter a day: Association of book reading with longevity. Social Science & Medicine 2016.
06 Doch nicht so selten? Update Herzinsuffizienz: Wann an Amyloidose gedacht werden sollte
10 Das verflixte erste Jahr ... Neudiagnose kardiovaskuläre Erkrankung: Betroffene auf psychische Komorbiditäten screenen
13 Wirkungsreiches Risikomanagement Primäre und sekundäre Insultprävention in der Praxis
23 Traumatische Nervenläsionen State of the Art – Standards und Fortschritte

26 Frauen öfter betroffen und häufig schlechter versorgt
Warum die Gendermedizin bei Rheuma ein großes Thema ist
28 Behandlungslücke schließen
Osteoporose erfordert ein individualisiertes Vorgehen
31 Allergien auf molekularer Ebene betrachten Komponentenbasierte Diagnostik und Therapie am Beispiel der Ragweedallergie
34 Aktuelle Leitlinienempfehlungen Diabetesmanagement bei chronischer Nierenerkrankung
16 Zeit ist Hirn Handlungsbedarf bei strukturierter Nachsorge und Sekundärprävention
20 Demenz in Bewegung
Paradigmenwechsel von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise
36 East meets West Serie, Teil 2: Das Reizdarmsyndrom aus Sicht der ayurvedischen Medizin und der mitteleuropäischen naturheilkundlichen Ernährungslehre

45 Skabies auf dem Vormarsch Anstieg von Inzidenz und Prävalenz
extra
Ragweed ist nicht nur eine hochallergene, sondern auch eine hochinvasive Pflanze.

46 Gelungene Transition
Die KinderkrebsNachsorge Ambulanz im Gesundheitszentrum Mariahilf zieht als Vorreiterprojekt im deutschsprachigen Raum viel Aufmerksamkeit auf sich
48 Impressum
Kardiale Amyloidose: Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die Behandlung.
Um eine solche zu diagnostizieren, müssen Medizinerinnen und Mediziner sowohl die klinischen Indikatoren im Zusammenhang mit der Krankheit als auch die erforderlichen Diagnoseinstrumente kennen. Bei Verdacht auf eine Amyloidose sind spezifische Labor- und Bildgebungstests vonnöten. Eine frühzeitige Diagnose ist von entscheidender Bedeutung, da eine sofortige Therapie weitere Amyloidablagerungen und Schäden an den Endorganen verhindern kann.

Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die sich durch typische Symptome wie Atemnot und eine eingeschränkte Herzfunktion sowie durch spezifische klinische Anzeichen äußert, etwa einen erhöhten zentralen Venendruck, feuchte Lungengeräusche und Flüssigkeitsansammlungen im peripheren Gewebe. Die geschätzte Inzidenzrate beträgt drei bis fünf Fälle pro 1.000 Personenjahre in der erwachsenen europäischen Bevölkerung. Die Prävalenz der Herzinsuffizienz bei Erwachsenen liegt bei etwa 1-2 %, steigt aber bei Menschen über 70 Jahren auf über 10 %. Mit einer Fünf-Jahres-Sterblichkeitsrate nach der Diagnose von 53-67 % ist die Prognose schlecht. In den westlichen Ländern lässt sich die Mehrzahl der Fälle (etwa 70-90 %) auf eine koronare Herzkrankheit, eine arterielle Hypertonie oder eine Kombination von beiden zurückführen. Andere – weniger häufige – Ursachen sind nichtischämische Kardiomyopathien, Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen oder Herzbeutelerkrankungen.
Auch bestimmte Medikamente können eine Herzinsuffizienz auslösen, und Alkoholmissbrauch ist für etwa 2-3 % der Fälle verantwortlich. Eine seltene Ursache stellt die kardiale Amyloidose dar. An sie muss proaktiv gedacht werden, weil eine spezifische Therapie zur Verfügung steht.

Die kardiale Amyloidose ist durch eine Anhäufung von falsch gefalteten Proteinen außerhalb der Herzzelle gekennzeichnet. Dadurch kommt es zu einer Versteifung des Herzens und schlussendlich zu einer Kardiomyopathie. Obwohl die Amyloidose im Allgemeinen als eine seltene Krankheit angesehen wird, deuten neue Erkenntnisse darauf hin, dass sie als mögliche Ursache häufiger Herzerkrankungen oder -syndrome nicht ausreichend berücksichtigt wird. Fortschritte in der kardialen Bildgebung, der Diagnostik und der Therapie haben die Erkennung und Behandlung der kardialen Amyloidose verbessert.
Bei der kardialen Amyloidose sind die Leichtkettenamyloidose (AL) und die Transthyretinamyloidose (ATTR) für 99 % der Fälle verantwortlich. AL tritt auf, wenn Plasmazellen fehlgefaltete Leichtkettenproteine produzieren, die zur Amyloidbildung führen, während die ATTR eine genetische Erkrankung ist, die durch eine Punktmutation verursacht wird und zu einer fehlerhaften Transthyretinbildung oder einer Instabilität des Transthyretintetramers im Alter führt.
Die klinischen Indikatoren für die kardiale Amyloidose lassen sich in zwei Haupttypen unterteilen: in kardiale Merkmale wie linksventrikuläre Wanddicke, Herzinsuffizienzsymptome, Vorhofflimmern und erhöhte kardiale Biomarker sowie in extrakardiale Manifestationen wie Karpaltunnelsyndrom, Spinalkanalstenose, Proteinurie und
„Die frühzeitige Diagnose einer kardialen Amyloidose ist entscheidend, da eine sofortige Therapie weitere Amyloidablagerungen und Schäden an den Endorganen verhindern kann.“
Neuropathie, außerdem frühere Hüft- oder Kniegelenkersatz- und Schulteroperationen.

Die Diagnose der kardialen Amyloidose beginnt mit einer klinischen Beurteilung, einem Elektrokardiogramm (EKG) und einem transthorakalen Echokardiogramm, wobei ein anerkanntes Merkmal die QRS-Niedervoltage und eine ausgeprägte Linksventrikelhypertrophie im Echokardiogramm sind. Das Fehlen einer QRS-Niedervoltage im EKG schließt die Diagnose jedoch nicht aus, da sie nur bei etwa 30 % der Patientinnen und Patienten mit kardialer Amyloidose vorhanden ist.
Zu den echokardiographischen Hinweisen gehören eine linksventrikuläre Hypertrophie (typischerweise > 1,2 cm Wandstärke), eine diastolische Dysfunktion, eine Verdickung der Atrioventrikularklappen/ des intraatrialen Septums und der rechtsventrikulären freien Wand. Eine verringerte systolische Geschwindigkeit des Mitralrings, eine biatriale Dilatation und eine verringerte „longitudinal strain“ sind weitere Befunde des Herzechos bei kardialer Amyloidose. Die Echokardiographie kann dabei helfen, diese Anzeichen zu erkennen, und die kardiale Magnetresonanztomographie (CMR) kann eine detaillierte Gewebecharakterisierung liefern, um die kardiale Amyloidose von anderen Erkrankungen des Herzens abzugrenzen. Die charakteristischen CMR-Merkmale umfassen eine Vergrößerung des extrazellulären Volumens, eine abnorme Gadoliniumkontrastkinetik und eine diffuse späte Gadoliniumanreicherung. Mit der CMR allein lässt sich jedoch weder die Diagnose einer kardialen Amyloidose stellen noch zwischen AL- und ATTR-Typen differenzieren.
Es ist schwierig, die AL- von der ATTR-Amyloidose ausschließlich anhand der kardialen Symptome zu unterscheiden, da es bei den klinischen, bildgebenden und elektrokardiographischen Merkmalen erhebliche Überschneidungen gibt. Extrakardiale Symptome wie Makroglossie/Submandibulardrüsenvergrößerung und periorbitale Purpura sind allerdings einzigartig für die AL-Amyloidose, während muskuloskelettale Symptome wie spontane Bizepssehnenruptur (Popeye-Sign) und Spinalkanalstenose einzigartig für die ATTR-Amyloidose sind. Zu den gemeinsamen Symptomen der beiden Erkrankungen gehören kardiale und gastrointestinale Störungen, periphere Neuropathie und orthostatische Hypotension (siehe Tabelle, Seite 8). Labortests zeigen in der Regel erhöhte BNP- und Troponinwerte. Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines monoklonalen Proteins ist der obligatorische erste Entscheidungspunkt bei der Wahl des geeigneten
GASTAUTOR:diagnostischen Weges. Als nächster nichtinvasiver Schritt wird eine Knochenszintigraphie empfohlen. Obwohl sich die Herzszintigraphie als Eckpfeiler der nichtinvasiven ATTR-
bitoren (ARNI) und SGLT2-Inhibitoren sollte fixer Bestandteil der Behandlung sein. Anzumerken ist, dass Betablocker aufgrund der negativen Chronotropie häufig bei restriktiver Kardiomyopathie nicht gut vertragen werden, weil sie insbesondere unter Belastung – bei ohnehin geringem Schlagvolumen – einen adäquaten Anstieg des HZV verhindern können.
Kardiomyopathie-Diagnose herauskristallisiert hat, kann bei über 10 % der Patienten mit AL-Kardiomyopathie ein kardiales Uptake vorhanden sein, das mit ATTR-CM übereinstimmt (Uptake Grad 2 oder 3). Wenn die Ergebnisse unklar sind, kann eine kardiale Biopsie erforderlich sein, die in einem Amyloidosediagnosezentrum mit viel Erfahrung durchgeführt werden sollte.
Eine medikamentöse Basistherapie mit ACE-Hemmern oder Angiotensin-IIRezeptorblockern (ARB), Mineralokortikoidrezeptorantagonisten (MRA), Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhi-
Die Patientinnen und Patienten sollten sich in Abständen von sechs bis zwölf Monaten einem 24-Stunden-EKG, einem transthorakalen Herzecho und einer MRT unterziehen. Die Behandlung von ATTR umfasst eine genetische Analyse, eine neurologische Untersuchung und eine Therapie mit Tafamidis, Inotersen oder Patisiran, je nachdem, ob eine begleitende Polyneuropathie vorliegt. Die Primärversorgung wird von Kardiologen übernommen. Die Behandlung von Patienten mit AL besteht aus onkologischen Untersuchungen, Proteasominhibitoren, Immuntherapien, monoklonalen Antikörpern sowie einer Knochenmarkstransplantation und muss primär an eine Onkologie angebunden sein. Die frühzeitige Erkennung einer kardialen Amyloidose ist wichtig, da eine unbehandelte genetische ATTR die Lebenserwartung erheblich verringern kann. Eine Herztransplantation kann in ausgewählten Fällen erforderlich sein.
Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die Behandlung der kardialen
Klinische Manifestationen der kardialen Amyloidose
kardial
Herzinsuffizienz
Vorhofflimmern
Bradyarrhythmie, Reizleitungsstörungen, Schrittmacher
Niedervoltage im EKG
Linksventrikelhypertrophie
muskuloskelettal
Karpaltunnelsyndrom
Rückenschmerzen/ lumbale Spinalstenose
Bizepssehnenruptur (Popeye-Sign)
Schulter, Knie- und Hüftschmerzen oder OP
Trigger-Finger
Amyloidose, die eine schlechte Prognose hat. AL- und ATTR-Amyloidose sind die wichtigsten Formen der Krankheit, beide führen zu Ablagerungen von Amyloidfibrillen im Herzen. Die Diagnose umfasst eine klinische körperliche Untersuchung – einschließlich der Berücksichtigung von diversen Anzeichen wie periorbitalen Blutungen, Makroglossie und Karpaltunnelsyndrom – sowie eine Anamnese, ein EKG und eine erweiterte kardiale Bildgebung mit Herzecho und kardialer MRT. Mittels der Proteinelektrophorese und der Bestimmung der freien Leichtketten in Serum und Urin wird zwischen AL- und ATTR-Amyloidose unterschieden, während eine DPD-Knochenszintigraphie den Verdacht auf ATTR-Amyloidose bestätigt. Chemotherapie mit oder ohne autologe Stammzelltransplantation sowie Proteasominhibitoren sind die primären Behandlungsmethoden bei ALAmyloidose, die sich gegen Plasmazellen richten. Spezifische lebensverlängernde Therapien für die ATTRAmyloidose stehen zur Verfügung, und in naher Zukunft sind weitere Therapieentwicklungen zu erwarten, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern.
Literatur: Writing Committee; Kittleson MM et al., 2023 ACC Expert
Consensus Decision Pathway on Comprehensive Multidisciplinary Care for the Patient With Cardiac Amyloidosis: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2023 Mar 21;81(11):1076-1126. doi: 10.1016/j. jacc.2022.11.022. Epub 2023 Jan 23. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2023 Mar 21;81(11):1135. PMID: 36697326.
Polyneuropathie
schmerzhafte Neuropathie der Hände und Füße
Muskelschwäche, Gangschwierigkeiten und Stürze
autonome Dysfunktion
orthostatische Hypotension/ Intoleranz gegenüber Blutdruckmedikamenten
chronischer Durchfall
erektile Dysfunktion
„Um eine kardiale Amyloidose festzustellen, müssen Mediziner:innen sowohl die klinischen Indikatoren als auch die erforderlichen Diagnoseinstrumente kennen.“
Menschen mit einer kardiovaskulären Erkrankung (CVD) haben ein deutlich erhöhtes Risiko, nach der Diagnose eine psychische Störung zu entwickeln – und das unabhängig von der familiären Vorgeschichte sowie von anderen Komorbiditäten, schlussfolgerten Shen Q et al. in einer großen Kohortenstudie.1 Der größte Effekt zeigte sich im ersten Jahr nach der Diagnosestellung, was die Bedeutung einer klinischen Überwachung in jener Hochrisikophase unterstreicht.


Das Studienteam analysierte Daten von 869.056 Patientinnen und Patienten aus dem Swedish Patient Register
und dem Swedish Multi-Generation Register, die zwischen 1987 und 2016 erstmals die Diagnose einer CVD erhielten und keine psychische Erkrankung in der Vorgeschichte hatten. Ein Vergleich mit insgesamt 910.178 gesunden Vollgeschwistern der Patienten erfolgte, außerdem wurde jeder Indexpatient zehn nach Alter und Geschlecht angepassten Kontrollpersonen aus der schwedischen Allgemeinbevölkerung gegenübergestellt. Das mediane Alter zum Zeitpunkt der CVD-Diagnose betrug bei den Probanden 60 und bei ihren Geschwistern 55 Jahre – 59,2 bzw. 48,4 % waren männlich. Während des bis zu 30 Jahre andauernden Nachbeobachtungszeitraums traten 7,1, 4,6 und 4,0 psychische Er-
krankungen pro 1.000 Personenjahre bei den Indexpatienten, bei ihren Geschwistern und in der Bevölkerungskontrollgruppe auf. Im ersten Jahr nach der CVD-Diagnose war das Risiko, psychisch zu erkranken, um den Faktor 2,74 (HR, 2,74; 95 % CI, 2,62-2,87) höher als bei den herzgesunden Geschwistern, danach um den Faktor 1,45 (HR, 1,45; 95 % CI, 1,42-1,48). Eine Risikoerhöhung wurde für alle psychiatrischen Störungen und bei allen kardiovaskulären Diagnosen beobachtet. Der Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung zeitigte ähnliche Assoziationen.w Zudem wurde bei Probanden, die nach der CVD-Diagnose eine psychiatrische Komorbidität entwickelten, ein um etwa 55 % höheres Risiko in Bezug
Neudiagnose kardiovaskuläre Erkrankung: Betroffene auf psychische Komorbiditäten screenen
auf kardiovaskulären Tod festgestellt, verglichen mit Patienten ohne psychische Erkrankung (HR, 1,55; 95 % CI, 1,44-1,67). Die Mortalitätsraten betrugen 9,2 respektive 7,1 pro 1.000 Personenjahre.
Die Autorinnen und Autoren der schwedischen Kohortenstudie hielten fest, dass ihre Ergebnisse mit der vorhandenen Literatur übereinstimmten, welche eine positive Assoziation von CDV und verschiedenen psychischen Störungen vorschlage. Sie betonten, wie wichtig es sei, nach einer diagnostizierten kardiovaskulären Erkrankung Betroffene in puncto psychischer Komorbidität zu screenen bzw. zu beobachten und gegebenenfalls eine Behandlung einzuleiten. Das breite Spektrum der kardiovaskulären Entitäten, das von koronarer Herzkrankheit über Rhythmusstörung, Hypertonie oder Herzinsuffizienz, zerebrovaskuläre Erkrankungen bis hin zu Thrombosen reicht, verdeutlicht die hohe Relevanz für die Praxis.
Anna Schuster, BScLiteratur:
1 Shen Q et al., Cardiovascular disease and subsequent risk of psychiatric disorders: a nationwide sibling-controlled study. eLife. 2022;11:e80143.
Zur Erfassung von Angst und Depression bei Patient:innen mit somatischen Erkrankungen oder (möglicherweise psychogenen) Körperbeschwerden kann die „Hospital Anxiety and Depression Scale“ – Deutsche Version (HADS-D) herangezogen werden. Sie ist für den Einsatz als Screeningverfahren, zur dimensionalen Schweregradbestimmung sowie in der Verlaufsbeurteilung geeignet. Mittels einer Selbstbeurteilung wird die Ausprägung ängstlicher und depressiver Symptomatik während der vergangenen Woche auf zwei Subskalen mit je sieben Items erfasst. Der Gesamtsummenwert kann als Maß für die allgemeine psychische Beeinträchtigung verwendet werden. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. fünf Minuten, die Auswertungszeit ca. eine Minute.
Itemauswahl und -formulierung berücksichtigen die spezifischen Anforderungen eines Settings, das durch körperliche Krankheit bestimmt ist. Der Fokus liegt auf psychischen Angst- und Depressionssymptomen, um eine Konfundierung durch somatische Komorbidität zu vermeiden. Erfasst werden auch leichtere Ausprägungen psychischer Störungen. Schwere psychopathologische Symptome werden bewusst ausgeklammert, was die Akzeptanz des Verfahrens in den Zielgruppen erhöht.
In der vierten, aktualisierten und neu normierten Auflage von 2018 liegen Normen aus Bevölkerungsstichproben (N = ca. 2.000) sowie aus kardiologischen Patient:innenkollektiven (N = über 5.000) vor. Quelle und weitere Infos: hogrefe.com/at/shop/hospital-anxiety-anddepression-scale-deutsche-version.html
In Österreich erleiden circa 25.000 Personen jährlich einen Schlaganfall. 90 % davon sind zerebral-ischämische Ereignisse, 10 % Gehirnblutungen. Die altersbezogene Inzidenz hat in den letzten Jahren stetig abgenommen – ein Erfolg der präventiven Maßnahmen. Dies wird aber durch eine wachsende Zahl immer älter werdender Personen ausgeglichen, die im höheren Lebensalter einen Insult erleiden. Gleichzeitig ereignen sich Schlagfälle öfter bei jüngeren Menschen, häufig bei jenen mit einem ausgeprägten Risikoprofil. Der Schlaganfall ist der wichtigste Grund für eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter und eine bedeutende Todesursache. Die gute Nachricht ist, dass sich viele Ursachen des Insults gut beeinflussen lassen und theoretisch –wenn alle Risikofaktoren bei allen Personen optimal eingestellt wären – ca. 80 % der Fälle vermieden werden könnten. Prinzipiell besteht in der Beachtung von Risikofaktoren kein Unterschied zwischen primärer und sekundärer Prävention. Lediglich die Einstufung des Risikos ist unterschiedlich, denn Patientinnen und Patienten mit stattgehabtem ischämischem Schlaganfall oder TIA gelten in den meisten Fällen als Hochrisikopersonen.
Die Wahl des Antihypertensivums hängt u. a. von Komorbiditäten ab. In großen Metaanalysen erzielten allerdings Kalziumkanalblocker und Diuretika die besten Ergebnisse, weniger günstig erschienen Betablocker. In den meisten Fällen muss ohnehin eine Kombinationstherapie angewandt werden. Nicht vergessen sollte man auf eine Reduktion des Salzkonsums. Zielwerte der Blutdruckeinstellung gemäß der Österreichischen Gesellschaft für Hypertensiologie sind in der Tabelle (Seite 14) dargestellt.

GASTAUTOR: Prim. Assoc.-Prof. Dr. Karl Matz Vorstand der Abteilung für Neurologie, LK Baden-Mödling; Zentrum für Vaskuläre Prävention, DonauUniversität Krems

Antithrombotisch wirksame Substanzen haben nur in der sekundären Prävention vaskulärer Ereignisse ihren Platz. In der primären Prävention zeigten die Studien keine Evidenz für eine positive Nutzen-RisikoRelation. In der Sekundärprävention ist beim ischämischen Insult – außer bei Indikation für eine Antikoagulation – ein Thrombozytenfunktionshemmer zu verordnen. Acetylsalicylsäure in einer Dosierung von 50-100 mg/Tag ist hier seit langem die führende Standardtherapie. Clopidogrel und die Kombination ASS + Dipyridamol haben ebenfalls ihren Platz und werden oft nach vaskulären Ereignissen unter ASS-Therapie verordnet. Eine duale Plättchenhemmung mit ASS + Clopidogrel oder ASS + Ticragelor wird aktuell für eine Dauer von drei Wochen nach einem Minor Stroke oder einer TIA mit höherem Risiko empfohlen.
Epidemiologisch gesehen ist die arterielle Hypertonie der bedeutsamste Schlaganfallrisikofaktor, auch von Hirnblutungen.
Vor allem im höheren Lebensalter ist Vorhofflimmern sehr prävalent und erhöht das individuelle Schlaganfallrisiko beträchtlich. Zur Risikoberechnung wird der CHA2DS2-VASc-Score herangezogen. In den allermeisten Fällen ist die Risikostufe so hoch, dass eine orale An-
tikoagulation erfolgen sollte. Gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten haben NOAK die Vorteile eines geringeren Blutungsrisikos bei zumindest gleichwertiger Risikoreduktion. Außer bei beträchtlicher Niereninsuffizienz oder bei valvulärem Vorhofflimmern wird meistens dem Thrombinantagonisten Dabigatran oder den Anti-Xa-Antagonisten Rivaroxaban, Apixaban oder Edoxaban der Vorzug gegeben. Nach einem ischämischen Insult kann – abhängig von der Infarktgröße –nach wenigen Tagen bis drei Wochen mit einer Antikoagulation begonnen werden, nach TIA im Prinzip sofort. Nach einer Hirnblutung soll mit einer Neurologin/ einem Neurologen die spezielle Risikosituation erörtert und abgewogen werden. In vielen Fällen kann nach Resorption der Blutung nach ca. einem Monat mit der OAK (wieder) begonnen werden. Bei andauernder Kontraindikation gegen eine OAK bietet der endovaskuläre Herzohrverschluss eine wirksame Alternative.
Diabetes mellitus erhöht vor allem das Risiko, Schlaganfälle aufgrund der Arteriosklerose großer Gefäße (Carotisstenose) und einer atherosklerotischen Kleingefäßerkrankung zu erleiden. Dauer und Ausprägung des Diabetes sind entscheidend für das Ausmaß der atherosklerotischen Veränderungen. Daher ist die Früherkennung wichtig: Nüchternblutzucker-Messungen, ergänzt durch HbA1cBestimmung oder oGTT, sollten regelmäßig erfolgen. Lebensstilmaßnahmen können im Stadium des Prädiabetes oder des frühen Typ-2-Diabetes die Stoffwechsellage noch umkehren. Spätestens bei manifestem Diabetes mellitus ist eine medikamentöse Behandlung obligat. Bezüglich der Therapie kann auf Leitlinien der Österreichischen Diabetes Gesellschaft verwiesen werden. Bei der Sekundärprävention kann bzw. soll ein Diabetesmedikament mit nachgewiesener Reduktion vaskulärer Endpunkte gewählt werden, z. B. SGLT2-Hemmer oder GLP-1-Rezeptorantagonisten.
Bei Hypercholesterinämie reichen Diätmaßnahmen nicht aus, um den LDL-
Cholesterinwert in den Zielbereich zu bringen. Eine medikamentöse lipidsenkende Therapie ist fast immer erforderlich. Die Zielwerte der Therapie gemäß den ESC-Guidelines richten sich nach der Risikoeinstufung. In der Sekundärprävention sind die Zielwerte sehr niedrig – etwa bei atherosklerotischem ischämischem Schlaganfall < 55 mg/dl LDL-C. Daher wird zu Beginn ein hochpotentes Statin wie Atorvastatin oder Rosuvastatin empfohlen, entweder schon initial oder auch konsekutiv kombiniert mit Ezetimibe. Sollten unter vorausgesetzter guter Compliance mit dieser Therapie die Zielwerte nicht erreicht werden, gibt es beispielsweise die Möglichkeit einer Therapie mit PCSK9Antagonisten (antikörperbasiert: Evolucomab oder Alirocumab; als „small interfering RNA“: Inclisiran).
Bei der Hypertriglyzeridämie gibt es für die präventive medikamentöse Therapie noch wenig gesicherte Evidenz: Fibrate blieben bisher den Nachweis der Prävention vaskulärer Endpunkte in Studien weitgehend schuldig und der in einer Studie (REDUCE-IT) nachgewiesene Effekt einer Therapie mit Icosapent-Ethyl sollte noch in weiteren hochwertigen Untersuchungen reproduziert werden. Änderungen betreffend die Ernährung – reduzierter Fettanteil, wenig Alkohol, wenig Fruchtzucker – sind hier vorrangig, außerdem besteht in den meisten Fällen auch eine Indikation zur Statintherapie.
Blutdruckzielwerte bei unkomplizierter Hypertonie
Art der Blutdruckmessung
Officeblutdruck
Systolischer Blutdruck
Zielwert in mmHg
1. Ziel: 130
2. Ziel: 120-129 (bei guter Verträglichkeit)
Diastolischer Blutdruck 70-79
Unbeobachtete automatische Officemessung
Mittelwert dreier Messungen 120-125/70
24-Stunden-Blutdruckmonitoring
24-StundenMittelwert 125/70
Tagesmittelwert 125-129/70-75
Nachtmittelwert 115-120/65
Blutdruckselbstmessung
Mittelwert 125-129/70-75
Quelle: Weber T et al., Österreichischer Blutdruckkonsens 2019 – Kurzfassung, Journal für Hypertonie 2020; 24 (1), 6-33.
Bewegungsmangel führt zu Übergewicht mit Metabolischem Syndrom sowie zu Bluthochdruck. Diesen Lebensstil positiv zu verändern ist daher Primärprävention im eigentlichen Sinn, d. h., es dient der Prävention der gefäßschädigenden Faktoren. Empfohlen wird körperliche Aktivität mittlerer Intensität von mindestens 150 Minuten pro Woche oder hoher Intensität für mindestens 75 Minuten pro Woche. Rauchen stellt einen sehr starken vaskulären Risikofaktor dar. Die positive Nachricht: Er ist reversibel – nach etwa fünf Jahren Nichtrauchen sinkt das vaskuläre Risiko auf das Niveau eines Menschen, der nie geraucht hat. Die Begrenzung eines regelmäßigen Alkoholkonsums auf sehr moderate Mengen und auf einen nicht täglichen Konsum soll sowohl primär- als auch sekundärpräventiv empfohlen werden. Vor allem Patienten mit Hirnblutung sollten auf den Risikofaktor Alkohol aufmerksam gemacht werden und den Konsum einschränken.
Zusammenfassend stellt die primäre und sekundäre Schlaganfallprävention eine sehr wichtige und lohnende hausärztliche Aufgabe dar. Das Potential, Ereignisse zu verhindern, ist enorm.
Quellen:
Positionspapiere der Österreichischen Schlaganfallgesellschaft, Zeitschrift: Neurologisch.
Weber T et al., Österreichischer Blutdruckkonsens 2019 –Kurzfassung, Journal für Hypertonie 2020; 24 (1), 6-33.
Catapano AL et al., 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias. Eur Heart J 2016; 37: 2999-3058.
Österreichische Diabetes Gesellschaft, Diabetes mellitus –Anleitungen für die Praxis, Wien Klin Wochenschr (2019) 131 [Suppl 1]: S1–S246.
Die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) beging dieses Jahr ihre 20. Jahrestagung in Bregenz.
Wien und Pastpräsident der ÖGN, über bedeutende Errungenschaften in der Neurologie der letzten 20 Jahre, aber auch über die Lehren aus der SARSCoV-2-Pandemie sowie über wichtige Themen 2024.
Die Hausärzt:in sprach mit Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie, MedUni
„M it Sicherheit hat sich die Neurologie in den letzten 20 Jahren von einem mehr deskriptiven bzw. diagnostischen Fach zu einem therapeutischen Fach entwickelt“, skizziert Prof. Berger. „ A ls ich vor fast 30 Jahren in der Neurologie begonnen habe, bestand im Hinblick auf zahlreiche neurologische Erkrankungen ein therapeutischer Nihilismus. Die Krankheitsbilder wurden blumig

umschrieben, die eine oder andere gute Diagnose konnte erstellt werden, aber bei vielen wesentlichen Erkrankungen, z. B. Schlaganfall, Demenz oder Multipler Sklerose, Myasthenie, waren die therapeutischen Möglichkeiten äußerst bescheiden.“
Aber in den letzten 20 Jahren hat sich viel getan – nicht nur in der Neurologie, sondern auch in der Bevölkerung. „ D ie Menschen werden immer älter und so manche neurologische Erkrankungen – Schlaganfall, Demenz, neurodegenerative Erkrankungen – werden deutlich zunehmen“, betont der Experte.
Handlungsbedarf bei strukturierter Nachsorge und Sekundärprävention in der Neurologie
„Es ist dann ,sexy‘, sich für Neurologie zu interessieren, wenn man auch etwas für die Patient:innen tun kann.“
„Die Entwicklung in der Diagnostik und Behandlung des Schlaganfalls in Österreich ist beispielhaft für Europa und hat in der Versorgung der Bevölkerung einen massiven Schritt nach vorne gemacht“, hebt Prof. Berger hervor. Dies beginnt nicht erst bei den Stroke Units, sondern bereits bei der Awareness in der Bevölkerung bis hin zum Notarzt und dem Weiterleiten an die neurologische Abteilung. Das Mantra „Time is Brain“ ist eine Errungenschaft aus wissenschaftlicher Evidenz und den strukturellen Gegebenheiten, dass jede neurologische (Akut-)Abteilung mit einer Stroke Unit ausgestattet ist. „ Die ist ein wesentlicher Schritt vorwärts in der Akutversorgung der österreichischen Bevölkerung“, ist der Neurologe überzeugt. Allerdings ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen, weil beispielsweise erst letztes Jahr eine strukturierte Nachsorge bzw. das Management nach einem Schlaganfall routinemäßig etabliert wurde. Auch in der Sekundärprävention sieht er noch Handlungsbedarf, insbesondere in der Kontrolle der Verursacher- und Risikofaktoren, um ein Wiederauftreten zu vermeiden. Prof. Berger: „Weil dies eine große gesundheitspolitische Bedeutung hat, wurde das Schlaganfallregister der Österreichischen Gesellschaft für Schlaganfallforschung initiiert, die Logistik dazu wird von der Gesundheit Österreich durchgeführt.“
„I m Hinblick auf die Demenz hat die Erkenntnis an Bedeutung gewonnen, wie die Diagnose frühzeitig gestellt werden kann, als wenn bereits klinische Symptome vorherrschen“, erläutert Prof. Berger. „Liegen bereits deutliche Zeichen einer Demenz vor, ist die Diagnose nicht schwer und gleichzeitig sind die Möglichkeiten einer Verbesserung oder einer Therapie definitiv geringer.“ Über die letzten zwei Jahrzehnte wurden verlässliche Diagnosetools entwickelt, die sehr stark auf Biomarkern bzw. dem Nachweis von Biomarkern basieren, beispielsweise bei der Alzheimerdemenz (AD). Dies sind etwa Biomarker, die sowohl bildgebend (z. B. Amyloid-PET) als auch in der Liquordiagnostik (z. B. Tau-Protein) nachgewiesen werden können. Prof. Berger: „ Der Fortschritt ist, dass diese biomarkerbasierte Diagnostik früher – noch bevor Atrophien in der MRT vorliegen – durchgeführt werden kann “ Und in den letzten zwei, drei Jahren hat die Alzheimerforschung spezifische Therapien für die frühe AD („m ild cognitive impairment“) hervorgebracht, die bereits an der Schwelle der Verfügbarkeit stehen. Der Experte ist überzeugt, dass „es in den kommenden Jahren erstmals ein spezifisches Therapeutikum für die frühe AD geben wird.“

Eine weitere „Vorzeigeerkrankung “ ist die Multiple Sklerose (MS). Prof. Berger: „1994 sind die ersten spezifischen, für die Behandlung der schubförmigen MS zugelassenen Medikamente auf den Markt gekommen. Heute stehen bereits 17 zugelassene Therapien für die verschiedenen Verlaufsformen bzw. Ausprägungen und Varianten der MS zur Verfügung “ Krankheitsentitäten der MS, die früher als Varianten verstanden wurden, z. B. die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, stellen mittlerweile eine eigenständige Erkrankung dar, die mit MS nichts zu tun hat – und auch hier gibt es bereits drei zugelassene Therapiemöglichkeiten, obwohl es sich um eine Orphan Disease handelt.
„A m Beispiel der MS ist zu sehen, wie die Entwicklung spezifischer Therapeutika einen Boom in der Neurologie mit sich gebracht hat “ , unterstreicht der Experte. „ E s ist dann ‚sexy‘, sich für Neurologie zu interessieren, wenn man auch etwas für die Patient:innen tun kann “ Das hat dazu beigetragen, dass sich viele Neurolog:innen für das Thema MS zu interessieren begonnen haben, und der Boom hat sich auch in der Forschung, der Versorgung und der Gesundheitspolitik bemerkbar gemacht.
„Die Pandemie hat uns vieles gelehrt – ein Beispiel ist die Umstellung auf Teleneurologie im ersten Lockdown 2020 mit Remote-Monitoring und Caregiving“, erinnert sich der Pastpräsident der ÖGN. Die Idee dazu war nicht neu, aber zuvor aus vielerlei Gründen (technischen, legistischen, abrechnungstechnischen etc.) nicht realisierbar. „Teleneurologie stellte einen nicht unerheblichen Zugewinn in der Pandemie dar – diese Möglichkeit Patient:innen zu offerieren und den virtuellen Zugang zu nutzen, spart einfach Zeit, nämlich in erster Linie den Betroffenen“, so Prof. Berger.
Eine weitere Lehre war, dass neurologische Erkrankungen im Zuge einer SARS-CoV-2-Infektion – bis auf die Geruchsstörung – eher selten sind. Das SARS-CoV-2-Virus ist kein neurotropes Virus, das Risiko einer Meningitis bzw. Enzephalitis ist gering. „ Dass aber neurologische Folgeerkrankungen nach schweren, intensivpflichtigen SARS-CoV-2-Verläufen, die lange andauern, auftreten und PostIntensive-Care-Konsequenzen darstellen, war zwar für Neurolog:innen und Intensivmediziner:innen nicht neu, sehr wohl aber für die Öffentlichkeit“, gibt der Experte zu bedenken. Ebenfalls kein Neuland war das mögliche Auftreten von Folgebeschwerden nach einer Infektion, Prof. Berger verweist auf historische Berichte zur Spanischen und Russischen Grippe. „ Deswegen ist der Begriff ,Long COVID‘ bzw. ,Post COVID‘ falsch, weil es sich um einen Postinfektionszustand handelt, der nach einer Influenza bzw. jeder anderen Infektion auftreten kann“, stellt er klar. Aber weil es so viele Betroffene gegeben hat, waren diese Folgeerkrankungen viel prävalenter als jene beispielsweise nach einer Influenza. Auch hat sich im Kontext der eigenen neurologischen Post-COVID-Ambulanz gezeigt, dass „relativ wenige tatsächliche neurologische Ursachen hinter Post-COVIDBeschwerden stecken“, sagt der Experte. „ Auffällig war, dass bis zu einem Drittel der Betroffenen auch psychiatrische Vorerkrankungen hatten. Daher vermuten wir, dass die grundsätzliche Bedrohung durch die Pandemie eine relevante Komponente im Post-COVIDSyndrom darstellt.“
„Neurologische Erkrankungen sind nach wie vor ein Exklusivthema der Neurolog:innen, obwohl die Allgemeinmediziner:innen einen nicht unerheblichen Anteil von Betroffenen mit neurologischen Beschwerden, z. B. mit Kopfweh, Schwindel, Kreuzschmerz,
im Praxisalltag sehen“, bemängelt Prof. Berger. Bereits 2015 urgierte die ÖGN gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) im Rahmen der Ärzteausbildungsordnung, neurologische Inhalte in die Ausbildung zum Allgemeinmediziner verpflichtend aufzunehmen.
Allerdings wurde dies nicht entsprechend umgesetzt, „d aher veranstaltet die ÖGN gemeinsam mit der ÖGAM Fortbildungen, um wichtige neurologische Inhalte zu transportieren“, betont der Facharzt.
2024 steht im Zeichen von
„Der kommende Jahreskongress der ÖGN, der in Wien stattfinden wird, aber auch das Jahr 2024 wird unter dem Motto ‚Brain Health‘ stehen“, informiert Prof. Berger und betont: „ Brain Health ist eine Strategie, darauf hinzuweisen, wie wichtig die Gehirngesundheit ist “ Denn Gehirngesundheit bedeutet nicht nur Freiheit von einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung, sondern hat auch mit Prävention zu tun, damit schon das Risiko einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung entscheidend vermindert wird. Prof. Berger merkt abschließend an: „G esundheit ohne Gehirngesundheit gibt es nicht! Das betrifft jede:n von uns.“ Deshalb sind zu diesem Thema zahlreiche Awareness-Kampagnen geplant.
Mag.a Nicole Bachler
„Der Begriff ,Long COVID‘ bzw. ,Post COVID‘ ist falsch, weil es sich um einen Postinfektionszustand handelt, der auch nach Influenza bzw. jeder anderen Infektion auftreten kann.“
Paradigmenwechsel von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen
Zusammenarbeit ermöglichen, müssen in Österreich geschaffen werden.
Demenz ist eine enorme gesellschaftliche Herausforderung. Gegenwärtig ist keine Heilung für demenzielle Erkrankungen in Sicht. Gleichzeitig steigen die Zahlen der Betroffenen: Derzeit leben weltweit ca. 57,4 Millionen Menschen und deren An- und Zugehörige mit Demenz, diese Zahl wird sich alle 20 Jahre verdoppeln. Die letzten Jahre haben einen Paradigmenwechsel
GASTAUTORINNEN-TEAM:
von einer nihilistischen hin zu einer optimistischen Betrachtungsweise der Behandlung demenzieller Erkrankungen gebracht. Eine Vielzahl von Therapien und Methoden kann eine signifikante Linderung der Symptomatik erzielen und ein erfülltes Leben trotz Demenz möglich machen. Erfolgversprechende psychosoziale Interventionen müssen kulturell adaptiert und umgesetzt werden. Die Fülle von Methoden, die sich heute anbietet, reicht von Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen der Gesellschaft über die Ausbildung von Pflegeteams, die personalisierte und stadiengerechte Beschäftigungstherapie, die Umgebungsgestaltung, den Einsatz technischer Hilfsmittel, die Optimierung medizinischer Parameter wie Blutdruckkontrolle, Überprüfung der Hörfunktion, Diabetesbehandlung etc. bis hin zu einer sensiblen medikamentösen Behandlung. Demenz ist also kein unabänderliches Schicksal mehr. Die mannigfaltigen Möglichkeiten der Einflussnahme zeigen, dass eine erfolgreiche Behandlung nicht an eine Disziplin gebunden sein kann, wenn diese gesellschaftliche Herausforderung gemeistert werden soll. Eine multidisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Forschung und Praxis, welche die Hirn- und soziale Gesundheit in den Vordergrund stellt, könnte bessere Therapien für Betroffene und eine bessere Unterstützung für An- und Zugehörige bieten. Entsprechende Strukturen, die diese optimale


Junge Menschen müssen für die verschiedenen spannenden Berufe im Gesundheitswesen und darüber hinaus begeistert sowie Möglichkeiten für Forschung geschaffen werden. Praxis und Forschung sollten sich in einem spannenden Austausch befruchten und neue Bildungschancen eröffnen. Menschen, die von einer Demenz betroffen sind, brauchen in erster Linie eine sehr gute Förderung ihrer Fähigkeiten, die früh im Krankheitsverlauf beginnt – idealerweise setzen die Programme zur Prävention schon vor Auftreten der klinischen Symptome einer Demenz an. Viele ungeklärte Fragen nach der Methode sowie danach, wie Förderprogramme zur Optimierung des Verlaufes einer Demenz aussehen und Präventionsprogramme gestaltet werden können, müssen mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet und Lösungen gemeinsam mit den Expert:innen in der Praxis implementiert werden. Ein förderliches Netzwerk von Wissenschaft und Praxis sollte etabliert werden (z. B. in Form von „L ehrpflegeheimen“, vergleichbar mit den bewährten Universitätskliniken oder der Integration von Hirngesundheit in die Primärversorgung). Auf der 4. Kremser Demenzkonferenz stellt Prof.in Dr.in Debby Gerritsen (Univerity Radboud, The Netherlands) ein Modell vor, das sich in den Niederlanden bestens bewährt hat. Prof.in Iva Holmerova, PhD wird weitere europäische Modelle in der Ausbildung und Forschung präsentieren. Junge Forscher:innen, die sich für eine Karriere auf dem Gebiet entschieden haben, werden vor den Vorhang geholt, damit sie ihre Forschungsarbeiten präsentieren können und so als Modelle für andere junge und engagierte Menschen dienen.

„In Österreich braucht es Strukturen für eine multidisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe in Forschung und Praxis, welche die Hirngesundheit und die soziale Gesundheit in den Vordergrund stellt.“
Das europaweite Netzwerk von Forscher:innen „I nterdem“ („ Early detection and timely INTERvention in DEMentia“, interdem.org) sollte auch in Österreich verstärkt genutzt werden und jungen Forscher:innen neue Möglichkeiten eröffnen. Dr.in Fania Dassen (Alzheimer Center Limburg, Maastricht University, the Netherlands) und Prof. Dr. Frans Verhey (Radboud University, the Netherlands) stellen als Vertreter des Interdem-Netzwerks diese spannende und sehr erfolgreiche Initiative auf dem 4. Kremser Demenzkongress vor und laden junge Forscher:innen zur Mitarbeit in der Inderdem Academy ein. Dadurch werden ein Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen aus verschiedenen europäischen Ländern ermöglicht.

There is an urgent need to improve the awareness and understanding of dementia across all levels of society as a step towards improving the quality of life of people with dementia and their caregivers.”
(WHO 2012, page 4)
Wenn wir als Gesellschaft lernen, Menschen mit Demenz besser zu integrieren und zu fördern, können sie länger ein erfülltes und unabhängiges Leben führen und eine Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit kann verzögert werden. Um diese Vision verwirklichen zu können, braucht es die gemeinsame Arbeit mit allen Berufsgruppen auf Gemeindeebene. Menschen mit Demenz sowie deren An- und Zugehörige sollten ermutigt werden, sich aktiv am Leben zu beteiligen. Wissen über Demenz, ihre Symptome und Konsequenzen ist daher auf allen Ebenen der Gesellschaft nötig. Ein Onlinelernprogramm (Demenz. Aktivgemeinde) wurde für Gemeindebedienstete entwickelt.
Kriterium für eine Zertifizierung einer Gemeinde als „Demenzkompetente Gemeinde“ ist, dass mindestens 70 % aller Bediensteten einer Gemeinde oder Organisationseinheit einer Gemeinde (z. B. Bürgerservice, Bauhof) das Lern-
Fortsetzung einer erfolgreichen Initiative
Zum 4. Mal veranstaltet das Zentrum für Demenzstudien am 27. und 28. April 2023 an der Universität für Weiterbildung Krems einen internationalen Kongress zum Thema Demenz mit dem Titel: „Dementia on the Move”, weitere Infos: donau-uni.ac.at/dementia-conference
programm erfolgreich abgeschlossen haben. Weiters wird die Gemeinde gebeten, über ihre momentanen Aktivitäten zum Thema Demenz zu berichten bzw. Pläne für die Zukunft zu präsentieren. Auf der Konferenz wird das Lernprogramm vorgestellt und es werden wieder Vorzeigegemeinden ausgezeichnet.
Am zweiten Tag des 4. Kremser Demenzkongresses 2023 wird ein neues und innovatives Workshopformat vorgestellt. Dieses hat zum Ziel, Demenzprävention in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Der Workshop „Dementia Leader“ wird in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) abgehalten. Führende Expert:innen wie Demenzaktivistin Helga Rohra und Prof.in Dr.in Martina Roes (Uni Witten/Herdecke) leiten den Workshop und die Diskussionsrunden. Der Workshop richtet sich an Menschen, die sich Sorgen um ihr Gedächtnis machen und aktiv Prävention betreiben wollen, die neues Wissen erwerben und neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Die Teilnehmer:innen werden aufgerufen, sich an der Diskussion über eine bessere Integration von Menschen mit Gedächtnisproblemen und Demenz zu beteiligen und zu aktiveren Mitgliedern der Gesellschaft zu werden.
Hausärzt:in trifft Kliniker:in
Moderne Schmerzmedizin –Möglichkeiten & Grenzen
PräsenzFortbildung
Sa., 3. Juni 2023
IN LINZ
Themen (mit Fallbeispielen aus der Allgemeinpraxis):
Chronischer Schmerz – eine Herausforderung: von der Diagnose bis zur Therapie
Klinische Pharmakologie – Medikationsmanagement & Polypharmazie
Geriatrie & Palliativmedizin – Schmerztherapie ist Teamarbeit


Pädiatrie – Kleiner Mensch, großer Schmerz
Podiumsdiskussion:
Ambulante Schmerztherapie heute – Was tun gegen Lücken in der Versorgung?
Programm und Anmeldung: meinmed.at/dialogtag-linz
6 DFP-Punkte in Planung
Teilnahmegebühr:
OBGAM-, ÖGAM-, Vinzenz-Gruppe-Mitglieder 65€, Nichtmitglieder 85€ Rückfragen an info@meinmed.at


Mit freundlicher Unterstützung von:
Veranstalter:innen:
zur Behebung einer Scapula alata bei nicht mehr regenerierender Nervenläsion. D) Typische „Scapula alata“ der rechten Schulter aufgrund einer Läsion des N. thoracicus longus mit abgehobenem medialem Scapularand bei nicht wesentlich verändertem Abstand zur Mittellinie/der Dornfortsätze, aufgrund des Verlustes der Zug- und Stabilisierungswirkung des M. serratus anterior. A) Eingezeichneter Verlauf der Nervenäste des N. thoracodorsalis und des N. thoracicus longus bei der gleichen Patientin. B) Angeschlungener N. thoracodorsalis, dessen lateraler Ast als Axonspender mit dem N. thoracicus longus koaptiert wird. C) Nervenkoaptationsstelle mit zwei erkennbaren 10-0 Nervennähten (= 0,02 mm); N. thoracicus longus rechts, lateraler thoracodorsalis Ast links.
Entscheidend für die Stellung der Indikation zur Operation und die Wahl der geeigneten Maßnahme ist die richtige Einschätzung der Läsion. Erstens erfolgt diese in funktioneller Hinsicht: kompletter/inkompletter Ausfall, Ausfallmuster, Elektrophysiologie – segmentaler Leitungsblock/fokale Demyelinisierung. Zweitens ist eine Beurteilung unter pathomorphologischen Gesichtspunkten nötig: Neurom, Nerv in Kontinuität oder Durchtrennung, Teildurchtrennung, Kombinationen. Ausschlaggebend sind hierfür eine genaue Anamneseerhebung, z. B. bezüglich des Unfallmechanismus im Detail, des initialen Ausfallmusters und einer fraglichen Besserungstendenz/Beschwerdenveränderung, sowie eine detaillierte körperliche Untersuchung, bei der sensible Areale, Muskelausfälle, Gelenkstatus und Schmerzpunkte beurteilt werden. Die Elektrophysiologie sollte folgende Parameter umfassen: Nervenleitgeschwindigkeit – Latenzen und Amplitude: sensibel und motorisch; Elektromyographie – richtige Auswahl der Muskeln, komplette Denervierung oder Nachweis einzelner Muskelaktionspotentiale, Interferenzmuster, Besserung im Verlauf: ja/nein. In schwierig zu entscheidenden Fällen ist die Darstellung der Nervenlä-
sion und der muskulären Veränderungen im Hochfrequenzultraschall und mittels Kernspintomographie (MRNeurographie) für die korrekte Einschätzung einzubeziehen.1-3 Erstere Methode ist untersucherabhängig, außerdem besteht bei hoher Frequenz und damit hoher Auflösung eine Beschränkung der Eindringtiefe, letztere Methode ist zeitaufwendig und ebenfalls untersucherabhängig.
GASTAUTOR: Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Kretschmer, IFAANS, FEBNS Abteilung für Neurochirurgie und Neurorestauration, Klinikum Klagenfurt, nsurge.at

Zu betonen ist, dass versorgungsbedürftige Läsionen möglichst zeitnah operiert werden sollten. Eine verspätete Versorgung substanzieller Nervenschäden beeinflusst das erreichbare funktionelle Resultat negativ, z. B. durch Apoptosevorgänge auf Rückenmarksebene, Veränderungen der Zielorgane (etwa eine Muskelfibrosierung) und zerebrale Veränderungen.
Wesentlich ist es, sich der Nervenläsion während der Operation von distal und proximal im Gesunden zu nähern, damit man potenziell noch intakte Nervenan-
teile nicht gefährdet – was bei einer zu brüsken, direkten Präparation durch die externe Narbe und das Neurom der Fall sein könnte. Nachdem die Läsion frei präpariert wurde, muss der vorliegende Schaden erneut bewertet werden (intraoperative Evaluation). Ist der Schaden nicht zur Gänze offensichtlich – etwa wenn der Nerv trotz eines kompletten Ausfalls kein wesentliches Neurom aufweist und nicht durchtrennt ist (= Kontinuitätsläsion) –, helfen die intraoperative elektrophysiologische Evaluation und die Hochfrequenzultraschall-Darstellung. Für die Funktionswiederherstellung peripherer Nervenläsionen steht mittlerweile eine Vielzahl von mikrochirurgischen Techniken zur Verfügung, wobei auch alte und neue Verfahren kombiniert werden.1 So wurde beispielsweise eine „verlassene“ Methode wiederentdeckt und technisch erneuert: die End-zu-End-Koaptation unter Neuromausschneidung mit nachfolgender kontinuierlicher Nervenlängung unter Überdehnungsschutz (Technik der Gruppe um JM Brown,

Massachusetts
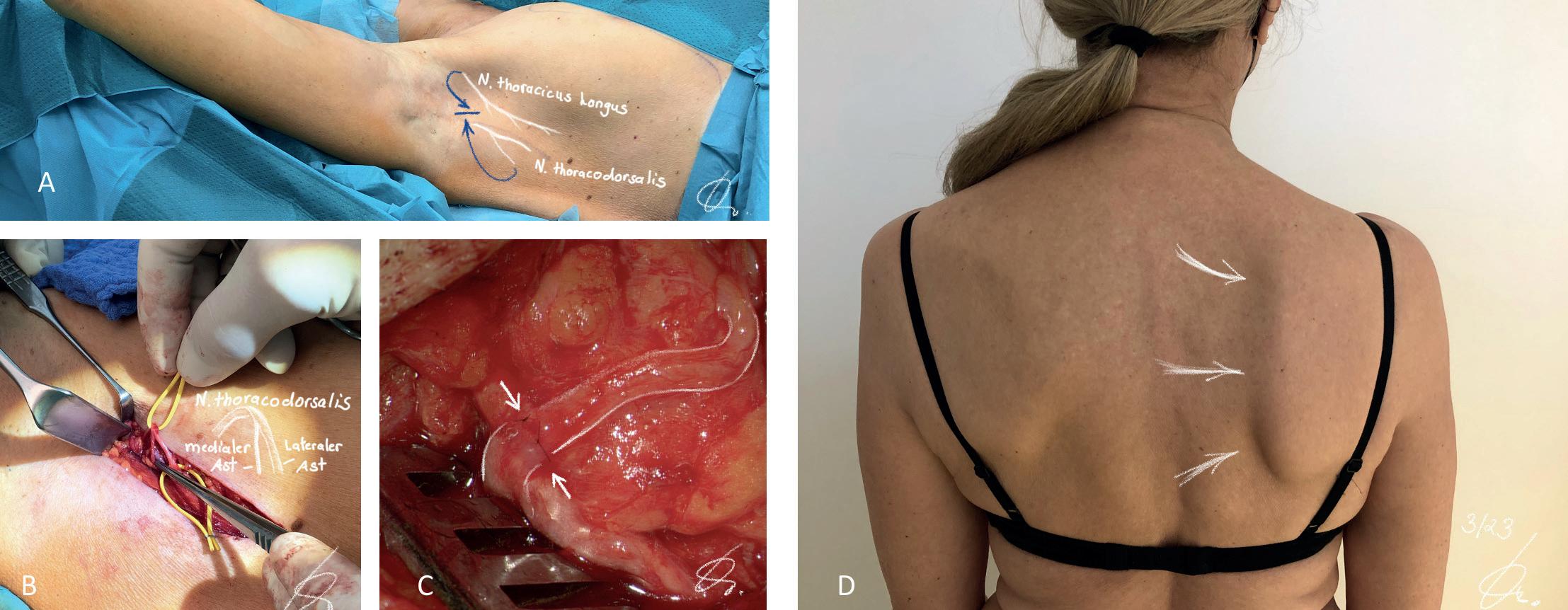
General Hospital).4,5 Bei richtiger Anwendung führt dieses Verfahren zur schnelleren Aussprossung von Axonen und zu weniger Axonverlust. Des Weiteren gewinnt etwa der Nerventransfer (extraplexal/intraplexal, kontralateral –von gesunder Gegenseite) stetig an Bedeutung: Ein gesunder, funktionierender motorischer Nerv oder Nervenanteil wird als Axonspender geopfert und mit dem nicht funktionierenden distalen Anteil des Zielnervs, dem Axonempfänger, verbunden. Bei richtiger Auswahl schafft das Gehirn aufgrund seiner Plastizität eine bewusste Ansteuerung der für den transferierten Nerv „neuen“ Funktion (z. B. Armbeugung mit Hilfe zweier Faszikel aus dem N. ulnaris, die vormals eher für die Handgelenkbeugung zuständig waren). Wegen der faszikulären Funktionsüberlappung geht bei entsprechender Auswahl auch die ursprüngliche Funktion nicht verloren. Nerventransfers werden zunehmend durchgeführt, mehr und mehr auch bei zentralen Läsionen des Gehirns und des Rückenmarks.6 Abgesehen von Wurzelausrissschmerzen, können verletzte Nerven stark beeinträchtigende Schmerzen in ihrem Versorgungsgebiet erzeugen. Geeignete rekonstruktive Maßnahmen, etwa Transplantationen oder Dekompressionen, können den Schmerz zum Verschwinden bringen. Teildurchtrennte oder in Narben eingebackene Nerven, die nicht mehr gleiten können („tethered nerves“), sind oft besonders schmerzhaft.
Viele wissenschaftliche Untersuchungen zur Nervenregeneration zielen darauf ab, die funktionellen Ergebnisse über eine schnellere, stärkere und zielgerichtete Axonsprossung zu verbessern. Lange bekannt ist, dass die Elektrostimulation Axone früher und stärker sprossen lässt. In den letzten Jahren wurde erkannt: Die Art des elektrischen Reizes spielt eine entscheidende Rolle (Frequenz, Reizmuster, Dauer und Zeitpunkt der Stimulation; 20 Hz, 0,1 ms, 3 V). Dr.in Tessa Gordon von der University of Toronto, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, brachte ein, dass auch die direkt während der ope-
rativen Versorgung durchgeführte Elektrostimulation die Sprossung verstärkt. Aktuell wird an praktikablen Umsetzungen für den klinischen Alltag gearbeitet.7 Autologe Wachstumsfaktoren, SchwannZellen und Endothelzellen induzieren und fördern den Sprossvorgang. Endotheliale, kapilläre Vorläufer scheinen dem Wachstum von Büngner‘schen Bändern vorauszugehen und die Nervenfasern zu schienen. Der Gruppe des Miami Center to Cure Paralysis ist es gelungen, aus Spendernerven von verletzten Patienten Schwann-Zellen zu züchten, die sich potenziell zum klinischen Einsatz eignen.8
Die Oldenburger AG Neurorestauration beschreibt ein einfaches Verfahren, bei dem in wenigen Schritten autologe Endothelzellen aus einem menschlichen Nerv gezüchtet werden können.9
Ein weiteres Hilfsmittel zur besseren Aussprossung stellt die direkte End-zu-EndKoaptation (s. o.) dar, sofern eine solche möglich ist und keine Spannung auf der Nahtstelle selbst vorliegt. Das Interesse an dieser Versorgungsform ist neu erwacht. Frühere Versuche waren frustran und endeten in Neuromen ohne Funktionsgewinn. Ein langsame – über mehrere Wochen andauernde – physiologische Nervdehnung in den gesunden Anteilen, also nicht an der Koaptationsstelle, scheint einen zusätzlichen Aussprossungsreiz zu generieren.10 Bewegungen und Trainingsreize können durch myoelektrisch getriebene Orthesen sowie Exoskelette gesetzt werden – Letztere ermöglichen u. a. Traumapatienten, Para- und Tetraplegikern, Schlaganfallpatienten oder schwer an Multipler Sklerose Erkrankten, aufrecht zu gehen. Durch die Bewegung und Feedbackmechanismen werden mannigfaltige Effekte erzeugt, die zukünftig bei der Wiederherstellung von Bewegungsmustern und für die Vermeidung von negativen Immobilisationsfolgen genützt werden können.
Viele österreichische Patienten mit komplexen Nervenläsionen werden nicht den geeigneten Eingriffen zugeführt und letztlich unter den funktionellen Möglichkeiten behandelt. Es zeichnet sich ab, dass Nerventransfers nicht nur in der Plexus-
chirurgie, sondern zunehmend auch nach Hirn- und Rückenmarksläsionen Funktionsverbesserungen bringen können. Somit besteht Bedarf für die umfassende und ineinandergreifende operative Behandlung von peripher und zentral verursachten Funktionsausfällen – genau dies, die Funktion wiederherzustellen, ist der Ansatz eines Paralysis Centers. Hierfür ist nerven- und neurochirurgische Expertise nötig. Aufgrund der komplexen und sehr speziellen Verfahren ist ein zentralisierter Ansatz erfolgversprechender. Die Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie (ÖGNC) und der Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) unterstützen den Aufbau eines derartigen Zentrums – des Paralysis Centers Klagenfurt/Austria.
Literatur:
1 Kretschmer T, Antoniadis G, Assmus H. Nervenchirurgie –Trauma, Tumor, Kompression. Springer-Verlag 2014.
2 Koenig RW et al., J Neurosurg. 2011 Feb;114(2):514-21.
3 Heinen C et al., Neurosurgery. 2019 Sep 1;85(3):415-422.
4 Bazarek S et al., Neural Regen Res. 2022 Apr;17(4):779–780.
5 Bhatia A et al., Neurosurg Focus. 2017 Jul;43(1):E3.
6 Midha R, Grochmal J, J Neurosurg. 2019 Mar 1;130(3):675-685.
7 Zuo KJ et al., Exp Neurol. 2020 Oct;332:113397.
8 Khan A et al., J Neurosurg Spine. 2021 Sep 3;36(1):135-144.
9 Dömer P et al., Scientific Reports. 2021;11:1951 (1-10).
10 Howarth HM et al., Exp Neurol. 2020 Sep;331:113328.
Für substanzielle Nervenläsionen mit Funktionsverlust und eine dadurch erzeugte Schmerzsituation gibt es sehr gute operative Behandlungsmöglichkeiten.
• Alte und neue Verfahren werden kombiniert und mittels mikrochirurgischer Technik durchgeführt.
• Voraussetzungen für einen guten funktionellen Erfolg sind die richtige Einschätzung der Läsion, die richtige Wahl des Verfahrens und eine zeitnahe Versorgung.
• Moderne bildgebende Verfahren mit hochauflösendem Ultraschall (6-22 MHz) und spezielle kernspintomographische Sequenzen (MR-Neurographie) helfen dabei, frühzeitig (Teil-)Durchtrennungen zu erkennen.
• Nerventransfers werden immer häufiger vorgenommen und bereits erfolgreich zur Funktionswiederherstellung bei zerebralen und Rückenmarksläsionen eingesetzt.
• Mit der rekonstruktiven Neurochirurgie ist ein Spezialgebiet entstanden, das den Betrieb eines hochspezialisierten Paralysis Centers erforderlich macht, um die Funktionswiederherstellung nach zentralen und peripheren Läsionen zu gewährleisten.
NACHBERICHT
Warum die Gendermedizin bei Rheuma ein großes Thema ist
Autoimmun bedingte entzündlichrheumatische Erkrankungen betreffen deutlich mehr Frauen als Männer (siehe Tabelle „Typisch Frau“). Vor allem im Bewegungsapparat kommt es zu entzündlichen Reaktionen, aber auch Organe, etwa Herz oder Nieren, können beteiligt sein. Beispiele dafür sind die rheumatoide Arthritis oder der systemische Lupus erythematodes (SLE). Letzterer tritt bei Frauen neun bis zehn Mal häufiger auf. Wenn jedoch Männer von solchen typisch weiblichen Erkrankungen betroffen sind, zeigen sich bei ihnen häufig schwerere Verläufe. Darüber, ob bzw. inwiefern Frauen und Männer unterschiedlich auf Therapien ansprechen, liegen bislang keine ausreichenden Daten vor.
Die axiale Spondyloarthritis (axSpA), die lange Zeit als typische Männerkrankheit galt, wird heute bei Frauen öfter diagnostiziert. Dennoch betrifft axSpA als einzige entzündlich-rheumatische Erkrankung Männer häufiger. Das klinische Erscheinungsbild ist in erster Linie von chronischen entzündlichen, tiefsitzenden Rückenschmerzen gekennzeichnet. Diese beginnen in der Regel schleichend vor dem 45. Lebensjahr, treten oft nachts bzw. in den frühen Morgenstunden auf und bessern sich in

der Regel bei Bewegung. Oft kann es bei der axialen Spondyloarthritis auch zu einer Arthritis kommen – oder zu einer Enthesitis. Mögliche extraskelettale Begleiterkrankungen sind unter anderem Psoriasis, Uveitis oder Colitis. Betroffene sprechen üblicherweise gut auf nichtsteroidale Antirheumatika an. Typisch für die Krankheit ist eine familiäre Häufung. Bis Frauen die Diagnose bekommen und somit mit der Therapie begonnen werden kann, dauert es im Schnitt sieben Monate länger als bei Männern. „ Frauen weisen oft nicht die typischen Beschwerden auf. Sie kön-
EXPERTIN: Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner Klinische Abteilung für Rheumatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien
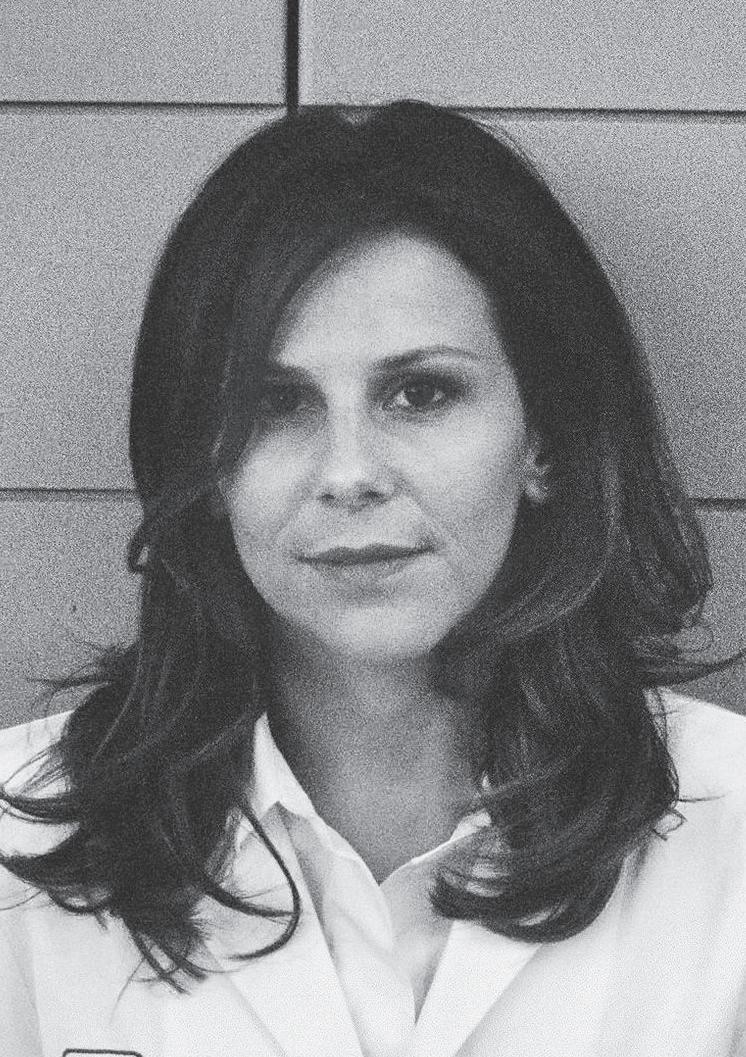
nen häufig ihre Schmerzen nicht so genau definieren und beschreiben einen ,widespread pain‘, also einen Ganzkörperschmerz, während Männer eher dem klassischen Krankheitsbild entsprechen und es auch so beschreiben“, erklärte die Rheumatologin Dr.in Antonia Mazzucato-Puchner von der Medizinischen Universität Wien in einem MeinMed-Webinar (siehe Kasten).
„Die Ursachen für das fehlgeleitete Immunsystem sind größtenteils immer noch unbekannt, was natürlich die Behandlung erschwert“, so die Rheumatologin. Dass Frauen öfter an rheumatischen Erkrankungen leiden, hängt mit ihren Abwehrkräften zusammen, die Infektionen besser bekämpfen oder auch nach Impfungen mehr Antikörper produzieren. Aufgrund seiner Sensibi-
lität entwickelt das weibliche Immunsystem jedoch auch eher Autoimmunerkrankungen. Dies ist auf die Rolle der Sexualhormone zurückzuführen: Östrogen und Prolaktin aktivieren das Immunsystem, Testosteron und andere Androgene hingegen unterdrücken es.
Interessant ist der Verlauf verschiedener Autoimmunerkrankungen bei einer Schwangerschaft, bei der im Immunsystem der Mutter viele Veränderungen stattfinden. Beispielsweise können Frauen, die an SLE erkrankt sind, während oder kurz nach einer Schwangerschaft vermehrt zu Krankheitsschüben tendieren. Die rheumatoide Arthritis bessert sich hingegen oft vorübergehend. Das liegt an den jeweils „ z uständigen“ Lymphozyten-Abwehrzellen (Th1- versus Th2-Zellen), die unterschiedliche Botenstoffe produzieren. Th1-Zellen bekämpfen Bakterien oder andere Krankheitserreger nicht direkt, vielmehr töten sie infizierte Zellen des eigenen Organismus ab. So bewirkt das Immunsystem, dass sich erkrankte Zellen nicht ausbreiten, sondern vom Körper ausgeschieden werden können. Ein menschlicher Fötus wächst innerhalb des Immunsystems der Mutter heran. Allerdings stellt das Baby für das mütterliche Immunsystem fremdes Gewebe dar, dessen Antigene vom Vater stammen. Es ist also sinnvoll, dass die Th1-Immunabwehr vorübergehend gedrosselt wird, damit der Fötus nicht abgestoßen wird. Hingegen ist die Th2-Immunabwehr, die Krankheitserreger direkt bekämpft, in dieser Lebensphase von besonderer Bedeutung. „Wenn eine Autoimmunerkrankung besteht, ist die exakte medikamentöse Einstellung der Patientin entscheidend, um Frühgeburten oder andere Komplikationen während der Schwangerschaft zu verhindern“, so Dr.in Mazzucato-Puchner.
Mit modernen Biologika stehen mittlerweile Therapien zur Verfügung, welche das Krankheitsmanagement allgemein und auch bei Frauen im gebärfähigen Alter erleichtern. Einige csDMARDs der älteren Generation sind in der Gestation und Stillzeit kontraindiziert. Nun gibt es mit den TNF-α-Inhibitoren, vor allem mit Certolizumab Pegol, gute neue Optionen.
Margit KoudelkaIm Rahmen von MeinMed hielt Dr. in Antonia Mazzucato-Puchner einen Vortrag über autoimmune chronisch entzündliche rheumatische Erkrankungen. Das gesamte Video dazu finden Sie auf meinmed.at/1756
Das Webinar wurde unterstützt von:

Osteoporose erfordert ein individualisiertes Vorgehen
+++ Ziel: (Re-)Frakturrisiko senken – „Treat to target“ +++ Therapieindikation bei osteoporotischer Fragilitätsfraktur oder gemäß dem Frakturrisiko +++ frühe Intervention ist effektiver +++ Medikamentenwahl von Frakturrisiko abhängig +++ Timing bei osteoanabolen und antiresorptiven Substanzen +++ notwendiges Langzeitmanagement +++ Erhöhung der Persistenzrate +++
Klassische osteoporotische Frakturen wie die Schenkelhals- und Wirbelkörperfraktur treten in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten häufig auf und sind zugleich mit sehr hoher Morbidität und auch Mortalität verbunden. Trotz der hohen Versorgungskosten wird ein hoher Prozentsatz der Betroffenen nicht zeitgerecht und adäquat medikamentös versorgt, obwohl damit nachweislich weitere Frakturen
und Kosten verhindert werden können. Laut Datenlage leiden in Österreich mehr als eine halbe Million Menschen an Osteoporose.
Die Osteoporose als häufigste Knochenerkrankung führt mit der Zeit, beeinflusst von vielen Faktoren, zu einer reduzierten, rarefizierten Knochenstruktur im gesamten Skelett, die durch diesen Quantitäts- und Qualitätsverlust in eine abnorme Knochenbrüchigkeit mündet.
Ist infolgedessen eine osteoporotische Fragilitätsfraktur bei leichtem Trauma oder spontan aufgetreten, dann spricht man von einer manifesten Osteoporose. Durch die Überalterung der Bevölkerung und die steigende Lebenserwartung ist diesbezüglich in Zukunft mit einer zunehmenden Prävalenz zu rechnen. Eine zeitnahe und effiziente spezifische (Anti-)Osteoporosetherapie würde hingegen diesem Trend entgegenwirken.

Die therapeutische Strategie bei Osteoporose hat sich aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der verfügbaren Medikamente und der daraus resultierenden Effektivität in den letzten Jahren drastisch gewandelt. Der Zeitfaktor spielt aktuell, ebenso wie in anderen Disziplinen, eine wesentliche Rolle. Ein rasches Handeln ist bei einer rezenten Fragilitätsfraktur wegen des unmittelbar danach sehr hohen Refrakturrisikos notwendig. Eine zeitnahe Therapie mit schneller Wirksamkeit zeigt im Gegensatz zu einem späteren Einsatz derselben Medikamente in Studien einen deutlich besseren Effekt und wird ergo von den nationalen und internationalen Gesellschaften empfohlen. Oftmals wird eine Osteoporosetherapie jedoch verzögert bzw. verspätet begonnen – wegen einer vermeintlich
GASTAUTORIN:
OÄ Dr.in Maya Thun Fachärztin für Innere Medizin, Rudolfinerhaus Privatklinik, Wien, Ordination: internist-wien.at
erforderlichen Knochendichtemessung. Obwohl leitlinienkonform eine medikamentöse Therapie bei einer osteoporotischen Fragilitätsfraktur an typischer Lokalisation – auch ohne Knochendichtemessung – indiziert ist. Überdies soll der Beginn einer indizierten Osteoporosetherapie wegen einer möglichen zahnärztlichen Prophylaxe laut aktuellen S3-Leitlinien nicht hinausgezögert werden, da das niedrige antiresorptivaassoziierte Kiefernekroserisiko in keinem Verhältnis zu einem drohenden Frakturrisiko und den damit verbundenen Komplikationen steht.
Ein anderes Bild bietet derzeit die Versorgung der Osteoporosepatientinnen und -patienten in Europa wie auch in Österreich: Sie ist unzureichend bzw. lückenhaft – z. B. erhalten hierzulande nur circa 20 % der Patienten mit einer osteoporotischen Fraktur nach einem Krankenhausaufenthalt eine

spezifische (Anti-)Osteoporosetherapie. Wesentlich und notwendig ist es demnach, einerseits diesen TreatmentGap zu schließen, andererseits das Augenmerk auf jene zu richten, die noch keine Fraktur erlitten haben, aber mit einem erhöhten Frakturrisiko behaftet sind – sodass man bereits vorbeugt und in der Folge Fragilitätsfrakturen vermeidet.
Frakturrisiko berechnen
Das jeweilige Frakturrisiko lässt sich anhand von Kalkulatoren abschätzen, um frühzeitig Risikopersonen zu identifizieren. Diesbezüglich sind Frakturrisikorechner wie der FRAX („ Fracture Risk Assessment“) und das Nomogramm des DVO hilfreich. Im FRAX werden unterschiedliche Risikofaktoren, z. B. Alter, Geschlecht, BMI, genetische Prädisposition, Medikamente, Erkrankungen, Alkohol-/Zigarettenkonsum etc., unter Berücksichtigung des Ergebnisses der aktuellen Densitometrie des Schenkelhalses, zur Kalkulation des Zehn-Jahres-Risikos einer
Hüft- und osteoporotischen Majorfraktur (MOF) herangezogen. Die jeweilige Interventionsschwelle, bei deren Überschreiten eine spezifische Osteoporosetherapie empfohlen wird, ist altersabhängig und länderspezifisch. Allgemein besteht ein sehr hohes Risiko, wenn der FRAX-Score bei einer MOF mehr als 20 % über der Interventionsschwelle liegt. Aktuelle Daten wurden kürzlich auch für Österreich publiziert.
Das vormals in der Osteoporosetherapie verwendete fixe Stufenschema ist nicht mehr zeitgerecht bzw. leitlinienkonform. Die Entscheidung, welches Medikament zum Einsatz kommt, soll sich am Frakturrisiko des Patienten orientieren, an dessen Bedürfnisse angepasst sein sowie das Wirkungsprinzip, den Wirkungseintritt, die Effektivität und mögliche Kontraindikationen der Medikamente berücksichtigen. Deshalb ist die Stratifizierung in Bezug auf das unmittelbare sehr hohe und niedrige Frakturrisiko für die Therapieentscheidung wesentlich. Aktuelle Leitlinien raten, dass Patienten mit sehr hohem Frakturrisiko, z. B. jene mit einer frischen Fragilitätsfraktur, so rasch wie möglich ein hocheffektives, schnell wirksames Medikament erhalten, um das imminente Frakturrisiko effizient zu senken. In solchen Fällen wird eine knochenanabole (Romosozumab oder
Knochenbruchs unmittelbar nach einem Indexbruch am höchsten ist, andererseits die knochenanabole Therapie rasch und effektiver wirkt, wenn sie vor einer antiresorptiven Therapie eingesetzt wird.
Unter Knochenanabolika versteht man Substanzen, die Osteoblasten stimulieren und dadurch den Knochenaufbau fördern. Dazu zählen Teriparatid und Romosozumab, wobei Romosozumab dual wirksam ist, d. h. gleichzeitig Osteoblasten anregt wie auch Osteoklasten hemmt. Zu den antiresorptiven Medikamenten gehören die parenteralen sowie oralen Bisphosphonate und Denosumab als RANK-L-Antikörper. Sie hemmen jedoch die Osteoklastenaktivität in unterschiedlicher Weise und differieren daher in Wirkdauer, Effektivität, Wirkungseintritt, Nebenwirkungsprofil und Einsatzgebiet.
Bei niedrigem Risiko sind Lebensstilmaßnahmen ausreichend. Raloxifen oder eine Hormonersatztherapie können bei Osteoporose mit niedriger Interventionsschwelle bei Frauen erwogen werden. Im Falle eines hohen Risikos gilt die klassische antiresorptive Therapie mit Bisphosphonaten oder Denosumab als First Line.
(parenteral) bis fünf Jahre (oral) belegt. Bei einer langfristigen Behandlung mit Bisphosphonaten steigt jedoch das atypische Femurfrakturrisiko schrittweise, sodass eine Therapie für mehr als zehn Jahre nicht mehr befürwortet wird. Hingegen legen Daten zur Frakturrisikoreduktion bei einer Langzeitbehandlung mit Denosumab über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren aus der Verlängerungsstudie der FREEDOM-Studie nahe, dass Denosumab langfristig das Risiko vertebraler und nichtvertebraler Frakturen zu senken scheint. Daher besteht derzeit die Empfehlung, bei Patienten mit erhöhtem Frakturrisiko die Therapie mit Denosumab weiterzuführen. Da Denosumab nur für die Dauer der Behandlung wirksam ist, beobachtet man jedoch nach einem Absetzen nicht nur einen Wirkverlust, sondern auch einen zeitlich begrenzten Effekt mit kurzfristig gesteigertem Knochenumbau (Rebound). Deshalb wird von manchen Gesellschaften bei einem eventuellen Stopp von Densumab eine Konsolidierungstherapie mit einer ZolendronatGabe empfohlen. Bei Switch von Denosumab auf Romosozumab ist dies nicht notwendig.
Gemeinsam vorgehen
Teriparatid) First-Line-Therapie empfohlen. Diese aktuellen Empfehlungen beruhen auf der Erkenntnis, dass einerseits das Risiko eines nachfolgenden
Die Osteoporose stellt eine chronische Erkrankung des Knochens dar und ähnlich wie bei anderen chronischen Krankheiten benötigen Betroffene zeitlebens Kontrollen zur eventuellen Therapieoptimierung, um langfristig das Frakturrisiko zu minimieren. Einerseits ist die Therapiedauer einiger Medikamente aufgrund von Wirkungsverlust zeitlich limitiert. Andererseits ist aber eine langfristige Frakturkontrolle notwendig. Teriparatid als Knochenanabolikum ist nach zwei Jahren zu beenden und es muss auf eine antiresorptive Therapie umgestiegen werden. Auch bei Romosozumab wird nach einem Jahr eine Anschlusstherapie mit einem antiresorptiven Medikament notwendig. Nach den aktuellen Leitlinien ist der Nutzen einer Bisphosphonattherapie nur für drei
NACHBERICHT
Aufgrund dieses Langzeitmanagements ist in der Betreuung von Osteoporosepatienten das Augenmerk auch auf die Adhärenz bzw. Persistenz zu richten. Die Betroffenen sollen von Anfang an in die Therapiestrategie einbezogen werden („shared decision“), da in der Osteoporosetherapie oftmals eine niedrige Persistenzrate festzustellen ist. Die Ursachen dafür sind oft eine unbegründete Angst vor möglichen Nebenwirkungen sowie eine Unterschätzung der Wichtigkeit von Osteoporosemedikamenten seitens der Patienten.
Da viele medizinische Disziplinen mit der Problematik der Osteoporose und ihrer Folgen konfrontiert sind, wäre ein gemeinsames Vorgehen für die Zukunft wünschenswert. Der Vermittlung und Versorgung durch die Hausärztin, den Hausarzt wird hier eine große Bedeutung beigemessen.
Die Gastautorin war Vortagende bei der 53. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, 22.-24.9.22, Salzburg Kongress.
„Das vormals in der Osteoporosetherapie verwendete fixe Stufenschema ist nicht mehr zeitgerecht bzw. leitlinienkonform.“
Bei Ragweed (Ambrosia artemisiifolia) handelt es sich nicht nur um eine hochallergene, sondern auch um eine hochinvasive Pflanze: Vorhersagen zufolge könnte sich die Konzentration von Ragweedpollen in der Luft innerhalb Europas bis 2050 vervierfachen. Das würde die Zahl der Sensibilisierungen bis 2060 mehr als verdoppeln. Statt derzeit 33 Millionen wären dann 77 Millionen Europäerinnen und Europäer aufgrund jener Pflan-
zenpollen von Rhinokonjunktivitis und Asthma betroffen.1 Ragweed stellt dabei unter den Pollenallergien eine Besonderheit dar: Allergische Symptome treten schon bei Konzentrationen von < 10 Pollen/m3 auf, im Fall von Gräserpollen jedoch erst bei > 15 Pollen/m3 und von Birkenpollen bei > 30 Pollen/m3 2 Derzeit wird die Ragweedpollensaison zumeist mit Anfang August bis Ende September angegeben.3 Forscherinnen
und Forscher gehen allerdings davon aus, dass steigende Temperaturen ebenso wie erhöhte CO2- und NO2-Konzentrationen in der Luft die Saison auf Dauer verlängern werden.1 Das macht ein frühzeitiges Erkennen und Eingreifen aus ärztlicher Sicht noch viel wichtiger, denn nur so kann auch die Sensibilisierungskaskade verhindert werden.
Zwei Wochen nach Beginn der AIT:
Erhöhte IgG4-Konzentration im Serum – die IgG4-Konzentration bleibt für mehr als ein Jahr erhöht; Antikörper der Klasse IgG4 maskieren das Allergen, sodass Antikörper der Klasse IgE nicht mehr binden und Mastzellen nicht mehr aktivieren können.
Erste Monate nach Beginn der AIT:
Erhöhte allergenspezifische IgE-Konzentration im Serum – natürliche Reaktion auf AIT, keine Verschlimmerung der Allergie.
Sechs bis zwölf Monate nach Beginn der AIT: Progressive Reduktion der allergenspezifischen IgE-Konzentration im Serum – aufgrund der Verringerung IgE-sekretierender Plasmazellen im Knochenmark.
Erstes bis drittes Jahr nach Beginn der AIT:
Nach einer SLIT steigen auch IgA-Konzentrationen im Serum stark an, welche in Schleimhäuten die Immunreaktionen auf das Allergen inhibieren.
Mehrere Jahre nach erfolgreicher AIT:
Nachhaltig gesenkte allergenspezifische IgE-Konzentration im Serum.
Auf molekularer Ebene unterscheidet man mittlerweile zwölf Ragweedallergene.4 Amb a 1 ist das wichtigste Majorallergen, mit einer Sensibilisierungsrate von mehr als 95 % unter allen von der Ragweedallergie Betroffenen im Pricktest bzw. bei der Bestimmung spezifischer IgE. Als zweites Majorallergen gilt Amb a 11, auf das 66 % der Allergikerinnen und Allergiker mit der Bildung von Antikörpern reagieren.2 Werden die IgE-Konzentrationen gegenüber Amb a 1 mit jenen gegenüber Ragweedpollenextrakten verglichen, fällt jedoch auf, dass die Übereinstimmung nur 73,8 % beträgt – ein Hinweis darauf, dass mehrere Moleküle aus allergologischer Sicht relevant sein könnten.5
Kreuzreaktivität beachten
Die Bestimmung der Majorallergene liefert auch wichtige Hinweise hinsichtlich der Kreuzreaktivität: So besteht eine Kreuzreaktivität von Amb a 1 mit Art v 6 (Beifuß), Cup a 1/Jun a 1 (Zypresse) und Cry j 1 (Zeder).
Dahingegen werden Kreuzreaktivitäten zwischen Amb a 11 und Act d 1 (Kiwi), Ana c 2 (Ananas) und Der f/ Der p 1 (Hausstaubmilbe) beobachtet.
Neueste Daten über verschiedene IgEReaktivitätsmuster bei Ragweedallergikern zeigen, dass neben Amb a 1 und Amb a 11 auch Amb a 4, Amb a 6 und Amb a 8 klinisch relevant sein könnten. Für die kommerzielle komponentenbasierte Diagnostik stehen laut den Studienautorinnen und -autoren aber häufig nur die Allergene Amb a 1 und Amb a 4 zur Verfügung.4
Unterscheidung von Ragweed und Beifuß

Auch die Leitlinie zur Allergenimmuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen6 empfiehlt, eine spezifische Komponentendiagnostik einzusetzen, um Ragweedallergien z. B. von Beifußallergien zu unterscheiden. Dies ist für die Abklärung wichtig, da sich die Pollensaison von Beifuß (Artemisia vulgaris) mit jener von Ragweed überschneidet.5 Die komponentenbasierte IgE-Diagnostik wäre auch im Fall einer Polysensibilisierung auf Pollen hilfreich und könnte dabei unterstützen,
den Erfolg einer allergenspezifischen Immuntherapie (AIT) abzuschätzen.6
Eingriff in die Sensibilisierungskaskade möglich
Wird die Sensibilisierung gegen einzelne Pollenmoleküle erfasst, so kann auch auf die Sensibilisierungskaskade rückgeschlossen werden. Dies beobachtete man etwa bei Gräserpollen- bzw. Hausstaubmilbenallergien. Die Allergien begannen bei Kindern mit einer monomolekularen Sensibilisierung, welche sich im Verlauf zu einer oligomolekularen und bei einigen Kindern auch zu einer polymolekularen Sensibilisierung entwickelte. Die Wissenschaft spricht hierbei von „molecular spreading“ Jene Probandinnen und Probanden, welche polymolekular sensibilisiert waren, hatten ein signifikant höheres Risiko, an allergischer Rhinitis und Asthma zu erkranken als jene, die nur monomolekular sensibilisiert waren.7 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen dementsprechend vor, nicht abzuwarten, bis sich die Sensibilisierung verbreitert. Eine Allergenimmunprophylaxe (AIP) könnte ein gangbarer Weg sein, um z. B. monomolekular sensibilisierte, aber noch nicht erkrankte Kinder aus Risikofamilien – in denen etwa die Eltern unter Heuschnupfen leiden – vor dem „molecular spreading“ und dem Auftreten von Symptomen zu bewahren.7
Diese Vorgehensweise ist momentan zwar noch Zukunftsmusik – klar ist aber, dass jene Patientinnen und Patienten, die im vergangenen Spätsommer allergische Symptome aufgewiesen haben, ehebaldigst abgeklärt werden müssen, damit sie noch vor Beginn der nächsten Ragweedpollensaison einer Behandlung zugeführt werden können. Man sollte die Therapie zumindest zwölf Wochen vor Saisonbeginn einleiten und drei Jahre lang fortführen.3 Die Leitlinie empfiehlt bei Kindern und Erwachsenen mit nachgewiesener Ragweedallergie und Rhinokonjunktivitis mit bzw. ohne Asthma die sublinguale Immuntherapie (SLIT) mit der RagweedpollenextraktTablette. Als Alternative könne bei Erwachsenen auch eine subcutane Immuntherapie (SCIT) erwogen werden –Studiendaten für Kinder fehlten diesbezüglich allerdings und die Wirksamkeit sei bei Asthma nur schwach belegt.6
Mag.a Marie-Thérèse Fleischer, BSc
Quellen:
1 Liu SH et al., Front Allergy 2022; 3:854038.
2 Albertini R et al., Acta Biomed 2022; 93(5):e2022324.
3 pollenwarndienst.at
4 Buzan MR et al., Clin Transl Allergy 2022; e12179.
5 Horak F et al., Authorea, May 20, 2022.
6 Pfaar O et al., S2k-Leitlinie zur Allergen-Immuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen, Stand: 06/2022.
7 Matricardi PM et al., J Allergy Clin Immunol 2019; 143:831-43.
8 Izmailovich M et al., Cells 2023; 12:383.
9 Wöhrl S, hautnah 2020; 19:157-161.
Die KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) machte in ihrer rezenten Guideline1 aufmerksam: Die weltweite Prävalenz von Diabetes hat ein epidemisches Ausmaß erreicht und Prognosen besagen einen weiteren Anstieg. Zudem werden laut Schätzungen 40 % oder mehr der Personen mit Diabetes eine chronische Nierenerkrankung („chronic kidney disease“ – CKD) entwickeln. Gleichzeitig kommen immer mehr Behandlungsmöglichkeiten hinzu und die Datenlage zur Betreuung von Diabetespatienten mit CKD gewinnt an Quantität sowie Qualität. So veröffentlichte die KDIGO im Jahr 2020 ihre erste Guideline zum Diabetesmanagement bei CKD für die klinische Praxis – im November 2022 erfolgte bereits ein Update.1 Um Ärztinnen und Ärzten einen kompakten Überblick zu ermöglichen, formulierte die KDIGO „Top 10 “-Take-homeMessages.2
Patientinnen und Patienten mit Diabetes und CKD leiden an einer Multisystemerkrankung. Erforderlich ist daher eine umfassende Behandlung, die sowohl Lifestyle-Interventionen als Basis – etwa gesunde Ernährung, kein
Rauchen, Bewegung und Gewichtskontrolle – als auch eine medikamentöse Therapie beinhaltet. Dabei wird das Ziel verfolgt, renale sowie kardiovaskuläre Outcomes, z. B. in Bezug auf Lipide, Blutzucker und -druck, zu verbessern.
2. Ernährung
Betroffene sollten auf eine ausgeglichene und gesunde Ernährungsweise achten, die reich an Gemüse, Obst, Vollkorn, Fasern, Hülsenfrüchten, pflanzlichen Proteinen, ungesättigten Fettsäuren und Nüssen sowie arm an verarbeitetem Fleisch, raffinierten Kohlenhydraten und gesüßten Getränken ist. Gemäß den Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung gilt es zudem, 0,8 g Proteine pro kg Körpergewicht und Tag sowie weniger als 5 g Salz pro Tag zu sich zu nehmen.
3. SGLT2-Inhibitoren
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und einer chronischen Nierenerkrankung sollten SGLT2-Hemmer verordnet werden, solange die eGFR ≥ 20 ml/ Min./1,73 m2 beträgt. Unterschreitet die eGFR jene Schwelle nach der Therapieinitiierung, kann der SGLT2Inhibitor weiterhin gegeben werden.
SGLT2i senken das Risiko einer CKDProgression, einer Herzinsuffizienz und atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankungen deutlich – auch bei bereits gut eingestelltem Blutzucker.
4. Metformin
Bei einer eGFR von ≥ 30 ml/ Min./1,73 m2 sollten Personen mit Diabetes Typ 2 und einer CKD Metformin erhalten. Für jenes Patientenkollektiv stellt Metformin ein sicheres, effektives und günstiges Arzneimittel dar, um den Blutzucker zu kontrollieren und diabetische Komplikationen zu reduzieren.
5. Glukosemonitoring und Zielwerte
Der HbA1c-Wert ist regelmäßig zu messen. Die Zuverlässigkeit sinkt allerdings mit dem Voranschreiten der CKD, insbesondere bei Patienten, die mittels Dialyse behandelt werden. Daher sollten die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden. Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung oder eine Selbstmessung der Blutglukose können hilfreich sein – besonders auch für Personen, deren Behandlung mit einem erhöhten Hypoglykämierisiko verbunden ist. Die HbA1c-Zielwerte sollten zwischen < 6,5 % und < 8,0 % individualisiert festgelegt werden.
6. GLP-1-Rezeptoragonisten
Erreichen Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD trotz der Behandlung mit Metformin und SGLT2-Inhibitoren ihre individuellen glykämischen Zielwerte nicht bzw. sind diese Therapeutika bei ihnen nicht anwendbar, wird empfohlen, die Therapie um einen langwirksamen GLP-1-Rezeptoragonisten zu ergänzen.
7. RAS-Blockade
Personen mit Diabetes Typ 1 oder 2, Hypertension and Albuminurie (persistierende ACR ≥ 30 mg/g) sollten mit einem RAS-Inhibitor – entweder einem ACEHemmer oder einem Angiotensin-II-Rezeptorblocker – behandelt werden. Der Wirkstoff wird auf die maximale zulässige oder höchste tolerierte Dosis titriert. CAVE: Monitoring von Serumkalium und Kreatinin ist erforderlich.


8. Nichtsteroidale Mineralokortikoid-Antagonisten
Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und andauernder Albuminurie können ns-MRA das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse und einer CKD-Progression reduzieren. Ihr Einsatz wird für Personen mit Diabetes Typ 2 vorgeschlagen, die trotz Standardtherapie eine ACR von ≥ 30 mg/g im Urin und normale Serumkalium-Werte haben. Auch hier müssen Serumkalium und Kreatinin regelmäßig kontrolliert werden.
9. Ansätze für das Management
Die Betreuung der Patientinnen und Patienten sollte auf interdisziplinärer Teamarbeit beruhen – mit Schwerpunkten auf regelmäßigen Überprüfungen, der Kontrolle verschiedener Risikofaktoren und strukturierter Patientenedukation. Das Ziel letzterer Maßnahme: Betroffene zu befähigen, eigenständig ihre Nierenfunktion zu schützen und das Risiko, Komplikationen zu entwickeln, zu verringern.
10. Forschungsschwerpunkte
Weiterhin besteht ein Mangel an Daten bezüglich des optimalen Diabetesmanagements bei Nierenversagen. Daher empfiehlt die KDIGO, hierauf künftig einen Fokus in der Forschung zu richten. Einzubeziehen sind dabei auch Dialyse und Transplantation.
Anna Schuster, BScMeine Patienten können:
1. Accu-Chek Blutzuckermessgerät* mit der mySugr App** verbinden.
Quellen:
1 KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney International (2022) 102 (Suppl 5S), S1–S127.
2 Top 10 Takeaways for Clinicians from the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in CKD.
Die gesamte Guideline und ergänzende Dokumente, etwa die „Top 10 Takeaways“ für Mediziner:innen sowie für Patient:innen, sind für den Download verfügbar unter: kdigo.org/guidelines/diabetes-ckd

2. Messwerte automatisch übertragen und zusätzliche Informationen hinzufügen.
3. Analysen & Reports ansehen, und z.B. als PDF per E-Mail teilen oder ausgedruckt mitnehmen.
* Accu-Chek Mobile benötigt einen Adapter [kostenlos erhältlich auf www.accu-chek.at].
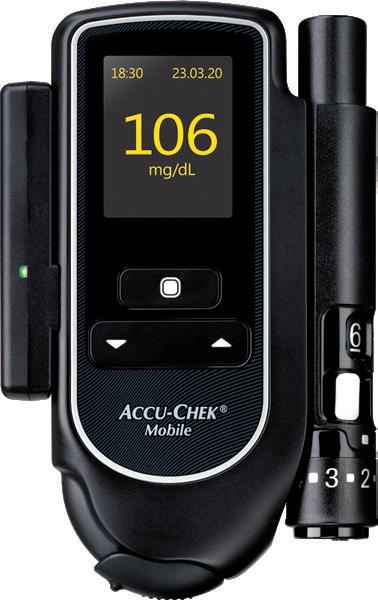

** mySugr Pro ist in Verbindung mit einem Accu-Chek Blutzuckermessgeräte KOSTENLOS [statt € 27,99 jährlich].

Serie, Teil 2: Das Reizdarmsyndrom aus Sicht der ayurvedischen Medizin und der mitteleuropäischen naturheilkundlichen Ernährungslehre
Derzeit praktizierte Therapie- wie Forschungsansätze in der Naturheilkunde im Zusammenhang mit dem Reizdarmsyndrom (RDS) sind relativ jung und weisen insbesondere bezüglich der Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine große Nähe bzw. Überlappung zur konventionellen Medizin auf – mit der großen Ausnahme eines stark individualisierten Konzeptes aus der europäischen – hier österreichischen – Tradition, der Diagnostik und Therapie nach F. X. Mayr, sowie vor
allem der ayurvedischen Ernährungslehre aus Asien.


GASTAUTOR: Dr. Rainer Stange Abteilung Naturheilkunde, Charité – Universitätsmedizin Berlin und Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee

Für jegliche Störung in Verdauung und Stoffwechsel ist in der ayurvedischen Medizin das Prinzip des „ Agni“, auch „ Pachataha“, zumindest mitverantwortlich. Darunter versteht man jene Energie, die der Körper aufwenden muss, um sämtliche Verdauungs-, Transformations- und Stoffwechsel-
prozesse zu vollziehen. Übersetzt wird es meist mit „Verdauungsfeuer“ Das Agni sorgt auch für die Funktion des Immunsystems und vernichtet pathogene Mikroorganismen sowie Toxine in Magen, Dünndarm und Dickdarm. Weiß der ayurvedisch orientierte Arzt um entsprechende Beschwerden, möglicherweise gestützt durch manuelle Befunde, wird er versuchen, Schwächen des Agni auszugleichen. Dies geschieht in der Regel gleichzeitig durch individuelle Ernährungsmaßnahmen und Phytotherapie.1
In einem jüngeren RCT sollte untersucht werden, wie RDS-Patienten nach >

• Ideal bei unspezifischen Diarrhöen und gastrointestinalen Beschwerden
• Bindet Schadstoffe und Toxine

einer ayurvedischen Ernährungsberatung bewusst ohne Phytotherapie im Vergleich zum Konzept der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) abschneiden, welches sich im Wesentlichen am Low-FODMAP-Konzept orientiert (siehe Teil 1 der Serie Reizdarm, Hausärzt:in 3/23).2 Alle Patienten erhielten individuelle Beratungen: 45 Minuten zu Beginn und dann zweimal je 30 Minuten im Verlauf. Hauptzielparameter war der international am häufigsten gebrauchte „I rritable Bowel Syndrom – Symptom Severity Score“ (IBS-SSS) im Verlauf von sechs Monaten. Beide Gruppen verbesserten sich im Mittel bis drei Monate deutlich, dann kam es wieder zu einem ähnlichen Rebound bis etwa 90 IBS-SSS-Punkte unterhalb des Ausgangswertes (eine Verbesserung um 50 gilt als klinisch relevant). Über den Verlauf ergab sich ein leichter Vorteil für die ayurvedische Intervention.
Die mitteleuropäische naturheilkundliche Ernährungslehre geht nicht so differenziert vor wie das Ayurveda. Dennoch finden sich auch hier leicht umsetzbare und oft bereits zum Erfolg führende Empfehlungen.3
Im strukturierten Anamnesegespräch werden Details sowohl der Auswahl als auch der Zubereitung der Lebensmittel eruiert, die verträglichkeitsbestimmend sein können. Bei Defiziten wird entsprechend beraten:
• Auswahl, Menge und Zubereitung der Kohlenhydrate, nicht der Eiweiße, sind in Bezug auf Makronährstoffe bei RDS problematisch. Dies steht in Abgrenzung zur Funktionellen Dysplasie (FD), bei der zusätzlich eine ungünstige Qualität und eine zu hohe Quantität der Fette die Symptomatik begünstigen.
• Die Palette blähender Gemüse ist groß, allgemeine Regeln sind schwer festlegbar, da die in der Routine leider immer noch nicht messbare biliäre Leistung sowie das Mikrobiom entscheidend mitspielen. Lauchgewächse, Leguminosen und die meisten Kohlsorten zählen sicherlich dazu.
• Neben dem, was gegessen wird, ist auch das Wie zu thematisieren:
- ausreichend Zeit zum Kauen und Einspeicheln,
- nicht zu heiße und nicht zu kalte Speisen und Getränke,
- Frequenz und Tageszeit der Mahlzeiten,
- prokinetischer Effekt, z. B. durch Kaffee oder Nikotin,
- i .d. R. hypokinetische Effekte durch Alkohol.
Verträglichkeitskriterien für Speisen in Hinblick auf das Verdauungssystem lassen sich generell nicht quantifizieren. Man wird sich deshalb noch für lange Zeit mit grundsätzlich plausiblen Maßnahmen begnügen müssen:
• höhere Anteile schonend und werterhaltend erhitzter Kost,
• höhere Mahlzeitenfrequenz, entsprechend kleinere Portionen,
• ggf. mehr Küchenkräuter und Gewürze, die Verdauungssekrete stimulieren können,
• weitestgehend naturbelassene Lebensmittel aus hochwertiger Produktion. Teile dieser Empfehlungen sind auch Bestandteil der Diagnostik und Therapie nach F. X. Mayr, die insbesondere in Österreich vertreten ist (Dr. Franz Xaver Mayr, 1897-1965).4 Mayr konnte das Konzept RDS noch nicht kennen, beschreibt aber ganz ähnliche Patienten. Neben verschiedenen Fastenfor-
men hat sein erster Schüler, Dr. Erich Rauch, 1965 das Konzept der „m ilden Ableitungsdiät“ formuliert, das stetig weiterentwickelt wurde.5 Hierbei nutzt der Mayr-Arzt eine Art Baukasten, aus dem er gezielt Patienten beraten kann und dabei weitere – sogenannte konstitutionelle – Aspekte berücksichtigt.
Diätetische Veränderungen auf Dauer können durch ärztliche oder ernährungstherapeutische Beratung nur angestoßen werden. Das Hauptproblem auch der besten in Studien geprüften Konzepte bleibt die Compliance. Diese lässt sich nur durch den Patienten garantieren, also mittels des vielzitierten Prinzips der Selbstwirksamkeit. Wie bei den meisten chronischen Krankheiten haben sich aber auch beim RDS nationale Selbsthilfegruppen etabliert, an die man Patienten verweisen kann, etwa die Österreichische Patienteninitiative Reizdarm (ÖPRD) oder die Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V. In der Schweiz gibt es mit der Magendarmliga Schweiz eine professionelle patientenorientierte Organisation. Abzuwarten bleibt, ob Inzidenz und mittlere Symptombelastung des bislang noch aggravierenden RDS sich mit zu erwartenden Änderungen des Ernährungsverhaltens in den westlichen Ländern senken lassen. Dazu könnten obligatorische Produktinformationen, die z. B. den Gehalt an Fruktose einbeziehen, oder gar gesetzliche Einschränkungen ihrer Hinzufügung zu Lebensmitteln beitragen.
Vorschau: Im dritten Teil der Serie RDS stehen Lebensmittelunverträglichkeiten wie die Laktose- und die Fruktoseintoleranz im Fokus.
Literatur:
1 Gupta SN, Stapelfeldt E, Ayurveda-Medizin: kayacikitsa – Therapiekonzepte für innere Erkrankungen. Thieme, Stuttgart, 3. aktualisierte Auflage 2019.
2 Jeitler M et al., Ayurvedic vs. Conventional Nutritional Therapy Including Low-FODMAP Diet for Patients With Irritable Bowel Syndrome-A Randomized Controlled Trial. doi: 10.3389/fmed.2021.622029.

3 Stange R, Ernährungstherapie bei Reizdarm und Dyspepsie. Beim Essen zählt nicht nur das Was, sondern auch das Wie. doi: 10.1007/BF03364562. PMID: 16529360.
4 Mayr FX, Fundamente zur Diagnostik der Verdauungskrankheiten. Nachdruck. Bietigheim,1998.
5 Witasek A, Lehrbuch der F. X. Mayr-Medizin: Grundlagen, Diagnostik und Therapie. Springer, 2019. Weitere Literatur beim Autor.
Unterstützt von Dr. Böhm®
Fünf
Arthrose, der sogenannte „Gelenkverschleiß“, betrifft mit zunehmendem Alter einen großen Teil der Bevölkerung. Übergewicht, mangelnde Bewegung oder Verletzungen begünstigen die Entstehung. Die Einnahme von Makromolekülen wie Glucosamin, Chondroitin, Hyaluronsäure, Kollagen vom Typ II und auch Schwefel in Form von Methylsulfonylmethan (MSM) hat, wie Studien belegen, einen vorteilhaften Effekt für die Gelenkknorpel. Vor allem die Kombination dieser Gelenksbausteine ist dabei aufgrund ihrer synergistischen Wirkung zu bevorzugen. Darüber hinaus sind diese fünf Substanzen wesentliche Bestandteile der Knochenmatrix. Entsprechend neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse könnte somit auch ein Einsatz in der Osteoporoseprophylaxe sinnvoll sein.

Durch viele Faktoren kommt es im Laufe des Lebens zu Abnützungserscheinungen der Gelenke. Im Volksmund spricht man gerne von "Gelenkverschleiß" während Fachkreise den Terminus Arthrose verwenden. Darunter versteht man eine langsam fortschreitende, degenerative Erkrankung der perpheren
Gelenke.1 Eine Analyse in Österreich hat ergeben, dass ab etwa 70 Jahren bereits jeder dritte Mann und jede zweite Frau in irgendeiner Form betroffen ist.2 Arthrose wird in unterschiedliche Schweregrade der Abnützung eingeteilt (Abb. 1). Doch was passiert genau? Ein Abbau der schützenden Knorpelschicht zwischen den Gelenkflächen verschmälert den Gelenkspalt. Mit der Zeit berühren sich dadurch die Knochen und reiben bei Be-
wegung direkt aneinander. Das Abriebmaterial von Knorpel und Knochen ruft ein Entzündungsgeschehen hervor und begünstigt letztlich auch die Bildung von Verknöcherungen an den Gelenkflächen, den sogenannten Osteophyten. Das Gelenk schmerzt, schwillt an und wird zudem immer unbeweglicher.3
Der Gelenkknorpel ist ein Bindegewebe, das grundsätzlich aus einer Matrix und zellulären Bestandteilen aufgebaut ist, den Chondroblasten und Chondrozyten. Sie sind für die Synthese der Matrixbestandteile verantwortlich und bilden somit die kollagenen Fasern (Kollagen Typ II), Proteoglykane, Glykosamin-
glykane (Chondroitin, Hyaluronsäure, Keratan) sowie nicht-kollagenen Proteine (Abb. 2). Diese Stoffe sind wesentliche Strukturbausteine und können sehr viel Wasser binden (60 - 80 % der Gesamtmatrix), eine Fähigkeit, die von immenser Bedeutung für die Gelenkfunktion ist. Durch diese Wasserbindung übersteht der Knorpel Millionen von Belastungszyklen ohne sich abzunützen.1 Die kollagenen Fasern des Gelenkknorpels bestehen, wie die Bezeichnung vermuten lässt, aus Kollagen, genauer aus Kollagen vom Typ II. Diesen Typus II findet man vorwiegend in Geweben an, die regelmäßig Belastungen in Form von Kompressionen unterliegen während andere Kollagentypen in diesen Geweben nur in sehr geringem Ausmaß vorkommen und nicht von Bedeutung sind.4 Wird der Knorpel regelmäßig belastet, wird auch die Kollagenbildung gesteigert.5 Kollagenfasern verleihen dem Gelenk Stabilität, Zugfestigkeit sowie Elastizität.6 Verantwortlich für die Faserbildung ist das sogenannte Crosslinking bzw. die Quervernetzung der einzelnen Kollagenmoleküle untereinander.6

Hyaluronsäure ist physiologisch betrachtet das „Schmiermittel“ der Gelenke. Sie reduziert Druck und Reibung, indem sie die Viskosität der Gelenkflüssigkeit erhöht.5,7 An die Hyaluron
Proteoglykane gebunden. Diese Proteoglykane sind ihrerseits aufgebaut wie Flaschenbürsten, bestehend aus einer Proteinkette und Verzweigungen verschiedener Glykosaminglykane (Chondroitinsulfat und Keratansulfat).4 Vor allem Chondroitin zeichnet sich durch seine hohe Wasserbindungskapazität aus, welche für die Elastizität und Druckfestigkeit des Knorpels wesentlich ist. Außerdem hemmt es knorpelabbauende Prozesse, genauer gesagt wird das Absterben von Chondrozyten vermindert und so der Knorpelgewebsverlust reduziert.8,9 Zusätzlich unterstützt Chondroitin den Knorpel bei seiner Regeneration8, hemmt entzündliches Geschehen in den Gelenken10 und erhöht die Hyaluronsäureproduktion.8
Der Aminozucker Glucosamin repräsentiert einen wesentlichen Grund- und Strukturbaustein des Knorpels wie auch der Gelenkflüssigkeit. Es ist essenziell für die Bildung der Proteoglykane, sowie Chondroitin und Hyaluronsäure.6,11 Weniger bekannt ist, dass auch Schwefel ein wichtiger Bestandteil von Knorpeln und Bändern, aber auch der Knochen ist. Denn es sind Disulfidbrücken über die Glucosamin, Chondroitin und Kollagen miteinder vernetzt werden.12
Auf diese Weise werden die Funktion des Knorpels sowie die Beweglich
sert und die Knorpelzellen geschützt.13 Werden diese Gelenkbausteine regelmäßig zugeführt, sind die Zellen in der Lage weiterhin dieses komplexe Maschwerk sowie die Gelenkschmiere zu erhalten. Somit gewährleisten sie die Funktionalität der Gelenke.14,15
Glucosamin und Chondroitin

In einer Langzeitstudie über drei Jahre wurde der Effekt von oral verabreichtem Glucosaminsulfat (1500 mg/d) gegen Placebo verglichen. Bei den 212 Teilnehmern, welche an einer Kniearthrose litten, konnte am Ende des Beobachtungszeitraumes deutlich gezeigt werden, dass in der Verumgruppe um die Hälfte weniger Verschlechterungen der Arthrose (Gelenkspaltverschmälerungen) im Vergleich zur Placebogruppe aufgetreten sind.16 Häufig wird auch die Frage nach der idealen GlucosaminSalzform gestellt.
In einer weiteren groß angelegten Studie mit 1120 Teilnehmern wurde diese beantwortet, indem entweder 500 mg Glucosaminsulfat oder 500 mg Glucosaminhydrochlorid in Kombination mit 400 mg Chondroitinsulfat für 16 Wochen verabreicht wurden. Die For
mit dem Hydrochlorid eine signifikante (p < 0,001) Reduktion der Schmerzen bewirken konnte. Unterschiede zwischen den Salzformen wurden dabei nicht festgestellt. Ebenso ist zu erwähnen, dass sich die Kombination aus Glucosamin und Chondroitin sehr vorteilhaft auf die arthrotischen Beschwerden ausgewirkt hat.17
In zwei anderen Arbeiten wird der Effekt von Chondroitin bzw. von der Kombination Chondroitin und Glucosamin gegen Celecoxib verglichen. In einer placebokontrollierten Studie mit 604 Patienten mit Kniearthrose war die Anwendung von täglich 800 mg Chondroitinsulfat über sechs Monate hinsichtlich Schmerzen und Verbesserung der Gelenkfunktion gleich wirksam wie eine Therapie mit 200 mg Celecoxib. Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Verumgruppen (p = 0,446). Jedoch sehr wohl signifikant war der Effekt der Verumgruppen gegen die Placebogruppe (p = 0,001).18
Ebenso konnte in einer anderen Studie eine deutliche Verminderung der Schmerzen durch die Kombination von täglich 1200 mg Chondroitinsulfat und 1500 mg Glucosaminhydrochlorid als auch durch 200 mg Celecoxib über ein halbes Jahr erreicht werden (Abb. 3). Auch diese Forschungsgruppe fand keine statistisch relevanten Differenzen zwischen den beiden Verumgruppen (p = 0,92).19
In der Kosmetik und auch als Injektionen für die Gelenke ist Hyaluronsäure schon lange bekannt. Manchmal treten Bedenken auf, ob Hyaluronsäure auch oral bioverfügbar ist. Genau diese Thematik wurde in einer Tierstudie behandelt. Durch Szintigraphie (ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin) konnte anschaulich die Biodistribution von Hyaluronsäure in einer Ratte gezeigt werden (Abb. 4).
Kollagen Typ II
Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig auf den richtigen Kollagentyp zu achten. Mehrere klinische Studien mit standardisiertem Kollagen Typ II beleuchteten das Thema Gelenkarthrose und Beweglichkeit. Zwei Arbeiten weisen auf einen schmerzreduzierenden Effekt von Kollagen Typ II hin. In einer Anwendungsbeobachtung mit 226 Kniearthrose-Patienten erhielten die Teilnehmer 90 Tage lang standardisiertes Kollagen Typ II. Es kam zu einer signifikanten (p < 0,001) Reduktion der Schmerzen, Gelenksteifigkeit und von Bewegungseinschränkungen (Abb. 6). Die Teilnehmer berichteten zudem von einer Verbesserung der Lebensqualität.21
Abb. 3: Die schmerzlindernde Wirkung von Chondroitin und Glucosamin (CS = 1200 mg/d, GH = 1500 mg/d) ist vergleichbar mit der von Celecoxib (200 mg/d).19
So wurde die Hyaluronsäure-Anreicherung in Knorpel, Gelenken und auch Muskeln sichtbar und verweist auf die orale Bioverfügbarkeit.20 Auch der Nutzen von Hyaluronsäure bei Arthrose wurde in einer Studie gezeigt. Für 90 Tage erhielten 68 Arthrosepatienten mit Knieschmerzen oral 52 mg Hyaluronsäure oder ein Placebo. In der Hyaluronsäuregruppe kam es zu signifikanten (p < 0,001) Verbesserungen der Schmerzen (Abb. 5) und zu einer Minderung der Kniegelenkergüsse (Ultraschall-Messung) im Vergleich zu Placebo (p < 0,05).7

Ebenso konnte eine signifikante (p < 0,05) Besserung der Schmerzen und Gelenkfunktion bei den Studienteilnehmern mit Kniearthrose festgestellt werden, welche für drei Monate mit einer Kombination aus 1500 mg Paracetamol und 10 mg standardisiertem Kollagen Typ II pro Tag behandelt wurden (n=20). Die Vergleichsgruppe, welche nur Paracetamol erhielt, zeigte diese Verbesserung nicht (n=19).22 Eine Studie mit 27 Teilnehmern zeigte eine signifikant (p < 0,05) verbesserte Beweglichkeit bei Streckund Beugebewegungen, sowie eine verlängerte Fähigkeit Treppen zu steigen. Das Studiendesign ist besonders interessant, da es sich um gesunde Probanden handelte, welche für 120 Tage 40 mg Kollagen Typ II oder Placebo erhielten.23
Methylsulfonylmethan (MSM) Physiologischer, organisch-gebundener Schwefel unterstützt, wie im Folgenden
beschrieben, nachweislich den Gelenkund Knorpelstoffwechsel. In einer placebokontrollierten klinischen Studie mit 147 Patienten wurde untersucht, ob der Zusatz von 500 mg MSM zu einer Kombination bestehend aus 1500 mg Glucosamin und 1200 mg Chondroitinsulfat zu einer weiteren Verbesserung bei Kniearthrose-Patienten führt. Es zeigte sich, dass die Dreierkombination im Vergleich zu der Placebogruppe die Schmerzen signifikant (p = 0,01) reduzierte (Abb. 7) und diese Effekte durch MSM noch rascher und deutlicher waren.24
Typ II vor. Bei den im Handel erhältlichen Kollagenhydrolysaten gibt es erhebliche Unterschiede in Qualität, Zusammensetzung und Wirksamkeit. Hochwertige, native Kollagenhydrolysate sind auf den darin enthaltenen Kollagentyp (I oder II) standardisiert, während es sich bei minderwertigen Kollagenhydrolysaten um einen Mix aus Eiweißen unbekannter Zusammensetzung, Reinheit und Herkunft handelt. Billig hergestellte, nicht standardisierte Kollagenhydrolysate ähneln in ihrer Struktur der Gelatine, bei der weder Kollagentyp noch Gehalt bekannt sind.
Aufgrund der chemischen Struktur und Eigenschaften des standardisierten, nativen Typ II Kollagens sind bereits wenige Milligramm ausreichend. Hingegen kommen bei nicht näher definierten, minderwertigen Kollagenhydrolysaten (unspezifische Peptidgemische) oft mehrere Gramm zum Einsatz.
gezeigt werden, dass durch die Gabe von Chondroitinsulfat eine bestehende diabetische Osteoporose positiv beeinflusst wird. Im Detail zeigte sich eine Verbesserung der Knochenmikrostruktur und des Knochenmetabolismus.26 Auch zu MSM gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die aufzeigen wie der organisch gebundene Schwefel die Osteoblasten-Differenzierung aus mesenchymalen Stammzellen stimuliert.27 Während Glucosamin wiederum die Osteoblastenproliferation begünstigt 28 und Hyaluronsäure auf unterschiedliche Weise positiv auf die Knochenstruktur wirkt.29 Nicht zuletzt konnte auch Kollagen vom Typ II im Mausmodell eine relevante Funktion zuerkannt werden, denn es verbesserte sich die Knochenalterung bei gleichzeitig weniger Knochenschäden.30
Abb. 7: Glucosamin (G) und Chondroitinsulfat (C) kombiniert mit MSM führen zu einer Besserung von arthrosebedingten Beschwerden im Vergleich zur Placebogruppe.24
Es ist sehr wichtig, den richtigen Kollagentyp für das jeweilige Anwendungsgebiet zu nutzen. In den Gelenken und Knorpeln kommt hauptsächlich Kollagen
Neben mineralischen Komponenten finden sich im Knochen gleich wie im Knorpel Proteo- und Glycosaminoglykane als Strukturbausteine wieder.5,6,25 Zahlreiche Studien weisen auf nützliche Effekte der oben beschriebenen Stoffe hinsichtlich Knochengesundheit hin. So konnte in einem Rattenmodell
Glucosamin, Chondroitin, Hyaluronsäure, Kollagen Typ II & Schwefel als Kombination sind für den Erhalt des Gelenkknorpels und der Gelenkfunktion vorteilhaft. Auch sind sie als Bestandteile des Knochens aus wissenschaftlicher Sicht für den Einsatz im Bereich Osteoporose interessant.
References: 1 Vaupel P et al. Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen: 158 Tabellen. 7th edn. Stuttgart: WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2015.; 2 Dorner TE, Stein KV. Prevalence and status quo of osteoarthritis in Austria. Analysis of epidemiological and social determinants of health in a representative cross-sectional survey. Wien Med Wochenschr 2013; 163 (9-10): 206–11.; 3 Bronner F, ed. Bone and Osteoarthritis. London: Springer-Verlag London Limited, 2007.; 4 N.N. Das Bindegewebe des Bewegungsapparates verstehen und beeinflussen. 2nd edn. Stuttgart: THIEME, 2003.; 5 Spornitz UM. Anatomie und Physiologie: Arbeitsbuch ; für Pflege- und Gesundheitsfachberufe. s.l.: Springer-Verlag, 2009.; 6 Lüllmann-Rauch R, Asan E. Taschenlehrbuch Histologie. 6th edn. Stuttgart: THIEME, 2019.; 7 Sánchez J et al. Blood cells transcriptomics as source of potential biomarkers of articular health improvement: Effects of oral intake of a rooster combs extract rich in hyaluronic acid. Genes Nutr 2014; 9 (5): 55.; 8 Jerosch J. Effects of Glucosamine and Chondroitin Sulfate on Cartilage Metabolism in OA: Outlook on Other Nutrient Partners Especially Omega-3 Fatty Acids. International Journal of Rheumatology 2011; 2011 (3): 1–17.; 9 Lippiello L. Glucosamine and chondroitin sulfate: Biological response modifiers of chondrocytes under simulated conditions of joint stress. Osteoarthritis and Cartilage 2003; 11 (5): 335–42.; 10 Tio L et al. Effect of chondroitin sulphate on synovitis of knee osteoarthritic patients. Med Clin (Barc) 2017; 149 (1): 9–16.; 11 Matheson AJ, Perry CM. Glucosamine. Drugs Aging 2003; 20 (14): 1041–60.; 12 Bötsch K. Funktionelle Anatomie des Gelenkknorpels: eine Literaturstudie. München: Ludwig-Maximilians-Universität München, 2007. Dissertation.; 13 Butawan M et al. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients 2017; 9 (3): 290.; 14 Fresenius M et al. Physiotherapie in der Traumatologie/Chirurgie. 4th edn. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag, 2016.; 15 Schünke M. Funktionelle Anatomie: Topographie und Funktion des Bewegungssystems. Stuttgart: THIEME, 2000.; 16 Reginster JY et al. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001; 357 (9252): 251–6.; 17 Provenza JR et al. Combined glucosamine and chondroitin sulfate, once or three times daily, provides clinically relevant analgesia in knee osteoarthritis. Clin Rheumatol 2015; 34 (8): 1455–62.; 18 Reginster J-Y et al. Pharmaceutical-grade Chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: The ChONdroitin versus CElecoxib versus Placebo Trial (CONCEPT). Ann Rheum Dis 2017.; 19 Hochberg MC et al. Combined chondroitin sulfate and glucosamine for painful knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority trial versus celecoxib. Ann Rheum Dis 2015.; 20 Balogh L et al. Absorption, uptake and tissue affinity of high-molecular-weight hyaluronan after oral administration in rats and dogs. J Agric Food Chem 2008; 56 (22): 10582–93.; 21 Mehra A et al. A non-interventional, prospective, multicentric real life Indian study to assess safety and effectiveness of un-denatured type 2 collagen in management of osteoarthritis. Int J Res Orthop 2019; 5 (2): 315.; 22 Bakilan F et al. Effects of Native Type II Collagen Treatment on Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial. Eurasian J Med 2016; 48 (2): 95–101.; 23 Lugo JP et al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: A randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr 2013; 10 (1): 48.; 24 Lubis AMT et al. Comparison of Glucosamine-Chondroitin Sulfate with and without Methylsulfonylmethane in Grade I-II Knee Osteoarthritis: A Double Blind Randomized Controlled Trial. Acta Med Indones 2017; 49 (2): 105–11.; 25 Bilezikian JP, Raisz LG, Rodan GA, eds. Principles of bone biology. 2nd edn. San Diego: Academic Press, 2002.; 26 Qi SS et al. Chondroitin Sulfate Alleviates Diabetic Osteoporosis and Repairs Bone Microstructure via Anti-Oxidation, Anti-Inflammation, and Regulating Bone Metabolism. Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 759843.; 27 Kim DN et al. Methylsulfonylmethane enhances BMP-2-induced osteoblast differentiation in mesenchymal stem cells. Mol Med Rep 2016; 14 (1): 460–6.; 28 Lv C et al. Glucosamine promotes osteoblast proliferation by modulating autophagy via the mammalian target of rapamycin pathway. Biomed Pharmacother 2018; 99: 271–7.; 29 Zhai P et al. The application of hyaluronic acid in bone regeneration. Int J Biol Macromol 2020; 151: 1224–39.; 30 Fan R et al. Native Collagen II Relieves Bone Impairment through Improving Inflammation and Oxidative Stress in Ageing db/db Mice. Molecules 2021; 26 (16).
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail: science@apomedica.com
SECHS MARKENZEICHEN FÜR QUALITÄT:
y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc Wartezimmer TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0
www.y-doc.at
© shutterstock.com/Kat
Über die Inzidenz und Prävalenz der Skabiesinfektionen liegen zwar keine genauen Daten vor, jedoch lassen verschiedene Untersuchungen auf eine Zunahme trotz „social distancing“ in der Pandemie schließen. In Europa ist die „K rätze“ seit Jahrhunderten bekannt. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) gehört sie zu den verbreiteteren Infektionskrankheiten. „ Es gibt mehrere Indizien, die für eine Zunahme des Skabies sprechen“, bestätigt Prof. Dr. Cord Sunderkötter, Direktor der Uni- und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie Halle, in einer Aussendung. Dafür verantwortlich seien vermutlich unterschiedliche, ineinandergreifende Faktoren.
Der Befall der Haut mit der Milbe Sarcoptes scabiei verursacht intensiv juckende Läsionen mit erythematösen Papeln und Gängen an charakteristischen Stellen wie in den Interdigitalräumen, an Handgelenken, Taille und Genitalien. Zu einer erfolgreichen Behandlung gehören eine umfassende Beratung der Erkrankten sowie das Identifizieren und Mitbehandeln enger Kontaktpersonen. Auch wenn eine Skabiesinfektion kein medizinischer Notfall ist, so ist doch ein rasches Handeln essenziell. Gut wäre eine licht- oder auflichtmikroskopisch gesicherte Diagnose. Auch für erfahrene Dermatologinnen und Dermatologen sei die Diagnostik herausfordernd, betont Prof. Sunderkötter. Zur Behandlung werden topische Skabizide oder seltener Ivermectin eingesetzt. Die zugelassenen Arzneimittel sind meist äußerlich in Cremeform auf der gesamten Haut anzuwenden. „ Es gibt Belege, dass ein ausbleibender Therapieerfolg in Wahrheit Ergebnis einer fehlerhaften Anwendung ist“, gibt der Experte zu bedenken.
Der oder dem Erkrankten müssten zu Therapiebeginn die genaue Anwendung der verordneten Creme und mögliche Fehler erklärt werden. So sei die Einwirkzeit manchmal zu kurz, Hautbereiche würden ausgespart oder die Fingernägel nicht wie empfohlen gekürzt. Vor allem Kinder werden häufiger unzureichend behandelt und sind aufgrund der bei ihnen auftretenden Milbendichte und der höheren Prävalenz eine unterschätzte Infektionsquelle. Da sich die Milben noch bis zu 36 Stunden nach Behandlungsbeginn bewegen können, gilt es, Körperkontakte in dieser Zeit zu vermeiden.

Quelle: idw/Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG).

Sabine Burger, Fachärztin für Hämatologie und Onkologie. Die interdisziplinäre Betreuung umfasst u. a. regelmäßige medizinische Kontrollen und Untersuchungen, um Folgen der Vorerkrankungen möglichst früh zu erkennen und zu behandeln. Dem interdisziplinären Team gehören auch zwei klinische Psychologinnen und eine speziell ausgebildete Sozialarbeiterin an.
Seit der Eröffnung der interdisziplinären onkologischen Nachsorgeambulanz IONA im ÖGK-Gesundheitszentrum Mariahilf im Frühsommer 2020 werden fast 500 Patientinnen und Patienten, die im Kindes- oder Jugendalter von einer Krebserkrankung betroffen waren, langfristig nachbetreut. Aufgrund der positiven Erfahrungen und des Bedarfs haben die Stadt Wien und die Österreichische Gesundheitskasse das gemeinsame Pilotprojekt nun bis zumindest Ende 2023 verlängert. Die Patientinnen und Patienten werden überwiegend vom St. Anna Kinderspital und vom AKH direkt übernommen, wodurch eine kontinuierliche Betreuung garantiert ist. „ Zuvor kamen sie meist über viele Jahre für die Nachsorge in ,ihr Kinderspital‘, wollten aber verständlicherweise nicht das ganze Leben auf dem Kindersessel sitzen“, erklärte Prim. Univ.-Prof. Dr. Felix Keil, Leiter der Hämato-Onkologischen Abteilung des Hanusch-Krankenhauses, bei einem Pressegespräch im Gesundheitszentrum Mariahilf die Hintergründe. „Wir wollten eine erfolgreiche Schnittstellenversorgung von Tumorpatienten vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter aufbauen, und das ist uns mit der IONA gelungen “ Von Beginn an wurde das Projekt durch die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe und die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD unterstützt.


Betroffenen wird eine altersgerechte medizinische und psychosoziale Langzeitnachsorge geboten. Damit soll der von Seiten der betreuenden Spitäler und der Selbsthilfegruppen geäußerte Wunsch nach einer interdisziplinären Nachsorge außerhalb des Spitalswesens in der Bundeshauptstadt erfüllt werden. „ Der über die Jahrzehnte immer drängender gewordene Bedarf an einer medizinischen und psychosozialen Versorgung der geheilten Patientinnen und Patienten im Erwachsenenalter kann somit endlich gedeckt werden“, bestätigte Prof. Dr. Wolfgang Holter, Kinderonkologe und Ärztlicher Direktor des St. Anna Kinderspitals. Geleitet wird die Transitionsambulanz in Rotation von OÄ PD Dr.in Alexandra Böhm, Internistin mit hämatoonkologischer Spezialausbildung, sowie von Dr.in
„Wir hatten ja keine Vorzeigemodelle, an denen wir uns orientieren konnten“, schilderte OÄ Böhm eine der Herausforderungen rund um die praktische Umsetzung der Ambulanz. „ Der Erfolg von IONA ist sicher den Tatsachen zu verdanken, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt haben und dass wir das Konzept ständig optimieren.“ Dabei gehe es beispielsweise um die Vernetzung mit anderen Fachrichtungen oder um die Qualität der Versorgung. „IONA ist ein kleines Projekt, aber wir haben Großartiges geleistet und sind Vorreiter im deutschsprachigen Raum“, so die Expertin. „ Es hat international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen!“ Die Ambulanz sei auf Nachhaltigkeit ausgelegt und man sei natürlich froh und dankbar, wenn sie weiter finanziert wird.
„Die Idee und die Ausführung des Projekts sind grandios, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Versorgung nachhaltig etablieren können“, versprach Mario Ferrari, ÖGK-Landesstellenaus-
viel Aufmerksamkeit auf sich© Markus Wache Am Podium (v.l.n.r.): Peter Hacker / Stadt Wien, Mario Ferrari / ÖGK, Prof. Felix Keil / Hanusch-Krankenhaus, Prof. Wolfgang Holter / St. Anna Kinderspital.
schussvorsitzender in Wien. „Uns ist es wichtig, unseren Versicherten in der Phase der Erkrankung und danach die beste medizinische Versorgung zu bieten, das darf beim Übergang ins Erwachsenenalter nicht enden “ Ein großer Vorteil im Gesundheitszentrum Mariahilf sei, dass es ein breites fachärztliches Spektrum biete, das von der Augenheilkunde über die Hämatologie bis hin zur Zahnmedizin reiche. Darüber hinaus seien die ÖGK-Gesundheitszentren eng mit dem hauseigenen Hanusch-Krankenhaus vernetzt. Das ermögliche eine gute Zusammenarbeit zwischen niedergelassenem Bereich, Gesundheitszentren und Spital. „ Die jungen Patientinnen und Patienten profitieren im Rahmen der langfristigen Betreuung von diesem optimalen multiprofessionellen Netzwerk“, zeigte sich Ferrari überzeugt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker liegt das Projekt ebenfalls am Herzen: „Der größte Erfolg dieser Ambulanz ist die Tatsache, dass alle jungen Erwachsenen, die hier eine interdisziplinäre Versorgung auf höchstem Niveau erhalten, auch sehr




zufrieden mit der Betreuung sind“, hielt er fest. „Auch unser Ziel ist es daher, das Versorgungsangebot in der Transitionsambulanz Mariahilf gemeinsam mit der Sozialversicherung langfristig sicherzustellen.“








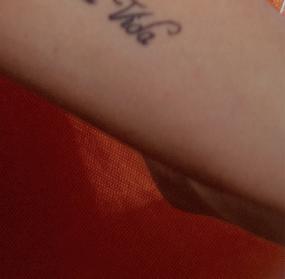

Derzeit laufe IONA als Zielsteuerungsprojekt über die Sonderfinanzierungsschiene, führte Hacker weiter aus. „So gelingen zwar viele winzig kleine ,Lückenschlüsse‘ im Gesundheitssystem. Wir brauchen in Zukunft aber – angesichts der Vielfalt der Patientinnen und Patienten – eine starke Finanzierung vieler solcher Projekte. Sie müssen zur Regel werden und sollten nicht am Rande der großen Finanzierung mitlaufen“, gab er in Anspielung auf die laufenden Finanzverhandlungen fürs Gesundheitswesen zu bedenken. Die ÖGK könne nicht die gesamte Nachsorge im ambulanten Setting stemmen. Dringend notwendig seien daher eine Zusammenführung von extra- und intramuraler Betreuung sowie Ideen, wie die Finanzierung neu aufgestellt werden könne.

Ob IONA auch ein Vorzeigeprojekt für die übrigen Bundesländer sei? – kam abschließend eine Frage aus dem Publikum. Oder ob eine Mitversorgung der anderen Bundesländer angedacht werde? Die Stadt trage in Wien die gesamten Personalkosten, gab Hacker zu bedenken: Patientinnen und Patienten aus ganz Österreich mitzuversorgen, sei nicht leistbar. Und nicht alle Bundesländer hätten die Finanzkraft wie Wien, um eine eigene Ambulanz einzurichten: „Wir brauchen aber in den Bundesländern zumindest ähnliche Strukturen!“



 Mag.a Karin Martin
Mag.a Karin Martin









INFO



IONA – Interdisziplinäre onkologische Nachsorge Ambulanz




Mein Gesundheitszentrum Mariahilf, Mariahilfer Straße 85-87, 1060 Wien.
Ambulanzzeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr, Terminvereinbarung: +43 5 0766-1140679, E-Mail: onkologischenachsorge-mariahilf@oegk.at, Website: gesundheitskasse.at






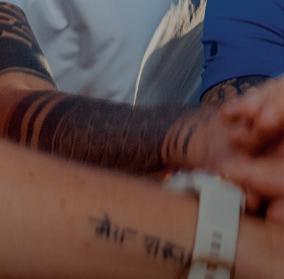




Investieren Sie mit uns in das Wachstum Ihres Unternehmens. Erfolg fängt an, wo man vertraut.
Herausgeber und Medieninhaber:
RegionalMedien Austria Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka, Marcel Toifl.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Helena Valasaki, BA, Angie Kolby.
Cover-Foto: shutterstock.com/Jasmina Buinac.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte bzw. gänzlich orthografisch/grammatikalisch korrekte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden.
Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum
Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.
FÜR WEITERE FRAGEN:
+43 (0) 664 8000 2237
Alexa Ladinser
alexa.ladinser@iqvia.com
+43 (0) 664 8000 2237
Lidia Wojtkowska
medicalindex@iqvia.com
0800 677 026 (kostenlos) weltweit
Weltweite Studie zu indikationsbezogenen Verordnungen!
Sichere und anonyme Datenübermittlung 1x/Quartal.

Flexibler Zugriff auf ein bedienerfreundliches Online-Tool.
120 €
Bis zu 120 € pro Stunde Aufwandsvergütung
Hier scannen um sich zur Teilnahme zu registrieren.





