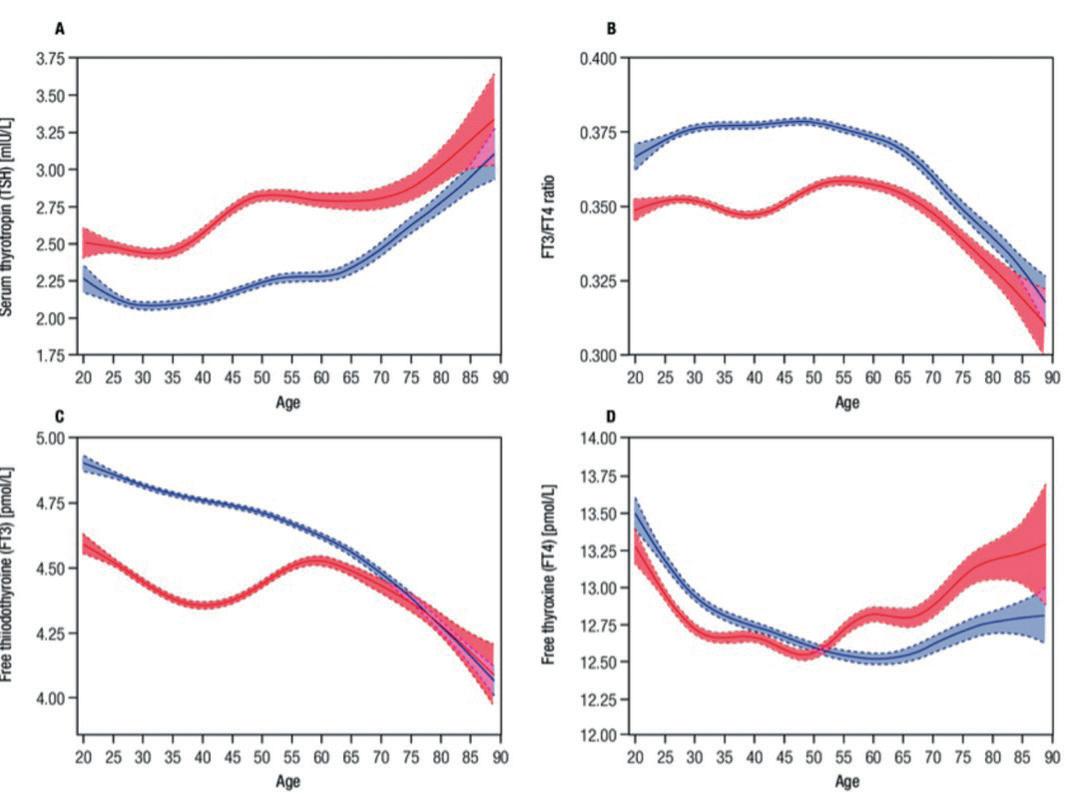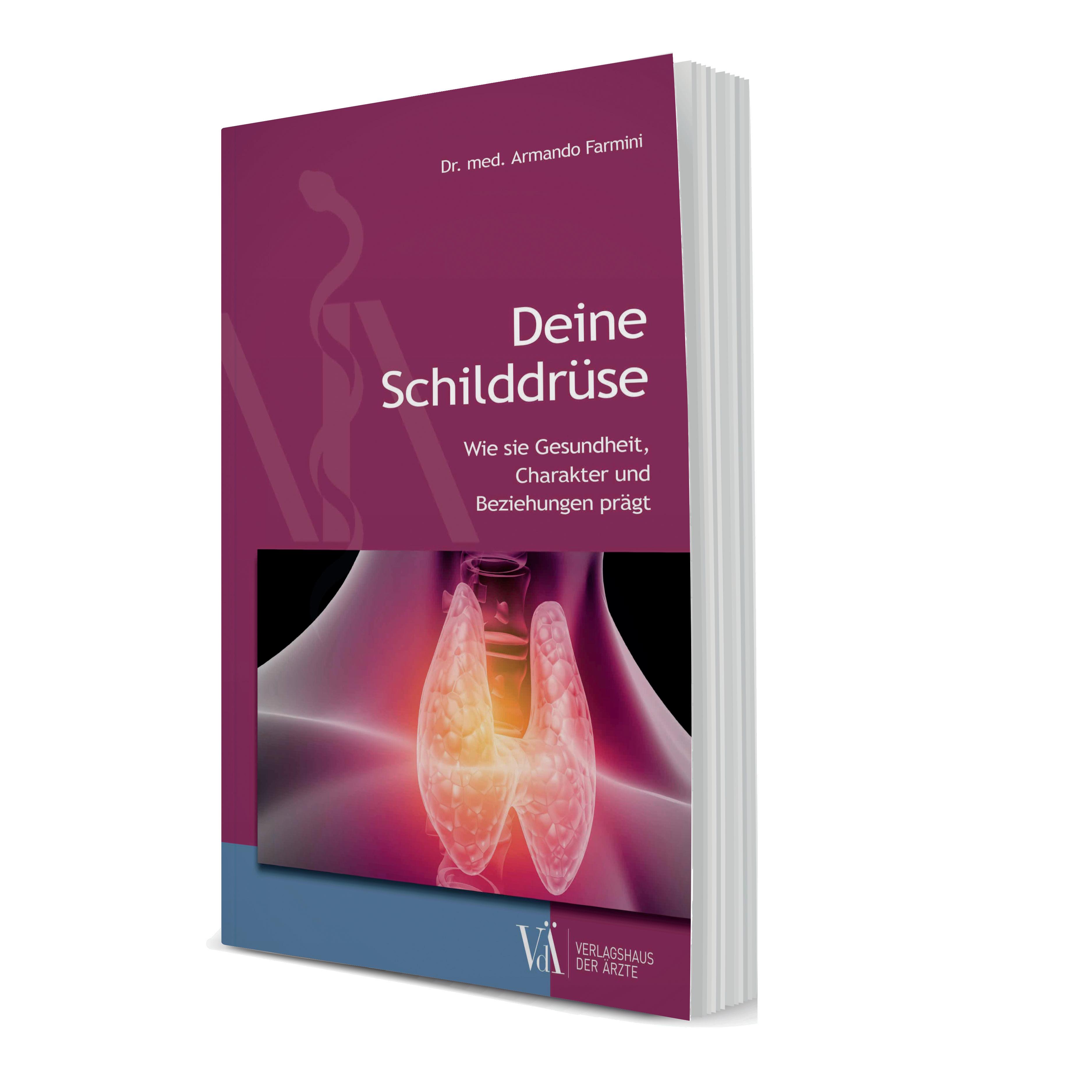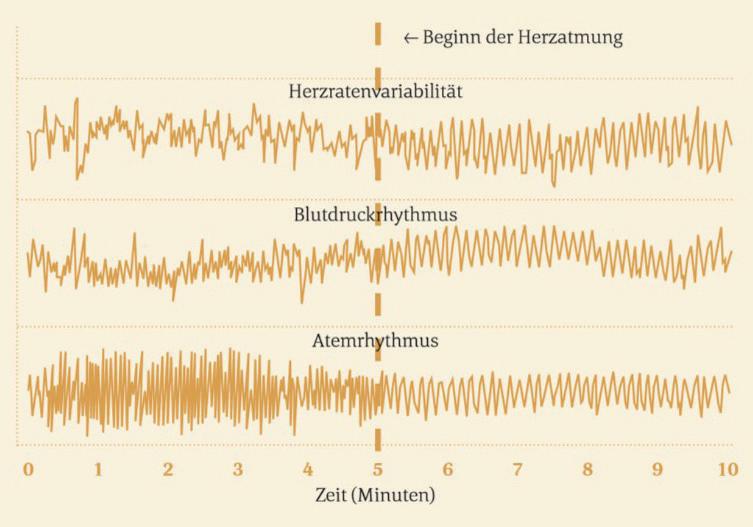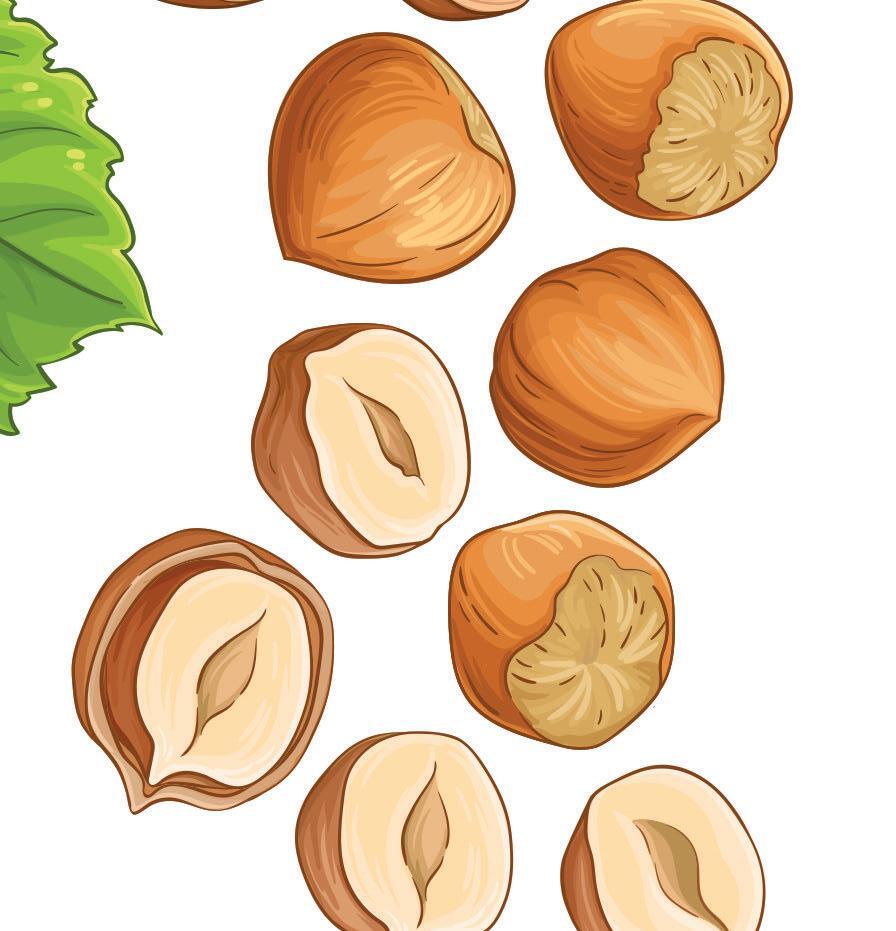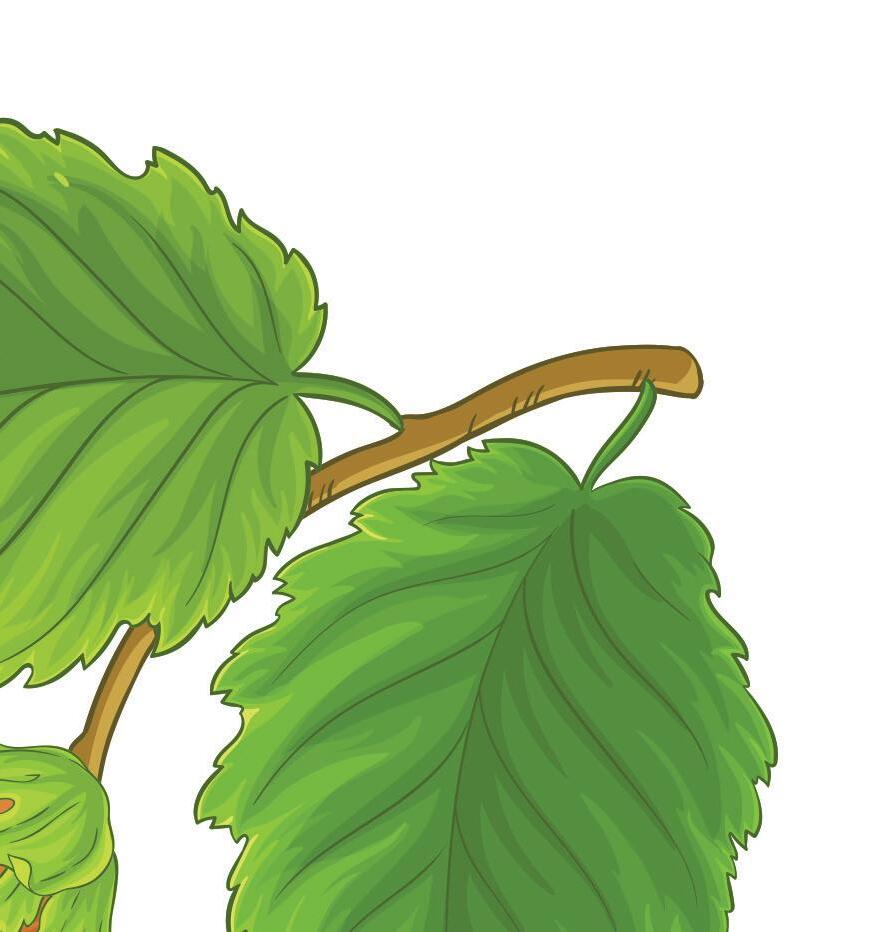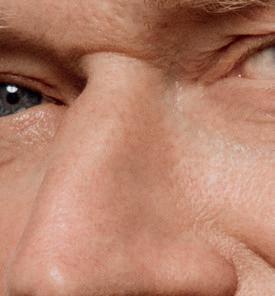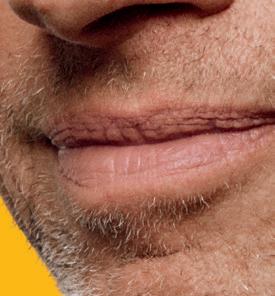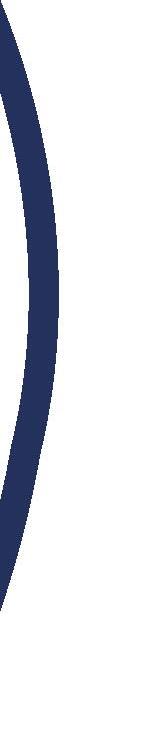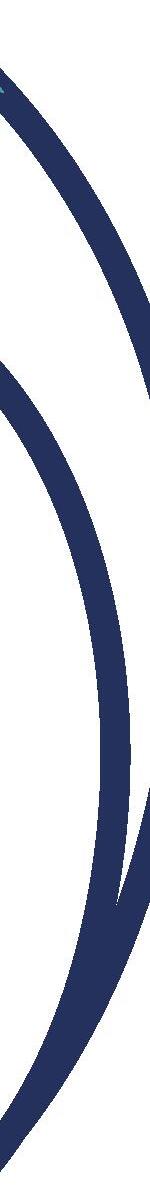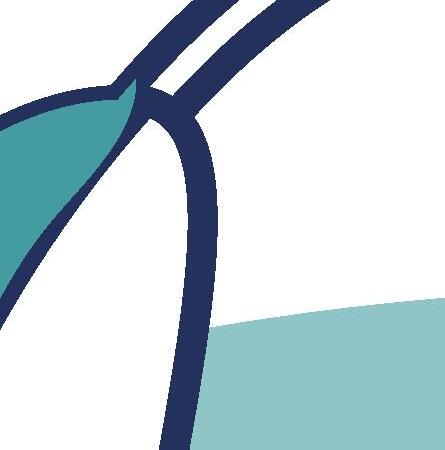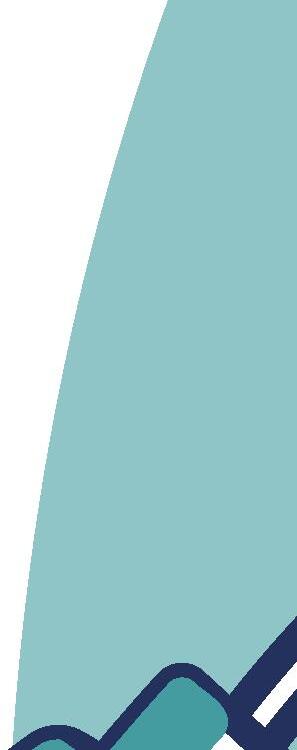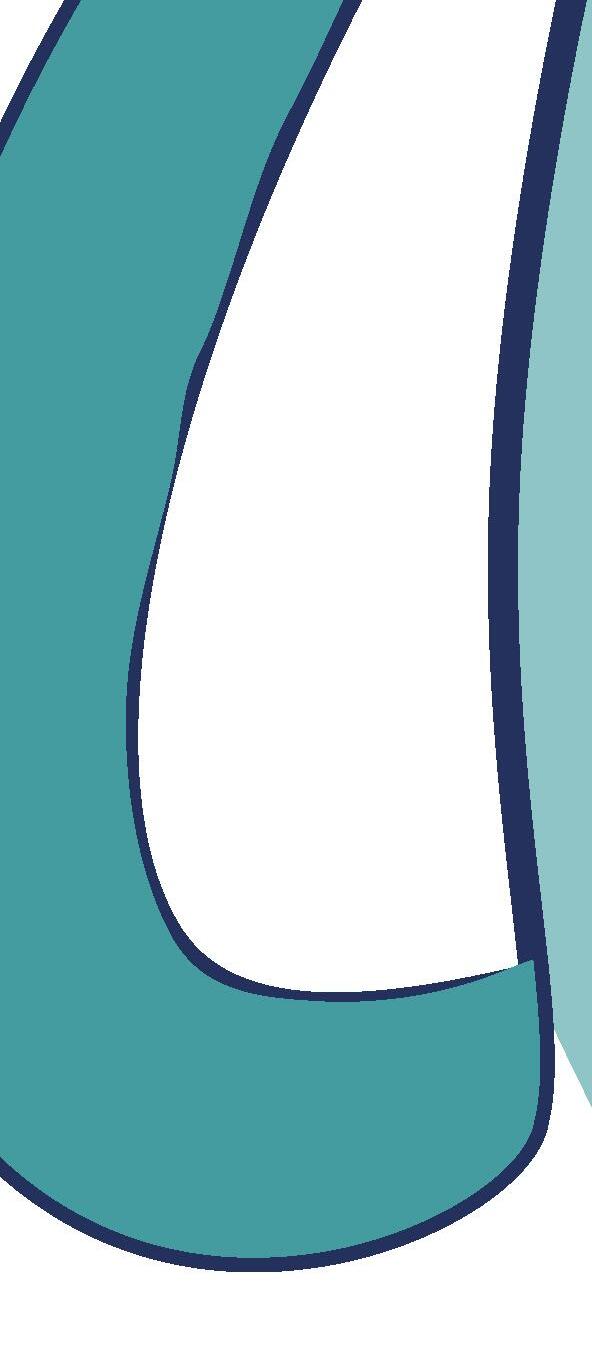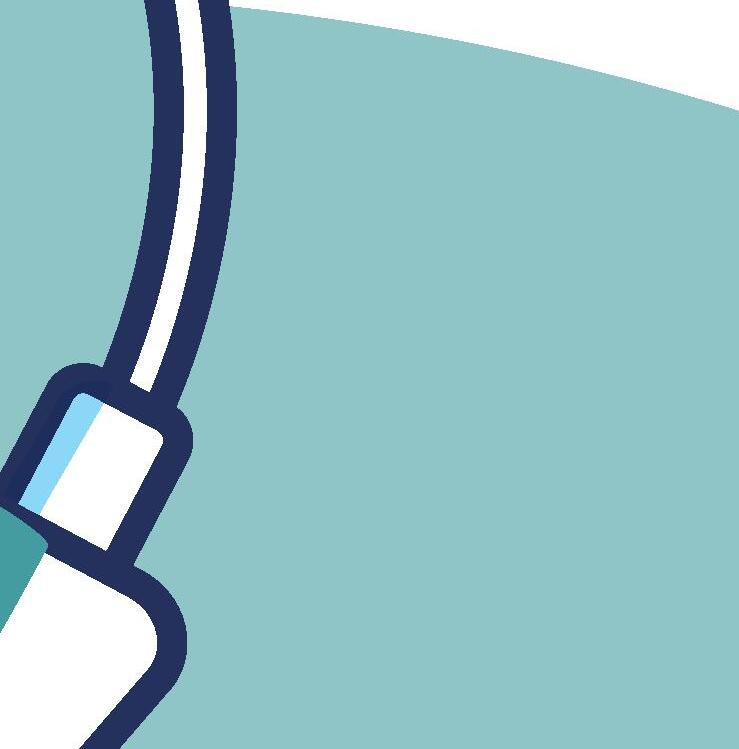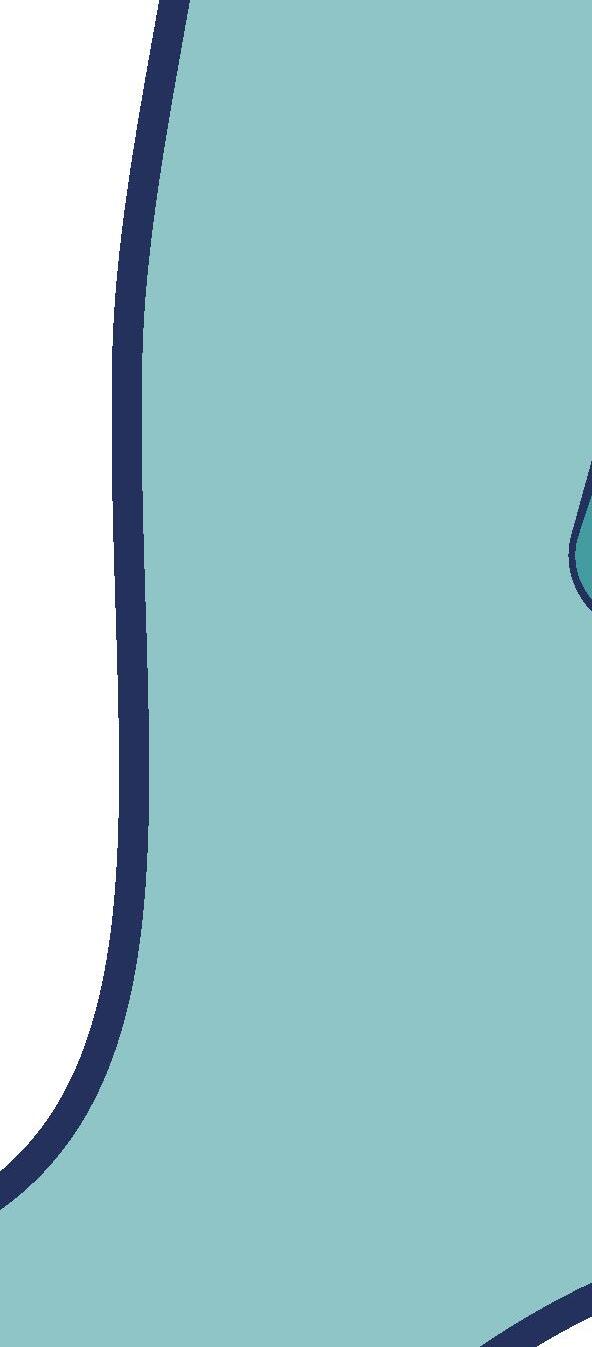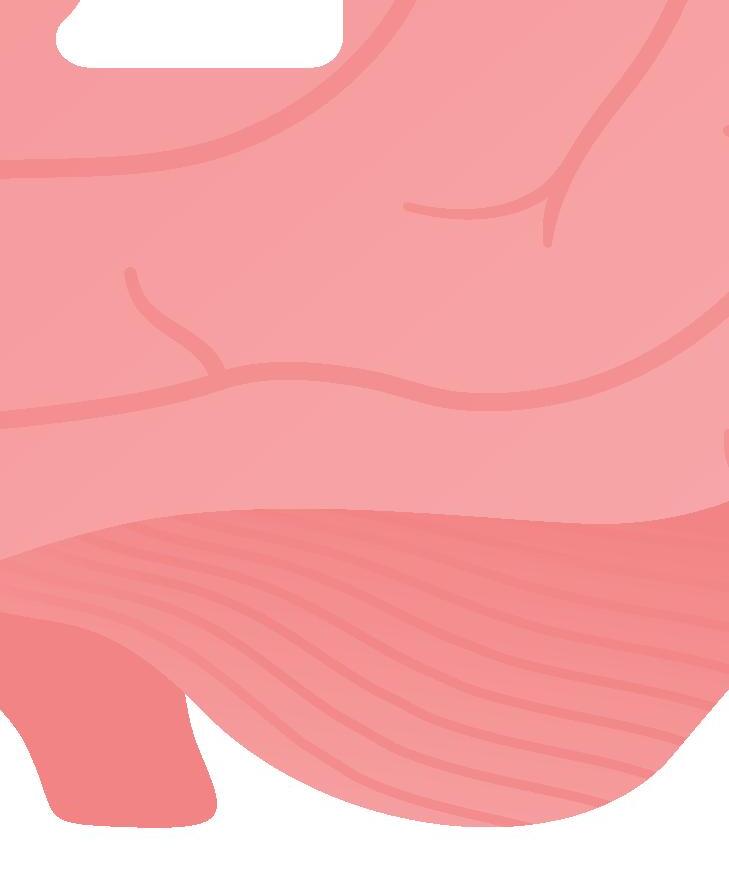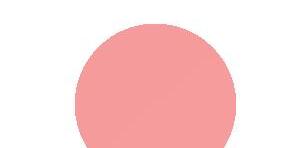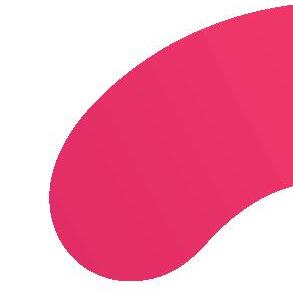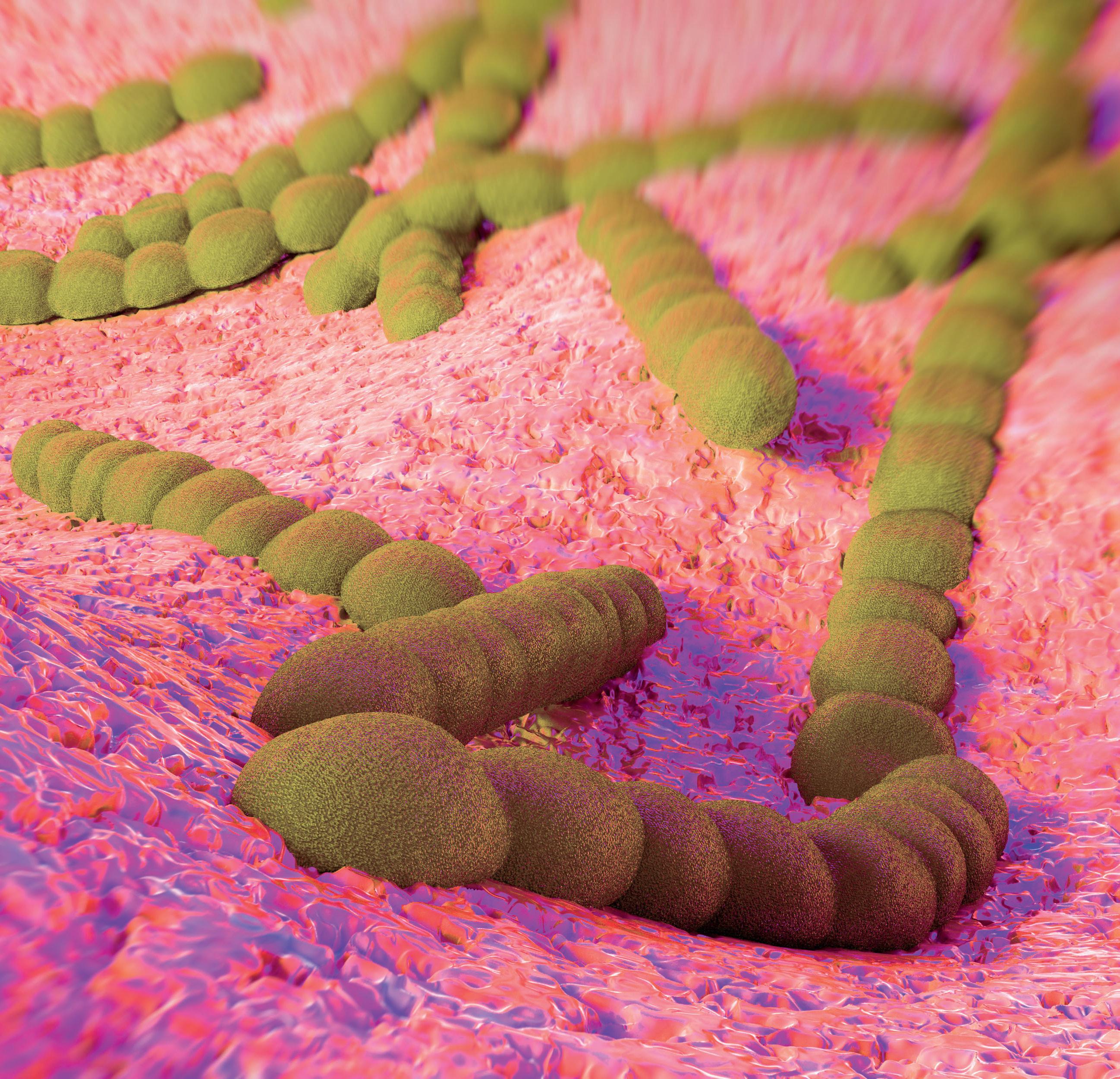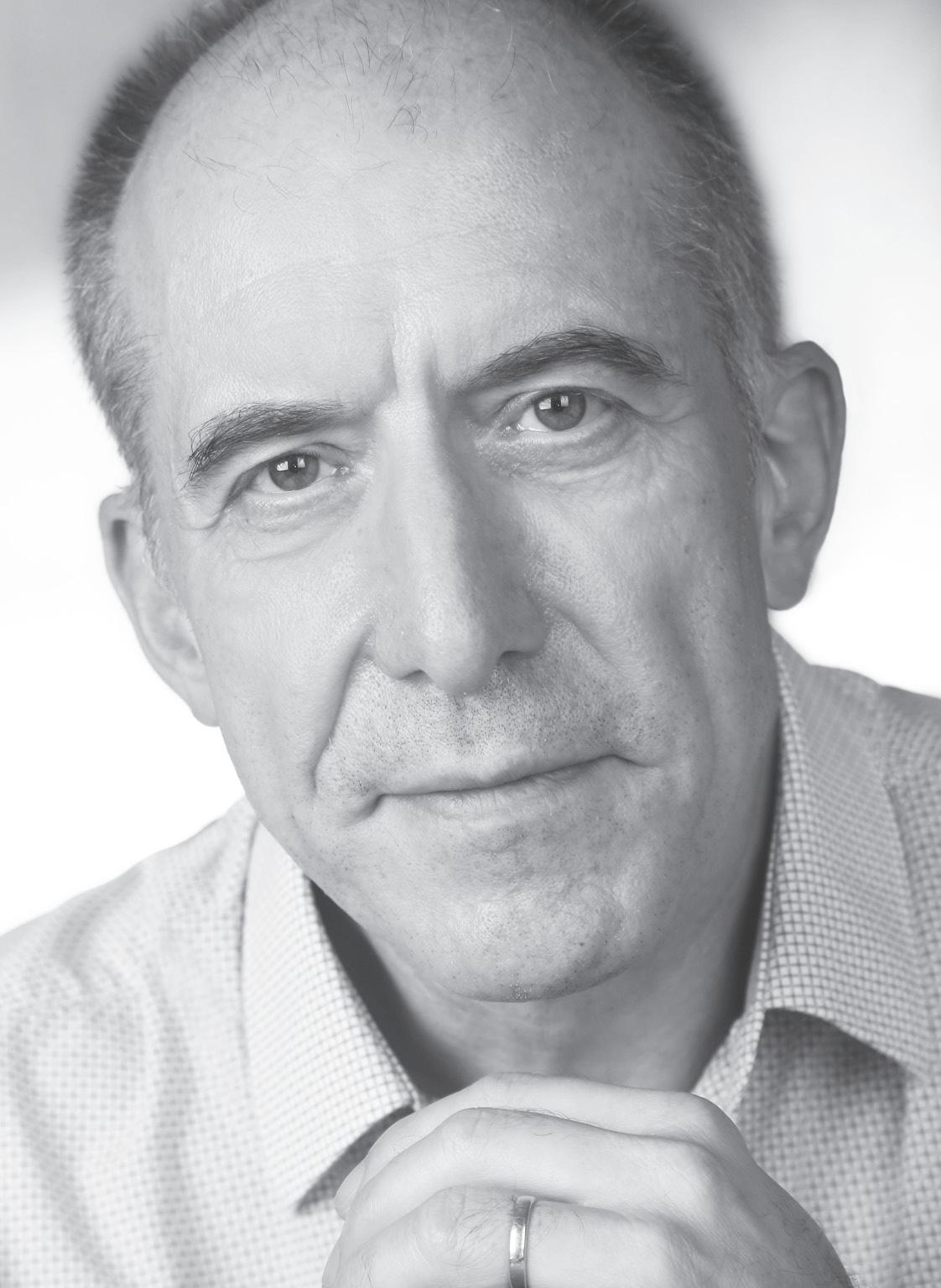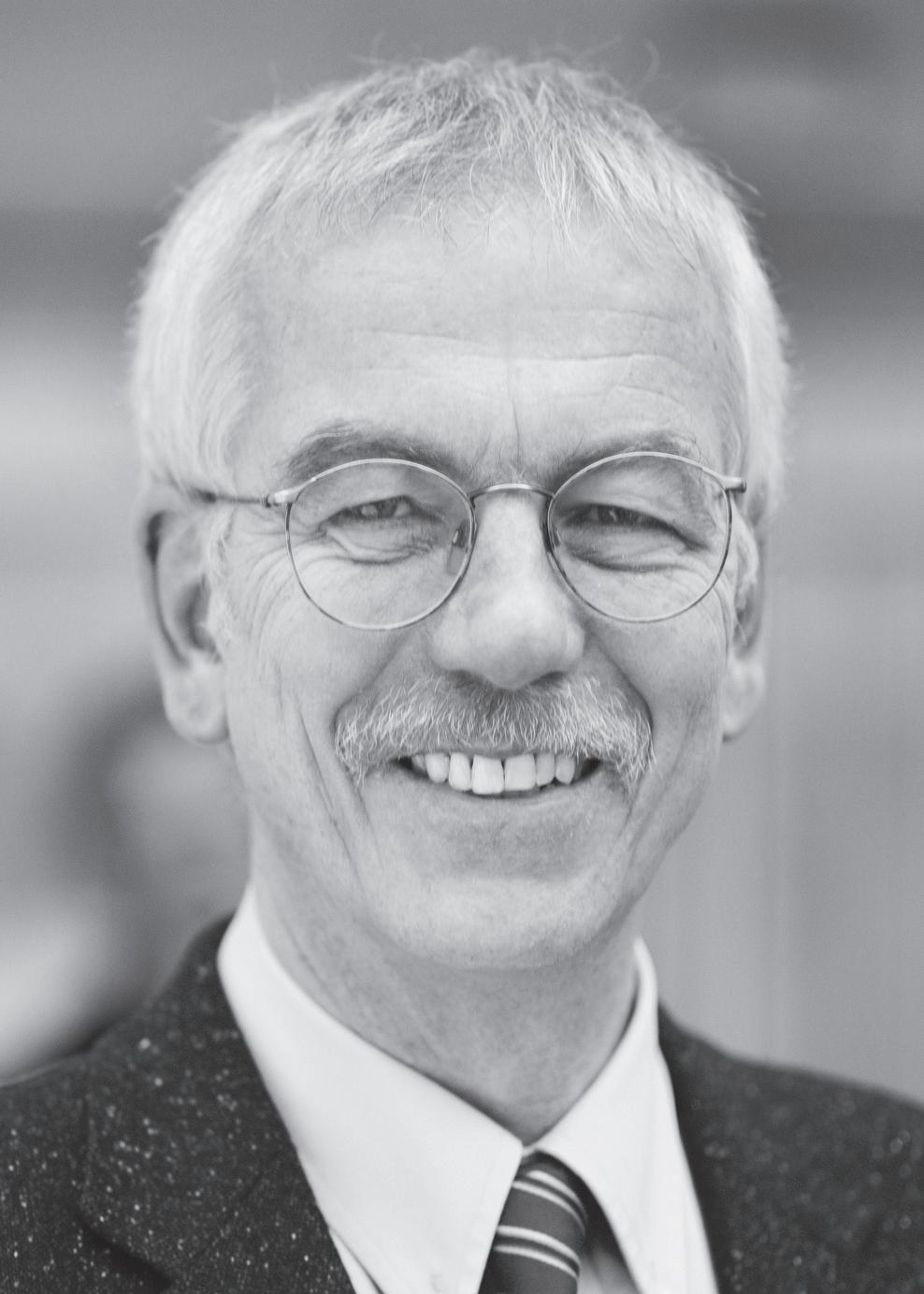Praxis-Magazin für Primärversorgung mit Sonderteil Pharmazie
Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit

Reizdarm Beruhigend
Bei Essen zählt nicht nur das Was, sondern auch das Wie
Zu viel verlangt?
Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie
Praxiswissen:
Herz-Kreislauf-Stillstand
Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines

Österreichische Post AG, MZ16Z040661M, 32. Jahrgang, RegionalMedien Austria GesundheitRMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien
für den
DIE ADIPOSITAS EPIDEMIE
03/2023
04 Zeit ist Muskel Update Akutes Koronarsyndrom: Frühzeitige Diagnose, Intervention und Therapie sind ausschlaggebend für die Prognose
07 DFP Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand

Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines für die hausärztliche Praxis
20 Herz-Gehirn-Kohärenz Wie die Atmung Körper und Geist in Balance bringt
24 Zu viel verlangt? Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie
28 Tabuthemen in der Onkologie Stuhl-, Harninkontinenz sowie Stomaversorgung als Folgen der Behandlung eines Kolorektalkarzinoms
31 Hörgeräte nicht nur für Oma? Hypakusis kann jede Altersgruppe betreffen – mit weitreichenden Folgen
35 Neue Wege hin zur Prävention und Behandlung Blut-Hirn-Schranke als zentraler Akteur in der Demenzentwicklung
51 Impressum
THEMA DES MONATS
12 Die Adipositas-Epidemie Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit
14 „Die Erstattungskriterien müssten neu überarbeitet werden“
Adipositas ist als Erkrankung medizinisch untertherapiert – wie Medikamente die Behandlung unterstützen können
17 „Am richtigen Rad drehen“

Bei starkem Übergewicht, Diabetes und/oder Hypercholesterinämie sollten auch schilddrüsenbezogene Symptome und Körperzeichen berücksichtigt werden
38 Kraft der Eiche
Durch eine gezielte Auswahl des Wirtsbaumes kann die Misteltherapie bei onkologischen Erkrankungen individualisiert und optimiert werden
40 Oft unterschätzt
Pneumokokken-Pneumonie: Luft nach oben bei der Immunisierung von Risikogruppen
43 Feinstaub verstärkt Haarverlust
PM10-Partikel beeinträchtigen Cateninbildung
45 Beruhigend für den Reizdarm
Serie, Teil 1: Das RDS in der Naturheilkunde – was eine Low-FODMAP-Diät bewirken kann

Hausärzt:in Inhaltsverzeichnis
pharmazeutisch
Hörstörung immer professionell abklären lassen.
31 45 medizinisch politisch © shutterstock.com/Julia Mikhaylova © shutterstock.com/Peakstock 38 Eichenkraft.
Geeignete Lebensmittel während einer FODMAP-Diät.
© shutterstock.com/Alexander Tolstykh
Eine Frage der Bildung
Der Trend zu mehr Übergewicht hält an. Das belegt u. a. eine USStudie anhand von Längsschnittdaten für die Geburtsjahrgänge seit den 1980er Jahren.* Demnach lag der durchschnittliche BMI jeder Generation höher als jener der vorangegangenen. Besonders gravierend sind die Probleme bei Personen mit niedrigem Bildungsstand. Ein paar spannende Details: Sowohl höhere Bildungsabschlüsse der Eltern als auch der Befragten waren in allen Altersgruppen mit niedrigeren BMI-Werten verbunden. Bei Frauen, deren Eltern einen Hochschulabschluss hatten, war zudem der Anstieg des mittleren BMI im Lebensverlauf geringer. Ebenfalls interessant: Der Einfluss der Bildungsunterschiede war in jüngeren Kohorten stärker ausgeprägt. Die Forscher:innen sehen hier einen besorgniserregenden Trend, allerdings auch Möglichkeiten gegenzusteuern: Mit Präventionsprogrammen sollte unbedingt schon im Jugend- und jungen Erwachsenenalter angesetzt werden. Denn schon dann entstünden bildungsbezogene Ungleichheiten, die sich im Erwachsenenalter verfestigten.
Apropos „Wohlstandskrankheiten“ …
Welche Risikofaktoren sonst noch bei krankhaftem Übergewicht mitspielen und welche politischen Maßnahmen am dringendsten erforderlich wären, erfahren Sie in unserer Titelgeschichte „Die Adipositas-Epidemie“ ab Seite 12.
Auch unser aktueller DFP-Fortbildungsartikel ab Seite 7 widmet sich einem Thema, das mit den sogenannten „Wohlstands-
DIE GESELLSCHAFT DER ÄRZTE LÄDT EIN
Der Fortbildung von Mediziner:innen – ein Leben lang – widmet sich die Gesellschaft der Ärzte in Wien. Sie wurde im Jahr 1837 gegründet und ist die traditionsreichste medizinische Gesellschaft Österreichs. Ihr Sitz ist das „Billrothhaus“ im 9. Wiener Gemeindebezirk. Die Hauptaufgabe des gemeinnützigen Vereins besteht in der Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des wissenschaftlichen Fortschrittes sowie in der Vermittlung und Erweiterung des medizinischen Fachwissens auf allen Gebieten der Medizin. Geboten werden u. a. DFP-zertifizierte Präsenz- und Hybridveranstaltungen, im April u. a. zu folgenden Themen:
4.4. Rudolf-Höfer-Preis 2023
5.4. Wissenschaftliche Geburtstagsfeier Rudolf Höfer – Ein Pionier der Nuklearmedizin wird 100
13.4. Medical History Tour
19.4. Infektiöse Endokarditis
26.4. Top News aus der medizinischen Forschung „Inhibition of complement C1s improves severe hemolytic anemia in cold agglutinin disease: a first-in-human trial”
26.4. Cholesterinwoche 2023
Der Eintritt ist für Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in Wien frei.
krankheiten“ im Zusammenhang steht: dem Herz-KreislaufStillstand. Die Gänsefüßchen sind wichtig, denn kardiovaskuläre Erkrankungen entstehen zwar vorrangig in einer Wohlstandsgesellschaft, treffen darin bekanntlich aber vor allem diejenigen, die zu den Ärmsten zählen. Und sie breiten sich längst auch in ärmeren Weltgegenden aus.
Welche Bedeutung dem sozioökonomischen Status neben bekannten Erkrankungen für die Lebenserwartung wirklich zukommt, wollten Wissenschaftler:innen im Rahmen einer Studie des Lifepath Konsortiums nachgehen, welches u. a. von der Europäischen Kommission finanziert wird.** Das Fazit: Wer finanziell schlechter gestellt ist, lebt tatsächlich kürzer: Armut sei im Vergleich sogar „lebensgefährlicher“ als Adipositas oder Hypertonie – so die Expert:innen. Das zeigt einmal mehr, welch hohen Stellenwert die Armutsbekämpfung und die Bildungsförderung in Hinblick auf die Volksgesundheit haben. Eine lehrreiche Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Mag.a Karin Martin Redaktionsleiterin RegionalMedien Gesundheit, karin.martin@regionalmedien.at

* Yang C et al. (2021), doi: 10.1073/pnas.2020167118.
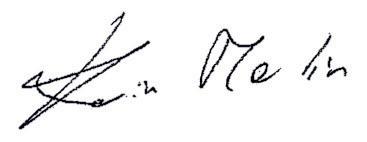
** Stringhini S et al. (2017), doi: 10.1016/S0140-6736(16)32380-7.
Das Semesterprogramm 2023 in der praktischen Übersicht: billrothhaus.at/images/pdf/ GdAe_Sommersemester_2023.pdf
Anmeldung: billrothhaus.at/veranstaltungen
Die Gesellschaft der Ärzte betreibt auch eine Bibliothek, die zu den größten privaten Büchersammlungen und den wertvollsten Fachbibliotheken der Welt zählt, sie ermöglicht ihren Mitgliedern den Onlinezugriff auf medizinische Fachzeitschriften und Datenbanken und stellt ihnen über Billrothhaus.TV umfangreiche Videoangebote für die medizinische Fortbildung zur Verfügung.
Quelle: billrothhaus.at


Hausärzt:in Editorial © RegionalMedien Gesundheit
3 März 2023
Zeit ist Muskel
Update Akutes Koronarsyndrom: Frühzeitige Diagnose, Intervention und Therapie sind ausschlaggebend für die Prognose

Der Sammelbegriff „a kutes Koronarsyndrom“ (ACS) umfasst den akuten Myokardinfarkt (AMI) sowie die instabile Angina pectoris und bezeichnet somit die unmittelbar lebensbedrohlichen Phasen der koronaren Herzerkrakung. Bei Verdacht auf ein ACS wird anhand des 12-Kanal-Elektrokardiogramms (EKG) zwischen erstens einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), zweitens – bei fehlender ST-Hebung durch (serielle) Messung des kardialen TroponinT/-I – einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) und drittens – bei nicht er-
höhtem Troponin/fehlender Dynamik – einer instabilen Angina pectoris unterschieden.1,2

In den letzten Jahrzehnten haben sich sowohl die Diagnostik als auch die Therapie des akuten Koronarsyndroms deutlich verbessert. Dies inkludiert einerseits schnellere und präzisere diagnostische Algorithmen, andererseits therapeutische Optionen („d rug-eluting-stents“, potente P2Y12-Inhibitoren, modernes Lipidmanagement).3,4 Zusätzlich ist das Bewusstsein für die Primärprävention gestiegen.5 Diese

Hausärzt:in medizinisch 4 März 2023
GASTAUTOREN-TEAM:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Hannes Alber Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie
© privat © privat
Dr. Johannes Sternard Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie
© unsplash.com/camilo jimenez
Veränderungen haben zu niedrigeren Inzidenzraten des Myokardinfarktes sowie auch zu einer sinkenden Mortalität geführt.6
Rasche Diagnose

Die frühzeitige Krankheitserkennung ist beim AMI von größter Bedeutung, um eine evidenzbasierte Therapie rechtzeitig beginnen zu können („Zeit ist Muskel“). Die Hauptsäulen der Früherkennung des AMI bilden eine detaillierte Anamnese – einschließlich Brustschmerz-Charakteristik –, die körperliche Untersuchung, das 12-Kanal-EKG und die (serielle) Messung des kardialen Troponin-T/-I.1,2 Speziell bei Frauen treten häufiger unspezifische Symptome wie
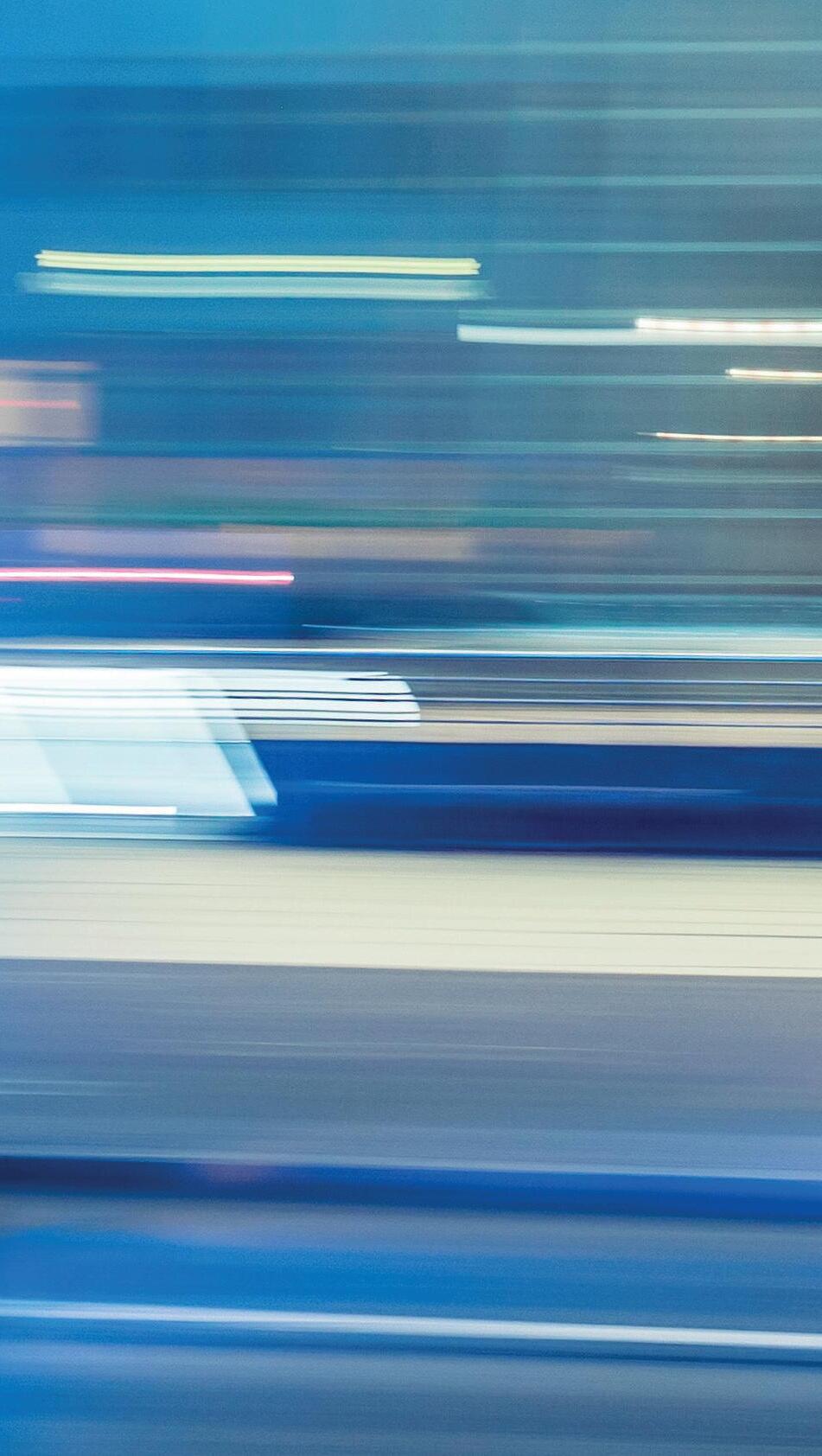
>
KARDIO
Serie
Dyspnoe, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen auf, was anamnestisch eine Herausforderung sein kann.7
Wenn ein ST-Hebungsinfarkt ausgeschlossen wurde, spielt die Labordiagnostik eine zentrale Rolle. Die Entwicklung der hochsensitiven cTn-Assay-Technologie ermöglicht eine präzise Quantifizierung des kardialen Troponins. Die verbesserte Sensitivität führte zu einer erhöhten diagnostischen Genauigkeit für den AMI in der Notaufnahme und ermöglicht dadurch, das „troponinblinde“ Intervall und die Zeit bis zum Einbzw. Ausschluss eines AMI erheblich zu reduzieren. In den Leitlinien der ESC (European Society of Cardiology) ist der 0/1-h-Algorithmus der derzeit bevorzugte, da er Sicherheit und Wirksamkeit bestmöglich in Einklang bringt. Bei einem Schmerzbeginn ab drei Stunden vor Ankunft in einer Notaufnahme und einer hs-cTn-Konzentration unterhalb der testspezifischen Nachweisgrenze kann ein akuter Myokardinfarkt mit nur einem Bluttest ausgeschlossen werden.1,2
Timing eines invasiven Vorgehens
Die zu bevorzugende Therapie bei einem STEMI ist die perkutane koronare Intervention (PCI). Bei kurzer Infarktdauer (< 2 h) und vermutlich langer Zeitverzögerung bis zur primären PCI (> 2 h) sollte nach wie vor eine Fibrinolyse erwogen werden.2
Bei einem NSTEMI ist der Zeitpunkt für eine invasive Abklärung individuell festzulegen. Metaanalysen ergaben, dass eine routinemäßig frühe invasive Abklärung die Überlebenschancen beim NSTEMI nicht verbessern konnte. In den Leitlinien wird eine Einteilung der Patientinnen und Patienten in drei Risikoklassen (sehr hohes – hohes – niedriges Risiko)
empfohlen. Eine sofortige invasive Intervention (innerhalb von zwei Stunden nach Klinikaufnahme) wird darin nur für Personen mit einem sehr hohen Risiko empfohlen. Dazu gehören solche mit STEMI-ähnlichen Charakteristika oder lebensbedrohlichen infarktbedingten Komplikationen (Klasse I C).
Für Betroffene mit hohem Risiko soll eine frühe invasive Strategie (innerhalb von 24 Stunden) angestrebt werden. Darunter fallen Personen mit einem GRACE-Score von > 140, mit einer Troponin-Dynamik oder mit dynamischen ST-Strecken-Veränderungen (Klasse I A).
Bei Niedrigrisikopatientinnen und -patienten kann man sich mit der Abklärung demnach Zeit lassen. Hier wird in den Leitlinien zu einer selektiven invasiven Strategie – in Abhängigkeit von der vorhandenen Ischämie bzw. von obstruktiven Stenosen in der nichtinvasiven Bildgebung (Klasse I A) – angeraten.1,8
Antithrombotische Therapie
Patientinnen und Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom profitieren von einer dualen Plättchenhemmung (DAPT). Dies ist unumstritten. Der Zeitpunkt des Beginns, die Wahl des Präparats und der Therapiedauer sind jedoch nach wie vor Gegenstand von Diskussionen. Die ehebaldige Gabe von Acetylsalicylsäure (ASS) wird empfohlen. Gleiches gilt im Falle eines STEMI auch für die P2Y12-Hemmung. Demgegenüber wird die erstmalige Gabe des P2Y12-Inhibitors beim NSTE-ACS in aller Regel erst nach der Feststellung der Koronaranatomie – somit zumeist nach einer diagnostischen Koronarangiografie – empfohlen. Eine Vorbehandlung der Patientinnen und Patienten, die rasch in ein Katheterlabor überstellt werden, ist nicht indiziert (Klasse-III-Empfehlung). Wenn hingegen ein primär konservatives Vorgehen oder eine verzögerte bzw. selektive invasive Abklärung geplant ist, sollte sehr wohl eine duale Antiplättchentherapie durchgeführt werden.1,2 Daraus ist ersichtlich, dass die Gabe eines P2Y12-Inhibitors beim NSTE-ACS ein stärker individualisiertes Vorgehen impliziert.
In den aktuellen Leitlinien wird – außer bei erhöhtem Blutungsrisiko – eine Therapiedauer der DAPT über zwölf Monate empfohlen (Kategorie IA). Es werden drei Empfehlungen ausgesprochen, inwieweit die antithrombotische Therapie verkürzt werden kann. Sie beziehen klar das Blutungsrisiko mit ein.1,2
Nachhaltiges Risikofaktorenmanagement
Trotz dieser Verbesserungen in Diagnostik und Therapie stellt das ACS eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität weltweit dar. Kardiale Risikofaktoren sind für das Auftreten von neuerlichen kardiovaskulären Ereignissen maßgeblich verantwortlich. Umso mehr muss auf eine leitliniengerechte Sekundärprophylaxe geachtet werden.1,2
Nach einem ACS wird laut Leitlinien ein LDL-Cholesterin-Ziel von < 55 mg/dl (= 1,4 mmol/L), bei einem Zweitereignis innerhalb von zwei Jahren sogar ein Wert von < 40 mg/dl (= 1,0 mmol/L), empfohlen – insbesondere unter dem Einsatz von Kombinationstherapien im Sinne von Statinen plus zunächst Ezetimib, ggf. gefolgt von einer weiteren Intensivierung mit Bempedoinsäure, Inclisiran oder PCSK9-Inibitoren.1,2
Zusätzlich wird Betroffenen eine HerzKreislauf-Rehabilitation nach einem ACS nahegelegt. Sie stellt ein wirksames Mittel dar, um eine gesunde Lebensweise umzusetzen und mit Risikofaktoren adäquat umzugehen. Damit soll die gesamte und kardiovaskuläre Mortalität sowie Morbidität reduziert und die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbessert werden.1,2
Literatur:
1 Collet JP et al., Eur Heart J. 2021 Apr 7;42(14):1289-1367. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa575.
2 Ibanez B et al., Eur Heart J. 2018 Jan 7;39(2):119-177. doi: 10.1093/eurheartj/ehx393.
3 Nabel EG, Braunwald E, New Engl J Med 2012, 366(1):54–63. doi: 10.1056/NEJMra1112570.
4 Bestehorn K et al., Clin Res Cardiol 2015, 104(7):555–565. doi: 10.1007/s00392-015-0818-3.
5 Yusuf S et al., Lancet. 2020 Mar 7;395(10226):795-808. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32008-2.
6 Neumann JT et al., Clin Res Cardiol. 2020 Sep;109(9):1186-1192. doi: 10.1007/s00392-020-01612-1.
7 Haider A et al., Eur Heart J. 2020 Apr 1;41(13):1328-1336. doi: 10.1093/eurheartj/ehz898.
8 Kite T et al., Eur Heart J. 2022 Sep 1;43(33):3148-3161. doi: 10.1093/eurheartj/ehac213.
NACHBERICHT
Die Gastautoren hielten einen Vortrag zum Thema „Akutes Koronarsyndrom“ bei der ÖGIM-Jahrestagung 2022 in Salzburg.
Hausärzt:in medizinisch 6 März 2023 <
„Trotz Verbesserungen in Diagnostik und Therapie stellt das ACS eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität weltweit dar.“
Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand
Die Relevanz der aktuellen ERC-Guidelines für die hausärztliche Praxis
Ca. 12.000 Menschen pro Jahr erleiden in Österreich einen prähospitalen HerzKreislauf-Stillstand. Das entspricht einer Inzidenz von rund 120 bis 140 pro 100.000 Einwohner. Eine interessante Tatsache ist, dass mehr als 50 % dieser Herz-Kreislauf-Stillstände beobachtet werden.
In Deutschland wird ein Reanimationsregister geführt, aus dem man einige Zahlen und Daten ablesen kann, z. B. die Laienreanimationsrate, die in Deutschland bei 30 bis 40 % liegt. Im Vergleich
dazu ist diese Rate in Österreich deutlich geringer. Da es derzeit für Gesamtösterreich noch kein Register gibt, sind das jedoch nur Schätzungen. Weitere wissenswerte Daten aus Deutschland:
• Bei etwa 25 % der HerzKreislauf-Stillstände wird ein automatisierter externer Defibrillator (AED) angewandt.


• Eine über Telefon angeleitete Reanimation erfolgt bei
GASTAUTOR: Dr. Markus Simmer Oberarzt am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinikum WelsGrieskirchen

ca. 70-80 % aller Wiederbelebungen.

Die angeleitete Reanimation ist in den ERC-Leitlinien von 2015 bereits verankert und wird auch in Österreich mittlerweile flächendeckend durchgeführt. Bei außerklinischen Herz-Kreislauf-Stillständen („OHCA-out of hospital cardiac arrest“) ist trotz immer besser werdender medizinischer und prähospitaler >
©
Hausärzt:in DFP 7 März 2023
© shutterstock.com/pixelaway
Klinikum Wels-Grieskirchen
Schnellzugriff zum Literaturstudium: Geben Sie auf meindfp.at/dfp-fortbildungssuche den Suchbegriff 766514 ein.
DFP-Punktesammler LITERATUR
Versorgung die Überlebensrate nur bei rund 8 % angesiedelt. Auch diese Outcome-Daten stammen aus dem deutschen Reanimationsregister. Einzelne punktuelle Daten aus Österreich lassen darauf schließen, dass auch bei uns nur etwa 8-10 % der Patientinnen und Patienten einen Herz-KreislaufStillstand außerhalb des Krankenhauses (OHCA) überleben.
Zwei Lösungsansätze für die Verbesserung des Outcomes nach Herz-KreislaufStillstand könnten wie folgt aussehen:
1. Bewusstsein schaffen, dass Laienreanimation wichtig und sinnvoll ist vermehrte Schulungen von Laien,
2. Etablierung eines österreichischen Reanimationsregisters, um aussagekräftige Daten bzw. mögliche Ansatzpunkte zu finden, welche die Überlebensrate verbessern könnten.
Lebensrettende Ansätze
In den ERC-Leitlinien von 2021 wurde dem Thema „ Systeme, die Leben retten“ ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe Infobox). Von diesen fünf Kernaussagen sollen nachstehend einige erläutert werden.
Zum einen ist es sehr wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass Laienreanimation und die Verwendung eines Defibrillators tatsächlich Menschenleben retten.
Wir Ärztinnen und Ärzte – insbesondere auch Hausärztinnen und Hausärzte – sollten uns dafür einsetzen, dass flächendeckende und frei zugängliche Defis in ganz Österreich installiert werden. Weiters obliegt es uns, regelmäßige Schulungen zur Anwendung der Defis bei der Laienreanimation anzubieten.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die europaweite Aktion „ K ids save lives“ Wir sollten danach trachten, bereits Kinder und insbesondere Schulkinder in der Laienreanimation zu schulen. Dies bringt einige große Vorteile: Zum einen sind diese unvoreingenommen, wenn es darum geht, an reglose Personen heranzutreten und zu helfen. Zum anderen ist es für Kinder in späteren Jahren eine Selbstverständlichkeit zu helfen, wenn sie bereits im Alter von zehn bis 15 Jahren lernen, wie es funktionieren könnte, ein Leben zu retten. In ganz Österreich gibt es schon viele
gute Projekte zum Thema „ K ids save lives“
Wenn Laien in den Grundzügen der Reanimation geschult sind, ist es um ein Vielfaches leichter, eine telefongeleitete Reanimation durchzuführen.
Aktuelles aus den Reanimationsguidelines 2021
Nach wie vor ist die qualitativ hochwertige Herzdruckmassage ein zentrales Thema bei der Herz-Lungen-Wieder-
SYSTEME, DIE LEBEN RETTEN
1. Bewusstsein für Laienreanimation und Defibrillation erhöhen
� Training so vieler Menschen wie möglich
� Beteiligung am World Restart a Heart Day
� Entwicklung von neuen und innovativen Systemen und Regeln, um mehr Leben zu retten
2. Technologien nutzen, um Communitys einzubinden
� Implementierung von Technologien zur Alarmierung von Ersthelfern bei Kreislaufstillstand durch Smartphone-Apps/Textnachrichten
� Aufbau von Communitys aus Ersthelfern mit dem Ziel, Leben zu retten
� Lokalisieren und Teilen der Standorte öffentlich zugänglicher Defibrillatoren
3. „Kids save lives“
� Unterrichten aller Schüler:innen in Laienreanimation mit den Schritten „Prüfen, Rufen, Drücken“
� Weitergabe des Erlernten zur Herzdruckmassage durch Kinder an die Eltern und Verwandten
4. Cardiac-Arrest-Zentren
� Wo möglich, Versorgung von erwachsenen Patient:innen mit präklinischem Kreislaufstillstand in Cardiac-Arrest-Zentren
5. Telefonreanimation
� Bereitstellen einer telefonisch assistierten Laienreanimation, wenn die Betroffenen nicht reagieren und keine normale Atmung haben
� Zusammenarbeit mit dem Einsatzpersonal, damit die telefonisch assistierte Laienreanimation kontinuierlich überwacht und verbessert werden kann
Quelle: Leitlinien des European Resuscitation Council 2021 (eigene Darstellung).
belebung – sowohl im BLS(„basic life support“)- als auch im ALS(„advanced life support“)-Algorithmus. Dies ist in der sogenannten Überlebenskette dargestellt (siehe Abbildung).
Das heißt, entscheidend ist, rasch zu erkennen, dass ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt, eine frühe Herzdruckmassage einzuleiten, eine möglichst frühe Defibrillation vorzunehmen und schließlich die betroffene Person in ein geeignetes Zentrum zu bringen.
Unser Gehirn erfährt bei einem HerzKreislauf-Stillstand und einem daraus resultierenden Sauerstoffmangel innerhalb von fünf bis sieben Minuten eine irreversible Schädigung. Trotz eines sehr gut ausgebauten Rettungswesens in Österreich ist es praktisch nicht möglich, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne einen professionellen Helfer an den Einsatzort zu bringen. Deshalb ist es entscheidend, eine Reanimation durch By-Stander (Laien) zu beginnen. Das Erkennen des Herz-Kreislauf-Stillstandes sollte für Laien möglichst einfach sein, weshalb eine alleinige Atemkontrolle mittels Hörens, Sehens und Fühlens ausreicht, um diesen zu bestätigen. Bei nicht normaler Atmung sollte unverzüglich eine Herzdruckmassage durchgeführt werden. Hier ist es seitens des ERC durchaus legitim, ausschließlich eine Herzdruckmassage („compression only CPR“) vorzunehmen, bis ein zweiter Helfer oder ein professioneller Helfer für die Beatmung anwesend ist. Sobald es zu einer Zwei-Helfer-Methode kommt, sollte im BLS-Algorithmus möglichst rasch ein AED am Patienten angebracht werden, um frühzeitig einen Schock abzugeben.
Hochwertige Herzdruckmassage
Die hochwertige Herzdruckmassage stellt einen zentralen Aspekt der HerzLungen-Wiederbelebung dar – sowohl im BLS- als auch im ALS-Algorithmus. Der Druckpunkt befindet sich in der unteren Hälfte des Brustbeins, dies entspricht genau der Mitte der Brust (Mitte zwischen Jugulum und Rippenbogen). Die Drucktiefe sollte mindestens 5 cm und max. 6 cm betragen, mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Erwähnenswert ist es außerdem, auf eine
Hausärzt:in DFP 8 März 2023
Fünf Kernaussagen
ABBILDUNG: DIE ÜBERLEBENSKETTE
vollständige Entlastung des Brustkorbs zu achten und die Herzdruckmassage –wenn immer möglich – auf einer harten Unterlage durchzuführen. Falls ein professioneller Helfer oder ein zweiter Helfer, der Erfahrung mit der Beatmung hat, anwesend ist, sollten zwei Beatmungen mit 30 Thorax-Kompressionen abwechselnd ausgeführt werden.
Der Advanced-Life-SupportAlgorithmus
Im Vergleich zu den Leitlinien 2015 stellt die weitere Aufwertung der ThoraxKompressionen eine wichtige Änderung des ALS-Algorithmus dar. Der zentrale Punkt ist auch hier, Thorax-Kompressionen kontinuierlich durchzuführen. Die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zum Basic-Life-Support-Algorithmus liegen in der Anwendung eines manuellen Defis, wobei die Rhythmusanalyse alle zwei Minuten erfolgen und ermittelt werden sollte, ob ein defibrillierbarer Rhythmus oder ein nicht defibrillierbarer Rhythmus vorliegt.
Im Gegensatz zum BLS-Algorithmus werden Medikamente verabreicht, wobei Adrenalin beim nicht defibrillierbaren Rhythmus sofort und dann alle drei bis fünf Minuten gegeben werden sollte. Im defibrillierbaren Rhythmus wird Adrenalin nach dem dritten erfolglosen Schock und auch dann alle drei bis fünf Minuten verabreicht. Als zweites Medi-
kament während der Reanimation sollte Amiodaron 300 mg einmalig nach dem dritten erfolglosen Schock gegeben bzw. kann eine Repetition mit 150 mg Amiodaron nach dem fünften Schock erwogen werden. Neu ist, dass anstelle von Amiodaron auch Lidocain in einer Dosierung von 100 mg bzw. 50 mg bei der Repetition angewandt werden kann.
Goldstandard beim Airway-Management bleibt die endotracheale Intubation. Diese sollte jedoch nur von Ärztinnen und Ärzten mit entsprechender Expertise und Übung vorgenommen werden. Der große Vorteil der endotrachealen Intubation beim ALS-Algorithmus liegt darin, dass eine kontinuierliche Herzdruckmassage durchgeführt werden kann.
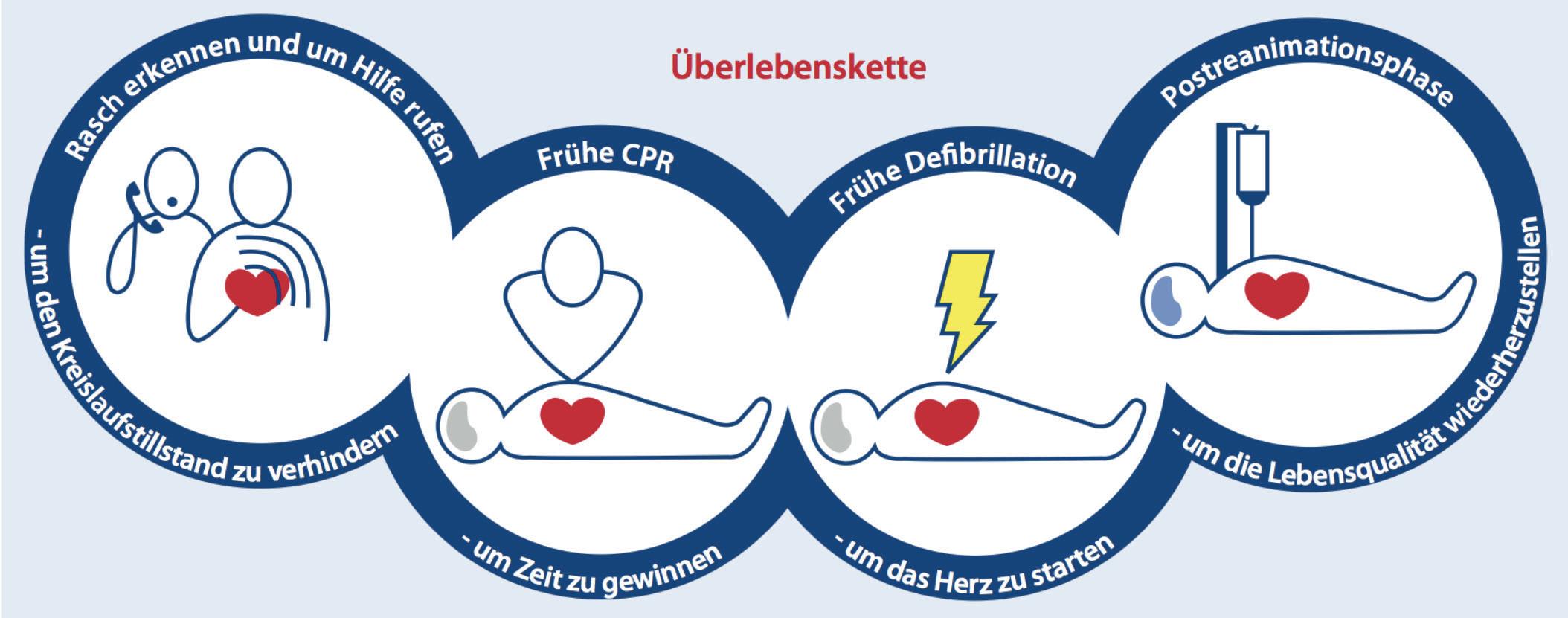
Ethik der Reanimation & Entscheidungen am Lebensende
Die Leitlinien 2021 befassen sich unter anderem auch mit ethischen Gesichtspunkten im Rahmen der Reanimationsbehandlung. Bei diesem Thema möchte ich insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte mit ins Boot holen, da sie normalerweise erste Ansprechpartner bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten sind.
Hier empfiehlt das ERC in seinen Guidelines, vorausschauende Behandlungspläne zu erstellen. Insbesondere bei chronisch kranken und pflegebedürftigen Perso-
nen sollte bereits im Vorfeld ganz klar kommuniziert werden, wie eine Behandlung am Lebensende erfolgen sollte. Gemeinsam mit den Betroffenen und auch den Angehörigen oder betreuenden Personen ist zu erläutern, wie bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand vorzugehen ist. Weiters sollten Hausärzte darüber aufklären, was es bedeutet, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, und welche OutcomeSzenarien möglich sind. Ein würdevolles Sterben ist manchmal sowohl für den Patienten als auch für Angehörige die einfachere und möglicherweise bessere Variante. Zu erwähnen sei die Option einer Patientenverfügung, die im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes die Behandlung im Sinne des Patienten regeln sollte.
DFP-Pflichtinformation Fortbildungsanbieter:
Klinikum Wels-Grieskirchen
Lecture Board:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Johann Knotzer Abteilungsleitung am Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinikum Wels-Grieskirchen
Dr.in Johanna Holzhaider
2. Vizepräsidentin der OBGAM Gruppenpraxis Sandl, Oberösterreich
Hausärzt:in DFP 9 März 2023
<
© zVg
Hausärzt:in DFP – Das Wichtigste in Kürze
Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand hat unser Gehirn nur 3-5 Minuten Zeit, bis die ersten irreversiblen Schädigungen auftreten.
Laien sollten geschult werden, um einen HerzKreislauf-Stillstand zu erkennen und eine qualitativ hochwertige Herzdruckmassage beginnen zu können. Für das Erkennen des Herz-Kreislauf-Stillstandes reicht die Atemkontrolle. Eine nicht normale Atmung erfordert sofortige Thorax-Kompressionen.
DFP-Literaturstudium HAUSÄRZT:IN

AEDs sollten flächendeckend in ganz Österreich zugänglich sein und auch von Laien eingesetzt werden. Auch im ALS-Algorithmus ist die qualitativ hochwertige Herzdruckmassage die zentrale und wichtigste Maßnahme. Man sollte mit chronisch kranken Patientinnen und Patienten bereits im Vorfeld über die Möglichkeit der Patientenverfügung und über Maßnahmen nach plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand sprechen.
So machen Sie mit: Entsprechend den Richtlinien der ÖÄK finden Sie im Anschluss an den Fortbildungsartikel Multiple-Choice-Fragen.
Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn Sie von den vorgegebenen Antworten alle richtigen angekreuzt haben. Für eine positive Bewertung ist erforderlich, dass Sie 2 der 3 Fragen richtig beantworten. In diesem Fall wird 1 DFP-Fachpunkt angerechnet.
Online lesen und beantworten: Dieser Fortbildungsartikel inkl. Test steht online auf meindfp.at noch 2 Jahre zur Verfügung.
Wenn Sie dieses elektronische Angebot nutzen, erhalten Sie auch die Teilnahmebestätigung elektronisch.
Per E-Mail oder Post: Schicken Sie den beantworteten Fragebogen bitte per Mail als Scan-Dokument an office@gesund.at oder per Post an Redaktion HAUSÄRZT:IN/RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien. Einsendeschluss: 30. September 2023. Alle unsere Fortbildungen finden Sie unter meindfp.at (Reiter Akademie Lernwelt, E-Learning) mit der Stichwortsuche „Praxiswissen“
DFP-Fragen zu „Praxiswissen: Herz-Kreislauf-Stillstand“
Die Anzahl der richtigen Antworten ist nach jeder Frage in Klammern angegeben.
Wie hoch ist die Überlebensrate nach einem außerklinischen (OHCA) Herz-Kreislauf-Stillstand? (1 richtige Antwort)
Sie haben ein Fortbildungskonto?
JA – dann buchen wir Ihre DFP-Punkte automatisch!
Dazu brauchen wir Ihre ÖÄK-Ärztenummer und E-Mail-Adresse:
Was sind effektive Maßnahmen nach einem plötzlichen Herz-KreislaufStillstand? (2 richtige Antworten)
Eine möglichst rasche Intubation und Beatmung.
Eine qualitative Herzdruckmassage. Der sofortige und rasche Transport in ein Krankenhaus. Das Herbeischaffen und Anlegen eines AEDs.
Welche Aussagen zum Thema ALS-Algorithmus sind richtig? (2 richtige Antworten)
Das primäre Ziel muss sein, den Atemweg des Patienten zu sichern. Bei einem nicht defibrillierbaren Rhythmus sollte so rasch als möglich eine Schockabgabe erfolgen.
Auf 30 Herzdruckmassagen sollten zwei Beatmungen folgen.
Adrenalin wird bei nicht defibrillierbarem Rhythmus alle drei bis fünf Minuten in einer Dosierung von 1 mg verabreicht.
NEIN – ich möchte meine Teilnahmebestätigung per Post erhalten per E-Mail erhalten
Bitte gut leserlich ausfüllen und E-Mail-Adresse angeben: Name Anschrift PLZ/Ort E-Mail
Hausärzt:in DFP 10 März 2023
3-5 %. 8-10 %.
%.
12-15
15-20 %.
1 2 3
LITERATUR
Haus Ärzt:in DIALOGTAG
Hausärzt:in trifft Kliniker:in
Moderne Schmerzmedizin –Möglichkeiten & Grenzen
PräsenzFortbildung
Sa., 3. Juni 2023
IN LINZ
Themen (mit Fallbeispielen aus der Allgemeinpraxis):
Chronischer Schmerz – eine Herausforderung: von der Diagnose bis zur Therapie
Klinische Pharmakologie – Medikationsmanagement & Polypharmazie
Geriatrie & Palliativmedizin – Schmerztherapie ist Teamarbeit



Pädiatrie – Kleiner Mensch, großer Schmerz
Podiumsdiskussion:
Ambulante Schmerztherapie heute – Was tun gegen Lücken in der Versorgung?
Programm und Anmeldung: meinmed.at/dialogtag-linz
7 DFP-Punkte in Planung
Teilnahmegebühr:
OBGAM-, ÖGAM-, JAMÖ-Mitglieder 65€, Nichtmitglieder 85€ Rückfragen an info@meinmed.at

Mit freundlicher Unterstützung von:
Veranstalter:innen:
Änderungen vorbehalten.
Die Adipositas-Epidemie
Eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit
Adipositas hat endemische Ausmaße erreicht. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes Jahr mindestens 2,8 Millionen Menschen an den Folgen von (krankhaftem) Übergewicht, Tendenz steigend. Seit den 1970ern hat sich die chronische Krankheit weltweit fast verdreifacht. Die WHO hat daher aus gutem Grund bereits 1997 Adipositas als globale Epidemie eingestuft, die es zu bekämpfen gilt.
Auch im deutschsprachigen Raum ist die Prävalenz hoch. Rund 15 % der Bevölkerung leben mit Adipositas. Oft sind schon Kinder und Jugendliche betroffen: Die Adipositasprävalenzen steigen laut Robert Koch Institut (RKI) von etwa 2 % bei den Drei- bis Sechsjährigen auf etwa 8,5 % bei den 14- bis 17-Jährigen.
„Die Adipositas-Epidemie ist eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit“, bestätigt Prof. Dr. Hans Hauner, Tagungspräsident des Adipositas-Kongresses 2022 in München. „ Starkes Übergewicht ist selbst eine chronische Erkrankung und zugleich eine Ursache für die Entstehung von schwerwiegenden Folgen wie kardiologischen Erkrankungen, Insulten,
Typ-2-Diabetes und mindestens 13 verschiedenen Karzinomarten.“
Als Krankheit akzeptieren
Definiert ist Adipositas als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Sie wird anhand des Body-Mass-Index (BMI) klassifiziert (siehe Tabelle). Die Entstehung ist meist multifaktoriell und schließt in der Regel eine genetische Prädisposition mit ein. Letztlich resultiert Adipositas aus einem langjährigen Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und -verbrauch. Jedoch scheinen viele andere Faktoren die

Prädisposition einer Person für Fettleibigkeit zu erhöhen, einschließlich endokriner Disruptoren (z. B. Bisphenol A),
Empfehlungen der WHO
Nach einhelliger Einschätzung von Expert:innen ist ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen in verschiedenen Politikfeldern nötig („Health in All Policies“). Die WHO Europa empfiehlt vier „besonders vielversprechende“ Sofortmaßnahmen:
� gesundheitsorientierte Besteuerung von Lebensmitteln (z. B. Zuckersteuer für Erfrischungsgetränke, Subventionen für Gemüse und Obst);
Präadipositas: 25-29,9 kg/m2
Adipositas Grad I: 30-34 kg/m2
Adipositas Grad II: 35-39,9 kg/m2
Adipositas Grad III: ab 40 kg/m2
Tabelle: Adipositas wird anhand des Body-MassIndex (BMI) klassifiziert.
� Beschränkungen der an Kinder gerichteten Werbung für unausgewogene Lebensmittel;
� schulbasierte Interventionen zur Förderung von gesunder Ernährung und Bewegung;
� verbesserter Zugang zur Adipositastherapie im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsversorgung.
Quellen: DAG, WHO Europe.
Hausärzt:in politisch 12 März 2023
INFO
©
shutterstock.com/agsaz
des Darmmikrobioms, der Schlaf-wachZyklen und diverser Umweltfaktoren.
TERMIN
ÖAK-Diplom Ernährungsmedizin
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm.
Themenauszug: Adipositas, Diabetes mellitus, Metabolisches Syndrom, angeborene Stoffwechselstörungen, gastrointestinale Erkrankungen, Allergien und Intoleranzen, Bulimie/Anorexie, Ernährung bei Krebs, Osteoporose, Ernährung und Sport, Ernährung im Alter, Ernährung von Säuglingen, Ernährung der Schwangeren und Stillenden, alternative Ernährungsformen, Psychologie, Karies usw.
Ausbildungszyklus II/2023: Seminar 1: 05./06.05.2023, Seminar 2: 02./03.06.2023, Seminar 3: 30.06./01.07.2023, Seminar 4: 22./23.09.2023, Seminar 5: 20./21.10.2023, Seminar 6: 24./25.11.2023 + Prüfung.
Veranstaltungsort: Europahaus Wien, Linzer Straße 429, 1140 Wien, Tel.: 01/5766677, Internet: europahauswien.at
Infos & Anmeldung: Österreichisches Akademisches Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE), Tel.: 01/402 64 72, E-Mail: office@oeaie.org, Internet: oeaie.org
Adipositas ist also keine Schuldfrage, sondern sollte ebenso therapiert werden wie jedes andere Leiden, welches das Leben von Menschen bedroht. „ Dafür müssen wir aber zuerst akzeptieren, dass Adipositas eine Krankheit ist“, weiß Dr. Daniel Weghuber, Leiter der Abteilung Pädiatrie an der Uniklinik für Kinderund Jugendheilkunde der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg, um die Problematik in der Praxis. „ Da sie eine chronische Krankheit ist, muss jede Person, die an ihr leidet, diagnostiziert und in einem weiteren Schritt ein Behandlungsplan festgelegt werden. Das ist die Zukunft.“
Politische Forderungen
In der Gegenwart sei die Versorgung von Menschen mit Adipositas in Österreich oft noch „absolut unzureichend“, bekräftigt Priv.-Doz.in OÄ Dr.in Johanna Brix, Präsidentin der Österreichischen Adipositasgesellschaft (adipositas-austria.org). Diesen Zustand zu verbessern, bezeichnet sie als vorrangiges Ziel der „Österreichischen Adipositas Allianz“, die im Vorjahr von drei medizinischen Fachge-
sellschaften gemeinsam mit einer Patientenvertreterin gegründet wurde. Ihre Forderungen an die Entscheidungsträger aus Gesundheitspolitik und Sozialversicherung:
• Die Anerkennung von Adipositas als ernstzunehmende und eigenständige Erkrankung. Trotz der Zuweisung des ICD-10-CM-Codes E66 werde Adipositas als individuelles „Lifestyle-Problem“ verkannt. Das blockiere die Etablierung effizienter Präventions- und Therapiemaßnahmen.

• Ein Ende der Diskriminierung und Stigmatisierung Betroffener.
• Effektive Verhältnisprävention. Um Kindern und Jugendlichen einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen, müsse ein weniger „adipogenes“ Umfeld geschaffen werden.
• Ein freier und einfacher Zugang für Menschen mit Adipositas zu einer individuell angepassten multifaktoriellen Adipositastherapie sowie die Erstellung eines Disease-Management-Programmes gemeinsam mit den Gesundheitskassen und der Gesundheitspolitik.
Mag.a Karin Martin
Hausärzt:in politisch 13 März 2023
Eine Lebensstiländerung bildet die Basis der Behandlung von Adipositas. Demnach sollten sich Betroffene kalorienreduziert ernähren und ihre körperliche Aktivität steigern. Eine Verhaltenstherapie kann die Lebensstilintervention begleiten. Wird durch diese Basistherapie keine ausreichende Gewichtsabnahme erreicht, so können Ärzt:innen in Absprache mit ihren Patient:innen eine medikamentöse Therapie initiieren. Derzeit sind in Österreich folgende Präparate zugelassen: Liraglutid, Orlistat, Bupropion/Naltrexon und seit dem Vorjahr Semaglutid (siehe INFO). Der Wermutstropfen: Von der sozialen Krankenversicherung werden die Medikamentenkosten bisher in der Regel nicht übernommen.
HAUSÄRZT:IN: Sie haben im Vorjahr beim DERM-Alpin-Kongress in Salzburg zum Thema „Spritze zum Abnehmen: Fakt oder Fake?“ gesprochen … Dr.in ITARIU: Ja, das war eine ganz neue Erfahrung für mich, als Internistin vor Plastischen Chirurgen und Dermatologen einen Vortrag zu halten. Und dementsprechend waren auch die Reaktionen etwas anders, als ich sie bisher gekannt habe. Die unterschiedlichen Fachgebiete haben doch recht unterschiedliche Blick-
winkel. Für uns Internisten liegt der Fokus auf der Gesundheit, auf möglichen Folgeerkrankungen und auf der Sterblichkeit. Die dermatologische und plastisch-chirurgische Sicht hingegen ist oft sehr beautyspezifisch, auf Kontur und Shape als Endpunkte fokussiert. Eine Kollegin aus dem Publikum meinte zum Beispiel: „Eine Gewichtsreduktion um 10 bis 15 % beeindruckt mich nicht. Das ist mir der Aufwand nicht wert.“ Wir wissen aber aus Studien, dass oft 5 bis 15 % Gewichtsreduktion reichen, um z. B. den Blutdruck oder den Blutzucker zu senken, eine Schlafapnoe oder die COPDSymptomatik zu verbessern … Die Liste von Argumenten dafür ist also aus internistischer Sicht lange, auch die Beweglichkeit bessert sich. Auf einmal kann ein Patient wieder in den zweiten Stock ohne Pause hinaufgehen – und das nach „nur“ 10 % Gewichtsabnahme.


Die Ergebnisse beeindrucken Sie also? Ja, sie beeindrucken mich wirklich. Lange hatten wir keine vergleichbare medikamentöse Behandlung zur Verfügung. Trotzdem bleibt bei Adipositas Grad 3 die chirurgische Therapie weiterhin am effektivsten. Auch als Internistin mache ich deshalb bei Patienten mit einem BMI
NACHBERICHT
> 40 kg/m2 ständig Lobby pro Chirurgie –der bariatrische Eingriff wird ab dann erstattet. Aber natürlich, die OP birgt auch Risiken – nicht jeder will sie und es gibt Kontraindikationen.

Für welche Patient:innen kommt eine medikamentöse Therapie in Frage? Mittlerweile sind in Österreich vier Substanzen zugelassen. Eine Erstattung durch die soziale Krankenversicherung erfolgt aber nur bei Typ-2-Diabetes mit Adipositas unter bestimmten Voraussetzungen. D. h., es profitiert leider nur ein Bruchteil der Patienten davon.
In Erwägung gezogen werden kann eine Adipositastherapie generell ab einem BMI ≥ 30 kg/m2, also ab Grad 1. Zusätzliche Befunde sind in diesem Fall nicht erforderlich. Da der BMI nicht immer ein idealer Marker ist, kann man – wenn man sich unsicher ist – zusätzlich den Bauchumfang von Betroffenen messen. Bei über 88 cm bei der Frau und über 102 cm beim Mann kann man von einer nicht idealen Fettverteilung/ von Fetteinlagerungen ausgehen.
Darüber hinaus ist eine medikamentöse Adipositastherapie bei einem BMI ≥ 27 kg/m2 indiziert, wenn mindestens eine mit Übergewicht assoziierte Komor-
Hausärzt:in politisch 14 März 2023
„Die Erstattungskriterien müssten neu überarbeitet werden“
Adipositas ist als Erkrankung medizinisch untertherapiert – wie Medikamente die Behandlung unterstützen können
Dr.in Bianca-Karla Itariu, Fachärztin für Innere Medizin in Wien, im Gespräch.
© shutterstock.com/Anatta_Tan
© Alexander Jürets
Die Expertin war Vortragende beim Kongress DERM Alpin, 28.-30. Oktober 2022, Salzburg Congress.
bidität vorliegt, etwa Prädiabetes, Typ2-Diabetes, Hypertonie, Hyperlipidämie, Gelenkbeschwerden, eine Schafapnoe etc.
Was können die zugelassenen Medikamente, wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Die Medikamente wirken auf den Verdauungstrakt und/oder auf das Sättigungszentrum im Gehirn. Die Gewichtsreduktion ergibt sich aus der schnelleren und längeren Sättigung. D. h., bei der Mitte der Portion hören die Patienten in der Regel mit dem Essen auf. Manche sprechen daher von „Iss die Hälfte!“-Medikamenten. Teilweise verändert sich auch das Verhalten: Viele Patienten berichten, dass sie nichts Süßes mehr mögen, ja, eine Abneigung dagegen verspüren. Da liegt Schokolade herum, aber es kommt kein Verlangen danach auf (lacht).
Das heißt, die Lebensstiländerung funktioniert teilweise automatisch?
Genau. Man braucht sich nicht zu geißeln, da man nicht mehr ständig ans Essen denken muss. Die Patienten wissen ja oft, was sie falsch machen, und wollen es ändern.
Manche könnten ein Buch über gesunde Ernährung schreiben. Trotzdem schaffen sie es nicht, weil ihnen die Biologie/das Gehirn dazwischenfunkt. Die medikamentöse Adipositastherapie ermöglicht es in diesen Fällen erst, alles so umzusetzen, wie man es gerne hätte.
Nicht bei allen Adipositaspatient:innen wirkt die Pharmakotherapie … Das stimmt. Laut Zulassung sollte der Therapieerfolg 12-16 Wochen nach Behandlungsbeginn überprüft werden. Ab einem Gewichtsverlust von 5 % des Ausgangsgewichts wird von einem Therapieerfolg gesprochen. Hat sich dieser nicht eingestellt, so sollte die Therapie abgebrochen werden.
Ist die Therapie erfolgreich –wie lange muss sie fortgeführt werden? De facto „Open End“ Aus Studien wissen wir, dass die maximale Gewichtsreduktion nach zirka einem Jahr erreicht wird. Danach tut sich deutlich weniger. Die Therapie fortzusetzen, ist jedoch auch wichtig, um das Gewicht zu hal-
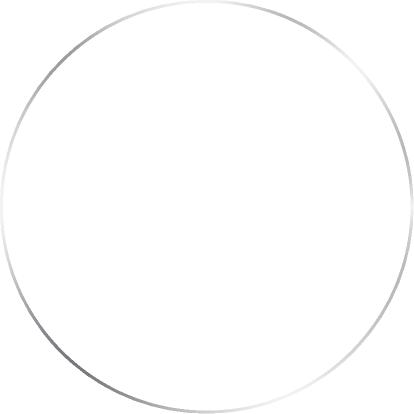
boso medicus exclusive Automatisierte Dreifachmessung mit Mittelwertanzeige

ten. Eine Studie mit dem Wirkstoff Semaglutid – einem Nachfolger von Liraglutid – zeigt, dass die Patienten teilweise eine Gewichtsreduktion von 15-20 Prozent erreichten. Setzten sie das Medikament ab, nahmen sie im darauffolgenden Jahr allerdings wieder zehn Prozent zu. Das veranschaulicht: Adipositas ist eine chronische Krankheit. Fettgewebe ist ein aktives, endokrines Organ, das nicht einfach so verschwinden wird. Wer die Medikamente braucht, sollte sie deshalb lebenslang einnehmen bzw. spritzen. Schwere Nebenwirkungen sind nach jetzigem Wissensstand nicht zu befürchten. Am ehesten Übelkeit bis hin zu Erbrechen, wenn man sich überisst.
Das heißt, Fake wäre, dass unendlich viele Kilos abgenommen werden könnten …
Genau. Die Spritze und die Pillen sind kein Wundermittel. Ein solches wird es bei Adipositas vermutlich nie geben. Die medikamentöse Therapie hat Vor- und Nachteile und es gibt Grenzen des Erreichbaren. Die maximal erreichbare Ge- >

So individuell wie die Gesundheit.
boso medicus exclusive lässt sich auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen, bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine optimale Beurteilung der Blutdruckwerte und ist besonders empfohlen bei erhöhter Blutdruckvariabilität. Überzeugend in jeder Beziehung: das elegante Design, die hochwertige Verarbeitung und ein Funktionsumfang, der keine Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und benutzerfreundlich, wie Sie und Ihre Patienten es von boso gewohnt sind: Die große Anzeige und die zuschaltbare Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung besonders einfach und komfortabel – nicht nur für ältere oder sehbehinderte Menschen.
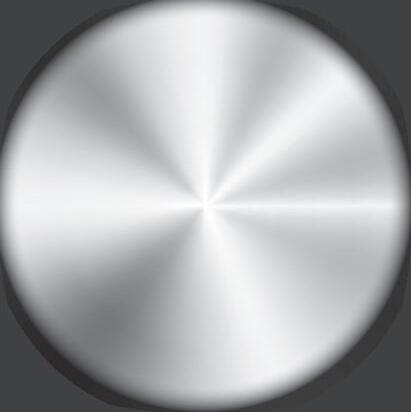
BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 94– 96 | 1200 Wien | www.boso.at
Hausärzt:in politisch
boso medicus exclusive Oberarm-Blutdruckmessgerät | Medizinprodukt
Erhältlich in Apotheke und Sanitätsfachhandel.
SCHLUSS
MIT HANDGESCHRIEBENEN TAGEBÜCHERN.
wichtsreduktion liegt momentan bei der Spritze bei 15 bis 20 % in der Semaglutid-Kategorie. Es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft weitere Medikamente auf den Markt kommen, dann wird die Therapielandschaft noch einmal besser aussehen.
Wird es dadurch in Zukunft weniger bariatrische Operationen geben?
Nicht unbedingt. Die bariatrische OP schafft durchschnittlich eine 30-prozentige Gewichtsreduktion – und nur sie hat bisher in Studien einen Überlebensvorteil gezeigt! Der schwedischen SOS-Studie zufolge, die Patienten seit über 25 Jahren begleitet, lebten Patienten, die bariatrisch operiert wurden, durchschnittlich fast drei Jahre länger als jene ohne Eingriff. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung waren es aber immer noch fünf Jahre weniger … Wie es sich mit den medikamentösen Therapien verhält, haben die Schweden leider nicht untersucht. Doch die Ergebnisse decken sich mit den Daten, die wir kennen: Bei einem BMI über 40 ab dem 40. Lebensjahr ist die Lebenserwartung um bis zu acht Jahre geringer.
Was ist Ihnen abschließend wichtig, als Fakt festzuhalten? Fakt ist: Ein Rufzeichen hat noch keine Heilung gebracht. Steht im Arztbrief „Gewichtsreduktion empfohlen“ mit fünf Rufzeichen, dann sollte auch dabeistehen, wie diese erreicht werden kann. Mit der Spritze bzw. den Pillen kann man einer bestimmten Patientengruppe endlich die Gewichtsabnahme ermöglichen. Damit die Therapie nicht an der Kostenfrage scheitert, müssten die Kassen die Erstattungskriterien neu überarbeiten.
ICH EMPFEHLE MYSUGR
UM DEN ÜBERBLICK ZU
BEHALTEN!
Meine Patienten können:
1. Accu-Chek Blutzuckermessgerät* mit der mySugr App** verbinden.

2. Messwerte automatisch übertragen und zusätzliche Informationen hinzufügen.
3. Analysen & Reports ansehen, und z.B. als PDF per E-Mail teilen oder ausgedruckt mitnehmen.
* Accu-Chek Mobile benötigt einen Adapter [kostenlos erhältlich auf www.accu-chek.at].

** mySugr Pro ist in Verbindung mit einem Accu-Chek Blutzuckermessgeräte KOSTENLOS [statt € 27,99 jährlich].

INFO
In Österreich zugelassene Antiadiposita
Der Lipasehemmer Orlistat hemmt die intestinale Fettabsorption. Erhältlich sind eine rezeptpflichtige (3 x 120 mg) und eine OTC-Formulierung (3 x 60 mg). Die Kapseln sollen in Kombination mit fettarmen Mahlzeiten eingenommen werden. Potenzielle Nebenwirkungen sind in erster Linie gastrointestinaler Natur. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-8 %.
Naltrexon/Bupropion ist ein Kombinationspräparat aus einem Opioidantagonisten und einem Norepinephrin-Dopamin-ReuptakeInhibitor. Die maximale Dosierung beträgt 2 x 2 Tabletten täglich in einer Dosierung von Naltrexon 8 mg und Bupropion 90 mg. Die gewichtsreduzierenden Effekte kommen vermutlich durch die anhaltende Aktivierung anorexigener Neuronen im Hypothalamus zustande. Abgesehen von möglichen Nebenwirkungen, gibt es eine Reihe von Kontraindikationen wie Hypertonie, eine Anfallskrankheit oder eine frühere Bulimie oder Anorexie. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-8 %.
Liraglutid und Semaglutid sind Wirkstoffe aus der Gruppe der GLP-1Rezeptor-Agonisten, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2Diabetes entwickelt wurden und einen zentralen appetitvermindernden Effekt im Gehirn haben. Für die tägliche Injektion sind Fertigpens erhältlich. Sie sind verschreibungspflichtig. Die Dosis wird zu Behandlungsbeginn auftitriert. Mögliche Nebenwirkungen sind vorrangig gastrointestinaler Natur, Kontraindikationen z. B. eine Pankreatitis oder ein medulläres Schilddrüsenkarzinom. Durchschnittliche Gewichtsreduktion: 5-15 %. Kritisch sehen Fachgesellschaften die zunehmende Off-Label-Anwendung als Lifestyle-Medikamente zum Abnehmen.

Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3
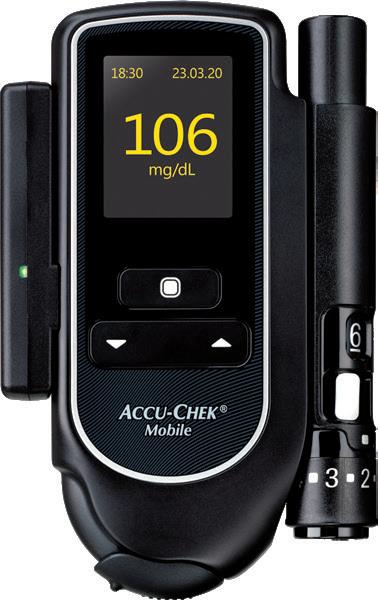
 Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK MOBILE und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern. © 2023 Roche
Simone hat Typ-2 Diabetes. Sie ist mySugr Fan.
„Am richtigen Rad drehen“
Bei starkem Übergewicht, Diabetes und/oder Hypercholesterinämie sollten auch schilddrüsenbezogene Symptome und Körperzeichen berücksichtigt werden
HAUSÄRZT:IN: Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den Cholesterinwerten und der Schilddrüsenfunktion?
Dr. FARMINI: Die Schilddrüsenhormone beeinflussen den Stoffwechsel des Cholesterins. Wenn ein Patient einen erhöhten Cholesterinwert aufweist, ist das Vorliegen einer Hypothyreose wahrscheinlich. Die Hypothyreose wird, wie schon mehrmals publiziert, häufig bei Patienten diagnostiziert, die von einer Hypercholesterinämie betroffen sind.1-5 Im Rahmen der Colorado-Studie, an der fast 26.000 Menschen teilnahmen, wurden der TSH-Wert und die Lipidwerte analysiert.6 Eine signifikante Zunahme der Cholesterin- und LDL-Werte ließ sich bei einem TSH zwischen 5.1 und 10 mI E/L nachweisen. Bereits zwischen 1923 und 1930 wurde das Senken des Cholesterinlevels im Blut durch die Therapie mit Schilddrüsenhormonen in Tests mit Tieren und Menschen beschrieben.7 Eine Reihe von Studien, darunter die Basel-Thyroid-Study, konnte dieses Ergebnis im Laufe der Jahre bestätigen.8-10

Über welche Wege können die Schilddrüsenhormone den Cholesterinspiegel senken?
1. Durch Unterdrückung des TSH: Das TSH erhöht die Expression und reduziert die Inaktivierung des HMGCR (3-Hydroxy-3-Metylglutaryl-CoenzymA-Reduktase).11-12 Das ist das Schlüsselenzym für die Bildung des Cholesterins. Somit wird auf diese Weise die Produktion desselben gefördert. Dank ihrer Wirkung als HMGCR-Inhibitoren werden u. a. Statine zur Therapie der Hypercholesterinämie eingesetzt.
2. Durch Aktivierung der Cholesterin-7α-Hydroxylase, eines Enzyms zum Abbau des Cholesterins und zur Auscheidung in die Gallenflüssigkeit.13
3. Durch Reduzierung der Synthese des Apo-B-100, das zu einem Abfall des LDL führt.
4. Durch Erhöhung der LDL-Rezeptoren, mit konsequentem Abtransport des LDL aus dem Blut.
Die lipolythische Wirkung entfaltet sich über die Bindung an den Schilddrüsenrezeptor TRβ 14 Auch einige Medikamente, die als TRβ-Agonisten wirken, haben einen
ähnlichen Effekt gezeigt. Im Praxisalltag kann man regelmäßig beobachten, wie im Zuge einer Optimierung der Schilddrüsenkonstellation das Cholesterin gesamt, aber auch das LDL und die Triglyceride abfallen. Ebenso ist das gelegentlich bei der Gabe von Withania somnifera, auch bekannt als Ashwagandha, zu beobachten.15-16
Was bedeutet das für Vorsorge, Diagnose und Therapie?
In der Diagnostik ist es sehr wichtig, die schilddrüsenbezogenen Symptome und Körperzeichen zu erkennen, weil dadurch ursachenbezogene Medizin und nicht nur Symptommedizin angewandt werden kann. Viele Krankheitsbilder resultieren aus zu geringer Energie, die von einer zu schwachen Schilddrüsentätigkeit ausgehen kann. Oft wird am „falschen Rad gedreht“, welches lediglich die Konsequenz eines Systemfehlers ist, die Ursache wird jedoch übersehen. Es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, dass optimale Schilddrüsenwerte das Risiko einer Herzerkrankung, einer Demenz, einer Insulinresistenz und der Sterblichkeit nach Herzinfarkt reduzieren können.18-20

Hausärzt:in politisch 17 März 2023
Dr. Armando Farmini, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit den Schwerpunkten Onkologie und Endokrinologie mit Wahlarztpraxis in Salzburg, im Gespräch.
© shutterstock.com/GAS-photo >
© Isabelle Farmini
Inwiefern spielen Übergewicht und/oder Diabetes hinein?
Die Hypothyreose korreliert mit dem Körpergewicht, sodass man bei einer Überproduktion von Schilddrüsenhormonen an Gewicht verlieren kann, bei einem Defizit ist eine Gewichtszunahme zu erwarten. Die Hypothyreose kann zu Übergewicht oder zu Erkrankungen führen, die mit Übergewicht in Zusammenhang stehen, etwa zum Metabolischen Syndrom, zur arteriellen Hypertonie, zur Hyperglykämie und Dyslipidämie.21-23 Zahlreiche Studien bestätigen die Zusammenhänge (siehe INFO).
Gibt es gender- und altersbedingte Unterschiede?
Eine große Studie von 2015 untersuchte in etwa 13.000 Menschen und stellte fest, dass die Hypothyreose, definiert als TSH von > 5.0, bei Frauen häufiger auftritt als bei Männern und die Tendenz zur Hypothyreose mit dem Alter bei beiden Geschlechtern steigt.30 Wie in Abbildung 1 gezeigt wird, sinken mit zunehmendem Alter die Produktion vom aktiven Hormon T3 und das Verhältnis von T3 zu T4.31
Was ist Ihnen noch wichtig, den Hausärzt:innen zu diesem Themenkomplex zu vermitteln?
In der Diagnostik der Schilddrüse würde ich empfehlen, immer die Hormone T3 und T4 (den freien Anteil) und die Autoantikörper gegen TPO und Thyreoglobulin erheben zu lassen. Dank der Messung der Autoantikörper kann man einen Autoimmunprozess erkennen, der sonst mit einer Hypooder Hyperthyreose verwechselt werden könnte.
Der erste Vorteil von T3 und T4 besteht darin, dass sie stabiler sind als das TSH. Das kann man in wiederholten Messungen im Abstand von wenigen Tagen oft erkennen. Der zweite Vorteil der Messung von T3 und T4: Man kann erkennen, wie viele Patienten unter der Therapie mit einem T4-Präparat daraus genug T3 produzieren, und das kann mit den angegebenen Symptomen korreliert werden.
Können Sie uns ein Beispiel aus Ihrer Praxis nennen?
Ein Patient kommt mit typischen Schilddrüsensymptomen – wie Kälteempfindlichkeit, Verstopfung, depressive Verstimmung, Müdigkeit –, die Laboranalyse zeigt ein nicht optimales Schilddrüsenprofil und der Patient erhält ein T4-Präparat. Bei der ersten Kontrolle sollte man in der Blutanalyse erkennen, dass die Menge von fT4 und fT3 zunimmt, und die Symptome sollten sich
reduzieren. Manchmal passiert es aber, dass die Symptome in gleicher Stärke vorhanden sind, und man sieht im Labor einen Anstieg des fT4, nicht aber des fT3. In diesem Fall könnte man eventuell auf ein T3-T4-Präparat umsteigen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass ein niedrigeres T3 das Risiko unterschiedlicher Probleme erhöhen kann: das Risiko einer schwereren Herzinsuffizienz von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, das einer erhöhten Sterblichkeit von Patienten mit Lungeninsuffizienz, einer Kardiomyopathie oder eines Schlaganfalls sowie der Entstehung von Schilddrüsenkarzinomen.32-37
Neben dem bekannten Hormon T3 gibt es laut aktueller Studienlage ein zweites aktives Schilddrüsenhormon, das T2, das die Verbrauchsrate durch Mitochondrien und die Stoffwechselaktivität erhöht
INFO
Studien zum Zusammenspiel von Übergewicht, Diabetes und Hypothyreose
� Die Framingham-Offspring-Study schloss 2407 Teilnehmer ein und beobachtete sie über 3,5 Jahre. Bei den Teilnehmern mit dem TSH in der untersten Quartile war das Gewicht zu Beginn der Studie niedriger und erhöhte sich bis zur letzten Quartile. Die Zunahme des TSH im Laufe der Studie korrelierte positiv mit einer Gewichtszunahme der Teilnehmer.24
� Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit für ein Kind mit Diabetes mellitus Typ 1, an Hypothyreose zu erkranken, 24 Mal höher als für Kinder ohne Diabetes mellitus.25
� In Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 findet man häufiger eine subklinische Hypothyreose als in der gesunden Bevölkerung. Das Vorliegen einer subklinischen Hypothyreose kann das Risiko erhöhen, Komplikationen des Diabetes zu erleiden: Nephropathie (OR 1.74), Retinopathie (OR 1.42), periphere Gefäßerkrankung (OR 1.85), Neuropathie (OR 1.87).26-27
� Auch das Risiko eines Diabetes mellitus in der Schwangerschaft ist sowohl bei der subklinischen Hypothyreose (OR: 1.558) als auch bei der Hypothyreose (OR 1.892) erhöht.28
Abbildung 1 – A: TSH-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). B: fT3/fT4-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). C: fT3-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau). D: fT4-Verlauf bei Frauen (rot) und Männern (blau).
� Eine Studie von 2019 untersuchte die Schilddrüsenhormone (fT3, fT4 und fT3/fT4) von Patienten, die gerade einen Schlaganfall erlitten hatten, und korrelierte sie mit den Symptomen einer Depression. Sowohl in der akuten (OR 1.85) als auch in der subakuten (OR 2.5) Phase korrelierte das niedrige fT3 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln.29
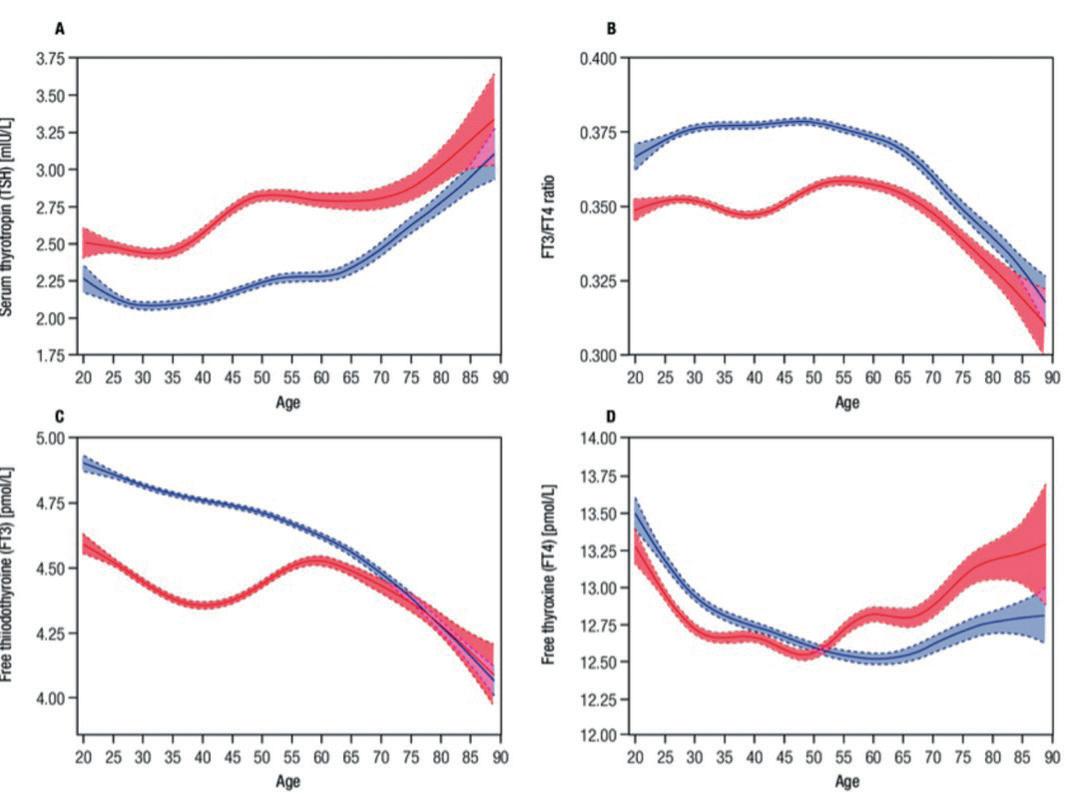
Hausärzt:in politisch 18 März 2023
Alter Alter Alter Alter Serum thyrotropin (TSH) {mlU/L} FT3/FT4 ratio Free thiiodothyroine (FT3) {pmol/L} Free thyroxine (FT4) {pmol/L}
und Fettleibigkeit, die durch eine fettreiche Ernährung verursacht wird, verhindern kann.38
Wann ist die Überweisung zu Fachärzt:innen wichtig?
Die Überweisung zum Facharzt sollte zur Abklärung von Auffälligkeiten der Schilddrüsenechostruktur, bei besonderen Fragestellungen, zur nuklearmedizinischen Diagnostik oder zur Planung einer Knotenentfernung erfolgen. Die Zusammenarbeit von Kollegen sollte auf Offenheit, Ehrlichkeit und Patientenorientierung beruhen. Unsere Patienten berichten uns die eigene Geschichte, die Symptome, die körperlichen Zeichen – und die Laborwerte untermauern den klinischen Verdacht. Die wissenschaftlichen Publikationen zur Unterstützung unserer Expertise liegen vor. Es geht nun darum, für die Patienten den maßgeschneiderten Weg zum Wohlbefinden auszuwählen. Der Mensch ist ein einzigartiges System und eine Therapiemöglichkeit passt nicht zu allen. Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
X HAUSÄRZT:IN-Buchtipp
Deine Schilddrüse
Wie sie Gesundheit, Charakter und Beziehungen prägt
Von Armando Farmini Verlagshaus der Ärzte 2022
Referenzen:
1 Sampaolo G, Recenti Prog Med. 2014 Feb;105(2):79-82.
2 Morris MS, Atherosclerosis. 2001 Mar;155(1):195-200.
3 Abrams JJ, J Lipid Res. 1981 Feb;22(2):323-38.
4 Duntas LH, J Indian Med Assoc. 2008 Apr;106(4):240, 242.
5 Gupta S, Thyroid. 2002 Apr;12(4):287-93.
6 Canaris GJ, Arch Intern Med. 2000 Feb 28;160(4):526-34.
7 Mason RL, New England Jr. 1930.
8 Xong X, Medicine (Baltimore). 2016 Jul;95(29):e4291.
9 Sauter G, Horm Metab Res. 1997 Apr;29(4):176-9.
10 Meier C, J Clin Endocrinol Metab. 2001 Oct;86(10):4860-6.
11 Tian L, Hepatology. 2010 Oct;52(4):1401-9.
12 Zhang X, Journal of Lipid Research. 2015;56(5):963-71.
13 Ness GC, The Journal oft he Florida Medical Association, 01 Jun 1991, 78(6):383-5.
14 Gullberg H, Mol. Endocrinol., 16 (2002), pp. 1767-1777.
15 Andallu B, Indian Journal of Experimental Biology 38, no. 6 (2000): 607-609.
16 Ojha SK, World J Med Sci 4, no. 2 (2009): 156-158.
17 Neves JS, Int J Cardiol. 2019 Jun 15;285:115-120.
18 Quinlan P, Psychoneuroendocrinology. 2019 Jan;99:112-119.
19 Wang CY, Sci Rep. 2018 Jul 16;8(1):10685.
20 Suda S, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Oct;27(10):2804-2809.
21 Mehran L, Horm Metab Res. 2017 Mar;49(3):192-200.
22 Sieminska L, Endokrynol Pol. 2015;66(5):394-403.
23 Hamlaoui ML, Diabetes Metab Syndr. 2018 Jan-Mar;12(1):1-4.
24 Fox CS, Arch Intern Med. 2008 Mar 24;168(6):587-92.
25 Spaans E, J Pediatr. 2017 Aug;187:189-193.e1.
26-27 Han C, PLoS One. 2015 Aug 13;10(8):e0135233.
28 Gong LL, Taiwan J Obstet Gynecol. 2016 Apr;55(2):171-5.
29 Taroza S, J Psychosom Res. 2019 Jul;122:29-35.
30 Meng Z, Medicine (Baltimore). 2015 Dec; 94(49): e2186.
31 Chen X, Arch Endocrinol Metab. 2020 Feb;64(1):52-58.
32 Chen P, The America Journal of the Medical Sciences. Vol 350, Iss 2, Aug 2015, Pages 87-94.
33 Scoscia E, European Journal of Endocrinology (2004) 151 557–560.
34 Kozdag G, European Journal of Heart Failure.
35 Pingitore A, The American Journal of Medicine. Vol 118, Iss 2. Feb 2005. Pages 132-6.
36 Suda S, J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Oct;27(10):2804-2809.
37 Jonklaas J, Thyroid. 2008 Sept 12. Vol 18, No 9.
38 Senese R, Journal of Endocrinology (2014) 221, R1–R12.
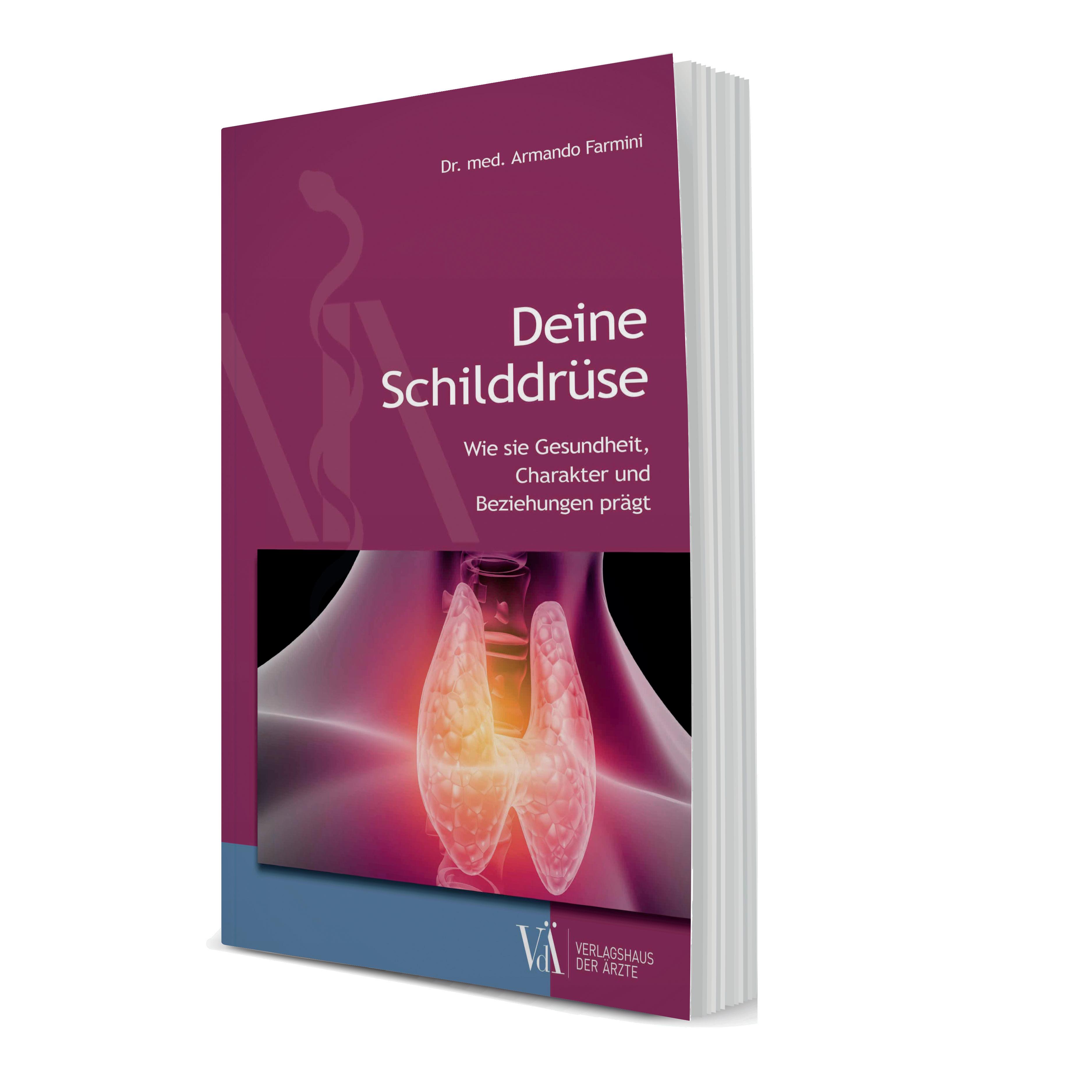
Herz-Gehirn-Kohärenz
Wie die Atmung Körper und Geist in Balance bringt
Dieser Tage scheint Atmung in aller Munde zu sein. „ Breathworks“ und Atemseminare schießen wie Pilze aus dem Boden und versprechen heilende Wirkungen auf seelische, körperliche und psychosomatische Beschwerden. Doch hat die Atmung tatsächlich solch eine große Wirkung auf unser Körper-Geist-System? Die einfache Antwort ist: Ja, das hat sie. Nicht nur beeinflusst sie über das Einatmen von Sauerstoff und das Ausatmen von Kohlendioxid maßgeblich den Säure-Basen-Haushalt des Organismus, sie spielt auch bei der Emotionskontrolle und -verarbeitung eine wesentliche Rolle. Langsames Atmen sowie eine Verlängerung der Ausatemphase führen bekannterweise zu mehr

GASTAUTOR:
Vom Durcheinander zum Zusammenspiel
Dr. Wolf-Dieter Nagl Arzt für Allgemeinmedizin, Psychosomatische Medizin und Medizinische Hypnose in Mödling, Buchautor und Keynotespeaker

Entspannung und können Ängste reduzieren. Die Atmung ist darüber hinaus aber auch der zentrale Rhythmusgeber im Körper und damit in der Lage, einen Zustand zu erzeugen, den man Kohärenz nennt.
Der menschliche Körper besteht bekanntlich aus Organsystemen, die eine dreidimensional-anatomische Struktur aufweisen. Manche seiner Organfunktionen zeigen rhythmische Aktivitäten, die sich über die Zeit messen und sich gemäß der Chronobiologie als „ zeitlich-anatomische“ Frequenzstrukturen darstellen lassen. So haben etwa Herz und Atmung ihre individuelle Frequenz, wie auch das Gehirn je nach Aktivität bestimmte Hirnfrequenzen erzeugt. Die Körperdrüsen schütten ihre Hormone und Enzyme in rhythmischen Abständen aus und auch der Blutdruck unterliegt permanenten Frequenzschwankungen. Im üblichen Trubel des Alltags arbeiten all diese Organe in ihren eigenen Rhythmen und passen sich, gesteuert vom autonomen Nervensystem, den Herausforderungen des jeweiligen Moments an. Dabei entsteht untertags häufig ein wildes Durcheinander von Körperrhythmen, die alle ihrer eigenen Wege gehen –ein Zustand, den man Inkohärenz nennt. Vergleichen lässt er sich mit einem Or-
chester ohne Dirigent, in dem jeder Musiker in seinem eigenen Takt vor sich hin spielt. Die Folge ist eine Kakophonie an Klängen und Rhythmen, die Disharmonie und Stress erzeugen kann. Hingegen sorgt das harmonische Zusammenspiel dieser rhythmischen Elemente im Organismus für Ruhe und Balance. Die Kohärenz, also das „Aufeinanderhören“ sämtlicher oszillierender Organsysteme, lässt sich beim Menschen meist nur in den Tiefschlafphasen beobachten, in welchen sich der Körper maximal regeneriert und von den Strapazen des Tages wieder erholt. Durch eine Messung der Herzratenvariabilität kann man beobachten, wie sich im Schlaf die Herzfrequenz an die Atemfrequenz anpasst und beim Einatmen ansteigt sowie beim Ausatmen abfällt. Die respiratorische Sinusarrhythmie ist Ausdruck regenerativer Entspannung und eines Zusammenspiels von Atmung und Herzschlag.
Eingangstor zum Unterbewusstsein
Das Spannende ist, dass wir nicht auf den Tiefschlaf warten müssen, um diesen heilsamen Effekt zu bewirken. Denn jeder Mensch hat die erstaunliche Fähigkeit, jene Regeneration im Körper bewusst zu erzeugen – und zwar über langsames und rhythmisches Atmen. Alle inneren Organe werden vom autonomen Nervensystem unwillkürlich gesteuert und entziehen sich somit unserer bewussten und willkürlichen Kontrolle. Alle ... bis auf eine Ausnahme: die Atmung! Sie ist, wenn man so möchte, das bewusste Eingangstor zur unbewussten Innenwelt des autonomen Nervensystems und der stärkste Rhythmusgeber
AKTUELL
Das nächste Seminar „Die Kraft des Bewusstseins“ zum Erleben der Meditation und Vertiefung der Herz-Gehirn-Kohärenz findet am 25. und 26. März 2023 in Schloss Puchberg statt. Nähere Infos und weitere Veranstaltungen unter: drwolfdieternagl.com
Hausärzt:in medizinisch 20 März 2023
©
IMAGES
© Harald Eisenberger
shutterstock.com/GAGO
„Die Atmung ist die Dirigentin des Lebens.“
Abbildung: Kohärenz der Körperrhythmen bei meditativer Atemübung.
des Körpers. Über sie lassen sich Organfunktionen und Körperrhythmen willentlich beeinflussen und harmonisieren. Ein idealer Atemrhythmus für das Erzeugen der Kohärenz ist der Fünf-Sekunden-Rhythmus: Für wenige Minuten wird ruhig und gleichmäßig fünf Sekunden lang ein- und fünf Sekunden lang ausgeatmet. Hierbei beginnt das Herz plötzlich, sich an den Atemrhythmus „a nzulehnen“ und sozusagen auf die Atmung zu hören. Beide Systeme fangen an, in einem geordneten Verhältnis zueinander zu arbeiten. In der Folge wird über den Barorezeptorreflex auch der Blutdruckrhythmus in diese Ko-
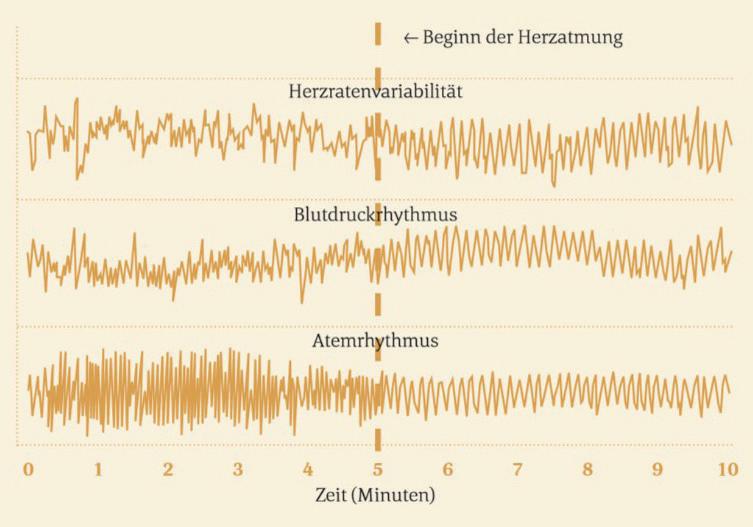
härenz „h ineingezogen“ und synchronisiert sich wiederum mit dem Herzschlagmuster. Die Abbildung links zeigt, wie durch jene „ Herzatmung“ der regenerierende Zustand der Kohärenz entsteht. Dies führt zu einem optimalen Gasaustausch in den Lungen, zu einem Senken des Blutdrucks und zur Beruhigung der Gehirnfrequenzen.
Selbstwirksamkeit erleben
Wird während dieser Übung die gesamte Aufmerksamkeit auf den Atemvorgang gerichtet – und gespürt, wie sich die Bauchdecke über den Verlauf der Atmung hebt und senkt –, dann beruhigt sich auf natürliche Weise auch der Geist. Denn entzieht man den Gedanken die Aufmerksamkeit, weil sie vollständig auf die Atmung gerichtet ist, werden die Gedanken weniger und kommen zur Ruhe. Im Gehirn kann man dabei mittels EEG messen, dass sich auch die Gehirnfrequenzen verlangsamen und von den hochfrequenten Betawellen des Alltagsbewusstseins zu den niedrigeren Alphawellen der Entspannung gelangen.
Die Fünf-Sekunden-Herzatmung bewirkt also eine Synchronisation sämtlicher Körperrhythmen und bringt das KörperGeist-System in eine heilsame Balance. Die Atmung ist die Dirigentin des Lebens und wenn wir diese bewusst einsetzen, schwingen wir uns selbst aufs Dirigentenpult. Wir erleben, dass wir selbstwirksam sind und unsere Gesundheit positiv beeinflussen können.
Hausärzt:in medizinisch
<
© Wolf-Dieter Nagl
Quelle: „Denke, was dein Herz fühlt“ – Wolf-Dieter Nagl, 2021, Kneipp Verlag Wien.
Zu viel verlangt?
Evidenzbasierte Verordnung in der Allergologie
Die Allergieimmuntherapie (AIT) stellt die einzige kausale Behandlung von Allergien dar. Für den Erfolg dieser mehrere Jahre dauernden Therapie ist die Patientenadhärenz ein wesentlicher Faktor. Doch was hilft dem Patienten die beste Therapietreue, wenn im Laufe seiner Behandlung das eingesetzte Präparat aufgrund nicht ausreichender Wirksamkeit oder nicht erbrachter Nachweise zur Wirksamkeit vom Markt genommen wird und nicht mehr verfügbar ist? Mehr noch, welches Vertrauen in die AIT und seinen behandelnden Arzt hat ein Patient weiterhin, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass seine bisherige Therapie den Wirksamkeitsbeweis schuldig geblieben ist?

Therapieallergene-Verordnung in Deutschland
Vor der Einführung der Therapieallergene-Verordnung (TAV) 2008 in Deutschland standen in deren Geltungsbereich noch über 6.600 nicht zugelassene Therapieallergene für die häufig vorkommenden Allergene zur Verfügung. Für 123 dieser Präparate wurden schließlich Anträge auf Zulassung eingereicht, mit dem Ziel, in einem klinischen Entwicklungsprozess ihre Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit nachzuweisen. Der TAV-Prozess stellt dabei eine Ausnahme im Bereich der arzneimittelrechtlichen Zulassungsprozesse dar, gelten die Therapieallergene doch bereits ohne entsprechende Nachweise als verkehrsfähig und stehen damit weiter als Therapieoption zur Verfügung.

Über 13 Jahre nach dem Inkrafttreten der TAV ergab ein systematischer Review der TAV-Studien, dass lediglich zwei Präparate (ein Studienprogramm) erfolgreich den Zulassungsprozess durchlaufen haben, der nach mehrmaliger Verlängerung der Übergangsfrist 2026 abgeschlossen sein soll. Dieses ernüchternde Ergebnis wurde durch ein Update im Oktober 2021 be-
AKTUELL
Pollenbelastungen setzen früher ein
Bereits Anfang Jänner waren die ersten Haselpollen in der Luft – fast ein Monat früher als im langjährigen Schnitt. Auch die Erle steht bereits in ihrer vollen Blüte.1 Verursacht wird der vorzeitige Pollenflug durch die Klimaerwärmung. Allergiker sollten sich zunehmend auf diese früher einsetzenden Belastungen einstellen und rechtzeitig vorsorgen. Eine allergen-spezifische Immuntherapie (AIT) kann sowohl subkutan als auch sublingual (in Form von Tabletten oder Tropfen) verabreicht werden. Oft wird bei rechtzeitigem Therapiebeginn dadurch schon in der bevorstehenden Pollensaison eine deutliche Besserung des Beschwerdebildes erzielt.
Je früher, desto besser
„Bei einer Allergie verkennt das Immunsystem die eingeatmeten Pollenkörner als Bedrohung und wehrt sie ab. Diese daraus resultierenden Beschwerden müssen rasch behandelt werden, damit sich die allergische Entzündung von den oberen nicht in die unteren Atemwege ausbreitet und eine chronische Asthma-Erkrankung verursacht“, erklärt Assoz. Prof. Priv.-Doz. DDr. Peter Valentin Tomazic von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Graz die Bedeutung einer frühzeitigen Therapie. Antiallergische Medikamente wie Antihistaminika und KortisonSprays lindern die Symptome zwar schnell und gut, eine langfristige Erleichterung bietet jedoch nur die AIT. Hierbei wird das Allergen über einen Zeitraum von etwa drei Jahren zugeführt und es kommt zu einem Gewöhnungseffekt. „Die Therapie greift unmittelbar in den Krankheitsprozess ein und nimmt damit nicht nur die Symptome, sondern vor allem auch die Ursache der Allergie ins Visier“, erklärt Prof. Tomazic.
Der beste Zeitpunkt, um das gestresste Immunsystem zu kurieren, ist die pollenfreie Zeit. Ein Therapiestart ist aber grundsätzlich auch während der Allergiezeit möglich. Jedoch: „Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto größer sind die Aussichten auf Linderung und das Aufhalten des allergischen Marsches in die unteren Atemwege.“ Betroffenen wird daher empfohlen, ehebaldigst eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für HNO-, Lungen- oder Hauterkrankungen aufzusuchen, um die Beschwerden abzuklären und mit einer Therapie starten zu können. Dadurch sind sie gut für die kommende Pollensaison gerüstet – die vermutlich früher als erwartet kommt. PA/InP
1 pollenwarndienst.at (abgerufen am 13.3.23)
Hausärzt:in medizinisch 24 März 2023
©
© privat
shutterstock.com/nito
GASTAUTOR: Dr. Andreas Horn HNO-Arzt und Allergologe in Heidelberg
stätigt. Bemerkenswert ist, dass trotz des zeitlich fortgeschrittenen Prozesses für einen nicht unerheblichen Teil (10) der Präparate weiterhin keine zielführende Studienaktivität im Rahmen der TAV nachgewiesen werden kann und der verbleibende Teil (18) keine Studienergebnisse zeitigt, die auf eine baldige Zulassung schließen lassen. Dass die Therapie mit nicht zugelassenen Präparaten zu einer unsicheren Patientenversorgung führt, zeigen die letzten Monate, in denen es wegen verweigerter Chargenfreigaben und Vertriebsstopps von TAV-Präparaten zu Marktrücknahmen von 17 Präparaten und damit zu Therapieumstellungen bzw. -abbrüchen in Deutschland kam. Leidtragende waren dabei ca. 25.000 Patientinnen und Patienten.
Österreich – ein Wandel in Sicht?
Während die TAV in Deutschland zumindest in absehbarer Zeit abgeschlossen sein sollte, ist ein entsprechender Prozess in Österreich noch nicht initiiert. Allerdings könnte sich das in naher Zukunft ändern, was unter anderem die Kommentare der österreichischen Fachgesellschaften im Rahmen der Europäischen Leitlinie zur Harmonisierung regulatorischer Prozesse bei den Therapieallergen verdeutlichen: Bekundet werden Interesse und Unterstützung für die Implementierung eines mit der TAV vergleichbaren Prozesses für die Hauptallergene in Österreich.
Ein Blick auf den österreichischen Markt zeigt: Präparate, die sich im deutschen TAV-Prozess befinden und bei denen im Rahmen der Phase-IIIStudien regelmäßig die aktuelle Marktdosis um ein Vielfaches erhöht werden musste (teilweise um einen Faktor von > 5), verweilen unverändert am österreichischen Markt. Darüber hinaus sind in Österreich weiterhin Produkte verfügbar und verordnungsfähig, für die kein Zulassungsantrag bei der deutschen Zulassungsbehörde (Paul-Ehrlich-Institut) gestellt wurde oder die bereits, teilweise aufgrund mangelnder Wirksamkeitsbelege, vom Markt genommen wurden. Diese Umstände lassen erahnen, weshalb der österreichische Therapieallergene-Markt ak-
tuell vereinzelt als „ Resteverwerter“ bezeichnet wird.
AIT-Leitlinie als Wegweiser
Ein Meilenstein auf dem Weg zur evidenzbasierten Versorgung ist die 2014 vorgestellte S2k-Leitlinie zur AIT, in der die Autorinnen und Autoren (u. a. die ÖGAI) erstmals die Empfehlung für die Therapie mit zugelassenen Allergenpräparaten mit dokumentierter Wirksamkeit und Sicherheit aussprachen. Zudem wurde die produktspezifische Bewertung der Datenlage hervorgehoben, welche von der neuen, ab 2022 gültigen Leitlinie bekräftigt wurde. Zugelassene oder anderweitig verkehrsfähige Allergenpräparate, die eine positive Nutzen-Risiko-Bilanz gemäß EMAGuidelines haben, sollen bevorzugt eingesetzt werden. In Tabellen wurde zusammenfassend die klinische Dokumentation je Präparat bei den Allergenen Gräser, Bäume und Hausstaubmilben zur besseren Orientierung dargestellt. Anders als bei ihren Vorgängern richtet sich der Fokus in den aktuellen Tabellen stärker auf den Zulassungsstatus sowie die klinischen Wirksamkeitsstudien außerhalb bzw. die klinische Entwicklung innerhalb des TAV-Prozesses. Auch Studien mit Kindern und Jugendlichen werden nun produktspezifisch abgebildet. Die neue Darstellung der Informationen ermöglicht noch mehr Transparenz, bringt dadurch jedoch auch eine höhere Komplexität mit sich. Somit wird eine Bewertung der heterogenen Studienqualität erschwert. Für die aktuelle Leitlinie wäre das allerdings insofern wichtiger, als die Abbildung der Wirksamkeitsstudien – anders als in der vorherigen Version – nicht daran geknüpft ist, dass die von der World Allergy Organization (WAO) definierten Kriterien für evidenzbasierte Nachweise erfüllt wurden. Zu den WAO-Kriterien zählen u. a. die Randomisierung, die Doppelverblindung, ein placebokontrolliertes Studiendesign, die Angabe eines Symptommedikationsscores sowie die mindestens um 20 % über Placebo liegende Wirksamkeit des Verums. >
Mangelnde Vergleichbarkeit
Ohne die Vergleichbarkeit von Studien einzelner Präparate gibt die Evidenz dieser Präparate lediglich Auskunft über die Sicherheit des Nachweises, nicht jedoch über die Qualität. Aussagen zur Wirksamkeit lassen sich somit nicht allein durch die bloße Existenz von klinischen Studien treffen. Hierbei sind Ausmaß und Aussagekraft der entsprechenden klinischen Endpunkte entscheidend. Die Wirksamkeit ist durch das Einhalten standardisierter klinischer Prüfparameter wie die der WAO nachzuweisen. Auch tragen angewandte Studiendesigns publizierter Studien zur Heterogenität der Ergebnisse und damit zu Verzerrungen bei. So erfordern Zulassungsstudien in der Regel Auswertungsverfahren, in die möglichst alle teilnehmenden Probanden einbezogen werden (Intention-to-Treat oder Full-Analysis-Set). Nur dadurch werden erhebliche Verzerrungen vermieden, welche häufig noch in älteren Studien mit Per-Protocol-Verfahren und damit verbundenem Ausschluss von größeren Teilpopulationen auftraten. Aus diesen Gründen ist bspw. ein Evidenzlevel 1a nach der EAACI-Guideline, welches von einzelnen AIT-Herstellern beworben wird, nicht mit einer entsprechenden Güte der Wirksamkeit gleichzusetzen – sonst hätten entsprechende TAV-Präparate vermutlich bereits eine Zulassung erhalten. Ein Anzeichen dafür, dass sich auch künftig wenig am Zulassungsstatus dieser Präparate ändern wird: Weiterhin sind kaum zulassungsrelevante Studienaktivitäten erkennbar und selbst die in Phase-IIStudien als optimal definierten höheren Dosierungen können die modernen Anforderungen an die Zulassung bisher größtenteils nicht erfüllen.
Fazit: Zulassung und Wirksamkeit ausschlaggebend Unter evidenzbasierter Verordnung ist vor allem die Evidenz der Wirksamkeit zu verstehen. Auf diese kann auch in Österreich schon heute zurückgegriffen werden, schließlich stehen genügend durch das Paul-Ehrlich-Institut zugelassene und geprüfte Präparate für alle häufigen Allergene zur Verfügung.1
Referenz:

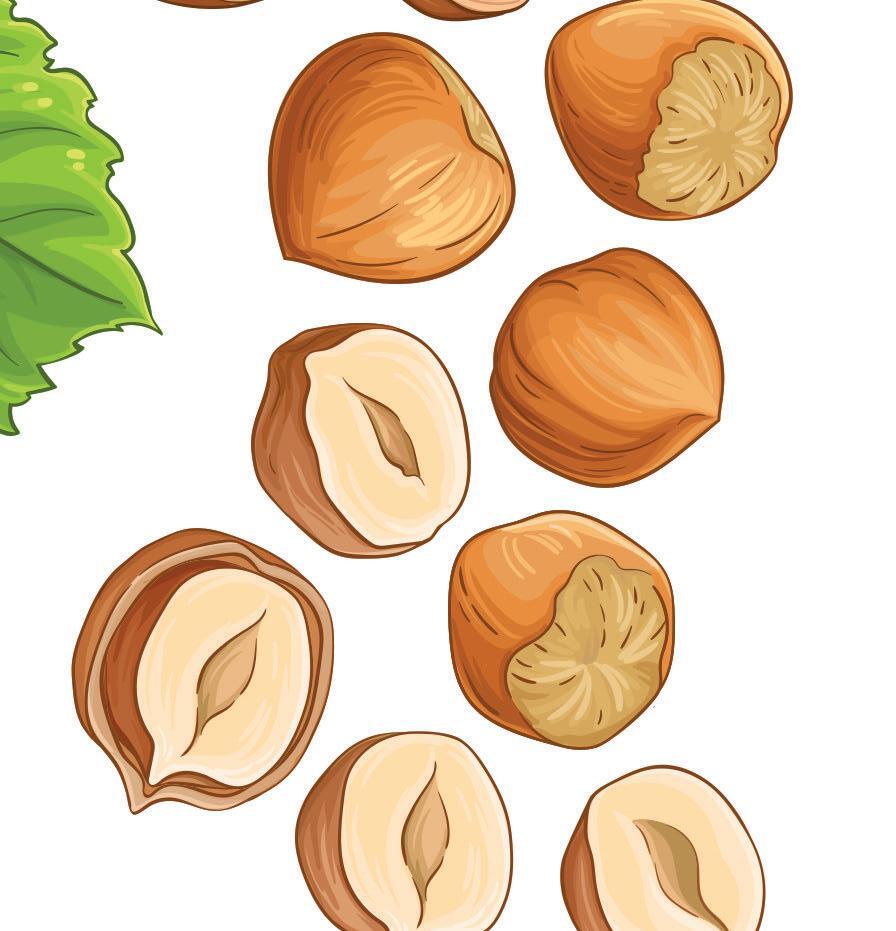



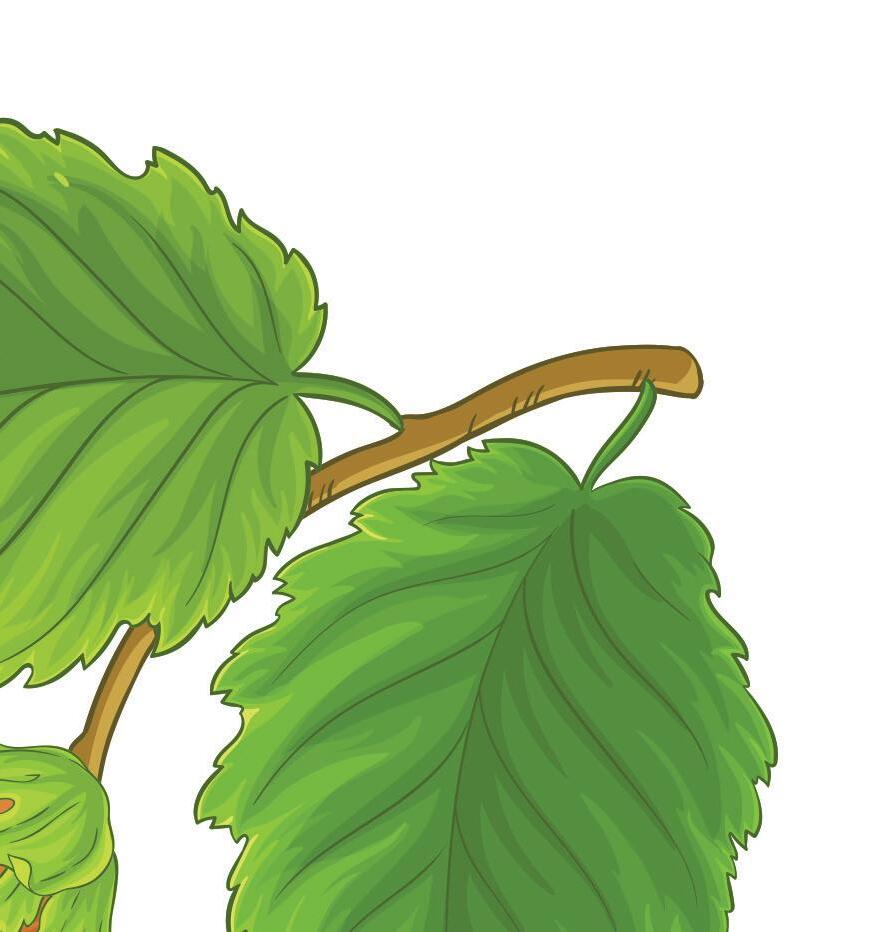
1 Die durch das Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Präparate sind zu finden unter: pei.de/DE/arzneimittel/allergene/allergene-node.html



NACHBERICHT

Gastautor Dr. Horn war Vortragender bei „DERM Alpin: Der internationale Kongress in deutscher Sprache“, 28.-30. Oktober 2022, Congress Salzburg.

<
© shutterstock.com/cuttlefish84 © shutterstock.com/Kate Romenskaya
Tabuthemen in der Onkologie
Stuhl-, Harninkontinenz sowie Stomaversorgung als Folgen der Behandlung eines Kolorektalkarzinoms
Die deutliche Mehrzahl der bösartigen Tumoren im Darm entsteht im Dickdarm (Kolon). Etwa 95 Prozent aller Darmtumoren sind Karzinome. Bei den übrigen fünf Prozent handelt es sich um neuroendokrine Tumoren, Plattenepithelkarzinome, Lymphome und kleinzellige Karzinome. Kolonkarzinome entwickeln sich meist aus Polypen der Dickdarmschleimhaut. Bis zu 50 Prozent der Karzinome befinden sich im Rektum, 30 Prozent im Sigma, zehn Prozent im Colon ascendens und zehn im restlichen Kolon. Hierbei ist das Kolonkarzinom das dritthäufigste Karzinom bei Männern und das zweithäufigste bei Frauen. Mit einem mittleren Erkrankungsalter von knapp 70 Jahren tritt es überwiegend im höheren Lebensalter auf, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr nimmt es deutlich zu.
Funktionelle Störungen wenig beachtet
„Die Tumorchirurgie hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Behandlung von Kolorektalkarzinomen“, betont Prim. Prof. Dr. Matthias Biebl, Leiter der Abteilung für Chirurgie am Ordensklinikum Linz, „denn fast immer besteht der einzige kurative Ansatz darin, den Tumor chirurgisch komplett zu entfernen. Oft wird der Eingriff um eine Chemotherapie bzw. um radioonkologische Verfahren ergänzt “ Für die chirurgische Sanierung eines Kolorektalkarzinoms sind verschiedene primäre Qualitätsindikatoren defi-

niert. Dazu zählen: 30-Tage-Mortalität, (MTL30, Zahl jener Patientinnen und Patienten, die 30 Tage nach einer Kolonresektion verstorben sind oder sich noch in stationärer Behandlung befinden), Wundeffekt, Anastomoseninsuffizienz sowie die Anzahl resezierter Lymphknoten, die größer als zwölf sein sollte. Prim. Biebl fügt hinzu: „Keine Berücksichtigung finden hingegen funktionelle Probleme “ Dies steht im klaren Widerspruch zu dem, was für Betroffene nach einer Darmkrebsoperation größte Relevanz hat: Bei einer Umfrage gaben diese an, dass es ihnen nach der Operation am wichtigsten sei, „kein permanentes Stoma zu haben“ und „von Krebs geheilt zu sein“ Prim. Biebl weiß: „ Auch bei der Aufklärung der Patientinnen und Patienten steht das primäre Ziel, die Krebserkrankung zu heilen, im Vordergrund. Viel zu wenig Beachtung findet hingegen der Umstand, dass sich aus der Behandlung eine Vielzahl funktioneller Störungen ergeben kann “ Dazu gehören Stuhl- und Blasenentleerungsstörungen, Sexualfunktionsstörungen sowie chronischer Schmerz im Bereich des Beckenbodens. Und auch in vielen Studien sind funktionelle Beeinträchtigungen höchstens sekundäre Endpunkte.
Ursachen funktioneller Beschwerden
„Die Mehrheit der Kolorektalkarzinome befindet sich im unteren Dickdarm, wes-
halb häufig eine Hemikolektomie links – mit oder ohne Mastdarmentfernung – samt zirkulärer Klammernahtanastomose durchgeführt wird. Das Problem besteht darin, dass das Rektum in seiner Gesamtheit ein bedeutendes Organ ist. Nicht nur der Schließmuskel, sondern auch die Reservoirfunktion des gesamten Rektums ist für die Kontinenz essentiell. Daneben hat die Intaktheit der Nerven in und um das Rektum in Richtung des kleinen Beckens eine entscheidende Bedeutung“, erklärt Prim. Biebl. Ein wesentlicher Punkt bei einer Rektumoperation betrifft daher auch die Schonung der Nervenversorgung von Blase und Geschlechtsorganen. Diese Nerven verlaufen sehr dicht am Enddarm und sollten bei der Behandlung durch entsprechend geschulte Chirurginnen und Chirurgen erhalten bleiben. So lassen sich Blasenentleerungsstörungen meist vermeiden. Prim. Biebl erläutert: „Eine Blasenentleerungsstörung kann einen dauerhaften Katheder bedeuten, was für die Patientinnen und Patienten schwierig ist. Eine Langzeitstörung der Blasenfunktion tritt bei 0,5 Prozent der Betroffenen auf “ Die Ursachen für funktionelle Beschwerden sind im Wesentlichen eine chirurgische Verletzung der Nerven, eine Vorbehandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung, eine bewusste Resektion der Nerven bei tief sitzenden großen Tumoren sowie die Höhe der Anastomose, die Anastomosentechnik und das Resektionsausmaß.
Gefahr für gestörte Darmfunktion
Eine gestörte Darmfunktion nach chirurgischer Resektion wird als tiefes vor-

Hausärzt:in medizinisch 28 März 2023
© Ordensklinikum Linz © shutterstock.com/Cliff Day
EXPERTE: Prim. Prof. Dr. Matthias Biebl Abteilung für Chirurgie, Ordensklinikum Linz
deres Resektionssyndrom (LARS; „low anterior resection syndrome“) beschrieben. Der validierte LARS-Score bemisst die Darmfunktionsstörung anhand von Stuhlinkontinenz, Stuhlfrequenz, Stuhlentleerung und imperativem Stuhldrang. „ Die Gefahr für eine gestörte Darmfunktion besteht vor allem, wenn der Tumor nahe am Schließmuskel liegt oder weit fortgeschritten ist. Bei rund 60 Prozent der Patientinnen und Patienten kommt es zu Beschwerden – funktionelle Störungen sind also eher die Regel als die Ausnahme“, beschreibt Prim. Biebl. Wenn der komplette Schließmuskel erhalten werden konnte, gibt es jedoch ein gewisses Rückbildungspotential der Beschwerden innerhalb von sechs Monaten.
Stoma: Aufklärung ist wichtig
Vor planbaren elektiven Operationen, bei denen ein künstlicher Darmausgang
(Stoma) als vorübergehende oder permanente Maßnahme geschaffen werden muss, sind die präoperative Aufklärung und die Planung der Therapie von Bedeutung. Prim. Biebl stellt klar: „Es ist wichtig, für das Stoma eine Stelle zu wählen, an der es von der Patientin oder dem Patienten gut versorgt werden kann. Die Stelle sollte unbedingt vor der Operation am Körper markiert werden. Nicht zuletzt ist auch die Kommunikation zwischen Stomaberatung und chirurgischem Fachpersonal wesentlich “
Ist ein Stoma ein Problem? „Diese Frage muss mit ja beantwortet werden“, sagt Prim. Biebl, „denn die Komplikationsrate kann bei einem Stoma immerhin bis zu 30 Prozent betragen “ Jedes dritte Stoma wächst nicht perfekt ein, es gibt Wundheilungsstörungen, es kann zur Retraktion des Stomas kommen, zum Flüssigkeitsverlust, zu Hautirritationen, zu Nekrosen, oder aber die Stomaplatte hält nicht. Ein höheres Risiko, eine
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR HAUSÄRZT:INNEN
� Eine Heilung von Darmkrebs lässt sich in der Regel am besten durch eine Kombination von einer Operation mit Tumorentfernung und einer systemischen Behandlung erzielen.
� Funktionelle Änderungen und Beschwerden sind vor allem bei Resektionen im unteren Dick- und Mastdarm sehr häufig und für die Patientinnen und Patienten belastend. Hier haben eine gute und offene Aufklärung präoperativ sowie die Betreuung postoperativ eine besonders große Bedeutung.
� Wird ein künstlicher Darmausgang (Stoma) angelegt, ist eine gemeinsame Bestimmung der späteren Lage vor der Operation für die Lebensqualität nach dem Eingriff entscheidend.
Komplikation zu erleiden, besteht, wenn ein Kolostoma angelegt wurde, bei einer Notfall-OP, bei einem BMI von > 30 und bei fehlender Stomamarkierung.
Mag.a Martina Stehrer
CeraPlus™ Produkte* schützen Sie dort, wo es am wichtigsten ist
Die Haut um Ihr Stoma verdient einen besonderen Schutz. CeraPlus™ Produkte* bieten eine sichere und bequeme Passform, die vor Unterwanderungen schützt und hilft, gesunde Haut gesund zu erhalten. Angereichert mit Ceramiden, die ein natürlicher Bestandteil der Haut gegen Beschädigungen und Trockenheit sind, schützen CeraPlusTM Produkte die Haut vom ersten Tag an.




Erleben Sie den Unterschied mit CeraPlus und fordern Sie Ihr Muster an!
Tel. 01/877 0800-0
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com www.hollister.at
Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.
Hausärzt:in medizinisch
Hollister, das Hollister Logo sowie CeraPlus sind Markenzeichen der Hollister Incorporated. Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. ©2022 Hollister Incorporated. *Remois ist eine Technologie von Alcare Co., Ltd. Stomaversorgung Gesunde Haut. Gute Aussichten.
CeraPlusTM Stomaprodukte NACHBERICHT Kongress „Onkologie für die Praxis“ des Ordensklinikum Linz, 14.-15. Oktober 2022.
LeeAnne,
CeraPlus™ Anwenderin
Rezeptstudie
Österreichischer Verschreibungsindex
Werden Sie Teil einer Studie zur Arzneimittelversorgung in Österreich – völlig anonym melden Sie einmal pro Quartal die Verschreibungen und Diagnosen einer Arbeitswoche über ein bedienerfreundliches
Online Tool, auf das Sie völlig flexibel auch von Ihrem Tablet oder Smartphone zugreifen können.
FÜR WEITERE FRAGEN:
+43 (0) 664 8000 2237
Alexa Ladinser
alexa.ladinser@iqvia.com
+43 (0) 664 8000 2237
Lidia Wojtkowska
medicalindex@iqvia.com 0800 677 026 (kostenlos)

weltweit
Weltweite Studie zu indikationsbezogenen Verordnungen!
anonym
Sichere und anonyme Datenübermittlung 1x/Quartal.
flexibel
Flexibler Zugriff auf ein bedienerfreundliches Online-Tool.
120 €
Bis zu 120 € pro Stunde Aufwandsvergütung
Hier scannen um sich zur Teilnahme zu registrieren.
Hörgeräte nicht nur für Oma?

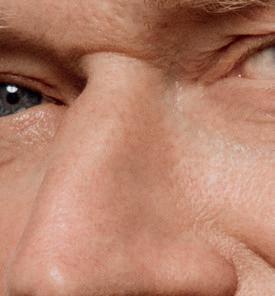
Hypakusis kann jede Altersgruppe betreffen – mit weitreichenden Folgen



Laut Statistik der WHO leiden circa 19 % der Bevölkerung ab dem 14. Lebensjahr an einer Hörminderung. Auf die österreichische Bevölkerung heruntergerechnet, haben somit etwa 1,7 Millionen Menschen eine behandlungsbedürftige Schwerhörigkeit. Allerdings zeigen Studien, dass weniger als 50 % der Betroffenen ausreichend therapiert sind. Schwerhörigkeit kann bei Personen in jedem Alter auftreten. Die Inzidenz erhöht sich jedoch mit den Lebensjahren. So ist eines von 1.000 Neugeborenen von einer permanenten Hörstörung betroffen, im Alter von zehn Jahren sind es bereits zwei von 1.000 Kindern. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen besteht bei einem Drittel eine permanente Hypakusis. Die mit dem Alter steigende Inzidenz spiegelt die unterschiedlichen Ursachen wider. Im Neugeborenenalter sind vor allem genetische Störungen relevant,





























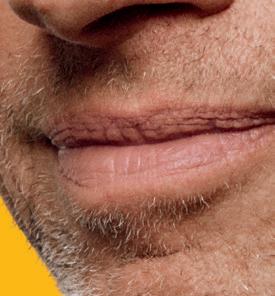


















Hausärzt:in medizinisch
© shutterstock.com/Peakstock Neuroth: über 140 x in Österreich Service-Hotline: 00800 8001 8001 neuroth.com QR-Code scannen und Termin online buchen.
Jetzt Hörstärke in Ihrem NeurothFachinstitut entdecken. >
Damit bleib ich gut connected.
während im Lauf des Lebens Lärm, Infektionen und Alterungsprozesse immer mehr in den Vordergrund rücken.

Kritischer Zeitpunkt
Die Folgen sind in jedem Alter erheblich. Kinder, die mit einer Hörstörung geboren werden, haben je nach Schweregrad der Hörminderung eine verzögerte oder gar keine Sprachentwicklung. Hier spielt vor allem Zeit eine gewichtige Rolle, da die ersten vier Lebensjahre eine sensible Phase für die Reifung der zentralen Hörbahn darstellen. Wenn in dieser Periode keine entsprechende Rehabilitation des Gehörs erfolgt, haben alle nachfolgenden Maßnahmen einen deutlich schlechteren Outcome, sodass die Betroffenen ein Leben lang unter Einschränkungen ihrer Kommunikationsfähigkeit leiden. Der Satz „Das wächst sich aus!“, welchen Eltern mancherorts nach wie vor gesagt bekommen, ist also in solch einer Konstellation völlig unangebracht.








Maßnahmen im ersten Lebensjahr
Um früh genug eine Diagnose stellen zu können, gibt es seit den 1990er-Jahren in Österreich ein universelles Neugeborenen-Hörscreening. Dieses wird in den ersten Lebenstagen durchgeführt und bei Auffälligkeiten an einem Ohr oder beiden Ohren ist eine weitere Abklärung an einer pädaudiologisch ausgestatteten HNO-Abteilung angezeigt. Sollte sich die Diagnose einer Schwerhörigkeit bestätigen, so ist eine entsprechende Therapie spätestens bis zum


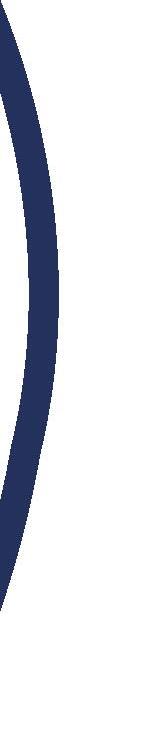
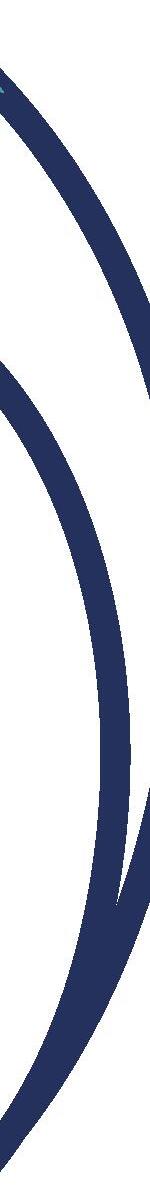
sechsten Lebensmonat einzuleiten. In den meisten Fällen werden Hörgeräte unterschiedlicher Art eingesetzt. Sollte ein Hörgerät aufgrund der Schwere der Hörbeeinträchtigung nicht ausreichen, kommt zumeist ein Cochlea-Implantat in Frage. Dabei wird im Rahmen einer Operation, die gegen Ende des ersten Lebensjahres vorgenommen wird, eine Elektrode in das Innenohr eingeführt, die den Hörnerv daraufhin elektrisch stimulieren kann. Der dadurch entstehende Sinneseindruck wird als akustischer Reiz wahrgenommen und so können Kinder, die rechtzeitig mit dem Implantat versorgt werden, ein normales Hörvermögen erreichen und in der Folge eine normale Sprachentwicklung durchlaufen.
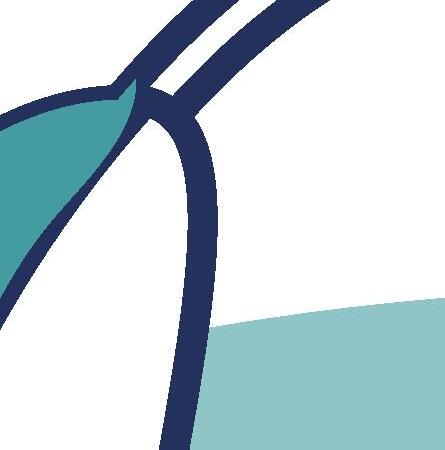



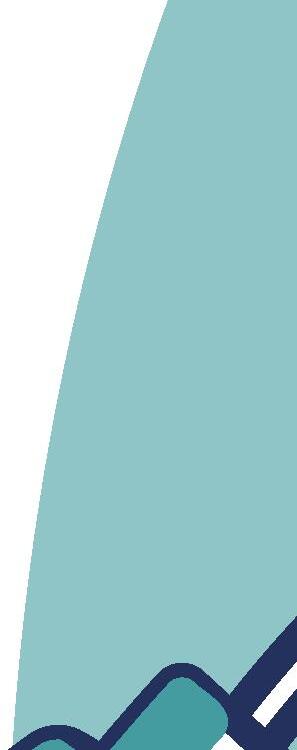





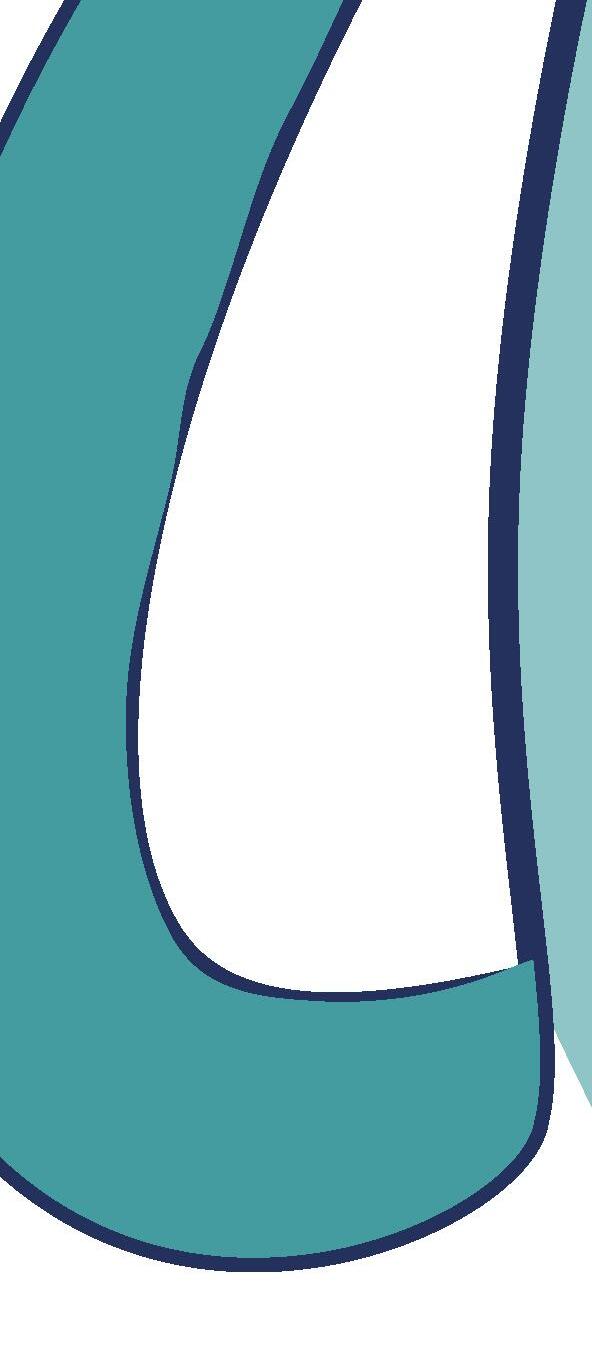



Die Sprachentwicklung im Blick


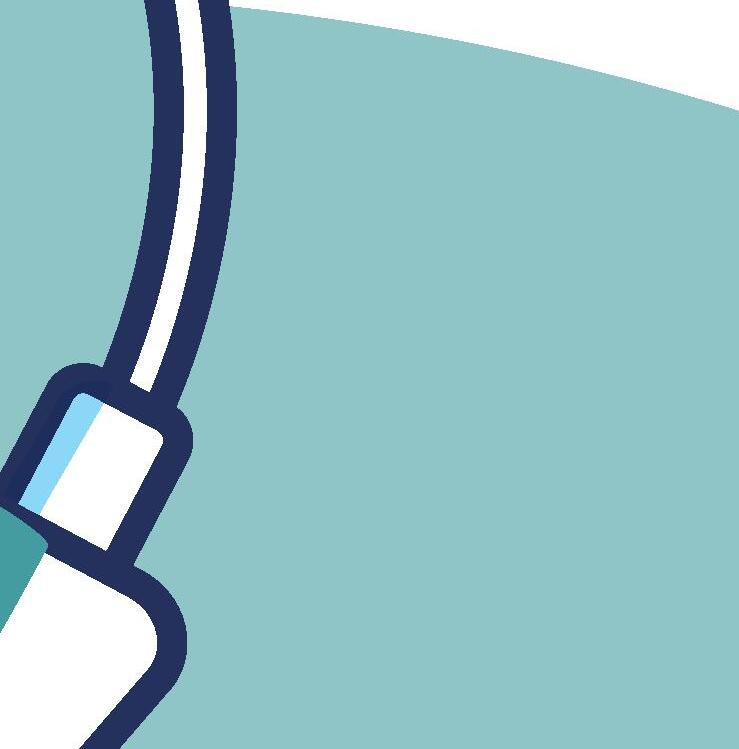





Bei Kindern im Schul- und Vorschulalter ist das Stagnieren oder sogar der Rückgang der Sprachentwicklung das erste Anzeichen einer Hörstörung. Ursächlich ist in diesem Alter meist ein Paukenerguss, der durch hypertrophe Adenoide im Nasenrachenraum zu Stande kommt. Jenen Kindern kann mit einer konservativen oder operativen Therapie im Sinne einer Adenotomie und Parazentese unkompliziert geholfen werden.


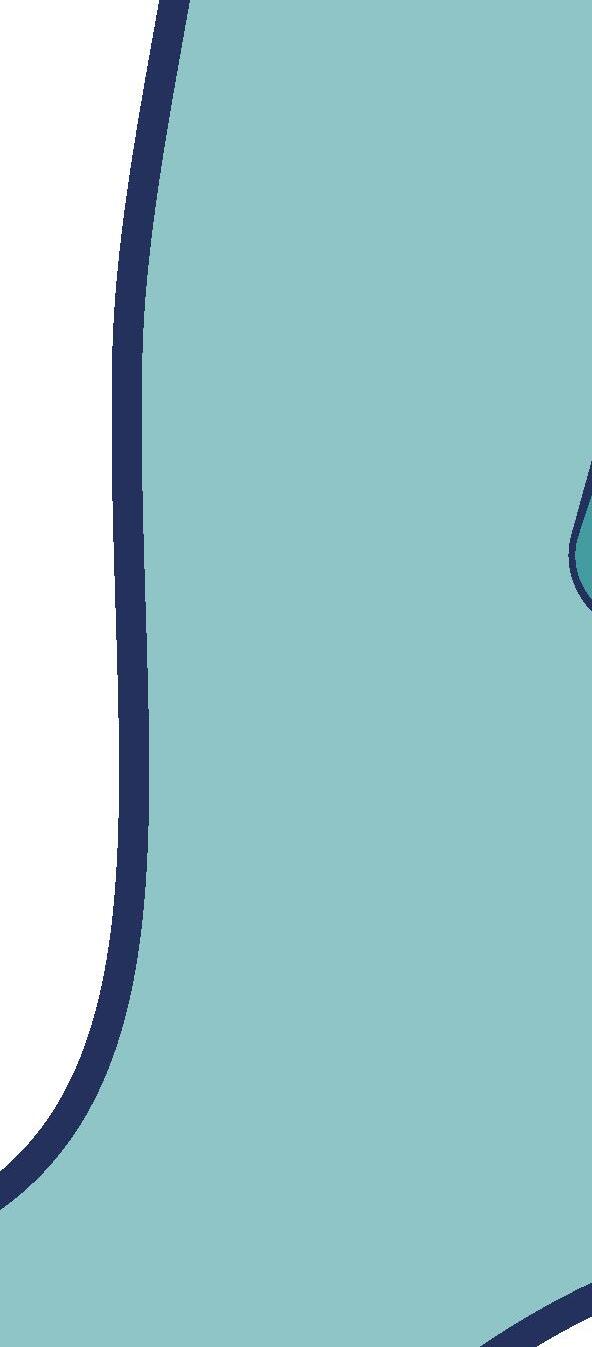


Häufige Ursachen bei Erwachsenen
Im Erwachsenenalter bewirken Entzündungen oftmals eine Hörminderung. Während akute Entzündungen in den meisten Fällen folgenlos abheilen, kann eine chronische Entzündung im Ohr – meist durch ein Loch im Trommelfell und wiederholte Sekretion charakterisiert – längerfristige Konsequenzen haben. Hierbei führt die chronische Entzündung zur Zerstörung des Mittelohres und so zur progredienten Hypakusis. Aufgrund des Fehlens konservativer Alternativen kommt hier nur eine mikrochirurgische Sanierung des Ohres in Frage, wobei in den meisten Fällen das Hörvermögen durch die Verwendung kleiner Prothesen, zum Beispiel aus Titan, wiederhergestellt werden kann. Sollte das nicht mehr möglich sein, gibt es verschiedene Hörimplantate, die auch diesen Patientinnen und Patienten wieder zu einem normalen Hörvermögen verhelfen können. Der Hörsturz als weitere häufige Ursache im Erwachsenenalter ist charakterisiert durch eine plötzlich auftretende einseitige Schwerhörigkeit bei unauffälligem Trommelfellbefund. Die Pathophysiologie ist bis heute nicht geklärt, wobei unter anderem vaskuläre und immunologische Mechanismen diskutiert werden. Lange Zeit galt ein Hörsturz als Notfall. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass ein Therapiestart innerhalb der ersten 24 Stunden keine bessere Prognose bringt. Empfohlen wird der Beginn mit einem hochdosierten systemischen Kortison innerhalb der ersten drei Tage. Sollte das keine hinlängliche Besserung erzielen, besteht die Option einer intratympanalen Kortisontherapie, bei der das Mittelohr durch einen Stich ins Trommelfell mit Korti-
Hausärzt:in medizinisch 32 März 2023
GASTAUTOR: Priv.-Doz. DDr. Matthias Koiner-Graupp Abteilung für allgemeine HNO, Med Uni Graz
© Med Uni Graz
„Die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, steigt mit einer untherapierten Schwerhörigkeit um 50 Prozent.“
© shutterstock.com/Katja Frischbutter
son aufgefüllt wird. Wenn auch diese Behandlung nicht ausreicht, kann noch eine hyperbare Sauerstofftherapie versucht werden.

Presbyakusis nicht verharmlosen
Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Häufigkeit der Altersschwerhörigkeit zu. Ursächlich wird neben einer genetischen Prädisposition und der Akkumulation von Lärm im Laufe des Lebens seit kurzem auch das Inflammaging – als Form der chronischen Entzündung während des Alterungsprozesses – in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert. Da es sich um einen schleichenden Prozess handelt, suchen Betroffene oft erst spät Hilfe. Ein erstes Anzeichen für eine therapiebedürftige Presbyakusis ist der sogenannte Cocktailparty-Effekt. Hierbei haben Betroffene Schwierigkeiten, ihre Gesprächspartner bei Hintergrundlärm zu verstehen. Gespräche in Ruhe bereiten ihnen keine Probleme,
daher werden akustisch schwierige Situationen gemieden und der Besuch beim HNO-Arzt aufgeschoben, obwohl längst eine behandlungsbedürftige Schwerhörigkeit vorliegt. Dies ist insofern fatal, als mittlerweile bekannt ist: Die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit einer untherapierten Hypakusis um 50 %.
Keine Altersgrenze für CochleaImplantate
Die Therapie der Presbyakusis erfolgt mit konventionellen Hörgeräten. Sollte dies nicht genügen, besteht auch hier die Möglichkeit eines CochleaImplantats. Eine Altersgrenze gibt es dabei nicht. Die Entscheidung für oder gegen ein Cochlea-Implantat sollte nach gründlicher medizinischer und audiologischer Abklärung sowie nach eingehender Aufklärung der Patienten getroffen werden. Auch ein Lebensalter von über 80 Jahren stellt keine Kontraindikation dar, sofern der körperliche und geistige Zustand des Patienten gut ist. In solchen Fällen kön-

Neue Hörgeräte, neues

nen oft erstaunliche Ergebnisse erzielt werden.
Fazit
Anzeichen für eine Hörstörung sollten nicht bagatellisiert werden. Vielmehr sind Betroffene in jedem Alter umgehend einer professionellen Abklärung durch einen HNO-Arzt zuzuführen, um eine suffiziente Therapie gewährleisten zu können und Spätfolgen zu vermeiden.

Hausärzt:in medizinisch
„Werden angeborene Hörstörungen in den ersten vier Lebensjahren nicht behandelt, haben alle nachfolgenden Maßnahmen einen deutlich schlechteren Outcome.“
<
Hör-Erlebnis! Jetzt kostenlos testen! Hervorgehobene Sprache Besser hören und verstehen in jeder Umgebung Freisprech-Telefonie Handy-Anrufe mit nur einem Finger annehmen TV-Ton direkt im Ohr Fernsehen in der für Sie idealen Lautstärke Jetzt Termin vereinbaren und ausprobieren! 0800 880 888 hansaton.at
y-doc ist die Nr. 1 im Wartezimmer TV. Das professionelle, nach Ihren Wünschen gestaltete Ordinationsprogramm überzeugt Ihre Patientinnen und Patienten.

y-doc TV sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Wartezimmer, verkürzt die gefühlte Wartezeit und fördert damit ein angenehmes und effizientes Patientengespräch.
+43-732-60 27 28-0 www.y-doc.at
Wartezimmer TV
Neue Wege hin zur Prävention und Behandlung
Blut-Hirn-Schranke als zentraler Akteur in der Demenzentwicklung
Es ist sehr erfreulich, dass die Menschen in sozial gesicherten Gesellschaften ein immer höheres Alter erreichen. Doch mit dem steigenden Lebensalter der Bevölkerung treten auch vermehrt Demenzen auf. Der schleichende Verlust der Persönlichkeit wirkt unheimlich und bedrohlich. Bisher gibt es nach dieser Diagnose keine Heilung, allenfalls kann eine Verbesserung der Lebensqualität erzielt werden. Lange wurden Ablagerungen von Proteinen, die im Gehirn von Alzheimerkranken erkennbar sind, als Auslöser der Demenz interpretiert. Daher erachtete man die Entstehung der Erkrankung als ein genetisch bedingtes unabänderliches Schicksal. In den letzten Jahren hat sich das Bild jedoch deutlich gewandelt.

Vier Elemente zur Erhaltung geistiger Gesundheit

Weltweit durchgeführte Studien bestätigen, dass der überwiegende Anteil der Demenzen primär durch die Lebensführung bedingt ist. Neben körperlicher und geistiger Betätigung wird zunehmend die Bedeutung sozialer Kontakte deutlich. Das vierte Element zur Erhaltung der geistigen Gesundheit stellt die gesunde Ernährung dar. Das leuchtet ein, allerdings gelingt diese in unserer Gesellschaft mit ihren industriellen Lebensmitteln nicht leicht.
GASTAUTOR: Univ.-Prof. Dr. Christian Noe Ehem. Vorstand der Institute für Pharmazeutische Chemie an den Universitäten Frankfurt und Wien

Altern ist ein Teil des Lebens. Die Volksweisheit „ Der Kopf muss jung bleiben!“ weist darauf hin, dass der Erhalt der Vitalität eben-
dort beginnt. Auch das Gehirn altert. Seine synaptische Plastizität schafft jedoch einen besonderen Spielraum für die Entscheidung, ob man gesund oder ungesund altern will. Bei der Erhaltung der Gesundheit geht es nicht zuletzt auch um die Beobachtung von Körpersignalen. Die Definition des Metabolischen Syndroms hat es ermöglicht, mittels einfacher Daten schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt bzw. Schlaganfall oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabe-
Hausärzt:in medizinisch 35 März 2023 > © shutterstock.com/Krakenimages.com
© BM Health
„Bis zur Etablierung einer angepassten Prävention und einer erfolgreichen Therapie ist noch viel zu tun.“
tes vorzubeugen. Ebenso wird die Beachtung des Zerebralen Metabolischen Syndroms neurodegenerative Entwicklungen und das Entstehen von Demenzen hintanhalten. Doch das allein reicht nicht aus. Die Formen dieser Erkrankung und die Wege hin zu ihrer Entstehung sind vielfältig. Wenn es um die Ernährung des Gehirns geht, muss man ins Detail gehen und sich mit den Stoffwechselwegen befassen.
Das Ende einer Entwicklung
Jeder Stoff, der ins Gehirn gelangt, muss die Blut-Hirn-Schranke (BHS) passieren. Diese ist keinesfalls eine einfache Barriere, die man überwinden oder gar umgehen muss. Bei ihr handelt es sich um ein komplexes System von dicht aneinandergereihten Gefäßzellen der Kapillaren im Gehirn, welche eng von den angrenzenden Gehirnzellen umschlossen sind. Mit schier unglaublicher Effizienz werden Moleküle aktiv in die Zellen aufgenommen und weiter ins Gehirn hineintransportiert. Was schädlich ist, darf nicht hinein, Abbauprodukte werden umgehend hinausbefördert. Der Funktionsverlust der BHS-Zellen ist einer der ersten Schritte bei der Entwicklung von Demenzen. Dies zu verhindern, stellt daher eines der wichtigsten Ziele einer kommenden kausalen Demenztherapie dar, welche das Fortschreiten der Krankheit effektiv unterbinden soll.
Wenn Zellen des Gehirns zugrunde gehen, handelt es sich meist nicht um ein spontanes Ereignis, sondern um das Ende einer Entwicklung, welche von einer nachlassenden Transportkapazität der Blut-Hirn-Schranke ausgeht. Sie schreitet über viele Jahre schlei-
chend voran, bis im Alter die Demenz zu Tage tritt. Da zunächst noch keine irreversiblen Schäden am Netzwerk der Neuronen entstanden sind, kommt der Prävention eine ganz besondere Bedeutung zu. Wann man damit beginnen soll, ist schwer zu sagen. Die Grenzen zwischen der Stärkung der geistigen Fitness in jungen Jahren und der Vorbeugung einer Demenz im mittleren Alter sind fließend.
Energiegewinnung im Gehirn
Der Stoffwechsel bildet die Basis des Lebens. Seine Vielfalt und die Vernetzung der metabolischen Wege sind beeindruckend und gut erforscht. Die Vorbeugung einer Demenz beginnt mit der Kenntnis ebenjener. Wenn die BHS ins Spiel kommt, dann steht das Nachlassen der Transportkapazität im Vordergrund. Die Vermeidung eines gefährlichen Energiedefizits im Gehirn ist eine präventive Grundmaßnahme. Die Energiegewinnung im Gehirn erfolgt durch die intrazelluläre Verbrennung von Glukose. Etwa 200 Gramm davon müssen täglich über die Schranke transportiert werden. Die Stärke im Brot und in anderen kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln ist die Hauptquelle der Glukose. Diese wird in der Regel nur zu einem geringeren Teil als Zucker verzehrt. Der Glukosetransport ins Gehirn erfolgt mittels eines speziellen Transportproteins (GLUT1), welches unabhängig vom Insulin arbeitet. Dieser Transporter ist gegebenenfalls zu aktivieren.
Das Prinzip des aktiven Transports über die Blut-Hirn-Schranke wird bei Morbus Parkinson seit langem therapeutisch genutzt. Bei dieser Krankheit kommt es in bestimmten Regionen des Gehirns zu einem Mangel am Neurotransmitter Dopamin, der die Schranke nicht passieren kann. Daher wird die Aminosäure Levodopa als Medikament verabreicht. Diese wird im Gegensatz zum Dopamin aktiv über die Blut-Hirn-Schranke transportiert. Weil die Autophagie-Induktoren Spermidin und Spermin ebenfalls nicht aktiv ins





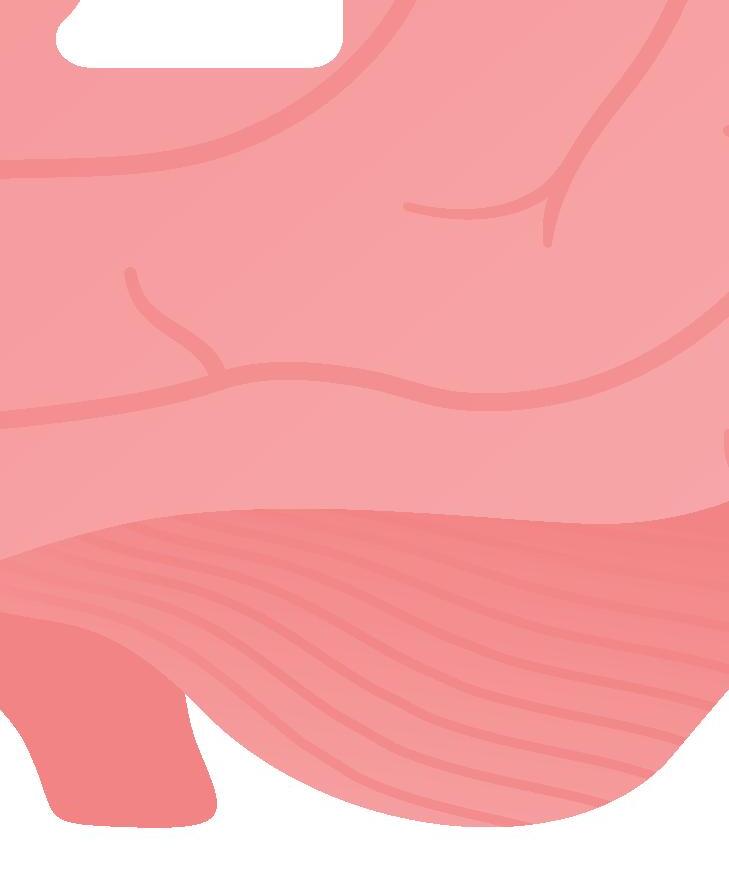
Gehirn transportiert werden, können in vergleichbarer Weise ihre beiden Aminosäurevorstufen als transportfähige Substrate eingesetzt werden, um in den neuronalen Zellen die Synthese der beiden Hauptakteure der Autophagie zu unterstützen. Auch die damit einhergehende Zellaktivierung ist ein wichtiger Beitrag für die Prävention neurodegenerativer Prozesse. Die Apoptose ist der bekannteste unter den verschiedenen metabolischen Wegen, welche zum neuronalen Zelltod führen. Am Ende dieser Form des Zelltodes steht das Signal des „ E at me“- Moleküls Phosphatidylserin, das die Makrophagen anlockt, welche die absterbenden Zellen „ f ressen“. Durch eine gezielte Beeinflussung des Zellstoffwechsels kann der Entstehung dieses Moleküls und damit dem Zelltod entgegengewirkt werden.
Fazit


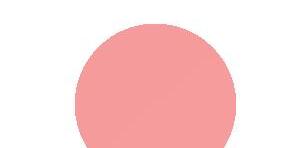



Vielfältig sind also die metabolischen Wege, welche für die Erhaltung der mentalen Gesundheit von Bedeutung sind. Eine patientenspezifische Prävention der Neurodegeneration muss besonders auf Veränderungen dieser Wege und des gesamten Stoffwechsels des Noch-nicht-Patienten achten. Bei Demenzen ergibt sich hierbei eine spezielle Gemengelage. Da eine Vorbeugung der Neurodegeneration über lange Zeit läuft, sollte man möglichst nicht Medikamente, sondern vielmehr Nahrungsergänzungsmittel einsetzen, welche die Nahrung ideal ergänzen. Sie greifen in den Stoffwechsel genauso ein wie Medikamente und sollten wie diese auf die Bedürfnisse der Patientin oder des Patienten zugeschnitten sein. Menschen entwickeln je nach ihrer Disposition – ausgehend von verschiedenen Ursachen – eine Demenz. Daher sollten auch die vorbeugenden Maßnahmen an diese speziellen Anforderungen angepasst sein. Eine individuelle Analyse des Risikos, in Zukunft daran zu erkranken, und eine darauf abgestimmte Prävention sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Bis zur vollständigen Etablierung einer angepassten Prävention und einer erfolgreichen Therapie von Demenzen ist noch viel zu tun.
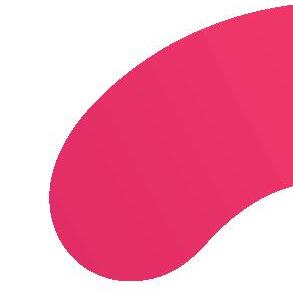





Hausärzt:in medizinisch 36 März 2023
< © shutterstock.com/Anastasiia
„Weltweit durchgeführte Studien bestätigen, dass der überwiegende Anteil der Demenzen primär durch die Lebensführung bedingt ist.“
Usenko
Kraft der Eiche
Durch eine gezielte Auswahl des Wirtsbaumes kann die Misteltherapie bei onkologischen Erkrankungen individualisiert und optimiert werden
FALLBEISPIEL MIT EICHENMISTEL
Bei einer 56-jährigen Patientin wurden 2014 ein metastasiertes Mammakarzinom rechts und ein DCIS rechts diagnostiziert. Sie bekam eine Radiotherapie und eine Hormontherapie mit Tamoxifen.
2019 zeigte sich eine ausgedehnte ossäre Metastase LWK 5 mit pathologischer Kompressionsfraktur und extraossärer Infiltration paravertebral und intraspinal.
Die Patientin, eine selbstständige Friseurin, präsentierte sich beim Erstkontakt völlig erschöpft und kraftlos, obwohl sie eine energische, kraftvolle und willensstarke Persönlichkeit hatte. 2016 startete sie mit der Misteltherapie. Anfänglich klagte sie über Fieber, Ohrenschmerzen und Herzrasen, was jedoch immer besser wurde. Bis heute zeigen sich regelmäßige Hautreaktionen.
Bei Krebserkrankungen gilt die Mistel seit mehr als hundert Jahren als wesentlicher Bestandteil der ganzheitlichen bzw. integrativen Therapien. Sie wird komplementär zu den schulmedizinischen Behandlungen eingesetzt. Je nach Erkrankung der Patientin/des Patienten werden bestimmte Wirtsbäume ausgewählt, auf denen die Mistel wächst. Die Mistelpräparate werden dann mit den gebräuchlichen Chemotherapeutika, monoklonalen Antikörpern oder Östrogenrezeptorblockern kombiniert: etwa die Kiefermistel bei Erkrankungen der Haut oder bei Hauttumoren oder die Apfelbaummistel bei Erkrankungen der Brustdrüse
oder der Gebärmutter. Aber auch der Konstitutionstyp des Patienten ist bei der Bestimmung des passenden Wirtsbaumes wichtig, um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Bei einem Onlineseminar der Gesellschaft für klinische Forschung e. V. Berlin stand u. a. die Eiche als Wirtsbaum im Fokus der Expertenvorträge.
Die Eichenmistel in der Mythologie
Bei den Germanen und Kelten war die Eiche heilig. So stammt etwa das Wort Druide von „duir “ ab, was „W issen der Eiche“ bedeutet. Die Eiche gilt als Sinnbild für Kraft und Freiheit und war der am meisten verehrte Baum.
„ Auch bei den Griechen war die Eiche der göttliche Baum und es durfte kein heiliger Hain existieren, in dem sich keine Eichen befanden“, schilderte

NACHBERICHT
Onlineseminar „Birke und Eiche“ der Gesellschaft für klinische Forschung e.
Der Erfolg: Die Tumormarker haben sich komplett zurückentwickelt, sie besucht regelmäßig das Fitnessstudio. Mit Stand 01/2023 ist keinerlei Tumoraktivität mehr nachweisbar.
Dr. Frank Meyer, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren in Nürnberg.
Die Eichenmistel und der Mensch
Die diversen Wirtsbäume werden nicht nur entsprechend den jeweiligen Krankheiten ausgewählt, sondern sollen auch zum Typus Patient passen. Dazu meinte Dr. Johannes Wilkens, Ärztlicher Direktor der Alexander von Humboldt Klinik: „ Patientinnen und Patienten, welche die Eichenmistel brauchen, sind vor allem jene, die sehr viele Merkmale der Eiche in sich tragen. So steht etwa kein anderer
14. Februar 2023.
Hausärzt:in pharmazeutisch 38 März 2023
V.,
„Je größer die Stürme, desto fester wurzelt die Eiche.“
©
shutterstock.com/Alexander Tolstykh
Baum für so viel übermäßige Kraft und Präsenz. Die Eiche möchte permanent den Tod überwinden. So findet man etwa immer noch Blätter im Herbst an ihr, wenn alle anderen Bäume diese schon längst abgeworfen haben. Auch nach einem Blitzeinschlag oder wenn Äste abgebrochen sind, treibt sie wieder aus und gibt nicht auf. Sie hat einen starken Eigenwillen, ist aber auch unglaublich sozial – viele Insekten können von ihr leben “ Ähnlich müssten auch die Menschen sein. „ Sie sollten klare Willenstendenzen haben und sich – ganz egal, was passiert im Leben – nicht beugen lassen.“
Im menschlichen Körper entspricht die Eichenmistel dem Lebermeridian. „Wenn man sich anschaut, was die Leber alles leisten muss, sieht man auch hier dieses Kraftprinzip: schaffen, schaffen, nie Pause machen, sich permanent anstrengen, vielleicht auch überfordern“, so Dr. Wilkens weiter. Nehme man Eichenmisteln ein, so verspüre man in der Regel schnell (wieder) mehr Kraft, Lust und Vitalität.
Indikationen für die Eichenmistel
Die Misteltherapie wird unterstützend zu allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität bei soliden Tumoren während und nach einer Standardtherapie eingesetzt.

„Das Mammakarzinom kann – vor allem, wenn der Konstitutionstyp der Eiche entspricht – mit Eichenmistel gut behandelt werden“, präzisierte Dr. Meyer. Eichenmistel gilt als ein sehr gut verträgliches Arzneimittel. Die Dosierung hängt vom Therapiekonzept des Arztes ab. „Ich selbst verwende sie eher hochkonzentriert. Also so, dass ich ein deutliches Ansprechen sehe“, erklärte Dr. Meyer. „Wenn der Wirtsbaum gut zum Patienten passt, kann man aber auch mit einer niedrigen Dosierung oder
Potenzierung arbeiten. Vorsichtig bin ich bei akut entzündlichen Erkrankungen.“ Dr. Wilkens bestätigte: „ Die besten Ergebnisse zeigen sich beim energiegeladenen Typus. Man kann aber auch einen trägen oder ausgezehrten Menschen mit der Eichenmistel kräftigen.“ Er dürfe nur nicht mit einer zu hohen Dosis überfordert werden.
Gabriella Mühlbauer
Hausärzt:in pharmazeutisch
© shutterstock.com/Miliausha_art
Die Misteltherapie ist in Österreich unterstützend zu allgemeinen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität bei soliden Tumoren während und nach einer Standardtherapie zugelassen.
Oft unterschätzt
Pneumokokken-Pneumonie: Luft nach oben bei der Immunisierung von Risikogruppen
Seit kurzem stehen in Österreich potentere und breiter wirksame Konjugat-Impfstoffe zur Verfügung, die vor Pneumonien und invasiven Erkrankungen durch Pneumokokken schützen können. Die Immunisierung von Kindern ist im kostenfreien Impfprogramm enthalten. Gleichzeitig gilt auch für erwachsene Risikopersonen, zum Beispiel immunsupprimierte Pa-
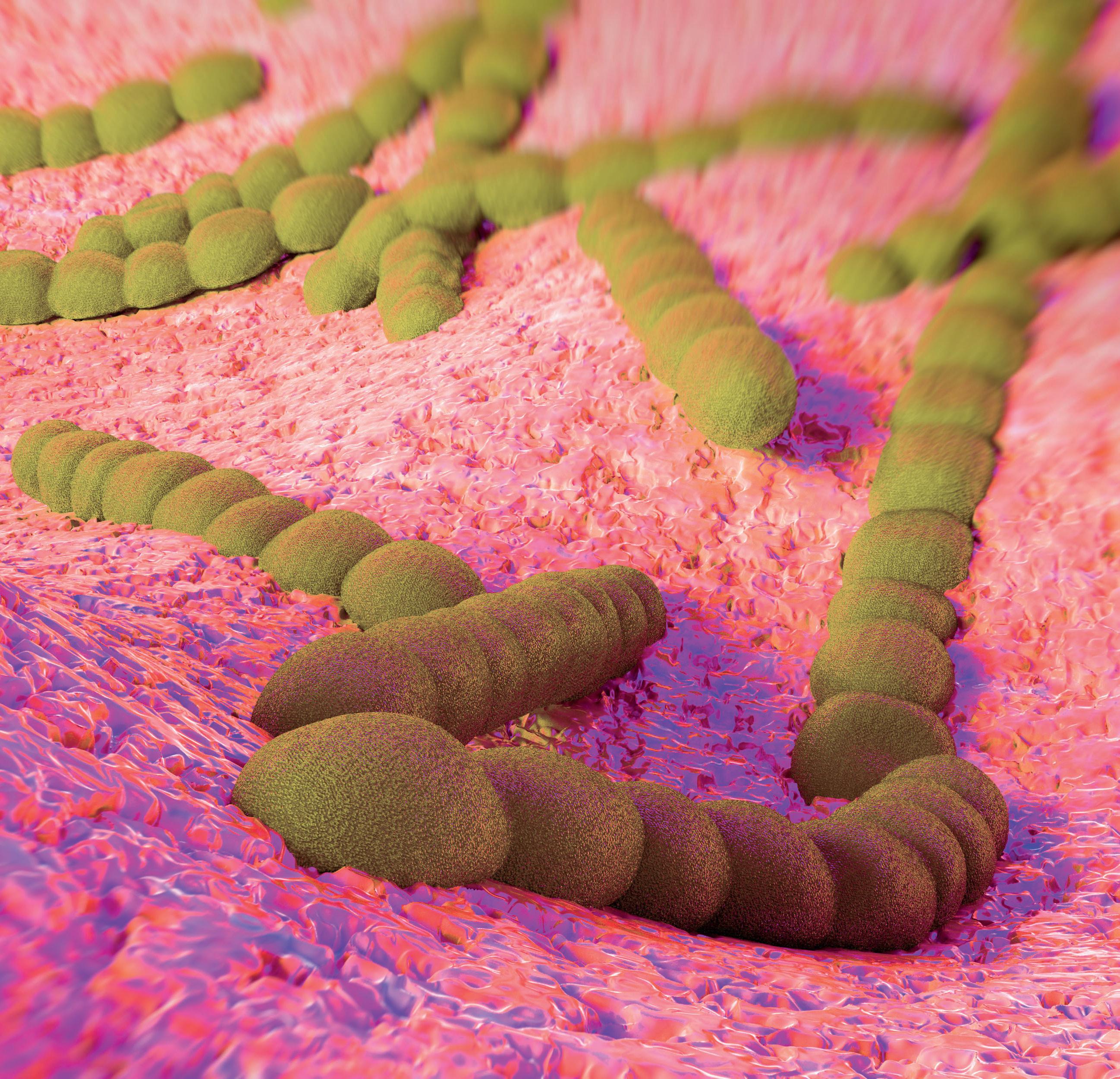
tienten, Menschen im höheren Alter oder mit einer chronischen Erkrankung, eine klare Impfempfehlung. Eine Umfrage des ÖVIH1 deutet jedoch darauf hin, dass eine Vielzahl jener Personen keinen Impfschutz haben dürfte: Vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern geben an, an einem chronischen Gesundheitsproblem zu leiden (Austrian Health Re-
port 2022) – von diesen Menschen sind laut eigenen Angaben nur 22 Prozent in den letzten fünf Jahren gegen Pneumokokken geimpft worden; „ i rgendwann einmal“ gegen Pneumokokken geimpft wurden immerhin 33 Prozent. Am Allgemeinmedizinkongress 2022 in Graz sprach Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski von der Klinischen Abteilung für Pulmonologie der Med Uni
Hausärzt:in pharmazeutisch 40 März 2023
>
© shutterstock.com/Peddalanka Ramesh Babu
Graz über die Pneumokokken-Pneumonie und warnte davor, die Erkrankung zu unterschätzen.
Gefahr in jedem Alter
Lungenentzündungen werden prinzipiell in drei Gruppen unterteilt: ambulant erworbene Pneumonien (CAP – „community acquired pneumonia“), im Krankenhaus erworbene Pneumonien (HAP – „hospital acquired pneumonia“) und Pneumonien bei Immunsuppression, also opportunistische Infektionen der Lunge. In seinem Vortrag legte Prof. Olschewski das Hauptaugenmerk auf die CAP, da sie im niedergelassenen Bereich die größte Rolle spiele. „Wir rechnen mit 40.000 bis 68.000 Fällen von CAP pro Jahr in Österreich – etwa 24.000 dieser Personen werden im Krankenhaus aufgenommen.“ In puncto Sterblichkeit sei das Alter eine der wichtigsten Determinanten: Weniger als 1,5 Prozent der Personen im Alter bis 39 Jahre versterben laut dem Experten an einer Pneumonie – bei Menschen jenseits des 80. Lebensjahres liege die Sterblichkeit bei circa 20 Prozent. Prof. Olschewski: „ D ieser Kontrast beeindruckt und man könnte schlussfolgern, dass ein hohes Alter lebensgefährlich sei. Aber das ist eigentlich banal. Vielmehr muss man sagen: Die Pneumonie ist in jedem Alter lebensgefährlich. 1,5 Prozent erscheinen im Vergleich wenig, aber in Wirklichkeit ist es enorm viel. Und das trotz etablierter Behandlungsmöglichkeiten.“
Diagnostische Überlegungen
Klinisch kann sich eine Pneumonie dem Experten zufolge unterschiedlich äußern. „Viele Patienten präsentieren sich mit typischen Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Fieber und Schüttelfrost. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass alle Husten und Auswurf haben. Gerade im fortgeschrittenen Alter
steht häufig Durchfall im Vordergrund oder die Personen erscheinen verwirrt und weniger orientiert, als man es von ihnen kennt“, gab Prof. Olschewski zu bedenken. Für die Diagnostik seien außerdem die Auskultation sowie das Röntgen besonders wichtig. „ D ie Pneumonie ist radiologisch durch ein sichtbares Infiltrat definiert“, erläuterte der Experte. Alternativ könne eine CT oder eine Ultraschalluntersuchung der Lunge durchgeführt werden –Letztere erfordere allerdings ein hohes Maß an Erfahrung. Im Gegensatz zu Personen, die hospitalisiert werden müssen, bräuchte bei Patientinnen und Patienten, deren Zustand eine ambulante Behandlung mittels kalkulierter Antibiose erlaubt, keine Erregerdiagnostik erfolgen.
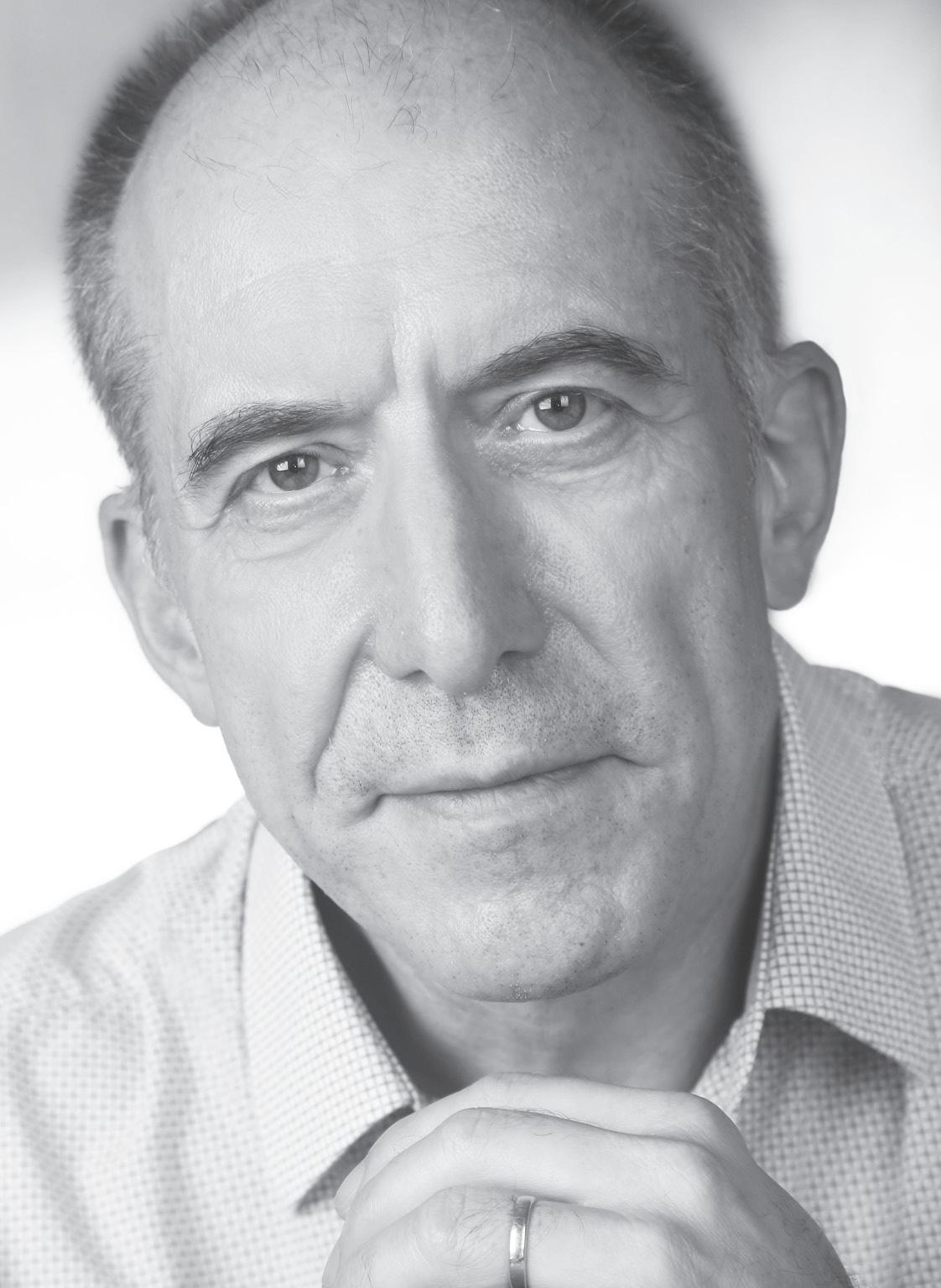
Kinder als Überträger
„P neumokokken sind mit 40 Prozent die häufigsten Erreger der Lungenentzündung“, betonte Prof. Olschewski. Anders als bei viral bedingten Erkrankungen etwa komme es jedoch nur sehr selten zu einer familiären Häufung von Pneumokokken-Pneumonien. „ P neumokokken verursachen bei Erwachsenen typischerweise Lungenentzündungen, bei Kindern führt eine Infektion in der Regel zu einer Sinusitis oder Mittelohrentzündung – bei Kleinkindern kann auch eine Meningitis die Folge sein. Die gleichen Keime rufen also unterschiedliche Krankheiten hervor.“ Bei einer Analyse von Daten aus dem CAPNETZ – einem großen Untersuchungsprojekt, welches in Deutschland gestartet wurde – stellte sich heraus, dass bei Personen, die mit zwei oder mehr Kindern in einem Haushalt leben, das Risiko einer Pneumokokken-Pneumonie um das Zwei- bis Dreifache erhöht ist, bei älteren Frauen, die mit drei oder mehr Kindern leben, sogar um das Siebenfache.2
Prof. Olschewski erklärte, dass 25 bis 50 Prozent der Kleinkinder bis zwei Jahre
NACHBERICHT
im Rachen mit Pneumokokken besiedelt seien, zumeist ohne zu erkranken. „ Aber die Kleinkinder können die Eltern und vor allem die Großeltern anstecken“, machte der Pneumologe aufmerksam. Dass dieser Mechanismus entscheidend sei, habe die Einführung der Pneumokokkenimpfung bei Kleinkindern im Jahr 2009 bestätigt, denn sie habe zu einem signifikanten Rückgang der Pneumokokken-Pneumonien bei älteren Personen geführt.
Fazit
Wie kann man einer Pneumonie nun vorbeugen? Zum Beispiel mit normalem Körpergewicht – Untergewicht stelle einen Risikofaktor dar –, mit ausgewogener Ernährung, Nichtrauchen, Lüften etc. und durch den Schutz der gefährdeten Menschen vor den „ K leinen“, fasste Prof. Olschewski zusammen. „ Heißt das, man sollte die Großfamilien auseinanderreißen? Nein, sicher nicht. Die richtige Methode besteht darin, sowohl Kleinkinder als auch erwachsene Risikopersonen gegen Pneumokokken zu impfen“, so der Pneumologe.
Anna Schuster, BSc
Referenzen:
1 INTEGRAL, ÖVIH – Impfverhalten in Österreich –Welle 3, Studie 7166, Juni-Juli 2022.
2 Schnoor M et al., Epidemiol Infect 2007: 135:13891397.
INFO
Die Risikofaktoren bzw. -gruppen für eine Pneumokokkenerkrankung sowie das empfohlene Impfschema bei Kindern und Erwachsenen sind dem aktuellen Impfplan zu entnehmen. Der Impfplan Österreich 2023 steht online zur Verfügung unter: sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/ Impfen/Impfplan-Österreich.html
Hausärzt:in pharmazeutisch 42 März 2023
© privat
EXPERTE: Univ.-Prof. Dr. Horst Olschewski Klinische Abteilung für Pulmonologie, Med Uni Graz
Der Experte war Vortragender zum Thema beim 52. Kongress für Allgemeinmedizin der STAFAM vom 24. bis 26. November in Graz.
Feinstaub verstärkt Haarverlust
PM10-Partikel beeinträchtigen Cateninbildung
Eine auf dem Dermatologen-Kongress in Madrid unter der Leitung des koreanischen Forschers Hyuk Chul Kwon, MS, PhD vorgestellte Studie belegte, dass das Vorhandensein von Feinstaub- und Dieselpartikeln diffusen Haarausfall begünstigt. Der Gehalt an Catenin, dem für das Haarwachstum verantwortlichen Protein, reduziert sich. Die Forschungsarbeit ergab auch, dass die Konzentrationen von drei anderen Proteinen (Cyclin D1, Cyclin E und CDK2), die für Haarwuchs und Haarretention verantwortlich sind, durch Feinstaub (PM10)-ähnliche Staub- und Dieselpartikel dosisabhängig verringert wurden. Zu den Quellen von PM zählen die Verbrennung fossiler Brennstoffe, einschließlich Benzin, und andere brennbare Materialien wie Kohle, Öl und Biomasse. Laut Dr.in Claudia Lercher vom InterHaar-Institut in Wien zeigt sich in Zeiten wachsender Luftverschmutzung ein Anstieg der Patientinnen und Patienten: „Persönlich bin ich überzeugt davon, dass ein Zusammenhang eines deutlich sichtbaren Anstieges zunehmender Haarprobleme aufgrund von Umweltverschmutzung, speziell in den letzten zehn Jahren, beobachtet werden konnte. Bei dieser Gruppe von Personen lagen sonstige für verstärkten Haarausfall relevante Faktoren im Normbereich oder spielten eine untergeordnete Rolle.“ Zudem würden auch Intoxikationen durch Umweltgifte wie Blei, Thallium, Cadmium, Kupfer oder Quecksilber entstehen und zum Auftreten eines diffusen Haarverlusts beitragen, jedoch nur als Begleiterscheinung im Rahmen der Gesamtsymptomatik.

Tipps für Hausärzt:innen
Falls bei einem Patienten keine Besserung nach Behandlung auftritt, sei es laut Dr.in Lercher obligat diese Haarprobleme durch Spezialisten abklären zu lassen: „ Diese verfügen über spezifische Untersuchungsmethoden wie digitale Dermoskopie und mikroskopische Analysen. Patienten mit verstärktem Effluvium capitis oder anderen Haarproblemen können durch ein breiteres Wissensspektrum und dem entsprechenden Erfahrungswert bezüglich optimaler Behandlung am effektivsten therapiert werden.“ ots/mat
STOK
© shutterstock.com/TR
DAS Probiotikum
zum Antibiotikum
10
hochaktive Bakterienstämme für Ihren Darm
OMNi-BiOTiC ® 10 AAD: Zum Diätmanagement bei einer Dysbalance der Darmflora während und nach der Gabe von Antibiotika.



Symbolpackung
www.omni-biotic.com Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
Beruhigend für den Reizdarm
Serie, Teil 1: Das RDS in der Naturheilkunde –was eine Low-FODMAP-Diät bewirken kann

Expertinnentipp
Das Probiotikum zu jedem Antibiotikum
Mag. Anita Frauwallner, Darmexpertin

Die Antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD) ist die häufigste Nebenwirkung der Antibiotika-Behandlung. Je nach eingesetzter Substanz werden bei bis zu 49 % der Patienten Durchfälle durch das Antibiotikum bzw. durch Keime wie Clostridium difficile ausgelöst. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten bestätigen die Wichtigkeit des gezielten Einsatzes von speziell für diesen Zweck entwickelten Probiotika.
Probiotika: Wissenschaftlich fundierte Begleittherapie
Das Reizdarmsyndrom (RDS) ist eine relativ junge nosologische Entität. Eine ernsthafte Beschäftigung der Medizin mit ihm lässt sich erst wenige Jahre vor der berühmten Rom-I-Definition von 1992 ausmachen. Die Naturheilkunde ist umgekehrt ein relativ traditionsbewusstes Fachgebiet, auf dem sich Änderungen nicht so rasch einstellen wie in der konventionellen Medizin. Als Resultante kann man hier kaum auf verschriftlichte Empfehlungen zu Reizdarm und Ernährung hinweisen. Ein im deutschsprachigen Raum in jüngerer Zeit über mehrere Auflagen gut verbreitetes Standardwerk der naturheilkundlichen Ernährungslehre kennt das Leiden überhaupt nicht.1 Daraus folgt, dass derzeit praktizierte Therapie- wie Forschungsansätze relativ jung sind und insbesondere bezüglich der Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine große Nähe bzw. eine Überlappung mit der konventionellen Medizin aufweisen – mit Ausnahme eines stark
GASTAUTOR:
individualisierten Konzeptes aus der europäischen – hier österreichischen – Tradition, der Diagnostik und Therapie nach F. X. Mayr, sowie aus Asien v. a. der ayurvedischen Ernährungslehre (mehr dazu im zweiten Teil unserer Serie).
Dr. Rainer Stange Abteilung Naturheilkunde, Charité – Universitätsmedizin Berlin und Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee
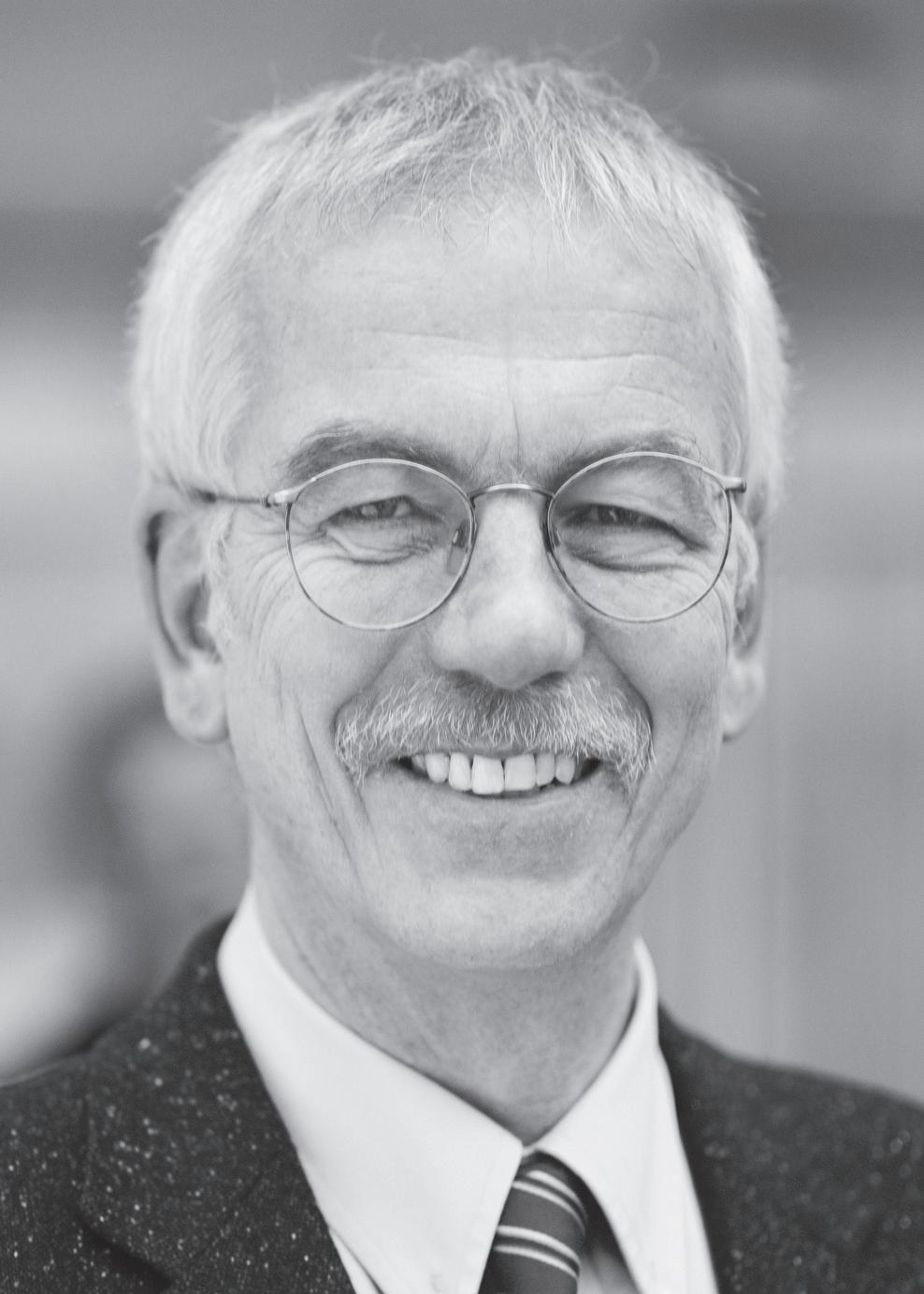
Ein Grundproblem von jeder der zahlreichen auch aus konventioneller Sicht vorgeschlagenen und vielfach schon gescheiterten Interventionen bei RDS ist seine multifaktorielle Ätiologie und Pathogenese. Auch wenn wir derzeit als vorherrschende Symptomatik ganz grob vier Typen mit mehr Obstipation, mehr Durchfällen, einem Mischtyp sowie einem ohne sichere Zuordnung unterscheiden, lässt sich aus dieser Zuordnung im Einzelfall nicht die Ätiologie ableiten, die für das Ansprechen einzelner Maßnahmen aber sehr entscheidend ist. Wichtige Ätiologien sind etwa die postinfektiöse, die medikamentös induzierte oder die „stressassoziierte“, was in den bisherigen Studien aber kaum berücksichtigt wurde. Ihre
OMNi-BiOTiC® 10 AAD* ist ein durch evidenzbasierte Studien geprüftes Probiotikum mit 10 speziell kombinierten Bakterienstämmen und wird zum Diätmanagement bei einer Dysbiose der Darmflora während und nach der Gabe von Antibiotika eingesetzt. Die Multispezies-Kombination reduziert das durch Antibiotika bedingte Wachstum pathogener Keime und reguliert in Folge auch die damit einhergehende Antibiotika-assoziierte Diarrhö. Entscheidend für die Wirksamkeit ist vor allem die hohe Qualität der speziell ausgewählten probiotischen Bakterien, welche



• sich nachweislich im menschlichen Darm ansiedeln und vermehren können – auch bereits während der Antibiotika-Therapie
• die Vermehrung pathogener Keime (z. B. Clostridium difficile) inhibieren und
• deren Ausschüttung von Toxinen reduzieren
Die tägliche Anwendung von OMNiBiOTiC® 10 AAD wird für die gesamte Dauer der Antibiotika-Therapie und auch noch 14 Tage danach empfohlen.
* Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)
45 März 2023 BEZAHLTE ANZEIGE
© shutterstock.com/Julia
Mikhaylova
© Institut AllergoSan/christianjungwirth.com >
© Immanuel Krankenhaus
Verteilung etwa für mitteleuropäische Reizdarmpatienten ist nicht publiziert, der Behandler also auf wenige Daten, v. a. auf sein anamnestisches Gespür, angewiesen. Die Anamnese einer signifikanten Diarrhoe, z. B. durch tropische Erreger (Reisedurchfall, „ Montezumas Rache“), die viele Jahre zurückliegen kann, aber auch Campylobacter pylori weist in eine klare Richtung, ebenso häufige Antibiotikatherapien. Für die übrigen – nach Erfahrung des Autors – ca. 60 Prozent der RDS-Patienten bei uns bleibt die Ätiologie hingegen unklar. Lebensmittelunverträglichkeiten und -allergien können zwar eine RDS-Symptomatik perfekt mimikrieren, sind nosologisch jedoch vom RDS abzugrenzen (mehr dazu im dritten Teil unserer Serie).
S3-Leitlinie empfiehlt FODMAP-arme Ernährung
FODMAP steht für „fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols“
(auf Deutsch: „fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole“), vereinfacht gesagt sind das etwa vergärbare Mehrfach-, Zweifach-, Einfachzucker und mehrwertige Alkohole. Jene Abkürzung bezeichnet eine Gruppe von Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen, die in vielen Nahrungsmitteln vorkommt und im Dünndarm nur schlecht resorbiert wird. Dieser Gruppe werden Fruktose (Monosaccharid), Laktose (Disaccharid), Fruktane, Galaktooligosaccharide (Oligosaccharide) und Sorbit sowie Mannit (Polyole) zugerechnet. In einer 2010 veröffentlichten klinischen Studie wurde erstmals von einer positiven Wirkung einer FODMAP-armen Ernährung auf die Symptomatik funktioneller Darmerkrankungen, vor allem des RDS, berichtet.2 Seitdem wurde diese in zahlreichen Studien bestätigt, es gibt mindestens sechs systematische Reviews hierzu. Wohl noch nie in der Geschichte der Ernährungstherapie hat sich der Nutzen eines Konzepts so rasch, so multipel und so eindeutig replizieren lassen. Man kann heute von jedem Ernährungsberater diesbezügliche Kennt-
nisse erwarten, zahlreiche Laienführer mit Kochrezepten usw. überschwemmen den Markt.
Auch wegen dieser Fortschritte hat die deutsche S3-Reizdarmleitlinie der Ernährungstherapie mehr Bedeutung zugesprochen. Seit Juni 2021 wird das Low-FODMAP-Ernährungskonzept empfohlen (DGVS). Zahlreiche weltweit – also insbesondere von sehr unterschiedlichen Ernährungsweisen ausgehende –Studien zeigen, dass zwischen 50 und 75 Prozent der Betroffenen von einer Einschränkung der FODMAP profitieren. Auch andere Formen „ restriktiver Ernährung“, vor allem die glutenfreie, werden bei RDS empfohlen. In einem jüngeren systematischen Review einschließlich einer sog. Netzwerk-Metaanalyse werden 14 RCT als geeignet angesehen, darunter zehn mit FODMAP, zwei mit glutenfreier Ernährung und jeweils eine mit stärke- und zuckerarmer Ernährung sowie auf IgG-Testung basierender Auslassdiät.3
Erstaunlicherweise ist selten gefragt worden, ob der sehr erfreuliche Nutzen von Low-FODMAP in einer speziellen Komponente begründet liegt.
Von Fruktose-Glukose-Sirup (HFCS) ist abzuraten
In der Naturheilkunde ist man traditionell skeptisch gegenüber Veränderungen der Ernährung, die durch westliche Lebensweisen und die Nahrungsmittelindustrie geprägt sind. Während Begründungen hier auch mangels wissenschaftlicher Kapazitäten manchmal etwas krude ausfallen, ist das über alle Schulen weitgehend einheitliche Verdikt zusätzlichen Süßens, bis auf vielleicht Spuren von Honig, in der Sache richtig gewesen. In thematischer Nähe zum Low-FODMAP-Ansatz wurde schon Jahre vorher auf den steigenden Anteil zugefügter Fruktose hingewiesen. Ein bedeutsamer Anteil der Zuckeraufnahme kommt aus industriell
gefertigten Nahrungsmitteln, die Fruktose-Glukose-Sirup („h igh-fructose corn syrup“, HFCS) enthalten. Dieser ist als „bulkware“ am Weltmarkt als Zusatzprodukt für viele Lebensmittel äußerst kostengünstig erhältlich, seit er sich durch Zugabe von Amylase meist aus dem Abfallprodukt Maisstärke über Maissirup und in einer weiteren Reaktion durch Zugabe von Glukoseisomerase einfach gewinnen lässt (Fruktose). Für die Industrie sind Preis und Handhabbarkeit des Sirups bezüglich Transport, Lagerung und der im Herstellungsprozess gut steuerbaren Zugabe zu einer ganzen Palette von Produkten das schlagende Argument. In den USA hat sich so der Pro-Kopf-Verbrauch von HCFS zwischen 1970 (0,23 kg/y) und 2000 (28,4 kg/y) mehr als verhundertfacht, wodurch der Anteil der Fruktose an der Gesamtenergieaufnahme um 26 Prozent gestiegen ist.4 Die Literatur über bionegative Auswirkungen verstärkten Fruktosekonsums insbesondere in Hinblick auf die Begünstigung von Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, Adipositas und Krebs ist abundant. Die EU hat 2017 eine bis dahin zum Schutz der europäischen Zuckerrübenindustrie geltende Restriktion für den Import von HFCS völlig fallengelassen. Insofern stehen wir hier gerade am Beginn des HFCSZeitalters. In der naturheilkundlichen Ernährungsberatung wird von Lebensmitteln mit HFCS abgeraten.
1 Anemueller H, Das Grunddiät-System. Leitfaden der Ernährungstherapie mit vollwertiger Grunddiät, Haug Verlag Stuttgart.
2 Gibson PR et al., Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach, doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.06149.x.
3 Yu SJ et al., Efficacy of a Restrictive Diet in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Network Meta-analysis, doi: 10.4166/kjg.2022.014.
4 Jung S et al., Dietary Fructose and FructoseInduced Pathologies, doi: 10.1146/annurevnutr-062220-025831.
Weitere Literatur beim Autor.
VORSCHAU
Serie, Teil 2: RSD aus westlicher und östlicher Sicht – naturheilkundliche Empfehlungen.
Serie, Teil 3: RSD und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Infos & Fortbildung: forum-naturheilkunde.de
Hausärzt:in pharmazeutisch 46 März 2023
<
© shutterstock.com/Alexander Lysenko
IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber:
RegionalMedien Austria Gesundheit – RMA Gesundheit GmbH, Am Belvedere 10 / Top 5, 1100 Wien, Tel. 01/74321708114, office@gesund.at.
Geschäftsführung: Mag.a Birgit Frassl, Marlis Rumler.
Redaktionsleitung: Mag.a Karin Martin.
Redaktion: Mag.a Karin Martin, Anna Schuster, BSc, Mag.a Ines Pamminger, BA, Margit Koudelka, Marcel Toifl.
Lektorat: Mag.a Katharina Maier.
Produktion & Grafik: Helena Valasaki, BA. Cover-Foto: shutterstock.com/agsaz.
Verkaufsleitung: Mag.a Birgit Frassl, birgit.frassl@regionalmedien.at.
Kundenbetreuung: Mag.a Dagmar Halper, dagmar.halper@regionalmedien.at, Ornela-Teodora Chilici, BA, ornela-teodora.chilici@regionalmedien.at.
Druckerei: Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
Grundlegende Richtung: Unabhängige österreichische Fachzeitschrift für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte.
Die HAUSÄRZT:IN – Praxis-Magazin für Primärversorgung –ist ein interdisziplinäres Informations- und Fortbildungsmedium.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in den Artikeln teilweise auf die gendergerechte bzw. gänzlich orthografisch/grammatikalisch korrekte Schreibweise. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Bezeichnungen für sämtliche Geschlechter.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlages wieder, sondern fallen in den Verantwortungsbereich der Autor:innen. Der Inhalt von entgeltlichen Einschaltungen und Beilagen sowie die Angaben über Dosierungen und Applikationsformen liegen außerhalb der Verantwortung der Redaktion oder des Verlages und sind vom/von der jeweiligen Anwender:in im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt, verwertet oder verbreitet werden.
Mit „Bezahlte Anzeige“ gekennzeichnete Beiträge/Seiten sind gemäß §26 Mediengesetz bezahlte Auftragswerke. Offenlegung: gesund.at/impressum
51 März 2023







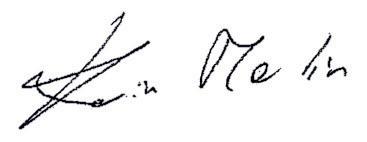






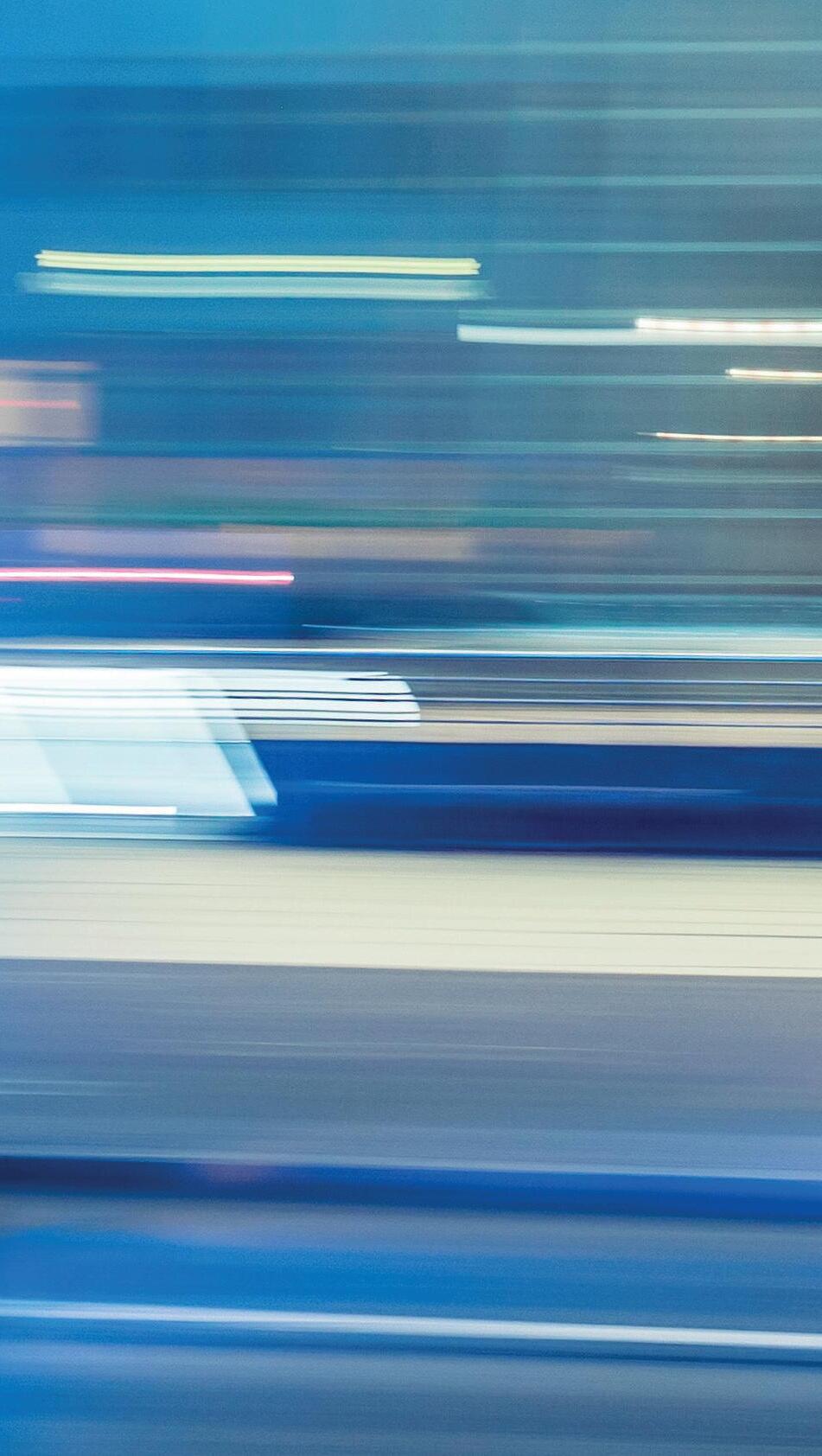




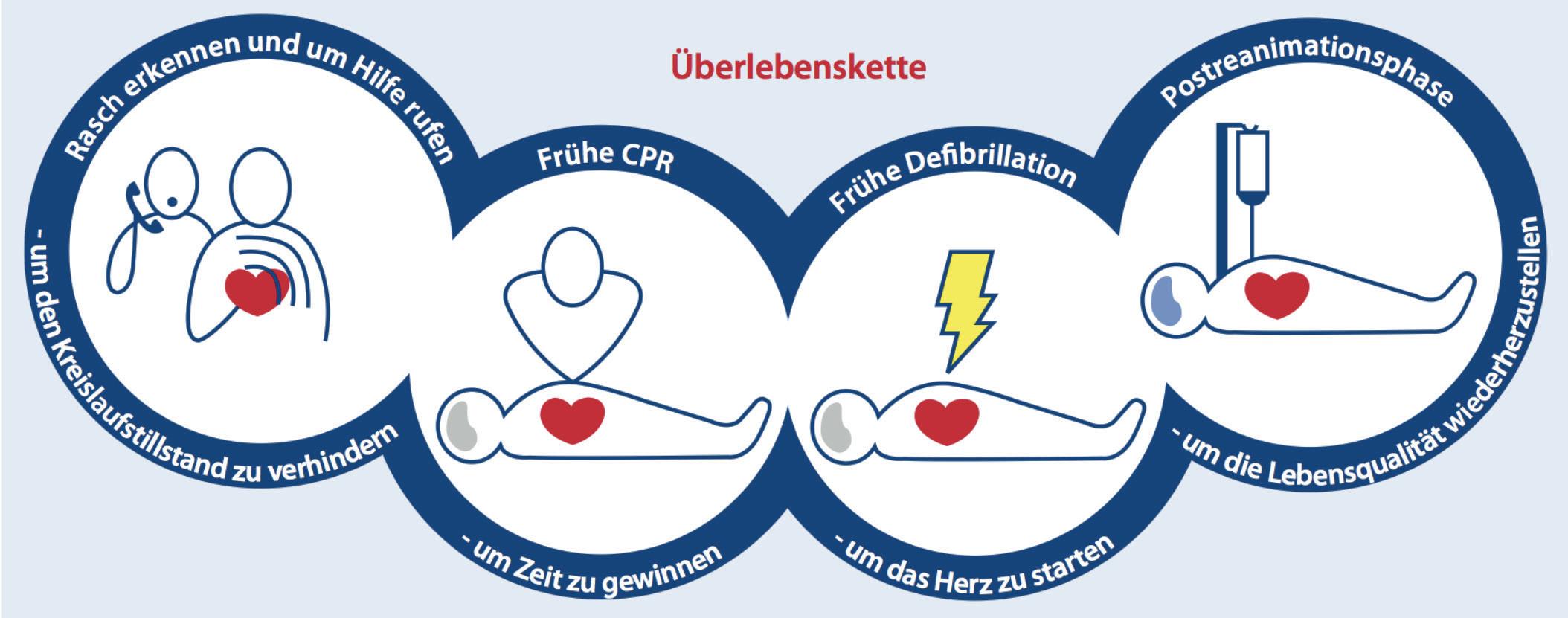










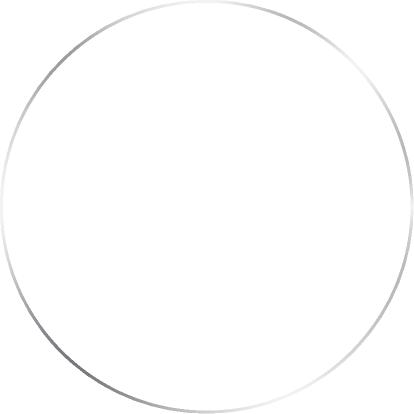

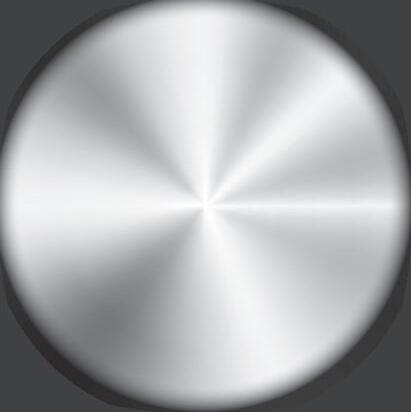




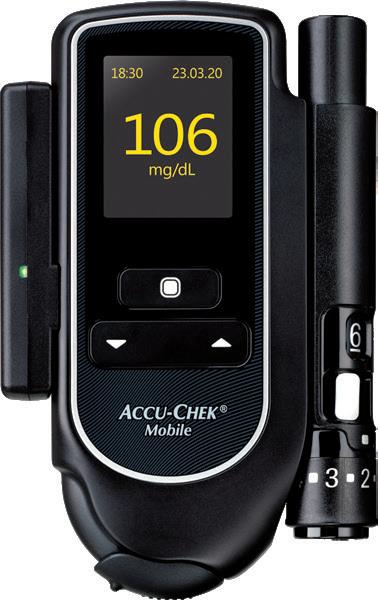
 Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
Das Interview führte Mag.a Karin Martin.