
4 minute read
Ein Stich, viele Möglichkeiten
Borreliose-Update aus Forschung und Praxis
Das erhöhte Risiko, sich mit der LymeBorreliose anzustecken, besteht noch bis in den Herbst hinein. Erst bei Temperaturen unter 6 °C werden Zecken inaktiv. Diese sind häufig mit Borrelien infiziert. „Nicht jeder Stich führt zu einer Infektion. Und nicht jede Infektion verursacht Symptome“, weiß Doz. Dr. Alexander Zoufaly, Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin. „Je nach Region und Alter lassen sich bei bis zu 20 % der gesunden Normalbevölkerung spezifische BorrelienIgG-Antikörper nachweisen“, ergänzt der Mediziner. Zecken übertragen bekanntlich nicht nur Borrelien. Am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der MedUni Wien wird bundesweit kontinuierlich das Krankheitsprofil der Zecken überwacht: In 26 % der Zecken werden Lyme-Borrelien gefunden, in 17 % Rickettsien, in 5 % Candidatus Neoehrlichia mikurensis, in 3 % Babesien, in 2 % die Rückfallfieberborrelie Borrelia miyamotoi und in 1 % Anaplasma phagocytophilum. „Infektionen mit Lyme-Borrelien sind die von uns am häufigsten diagnostizierten, jedoch sahen wir in den letzten Jahren auch immer wieder Infektionen mit den anderen genannten Pathogenen, die man somit bei der Diagnose nach einem Zeckenstich in Erwägung ziehen muss“, berichtet Univ.-Prof. Dr. Hannes Stockinger, Leiter des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie an der Medizinischen Universität Wien. Die Möglichkeiten, eine Lyme-Borreliose zu verhindern, sind begrenzt. Der Schlüssel liegt in der Expositionsprophylaxe. Bekanntlich muss die Zecke außerdem ehestmöglich entfernt werden, um eine Infektion abzuwenden. Derzeit gibt es zwar kein zugelassenes Borreliose-Vakzin, aber einige Impfstoff-Ansätze. „Aufgrund der leider weit verbreiteten Impfskepsis ist die pharmazeutische Industrie bezüglich der Markteinführung eines Impfstoffes jedoch zurückhaltend“, so Prof. Stockinger. Ein schlagendes Argument gegen Vakzine sei wohl auch die effiziente Therapie mittels Antibiotika – ganz im Gegensatz zu den eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten bei einer FSMEInfektion.
Häufige Fehldiagnose bei mangelnder Erfahrung
Das häufigste Krankheitsbild einer Lyme-Borreliose ist das Erythema migrans (EM). Die Wanderröte tritt frühestens nach zwei Tagen auf und wird vor allem an der Größenprogredienz erkannt. „Die Rötung kann dabei durchaus auch flächig sein, die typische Ringform bildet sich oft erst recht spät aus – ein Fehlen der zentralen Abblassung kann nicht zum Ausschluss dieser akuten Hautinfektion führen“, betont Doz. Zoufaly. Gelegentlich komme es zur Ausschwemmung von Bakterien über die Blutstrombahn oder das Lymphsystem, was Erkrankungen anderer Organsysteme wie des Nervensystems, des Herzens oder der Gelenke erkläre. Im Stadium des Erythema migrans seien serologische Tests auf Antikörper gegen Lyme-Borrelien nur selten positiv, merkt Prof. Stockinger an. Eine Ausnahme könne eine verschleppte oder übersehene Wanderröte, beispielsweise am Rücken, sein. Die Entwicklung der Antikörper nehme nach einer Infektion etwa zwei Wochen in Anspruch.
„Infektionen mit LymeBorrelien sind die von uns am häufigsten diagnostizierten, jedoch gibt es auch andere Pathogene, die man in Erwägung ziehen muss.“ „Je nach Region und Alter lassen sich bei bis zu 20 % der gesunden Normalbevölkerung spezifische Borrelien-IgG-Antikörper nachweisen.“
Experte zum Thema: Univ.-Prof. Dr. Hannes Stockinger
Leiter des Instituts für Hygiene und Angewandte Immunologie, Medizinische Universität Wien
„Bei Lyme-Borreliose ohne EM ist die wichtigste Säule der Labordiagnostik ein zweistufiger serologischer Test, bei dem ein sensitiver Enzym-Immunoassay (EIA) als erste Stufe dient. Fällt der EIA positiv aus, werden anschließend getrennte IgM- und IgG-Immunoblots durchgeführt. Das richtige Lesen der Banden, insbesondere bei den IgM-Immunoblots, ist kritisch und führt bei mangelnder Erfahrung oft zu Fehldiagnosen“, ergänzt der Wissenschaftler. Wenn unbehandelte Patientinnen und Patienten trotz länger als sechs Wochen anhaltender Symptome seronegativ blieben, dann liege höchstwahrscheinlich keine Lyme-Borreliose vor und man müsse andere Erkrankungen in Betracht ziehen. Zudem könnten Hintergrund-Seropositivitäten von 50 % – wie beispielsweise bei über 50 Jahre alten Jägern – die Interpretation der Seroreaktivität beeinträchtigen. Bei solchen Patienten empfiehlt der Experte zusätzliche Tests, etwa einen Nachweis intrathekaler Antikörper bei Verdacht auf Lyme-Neuroborreliose, PCR-Tests von Gelenkflüssigkeit bei Verdacht auf Lyme-Arthritis oder Hautbiopsien bei Verdacht auf Acrodermatitis chronica atrophicans. Das Risiko, Fehldiagnosen zu stellen, sei vor allem bei positiven serologischen Befunden gegeben, welche oft nur eine früher durchgemachte Infektion anzeigten, meint auch Doz. Zoufaly. Beschwerdebilder wie Schmerzen, Abgeschlagenheit und Konzentrationsstörungen, die nicht borreliosetypisch seien, könnten vielfältigste Ursachen haben. „Hier empfiehlt sich eine sorgsame Abklärung von Differentialdiagnosen oder bei Unklarheiten die Überweisung zum Spezialisten“, macht der Facharzt aufmerksam. „Bei der routinemäßigen Nachsorge sind serologische Tests nicht indiziert, da IgM- und/oder IgG-Antikörper bei erfolgreich behandelten Patienten viele Jahre persistieren können“, bekräftigt Prof. Stockinger.
Erregerelimination durch Antibiotika
In der Regel bewirken Antibiotikatherapien eine rasche Limitation der Erreger und eine Ausheilung. Je nach Stadium reiche eine Behandlungsdauer von zwei bis vier Wochen fast immer aus, so Doz. Zoufaly. Sollten die Symptome nicht verschwinden, so sei die Diagnose ebenfalls zu hinterfragen. Aber selbst ohne Antibiotikagaben führe die angeborene und spezifische Immunantwort zu einer Eindämmung der Infektion, sodass die Symptome der Erkrankung letztlich verschwinden würden. „Gelegentlich bleiben Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Schmerzen nach der Behandlung einer Wanderröte oder Neuroborreliose bestehen. Es ist unklar, ob es sich hierbei um ein borrelientypisches Beschwerdebild handelt oder ob dies auch bei anderen Infektionen (zum Beispiel bei Long COVID) oder anderen Auslösern auftreten kann“, schildert Doz. Zoufaly. Es gebe jedoch keinen Hinweis für eine Persistenz des Erregers.
Experte zum Thema: Doz. Dr. Alexander Zoufaly
FA f. Innere Medizin, Infektiologie, Tropenmedizin Otto-Bauer-G. 15/14, 1060 Wien, infektionen.wien
Mag.a Ines Riegler, BA
Quellen: AMBOSS, Lyme-Borreliose; Stand: 08/2021. Klein S, Lyme-Borreliose, Gelbe Liste, 05.06.2019.


Aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Kopfschmerzen mit Schwerpunkt Migräne jetzt auch in kompakter Form online.

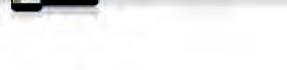



Therapie-News: Deutschsprachige Plattform, die in kompakter Form über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Kopfschmerzen Form über aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich Kopfschmerzen mit Schwerpunkt Migräne informiert: • Internationale Kongressberichterstattung • Video-Vorträge • Diplomfortbildung • Podcasts mit Tipps von Experten • u. v. m.










