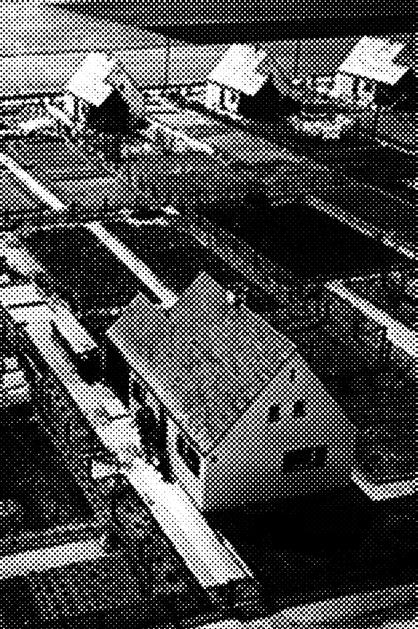
1 minute read
Heimstätte im Nationalsozialismus
Als Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, unterlag der Wohnungsbau der autoritären Parteiführung und deren Ideologie. Der Mensch sollte vom Individuum zu einem Glied der Volksgemeinschaft umerzogen werden.
Die Nationalsozialisten waren Feinde der Großstadt. Mit Hilfe einer Prüfung wurden Arbeiter als geeignet (Bedingungen waren unter anderem Erwerbstätigkeit, Nachwuchs und gesundes Erbgut) oder ungeeignet eingestuft, und Geeignete wurden aus den Großstädten in kleineren Wohnstätten umgesiedelt. Zielsetzung des NS-Siedlungsbaus war eine Dezentralisierung, die Bevölkerung auf dem Land sesshaft zu machen, den Erwerbslosen Arbeit zu geben und für die Siedlerfamilien einen familienfreundlichen Ort zu schaffen, an dem sie eine starke und gesunde Nachkommenschaft zeugen und sich selbst versorgen konnten.20 Die Verwurzelung an den Heimatboden wurde durch Eigentum und Garten angestrebt.21 Beispiele hierfür sind die Mustersiedlung Braunschweig-Mascherode (1936) und die Hugo-Junkers-Siedlung in Magdeburg (1936 – 1939).
Advertisement
Mein Haus.
Mein Boden.
Mein Vaterland.
Der Reichsarbeitsminister Franz Seldte formulierte folgende Punkte, die den Kleinsiedlungsstil als eine optimale Wohnform eines Volkes darstellen:
»1. Die Kleinsiedlung ist die beste und billigste Siedlungsform für den deutschen Arbeiter.
2. Die Kleinsiedlung ist das soziale Wohnungsideal für diejenigen Arbeiter, die aus der breiten Masse der arbeitenden Schichten zu Eigentum kommen wollen.
3. Die Kleinsiedlung ist auch allgemein staatspolitisch von politisch höchster Bedeutung. Sie verbindet den werktätigen Arbeiter mit dem Grund und Boden und macht ihn zu einem heimatverbundenen und politisch gefestigten Mitglied der Volksgemeinschaft.
4. Die Kleinsiedlung ist auch besonders geeignet, bevölkerungspolitische Aufgaben zu erfüllen. Auf eigenem Grund und Boden wird der Wille zum Kind gestärkt.«22
4,46 Millionen Menschen leben in Wohngemeinschaften.23 Als gemeinschaftliche Wohnform versteht man zusammenlebende Gemeinschaften, deren Mitglieder nicht miteinander verwandt sind.24 Diese Wohnform unterliegt in erster Linie dem Wunsch nach sozialen Kontakten und nicht dem finanziellen Aspekt.
Das gemeinschaftliche Wohnen kann auf zwei verschiedenen Ebenen stattfinden. Zum einen können sich mehrere Personen eine Wohnung teilen, oder das gemeinschaftliche Leben findet in dem Wohnumfeld statt –die Wohnung bleibt privat.25





