Das Magazin der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Wie wir mit ihr lehren und lernen Künstliche

Das Magazin der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Wie wir mit ihr lehren und lernen Künstliche
IMPRESSUM
Herausgeberin
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) Schinerstrasse 18, CH-3900 Brig cloudmagazin@ffhs.ch ffhs.ch
Redaktion FFHS Hochschulkommunikation Gestaltung Tonic GmbH Druck Valmedia AG, Visp Auflage 6 00 0 Exemplare Erscheinung 2× jährlich Abo-Bestellung oder Änderung ffhs.ch/cloudmagazin Bildnachweis Coverfoto Adobe Stock Genderhinweis Die in diesem Magazin verwendete maskuline bzw. feminine Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter.
Dieses Magazin ist auf FSC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt.
EDITORIAL
Die generative KI zwingt uns die Definition von Aufklärung um eine Stufe zu erweitern – Verantwortung 4
FO KUSTHEMA
Hochschulen müssen entspannt mit KI umgehen können 5
KI in der Bildung 6 – 9
Interview mit KI-Experte Niels Pinkwart
10 – 12
Pro und Contra: Sollen wir bei Abschlussarbeiten zu KI-Detektiven werden? 13
K I in der Ernährungberatung 14 – 15
Was Kartoffellagerung, Lernplattformen und Hockeyspiele gemeinsam haben 1 6 – 17 «KI eignet sich besonders in den frühen Phasen der Rekrutierung» 18
U MFRAGE
Was wird KI nie können? 19
T IPPS
KI-Tools fürs Studium 20
E-HOCHSCHULE
Wie die Qualität in den Studiengängen gesichert wird 21 «Nachhaltigkeit ist ein Luxusgut» 22 – 23 «Das Thema Vertrauen ist am wichtigsten» 24– 25
 MICHAEL ZURWERRA Rektor Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
MICHAEL ZURWERRA Rektor Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
Unter generativer KI versteht man die KI, die auf der Grundlage trainierter Modelle sich eigenständig oder interaktiv selbstständig weiterentwickelt. Die Anwendungsmöglichkeiten hierfür sind unbegrenzt. Generative KI kann in der Lage sein, neue Kunstwerke, Musikstücke und Texte zu erstellen, mit meiner Art zu sprechen, eine Rede halten. Avatare werden in Zukunft Sendungen präsentieren und Kommentare sprechen.
Generative KI kann Forschungsdaten analysieren und neue Materialien oder Medikamente designen. Autos, Flugzeuge, Züge, Busse usw. werden schon in Bälde von KI gesteuert. Die Pflegefachpersonen können durch Pflegeroboter, wie in Japan schon vorhanden, ersetzt werden. Roboter werden zudem in der Schule, im Gastgewerbe, als Sportcoach im Fitnesscenter und an anderen Orten mehr Einzug halten.
Durch den Einsatz von KI-Technologien können Bildungseinrichtungen personalisierte Lernwege für Schülerinnen und Schüler schaffen, Lehrkräfte bei der Individualisierung des Unterrichts unterstützen und die Effizienz von Bildungsprozessen steigern.
Doch die Integration von KI in Bildungseinrichtungen wirft auch wichtige Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz, Ethik und birgt die Gefahr von Automatisierung von Lernprozessen in sich.
Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess der Integration von KI in Bildungseinrichtungen aktiv gestalten und sicherstellen, dass die Menschlichkeit, Empathie und Originalität in der Bildung nicht verloren gehen. Nur auf diese Weise können wir das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Bildung ausschöpfen und eine zukunftsorientierte Bildungslandschaft schaffen, die auf die Bedürfnisse und Potenziale jedes einzelnen Lernenden eingeht.
Und damit wird auch sichtbar, dass nicht alles, was machbar ist, auch sinnvoll ist oder ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Die KI kann alles, was der Mensch kann und noch mehr und schneller, aber eines kann man ihr nie übertragen: Verantwortung.
Darum muss die Kantische Definition von Aufklärung, «AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen» mit dem Zusatz ergänzt werden: Habe Mut, den eigenen Verstand als Grundlage und Massstab deiner Verantwortung gegenüber dir und der künstlichen Intelligenz wahrzunehmen und nie eine gesellschaftliche Diskussion zu scheuen, wenn es um Verantwortung geht. Die menschliche Existenz definiert sich heute vorwiegend über die Wesenheit, selbstbewusst und kritisch Verantwortung zu übernehmen.

In «Per Anhalter durch die Galaxis» schrieb Autor Douglas Adams, dass wir Menschen auf drei verschiedene Arten auf neue Technologien reagieren.
Erstens: Alles, was bei unserer Geburt in der Welt existiert, ist normal und gewöhnlich und einfach ein natürlicher Teil der Funktionsweise der Welt.
Zweitens: Alles, was zwischen unserem fünfzehnten und fünfunddreissigsten Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär, und man kann wahrscheinlich eine Karriere darin machen. Und schliesslich drittens: Alles, was nach unserem fünfunddreissigsten Lebensjahr erfunden wird, widerspricht der natürlichen Ordnung der Dinge.
Für viele ist künstliche Intelligenz (KI) etwas, das diese Ordnung stört. Das mag daran liegen, dass wir dazu neigen, Objekten menschliche Eigenschaften, Gefühle oder Absichten zuzuschreiben. Wir sehen die Welt nur aus unserer menschlichen Perspektive. Letztlich ist KI aber nur ein grosses, lernendes Netzwerk, das wir uns zunutze machen können – auch in der Bildung.
Texte, Lösungen und Zusammenfassungen werden auf geschickte Prompts ausgespuckt. Der Bildungsalltag auf allen Stufen wird beeinflusst, das Lehren und Lernen ist im Wandel. An den Hochschulen sorgt KI für gravierende Veränderungen, auch an der FFHS. KI zwingt uns zu einer Auseinandersetzung mit uns selbst: Wie wird bei uns gelernt, gearbeitet und geprüft? Braucht es noch Abschlussarbeiten? Unser aller Lernziel muss es sein zu wissen, wann, wie und wofür wir KI einsetzen. Denkanstösse dazu finden sie im Fokusteil dieser Ausgabe.
Melanie Biaggi1. Wie können wir die Leistungen von St udierenden prüfen und bewerten?
Dass ganze Abschlussarbeiten durch ChatGPT verfasst werden – ein Horrorszenario für jede Hochschule. Dennoch lebt die FFHS die Philosophie, dass wir generative KI nicht verbieten können. Daher hat sie Richtlinien für die Verwendung von KI bei unbeaufsichtigten Prüfungen, also etwa schriftlichen Semester- oder Abschlussarbeiten, definiert. «Der Einsatz von KI ist erlaubt, darf jedoch den wissenschaftlichen Prozess nicht stören», sagt Prof. Dr. Tobias Häberlein, Departementsleiter Informatik und Leiter der Arbeitsgruppe KI an der FFHS.
Die grosse Revolution im Bildungswesen steht an. KI verändert die Art, wie wir lernen und unterrichten. Dies stellt Hochschulen vor grosse Herausforderungen. Wie die FFHS dazu steht, was sie tut und was sie plant – drei Fragen zu KI im Hochschulwesen. müssen. Beispielsweise indem mehr projektbezogen oder mündlich geprüft wird. Wenn eine KI gut oder sogar besser programmieren kann, wieso muss es der Mensch überhaupt noch können? «Natürlich müssen wir gerade heute die Grundlagen beherrschen, aber wir müssen uns auch fragen, welche Kompetenzen die Studierenden in Zukunft benötigen», sagt Häberlein.
2. Wie kann ein digitaler Lernassistent Studierende motivieren?
Das heisst, dass KI-Tools genutzt werden dürfen oder sogar sollen, wenn es etwa um die Ideenfindung geht, um die Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses oder zur Unterstützung bei Formulierungen. Die benutzten Tools müssen im Hilfsmittelverzeichnis angegeben werden. «Wir wollen, dass die Studierenden die Kompetenzen im Umgang mit KI erwerben, schliesslich werden sie das Szenario auch später im Beruf erleben», so Häberlein. Doch wie lässt es sich dann verhindern, dass ChatGPT nicht die komplette Arbeit übernimmt? Stand heute ist es quasi unmöglich, den Einsatz von KI zuverlässig nachzuweisen, auch wenn es bereits einige Tools dazu gibt.
Gemäss Häberlein sei KI jedoch (noch) nicht in der Lage, den grossen Bogen zu spannen, den es für eine wissenschaftliche Arbeit braucht. «Man erkennt sehr gut, wenn KI für die Erstellung einer Thesis unreflektiert verwendet wurde.» So kann die KI ein Inhaltsgerüst erstellen und Literatur recherchieren, aber das «Befüllen» und den roten Faden durchzuziehen, das kann sie noch nicht. Inkonsistente Kapitel oder eine uneinheitliche Terminologie sind gemäss Häberlein Hinweise, die den Betreuenden einer Arbeit auffallen müssen. «Die Art und Weise, wie wir Thesen lesen, ist elementar.»
Dennoch werden KI-Anwendungen sich weiter verbessern und das Prüfungswesen wird sich daran anpassen
Erinnern wir uns an unsere Grundschulzeit: Eine Klassenarbeit wird geschrieben und abgegeben, vier Wochen später kommt die Arbeit mit den Korrekturen zurück. Nach so langer Zeit und ohne unmittelbares Feedback ist der Lerneffekt gering, eher gleich null. «Ein digitaler Lernassistent könnte unseren Studierenden innerhalb von Sekunden ein direktes Feedback zu einer Aufgabe geben. Der Lerneffekt wäre gross und das würde die Studierenden zusätzlich motivieren», ist Tobias Häberlein überzeugt.
Zurzeit haben die Studierenden die Möglichkeit, offene Fragen im Forum ihres Moodle-Kurses zu stellen. Dort erhalten sie Antworten von Dozierenden oder Kommilitonen. Aber das Departement Informatik hat eine Vision: Ein digitaler Lernassistent, der den Studierenden seine Hilfe anbietet. Dieser soll sie vor allem während der Selbstlernphase unterstützen. Dazu Häberlein: «Im Idealfall würde ein solcher Lernassistent den bisherigen Lernprozess der Studierenden kennen. Er wüsste, wo er bei ihnen ansetzen, worauf er aufmerksam machen oder wo er sie zusätzlich motivieren muss – adaptives Lernen 2.0 sozusagen».
Noch vor zwei Jahren waren die Sprachmodelle, die für solche Assistenten benötigt werden, zu klein und nicht frei verfügbar. Das hat sich geändert, die heute verfügbaren, bereits vortrainierten grossen Sprachmodelle wären nun eine probate Möglichkeit. «Wir brauchen aber ein lokales, abgeschirmtes Modell, weil wir viele sensible Daten haben. Unsere Ausgangssituation ist sehr gut.
Durch unser Blended-Learning-Modell haben wir mit der Moodle-Plattform bereits eine sehr gute Datenbasis», erklärt Häberlein.
Das Large Language Model für den geplanten Lernassistenten muss also nicht neu trainiert, sondern nur mit Daten gefüttert werden. Dafür gibt es laut Häberlein bereits eine Technik, die Retrieval Augmented Generation (RAG). Mit dieser Technik kann das Sprachmodell auf vorhandene Daten reagieren. Dank RAG können die Ergebnisse eines grossen Sprachmodells auch qualitativ verbessert werden. Die Entwicklung eines solchen digitalen Lernassistenten könnte ausgelagert werden, für das Departement Informatik ist dies aber keine Option. «Die Daten müssen unter unserer Kontrolle bleiben. Bei der Anwendung dieses Sprachmodells können wir zudem unsere Erfahrungen einbringen, denn es sind auch genau diese Themen, für die wir künftig vermehrt Module anbieten wollen», betont Häberlein.
Der digitale Lernassistent für die FFHS befindet sich in der Vorprojektphase, noch sind einige Punkte offen wie zum Beispiel mögliche Partner oder auch die Finanzierung.
3. Wie macht die FFHS Dozierende fit für KI?
Die Dozierenden waren sich einig: Dank KI fallen einige Aufgaben weg. Dadurch bleibt mehr Zeit für kreative Aufgaben. Über diese und andere Erfahrungen tauschten sich die Teilnehmenden an den Kursen für Dozierende «KI in der Lehre» aus, welche die FFHS im Februar und März organisierte.
«Unsere Dozierenden müssen in Sachen künstliche Intelligenz fit sein, möglichst sogar mehr wissen als die Studierenden. Grundsätzlich gilt: Nur wer KI selbst
anwendet, weiss auch wie man damit umgehen muss», erklärt Tobias Häberlein, Initiant und Mitentwickler des KI-Kurses für Dozierende. Bei dem Basis-Kurs wurden in verschiedenen Workshops ganz konkrete Anwendungsfälle von KI in der Lehre geübt. Und offene Fragen geklärt, etwa in welchen Bereichen der Lehre KI eingesetzt werden kann, wie man präzise Prompts schreibt oder wie unbeaufsichtigte Prüfungen angemessen bewertet werden könnten, wenn generative KI als Hilfsmittel verwendet wird. «Ein kritischer Umgang mit generativer KI hat nach wie vor oberste Priorität und die wissenschaftliche Arbeitsweise darf nicht darunter leiden», fasst Häberlein zusammen. Die Dozierenden, vielleicht auch solche, die KI gegenüber eher kritisch eingestellt sind, sollten aus diesem Kurs neue Impulse mitnehmen können.
Dr. Sandro Olveira, Fachbereichsleiter Corporate Sustainability and Green Technologies, erstellt beispielsweise mit Hilfe von ChatGPT Begrüssungstexte für die Studierenden oder greift bei der Erstellung von Modulen auf generative KI zurück. «Ich brauche KI, um ein Quiz auf unserer Lernplattform Moodle zu erstellen. Was früher zeitaufwendig und mühsam war, geht jetzt ganz einfach und schnell», erklärt Cindy Eggs, Dozentin für Digital Business. Für Prof. Dr. Joachim Steinwendner, Professor für Digitale GeoHealth an der FFHS, war vor allem der Austausch mit anderen Dozierenden bei den Workshops wertvoll: «Ich konnte meine bisherigen Erfahrungen mit denen der anderen Teilnehmer vergleichen und etwas dazu lernen». Mit KI-Tools würden Aufgaben heute oft bereits gelöst, so Steinwendner, die Studierenden kämen gar nicht mehr in den Akt des Lernens. «Trotz aller Tools muss es unser Ziel bleiben, ihnen noch etwas beizubringen.»
Text: Melanie Biaggi und Natascha Ritz

Künstliche Intelligenz wird in vier Typen eingeteilt. Die ersten zwei Arten existieren bereits und werden als Artificial Narrow Intelligence (ANI) bezeichnet. Die Stufen drei und vier sind bislang noch Fiktion und haben nach Ansicht von Forschenden das Potenzial, so intelligent wie ein Mensch oder noch intelligenter zu sein.
Der erste Typ von KI ist in der Lage, eine einzige Aufgabe basierend auf der aktuellen Situation auszuführen. Sie kann keine Erfahrungswerte nutzen und daraus lernen.
Beispiel: Schachcomputer

Die heute gebräuchlichste Art ist die Limited Memory KI. Sie kann frühere Daten analysieren und mit der aktuellen Situation verbinden, um eine Vorhersage zu machen bzw. eine Entscheidung zu treffen.
Beispiel: moderne selbstfahrende Autos
Der nächste Schritt ist eine KI, die ein Bewusstsein entwickelt. Sie könnte nicht nur denken, sondern wüsste auch, dass sie denken kann und wäre sich ihrer eigenen Existenz bewusst. Diese höchste Form von KI könnte unter Umständen die menschliche Intelligenz übersteigen.

KI der dritten Stufe verfügt über soziale Intelligenz und kann menschliche Emotionen verstehen und darauf reagieren. Bisher gibt es noch keine KI-Modelle, die dies erreichen.
Für Niels Pinkwart ist klar: Eltern brauchen heute eine gewisse KI-Kompetenz, damit sie ihre Kinder bestmöglich begleiten können. (Fotos:

«KI
Niels Pinkwart ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er kennt das Potenzial von KI-Techniken im Hochschulbereich, interessiert sich aber vor allem auch dafür, was künstliche Intelligenz mit einer Gesellschaft macht. Im Interview erklärt der Experte, wo er die grössten Chancen für die FFHS im Zusammenhang mit KI sieht und wie er seinen Kindern den Umgang mit ChatGPT beibringt.
Niels Pinkwart, Sie haben Informatik und Mathematik studiert, ich bin Journalistin – was muss ich über die Algorithmen hinter KI wissen, damit wir auf Augenhöhe sprechen können?
Es hilft, sich vorzustellen, dass künstliche Intelligenz eine besondere Form von Computerprogramm ist. Und es gibt nicht nur eine Form, sondern mindestens zwei
grosse Familien. Zum einen haben wir eine Form von Ablage. Das heisst, in einem Computer sind viele Daten und Regeln gespeichert. Wenn wir ihn abfragen, dann sucht das System in diesem abgelegten Wissen. Zum anderen haben wir das maschinelle Lernen. Darauf basieren die derzeit sehr erfolgreichen Sprachmodelle. Diese Systeme müssen trainiert werden, sie lernen selbst aus bereitgestellten Daten.
Ist künstliche Intelligenz ein Narrativ, auf das wir alle hereinfallen? Kann man bei einer Maschine überhaupt von Intelligenz sprechen?
Da der Begriff Intelligenz in KI vorkommt, assoziieren wir damit auch Menschen und kommen in diese narrative Richtung. Es ist hilfreich, sich die Definition von KI und ihre Entwicklung genauer anzusehen. Von der ursprünglichen Definition, dass Maschinen Menschen simulieren, hat man sich inzwischen entfernt. Eine technische Definition von KI ist wünschenswert und dies wird im AI Act, dem EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz, geregelt. Dennoch wird man KI nur dann richtig verstehen, wenn man sie nicht nur aus einer informatischen Perspektive betrachtet, sondern auch die Wirkungszusammenhänge.
Zum Beispiel: Was macht KI mit den Berufen, mit der Gesellschaft, mit dem sozialen Miteinander? Das sind alles sehr wichtige Fragen, deshalb ist eine Regulation mit einem KI-Gesetz auch sinnvoll.
Die breite Bevölkerung sorgt sich um ihre Jobs. KI soll in Zukunft nicht nur Routinearbeiten übernehmen.
Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sich durch neue Technologien Berufsbilder verändern, aber bisher nicht zu Massenarbeitslosigkeit geführt haben. Wenn KI Routineaufgaben übernimmt, kann die Produktivität an anderer Stelle gesteigert werden. Die Menschen müssen offenbleiben und die neuen Technologien nutzen.
ChatGPT – das wohl bekannteste Sprachmodell – ist für viele von grossem Nutzen. Auch die Studierenden der FFHS benutzen es. Die Qualität der ChatGPT-Texte ändert sich ständig, aber verbessert sie sich auch?
Wenn wir die verschiedenen Versionen von ChatGPT miteinander vergleichen, sehen wir, dass sie mit der Anzahl der Parameter besser werden.
Stichwort «Model collapse» – in ChatGPT steckt schon das ganze Internet, aber wir haben kein zweites. Wie geht es also weiter?
Diese Frage ist berechtigt. Für die ersten Sprachmodelle wurden ausschliesslich von Menschen generierte Daten verwendet. Jetzt erleben wir schon, dass die Dinge, die wir im Web finden, zum Teil maschinengeneriert sind. Und es gibt nicht wesentlich mehr andere Inhalte, vielleicht noch Daten, die hinter einer Paywall waren. Da muss man sich schon fragen, was passiert, wenn die Sprachmodelle zunehmend mit maschinengenerierten
Daten trainiert werden. Die Qualität wird dadurch sicherlich nicht besser werden. Aber es wird ja zum Teil schon gegengesteuert.
Wie?
Es wird zunehmend an kleineren, spezifischeren Sprachmodellen gearbeitet. Gerade im Bildungsbereich sind solche kleinen Sprachmodelle von grosser Bedeutung. Denn man kann sich fragen: Brauche ich ein Sprachmodell, das alle meine Fragen beantwortet? Oder nicht eher eines, das genau auf meine Anwendungsgebiete zugeschnitten ist? Mit einem spezifischen Modell wäre man sicherlich produktiver.
KI-Modelle sind gut darin, Korrelationen zu entdecken. Sie können semantisch und syntaktisch sinnvolle Texte produzieren, aber KI besitzt keinen gesunden Menschenverstand.
Ja, aber sie erwecken den Eindruck. Deshalb brauchen wir dringend KI-Kompetenzen bei den Menschen. Damit sie mit KI umgehen können und verstehen, wo die Grenzen dieser Technologie liegen. Am Ende ist es ein sehr grosses, lernendes Netzwerk mit vielen Nullen, Einsen und Parametern.
Wie bringen Sie Ihren Kindern den Umgang mit künstlicher Intelligenz bei?
Wenn zum Beispiel eine Deutscharbeit ansteht, dann fragen wir bei uns zu Hause schon mal ChatGPT an, um mehr Übungsmaterial zum Thema zu bekommen. Aber man muss vor allem die jüngeren Kinder bei diesen Prozessen begleiten und ihnen die Technik so gut wie möglich erklären. Da brauchen Eltern heute sicherlich eine gewisse Kompetenz.
Ganze Bachelorarbeiten mit ChatGPT schreiben, unbeaufsichtigte Prüfungen ablegen… Hochschulen haben grossen Respekt vor KI, wenn nicht sogar Angst. Können sie das verstehen?
Das kann ich natürlich verstehen. Aber Angst ist hier wirklich ein schlechter Ratgeber. Man muss eher in die Analyse gehen. Zum Beispiel bei den Prüfungen. Also sich fragen, sind unsere Prüfungsformate eigentlich perspektivisch zeitgemäss. Ich glaube, dass man in Zukunft zu anderen – mehr kompetenzorientierten –Prüfungsformaten übergehen wird. Also nicht mehr eine grosse Textmenge ohne jeglichen Diskurs einreichen. Sondern die Hochschulen werden beispielsweise mehr Reflexion verlangen, oder auch kurze mündliche Verteidigungen der Thesen oder Nachfragen.
Welche KI-Kompetenzen brauchen Studierende und Dozierende an Hochschulen?
Dazu gehören sehr viele Kompetenzen. Von den grundlegenden technischen Kompetenzen, also der Bedienung eines Tools, bis hin zum Thema der sozialen Interaktion unter dem Einfluss von KI. Die Arbeit an KI-Kompetenzmodellen schreitet zügig voran, und wir sehen auch bereits erste Integrationen in Curricula für Studierende und Dozierende.
Eigentlich müssten Dozierende in Sachen KI fitter sein als die Studierenden?
In der Theorie ja. Die Studierenden sind sicher fitter in den aktuellen Toolsystemen und generell in der Anwendung. Aber in der Bewertung, Einordnung und didaktischen Nutzung müssen die Dozierenden einen Vorsprung haben.
Wo sehen Sie die grösste Gefahr für uns als Fernfachhochschule im Zusammenhang mit KI?
Ich glaube, dass eine der grössten Gefahren für die FFHS im Bereich der Prüfungen liegt. Man sollte sich
das Prüfungsszenario genau anschauen und über Alternativen nachdenken. Wichtig ist, dass auch die Qualität der Lehrmittel gegeben ist, das gilt auch für die Präsenzuniversitäten. Wir müssen uns fragen, sind unsere Angebote so gut, dass sie nicht durch billigere – ob mit oder ohne KI – ersetzt werden können. Wenn man aktuell ist, bleibt man für die Studierenden attraktiv.
Wo sehen Sie die grössten Chancen?
Wenn die FFHS am Ball bleibt, hat sie grosse Chancen, KI nicht einfach nur zu tolerieren, sondern damit Neues zu schaffen. Die Idee der FFHS eines digitalen Lernassistenten sehe ich als eine grosse Chance. Damit schaffen sie nicht nur einen Mehrwert für die Studierenden, sondern zeigen ihnen auch, dass KI nicht nur etwas ist, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, sondern mit dem sie arbeiten und gestalten können. Ich würde der FFHS auch empfehlen, die Verwaltung durch gewisse Automatisierungen in der Administration zu entlasten. Das steigert die Effizienz und bietet die Möglichkeit, weitere spannende Projekte, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, umzusetzen.
Interview: Melanie Biaggi

Niels Pinkwart ist seit 2013 an der HumboldtUniversität zu Berlin als Leiter des Lehrstuhls «Didaktik der Informatik/Informatik und Gesellschaft» tätig, seit Oktober 2021 auch als Vizepräsident für Lehre und Studium.
Die Frage beantworte ich mit JA. Allerdings geht es mir nicht um die Detektion «ob», sondern um «wie» KI eingesetzt wurde. Das «ob» ist schnell beantwortet und liegt schon im Schreibstil auf der Hand: Oberflächliche, überlange und nichtssagende «Wiki-Einheitsbreitexte» benötigen nicht mal ein Tool für die Detektion von KI. Das erkennen wir von blossem Auge. Auch wenn der Beweis in der Folge zugegebenermassen schwierig ist.
Wir haben als Hochschule die Pflicht, auf die Richtigkeit des Inhaltes und die akademische Redlichkeit einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit zu achten und diese bestmöglich zu prüfen. Solange die KI ihrem Namen noch nicht gerecht wird und lediglich Informationen unreferenziert aneinanderreiht (man kann es auch plagiieren oder stehlen nennen), und solange die Studierenden den Nutzen der KI überschätzen (wie wir an der diesjährigen Kohorte gesehen haben), ist es an uns Prüfern, diese Defizite mühselig aufzudecken. Quellen müssen geprüft und Inhalte verifiziert werden.
Damit findet aber auch bei uns Prüfern ein Learning statt, welches uns ermöglicht, den Studierenden anhand konkreter Beispiele die Risiken von KI aufzuzeigen und die akademisch redliche Nutzung von KI zu fördern.
 DR. CLAUDIA STADELMANN KELLER Leiterin Qualitätssicherung Forschungsmethoden Lehre
DR. CLAUDIA STADELMANN KELLER Leiterin Qualitätssicherung Forschungsmethoden Lehre
Die aktuellen Technologien der generativen KI sind weit davon entfernt, autonom kohärente und tiefgründige akademische Arbeiten zu erstellen. Generative KI kann unterstützen oder Ideen generieren. Aber die Fähigkeit, einen roten Faden zu spinnen oder eine Arbeit auszugestalten, bleibt (noch) eindeutig menschlich.
Durch einen unreflektierten Gebrauch generativer KI im Schreibprozess wird nicht nur die Struktur leiden, sondern auch der Gesamtzusammenhang fragmentiert. Hier können wir aber nahezu auf genau die Kriterien zurückgreifen, die wir schon immer herangezogen haben, um die Qualität akademischer Arbeiten zu beurteilen. Daher plädiere ich dafür, unsere Energie nicht darauf zu verwenden, Technologien zu jagen und zu identifizieren, die möglicherweise im Erstellungsprozess einer Arbeit verwendet wurden.
Es spricht nichts dagegen, Transparenz über die Verwendung von KI in der Abschlussarbeit einzufordern. Aber anstatt zu KI-Detektiven zu werden, sollten wir uns als Mentoren sehen, und unsere Studierenden darauf vorbereiten, die Werkzeuge und Technologien ihrer Zeit verantwortungsvoll und effektiv einzusetzen und gleichzeitig eine kritische Haltung einzunehmen, die weit über das blosse Bewusstsein, dass ChatGPT Fakten erfinden kann, hinausgehen muss.

PROF.
DR. TOBIAS HÄBERLEINLeiter Departement Informatik
Digitale Gesundheitsapps, etwa zur Ernährungsumstellung, sind beliebt. Es zeichnet sich ab, dass digitale Tools mithilfe von KI in Zukunft immer mehr Aufgaben eines Ernährungsberaters übernehmen. Doch kann die KI auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Beraterin ersetzen?
Eine App erfasst mein Gewicht sowie meine Körpergrösse und fragt mich nach Vorerkrankungen. Aufgrund dieser persönlichen Daten gibt sie mir Tipps für die Ernährungsumstellung, schlägt Übungen vor und erfasst meine Fortschritte in einem Foto-Esstagebuch. Digital unterstützte Ernährungsberatung wie Oviva bietet eine personalisierte Begleitung für Menschen, die beispielsweise ihre Ess- oder Bewegungsgewohnheiten ändern möchten. Oviva ist eine Kombination zwischen App und persönlicher Ernährungsberatung durch ausgebildete Ernährungsfachpersonen und wird von Krankenkassen anerkannt.
«Die Vorteile einer digitalen Anwendung sind sicher die zeitliche Flexibilität und die geringere Hemmschwelle. Eine App ist im Gegensatz zu einer Ernährungsberaterin auch morgens zwischen drei und fünf Uhr erreichbar», sagt Jacqueline Javor Qvortrup, die an der FFHS die beiden Bachelorstudiengänge «Ernährung und Diätetik» sowie «Ernährung und Gesundheit» leitet. Die Patienten seien bei einem Chatbot weniger gehemmt, mehrmals die gleichen Fragen zu stellen. Auch für Beratende kann KI gemäss Javor Qvortrup durchaus nützlich bei repetitiven Aufgaben sein, wenn Unterlagen zu Ernährungsfragen zusammengestellt oder Berichte formuliert werden müssen. Das spart Zeit und Ressourcen.
Food Scanner gegen Mangelernährung
Aufsehen erregt hat kürzlich der schweizweit einzige Food Scanner in einem Basler Altersspital. Der Scanner überwacht mittels KI, ob die Patientinnen genug essen. Wieviel Essen wieder in die Spitalküche zurückkommt, ist ein wichtiger Indikator und kann helfen Mangelernährung, ein Risiko gerade bei älteren Patientengruppen, vorzubeugen. Via 3D-Kamera werden die Teller vor dem Abwaschen gescannt und die KI berechnet, wie viel tatsächlich gegessen wurde. In Zukunft sollen noch genauere Daten mit Angaben zu aufgenommenen Nährstoffen, Kohlenhydraten, Proteinen und Kalorien pro Patient möglich sein.

Was habe ich die ganze Woche über gegessen?
Digitale Apps helfen beim Erstellen eines Ess-Tagebuchs. (Foto: Eaters Collective)
Die Möglichkeiten von KI-Anwendungen in der Ernährungsberatung lassen sich noch weiterdenken. Wenn eine App in der Lage ist, individuelle Daten, etwa zu Therapiefortschritten oder Essenstagebüchern, laufend zu erheben und zu analysieren, kann sie daraus KI-basiert personalisierte Behandlungsempfehlungen ableiten. So könnten
Aufgaben wie etwa die Anamnese oder die Erstellung von Ernährungsprotokollen und Diätplänen komplett automatisiert werden. Denkbar ist auch ein Einsatz von KI zur Erstellung eines digitalen Zwillings eines Patienten. Diese können anhand von genetischen und physiologischen Daten eine Simulation eines Gesundheitszustandes herstellen und so die weiteren Therapieansätze definieren.

Empathie, Gefühle, Wertschätzung
Doch wird eine KI eine menschliche Ernährungsberaterin ersetzen können? «Sag niemals nie», meint Jacqueline Javor Qvortrup mit Blick auf die Zukunft. Sie fügt aber direkt an, dass KI heute noch weit davon entfernt sei, die menschliche Beziehung zwischen Klienten und Beratenden zu ersetzen. Eine Ernährungsberatung sei nicht nur eine rein sachliche Angelegenheit, es gelte auch, die Gefühlslage eines Patienten zu erkennen und darauf zu reagieren. «Empathie, Wertschätzung und aktives Zuhören gehören ebenso dazu», so Javor Qvortrup. Eine Beratungsperson müsse die Gefühlslage der Patientinnen erfassen und darauf reagieren können.
Noch wichtiger ist gemäss Javor Qvortrup jedoch die Reaktion auf Fehler: «In der Ernährungsberatung kann es um Leben und Tod gehen». Eine KI könne nur Wissen wiedergeben, mit welchem sie zuvor gefüttert worden ist, aber sie könne nicht kontrollieren, ob es stimmt. «Sicher machen auch Menschen Fehler. Aber ein Mensch merkt eher als eine KI, wenn eine Empfehlung falsch war.»
Wie in vielen anderen Feldern bietet die Anwendung von KI auch in der Ernährungsberatung vielfältige Möglichkeiten und kann zeitliche Ressourcen freimachen, die dann anderweitig in die Begleitung von Patienten eingesetzt werden können. Daher ist der Umgang mit digitalen Hilfsmitteln ein wichtiges Thema, das in die Ausbildung von Ernährungsfachpersonen einfliessen muss. Gemäss Jacqueline Javor Qvortrup sei es wichtig, dass Studierende sensibilisiert werden für die neuen Möglichkeiten. Sie müssten aber auch die Grenzen dieser Technologien kennen und sie kritisch hinterfragen können. Angesichts der Risiken und der vielfältigen Chancen hält sie fest: «Verteufeln bringt nichts».
Text: Natascha Ritzffhs.ch/studium DIE FFHS BIETET ZWEI BACHELORSTUDIENGÄNGE IM BEREICH ERNÄHRUNG AN
Der Bachelor Ernährung und Diätetik fokussiert die Ernährung von kranken Menschen un d ist nach dem Gesundheitsberufegesetz akkreditiert. Der Bachelor Ernährung und Gesundheit bietet breite Berufsperspektiven, etwa in der Gesundheitsförderung, der Produktentwicklung oder der Beratung von sp eziellen Gruppen wie Sportlern.
KI ist spätestens seit ChatGPT zu einer Alltagstechnologie geworden. Die Forschung wendet sich immer mehr Fragestellungen zu, wie KI in der Praxis eingesetzt werden kann. Den Anwendungsgebieten sind kaum Grenzen gesetzt, wie drei aktuelle Beispiele aus der FFHS-Forschung illustrieren.
Die Kartoffel ist die viertwichtigste Nahrungspflanze der Welt und kann bis zu elf Monate gelagert werden. Ein Qualitätsmerkmal, das sie so wertvoll macht. Allerdings muss bei der Lagerung das «Austreiben» vermieden werden, so dass die Kartoffel weder grüne Stellen noch knollen- oder wurzelartige Auswüchse bildet. Das Laboratory for Web Science (LWS) untersucht derzeit in einem Kooperationsprojekt die Vorhersage der Kartoffelkeimung mittels KI, um die Knollenlagerung zu optimieren. Man will den Austrieb überwachen, bevor sichtbare Anzeichen auftreten, sowie Sprühpläne testen, um effiziente und umweltfreundliche Vorgehen zu finden. Mit der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) wird etwa an Vorhersagealgorithmen und der Analyse von Behandlungsdaten gearbeitet.
Der Ansatz kombiniert Machine-Learning-Technologien mit der sensorbasierten Überwachung elektrischer Signale von Kartoffeln, um das Auftreten von Keimen vorherzusagen. «KI hilft uns, die Bedingungen der Kartoffellagerung besser zu verstehen und so das Timing der Behandlungen mit Anti-Austriebsmitteln zu verbessern. Das führt zu weniger Rückständen im Endprodukt und reduziert die Kosten der Lagerung», so LWS-Leiterin Prof. Dr. Beatrice Paoli. Ziel ist es, eine nachhaltigere Verarbeitung von Kartoffeln zu ermöglichen und den Zeitpunkt der Anwendung von Mitteln zur Bekämpfung von Keimlingen zu optimieren, was letztendlich zu weniger Behandlungen führen könnte und so der Umwelt, der menschlichen Gesundheit und der Arbeitsbelastung der Landwirte zugute käme.
Studierende sollen besser und schneller lernen
Wie kann man die Aufmerksamkeit von Studierenden lenken und steigern, damit sie effizienter lernen? Zu Beginn gilt es herauszufinden, worauf sie sich beim Lernen achten oder durch was sie abgelenkt werden. «Wir konzipieren Onlinekurse, um zu erfassen, wo die Aufmerksamkeit der Studierenden beim Lesen eines Textes oder Beantworten von Fragen liegt. Dazu werten wir ihre Mausbewegungen oder ihre Eingaben aus», erklärt Prof. Dr. Per Bergamin, Leiter des Instituts für Fernstudien- und eLearningforschung (IFeL). Die Forschenden setzen KI ein, um zu schauen, worauf die Studierenden ihren Fokus am Bildschirm legen. Wenn die Aufmerksamkeit auf den ungünstigen Stellen liegt, wird diese mittels visueller Markierungen umgelenkt. Dazu Bergamin: «Mit einfachen Mitteln wie Symbolen, übermalten Textstellen oder eingeblendeten Rahmen können wir ihre Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenken».
Mit dem Projekt wollen die Forschenden die individuellen Lernfähigkeiten von Studierenden auf effiziente Weise weiterentwickeln. Dies nicht nur mit der Lenkung und Steigerung der Aufmerksamkeit. Später soll KI auch helfen, die Lernfragen an die persönlichen Bedürfnisse der Studierenden automatisch anzupassen. Mit diesen maschinen-basierten Algorithmen können Lernprozesse optimiert werden. Diese Algorithmen werden gemäss Per Bergamin später auch in Kursen der FFHS zum Einsatz kommen. Und künftig könnten auch andere
Auch für Bauern kann KI effizienzsteigernd sein, etwa wenn es um die Lagerung von Kartoffeln geht.
(Bild: KI-generiert / FFHS)

Hochschulen oder schulische Einrichtungen davon profitieren. Die Projektverantwortlichkeit teilt sich die FFHS mit der südafrikanischen North-West University (NWU). Auch die Universität Johannesburg und die Universität Zululand (Südafrika) sind am Projekt beteiligt. Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfond (SNF) finanziell unterstützt.
Zuschauerprognosen fürs Hockeystadion
Für Schweizer Hockeyclubs ist entscheidend, dass an Spieltagen möglichst viele Zuschauer ins Stadion strömen und konsumieren, denn das Catering- und Gastronomieangebot ist neben den verkauften Tickets ihre grösste Einnahmequelle. In einer Machbarkeitsstudie im Auftrag des Hockeyclubs SCL Tigers hat das Institut für Management und Innovation (IMI) in Zusammenarbeit mit dem LWS eine Anwendung geprüft, die mittels Machine Learning Prognosen für die zu erwartenden Zuschauerzahlen macht. «Zu wissen, wie viele Personen an einem Spieltag vor Ort sein werden, gibt den Verantwortlichen Planungssicherheit, um ihren Waren- und Personaleinsatz zu optimieren», sagt Prof. Dr. Andrea L. Sablone vom IMI.
Im Projekt konnten einige Faktoren eruiert, andere bestätigt werden, die für den Besuch eines Spiels ausschlaggebend sind. Wenn etwa die eigene Mannschaft im oberen Feld der Tabelle steht oder wenn der Spieltag auf einen Samstag fällt, werden voraussichtlich mehr Personen ins Stadion strömen. Das interdisziplinäre Forschungsteam hat auf Basis vergangener Daten, angereichert mit relevanten Faktoren wie beispielsweise Wochentag, an dem das Spiel stattfindet, oder aktuellem Tabellenplatz, Berechnungen durchgeführt und so die Algorithmen trainiert, um die präzisesten Vorhersagen zu machen. Angewandt auf Spiele der laufenden Saison erzielten die so trainierten Algorithmen erstaunlich genauere Angaben der Zuschauerzahl. Die Fehlerquote lag mit 3,1 Prozent weit besser als die üblichen 10 Prozent der erfahrungsbasierten Prognosen der Clubmanager. Die von Innosuisse unterstützte Studie legt nahe, dass datenbasierte Tools durchaus wirtschaftliches Potenzial für Sportclubs haben. «Aus dieser Sicht wäre eine Weiterentwicklung wünschenswert, zumal es derzeit auf dem Schweizer Markt keine vergleichbare Applikation gibt», so Sablone.
Text: Natascha Ritz
Braucht es beim Bewerbungsgespräch bald keine HR-Verantwortlichen mehr?
Florian Witschi hat in seiner Bachelorarbeit im Studiengang Wirtschaftsinformatik untersucht, in welchen Bereichen des Rekrutierungsprozesses künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann.
Florian Witschi arbeitet selbst als Recruiting Partner bei einem Schweizer Energiekonzern. Dort beschäftigt er sich seit kurzem mit dem Einsatz von KI im Rekrutierungsprozess. Deshalb war für ihn schnell klar, dass er sich in seiner Bachelorarbeit mit diesem Thema auseinandersetzen würde. «So konnte ich mein Studium mit meinem Arbeitsalltag verbinden.»
Ziel der Bachelorarbeit war es, ein umfassendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie KI-Technologien den Rekrutierungsprozess optimieren können und welche technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
Dazu führte Witschi eine Literaturanalyse durch, um den aktuellen Stand der Forschung zu ermitteln und theoretische Grundlagen zu schaffen.
Vorselektion und Social Media Check
KI im HR-Bereich ist noch wenig erforscht. Dies ist laut Witschi insofern erstaunlich, als im Personalmanagement eigentlich sehr grosse Datenmengen an Informationen über die Mitarbeitenden zur Verfügung stünden. Heute nutzen erst einige grosse Technologieunternehmen wie Google oder IBM diese Daten, um Prognosen über Fluktuation, Absenzen oder andere Personalkennzahlen zu erstellen.
Mit seiner Literaturanalyse, für die Witschi Schlüsselwörter definierte, nach passenden Quellen suchte und die Ergebnisse zusammenfasste, konnten KI-Anwendungen für alle Phasen der Personalrekrutierung gefunden werden. «Die meisten Anwendungsbeispiele wurden bei der aktiven und passiven Suche nach potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen sowie bei der Analyse von Bewerbungsunterlagen gefunden. In diesen Bereichen gibt es auch bereits viele Praxisbeispiele und auch die Akzeptanz auf Seiten der Bewerbenden ist am höchsten», so Witschi.
Konkret sehen die Expertinnen und Experten das grösste Potenzial für KI im Rekrutierungsprozess noch im Bereich der Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern sowie in der automatischen Analyse von Bewerbungsunterlagen.
Witschi hat seine Auswertungen in einem Konzept festgehalten. Darin erläutert er, welche konkreten KI-Anwendungen in den einzelnen Prozessphasen zum Einsatz kommen könnten. Beispielsweise könnte in der Bedarfsanalyse ein Chatbot die Korrespondenz mit den Bewerbenden übernehmen. In der Vorselektion wäre es möglich, KI für Social-Media-Checks zu nutzen, im Interview für die Terminkoordination und im Onboarding für die automatisierte Vertragserstellung.
KI kann Lebensläufe prüfen, aber nicht die sozialen Kompetenzen eines Bewerbers. Gerade diese spielen aber eine wichtige Rolle. Dazu sagt Witschi: «Deshalb habe ich im Endergebnis meiner Arbeit, dem Konzept für den Einsatz von KI im Recruiting, auch auf KI-Interviews verzichtet, weil hier der Faktor Mensch noch zu wichtig ist». Technisch wäre es bereits machbar, erklärt Witschi weiter, in der Praxis gebe es aber noch kaum Beispiele. Auch die Tiefe solcher Gespräche sei derzeit noch eher bescheiden und begrenzt, gebe aber einen Vorgeschmack auf das, was in Zukunft möglich sein werde.
Text: Melanie Biaggi
ffhs.ch/bsc-wirtschaftsinformatik SPANNUNGSFELD ZWISCHEN IT, BETRIEBSWIRTSCHAFT UND MANAGEMENT
Im BSc Wirtschaftsinformatik lernen die Studierenden sowohl die Sprache der Informatik als auch der Betriebswirtschaft. Das praxisorientierte Bachelorstudium dauert neun Semester. Ab dem sechsten Semester stehen drei Vertiefungsrichtungen zur Auswahl.
Ich wage mich hier kaum mehr auf die Äste hinaus. Was habe ich nicht schon alles für unmöglich gehalten und wurde eines Besseren belehrt. KI kann nicht kreativ sein? Doch, kann sie. KI kann keine moralischen Urteile fällen? Doch, kann sie. KI kann nicht empathisch sein? Doch, kann sie. Aber KI agiert aus einer formalen Logik heraus und sieht nur die Welt, die wir ihr in Daten zur Verfügung stellen. Ihr fehlt der freie Wille, das Bauchgefühl, das Gewissen. So kann etwa ein KI-gesteuerter PflegeRoboter trainiert werden, zuvorkommend zu sein. Genauso gut könnte er aber auch – völlig ohne schlechtes Gewissen – einen Patienten ohrfeigen. KI kann viel und vieles besser als der Mensch. Doch KI bleibt KI und der Mensch bleibt Mensch. Sie darf mir gerne bei der Arbeit mühsame Aufgaben abnehmen, aber ein Feierabendbier werde ich immer lieber mit meinen Kolleginnen und Kollegen der FFHS trinken.

E-Learning Expertin Learning Center
KI wird nie in der Lage sein, eigenständig logische Schlüsse zu ziehen. Zumindest nicht mit den aktuellen (auf Wahrscheinlichkeit beruhenden) Modellen. Nutzt man eine KI beispielsweise zur Informationsbeschaffung, lassen sich leicht Parallelen zu einer Google-Suche ziehen. Die erfolgreiche Auswertung von Informationen steht dabei eng im Zusammenhang mit dem individuellen Wissen. Die Qualität der von KI ausgegebenen Informationen hängt jedoch von der Qualität des Datensatzes ab. Da die KI momentan nicht in der Lage ist, Daten eigenständig und in vergleichbarer Weise zu bewerten, müssten Menschen diese Datensätze auf Richtigkeit und Aktualität überprüfen und pflegen. Eine künstliche Intelligenz sollte jedoch in der Lage sein, eigenständig logische Schlussfolgerungen zu ziehen, um etwas bewerten zu können. Es stellt sich also die Frage, ob und auf welche Weise dieses Ziel erreicht werden kann.

Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren zunehmend unseren Alltag erobert, und nie zuvor war das Interesse so gross wie jetzt. Sie unterstützt uns nun noch mehr im Alltag, indem sie durch natürliche Sprache bedient werden kann. Die Unterstützung bei komplexeren Aufgaben wie der Generierung von Texten bis hin zur Programmierung ist ein Schritt in Richtung Effizienzsteigerung unserer Gesellschaft. Aus meiner Sicht wird KI niemals im Bereich Kreativität, Empathie und Emotion so gut sein wie wir Menschen. Das kommt schlicht und ergreifend daher, dass die KI lediglich auf den aktuell existierenden Daten trainiert wird. Kreativität lebt jedoch von der Schöpfung neuer Artefakte, zum Beispiel eines Gemäldes oder Musikstücks. Zwar kann die KI bestehende Muster neu kombinieren, jedoch keine völlig neue Form oder Melodie kreieren. Hier bleibt der Mensch immer noch überlegen.

Fachbereichsleiter Informationssysteme und Internet of Things
Perplexity ist eine KI-Suchmaschine, die sich durch die transparente Angabe von Quellen auszeichnet und die Auswahl verschiedener Quellentypen ermöglicht. Zusätzlich unterstützt perplexity sequenzielle Fragen und bietet eine Funktion zum Hochladen und Analysieren von PDF-Dokumenten.
perplexity.ai
Du bist mehr der auditive Lerntyp?
Speechify liest dir Texte vor, seien es Bücher, Fachbeiträge oder deine Zusammenfassung für die Prüfung. Es ermöglicht dir zu lernen, während du unterwegs bist, zum Beispiel beim Joggen oder im Zug.
speechify.com
Writefull hilft dir beim Korrigieren deiner Arbeit und spürt unnötige Rechtschreib- oder Grammatikfehler auf. Die App ist speziell für akademische Texte geeignet und unterstützt dich auch beim Formulieren, indem sie dir Synonyme vorschlägt.
writefull.com
Mit Gamma lassen sich ganz einfach Präsentationen erstellen – ohne lästige Formatierungen oder Designarbeiten. Zudem erhältst du durch das Tool die Möglichkeit, deine gesamte Präsentation mit nur einem Klick umzugestalten und sie so jederzeit an unterschiedliche Anforderungen anzupassen.
gamma.app
Genei erstellt Zusammenfassungen in Nullkommanichts, sei es eine wissenschaftliche Studie, ein Buch oder sonstige Dokumente. Dabei erkennt es Schlüsselbegriffe der Texte und hebt die wichtigsten Punkte hervor.
genei.io
Um hochstehende Studiengänge anzubieten, müssen diese laufend systematisch überprüft werden. Wie dies an der FFHS aussieht, erklärt Désirée Guntern Kreuzer, Direktorin Grundbildung, im Interview.
Désirée Guntern Kreuzer, wie stellt die FFHS die Qualität in den Studiengängen sicher?
Wir haben drei eigens definierte Prozesse, die wir mit der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) teilen. Zum einen sind dies die Bewertung der Studiengänge durch die Absolventen und die Bewertung des Unterrichts durch die Studierenden. Ausserdem bewerten wir regelmässig unser gesamtes Portefeuille an Studiengängen hinsichtlich Relevanz und Qualität und unsere Studiengänge der Grundbildung durchlaufen alle sieben Jahre eine Evaluation mit externen Peers.
Welche konkreten Möglichkeiten haben Studierende, um ihr Feedback während des Studiums abzugeben?
Zentral sind die Modulevaluationen, die am Ende jedes Semesters durchgeführt werden. Alle Studierenden werden aufgefordert, ihre belegten Module zu bewerten, sei es hinsichtlich der Qualität der Module, des Unterrichts und der Online-Betreuung oder auch der Kursliteratur und dem Kursmaterial. Aber auch während des Semesters können sie jederzeit Rückmeldungen direkt an die Dozierenden oder die Studiengangsverantwortlichen richten.
Wie geht die FFHS mit den Feedbacks um?
Jedes Feedback nehmen wir ernst. Wir prüfen, ob es sich um eine Einzelmeinung handelt oder um eine geteilte Ansicht und leiten die notwendigen Massnahmen ein.
Wie können solche Massnahmen aussehen?
Die Massnahmen können je nach Feedback unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise überarbeiten wir ein Modul, verbessern die Unterrichtsqualität, die Online-Betreuung oder den organisatorischen Ablauf.

«Studierende sollten die Möglichkeit für Feedback nutzen, nur so können wir uns verbessern», sagt Désirée Guntern Kreuzer, Direktorin Grundbildung an der FFHS. (Foto: FFHS)
Was ist Ihnen als Verantwortliche in der Qualitätssicherung wichtig?
Dass wir die Prozesse einhalten und Hand in Hand mit der SUPSI arbeiten. Wir wollen die hohe Qualität unserer Studiengänge halten und verbessern. Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse aller Stakeholder zu berücksichtigen.
Wie verändert sich die Qualitätssicherung im heutigen Hochschulumfeld?
Wir müssen uns überlegen, wie wir im Zeitalter von KI die Qualität sicherstellen und dafür sorgen, dass die Studierenden kritisch damit umgehen. Es ergeben sich neue Fragen. Wie können Studierende KI sinnvoll nutzen und trotzdem ihre wissenschaftliche Eigenleistung erbringen? Wie müssen Prüfungen in Zukunft aufgestellt sein? Aber auch: Wie können wir als Hochschule KI nutzen, um qualitativ hochwertige Kurse anzubieten?
Interview: Natascha Ritz

Ruth Westrick arbeitet im Kongo und hilft dort, einen Nationalpark touristisch zu entwickeln. Im Januar hat sie an der FFHS den Master in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft abgeschlossen. In ihrem Studium und ihrer Arbeit in Afrika treffen ganz unterschiedliche Blickwinkel zur Nachhaltigkeit aufeinander.
Eine gute Internetverbindung ist nicht überall auf der Welt eine Selbstverständlichkeit. Das wird klar, wenn man mit Ruth Westrick spricht. Im Online-Interview schaltet sie kurz nach der Begrüssung ihre Webcam aus, um das Netz nicht zu überlasten. Westrick kennt die kleinen Tricks, schliesslich hat sie ihr Masterstudium in den letzten Semestern komplett online von Afrika aus gemeistert. Seit Januar 2023 arbeitet sie in der Demokratischen Republik Kongo als Commercial Manager im Nationalpark Garamba. Der Park im Nordosten des Landes ist das einzige Gebiet des Ostkongos, das derzeit als sicher gilt. Ruth Westrick gibt zu: «Es ist nicht gerade die erste Touristendestination». Ihr Job ist es, als Commercial Manager den Park touristisch zu entwickeln und Einnahmequellen für die lokale Bevölkerung zu finden.
Der 5'100 Quadratkilometer grosse Garamba Park existiert bereits seit 1938, es ist der drittälteste Nationalpark Afrikas. Doch kriegerische Konflikte und Wilderei haben die Region arg gebeutelt. «Vor 40 Jahren gab es hier 20'000 Elefanten, heute sind noch 1'500 übrig. Nashörner wurden 2006 ausgerottet», so Westrick. Der Park gilt heute jedoch als sicher und ist rund um die Uhr bewacht. Nun geht es darum, den Park in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wiederaufzubauen. Strassen und Unterkünfte sollen angelegt und Wildtiere wieder angesiedelt werden. «Dieses Jahr fliegt unsere Organisation 64 Nashörner von Südafrika in den Kongo, eine logistische Riesenoperation».
«Nachhaltigkeit ist die Zukunft»
Westrick ist bei der Naturschutzorganisation «African Parks» angestellt, die in 12 afrikanischen Ländern tätig ist. Der Garamba Park finanziert sich derzeit ausschliesslich aus Spendengeldern, doch Westrick sieht im lokalen Tourismus Potenzial. Im Kongo gebe es durchaus Personen, die es sich leisten können zu reisen: «Dieser Tourismus ist nachhaltiger als eine internationale Kundschaft zu holen, die einmal im Leben für eine Safari eine weite Flugstrecke zurücklegt».
Die Grundsätze nachhaltiger Wirtschaft kennt Westrick aus ihrem Studium. 2022 lancierte die FFHS den Master in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, komplett online und in englischer Sprache. Perfekt für Westrick, die zu diesem Zeitpunkt bereits mitten im Masterstudium mit Vertiefung Innovation Management steckte und ins neue Modell wechselte. Sie sagt: «Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind die Zukunft».
Schon ihr Bachelorstudium hat die gebürtige Spiezerin berufsbegleitend an der FFHS absolviert. Vor ihrer Zeit in Afrika war sie 13 Jahre lang im Head Office beim Reiseunternehmen Globetrotter tätig. Zur Leidenschaft fürs Reisen kam die Faszination für Afrika hinzu und so wagte sie 2016 den Schritt, in Afrika zu arbeiten. Vier Jahre lang leitete sie in zwei Nationalparks in Sambia Luxus Safari Camps, bevor Covid sie zur Rückkehr in die Schweiz zwang.
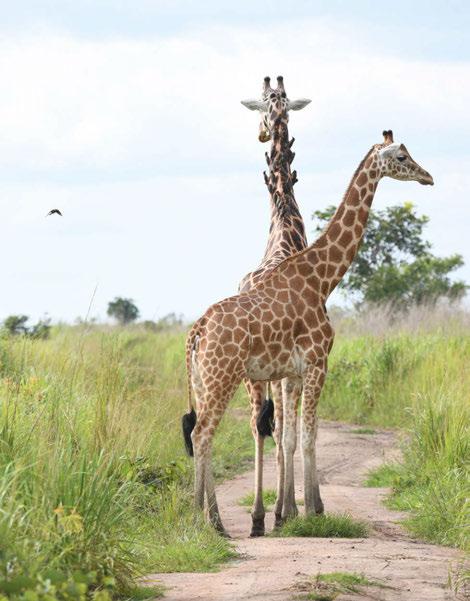
Studieren aus allen Teilen der Welt
Den Master absolvierte sie anfangs im Amazonas, dann in der Schweiz, nach der Pandemie auf Reisen in Kolumbien und in Kanada und zuletzt im Kongo. «An einer anderen Schule hätte ich definitiv nicht studieren können», lacht sie. Das Onlinestudium war hin und wieder eine Herausforderung, etwa als bei einer mündlichen Prüfung wegen eines Gewitters der Strom ausfiel. «Durch Batterien wurde wenigstens die Internetleitung aufrechterhalten, aber das Licht war weg. Ich habe dann mit der Taschenlampe mein Gesicht beleuchtet, damit der Dozent mich immerhin sehen konnte», erinnert sie sich schmunzelnd.
Rückblickend sind es die Nachhaltigkeitsmodule, die ihr im Studium am meisten gefallen haben. Auch wenn sie viele Aspekte ganz anders erlebt: «Wir haben viel über modernes Management und Leadership gesprochen, über Gleichstellung und Diversity. Das ist hier in Afrika eine völlig andere Situation». Die Gleichstellung sei kulturbedingt noch nicht so weit. In Sambia war sie die einzige Frau und die einzige Weisse unter 17 sambischen Männern. «Hätte ich dort eine einheimische Frau eingestellt, hätte sie es sehr schwer gehabt.» Diese Perspektive konnte sie auch im Studium einbringen und hat angeregt, dass auch Blickwinkel der weniger entwickelten Welt integriert werden müssen. «Nachhaltigkeit ist ein Luxusgut, das können sich die meisten Leute gar nicht leisten.»
In ihrer Arbeit bei African Parks ist Nachhaltigkeit das oberste Ziel und der Garamba Park soll eines Tages der Bevölkerung zurückgeben werden. Für einen Bewohner im Dorf jedoch hat Nachhaltigkeit keine Priorität: «Er muss sich überlegen, was er seinen Kindern am Abend zu essen gibt». Daher ist es auch die Dankbarkeit, die Westrick in der Schweiz oft vermisst: «Wir haben alles und unser Ressourcenverschleiss ist extrem hoch. Kaum ist ein Sofa abgenutzt, muss ein neues her. Im Vergleich zum Kongo müssten wir uns eigentlich schämen». So gesehen hat Nachhaltigkeit sehr viele Facetten.
Text: Natascha Ritz
ffhs.ch/msc-sustainability MSC BUSINESS ADMINISTRATION
Der MSc Business Administration in Sustainability and Circular Innovation richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die in ihrem Unternehmen Innovation in Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung vorantreiben möchten.
«Das
ist am wichtigsten»
Agile Teams, keine Chefs, Du-Kultur: New-Work-Ideen werden in Schweizer Unternehmen und Institutionen immer beliebter. Hannah Instenberg, Studiengangsleiterin MAS Arbeit 4.0, erklärt, was hinter der «neuen Arbeitswelt» steckt und welche Werte nach wie vor wichtig sind.
Das Konzept ist älter als man denkt. Der Philosoph Frithjof Bergmann ist der Begründer der New-WorkBewegung und untersuchte Ende der 70-er Jahre die Arbeitskultur in den Ostblockstaaten. Sein Fazit: Der real existierende Sozialismus hat keine Zukunft. Als Gegenmodell schuf er New Work. Darunter verstand er Arbeit, die man wirklich will. «Die Sinnhaftigkeit der Arbeit und der Zusammenarbeit sind sehr wichtige Aspekte im Zusammenhang mit New Work», erklärt Hannah Instenberg, Studiengangsleiterin MAS Arbeit 4.0.
Es gibt viele Definitionen von New Work. Häufig wird es als Sammelbegriff für alle Ideen verortet, die darauf abzielen, Arbeit weniger starr oder von oben herab zu gestalten. Das können selbstorganisierte Teams sein, das Duzen oder andere Formen der Mitbestimmung.
Reaktion auf komplexer werdende Welt
Mit der industriellen Revolution hat sich unsere Arbeitswelt verändert, Maschinen haben einen Teil der Aufgaben übernommen. Heute ist durch den technologischen Wandel mehr Flexibilität möglich und die Welt ist komplexer geworden. Darauf müsse man reagieren, so Instenberg: «Damit meine ich nicht einfach die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, das ist längst überholt. Ein Unternehmen muss sich den komplexen Strukturen der Umwelt anpassen».
Wie Instenberg weiter ausführt, geht es bei New Work heute mehr um strukturelles und psychologisches Empowerment. Strukturelles Empowerment bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Unternehmen oder eine Institution organisiert ist, psychologisches Empowerment bezieht sich auf die Anliegen der Mitarbeitenden.
New Work umfasst also viele Bereiche der Arbeitswelt, vom Arbeitsplatz über die Unternehmensstruktur bis hin zur Führung. Wie sehen zum Beispiel New-Work-Arbeitsplätze aus? «Ideal wären offene Strukturen. Wenn sich Mitarbeitende konzentrieren müssen, sollten ihnen zusätzlich abgeschlossene Arbeitsplätze, also quasi Rückzugsorte, zur Verfügung stehen», erklärt Instenberg.
Was kommt nach den Chefs?
Anfang 2024 sorgte der Schweizer Versicherungskonzern AXA für Schlagzeilen. Die Zeitungen titelten etwa, dass der Konzern seine Chefs abschaffe. AXA selbst teilte mit, man wolle auf hochtrabende Titel verzichten und die Hierarchieebenen straffen. Neu soll es bei der AXA Joblevel und Jobprofile geben.
Für Hannah Instenberg geht AXA damit konsequent den nächsten logischen Schritt. Agile Teams seien die Zukunft. Was kommt nach den Chefs? «Ideal wäre, wenn die Unternehmensleitung es den Teams überlässt, ob sie sich selbst organisieren wollen oder nicht. Wenn sich ein Team dafür entscheidet, kann es immer noch einen Verantwortlichen für die einzelnen Bereiche geben», erklärt Instenberg. In agilen Teams liege die Verantwortung also nicht mehr nur auf einer, sondern auf mehreren Schultern. Es gebe aber auch Mitarbeitende, die klare Strukturen bevorzugen und nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen. Denen, die dazu bereit seien, sollten die Führungskräfte aber die Chance geben, fordert Instenberg: «Irgendwann muss man die Kinder auch mal laufen lassen. Mit einem eingespielten Team kann man das probieren».
Wie viele Unternehmen in der Schweiz haben bereits solche flachen Hierarchien? Instenberg: «Es gibt viele Unternehmen, die im Moment nach Teillösungen suchen. Ich würde sagen, dass wir uns in der Schweiz momentan in einer Testphase befinden».

Mit einem eingespielten Team sind flache Hierarchien möglich. (Foto: Unsplash)
Mehr Praxis beim CAS New Organisational Development
Niemand will die militärischen Vorgesetzten zurück. Während AXA Titel abschafft, buchstabieren andere Unternehmen zurück. Sie holen zum Beispiel Mitarbeitende aus dem Homeoffice zurück ins Büro. Um sie besser kontrollieren zu können? Dazu Instenberg: «Vielleicht wurde das Vertrauen von einigen Mitarbeitenden missbraucht oder Arbeitgebende sind generell misstrauisch». Vor allem das Thema Vertrauen habe für Arbeitnehmende und Arbeitgebende in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. «Das betrifft alle Bereiche der Arbeit. Arbeitgebende müssen Vertrauen schenken und die Arbeitnehmenden müssen es sich erarbeiten. Vertrauen ist die Basis für ein gutes Arbeitsverhältnis», fasst Instenberg zusammen.
Wie sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert hat und wie Unternehmen mit New-Work-Massnahmen fit für zukünftige Herausforderungen gemacht werden, erfahren die Studierenden an der FFHS im CAS New Organisational Development, das früher CAS Agile
Organisation hiess. Warum wurde das CAS angepasst? Instenberg erklärt: «Im alten CAS lernten die Studierenden viele neue New-Work-Konzepte und Tools kennen. Die Studierenden gaben uns aber das Feedback, dass sie sich mehr Praxis wünschten. Konkret: wie sie diese neuen Konzepte in ihre Unternehmen integrieren können».
Text: Melanie Biaggi
ffhs.ch/cas-new-organisational CAS NEW ORGANISATIONAL DEVELOPMENT
Im CAS New Organisational Development werden die Studierenden mit der modernen Arbeitswelt 4.0 vertraut gemacht und lernen die Grundlagen der prozessorientierten Organisationsentwicklung sowie die Arbeitsmethoden und Rahmenbedingungen von New Work kennen. Das CAS wird jeweils im Frühjahr angeboten. Es dauert ein Semester und Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2024.
Ernährung und Diätetik:
FFHS erfüllt Auflage der Akkreditierung
Im Juni 2022 hat der Schweizerische Akkreditierungsrat den BSc Ernährung und Diätetik der FFHS akkreditiert. Mit der Einführung eines neuen Moduls wurde nun noch die einzige Auflage erfüllt und somit ist die gesamte Akkreditierung des Studiengangs bis Juni 2029 gültig. Damit wird bestätigt, dass die Absolvierenden des Studiengangs die geforderten Kompetenzen gemäss Vorgaben erreichen und für die Berufsausübung im vielfältigen Berufsfeld der Ernährungsberatung qualifiziert sind.
Duales Studium an Fachhochschulen
wird anerkannt
2015 initiierte die FFHS das praxisintegrierte Bachelorstudium (PiBS) in der Schweiz. Das PiBS richtet sich an gymnasiale Maturanden und verbindet die Praxiserfahrung in einem Unternehmen mit einem Bachelorstudium. Dabei entfällt die vorherige einjährige Arbeitswelterfahrung als Zulassungsbedingung für gymnasiale Maturanden. Das neuartige Modell wurde für Studiengänge in den MINTBereichen als Pilotprojekt bis und mit Startjahrgang 2025 bewilligt. Nun empfiehlt der Hochschulrat, das Angebot an allen Fachhochschulen regulär weiterzuführen.
Mit Dr. Elvira Haas übernimmt ab 1. Juni eine ausgewiesene Führungsperson aus dem Hochschulbereich die Leitung des Departements Gesundheit. Haas studierte Technische Biologie an der Universität Stuttgart und promovierte dort anschliessend am Institut für Zellbiologie. Die 57-Jährige folgt auf Prof. Dr. Sonja Kahlmeier, die das Departement in den letzten fünfeinhalb Jahren geleitet und den Bereich Bewegungs- und Ernährungsforschung an der FFHS aufgebaut hat.
künstliche Intelligenz Neue Professur für generative
An der FFHS wurde Prof. Dr. Tobias Häberlein, Leiter des Departements Informatik, von der SUPSI zum Professor SUPSI ernannt. Die Ernennung bestätigt die wissenschaftliche Kompetenz sowie die Güte der Lehrtätigkeit und die Qualität der Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die während der akademischen und beruflichen Laufbahn erreicht wurden.
Werben um IT-Fachkräfte
Die FFHS stellte ihre Ausbildungsangebote in der Informatik vor. Zu diesen zählt auch das duale Studienmodell PiBS. Dieses praxisintegrierte Bachelor-Studium kombiniert den Einstieg in die Berufswelt mit einem anerkannten Hochschulabschluss BSc Informatik. Die Unternehmen Indual aus Brig-Glis und solffest aus Visp, die solche PiBS-Studienausbildungsplätze anbieten, zeigten auf, wie vielfältig ein Arbeitstag in der IT-Branche ist. «Der Umgang mit Digitalität ist eine überfachliche Kompetenz, welcher im Gymnasium grosse Bedeutung beigemessen wird», betonte Rektor Gerhard Schmidt.
Professor Tobias Häberlein, Leiter des Departements Informatik an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS), über den neuen Studiengang BSc Cyber Security, den Fachkräftemangel und was es braucht, um Nachwuchs für ein Informatik-Studium zu begeistern. […] «Man muss sich schon bewusst sein, dass Informatik ein Berufsbereich ist, in dem man Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung an den Tag legen muss. Die Grundlagen bleiben im Wesentlichen gleich, aber die Technologien verändern sich, und hier muss man als Arbeitnehmer Up to Date bleiben, um weiterhin attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein».
Wie künstliche und menschliche Intelligenz bei Cybersicherheit zusammenspielen
Zum Start des GOHack23, einem dreitägigen Anlass von GObugfree und der Fernfachhochschule Schweiz, diskutierten Referenten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die Zukunft der Schweizer Cybersicherheit. Das Timing des GOHack23 könnte fast nicht besser sein. Nur einen Tag nachdem der Bundesrat seinen Bericht über «die Förderung des ethischen Hackings in der Schweiz» vorlegte, machten der Bug-Bounty-Dienstleister GObugfree und die Fernfachhochschule Schweiz ethisches Hacking zum Thema ihrer gemeinsamen Konferenz. «Kryptografie ist kein Zuckerschlecken»
«Selbstbewusstsein ging flöten» – wie eine Schweizer Spitzensportlerin mit ADHS umgeht Leichtathletin Catia Gubelmann startet mit dem Medikament Ritalin. Das ADHS der 22-Jährigen wurde erst vor zwei Jahren diagnostiziert. Die aufwühlende Lebensgeschichte einer Spitzensportlerin: Die Studentin in Betriebsökonomie und Sportmanagement sitzt in einem belebten Café, vor ihr eine grosse Tasse Tee. Eine Frage reicht und es sprudelt aus ihr heraus. Wie ist es, mit ADHS Leistungssport zu betreiben? Wie fühlt es sich an, wenn man dies ohne therapeutische Behandlung tut? Und welchen Unterschied macht Ritalin?
01.02.2024
Mit Abstand am besten – aber mit welchem? «Rück mir nicht auf die Pelle!» Diesen Appell kennen wir sicher alle. Doch sind wir uns auch dessen bewusst, dass die «Pelle» und damit das Raumverständnis und Raumverhalten kulturabhängig vollkommen konträr sein können? Dr. Irene Pill, die an der FFHS doziert, schreibt in einem spannenden Fachartikel über die unterschiedlichen Wahrnehmungen von räumlich-sozialem Abstandhalten in anderen Kulturen.
CAS AI Engineering
Das Certificate of Advanced Studies (CAS) in AI Engineering ist speziell für Informatiker, Software Engineers oder Data Scientists konzipiert, die ihre Expertise in den neuesten Technologien der angewandten Large Language Model (LLM) vertiefen möchten. Sie wollen wissen, wie sie mit Retrieval AugmentedGeneration (RAG) beliebige Datenquellen mit einem LLM verknüpfen? Sie wollen die neusten Bibliotheken mit Open-Source-LLM ansprechen, intelligente Systeme bauen und gleichzeitig die notwendigen theoretischen Grundlagen kennenlernen?
Dann ist dieses neue CAS das Richtige für Sie.
ffhs.ch/cas-ai-engineering
CAS Innovations in Digital Learning Modernes Lehren und Lernen ist digital. Die Möglichkeiten darin erweitern sich laufend und in beeindruckendem Masse. Im CAS Innovations in Digital Learning eignen Sie sich die relevanten Kompetenzen an, um sich Ideen, Trends und Innovationen des digitalen Lehrens und Lernens zu erschliessen, solche zu beurteilen und selbst passende Lösungsansätze herbeizuführen. Neben der Vermittlung der fachlichen Grundlagen legen wir im CAS grossen Wert auf das aktive Ausprobieren, Üben und Anwenden. Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe und das gegenseitige Lernen voneinander sind für uns wichtige Aspekte. Das Studium bietet Ihnen zudem die Gelegenheit, Ihr berufliches Netzwerk auszubauen.
ffhs.ch/cas-innovations-learning
Die moderne Arbeitswelt erfordert eine Neuausrichtung der HR-Prozesse und -Aufgaben im digitalen Zeitalter. Eine starke Unternehmenskultur ist zentral. Dieses DAS vermittelt Ihnen neben der strategischen Personalentwicklung, die effektive Umsetzung von Talentmanagement und wie Sie Skills als Währung der Zukunft einsetzen können. Durch gezielte Massnahmen zur Einbindung aller Mitarbeitenden schaffen Sie eine Kultur der Zugehörigkeit, die Ihre Arbeitgebermarke nachhaltig stärkt. Durch praxisorientierte Ansätze lernen Sie, Kommunikations- und Werbemassnahmen des Employer Brandings erfolgreich umzusetzen und Ihre Kultur authentisch zu präsentieren. Auch die Förderung von Vielfalt und Inklusion ist ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor – nicht nur ethische Verpflichtung.
ffhs.ch/das-people-and-culture


ffhs.ch/studienangebot ZU UNSEREN AUS- UND WEITERBILDUNGEN
Noch mehr Aus- und Weiterbildungsangebote sowie entsprechende Beschriebe der Studieninhalte und Informationen zum Studienmodell der FFHS finden Sie auf unserer Website. Der Anmeldeschluss für die Weiterbildungen mit Start im Herbst 2024 ist der 31. Mai 2024. Spätere Anmeldungen sind je nach verfügbaren Studienplätzen möglich.
Haben Sie die Cloud-Ausgabe aufmerksam gelesen?
Dann ist diese Frage kein Problem für Sie:
Wie viele Elefanten gibt es noch im Nationalpark Garamba?
S chicken Sie die richtige Antwort per Mail an cloudmagazin@ffhs.ch. Teilnahmeschluss: 31. Juli 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zweimal einen Büchergutschein im Wert von 50 Franken. Viel Glück!
Mitmachen und gewinnen!
Geschenkkarte Gift Card
Geschenkkarte Gift Card
Die FFHS organisiert neben dem breiten Aus- und Weiterbildungsangebot vielseitige Veranstaltungen, wobei dem Publikum stets ein Mehrwert mitgegeben werden soll – durch neues Wissen, dem Netzwerkcharakter unserer Anlässe oder die Anknüpfungspunkte für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung anhand unseres Bildungs- und Dienstleistungsangebots.
Anja Bouron Leiterin Corporate Relations und Career Services
07. Juni, Brig
Zukunft Inklusion: Warum Menschen mit Behinderungen eine Bereicherung für die Berufswelt sind
20. Juni, Zürich Weblaw Forum Legaltech 2024
11 . September, Zürich Maturierenden-Messe
16. September, Zürich Student 4 a Day Ernährung
21 . September, Brig Diplomfeier 2024
26. September, St. Gallen Blended Learning Fachtagung
31 . Oktober, Zürich Master-Messe
14.–16. November, Zürich GOHack24 Weitere Veranstaltungen und Informationen finden Sie unter: ffhs.ch/events
Leben & Studieren einfach kombinieren
Das spezifisch für berufsbegleitendes Studieren entwickelte Studienmodell der FFHS passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an und lässt sich mit Beruf, Familie oder Sport flexibel vereinbaren.