
9 minute read
Familie Leben
Stille Die Macht zu hören
Auf natürliche Weise hören: Das ist Karin Unterholzners größter Wunsch. Ein Implantat und ein Hörgerät unterstützen die Ohren der 49-jährigen Boznerin maschinell. Im Benediktinerkloster in Gries sucht der mit 81 Jahren älteste Mönch P. Plazidus Hungerbühler die Stille immer bewusster. Er bietet Schweigen in der Gruppe an. Für Benedetta Michelini aus Oberbozen gehört morgendliches Schweigen seit fast 25 Jahren zum Tagesauftakt. Jährliche Schweigewochen begleiten sie zu den Wurzeln. Während viele Menschen sich besonders in der Vorweihnachtszeit nach Lautlosigkeit sehnen, bedeutet das für andere Ausschluss aus der Gesellschaft. Vom Wert und Fluch der Stille.
Advertisement
Unser Bedürfnis nach Stille ist ein relativ junges Phänomen, Ohropax beispielsweise wurden erst 1907 erfunden. Auch die akustische Maßeinheit Dezibel ist nicht alt.
Beschauliche Stille kennt Karin Unterholzner aus Bozen nicht. Sie kann ihr auch nichts abgewinnen. Bedingt durch Röteln in der Schwangerschaft hörte sie schon als kleines Mädchen schlecht. Links ist ihr „gutes“ Ohr. Dort ist ganz wenig natürliches Restgehör vorhanden, das mit einem Hörapparat verstärkt wird. Rechts trägt sie ein Cochlea-Implantat. Die Maschine macht den größten Teil ihres Gehörs aus. Sie kann auch Vogelgeräusche wahrnehmen. Wie sich natürliches Hören anfühlt, weiß sie schon lange nicht mehr. Die Ärzte raten ihr, auch im linken Ohr ein Implantat einzusetzen. Doch die Angst ist groß, das selbstständige Hören ganz zu verlieren. Die 49-jährige Mutter von zwei Buben im Alter von 13 und 15 Jahren leidet auch unter Sehschwäche. Mit vier Jahren trug sie ihre erste Brille. Sie war ein geselliges Kind, eine aufgeschlossene Jugendliche, maturierte und studierte. Von der Innenohrerkrankung Morbus Menière hörte sie als 27-jährige Studentin in der Schweiz zum ersten Mal. Dem waren zehn Jahre starker Schwindel, Tinnitus und Hörverschlechterung vorausgegangen. Niemand hatte
ihre Schwindelanfälle mit der Erkrankung im Ohr in Verbindung gebracht.
Über Stille, sagt P. Plazidus Hungerbühler im Kloster Muri Gries in Bozen, solle man nicht reden und lädt zum Schweigen ein. Später kommt er doch ins Erzählen und zitiert Ludwig Wittgenstein: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Die Geräusche der Stadt dringen in das Kloster: „Wir haben kaum mehr Orte der Stille“, bedauert er. P. Plazidus wurde 1940 in der Schweiz in einem Dorf nahe St. Gallen als Karl Hungerbühler geboren. Nach der Grundschule und dem Gymnasium bei den Pallottinern in Gossau ging er zu den Benediktinern nach Sarnen in die Innerschweiz, wo er maturierte.
P. Plazidus Hungerbühler
Von Klein auf hatte P. Plazidus das Bedürfnis, Priester oder Missionar, jedenfalls Seelsorger zu werden. Mit 25 Jahren wurde aus Karl Hungerbühler im Kloster Muri Gries P. Plazidus und ein Priester. Er studierte in Innsbruck vier Jahre Christliche Philosophie, half später in Südtiroler Pfarreien aus, unterrichtete, hielt Glaubensseminare. Er wurde Prior und Erwachsenenbildner, und kümmert sich bis heute um die Klosterbibliothek. Meditation begleitet ihn von Jugend auf. Es gehe dabei nicht um Stillstand, sondern um grenzenlose Stille. „Der Atem fällt runter und fließt in die lebendige Stille hinein. Die Stille kommt hoch, sammelt sich wieder in der Tiefe und führt mich in die Ewigkeit, in Gott hinein.“ 20 Minuten sitzt er mit seiner Meditationsgruppe jeweils in Stille, acht bis zwölf Personen, mehr möchte er nicht in der Gruppe haben.
Benedetta Michelini
Schweigen, sagt Benedetta Michelini, erde sie. Die 49-Jährige ist in Bozen aufgewachsen und hat in Innsbruck Theologie studiert. Da keine Lehrstellen frei waren, ist sie 1997 nach Paderborn gezogen, hat weiter studiert, war 18 Jahre im pastoralen Dienst tätig. Bereits während ihres Studiums hat Benedetta Michelini mit Schweigeexerzitien im Alltag begonnen. Jedes Jahr verbringt sie eine Woche in Stille. Drei Mal war sie in großen Schweigegruppen dabei. Im heurigen August hat sie an Wanderexerzitien teilgenommen. Als sie ein Studentinnen-Heim leitete, spürte sie jedes Mal neu, wie ihr das Schweigen half, um zu ihrem inneren Kern zu gelangen, dem Geheimnis des Lebens und Gott auf die Spur zu kommen. Schweigen sei eine Übung, sagt sie. Es brauche Konzentration, um
Foto © Privat

In der Nacht ist Karin Unterholzner mit den Geräuschen allein. Die gehörlose Frau aus Bozen leidet unter Tinnitus und unter mangelnder gesellschaftlicher Teilhabe.
auf das zu hören, was im Alltag häufig von anderen Reizen übertüncht wird. Es sei wohltuend, nichts zu hören und der Stille zu lauschen. Schweigen bedeutet für sie Erholung für Ohren, Geist und Seele. Benedetta Michelini wohnt in Oberbozen, arbeitet viel im Garten und lässt sich vom Hund gern auf den Berg und in den Wald begleiten.
Die Corona-Pandemie war für Karin Unterholzner der Supergau. Plötzlich redeten Menschen hinter Masken, sie

P. Plazidus Hungerbühler nahm das staatlich verordnete Daheimbleiben zur ganz persönlichen Einladung, um mit der eigenen Stille umzugehen.
konnte ihre Mundbewegungen nicht mehr verfolgen. Sie ist mutig: Weil es sich terminlich nicht ausgeht, erklärt sie sich zum Online-Interview bereit. Am Bildschirm schaut sie genau hin, bittet um langsames Sprechen, antwortet auf jede Frage. Sie studierte in der Schweiz und in Innsbruck Geschichte und Geografie auf Lehramt und gab alles, um ihr Studium abzuschließen – stets das Ziel vor Augen: „Ich will Lehrerin sein.“ Sie kam in die Stammrolle, unterrichtete 14 Jahre lang in der Mittelschule und fühlte sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Doch die Schwierigkeit, die Kinder richtig zu verstehen, nahm zu. Vor vier Jahren hat Karin Unterholzner mit dem Unterrichten aufgehört. Darunter leidet sie sehr. Vor drei Jahren wurde ihr im rechten Ohr das Implantat eingesetzt. Ihr linkes Auge ist inzwischen fast blind. Sie
Mindestens einen Tag braucht Benedetta Michelini bei Schweigewochen, um in die Stille zu kommen. Dann kann die Stille auch ganz laut werden.

Foto © Maria Lobis
hat Angst, dass sich auch das rechte verschlechtert. Der Verlust des zweiten Auges würde den Verlust ihrer Autonomie bedeuten. Sie könnte das Leben ihrer Kinder nicht mehr managen. Neben der Arbeit ist ihr die Familie alles. Seit zwei Jahren arbeitet sie in zwei Schulbibliotheken. Das bringt ihr nicht die Genugtuung wie das Unterrichten, senkt ihr Selbstwertgefühl. Zweiergespräche mit Karin Unterholzner sind wohltuend. In der Gruppe ist es schwierig für sie: „Wenn Leute fröhlich durcheinanderreden, komme ich nicht mit.“ Das Umfeld weiß um ihre Hörprobleme. Sie liebt Impulse von außen, ist viel geselliger, als sie das leben kann. Den Diskussionen im Elternkreis autistischer Kinder kann sie kaum folgen. Sie hätte viel zu sagen: Ihr kleiner Sohn ist autistisch.
Für P. Plazidus Hungerbühler war der Lockdown ein Segen: „Die Pandemie war erholsam für mich. Sie hat mir deutlich gemacht, dass mein Weg nicht der ist, gegen das Virus zu kämpfen, sondern mich mit dem Virus anzufreunden.“ Seiner Meditationsgruppe hat er schriftliche Impulse auf den Weg gegeben. Mit der Technik des Online-Konferierens
GUTSCHEIN
IM WERT VON

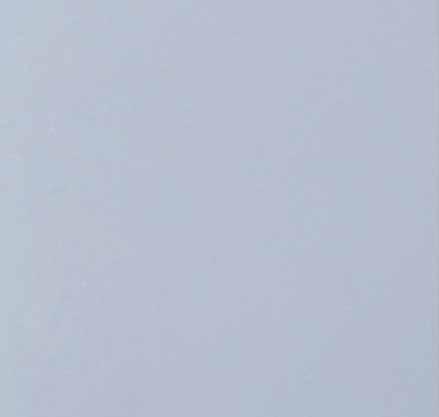

Athesia Buch GmbH srl Bücher Medien Musik Lauben 41 via Portici IT-39100 Bozen Bolzano (BZ) Tel. +39 0471 081 100 COUPON-GUTSCHEIN
Nr. 582902
Gutscheincode - codice buono
Aktion mit dem Katholischen Familienverband (Gültig bis 31.01.2021/ME 50 Euro)
0574 5457 3900 8668 7
Betrag - importo
5,00 €
Sachb. / ns. segno hfi/DBAE199
Unterschrift / firma
..........................................................................
Mit diesem Gutscheincode erhalten Sie einen Rabatt von 5 Euro bei einem Mindesteinkauf im Wert von 50 Euro. Rabatt nicht kumulierbar.
hat Papier und Buch, komm doch einfach zu Besuch! Sogar Geschenke gibt es dort, ein wirklich magischer, perfekter Ort!
hat er sich auseinandergesetzt, auf Zoom viele Einzelgespräche geführt. Manche Leute sagen ihm, meditieren habe eine Bedeutung für sie, andere können nichts damit anfangen. P. Plazidus braucht keine Bestätigung. Er weiß um seinen persönlichen Wert der Stille.
Um bei Schweigewochen in die Stille zu kommen, braucht Benedetta Michelini mindestens einen Tag. Dann kann die Stille auch ganz laut werden. Situationen, die ihr Kopfzerbrechen bereiten, lassen sich nicht wegschieben. Aufschreiben ist dann eine gute Übung für sie. „Ich mache mir keinen Druck, gräme mich nicht, möchte stehenlassen, dass es so ist, wie es ist.“ Schweigen macht sie mitunter auch traurig. „Ich spüre die eigene Begrenztheit, die Ängste, das Versäumte.“ Das Zurückkommen nach den Schweigetagen gestaltet sie bewusst. Sie versucht, sich dem Außen langsam zu nähern, nachdem sie tagelang ohne Ablenkung wie Fernseher, Radio oder Smartphone war. Schweigen macht sie empfänglicher für Regungen des Inneren und empfindsamer für Töne rund um sie herum, lässt sie Liebe und Freundschaft dankbar wahrnehmen, in Beziehung mit sich und in Kontakt mit
„Als Gehörlose gehöre ich nicht dazu.“
Karin Unterholzner
Gott sein. Seit fast 25 Jahren nimmt sie sich morgens jeweils eine halbe Stunde Zeit, um zu schweigen: Was hat der gestrige Tag gebracht, was wird/soll der heutige bringen? Meditation trägt sie über das zu Erledigende hinaus, der Tag gelingt leichter. Ein täglicher Impulssatz begleitet sie im Büro, auf der Straße, hilft ihr, zu unterbrechen, innezuhalten, gibt ihr Distanz und Balance. Sie genießt die Stille, kann die
„Wir haben kaum mehr Orte der Stille“, bedauert P. Plazidus Hungerbühler. Auch im Kloster werde die Stille zu wenig gefeiert.

Stille anderer aushalten und macht sie nicht abhängig von dem, was die Menschen sagen.
Auch P. Plazidus Hungerbühler ver-
sucht, in der Stille auftretende Ohnmachten auszuhalten. Stille sei ein Genuss und mutig seien jene, die sich darauf einlassen. Als Kloster-Ältester hat er im Außen keine Verpflichtungen mehr. Er sieht sich nicht als Meister des Schweigens und Meditierens, sondern als Begleiter. Im Stress und in der Schnelligkeit der Zeit lassen wir uns von den Gedanken oft überfahren, sagt P. Plazidus. Er plädiert dafür, respektvolles Sprechen zu lernen – Respekt, um die Würde des anderen zu schätzen. In der Stille werden ihm Bilder geschenkt, fallen ihm Wörter ein. Er betrachtet Schweigen als Teil seiner inneren Hygiene. Als vierjähriges Kind hatte der kleine Karl eine Hirnblutung. Beim Spielen fiel er von einer Rampe auf den Steinboden. Drei Tage lang lag er bewusstlos im Krankenhaus. Was das ewige Leben ist, kann er nicht sagen. Irgendwann werde der Atem aufhören. Er hat keine Angst davor.
Stille sei eine Typ-Frage, sagt Bene-
detta Michelini. Jede Person habe andere Kraftquellen. „Ich wünsche den Menschen, dass sie entdecken, wo sie Kraft schöpfen können und dass jede und jeder sich nach der eigenen Kraftquelle sehnt und sie sucht."
Karin Unterholzner wünscht sich
nichts sehnlicher als eine für ihre Bedürfnisse passende Arbeit, wo sie gefordert ist, leisten und ihren Fleiß unter Beweis stellen kann. Die frühere „Ratschkattel“ hat sich zurückgezogen. Sie hat es rundherum mit einer gesunden Gesellschaft zu tun, sieht viel Perfektion, wird auf die eigenen Defizite zurückgeworfen. „Als Gehörlose gehöre ich nicht dazu.“ Jedes Treffen mit anderen verlangt vollste Konzentration von ihr, nach jedem Gespräch muss sie rasten. Karin Unterholzner ist nicht lärmempfindlicher als andere Menschen, die Hörgeräte sind klug, machen leise Stimmen lauter, blenden das Geräusch klirrender Gläser aus. „Bei mir gibt es keine Stille“, sagt sie. Wenn sie abends die Geräte aus dem Ohr entfernt, tritt in ihrem Kopf mit dem Tinnitus eine Geräuschkulisse auf, die andere sich nicht vorstellen können. Die Geräusche sind unterschiedlich stark und klingen häufig wie ein Zug.
MARIA LOBIS










