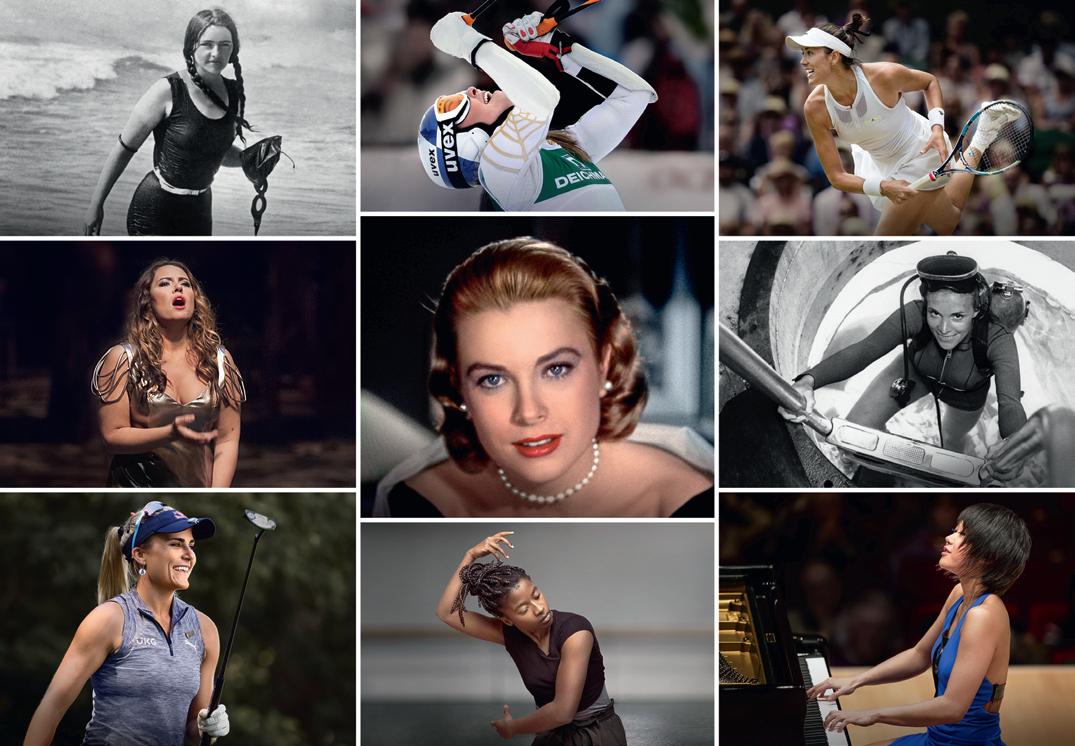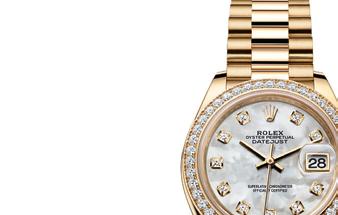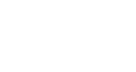Das Gütesiegel „Qualität Tirol“ steht für regionale, nachhaltig produzierte Lebensmittel von höchster Güte, die zu 100 % in Tirol gewachsen und veredelt sind.
Weihnachtskekse sind fester Bestandteil in dieser besinnlichen Jahreszeit. Mit der Vielfalt der „Qualität Tirol“ Produkte lassen sich schmackhafte Kekse aller Art zaubern. Von einfach bis anspruchsvoll, mit und ohne Ausstechen, zum Verzieren oder pur Genießen, mit unseren Rezepten wird die Weihnachtsbäckerei einfach wunderbar.

Es war ein heißer, trockener und vor allem richtig langer Sommer. 20 Grad im November machten es nicht unbedingt leicht, ein Magazin für den Winter zu produzieren, und stellten uns tatsächlich vor so manche Herausforderung. Fotos vom Grillen im Winter zu machen, wo doch weit und breit noch keiner in Sicht war, das hat Marian Kröll vor eine wirkliche Aufgabe gestellt. Da passt es ausgezeichnet, dass er sich nicht nur um die Kulinarik gekümmert hat, sondern auch um die Veränderung des heimischen Klimas in einer Geschichte über Wetterextreme. Vorausschauend haben wir so manches indes bereits im letzten Winter mitgedacht. Sonst wären etwa die großartigen Fotos von Tom Bause in der FalknerOase am Ahorn im Zillertal nicht möglich gewesen. An Inspiration und Motivation mangelte es uns im sommerlichen Winter ohnehin nicht, um die besten und spannendsten Geschichten für die kalte Jahreszeit zu recherchieren und zu schreiben. Das Ergebnis halten Sie nun in den Händen.
Einen grossen Teil der Ausgabe haben wir auch dieses Mal wie-
der spannenden Menschen unseres Landes gewidmet. Manche sind oder waren prominent, manche kennt man eher in Spezialistenkreisen. So haben wir uns gefragt, wie denn das Leben danach so ist, wenn Spitzensportlerinnen und -sportler ihre Karriere beenden. Sieben unterschiedliche Porträts, meisterhaft ins Bild gerückt von Gerhard Berger, beschreiben Ende und Neubeginn. Und wir waren dem alten Handwerk auf der Spur: der Weberin, dem Sattler, dem Hafner … Sie alle sind in Berufen tätig, die einst allgegenwärtig waren, heute jedoch nur mehr Nischen bedienen. Manches Handwerk steht dabei tatsächlich kurz vor dem Aussterben, andere erleben aktuell ihre Renaissance.
Nicht nur handwerklich verneigen wir uns vor der Tradition: Das Stift Stams begeht im kommenden Jahr sein 750. Jubiläum.
Feiern Sie gemeinsam mit uns unser wunderbares Land.
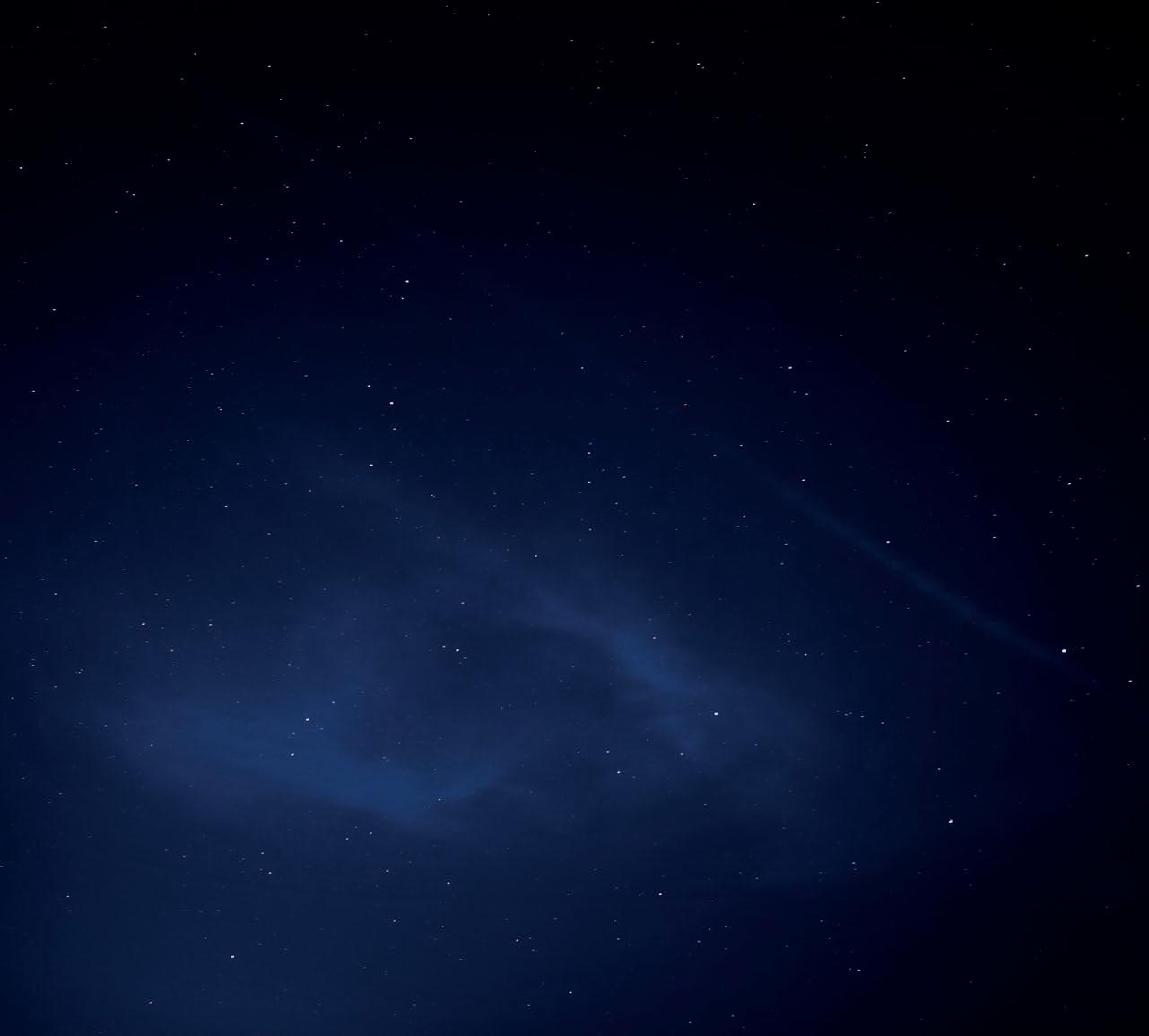

12_Power of Nature
When birds of prey fly their circles.
24 Stepping quietly
Habitat Hohe Tauern National Park.
34_The big snowfall
When Frau Holle shakes the bedding.
44_Hay from the heights How the hay comes from the mountain to the valley.
64_Art Encounter
A portrait of the brothers Matthias and Maximilian Bernhard.
74_The courage to take risks Gregor Bloéb is the new director of the Volksschauspiele.
88_Morality judge Painter Mathias Schmid’s artistic critique.
108_Heart of Tyrol Abbot German Erd and his Stams Abbey.
120_The life afterwards The lives of former top athletes today.
136_On course for an Oscar Ulrike Kofler addressing painful subjects.
146_Old, but gold Craftsmen with heart and soul.
160_Hot and cold The charm of a barbecue in winter.
12_Naturgewalt Wenn Greifvögel ihre Kreise ziehen.

24_Leiser treten Lebensraum Nationalpark Hohe Tauern.
34_Der grosse Schnee Wenn Frau Holle kräftig schüttelt.
44_Heu aus der Höh’ Wie das Heu vom Berg ins Tal kommt.
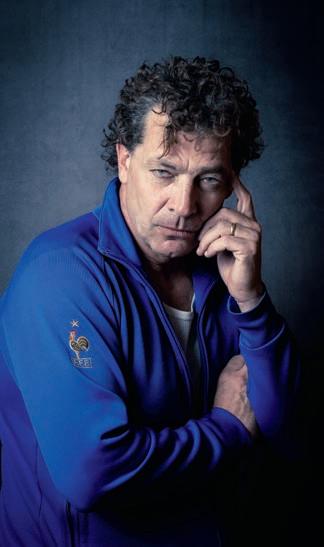


Seit neun Jahren darf ich für die ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ die schönsten Orte unseres Landes suchen, filmen und präsentieren. Und jedes Jahr bin ich auf das Neue begeistert, wie großartig unser wunderbares Tirol ist. Es wird oft gesagt, und es stimmt: Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Die Sendung läuft immer am Nationalfeiertag, und wenn man Teil der Show ist, spürt man ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl, diesen Stolz auf die Heimat, diese Freude.
Heuer sind für Tirol der Fernsteinsee, der Grawa-Wasserfall und die Klobensteinschlucht am Start gewesen. Zum schönsten Platz gekürt wurde letztendlich das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark. Gerade in Zeiten wie diesen eine schöne Entscheidung.
Es geht bei „9 Plätze“ auch nicht um den Sieg. Es geht darum, andere Menschen mit dieser Sendung zu unterhalten, ich gehe noch weiter –glücklich zu machen. Wenn die geschätzten Leserinnen und Leser jetzt vielleicht denken, was für ein Gesülze, Frau Kramer, es geht doch nur um die Quote. Ja eh. Um die geht es auch, und sie war übrigens gut. Aber es geht – ich wiederhole mich –um mehr. Ich will den Menschen mit den schönsten Bildern unseres Landes ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ich will erreichen, dass man sagt, da muss
ich hin. Da sehe ich auch eine Gemeinsamkeit mit dem Tirol-Magazin, das sich seit vielen Jahrzehnten auf die Suche nach Sehnsuchtsorten, Naturschönheiten und kulturell bedeutsamen Plätzen macht.
Immer wieder heißt es aber auch, warum macht der ORF das? Wieso müssen noch mehr Menschen auf die schönsten, verborgenen Plätze im Land aufmerksam gemacht werden? Ich versuche daher immer, sehr behutsam vorzugehen. Man kann keinen Platz nominieren, der keine Infrastruktur hat oder vielleicht ohnehin schon überlaufen ist. Man muss sich das schon genau anschauen.
Und auf den Wunsch, diese Plätze sollen doch geheim bleiben, sage ich auch - bitte über den Tellerrand hinausschauen und an jene Menschen im Land denken, die nicht mehr die Möglichkeit haben, selbst so einen schönen Platz zu besuchen. Aus welchen Gründen auch immer. Denen liefern wir traumhafte Bilder ins Wohnzimmer.
Meine Liste mit den schönsten Plätzen des Landes ist übrigens noch lang.
Katharina Kramer begann ihre journalistische Laufbahn während des Studiums bei mehreren Privatradio-Sendern und wechselte dann für einige Jahre zum Kurier. Seit 1996 ist sie beim ORF, seit 1999 moderiert sie die Sendung Tirol heute.










Vor der gewaltigen Kulisse der Zillertaler Bergwelt ziehen auch im Winter die Greifvögel von der Falknerfamilie Thomas, Waltraud und Didi Wechselberger am Ahorn ihre Kreise. Sie genießen diese Freiheit auf Zeit, kehren aber immer wieder kontrolliert zurück.Was wohl an einer ganz besonders engen Beziehung zwischen den Falknern und den Tieren liegt.
 Fotos: Tom Bause
Fotos: Tom Bause

Der Wüstenbussard, auch als Harris Hawk bezeichnet, ist eine mittelgroße Greifvogelart aus der Familie der Habichtartigen. Lanny ist übrigens ein Weibchen und unter den Vögeln der Falknerfamilie Wechselberger die „Chefin“.

Länge: 55 – 60 cm
Spannweite: 110 – 140 cm
Gewicht: 750 – 1.100 g





Menschen, Verkehr, Umwelt –eine lebenswerte Stadt für alle.
SWARCOs durchdachtes urbanes Mobilitätsmanagement bietet intelligente, nachhaltige Lösungen für den Verkehr von heute und morgen.
Von intelligenten Kreuzungen bis zur vernetzten Smart City: Mit Systemen von SWARCO sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet.
Entdecken Sie jetzt das urbane Mobilitätsmanagement der Zukunft!
Zukunftssichere Lösungen aus einer Hand.
Der Steppenadler ist eine Vogelart aus der Gattung der echten Adler. Die schnellen und gewandten Flieger können im Sturzflug maximale Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreichen. Im Normalflug erreichen sie ein Tempo von 50 bis 60 km/h.

Länge: 62 – 74 cm
Spannweite: 165 – 200 cm
Gewicht: 2.400 – 3.800 g













































Der Virginia-Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung der Uhus, die zur Familie der eigentlichen Eulen gehört. Wie bei allen Uhus haben die Federohren keine Bedeutung für den Gehörsinn. Die großen Augen sind gelb.

Länge: 46 – 63 cm
Spannweite: 90 – 150 cm Gewicht: 750 – 1.300 g
liegt auf einer Seehöhe von 633 Metern im Zillertal. Flächenmäßig ist es die viertgrößte Gemeinde Tirols. Der Urlaubs- und vor allem Wintersportort wird durch zwei gegenüberliegende Skigebiete geprägt: Ahorn und Penken.

Einwohner: 3.930 | fläche: 178 km2
Unweit der Bergstation der Ahornbahn in Mayrhofen wird Adler und Co. eine Bühne geboten, die die Greifvögel so richtig zu bespielen wissen. Im Sommer finden in der höchstgelegenen GreifVogelStation Europas atemberaubende Vorführungen statt. Die Stars: Lanny, Steppi, Hansi, Billi ... Doch nicht nur im Sommer, nein, auch im Winter kommen Gäste am Ahorn auf ihre Kosten: Denn die Vögel wollen fliegen, wollen trainiert werden, zu jeder Jahreszeit.
Wenn Falkner Didi Wechselberger dieses Schauspiel beschreibt, dann kommt er rasch ins Schwärmen: „Die Vögel fliegen vor diesem umwerfenden Panorama, bei glitzerndem Schnee, über den Speichersee. Richtig kitschig ist das, ich kann’s gar nicht anders sagen.“ Die Vogelbeobachtung lässt sich dabei ideal mit einer Winterwanderung verbinden. Rund um den Speicherteich gibt es außerdem Infostationen, die Herkunft und Sinn der Falknerei beschreiben.
Zuerst kommt der Vogel.
Das Wohl der Vögel hat für Thomas, Waltraud und Didi Wechselberger oberste Priorität: „Der Vogel kommt zuerst. Wir haben eine tolle Anlage, die Vögel sind in perfektem Zustand. Das wird auch jedes Jahr von der Behörde kontrolliert.“ Insgesamt sind es maximal zehn Tiere, die Familie Wechselberger in ihrer Falknerei hat. Dadurch, so sagt er, baue sich eine sehr enge Bindung auf. Die beweisen Bussard, Falke, Uhu und Adler auch täglich bei den Flügen. „Die Vögel können jeden Tag selbst entscheiden, ob sie wieder zurückkommen. Unser Adler bleibt oft zwei Stunden weg, aber wenn ich pfeife, kommt er“, beschreibt Didi Wechselberger dieses unsichtbare Band, das hier Mensch und Tier verbindet.
Der Falke gehört zur Familie der Falkenartigen, mit meist langem Schwanz und spitzen Flügeln. Zu seinen Merkmalen zählt der hakig nach unten gebogene Oberschnabel. Die Gattung der Falken ist fast weltweit verbreitet und umfasst 39 Arten mit unzähligen Unterarten.

Länge: 38 – 51 cm
Spannweite: 89 – 133 cm
Gewicht: 630 – 1.100 g


Die AdlerBühne Ahorn mit den GreifVogelVorführungen zieht bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Besucher an. Für Wissbegierige wurde 2021 zusätzlich die FalknerOase in Mountopolis, der Erlebniswelt der Mayrhofner Bergbahnen, geschaffen. Rund um den Speicherteich Filzen kann man dort an sieben lehrreichen Stationen in die Geschichte der Falknerei eintauchen. So tief, wie es einem gerade beliebt.

Innsbrucker Str. 22 · A-6100 Seefeld in Tirol
Innsbrucker Str. 22 · A-6100 Seefeld in Tirol
+ 43 (0)5212 2317-0 · juwelier@armbruster.at www.armbruster.at
+ 43 (0)5212 2317-0 · juwelier@armbruster.at www.armbruster.at


Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Alpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol.
Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2
Auch wenn es den Anschein haben mag, dass die Natur im Winter Pause macht, so sind viele Tiere im Nationalpark Hohe Tauern aktiv und brauchen Rückzugsräume und Ruhe. Das wird zunehmend schwieriger, weil Berge mittlerweile vielfach zum Sportgerät geworden sind. Dennoch kann man als Naturnutzer die Natur genießen, doch sollte man das maß- und rücksichtsvoll tun.
Wenn sich in der kalten Jahreszeit der Schnee, die weiße Pracht, wie eine samtige Decke über die Landschaft legt, dann wird es vermeintlich still im Nationalpark Hohe Tauern. Doch dieser oberflächliche Eindruck täuscht. Viele Tiere sind auch im Winter aktiv. Wenn die zunehmenden Massen an Wintersportlern, die es vor allem im Rahmen von Skitouren vermehrt in entlegene Gegenden zieht, zum Halali auf die zahllosen Gipfel im Nationalpark blasen, ist das für die Tierwelt eine Herausforderung.
Das erhebende Wintersporterlebnis des einen ist der pure Stress für den anderen. Stress, der den Winter für die Tiere nicht selten zum Überlebenskampf werden lässt. Sie brauchen Lebensräume. Schutzgebiete wie der Nationalpark Hohe Tauern dienen in erster Linie dem Schutz der Flora und Fauna vor den Eingriffen des Menschen. Natürlich kann man als Besucher auch im Winter die wunderbare Natur im Nationalpark genießen, jedoch sollte

Informationen über von Rangern geführte Schneeschuhwanderungen im Nationalpark Hohe Tauern sind im Internet unter www.hohetauern.at zu finden.
Nähere Informationen zu Verhaltenstipps im Winter gibt’s zum Beispiel unter www.bergwelt-miteinander.at
man dies im Bewusstsein tun, dass diese Landschaften gewissermaßen die Antithese zum intensiven Tourismus in den Skigebieten des Landes darstellen. Im Vordergrund sollte sanftes Naturerleben stehen, das von Rücksichtnahme auf den Lebensraum von Wild und Co. geprägt ist.
Die Faszination, die das Skitourengehen ausübt, ist nachvollziehbar. Sie ist aber nicht ohne weiteres mit den Bedürfnissen der Tierwelt in einer ansonsten fast unberührten Winterlandschaft zu vereinbaren. Wenn die zwei Brettln und der gführige Schnee zu verlockend sind, sollte man sich vor der Skitour einen Überblick über möglichst umwelt- und wildtierverträgliche Routenverläufe verschaffen. Zu diesem Zweck wurden in beliebten Tourengebieten in der Nationalparkregion Wild- und Waldruhezonen definiert, die auch auf Informationstafeln an den Ausgangspunkten beliebter Touren ersichtlich sind. Jägerschaft, Grundbesitzer, Forstwirtschaft, Touristiker, Nationalpark und die Plattform „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ haben
gemeinsam problematische Zonen erhoben, Ruhezonen festgelegt und Routenverläufe auf höchstmögliche Umweltverträglichkeit abgestimmt.
Leiser treten.
Gerade deshalb empfiehlt es sich manchmal, etwas leiser zu treten. Die Schneeschuhe anzuziehen, um sich in gemächlicherer Art und Weise in der Natur zu bewegen, als das beim Skibergsteigen mit seinen rasanten Abfahrten der Fall ist. Dadurch ist man freilich nicht davor gefeit, in gewissen Bereichen genauso zum Störfaktor zu werden. Im Rahmen von geführten Rangertouren lässt sich das Schneeschuh-Erlebnis aber derart gestalten, dass zum einen der Fußabdruck im winterlichen Ökosystem des Nationalparks möglichst klein bleibt und man zum anderen im Gehen auch noch einiges an Wissen vermittelt bekommt. Dabei lernt man auch, die eigenen Grenzen und jene der Natur zu respektieren. Zum Beispiel dadurch, indem man auf den gekennzeichneten Touren bleibt und keinen unnötigen Lärm verursacht.
Mit dem Wildtierbiologen Dr. Gunther Greßmann haben wir die Komplexität dieses Ökosystems und seiner Tierarten erkundet und erfahren, wie man sich verhalten sollte, um den winterlichen Nationalpark möglichst wildtierverträglich genießen zu können.

Es gibt die ebenso romantische wie falsche Vorstellung, dass die meisten Tiere im Winter ohnehin schlafen würden und der Lebensraum deshalb weniger anfällig für Störungen sei. Wie verhält es sich tatsächlich? Gunther Gressmann: Man muss die Störung von Wildtieren gesamthaft sehen und nicht auf den Winter beschränkt. Störungen, die für die Tiere gravierende Folgen haben können, beginnen viel früher und schaukeln sich auf. Arten wie Gams-, Rot- und Steinwild beginnen bereits im August damit, sich auf den Winter vorzubereiten. Sie beginnen, Fettreserven aufzubauen und langsam die Körpertemperatur herunterzufahren. Der Stoffwechsel wird gedrosselt, die Herzschlagrate verlangsamt. Werden die Tiere dabei häufiger gestört, ist das ein Problem, weil sie da-
durch mit weniger Fettreserven in den Winter gehen. In vielen Fällen ist es die Aufeinanderfolge und Aufschaukelung einzelner Störungen, die für das Wildtier zum Problem werden.
Naturnutzer sollten also schon im August besondere Vorsicht walten lassen, um die Tiere möglichst wenig zu stören? Wir haben es in der Natur mit ganz unterschiedlichen Tierarten zu tun, die verschiedene Strategien haben, um den Winter zu meistern. Es gibt sogar Unterschiede innerhalb der Arten, was den Umgang mit Störungen betrifft, Eltern mit Jungtieren, männliche Tiere, ja sogar einzelne Charaktere gehen anders damit um, auch in Abhängigkeit davon, welche Erfahrungen die Tiere in der Vergangenheit gemacht haben. Noch schwerer zu fassen ist allgemein die Tatsache, dass man es beim Thema Störungen oftmals mit Langzeitprozessen zu tun hat, die sich auf verschiedenen Ebenen – individuell und generell – auswirken können. Tiere wechseln beispielsweise für einen gewissen Zeitraum den Ort, kommen aber wieder zurück, wenn die Störung aufhört. Tiere, die dauernd ausweichen müssen, haben ein höheres Stresslevel und geringere Fettreserven. Das wirkt sich nachteilig auf die Nachwuchsraten aus in dem Sinne, dass Würfe ausbleiben oder die Anzahl der Jungen sinkt. Diese Auswirkungen werden oft erst nach zehn, fünfzehn Jahren sichtbar.
Das ist also mit Langzeitprozessen gemeint. Gibt es dabei noch andere Aspekte? Gerade bei den größeren Wildtieren spielt sich sehr viel über Traditionen ab. Dabei geht es um erlerntes Verhalten, welches das Jungtier vom Muttertier übernimmt. Häufige Störungen ändern auch das Raum-Zeit-Verhalten der Tiere. Die Tiere gehen mit ihren Jungen dorthin, wo sie sich weniger gestört fühlen, und die Jungtiere lernen dadurch, dass dies vermutlich ein passender Lebensraum ist, und ziehen
ihre Jungen, so es möglich ist, dann dort auf. Langfristig kommt es somit zu Veränderungen in der Wildverteilung oder im Falle von territorialen Arten zu vermehrten Revierkämpfen.
Die Tiere drängen an Orte, an denen sie nicht gestört werden, wo wiederum die Ressourcen knapper werden. Grundsätzlich ja. Das ist ein Problem, das es vor allem mit der Winternutzung gibt, vom Skitourengehen übers Schneeschuhwandern bis hin zum Speedflying. Früher gab es gewisse Standardrouten, die begangen wurden. Jetzt ist es so, dass vielen ein Gipfel pro Tag gar nicht mehr reicht, sondern gleich der nächste her muss. Der Wintersport geht viel mehr in die Fläche. Das macht es für viele Tierarten schon schwierig, ruhige Lebensräume zu finden.


Gibt es Unterschiede bei den Arten, was den Umgang mit Stress betrifft? Große Arten haben vielleicht mehr Möglichkeiten, mit einer Störung umzugehen. Kleinere dagegen, wie das Schneehuhn, können nicht viel Fettreserven anlegen, weil sie sonst nicht mehr fliegen könnten, wenn es eng wird. Werden solche Arten mehrmals hintereinander an der Nahrungsaufnahme gehindert, geht es ums Überleben. Es braucht da gar nicht viel an Störung. Der Steinbock geht mit bis zu 25 Kilogramm Fettreserven in den Winter und kann Störungen eine Zeit lang relativ gut austarieren. Diese Fettreserven braucht
Der Bartgeier ist – ganz im Gegensatz zum Schneehuhn –in den Lüften zu Hause. Doch auch er braucht Lebensräume, in denen er sich ungestört entfalten kann.
Das Schneehuhn gehört zu den Arten, die im Winter nicht viele Fettreserven anlegen können und auf Störungen bei der Nahrungsaufnahme besonders sensibel reagieren.
„DIE NUTZER SIND ZWEIGETEILT. DIE EINEN GEHEN SEHR AUFMERKSAM UND RÜCKSICHTSVOLL DURCH DIE NATUR, FÜR DIE ANDEREN IST DER BERG NUR NOCH EIN SPORTGERÄT UND EINE KULISSE ZUR SELBSTDARSTELLUNG.“
er im Winter, weil die Nahrung in dieser Zeit nicht nährstoffreich genug ist. Vereinfacht gesagt kann es dem Steinbock völlig egal sein, wie das Wetter ist – ob es sonnig ist oder ob es schneit, ob Schnee liegt oder nicht. Er ist immer auf seine Fettreserven angewiesen. Unsere heimischen Arten sind fast alle an Kälte besser angepasst als an Wärme. Wärmere Temperaturen im Winter führen bei ihnen sogar oft zu einem höheren Stoffwechselumsatz, was wiederum mehr Energie kostet. Besonders kritisch wird es für Steinbock und Co. eher gegen Ende des Winters, wenn die Reserven aufgezehrt sind. Trifft ein Skitourengeher im März auf eine tote Gämse, kann


Die
• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol
• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.
• West-Ost-Erstreckung: 100 km
• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km
• mehr als 300 Dreitausender
• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle
• 551 Bergseen
er beispielsweise schon im Dezember durch Störungen dazu beigetragen haben. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass die Zusammenhänge komplex sind.
Gibt es überhaupt einen Weg, den Naturraum im Winter für die sportliche Betätigung naturverträglich zu nutzen? Das ist eine zweischneidige Frage. Sobald wir im Gelände unterwegs sind, befinden wir uns im Lebensraum anderer Arten. Es ist aber durchaus sinnvoll, dass die Leute die Natur nutzen und genießen, weil sie dadurch einen Bezug dazu bekommen. Dadurch entsteht die Bereitschaft, sie zu schützen. Es wäre gut, könnte man die Naturnutzung in gewisse Bahnen lenken und von der Fläche wieder etwas wegbekommen. Freiwilligkeit halte ich diesbezüglich für einen guten Zugang. Dazu braucht es aber gut informierte Naturnutzer, die Verzicht üben können und wollen. Sonst steuern wir darauf zu, dass es irgendwann Gebiete geben wird, die gesperrt sind.
Dann wird es mehr Bildung und vor allem Bewusstseinsbildung brauchen, damit die Naturnutzer überhaupt damit beginnen, über diese Thematik nachzudenken. Es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten und Lenkungsprojekte, um sich zu informieren, wo zumindest sensible Lebensräume sind. Würde das respektiert werden, wäre schon einiges erreicht. Jeder Naturnutzer könnte sich über das Internet mit Wildtieren beschäftigen. Es gibt dort jede Menge Verhaltenstipps. Es gilt, sich bewusst zu machen, dass man da draußen grundsätzlich ein möglicher Störfaktor ist. Das gilt selbst dann, wenn man keine Tiere zu Gesicht bekommt. Es gibt den schönen Begriff der „Störschleppe“, das ist der Bereich um sich herum, den man mit seinem Verhalten beeinflusst. Je nach Wildtierart kann dieser Bereich sehr groß sein. Rotwild beispielsweise kann den Menschen bei geringsten Luftströmungen schon auf rund einen Kilometer riechen.
Gibt es ausser Vermeidung Strategien, um den Stress der Wildtiere zu minimieren? Es hilft, wenn nicht jeder Skitourengeher seine eigene Spur anlegt. Das gilt beim Aufstieg, aber vor allem bei der Abfahrt. Ein Pulverschneehang ist verlockend. Schnee- und Birkhühner sind in ihren Höhlen, in welchen sie oft die Nächte und auch Teile des Tages verbringen, blind und können Vibrationen in der Schneedecke über eine große Entfernung wahrnehmen und schalten dann auf Alarmbereitschaft. Es ist also besser, zu vermeiden, in die Fläche zu gehen. Da sind besonders die einheimischen Wintersportler gefordert, die sich gut auskennen und oft die erste Spur ziehen.
Welche Rolle spielt die Wahl der Sportgeräte – Tourenski oder Schneeschuhe –, was die Störungswahrscheinlichkeit betrifft? Mit beiden kann man sich prinzipiell überall bewegen. Beim Tourenski gibt es das zusätzliche Problem, dass man sich bei der Abfahrt schneller fortbewegt. Bei perfekten Firnbedingungen im Frühjahr kann man sehr gut steile Rinnen abfahren und kommt so mitunter auch in Einstandsgebiete, die sonst noch eher Ruhe haben. Es gibt außerdem viel mehr Skitourengeher als Schneeschuhwanderer.

Können sich die Tiere an die Sportler gewöhnen? Gewöhnung bedeutet, dass auf einen Reiz keine Reaktion gesetzt wird – das findet da draußen selten statt. Oftmals, wenn ein Tier nicht flieht, interpretieren wir das als Gewöhnung. Aus Sicht des Wildtiers stellt sich aber vielmehr die Frage, wo es weniger Energie verliert. Beim Stehenbleiben und gestressten Aushalten der Gefahr oder beim Wegrennen. Den Begriff Gewöhnung würde ich dafür deshalb nicht verwenden wollen
Marian_Kröll
Even though it may seem that nature takes a break in winter, many animals in the Hohe Tauern National Park are active and need places to retreat and rest. This is becoming increasingly difficult, because mountains have meanwhile turned into a sporting venue in many cases. Nevertheless, as a visitor to nature, one can still enjoy nature, but one should do so moderately and considerately.
When the snow, the white splendour, covers the landscape like a velvety blanket in the cold season, it is supposedly quiet in the Hohe Tauern National Park. But this superficial impression is deceptive. Many animals are also active in winter. When the growing masses of winter sports enthusiasts, who are increasingly drawn to remote areas, especially in the context of ski tours, call out to the countless peaks in the National Park, it is a challenge for the animal world.

One person’s uplifting winter sports experience is pure stress for others. Stress that often turns winter into a struggle for survival for the animals. They need habitats. Protected areas such as the Hohe Tauern National Park primarily serve to protect flora and fauna from human interference. Of course, visitors can also enjoy the wonderful nature in the national park in winter, but they should do so in the awareness that these landscapes are, in a way, the antithesis of the intensive tourism in the country’s ski resorts. The focus should be on a gentle experience of nature, character-
ised by consideration for the habitat of game and co. The fascination of ski touring is understandable. However, it cannot be easily harmonised with the needs of wildlife in an otherwise almost untouched winter landscape. For this reason, wildlife and forest quiet zones have been defined in popular touring areas in the National Park region, which can also be seen on information boards at the starting points of popular tours. Sometimes it is indeed advisable to tread a little more softly. Put on your snowshoes to move in nature in a more leisurely manner than it is the case with ski mountaineering with its rapid descents. Of course, this does not mean that you are immune to becoming just as much of a disturbance in certain areas. Within the framework of guided ranger tours, however, the snowshoe experience can be organised in such a way that, on the one hand, the footprint in the winter ecosystem of the national park remains as small as possible and, on the other hand, you also gain some knowledge while walking. You also learn to respect your own limits and those of nature. For example, by staying on the marked tours and not making unnecessary noise.


Suche nach dem höchsten Dorf Tirols.
Die Frage, welches denn nun das höchstgelegene ständig besiedelte Dorf in Tirol ist, ist kniffliger als auf den ersten Blick angenommen. Denn in der Schule lernt(e) man: Die höchste dauernd –Sommer wie Winter – bewohnte Siedlung sind die Rofenhöfe oberhalb von Vent im Ötztal auf einer Seehöhe von 2.014 Metern. Ein kleiner Weiler macht allerdings noch kein Dorf, also geht die Suche weiter. Obergurgl gilt zwar als höchstes Kirchdorf Tirols und liegt auf einer Höhe von 1.907 Metern. Allerdings ist Obergurgl wiederum keine eigene Gemeinde, sondern gehört zu Sölden. Und das liegt wesentlich tiefer. Da kommt Spiss im Samnaun an der Schweizer Grenze zum Zug. Es ist mit seinen 100 Einwohnern die höchste Gemeinde Österreichs überhaupt und liegt auf 1.628 Metern. Es bleibt also diffizil.
 Die
Die

Manchmal schüttelt Frau Holle ihre Kissen ganz besonders kräftig über dem Land aus. Dann kann die weiße Pracht auch bedrohlich werden. Extreme Niederschlagsereignisse, die im Winter den großen Schnee bringen, haben in Tirol regional unterschiedliche Ursachen. In höheren Lagen wird es solche trotz des Klimawandels weiterhin geben.
Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter keinen Pullover. Diese satirische Variante einer Bauernregel trifft wohl als einzige zuverlässig ins Schwarze. Ansonsten ist die Aufstellung von derartigen Regeln für das Wetter recht schwierig, überhaupt was mittelund längerfristige Prognosen betrifft. Meteorologe Dr. Manfred Bauer, der die Kundenservicestelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – kurz ZAMG – in Innsbruck leitet, arbeitet nicht mit Bauernregeln, sondern vielmehr mit immer mehr Rechenleistung und immer umfangreicheren Daten, um einen zunehmend präzisen Überblick über die Wetterentwicklung zu bekommen.
Nun ist die Prognose des Wetters schon diffizil, jene der Klimaentwicklung aber noch komplexer. Einerseits aufgrund ungeheuer vieler, einander wechselseitig beeinflussender Variablen, andererseits hängt er aber auch von unserem Verhalten und den Maßnahmen ab, die wir setzen. „Der Klimawandel ist in den letzten Jahren immer offensichtlicher geworden“, sagt Bauer. Das äußert sich in außergewöhnlichen Temperaturen auf der einen, in Rekordniederschlägen auf der anderen

Seite. „Winterniederschläge sind meistens sehr stark auf Fronten bezogen, auf organisierte Störungen. Dagegen sind Sommerniederschläge häufig Gewittern zuzurechnen, die viel punktueller und kleinräumiger niedergehen und dabei riesige Schäden anrichten können“, erklärt Bauer den Unterschied zwischen rekordverdächtigen Niederschlägen in der warmen und kalten Jahreszeit. „Im Sommer und im Winter hat man es mit grundlegend anderen Phänomenen zu tun“, so der Experte, der die winterlichen Störungen grundsätzlich für meist gut vorhersagbar hält.
In Bezug auf Tirol gilt es zu unterscheiden, ob sich an der Alpennord- oder der Alpensüdseite etwas
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist der staatliche meteorologische und geophysikalische Dienst Österreichs. Im Jahr 1851 gegründet ist sie der älteste staatliche Wetterdienst der Welt. In Innsbruck ist sie mit einer Kundenservice-Stelle am Flughafen vertreten.
zusammenbraut. „In Osttirol und am Alpenhauptkamm sind die Wetterlagen, die zu Extremereignissen führen, andere als auf der Alpennordseite“, sagt Bauer und nennt ein Beispiel: „Im Jahr 2019 gab es zehn bis 15 Tage lang eine Strömung aus Nord bis Nordwest, in die immer wieder Kaltfronten eingelagert waren. Trifft so eine Kaltfront auf ein Hindernis, konkret auf eine Gebirgskette, ist es üblicherweise so, dass sie dort die ganz großen Niederschlagsmengen bringt“, erklärt der Meteorologe. Diese Wetterlage hat den Alpennordrand entlang für Schneerekorde an manchen Messstationen gesorgt, zum Beispiel in Seefeld und Hochfilzen. „In Seefeld gab es damals in sieben Tagen sieben Meter Neuschnee“, weiß der Meteorologe. Passiert ist nicht viel, die weiße Pracht ist friedlich geblieben. Ganz anders war die Situation 1999, bei der verheerenden Lawinenkatastrophe von Galtür. „Die Strömung kam auch damals aus Nordwest. Es waren aber nicht Kalt-, sondern mehrere Warmfronten eingelagert. Das verschiebt den Großteil der Niederschläge in Richtung Alpenhauptkamm. Damals sind im Paznaun, noch an der Alpennordseite, die größ-
Lawine im Osttiroler Tauerntal, April 1937 – Beginn der Arbeiten am Schneetunnel (am Ende 120 Meter lang!)

1951

ten Niederschlagsmengen gefallen“, erinnert sich Bauer.
Auf der Alpensüdseite, in Osttirol und am Alpenhauptkamm, sind dagegen Südlagen für die größten Niederschlagsmengen verantwortlich.

Im Dezember 2020 gab es in Lienz mit 445 Millimetern mehr als doppelt so viel Niederschlag wie im seit Aufzeichnungsbeginn 1854 niederschlagsreichsten Dezember im Jahr 1916, als 227 Millimeter gefallen waren. Der Großteil der Niederschläge fiel als Schnee, was Lienz immerhin 182 Zentimeter Neuschnee und Virgen sogar 225 Zentimeter einbrachte. „Derartige Mengen kommen von massiv feuchten Oberitalien- oder Genuatiefs. Das ist eine gänzlich andere Wetterlage, als wenn der Schnee vom Norden kommt. In kurzer Zeit kann so sehr viel Niederschlag fallen und binnen eines Tages kann es mehr als einen Meter schneien. Kommt die Luft aus Norden, ist das viel unwahrscheinlicher. 1986 hat es in Sillian an einem Tag 170 Zentimeter Neuschnee gegeben, das ist der Tagesrekord“, weiß Manfred Bauer. Von derartigen Südströmungen, die tendenziell wärmer sind und daher mehr feuchte Luft aufnehmen können, ist übrigens auch der Brenner betroffen. Allerdings sind Nordströmungen weit häufiger zu beobachten als ihre ergiebigeren südlichen Pendants. Als ganz grobe Faustregel könnte man sagen, dass es im Norden häufiger und teils auch über längere Zeiträume immer wieder schneit und im Süden kürzer, aber ergiebiger.
auf das Antoniuskirchl und Postgebäude in Lienz, 1986

Wissen, wie der Winter wird.
Starkschneeereignisse hat es schon immer gegeben. Sie sind keine Anomalien. Daran wird auch der Klimawandel nichts ändern. Vielleicht sogar im Gegenteil. „Realistische Klimaszenarien zeigen, dass bis Ende des Jahrhunderts der Winterniederschlag um etwa 20 Prozent zunehmen könnte“, sagt Manfred Bauer. Das heißt freilich nicht, dass es sich bei diesen Mehrniederschlägen auch um Schnee handeln wird. In höheren Lagen – ab 1.500 bis 2.000 Meter Seehöhe und mehr – vermutlich schon, in tiefen Lagen wird es höchstwahrscheinlich vermehrt regnen. Im Gegensatz zur Durchschnittstemperatur, die kontinuierlich steigt, kann man bei den Niederschlägen aber nicht definitiv sagen, ob es übers Jahr
gerechnet durchschnittlich mehr oder weniger davon geben wird. Dadurch, dass die Abstände zwischen Niederschlagsereignissen eher steigen und mit höheren Temperaturen einhergehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Niederschläge dann, wenn sie auftreten, stärker ausfallen können als in früheren Jahrzehnten. Manfred Bauer illustriert das anhand der Physik: „Mit jedem Grad Lufttemperatur mehr kann die Luft um etwa sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen.“ In den bisher kälteren Gegenden dürfte die Temperatur im Schnitt stärker ansteigen als am wärmeren Äquator.
Das globale Wetter wird von Temperaturunterschieden geprägt. Werden diese geringer, wird das System träger. „Das macht es wahrscheinlich, dass Wetterlagen persistenter
werden. Ein Tiefdruckgebiet könnte dadurch länger bei uns liegen bleiben und noch mehr Niederschlag bringen“, so Bauer. Im Hinblick auf den Klimawandel sollte man Schaufel und Schneehexe also nicht vorschnell einmotten. Der Meteorologe ist sich nicht sicher, ob im Winter im Hochgebirge durch das sich wandelnde Klima mehr Schnee zu erwarten sein wird oder ob der Temperatureinfluss stärker zum Tragen kommt in dem Sinne, dass es vermehrt auch hineinregnen wird. „Die Klimamodelle sind sich hier nicht einig.“
Die Meteorologie ist vor allem durch Wettersatelliten und leistungsfähigere Computer prognostisch immer besser geworden. „Als ich in den 1990er-Jahren beruflich eingestiegen bin, konnte man das Wetter für heute, morgen und im besten Fall noch für übermorgen gut prognostizieren, heute sind genaue Vorhersagen oftmals für eine Woche und manchmal auch länger möglich“, sagt Bauer. Allerdings scheint man einen Plafond erreicht zu haben. Man wird also auch noch in einigen Jahrzehnten geduldig sein müssen, um zu erfahren, wie der Winter wird und ob, wo und wie viel Schnee es geben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Winter wie Sommer überdurchschnittlich warm werden, liegt aber aufgrund des Klimawandels mittlerweile bei 80 Prozent. „Wenn man mich fragt, sage ich immer, der Sommer oder Winter wird zu warm. Es ist inzwischen ausgesprochen selten, dass eine Jahreszeit kälter ausfällt als im Mittel“, weiß Bauer die Statistik auf seiner Seite. Auch wenn die schwierigen Winter in tiefen Lagen zunehmen dürften, so spricht doch einiges dafür, dass auch zukünftige Generationen den großen Schnee noch aus eigener Erfahrung erleben werden, mit all seinen Eigenschaften. Als stille weiße Pracht genauso wie in Gestalt der Lawine als zerstörerische Urkraft, die alles zermalmt, was sich ihr in den Weg stellt.
 Marian_Kröll
Marian_Kröll
„ES
Trau dich und sag‘ auf 3.250 m über dem Meer

Hermann Holzmann ist ein Urgestein unter den Tiroler Anwältinnen und Anwälten. Es gab kaum einen großen Prozess in den letzten Jahrzehnten, bei dem seine Kanzlei nicht prominente Mandanten vertreten hat. Er berät zahlreiche Seilbahnunternehmen und Touristiker im Land und hat dabei auch eine eigene –für viele vielleicht überraschende – Meinung.
Heute genügt es als Anwalt ja nicht mehr nur, einen Mandanten in juristischen Fragen „rechtsfreundlich zu vertreten“, wie das so schön heisst. Welche Aufgaben sind denn hier dazugekommen?
Hermann Holzmann: In diesen herausfordernden Zeiten ist gerade die Tätigkeit eines Anwaltes als Berater höchst gefragt und gleichzeitig unter den derzeitigen wirtschaftlichen, politischen und damit auch gesellschaftlichen Voraussetzungen für uns Anwälte eine besondere Herausforderung.
Die Streitkultur hat sich in den letzten Jahren sehr verändert: Menschen beharren fanatisch auf ihren Standpunkten, oft sogar auf ihren eigenen – nicht haltbaren – „Fakten“. Wie sehr kann man da als Anwalt gegensteuern? Es liegt in der Natur des Menschen, dass nicht immer einheitliche Betrachtungen und Meinungen vorliegen. Das
bedeutet, dass man natürlich mit Leuten verhandeln muss, die eine andere Ansicht haben. Es werden dadurch möglicherweise auch heftige Auseinandersetzungen zu führen sein, da ja grundsätzlich immer unterstützenswert ist, dass jeder seinen Standpunkt mit Argumenten untermauert und engagiert in die Verhandlungsgespräche geht. Nichtsdestotrotz muss man immer wieder versuchen, die vorhandenen Emotionen zu vermeiden bzw. zu sublimieren, um eben in der Folge die richtige Lösung anstreben bzw. erreichen zu können.
Sie vertreten ja unter anderem Tiroler Touristiker und Seilbahnbetriebe. Spüren Sie auch dort eine wachsende Spaltung? Wir leben hier tatsächlich in einem Paradies und dennoch oder gerade deshalb steht im Moment das Touristikland Tirol im Fokus der Frage, wohin es sich in Zukunft entwickeln wird.
„INSBESONDERE MUSS MAN DIE NEGATIVEN AUSWÜCHSE DES APRÈS-SKIGESCHÄFTSMODELLS IN DEN GRIFF BEKOMMEN.“
Hermann Holzmann

Es tobt naturgemäß ein heftiger Streit zwischen den Touristikern einerseits und den Naturschutzvereinen, Umweltanwaltschaft etc. andererseits. Diese Auseinandersetzungen und verschiedenen Betrachtungsweisen dürfen aber nicht in emotionell geführten Streitigkeiten ausufern und es sind deshalb gute Berater aus allen möglichen Branchen höchst gefragt und notwendig, um eben diese Streitgespräche in die richtige Richtung zu führen. Man muss dabei beiden Seiten zugute halten, dass sowohl die Touristiker als auch die zuständigen Vereine, wie Alpenvereine, Umweltschutzbehörden etc., eines zum Ziel haben: Tirol so lebens- und liebenswert zu erhalten, wie es ist. Auch wenn die Ansätze, wie das geschehen soll, sehr unterschiedlich sind.
Aber was antworten Sie Ihren Klienten, wenn diese darauf hinweisen, dass ohne Tourismus und ohne Wachstum keine Wertschöpfung mehr in den Tiroler Tälern stattfindet? Natürlich sind hier auch wirtschaftliche Argumente auf jeden Fall mitzuberücksichtigen, wobei aber gleichermaßen festzustellen ist, dass Wachstum nicht endlos möglich ist. Man spricht ja durchaus schon nicht nur von einer Zeitenwende, sondern möglicherweise ist bereits ein
Hermann HolzmannDr. Hermann Holzmann ist seit 1985 als Anwalt tätig, beginnend in der Kanzlei von Dr. Richard Larcher und seit Mai 1989 selbstständig in den aktuellen Kanzleiräumlichkeiten in der Bürgerstraße 17. Inzwischen sind beide Kinder in die Fußstapfen des Vaters getreten: Matthias Holzmann ist bereits selbstständiger Anwalt in den Räumlichkeiten der Kanzlei in der Bürgerstraße, Tochter Lisa wird dort ab Mai 2023 als selbstständige Partnerin eingetragen.


Zeitenbruch eingetreten. In unserem herrlichen Bundesland muss man gerade für den Tourismus die richtigen Weichen stellen und die müssen unbedingt auf Nachhaltigkeit ausgelegt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen wird Tirol auch weiterhin eine begehrenswerte Urlaubsdestination bleiben.
Woran denken Sie da bei Nachhaltigkeit im Speziellen? Insbesondere muss man die negativen Auswüchse des Après-Ski-Geschäftsmodells und vor allem auch die explosionsartigen Steigerungen der Grundstückspreise in den Griff bekommen bzw. neu regeln oder überhaupt ganz neue Grundlagen hierfür schaffen. Wobei Wertschöpfung zwar wichtig ist, aber nicht das ultimative Ziel. Klar ist, dass wir uns durch den Klimawandel etc. schon in einem derartigen Wandel befinden, dass man ohne tiefgreifende Änderung in unserem gesellschaftspolitischen Dasein nicht mehr weiterkommt. Und dabei liegt es natürlich auch an den Beratern, dass man die zu führenden Auseinandersetzungen respektvoll führt, denn nur so kann man die richtigen Lösungen letztendlich auch erreichen. Wünschenswert wäre, wenn am Ende alle an einem Strang ziehen.
„DIESE AUSEINANDERSETZUNGEN UND VERSCHIEDENEN BETRACHTUNGSWEISEN DÜRFEN NICHT IN EMOTIONELL GEFÜHRTEN STREITIGKEITEN AUSUFERN.“
Sorglospaket für Vermieter
Ab einer Größenordnung von fünf Wohnungen übernehmen wir Ihre Sorgen rund um die Vermietung Ihrer Objekte. Für nur € 35,- pro Monat und Wohnung kümmern wir uns um die Mietersuche, den Mietvertrag und seine Anpassungen sowie sämtliche organisatorische und verwaltungstechnische Belange. Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie am besten gleich von unserer Mietenbetreuung.
Leopoldstraße 26 6020 Innsbruck info@immo-koessler.at www.immo-koessler.at immo Kössler +43 512 552777

Mittels althergebrachter Techniken und Gerätschaften sowie mit zeitlosen Tugenden wird in der Osttiroler Berglandwirtschaft im Winter das duftende Heu der Bergmähder ins Tal geschafft. „Heuziehen“ heißt diese kräfteraubende, nach Geschick und Mut verlangende Freiluftaktivität, die besonders in Prägraten am Großvenediger bis heute hochgehalten wird.
 Fotos: Ramona Waldner
Fotos: Ramona Waldner
Im Bergsteigerdorf (1.309 Meter Seehöhe) ist Massentourismus nach einem anfänglichen Boom zum Fremdwort geworden. Das Dorf besticht mit seiner landschaftlichen Schönheit als lohnender Ausgangspunkt unzähliger Wanderungen auf die umliegenden Gipfel.

Der kalte, pulvrige Schnee knirscht unter den Schuhsohlen der jungen, kräftigen Burschen aus Prägraten am Großvenediger, ganz zuhinterst im Virgental, die sich mit Fotografin Ramona Waldner bei Tagesanbruch in Richtung Wunalm aufgemacht haben. Sie sind nicht etwa zu einer winterlichen Wanderung aufgebrochen, sondern haben zu tun. Harte, spektakuläre Arbeit wartet auf sie.
„Heuziehen“ heisst die in der Osttiroler Berglandwirtschaft traditionelle Methode, das Heu aus den Schupfen der steilen Bergmähder ins Tal zu befördern. Das wird im Winter gemacht, weil sich die Heufuder am
Das Heuziehen ist eine der raren bäuerlichen Traditionen Tirols, die mehr oder weniger unverändert Bestand haben und keiner wie auch immer gearteten Inszenierung preisgegeben wurden. Es ist bäuerliche Arbeit und Traditionspflege in einem. Bereits 1558 findet im „Tiroler Landreim” von Georg Rösch von Geroldshausen der winterliche Heutransport von den tief eingeschneiten Schupfen über die „Riesen“ hin zu den Bauernhöfen Erwähnung.
Schnee besser ziehen lassen. Nach dem Aufstieg der modernen Landwirtschaft und der damit einhergehenden intensiven Bewirtschaftung der Tallagen ist die Bergmahd in den Hintergrund gerückt. Dennoch ist das Mähen der steilen Wiesen – oft sogar noch von Hand mit der Sense – nicht reine Folklore, sondern Landschaftspflege, die gutes, hochwertiges Futter abwirft. Die bewirtschafteten Bergmähder sind es, die dafür sorgen, dass nicht hochalpine Sträucher und Bäume wie Lärche und Zirbe sich diese steilen Flecken, die Bauern einst der rauen Natur abgetrotzt haben, zurückerobern. Durch den Eingriff des Menschen bleibt die Waldgrenze einige hundert Höhenmeter niedriger, als sie es unter natürlichen Umständen wäre. Qualitativ ist das Heu aus der Höh’ sowieso über jeden Zweifel erhaben, strotzt es doch vor allerlei alpinen Kräutlein und Gräsern, die den Tieren, an die es verfüttert wird, Kraft geben sollen. Im Tal wird sogar kolportiert, dass Schafe ohne das kostbare Bergheu nicht „leibig“, das heißt fett werden würden.

Kollektive Anstrengung.
„Gemeinschaftsfahrt“ mit Bergheu in Osttirol, um 1935
Heuziehen ist eine Gemeinschaftsunternehmung, eine kollektive Anstrengung, die unentgeltlich geleistet wird, bei der aber auch der Spaß keinesfalls zu kurz kommt. Wer Zeit, Kraft und
Eigentlich müsste das Heuziehen ja eher Heubremsen heißen, denn im steilen Gelände nimmt das Fuder ganz von allein Fahrt auf und muss gebremst und gelenkt werden.



Die Utensilien, die beim Heuziehen zum Einsatz kommen, werden wie das Wissen um ihre Verwendung von Generation zu Generation weitergereicht.

Geschick hat, kommt zum Helfen. Bevor es zum eigentlichen Höhepunkt, der kräfteraubenden und spektakulären Abfahrt mit dem zwischen 200 und 300 Kilogramm schweren Fuder Heu – dialektal trotz dieses beachtlichen Gewichts gerne zum „Füdalan“ verkleinert – kommt, gilt es, dieses überhaupt einmal herzustellen. Das ist nicht einfach und verlangt nach einer ausgefeilten, über Generationen hinweg überlieferten Technik. Mit Reisigbündeln und Hanfseilen wird da gearbeitet, ebenso wie mit einer Art hölzernen Karabinern, auch „Kloubm“ genannt, und mit „Tschipfen“, das sind eine Art Holzkufen, auf denen der Heubuckel im flachen Gelände besser gleiten kann. Jedes Fuder wird sorgfältig, Schicht für Schicht und mit zahllosen Handgriffen aufgebaut. Das Heu wird aufeinandergeschichtet, zusammengezogen, festgeschnürt. Zuletzt wird der entstandene Heuballen noch mit einem kleinen Rechen gekämmt, damit abstehendes Heu nicht am Weg ins Tal verloren geht.



Nach getaner Vorbereitungsarbeit, dem „Füdale-Fassen“, steht eine zünftige Jause am Programm, ein selbstgebrannter Schnaps darf dabei klarerweise nicht fehlen. Bei der anschließenden Talabfahrt wird der Heubuckel lediglich mit einem Seil gelenkt und mit viel Geschick, Ausdauer und Körperkraft gen Tal bugsiert. Es ist ein guter Brauch, der das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und an dem sich die Männer und bisweilen auch Frauen aus dem Dorf beweisen können. Eine Tradition, die Jahr für Jahr zuverlässig dafür sorgt, dass das feine Bergheu von den steilen Wiesen seinen Weg ins Tal zu den Tieren findet. Damit die Schafe „leibig“ bleiben und selbst die steilsten Mähder samt ihren wertvollen Kräutern und Almblumen nicht verwildern und diese besondere Kulturlandschaft, die das alpine Landschaftsbild prägt, für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

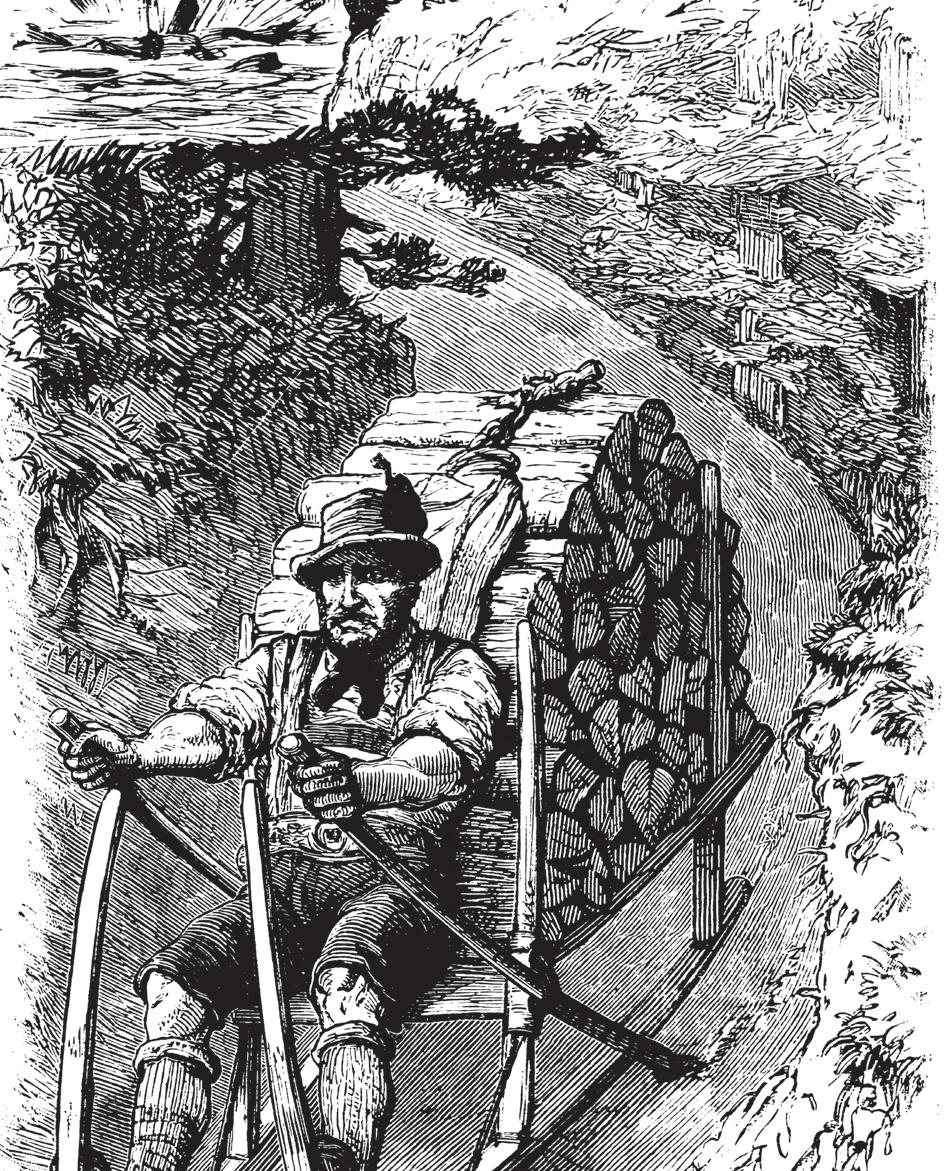
The cold, powdery snow crunches under the shoes of the young, strong lads from Prägraten am Großvenediger, at the very back of the Virgen Valley, who set off with photographer Ramona Waldner at dawn in the direction of Wunalm. They have not set out on a wintry hike, but have work to do. Hard, challenging work awaits them: “Haymaking” is the traditional method in East Tyrolean mountain farming of transporting hay from the sheds of the steep mountain meadows down into the valley. This is done in winter, as it is easier to pull the sacks of hay on the snow.

Haymaking is a communal undertaking, a collective effort that is carried out free of charge. But it is also a lot of fun. Anyone with time, strength and skill comes to help. Before the actual climax - the energy-sapping and spectacular descent with the 200 to 300 kilo-
gramme load of hay - it first has to be made. This is not an easy task and requires a sophisticated technique that has been handed down through generations. The hay is stacked on top of each other, pulled together and tied. Finally, the resulting hay bale is combed with a small rake so that any hay that sticks out does not get lost on the way down into the valley. After the preparatory work is done, a hearty snack is on the agenda, accompanied by a home-distilled schnapps. On the subsequent descent down the valley, the hay hump is merely steered with a rope and with a lot of skill, stamina and physical strength it is manoeuvred towards the valley. It is a good custom that strengthens the feeling of togetherness and in which men and sometimes women from the village can prove themselves. A tradition that year after year reliably ensures that the fine mountain hay from the steep meadows finds its way down into the valley to the animals.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten kreieren Heidi und Roland Dengg bereits köstliche Krapfen, Schlutzkrapfen und Knödel. Manch eines hat sich in dieser Zeit vielleicht verändert, neue Sorten sind dazugekommen. Eine wichtige Zutat ist allerdings geblieben: die Liebe zur Regionalität und Handwerkskunst.
rotz aller Krisen der letzten Jahre und der aktuell angespannten Energiesituation produziert Familie Dengg gestern wie heute ihre berühmten Krapfen, Schlutzkrapfen und Knödel. Besonders bekannt sind diese für ihre handwerkliche Erzeugung, die Verwendung von regionalen Zutaten und einen Geschmack, bei dem’s einem ganz heimelig ums Herz wird. „Wir distanzieren uns ganz klar von Industriebetrieben und stellen unsere Produkte so her, wie sich’s für ein Handwerk gehört, nämlich ohne Zusatzund Konservierungsstoffe“, so Roland Dengg. Seit mehr als 20 Jahren ist das der Schwerpunkt des Betriebes und wird sich auch nicht ändern. Bis ein Produkt fertig erzeugt und verpackt ist, haben es die Dengg-Mitarbeiter sechs bis sieben Mal in den Händen. Zwar ist das ein großer Aufwand, aber auf diese Weise kann eine permanente Qualitätskontrolle gewährleistet werden. Zudem sollen Gäste nicht nur schmecken, dass es sich um ein handwerkliches Produkt handelt, sondern es auch sehen. Jeder Schlutzkrapfen sieht deshalb etwas anders aus, ein Unikat, wenn man so will.
Regionale Schmankerl.
Angefangen hat alles mit den drei Klassikern: Spinatknödel, Spinatschlutzkrapfen und Graukäseschlutzkrapfen. Die Inspiration für neue Rezepte hat sich im Laufe der Jahre aus einer Mischung aus eigenen Ideen und Kundengesprächen ergeben. Manchmal kommen sehr viele Ideen zusammen, wo es dann ein gewisses Feingefühl erfordert, auszusortieren und letztlich die richtige Wahl zu treffen. Auch Saisonprodukte



werden angeboten und sorgen für geschmackliche Abwechslung. Die absoluten Favoriten unter den Dengg-Delikatessen sind allerdings nach wie vor der Spinatschlutzkrapfen und die Spinatknödel. Zum Teil wird sogar nach überlieferten alten Tiroler Rezepten produziert, wobei es wohl nicht das eine Rezept gibt. „Meines Erachtens gibt es kein Original-Schlutzkrapfenrezept. Früher haben die Menschen das verwendet, was ihnen zur Verfügung stand”, erklärt Roland Dengg. So wird ein Grundrezept verwendet, das immer wieder neu interpretiert wird.
Das Geschmacksmerkmal der Dengg-Produkte ist eigentlich ganz simpel: Weniger ist mehr. Denn wenn hervorragende Rohstoffe verwendet werden, braucht es keine zusätzlichen Geschmacksverstärker oder Farbstoffe. Ein Zusammenspiel aus natürlichem Geschmack, der ein angenehmes Mundgefühl hervorruft. Zusätzlich zum Produktverkauf im eigenen Shop hat sich Familie Dengg auf die Belieferung von Großhandelspartnern der Gastronomie und Hotellerie spezialisiert und agiert somit als verlässlicher Partner in Sachen traditioneller Tiroler Küche mit Fokus auf Regionalität, Nachhaltigkeit und persönlichen Service.
dengg krapfen & knödel manufaktur GmbH
Innsbrucker Straße 11, 6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0)5223/22441, office@dengg.info www.dengg.info

Sogar Menschen, die zum allerersten Mal auf Schlittschuhen stehen, können der Anziehungskraft von Natureis kaum widerstehen. Das Gleiten über zugefrorene Seen ruft in den meisten Menschen unbeschwerte, spielerische Gefühle hervor – eine Rundfahrt auf dem Piburger See im Ötztal.
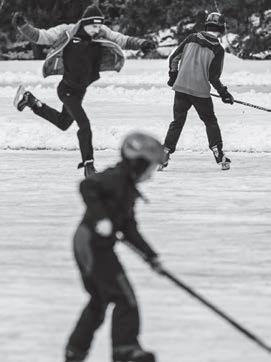

Es ist Sonntagnachmittag, und die 800 Meter lange Eisfläche des Piburger Sees ist ein einziges großes Wimmelbild. Besucher sitzen auf Schlitten, um ihre Schlittschuhe zu schnüren, andere haben auf einer überdachten Bank Platz genommen, die wie ein Bushäuschen am Rand der Eisfläche steht. Thermoskannen dampfen, Kinder werden mit Getränken aus Schnabeltassen versorgt, der eine oder andere nestelt in der Innentasche seines Parkas nach dem Flachmann. Für die Kleinen stehen ein paar Pinguine und Pandas aus Kunststoff parat. Man kann sie als Balancehilfe über das Eis schieben. „Park den Eisbären hier und sag Tschüss“, sagt eine Mutter, während ihr Mann versucht, die Szene zu fotografieren, ohne hinzufallen. Ein paar Jugendliche rutschen auf Schlittschuhen die vereiste Böschung hinunter und purzeln aufs Eis wie Würfel, die aus einem Becher geschüttelt werden. Einer schafft es immer wieder, auf beiden Beinen zu landen. Nicht nur seine 15-jährigen Begleiterinnen sind von dem Stunt mächtig beeindruckt. Die Menschen sind in kleinen und großen Gruppen unterwegs. Mehr oder weniger ambitioniert. Zügig oder ganz behutsam. Es gibt junge Frauen, die das Rückwärtsfahren üben oder sich an einfachen Figuren versuchen – und oft schnell wieder aufgeben müssen. Das Eis ist an diesen Tagen viel zu holprig und rissig für einen Flip, Lutz oder Rittberger.
Aber so ist das eben mit dem Eis: eine flüchtige, von Wind und Wetter bestimmte Substanz. Angetaut und wieder überfroren, zerkratzt und voller Schrammen. Ein
reines Naturprodukt. Aber gerade weil der Wechsel des Aggregatszustands nichts Selbstverständliches ist und sich nicht an feste Termine hält, hat es etwas Magisches, wenn ein Gewässer erst überfriert, die Eisdecke dann immer dicker wird, bis sie stabil genug ist, all das zu ertragen, was den Menschen einfällt, wenn sie in den Spielrausch geraten.
Buntes Modechaos im weissen Idyll.„Ist dir aufgefallen, dass hier auch die Mädels alle in Hockeyschuhen fahren?“, fragt eine ältere Dame ihre Begleitung, die das Eislaufen garantiert noch in schmalen weißen Stiefeln gelernt hat. „Wenn du bei so einer Oberfläche mit den Zacken in ein Loch kommst, bockt es dich voll auf“, sagt sie und lacht lauter, als man es erwartet hätte.

Auch die Bekleidung der meisten Eisläufer ist alles andere als klassisch. Die einen tragen neonfarbene Skioveralls, andere sind in Jeans unterwegs. Es gibt sportliche Tights und Leggins im Lederlook, Lammfellmäntel und selbst gestrickte Norwegerpullis. Die einen fahren mit Helm, andere tragen Pudelmützen, Lodenhüte oder Stirnbänder. Manche Outfits sehen aus, als hätte man sie für diesen Anlass aus den hintersten Ecken des Kleiderschranks gekramt. Kein Vergleich mit den Hightech-Messen auf Skipisten oder Mountainbike-Trails. Vielleicht ist es so: Weil ein zugefrorener See so selten ist, kann sich keine dominante Mode herausbilden.
Der See liegt im Landschaftsschutzgebiet AchstürzePiburger See beim Weiler Piburg oberhalb von Oetz. Schon 1929 wurde er wegen seiner Schönheit zum Naturdenkmal erklärt. Seit 2009 ist das Landschaftsschutzgebiet Teil des Naturparks Ötztal.
Der See entstand nach der letzten Eiszeit durch einen gewaltigen Bergsturz.
• Seehöhe: 913 m
• Uferlinie: ca. 1,9 km
• Länge: ca. 800 m
• Breite: ca. 240 m
• Tiefe: ca. 25 m
Auf dem Piburger See geht es kunterbunt zu. Man sieht Eisläufer, die von ihren bellenden Hunden begleitet werden, Eltern, die Kinderwagen über das Eis schieben, und Spaziergänger mit dem Großvater im Arm den See der Länge nach überqueren, um im Café am gegenüberliegenden Ufer Würstel oder Strudel mit Vanilleeis zu essen. Kaum vorstellbar, dass man sich auf dem spiegelglatten Steg vor dem Imbiss oder dem seit Wochen tiefgefrorenen Badefloß – das irgendwie an Shackletons berühmtes, im Packeis feststeckendes Forschungsschiff erinnert – je wieder in der Sonne ausstrecken können wird.
Am Piburger See im Ötztal ist der Wechsel von Eislaufen zu Eisessen allerdings nichts Ungewöhnliches: Kaum ein Winter, in dem er nicht schon im alten Jahr zufriert und dem frostigen Himmel für ein paar Tage seinen Spiegel vorhält. Über 900 Meter hoch liegt er, umrahmt von Gipfeln, die an den kurzen Tagen des Jahres nur wenig Sonne durchlassen.
Der See lässt die Wirbel knacken.
Ein Husky jagt einem Gummiball hinterher, Paare gleiten händchenhaltend vorbei, zwei kleine Mädchen kichern, weil der Schnellläufer mit den dicken Oberschenkeln ein gar so verbissenes Gesicht macht. Eislaufen ist ein Zuschauersport – auch und gerade für die Eisläufer. Überall sind kuriose Szenen zu beobachten. Garniert von dem charakteristischen Kratzen, Schaben und
Fauchen, das die Kufen auf dem Eis machen. Plötzlich wird das Geschehen für den Bruchteil einer Sekunde von einem lauten Krachen übertönt. Die Menschen schauen einander an. „Das ist nur die Spannung“, grinsen die coolen Jungs, während andere panikartig die Eisfläche verlassen: „Ganz normal.“ Dann kracht es noch einmal. Aber nichts passiert. Der See hat bloß kurz die Wirbel knacken lassen. Jetzt passt es wieder.
Nur die Hockeyspieler haben von dem Geräusch nichts mitbekommen. Viel zu laut und leidenschaftlich geht es auf ihrem selbst abgesteckten Feld zu. Regeln gibt es wenige, wenn auf Natureis gespielt wird, Vorschriften gar keine. Hauptsache, es macht Spaß. Spieldauer? Anzahl der Mitspieler? Egal! Nicht nur schnell und intensiv, sondern oft auch hart und manchmal schmerzhaft ist dieser Sport. Prellungen und blaue Flecken gehören dazu. Die wenigsten Spieler tragen Schoner; Helme sieht man auf dem See nur wenige. Trotzdem ist Eishockey eine Gaudi. Es wird geschrien und gelacht. Und am Schluss sind sowieso alle müde und kaputt. „Da dürfen auch Schlechte und ganz Gute zusammen spielen“, sagt ein Mann mit weißen Haaren, der wie jedes Jahr mit Familie und Freunden an den Piburger See gekommen ist, um sich auf dem Eis auszupowern. Zum ersten Mal schoss er vor 50 Jahren einen Puck über diesen See. Früher, erzählt er, habe man den Schnee noch selber vom Eis räumen müssen, um ein Feld zu bekommen. Inzwischen präpariert die Gemeinde die Oberfläche mit Kehrmaschinen. Zwei Kilometer lang und mindestens vier Meter breit ist die Bahn, die über und um den See gelegt wird. Außerdem gibt es ein Toilettenhäuschen mit Wärmestube, Kaffee- und Snackautomat.

Es wird langsam dunkel, die meisten Menschen haben den See verlassen. Nur noch eine Gruppe ist auf dem Eis.
„Olé“ und „venga, venga“ rufen die jungen Frauen und Männer einander zu, während sie voller Begeisterung auf einen Puck einprügeln. Die spanischen Studenten nehmen am Erasmus-Programm teil und sind aus Graz für ein langes Wochenende mit dem Minibus nach Tirol gekommen. „Die meisten von uns sind noch nie in ihrem Leben auf Schlittschuhen gestanden“, sagen die Spanier und lachen sich halb tot. Auf ihren Knien und Hintern sind dunkle, feuchte Flecken. „Unsere Hosen sind ganz nass.“ Aber egal. ¡No importa! Die spanischen Studenten bitten einen Eisläufer um ein Gruppenbild. Gracias, rufen die Spanier und spielen weiter, obwohl es immer dunkler wird und der Puck kaum noch zu sehen ist. Dann hört man nur noch das Kratzen der Kufen und lautes Lachen.



Das elegante 4-Sterne-Hotel Royal Hinterhuber in Reischach am Kronplatz liegt ruhig am Waldrand, mitten in der Natur und doch nahe am Ortskern. Eingebettet in eine zehn Hektar große Parklandschaft ist das familiengeführte Hotel ein Hideaway für sportive Genießer.


D
er „Kronplatz“ gilt als einer der modernsten und schneesichersten Skiberge Südtirols und punktet als ideale Skiregion für Pistenliebhaber, Schneeschuh- und Winterwanderer. Geschichtsträchtige Städte wie Brixen, Bozen oder Bruneck sind nur einen Katzensprung entfernt, sorgen für urbanes Feeling und begeistern mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten in der Adventszeit.

Mit einer außergewöhnlichen Wellness-, Wasserund Schönheitswelt wurde im Royal Hinterhuber ein Ort erschaffen, der sich vollends der ganzheitlichen Erholung widmet. Saunabesuche, Ruhen, Kraft tanken im Dampfbad. Bahnen ziehen im stilvollen Panorama-Indoorpool, entspannen im Whirlpool und die Gedanken auf Reise schicken. Um der Entspannung noch mehr Raum zu schenken, bietet das Royal Hinterhuber „Royal Moments“ wie Baden wie Kleopatra oder eine erlesene Auswahl an Treatments und Massagen.

Königlich geniessen.
Wenn der Geschmack Italiens auf die traditionelle Südtiroler Küche trifft, entsteht eine exklusive Kombination. Das Küchenteam im Royal Hinterhuber weiß gekonnt, wie aus Kreativität und Lebensmitteln von höchster Qualität außergewöhnliche Gerichte entstehen. Genuss hat im Royal Hinterhuber viele Facetten. Ob beim Gourmetfrühstück, dem Light Lunch, beim Aperitif an der Bar oder zum Nachmittagskaffee mit Spezialitäten aus der Patisserie. Stilvolle Stuben und das elegante, kürzlich modernisierte Restaurant bieten den passenden Rahmen für einen unvergesslichen Abend im Zeichen des Genusses. Buon appetito!
30 Tage Urlaub und mehr.
Die Angebotsvielfalt im Royal Hinterhuber kann sich sehen lassen. Wo schon gibt es Pauschalen für einen 30-tägigen Aufenthalt im Winterwunderland? Oder
wie wäre es mit einer Ski-Safari im Winter? Dabei werden sportive Naturliebhaber von Bergexperten zu den schönsten Skiregionen im UNESCO-Kulturerbe Dolomiten begleitet.
Natur von ihrer schönsten Seite. Gastfreundschaft in 6. Generation. Wellness im luxuriösen Ambiente. Exklusive Kulinarik für Feinschmecker: Das Royal Hinterhuber ist Sommer wie Winter ein Ort der königlichen Genüsse!


Lisa_Albegger-Fill
Ried / Pfaffental 1a I-39031 Reischach/Bruneck Tel. +39 (0)474 541000 E-Mail: info@royal-hinterhuber.com www.royal-hinterhuber.com

„Ganz oben am Berg fühle ich mich nicht behindert, sondern frei“, sagt Andreas Kapfinger.
Für Tiroler gehören die Berge selbstverständlich zu ihrer Welt. Aber das heißt nicht, dass sie die Gipfel zwischen Kitzbühel und Landeck nicht bewundern, fürchten und „zum Leben brauchen. Hier erzählen Tiroler, warum sie eigentlich in die Berge gehen, was die Berge ihnen geben und in welchen Momenten sie das Gefühl haben, eins mit der Natur zu sein. Drei Liebeserklärungen.
Texte:
Fotos: JÖRG
ANDREA LINDNER KOOPMANN & LENE HARBO PEDERSENdie berge als antrieb.
Die Tiroler Alpen sind mein Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen und empfinde es immer noch als großes Privileg, dass ich in so einer Landschaft leben darf. Unglaublich. Die Berge sind für mich pure Freiheit. Wenn ich da oben unterwegs bin, dann gibt es nur mich und die Berggipfel, mit dem Kopf bin ich dann ganz da.
Die Berge sind für mich Motivation und Antrieb, sie geben mir Orientierung und Halt, sie sind mein Arbeitsplatz und Mittelpunkt. Wenn ich mal nicht in den Bergen bin, geht es mir vielleicht eine Woche lang gut. Und dann kommt die große Sehnsucht.
Mein ganzes Leben habe ich in den Bergen verbracht. Auf dem Rad, beim Klettern oder auf der Piste. Ab elf ging es dann mit dem Snowboard los. Ich wollte immer höher, schneller, weiter und war auf einem gutem Weg zur Profikarriere. Doch dann kam der Unfall. Bei einem Showspringen daheim in Reith im Alpbachtal wollte ich es allen zeigen und habe einen besonders waghalsigen Sprung versucht. Leider habe
ist in Reith im Alpbachtal geboren und dort auch aufgewachsen. Er verbrachte sein ganzes Leben am Berg, bis ihn 1997 ein schwerer Snowboardunfall in den Rollstuhl brachte. Mit viel Energie und Entschlossenheit kämpfte er sich danach mit dem Monoski an die Weltspitze. Außerdem ist er als Bobpilot aktiv.
ich auf dem Schanzentisch verkantet und bin extrem unglücklich auf dem Oberkörper gelandet. Seitdem sitze ich im Rollstuhl, bin von der Brust abwärts gelähmt. Die Zeit nach dem Sturz war extrem schlimm. Ich konnte nicht mehr auf meine geliebten Berge steigen. Ich konnte eigentlich nichts mehr. Und habe mich in dieser Zeit schon gefragt: Ist das Leben noch lebenswert?
Aber zum Glück habe ich Wege und Lösungen für mich gefunden. Direkt in der Reha habe ich das Bild eines Monoskifahrers an der Wand entdeckt. Und irgendwie stand für mich sofort
fest: Ich werde Monoski-Profi. Es geht zurück an den Berg. Da, wo ich hingehöre. Das war mein größtes und einziges Ziel. Ab diesem Moment ging es wieder, nun ja, bergauf. Zum Glück bin ich schnell mit den richtigen Leuten zusammengekommen und fing an, Tiroler Meisterschaften zu fahren. Dann kamen Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaften und auch vier Olympische Spiele.
Der Sport und die Berge haben mich angetrieben und mir Kraft gegeben. Wenn ich meine Sachen packe und an den Berg fahre, existiert links und rechts nichts mehr für mich. Ich fühle mich am Berg nicht behindert oder beschränkt. Ich fühle mich frei. Ich genieße den Weitblick, die frische Luft, die Sonne. Meine Beziehung zum Berg ist wie eine Freundschaft, in der mir der Berg mehr gibt, als er mir genommen hat.
Durch den Unfall hat sich meine Beziehung zu meiner Heimat noch verstärkt. Denn die Liebe zum Berg ist natürlich auch die Liebe zu Tirol. Ich durfte auf der ganzen Welt wunderschöne Berge kennenlernen und runterrasen, aber für mich kann kein anderes Gebirge mit den Tiroler Gipfeln mithalten.“
die berge als problemlöser.
Wenn ich Probleme habe oder Entscheidungen treffen muss, dann löse ich das fast immer am Berg. Das Gehen macht den Kopf frei. Vor allem wenn die Dinge unklar sind … Das habe ich in meinem Leben oft erlebt, dass der Ausweg oder eine Idee dann langsam Konturen angenommen hat, so wie die Silhouette eines Berges, die sich aus den Wolken löst. Und auf einmal weiß man ganz genau, wie es geht. So habe ich fast alle meine privaten und beruflichen Entscheidungen getroffen. Die Berge sind echte Problemlöser.
Wenn man bei Landeck aufwächst, hat man fast automatisch eine enge Beziehung zum Berg. Früher hat es hier ja fast nix anderes gegeben als Skifahren. Wenn du im örtlichen Skiclub die Meisterschaft geholt hast, dann warst du wer, auch in der Schule und in der Familie. Was anderes gab es nicht.

Mein Vater ist leider verunglückt, als ich noch recht jung war. Das war
war in seiner Jugend Skiprofi und fuhr gegen Hansi Hinterseer. Danach ging er zur Flugrettung der Polizei, die er viele Jahre leitete – sein Spitzname: „Tiroler Adler“. Er lebt zwischen Landeck und Grins. Seit ein paar Jahren ist er im Ruhestand und kann die Berge wieder Vollzeit genießen.
eine schwere Zeit für mich, auch weil ich deshalb nicht aufs Skigymnasium gehen und meinen Traum von der Skiprofikarriere verfolgen konnte. Aber weil Wettkampf und Leistung damals alles für mich waren, habe ich es trotzdem geschafft.
Nach der Profikarriere blieb ich den Bergen treu: Ich arbeitete zunächst als Alpinpolizist und ab 1983 dann bei der Flugrettung. Ich war quasi der Typ,
der unter dem Hubschrauber an einem Seil hängt. Als ich später dann die Leitung der Flugpolizei und Flugrettung übernommen habe, habe ich auch den Hubschrauber-Berufspilotenschein gemacht. Weil ich finde: Wennst so a Standl führst, musst alles selbst können – sonst ist man immer auf Berater angewiesen.
In dieser Zeit war ich eher so ein Bürohengst in Wien: Du bist die ganze Woche in der Stadt, bist bei vielen Würschtlessen eingeladen. Und dazu der ganze Stress – da merkst du einfach: Ich brauche den Berg zum Runterkommen. In dieser Zeit habe ich begonnen, die Bergtouren auf eine neue Art und Weise zu genießen.
Über die Jahre hab ich um die 5.500 Einsätze am Berg miterlebt und geleitet. Und all diese Unglücke und Schicksale, die können schon an einem nagen. Mir war zwar schon immer klar, dass Respekt und Demut die wichtigsten Fähigkeiten eines guten Bergsteigers sind. Man muss auch mal umkehren können und sagen: Heute gehts halt nicht. Aber wenn man an einem Tag einen Lawineneinsatz mit Toten durchführt und am nächsten Tag selbst eine Skitour geht, dann ändert sich der Blick auf den Berg komplett. Und in dieser Situation eine Balance zu finden, dieses Erfüllende, dieses Bergglück aufrechtzuerhalten, das ist das Wichtigste.
Es gibt übrigens eine große Gemeinsamkeit zwischen dem Fliegen und dem Bergsteigen: In beiden Situationen kann man nicht bluffen oder sich rausreden. Das fand ich immer toll. Mit Beziehungen und Geld kannst du viel erreichen, gerade in der Politik oder im Geschäft.
Aber der Berg ist gerecht. Wenn du keine Kletterroute mit dem sechsten Schwierigkeitsgrad klettern kannst, dann kommst du halt nicht rauf. Punkt. Das mag ich am Berg.“


die berge als heimat.
Sarah: Jeden Tag fahre ich mit meiner Oma und mit meinen Geschwistern über die Streif runter in die Schule. Und nach der Schule fahre ich mit der Gondel wieder rauf. Mit meiner ganzen Familie wohne ich oben am Berg auf der Melkalm.
Oma Loisi: Wir sind hier drei Generationen und arbeiten jeden Tag zusammen. Das klappt sehr gut. Alle haben ihre Bereiche: Die Männer sind in der Küche, wir Frauen im Service und die Kinder in der Schule. Die Tage sind lang und voll. Wir stehen um 5.45 Uhr auf. Dann machen die Männer das Frühstück. Und ich heize den Ofen an. Wir frühstücken und um 6.40 Uhr fahren wir runter mit den Skiern.
Sarah: Der Rekord sind fünf Minuten!
Oma: Wenn ich zurückkomme, sind die Männer schon wieder in der Küche. Ab 10.30 Uhr kommen die Gäste und dann geht es stressig durch bis 15.30 Uhr.
Sarah: Meine Hausaufgaben mache ich meistens direkt in der Bahn oder am Tisch neben der Küche. Und dann spiele ich so schnell wie möglich mit meinen Geschwistern oder wir gehen noch mal Skifahren zusammen.
Oma: Und manchmal musst du auch helfen, gell? Sachen aufräumen, Teller rausbringen, kellnern …
Sarah: … des mach ich nicht so gern. Aber trotzdem will ich später das werden, was die Mama ist: Hüttenchefin.
Oma: In unserem Beruf weiß man, dass man wenig Freizeit hat. Damit musst du leben. Wenn du das nicht gern tust, dann ist das eine Qual. Wir sind den ganzen Winter hier oben und kommen fast nie in die Stadt. Aber da könnt ich eh nie leben. Wir sind hier aufgewachsen und verwurzelt. Wir sind hier heroben glücklich.
Sarah: Also auf dem Berg zu wohnen finde ich auch cool. Man hat eine schöne Aussicht und kann immer direkt die Ski anziehen und runterfahren. Und auch wenn ich in den Bergen wohne, sind sie trotzdem noch was Besonderes.
Sarah und ihre Oma Loisi Pölzelbauer wohnen auf der 1.694 Meter hoch gelegenen Melkalm bei Kitzbühel: Drei Generationen unter einem Dach. Während die Erwachsenen die Gäste auf der Alm bewirten, geht es für Sarah und ihre Geschwister die Streif hinab zur Schule.

Oma: Wenn du die Natur gern magst und gerne bergsteigen gehst, dann ist es hier perfekt. Heroben ist man irgendwie ruhiger.
Sarah: Also ich verbinde mit den Bergen vor allem Skifahren, Radfahren, Schwammerl suchen und Heidelbeeren pflücken, weil ich das alles gern mache am Berg. Die Berge sind mein Zuhause. Hier wird einem auch nie langweilig. Oma: Du brauchst keine Geschäfte. Wir sind frei hier. Die Leute hier oben sind auch netter. Alle per du. Und wir Bergler helfen uns gegenseitig. Das ist schon schön. Auch, dass ich immer mit den Enkeln zusammen sein kann. Gell Sarah?
Sarah: Also ich finde es auch gut, dass wir hier alle zusammenwohnen. Und auch wenn du öfter streng bist, Oma, mag ich dich sehr gerne. Du bist wie so meine zweite Mama, weißt?
Oma: Ich versteh schon. Wir Bergler sind einfach ein bisschen härter, gell? Das muss man aushalten. Das muss man positiv sehen. Anders geht das nicht.
on Beginn an prägt die Tischlerei Lanser mit ihren traditionell-modernen Einrichtungen aus Massivholz – frisch geschnitten oder aus Altbeständen – ein ganz spezielles alpines Wohn- und Wohlgefühl und trägt dieses über Generationen weiter. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind im Familienbetrieb dabei keine Schlagworte, sondern seit jeher gelebte Tugenden. Im Sinne der Ressourcenschonung werden hochwertige Möbel repariert oder restauriert, originalgetreu wiederaufbereitet oder zu Neuem umgestaltet. Auf diese Weise entstehen unter anderem wunderbare Stuben als Sinnbild des Tiroler Wohnens, aber auch ganze Wohnungen und Häuser, die bis ins Detail zu ihren Bewohnern passen. „Werden Möbel



in hochwertiger Qualität gefertigt, begleiten sie einen über viele Jahre und Jahrzehnte“, so die Brüder Roland und
Arnold Lanser, die die Tischlerei mittlerweile in fünfter Generation führen.
Wie beim Handwerk, im Zuge dessen aus charakterstarken Materialien individuelle Möbel nach Maß entstehen, legt man auch bei der ergänzenden Handelsware renommierter Marken Wert auf beste Qualität, die der Unternehmensphilosophie nach Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ebenso gerecht wird wie höchsten Ansprüchen ans Design.

Gasse 96a, 9932 Innervillgraten info@tischerlei-lanser.at www.tischlerei-lanser.at Schauräume in Lienz und Arnbach/Sillian
WINtERBEtRIEB vom 8.12.2022 bis 10.4.2023 - täglich von 08:00 – 16:30 Uhr



SOMMERBEtRIEB vom 12.5. bis 5.11.2023 - täglich von 08:30 – 17:00 Uhr

Die Brüder Matthias und Maximilian Bernhard befragen die Welt mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln, treten aber auch gern gemeinsam in Ausstellungen auf. Eine Begegnung in Kitzbühel, der Heimatstadt der beiden Künstler.
 Fotos: Andreas Friedle
Fotos: Andreas Friedle
Matthias Bernhards Atelier befindet sich in einer umgebauten Scheune am Fuße des berühmten Hahnenkamms, vor der Tür landen Paragleiter auf der grünen Wiese, drinnen wurde früher einmal Squash gespielt. Auf kuriose Weise scheint Kitzbühel sogar hier seinen Ruf als Sportstadt zu verteidigen, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Im malerischen Universum von Matthias Bernhard gerät das aber erst einmal in Vergessenheit, denn das quillt geradezu über vor Farbgebirgen und Formgeflechten, die manchmal auch über den Bildrand hinauswuchern oder sich Schicht für Schicht zu reliefartigen Objekten auswachsen. Was sich aus der Distanz betrachtet als abstrakte Malerei ausgibt, gibt in der Nahsicht immer wieder figurative Einsprengsel preis: Da und dort starrt einen aus bunten Farbhaufen heraus ein comicartiges Augenpaar an, anderswo tauchen in die Farbmassen verwobene Alltagsfundstücke auf.
Von Farbbeulen und Kalligraphie.
Hier ist unverkennbar jemand am Werk, der die Farbe als vielfältig formbares Material begreift, manchmal bearbeitet er sie auch mit dem Heißluftföhn, dann entstehen hartgesottene Farbbeulen, die wie Schaumstoffgebilde aussehen. Anderswo kommt die Malerei von Matthias Bernhard fast durchscheinend und kalligraphisch, aber auch dann noch als dichtes Geflecht daher. Ein Bild
Matthias Bernhard, geboren 1985 in Kitzbühel, Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien, lebt und arbeitet in Kitzbühel und Wien. Maximilian Bernhard, geboren 1990 in Kitzbühel, Studium an der Kunstakademie Karlsruhe, lebt und arbeitet in Kitzbühel und Karlsruhe.
sei für ihn dann fertig, wenn es nichts mehr von ihm wolle, sagt der Künstler, Jahrgang 1985, der das lange Haar zum Dutt zusammengebunden trägt, aber nicht so wirkt, als wolle er damit den Hipster markieren. Der Hang zur langen Haartracht scheint vielmehr genauso in der Familie zu liegen wie der Hang zur Kunst. Der Beweis dafür heißt Maximilian Bernhard, das ist der fünf Jahre jüngere Bruder des Malers, seinerseits in der Bildhauerei zuhause und derzeit ein vielbeachteter Newcomer auf dem Kunstparkett. Denn auch er ist ein ziemlich eigenwilliger Arbeiter am Material. Wenn er etwa Tonbatzen mit Druckstücken bearbeitet, kommen dabei Skulpturen und Objekte heraus, die an altertümliche Artefakte erinnern, zugleich aber auch eine höchst gegenwärtige Sprache sprechen.
Ins Atelier seines Malerbruders ist Maximilian Bernhard an diesem Tag als Besucher gekommen, vor kurzem haben die beiden hier aber erstmals auch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. Es war noch dazu ein Heimspiel, nämlich ein Kunst-am-Bau-Projekt für eine Wohnanlage in Reith bei Kitzbühel, wo beide dereinst die Schule besucht haben. Und es war eine gute Gelegenheit, ihr Verständnis von Kunst zu demonstrieren, die für sie bestenfalls ein „integrativer Bestandteil des Alltags“ und keine dem Leben enthobene Disziplin ist. Entstanden ist eine tribünenartig aufgebaute Aussichtsplattform, die als Begegnungsort für die Bewohner genauso wie als autonome
WIE SELBSTVERSTÄNDLICH VERSCHRÄNKTEN DIE BRÜDER MATTHIAS UND MAXIMILIAN BERNHARD IHRE UNTERSCHIEDLICHEN KÜNSTLERISCHEN GATTUNGEN, HÖCHST UNTERSCHIEDLICH WAREN IN DER TAT AUCH IHRE WEGE ZUR KUNST.
In der großzügig umgestalteten Kanzlei von dr. hermann holzmann kümmert sich die vierköpfige Anwaltsfamilie mit ihrem Team um Fragen rund die Fachgebiete Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Zivilrecht, Scheidungsrecht und Vertragsrecht.




Ganz unter dem Motto: “Die primäre Verpflichtung des Rechtsanwaltes ist es, prozessvorbeugend zu agieren!“
Eine echte „Familien-Kanzlei“: Isabella, Hermann und Lisa Holzmann
Es braucht nicht zwingend konkrete Bezüge, damit die Bernhard Brothers in Ausstellungen gemeinsame Sache machen.
Skulptur und skurril-bunte Bilderwand fungiert. Diese Wand ist aus einzelnen Betonplatten zusammengesetzt, die die Künstler jeweils individuell gestaltet, gefärbt und gegossen haben und die für sie auch so etwas wie die „guten Geister“ des Wohnbaus darstellen.

Anfänge in der Schnitzschule.
Wie selbstverständlich verschränkten die Brüder dabei auch die unterschiedlichen künstlerischen Gattungen, in denen sie unterwegs sind. Höchst unterschiedlich waren aber in der Tat ihre Wege zur Kunst: Den Älteren, Matthias Bernhard, verschlug es schon vor Jahren nach Wien, wo er zunächst ein Kunstgeschichte-Studium begann, um dann bei Gunter Damisch an der Akademie der bildenden Künste Malerei zu studieren. Maximilian Bernhard besuchte zunächst die Schnitzschule in Elbigenalp, um danach für einige Jahre auf Reisen zu gehen und in Australien als Tischler zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr ging er an die Kunstakademie Karlsruhe und studierte Bildhauerei bei Harald Klingelhöller. Das Holz habe er, so der seither in Deutschland lebende Bildhauer, „dann erst einmal beiseitegeschoben“, es entstanden unter anderem Arbeiten aus Draht und Gips, die entfernt an die informellen Plastiken eines Oswald Oberhuber erinnern, aber auch selbstbewusst eigene Wege einschlagen. „Ich komme aus dem Handwerk“, betont Maximilian Bernhard gern und bekräftigt damit, dass das auch seinen Umgang mit dem Material bestimme. „Am Anfang steht die Entscheidung, welches Material ich verwende und wie damit umzugehen ist. Beton ist ganz anders zu verarbeiten als Ton.“



Kitzbühel schwingt immer mit.
Beim Maler Matthias Bernhard ist es wiederum auch die Umgebung, mit der seine Bilder während des Entste-















hungsprozesses korrespondieren: Licht, Raum, Perspektive malen gewissermaßen mit, umso mehr, seit er seinen Arbeitsschwerpunkt mit Ausbruch der Coronakrise wieder verstärkt von Wien nach Kitzbühel verlagert hat. Besonders hier lasse er seine Bilder „oft ganz bewusst nach außen wandern und setze sie etwa in Beziehung zu den kollektiv eingebrannten Panoramen Alfons Waldes oder des Wilden Kaisers“, so der Maler, der seine Impulse auch aus der Kunstgeschichte schöpft: Es gibt Bezüge zur Art brut, zum expressiven Gestus und der intensiven Farbigkeit eines Franz Ringel, zu den amerikanischen Expressionisten und auch anderen Strömungen, auf die Bernhard in seiner eigenen, auch mit popkulturellen Bezügen gespickten Welt referiert. In dieser Welt spielen auch die von ihm gestalteten Künstlerbücher und die Sprache eine gewichtige Rolle. Manches Gekritzel an den Atelierwänden ist später zum Bildtitel geworden. „Die Abfahrt – Im Land,
Matthias Bernharddort wo es Leben gießt“ zum Beispiel, mit dem der Künstler augenzwinkernd auf Max Beckmanns Triptychon „Die Abfahrt“, aber natürlich auch auf Kitzbühel Bezug nimmt. In diese Arbeit, die sich wie auch manch andere nicht um herkömmliche Bildformate schert, hat er Luftmatratzenreste genauso eingearbeitet wie einen Teil einer Transportkiste, in der sein Bruder Maximilian einst seine Habseligkeiten von Australien zurück nach Österreich verfrachtet hat.
Es braucht aber nicht zwingend konkrete Bezüge, damit die Bernhard Brothers in Ausstellungen gemeinsame Sache machen. Dass in ihren Untersuchungen an Material und Form immer wieder persönliche, ironische oder historische Erzählungen ausapern, ist eine hübsche, wenn auch weit gedachte Klammer. Beide stehen jedenfalls auch dafür, dass der berühmte und bis heute bestens verkäufliche klassisch moderne „Schneemaler“ Alfons Walde längst nicht mehr das einzige künstlerische Aushängeschild der Gamsstadt ist. Auch wenn es manchmal so aussieht und auch so vermarktet wird. „In Kitzbühel könnte die Kunst eine wichtige Rolle spielen, aber es dreht sich alles um den Sport“, sagt Matthias Bernhard, der diesbezüglich zuletzt gemeinsam mit Wolfgang Capellari gegengesteuert hat. Die beiden Künstler organisierten zum 750. Stadtjubiläum eine Ausstellung im Museum Kitzbühel, die eine ganze Reihe von zeitgenössischen Kitzbühelern sowie eng mit der Stadt verbundenen Künstlerinnen und Künstlern versammelte. Der Ausstellungstitel „Arbeitstitel Kunstbühel“ war durchaus als Ansage zu verstehen, die darin gezeigten „Heimgeister“ von Matthias Bernhard und die von Maximilian Bernhard zu witzigen Trashskulpturen verarbeiteten Skipokale aus dem Familienkeller vielleicht auch. In jedem Fall stellt das von Stefan Klampfer gestaltete Katalogbuch eine bemerkenswerte Anthologie der Kitzbüheler Gegenwartskunst dar. Ivona_Jelčić


„IN KITZBÜHEL KÖNNTE DIE KUNST EINE WICHTIGE ROLLE SPIELEN, ABER ES DREHT SICH ALLES UM DEN SPORT.“














Matthias Bernhard’s studio is located in a converted barn at the foot of the famous Hahnenkamm in Kitzbühel. His artistic universe is overflowing with mountains of colour and form, which sometimes sprawl beyond the edge of the picture or grow layer by layer into relief-like objects. What appears to be abstract painting when viewed from a distance repeatedly reveals figurative elements when viewed up close. A painting is finished for him when it wants nothing more from him, says the artist, born in 1985, who wears his long hair tied up in a bun, but does not appear as if he wants to mark the hipster with it.
The penchant for long hair seems to run in the family just as much as the penchant for art. The proof of this is Maximilian Bernhard, the painter’s five-year younger brother, who works in sculpture and is currently a highly regarded newcomer on the art scene. He is also a rather idiosyncratic worker when it comes to materials. When he works on lumps of clay with printed pieces, for example, the result is sculptures and ob-
jects that are reminiscent of ancient artifacts, but at the same time speak a highly contemporary language.
While Maximilian Bernhard came to his brother’s painting studio that day as a visitor, the two had recently also worked together on a joint project. It was also a local project, namely an art-in-architecture project for a residential complex in Reith near Kitzbühel, where they both once attended school. As if it were a matter of course, the brothers intertwined the different artistic genres in which they are active. In fact, their paths to art were very different: the older, Matthias Bernhard, moved to Vienna years ago, where he first began to study art history and then went on to study painting with Gunter Damisch at the Academy of Fine Arts. Maximilian Bernhard first attended the carving school in Elbigenalp, then travelled for a few years and worked as a carpenter in Australia. Upon his return, he went to the Karlsruhe Art Academy and studied sculpture with Harald Klingelhöller. In the end, however, the two always find each other. Personally and artistically.

Das persönliche Gespräch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kund*innen den passenden Weg. Stets im Gepäck: Handschlagqualität und unsere bewährten Leistungen, gepaart mit innovativen digitalen Angeboten.

Die vielen Gesichter des Gregor Bloéb: rechts sein „Theater-“, links sein „Fernsehgesicht“

Wer sich nichts merken kann, muss fühlen.
Fotos: Andreas Friedle
Gregor Bloéb ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Und er ist neuer künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele. Wir haben ihn im Innsbrucker Café Central auf einen Kaffee getroffen. Und eine Cola.

Können Sie sich an Ihren allerersten Bühnenauftritt erinnern?
Gregor Bloéb: Nein. Das liegt jedoch daran, dass ich mich generell an nichts wirklich erinnern kann, das ein halbes Jahr oder Jahr vergangen ist. Ich lebe sehr im Hier und Jetzt. Was sich mir allerdings stark einprägt, sind Gefühle. Und zwar auf immer und ewig. Die Kombination daraus prädestiniert mich wohl auch für meinen Beruf.
Gregor BloébSie stehen auf der Bühne und vor der Kamera. Was macht für Sie den Unterschied? Es ist eine andere Form der Energie und des Handwerks. Und ein Geheimnis. Alles zusammen. Die Energie beim Theater geht weit, ist groß und mächtig, weil man die Zuschauer bis in die letzte Reihe erreichen möchte. Beim Film arbeitet man fokussierter, oft direkt in die Kamera. Deshalb funktionieren beim Film auch auffällige Charaktere so gut, weil sie für den Zuseher unmittelbarer erlebbar sind.
Gab’s zur Schauspielerei jemals einen Plan B? Nein, den hatte ich nie. Ich bin da irgendwie hineingeraten. Ich wollte gerne Volksschuldirektor werden, weil ich wahnsinnig gern mit Kin-
„BRAUCHEN TU ICH GAR NIX. ICH HAB ABER AUCH NICHTS GEGEN LUXUS.“Gregor Bloéb
dern arbeite. Oder Kindergartenonkel, aber das gab es damals noch nicht. Ich liebe Kinder. Ich habe selbst vier und die wiederum haben sehr viele Freunde, die immer wieder bei uns zu Gast sind oder waren. Wenn man über die Jahre sieht, wie sich deren Charakter entwickelt, ist das großartig. Generell bin ich einer, der die Menschen mag und sie gerne beobachtet. Das ist auch für meinen Beruf durchaus hilfreich.
Sie haben drei Brüder, waren Sie selbst ein angenehmes Kind? Man erzählt mir, ich sei ein ganz lieber gewesen. Ich war aber auch sehr schüchtern und hab schnell angefangen zu weinen. Ich war ein richtiges Mamakind. Wobei unsere Mutter einfach nur aus einem großen Herzen bestand. Sie war quasi die Gründerin der antiautoritären Erziehung, es hat nie ein lautes Wort gegeben. Unsere Mutter hatte diese natürliche Autorität. Bei mir ist das ähnlich. Ich muss mit meinen Kindern nie schimpfen. Nie, kein einziges Mal. Wobei unsere Kinder mit zwei Schauspielereltern fast naturgemäß mit viel Emotionen aufwachsen. Gefühle auszuleben gehört bei uns zum Alltag.
Sie leben unter anderem im beschaulichen Pfaffenhofen bei Telfs auf einem um- und ausgebauten Hof. Sie sind offenbar keiner, der Luxus und Schickimicki-Glamour braucht. Also brauchen tu ich gar nix. Ich hab aber auch nichts dagegen und durfte durch meinem Beruf sämtliche Facetten des Lebens kennenlernen. Ich hab unter der Brücke ge-
Gregor Bloéb wurde 1968 in Innsbruck geboren. Er ist Theater-, Film- und Fernsehschauspieler, seine Filmografie ist durchaus stattlich. Bloéb absolvierte sein Schauspielstudium in Innsbruck und startete seine Karriere 1990 in Felix Mitterers „Piefke Saga“. Er war Intendant des Theatersommers Haag, spielte in zahlreichen Serien und Filmen und schlüpft im Salzburger „Jedermann“ in die Rollen des Guten Gesells sowie des Teufels. 2013 erhielt er den Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie „Bester Schauspieler“ für seine Darstellung im Drama „Jägerstätter“, 2018 das Ehrenzeichen des Landes Tirol. Bloéb hat zwei Kinder mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Ute Heidorn sowie zwei Söhne mit Schauspielerin Nina Proll, die er 2008 geheiratet hat. Er lebt in Pfaffenhofen und Berlin.
nauso geschlafen wie im Luxushotel in Monte Carlo. Ich bin gerne überall und beobachte die Menschen, ich schaue gern. Haben muss ich nichts. Deswegen kann ich in meinem Leben immer wieder Risiken eingehen, weil es mir im Grunde egal ist, wo ich lande.
Darf man als Schauspieler scheitern? Das Schöne an der Schauspielerei ist ja, dass man mit jeder Rolle und jeder Produktion wieder neu anfangen kann, und wenn man Glück hat, kommt
Kunst dabei heraus. Es kann aber auch in die Hose gehen. Verziehen wird dir letztlich gar nichts, von außen bekommt man immer Prügel. Man kann das Scheitern nur für sich selbst hinnehmen.
Wie gehen Sie mit Kritik um? Ich bin diesbezüglich relativ gesund gestrickt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich Lob bekomme, und es ist mir total wurscht, wenn ich Schimpfe ausfasse. Natürlich kommt es darauf an, wer mich kritisiert. Und in welcher Form. Hier kann ich ganz gut unterscheiden und meistens berührt mich Kritik tatsächlich nicht.
Sie starten als künstlerischer Leiter in die neue Saison der Tiroler Volksschauspiele. Das war nicht ganz frei von Friktionen. Kränkt es Sie, dass Sie offiziell nicht die erste Wahl waren? Och, das sehe ich entspannt. Die Intendanz ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern man ist schon vor ein paar Jahren auf mich zugekommen mit der Frage, wie man die Volksschauspiele voranbringen könnte. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und diese auch weitergegeben. Dann meinten die Verantwortlichen, dass es ganz schön wäre, wenn ich diese Gedanken auch umsetzen würde. Das hätte ich schon damals gerne gemacht, man hat sich letztlich anders entschieden. Das war o.k. für mich. Nun wurde das Thema wieder aktuell, wir haben die Rahmenbedingungen abgesteckt und ich habe angefangen zu arbeiten. Ende der Geschichte.
Marina_Bernardi„ICH FREUE MICH WAHNSINNIG, WENN ICH LOB BEKOMME, UND ES IST MIR TOTAL WURSCHT, WENN ICH SCHIMPFE AUSFASSE.“
Werden Sie gerne auf der Straße erkannt?
Mit welchen Gefühlen denken Sie an Ihre Frau?

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich selbst im Fernsehen sehen?


Wie blicken Sie auf Ihre erste Spielzeit als künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele?

Wenn allein schon die Ankündigung des ersten Programms unter seiner Leitung Hunderte Interessierte in den Telfer Rathaussaal lockt, * dann weiß man, was uns abginge, wenn es das nicht mehr gäbe. Dieses gemeinsame Erleben von Kunst und Kultur, das uns oft erst den Blick für unser eigenes Menschsein öffnet. Und uns dadurch als Menschen verbindet. www.raiffeisen-tirol.at
* Antritts-Pressekonferenz von Gregor Bloéb, dem neuen künstlerischen Leiter der Tiroler Volksschauspiele, 7. November 2022

So ließ Autorin Astrid Lindgren nicht nur ihre Pippi Langstrumpf sein, genauso wird auch das Programm der Tiroler Volksschauspiele 2023.
Aufregend soll es werden, voller wilder Ideen und Visionen. Wenn Gregor Bloéb von seinem ersten Programm für die Tiroler Volksschauspiele in Telfs erzählt, werden die Gesten ausladend, die Stimme aufgeregt. Tatsächlich hat der neue künstlerische Leiter einiges vor im Sommer 2023. Gestartet wird mit einem großen Eröffnungsfest: „Die Volksschauspiele müssen wieder etwas für Telfs und die Telfer sein. Die meisten Einwohner wissen gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Das werden wir ändern. Es soll wieder um Gemeinschaft gehen und um Zusammenhalt“, zeigt sich Bloéb leidenschaftlich. Es soll eine große Tafel geben, an der gemeinsam gegessen wird. Und reichlich Musik.

Als Spielstätte wurde der Birkenberg auserkoren. Schon immer waren die Tiroler Volksschauspiele örtlich losgelöst von klassischen Aufführungsorten. „Wir spielen zwischen der Kirche und der Besamungsstation. Das finde ich einen sehr schönen Ort, um Theater zu machen“, sagt Bloéb. Auf der Tribüne sollen rund 500 Menschen Platz finden, am Platz vor der Kirche wird gemeinsam mit der kollaborativen Initiative columbosnext an einer Gestaltung gearbeitet, die ein Foyer als Raum des Miteinanders schafft. „Kunst und Kultur braucht den Austausch“, ist Gregor
Gregor Bloéb
Bloéb überzeugt. Auch ein öffentliches Klavier soll dort stehen: „Wenn daraus etwas entsteht, ist es super, wenn nicht, ist es auch gut. Mir geht es um Ästhetik und Schönheit. Es gibt keine Kleinigkeit mehr, die nicht durchdacht ist. Wir möchten nur noch Schönes in die Welt setzen.“ Dazu zählt auch hochkarätige Kunst. Bloéb hat es geschafft, Werke des jüdischen Malers Arik Brauer nach Telfs zu holen. Konkret in die katholische Kirche: „Der Dekan war sofort dabei. Alle blicken hier über den Tellerrand hinaus und springen über ihre Schatten. Das ist wirklich schön.“ Künstlertochter Timna Brauer wird die Ausstellung gesanglich einleiten.
Sieben Todsünden 2.0
40 und ein Jahr ist es her, dass die Tiroler Volksschauspiele mit dem Einakterzyklus „Die sieben Todsünden“ des Tiroler Dramatikers Franz Kranewitter in der Haller Burg Hasegg zum ersten Mal über die Bühne gingen. Das heurige Hauptstück ist eine Reminiszenz und eine Hommage an vier Jahrzehnte Volksschauspiel. Sieben verschiedene Autoren nehmen sich dabei je eine der Todsünden vor und erarbeiten sie auf ihre ganz spezielle Weise. „Nicht nur die Volksschauspiele haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sondern die ganze Welt ist ver-rückt.
„WIR MÖCHTEN NUR NOCH SCHÖNES IN DIE WELT SETZEN.“
Wir verstehen sie alle nicht mehr, vieles ist regel- und wertelos geworden. So manche Todsünde hat sich heute zur Tugend entwickelt. Geiz ist geil, die Habgier allgegenwärtig, die Völlerei hat sich in der westlichen Welt vollkommen umgekehrt bis hin zu Bulimie und Magersucht. Mich interessiert bei der Inszenierung weniger der katholische Hintergrund als das Gesellschaftspolitische“, erklärt der künstlerische Neo-Leiter.
Fix als Autorin ist Helene Adler, die sich der Trägheit annehmen und damit ihr erstes Kurzdrama verfassen wird. Multitalent David Schalko erörtert die Wolllust, Felix Mitterer wird sich dem Geiz in Form einer Parabel nähern und kommt damit nach Telfs zurück. Calle Fuhr, künstlerischer Produktionsleiter am Volkstheater Wien in den Bezirken, erforscht den Hochmut, Drehbuchautor Ulli Bree bringt den ihm ureigensten Dialogwitz ein und gibt sich hemmungslos der Völlerei hin und Nestroy-Preisträgerin Lisa Wentz durchdringt den Zorn. Für die Gier ist man aktuell noch in Verhandlungen. Auch der für „Darwin’s Nightmare“ oscarnominierte Dokumentarfilmer und laut Bloéb „völlig wahnsinnige“ Hubert Sauper ist dabei und gemeinsam mit Johannes Schmidl für Prolog und Epilog verantwortlich. Als Dramaturg konnte Florian Hirsch gewonnen werden, mit dem Bloéb bereits am Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen zusammengearbeitet hat. Aktuell ist er Chefdramaturg am Nationaltheater in Luxemburg. „Ein großartiger Typ“, beschreibt ihn Bloéb. Die Autoren haben freie Wahl in der Inszenierung. Plan ist, jeder Todsünde auf der Bühne 15 Minuten Ruhm zu geben. Als Schauspielerin hat die großartige Gerti Drassl bereits ebenso zugesagt wie Marlene Markt, Olivia Grigolli, Klaus Rohrmoser und Volksschauspieler Georg Friedrich. Ein großes Kompliment und Zeichen höchsten Vertrauens, in Anbetracht

dessen, dass es im Moment erst grobe Exposés gibt.
Neben dem Hauptstück wird es auch 2023 ein weiteres im Programm geben, mit dem vor allem die kleinen, traditionellen Bühnen im ganzen Land gefördert werden sollen. „In Tirol gibt es über 300 Dorf- und Volksbühnen. Fast alle großen Namen, die mit den Volksschauspielen einhergehen – Ruth Drexel, Hans Brenner, Kurt Weinzierl, Dietmar Schönherr – haben auf einer von ihnen begonnen. Deshalb ist es mir wichtig, diese Kultur zu erhalten“, sagt Bloéb. Aus diesem Grund hat er Theatermacher Thomas Gassner beauftragt, gemeinsam mit verschiedenen heimischen Dorfbühnen das Thema „Tugenden“ zu bearbeiten – quasi als Gegenpol zu den Todsünden. Neun Volksbühnen von Imst bis Lienz haben sich gemeldet, das daraus entstehende Stück „Ein Narrentanz. 7 Kardinaltugenden“ wird an vier Abenden im Rathaussaal in Telfs präsentiert. Als Abschlusshighlight soll
ein Preis für herausragende künstlerische Leistungen vergeben werden. Als Verneigung vor der wunderbaren Ruth Drexel soll er „Der Ruth“ heißen. „Ich bin mir sicher, das hätte ihr sehr gefallen“, glaubt Bloéb. „Ich fände es schön, wenn die erste Verleihung ihre Tochter Cilli, selbst Schauspielerin und großartige Regisseurin, übergeben würde.“
Der Tusch zum Schluss.
Und weil es nach einem grandiosen Eröffnungsfest folgerichtig einen ebenso grandiosen Schlusstusch braucht, wurde ein großes Abschlusskonzert fixiert. „Für die Jugend“, sagt Bloéb. Dafür ist ihm in der Tat ein echter Coup gelungen, wird doch Yung Hurn in der Kuppel auftreten. Dazu kommt noch reichlich Rahmenprogramm, an dem bis Ostern gefeilt wird. Karten für die Vorstellungen lassen sich bereits erwerben. www.volksschauspiele.at
If you can’t remember, you have to feel.
Gregor Bloéb was born in Innsbruck in 1968. He is a theatre, film and television actor, and his filmography is quite impressive. Bloéb completed his acting studies in Innsbruck and started his career in 1990 in Felix Mitterer’s “Piefke Saga”. He was the artistic director of the Haag Theatre Summer, played in numerous series and films and slipped into the roles of the Good Guy and the Devil in Salzburg’s “Jedermann”. Gregor Bloéb is a man with many faces. And he is the new artistic director of the Tiroler Volksschauspiele, for which he has many plans in 2023.
Can you remember your very first stage appearance? Gregor Bloéb: No. But that’s because I generally can’t really remember anything that has happened half a year or a year ago. I live very much in the here and now. What I do remember strongly, however, are feelings. And they last in my mind for ever and ever. The combination of this probably also predestines me for my profession.
You are on stage and in front of the camera. What makes the difference for you? It’s a different form of energy and craft. And a mystery. All of it together. The energy in theatre goes far, is big and powerful, because you want to reach the audience to the last row. In film, you work in a more focused way, often straight into the camera. That’s why flashy characters work so well in film, because they can be experienced more directly by the viewer.
One of the places where you live is in the tranquil village of Pfaffenhofen near Telfs, on a farm that has been converted and expanded. Obviously, you are not someone who needs luxury and fancy-pants glamour. Well, I don’t need anything. However, I don’t mind it either,

and my job has allowed me to get to know all facets of life. I’ve slept under a bridge as well as in a luxury hotel in Monte Carlo. I like to be everywhere and watch people, I like to observe. I don’t have to have everything. That’s why I can always take risks in my life, because I basically don’t care where I end up.
In the summer of 2022, the Tiroler Volksschauspiele in Telfs celebrated its 40th anniversary. Founded in Hall in 1981, the theatre festival moved to Telfs a year later and has always used ambitious productions of classics of folk theatre as well as contemporary plays. The festival is fearless, courageous and may polarise. Gregor Bloéb has been artistic director since October 2022, and in his first season in 2023 he will stage a play about seven deadly sins, among other things.
„Gemeinsam neue Wege gehen“ lautet das Motto der Tiroler Volksschauspiele unter neuer künstlerischer Leitung von Gregor Bloéb. „Gemeinsam besser leben“ können sie dank der Unterstützung von UNIQA Tirol.
it der Aufführung der „7 Todsünden“ will Gregor Bloéb als neuer künstlerischer Leiter im Sommer 2023 ein Theaterspektakel für alle inszenieren. Mit neuen Texten und spannenden Autorinnen und Autoren wird es am Birkenberg in Telfs so richtig zur Sache gehen. Dabei wird den Todsünden unserer Zeit auf den Zahn gefühlt. „Gregor versteht die DNA der Tiroler Volksschauspiele und dank seinem riesigen Netzwerk an Künstlerinnen und Künstlern ist es meine Vision, dass man, wenn man an Kulturveranstaltungen im Sommer denkt, Telfs in einer Reihe mit Salzburg oder Bregenz nennt“, versprüht Verena Covi, Geschäftsführerin der Volksschauspiele, jede Menge Optimismus, mussten sie doch in den ver-
gangenen Jahren pandemiebedingt durch harte Zeiten gehen.
In guten wie in schlechten Zeiten.
UNIQA ist in guten wie in schlechten Zeiten an der Seite der Tiroler Volksschauspiele. Seit beinahe 20 Jahren zählen die Tiroler Volksschauspiele in Telfs auf die Unterstützung der größten Versicherung in Tirol. Was die beiden verbindet? Das Wort „gemeinsam“. Denn nur gemeinsam kann ein wertvoller Beitrag zum Erhalt der Kultur in der Region geleistet werden. „Als größter Versicherer in Tirol ist es unser sozialer Beitrag, regionale Projekte wie die Tiroler Volksschauspiele zu unterstützen“, erklärt Michael Zentner, UNIQA
Landesdirektor in Tirol. Für Verena Covi wiederum bedeutet diese Unterstützung eine Stärkung der finanziellen Mittel sowie Sicherheit. „Gemeinsame Werte verbinden und schaffen einen Imagetransfer für beide Seiten“, sind sich die beiden einig. „Neben dem kulturellen Beitrag für die Gesellschaft ist ein Theater auch ein Unternehmen, das Arbeitsplätze schafft und zur regionalen Wertschöpfung beiträgt.“ Dass gerade in Zeiten umfassender gesellschaftlicher Veränderungen die Kultur eine wichtige Rolle spielt, hat sich schon in bisherigen Krisen gezeigt. „Umso wichtiger ist es uns als Versicherung, einen regionalen Beitrag für die Gesellschaft in unserem Land zu leisten“, unterstreicht Michael Zentner das Engagement der UNIQA Landesdirektion.

Seit 2016 werden im BTV Stadtforum zeitgenössische Positionen angewandter Fotografie gezeigt. Mit Hans-Joachim Gögl als künstlerischem Leiter ist 2018 hier ein neues Konzept eingezogen.
INN SITU kombiniert feine Fotokunst mit Musik und Dialog und lässt Künstler dazu einen ganz speziellen Blick auf Tirol werfen.

Die Ausstellung „Landschaft als Performance“ von Andrea Botto zeigt auf eindrückliche Weise die verschiedenen Funktionen von Sprengungen und ist noch bis 21. Jänner 2023 im BTV Stadtforum zu sehen.

In situ ist lateinisch und steht für „am Ort“. Das zweite N im Namen des Konzeptes INN SITU verweist mehr oder weniger subtil auf den Standort Innsbruck. Und der Name ist durchaus Programm, denn gezeigt werden nicht – wie in Ausstellungen sonst üblich – bereits vorhandene Werke, vielmehr sind gezielt ausgewählte internationale Fotokünstler eingeladen, sich vor Ort mit dem Kulturraum, der Landschaft und den sozialen Wirklichkeiten Tirols zu beschäftigen und sie nicht nur zu dokumentieren, sondern sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Daraus entstehen eigens für das BTV Stadtforum entwickelte Werke bzw. Ausstellungen, mit denen die Fotografen direkt auf ihre Wahrnehmung der Region reagieren. Das Ergebnis sind spannende Formate, in denen Künstlerinnen und Künstler immer wieder neue Brücken zwischen Fotografie und anderen Künsten schlagen. Parallel dazu werden Musikschaffende aus Tirol und Vorarlberg eingeladen, in Resonanz auf die Außenwahrnehmung der Fotokünstler jeweils ein Konzept neu zu entwickeln. Die darauf aufbauenden Dialoge regen zum Austausch an, denn „was nützt das stärkste Kunstwerk, wenn niemand damit in Kontakt geht“, findet Hans-Joachim Gögl. „Der Dreiklang aus Kunst, Musik und Dialog hat sich über die Jahre bestens bewährt und lässt sich stets neu befüllen. Tirol und Vorarlberg verfügen über eine Reihe an Weltklasse-Musikerinnen und -Musikern, das Potenzial ist unerschöpflich. Und auch die bis dato angefragten Fotokünstlerinnen und -künstler haben die Herausforderungen des Konzeptes gerne angenommen.“
Bis 21. Jänner 2023 ist die Ausstellung „Landschaft als Performance“ zu sehen, in der sich Andrea Botto mit dem Fotografieren von Explosionen beschäftigt. Das erfordert präziseste Vorbereitung und Planung, denn der Italiener fotografiert analog und hat nur den Bruchteil einer Sekunde Zeit für den optimalen Abdrückmoment. „Das Beeindruckende an seiner Arbeit ist, dass sie sehr viel mit Fototechnik und dem ureigenen Wesen der Fotografie zu tun hat“, beschreibt Gögl. Im ersten Raum wird dabei der wesentliche Aspekt der Ausstellung in verschiedenen Schwarz-Weiß-Bildern dargestellt – die Auslösung der Explosion, die damit gleichzeitig Sinnbild für das Auslösen des Fotos ist: „Beides ist unwiederholbar. Wenn die Sprengung vollbracht ist, lässt sich die Explosion und das Bild davon nicht rückgängig machen. Es geht darum, diesen einen, richtigen Moment zu treffen. Die Kamera wird zum Teil des Geschehens.“ Im selben Raum läuft ein Video mit zwölf verschiedenen Kurzfilmen, die das Arbeiten und die Sprengungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln dokumentieren.



„ICH
Die Motive der Fotos indes sind vielfältig. Von Straßenfeiern samt Feuerwerk, dem Tagabbau über eine Lawinensprengung in der Silvretta/Montafon, Muren- und Brückensprengungen bis zu einem ganz besonders beeindrucken Bild einer Sprengung im Brennerbasistunnel, für das die eine Millisikunde zählt, bevor einen die Druckwelle erfasst und es zu spät für das Bild ist. Die Kamera eingehaust in einen Karboncontainer, damit sie nicht zerstört wird. „Andrea Botto interessiert kein Storytelling, nicht die Serie. Ihn interessiert dieses eine Bild“, so Gögl. Auch die wohl berühmteste Sprengung der letzten Jahre – jene der eingestürzten Brücke in Genua – ist in der Ausstellung bildlich verewigt. Und selbst wenn dieser Zugang sehr technisch klingt, so ist er dennoch höchst emotional. „Der Moment, für den eine Explosion angekündigt ist, ein Feuerwerk gezündet wird, ein Haus einstürzt oder eine Lawine

In situ is Latin and stands for “in place”. The second N in the name of the concept INN SITU refers more or less subtly to the location Innsbruck. And the name says it all, because the exhibition does not show existing works – as is usually the case in exhibitions – but rather specifically selected international photo artists are invited to deal with the cultural space, the landscape and the social realities of Tyrol on site. This results in works or exhibitions developed especially for the BTV Stadtforum, with which the photographers respond directly to their perception of the region. The exhibitions change twice a year, admission is free.
abgeht, fasziniert uns Menschen. Oft bilden sich Menschentrauben, man will dabei sein. Vom Kind bis zum Greis sind das Ereignisse, die uns alle in irgendeiner Weise berühren. Das ist das emotionale Grundelement dieser Ausstellung – Landschaftsfotografie, Wissenschaftsdokumentation und Kunst in einem.“
Zweimal im Jahr wechseln die Ausstellungen von INN SITU, jeweils rund zwei Jahre im Voraus werden die Künstler dafür eingeladen. Sie haben dann etwa ein halbes Jahr Zeit, um sich vorzubereiten, und eines, um vor Ort zu fotografieren. „Das ist auch für uns eine sehr spezielle Situation“, sagt Gögl. „Andere Galerien laden fertige Arbeiten zu einer Ausstellung ein, bei uns schwingt immer eine gewisse Unsicherheit mit, weil wir das Ergebnis noch nicht kennen. Wir haben auch mit den Künstlerinnen und Künstlern vorher nie zusammengearbeitet, das heißt, ich muss allein aufgrund der Gespräche und meines Bauchgefühls abschätzen, ob die Ausstellung unter Einhaltung der Budgetgrenzen pünktlich fertig werden wird. Doch es ist ein Privileg, eine solche Arbeit machen zu dürfen.“ Selbst fotografiert Gögl außer dem üblichen „Knipsen ohne jeglichen Anspruch“ übrigens nicht.
Der Eintritt für die Ausstellungen von INN SITU ist frei und man kann gerne immer wieder kommen und wird auch in derselben Ausstellung stets Neues entdecken. Um sich der Kunst ganz unkompliziert zu nähern, gibt es verschiedene niederschwellige Formate wie die beliebten „Espressoführungen“, auch Schulklassen sind immer wieder gerne zu Gast. Gögl: „Fotografie hat es in der Breite vielleicht ein bisschen einfacher als andere Kunstformate, weil sie in der Regel zugänglicher ist als manche vielleicht theorielastigere Kunstausstellung, die ein gewisses Vorwissen benötigt, um sich zu orientieren. Die Fotografie kann auf diese Weise auch als Einstieg in die Kunstwelt betrachtet werden.“



Der Tiroler Maler Mathias Schmid schuf im 19. Jahrhundert nicht nur idyllische Bauernszenen, sondern übte in seinen Gemälden auch Sozial- und Kirchenkritik. Zum 100. Todestag wird in Ausstellungen und Publikationen an ihn erinnert.

Der Maler Mathias Schmid? Das war doch der, der Probleme mit der Kirche hatte. Hinter vorgehaltener Hand hätten die Alten im Dorf das erzählt, als er damals begonnen habe, sich nach eben diesem Maler zu erkundigen, erinnert sich Erwin Cimarolli lachend. Das ist nun schon einige Jahrzehnte her – und dass man sich heute im Paznaun bedeutend mehr über den Künstler zu erzählen weiß, ist nicht zuletzt auch Cimarollis Verdienst.
1999 eröffnete er das private Mathias Schmid Museum in der Paznauner Tourismushochburg Ischgl. Cimarolli war hier einmal Bürgermeister und er ist auch mit seinen achtzig Jahren noch ein leidenschaftlicher Museumsbetreiber, der Besucher höchstpersönlich durch die von ihm zusammengetragene Sammlung führt. Sie umfasst Gemälde, Zeichnungen und Skizzenbücher, aber auch Postkarten, Zeitungsartikel und andere Erinnerungsstücke rund um den Historien- und Genremaler aus dem Paznaun, der es im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum hochdekorierten Mitglied der feinen Münchner Gesellschaft gebracht hat.
Geboren wurde Mathias Schmid 1835 als Bauernsohn in der kleinen Paznauner Gemeinde See. Früh zeigte sich, dass er künstlerisches Talent besaß, also wurde er zum Fassmaler und Vergolder Gottlieb Egger in Tarrenz in die Lehre geschickt, malte dort Marterln und Bildstöcke ebenso wie Preisscheiben für Schützenfeste. Doch Schmid wollte mehr, nämlich an der Münchner Kunstakademie studieren und akademischer Maler werden. Das ist ihm auch gelungen. Zusammen mit seinen Landsleuten Franz von
Porträt Andreas Hofer. Tiroler Landesmuseen, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung

Defregger und Alois Gabl bildete er das sogenannte „Tiroler Kleeblatt“ an der Münchner Malschule von Carl Theodor Piloty und wurde weithin bekannt für seine Genreszenen aus Bauernstuben und vor Gebirgslandschaften, die den Geschmack eines wohlhabenden bürgerlichen Publikums trafen.
Eine Gefahr für das „Pfaffenthum“.
Schmid malte jedoch nicht nur idyllisch verklärte Szenen aus dem Tiroler Volks- und Bauernleben, er setzte sich motivisch auch mit den gesellschaftlichen und sozialen Umständen seiner Zeit auseinander. Und gerade mit seinen sozial- und kirchenkritischen Sittenbildern nimmt er eine besondere Stellung unter den Historienmalern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Das Spannungsverhältnis zwischen kirchlichem und staatlichem Obrigkeitsdenken und den Nöten des einfachen Volkes nahm zu, so manche Blicke, die der Maler die von ihm dargestellten Gottesmänner auf die kleinen Leute werfen lässt, sprechen Bände.
Ein bekanntes Beispiel ist das 1872 entstandene Gemälde „Die Karrenzieher“: Auf einem schmalen Gebirgspfad begegnen sich eine von Armut gezeichnete Familie, die ihr gesamtes Hab und Gut mühsam auf einem Karren bergauf zieht, und zwei geistliche Herren, die mit Verachtung
Mathias Schmid. Gegen den Strich gemalt, Tyrolia Verlag, 320 Seiten, EUR 39,–
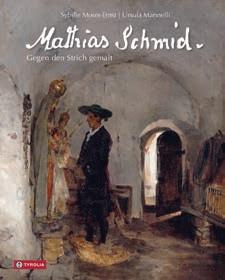
Die Kunsthistorikerinnen Sybille Moser-Ernst und Ursula Marinelli haben sich zum 100. Todestag des Tiroler Malers mit der Sozialkritik im Genre- und Historienbild beschäftigt. Viele Werke aus privaten Sammlungen werden in dem Buch erstmals öffentlich gezeigt.
auf die Vorbeiziehenden herabschauen. Schmid zeigte Dorfpfarrer als hochmütige „Sittenrichter“ (1872) und als feiste Beichtväter, vor denen das Volk zu buckeln hat („Die Beichtzettelablieferung“, 1873). Oder er ließ einen armen „Herrgottshändler“ (1874) vergeblich auf das Mitgefühl der hohen Geistlichkeit hoffen, die am reich gedeckten Wirtshaustisch sitzt.
Im Kunsthandel und in Ausstellungen kamen diese Motive durchaus gut an, der Tiroler Klerus dagegen empörte sich über Schmids „Attacken gegen das Pfaffenthum“, veröffentlichte Pamphlete gegen den Künstler und wusste so auch den Ankauf von „Der Herrgottshändler“ durch die Tiroler Landesregierung zu verhindern. Manche Motive kursierten später sogar in entschärften Reproduktionen, so kennt man etwa „Die Karrenzieher“ ebenso in einer Version ohne die zwei hochmütigen Geistlichen, an ihrer Stelle ist ein Kruzifix an der Felswand zu sehen. Schmid nahm freilich nicht nur die Doppelmoral von Kirchenmännern mit subtiler Ironie aufs Korn, sondern stellte auf seinen Gemälden auch Armut, existenzielle Not und Ausgrenzung dar. Eines seiner wichtigsten Werke – „Die Vertreibung der Zillertaler Protestanten im Jahr 1837. Der letzte Blick in die Heimat“ – entstand 1877 und befindet sich heute in der Sammlung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Der Künstler widmete sich hier einem historischen Ereignis, näm-
DER TALSCHAFT, DER SEINE HEIMAT IN EWIGEN BILDERN
lich der brutalen Vertreibung von mehr als 400 Männern, Frauen und Kindern aus dem Zillertal. Sie wurden 1837 zur Auswanderung gezwungen, weil sie sich zum Protestantismus bekannten. Schmids berühmte Darstellung zeigt eine dicht gedrängte Menschengruppe auf einem Felsplateau im Moment des endgültigen Abschieds und der Trauer, am rechten Bildrand eröffnet sich der letzte Blick ins Tal, links wacht ein Ordnungshüter über den Auszug der Zillertaler Protestanten.

Andreas Hofer mit dezenter Schnapsnase.
Mit den Tiroler Freiheitskämpfen von 1809, die im „Heiligen Land“ bis heute gern als identitätsstiftendes Ereignis
Stillvergnügt (Zwei Liebende in einer Bauernstube), um 1881/82. Tiroler Landesmuseen, Ältere kunstgeschichtliche Sammlung
gepriesen werden, hatte es Schmid dagegen nicht so sehr. Ganz im Gegensatz zu seinem „Kleeblatt“-Kollegen und Malerfreund Defregger, dessen heroisierende 1809-Historienschinken bis heute zum festen Inventar der Tiroler Malereigeschichte gehören. Ganz vorbeigekommen ist indes auch Schmid nicht an dem Thema. So hat es auch ihn zu triefendem Pathos verleitet – wenngleich aus etwas anderer Perspektive: In seiner Szene „Aus den Tiroler Freiheitskämpfen 1809“ zeigt er zwei Frauen vor einem Wegkreuz, die eine tödlich von einer Kugel getroffen, die andere zum Herrgott flehend. Auch ein Andreas-Hofer-Porträt gibt es von Mathias Schmid, im Vergleich zu anderen Darstellungen des Tiroler „Freiheitshelden“ wirkt es jedoch eher

untypisch und in groben Pinselstrichen verwaschen, man könnte fast denken, der Künstler habe dem Sandwirt aus dem Passeiertal dezent eine Schnapsnase verpasst.
Schmid war da im Übrigen längst mit allerlei Orden und Ehrenmedaillen behangen und bewohnte eine Villa an feiner Münchner Adresse in der Nymphenburger Straße. Der Dichter Peter Rosegger, der ihn dort einmal besucht hat, beschrieb den Künstler als „biedere Tirolergestalt, in dessen blondem Bart bereits graue Fäden weben. Sein munterblinzelndes Auge leuchtet in hellem Feuer, wenn er seine Lieblingswerke aufzeigt und dazu erklärend oder die Genesis erzählend geistvolle Bemerkungen macht.“
Hoffnungslos aus der Mode gekommen.
In den 1890er-Jahren gehörte Schmid zum Kreis jener Münchner Malerfürsten, die ihren Rang und Status erbittert
gegen die aufkommenden modernen Kunstströmungen verteidigten. Die beste Schaffenszeit lag da längst hinter dem einst armen Bauernsohn aus dem Paznaun, er wurde aber nicht müde, das konservative, kaufkräftige Publikum der Gründerzeit mit den gefragten Tiroler Volks- und Bergidyllen zu bedienen. Doch die „Salontirolerei“ ist im 20. Jahrhundert hoffnungslos aus der Mode gekommen. Und mit ihr Mathias Schmid, der am 23. Jänner 1923 im Alter von 87 Jahren in München gestorben ist. Viel Nachruhm war ihm nicht einmal in seiner Tiroler Heimat beschieden.
Die Wiederentdeckung des Künstlers und sohin seiner sozial- und kirchenkritischen Sittenbilder setzte in Tirol in den 1980er-Jahren ein. Das war jene Zeit, als Erwin Cimarolli zum ersten Mal durch Zufall auf den Namen Mathias Schmid gestoßen ist. „Ich war damals Verkehrsdirektor in St. Anton am Arlberg und wir haben dort ein Skiund Heimatmuseum eröffnet. Deshalb
habe ich mich in die alpine Literatur eingelesen und dabei bin ich auch auf Defregger und Schmid gestoßen, die das Leben der Tiroler dargestellt haben.“ Schmid hat Cimarolli seither nicht mehr losgelassen, er hat recherchiert, gesammelt, Kontakte zu den Nachfahren des Künstlers geknüpft und sogar die Bauernstube aus dem Elternhaus des Künstlers in sein Ischgler Museum integriert.
Dort wird selbstredend auch an den 100. Todestag des Künstlers erinnert, die aus diesem Anlass gestaltete Sonderausstellung legt den Fokus auf die Skizzenbücher und Zeichnungen von Schmid, der mit seiner Familie übrigens regelmäßig zur Sommerfrische nach Ischgl gekommen ist – lange bevor das Bergbauerndorf sich zum internationalen Wintersportort entwickelt hatte. Eine Mathias-Schmid-Ausstellung zum 100. Todestag ist im Sommer 2023 in Kooperation mit dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum auch in Schloss Landeck geplant. Ivona_Jelčić

Das Museum wurde 1999 im Chalet Cima, Stöckwald 33 in Ischgl eröffnet. Zu sehen gibt es Gemälde, Zeichnungen, Skizzenbücher, Dokumente und Erinnerungsstücke zu Mathias Schmid sowie Kulturhistorisches aus dem Paznaun. Öffnungszeiten: auf Anfrage unter +43 664 35 79 174



In the 19th century, the Tyrolean painter Mathias Schmid created idyllic peasant scenes, whilst also practising social and ecclesiastical criticism in his paintings. To mark the 100th anniversary of his death, he is being commemorated in exhibitions and publications.
In 1999, Erwin Cimarolli opened the private Mathias Schmid Museum in the Paznaun tourist stronghold of Ischgl. Cimarolli was once mayor here, and he is still a passionate museum keeper at the age of eighty, personally guiding visitors through the collection. It includes paintings, drawings and sketchbooks, as well as postcards, newspaper articles and other memorabilia relating to the history and genre painter from Paznaun, who made it as far as a most honoured member of fine Munich society at the end of the 19th century.
Mathias Schmid was born in 1835 as a farmer’s son in the small Paznaun community of See. It became apparent early on that he possessed artistic talent, so he was apprenticed to the barrel painter and gilder Gottlieb Egger in Tarrenz, and there he painted wayside shrines and altarpieces as well as prize discs for shooting festivals. But Schmid wanted more, namely to study at the Munich Art Academy and become an academic painter. He succeeded in doing so. He became widely known for his genre scenes from farmhouses and in front of mountain landscapes, which met the taste of a wealthy bourgeois audience. However, Schmid not only painted idyllically transfigured scenes from Tyrolean folk and peasant life, he also dealt motivically with the social and societal circumstances of his time. And it is precisely with these socially and ecclesiastically critical moral images that he occupies a special position among the history painters of the second half of the 19th century. His motifs were well received by the art trade and in exhibitions, but less so by the Tyrolean clergy.
In the 1890s, Schmid finally belonged to the circle of those Munich painter princes who fiercely defended their rank and status against the emerging modern art movements. But the “Salon Tyrolean” style went hopelessly out of fashion in the 20th century. And with it Mathias Schmid, who died in Munich on January 23, 1923, at the age of 87. He did not enjoy much posthumous fame even in his Tyrolean homeland. The rediscovery of the artist began in Tyrol in the 1980s, which was also the time when Erwin Cimarolli first came across the name Mathias Schmid by chance. Schmid has not let go of Cimarolli since then; he has researched, collected, made contact with the artist’s descendants, and even integrated the farmhouse parlour from the artist’s childhood home into his Ischgl museum.
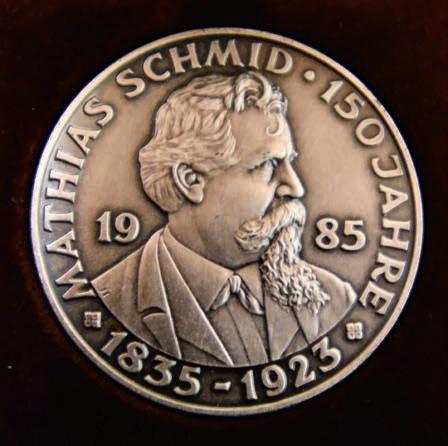
Höchste Kompetenz, professionelle Beratung und perfekte Druck-Qualität – alles aus einer Hand und gleich nebenan.

Als Tiroler Traditionsbetrieb mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Ihr verlässlicher Partner für alle Belange rund um Druck und Versand Ihrer brillanten Print-Produkte.







Testen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.

Stefanie Thurner, Felix Kupfer und Andreas Ablinger haben sich mit ihren Kongresslocations – dem Europahaus Mayrhofen, dem Gurgl Carat und der SALZRAUM.Hall livelocations – zusammengetan, um mehr zu erreichen und mit ihren Häusern als funkelnde Tagungskristalle weit über den Tiroler Raum hinaus zu strahlen.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass drei Tagungsorte, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, gemeinsam den Weg in die Öffentlichkeit suchen. Genau das haben Europahaus-Mayrhofen-Geschäftsführerin Stefanie Thurner und deren Kollegen Felix Kupfer, Geschäftsführer des Gurgl Carat, sowie Andreas Ablinger, Prokurist der SALZRAUM. Hall livelocations, letztes Jahr gemacht. Seither bilden die Kollegen, die lange schon befreundet sind, als dieDrei.tirol ein Trio, das regional und überregional Lust auf Tagungs- und Kongressaktivitäten in Tirol machen will.
Der Schlüssel dazu ist ein glaubwürdiges Angebot auf der Höhe der Zeit, gepaart mit langjähriger Expertise, akribischer Arbeit und Leidenschaft und nicht zuletzt dem Anspruch, als Gastgeber eine bessere Tagungs- bzw. Kongresserfahrung bieten zu können als Mitbewerber. Das Trio ist im ständigen Austausch, um voneinander lernen zu können und gemeinsam Dinge voranzubringen. Was die drei aneinander schätzen, was ihre Kooperation und die Tagungslocations ausmacht, haben sie im Rahmen der folgenden Kurzinterviews verraten.
„ALS TRIO WIRD MAN BESSER WAHRGENOMMEN ALS ALLEIN.“Stefanie Thurner
Welche persönlichen und fachlichen Qualitäten schätzt du an deiner Kollegin Stefanie Thurner besonders? Felix Kupfer: Stefanie ist die Initiatorin unserer Kooperation, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Sie ist jemand, der an den Themen dranbleibt und Dinge sehr konsequent verfolgt. Stefanie ist eine sehr verbindliche und verbindende Person. Das zählt in Verbindung mit ihrer Beharrlichkeit zu ihren großen Stärken, weil sie dadurch erst DIE DREI ermöglicht hat. In unserer Zusammenarbeit ist sie der ausgleichende Faktor, der immer versucht, einen Konsens zu finden. Stefanie hat eine klare Meinung, ist aber immer bemüht, dass wir am Ende eines Diskussionsprozesses mit einem klaren Ergebnis dastehen. Sie ist die Person in unserem Trio, die am strukturiertesten arbeitet und organisiert ist. Damit ist sie auch die Person, die Andreas und mich am häufigsten an anstehende Aufgaben und deren Verteilung erinnert. Sie ist damit in der Rolle der Schriftführerin, die oft nach außen als Kommunikatorin auftritt. Im Europahaus nehme ich sie als sehr geschätzte Chefin wahr, weil sie auf die Menschen schaut, die mit ihr arbeiten. Die Mitarbeiter liegen ihr sehr am Herzen. Es ist als Chefin absolut ihr Verdienst, dass sie ein so tolles Team um sich geschart hat, mit dem sie Höchstleistungen erzielen kann. Nicht zuletzt ist Stefanie auch eine fleißige Arbeiterin, die sich nicht zu schade ist, überall dort selbst Hand anzulegen, wo es gerade notwendig ist. Damit ist sie auch ein Vorbild für ihre Mitarbeiter.
Was macht das Europahaus Mayrhofen aus?
Andreas Ablinger: Ich war schön öfters im Zuge von Veranstaltungen vor Ort und muss sagen, dass mir die Kombination aus Zillertaler Herzlichkeit und Moderne – das Haus hat die Form eines Bergkristalls – sehr gut gefällt. Das Haus erfüllt alle Anforderungen, die an ein modernes Kongresszentrum gestellt werden, es ist sehr
zweckmäßig und flexibel und für Kongresse wie Vorträge sehr gut geeignet. Die Menschen sind es, die das Europahaus Mayrhofen zu etwas Besonderem machen. Wann immer ich dort war, bin ich dieser besonderen Herzlichkeit begegnet. Das füllt ein Haus mit jenem Charme, den es braucht, um sich von der Masse abzuheben. Man fühlt sich als Gast einfach rundum wohl. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Stefanie Thurner, die – obwohl sie keine gebürtige Zillertalerin ist – dort angekommen zu sein scheint. Sie macht einen sehr guten Job und das würdigen die Leute im Tal. Mit dem Waldfestplatz am Ortsrand hat das Europahaus zudem eine sehr lässige Sidelocation. Zur zeitgemäßen Ausstattung kommt in Mayrhofen eine menschliche Qualität dazu, die überaus einnehmend ist. Das ergibt in Summe ein sehr gutes Paket.
Wie hat sich eure Zusammenarbeit bisher bewährt? Stefanie Thurner: Durch unsere Kooperation hat sich die zwischenmenschliche Beziehung zwischen uns sehr intensiviert, was ich persönlich als großen Mehrwert empfinde. Wir sind alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Deshalb bewährt sich ein solcher Zusammenschluss auch dadurch, dass ein ständiger Erfahrungsaustausch stattfindet. Ich kann von den beiden Männern sehr viel lernen und sie mit Sicherheit auch das eine oder andere von mir. Wir haben gemeinsam schon einige Veranstaltungen erfolgreich umgesetzt und sind zusammen auf Kundenanlässen aufgetreten. Das schont für uns alle Ressourcen, sowohl in personeller als auch finanzieller Hinsicht. Wir haben mit unserer Kooperation sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hat sich bereits in konkreten Buchungen niedergeschlagen, ist aber sicher noch ausbaufähig. Durch unsere Kooperation haben unsere gemeinsame Reichweite und Werbewirksamkeit zugenommen. Drei Häuser, drei Charaktere, das ist eine sehr gute Geschichte, in der noch so manches Kapitel folgen wird.
„DURCH UNSERE KOOPERATION HAT SICH UNSERE ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNG INTENSIVIERT, WAS ICH ALS GROSSEN MEHRWERT EMPFINDE.“


Welche persönlichen und fachlichen Qualitäten schätzt du an deinem Kollegen Andreas Ablinger besonders? Stefanie Thurner: Ich kenne Andreas schon seit mehr als zehn Jahren. Für mich war er immer so etwas wie der kreative Optimist, der in allem immer mehr die positiven Seiten sieht. Andreas konzentriert sich nicht auf die Probleme, sondern immer auf die Lösungen. Er hat einen sehr smarten Zugang bei unseren Themen und ist ein starker Netzwerker. Es gibt in unserer Branche kaum jemanden, der ihn nicht kennt. Als alter Haudegen kennt er die Branche, die Kunden und deren Bedürfnisse wie die eigene Westentasche. Ich schätze ihn für seinen großen Erfahrungsschatz und seine Art, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Andreas ist immer kooperativ und nie wertend. Er lässt einen als Mensch so sein, wie er ist. Diese Werte bringt er auch in unsere Kooperation mit ein. Zugleich ist Andreas aber auch ein kritischer Beobachter, der dabei nie seine Objektivität verliert. Er hilft unserem Trio mit seinem kreativen Input, seinem strategischen Denken und seinem großen Netzwerk.
Was macht den SALZRAUM.Hall aus? Felix Kupfer: Den SALZRAUM.Hall zeichnet seine große Vielseitigkeit aus, mit seinen drei Locations, die alle anders positioniert sind und einen anderen Fokus haben. Mit dem Salzlager gibt es eine lässige Eventlocation für große Veranstaltungen, Partys, Messen und dergleichen. Man kann dort spektakulärerweise mit dem LKW hineinfahren und Großevents veranstalten. Mit der Burg Hasegg gibt es zudem ein Seminarzentrum mit einem sehr historischen Touch in unmittel-
barer Altstadtnähe, wo man sich sehr leicht für Seminare und Tagungen treffen kann. Die historischen Räumlichkeiten sind wunderschön und mit dem Burginnenhof gibt es auch sehr schöne Außenflächen, die bespielt werden können. Mit dem Kurhaus gibt es nicht zuletzt einen Ort, der für kulturelle Events prädestiniert ist. Das macht den SALZRAUM.Hall sicher zur vielseitigsten Location in unserer Kooperation. Durch die zentrale Lage in Hall nahe Innsbruck ist der SALZRAUM.Hall überdies leicht erreichbar. Die große Erfahrung in der Ausrichtung sehr unterschiedlicher Events hat im Team eine hohe Kompetenz geschaffen, das sich jeder Anforderung sehr gut anpassen kann und weiß, was es für eine gelungene Veranstaltung braucht.
Was ist das Wertvollste an eurer Kooperation? Andreas Ablinger: Die Antwort darauf muss man in zwei Dimensionen denken. Zum einen wäre da der konkrete Output, den wir erreichen wollen. In Sachen Werbewert und öffentlicher Wahrnehmung sind unsere diesbezüglichen Ziele aus meiner Sicht übertroffen worden. Die Idee trägt also in wirtschaftlicher Hinsicht bereits Früchte. Zum anderen haben wir unser sehr gutes kollegiales Verhältnis und die daraus resultierende Freundschaft, die seit längerem besteht, wirklich gefestigt. Es macht sehr viel Spaß, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Das würde ich gar nicht nur als Job betrachten wollen, sondern unser Austausch ist mit sehr viel Freude und Spaß verbunden. Wir entwickeln uns in beiden Dimensionen in eine erfreuliche Richtung.
„IN
Welche persönlichen und fachlichen Qualitäten schätzt du an deinem Kollegen Felix Kupfer besonders? Andreas Ablinger: Ich habe Felix schon vor längerer Zeit als noch sehr jungen Kollegen kennengelernt. Schon damals ist mir aufgefallen, dass Felix unglaublich fleißig ist und bei diversen Veranstaltungen immer als Letzter noch am Kunden ist, während andere bereits bei einem Gläschen zusammengesessen sind. Es hat mich immer beeindruckt, wie viel Herzblut in seinem Tun steckt. Seine Überzeugung und die Liebe zu dem, was er tut, schätze ich sehr an ihm. Im Laufe der Jahre hat sich zwischen uns eine Freundschaft entwickelt und ich schätze nicht nur seine hohen fachlichen Qualitäten, sondern auch seine klare und konstruktive Art. Er kann auf der Metaebene die Dinge sehr deutlich und unemotional betrachten und hat ein sehr analytisches Denken. Das ist in unserem Dreiergespann sehr wertvoll. Felix spricht die Dinge ganz klar an und aus, das hat für mich eine sehr hohe Qualität. Außerdem ist er immer zuverlässig und engagiert. Sein Blick fürs große Ganze ist sehr wertvoll. Felix hat auch sehr viel Humor – so wird auch immer viel miteinander gelacht. Unsere Dreierkonstellation zeichnet sich dadurch aus, dass wir zu jeder Zeit wertschätzend miteinander umgehen.
Was macht das Gurgl Carat aus? Stefanie Thurner: Das Gurgl Carat ist aus meiner Sicht ein echtes Juwel in den Alpen. Nicht zu groß, sondern fein und wandelbar. Qualitativ wird das Haus sehr hochwertig geführt und stellt höchste Ansprüche an die eigenen Events. Im Moment ist das Gurgl
Carat mit Sicherheit das technisch am besten ausgestattete Haus. In Gurgl ist alles rund ums Kongresszentrum gelegen und sehr nah. Hochklassige Hotels, gute Restaurants und die modernen Bergbahnen liegen in einem kleinen Umkreis. Das macht es sehr einfach und bequem, sich vor Ort zu bewegen. Damit gibt es direkt vor der Türe einen großen Naturspielplatz, um den Teilnehmern ein attraktives Rahmenprogramm bieten zu können. Eine Kongresslocation kann man nie isoliert von ihrem Standort betrachten. Mit Felix Kupfer hat das Gurgl Carat zudem einen sehr empathischen und professionellen Geschäftsführer. Das strahlt auf das Haus, den Ort und die Marke aus.
Wie wollt ihr euch in Zukunft gemeinsam weiterentwickeln? Felix Kupfer: Unsere Kooperation ist momentan sehr auf Tirol fokussiert. Das Funktionieren der Zusammenarbeit hat uns gezeigt, dass wir das noch ausbauen können. Wir überlegen derzeit, unsere Vertriebsaktivitäten stärker zu bündeln und in unseren Zielmärkten gemeinsam aufzutreten. Als Trio wird man besser wahrgenommen als allein und hat andere budgetäre Möglichkeiten. Vor allem im süddeutschen und ostösterreichischen Raum wollen wir zukünftig gemeinsam unterwegs sein und selbst das eine oder andere Kundenevent veranstalten, um gemeinschaftlich Kunden für Tirol zu begeistern. Dann schauen wir, in welcher Location der Kunde je nach Anforderung am besten aufgehoben ist. Ich glaube, unsere Kooperation wird es noch lange geben, weil sie gut ist, uns voranbringt und Spaß macht.
„ICH GLAUBE, UNSERE KOOPERATION WIRD ES NOCH LANGE GEBEN, WEIL SIE GUT IST, UNS VORANBRINGT UND SPASS MACHT.“

Tagen mit Weitblick und Zillertaler Herzblut: Im Europahaus sind Business- und Bergwelt nur durch eine Glasscheibe getrennt – ideale Kombination von Tagung, Natur und aktiven Erlebnissen. Max. Kapazitäten im grössten Raum: 790 Anzahl Breakouts: bis zu 15 Raumhöhe höchster Raum: 7 m Technik: 3 HD-Beamer, Tonanlage, Stimmungslicht, Live-Kamera Hoteldichte Walking-Distance: 3.000 Gästebetten Catering: exklusiver Caterer seit 2018
Österreichs modernstes Kongresszentrum mit Event-Technik der Extraklasse für spektakuläre Tagungen und Veranstaltungen. Max. Kapazitäten im grössten Raum: 520 Anzahl Breakouts: bis zu 27 Raumhöhe höchster Raum: 6 m Technik: 100 m² Front-Leinwand mit drei Full-HD-Laserbeamern, Soundsystem von L-Acoustics Hoteldichte Walking-Distance: 5.000 Gästebetten Catering: freies Catering, regionaler Anbieter

Raum für Geschichte(n): Das gelungene Verweben von gewachsener Tradition mit modernstem Eventdesign und Innovation ist im SALZRAUM.Hall bereits seit Jahren Garant für erfolgreiche Veranstaltungen. Max. Kapazitäten im grössten Raum: 800 Anzahl Breakouts: bis zu 11 Raumhöhe höchster Raum: 9 m Technik: wird an die Veranstaltung angepasst und individuell geplant Hoteldichte Walking-Distance: 600 Gästebetten Catering: freies Catering


„Wer in einem der drei Konferenzzentren veranstaltet, erhält jeweils Gutscheine für die Nutzung der Mitbringsel der beiden anderen Locations. Wir wollen erreichen, dass die Gäste wechselseitig unsere Häuser kennenlernen, und ihnen dabei auch die Schönheiten und Besonderheiten der jeweiligen Region näherbringen“, so Stefanie Thurner, Felix Kupfer und Andreas Ablinger.
Lehre auf höchstem Niveau, international anerkannte Professoren, Gastprofessoren und Lehrende und modernste Infrastruktur bieten ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium.


Bachelor-Studien Psychologie, Mechatronik, Elektrotechnik, Pflegewissenschaft, Wirtschaft, Sport- und Gesundheitstourismus.
Master-Studien Psychologie, Mechatronik, Gesundheitswissenschaften, Public Health, Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Pflege- und Gesundheitspädagogik, Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung, Medizinische Informatik. Universitätslehrgänge Dyskalkulie-Therapeut/in, Legasthenie-Therapeut/in, Führungsaufgaben/ Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege, Konfliktmanagement und Mediation, Health Information Management.

Doktoratsstudien Gesundheitsinformationssysteme, Psychologie, Health Technology Assessment, Management und Ökonomie im Gesundheitswesen, Public Health, Pflegewissenschaft, Technische Wissenschaften, Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften.

Das Hören ist der wohl am meisten unterschätzte unserer fünf Sinne – und dabei so wichtig. Wie Hören funktioniert, wie es sich anfühlt, wenn es das nicht mehr tut, und mit all den bunten Facetten zum Thema beschäftigt sich das Audioversum in Innsbruck. Als interaktives Museum rund ums Hören ist es in seiner Form einzigartig in Europa. Die Kombination aus Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen lässt auch uns immer wieder gerne dort vorbeischauen. Und -hören.
ören, sehen, riechen, schmecken, fühlen – alle fünf haben wörtlich wie übertragen ihren Sinn. Die Welt sinnlich zu begreifen, passiert dabei selten bewusst. Die Wichtigkeit, Funktion und den Nutzen unserer Sinne erkennen wir meist erst dann, wenn einer davon nicht mehr richtig arbeitet. Während jedoch Brillen etwa nicht nur praktisch, sondern zum modischen Accessoire geworden sind, sind Hörgeräte immer noch mit einer gewissen Scham behaftet. Dabei bedeutet nichts zu hören nicht nur einen deutlichen Verlust von Lebensqualität, es kann auch gefährlich werden –im Straßenverkehr zum Beispiel, wenn man Fahrzeuge schlichtweg überhört. Wenn man sich bewusst macht, von wie vielen Geräuschen wir täglich umgeben sind und wie viele davon wir sogar selbst produzieren, zeigt sich die breite Bedeutsamkeit des Hörens.
H
Dass sich ein Museum fast ausschließlich mit der Thematik des Hörens auseinandersetzt, ist außergewöhnlich. Das Audioversum tut das. Thematisch ist das übrigens wenig verwunderlich, ist doch der Initiator des Science Centers das Innsbrucker Unternehmen MED-EL und als solches weltweit führend bei
innovativen, implantierbaren Hörlösungen. Bessere Auskenner gibt es also kaum. Hat sich die innovative Hörwelt der Thematik anfangs nur medizinisch-wissenschaftlich genähert, ist mit Julia Sparber-Ablinger als neuem Head of Audioversum vor rund drei Jahren eine kunstaffine Geschäftsführerin gekommen, die das Konzept unter anderem um soziale sowie kreativ-gestalterische Komponenten erweitert und mehr in die Breite geöffnet hat. Das hat dem Audioversum sichtlich gutgetan. After-Work-Führungen laden zum Austausch ein, auch Schulklassen sind herzlich willkommen und nehmen das Angebot gerne an. Es gibt Erzähltheater und Führungen für ältere Menschen sowie eigene Podcast-Serien. Ausgebildete Guides leiten vor Ort bei Bedarf an und geben Hilfestellungen. Moderne Kunst fügt Medizin, Technik und Bildung eine neue, emotionale Dimension hinzu. So sind etwa in der Sound-Gallery Audioinstallationen zu hören, die von bildender Kunst umrahmt werden – unter anderem von Bildern, die von gehörlosen MED-EL-Nutzern gestaltet wurden. Aktuell sind Wortbilder des Kitzbüheler Künstlers Thomas Laubenberger-Pletzer zu sehen, die Fragmente eines Gedichtes der Innsbrucker Schriftstellerin Barbara
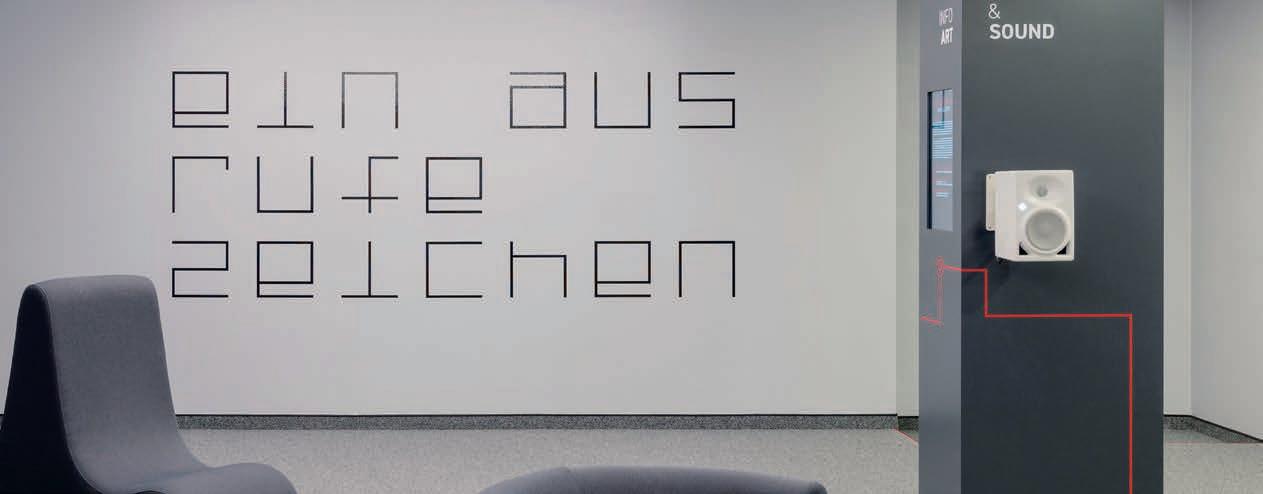
Hundegger abbilden, das in seiner gesamten Länge auch als Soundinstallation zu hören ist. „Hör-Weiten“, so der Titel des Gedichtzyklus in fünf Strophen, kleidet das Hören in Worte.

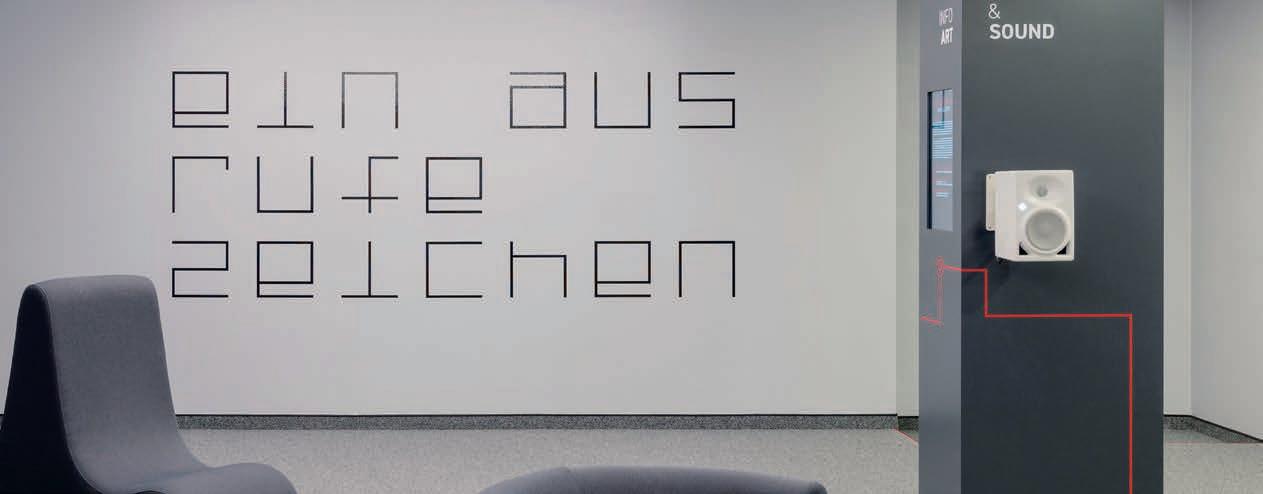
Hören mit allen Sinnen.
In der Hauptausstellung des Akustikmuseums – erreichbar über die Klangtreppe – geben interaktive Stationen außergewöhnliche Einblicke in das menschliche Ohr und dessen Funktionen, in Lärm und Stille. Geräusche werden zu Objekten, räumliches Hören und mehr lässt sich spielerisch erforschen, ein virtuelles menschliches Ohr veranschaulicht Spannendes über Aufbau und Anatomie, eine Klangreise nimmt mit auf eine akustische Reise um die Welt. Das Schöne: Das Audioversum ist ein Museum, in dem Anfassen nicht nur nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht ist. Auch Schreien ist explizit erlaubt. Mitmachstationen machen das Hören mit allen Sinnen erlebbar, Digitales verbindet sich mit analogen Elementen, VR-Brillen nehmen mit in die Virtualität.
Dazu gibt es jährlich wechselnde Sonderausstellungen, die sich unterschiedlichsten Themen auf akustisch einzigartige Weise nähern und sich vielschichtig mit Kunst und Kultur verweben. Sind Museen per se historisch und reproduktiv, so geht man im Audioversum auch hier bewusst einen anderen Weg: „Die interaktive Beschäftigung mit menschlichen Sinnen und gesellschaftlichen Phänomenen steht bei uns im Mittelpunkt. Bei uns wird zeitgeistiges und historisches Storytelling mit modernen Medien verknüpft. Für die Sonderausstellungen setzen wir auf Kooperationen mit anderen Museen und Science Centern, integrieren eigene Ideen und passen sie an unsere Räumlichkeiten an“, erklärt Julia Sparber-Ablinger. Die Verbindung zur Kunst gibt dem Audioversum seinen musealen Charakter, lässt den Besucher aber vom reinen Beobachter zum aktiven Mitgestalter werden.

Eine der nächsten Sonderausstellungen wird sich dem breiten Feld der Sicherheit widmen – auf abstrakte und ganz konkrete Weise. Welche Rolle spielt das Hören für unser subjektives Sicherheitsgefühl und welche Faktoren beeinflussen unser Sicherheitsempfinden? Im Rahmen der zweiten Schau wird die Stimme in den Fokus gerückt. Dazu soll unter anderem ein kleines Tonstudio aufgebaut und Wissen in Sachen Stimmbildung vermittelt werden. Synchronsprecher kommen dabei ebenso vor wie eine historische Sprechmaschine. Es bleibt also spannend!

Im hauseigenen Museumsshop Hör-Bar gibt es außerdem Bücher, Spielsachen sowie Geschenke aller Art für ein Stück Audioversum zum Mitnehmen. Viele Produkte sind dabei auch hörbar und mit einem QRCode versehen, mit dessen Hilfe Sie hören können, was es über Notizbücher, Postkarten und Taschen zu erzählen gibt. Das Audioversum gehört definitiv gesehen!
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck +43(0)5 7788 99, office@audioversum.at www.audioversum.at

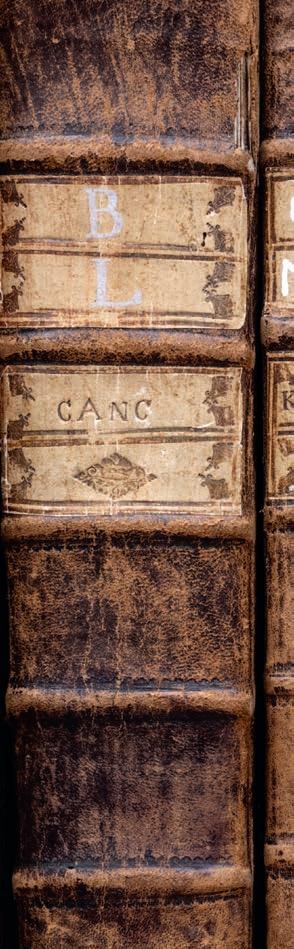
Seit 1273 trotzt es allen Weltenstürmen und Glaubenswirren. Stift Stams ist eine Art Geburtsstatt des Landes Tirol, hat Brände überstanden, Plünderungen, gierige Fürsten, Aufklärer und alle wilden Kriege. Es wurde den toten Tiroler Landesfürsten gewidmet, doch immer wieder siegte im Stift Stams das Leben. Dieses Leben darf so würdevoll wie andächtig sprudeln, wenn 2023 das 750. Jahr seines Bestehens gefeiert wird.
 Fotos: Isabelle Bacher
Fotos: Isabelle Bacher
Ja, Stift Stams steht trotz aller Turbulenzen, die es in der langen Zeit seines Bestehens gegeben hat, schön da und ist immer ein Blickfang im Tiroler Oberland geblieben“, sagt German Erd. Wenn der Abt von Stift Stams über all diese Turbulenzen spricht, jongliert er geschickt mit Jahreszahlen und noblen Namen, erweckt dabei wilde und glamouröse Zeiten zum Leben, Musik wird plötzlich hörbar und die Geschichte greifbar.
Seine eigene Geschichte ist eng mit der des Stiftes verwoben, dessen bauliche Pracht seit Jahrhunderten die Blicke der Reisenden fesselt. Vom Fernpass über das Mieminger Plateau kommend oder auf der Inntalautobahn passierend, wirken die Zwiebeltürme des Klosters wie Magneten. Seit knapp 35 Jahren werden sie bizarr ergänzt durch die Skisprungschanzen im Hintergrund. Doch auch die Schanzen sind längst zu Merkmalen des diffizilen Komplexes geworden, zu dem die Zisterzienserabtei genauso zählt wie der wunderbare Garten, der Klosterladen, die Orangerie, das Skigymnasium, die Pädagogische Hochschule, das Kolleg für Sozialpädagogik oder das Gymnasium Meinhardinum. Stift Stams ist ein quirliger Bildungsstandort. An die 1.500 Menschen tummeln sich außerhalb der Ferien täglich am historischen Gelände und schreiben die Geschichte fort. Abt German tut das auch.
Ab 1963 ging er hier zur Schule, trat nach der Matura ins Kloster ein, um dann während des Studiums zwischen Innsbruck, Salzburg und Oxford zu

• Das Museum kann von Juni bis September einzeln oder im Rahmen der Stiftsführung besucht werden. Führungen durch das Stift sind ganzjährig möglich. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der Homepage unter www. stiftstams.at, über die man sich auch anmelden kann.
• Die wohl bedeutendste Urkunde ist die Gründungsurkunde von Meinhard II. aus dem Jahr 1275. Auch diese Urkunde befindet sich im Stift Stams und belegt den offiziellen Gründungsakt durch den damaligen Landesfürsten.
• Gottesdienste finden jeden Sonntag statt, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche, um 10.30 Uhr in der Basilika.
• Der barocke Bernardisaal ist eines der Prunkstücke von Stift Stams und immer wieder Ort von Konzertaufführungen.
• Die Heilig-Blut-Kapelle mit ihrem einzigarten Hochaltar samt Lebensbaum stammt aus den Jahren 1715 bis 1717.
mäandern und immer wieder zurückzukehren – nach Stams, ins Stift. Kirchenchöre, Fahnenabordnungen, weltliche und kirchliche Würdenträger, eine große Festvolkmenge und Musikkapellen hatten seine letzte, seine richtig große Rückkehr begleitet. 2003 war das, als German Erd zum 44. Abt des Stiftes Stams gewählt wurde. „Nach Vils, meinem Geburtsort, wurde Stams meine zweite Heimat, meine Lebensmitte beziehungsweise meine Lebenswelt“, sagt er.
Es gibt viele Daten, die das Jahr 2023 zu einem Festjahr machen. Neben dem 20-Jahr-Jubiläum als Abt wird German Erd im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag und das Stift Stams das 750. Jahr seines Bestehens feiern. Dass es noch in der Urform existiert, ist so außergewöhnlich wie seine Geschichte und so eindrucksvoll wie seine Pracht. „Im Auf und Ab der Zeit gab es viele Krisen, aber es ist immer wieder zu neuem Leben erstanden“, weiß Abt German. Und wie das eben so ist mit dem Leben, ist es untrennbar mit dem Tod verbunden. Auch in Stift Stams, ja vor allem in Stift Stams.
Grablege der Tiroler Fürsten.
„Das Stift erinnert auch an den Tod von Konradin, dem letzten Staufer“, dreht Abt German das Rad der Zeit zurück, weit zurück ins Jahr 1268, als der letzte männliche Staufer auf dem Marktplatz in Neapel seinen Kopf verlor. Schön soll er gewesen sein und außergewöhnlich klug, doch hatte sich der Jüngling aus dem großen deutschen Adelsgeschlecht mit dieser letzten Schlacht ziemlich
„ES
In den schlichten, aber beeindruckendehrwürdigen Räumen der Stiftsbibliothek und des Archivs, deren Einrichtung aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt, werden rund 60.000 Buchbände, 379 Inkunabeln und 61 Handschriften aufbewahrt.
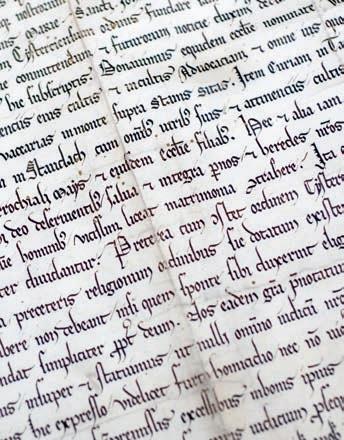



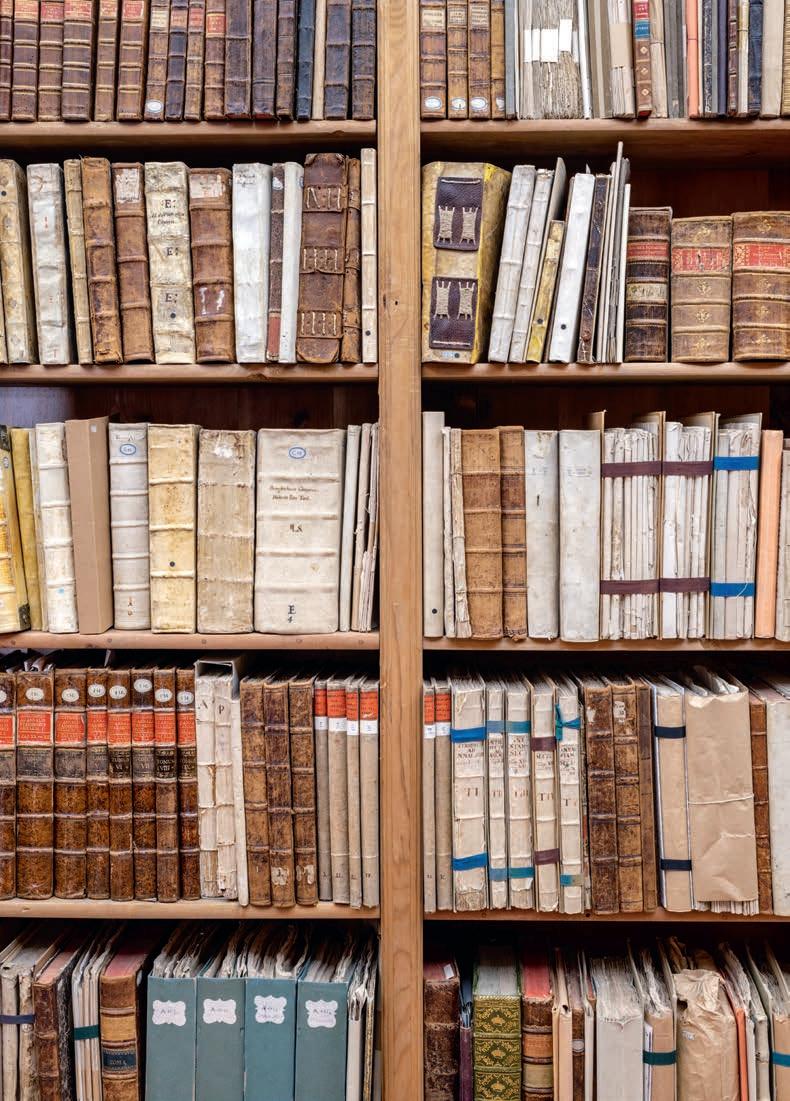
Es gibt viele Daten, die das Jahr 2023 zu einem Festjahr machen. Neben dem 20-JahrJubiläum als Abt wird German Erd im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag und das Stift Stams das 750. Jahr seines Bestehens feiern.



Ikonen sind Kultus- und Heiligenbilder und gehören ganz wesentlich zum Glauben der Ostchristen. Die Ikonenausstellung in Stift Stams ist keine rein museale Ausstellung, sondern bietet auch Gelegenheit zum Innehalten.

übernommen – und gegen eine Übermacht verloren. Es war die Zeit, als das römisch-deutsche Kaiserreich ausgiebig gegen den Papst und seine Verbündeten kämpfte. In diesen blutigen Scharmützeln ging es stets um Macht und Einfluss, diese so klassischen wie immer unheilvollen Triebfedern der Kriege. Nach der Enthauptung Konradins rückte für seine Mutter allerdings dessen Seelenheil in den Mittelpunkt.
Elisabeth von Bayern war im 13. Jahrhundert eine große Dame auf dem teils verwirrenden Schachbrett der europäischen Macht gewesen. Durch ihre Heirat mit Konrad IV. war sie römisch-deutsche Königin und auch Königin von Sizilien und Jerusalem geworden. Nach dem Tod des ersten Gatten heiratete sie Meinhard II. und wurde Gräfin von Tirol und Görz. „Elisabeth kannte die Gegend. Die Burg St. Petersberg bei Silz war eine staufische Sommerfrische gewesen, und so hat sie die Wallfahrt in Stams kennengelernt“, erzählt Abt German. Die Wallfahrt war Johannes dem Täufer gewidmet, der ebenso geköpft worden war wie Konradin. „Darum wollte Elisabeth eine Gebets- und Erinnerungsstätte für Konradin in Stams. Meinhard II. war das recht, weil er sowieso eine gescheite Grablege für seine Fürstenfamilie wollte“, berichtet Abt German. Auf Schloss Tirol bei Meran, wo die Tiroler Landesfürsten bislang ihre letzte Ruhe gefunden hatten, war es ziemlich eng geworden und das Erscheinungsbild war Meinhard II. auch nicht repräsentativ genug. So fügte es sich, dass die landesfürstlichen Wünsche des Ehepaars eine gemeinsame Idee be-
flügelten. Ein Kloster zu stiften, das dem Gedenken an den verlorenen Sohn genauso gerecht werden sollte wie den Gebeinen der verblichenen Mitglieder der hochherrschaftlichen Familie.
Jagd nach dem Unvergänglichen.
1273 fand der Gründungskonvent statt und nach knapp elfjähriger Bauzeit wurde das Stift zum Heim für die Zisterzienser, deren Orden sich auf reformierte Traditionen der Benediktiner stützt. Ein schöner, rund 1.500 Jahre alter Satz des heiligen Benedikt geht in etwa so: „Kümmert euch nicht um die vergänglichen Dinge, das wird euch schon gegeben. Jagt den unvergänglichen Dingen nach.“ In diesem Satz steckt die leicht zwiegespaltene Gratwanderung, die Stift Stams über die Jahrhunderte meisterte. Denn allzu oft war das Stift mit allzu vergänglichen Dingen konfrontiert, welche bei der Jagd nach dem Unvergänglichen durchaus stören können. „Das Zentrale ist für mich das religiöse Leben, die Vertiefung und die Weitergabe des Glaubens. Doch wenn ich die äußere Substanz nicht habe, kann auch innen nichts wachsen. Darum müssen wir schauen, das alles zu erhalten“, sagt Abt German.
Viel Energie musste er in den vergangenen Jahren in den Erhalt des Stiftes und seiner Schätze stecken. Holzwürmer, Feuchtigkeit, die nagenden Zähne der Zeit und Verfallserscheinungen machen auch vor den schönsten heiligen Hallen nicht halt. Mit viel Finesse ist es gelungen, die geschichtsträchtigen Gebäude, Räume und Kunstwerke von Stift Stams zu erhalten – und damit viel Geschichte des Landes selbst.
Die Stifter des Stiftes sind selbstverständlich allgegenwärtig. Vor allem Meinhard II., der das „Land an der Etsch und im Gebirge“ formte und in einer außergewöhnlich langen Regierungszeit von 36 Jahren die hohe Kunst der machtpolitischen Skrupellosigkeit genauso zelebrierte wie das geschickte Taktieren für seine Vision. Erhaben und stolz repräsentiert die Reiterstatue Meinhards II. auf dem Giebel der Westfassade des Stiftes sein dynamisches Leben. Dass auch seine lebensgroße, vergoldete Statue in der Fürstengruft beziehungsweise dem „Österreichischen Grab“ beeindruckt, versteht sich fast von selbst, war die repräsentative
Gruft doch seine Triebfeder für den Bau des Stiftes.
Dort, in der Gruft der rundum monumentalen Klosterkirche, tummeln sich die goldenen Abbilder zahlreicher Mitglieder der Fürstenfamilie und erzählen auf ihre Weise die glanzvollen Geschichten des Landes. Friedrich IV. „mit der leeren Tasche“ genauso wie sein Sohn Sigismund der Münzreiche, dessen Gemahlin Eleonore von Schottland oder Bianca Maria Sforza, die zweite Gemahlin Kaiser Maximilians I. Immer wieder führten die Fäden der Weltgeschichte zum Stift. Etwa, als Maximilian I. im Jahr 1497 Stams zum Schauplatz von Friedensverhandlungen mit der Delegation des türkischen Sultans Bayezid II. wählte. Das Osmanische Reich, das 1453 erst Konstantinopel erobert und weiterhin ziemlichen Kriegshunger gezeigt hatte, war den europäischen Machthabern ein Dorn im Auge, ein Waffenstillstand war das Ziel. Der in Stams ausgehandelte Vertrag hielt in verfeinerter Form sogar bis nach dem Tod des Kaisers, doch eindrücklicher als die Pause für die Gemetzel am Balkan müssen für die Tirolerinnen und Tiroler die osmanischen Gäste gewesen sein, die den ganzen Sommer im Land verbrachten und an Jagden, Konzerten und sonstigen höfischen Ereignissen teilnahmen.
Von verrückten Kulturschocks müssen die Oberländer auch geschüttelt worden sein, wenn die Landesfürsten ihre adeligen Sausen in Stams abhielten. Von Erzherzog Sigmund ist bekannt, dass eine seiner Jagdgesell-
schaften im Jahr 1478 innerhalb von vier Tagen rund 600 Liter Wein, 1.220 Brote, 67 Stück Federvieh, 300 Eier, 50 Kilogramm Rindfleisch und noch viel mehr verbrauchte.
Ein Gefährte der Landesgeschichte.
„Stift Stams ist immer auch ein Zentrum der Kultur und Kunst gewesen und geblieben. Wir haben beispielsweise viele Dürer-Stiche, die durch Maximilian I. hergekommen sein dürften“, macht Abt German auf die Kunstschätze aufmerksam, die der zisterziensischen Bescheidenheit zwar widersprechen, das Stift aber zu einer bedeutenden musealen Stätte machen. „Wir haben die größte Musiksammlung im Land“, stellt Abt German zudem fest. Die einzigartigen Zeugnisse, die in den rund 3.000 Musikhandschriften stecken, fügen sich klingend in das schillernde Sammelsurium an Artefakten, Heiligenbildern, Fresken, Stichen, Reliquien, Statuen oder Urkunden, die in den historischen Gemäuern bewahrt werden.
Jeder Gebäudeteil, jede Kapelle, jede Nische des Stifts hat derart viele Geschichten zu erzählen, dass es fast unmöglich scheint, sie in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Am ehesten schafft das wohl einer, der hier lebt und alles hier liebt. „Die Blutskapelle ist sehr beeindruckend und die Stiftskirche sowieso – wie da beispielsweise der Baum des Christentums herauswächst und über sich hinauswächst“, gerät Abt German beim Blick auf den einzigen noch erhal-
tenen Lebensbaum-Altar ins Schwärmen und sagt: „Es gibt viele schöne Plätze, wo man gerne verweilt und seine Gedanken hat.“
Der Obstgarten eignet sich hervorragend dafür, selbst wenn beim Gedanken an die Turbulenzen, die Stift Stams überstanden hat, der Kopffilm auch dort zu galoppieren droht. Zwei Mal wurde das Stift aufgehoben. Die Säkularisierungswelle der Aufklärung haben viele Klöster nicht überlebt. Sie erfasste Stift Stams im Jahr 1807 und dass die Patres knapp zehn Jahre später zurückkehren konnten, kommt einem Wunder gleich. „1939 wurde das Kloster von den Nazis wieder aufgelöst, innerhalb von zwei Tagen mussten die Patres alle weg. 1946 sind die ersten wiedergekommen“, sagt Abt German. Im Zweiten Weltkrieg, als die Stiftskirche das Lebensmittellager der Region und zum Schutz in Tarnfarben „gekleidet“ war, fuhren dort KleinLkws ein und aus. Das Stift war auch erste Nordtiroler Station zahlreicher Südtirolerinnen und -tiroler, die für das Deutsche Reich und gegen den Verbleib in Italien optiert hatten. Zwischen 400 und 500 Menschen sollen es gewesen.
Stift Stams weckt Erinnerungen, weil es viele Erinnerungen schuf und sie auch bewahrte. In 750 Jahren sammelt sich da einiges an. Abt German: „Ja, man spürt die Jahrhunderte.“ Dass das Stift diese Jahrhunderte unbeschadet überlebte, macht es zu einem verlässlichen Gefährten der Landesgeschichte – zu einem Herzen Tirols.
„NACH VILS, MEINEM GEBURTSORT, WURDE STAMS MEINE ZWEITE HEIMAT, MEINE LEBENSMITTE BEZIEHUNGSWEISE MEINE LEBENSWELT.“
Die Abtei St. Georgenberg ist ein Kloster der Benediktinerkongregation von St. Ottilien. Sie liegt stolz auf einem Felsen oberhalb des Inntals in der Gemeinde Stans. Das Kloster wurde im 10. Jahrhundert gegründet und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte Tirols.
Im 15. Jahrhundert von Wien nach Hall geschickte Prediger bilden den Beginn des Franziskanerklosters in Hall. Anfangs in der überschwemmungsgefährdeten unteren Lend ansässig, zogen die Franziskaner 1645 in das neu erbaute Kloster außerhalb der Haller Stadtmauern.
Erzherzog Ferdinand II. gründete das Haller Damenstift im Jahr 1567 für seine beiden ledigen Schwestern Magdalena und Helena. Damen des Hochadels führten im Stift ein sorgenfreies und frommes Leben, bis Kaiser Josef II. das Stift aufhob. 1912 wurde es mit dem Orden Filles di Sacré-Cœur wiederbelebt, die wegen ihres Ordenskleides im Volksmund „Weiße Tauben“ genannt werden.
Das Kapuzinerkloster Innsbruck ist das älteste des Kapuzinerordens in Österreich und Deutschland. Es wurde 1593/94 von Erzherzog Ferdinand II. und seiner Gattin Anna Caterina von Gonzaga gegründet. Das Kloster konnte nach den Aufhebungen durch Josef II. und während des Zweiten Weltkrieges wiederbelebt werden.
Das Redemptoristenkolleg in der Innsbrucker Innenstadt bot ab 1831 den Spitalsseelsorgern der Redemptoristen ein stattliches Zuhause. Obwohl es – wie das Kapuzinerkloster – beide Aufhebungen „überlebte“, zogen die Redemptoristen 2018 die Konsequenzen aus der sinkenden Mitgliederzahl –und zogen sich aus Innsbruck zurück.
Der Gründung des Klosters der „Unbeschuhten Karmelitinnen“ in Innsbruck im Jahr 1845 war Widerstand aus liberalen Kreisen vorausgegangen, auch das Stift Wilten fürchtete die Spendenkonkurrenz. In den 1990er Jahren zogen die Karmelitinnen an den Fuß der Nordkette im Innsbrucker Stadtteil Mühlau.
Stifte und Klöster in Tirol

Ein Karmeliter namens Hilari gründete 1689 das Kloster Hilariberg, eine Einsiedelei in Kramsach (Bezirk Kufstein). Von 1971 bis 2010 wurde das Kloster von Dominikanerinnen bewohnt.
Im Zentrum der Stadt Lienz befindet sich das Franziskanerkloster, das den Franziskanern in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts als Ersatz für das Franziskanerkloster Innsbruck übergeben wurde. Dafür mussten die zuvor hier lebenden Karmeliten das Kloster verlassen.
Das Wallfahrtskloster des Servitenordens Maria Waldrast liegt auf 1638 Metern Höhe am Fuß der Serles. Die Gründung des Klosters beruht auf einer Sage, der zufolge zwei Hirtenknaben aus Mützens hier 1407 ein aus einem Baumstamm gewachsenes Muttergottesbild fanden.
Franziskanerkloster Reutte
Das Franziskanerkloster Reutte wurde von Erzherzog Leopold V. und seiner Gemahlin Claudia von Medici gestiftet. Das Kloster bestand bis 2014, als es wegen Personalmangel schließen musste.
Franziskanerkloster Schwaz
In der silbernen Blütezeit der Stadt Schwaz wurde das Franziskanerkloster zwischen 1507 und 1515 erbaut. Das Kloster war und ist wegen des Kreuzgangs und des Uhrwerks aus dem Jahr 1752 bekannt.
Auch in Telfs wurde dem Franziskanerorden von 1703 bis 1706 ein prächtiges Gebäude erbaut, um die Seelsorge in Telfs und dem Oberen Inntal zu übernehmen.
Das Prämonstratenserstift in Wilten am Fuße des Bergisels wurde 1138 gegründet. Die Sage erzäht jedoch, dass der gefürchtete und von einem Mönch bekehrte Riese Haymon Gründervater des Stiftes war.
Der Pfarrer Nikolaus Tolentino baute 1811 ein Krankenhaus in Zams. Auf seinen Wunsch hin ging Katharina Lins zur Ausbildung nach Straßburg und kehrte als Barmherzige Schwester nach Zams zurück. Die Ordensgemeinschaft wurde 1826 offiziell anerkannt.
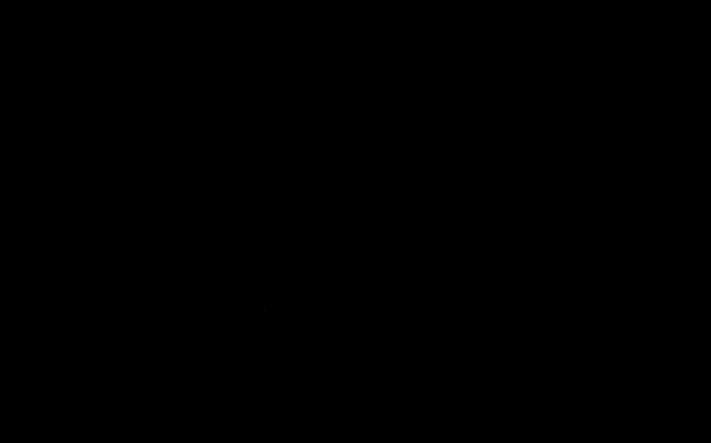
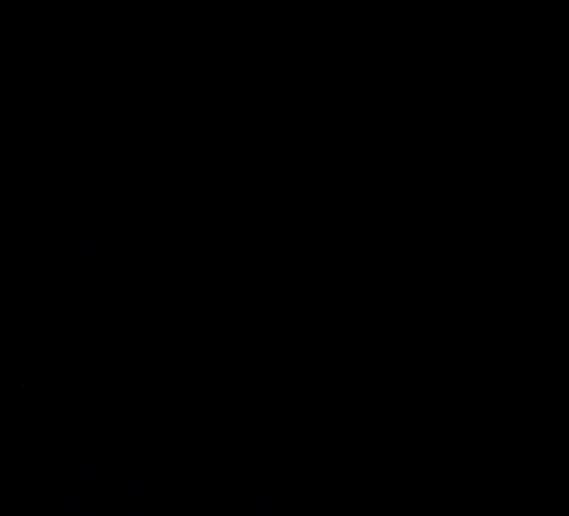







Since 1273 it has defied all the storms of the world and the turmoil of faith. Stams Abbey is somewhat of a birthplace of the province of Tyrol, has survived fires, plundering, greedy princes, enlighteners and all the savage wars.

Yes, Stams Abbey stands beautifully despite all the turbulence that has occurred in the long period of its existence and has always remained an eye-catcher in the Tyrolean Highlands,” says German Erd. When the Abbot of Stams Abbey talks about all this turbulence, he skilfully juggles dates and noble names, bringing wild and glamorous times to life, music suddenly becomes audible and history tangible.
His own story is closely interwoven with that of the monastery, whose architectural splendour has captivated the eyes of travellers for centuries. Coming from the Fernpass over the Mieminger Plateau or passing on the Inntal highway, the monastery’s onion domes act like magnets. For almost 35 years, they have been bizarrely complemented by the ski jumps in the background. But the ski jumps have long since become features of the complex, which includes the Cistercian abbey as well as the wonderful garden, the monastery store, the orangery, the ski school, the college of education, the college for social pedagogy or the Gymnasium Meinhardinum. Stams Abbey is a lively educational location. About 1,500 people come to the historic site every day outside the vacations and continue to write history.
The founding convent for Stams Abbey took place in 1273, and after nearly eleven years of construction, the abbey became a home for the Cistercians, whose order is based on reformed Benedictine traditions. It was founded by Elisabeth of Bavaria and her husband Meinhard II, who had it built in memory of their lost son and for the remains of the deceased members of the noble family. For in the meantime it had become rather crowded at Tyrol Castle near Merano, where the Tyrolean sovereigns had previously found their final resting place. The founders of the monastery are almost self-evidently omnipresent. The equestrian statue of Meinhard II on the gable of the west façade of the monastery, for example, proudly represents his dynamic life. It goes without saying that his life-size, gilded statue in the princely crypt or the “Austrian Tomb” is also impressive, since the representative crypt was his driving force for the construction of the monastery. There are many dates that make the year 2023 a year of celebration. In addition to the 20th anniversary as abbot, German Erd will celebrate his 75th birthday next year and Stams Abbey the 750th year of its existence. That it still exists in its original form is as extraordinary as its history and as impressive as its splendour. “In the ups and downs of time, there have been many crises, but it has always risen to new life,” knows Abbot German.

Die Karriere von Skirennläufer Benjamin Raich verlief beeindruckend. Heute ist er Unternehmer und ein durch und durch zufriedener Mensch.

Zurück im Eiskanal – zumindest fürs Foto: Die ehemalige Rennrodlerin Doris Neuner ist heute in der Organisation bei Sportherapie Huber & Mair in Innsbruck tätig und damit dem Sport wenn auch auf andere Weise verbunden geblieben.

Olympiasiegerin, Weltmeister, Weltcup-Gesamtsieger –irgendwann gehen selbst die glänzendsten Karrieren zu Ende. Doch wie geht es Athletinnen und Athleten mit der Entscheidung, ihre Karriere zu beenden? Und was folgt dann? Das TirolMagazin hat sieben ehemalige Top-Wintersportlerinnen und -sportler nach ihrem „Leben danach“ gefragt.
Zweimal wurde er Olympiasieger, dreimal Weltmeister, einmal Gesamtweltcupsieger und achtmal Weltcupsieger in Spezialdisziplinen. Beeindruckender kann eine Rennläuferkarriere fast nicht verlaufen wie jene von Benjamin „Benni“ Raich.
Im Jahr 2015 wollte es Raich noch einmal wissen und hatte sich als großes Ziel gesteckt, in Vail Weltmeister im Riesentorlauf zu werden. „Es war alles super an diesem Tag, ich war parat“, erinnert er sich. Doch dann war da diese „eine Stelle“ und der Traum geplatzt. Raich schied aus: „Das war eine riesige Enttäuschung. Normalerweise steckt man die weg, konzentriert sich auf die nächsten Rennen. Doch dieses Mal war es anders. Ich habe gespürt, dass es das gewesen ist.“ Der Kopf spielte nicht mehr mit, wollte den Körper nicht mehr motivieren. Stress machte sich der Pitztaler, der mit der ehemaligen Skirennläuferin Marlies Schild verheiratet ist, mit dem Abschied zwar keinen, doch im Sommer 2015 entschied er, dem Skizirkus Lebewohl zu sagen.
Schon während seiner aktiven Zeit hatte Benni Raich eine Bauträger-Gesellschaft gegründet und Wohnhäuser gebaut. Die Geschäfte leitete damals sein Vater. Da der Sohn nun Zeit hatte, stieg er aktiv ins Business ein. Vor eineinhalb Jahren kam eine Marketingagentur dazu. Außerdem sitzt Raich im Aufsichtsrat des Skigebietes Silvretta-Montafon und ist Analytiker bei den ORF-Übertragungen von Skirennen. Darum bezeichnet sich Benni Raich heute „als klassischer Unternehmer“ mit vielseitigen Aufgaben: „Unternehmer sein ist extrem spannend. Aber natürlich auch eine Challenge.“ Doch vor der hat er noch nie zurückgeschreckt.
Ihren größten Erfolg feierte Doris Neuner 1992, als sie bei den Olympischen Spielen in Albertville vor ihrer Schwester Angelika Gold im Rodel-Einsitzer holte. Und auch sonst raste sie erfolgreich durch die Eiskanäle: Bei der Weltmeisterschaft 1993 holte Neuner Bronze, im Gesamtweltcup belegte sie 1992 den dritten und 1993 den zweiten Rang. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte das durchaus noch eine Weile so weitergehen können. Doch ihr Körper wollte nicht mehr, sie bekam in der Saison 1993/94 Schwindelattacken, deren Grund die Mediziner nicht fanden. Doris Neuner erinnert sich an ihr Karriereende: „Die Entscheidung ist nicht schwer gefallen. Es ist einfach nicht mehr gegangen, wenn man in der Bahn nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist.“
In ihrer aktiven Zeit arbeitete Doris Neuner als Sekretärin im Landesdienst, während der Wintermonate war sie dort karenziert. Nach dem Ende ihrer Karriere kehrte sie vorerst auch zum Land zurück und wechselte vor 20 Jahren ins Büro der Sporttherapie Huber & Mair in Innsbruck: „Ich habe den Raini Huber schon aus der aktiven Zeit gekannt, da ist er als Betreuer bei uns mit dabeigewesen.“ Inzwischen ist Neuner nicht mehr nur im Büro, sondern hat auch die Lehrwarte-Ausbildung für Haltungsturnen und Aerobic gemacht. „Technische Beraterin“ der deutschen Rodler in Winterberg – wie im Internet nachzulesen ist – war Neuner übrigens nie.
„UNTERNEHMER
Olga Scartezzini-Pall hat noch immer gut lachen. Die ehemalige Skirennläuferin wurde unter anderem Abfahrts-Olympiasiegerin, mit vier Enkeln wird‘s auch in der Sport-Pension nicht fad.

Ingo Appelt hat den Bob gegen das Unternehmertum getauscht und den Familienbetrieb übernommen. Bis heute ist er erfolgreicher Juwelier.

 Naturmensch ist er geblieben – sportlich auch. Manfred Pranger gibt gemeinsam mit seinem Skirennläuferkollegen Reinfried Herbst Seminare, um Menschen in Bewegung zu bringen.
OLGA SCARTEZZINI-PALL
ehemalige Skirennläuferin
Naturmensch ist er geblieben – sportlich auch. Manfred Pranger gibt gemeinsam mit seinem Skirennläuferkollegen Reinfried Herbst Seminare, um Menschen in Bewegung zu bringen.
OLGA SCARTEZZINI-PALL
ehemalige Skirennläuferin
Olga Pall ist gebürtige Niederösterreicherin, kam jedoch schon als Kind nach Tirol. Im Jahr 1965 zeigte sie erstmals international auf, als sie die Abfahrt in Madonna di Campiglio gewann. Ihr Winter sollte jedoch jener von 1968 werden: Mit 20 Jahren wurde sie Olympiasiegerin in der Abfahrt von Grenoble. Im selben Jahr gewann sie den Abfahrtsweltcup, in der Saison darauf wurde sie Dritte. Doch der Winter 1969/70 verlief enttäuschend, 1970 beendete sie ihre Karriere: „Damals ist man nicht so lange Ski gefahren, wie das heutige Spitzensportler tun.“
Weil es zu Palls aktiver Zeit noch keine Sportgymnasien gab, holte sie ihren schulischen Abschluss nach dem Ende ihrer aktiven Zeit nach, legte die B-Matura ab und machte danach eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Pall erinnert sich: „Weil ich dann nicht gleich einen Job bekommen habe, war ich ein halbes Jahr Trainerin in einem Race-Camp in Vermont. Das waren die kältesten Tage meines Lebens auf dem Skilift.“ Nach ihrer Rückkehr arbeitete Pall bis zur Geburt ihres ersten Kindes 1977 als Physiotherapeutin an der Innsbrucker Klinik, später engagierte sie sich in der Mutter-Kind-Beratung in ihrer Heimatstadt Hall. Dem Skisport blieb sie weiter treu und war von 1990 bis 2002 ehrenamtlich ÖSV-Vizepräsidentin: „Ich habe mich für den Behindertensport engagiert und geschaut, dass die ordentlich eingekleidet wurden, was damals noch nicht so üblich war. Ich war auch bei den Paralympics in Lillehammer dabei. Das war ein sehr schönes Erlebnis.“ Heute ist Olga Pall gemeinsam mit ihrem Mann immer noch sportlich unterwegs und Oma mit Leib und Seele: „Mit ist nie fad, ich habe vier Enkelkinder. Die Zeit vergeht mir fast zu schnell.“
ehemaliger
BobfahrerGold medal Austria hieß es am 22. Februar 1992 in Albertville für den Bob Österreich 1 mit Ingo Appelt, Harald Winkler, Gerhard Haidacher und Thomas Schroll. Dass Appelt kurze Zeit später seine Karriere beenden würde, ahnte er an diesem Tag wohl noch nicht. Zwei Gründe, so erzählt er, hatten zu dieser Entscheidung geführt: „Sportlich hatte ich alle Ziele erreicht. Mein Vater war relativ knapp nach Olympia gestorben, meine Mutter hat mir die Firma verkauft und wir haben uns darauf verständigt, dass ich nicht weiter Spitzensport machen kann.“ So wurde aus dem erfolgreichen Bobfahrer ein Juwelier. „Grundsätzlich hat sich die Entscheidung gut angefühlt, aber rückwirkend habe ich mental doch einige Tiefen erleben müssen, die mit dem Entzug vom Spitzensport zu tun hatten“, erinnert sich Appelt. Doch er baute das väterliche Unternehmen beständig aus, übersiedelte in eine bessere Lage im heimatlichen Stubaital, kreierte seine eigene Kollektion und eröffnete in Innsbruck ein weiteres Geschäft. Aus heutiger Sicht nicht ganz so zufriedenstellend verlief Appelts Karriere als Politiker und Landtagsabgeordneter: „Ich bin mit der Emotion in die Politik gegangen, etwas zu bewegen, um dann zu erkennen, dass man aus der Opposition heraus kaum Möglichkeiten hat. Es war eine Lernerfahrung.“
Das Prickeln verspürt Ingo Appelt mit inzwischen 60 immer noch, wenn er bei einem Rennen am Innsbrucker Eiskanal steht: „Man erlebt die Gefühle, als wäre es gestern gewesen. In Wahrheit ist es aber doch 30 Jahre her. Man denkt sich kurz, es wäre reizvoll, sich wieder in einen Bob zu setzen, aber es siegt dann gleich die Vernunft.“
ehemaliger Skirennläufer
Kitzbühel, Schladming, Wengen… das sind für Manfred „Manni“ Pranger Orte mit einem besonderen Klang, stand der Slalomfahrer dort doch ganz oben am Stockerl: „Kitz ist etwas ganz Besonderes. Kitzbühel-Sieger bist du ein Leben lang.“ Erst danach kommt der Weltmeistertitel in Val-d’Isére 2009. Das alles ist eine Weile her. 2014 beendete Pranger seine Karriere.
Vorangegangen waren Jahre, die einer Fahrt in der Hochschaubahn glichen. Erfolge und gute Saisonen wechselten sich mit schlechten Jahren ab. Auch schwere Verletzungen machten ihm zu schaffen. Als 2014 außerdem seine Hüfte Probleme zu machen begann, „reifte über den Winter eine Entscheidung“. Am 9. Mai 2014 gab er seinen Rückzug aus dem Spitzensport bekannt. Am Anfang sei das schwer gewesen: „Wenn ich Bilder von anderen gesehen hab’, hat es zu kribbeln begonnen. Inzwischen hab’ ich es gut verdaut.“
Nach dem Karriereende wollte Pranger, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Gschnitz lebt, wieder etwas „mit derselben Emotion“ wie im Rennsport machen: „Ich bin in den Funktionen herumgehüpft, bis ich etwas gefunden habe.“ Gemeinsam mit seinem ehemaligen Rennläuferkollegen Reinfried Herbst gibt er in einem Kurzentrum nun Seminare, um Menschen zur Bewegung zu animieren: „Wir haben ein super Konzept zusammengestellt, das ziemlich gut ankommt. Das taugt mir voll. Ich trainiere selber ja auch immer noch sehr gerne.“




Die neuen Messer von TYROLIT LIFE sind ein absoluter Hingucker für jeden Haushalt. In 64 Arbeitsschritten von Meisterhand manufakturgefertigt, überzeugt die DARKLINE Messerserie durch Qualität und Präzision. Erhältlich in unserem Onlineshop tyrolitlife.com







Schon mit 18 wurde Ernst Vettori 1982 Juniorenweltmeister im Skispringen. Es begann eine großartige Karriere, die sich zwölf Jahre lang fortsetzte: Sieger der Vier-Schanzen-Tournee 1985/86 und 1986/87, 1991 Weltmeister im Mannschaftsspringen, 1992 Olympiasieger auf der Normalschanze sowie Silber im Teambewerb in Albertville. Dazu kommen viele Siege mehr. 1993 dann ein letztes Mal Bronze bei der Weltmeisterschaft in Falun. 1994 setzte Ernst Vettori schließlich seinen letzten Aufsprung in den Schnee. Das Karriereende bereitete ihm keine wehmütigen Gefühle, wie er sich erinnert: „Das war gleich erledigt. Ich war damals schon verheiratet, Vater von zwei Kindern und sportlich nicht mehr ganz auf dem Level, auf dem ich sein wollte. Ich war müde vom Reisen und Trainieren.“ Die öffentliche Aufmerksamkeit fehlte ihm nicht, er fiel in kein tiefes Loch wie manch anderer, auch wenn er zugibt, dass der Ausstieg aus dem Spitzensport nicht einfach ist: „Das Reisen, das Trainieren, das regelmäßige, zielbewusste Leben – das ist alles anstrengend, aber wenn man es nicht mehr hat, fehlt es einem.“
Bald nach der Beendigung seiner aktiven Zeit wurde Vettori Produktmanager bei Kneissl, studierte außerdem am Management Center Innsbruck vertiefend Marketing. 1999 wurde er schließlich Marketingleiter Nordisch beim ÖSV, später wechselte er in den sportlichen Bereich des Verbandes: „Das hat eine Weile gedauert. Bis Toni Innauer als Sportdirektor aufgehört hat, dann habe ich sein Amt für die Skispringer und die Kombinierer übernommen.“ Das war 2010 nach den Olympischen Spielen von Vancouver. Heute ist Vettori beim ÖSV wieder zum Marketing bei den Nordischen zurückgekehrt.
ehemaliger Skirennläufer
Egal ob Slalom, Riesentorlauf, Super-G oder Abfahrt: Günther Mader war immer dabei. Er war einer von ganz wenigen Allroundern im Skizirkus und auch einer, der in jeder Disziplin gewinnen konnte. Sein persönlicher Medaillenspiegel: 1 x Olympia-Dritter in der Abfahrt in Albertville, bei Weltmeisterschaften 1 x Silber, 5 x Bronze, 2 x Sieger im Gesamtweltcup, 14 erste Plätze bei Weltcuprennen, elf zweite und 16 dritte. 16 Jahre lang war der Wipptaler derart im Weltcup unterwegs. Doch langsam stellte sich eine Müdigkeit ein: „Grundsätzlich wollte ich bis zum Schluss in jeder Disziplin starten. Aber das war so anstrengend, dass ich das Gefühl hatte, ausgelaugt zu sein.“ Auch Pläne, vielleicht noch zwei Jahre als „Spezialist“ zu fahren, verwarf Mader und beendete im März 1998 seine Sportler-Laufbahn.
Wie es danach weitergehen würde, diese Frage stellte sich für Mader vorerst aber nicht, denn nur zehn Tage nach seinem letzten Rennen erlitt er einen schweren Schlaganfall, seine rechte Körperhälfte war gelähmt, er verlor 85 Prozent seines Sprachschatzes. Im Spätherbst 1999 heuerte er bei Salomon an: „Ich habe mir gedacht, arbeiten zu beginnen, ist die beste Reha.“ Insgesamt dauerte es drei, vier Jahre, bis er wieder der Alte war. Über seine Schlaganfall-Erfahrung schrieb er in der Folge ein Buch. Anfangs war Mader für Salomon in Österreich tätig, später international. Seit dem Frühjahr 2022 arbeitet der 58-Jährige beim ÖSV in der Abteilung für „Forschung und Entwicklung“.
„DAS REISEN, DAS TRAINIEREN, DAS REGELMÄSSIGE, ZIELBEWUSSTE LEBEN – DAS IST ALLES ANSTRENGEND, ABER WENN MAN ES NICHT MEHR HAT, FEHLT ES EINEM.“
Ernst Vettori
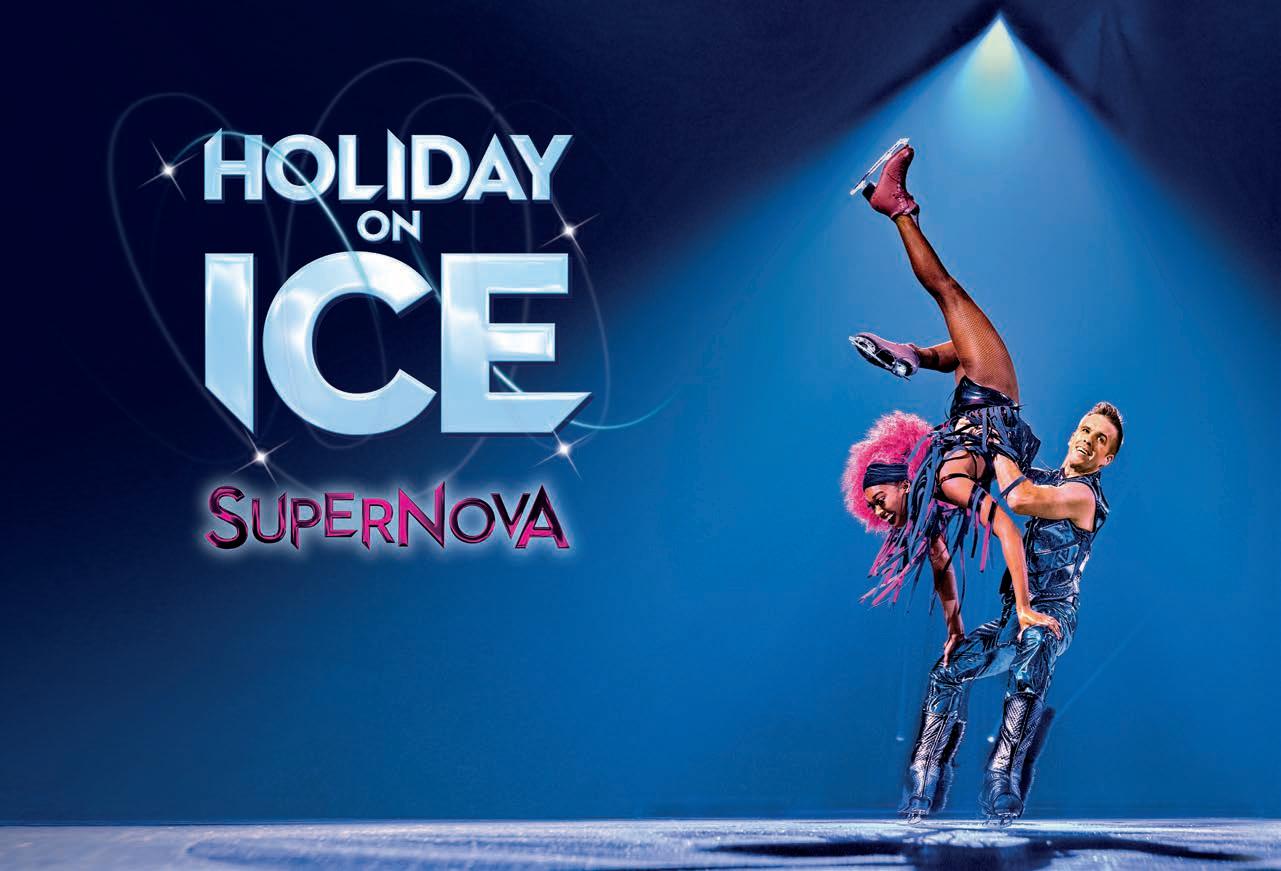


1956, Cortina d’Ampezzo
• Toni Sailer (Skisport: Riesentorlauf)
• Toni Sailer (Skisport: Slalom)
• Toni Sailer (Skisport: Abfahrt)
1960, Squaw Valley
• Ernst Hinterseer (Skisport: Slalom) 1964, Innsbruck

• Pepi Stiegler (Skisport: Slalom)
• Christl Haas (Skisport: Abfahrt)
• Josef Feistmantl (Rodel: Doppelsitzer)
1968, Grenoble

• Olga Pall (Skisport: Abfahrt)
© SCHÖFFEL
Immer Vollgas, so kannte man Benni Raich auf der Piste
• Leonhard Stock (Skisport: Abfahrt) 1988, Calgary
• Sigrid Wolf (Skisport: Super-G) 1992, Albertville
• Ernst Vettori (Skispringen: Großschanze)
• Ingo Appelt, Gerhard Haidacher, Thomas Schroll (Bob: Vierer)
• Doris Neuner (Rodel: Einsitzer)
• Stephan Eberharter (Ski Alpin: RTL)
• Fritz Strobl (Ski Alpin: Abfahrt)
• Benjamin Raich (Ski Alpin: Slalom)
• Benjamin Raich (Ski Alpin: Riesentorlauf)








• Christoph Bieler (Nordische Kombination: Mannschaft)
• Andreas Linger, Wolfgang Linger (Rennrodeln: Doppelsitzer)
• Andreas Kofler, Andreas Widhölzl (Skispringen: Großschanze/Mannschaft)

• Andreas Linger, Wolfgang Linger (Rennrodeln: Doppelsitzer)






















• Andreas Kofler, Gregor Schlierenzauer (Skispringen: Großschanze/Mannschaft)
• David Kreiner (Nordische Kombination: Mannschaft)



1992 errang der österreichische Viererbob mit Ingo Appelt OlympiaGold in Albertville
• Mario Matt (Ski Alpin: Slalom)
2018, Pyeongchang
• David Gleirscher (Rodel: Einsitzer)
Ingo Appelt






„MAN

Von Konrad zu Oscar: Als Regisseurin zeigt Ulrike Kofler keine Scheu vor Tabuthemen, als Cutterin hat die ExilThaurerin zuletzt mit Marie Kreutzer Hand am Sisi-Mythos angelegt und das Historiendrama „Corsage“ damit auf OscarKurs gebracht. Mit uns spricht die Filmemacherin über die Sinnlichkeit des Kinos, ihre Sehnsucht nach Weitblick und Drehbücher, die aus einem „herauskugeln“.


Ihren ersten Kinobesuch hat Ulrike Kofler immer noch im Kopf. Fast so, als wäre er gestern gewesen. „Diese magische Mischung aus plötzlicher Dunkelheit und fremden Geräuschen hat mich sofort gepackt. Außerdem gab’s Sportgummi. Besser geht’s eigentlich gar nicht“, denkt die 48-jährige Tirolerin an ihr neun Jahre altes Ich zurück, das Anfang der 1980er-Jahre im Innsbrucker Jugendzentrum MK das Kino lieben lernte. Im Schlepptau ihrer damaligen Schulfreundin aus Thaur tauchte Kofler ein in die Verfilmung von Christine Nöstlingers Kinderbuch „Konrad aus der Konservenbüchse“, in dem die alleinstehende Chaotin Berti Bartolotti eines Tages eine riesige Dose geliefert bekommt, in der ein Bub namens Konrad steckt. Der ultrabrave Knirps ist das Produkt einer Kinderfabrik, die ausschließlich tugendhafte Exemplare ausliefert. In diesem Fall halt an die falsche Adresse. Als das Musterknaben-Paket zurückgefordert wird, hat sich Frau Bartolotti aber schon an ihren Konrad gewöhnt – und treibt ihm nun absichtlich Flausen ein, damit er zum Rotzbengel wird. Und bei ihr bleiben darf.
Richtiges Revoluzzer-Feeling.
„Dieses Kino-Feeling hat sich bei mir eingebrannt. Auch deshalb, weil das so eine richtige Revoluzzergeschichte war. Das hat mir getaugt“, sagt Kofler, die Tirol schon mit Anfang 20 hinter sich ließ, weil sie sich „nach der Weite“
Ulrike Kofler (geb. 1974) ist in Thaur aufgewachsen, hat Tirol aber schon mit Anfang 20 hinter sich gelassen, um nach ihrer Ausbildung zur Fotografin an der Filmakademie in Wien Schnitt zu studieren. Hier lernte sie auch Marie Kreutzer kennen, mit der sie bis heute beruflich wie privat eng verbunden ist. Schon bei Kreutzers Spielfilmdebüt „Die Vaterlosen“ (2011) war Kofler für den Schnitt verantwortlich, zuletzt arbeiteten die beiden für das Historiendrama „Corsage“ zusammen, das für Österreich ins Oscar-Rennen geht. Kofler ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Wien.
sehnte. Und nach einem Weitblick, der sie unter anderem an die Filmakademie Wien und an die Kunsthochschule für Medien in Köln führte.
Aus heutiger Sicht wirkt es nahezu schicksalhaft, dass sie gleich bei ihrer ersten Begegnung mit der großen Leinwand auf ein familiäres Gefüge jenseits der vermeintlichen Vater-Mutter-Kind-Harmonie stieß. Schließlich prägt die Familienthematik seit jeher Koflers Werk als Regisseurin und Drehbuchautorin: In ihrem Diplomfilm „Wir fliegen“ erzählte sie 2012 die Geschichte einer Kindergärtnerin, die ein nicht abgeholtes Kind mit nach Hause nimmt. Koflers Langfilmdebüt „Was wir wollten“ aus dem Jahr 2020 kreist wiederum um ein kinderloses Ehepaar (gespielt von Elyas M’Barek und Lavinia Wilson), das nach der zigten erfolglosen In-vitro-Befruchtung über einen neuen Lebensweg nachdenkt und im Urlaub auf Sardinien ein Paar mit Kindern trifft, das nur auf den ersten Blick in seiner Mitte ruht. Glück ist eben Ansichtssache.
Immer wieder die Familie.
Auch der Plot ihres neuesten Projekts ist familienlastig: In „Full House“ – so der Arbeitstitel des im Herbst in Wien gedrehten Films – wird die Geschichte der kleinen Gina erzählt, die als Tochter einer vom Leben überforderten Alleinerzieherin aufwächst. Dem schnöden Alltag will die bald vierfache Mutter mit Partyexzessen entkommen
„DAS
EINMAL NICHT
EINFACHE KOST. TROTZDEM WILL ICH IN MEINE ERZÄHLUNGEN IMMER WIEDER LEICHTIGKEIT UND HUMOR HINEINBRINGEN.“© PAMELA RUSSMANN




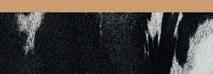



























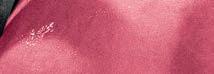












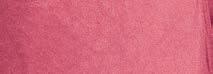





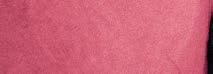


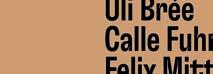

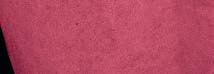



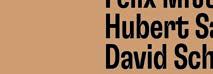


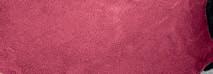


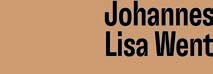
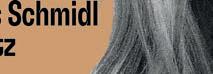































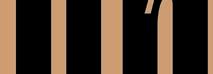






































und läuft dabei Gefahr, ihre Kinder zu verlieren. Gina wiederum will raus aus dieser Verliererspirale und bäumt sich auf gegen diesen Strudel aus fehlender Zuneigung, Armut und Bildungsnot. „Mir ging es hier um die Frage, ob man sich aus den Fußstapfen seiner Familie lösen kann. Und wie man es schafft, alte Generationen hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen“, sinniert Kofler. Den Plot zur – wie sie betont – „frei erfundenen Geschichte“ trägt sie schon länger mit sich herum. „Weil lange nicht klar war, ob wir die Finanzierung für ‚Was wir wollten‘ zusammenbekommen, hab ich die Wartezeit damit überbrückt, etwas Neues zu schreiben: Dieses Drehbuch ist dann mehr oder weniger aus mir herausgekugelt“, sagt sie.
Die Idee zum fiktionalen Plot lieferte dann aber doch das Leben. Koflers Leben. Die Wahl-Wienerin ist Mutter von zwei Kindern, ihre achtjährige Tochter ist ein Pflegekind. Um das Mädchen bei sich aufnehmen zu können, musste Kofler etliche Schulungen absolvieren. „Mir war dann rasch klar, dass ich dieses Thema auch künstlerisch verarbeiten will. Dabei wollte ich aber immer die Privatsphäre meiner Tochter und ihrer leiblichen Eltern wahren“, betont sie. Als Basis für ihr Drama dienten stattdessen anonymisierte Geschichten, die sie bei ihren Recherchen am Jugendamt zusammentrug. Feel-GoodMovie wird das also wieder keiner. Aber wie kommt’s, dass Kofler bewusst dahin schaut, wo es weh tut? Wieso macht sie es nicht leichter?


Einmal um die ganze Welt.
„Das Leben bietet nun einmal nicht nur einfache Kost. Trotzdem will ich in meine Erzählungen immer wieder Leichtigkeit und Humor hineinbringen. Bei ‚Was wir wollten‘ ging es mir aber auch darum, ein Tabu aufzubrechen. Denn obwohl die Kinderwunsch-Thematik so ein riesiges gesellschaftliches Thema ist, wird kaum öffentlich darüber gesprochen. Das
Ende 2020 hätte mit „Was wir wollten“ Ulrike Koflers Langfilmdebüt als Regisseurin in die Kinos kommen sollen, die Coronapandemie verhinderte jedoch einen regulären Kinostart. Das Beziehungsdrama war 2021 Österreichs Oscar-Kandidat und die erste österreichische Produktion, die vom Streamingriesen Netflix ins Programm genommen wurde.
„DINGE

















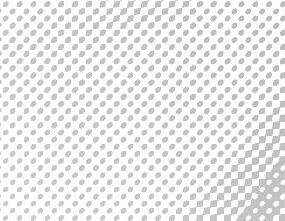








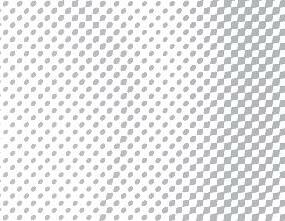

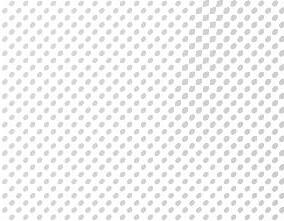
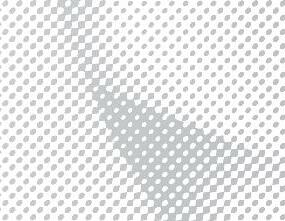
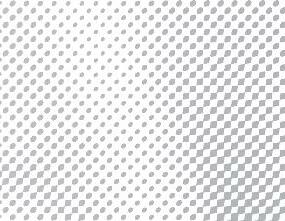


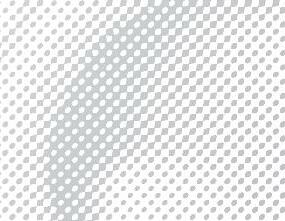




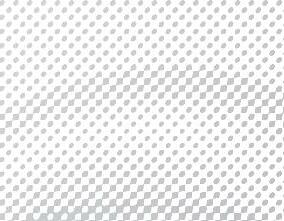


Big-Screen-Moment an der Pforte der Traumfabrik anklopfte. „Was wir wollten“ schaffte es 2021 in die GoldenGlobes-Vorauswahl und war der Austro-Kandidat für den Auslands-Oscar. Hand aufs Herz: Ist Hollywood ein Sehnsuchtsort für sie? Kofler schüttelt den Kopf. „Nein. Eigentlich gar nicht. Aber natürlich hab ich mich gefreut, dass ich auf einer Oscar-Liste gestanden bin. Das heißt ja auch, dass ich wahrgenommen werde.“
Träume teilen.
wollte ich ändern“, sagt Kofler, die sich auf die Fahnen schreiben darf, mit ihrem Regiedebüt den meistgesehenen österreichischen Film der Gegenwart produziert zu haben. Ende 2020 nahm der Streamingriese Netflix das Beziehungsdrama als erste rot-weiß-rote Produktion ins Programm und verschaffte Koflers in rund 30 Sprachen übersetztem Werk damit in mehr als 190 Ländern ein Millionenpublikum. „Es ist ein unglaubliches Glück, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. So eine Streuung schafft man
sonst ja kaum“, freut sich die Filmemacherin.

Bei all dem Erfolg schwingt aber auch ein wenig Wehmut mit. Lockdownbedingt blieb „Was wir wollten“ nämlich ein regulärer Kinostart verwehrt. „Ich will mich nicht beklagen: Aber es hat mir schon weh getan, dass der Film nicht auf die große Leinwand gekommen ist. Die Sinnlichkeit eines Kinobesuchs ist einfach nicht vergleichbar mit dem Filmerlebnis auf der Couch“, so Kofler, die damals übrigens auch ohne
Internationale Wahrnehmung und Wertschätzung wird der Wahl-Wienerin aber auch als Cutterin zuteil. So trägt Marie Kreutzers bildgewaltiges Historiendrama „Corsage“ Koflers Schnitt-Handschrift und rückt Kaiserin Elisabeth fernab des verkitschten Sisi-Mythos in ein neues Licht, das erhellende Schatten wirft. Bei den Filmfestspielen in Cannes lief „Corsage“ in der Reihe „Un Certain Regard“ und bescherte Hauptdarstellerin Vicky Krieps den renommierten Darstellerpreis. Aber auch sonst überschlagen sich die Kritikerstimmen vor grenzenlosem Lob: So gesehen war es also keine große Überraschung, als Anfang September bekannt wurde, dass das poetische Epos über eine eckenreiche Monarchin, die nach Freiheit giert, für Österreich ins Oscar-Rennen geht.
Inwiefern beflügeln einen solche Erfolge? „Natürlich ist es angenehm, wenn man von vielen Seiten hört, dass
„NATÜRLICH IST ES ANGENEHM, WENN MAN VON VIELEN SEITEN HÖRT, DASS EIN FILM GELUNGEN IST. ABER EIGENTLICH SOLLTE MAN SICH VON SOLCHEN URTEILEN BEFREIEN UND VERSUCHEN, SICH VON FREMDEN STIMMEN UNABHÄNGIG ZU HALTEN.“
ein Film gelungen ist. Aber eigentlich sollte man sich von solchen Urteilen befreien und versuchen, sich von fremden Stimmen unabhängig zu halten. Ein sicheres Rezept für Erfolg gibt es nämlich nicht“, sagt Kofler, die für „Corsage“ bereits zum wiederholten Mal mit Marie Kreutzer zusammengearbeitet hat. Angefangen von „Die Vaterlosen“ über „Gruber geht“ bis hin zu „Was hat uns bloß so ruiniert“ und „Der Boden unter den Füßen“: Immer dann, wenn Kreutzer als Regisseurin im Abspann stand, zeichnete Kofler für den Schnitt verantwortlich. Für „Was wir wollten“ tauschten die beiden Filmemacherinnen, deren Wege sich erstmals an der Filmakademie Wien kreuzten, dann allerdings die Rollen. Wieso hat Kofler als erfahrene Cutterin hier nicht selbst den Schnitt übernommen? „Vielleicht gibt es Leute, die das können: Ich kann es nicht. Beim Schnittprozess setzt man einen Film noch mal ganz neu zusammen. Da braucht es ganz dringend einen Blick von außen“, ist Kofler überzeugt.
Mit Kreutzer versteht sie sich übrigens nicht nur beruflich blendend. „Wir sind sehr gut miteinander befreundet und sehen das Leben ähnlich – auch mit seinen Hürden. Es gibt sogar Parallelen in unseren Träumen. Kein Wunder, dass wir so gut miteinander können“, lacht sie. Bei Koflers aktuellem Regieprojekt wird nun aber die deutsche Cutterin Bettina Böhler den Schnitt übernehmen. Nein – es gab keinen Cut mit Kreutzer, nur waren die Termine der Seelenfreundinnen dieses Mal einfach nicht unter einen Hut zu bekommen.
Höherer Beweisdruck.
Kommt nach so vielen Jahren im Filmbusiness bei ihr eigentlich noch ein Gefühl von Lampenfieber auf? „Und wie: Kurz vor Drehstart ist mir auch jetzt wieder die Muffn gegangen. Man steht als Regisseurin unter enormem Druck

und kämpft zwischendurch auch mal mit der Angst, dass das alles nichts werden könnte“, gibt sie zu. Dass man es als Frau im nach wie vor männerdominierten Filmbusiness womöglich schwerer hat, unterschreibt Kofler hingegen nur bedingt. „In meinem Arbeitsalltag spüre ich da keine Hürden. Aber ich glaube schon, dass sich Frauen noch immer viel mehr beweisen müssen als Männer. Die können auch mal ungestraft einen banalen Fernsehschmarrn drehen. Als Frau darf man sich so etwas nicht leisten“, ist Kofler überzeugt. „Aber ich gehe davon aus, dass das nicht mehr lange so sein wird. Dinge ändern sich. Manchmal auch zum Guten“, blickt sie hoffnungsfroh nach vorne.
Und wie ist es, wenn sie heute zurück nach Tirol blickt? Fehlt ihr etwas? „Im Grund genommen vermisse ich ein Stück Heimat“, sagt Kofler und kommt auf ihre Familie und ihre alten FreundInnen zu sprechen, nach denen sie sich immer wieder sehnt. Aber am allermeisten vermisst sie das Gefühl, „irgendwo oben zu stehen und runterschauen zu können“. Womit wir wieder beim Weitblick wären … Christiane_Fasching
„DIESE
As a director, Ulrike Kofler doesn‘t shy away from taboo subjects and as an editor, the exile from Thuringia recently worked with Marie Kreutzer on the Sisi myth, putting the historical drama „Corsage“ on course for an Oscar.
© ROBERT BRANDSTÄTTERUlrike Kofler still remembers her first visit to the cinema. “This magical mixture of sudden darkness and strange sounds immediately grabbed me,” the 48-year-old Tyrolean thinks back to her nine-year-old self, who learned to love the cinema in the early 1980s. “That cinema feeling burned itself into me,” says Kofler, who left Tyrol behind in her early 20s because she longed “for the wide open spaces.” And for a vision that led her to the Vienna Film Academy and the Academy of Media Arts in Cologne, among other places. In 2012, she delivered her diploma film “Wir fliegen” (We’re Flying), in 2020 she celebrated her feature film debut with “Was wir wollten” (What We Wanted), and the plot of her latest
project is also family-heavy: in “Full House” - the working title of the film, which will be shot in Vienna in fall - the story of little Gina is told, who grows up as the daughter of a single mother who is overwhelmed by life. Yet again, this is not a feel-good movie.
But how come Kofler deliberately chooses painful topics? “Life doesn’t just offer simple fare,” says Kofler, who can claim to have produced the most-watched Austrian film of the present with her directorial debut. At the end of 2020, the streaming giant Netflix included the relationship drama in its program as the first red-white-red production, thus providing Kofler’s work, which has been translated into around 30 languages, with an audience of millions in more than 190 countries. The Viennese-by-choice is also held in international esteem as an editor. Marie Kreutzer’s visually stunning historical drama “Corsage” bears Kofler’s editing signature and casts Empress Elisabeth in a new light, far removed from the tacky Sisi myth. The critics’ voices overflow with praise. So it was no great surprise when it was announced that the poetic epic would be entering the Oscar race for Austria.
After so many years in the film business, does she actually still feel stage fright? “You’re under enormous pressure as a director, and in between you also struggle with the fear that it might all end up being nothing,” she admits. And what is it like when she looks back to Tyrol today? Does she miss anything? “Basically, I miss a piece of home,” Kofler says, coming to talk about her family and her old friends, whom she longs for again and again. But most of all, she misses the feeling of “standing somewhere on top and being able to look down.”

Bei uns kann man auch übernachten.
Bei uns kann man auch übernachten. DAS CAFÉ MIT HOTEL




Wer heute an Handwerk denkt, dem kommen zuerst vermutlich Installateure, Fliesenleger, Malerinnen oder sonstige Berufe aus dem Baugewerbe in den Sinn. Aber Hafner, Gerber und Sattler, Weberinnen oder Drechsler? Dabei waren dies Berufe, die über Jahrhunderte völlig selbstverständlich existierten und lebenswichtige Produkte herstellten. Manche davon florieren nach mageren Zeiten wieder, andere sind ausgesprochene Nischengewerke, die zusehends weniger werden. Ein handwerklicher Streifzug durchs Land.

Texte: Uwe_Schwinghammer & Marina_Bernardi
Fotos: Tom_Bause
Nicht viele Betriebe können auf eine 500-jährige Geschichte zurückblicken. Die Gerberei Schatz in der Silberregion Karwendel kann. Auch wenn sich die Arbeitsmethoden gewandelt haben – ein bisschen jedenfalls.
Vor fast 500 Jahren wurde die Gerberei Schatz in Pill gegründet und seit damals ist sie ununterbrochen im Besitz der Familie von Vincenz Pinter. Früher brachten die Bauern aus der Umgebung die Holzrinden der gefällten Bäume in die Gerberei. Sie wurden in heißem Wasser ausgelaugt, mit dem Stoff, der daraus entstand, wurde das Leder gegerbt. Es ist ein zeitaufwändiges Verfahren, deshalb macht Vincenz in diesem Fall durchaus Zugeständnisse an die Moderne. Doch weil ihm das traditionelle Handwerk wichtig ist, wird nach wie vor umweltverträglich und ohne chemische Zusätze gegerbt. So natürlich wie möglich, das ist Vincenz wichtig. „Leder ist Natur, jede Haut ist anders. Das gilt es zu erhalten, damit man es spürt, wie’s von Natur aus ist“, sagt er.
Gegerbt wurde in den alten Gemäuern schon immer. Vincenz Schatz, Jahrgang 1867 und Urgroßvater des heutigen Vincenz, hat schließlich am 4. Juli 1903 das handwerksmäßige Gewerbe des Rotgerbers bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Schwaz angemeldet.

1933 übernahm Richard Pinter den Betrieb, 1971 der nächste Vincenz. Vincenzs Vater nämlich. Seit 1993 liegt er in den Händen der heutigen Generation.
Ein echtes Überraschungsei.
Wer so lange überlebt, muss etwas verdammt richtig machen. Und so entpuppt sich das rund 500 Jahre alte Haus als reinstes Überraschungsei. Hinter jeder Tür, die sich hinter knarrenden Stufen und scheinbar provisorischen Rampen öffnet, verbirgt sich ein anderer Verarbeitungsschritt. Zu Beginn stehen wir vor einer großen Maschine. „Für Schuhsohlen“, wie uns von Hausherrin Marlies Pinter erklärt wird. Die
Maschine ist zwar nicht mehr wirklich oft im Einsatz, thront aber imposant im Eingangsbereich. Das Hauptgeschäft von Gerber Vincenz Pinter spielt sich im Bereich der Raumausstattung ab, dazu kommen Materialien für Gürtel oder Ranzen, Sattel- und technische Leder.
Als Gerben wird generell die Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu Leder bezeichnet. Die Haut, die in der Gerberei Schatz verarbeitet wird, kommt dabei großteils von süddeutschen Kühen. „Die Bearbeitung beginnt schon bei der sorgfältigen Auswahl der Rohware“, sagt Vincenz.
Ein Produkt, verschiedene Ergebnisse.
Das Ausgangsprodukt ist stets dasselbe – die Endergebnisse so verschieden, dass man es kaum glauben mag. Die Haut (die Pinters verarbeiten nur die reine Haut und kein Fell) wird gewaschen, mittels verschiedener Gerbstoffe und -verfahren behandelt, eingefärbt und in Form gebracht. Die eigentliche Gerbung erfolgt in rotierenden Fässern und ist ein Spiel mit Optik und Haptik, braucht Erfahrung und Spürsinn: Leder kann unglaublich fein und weich sein, geschmeidig und elastisch, beinahe wie ein Stoff. Oder hart, dick und fast unbiegsam. Und so ziemlich alles dazwischen. Beim Rundgang kommen wir an von der Decke hängenden und auf Böcken gestapelten Ledern und den verschiedensten Maschinen vorbei. Alle riesig und fast alle haben nur eine einzige spezifische Aufgabe.
Sein Leder verkauft Vinzenz Pinter vorrangig an weiterverarbeitende Betriebe. Der Bedarf an natürlichen Materialien sei wieder mehr gegeben, meint er und hat deshalb wenig Angst um sein Handwerk.
„LEDERVincenz Pinter, Gerber aus Pill
„Als Gerben wird generell die Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu Leder bezeichnet. Die Bearbeitung beginnt schon bei der sorgfältigen Auswahl der Rohware“, sagt Vincenz Pinter.





Johannes Gürtler ist einer von nur mehr sechs Sattlern in Tirol. Trotz schwieriger Umstände brennt er für seinen Beruf, in dem so viel Tradition steckt.
In seinem Haus am Pirchanger hat Johannes „Hannes“ Gürtler alles, was ihn ausmacht, unter einem Dach: seinen Beruf, die Sattlerei, und seine geliebte Musik. Durch einen Raum mit großen Tischen zum Zuschneiden der Lederhäute betritt man Gürtlers Büro mit einer kleinen Kaffeebar. Dort stehen auch Musikinstrumente von der Tuba über die Geige bis zur Ziehharmonika.
Schon der Vater von Johannes Gürtler war Sattler im benachbarten Stans. Hannes erlernte dieses Handwerk ebenfalls, zog nach Schwaz in der Silberregion Karwendel und machte sich 1984 selbstständig. Anfänglich, so erzählt er, übte er auch tatsächlich noch die klassische Sattlerei aus: „Zur Meisterprüfung habe ich für einen Noriker ein Kummet und ein komplettes Zuggeschirr gemacht. Auch für einen Pillberger Bauern habe ich einmal ein Geschirr für seinen Schlitten angefertigt.“ Doch Pferde als Arbeitstiere und Fortbewegungsmittel sind inzwischen bekanntermaßen selten geworden. Sättel, Zügel und dergleichen werden nicht mehr gebraucht, daher verdiente sich Gürtler sein Geld eine ganze Weile mit „Trachtensattlerei“: Ranzen für Musik

und Schützen, schöne Glockenriemen für das Vieh, wenn es von der Alm abgetrieben wurde. Dabei entstand jedoch ein skurriles Problem. Gürtler arbeitete zu gut: „Das Blöde, wenn man so etwas aus Leder macht, ist, dass der Kunde nie wieder kommt, weil die Sachen so lange halten.“
Ein „Sattel“ für die Boliden.
Daher stand eine neuerliche Spezialisierung an: Gürtler verlegte sich auf die „Autosattlerei“: Er macht nun Sitze und Verkleidungen für alte und neue Autos aus Leder, aber auch gemischt mit
hochwertigen Textilien. Darum kann es schon einmal vorkommen, dass rassige Boliden oder echte Oldtimer vor seiner Tür stehen. Über mangelnde Aufträge kann er sich dabei wahrlich nicht beschweren. Er hat sich in der Branche einen Namen gemacht und seine Kunden kommen nicht nur aus der Silberregion Karwendel, sondern aus ganz Österreich und Süddeutschland.
Dass er diese Laufbahn eingeschlagen hat, bereut Hannes Gürtler nicht: „Das Handwerk ist mein Leben – und die Musik.“ Dass er nur mehr einer von sechs Sattlern in ganz Tirol ist, das bedauert er indes sehr. Aber das sei nun einmal der asiatischen Konkurrenz und einem völlig veränderten Lebensstil geschuldet: „Früher war einfach alles aus Leder: Die Riemen, die das Sägewerk angetrieben haben, das Geschirr für den Ochsen, der den Pflug gezogen hat.“ Er selbst versucht, die Tradition hochzuhalten, denn immerhin sei Leder „nicht irgendein Material“. Wenn er davon spricht, dann nur mit Hochachtung: „Da gehört die Ehrfurcht vor der Kreatur dazu. Das war einmal ein lebendes Tier. Und damit muss man entsprechend umgehen. Wenn man das versteht, kann man sich auch hineinleben in den Beruf, in die Tradition.“
Doch auch die Tage seines Betriebes sind gezählt. Gürtler ist inzwischen 60 und hat nicht vor, bis weit über das Erreichen des Pensionsalters zu arbeiten: „Es ist ein wunderschönes Handwerk, aber es waren zu viele Nachtschichten dabei. Ich muss einfach irgendwann kürzertreten.“ Auch seine langjährige Partnerin Elfi hat das Geschäft sprichwörtlich Tag und Nacht mitgetragen. Seine Bemühungen, Nachfolger zu finden, waren vergeblich: „Es ist mir leider nicht gelungen, jemanden für den Beruf zu begeistern. Dann stirbt er in meiner Linie halt aus.“
„ESJohannes Gürtler, Sattler aus Schwaz
Regina Knoflach musste erst den Mut fassen, die Liebe zum Handwerk auch auszuleben und die Weberei zu ihrem Brotberuf zu machen. Doch nun ist sie bestrebt, ihr Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben.
Handweberei steht über der Tür, ein großes Gemälde an der Fassade zeigt eine Frau an einem Webstuhl. Es besteht kein Zweifel, welches Handwerk hier (wieder) ausgeübt wird. Dass Igls wieder eine Weberei hat, das verdankt es der Patscherin Regina Knoflach.
Knoflach hat studiert und war in zwei pädagogischen Berufen tätig. Doch Handwerk hat sie immer schon fasziniert: Sie hat gefilzt, gesponnen und auch die Weberei interessierte sie. Während einer Bildungskarenz machte sie schließlich eine Weberinnenausbildung in der Schweiz. Ab dem Zeitpunkt wusste sie, dass sie ihr Metier gefunden hatte. Im Geschenkladen „Tiroler Edles“ in der Innsbrucker Altstadt fand sie eine erste Vertriebsstelle für ihre Produkte: „Das war ein Kickstart für mich“, erinnert sie sich. 2016 eröffnete sie ihre Werkstatt in der Bilgeristraße in Igls: „Bis dorthin habe ich das in Heimarbeit gemacht. Der Laden war seit den 1950ern eine Handweberei gewesen, stand aber dann lange leer. Ich
Regina Knoflachhabe das neu aufgebaut.“ Während sie im vorderen Bereich einen kleinen Verkaufsraum hat, stehen in der Werkstatt die Herzstücke ihrer Produktion: zwei Webstühle.
Dort produziert Knoflach Gebrauchsartikel: Handtücher, Tischsets, Servietten, … und hat dabei eine strenge Philosophie: „Es ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Sachen im Alltag verwendet. Sie sind gut zu waschen, gut in der Haptik, einfach für den Zweck gemacht.“
„Vor rund 200 Jahren wurde fast alles in Handarbeit hergestellt, viel auch noch vor 100. Heute steht viel von diesem handwerklichen Wissen knapp vor dem Vergessen“, sagt Knoflach, wenngleich sie in ihrem Bereich momentan durchaus einen leichten Aufwind verortet. Dort hakt sie auch mit Kursen ein. Im heutigen Berufsleben sei es für viele Menschen nicht mehr selbstverständlich, am Ende ein fertiges, angreifbares Produkt zu haben. Und auch wenn die Technik des Webens – vor allem der Planung – ausgesprochen komplex ist, sei man in so einem Kurs sehr bald in der Lage, seine ersten Textilien selbst herzustellen. Inzwischen ist Knoflach nicht mehr nur bestrebt, ihr Wissen um die Weberei weiterzugeben, sondern hat mit vier weiteren Frauen den Verein „Roter Faden – Neue Wege zu altem Handwerk“ gegründet. Denn immer weniger Menschen wüssten um die einfachsten Techniken wie das Häkeln, das Stopfen oder Nähen. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, Wissen zu horten, sondern man muss es weitergeben.“ Und besonders von jungen Menschen würde dies auch gerne angenommen.
Ein Gefühl für Traditionen.
Dass Handarbeit auch einen höheren Preis als Industrieware hat, leuchtet ein. Aber gibt es auch genügend Kundinnen und Kunden für solche Produkte? Knoflach: „Da habe ich in gewisser Weise Glück, dass ich in Tirol lebe und arbeite, wo die Leute eine Affinität zu Traditionen haben. Alle, die ein Gefühl fürs Handwerk haben, wissen, dass es viel Aufwand ist. Darum erlebe ich selten Diskussionen um den Preis. Und Leute, die nicht so viel Geld haben, leisten sich halt nur ab und zu ein Stück.“

„HEUTE STEHT VIEL VON DIESEM HANDWERKLICHEN WISSEN WIRKLICH KNAPP VOR DEM VERGESSEN.“Regina Knoflach, Weberin aus Igls
Regina Knoflach produziert Gebrauchsartikel: Handtücher, Tischsets, Servietten, … und hat dabei eine strenge Philosophie: „Es ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Sachen im Alltag verwenden kann.“





Das Handwerk des Kachelofenbauens ist viele Jahrhunderte alt. Das Ende wurde ihm oft vorhergesagt, Beileidsbekundungen aber waren stets verfrüht. Darum sieht Hafnermeister Erich Moser der Zukunft des Berufes auch sehr gelassen entgegen.
Erich Moser ist überzeugt: „Mit offenem Feuer wäre eine alpine Region wie Tirol nie besiedelbar gewesen. Es hat dazu eine Technik gebraucht, die mit Energie sparsam umgeht und in den Alltag passt.“ Den Kachelofen. Und ihm hat der Hafnermeister sein ganzes Berufsleben verschrieben. Seit vielen Jahren baut er allerdings keine neuen Öfen mehr, sondern hat sich auf die Restaurierung von alten spezialisiert. Oft haben sie sogar einige Jahrhunderte auf den Kacheln, stehen in Bürgerhäusern, Schlössern oder Burgen. Er bildet außerdem akademische Restauratorinnen und Restauratoren in Kursen an der Universität Innsbruck aus.
Als Erich Moser 1973 seine Lehre begann, prophezeite man ihm eine düstere Zukunft: „Man hat mir gesagt, dass der Beruf sicher bald ausstirbt. Bei der Gesellenprüfung waren wir drei Lehrlinge für das ganze Bundesland Tirol und Südtirol. Es war mir aber egal.“ Seine Kollegen aus der Zunft hatten ihm nämlich auch von deren Erfahrung erzählt, die da lautete: „Wir haben immer von unserem Beruf leben können. Und je schlechter die Zeiten waren, desto
Erich Moserbesser.“ Das hat sich inzwischen auch für Moser bewahrheitet: „Ich erlebe nun die vierte Energiekrise und mit jeder wird mein Beruf interessanter. Ich habe nie etwas anderes tun müssen, als Kachelöfen zu bauen.“
Ein Hafner für den Fürstenhof.
Erste schriftliche Zeugnisse vom Hafnerhandwerk stammen aus dem 13. Jahrhundert, ein gewisser Urs aus Brixen in Südtirol baute damals Öfen und hinterließ seine Spuren. Verbreitet waren und sind Kachelöfen im Alpenraum von der
Schweiz bis nach Slowenien. Zentren der Ofenbaukunst waren unter anderem Brixen, Trient, Winterthur oder auch Innsbruck. Die Regenten Tirols hatten sogar ihre Hofhafner. Einer der bekanntesten von ihnen war Hans Gantner, der Ende des 16. Jahrhunderts für Erzherzog Maximilian III. arbeitete, aber weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt war. „Kachelöfen sind nicht nur Wärmespender, sondern vor allem auch kunst- und kulturhistorische Objekte“, findet Moser, der gemeinsam mit Karl C. Berger vom Volkskunstmuseum Öfen aus dem ganzen Land akribisch erforscht hat.

Statussymbol und politisches Statement.
In den Stuben des Volkskunstmuseums stehen zahlreiche ausnehmend schöne dieser kunsthistorischen Zeugnisse, viele Schätze – in der Hauptsache Kacheln – lagern auch in den Kellern des Hauses. Früher, so erzählt Moser, waren Ofenbauer und Kachelhersteller dieselbe Person. Später sind daraus zwei Berufe geworden. Die alten Keramikteile, die in den Tiefen des Museums liegen, sind großteils alt und handgefertigt. „Das Schöne an historischen Kacheln ist, dass Fehler nichts Ungewöhnliches sind. Aber an einem Ofen hebt sich die Summe von Fehlern dann auf. Die industrielle Produktion versucht hingegen, Fehler zu vermeiden.“ Und das nehme dem Ofen seine Individualität, seinen Charakter.
Mit diesem Rückblick auf Jahrhunderte an Tradition und Geschichte ist Erich Moser um das Handwerk des Hafners nicht bange: „Der Kachelofen ist im Alpenraum nicht nur deswegen so beliebt, weil er ein nettes Objekt ist, sondern weil er den Menschen einen Nutzen bringt. Und wenn man diesen Weg nicht verlässt, dann ist ein Ende nicht abzusehen.“
„ICH ERLEBE NUN DIE VIERTE ENERGIEKRISE UND MIT JEDER WIRD MEIN BERUF INTERESSANTER.“Erich Moser, Hafnermeister aus Innsbruck
Die Rohrmosers führen ihre Drechslerei im Zillertal in der nunmehr dritten Generation. Und auch wenn das Handwerk selbst immer seltener wird, können sie persönlich im Moment über eines wahrlich nicht klagen: Arbeitsmangel.
Michael Rohrmoser wurde zwar nicht ins kalte Wasser, dafür aber quasi mitten in die Zirbenspäne geworfen. Sein Vater hatte 1975 in Stumm einen Drechslereibetrieb gegründet, Michael ging daraufhin von 1977 bis 1980 im Stubaital in die Lehre. Und schon wenig später, Anfang der 1980er-Jahre, musste er den Betrieb übernehmen, weil der Vater einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nun ist Michael Rohrmoser kurz davor, die Drechslerei an seinen Sohn Alexander zu übergeben: „In zwei Jahren ist es so weit.“
Abheben von der Masse.
Im Moment haben Vater, Mutter und Sohn kaum Zeit, über die weitere Zukunft nachzudenken. Sie stecken nämlich bis über beide Ohren in Holzspänen. Für Michael Rohrmoser hat in den letzten zwei Jahren ein unerklärlicher Wandel stattgefunden: „40 Jahre lang bin ich gerannt und habe geschaut, dass wir genug Aufträge ha-
ben, aber seit Corona können wir uns gar nicht mehr wehren vor Arbeit.“ Der Renner im Sortiment: die Zirbenschüssel. Viele Tausende davon drehen sie pro Jahr. Damit beliefern sie Handwerks- und Haushaltsgeschäfte, erzählt Mutter Marlies Rohrmoser, die für den Verkauf und Versand zuständig ist: „An Souvenirläden liefern wir nicht. Dazu sind wir zu hochpreisig, weil alles Handarbeit ist. Aber damit punkten wir auch.“ Viele Kunden kämen aus der Gastronomie und Hotellerie, ergänzt Sohn Alexander: „Wir machen viel auch auf Wunsch und Maß.“
Lange vorbereitet, schnell gedreht.
Das Holz, das die Rohrmosers verarbeiten, kommt teils aus unmittelbarer Nachbarschaft: Die Zirbe direkt aus dem Zillertal, Ulme und Nuss aus Österreich. Rund 100 Kubikmeter davon verarbeiten sie pro Jahr. Die fertigen Zirbenstücke bleiben unbehandelt, Ulmenholz wird geölt. Die wahre Kunst des Drechselns, so erklären sie, sei nicht das Drehen eines Stücks, sondern die Vorbereitung: Das Holz kaufen – oder sogar selbst schlagen, entrinden, stapeln, zuschneiden. Eine Schale selbst ist dann in zwei bis vier Minuten aus dem Block gedreht.

Früher hatte die Drechslerei Rohrmoser auch Lehrlinge. Doch das ist bei der vielen Arbeit, die Vater und Sohn inzwischen haben, unmöglich geworden: „Dass einer eine Schüssel drehen kann, das geht schnell, aber bis er alles beherrscht, dauert es Jahre. Und es muss entweder er mir zusehen oder ich neben ihm stehen bei der Arbeit“, erklärt Alexander die Problematik. In dieser Zeit könne er selbst zig Stücke produzieren. Und so kommt es, dass die Drechsler zusehends weniger werden. Die Großen, so erzählt Michael Rohrmoser, hätten alle schon aufgehört. Jetzt gebe es noch Betriebe in ihrer Größe oder kleiner, und eben die Hobbydrechsler. Dabei wäre ihnen Konkurrenz durchaus recht, sagt Vater Rohrmoser: „Weil jeder macht andere Sachen und je mehr unterschiedliche Auswahl auf dem Markt ist, desto besser ist es für die Nachfrage.“
Einstweilen düst der Sohn von Alexander noch mit dem Fahrrad durch die Werkstätte in Stumm und mitten durch die Späne. Doch wer weiß: Vielleicht greift auch er einst zum Eisen und stellt sich an die Drehbank, so wie es Großvater und Vater getan haben.
„SEITMichael und Alexander Rohrmoser, Drechsler aus Stumm im Zillertal
Das Holz, das die Rohrmosers verarbeiten, kommt teils aus unmittelbarer Nachbarschaft: Die Zirbe direkt aus dem Zillertal, Ulme und Nuss aus Österreich.




Few things are more satisfying and fulfilling than creating things. The knowledge that the result is a work of one‘s own hands and thoughts is wonderful. Traditional craftsmanship, however, is increasingly disappearing. Fortunately, there are still people who preserve such crafts.

In Tyrol they still exist, these small craft businesses that keep their trades and knowledge alive with both reverence for tradition and a great deal of foresight. “In a way, I’m lucky to live and work in Tyrol, where people have an affinity for tradition. Everyone who has a feeling for crafts knows that it takes a lot of effort,” says Regina Knoflach. She is a weaver in Igls and produces everyday items such as towels, placemats and napkins. Knoflach has a strict philosophy: “For me, it is a very important aspect that the products are used in everyday life. They wash well, have a good feel, and are simply made for a purpose.”
A sense of tradition.
Regina Knoflach can’t complain about a lack of buyers and neither can master stove maker Erich Moser from Innsbruck. The craft of building tiled stoves is many centuries old. Its demise was often predicted, but any sentiments of sympathy were always premature. This is also the experience of Moser, who was told during his apprenticeship: “We have always been able to live from our profession. And the worse times were, the better.” This has since proven true for Moser as well: “I’m now experiencing my fourth energy crisis, and
with each one, my job becomes more interesting. I’ve never had to do anything but build tile stoves.” Michael and Alexander Rohrmoser have a similar experience with their turnery workshop in Stumm in the Zillertal Valley. Even though the craft itself is becoming increasingly rare, there is one thing they cannot complain about at the moment: lack of work. “For 40 years I had to make sure we had enough orders, but since Corona we almost can’t keep up with work.” The top seller in the range is the pine bowl. They turn many thousands of them a year. Given that, it’s good that the next generation is almost ready to go.
Something that Johannes Gürtlern, a saddler from Schwaz, would also like to see. In terms of succession, however, things are looking rather bleak for him, even though he has found his field and has plenty of work. He has specialized in “car saddlery”, making seats and trim for old and new cars. Just like Geber Vincenz Pinter from Pill, he is active in a niche market. Pinter makes leather from animal skin: unbelievably fine and soft, supple and elastic, but also hard, thick and almost unbendable, thus demonstrating emblematically on a small workpiece how diverse and beautiful craftsmanship can be.



Die Grillsaison ist 365 Tage lang. Wenn es in der kalten Jahreszeit am Grill heiß hergeht, sorgt das für ein besonders atmosphärisches Erlebnis. Wie man an das Wintergrillen am besten herangehen sollte, weiß Meistermetzger, Fleischsommelier und Grillveteran Helmut Krösbacher aus langjähriger Erfahrung.

Wer sagt, dass sich das Erlebnis Grillen auf die warme Jahreszeit beschränken muss? Das kulinarische Spiel mit dem Feuer ist auch – und vielleicht sogar ganz besonders – in der kalten Jahreszeit ein Fest für die Sinne. Wenn es draußen kalt und die Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt ist, der Schnee unter den Sohlen knirscht, weckt das vertraute Knistern eines Feuers im Menschen eine besondere Stimmung. Eine archaische Urkraft, ein Gefühl der Zufriedenheit und Sicherheit. Der Stubaier Meistermetzger und Fleischsommelier Helmut Krösbacher ist einer, bei dem es im Winter am Grill schon fast traditionell heiß hergeht. Die Faszination des Wintergrillens vermittelt er einschlägig Interessierten übrigens auch im Rahmen seiner Grill-Academy. Gerade im Winter ist es klug, sich für den Griller ein optimales Plätzchen zu suchen, an dem man nicht ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt ist. Die Standortwahl ist noch wichtiger als im Sommer, macht das Wintergrillen doch weder im Gatsch noch auf Eis besonders viel Freude.
In Sachen Qualität überlässt Krösbacher schon von Berufs wegen nichts dem Zufall. „Mein Ziel ist es, gutes Fleisch weiter zu veredeln“, sagt der Metzger, der auf unterschiedliche Methoden der Fleischreifung setzt. Beim Rindfleisch schwört der Meister vor allem auf die Trockenreifung (dry aged), aber auch auf das Reifen im Fett (butter aged) und sogar in der Buchenholzasche. Das gängige Reifen im Vakuumbeutel (wet aged) gehört dagegen nicht zu den präferierten Methoden des Experten, weil „die Milchsäurebakterien das Fleisch bei längerer Reifung leicht säuerlich machen“. Einmal hat Krösbacher ein Edelstück vom Rind sogar drei Wochen lang zur Reifung in Schokolade eingelegt. Das schokoladig-herzhafte Resultat dieses Experiments dürfte besonders gut in die Wintermonate passen.
Im Winter grillt man meistens anders.
Im Winter wird anders gegrillt als im Sommer. Sowohl was die Methoden betrifft als auch die Zubereitungsarten. „Im Winter grillt man überwiegend mit
„DAS

Am gemauerten Griller mit der massiven Steinplatte ist das Wintergrillen – zumal bei angenehmen Außentemperaturen – ein einziger Genuss, der Lust auf mehr macht.


indirekter Hitze. Man macht Großstücke im Ganzen, die auch gerne etwas deftiger sein dürfen als im Sommer“, meint Helmut Krösbacher. Die Bedingungen im Winter sind anders, so dass man sich bei Minusgraden lieber nicht dauernd am Grill aufhält. Deshalb empfiehlt es sich, Fleischstücke zu verwenden, die nicht permanent betreut werden müssen. Im Winter läuft schließlich auch der Smoker zur Hochform auf. Darin wird das Grillgut ebenso langsam wie schonend gegart, bis es schließlich widerstandslos zerfällt, wie von Pulled Pork und Co. bekannt. Auch ein Dutch Oven, ein gusseiserner Feuertopf, der über ein offenes Feuer gehängt oder direkt auf die Kohlen gestellt werden kann, macht im Winter gute Figur. Generell empfiehlt der Meister, beim Grillen mit Kerntemperaturfühler zu arbeiten, damit man einerseits die volle Kontrolle über sein Grillgut behält und andererseits nicht so häufig den Deckel aufheben muss. Das erschwert es nämlich, eine konstante Temperatur zu halten. „Diese sackt im Winter schneller und stärker ab als im Sommer, wenn man den Deckel aufmacht“, weiß der grillende Metzger. „If you are looking, you’re not cooking“, heißt es in Grillerkreisen. Das gilt freilich nur, wenn es auch einen Deckel gibt.
In Sachen Aromatik gibt es zwischen auf Holzkohle oder Gas Gegrilltem keine signifikanten Geschmacksunterschiede. Die Wahl des jeweiligen Grills ist unter Enthusiasten

„IM
GRILLT MAN ÜBERWIEGEND MIT INDIREKTER HITZE. MAN MACHT GROSSSTÜCKE IM GANZEN, DIE AUCH GERNE ETWAS DEFTIGER SEIN DÜRFEN ALS IM SOMMER.“
dennoch so etwas wie eine Glaubensfrage. Viel diskutiert, aber ohne eine letztgültige Lösung. Wichtiger als die Wahl der Hitzequelle erscheint Krösbacher ein guter Grillrost, der Wärme entsprechend speichern kann. „Edelstahl und Guss haben die beste Wärmeleitfähigkeit, das sorgt für gute Röstaromen“, weiß der Grillexperte. Gerade günstige Modelle sparen häufig an der Qualität des Grillrosts. Eine massive Steinplatte ist freilich auch eine sehr gute, wenn auch seltenere Variante. Ein Holzgrill sorgt mit seinem Holzkohlerauch natürlich im Vergleich zum geruchsneutralen Gasgrill für eine würzigere Umgebungsluft, die so richtig Appetit auf Gegrilltes macht. Wesentlich für den Geschmack des Gegrillten ist aber die sogenannte Maillard-Reaktion. Dabei handelt es sich um eine komplexe nichtenzymatische Bräunungsreaktion, die bis heute nicht völlig verstanden wurde. Macht aber nichts, schmeckt trotzdem großartig.
Beginnend mit dem Herbst bis weit in den Winter hinein ist die beste Zeit, Wild drauflos zu grillen. Indem man etwa ganz klassisch einen Hirschrücken zum wohltemperierten Entspannen auf den Grill packt oder im Dutch Oven ein Hirschgulasch schmort. „Wild ist sensibel, weil das Fleisch so mager ist“, sagt Krösbacher. Das heißt, dass man die Gartemperatur im Auge behalten und es generell langsam angehen sollte. Helmut Krösbacher hat einen Tipp parat, der dafür sorgt, dass das kostbare Wildbret garantiert nicht zäh wird: „Man kann das Teil mit grünem Speck umwickeln, der sehr gut mit dem Wildgeschmack harmoniert. Oder man kann das Fleisch sehr gut spicken, auch wenn diese Technik ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Das Spicken wird irgendwann wieder in Mode kommen, weil es viele Möglichkeiten bietet, zusätzliche Aromen ins Fleisch zu bringen.“ Apropos Mode: Der Grillspieß galt vielen Grillenthusiasten lange als etwas zu spießig, hat aber auch und gerade im Winter seine Berechtigung. Wild ist besonders gesund, weil es nur die besten Kräuter und Gräser frisst, viel Bewegung hat und oft direkt vor der Haustür lebt. Regionaler geht es also kaum. „Das Gril-
Für den Tiroler Weinfachhandel steht die Leidenschaft für österreichische Weine an erster Stelle. Darüber hinaus verfügen die Weinexperten des Landes auch über viel internationales Wissen.

Wein ist ein Produkt wie kein anderes. Es braucht viel Erfahrung und Wissen, um passend zum Anlass und der Speise den entsprechenden Wein auszuwählen. Das können nur Spezialisten, die sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Ein Tiroler Weinfachhändler ist dabei immer in Ihrer Nähe. Wenn Sie kompetente Beratung suchen oder neue Weine verkosten wollen: Der Weinfachhändler freut sich darauf, Sie umfassend und kompetent zu beraten
Aus Tradition.
Der Weinfachhandel hat in Tirol eine lange Tradition: Manche Familienbetriebe existieren bereits in vierter oder fünfter Generation. Heute bietet der Tiroler Weinfachhandel ein breit gefächertes Sortiment von Weinen und Spezialitäten aus Österreich und der ganzen Welt, die den Weinliebhaber erfreuen. Mit größter Leidenschaft werden darüber hinaus neue Winzer, Weinbaugebiete und internationale Winzer gesucht
Der Tiroler Weinfachhandel steht für höchste Kompetenz, Vielfältigkeit, Qualität und Leidenschaft zum Produkt. Die persönliche Betreuung der Kunden durch Experten hat obersten Stellenwert. Weitere Info unter www.wein-tirol.at

len von Großstücken ist immer auch eine Angelegenheit, die üblicherweise in Gesellschaft stattfindet. Grillen ist dadurch auch ein verbindendes Ereignis, das Freunde und Familie zusammenbringt“, meint der Metzger zur sozialen Dimension des Spiels mit dem Feuer. Für den Grillverantwortlichen ist das Handling von Großstücken meist stressfreier als das Hantieren mit Kurzgebratenem im Sommer. Vorbereitung zählt, den Rest erledigt die möglichst konstante Hitze im Griller. Weil es sich um größere Fleischstücke handelt, sinkt auch die Gefahr, dass das Fleisch am Grill unnötigerweise ein zweites Mal stirbt. Das Aromenprofil
Jahrelang genoss Fett einen eher zweifelhaften Ruf, heute ist es wieder dick da. „Alles, was fettmarmoriert ist, macht geschmacklich etwas her“, weiß Metzgermeister Helmut Krösbacher, der dazu rät, nicht nur die klassischen Edelteile, die A-Cuts, sondern auch die B- und C-Cuts zu kaufen. Die sind nämlich, vor allem gesmoked oder geschmort, ein echtes Highlight am Grill.
hängt sowohl von der Temperatur im Griller als auch von der Garzeit ab. Mehr Hitze erzeugt mehr Röstaromen, birgt aber die Gefahr, dass das Fleisch zu trocken wird. „Beim Grillen ganzer Stücke kann man sich damit behelfen, im Griller eine Schale mit einer Flüssigkeit zu platzieren, damit sich Dampf entwickeln kann. Für Wildfleisch nehme ich meistens einen Rotwein, für Schweinefleisch Bier“, rät der Meister, der seinen Hirschrücken bevorzugt bei 120 °C im Wassersmoker macht. Das dauert ein paar Stunden, zahlt sich aber aus. „Das langsame, schonende Grillen wirkt sich extrem positiv auf die Wasser-Eiweiß-Bindung aus. Das ergibt ein besonders saftiges Fleisch.“ Beim Marinieren rät Krösbacher generell dazu, das Salz anfangs lieber wegzulassen und stattdessen stärker mit Gewürzen zu arbeiten. „Längeres Marinieren ist bei ganzen Stücken besonders wichtig, weil die Gewürze besser ins Fleisch einziehen“, so der Grillprofi.


Damit nicht der Eindruck entsteht, dass es beim Wintergrillen nur ums Fleisch ginge, sei noch erwähnt, dass auch Wintergemüse am Teller gute Figur macht. Am besten, wenn man es im Ganzen in der Glut verbuddelt, eine Zeit lang vergisst und – wie in der Vorspeisen-Rezeptempfehlung – dünn aufgeschnitten genießt. Marian_Kröll
Es raucht, es zischt, es brutzelt: Kräuter wie Rosmarin und Thymian dienen nebst Knoblauch als Aromaten. Der Fantasie sind aber keine Grenzen gesetzt, nur sollten die Aromaten den Eigengeschmack von gutem Fleisch und Gemüse nicht überlagern. TIPP: Wer einmal gut marinierte Kohlsprossen scharf angebraten hat, wird sie nie wieder weichkochen wollen.
Winter in der Tiroler Zugspitz Arena zeigt sich von der vielfältigen Seite. Sieben abwechslungsreiche Skigebiete sorgen für reichlich Skiaction. Doch auch abseits der Piste gibt es mit einem weitläufigen Loipennetz, Lamawanderungen, Rodelbahnen, Winterwanderwegen und vielen weiteren Aktivitäten einiges zu erleben!

Tel.: +43 5673 20 000 | info@zugspitzarena.com

Zipfer-Genießer dürfen’s jetzt persönlich nehmen: Ab sofort stehen auf den Urtyp-Flaschen die Namen unserer Fans! Und selbstverständlich können sie auch beim Lieblingswirt ganz persönlich anstoßen: Für das perfekt gezapfte Zipfer gibt’s Bierdeckel mit dem Etiketten-Design und vielen verschiedenen Namen. Darauf ein Prost – urtypisch wie du!
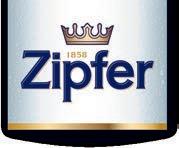

Äpfel (einer pro Portion)

Cremiges Naturjoghurt Cashewnüsse Honig Haferkekse

» Die Äpfel in die Glut geben und anschließend mit dem verkohlten Holz bzw. Holzkohle vollständig bedecken.
» Nach ca. 30 Minuten die Äpfel aus dem Feuer holen.
» Die äußere, verkohlte Haut abschälen bzw. mit einem Messer entfernen.
» Apfelstücke auf einem Teller oder in einer Schale anrichten, ein paar Kleckse Naturjoghurt dazugeben, mit Honig, Cashewnüssen und zerriebenen Haferkeksen anrichten.

So wie den Apfel kann man auch Gemüse wie Kohlrabi, Sellerie und Rote Bete den Flammen übergeben. Nach zwei Stunden in der Glut ist das Gemüse außen verkohlt, aber innen wunderbar zart und unglaublich geschmacksintensiv. In Scheiben schneiden, mit Schafsjoghurt, altem Balsamico, scharfem Paprika, grobem Salz und einem Schuss Olivenöl servieren.



Seit 1267 in Eppan / Südtirol und seit 1944 in Nordtirol bestens etabliert.
1944 Gründung durch Peter Meraner sen. (Winzer aus Südtirol)
1956 Übernahme des Betriebes durch seine Söhne Peter und Edi
1988 Erwerb der Linherr GmbH und Übersiedelung zum Rennweg 16 in Innsbruck
1995 Übernahme der Geschäftsleitung durch Dietmar Meraner
1995 Projektstart „Hamburger Fischmarkt“, jetziges 27. Fischvergnügen am Inn 2022
1997 Kauf der Geschäftsanteile Weinkellerei P. Meraner GmbH und Linherr GmbH durch Dietmar Meraner-Pfurtscheller

2005 Projektstart wellwasser® - „aus Leitungswasser wird wellwasser®“
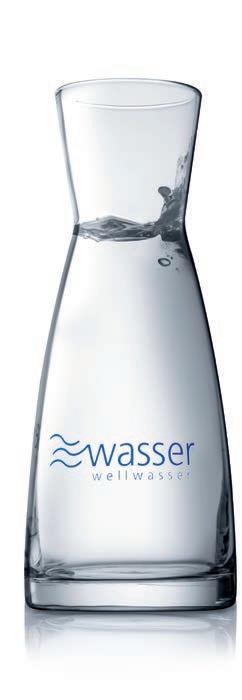
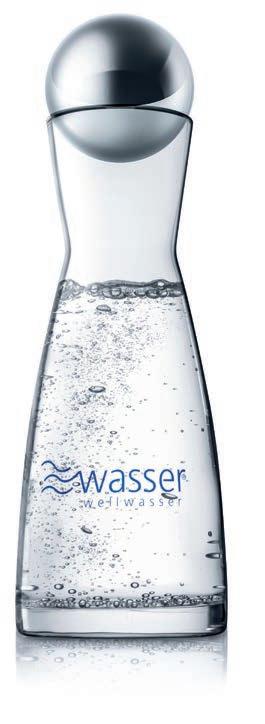


2021 Verein Weinwerbung TIROL – der Tiroler Weinfachhandelübersiedelt zum Rennweg 16 in Innsbruck
ohne Plastik ohne Transportwege und Abgase direkt aus der Leitung keimfrei gefiltert mit natürlichem Mineralstoffgehalt
Die Wellwasser Technology GmbH wurde als Finalist beim Energy Globe Austria in der Kategorie WASSER wausgezeichnet.
Der Energy Globe Award ist der weltweit bedeutendste Umweltpreis und zeichnet jährlich, auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, herausragende nachhaltige Projekte aus.

 Foto: Gerhard Berger
Foto: Gerhard Berger
aus Leitungswasser wird wellwasser® still oder perlend
Das ganze Jahr über ist Tirol ein Kleinod des Genusses und reich an regionalen Lebensmitteln. Neben Produkten, die das ganze Jahr über erhältlich sind, gibt es – von Natur aus quasi – immer wieder Schmankerln, die die Raffinessen jeder Jahreszeit in die Küche bringen. Auch beim Fleisch.
as Fleisch vom Grauvieh Almochs mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ gilt seit jeher als eine besondere regionale Spezialität. Der typische Rindfleischgeschmack und die Saftigkeit sind bei Feinschmeckern sehr beliebt. Das Geheimnis liegt einerseits in der autochthonen Rasse „Tiroler Grauvieh“ und andererseits in der mindestens einmaligen Alpung der Tiere
D
Lust bekommen?
Erhältlich ist der „Qualität Tirol“ Grauvieh Almochs ab sofort in den Filialen von Hörtnagl, Rezeptinspirationen haben wir hier für Sie.

im Sommer in Kombination mit einer artgerechten Fütterung. Das Fleisch vom Grauvieh Almochs eignet sich für die Zubereitung aller Rindfleischköstlichkeiten, besondere Spezialitäten vom Grauvieh Almochs sind der klassische Braten oder die Rindsschnitzel.
Weitere Infos und Bezugsquellen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter qualität.tirol
Zutaten für 6 Personen
1,5 kg Tafelspitz vom „Qualität Tirol“ Grauvieh Almochs
2 Rinderknochen (ca. 500 g)
1 „Bio vom Berg“ Zwiebel
3 „Qualität Tirol“ Karotten ½ Sellerie
2 Zweige Liebstöckel
2–3 „Bio vom Berg“ Knoblauchzehen
1 TL Pfefferkörner
2 Lorbeerblätter 3 bis 4 l Wasser Salz
2 EL „Qualität Tirol“ Modlbutter
500 g „Qualität Tirol“ Erdäpfel (vorwiegend festkochend)
60–80 g „Qualität Tirol“ Modlbutter Muskat Salz
» Gemüse schneiden, in Butter rösten und mit kaltem Wasser aufgießen.
» Knochen, Pfefferkörner, Lorbeerblätter zugeben und aufkochen lassen.
» Den Tafelspitz in den kochenden Sud geben und ca. 2 Stunden leicht wallend köcheln lassen (nach der ersten Stunde leicht salzen).
» Tafelspitz aus der Suppe nehmen, Gemüse und Knochen abseihen. Die Suppe zur weiteren Verwendung mit Salz abschmecken und aufbewahren.

» Erdäpfel schälen, in Salzwasser kochen, zerstampfen und mit zerlassener Nussbutter (erhitzte Butter) vermischen. Mit Salz und Muskat abschmecken.
» Karotten und Sellerie in Stifte schneiden und einige Minuten in Salzwasser bissfest kochen. Auf dem Stampf anrichten und eine Scheibe Tafelspitz dazugeben.
Kochzeit: 3 Stunden
Zutaten
1,2 kg Beiried vom „Qualität Tirol“ Grauvieh Almochs Salz, Pfeffer, 2 EL Öl
2 EL „Qualität Tirol“ Senf „Qualität Tirol“ Butterschmalz (zum Anbraten)
5 „Qualität Tirol“ Karotten (ca. 400 g) 250 ml „Bio vom Berg“ Schlagobers Salz, 1 Knoblauchzehe
» Öl, Senf, Salz und Pfeffer vermischen. Mit dieser Marinade das Fleisch bestreichen und einmassieren. Das Beiried gut einpacken und einige Stunden ziehen lassen.


» In einer ausreichend großen Pfanne „Qualität Tirol“ Butterschmalz erhitzen und darin das Beiried auf allen Seiten anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und auf ein Backblech geben.
» Das Fleisch im vorgeheizten Backrohr bei 80 °C Heißluft garen (ca. 2 Stunden), bis es eine Kerntemperatur von 55 bis 57 °C erreicht hat (medium). Aus dem Backrohr nehmen und noch ca. 10 Minuten rasten lassen.
» In der Zwischenzeit die Karotten waschen, schälen und klein schneiden. Die Karotten mit dem Knoblauch in der Sahne kochen, anschließend mit einem Pürierstab fein pürieren und mit Salz abschmecken.
» Das Fleisch mit einem scharfen Messer in dünne Scheiben schneiden und mit dem Karottenmousseline servieren.
Kochzeit: 2 Stunden 30 Minuten (+ Marinieren)
Zutaten für 2 Personen
300 g Filet vom „Qualität Tirol“ Grauvieh Almochs ½ rote Zwiebel
3 Essiggurken
1 kl. Bund Petersilie
1 EL Senf (Dijon)
2 Dotter vom „Qualität Tirol“ Goggei ½ TL Paprikapulver (edelsüß) Salz & Pfeffer
1 Baguette, Rucola
» Das Rinderfilet sehr fein schneiden und in eine ausreichend große Schüssel geben.
» Zwiebel, Essiggurken und Petersilie ebenfalls fein schneiden und zum Fleisch geben.
» Senf, Dotter und Paprikapulver in die Schüssel geben und kräftig umrühren.
» Die Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken und bis zur Verwendung kühlstellen.
» Rucola waschen und auf einem Teller verteilen. Das Tatar auf dem Rucola anrichten und mit getoastetem Baguette servieren.
Kochzeit: 20 Minuten


Bücher von und über Tirol. Unterhaltsames, Informatives, Räuchern in den Alpen
Altes Wissen und stärkende Rituale für alle Lebenslagen Michaela Thöni-Kohler, Tyrolia Verlag, 240 Seiten, EUR 27,00
Räuchern ist auch heute noch in vielen Teilen der Alpen und zu unterschiedlichen Gelegenheiten gelebtes Brauchtum. Wie gut es auch und gerade in unsere hektische Welt passt, zeigt Michaela Thöni-Kohler. Nach einer kleinen Einführung ins Riechen und in die Kulturgeschichte des Räucherns stellt sie 80 einheimische oder seit langem gebräuchliche Räucherpflanzen ausführlich vor. Sie beschreibt ihre seelische und körperliche Wirkung als Räucherware, informiert über Traditionen und Verwendung in der Volksheilkunde und gibt Tipps, welche Pflanzen sich am besten zu speziellen Räuchermischungen kombinieren lassen.
Gundi Herget, Droste Verlag, 168 Seiten, EUR 16,50
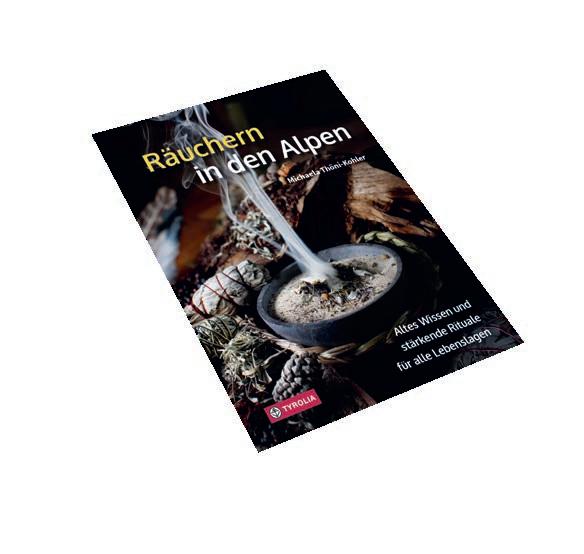
Die Autorin ist ja der Meinung, dass es in Tirol 8.000 Glücksorte gibt – mindestens. Aber sie musste sich eben auf 80 beschränken. Und die sind eine bunte Mischung aus Bekannten und Überraschendem geworden, verteilt quer übers Land. Ein weiterer Band aus der beliebten Serie „Glücksorte“, die inzwischen 150 Bücher umfasst.
Georg Neuhauser, Tobias Pamer, Andreas Maier und Armin Torggler, Tyrolia-Verlag, 472 Seiten, EUR 48,00

Einige Bergbaugebiete im historischen Tirol haben in der Geschichte Berühmtheit erlangt und für Geld gesorgt: Silber in Schwaz, Salz in Hall, Erz in Ridnaun. Im vorliegenden Buch sind aber wirklich alle Abbaugebiete mit zahlreichen Bildern von der Urgeschichte bis in die Gegenwart aufgelistet. Ein Muss für Liebhaber dieser Materie!

Andreas Schett/Markus Hatzer, Haymon Verlag, 132 Seiten, EUR 16,00
Das Cover des aktuellen QuartHeftes ziert eine Dunkelkammer. Im Inneren der Ausgabe wird es dann auch so richtig reich an Sprach- und sonstigen Bildern. Autorinnen sind u. a.: Katja Lange-Müller, Terézia Mora, Kathrin Röggla und Anna Weidenholzer. Die Beilage kommt von der aus Osttirol stammenden und in Amsterdam lebenden Künstlerin Margret Wibmer.

dr.-Felix-bunzl-strasse 1 • a-6112 wattens • tel.+43 5224/57402 • mail. ruth@apfis.at • www.apfis.at geöffnet: MO-fr 09.00 bis 12.00 uhr und 15.00 bis 18.00 uhr • SA 09.00 bis 12.00 Uhr 1 Stunde kostenlos parken (Tiefgarage gegenüber)




Das polychromelab aus Serfaus hat einen Oberstoff für Sport- und Funktionsbekleidung entwickelt, der kühlt, wenn’s warm ist, und wärmt, wenn’s kalt ist. Über die Zeit haben sich daraus bereits einige spannende Kooperationen mit internationalen Brands entwickelt. Dazu betreibt das polychromelab seit rund fünf Jahren eine eigene Alpakazucht. Die wunderbar fein-weiche Wolle der Tiere wird unter anderem zu flauschig-leichten Beanies und Socken verarbeitet. Erhältlich in verschiedenen Farben um je 69 Euro im Onlineshop unter www.polychromelab.com

Es ist das wohl unterschätzteste der fünf Häuser der Tiroler Landesmuseen. Wenn Sie sich für die Tiroler Geschichte interessieren, sollten Sie es dennoch besuchen, weil diese dort wirklich schön aufbereitet wird – ergänzt durch wechselnde Sonderausstellungen. Mit der Ausstellung „Geld macht Geschichte“ gewähren römische Münzen aus der Archäologischen Sammlung aufschlussreiche Einblicke in die historische und wirtschaftliche Entwicklung des Alltiroler Raumes. Zu sehen von 2. Dezember 2022 bis 8. Oktober 2023. www.tiroler-landesmuseen.at

Hey honey! Ein Bienenstock ist ein wahres Wunderwerk und bringt weit mehr hervor als Honig, auch wenn der uns schon vollkommen reichen würde. Bei der Tiroler Gebirgsimkerei Farthofer aus Schwaz gibt’s jedenfalls ganz wunderbaren Honig. Und mehr. www.fleissigerwilli.com

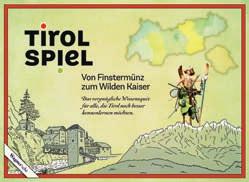
Die Wagner’sche in der Innsbrucker Museumstraße zählt zu unseren absoluten Lieblings-Buchhandlungen. In entspannter Atmosphäre schmökert man sich hier durch und findet unter anderem auch das „Tirol Spiel“ aus dem Eigenverlag, mit dem man das Bundesland spielerisch (neu) entdeckt und vieles lernt. Expertinnen und Experten aus den einzelnen Regionen Tirols haben dafür informative, aber auch kuriose Wissensfragen aus den Kategorien Sport, Geschichte, Kultur und Natur für Sie zusammengetragen. Das ist übrigens auch für Einheimische spannend. www.wagnersche.at
Alpiner Sirup. In die Flaschen von nako Sirup dürfen nur natürliche Inhaltsstoffe. Hergestellt werden die mittlerweile sechs Sorten allesamt in Handarbeit in Thaur. Schmecken pur und besonders gut in Cocktails. 0,2 Liter um 4,90 Euro / 0,5 Liter um 11,90 Euro. www.nako.tirol

Vor allem im Winter geht bei uns nichts ohne bequeme und warme Patschen, also geschlossene Hausschuhe, an den Füßen. Die können natürlich ganz gewöhnliche 08/15-Modelle sein, weil wir es aber gern besonders und vor allem regional mögen, empfehlen wir Ihnen die handgemachten Varianten von Guite Schuiche, einer Schuhmanufaktur aus dem Stubaital. Jedes Filzpatschen-Paar ist ein echtes Unikat aus natürlichen (wiederverwerteten) Materialien und wird nach alter Überlieferung hergestellt. Die traditionellen Patschen gibt’s ab 80 Euro. Und sollten Sie über die „Guiten Schuiche“ gestolpert sein –das heißt so viel wie „gute Schuhe“. Und das sind sie definitiv. www.guite-schuiche.at

„Der große Reichtum unseres Lebens sind die kleinen Sonnenstrahlen, die jeden Tag auf unseren Weg fallen.“Hans
Nach vielen Jahren in Tophäusern quer über den Globus ist Johannes Nuding nach Hall zurückgekehrt. Was uns freut, weil er eine wahre Bereicherung für das kulinarische Tirol ist. Nuding war Praktikant bei Johann Lafer, arbeitete bei Johanna Maier, ging ins kulinarische Epizentrum nach Paris und kochte sich dort unter Joël Robuchon in die klassisch französische Haute Cuisine ein. Als er auf Kochlegende Pierre Gagnaire stieß, blieb er über ein Jahrzehnt an dessen Seite – zuletzt in London, wo er Chefkoch des hochdekorierten „Sketch – The Lecture Room and Library“ in Mayfair war. Seit Eckart Witzigmann ist Johannes Nuding der erste gebürtige Österreicher, der vom Guide Michelin mit drei Sternen belohnt wurde. Seit Sommer ist er zurück in der Heimat. Im Schwarzen Adler in Hall. Die Menüs sind Momentaufnahmen der Saison, vorwiegend regionale Produkte werden frankophil-international interpretiert. Nur mit Reservierung! www.schwarzeradler-hall.tirol
Winterwunder. Stephanie Cammerlander, Besitzerin des Strudel-Café Kröll in Innsbruck, hat eine zweite Liebe: das Räuchern. Sie bietet feinste Harze erster Wahl sowie wunderbare Räuchermischungen aus Blüten und Kräutern. www.baumharz.at


Nicht erst seit Corona entdecken zahlreiche Menschen Yoga für sich. Besonders gut fühlt sich die Yogapraxis auf den handgefertigten Matten von Zirbit aus Reith bei Seefeld an. Die bestehen aus vielen kleinen Zirbenelementen und duften unaufdringlich nach Holz. Wenn man sie gerade nicht benutzt, macht sich die Matte zusammengerollt auch gut als Dekoelement. Zirbit pure um 198 Euro, Zirbit Elements um 399 Euro. Mittlerweile gibt’s die Matten auch als Badvorleger oder etwas abgewandelt als coole Flip-Flops. www.zirbit.at

Esther Kikowatz hat ihr Label Aster im Juni 2022 in Innsbruck gegründet und führt feine Ledertaschen aus Äthiopien, die unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt werden. Die Unisex-Modelle sind nicht nur schön, sondern auch richtig robust. Erhältlich als Biggies (249 Euro) oder Smalls (189 Euro) in Petra Kaminskys Schmuck-, Fashionund Conceptstore in Hall, wo es noch allerhand andere stylische, praktische oder einfach schöne Dinge gibt und wo wir quasi immer fündig werden.
Marian Kröll, Marina Bernardi, Ivona Jelčić _Mitarbeit: Martin Weissenbrunner, Ümmü Yüksek _Layout: Tom Binder _Anzeigenverkauf: Ing. Christian Senn, Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin, Matteo Loreck, Daniel Christleth Fotoredaktion: Andreas Friedle, Marian Kröll, Isabelle Bacher, Tom Bause _Übersetzungen: Viktoria Leidlmair Lektorat: Mag. Christoph Slezak _Druck: RWf Frömelt Hechenleitner GmbH _Unternehmensgegenstand: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art _Coverfoto: DomiTauber@bergfoto.tirol