



Wir freuen uns auf Deinen Besuch!











Tiroler Genussakademie:
Nose to Tail - Tyroler Steaktime!
Freitag 16.06. 1800–2145 Uhr





Wir freuen uns auf Deinen Besuch!











Tiroler Genussakademie:
Freitag 16.06. 1800–2145 Uhr
€ 149,00 p. P
Teamevent WeinGENUSS € 98,98 p. P eine Reise in die Welt der Weine

Für viele bedeutet Sommer Urlaubszeit, Süden und Meer und seichte Strandlektüre, in die sich mitunter ein paar Sandkörner zwischen die Seiten verirren. Der Körper wird dann bewegt, wenn es gilt, die Liege mit dem wandernden Schatten des Sonnenschirms mitzuschieben, oder für eine gelegentliche Abkühlung im Wasser. Das sanfte Plätschern der Wellen lullt dazu den Geist ein.
Tiroler Genussakademie € 139,00 p. P Sushi meets Tyrol!

Do. 20.07.
1800–2145 Uhr
Teamevent BierGENUSS € 77,09 p. P mit 7 heimischen Bierspezialitäten
Tiroler Genussakademie € 139,00 p. P
Tyroler Street & Superfood!
Do. 02.11. 1800–2145 Uhr
Die Veranstaltungen finden im Genusswerk, Ing. Etzel-Straße 81/82, 6020 Innsbruck statt.
t +43 512 57 57 01-25 e Lisa.Wetscher@agrarmarketing.tirol
weitere Veranstaltungen & Anmeldung unter: liz.tirol
Den Gegenentwurf zu diesem mediterranen Dämmerzustand halten Sie in Händen. Das neue Tirol-Magazin, in dem wir das Meer durch wunderbare Seen in den Bergen, das süße Nichtstun durch jede Menge Outdoor-Aktivitäten und die geistige Schläfrigkeit durch Geschichten mit hellwachen Geistern ersetzt haben.
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr.
Wie viele Seen es in Tirol gibt, ist tatsächlich schwer zu sagen – jedenfalls weit mehr, als man im ersten Moment annehmen möchte. Wir haben ein paar der schönsten, ruhigsten und klarsten davon besucht. Oft bilden sie tief blaugrüne Oasen in der hochalpinen Einöde, eingebettet
zwischen Schotterkare und Moospolster. Viele sind natürliche Speicher für das so wichtige Nass, um das uns viele beneiden. Also schätzen und schützen wir sie, unsere Seen, die übrigens auch Vierbeiner nicht minder mögen. Wer auf den Hund gekommen ist, weiß es längst: Mit den Fellnasen macht es im Freien besonders Spaß. Darum ist Alexandra Keller gemeinsam mit Tea und Lenny drei Tage lang wandern gegangen. Weil die Tiere ihren ganz eigenen Rhythmus haben, wirkt das auf uns Menschen gleichermaßen ansteckend wie entschleunigend –noch dazu in einer Landschaft wie dem hintersten Paznaun.
Marian Kröll wiederum hat zwei unglaublich faszinierende und wache Menschen getroffen: den blinden Extremkletterer Andy Holzer, dessen schier unglaublichen Weg auf den Mount Everest er beschreibt, und den Osttiroler Künstler Jos Pirkner, der mit seinen 95 Jahren noch immer vor Tatendrang strotzt und sich ebenso neugierig wie kritisch mit den Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt.
Das gesamte Team wünscht Ihnen einen wunderbaren Sommer, wo und wie immer Sie ihn verbringen mögen.
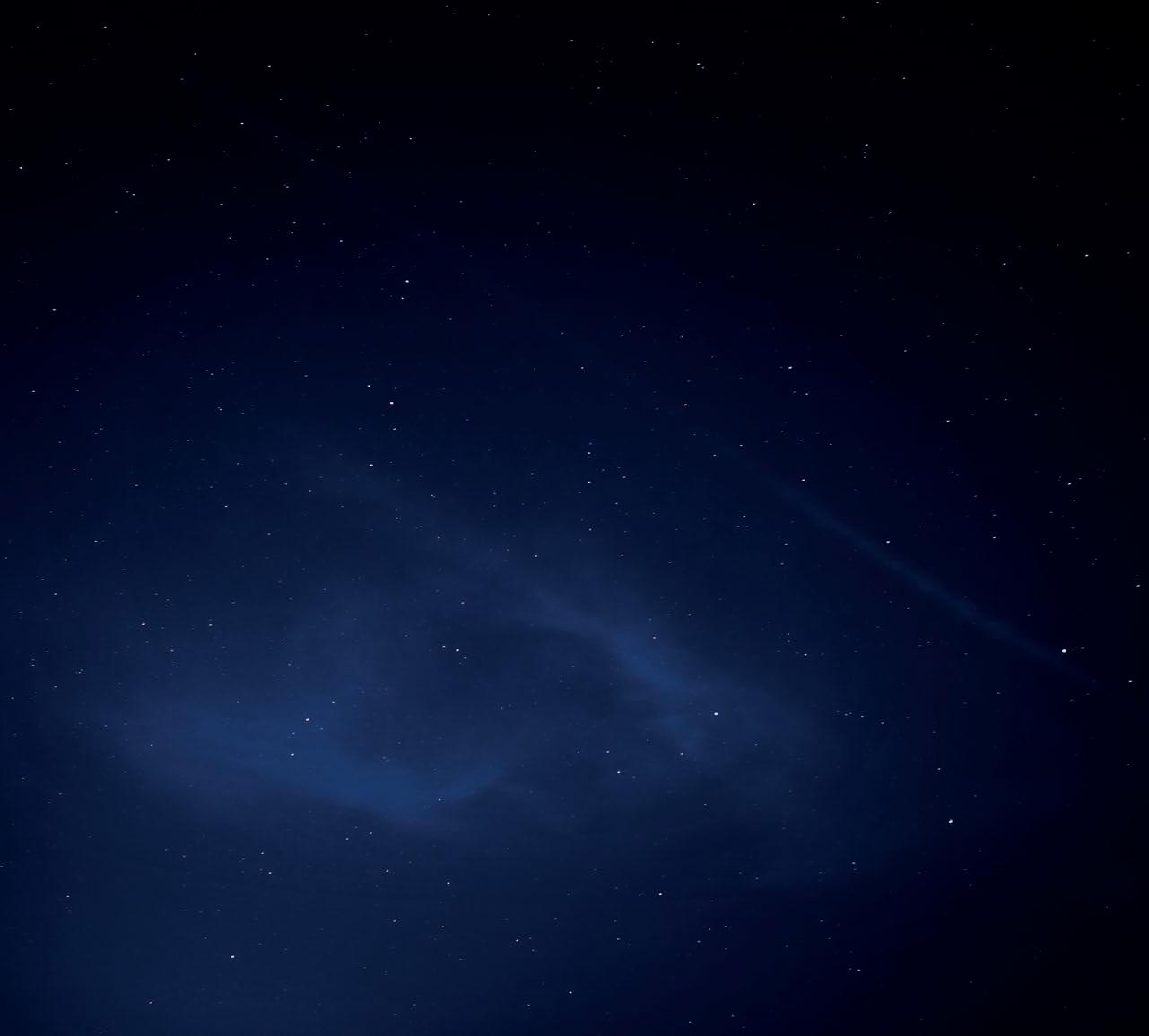

Nature
12_Lake Country Tyrol and the water.
24_Summer freshness
Life on the alp.
36_Forest change
Tyrol’s forest in 100 years.
50_Pioneering act
Old power plant, new electricity.
Culture
70_Klangspuren
30 years of contemporary music.
80_Drama, baby
An interview with playwright Lisa Wentz.
88_Role model
Anna Stainer-Knittl is more than the Geierwally.
96_Festival season
Erl is the place where music is made.
People
108_Mountain feeling
Andy Holzer, the blind climber.
116_Great art
Artist Jos Pirkner’s unbroken drive..
126_The gentian The yellow gold of Galtür
134_Superfood Honey Superfood from the beehive.
12_Seenland Tirol und das Wasser.

24_Sommerfrische Das Leben auf der Alm.
36_Waldwandel Tirols Wald in 100 Jahren.
50_Pioniertat Altes Kraftwerk, neuer Strom.
70_Klangspuren 30 Jahre zeitgenössische Musik.

80_Drama, baby
Dramatikerin Lisa Wentz im Interview.
88_Role-Model Anna Stainer-Knittel ist mehr als die Geierwally.
96_Festspielzeit
In Erl wird Musik gemacht.
108_Berggefühl Andy Holzer erklimmt die Berge, ohne zu sehen.

116_Grosse Kunst Künstler Jos Pirkner’s ungebrochener Tatendrang.
126_Der Enzian Das gelbe Gold von Galtür.
134_Superfood Honig Feines aus dem Bienenstock.

6_Editorial
10_Gastkommentar
44_Nationalpark Hohe Tauern
58_Höhlenkunst
60_Wandern mit Hund
142_Bücher
144_kurz & bündig
146_Impressum
Kommentar
Der Tiroler Tourismus hat zweifellos beeindruckendes Potential und spielt eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt im Land. Die Tourismuswirtschaft steht dabei allerdings auch einigen Herausforderungen gegenüber.
Immer öfter werden Angebote entwickelt, um sich von der Saisonalität hin zu einer möglichst ganzjährigen Destination zu entwickeln. Der Tourismuswirtschaft ist dabei die Ressource Natur und Lebensraum als Basis ihres Leistungsangebotes vollkommen bewusst. Das Ökosystem Tourismus funktioniert nur mit sensibler Steuerung, ganz besonders ist dabei auch die Lebensqualität der Einheimischen zu bedenken. Klar muss aber auch sein, dass die Freizeitinfrastruktur in unserem Land maßgeblich mit der Tourismuswirtschaft verbunden ist. Immer wieder aufkommende Diskussionen rund um ein Nein zur touristischen Weiterentwicklung bedeuten auch Rückschritte für das Freizeitangebot der Einheimischen.
In Bezug auf die Zukunftspotenziale bietet der Tiroler Tourismus viel Raum für Innovation. Tirol verfügt außerdem über eine reiche Geschichte, eine einzigartige Kultur und eine vielfältige Gastronomie. Zusätzlich wird der Ausbau des nachhaltigen Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Durch Investitionen in umweltfreundliche Infrastrukturen und den Schutz sensibler Ökosysteme kann Tirol seine Attraktivität als Reiseziel steigern.
Gerade das Thema Verkehr emotionalisiert dabei enorm. Der Vor-Ort-Nahverkehr wurde durch erhebliche Finanzierungsbeiträge aus dem Tourismus ausgebaut und umweltverträglichere Anreisealternativen zum Individualverkehr werden kontinuierlich entwickelt. Dabei müssen wir uns alle auch selbst an der Nase nehmen und uns von liebgewonnenen Bequemlichkeiten wie mit dem PKW von Haustür zu Haustür zu fahren oder eigenem Sportequipment im Urlaub verabschieden, denn genau diese sperrigen Güter sind es oft, die Gäste an der öffentlichen Anreise hindern. Die gemieteten Ski sind bereits gang und gäbe. Gemietete Bikes werden immer mehr.
Ein vielversprechender Bereich ist außerdem der Gesundheitstourismus. Mit seinen natürlichen Heilquellen und seiner reinen Bergluft hat Tirol das Potenzial, sich als Ziel für Erholungs- und Wellnessurlaube zu etablieren.
Die Tiroler Tourismuswirtschaft steht vor erheblichen Herausforderungen, die Chancen sind jedoch um ein Vielfaches höher. Durch eine nachhaltige Entwicklung, Diversifizierung und den Einsatz innovativer Konzepte wird Tirol seine Position als touristische Leaderdestination weiter stärken und gleichzeitig den Schutz der Umwelt und die Lebensqualität der Einheimischen gewährleisten.
Ihr Alois_Rainer
Alois Rainer ist Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol sowie Spartenvertreter in der Wirtschaftskammer Österreich und Geschäftsführer des Gasthof Hotel Post in Strass im Zillertal.


Der Reintalersee ist der größte der Kramsacher Seen und gehört mit bis zu 25 °C zu den wärmsten Badeseen Tirols. grösse: 0,29 km2 | max. tiefe: 11 m

In Tirol gibt es, man glaubt es kaum, an die 600 Seen, Weiher und Teiche. Nur finden muss man sie. Die hier gezeigte Auswahl ist nur ein Bruchteil, den Rest gilt es selbst zu entdecken.
Wer in Österreich an Seenland denkt, denkt zuerst einmal an das Salzkammergut oder Kärnten. Aber Tirol? Dabei hat das Land Hunderte Seen zu bieten. Abgesehen von einigen großen, wie dem Achensee, Plansee oder Walchsee, springen sie einem nur sprichwörtlich nicht gleich ins Auge. Der Stimmersee bei Kufstein zum Beispiel ist wohl nur Einheimischen ein Begriff, ebenso der Piburger See im Ötztal. Manche kennt man wiederum als viel gesehene Fotomotive, aber weiß in Wahrheit nicht genau, wo sie sich befinden. Da gibt es doch diesen herrlichen, glasklaren See mit der Zugspitze im Hintergrund, bei dem man sich seitens der Gemeinde, in der er liegt, sogar überlegt hat, eine Knipsergebühr einzuführen. Der Seebensee, genau! Die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen: Roßkarsee, Schwarzer und Grüner See, Ramsgrubensee, Salfeinssee, Rifflsee, Wildseelodersee ...

Und laut einer solchen Liste der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes gibt es an die 600 Seen, Weiher und Teiche in Tirol. Und hier findet sich auch die Erklärung, warum sie so wenig bekannt sind: 60 Prozent davon liegen oberhalb der Waldgrenze und gelten daher als Hochgebirgsbiotope. Nur 35 werden vom Land als klassische Badegewässer geführt, deren Wasserqualität auch regelmäßig überprüft wird. Beim Rest dürfte das auch kaum notwendig sein. Es handelt sich schlicht um kaltes, klares Wasser. Eingebettet in eine bizarre Hochgebirgslandschaft zwischen Schotterkaren, Moospolstern und Almrosenbüschen.
Uwe_Schwinghammer Fotos: Tom BauseDer Hintersteinersee liegt in einer Mulde hoch über Scheffau am Wilden Kaiser. Mehrere gemütliche Gasthäuser laden dort zu einem Besuch. grösse: 0,35 km2 | max. tiefe: 36 m


Der Möserer See liegt still im Wald zwischen Seefeld und Telfs auf immerhin 1295 Metern Höhe, aber wird doch bis zu 25 Grad warm. grösse: 0,03 km2 | max. tiefe: 11 m

Dem Stimmersee sieht man nicht mehr an, dass er einst aufgestaut wurde. Heute ist er ein beliebter, kleiner Badesee in der Region Kufstein. grösse: 0,03 km2 | max. tiefe: 6 m

Der Piburger See bei Oetz entstand nach der letzten Eiszeit durch einen gewaltigen Felssturz. So kam das Ötztal zu seinem einzigen Badesee. grösse: 0,14 km2 | max. tiefe: 25 m


Der Seebensee bei Ehrwald ist vor allem wegen des Zugspitzblickes berühmt. Etwas höher liegt südlich davon noch der Drachensee. grösse: 0,06 km2 | max. tiefe: 30 m


Der Blindsee nördlich des Fernpasses trägt seinen Namen vermutlich deshalb, weil man seinen Zufluss nicht sieht. Er ist ein Taucherparadies. grösse: 0,22 km2 | max. tiefe: 14 m

Den Obernberger See im Schluss des gleichnamigen Tales ziert eine romantische Kapelle. Manchmal geht der See auch über. grösse: 0,16 km2 | max. tiefe: 13 m
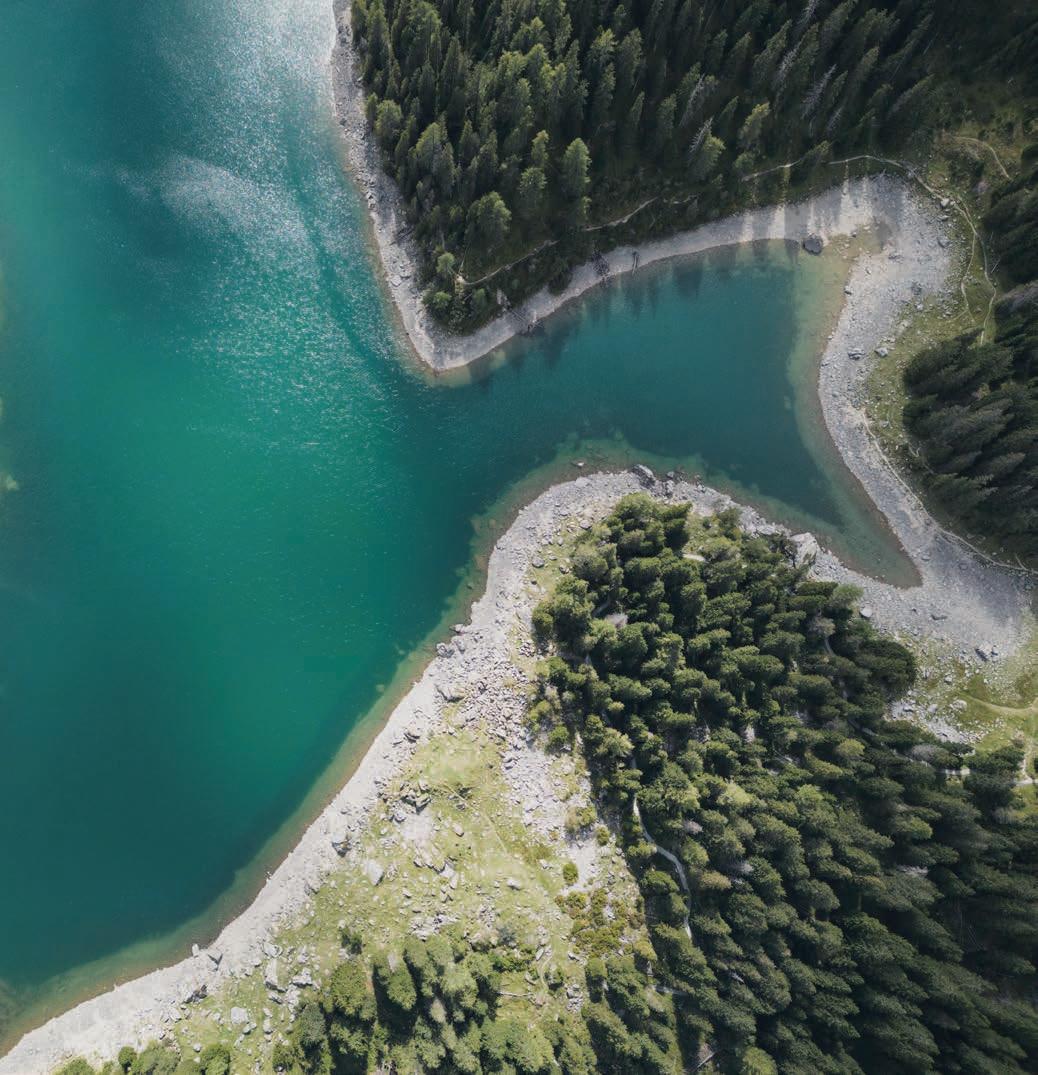
Das Tiroler Wasser-Wanderbuch 60 Tourentipps zu den schönsten Seen, Klammen und Wasserfällen Uwe Schwinghammer, Tyrolia Verlag, 200 Seiten, EUR 25,00
Viele der Tiroler Seen kann und muss man sich erwandern, denn Straßen führen keine hin. Dieses Buch umfasst 60 Tourentipps zu Seen, aber auch Klammen und Wasserfällen in Nordtirol. Im Osten mit dem Wildseelodersee beginnend und im Außerfern mit dem Vilsalpsee endend, mal sprichwörtlich kinderleicht, mal alpin und konditionell schon ziemlich anspruchsvoll. Jeder Tipp beinhaltet eine ausführliche Beschreibung der Tour, einen kurzen Steckbrief mit Höhen, Zeit und Einkehrmöglichkeit sowie eine Karte (mit einer Ausnahme). Im Taschenbuchformat kann man’s auch gut in den Rucksack stecken.

Tirol ist ein Almenland. Nirgendwo sonst verbringt so viel Milchvieh die Sommerfrische in luftiger Höhe und nirgendwo sonst springen so viele Schafe und Ziegen zwischen den Gipfeln umher. Das Almleben ist zwar hart, aber für viele Menschen die Erfüllung.

Das Leben auf der Alm, weit weg von der Hektik des Alltags, hat für so manchen Wanderer etwas durchaus Romantisches. Und natürlich hat das Leben mit und von der Natur seine Vorzüge. Doch es ist auch harte Arbeit, denn das Almleben findet nicht nur bei Schönwetter statt.

Saftig grüne Wiesen, das Gebimmel von Kuhglocken, ein kleines Holzhäuschen, davor ein Mann mit Lederhosen, Wolljanker und grauem Bart, dazu wuchtige Berge als Kulisse. Beim Begriff Alm läuft bei den meisten Menschen vor dem geistigen Auge wohl ein derartiger Heidi-Film ab. Romantisch, vielleicht sogar kitschig, ein bisschen Jodelsound mit im Ohr. Doch ist das Leben dort oben wirklich so? Die ganz zweideutige Antwort lautet: Jein!
Eine Alm zu betreiben bedeutet in allererster Linie verdammt viel Arbeit. Man „steht um halb fünf Uhr auf und springt den ganzen Tag“, wie der Geschäftsführer des Tiroler Almwirtschaftsvereins, Manuel Klimmer, sagt. Und obwohl er noch jung und neu in seinem Amt ist, weiß er, wovon er redet. Drei Jahre hat er als Hüter auf der Alpe Tritsch in St. Anton den Sommer verbracht. In Gesellschaft von 30 Milchkühen. Die Arbeit beginnt schon lange, bevor das Vieh im Mai oder Juni überhaupt auf die Alm kommt, mit dem Aufstellen der Zäune, die über den Winter meist niedergelegt oder ganz entfernt werden. Schließlich wird das Vieh aufgetrieben und verbringt die Zeit zwar auf der Weide, muss aber dennoch zweimal täglich gemolken werden. Oft steht während der Saison je nach Vegetation mehrmals ein Ortswechsel an. Die Tiere werden vom so genannten Niederunter Umständen auf den Mittel- und dann auf den Hochleger getrieben, um immer ausreichend Futter zu haben. Im Herbst, so Klimmer, sollte eine Alm im-
Der wesentlichste Bereich des Projekts Almleben ist die adäquate Qualitätssicherung der Produktion von Almkäse und Almprodukten und die entsprechende Vermarktung von Almkäse und Almbutter. Die Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung auf den Almen soll durch Qualitätssicherung und eine entsprechende Vermarktung von Almkäse und -butter gesteigert werden. Dazu benötigt es eine entsprechende Sensibilisierung der Senner sowie der Wanderer und Besucher der Almen. Das kulinarische Angebot soll sich in Zukunft stark an der Vermarktungsstrategie orientieren. Durch die gesetzten und weiterentwickelten Maßnahmen und Projekte soll die Alm zu einem Gesamterlebnis werden. Teilnehmende Almen erhalten unter anderem Unterstützung bei der Dokumentation oder der Qualitätssicherung in der Produktion. Außerdem gibt es Beratungsbesuche auf der Alm sowie bei Bedarf telefonische Hilfestellungen, Hygieneschulungen sowie entsprechende Werbemaßnahmen. www.qualitaet.tirol
mer noch grün sein. Das sei ein Zeichen, dass richtig beweidet worden sei.
Gesunde Produkte.
Viele Almen stellen ihre eigenen Produkte her: Neben der Milch meist Buttermilch, Käse und Butter. Wegen des besonderen Futters auf der Alm sind diese auch besonders gesund, erzählt Josef Lanzinger, ehemaliger Obmann des Almwirtschaftsvereins: „Es ist eine besonders gesunde Milch, weil die Kühe mehr Gras bekommen und weniger Kraftfutter. Der Anteil von Vitamin E ist daher bei der Almmilch wesentlich höher.“
Die meisten Almbetreiber liefern die Milch auf der Alm an die Molkerei ab und produzieren Käse und Butter nur für den Eigenbedarf. Von 2.070 Almen, weiß Lanzinger, sind nur rund 60 so groß, dass sie Käse auch in größerem Stil weiterverkaufen. Butter sei überhaupt rar, erzählt er: „Die muss man schon im Voraus bestellen, dass man überhaupt eine bekommt.“ Für solch hochwertige Produkte sollte man auch mehr verlangen können, was allerdings nicht immer ganz einfach sei, sagt Lanzinger. Manuel Klimmer glaubt, dass man den Konsumentinnen und Konsumenten Preis und Wert aber dennoch im wahrsten Sinn des Wortes schmackhaft machen kann: „Es gibt zum Beispiel die Diskussion um artgerechte Tierhaltung. Auf der Alm haben wir die artgerechteste Haltung überhaupt. Da können wir die Almen positiv in den Vordergrund stellen.“
Die Almwirtschaft hat in Tirol eine jahrhundertelange Tradition. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus wurden natürliche Weideflächen oberhalb der Waldgrenze bewirtschaftet. Noch heute werden auf vielen Almen nicht nur Tiere gehalten, sondern auch Lebensmittel hergestellt: Milch, Butter oder Käse zum Beispiel.


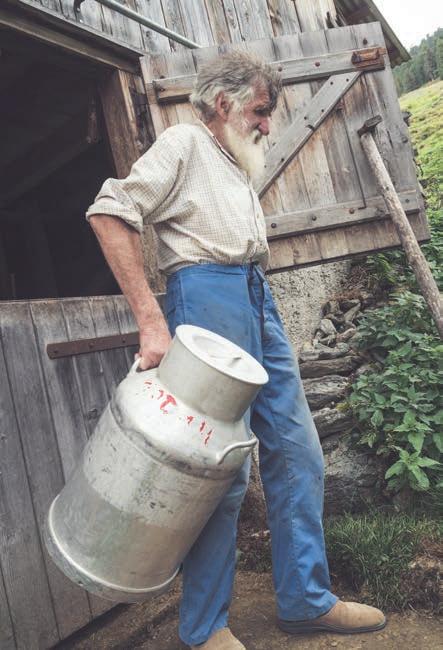
In grösserem Stil wird die Käserei zum Beispiel auf der Außermelang-Alm südlich von Wattens betrieben. Dort ist Ludwig Klingler seit 24 Jahren Käser. Außermelang ist eine Gemeinschaftsalm von sieben Bauern. Die 100.000 bis 120.000 Liter Milch, die sie über den Sommer hergibt, werden zu einem schmackhaften Käse verarbeitet. Ludwig Klingler ist auch nach vielen Jahrzehnten von seinem Beruf noch begeistert: „Mich fasziniert heute noch, Milch zu einem Lebensmittel zu verarbeiten.“ Auch Sohn Thomas ist Käser geworden. Solange Vater Ludwig, er ist inzwischen bereits 70, noch mag und kann, käst der Sohn auf einer anderen Alm, doch die Nachfolge ist gesichert. Nicht nur bei ihm in der Käserei im Speziellen, sondern für die Außermelang-Alm im Allgemeinen: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und eine gewaltige Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig.“ Und selbst von den Praktikantinnen der Landwirtschaftsschule, die Ludwig Klingler im Sommer über die Schulter schauen und mit anpacken dürfen, haben bereits zwei ihre Ausbildung zu Käserinnen abgeschlossen, eine dritte befindet sich in Ausbildung. Klingler weiß seine Faszination für das ehrliche Produkt Käse eben zu teilen.
Tiere vor Gästen.
Für Wandersleute bedeutet Alm meist ein mehr oder weniger großes Häuschen, wo es Jausenbrote, Knödel und Bier gibt. Doch nur auf rund 13 Prozent der Almen im Land wird auch tatsächlich ausgeschenkt. Das Angebot ist unterschiedlich, beschreibt Josef Lanzinger: „Manche gehen sehr locker damit um und man muss sich die Getränke aus einem Kühlschrank nehmen, andere haben extra Personal angestellt. Es soll aber auf jeden Fall der Almcharakter erhalten bleiben und das schließt große Gastronomie aus.“ Das sieht auch Klimmer so: „Ein Ausschank ist sicher eine gute zusätzliche Einnahmequel-
• Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Tirol sind Almfläche.

• 2.070 Almen gibt es, davon sind 300 mit Ausschank.
• Es gibt jeweils zur Hälfte Einzelsowie Anteilsalmen (also solche mit mehreren Eigentümern).
• Auf den Almen verbringen 30.000 Milchkühe, über 70.000 Schafe und Ziegen den Sommer.
le, aber die Tiere gehen ganz klar vor.“ Überdies gebe es bei zu vielen Besuchern auch zunehmende Nutzungskonflikte: offene Weidegatter, Menschen, die mitten durch die Kuhherden rennen, Hunde … Hier appelliere man an das Verständnis der Gäste, dass auch auf Almen gewisse Spielregeln zu beachten sind.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Almwirtschaft ist die Pflege der über Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaft. Das Schwenden, also das Freimachen der Flächen, kostet jährlich viel Kraft. Oft helfen dabei Freiwilligenprojekte wie jene des Österreichischen Alpenvereins. Hört die Bewirtschaftung auf, verbuschen die ehemaligen Weiden, verschwinden die Wege und folglich steigt die Gefahr von Lawinen und Muren.
Lehre in Genügsamkeit.
Warum also will man diesen Job bei all der vielen, harten Arbeit überhaupt noch machen? Manuel Klimmer erhält sehr viele Anfragen von Menschen, die eine Auszeit nehmen, etwas Sinnstiftendes tun, den Sommer über auf einer Alm arbeiten möchten: „Man kann das nicht so im Handumdrehen lernen, man muss es gerne tun, einen Bezug zu den Tieren haben. Weil es ist eine anstrengende Zeit und schön ist es auch nur bei schönem Wetter.“ Wenn jemand aber wirklich wolle, dann solle er am besten als Beisenner oder Beihirte beginnen. Für ihn selbst steht fest: „Die Zeit auf der Alm war für mich die wunderschönste. Da gibt es Momente, in denen bekommst du alles zurück, was du an Arbeit hineingesteckt hast.“
Josef Lanzinger beschreibt diesen Rhythmus, der das Leben auf der Alm bestimmt, so: „Du lebst viel mehr mit der Natur mit. Du schaust nicht auf die Uhr, du schaust nicht, welcher Wochentag ist. Stattdessen schaust du, wie es wächst, wie es den Tieren geht.“ Natürlich gebe es auf vielen Almen keine Dusche, oft auch keinen Strom, aber dieses „einfache Leben“ erde auch: „Man kommt dann drauf, dass man eigentlich nicht viel braucht.“ Für ihn selbst sei es jedenfalls die erfüllendste Zeit und er verstehe gut, wenn viele „jedes Jahr hinaufgehen wollen, solange sie irgendwie können“. Uwe_Schwinghammer








































Burgeralm, Rettenschöss
Jagdhausalm, St. Jakob in Defereggen
Foischingalm, Kirchdorf
Engalm, Hinterriß
Alpe Gamperthun, See
Tuftlalm, Lermoos
Taschach Alpe, St. Leonhard im Pitztal
Möslalm, Innsbruck
Außermelang-Alm, Wattenberg
Informationen und Adressen finden Sie auf der nächsten Seite
ZELL AM SEE
6347 Rettenschöss 61 Öffnungszeit: 1. Mai bis Anfang November (Freitag Ruhetag)
Almkäserei mit Ausschank Erreichbar ab Rettenschöss in einer leichten Wanderung (ca. 1 bis 1,5 Stunden). www.burgeralm.at
Die Anreise ist mit dem Auto oder im Sommer auch mit dem Bus möglich. www.engalm.at
5 Alpe Gamperthun
6553 See Öffnungszeit: 3. Wochenende im Juni bis 16. September (durchgehend geöffnet)
Mittelberg 34, 6481 St. Leonhard i. P. Öffnungszeit: Pfingsten bis Ende September
Wunderschöne Käsealm mit großer Tiervielfalt und schöner Sonnenterrasse.
9963 St. Jakob in Defereggen Öffnungszeit: 25. Juni bis 15. September
Denkmalgeschütztes Almdorf, das ausschließlich von Südtiroler Bauern bewirtschaftet wird. Kleiner Ausschank.
Erreichbar ist die Jagdhausalm zum einen von italienischer Seite vom Reintal über das Klammljoch, zum anderen aus dem Defereggental über die Seebachalm. www.jagdhausalm.com
Alm 86, 6382 Kirchdorf
Kein Ausschank, aber Käseverkauf www.koasa-mandl.at
4 Engalm
Eng Nr. 11, 6215 Hinterriß Öffnungszeit Rasthütte: Anfang Mai bis Ende Oktober
Die Ausflugsalm schlechthin am berühmten Großen Ahornboden mit Schaukäserei.
Wunderschöne Käsealm mit charismatischem Betreiber. Almschweine mit Auslauf.
Erreichbar ist die Alm von See mit der Seilbahn und über den Höhenweg oder vom Weiler Habigen aus. Gehzeit in beiden Fällen 3 bis 3,5 Stunden.
6631 Lermoos Öffnungszeit: bis Ende Oktober/Mitte November (je nach Witterung)
Wunderschöne Käsealm mit Panoramaausschank im Schatten des Zugspitzmassivs.
Die Tuftlalm ist in ca. 1,5 Stunden von Lermoos aus über verschiedene Wanderrouten erreichbar. Auch die Anfahrt mit dem Mountain- und E-Bike ist möglich. www.facebook.com/tuftlalm
Erreichbar zu Fuß in ca. 30 Minuten vom Parkplatz der Rifflseebahn. Empfehlenswert ist, mit der Bahn zum See zu fahren und auf dem Abstieg bei der Alm einzukehren. www.taschachalpe.at
8 Möslalm
Klein-Christen 1, 6020 Innsbruck
Öffnungszeit: Mai bis Oktober
Die Möslalm liegt zwar mitten im Karwendel, gehört aber dennoch zur Stadt Innsbruck. Weithin bekannt ist sie für ihren Graukäse.
Am besten erreichbar zu Fuß oder mit dem (E-)Bike von Scharnitz aus. www.moeslalm.tirol
9 Außermelang-Alm
6113 Wattenberg
Öffnungszeit: Mitte Juni bis Mitte September
Große Almkäserei mit Einkehrmöglichkeit am Fuße der Hippoldspitze im Wattental.
Erreichbar zu Fuß ab dem Parkplatz Lager Walchen des dortigen Truppenübungsplatzes in ca. 1,5 Stunden
Die Engalm ist die größte Gemeinschaftsalm des Karwendels und liegt direkt am botanisch einmaligen Großen Ahornboden. Hier stehen rund 2.300 Prachtexemplare des Bergahorns, den die Natur für diese raue Umgebung geschnitzt zu haben scheint.


Nowhere else do so many dairy cattle spend their summer holidays at lofty heights as in Tyrol, and nowhere else do so many sheep and goats bounce around between the mountain peaks.
First and foremost, running an alp means a hell of a lot of work. You “get up at half past four and run around all day,” as the managing director of the Tyrolean Alpine Pasture Association, Manuel Klimmer, says. And although he is still young and new in his role, he knows what he is talking about. For three years he spent the summer as a herdsman at Alpe Tritsch in St. Anton - in the company of 30 dairy cows. The work begins long before the cattle even arrive on the alp in May or June, with the installation of the fences, which are usually lowered or removed completely over the winter. Finally, the cattle are driven up and, although they spend their time on the pasture, they still have to be milked twice a day. Often during the season, depending on the vegetation, there is a change of location several times. Many alpine pastures produce their own products for this purpose: besides milk, mostly buttermilk, cheese and butter. Because of the special fodder on the pasture, these are particularly healthy, tells Josef Lanzinger, former chairman of the Alpine Pasture Association: “It is a particularly healthy milk, because the cows get more grass and less concentrated feed.”.
Hikers usually see an alpine pasture as a more or less large cottage where snacks, dumplings and beer are served. But only about 13 percent of the alpine pastures in the country actually serve beer. The range on offer varies. Manuel Klimmer also welcomes this in principle: „A bar is certainly a good additional source of income, but the animals clearly come first.“
Moreover, with too many visitors, there are also increasing conflicts of use: open pasture gates, people running through the middle of the herds of cows, dogs ... Here one appeals to the understanding of the guests that also on alpine pastures certain rules are to be observed.
Why do you do the hard work on the alp? „The time on the alp was the most wonderful for me. There are moments when you get back all the work you put in,“ says Klimmer, and Josef Lanzinger adds, „You live much more with nature. You don‘t look at the clock, you don‘t look at what day of the week it is. Instead, you look at how it‘s growing, how the animals are doing.“ And this „simple life“ also grounds you: „You then realize that you don‘t actually need much.“
Sous-Vide, Smoken, neue Grilltechniken oder einfach die ideale Fleischauswahl: Die mehr als 120 Tiroler Metzgereien sind perfekte Ansprechpartner für eine gelungene Grill-Session. Was wir wissen müssen für die „heißen“ Monate, erzählen die Metzgermeister Helmut Krösbacher (Fulpmes), Christoph Brindlinger (Rum) und Thomas Trixl (Reith b. Kitzbühel).
ie Kombination aus Sous Vide Garen und Grillen erfreut sich auch in Tirol steigender Beliebtheit. Das Fleisch wird saftig und trocknet nicht aus. „Zudem bleiben bei der Niedrigtemperatur-Garmethode Vitamine und Mineralstoffe erhalten“, erklärt der Rumer Metzgermeister Christoph Brindlinger. Die frischen Steaks können bereits vor der Grillfeier ohne Stress vorbereitet werden. Sie warten einfach im warmen Wasserbad, bis man sie braucht. Danach genügen pro Seite einige Sekunden am Grill, um die Röstaromen zu erzeugen. Als Geheimtipp empfiehlt Christoph Brindlinger die Zubereitung eines Onglet-Steaks, auch bekannt als Nierenzapfen: „Es ist eines der geschmacksintensivsten Fleischstücke und gehört übrigens zu den Innereien.“
Let‘s smoke!
Wer den amerikanischen Style bevorzugt, der setzt in der heurigen Grillsaison auf das „Smoken“. Bei 80120 Grad heißem Rauch gelingen große Fleischstücke mit mehr als 2 kg hervorragend. Speziell das „Pulled Pork“, also das „gezupfte Schwein“, wird meist in den verschiedensten Smokern zubereitet. Hier greifen die Profis entweder zum Schweineschopf oder zur Schulter. Wichtig ist der perfekt abgestimmte „Rub“, die Gewürzmischung. „Paprika, Zucker, Pfeffer, Salz, Chili und Knoblauch sollten immer dabei sein. Wir geben auch gerne Vanille hinzu“, informiert Metzgermeister Christoph Trixl aus Reith bei Kitzbühel. Wer „smoked“, sollte allerdings viel Geduld mitbringen. „Für die Zubereitung braucht es oft 12 Stunden oder mehr“, erklärt Trixl. Die Wahl des passenden Feuerholzes kann den geschmacklichen Unterschied ausmachen. Empfehlenswert sind: Erle, Buche und Eiche.
Immer beliebter:
Flank Steaks

Helmut Krösbacher, Österreichs erster Fleischsommelier aus Fulpmes, leitet seit vielen Jahren eine beliebte
Grill-Academy. In verschiedensten Seminaren gibt er wertvolle Tipps rund ums Thema Grillen. „Die Wahl der richtigen Grilltechnik spielt eine zentrale Rolle. Für große Stücke ist die indirekte und für Steaks die direkte Methode ideal“, so Krösbacher. Gerade bei Steaks gilt es dabei immer, die richtige Kerntemperatur im Auge zu behalten: Rare – bis 40 °C, Medium rare – 50 °C und Medium – 55 °C. „Nach dem Grillen sollte das Fleisch ca. 5 Minuten in einer Alufolie rasten“, informiert Helmut Krösbacher. Spürbar nachgefragter sind heuer sogenannte B- und C-Cuts, also nicht nur die Edelteile. „Flank Steaks werden immer beliebter. Diese sollten nur bis zu einer Kerntemperatur von max. 55 °C gegrillt werden“, erklärt der Metzgermeister. Tipp: Steak schräg anschneiden, dann bleibt das Fleisch zart.
Tiroler Metzger und Bäcker:
100 Prozent regional!
Beim Grillen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig sind die Fleischqualität und die passende Zubereitungsmethode. Für beides sind die mehr als 120 Tiroler Metzgereien die idealen Ansprechpartner*innen. Zu 100% regional wird das Grillfest mit handgemachtem Brot der 140 Tiroler Bäckereien. Mehr Wissenswertes gibt es hier: www.tirol-schmeckt.at

Die prächtigen Tiroler Wälder werden in 100 Jahren ganz anders aussehen als heute. Weil es wärmer wird und trockener, werden Laubbäume ihre Nadelkollegen vor allem in tieferen Lagen ablösen müssen, und weil sie dabei Hilfe benötigen, stehen die Tiroler Waldmenschen vor einer epochalen Herausforderung.
Im Wald tickt die Zeit anders, ganz anders. Langsamer, viel langsamer. Vielleicht ist es diese naturgegebene und unverrückbare Entschleunigung, die bei Waldspaziergängen sonst durch die Welt Hetzende trödeln, schlendern, lauschen, schauen, staunen, riechen und tief durchatmen lässt. Dass in diesem herrlich moosigen Sinneszustand alle Zweifel an der Existenz von Wichteln, Zwergen, Elfen, Gnomen, Trollen, Kobolden oder anderen Waldwesen schwinden, ist eine tolle Sache. Die Wirkung auf die Gesundheit ist eine weitere. Aus Japan stammt der Trend des Waldbadens – Shinrin Yoku – und auch zahlreiche wissenschaftliche Studien dazu. Sie belegen, dass Blutdruck und Blutzuckerspiegel durch ein Waldbad gesenkt, Depressionen gelindert, die Schmerzschwelle erhöht, Herz wie Kreislauf gestärkt und die Tatkraft verbessert werden. Ziemlich cool ist auch die Zunahme natürlicher Killerzellen und es gibt sogar eine Studie, laut der in der Waldluft mehr als 2.000 verschiedene Duftstoffe schweben.
Kurt ZiegnerMindestens 100 Jahre Vorausblick.
Vor dem Hintergrund der Superkräfte des blatt- und nadelgrünen Tausendsassas muss Kurt Ziegner ein echt gesunder Kerl sein. Ziegner arbeitet als Forstwirt im Tiroler Landesforstdienst, kennt die Tiroler Wälder wie kaum ein anderer und nach einem Gespräch mit ihm wird klar, dass er längst ein Teil der faszinierenden Tiroler Waldgesellschaft geworden und jedenfalls tief darin verwurzelt ist. „Im normalen Sprachgebrauch bedeutet langfristig rund zehn Jahre. Für uns als Waldexperten sind zehn Jahre gar nichts. Da sind junge Bäume in vielen Fällen noch nicht einmal kniehoch“, lenkt er den Fokus zurück auf den Waldboden und die Zeit. Spricht der Experte vom Wald, hat er 100 Jahre im Blick, in Hochlagen sogar 150. Alltagsübliche Planungshorizonte werden dabei jedenfalls rasch lächerlich. „Was ich jetzt setze, muss in 100 Jahren noch das Richtige sein“, beschreibt Kurt Ziegner seine Menschengenerationen weit überschreitenden Dimensionen.
„FÜR UNS ALS WALDEXPERTEN SIND ZEHN JAHRE GAR NICHTS.
DA SIND JUNGE BÄUME IN VIELEN FÄLLEN NOCH NICHT EINMAL KNIEHOCH.“
Durch die Waldbrille betrachtet liegt einer der größten, durch Menschenhand verursachten Eingriffe gerade mal drei Baumgenerationen zurück. Als Tirol ein silberner und salziger Mittelpunkt der damals bekannten Welt war, war der Holzhunger gigantisch. Für den Schwazer Bergbau und die Saline in Hall wurde derart viel Brennmaterial benötigt, dass praktisch die gesamten Alpentäler kahlgeschlagen wurden. „Sie waren ganz narrisch auf Nadelholz“, weiß Ziegner. Um die großen Sudpfannen in Hall zu erhitzen, war Laubholz wegen des viel höheren Brennwerts ungeeignet. Die Hitze hätte die Pfannen gesprengt. Zudem geht ein Laubbaumstamm im Wasser unter, Nadelholzstämme schwimmen hingegen und ließen sich höchst praktisch bis Hall oder Schwaz flößen. „Als ihnen das Holz ausgegangen ist, haben sie angefangen, nachzupflanzen. Das war die Geburt der Nachhaltigkeit – aus wirtschaftlichen Gründen“, so Ziegner.
Nachhaltigkeit, der Gedanke, der die Welt bewegt, kommt aus dem Wald. Aus dem deutschen Wald, um genau zu sein, der im 17. Jahrhundert genauso kahlgeschlagen war wie sein Tiroler Pendant. Parallel zum großen Hitzebedarf der aufstrebenden Bergwerksindustrien vermehrte sich die Bevölkerung, die Städte wurden größer und mit ihnen wuchs der Bedarf an Holz derart rapide an, dass zu der Zeit, als Johann Wolfgang von Goethe damit be-
gann, über die Natur zu dichten, dieselbe schon den ersten großen Raubbau erfahren hatte.
Die Geburt der Nachhaltigkeit.
Der bedrohliche Holzschwund war mit einer veritablen Energiekrise gleichzusetzen und es war Hans Carl von Carlowitz (1645–1714), den die Folgen nicht kalt ließen. Der stattliche Mann mit Doppelkinn und prächtig gelockter Perücke war Oberberghauptmann am kursächsischen Oberbergamt in der Silberstadt Freiberg und angesichts der Ausbeutung der Wälder verfasste er 1713 das Werk „Sylvicultura oeconomica“. Darin hielt er fest, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Mit seiner Forderung „eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen, daß es eine continuierliche beständige und nachhaltige Nutzung gebe“ legte er nicht nur den Grundstein für die moderne Forstwirtschaft, sondern auch für das Prinzip des nachhaltigen Umgangs mit Rohstoffen.
In Tirol konzentrierten sich die barocken Forsthelden in der ersten großen Nachhaltigkeits- beziehungsweise Nachpflanzungswelle aus Hitze- und Schwimmgründen auch dort auf die Fichte, wo sie eigentlich nicht zu Hause war. „Das Hauptgebiet der
Fichte, unserer Hauptbaumart, liegt zwischen 1.000 bis 1.200 und 1.700 Metern Höhe. In Tirol haben wir aber sehr viele Fichtenbestände unterhalb der 1.000-Meter-Grenze, wo von Natur aus Laubmischwald wachsen würde“, erklärt Forstexperte Ziegner. Wäre der Tiroler Wald unberührt geblieben, würden auf den untersten Stufen reine Laubwälder aus Buche, Eiche, Linde, Ulme und Ahorn wachsen. Ab rund 1.000 Metern Höhe würde ein Bergmischwald aus Fichte, Tanne und Buche stehen, um erst in einen Wald aus Fichten und Tannen überzugehen, dann einen aus Fichten und Lärchen. Immer mal wieder würden herrliche Kiefern herausblitzen und gekrönt würde das Waldreich mit Zirben. Die Wirtschaftshistorie ist der Grund dafür, dass das Waldbild vieler heimischer Mittelgebirgsrücken aber von Fichten geprägt ist. Und genau diese Bestände sind es, die im Zuge des Klimawandels immer mehr unter Druck geraten.
Der Wald wird aufgefressen.
Dass es in Tirol wärmer und trockener wird, ist kein Geheimnis. Laubbäume wie etwa Eichen, Ulmen oder Linden kommen damit recht gut klar. Mit ihren Wurzeln holen sie sich Wasser auch aus tieferen Schichten und als Notmaßnahme können sie Blätter abwerfen und den Stamm damit schützen. Fichten tun sich da viel schwerer. Wird es ihnen zu

trocken, vergilben sie und werfen die Nadeln ab, ihre Triebe sterben und sie wachsen schwach. Schwitzt die Fichte regelrecht in der Krone, spielt sich in der Erde Dramatisches ab, weil in den Wurzeln extrem hohe Saugspannungen entstehen. Bis zu 70 Bar Druck wurde in derart gestressten Wurzeln gemessen und Ziegner sagt: „Das bringt eine Pflanze irgendwann um.“
Nicht minder tödlich sind die Gefahren, die von den Borkenkäfern ausgehen. Die Käferchen sind nur ein paar Millimeter klein und gehören zum Ökosystem Wald genauso wie die Bäume selbst. Spechte und andere Waldvögel knabbern sie recht gerne, doch steckt in ihnen eine fast schon biblische Plagenkraft – dann, wenn sie überhandnehmen. Und das tun sie seit ein paar Jahren vor allem in Osttirol, wo die Wälder in Folge katastrophaler Schadensereignisse durch Stürme und Schneebrüche in einem ziemlich erbärmlichen Zustand sind. „Da haben wir seit 2018 eine ganz schwierige Situation, weil der Wald quasi aufgefressen wird“, so Ziegner. Für Borkenkäfer ist ein geschädigter Baum wie der Garten Eden. Er nistet sich ein, frisst Gänge zwischen Rinde und Stamm und legt seine Eier in die Brutgänge. Nach der Metamorphose bohren sich die Jungen von innen nach außen, fliegen weiter und befallen den nächsten Baum. Jeder Borkenkäfer legt 50 Eier, das heißt, die Vermehrungsrate ist „mal 50“ – und das immer. Diese exponentielle Potenz ist es, die aus den Nützlingen derart gefährliche Schädlinge macht.

Die heimischen Wälder reinigen Luft und Wasser und sind vielfältige Ökosysteme und Erholungsraum. Für das Gebirgsland Tirol ist außerdem der Schutz vor Steinschlag, Hochwasser, Lawinen und Muren durch Wälder unverzichtbar. Die Wälder sind also beinahe Alleskönner. Aber eben nur beinahe. In Folge des Klimawandels ändern sich die Baumarten im Tiroler Wald. Besonders in tieferen Lagen werden Laubhölzer die Fichte ersetzen. Dieser Baumartenwechsel kann allerdings kaum mit dem rasanten Tempo des Klimawandels mithalten. Deshalb wurde die Initiative „Klimafitter Bergwald Tirol“ ins Leben gerufen. Sie hat zum Ziel, die Tiroler Wälder langfristig an den Klimawandel anzupassen. Neben der Anpassung der Baumartenzusammensetzung der Wälder ist es für den Klimaschutz besonders wichtig, verstärkt Holzprodukte zu nutzen und fossile Rohstoffe durch Holzprodukte zu ersetzen. Das ergab die CareforParis-Studie des BFW 2020. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt und damit das Einsparungsziel der EU erreicht wird. Weitere Infos zur Initiative unter klimafitter.bergwald.eu
Die Herausforderungen der Tiroler Waldverantwortlichen sind aber auch in anderer Hinsicht diffizil, muss sich die Zusammensetzung der Wälder doch in den kommenden Jahren massiv ändern, um der Wärme stand- und ihre Funktion als Schutzwald behalten zu können. „Geht es im normalen Waldökosystemrhythmus, ist das ein langsamer, schleichender Prozess, den man jetzt schon sehr gut beobachten kann“, macht Ziegner etwa auf die wärmegetönten Mittelgebirgsebenen aufmerksam, wo sich zunehmend junge Eichen oder Bergahorne unter die Fichten schleichen. Mit der Initiative „Klimafitter Bergwald“ wird diesem Wandel nachgeholfen. Die Mischung ist der Schlüssel der Klimafitness, für die 100 Jahre vorausgeschaut und viel getan werden muss. Südlich und oberhalb von Innsbruck – in Lans – wurden beispielsweise schon paradehafte Mischwaldinseln angelegt, indem Fichten gefällt und Eichen, Ulmen, Linden, Bergahorn und Kirschen gepflanzt wurden. „Wir haben sie sehr eng gesetzt, damit sie wie eine Schutzgemeinschaft sind. Von dieser Mischwaldinsel bleibt in 100 Jahren schlussendlich ein Laubbaum über, der mit seinen Samen den nächsten Bestand bildet“, erklärt Forstexperte Ziener und macht wieder darauf aufmerksam, dass im Wald andere Gesetze herrschen und die Zeit anders tickt, ganz anders. Langsamer eben, viel langsamer.
„IN TIROL HABEN WIR SEHR VIELE FICHTENBESTÄNDE
Alles aus einer Hand I Schlosserarbeiten I Stahl I Edelstahl I Messing
Kupfer I Black Inox I Möbelbau I Metall I Holz I Glas I Stein I Technik
Planung & Design I Kältetechnik I Reparaturen
Alles aus einer Hand I Schlosserarbeiten I Stahl I Edelstahl I Messing

Kupfer I Black Inox I Möbelbau I Metall I Holz I Glas I Stein I Technik
Planung & Design I Kältetechnik I Reparaturen
tic usage, long-term means around ten years. For us as forest experts, ten years is nothing. In many cases, young trees are not even knee-high,” he says, shifting the focus back to the forest floor and time. When the expert talks about the forest, he has 100 years in mind, in high altitudes even 150 years.
Time ticks differently in the forest. Slower. Perhaps it is this natural and immutable deceleration that allows us to take a deep breath during forest walks. The effect on health goes hand in hand with this. The trend of forest bathing - Shinrin Yoku - comes from Japan, as do numerous scientific studies on the subject. They prove that a forest bath lowers blood pressure and blood sugar levels, alleviates depression, raises the pain threshold, strengthens the heart and circulation and improves energy.
Given the superpowers of the leafy and needle-green jack-of-all-trades, Kurt Ziegner must be a really healthy guy. Ziegner works as a forester in the Tyrolean Provincial Forest Service and knows the Tyrolean forests like no one else. “In normal linguis-

One of the biggest interventions in the forest was just three tree generations ago. So much fuel was needed for the Schwaz mining industry and the salt works in Hall that practically the entire Alpine valleys were clear-cut. “When they ran out of wood, they started replanting. That was the birth of sustainability - for economic reasons,” says Ziegner. For various reasons, the large waves of replanting also focused on spruce in places where that tree was not actually at home. The fact that it is getting warmer and drier in Tyrol is certainly no secret. Deciduous trees such as oaks, elms and lime trees can cope with this quite well. With their roots they get water from deeper layers and as an emergency measure they can shed leaves and protect the trunk. Spruces have a much harder time of it and die in the heat.
The challenges facing the Tyrolean forest managers are also difficult in other respects, as the composition of the forests must change massively in the coming years in order to withstand the heat and retain their function as protective forests. The “Klimafitter Bergwald” (“Climate-smart mountain forest”) initiative is helping to bring about this change. The mixture is the key to climate fitness, which requires looking 100 years ahead and doing a lot. South of and above Innsbruck, for example, parade-like mixed forest islands have already been created by felling spruces and planting oaks, elms, lime trees, sycamores and cherries.
The magnificent Tyrolean forests will look very different in 100 years from what they do today.

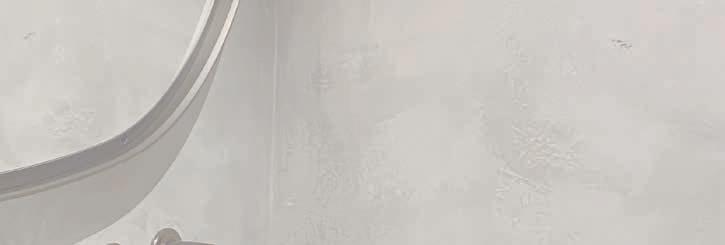
Ein Hauch von Tibet weht bei der Jagdhausalm im Defereggental. Erkundet man die Gegend mit NationalparkRanger*innen, erfährt man zudem allerlei Wissenswertes über Flora und Fauna in der Gegend.

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Ostalpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2
Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Raum zum Staunen, zum Innehalten, Rückzugsraum für Tiere und naturbewusste Menschen gleichermaßen und ein diverses Ökosystem. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute – und Vielseitige – liegt so nah? Die Vielgestaltigkeit des Nationalparkgebiets auf relativ kleiner Fläche ist weit beeindruckender, als man vielleicht annehmen möchte. Aber sehen Sie selbst!
Das Atemberaubende hat es so an sich, dass es in seiner Beschreibung nach dem Superlativ verlangt. Und tatsächlich kann es dem natursensiblen Beobachter in der klaren Luft des Nationalparks Hohe Tauern schon einmal den Atem verschlagen ob der Schönheit und vor allem Vielfalt der Landschaft, die sich hier auf verhältnismäßig kleinem Raum begehen, besichtigen und unmittelbar mit allen Sinnen erfahren lässt. Wer einen Hauch von Tibet sucht, findet ihn hier, genauso wie eine Antarktis en miniature oder eine bizarre Mondlandschaft, und sogar für ein bisschen Südseefeeling ist der Nationalpark Hohe Tauern gut. Das klingt weit hergeholt, liegt aber doch so nah.
Tibetisches Hochlandflair.
Die Jagdhausalm im Osttiroler Defereggental liegt auf 2.009 Metern Seehöhe und wird gerne als „Klein Tibet“ bezeichnet. Zu Recht. Sie gehört zu den ältesten Almen Österreichs, besteht aus
Der Nationalpark
• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol
• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.
• West-Ost-Erstreckung: 100 km
• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km
• mehr als 300 Dreitausender
• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle
• 551 Bergseen
16 Steinhäusern und einer Kapelle, die allesamt unter Denkmalschutz stehen. Die Alm ist aber mitnichten ein Museum, sondern ein lebendiges Zeugnis jener typischen Almwirtschaft, die in Osttirol noch vielerorts betrieben wird und welche die Kulturlandschaft ent-
scheidend geprägt hat. Auf der im Jahr 1212 erstmals urkundlich erwähnten Jagdhausalm, die eine Gesamtfläche von 1750 ha umfasst, werden zwischen Juni und September rund 350 Stück Rinder gealpt. Die Jagdhausalm versetzt einen in das Flair des tibetischen Hochlands, sie ist zum einen Teil der kleinen Weltreise, die man im Nationalpark unternehmen kann, zum anderen aber auch eine Zeitreise in längst vergangen geglaubte Tage, ein kleines Stück heiler Welt, das Bräuche und Traditionen hochhält, kurzum ein echtes Juwel, das es zu bewahren und behutsam weiterzuentwickeln gilt.
Fussläufig ist die Alm in gut zwei Stunden vom Alpengasthof Oberhaus erreichbar und auch Radfahrer können die Jagdhausalm im Wortsinn erfahren. Sie ist trotz ihrer Schönheit ein Idyll geblieben, das vom Massentourismus verschont blieb. In unmittelbarer Nähe ist übrigens ein echter Kraftplatz zu finden: Das Pfauenauge, ein mit Großseggen umwachsener, kleiner Bergtümpel von wahrlich mystischem Aussehen
Der Großvenediger, die weltalte Majestät, ist mit seinen Gletschern aus der Nähe wie aus der Ferne ein tatsächlich majestätischer und erhebender Anblick.
Der weltalten Majestät zu Füssen.
Bekanntermaßen ist der Südpol touristisch nicht erschlossen und einigermaßen unwirtlich. Osttirol ist die Antithese dazu: Gut erschlossen, dabei aber nicht überlaufen, und durchaus wirtlich, das heißt authentisch gastfreundlich. Wer würde ahnen, dass sich hoch oben in den Dachregionen des Nationalparks, südwestlich des weltalt-majestätischen Großvenedigers eines der größten und eindrucksvollsten Gletscherplateaus der Ostalpen verbirgt? Gewaltige Eismassen dominieren das

Vom Wildtierbeobachtungsturm im Oberhauser Zirbenwald – dem größten in den Ostalpen – kann man das beindruckende Ökosystem namens Wald von oben betrachten.
Sichtfeld, windstill ist es dort selten, von Hitze ganz zu schweigen. Hier liegt gewissermaßen die Antarktis Osttirols, die rund um das Defreggerhaus zum Greifen nah wird. Wer sich dieses beeindruckende Plateau aus Schnee und Eis ansehen möchte, kommt bei der wöchentlichen Ranger*innen-Erlebnistour am Gletscherweg Innergschlöss auf seine Kosten.
Die Gletscher sind in den Alpen am Rückzug. Noch gibt es an die 150 Quadratkilometer davon im Nationalpark Hohe Tauern. Ob man sie nun als Gletscher, Ferner, Kees oder Firn bezeich-

net, der Blick auf die imposanten, uralten Eismassen ist eindrucksvoll und regt zum Nachdenken an. Die eiskalten Giganten verlieren im Zuge des sich beschleunigenden Klimawandels kontinuierlich an Masse. In manchen Jahren mehr, in anderen etwas weniger. Noch kann man ihre vorübergehende Pracht bestaunen, etwa am Umbalkees am Ursprung der Isel, am Schlatenkees am Fuße des Großvenedigers oder am Teischnitz- und Ködnitzkees am Fuße des Großglockners und am von mehreren 3.000ern eingefassten Rainer- und Mullwitzkees in Prägraten am Großvenediger
Höchstgelegenes Südseegefühl.
Wer die Dabaklamm im Kalser Dorfertal durchquert, auf den wartet eine ganz spezielle Überraschung. Der an den Flanken der Granatspitze gelegene Dorfersee liegt auf 1.935 Metern Seehöhe und färbt sich – obwohl von milchig-weißem Gletscherwasser gespeist – in den warmen Sommermonaten tiefblau-türkis und ist eine echte Augenweide. Die Umgebung lässt allerdings nicht vergessen, dass man sich im alpinen Gelände befindet, weshalb statt Flip-Flops weiterhin festes Schuhwerk angesagt ist.
Osttiroler Mondlandschaft.
Beinahe außerirdisch wird die Weltreise im Nationalpark Hohe Tauern, wenn man sich zwischen dem Kals-Matreier-Törl-Haus und der Sudetendeutschen Hütte auf dem gleichnamigen Höhenweg bewegt. Dort, westlich der Kendlspitze, gehen sattgrüne Bergwiesen fast schlagartig in ödes, eintöniges Graubraun über. Plötzlich findet man sich in einer wüstenartigen Landschaft wieder, die in ihrer Kargheit genauso gut am Erdtrabanten liegen könnte. Dürrenfeld heißt die bizarre Urlandschaft, die


nach rund einer Stunde hinter der Dürrenfeldscharte ebenso plötzlich wieder aufhört und der gewohnten alpinen Flora weicht, wie sie aufgetreten ist.
Herzfluss à la Yukon.
Die Isel ist einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen und als solcher bahnt sie sich auch heute noch abwechslungsreich und beinahe ungehindert auf 57 Kilometern Länge ihren Weg zwischen ihrem Ursprung am Gletschertor des Umbalkees bis in die Bezirkshauptstadt Lienz, wo sie in die kleinere Drau einmündet. Seit 2020 kann man den Herzfluss der Osttiroler in seiner ganzen Pracht am Iseltrail erfahren, einem Weitwanderweg, der den Fluss in all seinen Facetten zwischen Menschenwelt und Wildnis zeigt. Die Isel unterliegt als Gletscherfluss starken jahreszeitlichen Schwankungen und zeigt sich je nach Witterung, Tagesund Jahreszeit von ganz unterschiedlichen, aber immer reizvollen Seiten.
(Nat)Urwälder pur.
Ursprünglichkeit unmittelbar erfahren kann man besonders in den Naturwaldreservaten Oberhauser Zirbenwald und Ochsenwald im Gschlösstal. Beide Naturwaldzellen sind von der Zirbe dominiert, einem sehr langsam wachsenden Baum, der bis zu 1000 Jahre alt werden kann. Der Oberhauser Zirbenwald in St. Jakob i. Defereggental ist der größte zusammenhängende Zirbenwald der Ost-
Hohetauern-Guide
Das ganze Angebot des Nationalpark Hohe Tauern auf einen Blick aufs Handy holen: www.hohetauernguide.at


Ein wenig Südseegefühl auf höchster Ebene vermittelt der an den Flanken der Granatspitze gelegene Dorfersee, dessen Wasser sich im Sommer tiefblau-türkis färbt.
An eine Mondlandschaft erinnert das Dürrenfeld, das man am Höhenweg zwischen dem KalsMatreier-Törl-Haus und der Sudetendeutschen Hütte durchquert.
alpen und ein ganz besonderes Erlebnis, das Ehrfurcht vor dem Ökosystem Wald einflößen kann. Dieser ist auch Schauplatz des Waldwildnis-Camps des Nationalparks Hohe Tauern. Die zweitägigen Camps für Kinder von 9 bis 12 Jahren finden an vier Terminen zwischen Ende Juli und Ende August statt (nähere Infos gibt’s im Netz auf der Website des Nationalparks Hohe Tauern). Im Zuge der aufregenden zweitägigen Expedition mitten in der Waldwildnis übernachten die Kinder mit den Ranger*innen auf einer urigen Almhütte ohne Strom und erleben eine aufregende Sommernacht mitten im Nationalpark. Man begibt sich dabei nicht nur auf die Suche nach Wildtieren, sondern auch nach Essbarem, und lernt, was die Natur in dieser Hinsicht zu bieten hat. Von Juni bis September kann man im Oberhauser
Zirbenwald in Begleitung kundiger Ranger*innen Wald & Wild beim Erwachen zusehen. Dafür geht’s bei Morgengrauen über den Zirbensteig zum Wildtierbeobachtungsturm, wo sich neben Hirschen und Rehen noch Gämsen und ab und zu auch Steinadler erspähen lassen. Ein spannender Morgen endet mit einem gemütlichen Zusammensein auf der Hütte des Nationalparks Hohe Tauern.
Herzfluss und Herzensangelegenheit: Die Isel vermittelt als einer der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen streckenweise die Wildheit des Yukon.
Die beeindruckende landschaftliche Vielfalt des Nationalparks Hohe Tauern ist der Beweis vor unserer Haustür, dass man nicht unbedingt in die Ferne schweifen muss, wenn das Schöne, das Ursprüngliche, das Natürliche und Authentische so nah liegt. Vielfalt, die zum Verweilen und Staunen einlädt.
Marian_KröllBesucherlenkung ist wichtig, damit die Natur und vor allem die Tierwelt nicht überfordert werden. Berücksichtigt man ein paar einfache Verhaltensregeln, dient man der Flora und Fauna gleichermaßen und trägt dazu bei, dass sich auch die nachfolgenden Generationen an den Naturwundern des Nationalparks Hohe Tauern erfreuen dürfen.
Beim Wandern gilt: Auf markierten Wegen und Steigen bleiben, keine Abkürzungen im Gebiet gehen und Hunde in der freien Natur stets anleinen.
Auf Fels und Eis: Nur auf bereits angelegten bzw. gekennzeichneten Routen bewegen.
Beim Biken: Bike & Hike nur auf klar ausgewiesenen Mountainbikerouten und Radwegen.
Generell gilt es, die Dämmerungszeiten in der Früh und am Abend zu meiden und keinen Abfall und keine Speisereste zurückzulassen. Für Luftsportarten und Bikesport gibt es klare gesetzliche Regelungen, die zu berücksichtigen sind.
nationalpark.osttirol.com


DIE ISEL IST EINER DER LETZTEN
BIKE-IN/BIKE-OUT - VOM BETT DIREKT AUF DEN TRAIL
Uphill, downhill oder querfeldein. In den Pletzer Resorts kommen Genussbiker gleichermaßen wie Bike-Enthusiasten und Profis auf ihre Kosten. Egal ob mit elektrischem Turbo-Booster, eigener Muskelkraft, Gravelbikes oder bei Bike & Hike Touren – die Alpenwelt rund um die Pletzer Resorts bietet grandiose Erlebnisse!

5 RESORTS, 1 MOVE & RELAX PHILOSOPHIE
Aktive Bewegung vereint mit wohltuender Entspannung und vitaler Ernährung verspricht Energie pur.

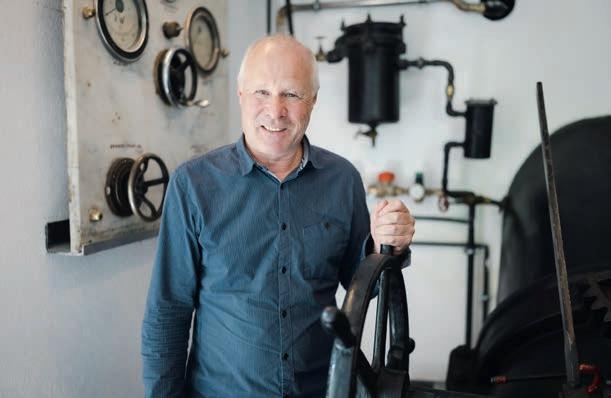

Andreas Rauch
Mit viel Liebe zum Detail und zur Geschichte erhält Andreas Rauch das erste Tiroler Kraftwerk mit Starkstromleitung.
„ICH HABE DAS KRAFTWERK PERSÖNLICH VON DER FIRMA ÜBERNOMMEN UND ERHALTE ES IM SINNE EINER
Vor 135 Jahren wurde im kleinen Dorf Mühlau von der Unternehmerfamilie Rauch das erste elektrische Kraftwerk mit Übertragung der Energie durch ein Starkstromkabel in Betrieb genommen. Eine Pioniertat, die im damaligen Österreich einmalig war.

Andreas Rauch
Mühlau war längst ein elektrisches Licht aufgegangen, als Innsbruck noch im Gaslaternen-Halbdunkel dahindämmerte. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber stimmt im Grunde. Zu verdanken war dies dem Pioniergeist der Unternehmerfamilie Rauch.
Wir schreiben das Jahr 1888. Müller Leopold Rauch steckte im doppelten Wortsinn ein bisschen in der Zwickmühle, denn er hätte gerne die Mehlproduktion erhöht. Doch bis dato konnte man eine Mühle nur mit Wasserrädern am Bach betreiben, wozu man allerdings das nötige Wasserrecht benötigte. Genau da war die Mühle der Rauchs am Mühlauer Bach im Nachteil, denn unmittelbar oberhalb und unterhalb war eine Expansion durch die Wasserrechte anderer beschränkt. Was also tun? Ein elektrisches Kraftwerk – die neue Technik war gerade im Entstehen – schien eine brauchbare Lösung. Am Eingang der Mühlauer Klamm hatten die Rauchs nämlich ein Wasserrecht erworben und konnten dort ein solches errichten. Wie allerdings die Kraft zur Mühle, die einige hundert Meter bachabwärts lag, bringen? Anfänglich, so erzählt Andreas Rauch, Nachfahre des Leopold Rauch, war eine sehr umständliche Lösung angedacht: „Ursprünglich war gedacht, eine Seilzuganlage bis zur Mühle zu bauen. Man hat geglaubt, dass Strom nur genau dort verwendet werden
Anton Rauch
verließ nach den Wirren der Napoleonischen Kriege seine Heimat, das Tiroler Oberland, und bekam eine Anstellung bei der Kindlmühle in Mühlau. Da deren Betreiber keine Nachfolger hatte, verkaufte er dem jungen Müller die Mühle gegen eine Leibrente. Dessen Sohn Leopold ließ 1888 das erste elektrische Kraftwerk mit Stromübertragung durch eine Leitung bauen. Die Rauchmühle stürzte während des Ersten Weltkrieges teilweise ein, wurde wieder aufgebaut und brannte 1919 ab. Danach wurde sie nicht mehr oberhalb des Mühlauer Zentrums, sondern an der Haller Straße neu errichtet.
kann, wo er produziert wird. Mein Vorfahre hat allerdings beim Besuch einer nicht mehr näher eruierbaren Elektroausstellung gesehen, dass man die elektrische Energie auch mit Kabeln transportieren kann und dass das sehr wohl eine Überlegung wäre.“

Strom für Mühle, Licht und Bahn.
Und so kam es, dass im Jahr 1888 das erste Kraftwerk in Tirol mit einer Übertragung per Starkstromkabel entstand. Die fünf Millimeter dicken Kupferkabel wurden vom Kraftwerk bis zur Mühle geführt. Dort liefen sie in einen – wie in einem zeitgenössischen Bericht stand – „Sekundärdynamo“, der seinerseits Mahlwerke antrieb. Im Katalog der Tiroler Landesausstellung 1893 hieß es gar: „Diese Mühle war das erste Fabriks-Etablissement in Österreich, welches die elektrische Kraftübertragung in Verwendung brachte.“
Andreas Rauch, heutiger Chef der Rauchmühle: „Die Bedeutung bestand darin, dass die Kapazität der Vermahlung so gesteigert werden konnte, was mit dem normal zur Verfügung stehenden Wasser nicht möglich gewesen wäre.“ Doch nicht nur das: Das elektrische Kraftwerk lieferte so viel Strom, dass in der damals noch eigenständigen Gemeinde Mühlau, in der die Familie Rauch immer kommunal aktiv war, eine elektrische Straßenbeleuchtung installiert wurde. Die Stadt Inns-
„MEIN VORFAHRE HAT BEIM BESUCH EINER ELEKTROAUSSTELLUNG GESEHEN, DASS MAN DIE ELEKTRISCHE ENERGIE AUCH MIT KABELN TRANSPORTIEREN KANN.“



bruck baute zwei Jahre später ein eigenes Kraftwerk und begann ebenfalls mit der Elektrifizierung der Straßenbeleuchtung. Ein Beispiel, dem viele andere österreichische Landeshauptstädte erst viele Jahre danach folgten: Linz etwa 1897 und Klagenfurt gar erst 1902.
Doch nicht nur zum Antrieb der Mahlwerke und fürs Licht nutzte Leopold Rauch die neue, revolutionäre Energie. Zwischen 1901 und 1919 betrieb man auch die erste elektrische Eisenbahn Tirols. Sie führte von der Hauptlinie der dampfgetriebenen Eisenbahn an der Haller Straße hinauf zur Rauch’schen Mühle, die damals noch nahe am Mühlauer Ortszentrum lag. Als man nach einem Brand 1919 die Mühle am heutigen Standort errichtete, wurde die Bahn obsolet.

Andreas Rauch
Altes Kraftwerk wird gehegt und gepflegt.
Auch für das erste Tiroler Kraftwerk mit Starkstromkabel schlug nach über 100 Jahren die letzte Stunde. Im Dezember 2005 ging in einem Zusammenspiel der Innsbrucker Kommunalbetriebe und der Firma Rauch ein Naturstrom-Kraftwerk in Betrieb. Andreas Rauch: „Alle bestehenden Wasserrechte wurden diesem neuen Kraftwerk übertragen. Und somit hat das erste Kraftwerk Tirols am 16. Dezember 2005 aufgehört, Strom zu produzieren.“ In der Folge wurden die Druckrohrleitung und die Kabelverbindung abgebaut.
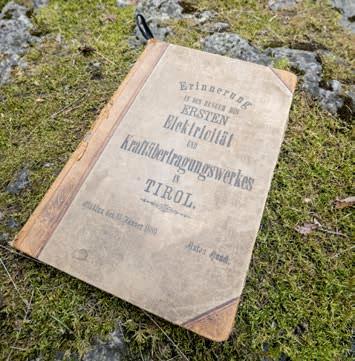
Die Kraftwerksanlage selbst besteht noch und wird von Andreas Rauch liebevoll erhalten: „Ich habe das Kraftwerk persönlich von der Firma übernommen und erhalte es im Sinne einer Gedächtniskultur.“ Diese lebt Rauch im wahrsten Sinne des Wortes vor. Er wohnt nämlich in der ehemaligen Kraftwerkswärter-Wohnung über der Turbine. Rauch: „Das Kraftwerk musste ursprünglich ständig gewartet werden. Von selbst ist dort nichts gelaufen.“ Somit symbolisiert das kleine Gebäude nicht nur 135 Jahre Kraftwerks-, sondern auch Industrie- und Wohngeschichte. Uwe_Schwinghammer
Der Werkzeugsatz des Kraftwerkswartes hängt fein säuberlich bereit, als wollte dieser jeden Moment zurückkommen. Auch das Erinnerungsbuch an die Eröffnung ist noch erhalten.
„DAS KRAFTWERK MUSSTE URSPRÜNGLICH STÄNDIG GEWARTET WERDEN. VON SELBST IST DORT NICHTS GELAUFEN.“© ANDREAS FRIEDLE
Mit dem Bike Cab für Gondelbahnen können bis zu acht Fahrräder gleichzeitig transportiert werden. Das garantiert eine hohe Förderleistung und Attraktivität für Radsportbegeisterte. Das Be- und Entladen erfolgt einfach und schnell. Die Biker:innen hängen ihre Fahrräder in der Talstation ins Bike Cab ein und steigen anschließend in die nachfolgende Kabine. In der Bergstation haben die Gäste genügend Zeit, um ihre Sportgeräte wieder zu entnehmen – ab geht’s ins Bike-Vergnügen.

135 years ago, in the small village of Mühlau, the Rauch family of entrepreneurs commissioned the first electric power plant with transmission of energy via a high-voltage cable. A pioneering act that was unique in Austria at that time.

In 1888, miller Leopold Rauch was in a bit of a dilemma, because he wanted to increase flour production. But until then, a mill could only be operated with water wheels on a stream, which required the necessary water rights. And it was precisely here that the Rauchs’ mill on the stream Mühlauerbach was at a disadvantage, because immediately above and below it, expansion was restricted by the water rights of others. So what to do? An electric power plant - the new technology was just emerging - seemed a viable solution. The Rauchs had acquired a water right at the entrance to the Mühlau gorge and were able to build one there. In the beginning, as Andreas Rauch, a descendant of Leopold Rauch, remembers, a very complicated solution was envisaged: “The original idea was to build a cable system up to the mill. It was believed that electricity could only be used directly where it was produced. But my ancestor, visiting an electric exhibition, saw that electric energy could also be transported by cables.”
And so it happened that in 1888 the first power plant in Tyrol was built with transmission by power cable. But not only that: the electric power plant supplied so much electricity that electric street lighting was installed in the then still independent community of Mühlau, where the Rauch family had always been active. Between 1901 and 1919, they also operated Tyrol’s first electric railroad.
For the first Tyrolean power station with high-voltage cable, the last hour struck after more than 100 years. In December 2005, a natural power plant
went into operation in a joint venture between Innsbruck’s municipal utilities and the Rauch company. Andreas Rauch: “All existing water rights were transferred to this new power plant. And thus, Tyrol’s first power plant stopped producing electricity on December 16, 2005.” However, the power plant itself still exists and is lovingly maintained by Andreas Rauch.
Dahinter steckt mein Tiroler Bad*, das mit Sicherheit für mich da ist.

Die Tischoferhöhle im Kaisertal bei Kufstein ist ob ihrer Ausmaße eher ein Dom denn eine Höhle: Sie ist 8,5 Meter hoch, am Eingang 20 Meter breit und etwa 40 Meter tief. In ihr wurden wahre Schätze gefunden, die ein Fenster in die Vorzeit der Tiroler Geschichte öffnen. Am bekanntesten sind wohl die Höhlenbären. Knochen von sage und schreibe 380 Bärenindividuen wurden hier gefunden, dazu Steinböcke, Hyänen, Gämsen und ein Höhlenlöwe. Ausgegraben wurden außerdem menschliche Werkzeuge. Es sind die ältesten, die bisher in Tirol gefunden wurden, und zwischen 27.000 und 28.000 Jahre alt. Auch Skelettteile von 30 unterschiedlichen Menschen kamen zum Vorschein: Männer, Frauen, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie datieren aus der sogenannten „Straubinger Kultur“ in der Bronzezeit und fanden hier ihre Grabstätte. Zu sehen sind einige dieser großartigen Funde im Heimatmuseum auf der Festung Kufstein.
www.kufstein.com

 Die Höhle kann vom Kaiseraufstieg im Kaisertal über einen mit einem Drahtgeländer gesicherten Steig zu Fuß erreicht werden.
Die Höhle kann vom Kaiseraufstieg im Kaisertal über einen mit einem Drahtgeländer gesicherten Steig zu Fuß erreicht werden.

Mit diesen zwei Hunden in den Tiroler Bergen zu wandern, ist anders prachtvoll. Auch weil Tea und Lenny den imposantesten Felsen und beeindruckendsten Panoramen die Show zu stehlen verstehen. Um hoch oben rundum entspannt mit Hunden zu wandern, ist der Herbst die beste Jahreszeit. Und Galtür ist möglicherweise der schönste Ort dafür.
 Fotos: MICHELA MOROSINI
Fotos: MICHELA MOROSINI
Sie bilden ein recht abenteuerlich gemischtes Doppel. Tea ist Italienerin – eine temperamentvolle Südländerin quasi. Ihr Haar ist schwarz, ihre Beine flink, die kleinen Knicke ihrer Ohren so großartig wie ihr ganzes Wesen und immer, ja immer scheint ein kleiner Schalk sie zu befeuern. Vor allem, wenn sie den kleineren, aber nicht minder schwarzhaarigen Lenny zum Spielen auffordert. Vielleicht ist Lenny ein Tiroler, vielleicht ist er das aber auch nicht. So genau weiß das niemand und genau genommen ist es ja auch egal. Er wurde in Innsbruck gefunden und adoptiert, wird arg beneidet um seine langen Wimpern, wirkt weise mit seinem an Kaiser Franz Joseph erinnernden Bart – und er überrascht. Dann, wenn er mit Tea um die Wette rennt, seine Beine kaum den Boden zu berühren scheinen. Bis, ja bis den beiden die Luft ausgeht, sie mit großen Augen, langer Zunge und für Leckerli hoch empfänglich erst sitzen und dann liegen – in der Wiese vor dem Ferienhaus Ambrosius, unserem Heim für die nächsten zwei Tage.
Das alte, liebevoll restaurierte und auf bezaubernde Weise einladende Haus steht an einem Ende von Galtür – am Eingang zum Jamtal. Federleicht gelingt es hier, den Ort selbst auszublenden. Beim Blick ins Jamtal dreht man ihm den Rücken zu und bekommt das Gefühl, weit weg zu sein, hoch oben, ganz nah den bizarren Gipfeln, die unweit von hier schon Piz heißen. Aus Vogelperspektive ist der vielleicht bekannteste – der Piz
Hundetouren in Galtür: Sonnenkogelrunde
Leichte Rundwanderung von Galtür über den Uferweg an der Trisanna zum Aussichtspunkt Sonnenkogel und retour.
Das Jamtal entlang des Jambaches
Mittelschwere Wanderung von Galtür zur Menta-Alm und durch das Jamtal zur Scheibenalm und retour. Besonders Ambitionierte gehen bis zur Jamtalhütte.
Von Galtür rund 6 Kilometer zum Zeinissee, über den Uferweg zum Stausee Kops, den man entweder betrachten oder umrunden kann.
Buin – zum Greifen nah. Er gehört zur Bergfamilie des Silvretta-Hauptkammes und markiert die Grenze zwischen Vorarlberg und dem Schweizer Kanton Graubünden. Grenzen gibt es viele hier. Ob von Menschen gezogen oder von der Natur geschaffen animieren sie zum Herantasten, Erkunden, Erleben und gegebenenfalls auch zum Überschreiten. Mit entsprechendem Wagemut eben – oder den dafür nötigen Papieren.
Jamtal. Jamtalferner. Jambach. Jam. „Jam ist keltisch und bedeutet beidseitig des Baches“, weiß Nikolaus Raggl. Sein Wissen ist reichhaltig und es sprudelt wie der Jambach selbst, der am Fuß der so dominanten und zackigen, 2.558 Meter hohen Gorfenspitze vorbei in Richtung Dorf rauscht, wo er zusammen mit dem Vermuntbach zur Trisanna wird. Nikolaus ist hier aufgewachsen, er ist tief verwurzelt in die Gegend und ihre Geschichte, die in schönen Teilen die der Familie Raggl ist. Gemeinsam mit seiner Frau Susanne, die Nikolaus’ wegen von Wien nach Galtür gezogen ist, schreibt er längst an einem neuen Kapitel. Mit den Kindern Jonathan und Sarah, der Gastfreundschaft im Ferienhaus Ambrosius und viel Gespür für die Energien der Menschen wie der Natur.
Hundewandern ist anders.
Tea kitzelt es wieder. Sie erklärt die Verschnaufpause auf ihre Weise für beendet. Lenny neigt zum Träumen, Tea eher zum Überschäumen. Sie ge-
UND MIT HUNDEN ZU WANDERN IST ÜBERHAUPT ANDERS. EREIGNIS- UND ABWECHSLUNGSREICHER JEDENFALLS.
winnt – wie eigentlich immer – und bringt Bewegung in tierische Pfoten und menschliche Beine. Das Naheliegende soll wohl die erste Wanderung sein – ins Jamtal. Als kleiner Junge hat Nikolaus dort schon Kühe gehütet, sie zu saftigen Plätzen geführt, sich die Zeit mit Schnitzen vertrieben und jeden Stein und Baum und Blick derart in Geist und Mark und Bein gesogen, wie es nur möglich scheint, wenn die Umgebung mit Kinderbeinen erkundet wird. „Es stellte sich nie die Frage, ob ich hier richtig bin oder falsch“, beschreibt er mit beneidenswerter Klarheit sein Urgefühl von Heimat und die Gewissheit, genau hierhin zu gehören.
Sobald das letzte Weiß verschwunden ist und Grün die Wiesen erobert, ist das Jamtal nach wie vor ein Königreich für Kühe. Von ihnen zeugen jetzt aber lediglich getrocknete Fladen, denn es ist Oktober und sie sind längst zu Hause. Der Herbst ist die beste Jahreszeit, um hoch oben rundum entspannt mit Hunden zu wandern. Und mit Hunden zu wandern ist überhaupt anders. Ereignis- und abwechslungsreicher jedenfalls. Ihre Bewegungen ziehen die Blicke automatisch immer wieder mit sich – mal zum Busch, der intensiv beschnüffelt werden will, mal zum Erdhügel, in dem ein Maulwurf wohnt, mal den kleinen Felsen hinauf, wo weiter entfernt Gämsen klettern, und mal zum Bach hinunter, der zu einem Barfußbad einlädt. Das Jamtal hat all das zu bieten – und noch mehr, wobei es nur die stets wechselnden Gebirgspanoramen sind, die den Atem stocken lassen. Denn der Weg geht gnädig steil bergan, an der Menta-Alm vorbei und den Zwergbumbsdi-Weg links des Baches weiter in Richtung Talschluss. Je weiter wir wandern, umso felsiger wird es und umso näher rückt der Jamtalferner.
Er lockt, doch entscheiden wir uns nach knapp sieben Kilometern feinem Marsch, irgendwo zwischen Scheibenalm und Jamtalhütte, auf einer Höhe


von etwa 2.000 Metern dazu, umzudrehen und ins Tal zurückzukehren. Der Schnüffelmarathon hat Tea und Lenny ruhiger werden lassen. In gemütlicher Zufriedenheit traben sie bergab mit uns. Es ist immer und auch hier erstaunlich, wie sich die Rückwege von den „Hinwegen“ unterscheiden. Nun wirken die gegenüberliegenden Bergmassive wie Magnete. Fädnerspitze, Grieskopf, Grieskogel, Gaisspitze heißen ein paar von ihnen, doch streben wir der pyramidenförmigen Gorfenspitze zu, zu deren Fuß ja nicht nur der Jambach seine letzten Meter fließt, sondern auch das Haus Ambrosius steht.
Nimmermüde Hundebeine.
Auf einen Abend, der von heiterer Müdigkeit geprägt ist, folgt eine entspannte Tiefschlafnacht mit glücklich schnarchenden, den Tag mit Pfotenzucken nachträumenden Hunden. Die Lust auf mehr und die Ungeduld der zwei Fellnasen machen uns in Allerherrgotts-
IN GEMÜTLICHER ZUFRIEDENHEIT TRABEN DIE BEIDEN HUNDE MIT UNS BERGAB.

früh Beine. Die Luft ist knackig frisch, der Nebel hängt noch tief, doch sind die vereinzelten Lichtstrahlen, in denen das nuancenreiche Waldgrün mit den üppigen Herbstfarben um die Wette strotzt, schon ziemlich vielversprechend.

Die Wege am Alpkogel, dem Stausee Kops und dem Zeinissee haben wir uns für heute vorgenommen und das war eine richtig gute Idee. Schon bei der Talstation der Alpkogelbahn hat der Nebel sich gelichtet. Auf der einen Seite ist es die Aussicht nach Galtür und darüber hinweg, die fesselt. Auf der anderen Seite ist es das großzügig stechende Blau des Stausees Kops, der – schon auf Vorarlberger Seite – viel Wasserkraft sammelt. Auch der Jamtalferner liefert ihm energiereiches Nass, wird der Großteil der Jambachwasser doch abund dem Stausee Kops zugeleitet. Ein epochaler Eingriff ist das, auch weil der Jambach eigentlich über die Trisanna, die Sanna, den Inn und die Donau entwässern würde. So aber fließt das Jamwasser in den Rhein und stellt damit die Europäische Wasserscheide in Frage.
Dem Wasser selbst ist’s wohl egal. Unbeeindruckt spiegelt es die Gipfel und Wolken, die uns wohlgesonnen sind. Ja, der Himmel meint es gut mit uns. Die Erde auch. Zwischen den eigenwillig knorrigen Latschen wachsen Wacholderbüsche, deren Beeren holzig, harzig, blumig schmecken, herb ist hingegen der Geschmack der letzten Prei-



selbeeren. Immer wieder werden die kontemplativen Gebirgsmomente vom Herumtollen der Hunde befeuert, deren Energie endlos zu sein scheint und erst abnimmt, nachdem wir am Kopssee vorbeigewandert sind und den bezaubernden Zeinissee umrundet haben. Nikolaus’ Erinnerungs- und Geschichten-Kopfkiste ist prall gefüllt. Trigger gibt es wahrlich genug. Beim Zeinissee fällt ihm beispielsweise ein, wie der Wirt des Alpengasthofs Zeinisjoch die Skischülerinnen und -schüler früher vom Zeinislift zum Mittagessen abholte. „Mit einem Schneewiesel und einer langen Schnur, an der man sich festhalten konnte. Bis zu 30 Leute konnte er damit zum Gasthaus ziehen und wieder heraus zum Lift“, erzählt er und richtet den Blick in Richtung Osten.

Der Duft nach Wald und Moos.
Ohne Zögern haben sich Tea und Lenny ihre Plätzchen im Haus erobert und wieder einmal gezeigt, wie schnell fremde Orte zu einem Zuhause werden können, wenn sie so einladend sind –und so heimelig. Besser geht’s nicht, möchte man meinen, doch zeigt die dritte Wanderung, dass sich hier viel Schönes steigern lässt.
Alle Wege rund um Galtür scheinen endlos erweiterbar zu sein. Vom Aussichtspunkt Sonnenkogel aus, den wir erreichen, nachdem wir den Ort Galtür gekreuzt und die uns gegenüberliegenden Berghänge erklommen haben, bietet sich beispielsweise der Marsch zur Friedrichshafener Hütte an. Wir entscheiden uns aber für einen Rundweg mit richtig viel Wald. Dafür wandern wir erst auf dieser Tiroler Seite der Verwall-Gruppe, kreuzen die Trisanna beim Galtürer Ortsteil Tschafein und tauchen bald ein in den Panoramaweg „Wald erleben“, dessen Name Programm ist. Feuchte Moosluft füllt die Lungen, wieder können sich Tea und Lenny nicht sattschnüffeln und wieder sind es Nikolaus’ Geschichten, die dem Erlebnis Wurzeln verleihen. So zeigt er uns beispielsweise jene uralten Bäume, die er bald zum richtigen Mondzeichen fällen und zu Brettern verarbeiten wird, um mit ihnen die Fassade des Hauses Ambrosius zu verkleiden. Ein schöner Plan, der so typisch ist für den Kreislauf seines Lebens in Galtür.
 Alexandra_Keller
Alexandra_Keller
Auf der einen Seite ist es die Aussicht nach Galtür und darüber hinweg, die fesselt. Auf der anderen Seite ist es das großzügig stechende Blau des Stausees Kops, der – schon auf Vorarlberger Seite – viel Wasserkraft sammelt.


Autumn is the best season to go for a nice hike with your dog –and Galtür is possibly the most beautiful place for it.

The two dogs Tea and Lenny form quite an adventurous pair. With them on our side, the vacation home Ambrosius becomes our home for the next two (hiking) days. The old, lovingly restored and charmingly inviting house stands at the one end of Galtür - at the entrance to the Jamtal Valley, through which our first tour leads.
Hiking with dogs is different. Their attention is always drawn to something - either to a bush that needs to be sniffed, to a mound where a mole lives, to a small rock where chamois are climbing, or to a stream that invites for a barefoot bath. The Jamtal Valley has all this to offerand more, although it is mainly the ever-changing mountain panoramas that will take your breath away. The path goes uphill graciously, past the Menta-Alm Alpine farm and continues to the left of the stream towards the end of the valley. The further we hike, the rockier it becomes and the closer we get to the mountain Jamtalferner. Although it is tempting, we decide to turn around and return to the valley after almost seven kilometres of walking, somewhere between the Scheibenalm and the Jamtal Hut, at an altitude of about 2,000 meters.
An evening marked by cheerful fatigue is followed by a relaxing night of deep sleep. The desire for more
and the impatience of the two fur noses make us get up at the crack of dawn. Today’s agenda includes the trails at the Alpkogel, the artificial lake Kops and the lake Zeinissee, which we think was a really good idea. At the valley station of the Alpkogel lift, it is on the one hand the view to Galtür and beyond that captivates. On the other hand, it is the generously piercing blue of the artificial lake Kops, which - already on the Vorarlberg side - collects a lot of water power ... and invites you to get going.
Back at the house, Tea and Lenny have taken over their spots without hesitation, showing once again how quickly foreign places can become home when they are so inviting - and so cosy. It doesn’t get any better than this, one would think, but the third hike shows that there is much beauty to be enhanced here. From the Sonnenkogel viewpoint, which we reach after crossing the village of Galtür and climbing the mountain slopes opposite us, for example, the march to the Friedrichshafener Hut is a good choice. However, we opt for a circular route with a lot of forest. We start by hiking on the Tyrolean side of the Verwall Group, cross the Trisanna at the Galtür district of Tschafein and soon dive into the panoramic trail “Wald erleben” (“Experience the forest”), the name of which says it all.

Die zeitgenössische Musik hat in Schwaz seit 30 Jahren mit den Klangspuren ein Zentrum gefunden. Die Anfänge des international anerkannten Festivals waren spontan und bescheiden.

Wer an ein Festival für zeitgenössische Musik denkt, hat wahrscheinlich Orte wie Wien oder eine deutsche Großstadt im Kopf. Doch das beschauliche Schwaz? Mit seinen knapp 14.000 Einwohnern? Ganz im Westen von Österreich? Und dann noch nicht einmal die Landeshauptstadt. Aber ja, so ist es. In eben dieser Stadt gibt es seit mittlerweile 30 Jahren eines der anerkanntesten Festivals für zeitgenössische, avantgardistische Musik.
Wie Wien, nur in Tirol.
„Die Stadt Schwaz hatte eine Stelle ausgeschrieben, die ich bekommen habe. Und zwar die Leitung des Kulturamtes, das bis dahin mit den Bereichen Sport und Schule zusammengelegt war. Wobei Leitung etwas groß gegriffen ist. Ich war alleine und das halbtags. Doch die Aufgabe klang sehr reizvoll. Ich sollte innovative Kulturprojekte in Schwaz etablieren“, erzählt Maria-Luise Mayr, eine von zwei Gründerinnen des Festivals. Da es nicht in Frage kam, einfach „jemanden von außen“ einzukaufen, wurde erst einmal mit der lokalen Community gesprochen. Ein Glücksfall war das Kennenlernen von Thomas Larcher, der zum zweiten Gründer wurde. „Thomas kam gerade aus Wien retour. Er hatte dort studiert und sagte zu mir, er wolle so etwas wie wienmodern, nur eben in Tirol aufziehen. Das war der Startschuss.“
Die ersten Schritte.
Auch wenn anfangs von künstlerischer Seite kurz darüber diskutiert wurde, ob Innsbruck nicht der bessere Austragungsort für eine solche Art von Festival wäre, stand ein Ortswechsel nie wirklich zur Debatte. „In Schwaz war der Wille einfach da. Darüber hinaus habe ich mir gedacht, dass Schwaz
eher ein Industrieort ist. Intuitiv habe ich gespürt, dass es hier Sponsoren und spannende Räume gibt“, erzählt die ehemalige Gründerin und langjährige Geschäftsführerin Mayr. Gemeinsam mit weiteren lokalen Größen wie Franz Hackl, der Avantgarde Schwaz, der Jazzakademie und vielen anderen Partnern wurde am Schwaz-Konzept gearbeitet. 1993 erfolgte die Vereinsgründung der Klangspuren. Im September 1994 fand das Eröffnungskonzert im Turnsaal der Hauptschule statt. „Um 20 Uhr sollte das Konzert des Tiroler Symphonieorchesters Inns-
7. bis 24. September 2023

Future Lab:
Das Klangspuren Future Lab richtet sich an hochtalentierte junge Musiker und Komponisten, die eine Karriere als Berufsmusiker anstreben, und steht heuer auf den zwei Säulen Composers Lab und konsTellation plus.
Composers Lab:

Aufführung der Werke der Teilnehmer durch das Schallfeld Ensemble am 18. September 2023
konsTellation plus:
Konzert am 20. September 2023
Programm, Tickets und weitere Infos unter www.klangspuren.at
„ES WAR EINE GLÜCKLICHE FÜGUNG, MIT DER MUSIK AN ORTE ZU GEHEN, WO MAN SONST KAUM HINKOMMT.“
bruck losgehen. Um halb acht war noch kaum jemand da. Da meinte Thomas zu mir: Weißt was, wenn keiner kommt, dann lassen wir’s halt wieder. Am Ende mussten wir dann sogar Extrastühle in den Saal stellen.“
Fabrikhallen als Konzertsäle.
Der Zuspruch ist auch 30 Jahre nach dem Eröffnungsabend ein großer. Doch wie kommt es, dass ein Festival abseits der großen Städte so erfolgreich ist?
„Alles spielt zusammen“, meint Mayr und spricht dabei nicht nur von der Neugier der Menschen. „Klar wollten die Leute Musik hören, für die man sonst vielleicht nach Wien fahren muss. Eine glückliche Fügung war es aber auch, mit der Musik an Orte zu gehen, wo man sonst kaum hinkommt. Das hat gezogen.“ Fabrikhallen, Indus-
triegebäude oder Kirchen, die Klangspuren sind seit jeher für Konzerte an unerwarteten Orten bekannt. „Diese Orte erlauben einen niederschwelligen Zugang. Die Leute trauen sich zu kommen. Und das bringt wunderbare Anekdoten. Ich kann mich noch erinnern, wie eine Frauengruppe auf einem Konzert in der Kirche St. Martin war und nach dem Konzert eine der Frauen zu den anderen sagt: ‚Boah, super war es. Aber gefallen hat es mir nicht.‘ In diesem Satz steckt wahnsinnig viel.“
Ein neuer Ansatz.
Menschen mit moderner Musik in Kontakt zu bringen ist ein Ziel der Klangspuren. Aus dieser Motivation heraus haben sich viele unterschiedliche Formate entwickelt, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Besucher. „Ich
komme selbst von einem Bergbauernhof im Tiroler Oberland. Mein erstes Orchesterstück habe ich mit 20 Jahren gehört. Ich verstehe absolut, dass es gerade bei Uraufführungen schwer sein kann, reinzukommen. Aber wenn man dann mit einem Komponisten sprechen kann und es Klick macht, wird es spannend. Plötzlich hat man einen anderen Zugang und will mehr wissen. Warum spielt er das so? Warum hat er das gemacht?“
Um diesen Austausch zu ermöglichen, wurden Formate entwickelt, bei denen Zuhörer in lockerer Atmosphäre Originalnoten einsehen oder bei Proben dabei sein können. „Solche Nebenveranstaltungen sind entstanden, weil die Zuhörer sich das gewünscht haben: Das eine Mal habe ich vom Orchester, das sich nach dem Konzert in der örtlichen Tennishalle traf, die Noten eingesammelt und wollte sie dem Verlag zurückgeben. Das haben Zuschauer mitbekommen und wollten unbedingt einen Blick hineinwerfen. Das andere Mal war eine Volksschulklasse bei einer Probe eines Kölner Ensembles zu Gast. Die Kinder hatten so wunderbare Fragen, dass am Ende Komponisten, Musiker und Kinder am Boden saßen, die Notenblätter ausgebreitet und diskutiert haben. Das wollten wir anderen auch zugänglich machen.“
Neben ungewöhnlichen Veranstaltungsorten und dem unbändigen Wunsch, zeitgenössische Musik zugänglich zu machen, war und ist auch die Auswahl der Musikerinnen und Musiker ein Erfolgsfaktor der Klangspuren Schwaz. „Es war ganz sicher Thomas Larchers Verdienst, dass wir von Beginn weg auch lokale Größen wie Werner Pirchner, Bert Breit, Martin Lichtfuss, Robert Nessler, Haimo Wisser und viele andere bei den Klangspuren im Programm hatten. Das war



Thomas‘ und dann auch mein Wunsch. Wir wollten nicht nur irgendwelche Namen einkaufen, sondern vor allem auch den regionalen Künstlern, die es ernst meinten, eine Bühne bieten. Hier hatten Leute wie Johannes Maria Staud oder Christof Dienz die Möglichkeit, in einem internationalen Setting ihre Stücke zu präsentieren. Daraus ist ein wahrer Sog entstanden, der zu vielen Ensemblegründungen geführt hat“, berichtet Mayr.
Christof Dienz hat diese Wurzeln nicht vergessen und weiß die Möglichkeiten auch heute als künstlerischer Leiter zu schätzen: „Seit 30 Jahren kommen internationale, sehr berühmte Künstler nach Tirol und zeitgleich wird durch diesen Austausch die regionale Szene gefördert. Das ist etwas sehr Besonderes.“ Wie auch das Selbstverständnis der Klangspuren, das Dienz nach 30 Jahren fortsetzen wird: „Wir versuchen diesen Begriff neue Musik so zu deuten, dass vieles Platz hat. Nicht nur der akademische Zugang, der uns auch wichtig ist. Es gibt aber auch neue Musik, die im Proberaum entsteht. Oder über elektroakustische Ansätze. Oder aus der improvisierten Musik.“


Die Mischung aus Internationalität und Regionalität führte in den Anfangsjahren schnell zu positiven Kritiken und Achtung innerhalb der
Festivalszene. Nur wenige Jahre nach der Gründung war beispielsweise die elitäre Schweizer „Neue Zürcher Zeitung“ vor Ort „eben, weil es bei den Klangspuren frische, neue Gesichter zu sehen und hören gab“. Dass zu dieser Zeit auch der Österreichische Rundfunk eine eigene Redaktion für sogenannte ernste Musik hatte und Journalistengrößen an Programmdiskussionen teilnahmen, beflügelte das junge Festival in seiner Entwicklung zusätzlich.

30-JahrJubiläum.
Bei der 30. Ausgabe der Klangspuren lautet das Motto „Preview – Review“, also Ausblick und Rückblick. Im Jubiläumsjahr wird folglich nicht nur in Erinnerungen geschwelgt, sondern ganz bewusst nach Ausblicken gesucht, was die Klangspuren in Zukunft sein können. „Dran bleiben ist wichtig“, sagt dazu der künstlerische Leiter. „Das erreicht man am besten, wenn man junge Ensembles und Komponisten fördert, sich mit jungen Künstlern auseinandersetzt und ihnen zuhört. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Es gilt für das ganze Leben: Interessiert bleiben, offen bleiben, Lust am Leben haben. Das kann man sich erhalten.“ Besser könnte man die Faszination Klangspuren wohl nicht beschreiben.
Felix_Kozubek„SEIT 30 JAHREN KOMMEN INTERNATIONALE, SEHR BERÜHMTE KÜNSTLER NACH TIROL
UND ZEITGLEICH WIRD DURCH DIESEN AUSTAUSCH DIE REGIONALE SZENE GEFÖRDERT.
DAS IST ETWAS SEHR BESONDERES.“
Christoph Dienz
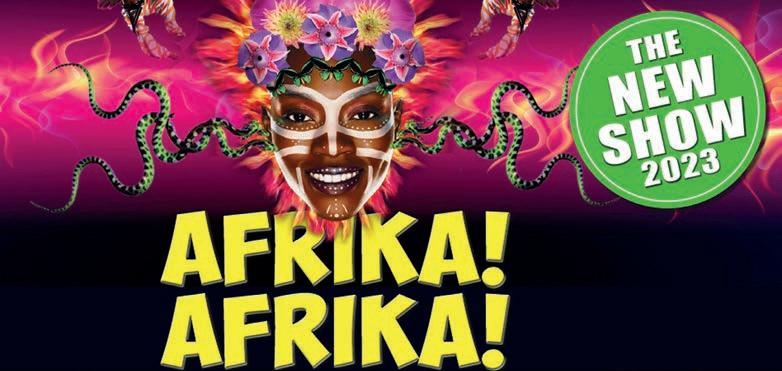
OLYMPIAHALLE
Das Ensemble aus über fünfzig Tänzer:innen, Musiker:innen, Akrobat:innen und Artist:innen aus über zehn verschieden Ländern wird nicht nur mit der neuen Bühnenshow für Furore sorgen, sondern auch wieder mit spektakulärer Videokunst und Live-Band erkennbar weiterentwickeln.

17. Juni – 16. Juli 2023
Vergnügungspark Innsbruck
24. Juni 2023
RAF Camora
18. Aug. – 03. Sept. 2023
Circus Berlin
22. Oktober 2023
One Vision of Queen
27. – 29. Oktober 2023
ARTfair Innsbruck
15. November 2023
Life of Agony
River Runs Red
25. Jänner 2024
Martin Rütter
Der will nur spielen!
26. Jänner 2024
Fab Box - Fabulos
09. März 2024
08.12.2023
OLYMPIAHALLE
Das Ensemble aus über fünfzig Tänzer:innen, Musiker:innen, Akrobat:innen und Artist:innen aus über zehn verschieden Ländern wird mit der neuen Bühnenshow, spektakulärer Videokunst und Live-Band für Furore sorgen.
12.01. –
OLYMPIAHALLE
Weltklasse auf und hinter dem Eis! HOLIDAY ON ICE bringt mit der neuen Eis-Show A NEW DAY Live-Entertainment der absoluten Spitzenklasse nach Innsbruck. A NEW DAY zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau.
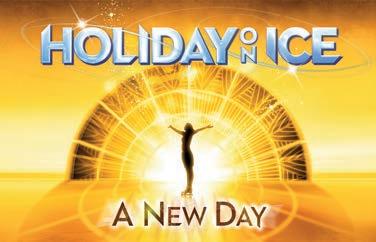
Thommy Ten & Amélie van Tass
Die Las Vegas Show
Info Ticketcorner
Tel.: +43 (0)512 33 83 83 33
For the past 30 years, with Klangspuren, contemporary music has found a centre in Schwaz.

When you think of a festival for contemporary music, you probably have places like Vienna or a major German city in mind. But tranquil Schwaz? With its population of just under 14,000? In the very west of Austria? In fact, this very city has been home to one of the most recognized festivals for contemporary, avant-garde music for 30 years now.
In 1993, Maria-Luise Mayr and Thomas Larcher founded the Klangspuren Schwaz association. Even though in the beginning there was a brief discussion from the artistic side as to whether Innsbruck would not be a better venue for this kind of festival, a change of location was never really up for debate. “In Schwaz, the will was simply there,” says the founder and longtime managing director. Together with other local celebrities such as Franz Hackl, Avantgarde Schwaz, the Jazz Academy and many other partners, they worked on the Schwaz concept until the opening concert was held in the gym of the main school in September 1994.
Even 30 years after that opening night, the response remains great. But how is it that a festival away from the big cities is so successful? “Obviously, people wanted to hear music for which you might otherwise have to travel to Vienna. But it was also a lucky coincidenceto take the music to places where one would otherwise hardly go. For some reason, that worked,” says Mayr. Factory halls, industrial buildings or churches, Klangspuren has always been known for concerts in unexpected places.
In addition to unusual venues and the irrepressible desire to make contemporary music accessible, the selection of musicians is also a factor in the success of
Klangspuren Schwaz. From the beginning, local stars such as Werner Pirchner, Bert Breit, Martin Lichtfuss, Robert Nessler, Haimo Wisser and many others have been part of the program. Regional musicians had the opportunity to present their songs in an international setting. Like Christof Dienz, who is now artistic director: “For 30 years, international, very famous artists have been coming to Tyrol and at the same time, the regional scene has been promoted through this exchange. That is something very special.”
Engel & Völkers ist seit über 21 Jahren mit sieben Immobilienshops in der Alpenregion Tirol & Salzburger Land aktiv und hat sich in den letzten Jahren einen Namen als lokaler Experte in Sachen Immobilien gemacht.

Unsere Immobilienprofis arbeiten präzise und effektiv. Dabei setzen wir auf langjährige Erfahrung und fundierte Marktkenntnis. Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie!

Inspiration. Schöne Momente. Ein vielfältiges Rahmenprogramm. Namhafte Künstler. Ein Open.Air, das seinesgleichen sucht. Und kulinarische Highlights, die den Genuss zwischen Berg & See vollenden. Das ist KLASSIK.UNIQUE im Alpine Lifestyle Hotel DAS KRONTHALER.





13. bis 16. Juli 2023
Vier Tage mit einzigartigen Highlights: [Alm].Wanderung mit Gerlinde Kaltenbrunner, Get-together mit Flo’s [Jazz].Casino, [Operette].nach Maß mit „Rosenheim-Cop“ Max Müller auf dem Achensee, 5.Gang.[Klassik].Dinner kreiert von Gastkoch Thomas Penz, das große Open.Air mit Eva Lind, Dmitry Korchak, Maria Barakova, Giora Feidman, Günther Groissböck und Nachwuchstalenten, begleitet vom Kammerorchester InnStrumenti, Matinée mit Geigen-Virtuose Benjamin Schmid & Familie uvm.
Erleben Sie das gesamte KLASSIK.UNIQUE
Wochenende oder besuchen Sie das fulminante
Open.Air am 15. Juli 2023.

Am Waldweg 105a | 6215 Achenkirch
+43 5246 6389

welcome@daskronthaler.com
www.daskronthaler.com
















Spätestens seit ihrem Nestroy-prämierten Stück „Adern“ gilt die Tiroler Dramatikerin Lisa Wentz als heller Stern am Theaterhimmel. Im Interview erklärt sie, was das Schreiben mit sauren Gummibärlis zu tun hat, weshalb Zorn in den richtigen Momenten eine wichtige Triebfeder ist, warum sie sich Sorgen um die Welt macht und wo es die besten Moosbeernocken der Welt gibt
In Ihrem Stück „Adern“ heisst es an einer Stelle: „Wenn man sich einmal ein Leben ausg’sucht hat, dann bleibt man auch dabei.“ Sie sind mit 18 von Schwaz nach Wien gezogen, wo Sie die Schauspielakademie Elfriede Ott absolviert haben. Gleich nach dem Abschluss sind Sie weiter nach Berlin, um dort Szenisches Schreiben zu studieren. Hatten Sie sich das falsche Leben ausgesucht? Lisa Wentz: Im Gegenteil. Alles, was ich in meinem Erwachsenenleben gemacht habe, hat mich näher zum Theater gebracht, zu den Geschichten und der Kunst. Mit 18 bin ich nach Wien gezogen, nur um Aufnahmeprüfungen machen zu können – die Jahre dort waren eine der wichtigsten, aufregendsten und prägendsten meines Lebens. Ich weiß aber nicht, ob ich die Meinung der Figur in diesem Fall zu 100 Prozent selber vertrete. Ich denke, es ist oft wichtig, sich neu zu orientieren.
Haben Sie die Schauspielerei als Motor gebraucht, um zum Schrei -
Lisa Wentz (geb. 1995) ist in Schwaz aufgewachsen und übersiedelte nach der Matura nach Wien, wo sie die Schauspielakademie Elfriede Ott absolvierte. 2017 schloss sie die Ausbildung ab und zog weiter nach Berlin, um an der Universität der Künste Berlin (UdK) Szenisches Schreiben zu studieren. Ihr erstes abendfüllendes Theaterstück „Aschewolken“ wurde 2020 mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis ausgezeichnet. Mit ihrem Stück „Adern“ gewann Wentz 2021 den „Retzhofer Dramapreis“. In der Folge wurde „Adern“ im März 2022 in der Regie von David Bösch am Akademietheater in Wien uraufgeführt: Die Inszenierung mit Sarah Viktoria Frick und Markus Hering in den Hauptrollen heimste durchwegs Kritikerlob ein. Im November 2022 wurde Lisa Wentz in der Kategorie „Bestes Stück – Autorenpreis“ mit einem Nestroy ausgezeichnet.
ben zu kommen? Oder gab es diese Sehnsucht, dem Ungesagten und dem Versickerten eine Sprache zu geben, schon immer? Das Schauspiel hat mich näher an die gespielte Szene gebracht. Ich glaube, in meinen Jugendjahren hatte ich gar keine Vorstellung davon, was das heißt, Dramatikerin zu sein, also für das Theater zu schreiben, aber schreiben wollte ich schon immer. Für mich geht das also Hand in Hand.
Ist das Schauspielkapitel für Sie eigentlich mittlerweile abgeschlossen? Nein ... abgeschlossen ist bei mir nie etwas komplett. Es bleibt also spannend!
Was bedeutet Ihnen das Schreiben? Ist es mehr Lust oder mehr Last? Schreiben zu dürfen, ist ein unheimliches Geschenk. Das Schreiben ist wie saure Gummibärlis, ich habe unendlich viel Bock drauf, das Reinbeißen ist eine Überwindung, dann kaue ich drauf rum und weiß nicht so recht, aber wenn es fertig ist, will ich das nächste.
Aktuell befinden Sie sich in einem „Writer’s Retreat“. Wollen Sie verraten, woran Sie gerade arbeiten? Das Thema ist leider unter Verschluss, aber ich arbeite an einem neuen Theaterstück.
In „Adern“ erzählen Sie, wie Ihr verwitweter Urgrossvater Anfang der 1950er-Jahre per Zeitungsannonce eine neue Mutter für seine Kinder sucht. Und damit Ihre Urgrossmutter dazu bringt, von St. Pölten nach Brixlegg zu ziehen, wo die Sprachlosigkeit den Ton angibt. Wann und wie haben Sie von diesem Teil Ihrer eigenen Familiengeschichte erfahren?
Es ist eine Geschichte, die mich schon seit meiner Kindheit begleitet, und ich bin dankbar, dass ich sie als Inspiration verwenden durfte. „Adern“ ist allerdings keine biographische Abhandlung meiner Familiengeschichte, das ist gar nicht möglich. Es ist ein Mix aus Inspiration, Anlehnung, Recherche und Fantasie.
Schon Ihr erstes abendfüllendes Stück „Aschewolken“ wurde 2020 mit dem Deutschen Jugendthea -
„Adern“ in den Innsbrucker Kammerspielen: In der Regie der jungen Wiener Regisseurin Bérénice Hebenstreit feiert Lisa Wentz’ Nestroy-prämiertes Stück „Adern“ am 10. Juni in den Innsbrucker Kammerspielen seine Tirol-Premiere. Der Einakter, der von der Jury des Retzhofer Dramapreises als „kunstvolles Volksstück“ gewürdigt wurde, spielt im Brixlegg der 1950er-Jahre und erzählt, wie die junge Aloisia mit Kind und Kegel nach Tirol zieht, nachdem sie die Annonce des Witwers Rudolf gelesen hat. Der Vater von fünf Kindern, der in einem Bergwerk arbeitet, ist auf der Suche nach einer neuen Frau und Ersatzmutter für seine Kinder. In Aloisia findet er sie. In den Kammerspielen schlüpft Hanna Binder in die Rolle der Aloisia, Stefan Riedl wird als Rudolf zu sehen sein. Mehr Infos unter www.landestheater.at
terpreis geehrt. „Adern“ wurde mit dem Retzhofer Dramapreis ausgezeichnet, am Akademietheater in der Regie von David Bösch uraufgeführt und mit dem Nestroy-Autorenpreis gewürdigt. Beflügeln solche Auszeichnungen? Oder kreieren sie auch Druck? Es ist eine unglaubliche Ehre und es ist für mich immer noch oft ein surreales Glück. Es gibt einem auch die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, und das tue ich dann, so gut ich kann.

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist immer wieder von einer Theaterkrise und von halbleeren Häusern die Rede. Machen Sie sich Sorgen ums Theater? Ums Theater mach ich mir nur Sorgen, weil ich mir um die Welt Sorgen mache. Solange wir leben, wird es Theater geben, da bin ich mir sicher. Es ist als Medium und als Ort unersetzbar und es wird immer Menschen geben, die es zum Theater zieht, das tut es seit tausenden von Jahren. Aber wenn wir nicht handeln, wird der Klimawandel alles zerstören, auch das Theater, und ja, das macht mir Sorgen.
Am 10. Juni feierte „Adern“ in den Innsbrucker Kammerspielen Premiere, ab 16. Juli zeigen die Tiroler Volksschauspiele Telfs eine Neufassung von Franz Kranewitters „7 Todsünden“, wo Sie zum Autorenkreis zählen. Sind Ihnen diese „Heimspiele“ besonders wichtig? Ich freue mich natürlich sehr auf eine Tiroler Perspektive auf meine Stücke und ich freue mich darauf, dass Familie und Freunde im Publikum sitzen werden. Und ich hoffe natürlich, die Texte gefallen und bewegen.
Im November 2022 wurde Lisa Wentz in der Kategorie „Bestes Stück – Autorenpreis“ mit einem Nestroy ausgezeichnet.
Dahinter steckt der große Appetit, Tirol mit allen Sinnen zu entdecken.
WWW.WILLKOMMEN.TIROL/IM-RESTAURANT

In Telfs wurde Ihnen als Todsünde der „Zorn“ zugeteilt. Sind Sie privat jemand, der zu Zornausbrüchen neigt? Nein, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, Ausbrüche versuche ich zu vermeiden. ABER: Zorn ist wichtig. Wir brauchen den Zorn als Motivation. Als Triebkraft. Wir brauchen Zorn in den richtigen Momenten, für die wichtigen Situationen.
In einem Interview haben Sie erzählt, dass Sie sich als junge Frau recht unwohl gefühlt haben, weil Sie oft wegen Ihres Gewichts angegriffen wurden. Solche Anfeindungen machen doch auch zornig ... Ich glaub, in dem Interview habe ich damals gesagt, dass ich mich als junge Frau unwohl gefühlt habe in vielen Situationen. Ich habe immer viel Unsinn gehört wegen meinem Körper, eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Menschen mit mir teilen – aber unwohl habe ich mich deswegen nie gefühlt. Ich habe recht früh verstanden, dass Menschen, die glauben, sie müssen das Aussehen anderer kritisieren, selber ein Problem haben, das nichts mit mir zu tun hat. Aber ja, dass es immer noch Leute gibt, die ihre Energie darauf verschwenden, das Äußere anderer, vor allem weiblich gelesener Körper zu kommentieren, das sollte wütend machen. Ich kann in dem Zug Stefanie Reinspergers Buch „Ganz schön wütend“ wärmstens empfehlen.
Sie haben vor einigen Jahren mit drei befreundeten Schauspielern
Im März 2022 wurde „Adern“ am Akademietheater in Wien in der Regie von David Bösch uraufgeführt. Hauptdarstellerin Sarah Viktoria Frick (hier neben Markus Hering) und Autorin Lisa Wentz wurden mit einem Nestroy-Preis ausgezeichnet.

„Die 7 Todsünden“ bei den Tiroler Volksschauspielen: Die Tiroler Volksschauspiele (16. Juli bis 19. August) kehren im heurigen Sommer zu ihren Wurzeln zurück: Anno 1981 – damals noch im Innenhof der Burg Hasegg in Hall – fing die Ära des Sommertheaters mit Franz Kranewitters Stück
„Die sieben Todsünden und ein Totentanz“ an. Auf der Bühne standen damals unter anderem Otto Grünmandl, Ruth Drexel, Hans Brenner, Julia Gschnitzer, Dietmar Schönherr, Krista Posch und Felix Mitterer. Letzterer zählt nun bei der Neuauflage der „7 Todsünden“ zum Kreis der Autorinnen und Autoren, zu dem auch Lisa Wentz gehört.
Als Todsünde, die sie dramatisch zu bearbeiten hat, wurde ihr der Zorn zugeteilt. Weitere prominente Schreibende sind Uli Brée, David Schalko, Felix Mitterer und Hubert Sauper. Regie bei den Todsünden
2.0 führt Gregor Bloéb, der heuer erstmals als künstlerischer Leiter der Volksschauspiele fungiert. Mehr Infos unter www.volksschauspiele.at
das Ensemble „QuerAkt“ gegründet, das über den Weg der Kunst auf Themen der LGBTQIA+ Community aufmerksam machen will. Was muss passieren, damit queere Menschen eine grössere Bühne bekommen? Repräsentation ist wichtig, Repräsentation inspiriert. Ich kann da eigentlich nur von mir sprechen und sagen, dass ich meine Möglichkeiten nutzen werde, queeren Geschichten und Menschen einen Platz auf der Bühne zu geben.
Ihre Urgrossmutter hat ihre alte Heimat hinter sich gelassen und in Tirol eine neue Heimat gefunden. Sie wiederum hat’s schon früh von hier weggezogen. Was bedeutet Ihnen Tirol heute? Tirol wird für mich und meine Texte immer wichtiger Ort sein, er ist der Ort der Erinnerung, der Zersplitterung, der Auseinandersetzung. Außerdem ist Tirol der Ort der besten Moosbeernocken der Welt, und das heißt schon was!
„SCHREIBEN ZU DÜRFEN, IST EIN UNHEIMLICHES GESCHENK.“
Lisa Wentz
Seit über 130 Jahren
eines der schönsten Kaffeehäuser Europas und der centrale Treffpunkt in Innsbruck

Since her Nestroy award-winning play „Adern“ - if not before – Tyrolean playwright Lisa Wentz has been regarded as a bright star in the world of theatre.

Lisa Wentz, born in 1995, grew up in Schwaz and moved to Vienna after graduating from high school, where she attended the Elfriede Ott Drama Academy. In 2017, she graduated and moved on to Berlin to study Scenic Writing at the Berlin University of the Arts (UdK): “Being allowed to write is an incredible gift. Writing is like sour gummy bears: I’m hooked to no end, biting into it is something to overcome, then I chew on it and I’m not sure about it, but when it’s done, I want the next one.”
And she writes with success. After graduating, she had her first workshop performance at the studio theatre of the Ernst Busch Drama School, participated several times in the reading series “Glanz oder Harnisch” (Shine or Armor) and was invited to the playwright’s exchange of the “Luaga & Losna” festival. Her first full-length play “Aschewolken” was awarded the German Youth Theater Prize in 2020. With “Adern” Wentz won the “Retzhofer Drama Prize” in 2021. Subsequently, the play premiered at the Academy Theater in Vienna in March 2022, directed by David Bösch: The production, starring Sarah Viktoria Frick and Markus Hering, received critical praise throughout. In Novem-
ber 2022, Lisa Wentz was awarded a Nestroy in the category “Best Play - Author’s Prize”. Since June 10, “Adern” can also be seen at the Innsbruck Kammerspiele.
In addition, Lisa Wentz is one of the authors who will reinterpret Franz Kranewitter’s play “The Seven Deadly Sins and a Dance of Death” for this year’s Tiroler Volkssschauspiele Telfs. Other prominent writers include Felix Mitterer, Uli Brée, David Schalko and Hubert Sauper. Deadly Sins 2.0 is directed by Gregor Bloéb, who this year serves as artistic director of the Volksschauspiele for the first time. Being performed on Tyrolean soil is something special for the author: “I am of course very much looking forward to a Tyrolean perspective on my plays, and I am looking forward to having family and friends in the audience. And of course, I hope the texts please and move.”
Currently Lisa Wentz is in Writer’s Retreat and is writing something new. She can’t reveal what it is, though: “The topic is unfortunately under wraps, but I’m working on a new play.” In any case, expectations are high.
Die mehrfach mit Designpreisen ausgezeichneten TYROLIT LIFE





Produkte für den Alltag setzen ein Statement in jedem Haushalt.

Erhältlich in unserem Onlineshop tyrolitlife.com



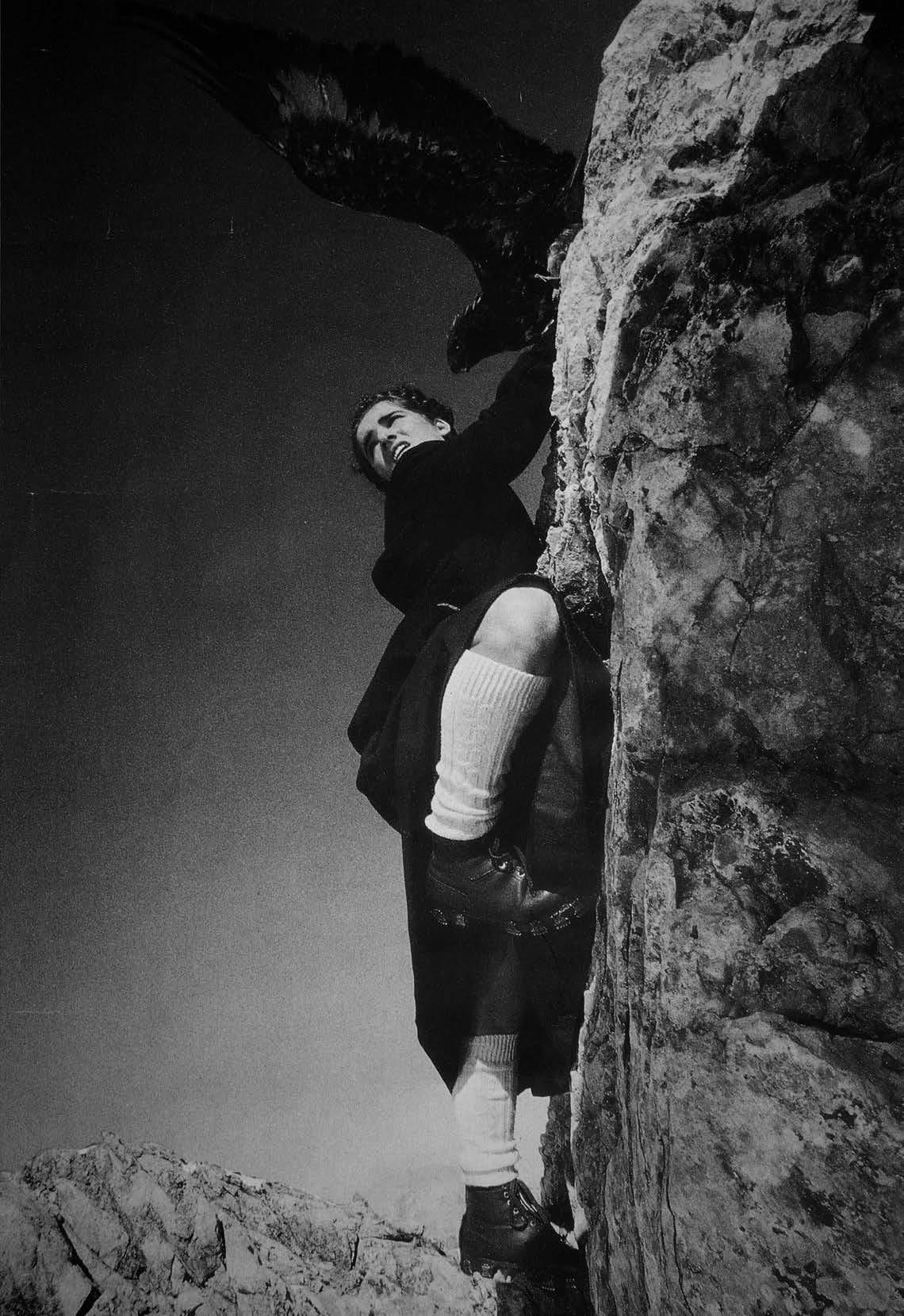
1993 ließ Felix Mitterers Geierwally die großartige Felsenbühne in Elbigenalp erstmals erbeben. 30 Jahre später wird das Stück wieder gespielt – anders und neu. Mit dem spannenden Jubiläumsspektakel auf der Geierwally-Freilichtbühne muss ein heller Spot auch Malerin Anna Stainer-Knittel erfassen. Sie hatte zur Romanfigur inspiriert. Viel mehr als für die Wally war die Lechtalerin aber im 19. Jahrhundert ein Role Model für Frauen, die sich viel trauen.
Als Anna Stainer-Knittel in ihrem 74. Lebensjahr starb, stand die Welt in Flammen. „Mit ihrem Tode verlieren wir eine bis in ihre letzten Tage emsig schaffende, bodenständige Künstlerin; ihre zahlreichen, in aller Welt verstreuten Werke verherrlichen die schönsten Reize unserer heimatlichen Berge“, heißt es in ihrem Nachruf, der im Allgemeinen Tiroler Anzeiger vom 1. März 1915 veröffentlicht wurde. Die Berichterstattung über den Ersten Weltkrieg beherrschte das Blatt. Im Telegrammstakkato wurden dabei die Kriegsschauplätze abgeklappert. „An der polnisch-galizischen Front herrschte stellenweise heftiger Geschützkampf. In den Karpathen ist die allgemeine Situation unverändert. Im Abschnitt Tucholka-Vyszov wurde heftig gekämpft“, sind nur ein paar Fetzen der blutroten Worte dieses Tages.
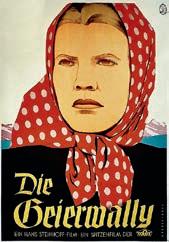
Als Anna Knittel 1841 zur Welt kam, war Innsbruck noch eine Tagesreise von Elbigenalp entfernt. Vier Jahre zuvor war die spätere Kaiserin Sisi geboren worden, vier Jahre später sollte der spätere Bayernkönig Ludwig II. das Licht der Welt erblicken. Anna Knittel
1870 entdeckte die deutsche Schriftstellerin Wilhelmine von Hillern in einem Innsbrucker Laden das Selbstporträt von Anna Stainer-Knittel. Es zeigt die junge Elbigenalperin in abenteuerlicher Pose – an einem Seil hängend –beim Ausräumen eines Adlerhorsts. Zum Schutz der Schafherden war es üblich, dass die Männer des Tals diese Aufgabe erledigten, doch hatten sie in diesem Jahr nicht den Mut dazu. Anna Knittel schon. Der Wagemut wurde in dem Selbstporträt festgehalten und inspirierte Wilhelmine von Hillern zu ihrem Roman. Die Romanfigur faszinierte zahlreiche Künstler*innen - auch Felix Mitterer, der seine Adaption des Stoffes exklusiv für die GeierwallyBühne schrieb. 30 Jahre nach der Uraufführung steht die Geierwally heuer wieder auf dem Programm der Elbigenalper Bühne.
wuchs in einer Zeit auf, in der Revolutionen den Kontinent erbeben ließen. Wissenschaftliche und technische Errungenschaften veränderten zunehmend die Welt – die Welt „draußen“ jedenfalls, denn zwischen den hohen Wänden der Lechtaler und Allgäuer Alpen, der Natur und ihren unberechenbaren Launen so nah, waren Leben und Überleben kaum Fragen akademischer Diskussionen. Auch nicht im Haus von Anton und Kreszenz Knittel, Annas Eltern.
Anton Knittel war Bauer, talentierter Büchsenmacher und Jäger – in Elbigenalp und darüber hinaus berüchtigt für seinen teils hitzköpfigen Zorn. Mit ihm verband Anna eine enge und stürmische Beziehung. Oft hatte sie unter seinen Ausbrüchen zu leiden und doch war er es, der ihr Talent entdeckte und zu einem ihrer stärksten Unterstützer wurde. Anton Knittel zeigte die Zeichnungen seiner jungen Tochter Johann Anton Falger. Der weitgereiste Künstler und Lithograf lebte seit 1831 wieder in seiner Heimatgemeinde Elbigenalp, wo er ein Jahr vor Annas Geburt den berühmten Totentanz gemalt hatte. Ebenso überzeugt von ihrem Talent, begann Falger das Mädchen zu unterrichten.
Sie wurde immer besser und Mitte der 1850er-Jahre nahm Anton Knittel seine Tochter mit auf eine Reise nach Deutschland, Frankreich und in die Schweiz. Sie besuchten Antons Bruder, der als Bildhauer in Freiburg arbeitete, und betrachteten in Basel die romantischen Landschaften von Joseph Anton Koch, einem Großonkel der angehenden Künstlerin. Einen Platz, an dem sie weiter studieren konnte, fanden sie aber nicht.
Sehnsucht nach der grossen Stadt.
Der Traum, als freischaffende Künstlerin zu arbeiten, rückte ab 1859 näher. Unterstützt von Anton Falger begann Anna in München zu studieren und das Jahr 1863 wurde schließlich zum Schicksalsjahr – für sie als Künstlerin und für sie als Mythos. Das Landesmuseum Ferdinandeum kaufte in diesem Jahr Knittels Selbstportrait in Lechtaler Tracht, was ihr ermöglichte, nach Innsbruck zu ziehen und dort eine Zeichenschule für Mädchen zu gründen. 1863 sollte sie sich aber auch zum zweiten Mal todesverachtend zu einem Adlerhorst abseilen lassen und damit jenes Bild prägen, das zum Geierwally-Markenzeichen schlechthin avancierte. Zu dem Nest in der Saxerwand, aus dem die 22-jährige Anna ihr zweites Adlerjunges holte, hatten sich die Männer der Region offensichtlich nicht gewagt. Über die wagemutige Episode wurde in der lokalen Presse berichtet. Und der Mythos nahm seinen Lauf.

Die Mutprobe im Adlerhorst prägte den Mythos der erfolgreichen Porträtmalerin. Später wurden Landschaftsund Blumenmalerei ihre Schwerpunkte.

Der bayerische Schriftsteller Ludwig Steub machte daraus eine Erzählung, die Matthias Schmid illustrierte, Wilhelmine von Hillern zum Roman „Die Geierwally“ inspirierte und Alfredo Catalani zur Oper „La Wally“. Arien daraus sind auf zahlreichen Soloalben bekannter Opernsängerinnen zu hören, auch Maria Callas verlieh der Wally ihre göttliche Stimme. Von Barbara Rütting bis Christine Neubauer reicht der Bogen der Geierwallys in Heimatfilmen, in denen die Geschichte der eigensinnigen Frau erzählt wird – mit Unheilstürmen und allem Pipapo. 1993 wurde der Stoff von Felix Mitterer für die Bühne in der Elbigenalper Bernhardstalschlucht verarbeitet und heuer – also 30 Jahre später – steht die Geierwally dort wieder auf dem Programm. Doch so oft und vielschichtig die Geschichte auch verarbeitet wird – mit dem wahren Leben der Künstlerin hat das wenig bis gar nichts zu tun.
Anfangs machte sich Anna Knittel als Porträtmalerin in Innsbruck einen Namen. Schätzungen zufolge hatte sie bis 1883 mindestens 130 Aufträge ausgeführt. Darunter waren auch Porträts von Erzherzog Karl Ludwig, Feldmarschall Radetzky und Kaiser Franz Joseph I. Nachdem der Markt unter der Last der Fotografie zusammenbrach, wurden Landschafts- und Blumenmalerei ihre Schwerpunkte.
Das Selbstporträt zeigt, wie Anna Stainer-Knittel sich selbst sah: eine willensstarke Malerin jenseits der Konventionen ihrer Zeit.
Ihr Privatleben bekam durch die Heirat mit dem Gipsformer Engelbert Stainer 1867 eine glückliche Wendung. Nach eigenen Angaben hatte Anna Knittel, bevor sie Anna Stainer-Knittel wurde, nicht weniger als 30 Heiratsanträge abgelehnt. Stainer war arm, ihm wurde nachgesagt, er hätte ein außereheliches Kind und Anton und Kreszenz Knittel machten keinen Hehl daraus, gegen diese Heirat zu sein. Trotz dieses Widerstands bestand Anna auf ihrem Recht, den Gatten selbst auszusuchen, heiratete Stainer und gründete mit ihm ein Geschäft in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, wo beide ihre Arbeiten ausstellten und verkauften.

Ungewöhnlich für ihre Zeit, wählte die Künstlerin einen Doppelnamen und behielt so ihren Mädchennamen bei, trug ihr Haar kurz und bestand darauf, ihr eigenes Bankkonto zu behalten. Anna Stainer-Knittel war eine erfolgreiche Künstlerin und eine Tiroler Femme vitale in einer Zeit, die beides noch nicht kannte. Sie war ein Role Model für Frauen, die sich viel trauen. Mehr als Wally.
Alexandra_Keller
EXKLUSIVE TIROLER DIRNDL KOLLEKTION

TRACHTENMODE VON RAUSCHER
LEOPOLDSTRASSE 28, INNSBRUCK MONTAG – FREITAG: 9 – 18 UHR
SAMSTAG: 9 – 13 UHR
DIREKT AM WILTENER PLATZL
ODER ONLINE SHOPPING AUF
HEUUNDSTROH.COM
2011 hat Bernhard Wolf die Leitung der Geierwally-Bühne übernommen. Die erste Aufführung des Mitterer-Stücks war 1993 Initialzündung für seine Schauspielkarriere. Anna Stainer-Knittel begleitet den Lechtaler schon sein ganzes Leben.
Ihr Bühnenleben hat sich parallel zur Geierwally und dem Wachsen der Geierwally-Bühne entwickelt. Bei den Schwabenkindern standen Sie erstmals auf der Bühne in der Schlucht. Können Sie, ein Kind des Lechtales, Ihre Annäherung an Anna Stainer-Knittel beziehungsweise die Geierwally beschreiben –wie begleitet sie Ihre Geschichte?
Bernhard Wolf: Als zehnjähriger Bub habe ich auf der Dorfbühne in Bach angefangen zu spielen. 1995 hatte Claudia Lang – die Geierwally-Bühne war zwei Jahre vorher gegründet worden – die Idee gehabt, die Schwabenkinder zu schreiben. Da hat sie einen Buben gesucht, der die Hauptrolle spielt. Das war meine Chance, auf der Geierwally-Bühne zu spielen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich 1993 die erste Aufführung der Geierwally anschauen durfte. Das war die Initialzündung für mich, den Weg auf die Bühne zu finden. Ich habe viele Jahre mitgespielt, dann etwas Gscheit’s gelernt und schließlich den professionellen Weg eingeschlagen. Seit der HTL bin ich Profiautor und -schauspieler und kann erstaunlicherweise davon leben.
War Anna Stainer-Knittel oder eben die Geierwally schon vor Ihrer Entdeckung beziehungsweise der Gründung der Bühne präsent? Für ein Kind verschmelzen die Romanfigur der Wilhelmine von Hillern und die Anna Stainer-Knittel sehr. Ich kom-
Bereits im Jahr 1991, zum 150-jährigen Geburtsjubiläum Anna Stainer-Knittels, wurde mit dem Beschluss des damaligen Tourismusverbandes der Grundstein für den Bau der Freilichtbühne gelegt. Gewidmet wurde die Bühne eben jener Lechtaler Künstlerin, die mit ihrem bekannten Adlerbild den Mythos der „Geierwally“ begründete. Das von Felix Mitterer eigens für die Bühne geschriebene Stück „Die Geierwally“ konnte dann 1993 uraufgeführt werden. Zum 30-jährigen Jubiläum wird das Stück wieder aufgeführt und feiert eine Premiere am 8. Juli 2023. Gespielt wird bis zum 19. August. Infos unter www.geierwally.at

me ja aus Bach und in Bach gibt es den Weg zur berühmten Schlucht der Geierwally, dem Originalschauplatz quasi. Sie war auch in der Familie Thema. Meine Oma hat viel von ihr erzählt, sie war ein riesengroßer Fan der Blumenmalereien von Anna Stainer-Knittel. Bei mir hängt in der Stube auch ein Bild von ihr. Ja, sie ist präsent.
Was ist für Sie das Faszinierende an der Figur beziehungsweise den zwei Frauen? Anna Stainer-Knittel hatte keine große Freude mit der Romanfigur. Sie hatte sich eher dagegen gewehrt. Ich finde die Entstehung des Geierwally-Romans hochspannend. Wilhelmine von Hillern war im Lechtal und die beiden Frauen haben sich auch wirklich getroffen. Die Figur der Geierwally weicht aber stark ab vom Leben der Anna Stainer-Knittel. Eigentlich geht die Figur der Geierwally gegen ihr Leben. Die Theaterfigur macht ja alles für den Mann. Sie ist in einem System von Stereotypen gefangen und eigentlich verändert sie ihr Leben nicht aus emanzipatorischen Beweggründen heraus, sondern weil sie den Bärenjosef liebt. Anna Stainer-Knittels größte Leistung war es aber, dass sie sich emanzipiert hat. Sie war die erste Studentin in München – das ist beeindruckend.
Die beiden Frauenfiguren scheiden sich ausgerechnet an der Urtriebfeder ihres Handelns, das macht nachvollziehbar, warum
Anna Stainer-Knittel nicht erfreut war von der Romanfigur … Genau. Einer starken Frau wie ihr muss das aufgestoßen sein. Heuer spielen wir wieder Mitterers Geierwally – zum 30-jährigen Jubiläum der Bühne –, weswegen ich mich gerade wieder mehr mit den Figuren beschäftige. Es ist dramaturgisch verständlich, alle Stereotypen zu verwenden, die es braucht. Aber zeitgemäß ist das nicht mehr. Darum war mir auch wichtig, dass heuer eine Frau – Elke Hartmann –die Inszenierung macht. Auch der Adler, den die Geierwally befreit, ist irgendwie ein Sinnbild von ihr, ein Symbol von Freiheit. Das ist es, was sie will. Sie will fliegen. Sie sperrt ihn aber trotzdem ein, steht sich selber im Weg, immer. Das ist ein interessanter Ansatz, den Elke verfolgt, und darauf freue ich mich sehr. Ich bin sehr gespannt.
Obwohl der Roman im Ötztal spielt, hat Felix Mitterer das Stück für die Geierwally-Bühne geschrieben, wo vor 30 Jahren die Premiere stattfand. Und die Bühne wurde zu einem Fixpunkt … Ja, genau. Wir sind zwar vom Inntal ziemlich abgeschnitten, haben es aber trotzdem geschafft, uns zu etablieren. Diese Autarkheit hat uns ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen.

Die Geierwally nach 30 Jahren wieder auf die Bühne zu stellen, die mit dem Stück geboren wurde, ist ein schönes Zeichen. Ja, wir feiern das Jubiläum mit ihr. Viele meinen, dass wir auf der Geierwally-Bühne nur die Geierwally spielen. Heuer haben sie recht. Die Lechtaler freuen sich, denn die Geierwally trifft uns alle.


 Alexandra_Keller
Alexandra_Keller
In 1993, Felix Mitterer‘s “Geierwally” made the magnificent rock stage in Elbigenalp shake for the first time. 30 years later, the play is being performed again - in a different and new way.
English SummaryWhen Anna Knittel was born in 1841, Innsbruck was still a day’s journey away from Elbigenalp. She grew up in a time when revolutions made the continent tremble. Scientific and technical achievements increasingly changed the world - or at least the world “outside”, because between the Lechtal and Allgäu Alps, life and survival were hardly matters of academic discussion. This was also the case in the home of Anton and Kreszenz Knittel, Anna’s parents.
Anton Knittel was a farmer, gunsmith and hunter. Anna often had to suffer from his outbursts of anger,
and yet it was he who discovered her talent and became one of her strongest supporters. Anton Knittel showed the drawings of his young daughter to Johann Anton Falger. The well-travelled artist and lithographer returned to live in his home community of Elbigenalp in 1831. Equally convinced of her talent, Falger began to teach the girl.
The year 1863 turned out to be an important one - for Anna Knittel as an artist and for her as a legend: the Landesmuseum Ferdinandeum bought Knittel’s self-portrait in Lechtal costume, which enabled her to move to Innsbruck and found a drawing school for girls there. In 1863, she rappelled daringly down to an eagle’s nest. This was already the second time she did this, thus creating the image that became the trademark of the “Geierwally”. The men of the region obviously did not dare to go to the nest in the Saxerwand. The episode was reported in the local press and so, the legend took its course. The Bavarian writer Ludwig Steub turned it into a story, which inspired Wilhelmine von Hillern to write the novel “The Geierwally” and Alfredo Catalani to write the opera “La Wally”. In 1993 the story was adapted by Felix Mitterer for the stage in the gorge Bernhardstalschlucht in Elbigenalp and this year - 30 years later - the Geierwally is on the program at that venue again.
Her private life took a happy turn when she married the plaster casterer Engelbert Stainer in 1867. According to Anna herself, before she became Anna Stainer-Knittel, she had turned down no fewer than 30 marriage proposals. Unusual for her time, the artist chose a double name, wore her hair short, and insisted on keeping her own bank account. Anna Stainer-Knittel was a successful artist and a Tyrolean femme vitale in a time that knew neither. She was a role model for women who dared to do a lot. More than Wally.
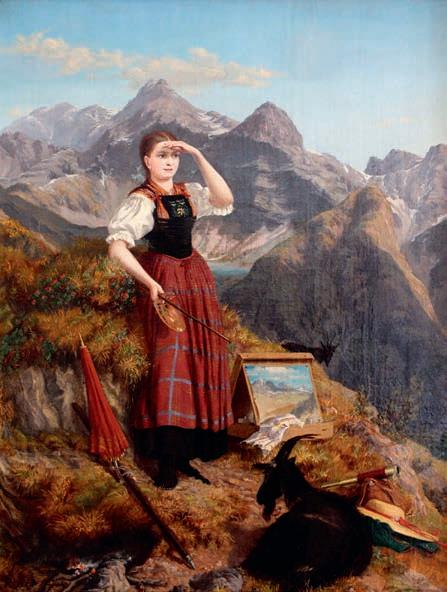
Lehre auf höchstem Niveau, international anerkannte Professoren, Gastprofessoren und Lehrende sowie modernste Infrastruktur bieten ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium.

Bachelor-Studien Psychologie, Mechatronik, Elektrotechnik, Pflegewissenschaft, Wirtschaft, Sport- und Gesundheitstourismus.
Master-Studien Psychologie, Mechatronik, Gesundheitswissenschaften, Public Health, Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Pflege- und Gesundheitspädagogik, Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung, Medizinische Informatik.

Universitätslehrgänge Dyskalkulie-Therapeut/in, Legasthenie-Therapeut/in, Führungs aufgaben/Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege, Konfliktmanagement und Mediation, Health Information Management.

Doktoratsstudien Gesundheitsinformationssysteme, Psychologie, Health Technology Assessment, Management und Ökonomie im Gesundheitswesen, Public Health, Pflegewissenschaft, Technische Wissenschaften, Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften.



In der Tiroler Zugspitz Arena dem hitzigen Alltag entfliehen! Wandern Sie entlang der Bäche, zu den malerischen Gebirgsseen am Berg wie auch im Tal. Es warten Wasserfälle, Wasserspiele und Bootsfahrten, die Möglichkeiten am kühlenden Wasser sind in der #TZA nahezu unbegrenzt. #dreamTZA




Entworfen wurde das Festspielhaus in Erl vom Wiener Architekturbüro Delugan Meissl Architects. Hans Peter Haselsteiner investierte dafür aus seiner Privatstiftung rund 20 Millionen Euro. Die markante, schwarz gehaltene Fassade wirkt neben dem komplementär gefärbten Passionsspielhaus mutig und zurückhaltend zugleich.
In Erl kommt im Passionsspielhaus und Festspielhaus zusammen, was zusammengehört: Klassik und der ländliche Raum, Natur und Kultur, Altes und Neues, Ratio und Emotion, Tirol und die Welt. Und über allem schwebt der Klang der Musik.

Seit über 400 Jahren wird im Örtchen Erl Theater gespielt. Konkret war und ist Erl ursprünglich vor allem für seine Passionsspiele bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel das ursprüngliche Passionsspielhaus aus Holz allerdings den Flammen zum Opfer. In den 1950er-Jahren beauftragte der Passionsspielverein folglich den Architekten Robert Schuller mit der Planung eines neuen Hauses, das aufgrund seiner markanten Form zu einem Wahrzeichen der Gemeinde geworden ist. Damals wie heute ist das Passionsspielhaus für seine perfekte Akustik bekannt, kann allerdings wegen fehlender Heizung nur im Sommer bespielt werden.
Um die Musikaffinität des Ortes aufzugreifen und noch mehr Kultur, klassische Musik, Oper und Kammermusik in den ländlichen Raum zu bringen, gründete Dirigent, Regisseur, Komponist und Autor Gustav Kuhn im Jahr 1997 die Tiroler Festspiele Erl, die ein Jahr darauf mit der Aufführung von Richard Wagners „Das Rheingold“ offiziell eröffnet wurden. Die Festspiele wuchsen und es brauchte eine Spielstätte, die auch im Winter entsprechende Aufführungen möglich machte. Mit dem Bau des nebenan liegenden Festspiel-
hauses konnte die Sommer- und eine entsprechende Wintersaison erweitert werden, die mittlerweile sogar um Zwischenzeiten verlängert wurden. Mit der architektonisch-baulichen Erweiterung erweiterte sich fast naturgemäß auch das Repertoire der Festspiele. Ein Großteil der Konzerte und Kammermusik wird im Festspielhaus präsentiert, die Sommeropern von Richard Wagner indes bleiben in der Regel dem Passionsspielhaus vorbehalten.


Erler Kultursommer.
Das Herz der Tiroler Festspiele Erl ist das Orchester, in dem sich seit 1999 junge Spitzentalente und Instrumen-
talisten namhafter internationaler Ensembles zu einem Klangkörper von exzellenter Qualität zusammenfinden. Es ist eine wahre Freude, diesem Orchester bei den Proben zuzuhören, und noch viel mehr, es bei den Aufführungen spielen zu sehen. Und jede feine musikalische Nuance wahrzunehmen.
Das Orchester besteht aus einer bunten Mischung aus Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Welt. In Erl treffen verschiedene Kulturen, Lebensweisen und Ansichten aufeinander, die sich in all ihrer Unterschiedlichkeit im Gleichklang der Musik auf wunderbare Weise zusammenfinden, um sich danach wieder über die Erdkugel zu zerstreuen. Und bald darauf wieder hier zusammenkommen – um etwa am 6. Juli das große Eröffnungskonzert mit Glière, Elgar, Wagner, Verdi und Bruckner im Festspielhaus zu geben. Tags darauf findet die Premiere von Engelbert Humperdincks „Königskinder” statt. Die Märchenoper ist eine Wiederaufnahme aus dem Jahr 2021 und das aus guten Gründen, war sie doch schon damals mehr als erfolgreich und gern gesehen.
Spannend wird mit Sicherheit der Auftritt des Schumann Quartetts, das mit neuen und teils ungewöhnlichen
Klassischer Musik haftet oft etwas Elitäres und Erhabenes an. Die Festspiele Erl zeigen, dass das nicht zwingend so sein muss und schaffen eine eindrucksvolle Atmosphäre, die es dennoch schafft, dem Genre seine Strenge zu nehmen und der Klassik eine neue Entspanntheit zu geben.
29.4. – 8.10.23

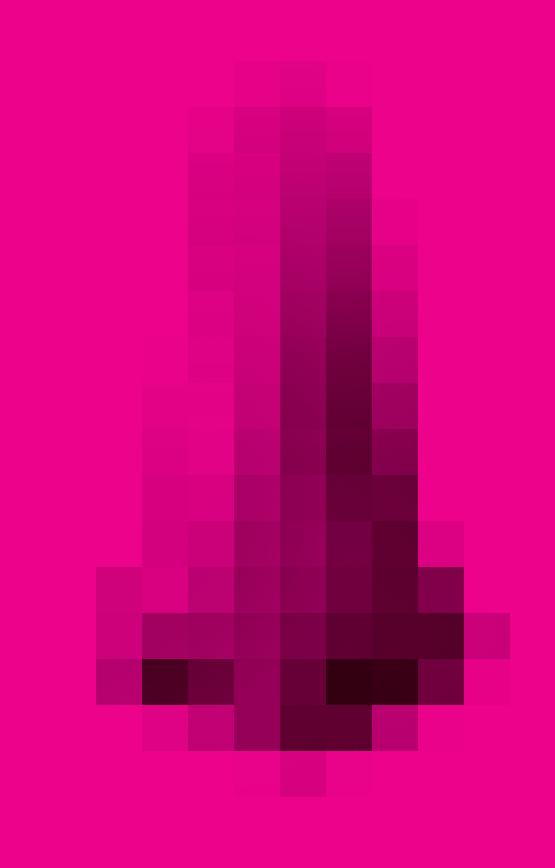
Konzertformaten die Musiklandschaft immer wieder aufs Neue bereichert. Am Abend des 9. Juli steht ihm Schauspielerin und Sprecherin Martina Gedeck zur Seite, die das Streichquartett um die Lesung „Guten Abend, Vielliebchen!“ ergänzt. Zwei Tage darauf kommt die junge Quartettformation noch einmal für einen Kammerkonzertabend in Erl zusammen. Anschließend wird das Ensemble Camerata aus Salzburg zu Gast sein, das an seinem zweiten Abend von Starpianist Fazil Say begleitet wird. Geheimes Highlight ist das Jubiläumskonzert von Oskar Hillebrand am 9 Juli. Der deutsche Bariton feiert heuer seinen 80. Geburtstag und nimmt diesen als Anlass, dem Publikum einen Vormittag voller geballter Stimmkraft zu schenken, wie man ihn selten erlebt. Das gesamte Programm bis zum Abschlusskonzert am 30. Juli finden Sie auf der Homepage.
Unser Extratipp für den Sommer: Vom 10. bis 12. August findet zum fünften Mal das Gitarrenfestival „La Guitarra“ statt, in dessen Mittelpunkt – man kann es erahnen – die Gitarre in all ihrer Vielfalt steht. Unter dem Motto ¡Ritmo de la Vida! wird Erl zum Ort purer Lebensfreude. Hochkarätige Musikerpersönlichkeiten nehmen Sie mit in Kontinente und Genres überschreitende Klangwelten voller Leidenschaft und musikalischer Entdeckungsfreude. Auch das ist Erl!
Der Ausblick für den Winter ist im Übrigen nicht minder fantastisch: Neben „Schneeflöckchen“, ei-

Der Klang der Tiroler Festspiele Erl findet inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus Resonanz. Fernab der Großstädte entwickelt sich hier seit über 20 Jahren inmitten schönster Naturlandschaft ein fruchtbarer Boden für Kultur auf höchstem Niveau, der auch zur wirtschaftlichen Bereicherung der Region beiträgt: Vor der Kulisse des Kaisergebirges widmen sich renommierte Künstler aus aller Welt mit großer Leidenschaft kanonisierten wie unbekannten Werken der klassischen Musik und des Musiktheaters – hauptsächlich in der Sommer- und Wintersaison, daneben auch zu Erntedank, im Rahmen der Klaviertage sowie in der „Zwischen/Zeit“. www.tiroler-festspiele.at
ner hierzulande eher unbekannten, aber mitreißenden Oper von Nikolai Rimski-Korsakow, wird unter anderem „Le Postillon de Lonjumeau“ von Adolphe Adam wiederaufgenommen, die der Gattung Oper ein kleines Augenzwinkern verleiht. Neben dem Weihnachtsoratorium und dem klassischen Weihnachtskonzert lädt der Tölzer Knabenchor zur alpenländischen Weihnacht, das Silvesterkonzert wird heuer „Der Graf von Luxemburg“ von Franz Lehár sein. Tags zuvor spielt die Musicbanda Franui im Festspielhaus ihr finales Geburtstagskonzert, feiert die Band heuer doch ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.
Erl für junge Menschen.
Klassischer Musik haftet oft etwas Elitäres und Erhabenes an. Die Festspiele Erl zeigen, dass das nicht zwingend so sein muss und schaffen eine eindrucksvolle Atmosphäre, die es dennoch schafft, dem Genre seine Strenge zu nehmen und der Klassik eine neue Entspanntheit zu geben. Mit den so genannten Polsterkonzerten öffnet man sich zudem in Richtung Familien. Der niederschwellige Zugang der Inszenierungen gefällt nicht nur Kindern, sondern führt auch Opern- und Operettenneulinge behutsam in eine neue Welt ein, deren herrliche Vielfalt und mannigfaltige Interpretation für jeden etwas bereithält, der Lust hat, sich darauf einzulassen und neugierig zu sein. Man muss ja nicht zwingend mit Richard Wagner starten.
Marina_Bernardi
Vor zehn Jahren wurde das Audioversum als ebenso einzigartiges wie interaktives Museum rund ums Thema Hören in Innsbruck gegründet. Entstanden ist ein Ort, an dem das Hören mit allen Sinnen begreiflich gemacht wird.
as Haus in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße, in dem das Audioversum vor zehn Jahren sein Zuhause gefunden hat, ist ein Haus voller Geschichte(n). In den 1920er-Jahren erbaut, zog zunächst die Rettung ein. Um die Finanzierung der Freiwilligen Rettung zu erleichtern, wurden 1928 die Kammerlichtspiele eröffnet. Die äußere Optik hat sich über die Zeit nicht stark verändert, das Innere sehr wohl.
Das Hören visualisieren.
Im Jänner 2013 wurde das Audioversum Science Center in Innsbruck offiziell eröffnet. Die Exponate der Dauerausstellung „Abenteuer Hören“ wurden dafür von der Linzer Ars Electronica exklusiv als Prototypen gebaut und das Audioversum zu einem Hightech-Museum, das ebenso unterhält wie es klüger macht. „Wir sind als akustisches Museum in dieser Form einzigartig in Europa“, sagt Julia Sparber-Ablinger, seit 2019 Head of Audioversum: „Das virtuelle Ohr, das sich mittels 3-D-Brille erkunden lässt, wird sogar von Audiologen

und Logopäden immer wieder gerne besucht, weil es eine detailgenaue Darstellung des menschlichen Ohrs bietet, wie es selbst in medizinischen Bereichen nicht oft zu finden ist.“
Die Hauptausstellung im Obergeschoss erreicht man über die Klangtreppe, die einen in die wunderbare Welt des Hörens, Staunens und des akustischen Erzählens führt. Auditives verbindet sich mit Visuellem und Haptischen zu einem großen Ganzen, interaktive Stationen laden zum aktiven Mitmachen ein, Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Ein Jahr nach der Eröffnung konnte das Nebenhaus integriert werden, um darin zusätzlichen Raum für Sonderausstellungen zu schaffen.
„In der Hauptausstellung möchten wir zeigen, wie das Hören funktioniert, mit den Sonderausstellungen können wir dem Thema zusätzliche Dimensionen hinzufügen, die spannende und außergewöhnliche Zugänge eröffnen“, erklärt Julia Sparber-Ablinger. „Obwohl die Hauptausstellung im Großen und Ganzen gleich bleibt, ist das Audioversum dadurch immer wieder neu zu
„DIE AKTUELLE SONDERAUSSTELLUNG STAY SAFE SOLL DEN EIGENEN, INNEREN BLICK

SCHÄRFEN: WO BRAUCHE ICH SICHERHEIT UND WO BIN ICH BEREIT, EIN RISIKO EINZUGEHEN.“
Julia Sparber-Ablingerentdecken. Wir möchten damit eine breite Zielgruppe erreichen: Familien und Schulklassen kommen ebenso regelmäßig wie Senioren, die sich über das Hören informieren möchten. Wir arbeiten außerdem immer wieder mit verschiedenen Künstlern zusammen und sprechen damit ebenso kunstinteressierte Besucher an. Auch in der Soundgallery laden wir immer wieder Künstler ein, sich mit Klängen und Geräuschen kreativ auseinanderzusetzen und ihre Gedanken auf unterschiedliche Weise zu vertonen.“
Immer anders. Immer neu. Immer spannend.
Die jährlich wechselnden Sonderausstellungen nähern sich den menschlichen Sinnen und gesellschaftlich relevanten Fragen an. „Wir möchten in den Ausstellungen – dem Museumsgedanken folgend – immer auch ein wenig zurückblicken, auch wenn wir als Science Center naturgemäß sehr zukunftsgewandt sind. Zukunft funktioniert jedoch nicht ohne das Lernen aus der Vergangenheit“, so Julia Sparber-Ablinger. Die aktuelle Ausstellung STAY SAFE beschäftigt sich dabei – der Titel lässt’s erahnen – mit dem breiten Feld der Sicherheit. Entstanden ist die Ausstellung in Kooperation mit dem Vorarlberg Museum aus Bregenz, das sich dem Thema bereits ausführlich gewidmet hat. Einige interaktive Elemente daraus wurden übernommen, vieles für Tirol entsprechend neu adaptiert.
Der Rundgang beginnt mit einem Bild des Tiroler Comiczeichners Patrick Bonato. In sein Wimmelbild
„Vom Vertrauen in die Sicherheit“ hat er die verschiedensten Gefahren des Lebens integriert und hält damit dem Betrachter eine Art Spiegel vor, wie er es selbst mit dem Thema Sicherheit hält. Denn letztlich betrifft diese sämtliche Bereiche unseres Lebens. So geht es in der Ausstellung ums Einschätzen von Risiken ebenso wie um Lawinenschutz, Sparen und Talismane und letztlich um die Frage: Was bedeutet Sicherheit für einen selbst? Man kann versuchen, einen Safe zu knacken, oder wagt sich in einen Gruselraum. Man balanciert über Balken und klettert durch Netze. Julia Sparber-Ablinger: „Wir möchten mit der Ausstellung dazu einladen, sein eigenes Sicherheitsempfinden auszuloten und darüber nachzudenken, wie viel Sicherheit man selbst braucht. Die Ausstellung hat selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben jedoch versucht, unterschiedlichste Perspektiven einzunehmen und einen umfassenden Blick auf das Thema zu werfen – von der eigenen Geschichte über soziale Gesichtspunkte, politische Sicherheit, Umweltschutz, Energie und Natur. Letztlich ist es uns wichtig, dass jeder seine ganz persönlichen Erkenntnisse daraus mitnimmt, und der Spaß soll dabei nie zu kurz kommen.“
AUDIOVERSUM Science Center

Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck
+43(0)5 7788 99, office@audioversum.at www.audioversum.at
Öffnungszeiten: Di. bis So. von 10 bis 18 Uhr
Die Swarovski Kristallwelten und das Circus-Theater Roncalli feiern die Zirkuskunst und heuer ein fünfjähriges Jubiläum.

Von 21. Juli bis 3. September zeigen die Acts in sechzehn Shows täglich Zirkuskunst vom Feinsten. Das gesamte Zirkusprogramm ist im Tagesticket inkludiert, die Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr.
www.kristallwelten.com/sommer
Zum fünften Mal in Folge findet in diesem Jahr das Zirkusfestival von 21. Juli bis 3. September 2023 im Garten der Swarovski Kristallwelten statt. Auch heuer gewährt das legendäre Circus-Theater Roncalli dabei einen Blick hinter die Kulissen der Zirkuswelt und die Besucher*innen dürfen sich auf magische Momente inmitten der Swarovski Kristallwelten freuen.

In den vergangenen Jahren begeisterten die Akrobaten und Akrobatinnen des Circus-Theater Roncalli ihre Zuschauer*innen mit eindrucksvollen Shows und Kostümen, spektakulären Höchstleistungen sowie mit ihrer herausragenden Körperbeherrschung. Besonders beeindruckend sind die Kreativität und die Disziplin der Artist*innen. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums lohnt es sich, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen und in die faszinierende Zirkuswelt im Garten der Swarovski Kristallwelten einzutauchen.
Die talentierte Lili Paul-Roncalli.
Im Sommer 2019 trat die jüngste Tochter des Circusdirektors Bernhard Paul, Lili Paul-Roncalli, in den Swarovski Kristallwelten als Kontorsionistin auf und faszinierte das Publikum mit ihrer Beweglichkeit. Neben dem beeindruckenden Aufritt der jungen Künstlerin stach ihr Kostüm mit bunt funkelnden Kristallen von Swarovski als optisches Highlight heraus. Diese Verknüpfung untermauert einmal mehr die enge Zusammenarbeit und Kreativität der beiden Familienunternehmen Swarovski und Roncalli.
Das artistische Wonderwheel.
Vor zwei Jahren begeisterte das Wonderwheel als artistisches Highlight und zog die Blicke nach oben. Dort führten die beiden Akrobaten wagemutige Kunststücke in zwei großen Laufrädern vor, die durch eine lange Stahlstange verbunden waren und sich um die eigene Achse drehten. In bis zu zehn Metern Höhe sorgten die beiden für puren Nervenkitzel, indem sie sich in rasender Geschwindigkeit durch die Lüfte schwangen und auf den Rädern Sprünge vollführten. In Sekundenschnelle rasten sie wieder in Richtung Boden und überzeugten ihr Publikum durch perfektes Teamwork und eindrucksvolle Körperbeherrschung.
Die meisterhaften Dazzling Dancers.
Aus dem letzten Jahr sind besonders die Dazzling Dancers in Erinnerung geblieben. Bei diesem Meisterstück der Vertikalakrobatik begann die Show in 20 Metern Höhe an der Fassade des Spielturms und ging steil bergab. Die Schwerkraft schien für einen Moment aufgehoben und es ließ sich nur schwer erahnen,
ob der Spielturm der Swarovski Kristallwelten die Tanzfläche darstellte oder ob das talentierte Duo gar in der Luft tanzte.
Die elegante WaterBallet-Artistin.

Ihre Bühne war eine transparente Halbkugel, die auf dem tiefschwarzen Spiegelwasser schwebte: Die Waterbowl-Artistin erschuf im Wasser und knapp darüber anmutige Figuren. Das Funkeln der Kristallwolke auf der Wasseroberfläche verstärkte den atemberaubenden Anblick.
Feste feiern.
Es ist zu einem Highlight der Sommerferien geworden: Ein Besuch beim Zirkusfestival in den Swarovski Kristallwelten, bei dem die Artist*innen des Circus-Theaters Roncalli mit ihren Showeinlagen ihr Publikum begeistern. Die kunstvollen und faszinierenden Shows, vollgepackt mit Nervenkitzel und Artistik, sind auch das Rezept der fünften Ausgabe des Sommerprogramms, das den Garten des Riesen wieder in eine Zirkusmanege verwandelt. „Der Sommer mit dem Circus-Theater Roncalli ist ein unterhaltsamer Ausflug für die Einheimischen, und auch internationale Besucher*innen reisen auf der Suche nach sinnreichen Veranstaltungen wieder verstärkt in die Swarovski Kristallwelten. Mit dem Sommerfestival bieten wir ein immersives und einzigartiges Erlebnis mit zahlreichen Momenten des Staunens“, sagt Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH.



Auch heuer darf man sich wieder auf ein spektakuläres Festival freuen. Unter dem Motto „Let’s Celebrate“ feiert das Circus-Theater Roncalli mit herausragender Zirkuskunst, die Malerei, Musik und Artistik vereint. Die Besucher*innen erwarten verschiedenste Showacts, darunter der Auftritt der italienischen Artistin Shannon im spektakulären Kristallluster, das ungarische Trio Bokafi mit atemberaubender Luftakrobatik und die Berliner Künstlerin Lena mit ihren besonderen Jonglage-Darbietungen.
Shiva_YousefiInfo · Karten
T +43 (0)5373 81000-20 karten@tiroler-festspiele.at www.tiroler-festspiele.at www.tiroler-festspiele.at
KONZERT ERÖFFNUNGSKONZERT
mit Werken von Glière, Elgar, Wagner,Verdi und Bruckner
DO 06. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
OPER
ENGELBERT
HUMPERDINCK KÖNIGSKINDER
Musikalische Leitung
Karsten Januschke mit Gerard Schneider und Karen Vuong
FR 07. JULI PREMIERE
SA 15. JULI
Jeweils 18:00 Uhr – Festspielhaus
OPER RICHARD WAGNER SIEGFRIED
Musikalische Leitung Erik Nielsen Regie Brigitte Fassbaender
SA 08. JULI PREMIERE
FR 21. JULI
DO 27. JULI
Jeweils 17:00 Uhr – Passionsspielhaus
SPECIAL-MATINEE
OSKAR HILLEBRANDT
zum 80. Geburtstag mit berühmten
Gästen
Moderation Hans Peter Haselsteiner
SO 09. JULI
11:00 Uhr – Festspielhaus
SPECIAL SCHUMANN QUARTETT UND MARTINA GEDECK
Lesung mit Werken von Schumann, Mendelssohn Bartholdy und Brahms
SO 09. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KAMMERMUSIK
SCHUMANN QUARTETT mit Werken von Beethoven und Schumann
DI 11. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KONZERT CAMERATA SALZBURG I mit Werken von Haydn und Mendelssohn Bartholdy als Gast: Veronika Eberle Violine
MI 12. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KONZERT CAMERATA SALZBURG II mit Werken von Beethoven und Haydn als Gast: Fazil Say Klavier
DO 13. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
SPECIAL FRANUI & NIKOLAUS HABJAN ALLES NICHT WAHR
Ein Georg-Kreisler-Liederabend
FR 14. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
OPER
Musikalische Leitung Erik Nielsen Regie Brigitte Fassbaender
SO 16. JULI 15:00 Uhr PREMIERE
SO 23. JULI 15:00 Uhr
SA 29. JULI 17:00 Uhr alle Vorstellungen im Passionsspielhaus
SPECIAL CHRISTIAN MUTHSPIEL & ORJAZZTRA VIENNA
DI 18. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KAMMERMUSIK
MARIKO HARA
mit Werken von Piazzolla, Mozart und Bruch
MI 19. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
FAMILIENKONZERT CHORKONZERT FÜR
FAMILIEN
Capella Minsk und Bundesmusikkapelle Erl
DO 20. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
SPECIAL INTERNATIONALE MEISTERSINGER AKADEMIE
mit Arien aus berühmten Opern
SA 22. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KAMMERMUSIK
PREISTRÄGERKONZERT
DER ORCHESTERAKADEMIE
u.a. mit den besten Streichern des Seminars
DI 25. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KAMMERMUSIK
KONSTANTIN KRIMMEL SCHWANENGESANG
Liederabend
MI 26. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
SPECIAL WIENER SÄNGERKNABEN 525
FR 28. JULI
19:00 Uhr – Festspielhaus
KONZERT ABSCHLUSSKONZERT mit Werken von Reger und Verdi
SO 30. JULI
11:00 Uhr – Festspielhaus
„LA MELODIA DELLA STRADA“

Andy Holzer ist blind. Das hindert ihn nicht daran, mit wachen Augen durchs Leben zu gehen. Dass das nicht immer auf zwei Beinen geschieht, liegt nicht daran, dass Holzer blind, sondern weil der Mann Kletterer und Alpinist ist.
Erfahren, abgebrüht und wettergegerbt hat Andy Holzer schon die höchsten Gipfel der Welt bestiegen. Nicht zum ersten Mal sitzt der Autor an Andy Holzers Wohnzimmertisch im Osttiroler Dorf Tristach. Beim letzten Gespräch, das vor gut zehn Jahren stattgefunden hat, sagt Holzer, der eben erst sechs der Seven Summits bestiegen hatte, über den höchsten Berg der Welt, dass ihn dieser letzte, höchste und zugleich berühmteste Gipfel nicht besonders interessiere. „Das habe ich damals tatsächlich behauptet“, gibt Holzer zu, „und heute weiß ich auch genau, warum.“
Mittlerweile war Andy Holzer am Gipfel des Mount Everest. Drei Anläufe hat er dafür gebraucht. „Das Gehirn hat in seinen zahlreichen Windungen eine Art Selbstschutzmechanismus eingebaut, der uns davor bewahrt, Dinge unternehmen zu wollen, die uns nicht machbar erscheinen“, meint Holzer, der als Blind Climber heute ein weltweit gefragter Keynote-Speaker ist und mit seinen Vorträgen dazu antritt, den Sehenden die Augen zu öffnen, wie es auf seiner Website heißt. Was dem Menschen als unüberwindbare Hürde erscheint, vermeint er nicht unbedingt
zu brauchen. Das scheint zunächst eine praktische und pragmatische Funktion zu sein, die vor Enttäuschungen und Gefahren schützt.
Der physische Everest.
Bis heute haben erst drei blinde Menschen den Mount Everest bezwungen, Andy Holzer war der zweite – und zugleich der erste an der Nordroute – und erreichte am 21. Mai 2017 das höchste der Gefühle für die meisten Bergsteiger: Eben jenen Berg, von dem er sich lange eingeredet hatte, er würde ihn nicht brauchen. Und wie er sich geirrt hat.
Reinhold Messner hat den Everest ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff erreicht, Andy Holzer ohne die Zuhilfenahme von Licht. Beides ist für sich genommen eine herausragende Leistung. „Viele Menschen scheitern daran, an sich zu glauben, dabei ist jeder Einzelne etwas ganz Besonderes, ein Unikat in einem unendlichen Universum. Kein Mensch kann genau das, was der andere kann“, findet Holzer, dem man anmerkt, dass er sich gerne und ausgiebig mit der Conditio huma-
„MIT DEM, WAS ICH MACHE, PASSE ICH VIELLEICHT MANCHEN MENSCHEN NICHT IN IHR WELTBILD HINEIN.“
Andy Holzer
na auseinandersetzt und es sich zur Berufung gemacht hat, Menschen zu motivieren, ihnen Mut zuzusprechen und ihnen dabei zu helfen, sich zu emanzipieren.
Zum Höhenbergsteigen braucht es einen eisernen Willen und einen Körper, der – wie Holzer betont – überdurchschnittlich gut funktioniert: „Bei einem Vollblinden ist jeder zweite Tritt ein Fehltritt, das kostet enorm viel Energie, physisch und mental.” Außerdem braucht es einen überdurchschnittlich gesunden finanziellen Background. Eine derartige Expedition ist teuer, und Andy Holzer hat auch dank einiger Sponsoren nicht nur seine eigenen, sondern auch die Auslagen seiner Begleiter finanziert. Das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ohne Begleiter, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, ist so eine Unternehmung am Himalaya nämlich völlig aussichtslos. „Ich kann nicht einfach in einen Flieger steigen und in Kathmandu einmal schauen, wen ich dort so antreffe. Wer auf den Everest möchte, sorgt für die besten Voraussetzungen. Ein Blinder spielt in dieser Gleichung normalerweise keine Rolle“, weiß Holzer.

Aller guten Dinge sind manchmal doch drei: Im dritten Anlauf haben
Andy Holzer, Wolfgang Klocker und Klemens Bichler 2017 den höchsten Gipfel erreicht, den man als Mensch zu Fuß erreichen kann.
„Hast du erst einmal Kohle und Körper beisammen, ist die Geschichte aber noch längst nicht gegessen.“ Ein Blinder, der sich in höchste Höhen begibt, ist nun einmal kein Selbstläufer. Es ist schwierig, Mitstreiter zu finden, die die Zeit – ein Everest-Trip dauert

„DAS
BEWAHRT, DINGE UNTERNEHMEN ZU
WOLLEN, DIE UNS NICHT MACHBAR ERSCHEINEN.“Andy © KLEMENS BICHLER
immerhin neun Wochen – investieren können und sich der Kritik aussetzen wollen, mit einem Blinden im Gepäck in der Todeszone ein derartiges Wagnis einzugehen. Seinen wohl wichtigsten Mitstreiter gewinnt Holzer ausgerechnet im Rahmen einer Charityveranstaltung im heimatlichen Tristach in Gestalt von Wolfgang Klocker. „Ein Spitzensportler und Heeresbergführer, der für mich vor dieser Veranstaltung im Dorfsaal nicht greifbar gewesen ist. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es ihn reizen würde, mit mir auf Expedition zu gehen“, erzählt Holzer, der zunächst sprachlos ist. Bald kristallisiert sich heraus, wohin die Reise gehen soll. Nach ganz oben, auf das Dach der Welt, den Mount Everest.
Andy Holzer unternimmt seinen ersten Anlauf mit Wolfgang Klocker, dem einstigen Weggefährten Andreas Unterkreuter, Daniel Kopp und einem dreiköpfigen Team der ARD. Doch die Natur legt gegen Holzers Gipfelsieg ihr Veto ein. Als dieser mit Gefährten im Basislager ankommt, ereignet sich das bislang schwerste Unglück auf dem Mount Everest. Eine Lawine löst sich auf einer Höhe von 5.800 Metern im sogenannten Popcorn-Feld und fordert 16 Menschenleben. „Emotional war das ein Wahnsinn. Wären wir einen Tag früher aufgebrochen, hätte es uns genauso erwischt“, blickt Holzer zurück, der mit Wolfgang Klocker noch im Flieger nach Hause den Entschluss fasst, es noch einmal zu versuchen. Diesmal, 2015, von Tibet aus, auf der Nordseite des Everest, gemeinsam mit Klocker und dem ebenfalls versierten Bergführer Klemens Bichler. „Ich habe gewusst, dass ich die besten Partner hatte, die man sich nur vorstellen konnte“, schwärmt Holzer. Doch auch beim zweiten Mal sollte es nicht sein. Als Holzer & Co. sich auf 6.400 Metern Seehöhe befinden, wird die Gegend von einem Erdbeben der Stärke 7,9 erschüttert, das in Tibet verheerende Zerstörungen anrichtet. „Wir durften aufgrund der Nachbeben
Der Laserzstock in den Lienzer Dolomiten ist Andy Holzers Wohnzimmer. Dort, in unmittelbarer Nähe zu Holzers Zuhause, gibt es unzählige lohnende Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Außerdem ist der Bergsteiger fasziniert von der Gegend rund um den Plöckenpass, die zu den Karnischen Alpen gehört und im Gebirgskrieg des Ersten Weltkriegs eine besondere Rolle gespielt hatte. Im Winter fühlt Andy Holzer sich besonders in der Sonnblickgruppe pudelwohl. Der Alpinist betont, dass er gar nicht weit wegfahren müsse, um Besonderes zu erleben. In der kalten Jahreszeit ist Andy Holzer gerne und oft auf Skitouren in Osttirol und der unmittelbaren Umgebung anzutreffen.

eine Woche lang nicht absteigen“, erinnert sich Holzer, der aber auch diesen folgenschweren Wink des Schicksals nicht als Zeichen interpretiert, den Everest bleiben zu lassen.
Andy Holzer surft seit Jahrzehnten leidenschaftlich auf der Kurzwelle. Der Funk ist eines seiner Tore zur Welt.
Zwischendurch schien er zwar mit dem höchsten Berg der Welt seinen Frieden gemacht zu haben, doch der Everest ließ ihn nicht mehr los. Beim dritten Versuch sollte es schließlich mit dem Gipfelsieg klappen. Am 21. April 2017, drei Wochen nach Holzers Abreise aus dem heimatlichen Osttirol gen Tibet, stirbt sein Vater. „Ich bin im Lager unter einer staubigen Plane gelegen und habe nicht gewusst, wie mir geschieht. Andy, wir gehen mit dir entweder auf den Friedhof oder auf den Gipfel, haben meine Partner damals zu mir gesagt“, erinnert Andy Holzer sich bewegt. Die Mutter bestärkt trotz des Schicksalsschlags ihren Sohn darin, weiterzugehen und damit gewissermaßen den Weg zu vollenden, den seine Eltern für Andy Holzer erst geebnet hatten. Sie haben ihren Sohn nämlich nie anders, nie wie ein behindertes Kind behandelt, sondern ihm beigebracht, dass auch der Blinde unter den Sehenden König sein kann.
Am 21. Mai 2017 um 7:20 Uhr Ortszeit legen Holzer und seine Bergkameraden sich schließlich die Welt zu Füßen. Gipfelsieg am Everest! Eine ungeheure Leistung, zunächst individuell und dann vor allem als Team. „Steilheit, Schwierigkeit, Höhe, Wetter, Eisqualität, diese und viele andere Faktoren sind beim Höhenbergsteigen zu beachten. Für die Blindheit, ein weiteres Kriterium im Team, bin eben ich der Spezialist. Als Benachteiligter sehe ich mich deswegen aber nicht“, sagt Holzer selbstironisch.
Der innere Everest.
„Wenn du in die Verlegenheit der Gelegenheit kommst, beginnt das Gehirn zu arbeiten und Lösungen zu generieren. Das gilt für alle Menschen, die – beruflich oder persönlich – unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ich treffe viele Menschen, die ein Wahnsinnspotenzial haben, aber viel zu wenig daraus machen“, formuliert Holzer, nun ganz im Duktus des Motivational Speakers, in dem er sich merklich wohl fühlt. Der Kletterer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Möglichkeitsräume zu eröffnen, nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für andere: „Weil ich sehe, wie viele andere blind durch die Gegend laufen.“
An Fokus mangelt es Holzer ganz gewiss nicht, davon zeugt sein ständiger Vorwärts-, besser gesagt Aufwärtsdrang. The Sky is the Limit. „Aus heutiger Sicht habe ich den Everest sehr wohl gebraucht“, meint der Bergsteiger rückblickend. „Der Berg hat mich geprägt, verändert, entwickelt und aus meiner Feigheit herausgebracht.“
Andy HolzerAndy Holzer wird am 3. September 1966 in Lienz geboren. Nach einer Ausbildung zum Heilmasseur und Heilbademeister macht er sich 2010 mit seiner großen Leidenschaft als Bergsteiger selbständig. Heute bereist er auch als Vortragender die Welt, um dabei – wie er selbst sagt – den Sehenden die Augen zu öffnen. Seit 1987 ist Holzer zudem Funkamateur mit Kurzwellenlizenz. Das Funkgerät ist eines von Holzers Toren zur Welt, durch das der kommunikative Osttiroler mit Menschen aus aller Welt in Kontakt tritt.
Berge sind wahrlich stille Meister. Schweigsame Schüler machen sie aber nicht zwangsläufig. Andy Holzer hat nämlich eine Botschaft vom Dach der Welt mitgenommen, die als Metapher universelle Gültigkeit beansprucht: „Der Everest steht nicht irgendwo in Asien. Jeder trägt seinen persönlichen Everest mit sich herum. Dieser will erforscht und entdeckt und im besten Fall schließlich bezwungen werden“, sagt Holzer, der im Laufe seines Lebens ein feines Sensorium dafür ausgebildet hat, was es bedeuten könnte, ein Mensch zu sein. Wo Erfolg ist, gibt es Neider. Leider. Bis heute sieht Holzer sich mit Zweifeln an seiner Blindheit konfrontiert. Das ist freilich grotesk. „Mit dem, was ich mache, passe ich vielleicht manchen Menschen nicht in ihr Weltbild hinein“, meint der Alpinist achselzuckend. Er werde als Keynote Speaker weltweit aber nicht wegen seiner bergsteigerischen Leistungen gebucht, sondern wegen seiner Botschaft, sagt Holzer: „Ich versuche, nicht meine Geschichte zu erzählen, sondern meinen Zuhörern einen Zugang zu ihrer Geschichte, zu ihrem eigenen Everest, zu öffnen.“ Der Berg dient Andy Holzer dabei als Metapher, als Lehrmeister und als ehrlichster aller Feedbackgeber. „Die Berge“, schließt Andy Holzer, „sie haben mir Klarheit gegeben.“

Und so ist aus dem Mittfünfziger Andy Holzer im Laufe der Zeit gewissermaßen selbst ein „Bergführer“ geworden, der die Menschen ans Seil nehmen und an ihren eigenen, inneren Everest heranführen kann. Auch diese Tour auf den höchsten mentalen Gipfel ist beschwerlich. Lohnend ist sie allemal.
Marian_Kröll„JEDER TRÄGT SEINEN PERSÖNLICHEN EVEREST MIT SICH HERUM. DIESER WILL ERFORSCHT UND ENTDECKT UND IM BESTEN FALL SCHLIESSLICH BEZWUNGEN WERDEN.“
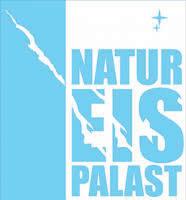

3.250 m über dem Meer
Andy Holzer is blind, but that doesn’t stop him from going through life with his eyes wide open - or from climbing mountains.
that - as Holzer points out - functions above average: “ For someone who is completely blind, every second step is a misstep, which costs an enormous amount of energy.” Moreover, the trip requires a particularly good financial background. An expedition of this kind is expensive, and Andy Holzer has financed not only his own expenses but also those of his companions. For him, this is a given. After all, without companions you can rely on one hundred percent, such an undertaking in the Himalayas is completely hopeless.
“Once you’ve got everything you need - money and a healthy body - the story is far from over,” says Holzer. A blind man who goes to the highest altitudes is not a self-runner. It is difficult to find companions who can invest the time - an Everest trip lasts nine weeks after all - and are willing to take on the challenge with a blind man in the death zone. It took Andy Holzer a total of three attempts to conquer Everest. On May 21, 2017, at 7:20 a.m. local time, Holzer and his mountain companions finally stood atop Everest with the world at their feet.
To date, only three blind people have conquered Mount Everest, Andy Holzer was the secondand the first to do so on the northern route. It was on May 21, 2017 that he reached the highest of feelings for most mountaineers, the very mountain he had long convinced himself he would not need. Well, how wrong he was.

Reinhold Messner reached Everest without the aid of artificial oxygen, Andy Holzer without the aid of light. Both are outstanding achievements. High-altitude mountaineering requires an iron will and a body
Mountains are silent masters indeed. Their disciples, however, are not necessarily silent. Andy Holzer has taken a message with him from the roof of the world that claims universal validity as a metaphor: “Everest is not somewhere in Asia. Everyone carries their own personal Everest around with them. It wants to be explored and discovered and, in the best case, finally conquered,” says Holzer, who today is also a sought-after keynote speaker worldwide. “I try not to tell my story, but to give my listeners access to their story, to their own Everest.” The mountain serves Andy Holzer as a metaphor, a teacher, and the most honest of feedback givers. “The mountains,” Andy Holzer concludes, “they gave me clarity.”



Jos Pirkner ist ein beeindruckender Mann, als Bildhauer und Maler ein Künstler durch und durch. Der 95-Jährige sprüht vor Elan und ist ein inspirierender, geistig wendiger Gesprächspartner, dem man stundenlang zuhören kann.
Jos Pirkner hat in der letzten Nacht nicht besonders gut geschlafen und ist einige Zeit wach gelegen. Das kommt nicht oft vor. Der 95-jährige Osttiroler Künstler wirkt davon abgesehen quirlig wie eh und je und ist durchaus gut aufgelegt und gesprächig. Im Laufe seines langen Lebens hat er viel gesehen und viel geschaffen. Es war keineswegs selbstverständlich, dass Pirkner eine Künstlerlaufbahn einschlagen konnte. Die Zeiten waren rund um die Wirren des 2. Weltkriegs hart, die Eltern haben das große Talent ihres Sohnes aber früh erkannt und ihn stets nach Kräften gefördert.


Ungebrochener Tatendrang.
In der Kunst der Moderne hat Pirkner schon seit langem seinen Lieblingsgegner gefunden. Mit ihr will er sich partout nicht anfreunden, ebenso wie mit den Mechanismen eines zunehmend kommerzialisierten Kunstmarktes. „Heute wird nicht mehr Kunst gekauft, sondern es werden Künstler gesammelt, oft in der Hoffnung, dass deren Kunstwerke im Wert steigen“, meint Pirkner, der mit dem Kunst-
werk als lebloses Anlage- und Spekulationsobjekt nicht viel anfangen kann und diesen materialistischen Zugang zur Kunst schon verschiedentlich als „Strafe Gottes für die Reichen“ bezeichnet hat. Nicht etwa, dass Jos Pirkner auf seinen Kunstwerken sitzen bliebe. Ganz im Gegenteil. Die Nachfrage ist so groß, dass Pirkner auch im hohen Alter gar nicht daran denken mag, sein Werkzeug beiseitezulegen. „Beim Malen tue ich mir leichter, aber ich muss auch noch einige Bronzen machen“, sagt der rüstige Künstler, der in mancher Hinsicht um vieles jünger wirkt, als sein biologisches Alter es nahelegen würde.
Künstler und Zeitzeuge.
Pirkner beherrscht in seiner Kunst fast spielerisch die Bewegung, den Körper und den Raum und sieht sich als Künstler auch in der Rolle des Zeitzeugen. Das spiegelt sich auch in seinen Motiven wider: Der Krieg, der Hunger, wiederkehrende Motive in der menschlichen Geschichte, die aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wieder an Aktualität – und beklemmender Nähe – gewonnen haben. „Momentan geht auf der Welt alles drunter und drüber. Krieg ist kein schönes Thema, aber so ist eben die Zeit. Und das möchte ich auch dokumentieren“, verleiht Pirkner einem weit verbreiteten, diffusen Unbehagen mit dem Weltenlauf Ausdruck. Die Malerei habe schon immer auch dazu gedient, die Dinge dokumentarisch festzuhalten.
Jos Pirkner besuchte zunächst die Kunstgewerbeschule in Klagenfurt, danach – von 1945 bis 1949 – setzte er seine Ausbildung an der Bundeslehranstalt für das Baufach und Kunstgewerbe in Graz fort, wo er ein Schüler der Fachschulklasse für Goldund Silberschmiede bei Georg Sieder war. Später führte Rudolf Reinhart den jungen Pirkner als Privatschüler in Salzburg in die Metallplastik ein. Das eröffnete ihm die Gelegenheit, auf Einladung hin zum renommierten Atelier Brom nach Holland zu gehen. Mit seinen Skulpturen in Silber, Bronze oder Glas hatte Pirkner Erfolg in Europa und den USA. 1966 heiratete er Joke. Nach über 25 Jahren in den Niederlanden kehrte Jos Pirkner mit seiner Frau 1978, nach der Geburt seines Sohnes Gidi, wieder nach Osttirol zurück, wo er seitdem in Tristach bei Lienz lebt und arbeitet.
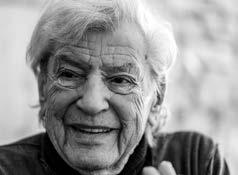
Jos Pirkner ist ein äußerst vielseitiger Künstler. Er versteht sich hervorragend auf die Treibarbeit und beklagt den Bedeutungsverlust dieser Technik im heutigen Kunstbetrieb. Beim Treiben werden Gegenstände mit Meißel, Punzen, Schlegel- und Treibhammer – meist im kalten Zustand – plastisch verformt. Bevorzugt geschieht dies mit weichen Metallen wie Gold, Silber oder Kupfer. Das Metalltreiben ist aber nur eine von mehreren Richtungen, denen sich Pirkner in seinem umfassenden Œuvre gewidmet hat: „Von den Techniken her, mit denen ich arbeiten kann, bin ich vielseitig. Metalltreiben, Goldschmieden, Malen, Architektur, all das habe ich immer seriös zu betreiben versucht“, sagt der Professor.
Pirkners Werk ist tatsächlich ein beeindruckendes Zeugnis der Vielseitigkeit des Künstlers, der ursprünglich Maler werden wollte, sich aber eine weit breitere künstlerische und handwerkliche Ausbildung angeeignet hatte. Das Malen ist aber als wichtiger künstlerischer Akt immer präsent geblieben und war gewissermaßen Pirkners Brücke zur Skulptur. „Ich bin schon als Schüler mit dem Malkoffer nach Kals gefahren und habe mir Motive gesucht“, erinnert sich Pirkner. Als Metalltreiber hatte er es nie auf die Herstellung von Schmuckund Ziergegenständen abgesehen, sondern von Anfang an Größeres im Sinne. Der Auftakt zur Karriere als gefragter Künstler gelang ihm nach seiner Ausbildung in den Niederlanden.
„ICH BIN KEIN ARCHITEKT, SONDERN EIN IDEENBAUER, UND MEINE ARCHITEKTUR IST DESHALB SO ANDERS, WEIL SIE VON DER IDEE, VOM URSPRUNG AUSGEHT.“
Jos Pirkner
Das Schicksal sollte Jos Pirkner 1951 nach Holland führen, wo er in einem eigenen Atelier in Utrecht arbeitete und parallel dazu an Hochschulen in Amsterdam und Utrecht seine künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickelte. Bereits 1952 fertigte Jos Pirkner eine zehn Kilogramm schwere Monstranz, aus Silber getrieben, vergoldet und mit 400 Edelsteinen und 240 Diamanten besetzt. „Derartige Treibarbeiten werden heute nicht mehr gemacht, das ist vorbei, und das ist schade“, so der Meister. Spätestens mit dieser eindrucksvollen Arbeit hat sich Pirkner in den Niederlanden und darüber hinaus einen Namen gemacht. Vor allem seine Sakralplastiken waren fortan gefragt. Bei
diesen ist der Inhalt bereits vorgegeben, was den künstlerischen Spielraum natürlich einengt. „Der sakrale Bereich gibt mir das Motiv vor, und das will ich nicht“, sagt Jos Pirkner heute.
Kunstsinnige Menschen wie Julien Green setzten auf Pirkners Begabung. Der französische Schriftsteller mit US-amerikanischem Pass ließ sich noch zu Lebzeiten seine Grabstätte in Klagenfurt von ihm gestalten und begründete seine Wahl derart: „Im Werk von Jos Pirkner vereinen sich Vorstellungskraft und Energie. Und noch eine andere, bei einem Bildhauer seltene Qualität fühle ich: Den Sinn für menschliche Empfindsamkeit.“ Seine
TIPP!
ONLINE-TICKETSHOP & GUTSCHEINWELT bergbahnen-langes.at

›
› 4 Sommer-Bergbahnen mit TOP-Aussicht zur Zugspitze!

›› Themenwanderwege + Höhenwanderungen am Grubigstein und Marienberg
›› Sommerrodelbahn + Mountaincart-Rollerstrecken ›› Top-Bikedestination und Geheimtipp für Paragleiter



›› Sommerbetrieb: 18. Mai bis 5. November 2023
›› Winterbetrieb: 8. Dezember 2023 bis 7.April 2024

„ICH SUCHE NACH DER VIERTEN DIMENSION.“
Jos Pirkner

Feinsinnigkeit ist Pirkner bis ins hohe Alter hinein erhalten geblieben, und ein guter Teil des Esprits aus früheren Tagen.
Spuren in der Heimat.
Jos Pirkner hat indes auch in seiner Heimat Spuren hinterlassen, in Ostund Nordtirol, aber auch im Salzburger Fuschl, wo Pirkner für die architektonische Gestaltung von Dietrich Mateschitz’ Red Bull Headquarter verantwortlich zeichnete. „In diesen Gebäuden finden Architektur, Skulptur und Natur zueinander. Es ist eine Skulptur, die man begeht“, sagt Pirkner über dieses imposante Gesamtkunstwerk. Neben-
bei stellen jene 14 Bullen, die kraftvoll aus einem der Gebäude stürmen, das größte Werk Pirkners und zugleich die größte Bronzeplastik Europas dar. Wie Lava ergießt sich die 80 Tonnen schwere und mehr als 20 Meter lange Herde aus dem Komplex, der in seiner Gestalt einem Vulkankegel nachempfunden ist und auch von Jos Pirkners treibender schöpferischer Kraft zeugt. Kunst und Handwerk in Vollendung.
Es ist fast immer der Mensch oder das Tier, das Pirkner bildlich und plastisch darstellt. Die Faszination für die Bewegung sieht man seinen Werken an, die, obwohl sie per se statisch sind, immer eine gewisse Dynamik vermitteln. „Ich suche nach der vierten Dimension“,
sagt Pirkner, der die drei Dimensionen des Raumes virtuos beherrscht und ein außergewöhnliches Gespür für Proportionen hat. Die vierte Dimension, die Zeit, werden viele seiner Werke wohl überdauern. In Lienz, wo Pirkner ab seinem zweiten Lebensjahr direkt am Hauptplatz aufgewachsen ist, hat sich um dessen Entwurf für die Neugestaltung eben dieses Hauptplatzes eine sehr sonderbare Kontroverse entsponnen, wie es sie wohl nur geben kann, wenn Politik im Spiel ist. Den alternativen Entwurf zu den Plänen der Stadtoberen hat Pirkner eingebracht, weil er sich erstens zweifellos auf diese Dinge versteht und zweitens mit der gestalterischen Qualität des aktuellen Entwurfs absolut nicht zufrieden war. Pirkner kennt den besagten Ort seit über 90 Jahren und hat in den 1990er-Jahren bereits einmal einen Vorschlag vorgelegt, der von der Stadtpolitik damals allerdings mehr oder weniger geräuschlos schubladisiert wurde. „Die Planung mit dieser Ritsche war einfach falsch. Der Hauptplatz ist eine Piazza, auf der man sehr viel machen könnte. Ich bin also nach Hause gegangen, habe einen Karton und eine Schere genommen und einen Entwurf gemacht. Ich
Jos Pirkner spart in seinem künstlerischen Schaffen nicht mit Kritik an den globalen Umständen oder vielmehr Zuständen und am Leid, das Menschen einander zufügen. Hier hat er den Hunger und – daraus folgend –den Tod auf die Leinwand gebannt.
bin am Hauptplatz aufgewachsen und es wäre schön gewesen, hätte ich ihn gestalten dürfen“, sagt der Künstler.



Binnen kürzester Zeit haben sich unzählige Unterstützer für Pirkners Entwurf stark gemacht. Eine weitsichtige und sensible Stadtführung hätte ihn wohl umgesetzt. „Meine Arbeiten stehen heute von Los Angeles bis Dubai. In Lienz gibt es fast nichts“, meint der Doyen der Osttiroler Kulturszene dazu doch einigermaßen resigniert. Pirkners kurze Aufwallung ist ebenso rasch verflogen, wie sie gekommen ist. „Ich bin kein Architekt, sondern ein Ideenbauer, und meine Architektur ist deshalb so anders, weil sie von der Idee, vom Ursprung ausgeht“, erklärt Pirkner, dem es auch







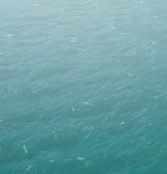
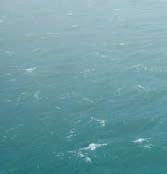








darum geht, den Raum einzufangen und Identität zu stiften. Der Künstler macht in architektonischer Hinsicht nicht das, was vorgegeben ist, sondern das, was er als passend empfindet. In der Bildhauerei wie Architektur zählt die Proportion, und darin ist Pirkner ein Meister.

Die Liebe und die Kunst.

Zurückgekehrt ins heimatliche Osttirol ist Jos Pirkner mit seiner Frau Joke, der Liebe seines Lebens, die er 1966 geheiratet hatte, nach der Geburt von Sohn Gidi im Jahr 1978. Der Sohn sollte in behütetem Umfeld aufwachsen, so die Intention. „Ich wollte irgendwann immer zurück nach Osttirol, und die Ge-







„MOMENTAN GEHT AUF DER WELT ALLES DRUNTER UND DRÜBER.“
Jos Pirkner
Der 95-Jährige ist ein launiger, feinund kunstsinniger Gesprächspartner, der es allemal verdient hätte, den prominentesten Platz der Bezirkshauptstadt Lienz zu gestalten.




burt unseres Sohnes war ein guter Grund, Holland den Rücken zu kehren. Sonst wäre ich womöglich immer noch dort“, sagt Pirkner, der seine Rückkehr in die Heimat nie bereut hat.
Noch immer ist auch die Formel 1 eine große Leidenschaft des Osttirolers. „Wenn’s geht, schaue ich die Wiederholungen auch noch“, so Pirkner, der Rennautos von Red Bull und der Scuderia Toro Rosso gestaltet hatte. Auch hier führt die Spur wieder zu Dietrich Mateschitz, den Jos Pirkner zu seinen engen Freunden gezählt hat. „Es tut mir leid um ihn. Wir haben viel miteinander geredet, gelacht und auch manches geplant“, denkt Pirkner mit Wehmut an den verstorbenen Freund zurück. Wehmut und vor allem Dankbarkeit liegt in Jos Pirkners Stimme, wenn er an seine 2010 verstorbene Frau Joke denkt. „Meine Frau war überall mit dabei. Sie war Ballettänzerin im Nationalballett, als wir uns kennengelernt haben. Sie wollte irgendwann nicht mehr zwischen Amsterdam und Utrecht hin- und herfahren und hat bei mir im Atelier angefangen“, schwelgt Pirkner in Erinnerungen. Zuerst habe seine spätere Frau sich dort gelangweilt, bald aber mit dem Schweißen seiner Treibarbeiten begonnen. „Sie war so geschickt, was sie in die Hand genommen hat, hat gepasst. Wie ein Bursche hat sie geschweißt und mir dabei so viel geholfen.“ Kein Tag vergeht, an dem der Künstler seine Joke, mit der er 45 glückliche Jahre lang verheiratet war, nicht vermisst. „Joke, wir haben es geschafft“, hat Jos Pirkner dem letzten seiner 14 Bullen in den Körper hineingekratzt.
Der Maestro ist nicht am Ende seiner Reise angelangt. Es gibt noch viel zu tun, und immer wieder hat Pirkner neue Ideen, die der Umsetzung harren. Er müsse, hat Pirkner einmal gemeint, mindestens hundert Jahre alt werden, um alles vollenden zu können. Das und noch mehr sei dem großen Meister vergönnt, der eine echte Bereicherung für das Land weit über die Sphäre der Kunst hinaus ist.
Marian_Kröll
Jos Pirkner is an impressive man, a sculptor and painter through and through.
The 95-year-old East Tyrolean artist Jos Pirkner seems as lively as ever and is definitely good-humoured and talkative. In the course of his long life he has seen a lot and created a lot, and it was by no means a matter of course that he was able to embark on a career as an artist. Times were hard around the turmoil of World War II, but his parents recognized their son’s great talent early on and always encouraged him to the best of their ability.
The start of his career as a sought-after artist came in the Netherlands. Fate was to take Jos Pirkner to Holland in 1951, where he worked in his own studio in Utrecht and at the same time further developed his artistic skills at colleges in Amsterdam and Utrecht. As early as 1952, he produced a 10-kilogram heavy sculpture made of silver, gold-plated and set with 400 precious stones and 240 diamonds. “Such drifting work is no longer done today, it’s gone, and that’s a pity,” says the master. At the latest with this impressive work, Pirkner has made a name for himself in the Netherlands and beyond.

But the artist has also left his mark in his homeland, in East and North Tyrol, as well as in Fuschl, Salzburg, where Pirkner was responsible for the architectural design of Dietrich Mateschitz’s Red Bull headquarters. “In these buildings, architecture, sculpture and nature come together,” Pirkner says of this imposing work of art. 14 bulls powerfully charging out of one of the buildings is Pirkner’s largest work and also the largest bronze sculpture in Europe.
Jos Pirkner returned to his native East Tyrol with his wife Joke, the love of his life, whom he had married in 1966, after the birth of his son Gidi in 1978, who was to grow up in a nurturing surrounding, according to his intention. Nostalgia and, above all, gratitude are in Jos Pirkner’s voice when he thinks of his Joke, who died in 2010. “My wife was always around. She was a ballet
dancer in the National Ballet when we met. At some point, she didn’t want to travel back and forth between Amsterdam and Utrecht and started working for me in the studio,” Pirkner reminisces.
The maestro has not reached the end of his journey. There is still much to do, and Pirkner always has new ideas waiting to be implemented. Pirkner once said that he would have to live to be at least a hundred years old to be able to complete everything.
KLASSIK.UNIQUE bietet vier Tage paradiesischen Hochgenuss vor fabelhafter Bergkulisse, fördert dabei junge Talente und verzaubert die Gäste.
emeinsam mit dem Team des Alpine Lifestyle Hotels DAS KRONTHALER steckt Sopranistin Eva Lind derzeit mitten in den Vorbereitungsarbeiten für das vom 13. bis 16. Juli 2023 stattfindende Klassikevent KLASSIK.UNIQUE, das wieder zahlreiche Programmhighlights erwarten lässt. Darunter natürlich das grandiose Open.Air am 15. Juli 2023 auf der DAS KRONTHALER-Panoramabühne. „Ich freue mich schon auf die Begegnungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der internationalen Klassikwelt wie Dmitry Korchak, die Mezzosopranistin Maria Barakova, der Klarinettist Giora Feidman oder der Bassbariton Günther Groissböck sowie einige der besten Studierenden aus den Meisterkursen der Musikakademie Tirol. Außerdem spielt das Kammerorchester InnStrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer. Das Open.Air findet vor einer großartigen Kulisse des Achensees und den umliegenden Bergen statt, bei schönem Wetter wird dieser Abend zum absoluten Sommernachtstraum“, sagt Eva Lind, Gründerin der Musikakademie Tirol.


Das Program m : Am ersten Tag findet eine geführte Wanderung mit Profibergsteigerin Gerlinde Kalten-
Am Waldweg 105a 6215 Achenkirch +43 (0)5246 6389 welcome@daskronthaler.com www.daskronthaler.com

Erleben Sie das gesamte KLASSIK.UNIQUE-Wochenende von 13. bis 16. Juli 2023 im DAS KRONTHALER oder besuchen Sie das fulminante Open.Air am 15. Juli 2023
brunner statt. Die Hütteneinkehr wird dabei musikalisch von den beiden jungen Geigerinnen Teresa Wakolbinger und Sophie Trobos umrahmt. Am Nachmittag folgt ein gemütliches Beisammensein mit der bekannten SwingBand Flo’s Jazz Casino. Abends nach dem Dinner tritt das Rita Goller Duo auf. Am Freitag gibt es eine Schifffahrt auf dem Achensee mit dem berühmten „Rosenheim Cop“ und ausgebildeten Opernsänger Max Müller und dem Adamas Quartett. Und am Freitagabend werden die Gäste beim 5-Gang-Klassik-Dinner kulinarisch sowie musikalisch verwöhnt. Das Dinner wird von Gastkoch Thomas Penz, Sieger des Kochwettbewerbs „Junge Wilde“ 2022, kreiert und passend dazu von den Nachwuchstalenten Greta Torelli, Petra Lantschner und Ivan Naumovski umrahmt.
Für Eva Lind steht vor allem die Förderung junger Talente im Fokus. In den Meisterkursen sind inzwischen weit über 20 Nationen vertreten: „Ich bin sehr glücklich, dass die Musikakademie Tirol sich in kurzer Zeit als Heimat für viele internationale Studierende und Dozierende etablieren konnte. Hier hat DAS KRONTHALER entscheidend dazu beigetragen, bedeutsame Impulse für ihre Karrieren zu ermöglichen.“

Jedes Jahr im September entscheidet in Galtür das Los, wer die Wurzeln des Gelben Enzians ausgraben darf. Seit einigen Jahren wächst der bittere Bergfex aber auch auf einem Paznauner Acker und findet nicht nur Verwendung für die Schnapsherstellung, sondern auch für Pflegeprodukte.
Ein Besuch beim ersten Enzianbauern Tirols.

Auf mittlerweile 5.000 Quadratmetern kultiviert Hermann Lorenz seit ein paar Jahren Gelben Enzian und hat damit einer jahrhundertealten Tradition ein neues Kapitel hinzugefügt.
In der Paznauner Tourismusgemeinde Galtür geht man es traditionell ruhiger an als in der knapp zehn Kilometer entfernten Party-Hochburg Ischgl. Der Einkehrschwung hat aber auch in Galtür Tradition, Gelegenheit dazu bietet sich zum Beispiel im so genannten „Weiberhimml“. Der Name des urigen Après-Ski-Lokals kommt nicht von ungefähr: Früher einmal habe man, wenn Frauen aus dem unteren ins obere Paznaun geheiratet hätten, gesagt, sie kämen in den „Weiberhimml“, erzählt Hermann Lorenz. Galtür liegt auf fast 1.600 Metern Seehöhe, wegen der hochalpinen Lage und dem rauen Klima gab es hier keinen Ackerbau und damit auch keine schwere Feldarbeit, die anderswo zum größten Teil von Frauen verrichtet wurde. Allzu paradiesisch dürfte das karge Leben im Tal wohl trotzdem nicht gewesen sein.
Mit dem Tourismus hat sich auch das Leben in Galtür verändert. Heute verändert es sich wieder, denn neuerdings wird hier geackert, bis die Hände tagelang nach Bitterstoffen schmecken, und zwar auf dem Feld des Enzianbauern Hermann Lorenz. Von „Weiberhimmel“ könne also keine Rede sein, sagt Lorenz‘ Frau Alexandra Walter lachend. Denn Familie und Freunde halfen von Anfang an mit, um die „Schnapsidee“ des Galtürers in die Tat umzusetzen. Auf mittlerweile 5.000 Quadratmetern kultiviert Lorenz seit ein paar Jahren Gelben Enzian und hat damit einer jahrhundertealten Tradition ein neues Kapitel hinzugefügt. Aus den Wurzeln des wilden, Punktierten Enzians wird im Paznaun seit jeher der berühmte „Enzner“ gebrannt. Dessen Geschichte
Der Galtürer Schnapsbrenner
Hermann Lorenzwurde 2013 sogar in das UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen. Und wer sie kennt, weiß um die Ehre, die einem zuteil wird, wenn man einen Enzner ausgeschenkt bekommt.
Grabungsrecht trotz Naturschutz.
Hermann Lorenz hat es geschafft, den Gelben Enzian zu kultivieren. 2017 wagte er sich an das Projekt, 2021 fand die erste Ernte statt.

„Den Enzner muss man sich verdienen“, heißt es in Galtür. Helfen soll der Schnaps außerdem gegen so ziemlich alles. Dem erdigen Wurzelbrand wird – in kleinen Mengen genossen – wegen seiner Bitterstoffe allerdings nicht nur eine heilsame Wirkung unter anderem bei Magen- und Verdauungsbeschwerden nachgesagt, er ist zudem äußerst rar. Der Punktierte Enzian wächst in Höhenlagen von 1.500 bis fast 3.000 Metern, in den 1960er-Jahren wurde die seltene Wildpflanze unter Naturschutz gestellt. Die Galtürer haben sich jedoch vor Gericht eine Ausnahmegenehmigung erstritten,
Wissenswertes über die Geschichte des Galtürer Enzners erfährt man unter anderem im Alpinarium Galtür. Das Ausstellungs-, Informations- und Dokumentationszentrum wurde im Gedenken an die Opfer der Lawinenkatastrophe von 1999 errichtet und ist ein baulicher Bestandteil der 345 Meter langen und 19 Meter hohen Schutzmauer, die nach dem Unglück errichtet wurde. Die Dauerausstellung widmet sich der Region und dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur. www.alpinarium.at
„BEI EINER BLINDVERKOSTUNG
KENNT DEN ANGEBAUTEN UND DEN WILDEN ENZIAN AM ENDE NIEMAND AUSEINANDER.“
um weiter Enzianwurzeln graben zu können. Jedes Jahr am Kirchtag im September werden in der 800-Seelen-Gemeinde exakt 13 Grabungsrechte verlost, die es den glücklichen Gewinnern erlauben, jeweils hundert Kilogramm Wurzeln zu graben. Was eine Knochenarbeit ist und am Ende gerade einmal sieben Liter Schnaps ergibt. Wer einmal ein Los gezogen hat, darf außerdem drei Jahre lang nicht mehr an der Ziehung teilnehmen.
Eigentlich ein guter Grund, um Wege zu suchen, die Sache einfacher zu machen. Von der Idee, in Galtür Gelben Enzian anzubauen, hielten viele im Ort zunächst trotzdem wenig. Er sei belächelt worden, erzählt der hauptberuflich bei den hiesigen Bergbahnen beschäftigte Lorenz. Man sagt den Alpenbewohnern indes eine gewisse Sturheit nach und womöglich hat auch die den passionierten Schnapsbrenner an seinem Vorhaben festhalten lassen. „Im Endeffekt wollte ich mir selbst beweisen, dass ich es kann“, sagt er heute schmunzelnd. Mit 12.000 vorgezogenen Enzianpflanzen sowie mit der Unterstützung der Tiroler Landwirtschaftskammer und der Münchner Agrarbiologin Centa Kirsch startete Lorenz 2017 das Pilotprojekt Galtürer Enzian. Es wurde zum vollen Erfolg.
Schnaps und Kosmetik.
Es ist Ende März, als wir durch knöcheltiefen Neuschnee zu einem kleinen Schuppen stapfen, der sich als die Brennerei von Hermann Lorenz entpuppt. Der Frühling hat zwar auch im Paznaun schon einmal kurz aufgemuckt, um diese Jahreszeit muss man allerdings jederzeit damit rechnen, dass der Winter mit weißer Pracht zurückschlägt. Doch spätestens im Juni werden auch die Galtürer Sommergäste wieder über die gelbe Blütenpracht auf dem Enzianfeld von Hermann Lorenz staunen. Weil das, was er hier an-
Viele denken bei Enzian zuerst an die leuchtend blaue Gebirgsblume, es gibt weltweit jedoch bis zu 400 verschiedene Enzianarten. Der Gelbe Enzian (Gentiana lutea) mag es besonders kalt und gebirgig und wird bereits seit Jahrtausenden als Heil- und Genussmittel verwendet. Er kommt nicht nur in den Alpen, sondern unter anderem auch in den Pyrenäen vor.

pflanzt, für einige Neugierde sorgt, hat er inzwischen eine Informationstafel aufgestellt. Und dass der Gelbe Enzian in Galtür so gut gedeiht, ließ alsbald neue Ideen sprießen.
Für die Schnapsherstellung wird ausschließlich die Wurzel verwendet, „die Blüten waren nur das Nebenprodukt“, sagt Alexandra Walter, die Ärztin ist und sich mehr und mehr für mögliche Weiterverarbeitungen dieses Rohstoffes mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen zu interessieren begann. Nicht nur in den Wurzeln des Gelben Enzian, sondern auch in seinen Blüten und Blättern steckt Amarogentin, der intensivste unter den natürlichen Bitterstoffen. Alexandra Walter beschäf-
tigte sich intensiv mit Phytotherapie und steckte gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Heidrun Walter viel Zeit und Energie in die Entwicklung von kosmetischen Hautpflegeprodukten. „Das war ein langer Weg“, sagen die beiden Galtürerinnen und erzählen von der schwierigen Suche nach einem Unternehmen, das die Enzianblätter und -blüten professionell trocknet, der Herstellung eines Extrakts in Arzeimittelqualität, von bürokratischen und olfaktorischen Hürden. Der charakteristische bitter-erdige Geruch des Gelben Enzian ist nämlich nicht gerade dezent – und erinnerte die ersten Testerinnen und Tester anfangs dann doch ein wenig zu sehr an Schnaps. Doch auch für die richtige Duftnote fand sich eine Lösung und mit den Seifen und Pflegelotionen des von den beiden Frauen gegründeten Start-ups „Enzian cultiviert“ wird die Geschichte des Galtürer Enzners heute auf ganz neuer Ebene fortgeschrieben. Wobei es den Unternehmensgründerinnen nicht darum geht, mit ihren Produkten gleich die ganze Welt zu erobern: „Wir arbeiten hauptsächlich im Direktvertrieb und mit vielen lokalen Partnern“, sagt die gelernte Marketing-Fachfrau Heidrun Walter. Und Alexandra ergänzt: „Wir sind zwar stetig dabei, neue Produkte zu entwickeln, machen das aber beide neben unseren Vollzeitjobs.“
Vordrängen ist zwecklos.
Auch Hermann Lorenz spricht, wenn es um die Schnapsherstellung geht, von einem zwar extrem arbeitsintensiven, aber „wunderschönen Hobby“, das er neuerdings auch als frischgebackener Edelbrand-Sommelier betreibt. Und mit dem er in der bestehenden Brennerei inzwischen am Limit angelangt sei, weshalb er die Errichtung einer neuen Anlage plane. Was keinesfalls bedeutet, dass der begehrte Enzner künftig in die Massenproduktion geht. Wer den Schnaps kaufen will, muss


Höchste Kompetenz, professionelle Beratung und perfekte Druck-Qualität – alles aus einer Hand und gleich nebenan.

Als Tiroler Traditionsbetrieb mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Ihr verlässlicher Partner für alle Belange rund um Druck und Versand Ihrer brillanten Print-Produkte.



Testen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.


sich in Geduld üben, die Interessentenliste ist lang, mit einem Jahr Wartezeit müsse man rechnen, sagt Lorenz. Man ist zudem gut beraten, bei Bestellungen auf Vordrängelversuche der Marke „Sie wissen aber schon, wer ich bin“ zu verzichten, vor allem wenn sie bei Alexandra Walter aufgegeben werden. Den Enzner muss man sich eben verdienen, und zwar nicht durch die eigene gesellschaftliche Stellung.
So manche Galtürer beharren übrigens immer noch darauf, dass der Schnaps, der aus den Wurzeln des Wilden Enzians gebrannt wird, anders schmecke als jener aus dem angebau-
Die zwei Galtürerinnen Alexandra Walter, Frau von Hermann Lorenz und Ärztin sowie diplomierte Phytotherapeutin, und Marketing- und Produktmanagerin Heidrun Walter gründeten 2021 ihr Unternehmen Enzian cultiviert. Dabei nutzen sie den oberirdischen Teil des Gelben Enzian und verarbeiten diesen zu hochwertigen Hautpflegeprodukten.


ten. Lorenz erzählt das mit einem milden Lächeln und dem Nachsatz: „Bei einer Blindverkostung kennt sie am Ende aber halt doch niemand auseinander.“ Auch beim Anbau wurde viel ausprobiert, um herauszufinden, wie die Pflanze am besten gedeiht. „Wir haben am Anfang viele Fehler gemacht –und daraus gelernt“, so Lorenz. Da war etwa die Sache mit dem Alpaka-Dung, „den wir extra eingekauft haben, weil der Enzian viel Stickstoff braucht“. Aber die Konsistenz machte Probleme: „Das war wie ein Pulver, und das war dann überall in Galtür, nur nicht bei meinen Pflanzen.“
Inzwischen hat das Galtürer Pilotprojekt in anderen Teilen Tirols zahlreiche Nachahmer gefunden. In Galtür macht man derweil allerlei interessante Zusatzerfahrungen. Zum Beispiel mit dem Meisterwurz, der zwischen den Enzianpflanzen wuchert. Und auf den, wie Lorenz inzwischen weiß, die Gin-Hersteller besonders scharf wären. Zudem hat die Verwendung des Meisterwurz als Heil- und Arzneipflanze eine lange Tradition. Womöglich tut sich da ja noch ein weiteres Kapitel im Galtürer Ackerbau auf? Für Hermann Lorenz schließt sich in erster Linie ein Kreis: Schon vor vielen Jahrzehnten hätten Apotheker aus Wien bei seiner früh verwitweten Mutter mit der Idee angeklopft, in dem schmalen Hochtal Heilpflanzen anzubauen. Es kam damals nicht dazu. Beim Enzianprojekt hat Mutter Irma Lorenz aber fleißig mitgejätet. Das gelbe Gold von Galtür wird im Familienverband geschürft.
„WIR HABEN VIEL ZEIT UND ENERGIE IN DIE ENTWICKLUNG VONAlexandra Walter und Heidrun Walter
Every September in Galtür, the decision is made by lot as to who gets to dig up the roots of the yellow gentian. For several years, this bitter elixir has also been growing in a field in Paznaun.
Galtür is located at an altitude of almost 1,600 meters above sea level. No farming has taken place here because of the high alpine location and the harsh climate. Lately, however, people have been ploughing on the field of gentian farmer Hermann Lorenz - the bitterness on their hands lasts for days. On an area of meanwhile 5,000 square meters, Hermann cultivates yellow gentian and has thus added a new chapter to a centuries-old tradition. From the roots of the wild, dotted gentian, the famous “Enzner” has been distilled in Paznaun since forever.
The dotted gentian grows at altitudes from 1,500 to almost 3,000 meters. In the 1960s, the rare wild plant was placed under nature protection. However, the people of Galtür won an exemption in court to be able to continue digging gentian roots. Every year on Kirchtag - a religious folk festival in September - 13 digging rights are granted in the community of 800 inhabitants, allowing the lucky winners to dig up one hundred kilograms of roots each. It is actually hard work, and results in just seven litres of schnapps in the end. All the more reason, to look for ways to make
things easier. Nevertheless, many people in the village initially thought little of the idea of growing yellow gentian in Galtür. It was laughed at, says Lorenz. Despite this, he launched the Galtür Gentian pilot project in 2017 with 12,000 preplanted gentian plants. The first harvest took place in the fall of 2021.
Since the yellow gentian thrives so well in this region, new ideas soon sprouted. Only the root is used for schnapps production, “the blossoms were only the by-product,” says Lorenz’s wife Alexandra Walter. Alexandra is a doctor and became more and more interested in ways to further process this raw material with its valuable ingredients. Amarogentin, the most intense of the natural bitter substances, is found not only in the roots of the yellow gentian, but also in its flowers and leaves. Consequently, Alexandra, together with her business partner Heidrun Walter, put a lot of time and energy into the development of cosmetic skin care products. With the soaps and skin care lotions of the start-up “Enzian cultiviert”, the history of the Galtür gentian is now being continued on a whole new level.


Seit 1267 in Eppan / Südtirol und seit 1944 in Nordtirol bestens etabliert.
1944 Gründung durch Peter Meraner sen. (Winzer aus Südtirol)
1956 Übernahme des Betriebes durch seine Söhne Peter und Edi
1988 Erwerb der Linherr GmbH und Übersiedelung zum Rennweg 16 in Innsbruck
1995 Übernahme der Geschäftsleitung durch Dietmar Meraner
1995 Projektstart „Hamburger Fischmarkt“, jetziges 27. Fischvergnügen am Inn 2022
1997 Kauf der Geschäftsanteile Weinkellerei P. Meraner GmbH und Linherr GmbH durch Dietmar Meraner-Pfurtscheller

2005 Projektstart wellwasser® - „aus Leitungswasser wird wellwasser®“
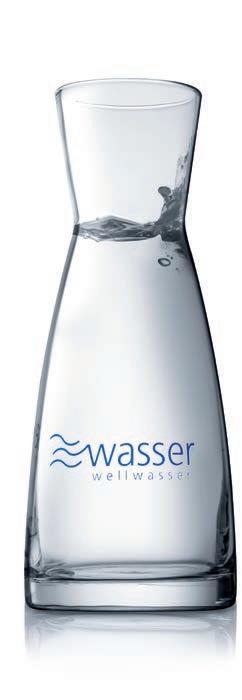
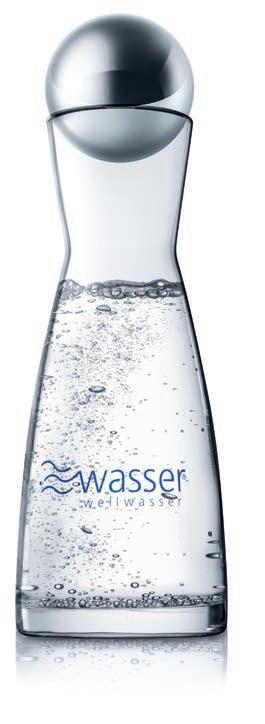


2021 Verein Weinwerbung TIROL – der Tiroler Weinfachhandelübersiedelt zum Rennweg 16 in Innsbruck
ohne Plastik ohne Transportwege und Abgase

direkt aus der Leitung keimfrei gefiltert mit natürlichem Mineralstoffgehalt
Die Wellwasser Technology GmbH wurde als Finalist beim Energy Globe Austria in der Kategorie WASSER wausgezeichnet.
Der Energy Globe Award ist der weltweit bedeutendste Umweltpreis und zeichnet jährlich, auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, herausragende nachhaltige Projekte aus.
 Foto: Gerhard Berger
Foto: Gerhard Berger
aus Leitungswasser wird wellwasser® still oder perlend

Ein Bienenstock ist eine bestens strukturierte Mischung aus Geburtsklinik, Wohnhaus und Superfabrik. So kurz das Leben dieser Insekten ist, so faszinierend ist es.

Wer kennt sie nicht, die schlaue und fleißige Biene Maja und ihren faulen Kollegen Willi aus dem Zeichentrickfilm? So herzerwärmend ihre Abenteuer sind, so wenig haben sie mit der Realität zu tun. Was schon allein an der banalen Tatsache zu erkennen ist, dass es faule Bienen nicht gibt. Darum hat Imker Klaus Farthofer den Automaten, über den er in Schwaz 24 Stunden täglich seine Imkerei-Erzeugnisse verkauft, auch den „Fleißigen Willi“ genannt. Und er muss es wissen.
Silvester ist für Bienen ungefähr Mitte August. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet der Imker eigentlich schon für das nächste Jahr, die nächste Ernte. In gewisser Weise bilden Imker mit ihren Bienen eine Zweck- und Tauschgemeinschaft. Die Tiere geben ihren Honig und bekommen dafür ein Ersatzfutter vom Menschen. Als Mundraub will das Klaus Farthofer aber keineswegs sehen, im Gegenteil: „Das Futter, das wir den Bienen geben, damit sie über den Winter kommen, ist optimal für sie.“ Der Waldhonig, von dem sie sich sonst ernähren würden, wäre im Winter schwer verdaulich. Bienen machen keinen Winterschlaf, verlassen bei den – gewöhnlich – niedrigen Temperaturen allerdings nicht ihren Stock. Um sich warm zu halten, drängen sie sich in Trauben zusammen. 18 Grad erreicht diese Körperheizung. Wenn sie sich aus irgendeinem Grund doch bewegen müssen, bringen sich die Bienen durch Muskelzittern auf Betriebstemperatur.
In Tirol gibt es rund 3.200 Imker mit ungefähr 40.000 Völkern. Pro Volk können – im Zehnjahresschnitt – jährlich rund
16 Kilo Honig geerntet werden. Geerntet wird in Tirol in der Regel nur einmal pro Jahr.
Honigarten:
• Frühjahrsblütenhonig
• Blütenhonig (wird als Produkt städtischer Blumenwiesen immer beliebter)
• Waldhonig
• Almrosen- bzw. Hochgebirgshonig
• Cremehonig (er wird langsam gerührt und behält seine Konsistenz bei)
Tipp: Fängt Honig an zu kristallisieren und wird dick/hart, ist dies ein Qualitätskriterium und ein Zeichen dafür, dass er nicht überhitzt wurde. Der Honig schmeckt natürlich nach wie vor. Wer ihn dennoch lieber flüssiger hat, erwärmt den Honig im Wasserbad auf maximal 42 Grad. Zu oft sollte man das allerdings nicht machen, in der Regel ist das Honigglas aber ohnehin vorher aufgebraucht.
Eine königliche Fortpflanzungsmaschine.
Erreichen die Tageshöchsttemperaturen über einen längeren Zeitraum null Grad, kommt wieder Leben in den Stock, erklärt der Imker: „Dann beginnen die Königinnen Eier zu legen.“ Was dann geschieht, ist eine durchgetaktete Organisation, die selbst die disziplinierteste Armee vor Neid erblassen ließe.
Die Königin legt die Eier entweder befruchtet oder unbefruchtet in eine Wabe, deren Sauberkeit sie zuvor überprüft hat. Ist das Ei unbefruchtet, wird daraus eine männliche Biene, eine Drohne, ist es befruchtet, entsteht in der Regel eine Arbeiterin. Zwar wird die Königin von den Arbeiterinnen gefüttert und beschützt, in Wahrheit, so Farthofer, ist ihr royales Leben aber nur einem Zweck gewidmet: „Sie legt bis zu 2.000 Eier pro Tag, je nach Temperatur vielleicht auch etwas weniger. Eigentlich ist sie eine Fortpflanzungsmaschine.“ Während nur relativ wenige Tiere überwintern, vervierfacht sich ihre Anzahl in der Hochsaison. Dementsprechend eng wird es in der Behausung. Dann muss der Imker nachhelfen: „Unsere Aufgabe ist es, die Raumverhältnisse anzupassen.“ Es wird also „angebaut“.
Ein durchgetaktetes Bienenleben.
Aus dem Ei entsteht nach drei Tagen eine Larve, die von „Ammenbienen“
gefüttert wird. Am Ende dieser Phase bedecken die Arbeitsbienen die Wabe mit Wachs, die Larve tritt in das Puppenstadium ein. Am 21. Tag platzt schließlich die Puppenhaut, das Insekt zernagt von innen den Wachsdeckel der Wabe und gliedert sich sofort in die Bienenhierarchie ein: Das Arbeitsleben beginnt mit dem Putzen des eigenen Körpers und der Wabe. Danach werden die Jungbienen zum Füttern der neuen Larven herangezogen. Im zweiten Lebensabschnitt werden sie zu „Baubienen“ und erstellen mit dem Wachs aus speziellen Drüsen neue Waben. Gegen Ende dieser Tätigkeit nähern sie sich unmerklich dem Ausgang des Stocks. Hier kommen sie für wenige Tage als Wächterbienen zum Einsatz. In dieser Zeit will man ihnen besser nicht begegnen, denn ihre Giftdrüse ist nun voll entwickelt. Erst um den 20. Tag ihrer Existenz wird aus der Stock- eine Sammelbiene. Sie fliegt aus, sammelt in den Taschen an ihren Beinen Pollen und mit ihrem Rüssel Nektar. Diese Tätigkeit verrichtet sie für rund zehn bis zwölf Tage, ehe ihr Leben endet. Farthofer: „Die Sommerbiene arbeitet sich sprichwörtlich zu Tode.“ Der Ertrag, den eine Biene zu ihren Lebzeiten für ihr Volk beziehungsweise in der Folge für die Menschen vollbringt: ein Teelöffel Honig!


Während dieser Zeit hat sich nicht nur im Bienenstock viel getan, sondern auch vor dessen Tür, draußen in der Natur. Die ersten Futterspender für die Bienen sind in der Regel die Palmkätzchen, es folgen Krokusse und andere Frühjahrsblumen. Schließlich kommt die Blüte der ersten Obstbäume. Hier nehmen die Bienen nicht nur, sondern geben auch, erklärt Klaus Farthofer: „Das ist ein besonderes Spiel der Natur, dass die Bienen nicht nur suchen und sammeln, sondern gleichzeitig die Blüten bestäuben.“ Ohne diese Bestäubung gäbe es bekanntlich keine Früchte. Schließlich tritt im Spätfrühjahr ein Futtermangel ein, die so ge-


nannte Trachtlücke. Jetzt wird es Zeit für einen Standortwechsel. Der Imker samt seinen Bienenvölkern macht sich die unterschiedliche Blütezeit in den verschiedenen Höhenlagen zu Nutze, wie Farthofer plastisch schildert: „Ein Bienenvolk muss immer eine volle Speisekammer haben. Daher wandert der Imker mit ihnen zum nächsten gedeckten Tisch.“ Dabei kann er praktischerweise auch gleich die Honigsorte mitbestimmen. Will er Wald-, Hochgebirgs- oder Almrosenhonig, so stellt er seine Bienen in der entsprechenden Gegend ab. Die Insekten haben allerdings einen guten Orientierungssinn. Sind sie zu wenig weit vom alten Standort entfernt, kann es vorkommen, dass sie dorthin zurückkehren.


Eine Bombe an Inhaltsstoffen.
Inzwischen neigt sich das Bienenjahr langsam dem Ende zu. Die Blüten, aus denen die fleißigen Insekten ihre Nahrung beziehen, werden weniger. Dann ist es für den Imker Zeit für seine Ernte: „Wenn die Natur nichts mehr gibt, dann entfernen wir die Kisten. Dazu müssen wir sie bienenfrei machen.“ Bei den leeren Waben wird der Wachsdeckel mit einer groben Gabel entfernt und sie kommen in eine Schleuder. Nun rinnt der Honig heraus, wird gesiebt und in Behälter abgefüllt. Nach einer Ruhezeit von zwei bis drei Wochen muss der Schaum von der Oberfläche des Honigs entfernt werden, ehe er in handelsübliche Mengen abgefüllt wird. Inzwischen, so Farthofer, hat Honig einen guten Ruf: „In den letzten 40 Jahren hat sich dieses Produkt einen Stellenwert verschafft. Und zwar völlig berechtigt. Denn wenn etwas den Namen Superfood verdient, dann ist es der Honig.“ Er spiegelt letztlich die Natur wider, in der er produziert wird. Dementsprechend unterschiedlich sind die Inhaltsstoffe. Generell sind es eine Vielzahl an Vitaminen, verschiedene Zucker wie Trauben- oder Fruchtzucker, Enzyme, Säuren, Mineral- und Aromastoffe. Vorausgesetzt, es handelt sich um echten Honig und nicht um (chinesische) Fälschungen. Klaus Farthofer rät daher: „Man sollte Honig aus der Region essen.“ Uwe_Schwinghammer
Die Königin legt die Eier entweder befruchtet oder unbefruchtet in eine Wabe, deren Sauberkeit sie zuvor überprüft hat. Ist das Ei unbefruchtet, wird daraus eine männliche Biene, eine Drohne, ist es befruchtet, entsteht in der Regel eine Arbeiterin.
„WENN ETWAS DEN NAMEN SUPERFOOD VERDIENT, DANN IST ES DER HONIG.“
Klaus Farthofer
Wie Honig am besten schmeckt? Pur! Deshalb hier unser ganz persönlicher Rezepttipp.

Zutaten: Honig, Brot und Butter.
Zubereitung: Brot in Scheiben schneiden, mit Butter bestreichen, mit Honig beträufeln und verstreichen.
A beehive is an optimally structured mixture of birth clinic, residential house and super factory. As short as the life of these insects is, it is just as fascinating.

In a way, beekeepers and their bees form a community of purpose and exchange. The animals give their honey and receive a substitute food from humans in return. Schwaz mountain beekeeper Klaus Farthofer does not consider this as stealing their food, on the contrary: „The food we give the bees to get them through the winter is optimal for them.“ Bees do not hibernate, but do not leave their hives when temperatures are low. If the daily maximum temperatures reach zero degrees for a longer period of time, life comes back into the hive, Farthofer explains: „Then the queens start laying eggs.“ Although the queen is fed and protected by the worker bees, in reality, says the beekeeper, her royal life is actually dedicated to one purpose: „She lays up to 2,000 eggs a day..
After three days, the egg gives rise to a larva that is fed by “nurse bees.” At the end of this phase, worker bees cover the comb with wax, and the larva enters the pupal stage. Finally, on the 21st day, the pupal skin bursts, the insect gnaws the wax cover of the honeycomb from the inside and immediately joins the bee hierarchy. In the second stage of its life, it becomes a “builder bee” and creates new honeycombs with the wax from special glands. Towards the end of this activity, it imperceptibly approaches the exit of the hive. It is only around the 20th day of its existence that the hive bee becomes a gathering bee. It flies out, collects pollen in the pockets on its legs and nectar with its proboscis. It performs this activity for about ten to twelve days before its life ends. The yield, which a bee accomplishes during its lifetime for its people and/or subsequently for humans is a teaspoon of honey!
When the bee year slowly comes to an end, it is time for the beekeeper to harvest. The wax cover of the empty combs is removed with a coarse fork and they are put into a centrifuge. Now the honey trickles out,
is sieved and filled into containers. Today, Farthofer says, honey has a good reputation: “In the last 40 years, this product has made a name for itself. And quite justifiably so. Because if anything deserves the name superfood, it’s honey.” It ultimately reflects the nature in which it is produced - ranging from blossom or forest to mountain honey. Accordingly, the ingredients vary. In general, it is a variety of vitamins, different sugars, enzymes, acids, minerals and flavourings that make it so special and healthy.
If the honey starts to crystallize and becomes thick/hard, by the way, this is a quality criterion and a sign that it has not been overheated. Of course, the honey still tastes good. If you still prefer it more liquid, heat the honey in a water bath to a maximum of 42 degrees. However, you should not do this too often, but usually the honey jar is used up beforehand anyway.




Bücher von und über Tirol. Unterhaltsames, Informatives, zum Schauen, Lesen und Schmökern.
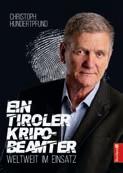
Zu Gast in Südtirol
Martina Hunglinger & Mads Mogensen, Callwey Verlag, 208 Seiten, EUR 46,30
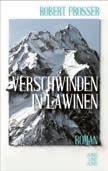
Südtirol ist viel, viel mehr als nur Schlutzkrapfen und ein Glasl Rot. Kein Buch könnte das eindrucksvoller beweisen als dieses. Kundig nimmt einen Martina Hunglinger mit auf eine Reise in die vier Regionen um Meran, Bozen, Brixen und Bruneck. Aus jeder dieser Gegenden stellt sie Restaurants, Hotels, ihre Geschichte, Gastgeber und Speisen vor. Manchmal ganz Altbackenes, manchmal Tradition gepaart mit Innovation und zuweilen durchaus auch Revolutionäres. Fantastisch fotografiert ist dieses wertige Buch von Mads Mogensen.
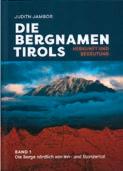
Tirols

Judith Jambor, Eigenverlag des Tiroler Landesarchivs, 304 Seiten, EUR 15,00
Gut 3.300 Berge prägen die Landschaft in Nord- und Osttirol. So manche Spitzen und Kogel tragen Namen, deren Sinn sich nur selten auf den ersten Blick erschließt. Woher sie stammen und was sie bedeuten, hat Judith Jambor in einem lexikalischen Werk niedergeschrieben, das im Tiroler Landesarchiv erhältlich ist.
Robert Prosser, Jung & Jung, 192 Seiten, EUR 22,00
Mit diesem Roman ist der gebürtige Alpbacher Robert Prosser wieder in seine alpine Heimat zurückgekehrt. Gegen Saisonende werden in einem Tiroler Bergdorf zwei junge Einheimische beim Powdern von einer Lawine verschüttet. Während die junge Frau geborgen wird und um ihr Leben kämpft, bleibt ihr Freund verschwunden …
Christoph Hundertpfund, Berenkamp Verlag, 160 Seiten, EUR 22,50
Unzählige Male stand Christoph Hundertpfund vor Fernsehkameras und brachte Zuseherinnen und Zuseher zu den Ermittlungen bei Kriminalfällen auf den neuesten Stand. Nach seiner Pensionierung, Hundertpfund war zuletzt stellvertretender Leiter der Tiroler Landeskriminalabteilung, plaudert er nun aus dem Detektivkoffer.
Mit erfrischend eisblauem Zifferblatt und limitiert auf 300 Stück lädt die Freedom 60 Chrono 40mm dazu ein, die Freiheit der Natur zu entdecken. Die Freedom Kollektion ist eng mit der Wertschätzung für die Natur verbunden, welche über Generationen weitergegeben wird. Das Vintage-inspirierte Design der Freedom Uhren zeichnet sich durch ein gewölbtes Saphirglas, Vintage-Armbänder mit den einzigartigen „NORQAIN Stitches“ und wunderschöne Zifferblätter aus, welche die Ästhetik der 60er Jahre aufleben lassen.





Mit den leistungsstarken Independence Wild ONE-Modellen lancierte Norqain die ultimative Sportuhr, die robust genug für jede Aktivität an Land oder im Wasser ist. Nun erhält die Independence-Serie erfrischenden Zuwachs, speziell durch die 40mm Modelle wie die Independence Hakuna Mipaka. Die Independence Familie schöpft ihre Inspiration aus dem Mut, den es braucht, um das Unerwartete zu tun. Die Uhren wurden für die Entdecker und Entdeckerinnen entworfen, die sich dem Credo „mein Leben, mein Weg“ verschrieben haben und selbstbewusst ihrer Leidenschaft nachgehen.
Die Adventure Linie verkörpert den Nervenkitzel, welcher beim Erkunden und Erobern der Wunder der Natur entsteht – Pfade, Gipfel, Gezeiten! Die Robustheit dieses leistungsstarken Zeitmessers bereitet sie auf alles vor, was die Natur zu bieten hat. Mit dem charakteristischen NORQAIN Pattern auf dem Zifferblatt, den drehbaren Lünetten und der einzigartig widerstandsfähigen Konstruktion sind die NORQAIN Adventure Uhren für ein Leben voller abenteuerlicher Momente gerüstet. Die Adventure Kollektion hat einen ausgeprägten Charakter, der sportliche Allrounder anspricht, welche immer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind. Das unterstreicht auch der neueste, Stahl und rotgoldene Chronograph mit Tag- und Datumsanzeige der Adventure Sport–Serie.
Am Figerhof der Familie Jans aus Kals am Großglockner wird ganz wunderbarer Käse hergestellt. Insgesamt sind es elf verschiedene Sorten aus Kuh- und Ziegenmilch, die für einen kompletten Käseteller made in Osttirol reichen. In der State-of-the-art-Käserei werden jährlich 500.000 Kilo Käse produziert und das bei gleichbleibend hoher Qualität, sodass auch die Gastronomie ihre Freude damit hat. Die moderne Käserei ist übrigens fest in Frauenhand: Geleitet wird die Käseproduktion von Maria Heinz, Schwägerin von Besitzer und Bauer Philipp Jans. Ihre Schwester und zugleich Philipps Frau unterstützt sie mit weiteren Mitarbeitern bei der Herstellung der vielfach prämierten Käse und Milchprodukte. www.figerhof.at

Museums- und Zoobesuch in einem: Aktuell geht die Naturwissenschaftliche Sammlung der Tiroler Landesmuseen im Naturkundemuseum Weiherburg beim Alpenzoo mit einer neuen Ausstellung im wahrsten Sinne auf Schatzsuche. Eine Welt der Mineralien, Kristalle und Gesteine fasziniert dabei mit prächtigen, schönen und seltenen Funden aus Nord-, Süd- und Osttirol sowie dem Trentino. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, wie sich meist schon mit bloßem Auge erkennen lässt. Doch die Schau zeigt auch winzige Kristalle, die lediglich mithilfe eines Spezialmikroskops erkennbar sind. Für einen Besuch ist noch reichlich Zeit, die Ausstellung läuft bis 28. Feber 2024.
www.tiroler-landesmuseen.at

Wir sind ja schon lange Freunde der unkaputtbaren Brillen von Gloryfy aus dem Zillertal, die uns vor allem beim Sport immer wieder gute Dienste erweisen. Dazu schauen die Teile auch noch echt gut aus – übrigens nicht nur als Sonnenbrillen, sondern auch in der optischen Version. Beide gibt’s ab sofort in einer limitierten Bernd-Mayländer-Edition. Der Deutsche ist seit über 24 Jahren (!) der offizielle Safety-Car-Fahrer der Formel 1. Die Sonnenbrille Gi39 ist in drei Farbvarianten um je 169 Euro, die optische SPORT Drift in zwei Versionen um je 339 Euro erhältlich. www.gloryfy.com
Feines im Glas. Das Restaurant zomm. im Meilerhof in Reith bei Seefeld steht für Nachhaltigkeit im schönsten Sinn. Thomas Kluckner und Waal Sternberg füllen Feines aus ihrer Küche auch ins Glas. Onlineshop unter: www.meilerhof.at

Ganz in Grün. Ein Jahr Arbeit investierten Peter und Thomas Kronbichler aus Walchsee in ihren Alpari, einen smaragdgrünen Noble Bitter. Der duftet wunderbar nach Kräutern und Orange und schmeckt fein-herb,


Neben dem Frühstücks- und DiningRestaurant „Steinberg“ mit junger Tiroler und internationaler Küche serviert im Kempinski Hotel Das Tirol in Jochberg nun auch wieder das panasiatische Edelrestaurant „Sra Bua“ (deutsch: der Lotusblütenteich) – ebenfalls verantwortet von Executive Chef Matthias Mezera – von Mittwoch bis Sonntag wahre Gaumengenüsse mit einer Kombination aus dem Besten, das Tirol zu bieten hat, und Geschmäckern aus der ganzen Welt. Die Gäste erleben eine aromaintensive Asiaküche ganz nach Izakaya Style: Wie in vielen asiatischen Ländern üblich werden dabei mehrere Gerichte bestellt, von denen sich die Gäste wahlweise bedienen können. Auch wer nicht im Hotel wohnt, ist gerne willkommen. www.kempinski.com/tirol

„Wandern ist eine Tätigkeit der Beine und ein Zustand der Seele.“
Josef Hofmiller© WOLFGANG LACKNER
Wir sind immer wieder erstaunt, um welch kreative Läden man stolpert, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Am Innsbrucker Claudiaplatz ist Penello von Simone und Michael Schröder zu Hause.
Dort kann man sich aus dem Regal aus über 250 – weißen – Rohkeramikformen sein Lieblingsstück auswählen und es nach Lust und Laune bemalen. Dafür stehen 50 Farbtöne und eine Reihe an Hilfsmitteln zur Verfügung.
Ist man fertig, wird das Teil sorgfältig per Hand glasiert und gebrannt. Für die Ewigkeit quasi. Nach fünf bis sieben Tagen ist das individuelle Meisterwerk abholbereit. Nebst klassischen Tassen, Tellern und Krügen gibt’s auch verschiedene Figuren, Feines für den Tisch oder Futternäpfe. www.pennello.at
Es wimmelt. Lisa Manneh hat schon über 20 Kinderbücher illustriert. Das bunte Papp-Wimmelbuch „Ab in die Berge“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Alpenverein und ist ein Fest für die Augen. Erschienen im Tyrolia Verlag, 16 Seiten, 18 Euro, für Kids ab zwei Jahren.
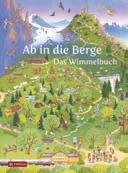
Passend zu unserer Seen-Geschichte auf Seite 12 kann man sich dem Thema Wasser auch spielerisch nähern. In Form eines Puzzles nämlich. Bei Ravensburger erschien kürzlich das „Naturjuwel Piburger See“ mit einem Bild des Hobbyfotografen Tobias Teunisse aus Natters, der als einer von zehn Gewinnern eines Fotowettbewerbs zur Österreich-Puzzle-Serie hervorging. Erhältlich im Fachhandel um 16,99 Euro.
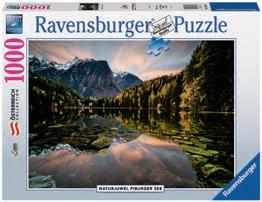
Zum Shirt von der Innsbrucker Agentur Weiberwirtschaft braucht’s eigentlich keine großen Worte. Um 35 Euro gesehen im Tiroler Edles in der Innsbrucker Altstadt, wo es praktischerweise auch gleich die Schoki dazugibt – als Set in der schmucken Holzkiste um 44,10 Euro mit einer Tafel Schokolade oder um 52,30 Euro mit drei Tafeln. Außerdem sind im Tiroler Edles noch viele andere schöne Dinge zuhause. Es gibt auch einen Onlineshop, Vorbeischauen lohnt sich aber! www.tiroleredles.at

Erscheinungsweise: 2 x jährlich _Auflage pro Magazin: 25.000 Stück
Herausgeber & Medieninhaber: eco.nova Corporate Publishing Senn & Partner KG, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at _Chefredaktion: Uwe Schwinghammer _Redaktion: Alexandra Keller, Christiane Fasching, Marian Kröll, Marina Bernardi, Ivona Jelčić, Felix Kozubek _Mitarbeit: Martin Weissenbrunner, Shiva Yousefi _Layout: Tom Binder _Anzeigenverkauf: Ing. Christian Senn, Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin, Matteo Loreck, Daniel Christleth _Foto-redaktion: Andreas Friedle, Marian Kröll, Isabelle Bacher, Tom Bause _Übersetzungen: Viktoria Leidlmair _Lektorat: Mag. Christoph Slezak _Druck: RWf Frömelt Hechenleitner GmbH _Unternehmensgegenstand: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art _Coverbild: Alpbachtal Tourismus/Christian Vorhofer





