














 BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F
BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F



















 BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F
BAGUETTE, LIENZ BAHNH Ö F



Die Natur, die Kultur, die Menschen und das Leben in unserer wunderschönen Heimat Tirol – all das vereint das Tirol Magazin zwei Mal im Jahr. Untermauert wird das Ganze mit spannenden Artikeln und ansprechenden Bildern. Es freut mich jedes Mal wieder, wenn ich beim Durchblättern die interessanten Beiträge lese, die aus dem Alltag der Tirolerinnen und Tiroler erzählen.
Kaum zu glauben, dass nun bereits die 100. Ausgabe des Magazins erscheint. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und bin mir sicher, dass auch die Jubiläumsausgabe wieder viele tolle Geschichten aus unserem Land für die Leserinnen und Leser bereithält. Die Gelegenheit möchte ich auch gleich dazu nutzen, um Dr. Peter Baeck, der das Tirol Magazin mit seinem leidenschaftlichen und engagierten Einsatz die vergangenen 50 Jahre geprägt hat und heuer seinen 80. Geburtstag feiert, ganz herzlich zu gratulieren.
Zugleich möchte ich auch dem eco.nova Verlag und seinem Team dafür danken, dass sie diese Tradition fortsetzen. Ihnen gelingt es nahtlos, an das sehr hohe Niveau, das Dr. Peter

Baeck und sein Team die letzten 50 Jahre vorgegeben haben, anzuknüpfen. Durch ihre großartige Arbeit wird das Magazin hoffentlich noch viele weitere Jubiläen feiern können und den Tirolerinnen und Tirolern auch in Zukunft ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude mit der Jubiläumsausgabe und einen schönen Sommer. Vielleicht schreibt ja bei der einen oder dem anderen das Leben eine Geschichte, über die wir schon in der nächsten Ausgabe des Tirol Magazins lesen werden – eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann, und genau das macht dieses Magazin auch für uns Tirolerinnen und Tiroler so einzigartig und wertvoll.
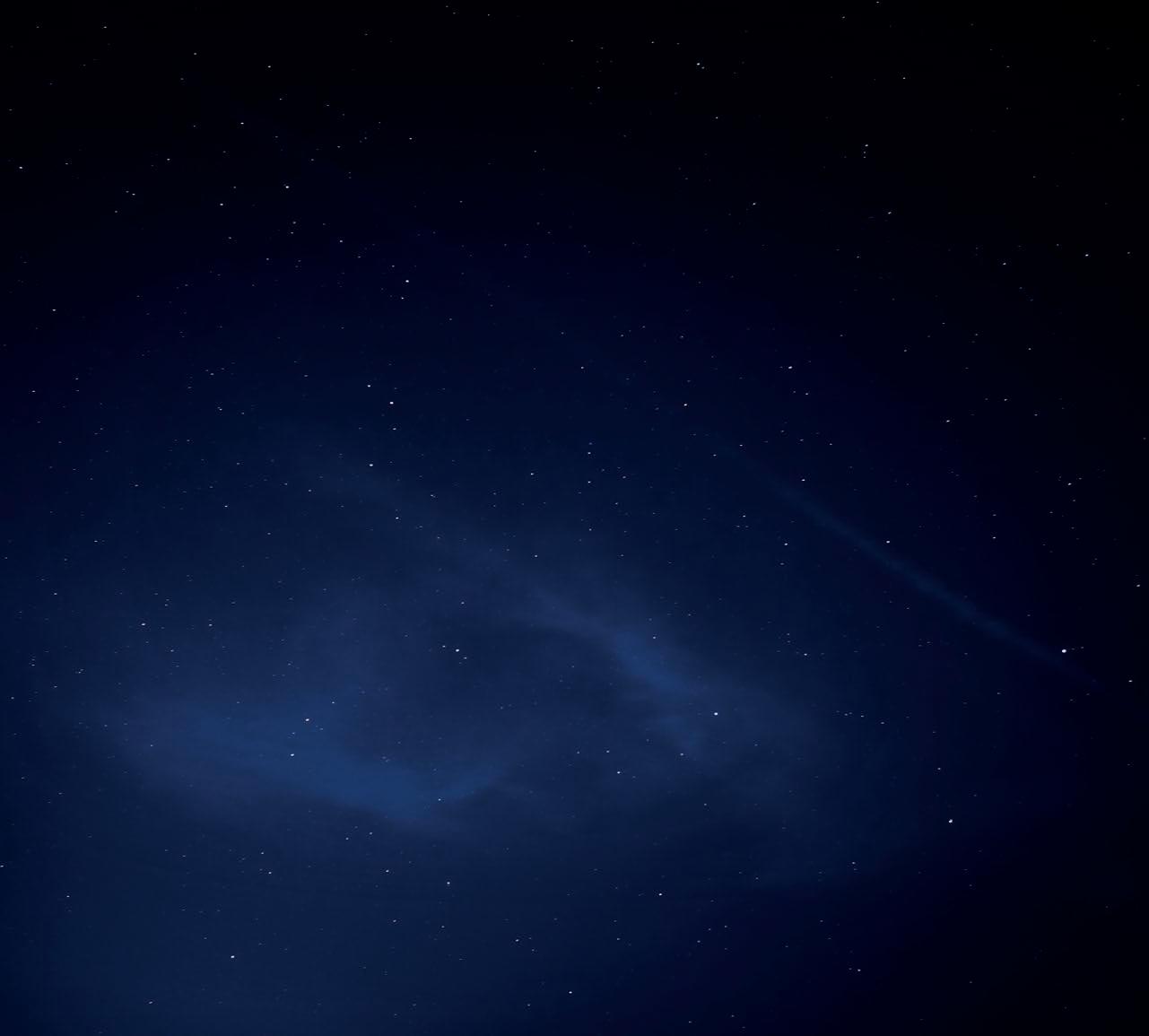

In Zeiten der Unsicherheit, von der wir gerade mehr bekommen als bestellt, tut es gut, Vertrautes um sich zu haben. Dazu gehören Familie, Freunde oder – bei aller kritischen Distanz zu diesem Begriff – die Heimat. Und für so manchen ist vielleicht auch das Tirol Magazin, oder wie einige jovial sagen „es Tirol-Heftl“, so eine Vertrautheit.
Mit dieser Ausgabe feiern wir die hundertste Nummer seit der Neuausrichtung des Magazins. Gesamt gesehen besteht es schon seit fast 100 Jahren und es mutet fast unvorstellbar an, was das Tirol Magazin in diesem seinem Jahrhundert gesehen und erlebt hat. Und wir finden: Gerade in einer derart schnelllebigen und immer oberflächlicher werdenden Zeit hat Kontinuität ihren ganz besonderen Charme.
Das Gewöhnliche im Ungewöhnlichen – oder umgekehrt – ist es, was uns bei den Inhalten und der Gestaltung dieses Magazins reizt. Wie etwa all die seltenen Nutztierrassen, die in Tirol gezüchtet werden, in der Öffentlichkeit jedoch beinahe gänzlich in Vergessenheit geraten sind. Oder die bayerische Königin Marie, die in Tirol zur Vorreiterin für Alpinismus und Tourismus geworden ist. Ziemlich ungewöhnlich finden wir auch, wenn ausgerechnet der Tiroler Marco Ebenbichler in Wien das traditionsreiche Schönbrunner Bad leitet und die Ötztalerin Nenda Neururer von London aus die FM4-Charts er-


In der Regel zeigt das Cover des Tirol Magazins eindrucksvolle Weit-, Aus- und Einblicke in unser wunderbares Land. Für die 100. Ausgabe haben wir uns etwas anderes überlegt, um das Jubiläum – auch optisch –gebührend zu würdigen. Gestaltet wurde das Titelbild vom Osttiroler Künstler Hans Salcher, der dieses eigens für diese Ausgabe gemalt hat. Auf Büttenpapier, wie es ihm zu eigen ist. Hans Salcher ist einer, der Geschichten erzählt. Auf Papier und in Buchform, mit so wenigen Strichen und Worten wie möglich. Er entwirrt mit seiner Kunst das Durcheinander unserer übervollen Gedankenwelt und kommuniziert mit seinen Bildern präzise und beeindruckend klar. Salcher ist ein weltoffener Heimatmaler und damit der perfekte Künstler für diese besondere Ausgabe.
obert. Natürlich gibt es demgegenüber auch den umgekehrten Weg: von der großen, weiten Welt ins kleine Tiroler Landl nämlich. Wir haben Menschen porträtiert, die nach Tirol gekommen und hier geblieben sind, selbst wenn sie in den meisten Fällen völlig andere Pläne und Lebensentwürfe hatten.
Und was wäre Tirol ohne seine Natur? Ein ganz besonders beeindruckendes Fleckchen ist der Ahornboden im Karwendel, der seine Existenz ausgerechnet dem Dreißigjährigen Krieg verdankt. Den zeigen wir in seiner ganzen Schönheit zu allen vier Jahreszeiten. Gewaltig ist auch das in Tirol glücklicherweise reichlich vorhandene Wasser, das sich über Jahrtausende durchs Gestein gegraben und Schluchten gebildet hat. Diese Urmacht wurde früher unter anderem dazu genutzt, um Holz aus den Bergen ins Tal zu befördern. Heute kann man auf den Spuren dieses gefährlichen „Transportgewerbes“ wunderbar wandern.
So ist diese Ausgabe wieder ein Panoptikum dessen geworden, was Tirol aus- und besonders macht: Seine Menschen, die Landschaft, Kultur, Historie und nicht zuletzt die Kulinarik. Genießen Sie die Lektüre des 100. Tirol Magazins und feiern sie im Geiste mit uns. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben.
Das verspricht Ihnen das gesamte Team!
Müllerstrasse 11 | A-6020 Innsbruck | 0512 - 21 44 11 www.kosmetik-aurora.at | shop.kosmetik-aurora.at










14_Curved roads
Tyrol’s most beautiful mountain roads. 26_ World Heritage Mountain Fire When the mountains burn. 34_Old, but strong Almost forgotten livestock breeds. 50_Drifting
The way of wood over water. 74_Pilgrim Paths The lessons of long-distance hiking.

Culture
94_Tyrol on stage The folk plays provide a deep insight into the region.
102_Concert and Chamber Music Interview with Bernd Loebe, director of the Erl Festival. 112_Smoke Signs The history of the Schwaz Tobacco Factory. 118_The House of Life The Rablhaus and the question of faith.
People
130_Here to stay When Tyrol becomes your new home.
140_Imperial A Tyrolean and the Schönbrunnerbad. 148_Mixed Feelings Nenda Neururer on identity and racism.
156_ Summit after summit Queen Marie’s passion for mountains.
180_Cheesy goodness Milk in its noblest form.
14_Geschwungen Tirols schönste Kurven.
26_Weltkulturerbe Bergfeuer Wenn die Berge brennen.
34_Alt, aber gut Fast vergessene Nutztierrassen. 50_Triftig Der Weg des Holzes übers Wasser. 74_Pilgerpfade Die Lehren des weiten Gehens.
„SCHAU TIEF IN DIE NATUR, DANN WIRST DU ALLES BESSER VERSTEHEN.“



Die Pässe Tirols sind bei Motorrad- wie Radfahrern gleichermaßen beliebt. Was für die einen die Herausforderung der Haarnadelkurve, ist für die anderen die der Prozente. Hier zeigen wir jedenfalls einige der schönsten Bergstraßen des Landes.
 Fotos: Tom Bause
Fotos: Tom Bause


Achtung, besonders laute Maschinen sind nicht überall erwünscht. Das Land Tirol hat daher praktisch für den ganzen Bezirk Reutte ein Fahrverbot für Motorräder mit einem Standgeräusch (Nahfeldpegel) > 95 dB (A) erlassen. Dieses gilt vom 15. April bis 31. Oktober eines jeden Jahres auf folgenden Strecken:
• B 198 Lechtalstraße von Steeg (Landesgrenze Vorarlberg) bis Weißenbach am Lech
• B 199 Tannheimerstraße von Weißenbach am Lech bis Schattwald (Staatsgrenze Deutschland)
• L 21 Berwang-Namloser Straße von Bichlbach bis Stanzach
• L 72 Hahntennjochstraße 2. Teil von Pfafflar bis Imst (Passhöhe)
• L 246 Hahntennjochstraße 1. Teil von Imst (Passhöhe) bis Imst Kreuzung Vogelhändlerweg
• L 266 Bschlaber Straße von Elmen bis Pfafflar
www.tirol.gv.at/verkehr/verkehrsrecht/motorrad-fahrverbot


Ausgangspunkte: Sölden bzw. St. Leonhard im Passeier Streckenlänge: Südrampe 30 km, Nordrampe 12 km | Passhöhe: 2.478 Meter Nordrampe Mautstraße, geöffnet von 7–20 Uhr



Ausgangspunkt: Kematen | Streckenlänge: 18 km Höchster Punkt: 1.700 Meter



Menschen, Verkehr, Umwelt –eine lebenswerte Welt für alle.

SWARCOs durchdachtes Mobilitätsmanagement bietet intelligente, nachhaltige Lösungen für den Verkehr von heute und morgen.
Ganzheitliches Mobilitätsmanagement von
Licht ist Information, Orientierung, Sicherheit. Mit Straßenmarkierungen in Topqualität von SWARCO werden Sie in der Dunkelheit geleitet, als wäre Licht im Asphalt eingebaut.
Auf allen Kontinenten. Mit professionellen Services. Wir wünschen „Gute Fahrt!“ www.swarco.com


In Tirol brennen um die Sommersonnenwende und zum Herz-Jesu-Sonntag die Berge. Feuer werden auf Gipfeln, Graten und in steilen Flanken entzündet. „Weltmeister“ unter den Bergfeuermachern sind alljährlich die Ehrwalder.











18. Juni, Beginn zwischen 21.45 und 22 Uhr
Die besten Plätze, um die Feuer zu sehen:
• Veranstaltungszentrum beim Hallenbad
• Restaurant Golfino
• Loisachbrücke im Moos
Was den Schweden ihr Midsommar, das ist den Tirolerinnen und Tirolern ihr Sonnwendfeuer. Unterschiedliche Vereine steigen am Samstag rund um den 21. Juni – bei Schlechtwetter wird’s auch mal verschoben – dazu auf die Gipfel und entzünden dort hohe Feuer oder zeichnen mit Fackeln Figuren in Schotterkare und Felsrinnen.
Weit patriotischer aufgeladen ist indes das Abbrennen der Herz-Jesu-Feuer am Vorabend des Herz-Jesu-Sonntags, dem dritten Sonntag nach Pfingsten. Als die Napoleonischen Kriege 1796 auch auf Tirol übergriffen, bat der Tiroler Landtag „um den Segen des Himmels für die angeordneten oder noch [zu] unternehmenden Vertheidigungsanstalten“ und schwor, zukünftig jedes Jahr an einem bestimmten Tag das „Heiligste Herz Jesu“ zu verehren. Woraus später eben der Feiertag wurde. Das Abbrennen der Feuer am Vorabend dieses Sonntags geht wohl darauf zurück, dass man zur Alarmierung der wehrfähigen Männer damals auf den Bergen Signalfeuer entzündete. Unter den flammenden Zeichen in den Berghängen findet sich noch heute oft ein Herz mit einem aufgesetzten Kreuz oder die christlichen Zeichen INRI oder IHS.


Weltkulturerbe Bergfeuer.

Inoffizielle „Weltmeister“ der Bergfeuerer zur Sonnwend sind die Ehrwalder, die alljährlich ganze Bildergalerien in die Hänge und Wände des Zugspitzmassivs zaubern. Da wird der Talkessel von Ehrwald, Lermoos und Biberwier wahrlich zur Zugspitzarena, wenn Tausende kommen, um dieses Schauspiel zu erleben. 2010 wurden die Bergfeuer des Gebietes sogar zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. In Ehrwald ist während zweier Jahre auch diese Bildstrecke entstanden. Uwe_Schwinghammer

Nur 10 Min. bis zum Gipfel „Faszination Zugspitze“ Erlebniswelt Schneekristall 4-Länder-Panoramablick Kostenlose Gipfelführungen Kostenloser Audioguide Panorama-Gipfelrestaurant Romantische Fondue-Abende und Sonnenaufgangsfahrten Technik-Schauraum

BAHNORAMA anno 1926
4*S Familien- und Erlebnisresort
5* Campingplatz
Beste Lage am Fuße der Zugspitze Genusserlebnis mit à la carte Stube, Lounge-Areas und Sonnenterrasse Family SPA mit Textilsauna Kinder-Erlebniswelten mit Kino, Kartbahn, Boulderwand, Abenteuerspielplatz u. v. m. Kinder-Wasserwelten mit 5 Erlebnisrutschen, Abenteuerund Babypool


Fahrbetrieb von 8.30–16.30 Uhr, im Juli/Aug./Sept. von 8.00–17.00 Uhr Wander- & Mountainbiketouren verschiedener Längen und Schwierigkeitsgrade Kinderwagentauglicher Wanderweg "DIDIs Almsee-Runde" Bergseen wie der bekannte Seebensee oder der Ehrwalder Almsee Top-Berggastronomie Tirolerhaus Kostenloser Kinderwagen- & Bollerwagenverleih
Top-Berggastronomie auf der Ehrwalder Alm Bedienungsrestaurant Große Sonnenterrasse Café-Lounge Seminarraum Kinderspielraum, frei zugänglich Kinderspielplatz

Rolltreppen zu den WC’s Kinderspielfest am 07.08.2022 Country Sunday am 04.09.2022 Weinfest am 15.10.2022
6632 Ehrwald/Tirol, Obermoos Tel. +43 5673 2309
info@zugspitze.at www.zugspitze.tirol
 EHRWALD ZUGSPITZE
EHRWALD ZUGSPITZE
Einige der seltenen, gefährdeten Nutztierrassen sind waschechte Tiroler. Die Erhaltung dieser Rassen ist gleich in mehrfacher Hinsicht wichtig und lohnenswert. Die Höfe, auf denen diese Tiere heute noch gezüchtet werden, sind vorbildliche Wirtschaftsbetriebe, keine Streichelzoos.

Tirols gefährdete Nutztierrassen haben meist ein sehr gutes Leben bei Landwirten, denen ihr Wohl am Herzen liegt. Ihre Sommer verbringen sie nicht selten auf der Alm, so wie hier im idyllischen Debanttal.

Die kontinuierlich fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft bringt bekanntermaßen jene Turbokühe hervor, die ihrerseits Milchseen erzeugen. Die hochgezüchteten Tiere sind nach wenigen Laktationsperioden „verbraucht“ und „funktionieren“ ohne die Zugabe von Kraftfutter nicht. Ob diese Art der Milchwirtschaft tatsächlich nachhaltig ist, scheint fragwürdig. Sie führt jedoch nicht zuletzt in eine genetische Sackgasse.
Demgegenüber stehen alte und selten gewordene Nutztierrassen. Diese seltenen Rassen – einige davon sind waschechte Tiroler – sind Kulturgut und gleichzeitig Rückhalt und Grundlage für künftige züchterische Forstschritte.
Eine Arche für die seltenen Tiere.
Florian Schipflinger ist Landwirt und Geschäftsführer der ARCHE Austria, eines Vereins, der sich ganz der Erhaltung seltener Nutztierrassen verschrieben hat und 1986 gegründet wurde. Viele der Mitglieder betreiben sogenannte ARCHE-Höfe, die sich als Botschafter in Sachen Arterhaltung verstehen und einer interessierten Öffentlichkeit offenstehen. „Es ist faszinierend, dass in einem kleinen Land wie Österreich – und besonders in Tirol und Salzburg – so viele Rassen
Der Ursprung des Begriffs „Rasse“ im Arabischen „ras“, was so viel wie Gebirgszug oder Geschlecht bedeutet, gibt bereits den Hinweis darauf, dass geografische Isolation bei der Herausbildung von Rassen eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Heute lässt sich der Begriff so definieren: Eine Rasse ist eine Gruppe von Haustieren, die einander aufgrund ihrer gemeinsamen Zuchtgeschichte und ihres Aussehens, aber auch wegen bestimmter physiologischer, das heißt den Stoffwechsel betreffende, und ethologischer bzw. das Verhalten betreffende Merkmale sowie der Leistungen weitgehend gleichen. Mit der ÖNGENE (Österreichische Nationalvereinigung für Genreserven) wurde bereits 1982 ein Verein zum Schutz und zur Bewahrung der Erbanlagen heimischer gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierrassen geschaffen.
ihren Ursprung haben. Diese seltenen Nutztierrassen sind Kulturgut, das uns über Jahrhunderte hindurch begleitet hat, sie sind Teil unserer Geschichte und Identität. Sie sind hervorragend an den Standort, das herrschende Klima und die Topografie angepasst“, erklärt Schipflinger. Zudem hätten diese gefährdeten Tiere durchwegs „eine gute Wesensart, sind sehr umgänglich und langlebig und sehr gute Futterverwerter“. Das bedeutet, die Tiere kommen auch an kargeren Standorten noch sehr gut zurecht, sind genügsam, robust und nicht zwingend auf Kraftfutter angewiesen. Sie können ihre Milchleistung auch dann erbringen, wenn sie nur mit Heu und Gras gefüttert werden.
Dass die Topografie, so wie es im arabischen Ursprung des Rassenbegriffs „ras“ für Gebirgszug angedeutet ist, die Rassen genetisch entscheidend geformt hat, lässt sich anhand der Geländegängigkeit zum Beispiel des Tiroler Grauviehs, der Tux-Zillertaler oder der Pustertaler Sprinzen illustrieren. „Diese Rassen sind durch ihre Klauenqualität und durch ihr Fundament – ihre Füße – einfach besser für die Alpung geeignet als extrem hochgezüchtete Milch- oder Fleischrassen. Sie sind auch um 100 bis 150 Kilogramm leichter“, erklärt Schipflinger.
Die ARCHE-Höfe indes sind keine Streichelzoos, sondern Wirtschaftsbetriebe. Und als solche werden sie auch
„DIESE
UND IDENTITÄT.“
Auch wenn es der Name –Original Pinzgauer – nicht unbedingt nahelegen mag, so handelt es sich doch auch um eine Rasse mit starkem Bezug zu Tirol. „Diese Rinder sind auch in den an den Pinzgau angrenzenden Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Lienz heimisch“, weiß Florian Schipflinger. Besonders in steilem und steinigem Gelände bewährt sich die Pinzgauerin.
Das Tux-Zillertaler Rind ist schwarz (Tuxer) oder rot (Zillertaler) gefärbt mit einer Weißfärbung in der Kreuzgegend. Die Fleischqualität ist ausgezeichnet. Zudem eignen sich die Tiere bestens für die Mutterkuhhaltung.

Das Tiroler Grauvieh ist als Zweinutzungsrasse (Fleisch und Milch) ein richtiger„Urtiroler“. Es hat sich perfekt an die hiesigen Verhältnisse angepasst. Das robuste und leistungsstarke Tier mit seiner genügsamen, geländegängigen und weidetüchtigen Art gilt als „edel und gutmütig“.


Die Pustertaler Sprinzen standen im Ruf, die beste Rinderrasse der k. u. k. Monarchie zu sein. Die Bezeichnung Sprinzen wurde deshalb gewählt, da die Regionen zwischen Weiß- und Rot-, Braunbzw. Schwarzfärbung aussehen, als seien sie mit Farbe bespritzt.
Das Tiroler Steinschaf eignet sich hervorragend für die Lammfleischproduktion und weist eine sehr gute Milchleistung auf. Seine Almtauglichkeit für extreme Hochgebirgszonen zeichnet es aus.


Das Braune Bergschaf ist vorrangig in der Tiroler Bergwelt beheimatet und wurde in der Nachkriegszeit beinahe ausgerottet. Diese Rasse ist an die rauen Haltungsbedingungen im Hochgebirge optimal angepasst, nutzt auch für Rinder unzugängliche Lagen und ist steigund trittsicher.

Die Gämsfärbige Gebirgsziege zählt unter den gefährdeten Rassen zu den leistungsfähigsten und eignet sich sowohl für die intensive Haltung im Stall mit Auslauf als auch für die Weidehaltung.
geführt. „Die ARCHE-Höfe verstehen sich auch als Präsentationsstätten. Man kann dort hinkommen und sich ansehen, wie die seltenen Nutztierrassen gehalten werden, mit der Bauernfamilie reden. Diese Betriebe sind so vielfältig wie die Regionen und Rassen. Es gibt kleine und große Betriebe, mit Direktvermarktung, Hotel, Erlebnisbauernhof, Schule am Bauernhof, Kräuterpädagogik, altes Handwerk und noch einiges mehr“, zählt Schipflinger auf.
Viele der auf den ARCHE-Höfen gehaltenen erhaltungswürdigen Nutztierrassen sind im Sommer auf den Almen Tirols als vierbeinige Landschaftspfleger unterwegs. Die idyllische Kulturlandschaft, für die Tirol weithin bekannt ist, trägt sprichwörtlich den Hufabdruck der Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, die diese erst geformt haben. Almen und Weiden sowie generell Grünland sind außerdem unterschätzte Kohlenstoffsenker. „Rind und Co. leisten in standortangepasster Nutzung mit Beweidung und möglichst wenig Kraftfutter einen positiven Beitrag zum Klimawandel“, weiß Schipflinger.
Zu Gast beim Oberholzer.
Einen dieser ARCHE-Höfe nebst angeschlossenem Landgasthaus führt Alois Steiner vulgo Oberholzer in Feld in Osttirol. Er ist seit rund 20 Jahren Mitglied, weil ihn die Arbeit mit gefährdeten Nutztierrassen schon immer interes-
Anerkannt seltene erhaltungswürdige Nutztierrassen mit Fokus auf Tirol:
Rinder
• Original Pinzgauer bzw. Jochberger Hummeln • Tiroler Grauvieh • Tux-Zillertaler • Pustertaler Sprinzen
Schafe • Braunes Bergschaf • Tiroler Steinschaf
Ziegen • Gämsfärbige Gebirgsziege • Blobe Ziege • Tauernschecken
Pferde • Österreichische Noriker
Die Blobe Ziege bzw. Blobe Goas bzw. – wie das Exemplar im Bild – der Blobe Goasbock ist eine kräftig gebaute, stämmige Gebirgsziege. Sie gilt als der Steinbock unter den Ziegen und ist die Nutztierrasse des Jahres 2022.


siert hat. „Ich führe meinen Hof mit alten Rassen und nach althergebrachten Gebräuchen, ohne dabei ewiggestrig zu sein oder gar ein Museum zu führen“, sagt Steiner, ein gestandenes Mannsbild mit kräftigen Händen.
Mit der über lange Jahre dominanten agrarpolitischen Wachstumsideologie „Wachsen oder Weichen“ kann der Osttiroler nichts anfangen. „Das hatten wir früher hier am Hof. Mein Vater war ein Spezialist für sogenannte Turbokühe, das war damals aber eine Zeiterscheinung“, erinnert sich der Bauer, der sich bei der Hofübernahme schon für Direktvermarktung und stärkere Nachhaltigkeit interessiert hat. Eine Strategie, die aufgegangen ist. „Anfangs sind wir deshalb noch belächelt, teils auch angefeindet worden“, erinnert sich der Steiner, der heute mit seinem Hof gerne als Vorzeigebauer herumgereicht wird.
Ein wenig ist es auch ein „Zurück zu den Wurzeln“, das Steiner mit seinem
© ARCHE AUSTRIA / STRUBREITER © ARCHE AUSTRIAAn den liebevoll restaurierten ARCHE-Hof in Feld in Osttirol ist ein Landgasthof angeschlossen. Dort wird serviert, was am Hof produziert wird.

Hof praktiziert. Er pflanzt unter anderem Korn – konkret Dinkel und Roggen – und baut Kartoffeln an, das Fleisch stammt von den hofeigenen Tieren. Alles, was der Hof produziert, wird im Gasthaus verwertet. Steiner betreibt eine eigene Schlachthalle und mahlt auch sein Korn selbst am Hof. Die Felder werden ausschließlich mit dem Mist der Tiere gedüngt, gepflügt wird mit Pferden und das Holz für die Hackschnitzelheizung wird ebenfalls mittels weniger Pferdestärken zum Hof gebracht. Im Schnitt stehen bei Alois Steiner zwischen zwei und sechs Pferde im Stall, die er selbst züchtet. Es handelt sich dabei ausschließlich um Noriker und Nonius, eine alte österreichisch-ungarische Rasse. „Der Noriker ist das prädestinierte Arbeitspferd, der Nonius – eigentlich ein Kavalleriepferd – eignet sich auch gut für die Landwirtschaft. Das sind gute und gutmütige Arbeitstiere“, sagt Steiner. Neben den Pferdekoppeln sind die Rinder eingestellt. Pustertaler Sprinzen, eine ebenso schöne wie gefährdete Rasse. „Da ist der Stier, da sind die Kälber“, deutet Steiner auf gewisse Bereiche im Stall, „gefüttert wird mit dem Futter, das wir


• Neuwirt, Karl Mair, Ellbögen
• Nockerhof, Franz Reinhart, Zirl
• Beim Stoaner, Sebastian Eder, Flaurling
• Finkenanderlas, Franz Josef Auer, Umhausen
• Hånnesen, Gotthard Gstrein, Sölden

• Stoagraue, Solveig und Manuel Thurnes, Serfaus
• Tonzseppa, Markus Juen, Kappl
• Waldesruh, Christian Wagner, Tannheim
• Badererhof, Christine und Georg Wechselberger, Stumm
• Sonnleitnhof, Veronika und Jakob Hölzl, Auffach
• Leiten, Josef Gomig, Gaimberg
• Oberholzer, Alois Steiner, Huben in Osttirol
„DA
selbst produzieren, und abgesehen von Kleien von unserem eigenen Korn ganz ohne Kraftfutter.“ Den alten Zuchtstier hat Steiner erst vor kurzem geschlachtet. Stolze 1.100 Kilogramm habe der auf die Waage gebracht.


Fast naturgemäss werden die Kühe beim Oberholzer auch gealpt, kommen zuerst im Mai auf eine Hochweide und dann von Juni bis Oktober auf die Schildalm im Tauerntal. „Die Freilaufzeit unserer Rinder ist von Mai bis November“, sagt Steiner. An frischer Luft, klarem Wasser und saftigen Gräsern herrscht folglich kein Mangel. Naturgemäß macht sich das auch in
einer hervorragenden Fleischqualität bemerkbar. „Da muss ich gar nicht groß ‚Bio‘ draufschreiben, weil jeder, der zu uns kommt, genau sieht, wie es bei uns läuft“, meint der Bauer. Im Herbst sollen zu den Sprinzen einige schwarze Pinzgauer und Murbodner dazukommen, allesamt Tiere gefährdeter Rassen. „Die Sprinzen sind ideale Mutterkühe, die ihre Kälber locker selbst weiterbringen“, weiß Steiner.
Das alte, 1680 gebaute Haus hat er in liebevoller Handarbeit nach althergebrachten Methoden restauriert und im Dachgeschoß einen Seminarraum eingerichtet. Unten befindet sich eine Backstube, in der regelmäßig aus dem am Hof erzeugten Mehl Brot gebacken wird. Im oberen Stock des Hauses, das zwischen 1796 und 1832 auch als eine der ersten Schulen im Iseltal genutzt wurde, wird Steiner bald selbst einziehen. Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis eines konsequent auf Nachhaltigkeit angelegten bäuerlichen Lebens und Wirtschaftens, im Einklang mit der Natur und deren Kreisläufen. Das Bewusstsein, dass es sich bei den alten Nutztierrassen um einen kulturellen wie genetischen Schatz handelt, nimmt allmählich zu. Landwirte wie Alois Steiner tragen dazu bei, es zu schärfen.
Der Noriker ist ein mittelschweres, breites, tiefes Gebirgskaltblutpferd, das sich durch Trittsicherheit und gutes Temperament auszeichnet. Entstanden ist die Rasse als Arbeitspferd zum Tragen und Ziehen schwerer Lasten, vorwiegend im Gebirge.
Marian_KröllAlles, was Sie dafür brauchen, ist eine Flasche Herr Friedrich Gin. Oder gleich alle drei. Die pure, die Black und die Blue Edition. Ausreichend Gläser. Und ein gespanntes Publikum. Weisen Sie auf die noble Blässe der Black Edition hin und nutzen Sie die atemlose Stille für ein energisches Schwenken. Und schon überzeugt sie mit sattem Schwarz im Glas. Mit der Blue Edition füllen Sie die Gläser Ihrer Zauberlehrlinge und lassen sie mit Tonic und Zitrone experimentieren. Ein Farbenspiel von Lila bis Purpur! Mit einem Schlag sind Sie Talk of Tirol. Wer weniger Wirbel im Glas braucht, trinkt Herr Friedrich Gin eben pur.

Tirols Wirtinnen und Wirte stehen für freiwillige Herkunftskennzeichnung. Ein Schulterschluss zwischen Tiroler Wirtschaft und Landwirtschaft. www.dakommtsher.at

Some of the rare, endangered livestock breeds are genuine Tyrolean. Preserving these breeds is important and worthwhile in several respects.

Florian Schipflinger is a farmer and managing director of ARCHE Austria, an association dedicated entirely to the preservation of rare livestock breeds. Many of the members operate so-called ARCHE farms, which also see themselves as ambassadors in matters of species conservation and are open to an interested public. “It is fascinating that in a small country like Austria - and especially in Tyrol and Salzburg - so many breeds have their origins. These rare livestock breeds are cultural assets that have accompanied us for centuries, they are part of our history and identity. They are excellently adapted to the location, the prevailing climate and the topography,” explains Schipflinger. There are a total of eleven ARCHE farms in Tyrol, which are home to cattle breeds such as Tyrolean Grey cattle, Tux-Zillertaler or Pustertaler Sprinzen, the brown or Tyrolean mountain sheep, the Chamois coloured mountain goat or Noriker horses, among others.
The continuously progressing industrialization of agriculture is known to produce those turbo cows which in turn produce milk in masses. The highly bred animals are “used up” after a few lactation periods and do not “function” without the addition of concentrated feed. Whether this type of dairy farming is actually sustainable seems questionable. However, it leads not least to a genetic dead end. In contrast, there are old and rare breeds of livestock. These rare livestock breeds - some of which are genuine Tyrolean - are cultural assets and at the same time the backbone and basis for future breeding forestry steps.
The Arche farms also see themselves as presentation sites. You can visit them and see how the rare breeds of farm animals are kept, and talk to the farmer’s family. These farms are as diverse as the regions and the breeds. There are small and large farms, with direct marketing, hotel, adventure farm, school on the farm, herbal education or old crafts. Many of the sustainable livestock breeds kept on the ARCHE farms spend their summers on the alpine pastures of Tyrol as four-legged landscape keepers. The idyllic cultural landscape, for which Tyrol is widely known, literally bears the hoofprint of the cattle, sheep, goats and horses that formed it in the first place. And because the animals are allowed to grow up so close to nature, their milk and meat quality is outstanding. This means that quality and sustainability go hand in hand, regional economic cycles are strengthened and the consumer receives a product that is as honest as it is first-class.


Neuwirt, Ellbögen Nockerhof, Zirl Beim Stoaner, Flaurling Finkenanderlas, Umhausen Hånnesen, Sölden Stoagraue, Serfaus Tonzseppa, Kappl Waldesruh, Tannheim Badererhof, Stumm Sonnleitnhof, Auffach Leiten, Gaimberg Oberholzer, Huben in Osttirol
Wo man sich die erhaltenswerten Viecher in Tirol in ihrer natürlichen Umgebung ansehen kann.

Karl Mair
Niederstraße 119 6082 Ellbögen 0512/37 71 75 info@gasthofneuwirt.at
Franz Reinhart Russhütte 2 6170 Zirl 0664/32 02 600 reinhart@klimatherm.at Beim Stoaner
Sebastian Eder Mitteldorf 10 6403 Flaurling 0699/17 12 75 80 info@raresheep.at
Franz Josef Auer Sandgasse 50 6441 Umhausen 0664/8244398 auer.franz.josef@gmail.com
Solveig und Manuel Thurnes Dorfbahnstraße 53 6534 Serfaus 0676/84 62 36 553 genuss@stoagraue.at
Markus Juen Perpat 650 6555 Kappl 0664/75 05 53 70 markusjuen650@gmail.com
Gotthard Gstrein Unterwaldstraße 4 6450 Sölden 0664/38 16 899 gotthard.gstrein@soelden.at
Christian Wagner Untergschwend 1 6675 Tannheim 0676/54 27 866 bauernhofwaldesruh@tirol.com
Christine und Georg Wechselberger Dorfstraße 35 6275 Stumm 0676/91 92 870 georgwechselberger@aon.at
Veronika und Jakob Hölzl Prädastenweg 298 6313 Auffach 0664/13 60 610 archehof@gmx.at
Josef Gomig Postleite 20 9905 Gaimberg 0676/71 69 108 berni81@gmx.net
Alois Steiner Feld 10 9971 Huben in Osttirol 0650/45 29 165 landgasthof.steiner@aon.at

In Österreich landet jedes fünfte Stück Brot in der Tonne. Dieser Entwicklung will die Bäckerei Therese Mölk als Produktionsbetrieb der Firma MPREIS in Völs entgegenwirken, indem sie Brot von gestern zu hochwertigen Spirituosen veredelt.
m Jahr 2019 errichtete die Familie Mölk ihre hauseigene Brennerei, in der Ausschussware nachhaltig verwertet und zu hochwertigem Alkohol gebrannt wird. Aus 100 Kilogramm Brot von gestern können etwa 12,5 Liter hochprozentiger Alkohol gebrannt werden. Das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch den Gaumen.
Am Anfang stand eine clevere Idee.
Friedrich und Mathias Mölk, der ehemalige und aktuelle Leiter der Bäckerei Therese Mölk, dachten: Unser Brot von gestern wäre doch eine ausgezeichnete Basis, um einen Gin nach Tiroler Art zu brennen. Gedacht, getan. Herr Friedrich scheute keine Mühen und keinen Vergleich, um seinen „Tyrolean Gin“ zu genüsslicher Perfektion zu führen. Mit Erfolg, denn der regionale und nachhaltige „Herr Friedrich“ erfreut sich großer Beliebtheit. Die Tiroler Variante des Trendgetränks – auf Basis von Brot – wurde 2021 von Falstaff mit 90 Punkten zu den besten Gins Österreichs gewählt. Vor Kurzem wurde das Sortiment um zwei Special Editions erweitert: die Herr Friedrich Blue Edition und die Herr Friedrich Black Edition.
„Herr Friedrich“ Gin Black Edition mit Schneekugeleffekt: Durch einmaliges Schütteln verwandelt sich der klare Gin in ein sattes Schwarz.



Gemeinsam mit Schnapsbrenner Toni Rossetti wird das nachhaltige Spirituosensortiment laufend erweitert. Unter den ausgezeichneten Bränden und Likören befindet sich unter anderem der außergewöhnlich anmutende Herr Friedrich Vinschgerl Brand, der ausschließlich aus würzigen Vinschgerln der Bäckerei Therese Mölk gebrannt wird – schmeckt ausgezeichnet in Kombination mit einer knusprigen Scheibe Schwarzbrot, Tiroler Bergkäse und Speck. Der Vinschgerl Brand ist ein ganz besonderes Produkt, das in dieser Form am Markt sonst nicht zu finden ist, und daher das perfekte Mitbringsel aus dem Tirol-Urlaub.
Wer es lieber süßer mag, greift zum Herr Friedrich Walnuss Likör, Herr Friedrich Zirben Likör oder zum Herr Friedrich Eierlikör, gebrannt aus nachhaltigem Alkohol aus Brot von gestern, verfeinert mit österreichischen Freilandeiern und Schlagobers.

Der neue blaue „Herr Friedrich“ ist ein echter Verwandlungskünstler: Durch die Zugabe von Tonic oder Zitrone färbt sich das Trendgetränk lila.
Erhältlich sind die Spirituosen in den Regalen von MPREIS und T&G sowie im MPREIS Online Shop. Weitere Informationen zu den Spirituosen aus Brot von gestern finden Sie unter www.therese-moelk.at

Auf der Länd in Scharnitz wurden die Stämme zu Flößen zusammengebunden und auf der Isar auf die Reise geschickt. Bei Mittenwald wurden diese außerdem mit Waren aller Art beladen.
Bevor es Traktoren und Lkw gab, war Jahrhunderte die Trift die einzige Möglichkeit, Holz aus entlegenen Landstrichen Tirols zu bringen. Ein mühevolles und gefährliches Unterfangen, dessen Spuren noch heute sichtbar sind.
Hunderte von Baumstämmen schießen mit großer Geschwindigkeit auf dem Wasser durch die enge Kaiserklamm. Verklemmt sich das Holz, müssen Arbeiter ins Wasser steigen und mit langen Stangen mit einer eisernen Spitze und Haken die Verklausung lösen. Ist das „Knäuel“ zu groß, wird ab und zu mit einer Sprengung nachgeholfen. Tagelang stehen die Männer im eiskalten Wasser, leben in der Angst, von einem Stamm erdrückt zu werden, und werden krank von den Arbeitsbedingungen.
Jahrhundertelang war die Trift das einzige Mittel, um Holz aus manchen Tälern zu holen, denn es gab weder die geeigneten Straßen noch Transportmittel. In Tirol gab es mehrere solche Gebiete, das wohl bekannteste davon ist Brandenberg. Auf einer Strecke von 30 Kilometern wurden Baumstämme von der tirolisch-bayerischen Grenze bei der Erzherzog-Johann-Klause bis nach Kramsach getriftet. Dabei waren die Kaiser- und die Tiefenbachklamm zu überwinden.

Die sogenannte Amtssäge (oben) und die Hinterödalm um 1930 (unten)
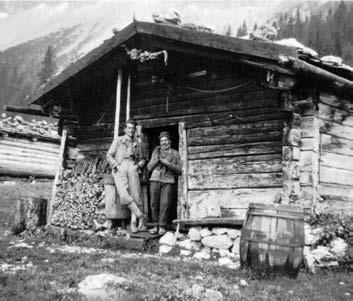
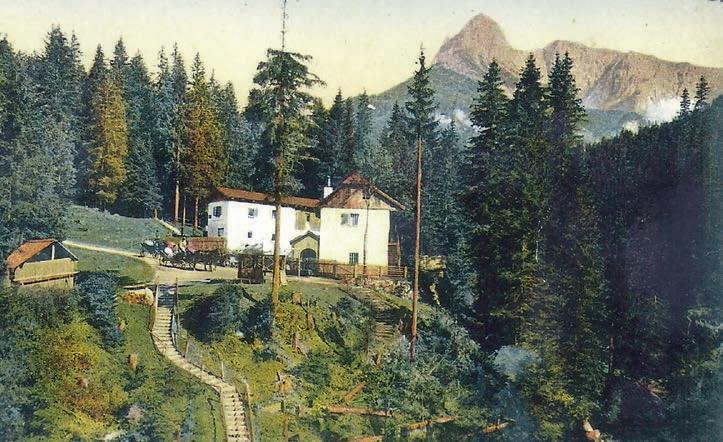
Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Trift in Kramsach 1412. Landesfürst Herzog Stephan von Bayern –dieser Teil des Unterinntals war damals noch nicht bei Tirol – verlieh in einem Schriftstück „Fritz dem Schmied zu Voldöpp“ das Recht, einen Rechen in die Fuldeppe, wie man damals die Brandenberger Ache nannte, zu bauen. Mit einem solchen Rechen konnte Holz im Wasser aufgehalten und herausgeholt werden. Der Grund für die Genehmigung dieser Art der Holzbringung dürfte wohl darin gelegen haben, dass zu dieser Zeit südlich des Inns zwischen Zillertal und Brixental mit dem Schürfen von Silber und Kupfer begonnen wurde. Dazu brauchte man große Menge an Holzkohle, die aus den Wäldern gewonnen werden musste. Ein derart waldreiches Gebiet wie das Rofan und Brandenberg waren willkommene Lieferanten.
Ursprünglich ließ man wohl einzelne Baumstämme einfach die Ache hinaus nach Kramsach schwimmen. Für große Holzmengen war dieses Verfahren jedoch nicht geeignet. Man musste das Gewässer an geeigneten Stellen aufstauen, so genannte Klausen bauen. Waren die Stauseen voll, ließ man das Wasser ab, und es schwemmte die angesammelten Stämme mit großer Wucht bis zum Rechen. 1555 wurde die Kaiserklause in Valepp in Bayern erstmals urkundlich erwähnt, errichtet wurde sie vielleicht schon einige Zeit früher. In dieser Zeit überließen das Kloster Tegernsee und einige andere bayrische Waldeigentümer ihre zwischen dem Spitzingsee und der Staatsgrenze gelegenen Wälder gegen geringes Entgelt den kaiserlichen Hüttenwerken im Inntal.

Eine ausgeklügelte Technik.
Im 18. Jahrhundert wurde am Seitenbach der Brandenberger Ache, der Steinberger Ache, eine Klause errichtet, im Jahr 1833 wurde schließlich die
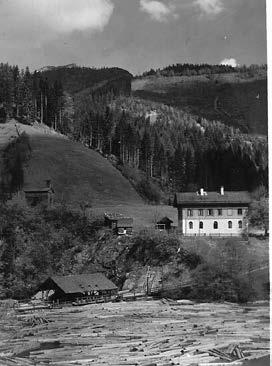






















Werl, ein damals junger Forstwirt, erhielt den Auftrag, auf Holzbringung mit Kraftfahrzeugen umzustellen. Denn ein großer Nachteil der Trift war: Große Teile des Holzes wurden auf dem Weg durch die Schluchten beschädigt. Triftholz war daher um zehn Prozent billiger als anderes Holz.
Die Arbeit war nach wie vor gefährlich – vor allem, die großen Stapel mit Holzstämmen, die man auf steilen Hängen im Winter aufgeschlichtet hatte, ins Wasser rollen zu lassen. Rasch geriet da ein Körperteil oder der ganze Mann unter die Stämme, die unkontrolliert ins Wasser fielen. „Die einzutriftende Holzmenge war leider nicht kontrollierbar“, erzählt Werl. 1966 wurde die Holztrift eingestellt, Werl hatte stattdessen 170 Kilometer Forstwege bauen lassen. Mit dem Ende der Trift verloren allerdings auch 90 Menschen ihre Arbeit.
Was Brandenberg für den Bergbau im Unterland war, waren das Karwendel und das Gaistal für die Salzgewinnung in Hall: unverzichtbare Holzlieferanten. Ein guter Teil der gefällten Bäume fand auch den Weg über die Isar ins Bayerische. Die leopoldinische Waldordnung aus dem 16. Jahrhundert berichtet von der Ausübung der Trift auf der Isar und aus dem Gleirschtal, um 1600 findet die Amtssäge im Gleirschtal eine erste Erwähnung. Wie im Brandenbergischen

Hinterautalstraße 555a, 6108 Scharnitz Tel.: 050880-540
Eintritt kostenlos, es muss vorher aber im Naturparkhaus ein Ticket gelöst werden.
Angerberg 10, 6233 Kramsach Tel.: 05337/62636 www.museum-tb.at

In der Holzerhütte finden Sie eine Installation zum Thema Trift in Brandenberg.
wurde das Holz hauptsächlich im Winter geschlägert und auf Schlitten zum Gleirschbach gebracht. Ab dem Frühjahr begann die Trift. Bei der sogenannten „Klausn“ wurde das Wasser aufgestaut und schließlich das Klausentor mit einem wuchtigen Schlag geöffnet. Die Bloche schossen durch die enge Gleirschklamm bis zur Länd. Auch aus dem Karwendeltal wurde getriftet, allerdings baute man dort keine künstlichen Stauseen, sondern brachte das Holz im Frühsommer während der Schneeschmelze auf den Weg. Ein besonders gefürchtetes Hindernis stellte die nur bis zu vier Meter breite Karwendelklamm dar. Dort legte man einen schmalen und gefährlichen Steig an, um das Holz unter großen Mühen einrichten – also in Fließrichtung bringen – zu können.
Auf der Länd in Scharnitz wurden die Stämme zu Flößen zusammengebunden und auf der Isar auf die Reise geschickt. Bei Mittenwald wurden diese außerdem mit Waren aller Art beladen. Somit galt das Wasser als schnellstes, effektivstes und obendrein billigstes Transportmittel zu dieser Zeit. Ihre Blütezeit erreichte die Isarflößerei zwischen 1860 und 1870. So passierten etwa im Rechnungsjahr 1864/65 über 10.000 Flöße München. Die Isar profitierte sehr davon, dass sie ganzjährig flößbar und die Strecke von Scharnitz bis zur Donaumündung in flotten 35 Stunden
zu bewältigen war. Mit der zunehmenden Bedeutung der Eisenbahn wurde die Flößerei am Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich eingestellt, die Holztrift aus dem Karwendel mit dem Bau von Forststraßen erst rund 50 Jahre später.
Eine ganz besondere Art der Trift indes gab es aus dem Gaistal in der Leutasch. Von einer Klause bei der Tillfußalm wurde zwischen 1690 und 1738 eine hölzerne Rinne – die sogenannte Hirnrinne – bis zum Inn bei Telfs gebaut. Auf ihr wurden Sommer für Sommer an die 160.000 Kubikmeter Holz getriftet. 200 bis 300 Holzknechte waren in der Leutasch und entlang der Rinne beschäftigt. 1815
Oft verkeilten sich Stämme und mussten wieder freigemacht werden.
ereignete sich allerdings eine Katastrophe. Oberschulrat Matthias Reindl schrieb damals nieder: „Am 30. Juni 1815 zerbrach im Gaistal die von Hirn erbaute Klause und die ungeheuer geschwellten Wasser und Holzmengen, auf einmal losstürzend, alles mit sich fortrissen und so in den ebenen Gefilden der bewohnten Leutasch viele tausend Gulden Schaden verursachten, ja sogar die Hauptursache waren, dass eben dortmals die zwei großen und festen Brücken der Isar bei Mittenwald und selbst jene bei der Stadt München ruiniert wurden.“ Ob der Ortschronist dabei nicht ein wenig übertrieb? Wie auch immer: Die Rinne aus dem Gaistal wurde nicht wieder repariert.
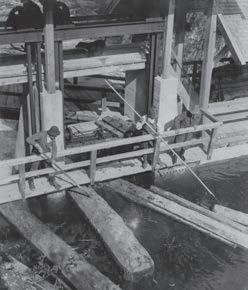 Uwe_Schwinghammer
Uwe_Schwinghammer
Entdecke, wie Land und Leute unsere Bierspezialitäten prägen und erfahre dabei so manches Zillertaler Geheimnis.
Discover how the region and its people form our beer specialties and learn about some of the Zillertals secrets.



For centuries, before the advent of tractors and trucks, the only way to bring wood from remote parts of the Tyrol was by means of the ‘Trift’. A difficult and dangerous undertaking, the traces of which are still visible today.
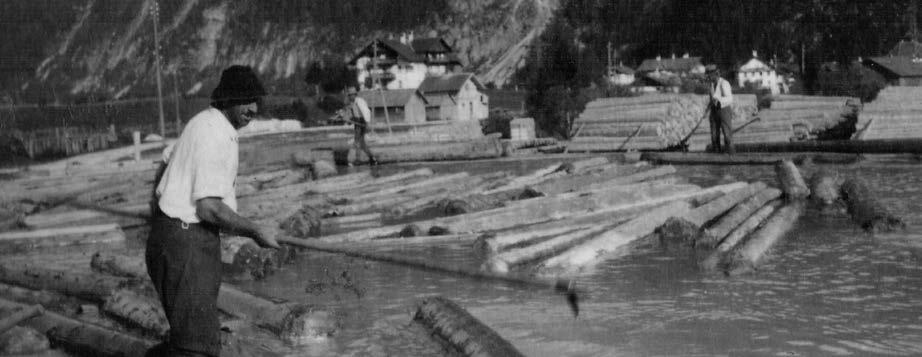
For centuries, the ‘Trift’ - transport on water - was the only means of fetching wood from some valleys. There were several such areas in Tyrol, probably the best known of which is Brandenberg. Logs travelled 30 kilometres from the Tyrolean-Bavarian border at the Erzherzog-Johann-Klause to Kramsach – and were primarily used for mining in the region. The first documented mention of the ‘Trift’ in Kramsach was in 1412, but this method was not suitable for large quantities of timber. The water had to be dammed at a suitable point and, when the reservoirs were full, the water was let out and the force of the water washed the accumulated logs downstream. It was not until 1920 that the first enclosures were given gates with which the water surge could be regulated. The 1960s finally saw the last moments of this method of timber transport. Franz Werl, a young forester at the time, was given the task of switching to hauling wood with motor vehicles. In 1966, the ‘Trift’ was discontinued and Werl
had 170 kilometres of forest roads built instead. What Brandenberg was for mining in the Unterland, the Karwendel and the Gaistal were for salt production in Hall: indispensable timber suppliers. A good part of the felled trees found their way to Bavaria via the Isar. Timber was also sent by water from the Karwendel valley, although no artificial reservoirs were built there; instead, the wood was brought to the valley in early summer during the snowmelt.
At the Länd in Scharnitz, however, the logs were tied together into rafts and floated on their journey down the Isar. At Mittenwald, they were also loaded with goods of all kinds. Water was considered the fastest, most effective and cheapest means of transport at that time. The rafting stopped at the beginning of the 20th century with the increasing importance of the railways, and the timber ‘Trift’ from the Karwendel was discontinued around 50 years later with the construction of forestry roads.

Aus vielen Tiroler Tälern wurde Holz über das Wasser Richtung Inn oder Isar gebracht. Nicht alle Bäche sind spektakulär oder gut zugänglich, einige jedoch schon. Vier Wanderungen aus triftigem Grund.

Gehzeit: hin und zurück ca. 2 Stunden | Höhen: Parkplatz 560 m – höchster Punkt 700 m Einkehrmöglichkeit: Gasthaus Kundler Klamm | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Durch die Kundler Klamm führt eine breite, fast ebene Schotterstraße, die einst sogar mit Autos befahren wurde. Das macht sie auch für Eltern mit Kinderwägen oder Menschen mit Gehproblemen erreich- und begehbar. Der großartigen Geologie mit den Felstürmen, die sich links und rechts des Wassers auftürmen, tut das keinen Abbruch. Immer wieder laden Bänke zum Rasten ein, hölzerne Fabelwesen säumen den Weg. Und nicht zuletzt befindet sich nur 15 Minuten vom Schluchteingang mit dem gleichnamigen Gasthaus ein Haubenlokal.
Gehzeit: hin und retour ca. 3 Stunden Höhen: Parkplatz Tiefenbachklamm 580 m – höchster Punkt 675 m Einkehrmöglichkeit: Jausenstation Tiefenbachklamm | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober
Die Tiefenbachklamm ist die zweite Schluchtstrecke, die die Brandenberger Ache durchfließt. Sie steht meist im Schatten der Kaiserklamm, dabei ist sie noch spektakulärer und vor allem etwas länger. Die Wanderung beginnt ein Stück hinter dem ehemaligen Sonnwendjochlift bei Kramsach. Der Steig ist gut gesichert, die Stege und Brücken sind modern und als Höhepunkt gibt es eine Aussichtsplattform, die einen tief in die Schlucht blicken und staunen lässt. Der Rückweg erfolgt auf derselben Strecke.



Gehzeit: vom Parkplatz Naturparkzentrum ca. 3 bis 3,5 Stunden, vom Bahnhof eine Stunde länger Höhen: Parkplatz ca. 960 m – höchster Punkt ca. 1.060 m
Einkehrmöglichkeiten: Scharnitz Alm, Café Länd, weitere Gastronomie in Scharnitz
Beste Jahreszeit: Juni bis September oder Oktober
Die Gleirschklamm ist eine sehr naturbelassene Schlucht, eine Tour durch die Klamm ist daher besonders spektakulär. Oft ist man verdammt nahe am gurgelnden, tosenden und schäumenden Wasser. Trittsicherheit ist erforderlich, ein Ausrutscher wäre wohl fatal. Als Wanderung mit kleineren Kindern ist sie daher nicht zu empfehlen, obwohl sie weder besonders lang noch steil ist. Mit etwas Auf und Ab sind an die 300 bis 400 Höhenmeter zu bewältigen. Der Rückweg führt entweder ein zweites Mal durch die Gleirschklamm oder über den breiten Schotterweg nach Scharnitz.

Gehzeit: durch die eigentliche Klamm hin und zurück ca. 1 Stunde Höhen: Parkplatz Kaiserhaus 710 m – höchster Punkt ca. 770 m Einkehrmöglichkeit: Kaiserhaus | Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Die Kaiserklamm in Brandenberg verdankt den tollen Steig, der sie erschließt, angeblich Kaiser Franz Joseph I. Der jagte gerne in dieser Gegend und wollte aus relativer Sicherheit die Urmacht des Wassers in der Schlucht und die Trift beobachten. So kommt man heute in den Genuss eines Steiges mit Stegen und Tunnel, der einen in etwa einer halben Stunde durch das spektakulärste Stück der Kaiserklamm führt. Kleine Kinder sollte man vorsichtshalber an ein kurzes Seil nehmen. An heißen Sommertagen ist auch ein Bad in einem der Gumpen am Schluchtende zu empfehlen.

Der Bergahorn ist der knorrige und starke Superheld in der Engalm. Sein Beschützerinstinkt funktioniert zu jeder Jahreszeit. Der Große und der Kleine Ahornboden in der Eng zählen zu den wohl schönsten Plätzen des Karwendels. fotos: isabelle bacher
 Rainer Haak
Rainer Haak

„WER SICH IM SOMMER ÜBER DIE SONNE FREUT, TRÄGT SIE IM WINTER IN SEINEM HERZEN.“



„IN


„DASJean Paul
Die Eng ist ein Ortsteil der Tiroler Gemeinde Vomp, was immer wieder betont werden muss, weil dieses Stück Tirol vom Inntal aus zwar zu Fuß über die Berge, aber autofahrend nur über bayerische Straßen erreicht werden kann. Alle Wege lohnen sich, denn es ist ein richtig schönes Stück Tirol, in dessen Mittelpunkt der Ahorn steht, der Bergahorn, um genau zu sein.

Dass um die 2.000 Prachtexemplare des Bergahorns, den die Natur für diese raue Umgebung geschnitzt zu haben scheint, am Ahornboden in der Eng bewundert werden können, hat ganz besondere Gründe. Das Wurzelwerk dieser Widerstandskämpfer, das den schottrigen Boden optimal nutzen kann, ist einer davon. Der Enger Grundbach hat in mühsamer Fließarbeit die Talsohle, die der so genannte „eiszeitliche Hobel“ im Laufe der letzten Eiszeit gehobelt hatte, mit richtig viel Schotter aufgefüllt. Wo es für Tannen oder Fichten schwer bis unmöglich ist, zu überleben oder unter dem Einfluss von Schneemassen, Steinschlägen oder Muren Haltung zu bewahren, fühlt sich der Bergahorn pudelwohl.
Die berühmten Rindviecher der Eng tun das auch, nur im Sommer versteht sich, aber schon ziemlich lange. Unterbrochen wurde diese Almsommer-Tradition lediglich zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648). Diese dreißig Jahre waren aber entscheidend für die Entstehung des Ahornbodens. Damals wurde er gewissermaßen geboren, weil die frischen, zarten Bäumchen nicht von den Kühen gefressen wurden. Die Babyahorne konnten in dieser kriegerischen Zeit ungestört wachsen. Als die Kühe dann wiederkamen, waren sie schon zu groß, um zu Tode geknabbert zu werden.
Das Klösterle unterhalb der Kronburg bei Zams vermittelt das Gefühl einer echten Pilgerherberge. Da kann man sich schon an den Jakobsweg in Frankreich und Spanien gewöhnen.
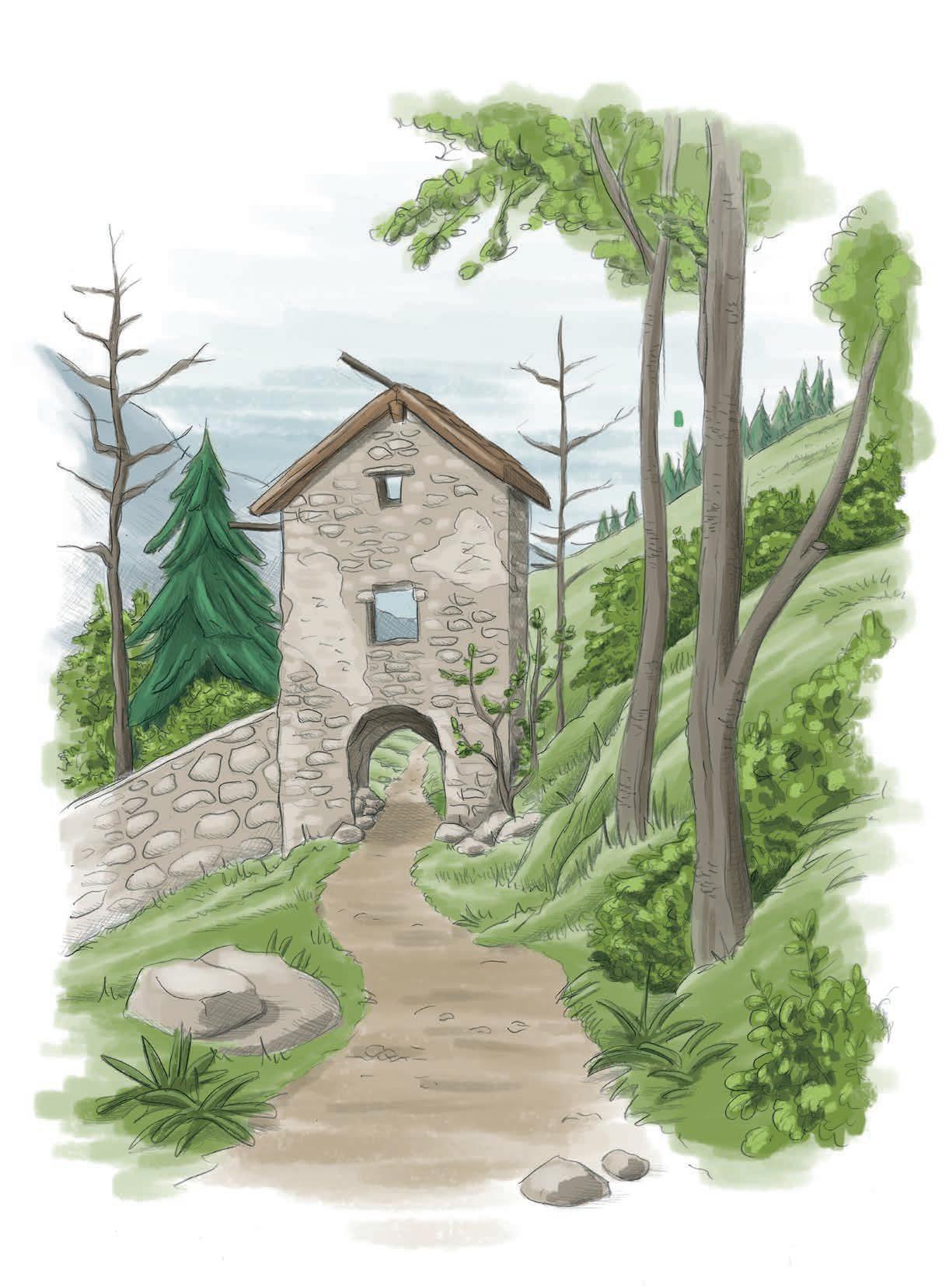
Um beim Wandern Raum und Zeit zu verlieren, muss man nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Auch in Tirol kann man dem Zeichen der Pilgermuschel folgen und eine Reise zu sich selbst machen. Auf den Spuren der Heiligen Jakob und Romedius geht es über Stock und Stein.
Illustrationen: illugra

Auf dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf eins: auf mich“, sagt der deutsche Entertainer Harpe Kerkeling über das Pilgern auf dem Jakobsweg in seinem Bestseller „Ich bin dann mal weg“ aus dem Jahr 2006. Tausende und Abertausende sind ihm seither auf der Suche nach sich selbst, nach Ruhe, nach Frieden, nach einem neuen Leben gefolgt. Hatte das Pilgern einst einen rein religiösen Hintergrund, so ist es heute für sehr viele Menschen eine Reise in ihre Vergangenheit, zuweilen auch die Zukunft. Beginnen kann diese Reise heute, morgen, in Frankreich, Spanien oder in Tirol. Enden kann sie nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten in Rom, Jerusalem, in Santiago oder San Romedio.
Einmal quer durch Tirol.
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Setzen wir diesen auf dem Pilgerweg aller Pilgerwege, dem Jakobsweg, an der Grenze Tirols in Lofer. In elf oder mehr Etappen wird er uns von Ost nach West führen, bis ans andere Landesende und gleichzeitig an den höchsten Punkt des Jakobsweges überhaupt, den Arlbergpass. Die Hauptroute verläuft vorrangig im Inntal abseits des Verkehrs und Trubels. Möglich, dass man dabei andere Wanderer trifft, Pilger werden es in unseren Graden eher selten sein. Die Dichte steigt jedoch rapide, je näher man dem Ziel Santiago de Compostela in Nordspanien kommt.
Einer, der in Tirol über das Pilgern so viel weiß wie wohl kaum jemand anderer, ist Werner Kräutler. Er ist im Jahr 2000 das erste Mal in Richtung Santiago aufgebrochen. Den Jakobsweg in Tirol kennt er genau, einen Teil davon kontrolliert er selbst sogar regelmäßig. Kräutler: „Der Tiroler Teil des Jakobsweges hat Etappen, wo man nur so staunt. Ich nehme das Wort atemberaubend selten in den Mund, aber da stimmt es.“ Der Pilgerspezialist empfiehlt, die „pragmatische Linie“ des Routenverlaufes links und rechts ein wenig mit speziellen Orten zu „garnieren“. Zum Beispiel mit einem Abstecher zum Jakobskreuz im Pillerseetal, nach Maria Brettfall am Eingang des Zillertales oder nach Locherboden oberhalb von Mötz. Das kostet Zeit, Höhenmeter und Kraft, doch zumindest Erstgenannte sollte beim Pilgern ohnedies keine Rolle spielen, rät Kräutler: „Man stellt sich erst nach ungefähr fünf Tagen um, ist aus dem normalen Leben heraußen. Der größte
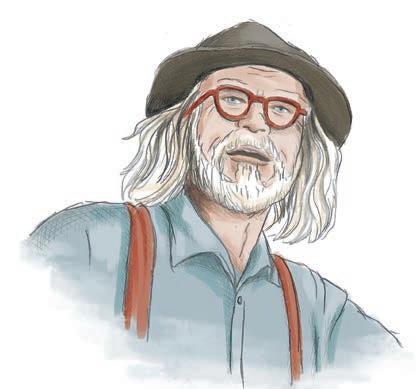
Jakob ist einer der Apostel Christi und soll um 44 n. Chr. getötet worden sein. Der Legende nach übergaben seine Jünger den Leichnam des Apostels nach der Enthauptung einem Schiff ohne Besatzung, das später im spanischen Galicien strandete, wo der Tote im Landesinneren auf einem Hügel begraben wurde. Nach der „Wiederentdeckung“ des Grabes wurde ebenda im 9. Jahrhundert eine erste Kapelle errichtet, später entstand Santiago de Compostela als bedeutende Pilgerstätte. Historisch belegt ist die Geschichte nicht. Schon Reformator Martin Luther spottete, es wisse niemand, ob dort nicht ein Hund oder totes Pferd begraben sei.
Fehler ist, zu sagen: Ich muss zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Denn das ist kein Sport, hat damit absolut nichts zu tun.“
Wandern mit egalitärer Wirkung.
Natürlich verlangt einem das Pilgern körperliche Leistung ab, aber die Faszination, die davon ausgeht, ist eine andere. Kräutler nennt unter anderem die Aufhebung sozialer Unterschiede unter denen, die dem Ziel Santiago zustreben. Es sei ein bisschen wie das Motto der Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“: „Ich habe Universitätsprofessoren getroffen, einen dänischen Bischof, da gibt es keine soziale Schichtung: Die haben alle die gleichen Blasen, sind fußmarod, müde.“ Sehr viele von denen, mit denen er ein Stück des Weges gegangen sei, hätten unerwartet und ganz offen über Probleme, Schicksalsschläge, ihre
„DER
Lebenssituation zu erzählen begonnen. Durch das stunden- und tagelange Gehen kämen einem Gedanken und tief vergrabene Erinnerungen, sagt der Tiroler Pilger: „Du kommst extrem weit in deinem Leben zurück.“ Und nicht wenige würden beschließen, als Konsequenz der Pilgererfahrung in diesem Leben nach ihrer Heimkehr etwas fundamental zu ändern. Nicht zuletzt, gesteht Kräutler, entstehe auch eine „spezifische Art von Sucht“.
Der Jakobsweg in Tirol zieht seine Hauptroute durch das Inntal, dazu verfügt er über Zuläufe und eine Variante. Wer zum Beispiel aus Osttirol kommt, startet in Nörsach und wandert über Lienz und das Pustertal bis Sterzing, dann über den Brenner und biegt erst bei Innsbruck in den Hauptweg ein. Aus Südtirol führt eine Strecke über den Vinschgau nach Müstair in der Schweiz. Eine weitere Variante zweigt bei Stams ab und führt durch das Außerfern ins Allgäu und weiter zum Bodensee. Historisch, so glaubt Pilgerexperte Kräutler, habe diese Strecke eine gewisse Berechtigung, immerhin führe sie über die alte Salzstraße. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Man umging und umgeht so den gefürchteten Arlbergpass. Nicht umsonst wurde von Heinrich Findelkind, einem Schweinehirten, auf der Passhöhe im Jahr 1386 eine Pilgerherberge errichtet. Zu viele Menschen waren zuvor auf dem Weg über die Berge in Unwettern und Schneestürmen umgekommen. Heute steht an ihrer Stelle das bekannte Arlberg Hospiz.
Auf dem Jakobsweg Paulo Coelho: Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela, 1987
Ich bin dann mal weg Harpe Kerkeling: Meine Reise auf dem Jakobsweg, 2006
Pilgern in Tirol Susanne und Walter Elsner: 50 Wallfahrtsziele und Besinnungswege in Nord- und Osttirol, 2021

hinten nach. Landschaft und Kultur hinterlassen bleibende Eindrücke. Und ja, die Sucht, wiederzukommen und sich neuerlich auf den Weg machen zu wollen, kann tatsächlich leicht entstehen.
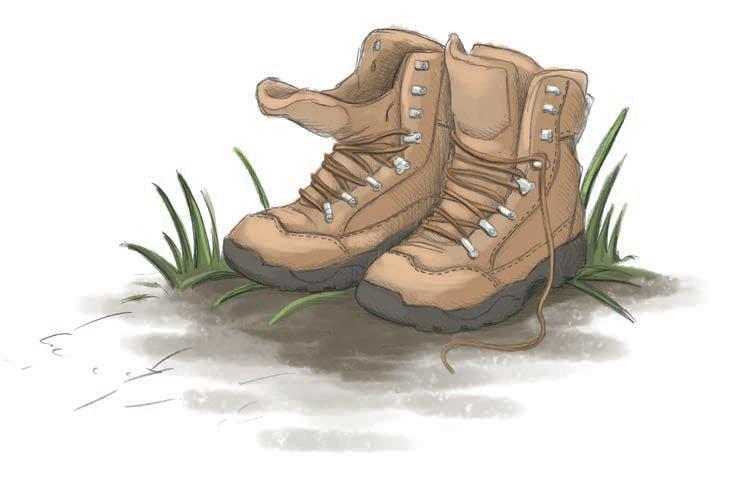
Es muss nicht immer der Jakob sein.
Wie wär’s zum Beispiel mit dem heiligen Romedius? Er gilt als Schutzpatron der Pilger und Wanderer und soll, adeliger Herkunft vom Schloss zu Thaur, sein gesamtes Hab und Gut verschenkt haben, um nach Rom zu pilgern. In Tavon auf dem Nonsberg wurde er schließlich zum Einsiedler.
GEDANKEN EILEN DEN SCHRITTEN VORAUS ODER HÄNGEN IHNEN HINTEN NACH. LANDSCHAFT UND KULTUR HINTERLASSEN BLEIBENDE EINDRÜCKE.
In Frankreich und Spanien gibt es am Weg noch immer ausgesprochene Pilgerherbergen. In Tirol fehlen die, dafür gibt es jede Menge gemütliche Pensionen und Gasthäuser, von denen manche sich durchaus auf Pilger eingestellt haben. Das Gefühl einer Pilgerherberge spürt man am ehesten bei einer Übernachtung im Klösterle am Fuße der Kronburg in Zams.
Pilgert man durch das alpine Tirol, ist das magische, romantische, historisch verbrämte Ziel Santiago de Compostela noch weit, doch die beschriebenen Gefühle können sich auch hier einstellen: Die Gedanken eilen den Schritten voraus oder hängen ihnen
Nützliche Links: • www.jakobsweg-tirol.net • wernerkraeutlerblog. wordpress.com • www.romedius-pilgerweg.at • www.tirol.at
Romedius ’ Spuren folgt man von Thaur in Nordtirol bis nach San Romedio im Trentino. Der Weg wurde 2014 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Diözese Innsbruck geschaffen. Im Gegensatz zum relativ flach dahinlaufenden Jakobsweg hat es der Romediweg in sich. Immerhin macht man auf 182 Kilometern 9.600 Höhenmeter. Vorgesehen sind für die Strecke zwölf Etappen. An der Strecke liegen großartige Orte wie das Kloster Maria Waldrast am Fuße der Serles, Obernberg oder St. Martin am Schneeberg. Am Ende des Weges steht auf einem spitzen Felsen im oberen Nonstal die Wallfahrtskirche San Romedio, in der der Heilige begraben wurde.
Ebenfalls eine moderne Neuschöpfung ist der Pilgerweg „Hoch und heilig“ in Osttirol. In neun Etappen führt er auf insgesamt 191 Kilometern von Lavant südöstlich von Lienz in einem großen Bogen über das Hochpustertal in Südtirol, das Villgratental, Defereggental, Virgental, Matrei sowie Kals am Großglockner nach Heiligenblut im Kärntner Mölltal. Er ist konditionell sehr anspruchsvoll, teilweise sind bis zu 1.700 Höhenmeter an einem Tag zu bewältigen Uwe_Schwinghammer
Mit Nationalpark-Ranger:innen zu den schönsten Plätzen im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol
Mit seinen 15.000 - 20.000 nachgewiesenen Tierarten, 3.500 Pflanzenarten, unzähligen Seen und vielen weiteren Highlights wird der Nationalpark Hohe Tauern zurecht als Oase der Artenvielfalt bezeichnet.

Bei geführten Wanderungen im ursprünglichen Osttirol bringen bergerfahrene Ranger:innen die Nationalparkbesucher:innen an die schönsten Plätze im Nationalpark Hohe Tauern.


Ob botanische Spezialführungen ins Gletschervorfeld, spannende Wildtierbeobachtungen, achtsame Naturwanderungen oder Kräuterwanderungen - beim vielfältigen Sommerprogramm des Nationalparks ist für jede Altersgruppe und alle Inter-
essen eine passende Tour dabei. Wer Lust auf ein individuelles Erlebnis hat, bucht sich seinen ganz persönlichen NationalparkRanger.
Die Ranger:innen wissen genau, wo die Wildtiere ihre Einstände haben, kennen jedes noch so kleine Blümlein beim Namen und kennen die Berge ringsum wie ihre Westentasche. Eines ist sicher: Bei einer Rangerwanderung erkunden Sie die Natur auf völlig neue Art & Weise.
 Bilder: Mathäus Gartner & Alexander Müller
Bilder: Mathäus Gartner & Alexander Müller

In order to forget time and space while walking, you don‘t necessarily have to venture far afield. Also in Tyrol you can follow the sign of the scallop shell and embark on a journey to yourself.
On the way I encounter only one thing: myself,” says German entertainer Harpe Kerkeling about pilgrimage on the Way of St. James in his bestseller “Ich bin dann mal weg” (I’m off then). Thousands have since followed him in search of themselves, peace, quiet and a new life. While pilgrimage once had a purely religious background, for many people today it is a journey into their past, and sometimes even into the future. This journey can begin today, tomorrow, in France, Spain ... or in Tyrol.
The famous first step is taken on the pilgrimage route of all pilgrimage routes, the Way of St. James, on the border of Tyrol in Lofer. In eleven (or more) stages, it will lead us from east to west to the Arlberg Pass. The main route runs primarily in the Inn Valley away from the traffic and hustle and bustle. In addition to this, the Way of St. James in Tyrol has various “tributaries” and variants. For example, if you come from East Tyrol, you start in Nörsach and hike via Lienz and the Puster Valley to Sterzing, then over the Brenner Pass and turn onto the main trail only at Innsbruck. Another variant branches off at Stams and leads through the Außerfern to the Allgäu and on to Lake Constance.
By the way, it doesn’t always have to be St. James. How about Saint Romedius, for example? You follow his footsteps from Thaur in North Tyrol to San Romedio in Trentino. In contrast to the relatively flat Way of St. James, the St. Romedius Path is a real challenge. There are 9,600 meters of altitude difference over 182 kilometres. Twelve stages are planned for the route.
Also a modern new creation is the pilgrimage route “High and holy” in East Tyrol. It leads in nine stages over a total of 191 kilometres from Lavant southeast of Lienz in a large arc across Alta Pusteria in South Tyrol, the Villgratental Valley, the Defereggental Valley, the Virgental Valley, Matrei and Kals am Großglockner to Heiligenblut in the Carinthian Mölltal Valley. It is very demanding in terms of physical condition, in some cases up to 1,700 meters in altitude have to be mastered in one day.
In general, pilgrimage demands physical performance, but the fascination that comes from it is another. The Tyrolean pilgrimage specialist Werner Kräutler refers, among other things, to the elimination of social differences among pilgrims, the reflection on one’s own life and the walking not only of one’s legs, but also of one’s own thoughts. So let’s get going



Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Alpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2
Die Idee zu einem Nationalpark in den Hohen Tauern entstand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das politische Bekenntnis dazu ist mittlerweile 50 Jahre alt und der Nationalpark Hohe Tauern selbst besteht in seiner heutigen Form als größter Mitteleuropas seit über 30 Jahren.
Der Nationalpark Hohe Tauern ist eine Idee, die auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Dieser Boden musste jedoch erst bereitet werden. Das hat Jahre, sogar Jahrzehnte gedauert. Heute genießt der Nationalpark Hohe Tauern als größter zusammenhängender Nationalpark der Alpen hohe Akzeptanz und gehört zur Identität vieler Menschen, die in den Nationalparkgemeinden leben, wirtschaften und arbeiten.
Der Nationalpark Hohe Tauern ist weder ein Freilichtmuseum noch ein Glassturz, unter dem die Zeit stehengeblieben ist. Er ist ein vitaler Lebens- und Wirtschaftsraum. Natur, Landschaft, Flora und Fauna, kurz gesagt Ökologie und Ökonomie, schließen einander nicht aus, vielmehr bedingen und ergänzen sie einander. „Nationalparkarbeit bedeutet, Beständigkeit über die eigene Generation hin zu denken. Es hat sich gelohnt, diesen einzigartigen Hochgebirgs-Naturraum zu schützen und zu einer Nationalparkdestination zu entwickeln“, ist Nationalparkdirektor Hermann Stotter überzeugt vom Generationenprojekt,
Am 21. Oktober 1971 dokumentierten die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol in der Heiligenbluter Vereinbarung den Willen, den bundesländerübergreifenden Nationalpark Hohe Tauern zu errichten. 50 Jahre später bekräftigen die Klimaschutzministerin und die Landeshauptleute dieses Bekenntnis zur Erhaltung und Weiterentwicklung dieser wertvollen Kultur- und Naturlandschaft.

dessen Stärke sich nicht zuletzt der intensiven, jahrzehntelangen Zusammenarbeit aller Stakeholder verdankt. Gerade in unserer heutigen Zeit erwacht zunehmend das Bewusstsein dafür, dass die Natur Orte braucht, an denen sie freier von menschlichen Eingriffen sein kann. Orte, die es zu bewahren gilt, nicht aus rein selbstlosen Motiven, sondern auch aus Eigeninteresse. Flüsse, die noch frei fließen dürfen, sind nicht nur Biotope, sie schützen auch das menschliche Siedlungsgebiet, da sie Hochwässer viel besser aufnehmen können als regulierte Flussstrecken.
Schützen und nützen.
Das Bewusstsein, dass es mit dem Nationalpark Hohe Tauern eine besonders schützenswerte alpine Region gibt, ist bereits vor rund 50 Jahren erwacht und wurde mit der sogenannten „Heiligenbluter Vereinbarung“ im Jahr 1971 erstmals in Schriftform gegossen, als sich die Landeshauptleute von Salzburg, Tirol und Kärnten zu einem gemeinsamen Schutzgebiet in den Hohen Tauern bekannt hatten.
An einmaligen Sehenswürdigkeiten herrscht im Nationalpark Hohe Tauern kein Mangel. Einige davon sind das Auge Gottes (oben), der Wildtierbeobachtungsturm Oberhauser Zirbenwald (Mitte rechts) und die 1212 erstmals erwähnten Jagdhausalmen, die auch in Tibet liegen könnten.
Bis aus diesem politischen Bekenntnis Realität wurde, hat es im Tiroler Teil des Nationalparks bis 1991 gedauert. Auch deshalb, weil es galt, die Menschen und im Besonderen die Grundbesitzer auf diesem Weg mitzunehmen. Ihnen zu zeigen, dass die Ziele „Schützen und nützen“ miteinander vereinbar sind und ein gelingendes Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz allen zugutekommt. So sind beispielsweise die traditionell bewirtschafteten Almen als wertvolle Kulturlandschaft,
die das Bild des Schutzgebiets mitprägen, ein unverzichtbarer Bestandteil in der sogenannten Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern geworden. Der Ausbau und die Erhaltung von Infrastrukturen wie Almwegen und Besuchereinrichtungen hat die Tür zu einem sanften Tourismus weit aufgestoßen, der eine Philosophie der „Hotspots“ verfolgt. Es werden dabei die herausragenden Orte im Schutzgebiet besonders hervorgehoben und mit entsprechender Besucherinfrastruktur

versehen, weite Teile vor allem in der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern bleiben dagegen völlig unangetastet.


Es ist erst die touristische Infrastruktur, die den Nationalpark zugänglich und dadurch unmittelbar erlebbar macht. Von ihr braucht es so viel wie notwendig und so wenig wie möglich. Dieser Spagat ist auf der Osttiroler Seite des Nationalparks Hohe Tauern gelungen. Natur wurde punktuell so in Szene gesetzt, nüchtern, zurückhaltend, ohne großes Spektakel und Effekthascherei, dass sie aus sich selbst heraus wirken kann. In die Natur zu kommen, bedeutet für die aufmerksamen Beobachter auch, wieder ein Stück zu sich selbst zu kommen. Der Mensch ist ein Wesen, das von seiner Umwelt abhängig ist. Das wird im hektischen Alltagsgetriebe gerade in den urbanen Ballungsräumen häufig vergessen. Im Nationalpark Hohe Tauern zeigt sich die Natur unmittelbar, gleichermaßen durch ungestüme, tosende Wasserfälle – etwa bei den ergreifend schönen Umbalfällen – und durch sanfte Bergwiesen, die mit einer Blütenpracht und Artenvielfalt bei Pflanzen wie Tieren aufwarten können, nach der man in der Ebene vergeblich sucht. Dergestalt ist der Nationalpark Hohe Tauern heute zu einem Sehnsuchtsort geworden für Menschen, die sich vom Unberührten berühren lassen wollen. Bei den imposanten Umbalfällen entstand übrigens 1976 der erste Wasserschaupfad Europas. Heute gibt es in der Nationalparkregion Osttirol zehn weitere nach dessen Vorbild gestaltete Themenwege.
Beobachten und bewirtschaften.
Die Unterteilung in Kern- und Außenzone ist eine Besonderheit des Nationalparks Hohe Tauern, weil dadurch die alpine Wildnis und die alpine Kulturlandschaft in gleichem Maße geschützt sind. Im „oberen Stockwerk“

lässt man der Natur ihren Lauf, hier ist der Mensch in der Rolle des Beobachtenden, der die natürlichen Abläufe ungehindert geschehen lässt. In den darunterliegenden Stockwerken, der zwischen 1.600 und 2.500 Meter Seehöhe gelegenen Almregion und schließlich den Wäldern, gewissermaßen das Erdgeschoß des Parks, wird die naturnahe Bewirtschaftung gefördert.
Seit 2006 ist der Nationalpark Hohe Tauern auch international anerkannt durch die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature). Das im Nationalpark vereinte Nebeneinander von rauer Natur und der naturnahen Nutzung von Kulturlandschaft genießt europaweit Vorbildfunktion und gilt als einzig gangbarer Weg, Schutzgebiete in dieser Größenordnung nachhaltig etablieren zu können. „Weitblick und Mut“ attestiert Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin und ressortzuständige Landesrätin Ingrid Felipe, die auch Vorsitzende des Tiroler Nationalparkkuratoriums Hohe Tauern ist, den Pionierinnen und Pionieren der Nationalparkidee. „Die damals weit verbreitete Angst, dass mit dem Nationalpark eine Art Glaskuppel über die gesamte Region gestülpt werde, hat sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil: Heute wissen wir, dass der Nationalpark eine
 Ingrid Felipe
Ingrid Felipe
Der Großglockner thront als höchster Berg Österreichs (3.798 m) majestätisch über dem Nationalpark Hohe Tauern, der auch den König der Lüfte, den Adler, zu seinen Bewohnern zählen darf. Hier sehen wir ein Adlerjunges, bevor es seinen ersten Flügelschlag getan hat.

„DIE ERFOLGSGESCHICHTE DES NATIONALPARKS HOHE TAUERN IST KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT, SONDERN DAS RESULTAT BEHARRLICHER ÜBERZEUGUNGSARBEIT, VON DER DIE NATUR, DIE LANDWIRTSCHAFT, DER TOURISMUS UND DIE MENSCHEN, DIE HIER LEBEN UND DIE ZUR ERHOLUNG HIERHERKOMMEN, HEUTE GLEICHERMASSEN PROFITIEREN.“
behutsame Entwicklung ermöglichte“, sagt Felipe, die zudem explizit auf die Infrastruktur verweist, die mit dem Schutzgebiet entstanden ist: Lehrwege, Museen, Informationsstellen, von Rangerinnen und Rangern geführte Exkursionen. Nationalparkdirektor Hermann Stotter sieht den Nationalpark in erster Linie als Rückzugsort sowohl für Menschen als auch für Tiere und Pflanzen. „Dieses Refugium zu schützen und gleichermaßen zugänglich und erlebbar zu machen, ist ein Kernauftrag des Nationalparkgedankens“, sagt Stotter. Dieses Bewusstsein für den Wert der unberührten Landschaft gelte es täglich mit Leben zu erfüllen.
• Gesamtfläche: 1.856 km2 , davon 611 km2 in Osttirol
• Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor, bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 %.
• West-Ost-Erstreckung: 100 km
• Nord-Süd-Erstreckung: 40 km
• mehr als 300 Dreitausender
• 279 Bäche und 26 bedeutende Wasserfälle
• 551 Bergseen
Schönheit, auf Bergen und in Tälern, wilde Natur-, aber auch sehr viel Kulturlandschaft, die über viele Generationen hinweg von Menschenhand geformt und geprägt wurde, zeichnet den Nationalpark Hohe Tauern aus. Hier musste sich der Mensch schon immer mit der Natur arrangieren, mit ihr kooperieren. Der Osttiroler Teil des Nationalparks Hohe Tauern ist stark von Großglockner, Großvenediger und den umliegenden, vergletscherten Gebirgen sowie von der Isel, einem der letzten relativ frei fließenden Gletscherflüsse Europas, geprägt. Österreichs höchster Berg, der 3.798 Meter hohe Großglockner, thront gleichsam zentral und majestätisch inmitten des Parks. Der Großvenediger, einst von Erstbesteiger Ignaz von Kürsinger als „weltalte Majestät“ bezeichnet, ist bis heute allseitig stark vergletschert, obwohl seit 1850 ein großer Teil seiner einst so mächtigen Eisfläche verloren gegangen ist.

Grossglockner und Großvenediger sind nur zwei Gipfel, die aus einem ganzen Meer von über dreihundert Dreitausendern, bekannteren und unbekannteren, aber nicht minder schönen, herausragen. Trotz seines hohen Bekanntheitsgrades und über einer halben Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr finden sich im Nationalpark Hohe Tauern noch viele einsame Hochgebirgstäler für ausgedehnte Wanderungen. Damit im Einklang stehen die Hauptmotive für einen Urlaub im Nationalpark Hohe Tauern: Erholung und Gesundheit und eine Abkehr vom Massentourismus, der andernorts fast schon industriell betrieben wird und mit immer neuen Superlativen auf sich aufmerksam machen muss. Urlaub im Nationalpark verheißt dagegen einen Tourismus der Zwischentöne und Nuancen, in deren Zentrum die Natur steht.

Die Natur als Lehrmeister.
Die Natur- und Kulturlandschaft mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna im Nationalpark Hohe Tauern ist aber nicht nur eine Augenweide und ein Spektakel, sondern auch ein wunderbarer Lehrmeister. Dementsprechend zählt es zu den Kernaufgaben des Nationalparks, Bewusstseinsbildung für das sensible Ökosystem zu betreiben. Diese Aufgabe wird heute besonders anschaulich von den gut ausgebildeten Nationalparkrangern und -rangerinnen erfüllt, die den Besuchern die Besonderheiten der Hohen Tauern im Wortsinn näherbringen. Der Nationalpark ist so auch ein gigantisches Freiluft-Klassenzimmer, das so manche Lektion bereithält, wenn man mit offenen Ohren und Augen sowie wachem Geist in die Natur geht.


Im Nationalpark wird zudem fleißig und in verschiedenen Disziplinen geforscht, um dem Ökosystem neue Geheimnisse zu entlocken, die bisher noch unentdeckt geblieben sind. Das tut dem Mythos Nationalpark freilich keinen Abbruch, schärft jedoch das Bewusstsein dafür, dass der Mensch nicht in einem Vakuum abgekoppelt von seiner Umwelt zu überleben vermag. All das und noch viel mehr macht den Nationalpark Hohe Tauern zu einem Sehnsuchtsraum in den Alpen, der bei seinen Besuchern bleibenden Eindruck hinterlässt.
 Marian_Kröll
Marian_Kröll
„DIESES
Der Weg ist das Ziel. Kaum irgendwo ist das unmittelbarer erfahrbar als am Iseltrail, einem Weitwanderweg, auf dem man dem Lauf eines der letzten frei fließenden Gletscherflüsse der Alpen von der Mündung bis zum Ursprung folgt. Dabei offenbart sich eine einzigartige Flusslandschaft in all ihren Facetten, zwischen Menschenwelt und Wildnis.
Fotos: tvbo / Ramona WaldnerGo with the flow ist eines der Hauptziele einer zunehmend hektischen und auch angesichts der langwierigen Pandemie abgekämpften Gesellschaft. Es gibt eine allgemeine Sehnsucht nach diesem als beglückend erlebten Flow-Zustand, in dem alles leicht wird, alles in Fluss gerät. Wo ließe sich ein solcher Zustand besser herbeiführen als an einem Ort, wo bereits alles im Fluss ist? Und zwar in einer Gestalt, wie sie die Natur geformt hat. An der Isel, die nicht zu Unrecht in poetischer Weise schon als Herzfluss, als Puls des Ursprungs, als Lebens- und Hauptschlagader Osttirols bezeichnet wurde.
Die Isel ist einer der letzten Gletscherflüsse der Alpen, deren natürlicher oder ehrlicher gesagt naturnaher Charakter bis heute weitestgehend erhalten geblieben ist oder schon in der Vergangenheit wiederhergestellt wurde. Bei Gletscherflüssen handelt es sich um einzigartige Ökosysteme, die saisonal starken Veränderungen unterliegen. Die Isel zeigt sich je nach Witterung, Tages- und Jahreszeit von ganz unterschiedlichen Seiten. Obgleich gerade in
Die durchgehend markierte Wanderroute beginnt in Lienz und endet an der Gletscherzunge am Umbalkees im Nationalpark Hohe Tauern. Der Weitwanderweg mit zahlreichen Blickpunkten auf magische Plätze wurde im Sommer 2020 eröffnet. Er nutzt dabei überwiegend bestehende Wege. Alle baulichen Maßnahmen erfolgten behutsam, um die Natur zu schonen. Mit einer Gesamtlänge von 74,19 Kilometern und insgesamt 2.169 Höhenmeter bergauf gliedert sich der Iseltrail in zwölf individuell wählbare Teilstücke, die in fünf Tagesetappen erwandert werden können.

der Tourismuswerbung der Superlativ die Stammform jeglicher Zustandsbeschreibung ist, so ist er durchaus geeignet, um die Isel zu beschreiben. Sie wird von den Gletschern genährt und ist äußerst vielseitig. Schön ist sie aber immer. Und urtümlich.
Ihre Ufer sind gesäumt von besonderen Orten, die man heutzutage wohl als Kraftplätze bezeichnen würde. Die Isel lädt einmal zum Nachdenken ein, dann zum Verweilen und ein Stück weiter zum ehrfurchtsvollen Staunen ob der gewaltigen Kraft des Wassers. Das Wasser hat die Flusslandschaft geformt. Besonders eindrücklich und aus nächster Nähe lässt sich das bei den im Nationalpark Hohe Tauern gelegenen Umbalfällen erleben. Die Isel ist Faszinosum, Naturschauspiel und Kulisse, die zum Innehalten einlädt. Die Isel ist ein Fluss, an dem entlangwandernd man zu sich kommt, in den Fluss. Go with the flow.
Ohne die Isel wäre alles nichts.
Ohne die Isel wäre nichts in der Gegend so, wie es ist. Bislang war sie in der

Beim und im Fluss sein, im FlowZustand dem vergletscherten Ursprung der Isel entgegenstreben. Der Weg ist das Ziel.
Öffentlichkeit eher den Eingeweihten und Naturschützern ein Begriff, um deren Erhaltung als ursprünglicher, fast unverbauter Gletscherfluss lange gerungen wurde. Sinnbildlich für dieses Ringen steht die Deutsche Tamariske. Das Engagement des Naturschutzes hat mit Blick auf den jahrelangen, umstrittenen Prozess der Ausweisung als Natura-2000-Schutzgebiet in der Bevölkerung eine Zeit lang polarisiert. Doch mittlerweile hat man sich damit angefreundet, das Flussjuwel Isel nicht länger zu verstecken, im Gegenteil: Mit dem Iseltrail erfolgte der Auftakt, um die Isel vor den Vorhang zu holen und (Weit-)Wanderern die Gelegenheit zu geben, das einmal laute, dann wieder leise, einmal tosend-imposante, dann wieder fast mäandernde Schauspiel aus der Nähe zu erfahren.
Dem Gletscherfluss jenen Raum zu geben, den er braucht, ist aber nicht allein eine Frage der Ästhetik und des Landschaftsbildes gewesen, sondern auch eine des Schutzes. Breite Ausschotterungsbecken, an denen sich Geschiebe und Treibholz anlagern kann, sind nicht nur kleine Ökosysteme, sondern dienen auch dazu, Hochwässer aufzunehmen in einer Art und Weise, dass der Fluss bei in immer kürzeren Abständen einsetzenden Wetterkapriolen keine Gefahr für den Siedlungsraum darstellt. Im Flussbett finden sich riesige Findlinge, die von der Isel flussabwärts transportiert werden und von der schieren Wucht des Wassers zeugen. Die Isel hat als dynamischer Wildfluss Raum zur Entfaltung und darf gelegentlich auch ausufern.
Die Initiative zur Schaffung eines Iseltrails ging vom Tourismusver-




band Osttirol aus. Bis zur Realisierung wurde mehr als drei Jahre lang an der Umsetzung des Projekts gearbeitet, für das es viele Stakeholder ins Boot zu holen galt. Aus der Kooperation resultierte eine Wegeführung, die besondere Plätze entlang der Isel eingerichtet und einbezogen hat, zudem gibt es am Ende des Iseltrails am Umbalkees und damit am Ursprung der Isel eine Zielpyramide „Die Isel ist ein launisches Wesen“, sagt Walter Hopfgartner, der als Leiter des Fachbereichs Wasserwirtschaft im Baubezirksamt Lienz an der Schaffung des Iseltrails mitgewirkt hat. So wie Konrad-Lorenz-Preisträger und Naturschutz-Urgestein Wolfgang Retter, unter anderem treibende Kraft hinter dem bereits 1976 verwirklichten Wasserschaupfad Umbalfälle, der nunmehr Bestandteil des Iseltrails ist. Im Zuge der Eröffnung des Weitwanderwegs bezeichnete Retter den Iseltrail als „letzten großen Stein in der Schutzmauer um die Isel“. Beteiligt war auch der Landschaftsfotograf, Journalist, Umweltaktivist und -stratege Matthias Schickhofer, der die Strecke erwandert, eindrücklich erlebt und fotografiert hat. „Der wilde Fluss ist eine andere Welt. Ein schmales Band mit einer mitunter sehr wilden Flusslandschaft, wo wir Menschen kaum präsent sind und die wir oft kaum kennen. Ich bin im Zuge meiner Erkundungen für den Iseltrail oft einfach ohne Weg am wilden Fluss entlanggegangen und in weglose Schluchten geklettert. Da gibt
 Matthias Schickhofer
Matthias Schickhofer
Ob weitläufige, naturbelassene Auenlandschaft, ursprüngliche Täler oder der Umbalgletscher als Geburtsort der Isel – sie ist ein Fluss mit vielen Gesichtern.

es wirklich sehr eindrucksvolle Naturlandschaften, die sogar vielen Einheimischen unbekannt sind: nicht einsehbare Wasserfälle, moosige Schluchtwälder, weite Schotterbänke, wuchtige Felsformationen. Da wir diese wilden Orte so wenig wie möglich stören wollen, werden nur einige wenige Stichwege und Holzplattformen einen beschränkten Zugang bieten“, sagt Schickhofer.
Als besondere Glanzlichter der Wanderung am Iseltrail kann man die Iselauen und Insellandschaften bei Oberlienz, die brüllenden Feldner Katarakte, die versteckte Waldschlucht bei Virgen, den grandiosen „Grand Canyon“ zwischen Welzelach und Bobojach, den „Regenbogenwasserfall“ in der Gloschlucht bei Prägraten und natürlich die Umbalfälle und die weite Hochgebirgstundra im Vorfeld des Umbalgletschers im Nationalpark hervorheben.
Die Isel in ihrem abwechslungsreichen Lauf ist aber nicht nur für Urlaubsgäste sehens- und erfahrenswert, auch viele Einheimische haben eine emotionale Beziehung zu ihr, die mitunter auch ambivalent ist. Die Isel ist, so viel steht fest, jedenfalls ein Urquell der Freude, und mit der Schaffung des Iseltrail auch für immer mehr Menschen der Inspiration und Kontemplation und nicht zuletzt – banaler, aber gerade für Einheimische mindestens gleich wertvoll – ein wunderbarer Naherholungsraum. Marian_Kröll

„DER WILDE FLUSS IST EINE ANDERE WELT. EIN SCHMALES BAND MIT EINER MITUNTER SEHR WILDEN FLUSSLANDSCHAFT, WO WIR MENSCHEN KAUM PRÄSENT SIND UND DIE WIR OFT KAUM KENNEN.“
23. Dolomitenlauf im Lienzer Talboden, 22. Jänner 1995
Ein Osttiroler Fotoessay zu Tirol von 1976 bis 1998.
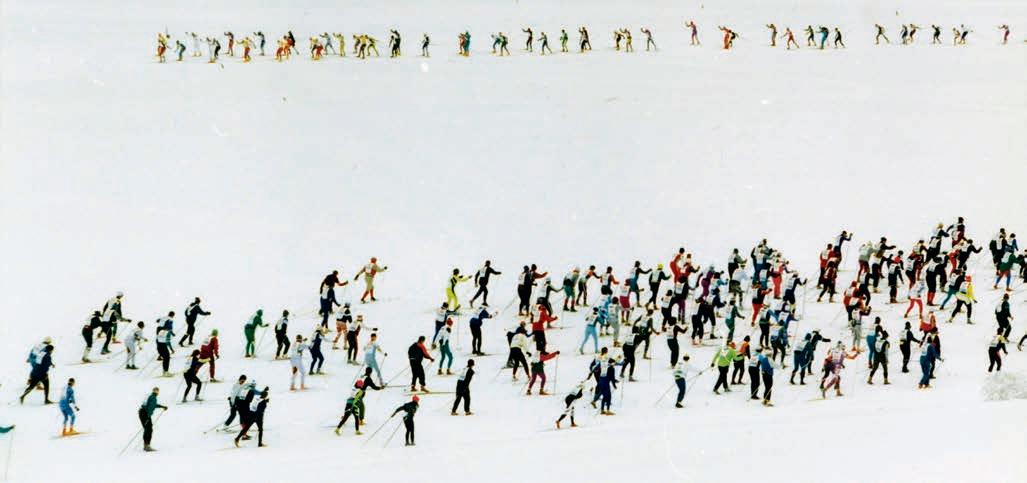
Diese visuelle Spurensuche im Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst (TAP – online seit 2011 unter www.tiroler-photoarchiv.eu) bewegt sich entlang der vier Leitmotive des Magazins TIROL seit 1972: Die Natur ist der Rohstoff, den es zu bewahren gilt. Der Mensch als Individuum bzw. als (große oder kleine) Gruppe bewegt und trägt zur Gesellschaft bei. Das Land wird gestaltet, direkt und indirekt, auf vielfältigste Weise, durch kleine Schritte oder jahrzehntelanges Tun. Das Leben durchzieht alle Bereiche, wir führen uns (hoffentlich) Gutes zu.
Die Recherche quer durch die Sammlungen des TAP zeigt, dass zu den letzten Jahrzehnten der Geschichte Tirols vordergründig noch viele Bildquellen zu sammeln und zu erschließen sind. Und dass hintergründig Fotografien aus dem Bezirk Lienz durchaus programmatisch für das ganze Land stehen können – selbst wenn sie Besonderheiten mit Lokalkolorit (re)präsentieren.
Martin_Kofler
Historiker Martin Kofler leitet das in Lienz und Bruneck angesiedelte Tiroler Archiv für photographische Dokumentation und Kunst (TAP).

Anna Waldeck (1908–2000), engagierte Sozialistin, von 1950 bis 1971 erste Lienzer Gemeinderätin, davon sechs Jahre erste Stadträtin, Aufnahme 1993


Bezirksmusikfest bei der Lienzer Pfarrkirche St. Andrä, 1984

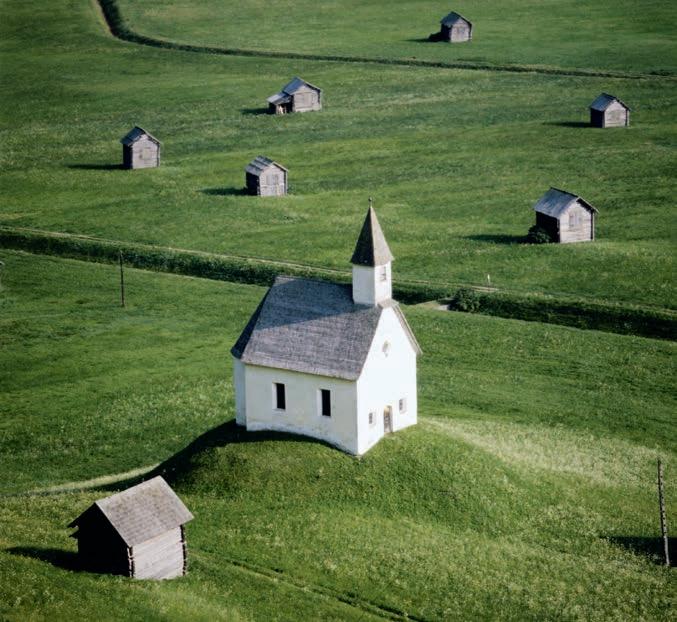
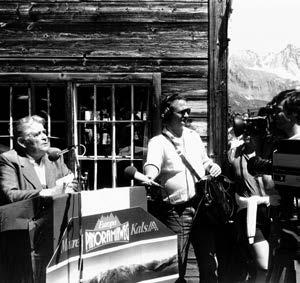

In Tirol gibt es zahlreiche starke Frauen und es gab sie auch in der Vergangenheit, selbst wenn sie zu damaligen Zeiten oft verkannt wurden. Wie Margarete von Tirol, der man – in der Nachbetrachtung zu Unrecht – den wenig schmeichelhaften Beinamen „Maultasch“ verlieh. Sie steht im Mittelpunkt der heurigen Tiroler Volksschauspiele in Telfs und ihre Geschichte ist erschreckend aktuell.

Margarete von Tirol war wohl eine der schillerndsten heimischen historischen Frauenfiguren. Sie war eine, die sich gegen die Widrigkeiten des Lebens stellte, die für sich einstand und es sich dadurch nicht einfacher machte. Sie wurde als „die hässliche Herzogin“ bezeichnet, bekam den Beinamen „Maultasch“. Sie war eine starke Frau, aber Opfer eines Systems und letztlich ihrer Zeit. Doch Margarete von Tirol war nie eine, die sich fügte.
Macht Aufbegehren hässlich?
Margarete ist zwölf Jahre alt, als sie in einer Zweckehe mit dem drei Jahre jüngeren Heinrich von Luxemburg vermählt wird. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt sie 1335 mit 17 Jahren die Führung der politischen Geschäfte und regiert als Gräfin von Tirol und Görz. Die Ehe mit Heinrich scheitert und sie setzt ihn gemeinsam mit den Räten von Tirol vor die Tür. Bereits ein Jahr später heiratet sie den Kaisersohn Ludwig I. von Bayern-Brandenburg, was ihr neben allen Irrungen und Wirrungen der damaligen Zeit und kriegerischen Auseinandersetzungen auch noch die erbitterte Feindschaft des Papstes und der Kurie einbrachte. Als Folge der kirchlich nicht legitimierten neuen Ehe verhängt der Papst einen 17 Jahre andauernden Bann auf Margarete und ihr Land Tirol. Einen Gutteil ihres Lebens kämpft die Gräfin gegen mächtige Gegner in Politik
Schon 1993 holte der Verein der Tiroler Volksschauspiele das Lustspiel „Tirili“ von Otto Grünmandl, bearbeitet und mit Liedern versehen von Georg Kreisler, nach Telfs. Rund 30 Jahre später stehen die brillanten Texte und Lieder des Wiener Kabarettisten, Komponisten, Schriftstellers und Satirikers Georg Kreisler als Wiederaufnahme vom Vorjahr erneut auf dem Spielplan.
Thomas Arzt
und Kirche, streitet für die Rechtmäßigkeit ihrer Scheidung und Neuvermählung und hat dabei dennoch ständig das Wohl ihres Landes Tirol vor Augen, das sie – nachdem sowohl ihr Gemahl als auch ihr kinderloser Sohn gestorben waren – notgedrungen den Habsburgern überschreiben muss. Margarete hat in einer Zeit gekämpft, in der Kriege, Barbarei und Antisemitismus die Welt auf den Kopf stellten. Und überlebt. Doch unterm Strich blieb aus den vielen Erzählungen von einer bewegenden Frauenfigur lediglich eine Fratze.
Die heurigen Tiroler Volksschauspiele stellen starke Frauen und große Legenden in den Fokus – darunter das Wirken und das Leben der Margarete von Tirol. Die Kunst besteht darin, diese ihre Geschichte nicht als Plattitüde immer wieder zu reproduzieren, sondern sie neu zu erzählen. Zu erzählen, wer

„KUNST IST GROSSE SCHÖNHEIT. SIE IST ABER AUCH DAS SICHTBARMACHEN VON HASS UND HÄSSLICHKEIT. VON NICHTS ANDEREM ERZÄHLT MEIN THEATERSTÜCK.“
die Maultasch war – auch die Hässliche, weil sie aufbegehrte. Der junge und als Theaterautor vielfach ausgezeichnete Oberösterreicher Thomas Arzt hat es geschafft, eine Margarete zu zeigen, die bislang vielfach im Verborgenen blieb: „Was wir von Margarete wissen, erzählt mehr über diejenigen, die sie im Laufe der Geschichte dargestellt und entstellt haben“, sagt er. „Über Systeme von Macht, Missbrauch und Gewalt. Und über Männer, die sich aus politischem Kalkül in Margaretes Leben ‚einschrieben‘.“ In einem aufwändigen Spektakel in der Kuppelarena des Telfer Sportzentrums eröffnen bekannte Schauspieler*innen und heimische Laiendarsteller*innen, Live-Musiker*innen und Chöre einen Blick in die Vergangenheit, der sich tief unter die Oberfläche gräbt.


Thomas Arzt hat ein grandioses Auftragswerk über eine so leuchtende wie undurchsichtige Persönlichkeit der Tiroler Geschichte geschrieben, einfühlsam und ehrlich; als Regisseurin fungiert Susanne Lietzow. Für die geborene Innsbruckerin ist es die erste Inszenierung in Tirol. „Lietzow macht wunderbares Theater“, sagt der künstlerische Leiter Christoph Nix. „Sie ist eine, die nachspürt – mit Humor, Energie und Klugheit.“ Entstanden ist mit „Monster und Margarete“ ein Stück, in dem Margarete von Tirol ein klein wenig Wiedergutmachung erfährt, ohne
sie ins Gegenteil zu romantisieren. Auch 700 Jahre später ist sie eine denkwürdige und dramenfähige Figur, glanzvoll und vielfach gebrochen und im Kampf der Frauen um Selbstbehauptung und -bestimmung noch immer Vorbild.
Ich bleibe hier.
Eine andere starke Frau ist nicht der Geschichte, sondern dem Roman „Resto qui“ (Ich bleibe hier) von Marco Balzano entstiegen. Schon das Buch ist eine echte Besonderheit, zumal sich ausgerechnet ein Italiener des Faschismus und des geschehenen Unrechts im Südtiroler Graun annimmt, wo für ein gewagtes Staudammprojekt ein ganzer Ort geflutet wurde. Noch heute ist dort der aus dem Wasser ragende Kirchturm steinerner Zeuge einer im wahrsten Sinne untergegangenen Welt. Die Tiroler Volksschauspiele konnten sich die Uraufführungsrechte des Bestsellers sichern, Regisseur Lorenz Leander Haas bringt die Geschichte auf die Bühne.
Ausserdem im Hauptprogramm: Der Kreisler-Liederabend „Der Träumer ist bereits frisiert“ als Wiederaufnahme aus dem vergangenen Jahr, gesungen – wenn möglich – im Kranewitterstadl. Die Location entpuppte sich als geheimer Publikumsmagnet, musste im vergangenen Jahr wetterbedingt jedoch leider oft ausfallen. Marina_Bernardi
Heuer begehen die Tiroler Volksschauspiele in Telfs ihr 40-Jahr-Jubiläum. 1981 in Hall gegründet, übersiedelte das Theaterfestival ein Jahr darauf nach Telfs und bedient sich seit jeher ambitionierter Inszenierungen von Klassikern des Volkstheaters sowie zeitgenössischen Stücken. Die Festivalgeschichte ist geprägt von klingenden Namen wie Kurt Weinzierl, Otto Grünmandl, Josef Kuderna, Ruth Drexl und Hans Brenner sowie Felix Mitterer, dessen Skandalstück „Stigma“ im Jahr 1982 nach der Absage der Marktgemeinde Hall in Telfs aufgeführt wurde. Gespielt wird im Stadl, einer Waldlichtung, in einer Abbruchsiedlung oder am Gipfel der Hohen Munde, die gesamte Region bildet einen spannenden Rahmen – bis hin zum Möserer See und der Friedensglocke. Ab Oktober 2022 folgt Gregor Bloeb (Bild) dem derzeitigen künstlerischen Leiter Christoph Nix nach.
„Ich bleibe hier“ nach einem Roman von Marco Balzano feiert am 22. Juli seine Premiere, die Wiederaufnahme von Georg Kreislers „Der Träumer ist bereits frisiert“ folgt am 26. Juli, „Monster und Margarete“ startet schließlich am 18. August. Das Gesamtprogramm sowie Tickets gibt’s unter www.volksschauspiele.at
COMING soon!
NAGILLERGASSE 67
Höttinger Au, Innsbruck große Freiflächen im Grünen 18 Wohnungen, 1-4 Zimmer-Wohnungen
MEHR INFOS auf unserer WEBSITE!


Die 18. Wunderkammer Umbra zeigt einmal mehr den Facettenreichtum der Swarovski Kristallwelten. Diesmal abstrakter.
Das Werk von James Turrell der Serie Shallow Spaces offenbart eine körperlich spürbare Erfahrung. Dem Raum wurde das Licht gegeben, das es braucht, um zu sein.
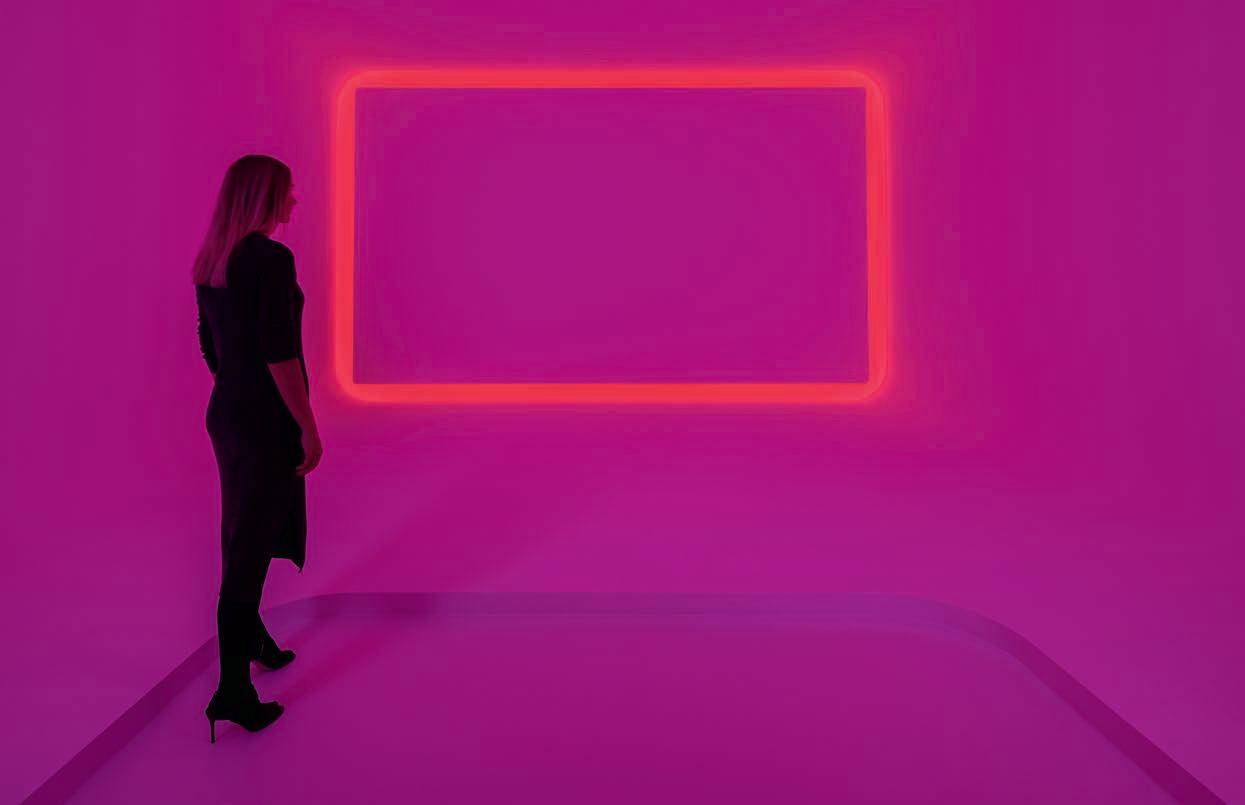
Mit der neuen Wunderkammer „Umbra“ taucht James Turrell tief ein in die Magie des Lichts.
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens eröffneten zu Ehren des 100-jährigen Jubiläums des Unternehmens Swarovski im Jahr 1995 ihre Türen. Damals wie heute werden Besucher*innen durch eine zauberhafte Welt des Crystal Lifestyle begleitet, in der Wissenschaft und Magie aufeinandertreffen.

Seit ihrer Eröffnung begeisterten die Swarovski Kristallwelten mit der Erlebniswelt der Wunderkammern, dem weitläufigen Garten und immer neuen Ausstellungen über 15 Millionen Besucher*innen aus aller Welt. Die Wunderkammern sind so konzipiert, dass jeder Künstler und jeder Designer mit Swarovski-Kristall eine andere Geschichte erzählen kann. Große Namen wie Manish Arora, Yayoi Kusama und Toord Boontje haben jeweils eine Wunderkammer nach ihren ganz eigenen Inspirationen gestaltet, sodass man mit jedem Raum in eine vollkommen neue Welt eintaucht und den ideengebenden Künstlern auf einer ganz persönlichen Ebene begegnet.
Eine Reise in die Unendlichkeit.
Der Streifzug durch die Wunderkammern inspiriert auf künstlerische Art und nimmt mit auf eine Reise voller strahlender Eindrücke. Eine Reise, die in der neuen Wunderkammer Umbra gefühlt ins Unendliche führt. Nur ein Schritt in den mit Licht durch- und überfluteten Raum genügt und man wird regelrecht aufgesogen von der Magie dieser Kunst. Alle Sinne erleben dabei ein wortwörtlich wundervolles Gefühl. Es passiert so viel und gleichzeitig so wenig, dass man von einer seelischen und körperlichen Leichtigkeit
überkommen wird. Fast so, als würde man schweben.
Die Wahrnehmung von Licht und Farbe ist das zentrale Element von James Turrells Œuvre, das mehr als fünf Dekaden umspannt. Architektonische Gegebenheiten werden durch den kreativen Einsatz von Licht beinahe gänzlich aufgelöst. Die von der Lichtquelle ausgehende Kraft wirkt künstlich und doch so natürlich. Wie das ewige Licht zieht das Werk in seinen Bann und man möchte nicht mehr aufhören, darin zu existieren. Die einzelnen Lichtstrahlen reflektieren ein Gefühl von unerreichbarer Nähe. All diese Eindrücke rufen einen meditativen Zustand hervor. In den Werken von James Turrell wird Licht zu einer körperlich spürbaren Erfahrung.
Schon lange war James Turrell auf der Wunschliste, wie Kuratorin Carla Rumler erklärt: „Es ist für uns eine große Ehre, ein Werk von James Turrell in den Swarovski Kristallwelten willkommen zu heißen. Licht haucht dem Kristall Leben ein und entzündet eine einzigartige Magie. Turrells Verständnis

James Turrells „Umbra“ ist die 18. Wunderkammer nach der kürzlich erfolgten Eröffnung von „The Art of Performance“. Das Werk ist täglich von 9 bis 19 Uhr in den Swarovski Kristallwelten zu sehen. kristallwelten.com/umbra
„LICHT
DEM
LEBEN EIN UND ENTZÜNDET EINE EINZIGARTIGE MAGIE.“
für das Licht und die Verwendung in seiner essenziellsten Form verwandeln es für den Betrachter zu einem immersiven Erlebnis. Wer es wagt, der Kraft des Lichts gegenüber offen zu sein, wird Umbra körperlich und emotional erfahren.“ Offenheit ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Man muss sich auf das Licht, die Farben und alle Elemente in diesem Raum einlassen, um diese Erfahrung in vollem Glanz machen zu können. Auch Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH, verweist auf das anspruchsvolle Besuchererlebnis der internationalen Destination. „Licht ist die Seele des Kristalls und deshalb ehrt uns, dass wir mit James Turrell zusammenarbeiten konnten, um diesem Medium einen würdigen Raum in den Swarovski Kristallwelten zu geben. Einmal mehr laden wir dazu ein, sich mutig und staunend auf das Phänomen Kristall einzulassen.“
in den Swarovski Kristallwelten.
Jeder Moment in den Swarovski Kristallwelten ist ein Erlebnis für sich. Die Mischung aus Kunst und Kultur, Entertainment und Shopping, Familienunterhaltung und Events macht die Swarovski Kristallwelten bei jedem Wetter einzigartig als Ausflugsziel in Tirol. Hier ist für jeden Geschmack, jedes Alter und jeden Kunstliebhaber etwas dabei.
Nur ein paar der Highlights im Wunderland der Fantasie: Im Süden des Gartens versprechen der Spielturm, der Spielplatz, das Karussell und das Labyrinth jede Menge Spaß und Spannung für große und kleine Gäste. Das Restaurant und Café Daniels Kristallwelten bietet internationale, regionale, Tiroler und vor allem saisonale Küche
und wurde dafür sogar mit einer Haube im Gourmetführer Gault&Millau und mit einer Falstaff-Gabel vom Falstaff Restaurant- und Gasthausguide ausgezeichnet.
Damit nicht genug. Erst letztes Jahr im Herbst 2021 eröffneten die Swarovski Kristallwelten mit großem Stolz die Wunderkammer „The Art of Performance“. Präsentiert werden hier neben Originaloutfits von Elton John, Cher oder Dita von Teese Nachbildungen von Marlene Dietrichs Outfit aus dem Film „Blonde Venus“, Marilyn Monroes „Happy Birthday“-Kleid sowie Katy Perrys Kronleuchterkleid von Moschino. Ein großes Highlight wartet auf die Besucher*innen auch im Sommer: Von 22. Juli 2022 bis 21. August 2022 heißt es in den Swarovski Kristallwelten „It’s Showtime!“. Ganz nach dem Motto der Wunderkammer „The Art of Performance“ begeistern auch heuer wieder Akrobaten des Circus-Theater Roncalli die Besucher*innen in eindrucksvollen Shows mit viel Körperkunst. Das erfolgreiche Sommerfestival verwandelt den weitläufigen Garten der Swarovski Kristallwelten dann erneut in eine Zirkusmanege.
Die Wunderkammer „The Art of Performance“ zelebriert die langjährige Zusammenarbeit zwischen Swarovski und Hollywoods größten Entertainer*innen und Künstler*innen auf fantastische Weise.



Seit September 2019 gibt Bernd Loebe, der Intendant der Oper Frankfurt, auch bei den Tiroler Festspielen Erl den Ton an. Im Interview mit dem Tirol Magazin spricht er über den Wert von Kultur in Krisenzeiten, sein berufliches Wandeln zwischen Metropole und Provinz und falsche Doktortitel.

Hier die hartnäckige Corona-Pandemie, dort der schreckliche Krieg gegen die Ukraine. Haben Sie angesichts dieser bizarren Weltlage nie daran gedacht, die Tiroler Festspiele Erl wie im Jahr 2020 abzusagen? Bernd Loebe: Nein. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Blick auf übergeordnete Themen wie die Liebe und den Tod zu richten. In der Kunst wie im tatsächlichen Leben. Mir ist es wichtig, diese Themen, die ja in nahezu jeder Oper aufgegriffen werden, mit der nötigen Qualität ans Tageslicht zu bringen und damit auch Denkprozesse auszulösen. Außerdem finde ich, dass es die Menschen verdient haben, bei der Dauerbelastung durch Pandemie und Krieg im Sommer ein paar schöne Stunden mit uns zu verbringen und daraus Kraft für den eigenen Alltag zu schöpfen.
Braucht der Mensch in Krisenzeiten Kultur noch dringender als sonst? Ja, das war eigentlich immer so. Schon meine Eltern haben mir erzählt, wie sie einen zehn Kilometer langen Fußmarsch durch das halb zerbombte Frankfurt auf sich genommen haben, um abends eine Opernvorstellung erleben zu können. Gerade dann, wenn wir glauben, dass alle Kriterien der Vernunft abhandengekommen sind, brauchen wir Erlebnisse, die uns spüren lassen, dass die Welt eigentlich zu etwas ganz anderem befähigt ist.
Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren lernen müssen, auf Distanz zu gehen und

7. bis 31. Juli 2022
Opern:
• Bianca e Falliero, Gioachino Rossinis
• Die Walküre, Richard Wagner
• König Arthus, Ernst Chausson
Weitere Infos auch zum Konzertprogramm, den Kammermusikaufführungen und Specials sowie Kartenvorverkauf unter www.tiroler-festspiele.at

auf kulturelle Liveerlebnisse zu verzichten. Dadurch scheint sich auch eine gewisse Kulturverdrossenheit entwickelt zu haben. Sehen Sie das ähnlich? Selbst bei mir hat sich zwischenzeitlich eine Form von Kulturverdrossenheit eingeschlichen. Und das, obwohl ich ja seit jeher einen Großteil meiner Abende im Theater verbracht habe. Aber wenn man über mehrere Wochen nur zu Hause sitzen kann und dort was Schönes zu essen bekommt, ehe man zum „Tatort“ schaltet, findet man diese Faulenzmomente plötzlich gemütlich. Mittlerweile kann ich aber sagen, dass das profane Leben nichts im Vergleich zu dem Leben ist, das wir im Theater führen. Dieses ständige Bemühen um Qualität, dieser dauerhafte Versuch, fremde Menschen zusammenzubringen, dieses Gefühl, Dirigenten beim Austausch mit dem Orchester zu beobachten oder Regisseure ein erstes Mal zu treffen – all das ist unfassbar aufregend. Für mich ist es ganz klar: Ein Leben ohne Kultur ist nicht lebenswert. Unsere Aufgabe als Kulturschaffende ist es nun, auch unser Publikum davon zu überzeugen und zum Kommen zu bewegen. Das gelingt nur mit erstklassiger Qualität, die sich wiederum nur finanzieren lässt, wenn die Auslastung hoch genug ist.
Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch in der Kultur Gräben hinterlassen. An vielen Opernhäusern haben russische Künstler, die sich nicht sofort von Putin distanziert haben, ihre Engagements verloren. Darunter
„GERADE
Bernd Loebe wurde 1952 in Frankfurt am Main geboren, wo er Jus studierte und ein privates Klavierstudium absolvierte.
Zunächst war er viele Jahre als Musikjournalist tätig, unter anderem für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Neue Musikzeitung“, die „Opernwelt“ und den Hessischen Rundfunk. Im November 1990 berief ihn das Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel als Künstlerischen Direktor. Ab September 2000 wirkte er als Berater an der Oper Frankfurt mit, die ihn mit der Spielzeit 2002/2003 zum Intendanten berief. Der ursprünglich bis 2013 laufende Vertrag wurde mehrfach verlängert und läuft aktuell bis zum Jahr 2028. Seine Wirkungsstätte in Frankfurt wurde in seiner Intendanz bereits vier Mal zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt. Seit mehreren Jahren hatte Bernd Loebe das Amt des Vizepräsidenten der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste inne. Im Juni 2010 wurde er überdies zum Vorsitzenden der Deutschen Opernkonferenz gewählt. Im September 2019 hat Loebe die Intendanz der Tiroler Festspiele Erl übernommen. Sein Vertrag läuft vorläufig bis zum Jahr 2024.
Stars wie Anna Netrebko oder Valery Gergiev, der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Finden Sie es angemessen, dass Kultur und Politik so verquickt werden? Bei den genannten Persönlichkeiten kann ich nachvollziehen, dass man sich diese Fragen gestellt hat. Ich persönlich hätte aber an der Stelle des Oberbürgermeisters von München mit Herrn Gergiev ein persönliches Gespräch gesucht, um eine Lösung zu finden. Ich fand es unangebracht, Herrn Gergiev wie einen Schulbuben zu behandeln und ihm vorzuschreiben, sich binnen drei Tagen von Putin zu distanzieren. Das ist eine Forderung, die unmöglich ist.
Auch in Frankfurt und Erl stehen russische und weissrussische Künstler auf den Besetzungslisten. Müssen sich diese von Putin distanzieren? Ich glaube nicht, dass wir den sogenannten kleinen Mann für die Untaten der politischen Führer bestrafen sollten. Gerade die Musiker aus Russland, Weißrussland und der Ukraine sind schon genug mit diesem Krieg bestraft. Man sollte diesen Menschen die Hand reichen und sie nicht in eine Ecke stellen. In Erl bekommen alle Künstler mit ihrem Vertrag einen Text, den sie unterschreiben sollten. Darin steht, dass sie sich von den aggressiven Vorgängen, die sich in der Ukraine tun, distanzieren. Darüber hinaus wollen wir unsere Künstler keinem moralischen Test unterziehen. Aber ich gehe davon aus, dass es für alle selbstverständlich sein wird, gegen einen Krieg zu sein.
Sie haben die Intendanz in Erl im September 2019 auf Bitten von Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner hin übernommen, nachdem die Ära von Festspielgründer Gustav Kuhn bedingt durch Missbrauchsvorwürfe unrühmlich zu Ende ging. Warum haben Sie sich das angetan? Im Wesentlichen war es so, dass Herr Haselsteiner mir damals in einem sehr ehrlichen Gespräch die Situation in Erl schilderte und dabei auch den Wunsch äußerte, dass jemand mit einer gewissen Professionalität und viel Know-how das Festival übernehmen und in die Zukunft führen möge. Ich habe mich angesprochen gefühlt und schnell zugesagt, weil ich das Engagement in Erl als spannenden Kontrast zu meiner Tätigkeit in Frankfurt empfinde. Hier arbeite ich im Herzen einer Metropole, wo es im Jahr 200 Vorstellungen mit einem der weltweit größten Ensembles zu stemmen gilt. Und dann ist da Erl, dieses naturbelassene Dorf in den Bergen, das gleichwohl hohe Ansprüche an die Kultur stellt und sich um ein humanes Miteinander und ein differenziertes Programm bemüht. Das habe ich als reizvolle Aufgabe empfunden und tue es bis heute: Die Arbeit in Erl beglückt mich. Was aber nicht heißt, dass wir hier im Paradies leben. Auch in Erl müssen wir rechnen und uns mit Subventionsanträgen und Auslastungszahlen auseinandersetzen. Wir können nicht einfach unsere Ressourcen überziehen und sagen „Der Haselsteiner wird das schon richten“.

„FÜR





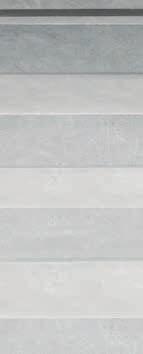
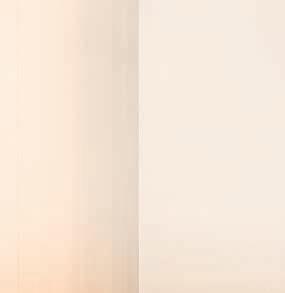






Ausgelastet wären Sie auch ohne Ihr Engagement in Tirol: Seit 2002 sind Sie Intendant der Oper Frankfurt, die in Ihrer Amtszeit bereits vier Mal zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt wurde. Wieviel Zeit bleibt Ihnen da überhaupt, in Erl leibhaftig vor Ort zu sein? Im Juni und Juli bin ich fast acht Wochen in Erl. Im Winter verbringe ich hier drei bis vier Wochen. Auch bei den Klaviertagen und den Erntedanktagen bin ich vor Ort und ich achte auch darauf, dass ich zwischendurch immer wieder nach Erl komme. Überdies kommt mein engster Mitarbeiter in Erl regelmäßig nach Frankfurt, um mit mir die wichtigsten Dinge persönlich zu besprechen. E-Mails gehen sowieso jeden Tag hin und her. Es vergeht also kein Tag, an dem ich nicht zumindest virtuell in Erl bin.
Heuer steht mit „Die Walküre“ erneut eine Wagner-Oper auf dem Programm. Regie führt dabei Brigitte Fassbaender, die langjähri -
ge Intendantin des Tiroler Landestheaters, die im Vorjahr schon „Rheingold“ inszeniert hat. Hat Sie das viel Überredungskunst gekostet? Nein! Ich kenne Brigitte schon sehr lange, auch von ihrer Arbeit in Frankfurt. Im April war sie gerade vor Ort, um „A Midsummer Night’s Dream“ von Benjamin Britten zu inszenieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie speziell für diese jüngere Sängergarde, die wir in Erl haben, mit all ihrer Nächstenliebe, ihrem Wissen über Menschen und ihrem unnachahmlichen Handwerk ideal sein würde. „Rheingold“ war ein riesiger Erfolg, und ich bin schon ganz gespannt, wo sie uns jetzt hinführen wird. „Die Walküre“ hat ja eine ganz andere Sprache als „Rheingold“ und führt uns weg von dieser – mit Verlaub – durchgeknallten Familie. Als Bühnenbildner mit dabei ist Kaspar Glarner, der eine internationale Karriere verfolgt und mit dem ich auch schon lange verbunden bin. Mit Erik Nielsen am Pult haben wir jemanden gefunden, der dank seines humanitären Zugangs vom Orchester
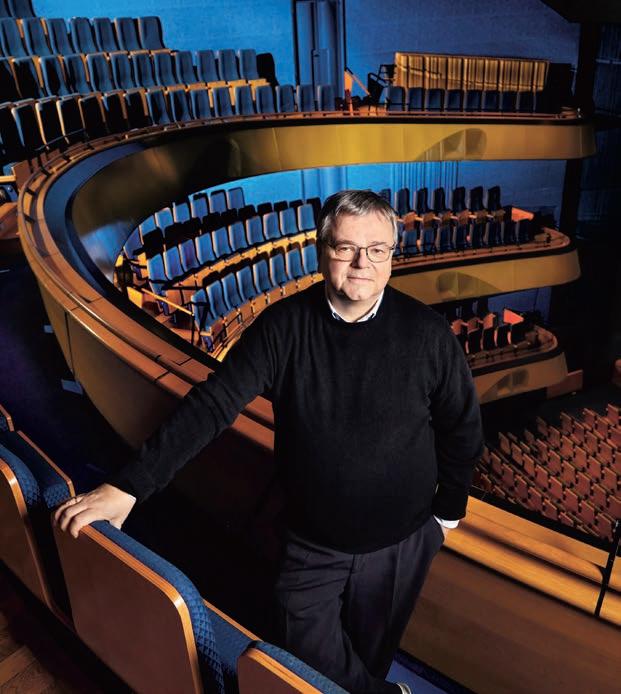
und den Sängern geliebt wird. Das sind gute Aussichten für den Sommer!
Warum passt Richard Wagner so gut nach Erl? Die akustischen Bedingungen sind einfach ideal: Das Orchester sitzt hinter den Sängern, die sich wie in einem antiken Raum bewegen können. Das verleiht Erl eine ganz besondere Note. Die Sänger müssen nicht schreien, sondern sie können zu uns sprechen. Sobald ich das Gefühl habe, dass mich ein Sänger mit Lautstärke überzeugen will, zucke ich zurück. Wenn Sänger allerdings zu mir flüstern, dann stellen sich meine Ohren auf und ich rücke im Sessel ein Stück nach vorne. Solche Momente sind sowohl im Passionsspielhaus als auch im Festspielhaus möglich.
Ihre Ära in Frankfurt dauert noch bis 2028, wie lange werden Sie Erl erhalten bleiben? Meine Planungen in Erl laufen vorläufig bis 2024. Alles, was danach ist, werde ich mit Herrn Haselsteiner besprechen. Wir sind ja beide nicht mehr so taufrisch, insofern muss man auch gewissenhaft mit Zukunftsfragen umgehen und einschätzen können, ob man den Aufgaben noch gewachsen ist. Vereinbart ist, dass wir im Laufe dieses Sommers zu einem „weißen Rauch“ gelangen werden. Wenn man mir dann sagen würde, dass die Tiroler Festspiele dank meiner Arbeit wieder gut dastehen und jetzt eine jüngere Crew zum Zug kommen soll, werde ich nicht zornentbrannt den Raum verlassen. Aber jetzt konzentriere ich mich einmal auf die Festspiele im Sommer, auf die ich mich sehr freue.
Ihr Vorgänger in Erl liess sich gern Maestro rufen. Wie wollen Sie genannt werden? Maestro finde ich ein bisschen kindisch. So eine Anrede würde ich mir verbitten. Auch der Doktor, der mir in Österreich oft unterstellt wird, behagt mir gar nicht. Ich bin Bernd Loebe. Das langt eigentlich.
Christiane_Fasching
Since September 2019, Bernd Loebe, the artistic director of the Frankfurt Opera, has also been setting the tone at the Tiroler Festspiele Erl. Find out more about how Bernd Loebe came to be in charge, what‘s on the program this year, and what he thinks of false titles.
the Frankfurt Opera has been named “Opera House of the Year” four times. For several years, Bernd Loebe has also held the title of Vice President of the German Academy of Performing Arts. In June 2010, he was also elected chairman of the German Opera Conference.
In September 2019, Loebe also took over the directorship of the Tyrolean Festival Erl and thus a not entirely easy legacy from the time of Gustav Kuhn: “Essentially, at that time, Festival President Hans Peter Haselsteiner described the situation in Erl to me in a very honest conversation and also expressed the wish that someone with a certain professionalism and a lot of know-how should take over the festival and lead it into the future. I felt addressed and quickly accepted, because I find the commitment in Erl an exciting contrast to my work in Frankfurt.” His contract will run until 2024. The next step will be decided this year together with Hans Peter Haselsteiner.

It was by no means a foregone conclusion that Bernd Loebe would become a theatre director and even end up in Tyrol one day. He was born in 1952 in Frankfurt am Main, where he studied law and completed private piano studies. Initially, he worked for many years as a music journalist, among others for the “Frankfurter Allgemeine Zeitung,” the “Neue Musikzeitung,” the “Opernwelt” and the “Hessischer Rundfunk”. In November 1990, the Théâtre Royal de la Monnaie in Brussels appointed him Artistic Director. From September 2000, he worked as an advisor to the Frankfurt Opera, which appointed him artistic director for the 2002/2003 season. His contract, which originally ran until 2013, has been extended several times and currently runs until 2028. During his time as director,
For the time being, Wagner’s Valkyrie is scheduled for this summer under the direction of Brigitte Fassbaender. Because Wagner is particularly suited for Erl, as Loebe finds: “The acoustic conditions are simply ideal: the orchestra sits behind the singers, who can move around as if in an ancient room. That gives Erl a very special touch.” Despite all his successes, the director of Erl does not want to be called a maestro like his predecessor, and he is also happy to refrain from the typical Austrian addiction to academic titles: “I find maestro a bit childish. I would forbid myself such a title. I am Bernd Loebe. That’s actually enough.” More about the program and advance ticket sales at www.tiroler-festspiele.at
OLYMPIAHALLE
FAST FERTIG! So heißt das neue hemmungslos alberne, grammelsche Bühnenspektakel. Aber Spandaus ganzer Stolz und blondgesträhnter Puppet Comedy-König feilt natürlich wie gewohnt noch bis zur allerletzten Sekunde an seinem bisher definitiv verrücktesten und emotionalsten Programm. Man kann sich also auf einige wilde Überraschungen freuen!

OLYMPIAHALLE
Wolfgang Ambros und der No.1 vom Wienerwald, Klaus Eberhartinger, die EAV-Legende als Gailtalerin, Joesi Prokopetz als Knecht und Vater und Christoph Fälbl werden in der spektakulären Original-Inszenierung noch einmal die zahllosen Fans begeistern.
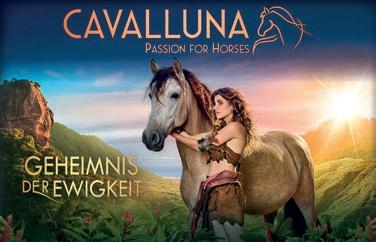
OLYMPIAHALLE
Das Zusammenspiel



Das AUDIOVERSUM ist ein interaktives Museum rund ums Hören in Innsbruck. Es ist ein Ort, an dem die Forschung und die Lehre über das menschliche Gehör dem Publikum spielerisch vermittelt wird. Gleichzeitig ist das Science Center aber auch Raum für die Kunst.
erzeit locken gleich zwei neue Sonderausstellungen ins AUDIOVERSUM. In der „SenCity“ begibt man sich auf einen kunstvollen akustischen Städtetrip. Eine Ausstellung der bekannten Wiener Künstlerin Deborah Sengl in einer Augmented-Audio-Installation von Sonic Traces. Ein gemaltes Stadtlabyrinth in 3D, das man durch Bewegung und Zuhören erobert. Die von Deborah Sengl gemalten Fassaden wurden in Menschengröße nachgebaut und so zu einer 3D-Welt aus Orient und Okzident.
Die Stadt Hören.
Mit Kopfhörern taucht man in eine laute, aufwühlende Stadt ein, erlebt aber auch die beruhigende Welt der natürlichen Stille. Wahlweise wird man in ein Rätselspiel versetzt oder von verschiedenen Klängen eingehüllt. Im Interview bekommt man spannende Hintergrundinformationen zur Ausstellung und dem Immerlauter-Werden unserer Welt.
Eigene Vielfalt entdecken.
Die Ausstellung „Du bist einzigARTig“ beschäftigt sich hingegen mit der vielfältigen Einzigartigkeit des Homo sapiens. Jeder Mensch besitzt Merkmale und Fähigkeiten, die ihn unverwechselbar machen. In der neuen Sonderausstellung kann man diese Einzigartigkeit nun
abmessen, testen, anfühlen und bestaunen. Man lernt dabei sich selbst und seine Besonderheiten ganz neu kennen. Eine interaktive Ausstellung für das einzigartige Ich-Gefühl inmitten der vielfältigen Spezies Mensch.

Audioversum für zuhause.
Übrigens kann man sich das interaktive Museum auch jederzeit nach Hause holen: Der AUDIOVERSUM-Podcast ist über die Website abrufbar und richtet sich an alle Menschen, die Freude am guten Zuhören haben.
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck +43(0)5 7788 99, office@audioversum.at www.audioversum.at

Über Lärm und Stille im akustischen Museum. Ein Interview mit Julia Sparber-Ablinger, Head of Audioversum.

Was hat das Thema Lärm mit der neuen Sonderausstellung SenCity zu tun?
Julia Sparber-Ablinger: Mit SenCity präsentiert das Audioversum eine 3D-Klangstadt, in der die Besucher:innen optisch und akustisch eintauchen können. Wie klingt eine Stadt und ab wann wird aus Geräuschen Lärm? Diese Fragen stellen wir unseren Besucher:innen und machen auch auf Lärmschutz aufmerksam.
Was fasziniert Dich am meisten daran? Unsere Ohren können wir nicht verschließen – wie unsere Augen. Sie sind immer „wach“ und können sich vor störenden Geräuschen nicht so einfach schützen. Trotzdem ist der akustische Reiz ein so wichtiger für uns Menschen, wir verbinden unsere Identität, unser Wissen, jegliches Erkennen und Erinnern damit. Die Ausstellung SenCity macht dies ganz eindrücklich bewusst – man macht einen Städtetrip mit den Ohren.
Erwartet die Besucher eine lärmende Stadt in der SenCity? Die SenCity klingt mancherorts unangenehm, weil zum Beispiel Baustellenlärm oder startende Flugzeuge zu hören sind. Im AUDIOVERSUM wird der Lärm aber so dosiert, dass er uns bewusst wird, uns aber keinesfalls schädigen kann. Auch leise Töne sind dabei, die ein konzentriertes Zuhören erfordern. Wenn das Gedicht der Schriftstellerin Barbara Hundegger zu hören ist oder wenn sich Kathi Lärm und Vicky Fanfare aufmachen, die Friedensglocke zu suchen. In der SenCity herrscht Frieden, laut und leise. Die realen Erfahrungen der Lockdowns haben uns gezeigt, dass eine durchgängig beruhigte Stadt auch
kein Ziel sein kann, wenngleich ein „immer lauter, schneller, greller“ ebenso enden wollend ist. So lotet die Ausstellung zwischen dem anthropogenen Lärm –also den von Menschen gemachten Geräuschen – und der natürlichen Stille aus und wie sehr sich unser Gehörsinn darauf einlassen kann.
Würdest Du sagen, dass die Welt tatsächlich lauter geworden ist? Die rasanten sozialen, technischen und wirtschaftlichen Veränderungen des letzten Jahrhunderts brachten eine gesteigerte Lautsphäre mit sich. Um 1900 sprach man von einer „Brandung der Großstadt“, heute kommt man einer „Dauerbeschallung“ kaum mehr aus, weil die Mobilität noch gesteigert, die technischen Entwicklungen noch erweitert wurden. Ob die Welt tatsächlich lauter geworden ist, kann man allerdings nur schwer feststellen, denn Geräusche hinterlassen keine archäologischen Spuren.
Welche bewusste oder unbewusste Rolle spielt das Thema Lärm im Leben der Menschen? Der Begriff Lärm ist keine messbare Größe, erst durch individuelle oder soziokulturelle Aspekte können Schallwellen wirklich störend werden. Die um die Ohren summende kleine Mücke, die unsere Nachtruhe stört, kann furchtbar laut sein. Der große Subwoofer, aus dem coole Musik zu hören ist, oft nicht laut genug. Wer was wie hört, ist sehr individuell und hängt von verschiedenen Faktoren ab – vom allgemeinen Gesundheitszustand oder auch von der persönlichen Einstellung. Grundsätzlich hilft das Bewusstsein, dass unser Gehör ein sensibles, schützenswertes Organ ist, aber auch, dass die Lebensfreude ab und zu lautstark daherkommen darf. Wer den akustischen Städtetrip zwischen Orient und Okzident durchläuft, wird erleben, wie eine Umkehrung der Sinne möglich wird –wenn also die Ohren Augen machen!
SCHWAZ HAT IM LAUFE DER JAHRHUNDERTE VIELES ERLEBT. DIE GESCHICHTE DES ORTES WURDE IN DEN LETZTEN 200 JAHREN MASSGEBLICH VON DER TABAKFABRIK MITGEPRÄGT.
Das Portierhäuschen mit Haupteingang der Tabakfabrik



In Glanzzeiten war die Tiroler Tabakfabrik in Schwaz Arbeitgeber für bis zu 1.200 Menschen, vor allem für Frauen, pro Jahr wurden bis zu 5,5, Milliarden Zigaretten nach ganz Europa exportiert. Nach 175 Jahren haben sich deren Werkstore 2005 geschlossen. Ein wichtiges Kapitel der Tiroler Industrie- und Sozialgeschichte wurde damit zu Ende geschrieben.
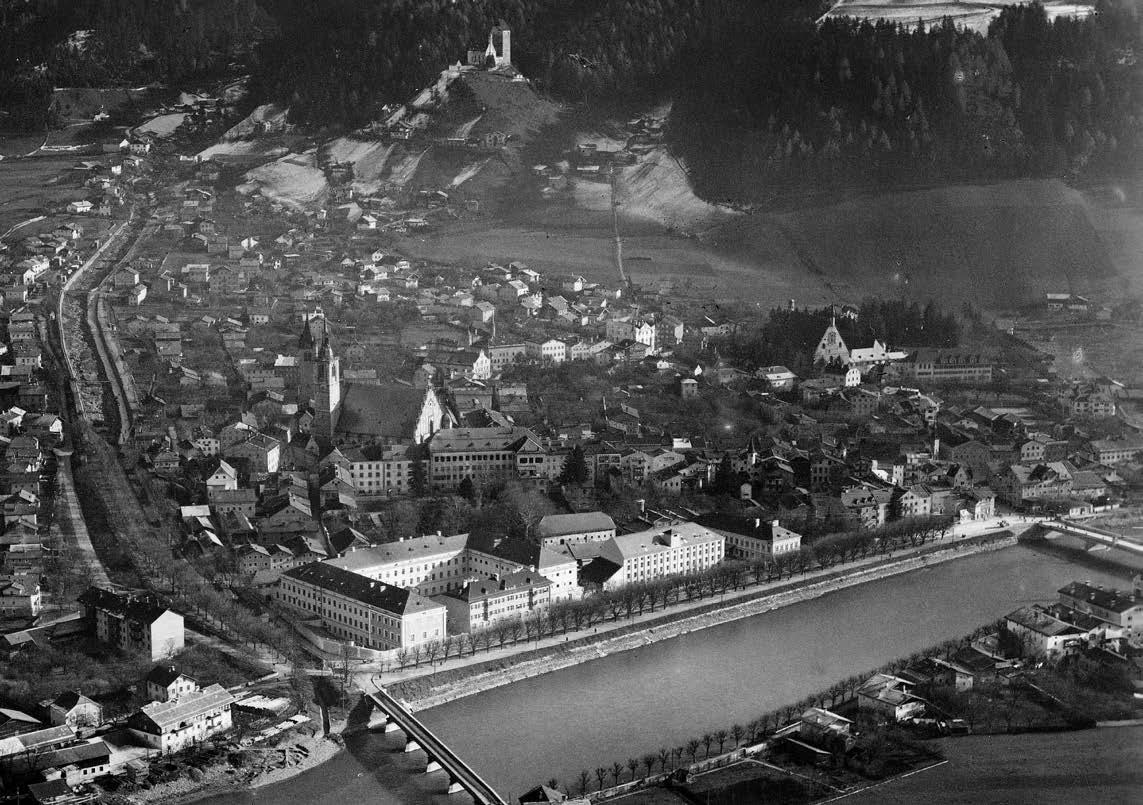
Die Geschichte des Tabaks in Österreich erzählt von Monopolisierung und Tabakprivilegien für den Freiheitskampf, von Schmuggel und illegalem Anbau und dem Rauchen als Rebellion. Tatsächlich wurde Tabak in Europa – wie so vieles herübergeschwappt aus Amerika – zu Beginn ähnlich dem Zucker oder Schokolade als ebenso wertvolle wie hochpreisige Apothekerware gehandelt.
Es waren vermutlich Bauern aus der Pfalz, die um 1570 die ersten Tabakpflanzen in das Gebiet der österreichischen Kronländer brachten, auch wenn es dafür keine wirklichen Belege gibt. Sicher indes ist, dass um diese Zeit der Tabakkonsum recht stark anstieg und im 17. Jahrhundert bei Männern wie Frauen aller sozialen Schichten verbreitet war. Nicht unschuldig an der Verbreitung war der Dreißigjährige Krieg, als Söldnerheere ihr „Soldatenkraut“ unter die Leute brachten. Gern gesehen war das nicht, nicht zuletzt wegen der Feuergefahr, die von den Rauchenden ausging. Letztlich aber fand der Staat die Steuereinnahmen doch zu verlockend. In weiterer Folge wurde der Tabakhandel monopolisiert. Im Jahr 1784 wurde die Österreichische Tabakregie unter Kaiser Joseph II. als sogenanntes Vollmonopol für alle österreichischen Länder gegründet. Dieses war unter anderem zur Versorgung von Kriegsinvaliden gedacht, die bei der Zuteilung der Verschleißstellen bevorzugt wurden. Daneben wurden auf diese Weise schuldlos verarmte Be-

Tiroler Zigarren für die Welt Maria Heidegger und Marina Hilber, herausgegeben von Günther Berghofer Tyrolia Verlag, 168 Seiten, EUR 19,95
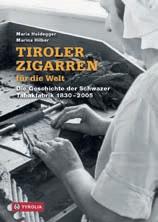
Zum 190-jährigen Jubiläum ihrer Gründung erzählen die Autorinnen die Geschichte der Tabakfabrik, aber auch des Tabaks in Tirol und bieten dazu viele bisher unveröffentlichte Fotos. In 15 Kapiteln folgen sie der Schwazer Fabrik von ihren Anfängen im Jahr 1830 bis zu ihrem Niedergang 2005. Und nicht zuletzt wird erstmals auch die Geschichte der Nachnutzung des ehemaligen Fabrikgeländes – die Stadtgalerien Schwaz – als Teil der Stadtgeschichte dargestellt.
amte versorgt. Das Monopol schwächte zwar die Lage der Tabakbauern, andererseits gab es ihnen in Krisenzeiten Sicherheit. 1828 wurde das Tabakmonopol, das bis dato nur bis Salzburg ging, unter Kaiser Franz Joseph I. schließlich auf Tirol ausgeweitet, auch weil Zigaretten, Zigarren und Kautabak einen großen Boom erlebten.
Schwaz und seine Tschiggin.
Die vom österreichischen Kaiserreich im Jahr 1830 ganz bewusst in Schwaz angesiedelte Tabakfabrik sollte nach dem Niedergang des Bergbaus und dem Brand von 1808 dem völlig verarmten Markt eine neue Perspektive eröffnen. Sie entwickelte sich durch Grundzukäufe und die laufende Erweiterung der Produktion rasch zu einem Wirtschaftsmotor für die ganze Region, beeinflusste das Leben mehrerer Generationen von Schwazerinnen und Schwazern sowie deren Familien und prägte jahrzehntelang das Bild des Ortes. Nicht zuletzt ist die Geschichte der Schwazer Tabakfabrik eng mit der Wirtschaftsgeschichte Tirols in dieser Zeit verwoben, war die Fabrik doch vor allem Arbeitgeberin für zahlreiche Frauen und in dieser Rolle auch Vorreiter in sozialen Belangen. Einrichtungen wie eine Betriebsküche und -badeanstalt, eine eigene Kinderkrippe und Säuglingsstation, ein Fabriksarzt und zunehmende Krankheits- und Altersvorsorge für die Belegschaft leisteten in vielerlei Hinsicht sozialpoliti-
„IN
schen Entwicklungen Vorschub. „Die Tabakfabrik war ein Markstein in der Gemeinde Schwaz und hat einfach zu Schwaz gehört. Wenn ein Unternehmen 175 Jahre lang im Zentrum eines Ortes liegt, ist das fast unweigerlich so. Schon als Kind war die ‚Tschiggin‘ für uns eine Selbstverständlichkeit“, erzählt Günther Berghofer, Herausgeber des Buches „Tiroler Zigarren für die Welt“ und für die Nachnutzung des Areals mit den Stadtgalerien und dem SZentrum verantwortlich. Beides wurde 2012 eröffnet, das originale Portal der ehemaligen Tabakfabrik wurde zum Erinnerungsort in den Stadtgalerien.
Zu Beginn waren rund 50 Menschen in der Schwazer Tabakfabrik beschäftigt, 1899 erhöhte sich der Stand auf über 1.200 – das entsprach rund einem Drittel der Schwazer Bevölkerung. Zu dieser Zeit wurden rund drei Millionen Zigaretten hergestellt, 1984 waren es zwei Milliarden! „In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ließ die sehr sozial eingestellte Werksleitung Wohnhäuser für die Arbeiter errichten – unter anderem den Dorrek-Ring und den Wlasak-Hof – und setzte damit auch Impulse in der Stadtentwicklung, die bis heute nachwirken“, so Berghofer im Vorwort des Buches. „Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Produktion weiter an. Die Austria Tabakwerke, ein staatlich geführtes Unternehmen, produzierten in Schwaz bis zu 5,5 Milliarden Zigaretten pro Jahr, die in ganz Europa vertrieben wurden. Umso tiefer war der Einschnitt, als die Austria Tabak privatisiert und im Jahr 2001 vom britischen Gallaher-Konzern übernommen wurde.“ Die Briten
gaben eine Beschäftigungs- und Standortgarantie bis 2004 ab, mit Ablauf der Frist wurde das Werk geschlossen.
Das Ende der Schwazer Tabakfabrik nach 175 Jahren Bestand war leider unrühmlich. Was hat das damals mit der Stadt und den Einwohnern gemacht, wenn ein solcher Meilenstein zu Ende geht? Günther Berghofer: Es war in der Tat nicht schön. Als das Werk privatisiert wurde und an Gallaher überging, waren viele verunsichert und wie man sieht, nicht zu Unrecht. Angeblich sei das Werk nicht mehr rentabel gewesen. In der Gemeinde hat man folglich über verschiedene Entwicklungskonzepte nachgedacht und mir war klar,
dass ein so großes Areal im Zentrum der Stadt großes Potenzial birgt.
Was war Ihre Intention, ein Buch über die Tabakfabrik herauszugeben? Ich wollte, dass die Geschichte der Tschiggin, die 175 Jahre lang an diesem Ort bestand, nicht vergessen wird. Sie war eine Institution. Das Buch soll einen Bogen spannen von der Hochblüte der Region im 14. und 15. Jahrhundert der Silberzeit über die Napoleonischen Kriege, während derer Schwaz seinen Tiefpunkt erlebt und sich große Armut über die Stadt gelegt hat, bis zu ihrem Aufschwung und ins Heute. Gerade jungen Leuten möchte ich diese Geschichte wieder ins Bewusstsein rufen.
Marina_BernardiArbeiterinnen beim Lösen der Einlagentabake auf dem Löseband, 1956


Mahla-Klammeranschlagmaschine für die Konfektionierung von Verpackungen, 1907
In its heyday, the Tyrolean Tobacco Factory in Schwaz employed up to 1,200 people, mainly women, and exported up to 5.5 billion cigarettes a year to the whole of Europe. After 175 years, their factory gates closed in 2005. This marked the end of an important chapter in Tyrolean industrial and social history.

It was probably farmers from the Palatinate who brought the first tobacco plants to the Austrian crown lands around 1570, although there is no real evidence of this. What is certain, however, is that tobacco consumption grew quite strongly around this time and was widespread among men and women of all social classes in the 17th century. The Thirty Years’ War, when mercenary armies brought their “soldier’s herb” to the people, played no small part in the spread of tobacco. This was not welcomed, not least because of the fire hazard posed by the smokers. Ultimately, however, the state found the tax revenue too tempting. As a result, the tobacco trade was monopolized.
In 1830, the Austrian Empire built the tobacco factory in Schwaz. After the decline of mining and the fire of 1808, it was intended to open up new prospects for the completely impoverished market. Through land acquisitions and the ongoing expansion of production, it quickly developed into an economic engine for the entire region. Last but not least, the history of the Schwaz Tobacco Factory is closely interwoven with the economic history of Tyrol at this time, as the factory was above all an employer for numerous women and in this role also a pioneer in many social issues. After many successful years, Austria Tabak was privatized in 2001 and taken over by the British Gallaher Group, which closed the factory in 2005. “The tobacco factory was a landmark in the Schwaz community and simply belonged to Schwaz. When a company is located in the centre of a town for
175 years, this is almost inevitable. Even as a child, the so called ‘Tschiggin’ seemed natural to us,” says Günther Berghofer. He is the publisher of the book “Tiroler Zigarren für die Welt” (Tyrolean Cigars for the World) and in charge of the subsequent use of the area with the City Galleries and the SZentrum. Both were opened in 2012, and the original portal of the former tobacco factory became a place of remembrance in the City Galleries.
Die Erfolgsgeschichte der Tiroler Industrie ist eng mit der Industriellenvereinigung Tirol, die 2022 ihr 75-jähriges Bestehen feiert, verknüpft. Im historischen Sitzungssaal der WK Tirol in Innsbruck schlossen sich am 13. März 1947 Tiroler Unternehmer zu einer freien Interessenvertretung zusammen. Aus heutiger Sicht kann diese Gründerversammlung der „Vereinigung Österreichischer Industrieller, Landesgruppe Tirol“ auch als Beginn einer Entwicklung gesehen werden, die Tirol im Laufe der vergangenen 75 Jahre zu einem modernen Standort für Unternehmer und ihre Ideen etabliert hat. Damals wie heute geht es der Industriellenvereinigung Tirol (IV-Tirol) mit ihren Mitgliedern darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen samt ihren Arbeitsplätzen im Lande abzusichern und laufend weiterzuentwickeln.
Eine rasante Entwicklung.
Beschäftigte die Tiroler Industrie 1947 noch 18.000 Mitarbeiter – es herrschte akuter Personalmangel –, so sind es 2021 an die 40.000 Menschen, die in über 400 Unternehmen sichere Ganzjahresarbeitsplätze finden. Nach dem Krieg waren es vor allem die Neugründungen, welche die Lage wirtschaftlich
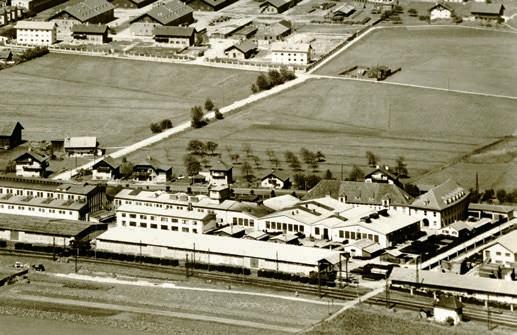
verbesserten. Die Tiroler Röhren- und Metallwerke AG in Hall oder die Biochemie in Kundl – heute Sandoz/Novartis – stiegen damals rasch zu führenden Industrieunternehmen auf. Der Betrieb in Hall wurde auf „grüner Wiese“ gebaut, die Produktion um 1949 aufgenommen. Es wurde vermerkt: „Erst nach mühevoller Arbeit konnten Arbeitsplatz für Arbeitsplatz die notwendigen Fachkenntnisse angelernt und das klaglose Zusammenwirken erreicht werden. Der Großteil der Belegschaft war industriefremd und aus den verschiedensten Berufen.“ Auch heute herrscht – zwar aus anderen Gründen – ein großer Mangel an qualifizierten Fachkräften, der sich sehr negativ auf das Wachstum vieler Unternehmen auswirkt. Dennoch erzielt die Tiroler Industrie einen Produktionswert von immerhin 12,5 Milliarden Euro (2021). Im Vergleich dazu lag die nicht wertbereinigte Industrieproduktion 1947 bei 315 Millionen Schilling –umgerechnet 23 Millionen Euro. Das gilt auch für die Industrieexporte, die 1947 bei etwa 80 Millionen Schilling (5,8 Millionen Euro) lagen. 2020 exportierte die Tiroler Industrie Güter im Wert von 6,3 Milliarden Euro. Zahlen, die den rasanten technologischen Fortschritt symbolisieren. Von der damals noch einfachen Fließbandarbeit einwickelte sich die industrielle Produktion immer weiter

hin zur Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0.
Industrie heute.
Gegenwärtig markieren Industrie 4.0 und Digitalisierung wohl den größten industriellen Wandel in der Geschichte, der nicht nur die Arbeit und die Produktion, sondern die ganze Gesellschaft noch radikal verändern wird. Dennoch bleiben die Namen großer Pioniere unvergessen: Von Daniel Swarovski über Paul Schwarzkopf (Plansee) bis hin zu Ernst Brandl oder Hans Margreiter, die Entdecker des säurestabilen Penicillins, des ersten oral anwendbaren Antibiotikums. Längst sind aber auch mittlere und kleine Nischenspezialisten sowie internationale Leitbetriebe Systemträger geworden. Osttirol beispielsweise hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer sehr starken Industrieregion entwickelt. Innovativ und wachstumsorientiert sind aber auch die Betriebe in anderen Teilen Tirols – etwa Egger, Med-El, Tyrolit, INNO, die Adler-Werke oder Thöni Industriebetriebe. Es könnten noch weitere Namen und Leistungen von etwa 400 Industriebetrieben aufgezählt werden, um die Stärke dieses Wirtschaftszweiges zu verdeutlichen. Mit einem Anteil von 26 Prozent an der Bruttowertschöpfung ist die Industrie für Tirol heute unverzichtbar geworden.
Das Rablhaus ist kein Religions-, sondern ein Glaubensmuseum.

Vielleicht kann man das Leben tatsächlich wie ein Haus betrachten. Verschiedene Abschnitte oder Ereignisse symbolisieren verschiedene Räume. So geschieht es jedenfalls im Rablhaus am Weerberg, einem der wohl außergewöhnlichsten und spannendsten Museen Tirols.

Liebe, Ehe und Geburt gehören in die Schlafkammer (wie sollte es anders sein?), das tägliche Leben in die „gute Stube“, das leibliche Wohl in die Küche. Und weil der Mensch irgendwann krank wird und stirbt, gibt es im Rablhaus auch eine Kranken- und eine Sterbekammer. Wobei in früheren Zeiten viele Leben leider schon nach wenigen Stunden oder Tagen in der Schlafkammer geendet haben.
So einfach dieses Konzept, umso tiefer rührt der Hintergrund dieses einzigen Museums im gesamten Alpenraum, das sich der Alltagsreligion und Volksmedizin widmet. Denn das Leben früherer Menschen – und vermutlich nicht nur der – war geprägt von einer tiefen Frömmigkeit. Glaube und Aberglaube waren kaum voneinander zu trennen, die Grenze war unscharf und verschob sich immer wieder. Diese faszinierende, zuweilen auch etwas unheimliche, düstere Welt wird in den wenigen Räumlichkeiten des atmosphärischen Hauses eingefangen.
Spezialisierung statt Heimatmuseum.
Wie viele andere Kleinode wäre um ein Haar auch das Rablhaus abgerissen worden. Nur eine einzige Stimme im Gemeinderat von Weerberg gab den Ausschlag, dass dies nicht passierte. Das Häuschen selbst stammt mindestens aus dem 17., vielleicht sogar aus dem 16. Jahrhundert. Belegt ist jedenfalls, dass es 1750 renoviert wurde. Der letzte private Besitzer überschrieb das Rablhaus dem Bürgermeister unter

Kirchgasse 17 (Postadresse: Reindlfeld 21) 6133 Weerberg www.rablhaus.at
Geöffnet von Mai bis in den Spätherbst Do. bis So. von 14 bis 17 Uhr
der Bedingung, dass die Gemeinde für seine minderjährigen Kinder sorgen sollte. Lange Zeit diente es folglich als Wohnhaus ärmerer Gemeindebürgerinnen und -bürger, ehe ein klassisches Heimatmuseum daraus wurde.
Hier kommt die Ethnologin Andrea Aschauer ins Spiel, die 2008 eine wissenschaftliche Aufnahme der Sammlung vornahm. Damals war das Land Tirol bestrebt, wenigstens ein paar der zahllosen Heimatmuseen zu spezialisieren. Da sich unter den Exponaten des Rablhauses einige Objekte für den Volksglauben befanden, fiel schließlich der Entschluss, ein Spezialmuseum für Volksglaube, Glaube und Aberglaube zu gestalten. Andrea Aschauer erhielt den Auftrag, diesen Schwerpunkt zu setzen, 2012 wurde das Rablhaus neu eröffnet, 2017 übernahm sie die Gesamtleitung des Museums. Wie sich bald zeigte, war es ein Schritt, der sich gelohnt hat, erzählt Aschauer: „Seit der Schwerpunktsetzung hat das Haus rasant an Besuchern gewonnen. Interesse besteht bei Jung und Alt, es sind Themen, die den Leuten sehr nahe sind.“
Glaube
muss nicht Religion sein.
Das Rablhaus, das ist Aschauer wichtig, ist kein Religions-, sondern ein Glaubensmuseum abseits der theologischen Lehrmeinung. Unter den Riten und Gebräuchen, dem, woran Menschen glaubten und glauben, findet sich viel, das in unterschiedlichsten Weltgegenden praktiziert wurde und wird. Etwa der Glaube an die Kraft der


„INTERESSE
Willkommen bei der ACHENSEESCHIFFFAHRT!
Steigen Sie ein, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich zu den schönsten Plätzen am Achensee entführen ...
Genießen Sie glückliche Momente auf dem kristallklaren Achensee, den Rundumblick auf die Bergwelt und die frische Brise bei uns an Bord!
www.achenseeschifffahrt.at Pertisau am Achensee/Tirol, Tel. +43 5243-5253, info@achenseeschifffahrt.at

Das Museum führt derzeit rund 4.500 Exponate in seiner Sammlung, von denen freilich nur ein Bruchteil ausgestellt werden kann.
Zähne von Wildtieren, die es bei amerikanischen Ureinwohnern ebenso gibt wie bei den Südtiroler Weinhütern, den Saltnern. Oder der Zauber mit Haaren und Blut, der ebenfalls auf der ganzen Welt vertreten ist. Auch den Wunsch, Naturgewalten wie Hagel, Blitz, Lawinen und Steinschlag gnädig zu stimmen, gab es vor der industriellen und technischen Revolution fast überall. Aschauer: „Die Basis ist interreligiös. Wir führen oft Gruppen durchs Haus mit ganz gemischtem religiösen Hintergrund, wo fast jede Teilnehmerin

 Andrea Aschauer
Andrea Aschauer
oder jeder Teilnehmer etwas aus seiner Tradition erkennt.“ Das Bedürfnis, ins eigene Schicksal auf irgendeine Art einzugreifen, sei tief in den Menschen verankert, meint die Ethnologin: „Der Mensch möchte nicht einfach dastehen und es geschehen lassen.“


Die Kirche hatte über die Jahrhunderte zu den diversen Phänomenen ein ambivalentes Verhältnis, erklärt die Ethnologin: „Da gab es ganz unterschiedliche Phasen. Einmal war sie aufgeschlossener, einmal kämpfte sie dagegen an. Was sie aber natürlich nicht wollte, war eine völlige Abkoppelung.“ Dies hätte bedeutet, ihre Schützlinge und damit ihren Einfluss zu verlieren. Daher wurde so manches – vielleicht auch zähneknirschend – integriert: Zum Beispiel die Verehrung von Reliquien, die Wallfahrt oder die Heiligenverehrung.
Modern und mobil.
Das Museum führt derzeit rund 4.500 Exponate in seiner Sammlung, von denen freilich nur ein Bruchteil ausgestellt werden kann. Doch seit letztem Jahr ist das Rablhaus auch mobil unterwegs. Aus einem Pool von Themen kann eines gewählt werden, das als entsprechendes Modul vor Ort kommt. Ein Konzept, das so richtig eingeschlagen hat, ist Andrea Aschauer erfreut: „Unser mobiles Museum wurde ganz stark aufgenommen. Damit können wir an Orte fahren, wo die Leute sich nicht unbedingt Kulturgenuss erwarten.“ Adressaten sind unter anderem Jugendliche, aber auch Senioreneinrichtungen. Neben der „räumlichen und zeitlichen“ Erweiterung – das Rablhaus ist relativ klein und muss ohne Heizung im Winter geschlossen werden – steht der Gedanke dahinter, dass die Besucherinnen und Besucher des mobilen Museums auch auf den Weerberg kommen. Denn die Fahrt lohnt sich allemal.
Uwe_Schwinghammer„UNSER
AUFGENOMMEN.“FOTOS: © MUSEUM RABLHAUS, ANDREA ASCHAUER


Perhaps life can actually be thought of like a house. Different stages or events symbolize different rooms. At least that‘s what happens in the Rablhaus on the Weerberg, probably one of the most unusual museums in Tyrol.

Love, marriage and birth belong in the bedchamber (how could it be otherwise?), daily life in the living room and physical well-being in the kitchen. And because people eventually fall ill and die, the Rablhaus also has a chamber for the sick and a chamber for the dying.
As simple as this concept is, the museum’s background is all the more profound as it is the only one in the entire Alpine region dedicated to everyday religion and folk medicine. Faith and superstition could hardly be separated from each other, the border between the two was blurred and also shifted again and again. This fascinating, at times somewhat eerie, gloomy world is captured in the few rooms of the atmospheric house.
The cottage itself dates back to at least the 17th, perhaps even the 16th century. In any case, it is documented that it was renovated in 1750. For a long time it
served as a residence for poorer citizens of the municipality, before it became a classic museum of local history. This is where folklorist Andrea Aschauer came into play, who in 2008 made a scientific record of the collection. At that time, the province of Tyrol was striving to specialize at least a few of the countless local history museums. Since among the exhibits of the Rablhaus there were some objects for folk belief, the decision was finally made to create a special museum for folk belief, faith and superstition. The Rablhaus, however, and this is important to Aschauer, is not a museum of religion but of faith: “The basis is almost interfaith. We often lead groups through the house with quite mixed religious backgrounds, where almost every participant recognizes something from his or her tradition.”
The need to intervene in one’s own destiny in some way is deeply rooted in people, the folklorist says: “People don’t want to just stand there and let it happen.”
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt bei Konsument*innen in sämtlichen Lebensbereichen – vom Konsumverhalten bei alltäglichen Gütern bis hin zu Versicherungsprodukten. Mit ambitionierten Maßnahmen verfolgt Uniqa das Ziel, Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit der heimischen Finanzbranche zu werden.
Nachhaltigkeit ist ein ehrlich gelebter und immer stärker werdender Teil unseres Kerngeschäfts, in allen Produkten, Bereichen und Abläufen“, betont UNIQA-Landesdirektor Michael Zentner: „Wir bekennen uns explizit zur Einhaltung der Pariser Klimaziele. Deshalb haben wir uns auch das klare Ziel gesetzt, die Klimaneutralität in Österreich bis 2040 zu erreichen – also zehn Jahre früher, als es das europäische Zwischenziel vorschreibt.“ Das weitreichende Bekenntnis zur Klimaneutralität habe konkrete Auswirkungen auf alle Geschäftsbereiche, von der Veranlagung bis hin zur Unternehmensführung. „Hier geht es nicht mehr um einzelne symbolische Maßnahmen, sondern um den notwendigen tiefgreifenden Wandel. Nachhaltigkeit umfasst bei UNIQA deswegen die ganze Firma und alle Unternehmensbereiche“, betont Zentner.
„Ein nachhaltiger Lebensstil unserer Kundinnen und Kunden muss auch bei der Veranlagung keine Ausnahme machen: Bei UNIQA stoßen insbesondere
die nachhaltigen Fonds auf reges Interesse. Der Absatz im Neugeschäft übersteigt bereits jenen der traditionellen Fonds, Tendenz steigend“, freut sich Michael Zentner.
Um den Kund*innen mit gutem Beispiel voranzugehen, setzt UNIQA in der eigenen Betriebsführung wichtige Klimaschutzmaßnahmen um. Dazu gehören unter anderem die Senkung des Stromverbrauchs und die Ökologisierung des Fuhrparks. Für die Analyse des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs in den rund 90 Service-Centern, den neun Landesdirektionen und in der UNIQA-Zentrale in Österreich

wurde das UNIQA-Energiemonitoring-System entwickelt. Es dient der zeitaktuellen Überwachung des Energieverbrauchs. Dieses Best-PracticeSystem in der Versicherungsbranche beweist laut Zentner den Ehrgeiz, den eigenen Energie- und Ressourcenverbrauch laufend zu minimieren. So konnten allein im Jahr 2020 österreichweit durch Effizienzmaßnahmen rund 300.000 kWh Strom und knapp 600.000 kWh an Fernwärme und Erdgas eingespart werden. Das entspricht vergleichsweise dem Jahres-Energieverbrauch von ungefähr 85 Haushalten.
In Tirol verfügen zudem alle eigenen Service-Center bereits über E-Tankstellen und in einigen Betriebsstätten wurden auch schon Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, um einen Großteil des Energieverbrauchs durch Sonnenstrom zu decken. Vor allem im städtischen Bereich kommen auch E-Bikes mehr und mehr zum Einsatz, „gut für das Wohl der Mitarbeitenden und gut für das Klima“, ergänzt Landesdirektor Zentner. Auch mit einigen nachhaltigen Sponsorings setzt die Tiroler Landesdirektion immer wieder Akzente.


Heute ist die Dogana einer der meistgebuchten Säle von Congress Messe Innsbruck. Der Saal fasst bis zu 3.000 Personen (Stehkonzert) und eignet sich bei variablem Aufbau und flexibler Bestuhlung für Veranstaltungen aller Art: Kongresse und begleitende Ausstellungen, Messen, Konzerte, Bälle, Präsentationen, Corporate Events und gesellschaftliche Veranstaltungen.

Oft ist die gerne erwähnte Auferstehung des Phönix aus der Asche ein Klischee, doch für die Innsbrucker Dogana stimmt der Vergleich: 1973 wurde aus der berühmtesten Bombenruine Innsbrucks ein moderner Kongress- und Veranstaltungssaal mit viel Geschichte und einem besonderen Charme.
Egal ob Konzerte von Wanda, Seiler & Speer, Bilderbuch oder Hubert von Goisern, ein goldenes Ärztejubiläum, Sitzungen des Tiroler Landtags oder die etwas größere Hochzeitsgesellschaft: Die Dogana der Congress Messe Innsbruck (CMI) bietet immer den geeigneten Rahmen. Das muss wohl an ihrer Schlichtheit und gleichzeitigen Eleganz liegen. Dabei war Schlichtheit nicht immer Ihres und der Name ist ohnedies irreführend. Den Namen Dogana und die Funktion eines Zollhauses haben dem pompösen Gebäude erst die Bayern während der Napoleonischen Kriege verpasst. Zuvor war die Dogana, was sie heute wieder ist: Theater, Sportstätte, Raum für allerlei Vergnügliches.
Ballspielhaus, Theater, Reitschule.
Der kunstsinnige Erzherzog Ferdinand II. ließ nicht nur das erste „Museum“ auf Schloss Ambras einrichten, sondern 1572 vor den Toren von Innsbruck ein kleines und zehn Jahre später ein großes „Ballonehaus“ errichten. Es diente einerseits den damals beliebten höfischen Ballspielen, aber auch Singspiele wurden dort aufgeführt. In den 1630er-Jahren wurde von Leopold V. für seine Gemahlin Claudia von Medici das große Haus zum ersten europäischen überdachten Saaltheater ausgebaut. So wie heute sah man der damaligen Architektur das Innenleben nicht an. Sichtbar aber waren die gewaltigen Ausmaße des Gebäudes: Es war 100 Meter lang, 30 Meter breit und zwölf Meter hoch. Auf ganzer Länge wurde es innen von Arkaden gesäumt, die heute noch vorhanden sind. Die Bühne war mit allen nur erdenklichen technischen Einrichtungen ausgestattet, sodass auch künstliche Seen und andere optische Ereignisse von wunderbarer Größe inszeniert werden konnten. Die Größe des Theaters
wurde allerdings rasch zum Problem, denn es ließ sich nicht mit ausreichend Publikum füllen. So wurde es nur wenige Jahre nach der Eröffnung zur Reitschule umgebaut und diente der Spanischen Hofreitschule in Wien als Vorbild.
Aus den Trümmern auferstanden.
Doch das war keineswegs die letzte Wandlung, die das Gebäude erfuhr: Unter Kaiserin Maria Theresia wurde es zur Universitätsbibliothek umfunktioniert, 1808 unter bayerischer Besatzung ein „Mauthamt und Waaren-Lager“. Am 16. Dezember 1944 ereilte das Haus, wie so viele in Innsbruck, das Schicksal: Es wurde von einer Bombe getroffen und blieb nach dem Zweiten Weltkrieg lange Jahre als die berühmteste Ruine der Stadt stehen.
Erst 1966 wurde beschlossen, den Platz für ein modernes Kongresszentrum zu nutzen. Ursprünglich wollte man die Überreste der Dogana abtragen, doch dann entschied man sich dafür, sie in ein neues Gebäude zu integrieren. Zum Glück. Gerade diese Kombination aus brutalistischer – inzwischen durchaus wertgeschätzter – Architektur und den alten, dicken Mauern mit den Arkaden aus dem 17. Jahrhundert macht den Charme der heutigen Dogana aus. 1973 wurde das Kongresshaus Innsbruck – der Name CMI kam erst später – offiziell eröffnet. Die Messen und Veranstaltungen, die seither dort stattgefunden haben, sind ohne Zahl. Uwe_Schwinghammer





DIE
ARCHITEKTUR UND DEN ALTEN, DICKEN MAUERN MIT DEN ARKADEN MACHT DEN CHARME DER HEUTIGEN DOGANA AUS.© STADTARCHIV INNSBRUCK, CMI
 DAS KAUFHAUS TYROL GRATULIERT ZUR JUBILÄUMSAUSGABE NR. 100
DAS KAUFHAUS TYROL GRATULIERT ZUR JUBILÄUMSAUSGABE NR. 100
ENRIQUE GASA VALGA : Die erste große Liebe des Katalanen in Tirol war das Tanztheater-Publikum.

Für viele Menschen ist Tirol eine Destination für ihren Urlaub, für manche ist es Studien- und Arbeitsort auf Zeit. Doch einige sind geblieben. Aus Liebe zu den Bergen, zum Sport, zur Lebensqualität und nicht zuletzt zum Partner. Das Tirol Magazin stellt sechs Menschen vor, die hier hängengeblieben sind.

Der gebürtige Katalane Enrique Gasa Valga leitet seit der Spielzeit 2009/10 die Tanzcompany am Tiroler Landestheater. Mit 27 Jahren hatte ihn 2003 die frühere Intendantin des Hauses, Brigitte Fassbaender, für sechs Monate als Tänzer engagiert, erinnert sich Gasa Valga: „Ich hatte eine Firma in Spanien und damit gerechnet, wieder zurückzugehen.“ Doch auch er ist der Gefühle wegen geblieben: „Meine erste Liebe in Innsbruck war das Publikum. Ich hatte vom ersten Tag an eine tolle Beziehung zu den Besucherinnen und Besuchern.“ Erst später folgte die Liebe zu seiner Frau, mit der er seit acht Jahren liiert und seit drei Jahren verheiratet ist.
An das Leben in Tirol hat sich der in Barcelona geborene Gasa Valga inzwischen bestens gewöhnt, ist ein leidenschaftlicher und – wie man hört – ziemlich furchtloser Skifahrer geworden. Sein idealer Tagesausklang ist „bei einem Sonnenuntergang auf einem Berg mit einem Bier, Kaspressknödel und Freunden“. Innsbruck hat für ihn eine „brutale Lebensqualität“, es sei nicht zu groß, nicht zu klein, habe ein tolles kulturelles Angebot. Zwei klitzekleine Schönheitsfehler hätten Stadt und Land aber, wie er augenzwinkernd meint: „Es gibt kein Meer und es ist schwer, eine gute Paella zu finden.“
Gerne würde Enrique Gasa Valga in Tirol bleiben, doch sein Engagement als Chef der Tanzcompany endet nach der nächsten Spielzeit. Was nachher wird, weiß er noch nicht: „Momentan bin ich so fokussiert auf die Arbeit, dass ich keine Zeit zum Nachdenken habe. Aber irgendwann muss ich überlegen, was ich danach mache.“
texte: Uwe_Schwinghammer
Fotos: : Gerhard_Berger
Julia SteinmayrJulia Steinmayr stammt aus Kuba und ebendort in Viñales lernte sie ihren „Cristiano“, einen Tiroler, kennen, erzählt sie: „Ich war Tänzerin in einer Afro-Show. Das ist sehr traditionell, wir tanzen für die Heiligen, alles hat eine Bedeutung.“ Es hat auf der Stelle gefunkt, obwohl es für Kubanerinnen illegal ist, mit Touristen engere Bande zu knüpfen. Nach einer Woche musste Christian wieder zurück nach Österreich und es wurde noch wesentlich schwieriger.
Die beiden Verliebten hielten Kontakt per Internet, was für Julia bedeutete, stundenlang vor der Post in einer Schlange zu warten, bis sie an einen Computer kam. Ein Jahr später besuchte sie Christian neuerlich in Kuba, dann lud er sie erstmals nach Österreich ein. Ein Ereignis der Freude, aber auch der Ungewissheit: „Das erste Mal in einem Flugzeug, das war unglaublich für mich. Ich habe mich so geschreckt und war so nervös.“ In Österreich trank sie ihr erstes Bier, aß ihr erstes Wiener Schnitzel, und es gefiel ihr, was sie sah und kennenlernte. Auch wenn es damals noch nicht Tirol, sondern Salzburg war.
Julia SteinmayrNach insgesamt fünf Jahren Fernbeziehung heiratete das Paar 2014 auf Kuba, danach konnte Christian seine Julia nach Österreich in seine Heimatstadt Innsbruck bringen. Heute haben sie zwei Kinder. Deutsch, das anfangs „brutal schwer“ war, hat sie gut im Griff. Sie träumt davon, eine kubanische Tanzschule zu eröffnen. Julia Steinmayr ist angekommen: „Mir gefallen die Berge, der Schnee, die Jahreszeiten. Oder das Theater, das war in Kuba nichts für normale Menschen.“ Mit ihrer Heimat ist sie noch immer stark verbunden, ehrt ihre Wurzeln: „Alles, was ich heute bin, kommt aus Kuba. Ich gehöre zur Hälfte zu beiden Welten.“
„ALLES, WAS ICH HEUTE BIN, KOMMT AUS KUBA. ICH GEHÖRE ZUR HÄLFTE ZU BEIDEN WELTEN.“
 IGOR PSHENYSHNYUK : Der Ukrainer wollte nur ein Semester in Tirol Deutsch lernen, doch die Nordkette animierte ihn zum Bleiben.
IGOR PSHENYSHNYUK : Der Ukrainer wollte nur ein Semester in Tirol Deutsch lernen, doch die Nordkette animierte ihn zum Bleiben.

 CHRISTEL THORESEN : Für die Norwegerin war Innsbruck ein Kompromiss zwischen dem Trubel einer Millionenstadt und dem Landleben.
Igor Pshenyshnyuk
CHRISTEL THORESEN : Für die Norwegerin war Innsbruck ein Kompromiss zwischen dem Trubel einer Millionenstadt und dem Landleben.
Igor Pshenyshnyuk
Ihm ist im Moment nicht zum Lachen. Nicht, weil es ihm in Tirol nicht gut ginge, sondern weil in seiner ukrainischen Heimat Krieg herrscht. Der 38-Jährige ist kein Flüchtling, sondern seit 2013 in Innsbruck Chef der „Bierwelt Tirol“, eines Geschäftes mit Hopfensaft aller Art.
Pshenyshnyuk ist in Kyiv geboren, hat dort in einer großen Brauerei im Marketing gearbeitet. Schon damals träumte er davon, sein eigenes Craftbier zu brauen: „Das war damals in der Ukraine noch zu früh.“ 2013 kam er schließlich nach Tirol, um hier Deutsch zu lernen. Von Innsbruck hatte er anfänglich keine besonders hohe Meinung: „Ich habe gedacht, das ist eine langweilige kleine Stadt. Aber ich habe schnell festgestellt, dass das ein Stereotyp war.“ Es kam, wie es kommen musste: Nach einem Semester hatte er sich verliebt … nicht in eine Frau, sondern in die Nordkette. Daher beschloss er zu bleiben: „Ich habe hier alles, was ich liebe: Natur, nette Leute, meinen Laden.“ Schon in der Ukraine setzte sich Pshenyshnyuk gerne aufs Rad oder wanderte in den Karpaten. In Tirol stieg er rasch aufs Mountainbike.
Zuerst arbeitete Igor Pshenyshnyuk als Kellner, eröffnete aber noch im ersten Jahr seinen eigenen Bierladen: „Ich habe fast mein ganzes Geld investiert und das Geschäft aufgemacht.“ Tirol hat der Ukrainer inzwischen lieben gelernt, selbst wenn es ihm das Land nicht immer leicht macht: „Hier ist es sehr kompliziert, etwas zu entwickeln. Entweder man ist schon aus einer wohlhabenden und bekannten Familie oder man wird nie reich.“ Doch dieser Wunsch ist einstweilen ohnedies hinter das Bedürfnis zurückgetreten, seinen Landsleuten zu helfen, die vor dem Krieg flüchten mussten.
HendersonGeplant war eigentlich nur ein Sommer, inzwischen ist Mark Henderson schon seit 27 Jahren in Tirol. Geboren ist der heute 48-Jährige in Wien, seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Schotte. Nach ersten Jahren in Wien übersiedelte die Familie wegen Papas Job nach Großbritannien. Der junge Mark wuchs in England, Wales und Schottland auf. Am Swansea College belegte er schließlich Deutsch und Betriebswirtschaftslehre. Mit 21 zog es ihn zurück nach Österreich, eigentlich wollte er nur jobben. Stattdessen war er plötzlich für eine Kette zuständig für Campingplätze in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Was nicht gutging, erinnert er sich: „Ich hatte mit 21 ein eigenes Dienstauto, eine Riesenverantwortung. Das hab’ ich nicht geschafft, das war mir zu viel.“
Schliesslich landete er am Campingplatz am Natterer See bei Innsbruck und arbeitete dort einen Sommer lang. Gerne ging er in ein damals für seine Liebespost legendäres Lokal im benachbarten Götzens: das Binis. Weil er sich nach dem Sommer in Tirol in den Kopf setzte, ein cooler Snowboarder werden zu wollen, blieb er und arbeitete eine Saison im Binis. Daraus wurden fünf Jahre: „Ich habe gearbeitet, bin aber fleißig Snowboarden gegangen.“
Nach der Zeit in Götzens suchte Henderson einen neuen Job und fand ihn als Kellner im Jimmy’s in Innsbruck. Schon nach ein paar Monaten übernahm er das Lokal, avancierte sogar zum Koch. Er eröffnete zusätzlich das Studio 21 in Innsbruck und gab kurze Zeit später beide Lokale ab: „Ich hab das zehn Jahre lang gemacht, genau wie es mein Plan war.“ Heute ist Henderson Spirituosenhändler, Vater dreier Kinder und wohnt in Mieders im Stubaital. Von dort bringt ihn so schnell auch nichts mehr weg.
Manchmal ist Innsbruck nur der Kompromiss zwischen München und Dalaas. Aber ein liebgewonnener. So ist das jedenfalls bei Christel Thoresen. Sie stammt aus Norwegen und tourte über zehn Jahre lang als Snowboardprofi durch die Welt, 1998 nahm sie an den Olympischen Spielen in Nagano teil. In Westendorf lernte sie dabei ihren heutigen Mann Christoph kennen. Das Paar, er ebenfalls Snowboardprofi, lebte einige Jahre in München, war aber unzufrieden mit der Situation, immer im Stau zu stehen, wenn es zum Trainieren in die Berge wollte. 2004 entstand die Idee, am besten gleich in die Alpen zu ziehen, erzählt Christel Thoresen: „Mein Mann wollte nach Dalaas in Vorarlberg, aber ich habe damals gedacht, ich bin ein Stadtkind, weil ich ja aus Oslo komme. Darum kam das für mich nicht in Frage und wir haben uns als Kompromiss für Innsbruck entschieden.“ Doch nach nur eineinhalb Jahren in der Stadt wollte es ein Onlineinserat, dass aus dem Stadtkind ein Landei wurde. „Wir haben zufällig eine Anzeige von einem kleinen Haus in Patsch entdeckt, das ganz bunte Farben hatte. Das wollte ich mir unbedingt anschauen und habe mich kopfüber verliebt.“ Vier Tage später war das Haus gekauft.
Inzwischen ist Christel Thoresen Hair- and Make-up-Artist. In der Halfpipe hatte sie sich 2003 verletzt und es kam ihr erstmals zu Bewusstsein, dass die Snowboardkarriere nicht ewig währen würde und sie keine Ausbildung hatte. Als sie in München zufällig das Schild einer Make-up-Schule entdeckte, dachte sie: „Warum nicht?“ Den Bergen und dem Snowboard ist sie dennoch treu geblieben, stammen doch die Kunden der zweifachen Mutter fast ausschließlich aus dieser Szene.
Kerngesund bedeutet für uns: stabil, solide und verlässlich sein. Eine wichtige Basis, um mutige Schritte zu setzen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. So gestalten wir Zukunft – mit unseren Mitarbeiter*innen und unseren Kund*innen.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das Tirol Magazin feiert seine 100. Ausgabe. Niemand hat in diesen letzten 50 Jahren das Heft so geprägt wie dessen langjähriger Schriftleiter Peter Baeck, der sich hier noch einmal an Abfuhren, Erfolge und Veränderungen erinnert.

Die Tradition des Tirol Magazins reicht bis ins Jahr 1924 zurück. Bedingt durch Wirtschaftskrise, Kriegs- und Nachkriegszeit erschien das Heft damals unregelmäßig. Es hatte sich jedoch stets um die Themen Natur, Kultur, Land und Leute gedreht. Diesen Kanon setzte auch Robert Fiala fort, der – als deren Landesparteisekretär eng mit der Tiroler Volkspartei verwoben – die Tiroler Heimatwerbung und damit auch das Magazin 1972 übernahm. Die Zählung begann zu diesem Zeitpunkt wieder bei null, bei Heft 5 stieg Peter Baeck als Schriftleiter ein und zeichnete dann für unglaubliche 91 Ausgaben verantwortlich. Zuerst allerdings sah es nicht nach einer solchen Karriere aus, wie er sich erinnert: „Ich habe Kontakt mit den Leuten aufgenommen, die früher im Magazin geschrieben haben. Ich bin zu ihnen hingegangen, aber sie haben mir eine Abfuhr erteilt.“ Doch Baeck ließ sich nicht entmutigen: „Ich habe dann Leute wie den Historiker Michael Forcher oder den Franz Caramelle vom Bundesdenkmalamt als Autoren engagiert. Ich hab mir gedacht: Wenn die Alten nicht mehr wollen, dann frag’ ich eben die Jungen. Aber die sind inzwischen natürlich mit mir gemeinsam auch alt geworden.“
Emanzipation vom Vorgänger.
Bei der Ausrichtung hielt sich Baeck sehr an frühere Hefte: „Es ist immer um Kultur und Tourismus gegangen.“
Anfänglich gab es in jeder Ausgabe nur vier Artikel, später wurde das flexibler gehandhabt, das Magazin emanzipierte sich von seinem Vorfahren,
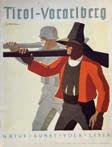
1924 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift „Tirol“, herausgegeben vom Tiroler Landesfremdenverkehrsamt. Das Magazin erschien in den folgenden Jahren in loser Reihenfolge.

die Themenpalette wurde vielfältiger, die Zahl der Autorinnen und Autoren wuchs. Unter anderem führte Baeck eine Porträtserie über Tiroler Künstlerinnen und Künstler ein. Aus dieser entstanden als Nebenprodukt zahlreiche Bücher: Etwa über Ernst Insam, drei Mitglieder der Prachensky-Dynastie, Jean Egger. Als eines der Highlights bezeichnet Baeck, den früheren und inzwischen verstorbenen Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher als Autor und Illustrator für das Magazin gewonnen zu haben. Gelesen wurde es gerne, war allerdings, wie Baeck ohne Umschweife zugibt, in den 1970er- und 1980er-Jahren auch ziemlich konkurrenzlos: „Damals gab es noch nicht viele Hefte, die über Tirol berichtet haben.“
1939 bis 1945: Während des Zweiten Weltkrieges kamen 14 Ausgaben heraus, allerdings als Heft des nationalsozialistischen Gaues Tirol-Vorarlberg.
1951: Nach den ersten, wirtschaftlich besonders schwierigen Nachkriegsjahren, erschien erstmals wieder eine Ausgabe des Tirol-Heftes.
Ein Land im Wandel.
1976: Seit diesem Jahr ziert die Titelseite das bekannte Tirol-Logo von Arthur Zelger.
2020: Das Tirol Magazin geht mit Ausgabe 97 an eco.nova corporate publishing über.
Ständig auf der Suche nach Themen und natürlich nach Inseratenkunden, war Baeck jahrzehntelang in Tirol unterwegs: „Ich bin pro Jahr sechs bis sieben Mal quer durch Tirol gefahren.“ So sah er auch in Echtzeit, wie sich das Land massiv veränderte: Es gab Straßenbauprogramme, die Erschließung der Gletscherskigebiete, den Modernisierungsschub in der Hotellerie, der Tourismus schraubte sich in lichte Höhen. Mit einem Großteil dieser Entwicklungen konnte und kann sich Peter Baeck gut identifizieren: „Ich habe die Entwicklung Tirols miterlebt, im guten und manchmal auch im nicht so guten Sinne. Ich blicke gerne zurück, es war eine schöne Zeit. Aber man muss schon auch ein bisschen aufpassen aufs Land!“

„DAMALS

Wiener Traditionsbad mit Tiroler Touch: Der gebürtige Absamer Marco Ebenbichler ist der Herr über das schmucke Schönbrunner Bad, in dem anno dazumal Klein-Franz-Joseph planschte und sich heute nicht nur Sportskanonen wie die Kaiser fühlen.
Marco Ebenbichler war schon immer gern der Erste. Von diesem Ehrgeiz zeugen seine Erfolge als Leistungsschwimmer, die ihm eine Flut an Medaillen eingebracht haben: Der 46-jährige Tiroler ist 15-facher österreichischer Schwimm-Staatsmeister, in seiner Paradedisziplin Delfin will man den muskelbepackten Vollblutsportler und Fitnessprofi bis heute nicht zu einem Duell herausfordern. Wobei – vielleicht stünden die Chancen gar nicht einmal soooo schlecht. „Letzte Saison war ich privat höchstens drei oder vier Mal im Wasser“, gibt Ebenbichler ganz unverblümt zu.
Dass dieses Geständnis nur wenige Meter neben „seinem“ 50-Meter-Edelstahl-Sportbecken ans Tageslicht kommt, erstaunt dann doch ein wenig. Doch der Athlet außer Dienst hat mittlerweile keine Zeit mehr, regelmäßig abzutauchen und an seiner Technik und seinen Geschwindigkeitsrekorden zu feilen. Jetzt muss er pH-Werte checken, den Rasen mähen, Wände streichen, Toiletten auf Sauberkeit prüfen, lästige Dohlen verscheuchen, Schwimmstunden geben,
Marco EbenbichlerLiegen hin und her tragen, die Wasser- und Stromrechnung im Auge behalten, gedankliche Schönwettertänze aufführen, den Kunden im Fitnessbereich zur Hand gehen und nach Badeschluss auch noch an die Buchhaltung denken. Kurz und gut: Die Arbeit im Schönbrunner Bad, wo Marco Ebenbichler das Sagen hat, geht nie aus. Im Gegenteil. Das Tirol Magazin hat den ehemaligen Leistungsschwimmer in seinem Refugium besucht und mit ihm über arbeitsreiche Sommer, hitzige Preisdiskussionen und die Angst vorm Weißen Hai gesprochen.
Vor dem Untergang bewahrt.
„Von April bis September hab ich eine 90-Stunden-Woche. Langweilig wird mir hier nie“, sagt die Personalunion aus Manager und Bade- und Hausmeister, der das traditionsreiche Areal wie seine Westentasche kennt. Schließlich ist er seit 20 Jahren in den fordernden Betrieb eingebunden, der knapp vor der Jahrtausendwende eigentlich dem Untergang geweiht schien. Damals stand es schlecht um die Zukunft der in
die Jahre gekommenen Anlage, die zum Besitz der Schloss Schönbrunn GmbH gehört. Deren Wunsch, das marode Bad, das nach dem Tod des einstigen Pächters schon zwei Jahre geschlossen stand, zu erhalten, war allerdings mehr als enden wollend.


Die Rettung nahte schließlich aus Tirol, der Heimat des damaligen Direktors des Tiergartens Schönbrunn, Helmut Pechlaner. Der holte mit Josef „Sepp“ Ebenbichler einen anderen Tiroler ins Boot und überzeugte den in Wien lebenden Bankdirektor davon, sich – mit seiner Frau Doris und seinem Sohn Marco im Rücken – bei der öffentlichen Ausschreibung für das Schönbrunner Bad zu bewerben. Mit Erfolg.
Bereits kurze Zeit später begannen die aufwändigen Umbauarbeiten, die das veraltete Bad auf den neuesten technischen Stand brachten und stolze 38 Millionen Schilling verschlangen, die zu gleichen Teilen von der Schloss Schönbrunn GmbH, dem Bund und der Familie Ebenbichler getragen wurden. Die Angst, dass diese satte Investition ein Schlag ins Wasser sein könnte, war durchaus da, wie Marco Ebenbichler gesteht. „Natürlich kriegst du bei solchen Summen Stress. Und dieser Stress hört als Selbstständiger nie auf. Schließlich bekommen wir keine öffentlichen Förderungen. Wenn es im Sommer also ein paar Tage hintereinander regnet, dann habe ich schon mal Kopfweh“, sagt der Wahl-Wiener, der das Schönbrunner Bad seit dem Vorjahr als alleiniger Chef verwaltet.

„DAS SCHWIMMEN IN FREIEN GEWÄSSERN TAUGT MIR GAR NICHT. SOBALD ES UNTER MIR DUNKEL WIRD, FÜHL ICH MICH UNWOHL.“
Einen freien Tag während der Saison gönnt er sich dabei nie. „Das kann ich mir nicht leisten“, meint der – laut Eigendefinition –„angelernte Perfektionist“, der die Tücken seines Refugiums wie kein Zweiter kennt und das Tagesgeschäft deshalb auch nicht abgeben will. „Wir punkten hier mit Sauberkeit und Genauigkeit: Die Anlage muss immer picobello sein, damit sich der Kunde wohlfühlt“, so Ebenbichler. Kaum hat er sein Credo deponiert, schwenkt sein Blick wieder in den Kontrollmodus um. Nicht dass irgendwo etwas herumliegt, was da nicht hingehört …



Wertfrage und Wuchervorwurf.
Was zu einer Auszeit im Schönbrunner Bad auf alle Fälle dazugehört, ist der entschleunigende Fußmarsch durch das malerische Ambiente des Schlossparks, in dem Jogger ihre Runden ziehen und wo das eine oder andere Eichhörnchen durchs Geäst hüpft. Wie man einem imperialen Briefverkehr entnehmen kann, lernte hier – einen Steinwurf von der Gloriette und dem Obeliskbrunnen entfernt – dereinst der achtjährige Franz Joseph das Schwimmen. Wie wohl majestätische Schwimmflügerln ausgesehen haben? Auch seine sportlichere Hälfte, die legendenumwobene Sisi, soll sich inmitten des herrschaftlichen Schlossparks in die Fluten gestürzt haben.
Die Zeiten, in denen die Abkühlung nur dem Adel vorbehalten war, sind indes längst vorbei. Wie die Kaiser fühlen dürfen sich hier mittlerweile alle, denen ein Schwimmtag 16 Euro wert ist. Genau hier scheiden sich regelmäßig die Geister. Vor allem in sozialen Netzwerken wird immer wieder die Kritik am „unverschämt teuren Eintritt“ laut. Marco Ebenbichler nimmt diese Vorwürfe mittlerweile recht gelassen. „Die Preisdiskussionen kenne ich seit 20 Jahren. Dabei hat ja jeder das Recht, in ein Bad zu gehen, in dem der Eintritt billiger ist“, sagt er. „Ich habe weder zehn Ferraris in der Garage, noch liege ich den ganzen Tag in der Hängematte: Ein Bad in dieser Qualität zu führen, kostet nun einmal eine Stange
SeeBar & Bistro Seepromenade 14, 6213 Pertisau Geöffnet von Mai - September täglich & witterungsbedingt www.seebar.at


Geld. In meinem Fall ist das Geld, das ich aus meiner Tasche bezahle. Und draufzahlen will ich wirklich nicht“, meint er bestimmt. Im Großen und Ganzen würden die positiven Stimmen aber überwiegen. „Pro Saison besuchen uns knapp 60.000 Gäste, von denen ein Großteil zufrieden wieder nach Hause geht. Beschwerden gibt es nur von einem Bruchteil unserer Kunden: Damit kann ich leben.“
Need for Speed.
Der Erste ist Marco Ebenbichler noch immer gerne. Deshalb hat das Schönbrunner Bad bei der Öffnung im Frühjahr auch stets die Nase vorn: Während die städtischen Bäder in Wien nämlich frühestens am 1. Mai ihre Pforten öffnen dürfen, ist dem privat geführten Kaiserbad dahingehend alles erlaubt. Liebend gerne erinnert sich Ebenbichler an gut besuchte erste Schwimmtage rund um den 20. April und an letzte Schwimmtage Ende September, als schon die Herbstsonne magische Lichteffekte ins glitzernde Edelstahlbecken zauberte. Auf der dort abgesteckten Sportbahn herrscht ein strenges Regiment: Wer für 100 Meter Kraul länger als 1:25 Minute braucht, muss das Feld räumen und klaglos auf eine der sieben anderen Bahnen ausweichen. Für Brust gilt als Richtzeit 1:45 Minute. Uff.
Dass der Selbstversuch der ambitioniert schwimmenden Autorin glorios scheiterte, entlockt Marco Ebenbichler ein herzhaftes Lachen. „Es gibt nur ganz wenige, die diese Zeit packen. Aber seit ich die Tafel mit den Limits angebracht habe, trauen sich dort wirklich nur mehr die ganz Schnellen rein. Damit erspare ich mir auch Diskussionen mit der netten Oma, die beim Brustschwimmen am liebsten keine nassen Haare bekommen würde“, grinst der speedverliebte Sportsmann, der nach wie vor das Recht auf die Randbahn hat. Gelernt ist eben gelernt.
Wo der Kaiser schwimmen lernte: Inmitten des Parks von Schloss Schönbrunn liegt das Schönbrunner Bad, das anno 1838 erstmals urkundlich erwähnt wird. Und zwar vom späteren Kaiser Franz Joseph höchstselbst. In einem Brief an seinen jüngeren Bruder Maximilian berichtet der damals achtjährige Erzherzog von seinen ersten Schwimmversuchen im Wasserreservoir des Obelisks, dem Quell des majestätischen Freibads. Um die Jahrhundertwende entsteht dort eine kaiserliche Schwimmschule, ehe das Bad in der Ersten Republik als Militärschwimmschule verwendet wird. In der Zeit des Nationalsozialismus wird das Areal, das im 13. Wiener Gemeindebezirk liegt, dann von der Wehrmacht in Beschlag genommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt es in den Händen der britischen Besatzungssoldaten. Erst 1955 öffnet das Schönbrunner Bad seine Pforten wieder für die Öffentlichkeit: In dieser Zeit entstehen auch die heutigen Gebäudekomplexe, die 1975 generalsaniert werden. 1999 wird der Betrieb wegen Unwirtschaftlichkeit vorübergehend geschlossen, doch dann tritt der aus Absam stammende Bankdirektor Josef Ebenbichler als neuer Pächter auf den Plan: Gemeinsam mit seiner Frau Doris und seinem Sohn Marco übernimmt er das Bad, das in den Jahren 2000/2001 auf den neuesten technischen Stand gebracht wird. Seit 2020 fungiert Marco Ebenbichler als Manager. www.schoenbrunnerbad.at
Von der Piste ins Becken.
Dass aus ihm einmal ein erfolgreicher Schwimmer werden würde, hatte Ebenbichler übrigens gar nicht auf dem Plan. Denn eigentlich wollte der Spross einer Skifamilie viel lieber mit zwei Brettln unter den Füßen Erfolge feiern. Auf die für ihn richtige Bahn lotste ihn sein damaliger Skitrainer, der das Schwimmen als ideale sommerliche Fitnessübung betrachtete. „Mit 13 bin ich dann halt zu einem Schwimmverein gegangen, mein Ehrgeiz war aber überschaubar“, erinnert er sich an den doch recht späten Sprung ins kalte Wasser, der Wellen schlagen sollte. Denn: „Obwohl mir die anderen viele Trainingsjahre voraus waren, war ich trotzdem bald der Schnellste.“
Weil er es irgendwann satthatte, täglich mehrere Stunden im Bus zu hocken, um in Tirol zu den Trainingseinheiten zu kommen, zog er mit 17 nach Wien, wo er sich in der legendären Südstadt voll auf seinen Sport konzentrieren konnte. Bis zu seinem Karriereende 1999 war Ebenbichler gleich aktiv wie siegreich, sein Comeback im Jahr 2003 krönte er noch einmal mit einem Delfin-Staatsmeistertitel. Heutzutage schwimmt er hauptsächlich in Arbeit. Außer in den Wintermonaten, wenn das Schönbrunnerbad im Dornröschenschlaf liegt. Da trifft man Ebenbichler wieder auf der Skipiste an oder auf Teneriffa, wo der begeisterte Surfer Energie für die nächste Saison tankt. Baden geht er dabei übrigens nicht. „Das Schwimmen in freien Gewässern taugt mir gar nicht. Sobald es unter mir dunkel wird, fühle ich mich unwohl“, gibt er zu. Hat da womöglich jemand Angst vorm Weißen Hai? Ebenbichler lacht. „Leider ja. Deshalb schwimme ich im Meer auch nie allein. Der Gedanke, dass ich dem Hai schneller davonschwimme als mein Begleiter, rettet mich“, lacht Ebenbichler. Er ist eben auch in Ausnahmesituationen gern der Erste.
Christiane_Fasching
Lehre auf höchstem Niveau, international anerkannte Professoren, Gastprofessoren und Lehrende und modernste Infrastruktur bieten ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium.

Bachelor-Studien Psychologie, Mechatronik, Elektrotechnik, Pflegewissenschaft, Wirtschaft, Sport- und Gesundheitstourismus.
Master-Studien Psychologie, Mechatronik, Gesundheitswissenschaften, Public Health, Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Pflege- und Gesundheitspädagogik, Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung, Medizinische Informatik. Universitätslehrgänge Dyskalkulie-Therapeut/in, Legasthenie-Therapeut/in, Führungsaufgaben/ Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege, Konfliktmanagement und Mediation, Health Information Management.

Doktoratsstudien Gesundheitsinformationssysteme, Psychologie, Health Technology Assessment, Management und Ökonomie im Gesundheitswesen, Public Health, Pflegewissenschaft, Technische Wissenschaften, Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften.

www.umit-tirol.at

A traditional Viennese pool with a Tyrolean touch: Marco Ebenbichler, who was born in Absam, is the master of the elegant Schönbrunnerbad, where even young Franz Joseph used to splash around in the old days and where today not only sportsmen feel like emperors.

give swimming lessons, carry loungers back and forth, keep an eye on the water and electricity bills, lend a hand to customers in the fitness area, and even think about accounting after closing time. In a nutshell, there is never a shortage of work at Schönbrunnerbad, where Marco Ebenbichler is in charge. On the contrary. “From April to September, I have a 90-hour week. I never get bored here,” says the manager, pool attendant and janitor. After all, he has been involved in the demanding operation for 20 years, which actually seemed doomed just before the turn of the millennium.
At the time, the future of the aging facility, which is owned by Schloss Schönbrunn GmbH, looked bleak. Rescue finally came from Tyrol, the home of the then director of the Schönbrunn Zoo, Helmut Pechlaner. He brought another Tyrolean on board, Josef “Sepp” Ebenbichler, and convinced the Vienna-based bank director - with his wife Doris and son Marco behind him - to apply for the public tender for the Schönbrunnerbad. With success, because a short time later the elaborate renovation work began.
Marco Ebenbichler has always liked to be first. His successes as a competitive swimmer, which have brought him a flood of medals, bear witness to this ambition: The 46-year-old Tyrolean is a 15-time Austrian national swimming champion. But the off-duty athlete now has no time to regularly hone his technique or break speed records. Now he has to check PH values, mow the lawn, paint walls, check toilets for cleanliness,
As can be gathered from imperial correspondence, it was here - a stone’s throw from the Gloriette and the Obelisk Fountain - that the eight-year-old Franz Joseph, later emperor, once learned to swim. His more athletic half, the legendary Sisi, is also said to have plunged into the waters in the middle of the stately palace park. But the days when cooling off was the exclusive preserve of the nobility are long gone. Everyone can now feel like an emperor here. Today, almost 60,000 guests visit the baths each season.
www.schoenbrunnerbad.at
Gemeinsam und mit Weitblick begleiten Ana Mari Reinisch und Magnus Mangeng ihre Patienten ein Stück ihres Weges. Die Praxis bietet neben Physiotherapie und Osteopathie auch Seelenarbeit in Form von Refl exionen an, um die körperlichen Beschwerden verstehen und besser behandeln zu können.

Frei nach dem Credo, dass der körperliche Ausdruck ein Zeichen der Seele ist, steht der Mensch in der Praxis Weitblick im Mittelpunkt. Mit all seinem Sein, seinen Erfahrungen und Wehwehchen kann der Hilfesuchende hier ankommen und Körper und Geist zu Ruhe kommen.
s strömt einem schon beim Betreten der Praxis eine große Portion Ruhe und Gelassenheit entgegen. Ana Mari Reinisch und Magnus Mangeng haben für ihre Patienten eine Ruheoase geschaffen, in der man ankommen und von der Hektik des Alltags einfach mal abschalten kann.
„Der Mensch als Ganzes, befindet sich bei uns im Mittelpunkt. Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir die Stabilität auch schwierige Themen gut mit den Patienten zu bearbeiten. Wir lieben es, Menschen in herausfordernden Situationen zur Seite zu stehen, von Lebensumbrüchen bis hin zu Palliativ. Durch unsere Zusammenarbeit versuchen wir Körper, Geist und Seele den Platz zu bieten, den eine Heilung benötigt“ sind sich die beiden einig. Magnus begleitet seine Patienten durch osteopathische und physiotherapeutische Behandlungen und Ana Mari sorgt für das Seelenwohl. Dabei arbeitet die Praxis Weitblick mit einem Netzwerk an unterschiedlichen Ärzten und Kliniken zusammen. „Für die Besucher ist es eine wertvolle Auszeit, wenn sie bei uns sind. Nach einer Behandlung stellt sich eine natürliche Entspannung ein, Patienten kommen zur Ruhe und können Kraft tanken“ erklärt Ana Mari mit viel Feingefühl und ergänzt: „Wir holen
die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen, und begleiten sie ein Stück ihres Weges. Unsere Besonderheit ist sicher der Schwerpunkt Osteopathie sowie die Kombination aus Körperarbeit und Gesprächen, denn für uns sind Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden“.
„Zusätzlich zur Physiotherapie stellt die Osteopathie eine sanfte Behandlungsmöglichkeit für sehr viele Beschwerden dar und ist aufgrund ihrer einfühlsamen und schmerzfreien Anwendung sogar für Säuglinge bestens geeignet“ verrät Magnus Mangeng, „ als spezielle Form der manuellen Therapie können mit osteopathischen Behandlungen viele Beschwerden gelindert werden“. „Zu uns kommen Hilfesuchende mit den unterschiedlichsten Symptomen, mit oder ohne Zuweisung vom Arzt. Viele davon suchen nach der physiotherapeutischen oder osteopathischen Behandlung noch eine Reflexion bei Ana Mari, um die körperliche Arbeit durch ein wenig Seelenpflege zu unterstützen und den Menschen ein Werkzeug für den Alltag mitzugeben“. Die Besucher haben zudem noch die Wahl, ob sie in den harmonisch gestalteten Räumlichkeiten in Innsbruck oder der heimeligen Praxis in der Leutasch ihre wertvollen Behandlungen genießen möchten.
www.weitblick-innsbruck.at

Die Ötztaler Schauspielerin und Musikerin Nenda Neururer bricht mit Klischees und rappt über Alltagsrassismus und Identität. Ein Gespräch.
Die hippe Großstädterin und das Madl von der Alm sind bei Nenda Neururer kein Gegensatz, sondern treffen sich in fröhlicher Personalunion. Im Musikvideo zu ihrem Song „Mixed Feelings“ sieht man die Ötztaler Rapperin im Dirndl durch die City streifen und mit angesagtem Gold-Zahnschmuck, so genannten Grillz, beim Schafefüttern in der Tiroler Bergwelt. Das Klischee wird lustvoll ins Gegenteil verkehrt, das Schubladendenken über Bord geworfen. Und zwar keineswegs nur optisch: Im englisch-deutsch-tirolerischen Sprachmix verhandelt Neururer Fragen von Identität und Zugehörigkeit und erzählt, wie es ist, als Person of Colour in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen. „Aber checksch du, Tirol / Dass i es Land verlassn hab / Weil mi zu viele Leit fragen / Ob I deitsch sprechen kann“, rappt das „Mixed Chick“ in „Mixed Feelings“ – und hat damit ausgerechnet während der vor allem auch für Künstlerinnen und Künstler schwierigen Corona-Lockdowns einen kleinen Überraschungshit gelandet. Es sollte nicht der einzige bleiben. Hauptberuflich ist Neururer Schauspielerin, lebt
als solche seit acht Jahren in London und ist nach zahlreichen Engagements im Theater nun auch in der Mystery-Serie „The Rising“ auf Sky zu sehen.
Man hat sie dieses Jahr auf dem roten Teppich der Berlinale gesehen, „The Rising“ wurde auf dem Berliner Filmfestival vorgestellt. Wie war der Eintritt in die Glamourwelt der Filmszene? Nenda Neururer: Danke, für mich ist das wie ein Traum, der wahr wird. Und es war vor allem eine sehr schöne Erfahrung, diese Serie zu drehen.
Sie haben bislang viel an Londoner Theatern gespielt, unter anderem in Stücken von Arthur Miller, Shakespeare oder auch Zadie Smith. Soll es nun mehr Richtung Film und Fernsehen gehen? Mal schauen, was kommt. Aber ich finde es schon reizvoll, dass man über Film und Fernsehen ein größeres Publikum erreichen kann. Und vor allem freut es mich, dass mein Opa, der ja in Österreich lebt, sich jetzt auch anschauen kann, was ich so mache.

War die Musik schon immer Ihr zweites Standbein? Musik war immer wichtig für mich und ist es auch in der Zeit auf der Schauspielschule in London geblieben. Es gibt außerdem immer wieder Theaterstücke, in denen auch musikalische und gesangliche Fähigkeiten gefragt sind. Auf diese Weise habe ich auch den Produzenten von meinem Song „Mixed Feelings“ kennengelernt.
Darin geht es um Ihre Erfahrungen, als Person of Colour in den „weissen“ Bergen aufzuwachsen. Wie war das? Das Komische war ja, dass ich mich nicht anders gefühlt habe, aber immer anders behandelt worden bin. Wenn andere Kinder gefragt wurden, woher sie kommen, und sagten, aus dem Ötztal, dann war’s das. Wenn ich das gesagt habe, dann hieß es immer: Ja, aber wo kommst du wirklich her? Was sind deine Wurzeln? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man mir nicht glaubt, dass ich mich fünf Mal mehr beweisen muss als andere, die wie „normale“ Österreicher ausschauen. Es ist heute noch so, dass Leute mich auf Englisch ansprechen. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehen kann, aber früher war das schwieriger.
Das erinnert ein bisschen daran, wie der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter vor Jahren den österreichischen Fussballer David Alaba auf Englisch angesprochen hat. Geht es Ihnen darum, solche Mechanismen aufzubrechen? Genau darum geht es. Wir stecken uns gegenseitig in Schubladen,
Nenda Neururer
Nenda Neururer (27) stammt aus Sautens im Ötztal und studierte Schauspiel am Rose Bruford College in London, wo sie auch lebt und arbeitet. Sie spielt unter anderem im Piccadilly Theatre im Londoner Westend, aktuell ist sie in der Serie „The Rising“ auf Sky zu sehen. 2020 veröffentlichte Neururer ihre Debütsingle „Mixed Feelings“, 2021 folgte „Borders“.
haben bestimmte Bilder und Vorstellungen im Kopf, aber es ist doch eigentlich schade, dass wir uns so einzäunen, dass wir nicht über den Tellerrand hinausschauen und -denken. Und dazu will ich den Leuten einen Anstoß geben. Es geht darum, den Horizont zu erweitern. Und es geht darum, zu erkennen, dass man vieles gleichzeitig sein kann, sich nicht für eine Seite entscheiden muss. Gerade Menschen mit gemischter Abstammung sind mit diesen Fragen nämlich ständig konfrontiert.
Sie wollten Ihre Erfahrungen vor allem auch an Kinder und Jugendliche weitergeben. Welche Reaktionen gab es auf „Mixed Feelings“? Die Reaktionen waren total schön. Mir hat zum Beispiel eine Mutter geschrieben, dass ihre fünfjährige Tochter zum ersten Mal ganz stolz mit offenen Haaren in den Kindergarten gegangen ist, nachdem sie mein Video gesehen hat. Vorher wollte sie da immer nur mit geflochtenen Haaren hin. Das hat mich unheimlich gefreut. Denn ich selbst wusste früher auch nie, was ich mit meinen Haaren machen soll, die eben anders waren als die meiner weißen Familie. Und ich hatte diesbezüglich auch keine Vorbilder. Ich weiß noch, wie ich zum allerersten Mal jemanden gesehen habe, der so ähnlich ausschaut wie ich: Da war ich 13 oder 14, und es war ein Foto von Rihanna in der Zeitschrift BRAVO. Sie trug auf dem Bild aber eine Perücke mit langen blonden Haaren. Ich bin damals zu meiner Mama gerannt und habe gesagt, schau, das will ich auch haben! Heute kann man sich im
„ES IST HEUTE NOCH SO, DASS LEUTE MICH AUF ENGLISCH ANSPRECHEN. MITTLERWEILE WEISS ICH, WIE ICH DAMIT UMGEHEN KANN.“© YUKI GADERER






















Internet informieren, sich YouTube-Videos anschauen, aber vor 26 Jahren im Ötztal war das halt schwierig, da gab es noch kein Instagram und Tik Tok.
In „Borders“ geht es um Grenzen und welche Auswirkungen sie auf das Leben mancher Menschen haben. Wie ist der Song entstanden? Ein alter Freund von mir, Fabian Sommavilla, hat ein Buch über „55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn“ geschrieben. Darin geht es um willkürlich gezogene Grenzen, um kuriose, traurige, manchmal auch lustige Grenzgeschichten. Er fragte mich, ob ich einen Song zu einer der Geschichten schreiben könnte. Das war zuerst eine seltsame Vorstellung, aber dann habe ich die Geschichte über einen Vater aus den USA gelesen, der für seine Tochter ein eigenes Königreich irgend-
wo in Nordafrika errichten wollte, in dem sie Prinzessin sein könnte. Das ist durch die Medien gegangen und Disney wollte die Geschichte sogar verfilmen. Zum Glück wurde dann doch noch erkannt, dass das einen sehr problematischen kolonialistischen Beigeschmack hat, und sie haben es gelassen. Ich fand diese Geschichte spannend und bedrückend zugleich. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Grenzen für reiche Menschen nicht zu existieren scheinen, während sie für andere Menschen unüberwindbare Mauern darstellen, nur weil sie im falschen Land geboren sind. So wie die aus Österreich nach Georgien abgeschobene Tina. Deshalb habe ich „Borders“ geschrieben.
Rap auf Tirolerisch klingt in Ihrer Wahlheimat London wahrscheinlich ziemlich exotisch. Wie
kommt das dort an? Natürlich versteht niemand was. Aber es wird trotzdem ganz gut angenommen. Im Rap geht es ja traditionell stark darum, wo man herkommt. Und bei mir ist das halt das Ötztal, Tirolerisch ist die Sprache meines Herzens. Rap ist für mich aber auch abgesehen davon ein cooles Medium, weil es um das Gesprochene geht und man damit eine Botschaft vermitteln kann.
Rap war lange stark männlich dominiert, das hat sich mittlerweile zwar verändert, aber was die Musikszene insgesamt betrifft, haben es Frauen nach wie vor schwerer, sich durchzusetzen. Sehen Sie das auch so? Man braucht sich ja nur umzuschauen, zum Beispiel bei den Festival-Line-ups. Da sieht man, wie viele männliche Künstler ausgewählt werden. Aber ich hoffe, dass sich da etwas verändert. Ich finde es wichtig, dass allen Leuten eine Plattform gegeben wird.

Und wie ist das in der Schauspielszene? Ähnlich. Ich habe viele Rollen gespielt, in denen ich die hübsche Frau war, die still ist und über die von Männern Witze gemacht werden. Deshalb habe ich mir auch irgendwann gedacht, beim Schauspielern allein hat man zu wenig mitzureden. Deshalb mache ich gerne Musik, da kann ich selbst die Dinge sagen, die ich sagen will. Aber natürlich gilt auch in der Schauspielerei: Je erfolgreicher man wird, desto mehr kann man sich auch aussuchen, welche Rollen man annehmen will und welche nicht.
Ivona_Jelčić
„ES GEHT DARUM, DEN HORIZONT ZU ERWEITERN. UND ES GEHT DARUM, ZU ERKENNEN, DASS MAN VIELES GLEICHZEITIG SEIN KANN.“© SKY STUDIOS LIMITED
Höchste Kompetenz, professionelle Beratung und perfekte Druck-Qualität – alles aus einer Hand und gleich nebenan.

Als Tiroler Traditionsbetrieb mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Ihr verlässlicher Partner für alle Belange rund um Druck und Versand Ihrer brillanten Print-Produkte.






Testen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.
The hip city dweller and the girl from the alpine pasture are not opposites in Nenda Neururer’s work, but meet in happy personal union. In the music video for her song “Mixed Feelings,” the Ötztal rapper can be seen roaming the city in a dirndl and wearing hip gold tooth jewellery, so-called Grillz, while feeding sheep in the Tyrolean mountains. The cliché is turned into the opposite with relish, pigeonholing is thrown overboard. And by no means just visually: in an English-German-Tyrolean language mix, the 27-year-old negotiates questions of identity and belonging and tells in “Mixed Feelings” what it’s like to grow up as a person of colour in a white majority society. Neururer is an actress by profession and has been living in London for eight years. After numerous engagements in theatre, she can now be seen in the mystery series “The Rising” on Sky

Has music always been your second mainstay? Nenda Neururer: Music has always been important to me and remained so during my time at drama school in London. There are also always plays that require musical and vocal skills. That’s how I met the producer of my song “Mixed Feelings”.
It’s about your experience growing up as a person of colour in the “white” mountains. What was that like? The funny thing was that I didn’t feel different, but I was always treated differently. When other kids were asked where they came from and said from the Ötz Valley, that was it. But when I answered that, they always said, “Yes, but where are you really from? What are your roots?” I’ve always had the feeling that people don’t believe me, that I have to prove myself five times more than others who look like “normal” Austrians.
“Borders” is about borders and what impact they have on some people’s lives. How did the song come about? An old friend of mine, Fabian Sommavilla, wrote a book about “55 curious borders and 5 stupid neighbours”. It’s about arbitrarily drawn borders, about bizarre, sad, sometimes funny border stories. He asked me if I could write a song to one of the stories. It was a strange idea at first, but then I read the story about a father from the U.S. who wanted to build his own kingdom for his daughter somewhere in North Africa where she could be a princess. This made the news and Disney even wanted to make a movie of the story. Fortunately, it was then realized that this had a very problematic colonialist flavour, and they let it go. I found this story exciting and depressing at the same time. It’s a good example of how borders don’t seem to exist for rich people, while for others they are insurmountable walls just because they were born in the wrong country. That’s why I wrote Borders.
Das Event KLASSIK.UNIQUE.2022 im DAS KRONTHALER – ein Sommernachtstraum im Gleichklang mit Natur und gelebter Gastlichkeit.
Allein schon durch seine ausgesprochene Publikumsnähe ragt KLASSIK.UNIQUE. heraus. Es ist ein wahres Gesamtkunstwerk, ein Feuerwerk für die Sinne, dessen Leitmotiv schlicht Lebensfreude heißt. Das Event geht auf eine Initiative von Sopranistin Eva Lind zurück, die von Tirol aus die ganze Welt verzaubert. Im 4-Sterne-Superior-Hotel DAS KRONTHALER im Tiroler Achenkirch hat sie für KLASSIK. UNIQUE. einen ganz besonderen Paten gefunden: Günther Hlebaina. Er ist Hotelier aus Leidenschaft, liebt die Natur und lebt dafür, seinen Gästen eine außergewöhnliche Wohlfühlkultur in dieser Traumkulisse am Achensee bieten zu können. Das Event ist eine Perle, die, 2020 ans Licht gebracht, glänzt, strahlt und funkelt. Wer einmal dabei war, möchte dieses Erlebnis im Sommer nicht mehr missen.
Das bedeutet auch in diesem Jahr vom 14. bis 17. Juli nichts anderes, als vier Tage verwöhnt zu werden mit all dem, wofür Genuss steht: Gaumenfreuden, die allein beim Anblick das Wasser im Mund zerlaufen lassen, edle Tropfen sowie Ohren- und Augenschmaus, wohin das Herz sich wendet. Für die Kulina-
KLASSIK.UNIQUE. im DAS KRONTHALER
14. bis 17. Juli 2022
Vier Tage. Drei Nächte. In höchster Harmonie in Kunst, Klang und Kulinarik.

16. Juli 2022
KLASSIK.UNIQUE. OpenAir Weltweit Umjubeltes, begleitet vom Kammerorchester InnStrumenti. Das Konzert kann auch ohne Hotelfaufenthalt besucht werden. Tickets direkt im DAS KRONTHALER oder unter www.oeticket.com


+43 (0)5246 6389 welcome@daskronthaler.com www.daskronthaler.com

rik gastiert diesmal Julian Hofbauer für das 5-Gang-(Klassik)-Dinner im Haus. Der „Überflieger” und Gewinner von „Junge Wilde“ 2021, dem wohl trendigsten Kochwettbewerb Europas, wird mit seinen ausgefallenen Kreationen überraschen. Doch Herzstück ist die Musik und Eva Lind als künstlerische Leiterin die perfekte Besetzung. Ihr ist es gelungen, auch in diesem Jahr wieder einen stilvollen, überraschenden Mix an phänomenalen Musikern zusammenzustellen: Ramón Vargas, Zoryana Kushpler, Benjamin Schmid, die Nachwuchstalente Thomas Essl und Selina Danzl sowie das Kammerorchester InnStrumenti.

Hier in Achenkirch am Achensee kann man eintauchen in eine feenhafte Märchenwelt zwischen malerischer Bergkulisse und klarstem Seewasser, den Alltag vergessen, sich den schönen Künsten und angeregten Gesprächen widmen, zwischen Wellness, Spa und Wohlfühlambiente, einfach die Seele baumeln lassen sowie unvergessliche Momente beim Aktivprogramm inklusive Wanderung mit Peter Habeler, Matinée mit Lesung von Julia Stemberger oder bei der Porsche.[Driving].Experience erleben.


Schwindelfrei, mutig und unerschrocken bestieg und erkletterte sie die Gipfel der Lechtaler und Allgäuer Alpen. Marie von Bayern, Mutter König Ludwigs II., war eine der ersten Alpinistinnen. Sie liebte Tirol, entfachte fast nebenher den Alpentourismus und ließ selbst große Bergpioniere über ihr Durchhaltevermögen und Geschick staunen.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Auch bei ihrem zukünftigen Gatten soll das so gewesen sein, doch der Moment, in dem der damalige Kronprinz Maximilian von Bayern (1811–1864) das Herz der Marie von Preußen (1825–1889) zum ersten Mal hüpfen ließ, war und bleibt privat. Bei der anderen Liebe der Marie von Preußen aber, der Liebe zu den Tiroler Bergen, war und bleibt das anders. Sie ist ewig nachvollziehbar, weil sich das Panorama nie verändert, das die junge Frau beim ersten Anblick derart in einen Rausch versetzte, dass er ihr Leben zu einem wunderbar aufregenden Teil bestimmen und außergewöhnlichen Wagemut in ihr wecken sollte.
Von den flachen, höchstens hügeligen Ebenen des bayerischen Voralpenlandes aus bestimmt eine leicht mystische und jedenfalls bezaubernde Dramaturgie der Annäherung an Tirol. Dieser so großzügige, ja breite Blick auf die Berge bleibt in den Tiroler Tälern meist verwehrt. Auf der Fahrt von München in Richtung Füssen kann das Auge aber ausgiebig in alle Richtungen schweifen. Am Rand der ersten Berge dieses echt majestätischen Fleckens Erde dann, wo unweit des Schwansees die Felsen rund um die Pöllatschlucht wirken, als wären sie in Stein erstarrte Wellen, tut sich wieder eine Bergwelt auf. Im Hintergrund des türkis schimmernden Alpsees recken sich Gehrenspitze, Köllenspitze, Gimpel, Schlicke, Vilser Kegel, Rossberg und Aggenstein stolz in den Himmel. Sie sind Teile eines einzigartigen Panoramas, in das Schloss Hohenschwangau eingebettet ist und das König Ludwig II. mit Schloss Neuschwanstein abrunden und auf anhaltend begeisternde Weise perfektionieren sollte.


Es gibt viele gute Gründe, warum Ludwig II. sein Märchenschloss genau hier errichten ließ. Bergformationen, Schluchten und Seen sind so fantastisch wie er. Die Aussicht „ins Tirol“ ist das nicht minder. Beim ersten Blick auf die felsigen Familienmitglieder der Tannheimer Alpen hatte sich schon seine Mutter in diese Schwindelwelten verliebt. „Von den Bergen bin ich ganz weg“, sagte sie, als sie die Sprache wiederfand. Bald schon sollte die frisch verheiratete Marie von Bayern die Berge nicht nur bewundern, sondern auf bewundernswerte Weise bezwingen.
Gipfel für Gipfel.
Großer Pomp liegt hinter dem königlichen Paar, als Marie ihr Herz zum zweiten Mal verliert. Der Oktober 1842 war
geprägt von den Hochzeitsfeierlichkeiten des bayerischen Kronprinzen mit der preußischen Kronprinzessin gewesen. Die Verbindung der beiden großen Häuser – der Hohenzollern und der Wittelsbacher – ist auch adelspolitisch ein Fest, doch noch ausgelassener freuen sich die Bayern darüber, dass ihr schon 31-jähriger Kronprinz nach langer Suche endlich die Richtige gefunden hat. Seine um 14 Jahre jüngere Auserwählte, deren Ahnenreihe sich wie ein „Who’s who“ der deutschen Geschichte liest, erobert die Herzen der Bayern wie im Flug. Dass sie eine Preußin ist, wird ihr erstaunlich rasch nachgesehen. Die ungezwungenen Zeiten, die ihre Familie auf Schloss Fischbach in Schlesien verbracht und Wanderungen im Riesengebirge unternommen hatte, haben die Prinzessin mehr geprägt als das Berliner Hofzeremoniell. „…ihre aus dem Herzen kommende
Schloss Hohenschwangau, am Fuß des 2.047 Meter hohen Säuling gelegen, sollte für die Familie der Lieblingsplatz werden und für Marie der perfekte Ausgangspunkt für ihre Gipfelleidenschaften.

Freundlichkeit ist aber auch recht für die Bayern gemacht“, meint Schwiegervater König Ludwig I. ein paar Tage nach der Hochzeit, die Anlass war, das Oktoberfest zu gründen, sodass am Hochzeitstag des späteren Königs Maximilian II. und seiner Königin Marie nach wie vor auf den Tischen getanzt wird. Für die Flitterwochen hat der Gatte Schloss Hohenschwangau ausgewählt. Knapp zehn Jahre zuvor war dort eine Ruine gestanden, die Maximilian kaufte und an ihrer Stelle eine Sommerresidenz erbauen ließ. Hohenschwangau, am Fuß des 2.047 Meter hohen Säuling gelegen, sollte für die Familie der Lieblingsplatz werden und für Marie der perfekte Ausgangspunkt für ihre Gipfelleidenschaften.
Noch sind längst nicht alle Berge der Alpen „entdeckt“, keine Alpenvereine gegründet und die Berge schon gar nicht erschlossen. Ganz langsam erst beginnen die bislang als feindlich-wildes Terrain wahrgenommenen Gipfel zu faszinieren. Geologen, Biologen und Landvermesser sind die Ersten, die sich in die Höhen wagen, die Engländer zeigen dabei die größte Lust und als Marie von Bayern ihren ersten Gipfelsieg feiert, war Hermann von Barth (1845–1876), der Entdecker der Nördlichen Kalkalpen, noch nicht einmal geboren.
„ICHFOTOS: © ISABELLE BACHER
Shaping the world since 1919.
Unsere Leidenschaft für Technologie und das Streben nach Innovation lassen seit 100 Jahren führende Schleiflösungen für Kunden in aller Welt entstehen.


Bis 1844 nähert sich Marie von Bayern den Bergen Stück für Stück an. Sie erkundet marschierend die Umgebung, klettert hier und da schon ein Stück nach oben, doch dann packt sie das „Auffi-will-i“. Die 1.150 Meter hohe Achsel bei Musau wird heute eigentlich hauptsächlich deswegen als Gipfel wahrgenommen, weil Marie von Bayern sie 1869 mit einem großen Gipfelkreuz markieren ließ. Für sie aber ist die Achsel „ihr Erster“. Das Erlebnis ist nicht nur für sie selbst einschneidend, sondern auch für jene Hofstaatsdamen und -herren, die die 19-Jährige begleiten dürfen – oder müssen. Gekleidet
in stoffreichen Röcken, dünnen Schühchen und an das gemütliche Flanieren in königlichen Parkanlagen gewöhnt, hält sich die Begeisterung der keuchenden, stolpernden und rutschenden Entourage offenkundig in Grenzen. Vielleicht ahnen sie schon, dass dies nicht der letzte Berg sein wird, den sie erklimmen müssen. Marie von Bayern muss das gewusst haben, denn sie stiftet gleich einen Orden, den nach ihren Lieblingsblumen benannten Alpenrosenorden, um ihre Begleiter zu animieren. „Diesen Orden dürfen nur diejenigen Personen bekommen, welche mit
Im Hintergrund des Alpsees recken sich Gehrenspitze, Köllenspitze, Gimpel, Schlicke, Vilser Kegel, Rossberg und Aggenstein stolz in den Himmel.
mir, der Großmeisterin, auf dem Achsel waren“, hält sie in der Stiftungsurkunde des Ordens fest.
1869 wird das 25-jährige Bestehen des Alpenrosenordens mit einem rauschenden Fest auf der Achsel selbst und in den Dörfern Musau und Pinswang gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt ist Marie von Bayern bereits auf zahlreiche Berge gestiegen, hat unter anderem den über 2.700 Meter hohen, extrem anspruchsvollen Watzmann bezwungen. Berge zu besteigen, kam im 19. Jahrhundert nur wenigen Frauen in den Sinn und wenn es das tat, dann mussten sie dafür genügend Geld, Unabhängigkeit, ausreichend Extravaganz und ein sattsam ausgeprägtes Egal-Gefühl gegenüber den gesellschaftlichen Zucht-und-Ordnung-Zwängen haben. Vor dem Hintergrund hat Marie ziemliches Glück, kann ihr Gatte doch die Bergleidenschaft nachvollziehen und verbietet ihr lediglich, die Zugspitze zu besteigen, weil sie ihm dann doch zu gefährlich erscheint. Um ihr Bekenntnis „Bergsteigen – nichts lieber“ immer wieder umsetzen zu können, muss sie trotzdem Tabus brechen. Etwa mit dem Bergsteiger(innen)kostüm, das sie –wie berichtet wird – selbst entworfen hat. Die weiten, langen Röcke der Zeit waren an sich schon unbequem und bei Bergwanderungen erst recht. Nicht nur, weil bei Regen elendsschwere nasse Säcke aus ihnen werden mussten, sondern auch, weil die Trägerinnen nicht sehen konnten, wohin ihre Füße traten. Darum lässt sich Marie eine lange Hose
Uphill, downhill oder querfeldein. In den Pletzer Resorts kommen Genussbiker gleichermaßen wie Bike-Enthusiasten und Profis auf ihre Kosten. Egal ob mit elektrischem Turbo-Booster, eigener Muskelkraft oder bei Bike & Hike Touren –die Alpenwelt rund um die Pletzer Resorts bietet grandiose Erlebnisse!

und einen leichten Rock aus Loden schneidern. „Es bietet größte Bewegungsfreiheit bei züchtigem Aussehen. Weiter oben, fernab neugieriger Blicke, lässt sich der Rock sogar ablegen!“, beschreibt Manfred Hummel, Autor des auf Königin Maries Spuren basierenden Wanderführers „Von den Bergen bin ich ganz weg“. Ein Stock und ein Stopselhut komplettieren das Outfit, das für Marie wie eine High-End-Funktionsausrüstung gewesen sein muss. Eduard Rietschel hat sie darin 1847 – drei Jahre nach ihrem ersten Gipfelsieg – in einer kolorierten Zeichnung festgehalten.
Von der Achsel aus ist der bayerisch-tirolerische Grenzberg Säuling in voller Größe zu bewundern, der fast gezwungenermaßen zu Maries „Hausberg“ wird, reckt er sich doch direkt beim Schloss Hohenschwangau in die Höhe. Marie besteigt den Säuling als erste Frau und auch ihre Söhne Ludwig und Otto –1845 geboren der eine, 1848 der andere – begeistert sie für ihn. Im August 1857, als Ludwig fast zwölf und Otto gerade mal acht Jahre alt sind, dürfen sie ihre Mutter auf den Säuling begleiten.
Entzückende Geschichten.Allzu viele zeitgenössische Aufzeichnungen über Marie und ihr Bergleben gibt es nicht. Eine Geschichte entzückt jedoch immer wieder. So soll Marie, die mit der Thronbesteigung ihres Mannes 1848 „Königin Marie“ geworden war, 1854 anteilnehmend nachgefragt haben, wo denn dieser Bergwanderer verunglückt war, von dem ihr da berichtet wurde. Der Glücklose war am „Metzenarsch“ abgestürzt. Metze heißt so viel wie Hure und keiner traute sich, ihrer Hoheit zu erzählen, dass das Unglück am „Hurenarsch“ passiert war. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit wurde ein anderer Name für den Berg erfunden, dessen Senke „in der Kölle“ bezeichnet wurde. So wurde die Köllenspitze, der höchste Berg der Tannheimer Berge, flott umbe-
Marie Friederike Franziska Hedwig

Prinzessin von Preußen (15. 10. 1825 – 17. 5. 1889) stammt aus einem Haus mit beeindruckender Ahnenreihe. Ihr Onkel war König von Preußen, ihr Urgroßvater der Bruder von Friedrich dem Großen. Und ausgerechnet diese Prinzessin aus dem Hause Hohenzollern wird Bayerns dritte Königin. Mit 16 Jahren verliebt sie sich in ihren Bräutigam Kronprinz Maximilian von Bayern – den späteren König Maximilian II. – und gleichzeitig in ihr neues Heimatland.
Diese Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, alle waren entzückt vom sanften „Mariechen“. Nach anfänglichem Glück sollte das Leben Maries jedoch von Schicksalsschlägen geprägt sein. Die Liebe zu den Bergen indes hat sie nie verlassen.
nannt und wird bis heute so bezeichnet. Darüber, wann genau Königin Marie auf dem in 2.238 Meter Höhe liegenden Gipfel der Köllenspitze gestanden hat, streiten die Chronisten zwar, dass sie auch diesen Berg erklommen hat, ist aber fix.
Die königliche „Ersteigerin“ ist echt viel unterwegs. Die Hohenschwangau recht nahe Stadt Vils etwa wird regelmäßig von ihr und ihren Söhnen besucht. Königin Marie ist mit den Besitzern der Hammerschmiede im Vilser Ortsteil St. Anna befreundet. Diese Schmiede ist Teil eines idyllischen Ensembles unterhalb der Burgruine Vilsegg und die Chronik spricht nicht nur von 141 Besuchen ihrer Hoheit, son-
dern auch davon, dass die Prinzen Ludwig und Otto mit Vorliebe in der Ruine herumkraxeln. Macht sich Marie selbst auf zum Kraxeln, tut sie das nie allein. „Für die armen Bewohner der Gebirgsdörfer ist es ein Segen, wenn die Hofgesellschaft zur Jagd oder zum Bergsteigen kommt. Menschen und Pferde wollen versorgt sein. Führer und Träger gilt es zu entlohnen. Unterkünfte sind vonnöten. Und die adeligen Herrschaften zahlen gut für die angebotenen Dienste“, beschreibt Manfred Hummel die einschneidenden wirtschaftlichen Effekte der königlichen Leidenschaft auf das Außerfern und hält fest: „So wird die Königin bald zur ‚Retterin in der Noth‘. Ihre Unternehmungen ziehen auch Nachahmer an. So fördert Marie, sicher ungewollt, den Alpentourismus.“
In den Tiroler Dörfern, die sie immer wieder besucht, wird Königin Marie fast wie eine Heilige verehrt. Besondere Spuren hinterlässt sie in Elbigenalp, dem Hauptort des Lechtales. Ludwig II., der nach dem plötzlichen Tod seines Vaters im Jahr 1864 König der Bayern geworden war, hatte seiner Mutter nach einem Ritt bis Häselgehr begeistert von dem Tal erzählt und nachdem sie Elbigenalp im Jahr 1867 zum ersten Mal besucht, wird der Ort eine Art Residenzdorf für die Königin.
Den Takt ihrer Bergtouren hat Marie schon reduziert, nachdem ihr Mann gestorben war, und nach ersten Anfällen von Gelenksrheumatismus kommt er vollends zum Erliegen. Die letzten Jahre der Alpenrosenkönigin sind alles andere als heiter. Sohn Otto wird eine unheilbare psychische Krankheit diagnostiziert und Sohn Ludwig, der König, wird zunehmend wunderlich und stirbt 1865 wohl in Folge eines mörderischen Komplotts. Bevor Marie am 17. Mai 1889 im Alter von 64 Jahren im Schloss Hohenschwangau stirbt, sagt sie: „Ich gehe aus einem schönen Lande in ein noch schöneres. Gott segne Bayern, Preußen, mein liebes Tirol.“ Alexandra_Keller

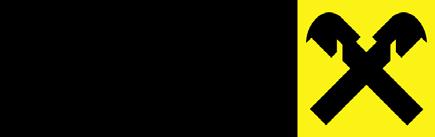
In seinem 2019 im Verlag Berg & Tal erschienenen Buch „Von den Bergen bin ich ganz weg“ fasst Manfred Hummel, langjähriger Redakteur der Süddeutschen Zeitung und Autor zahlreicher Wander- und Radlführer, das Bergleben von Königin Marie von Bayern in kompakte Worte und 23 auf den Spuren der Königin basierende Wanderungen in einen Wanderführer. Um die Welt, in der Marie von Bayern sich am liebsten bewegte, erfassen und ihre Leidenschaft nachvollziehen zu können, eignet sich die Wanderung auf den Thaneller am besten.
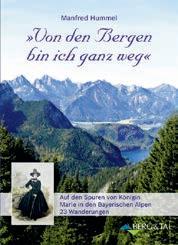
Dazu hält Manfred Hummel fest: Bereits von der Talstation des Thaneller-Karlifts aus ist der Gipfel zu sehen. Wir folgen der Beschilderung und wandern über leicht ansteigende Wiesen entlang der Lifttrasse zum Fahrweg, links und dann geradeaus in den gut markierten Steig. Zunächst geht es in Kehren durch den Wald, später durch Latschen hinauf zum Kampeleplatz, 1.717 m. Weiter in Serpentinen auf den freien Rücken des Thaneller-Südgrates. Der Weg wird steiler und felsiger. Über grasdurchsetztes Schrofengelände erreichen wir auf einem breiten Rücken den Gipfel.
• Talort: Berwang, 1.342 m / Heiterwang, 994 m

• Gipfel: Thaneller, 2.341 m
• Start: Talstation des Thaneller-Karlifts zwischen Berwang und Rinnen.
• Gehzeit: Über den Kampeleplatz auf den Gipfel 3 1⁄2 Stunden, Abstieg 2 1⁄2 Stunden. Gesamtgehzeit 6 Stunden.
• Schwierigkeit: Mittelschwere Bergwanderung auf Fahrweg, Wanderweg und einfachem Bergsteig. Von Heiterwang am gleichnamigen See erfordert der Aufstieg Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Kondition. Beim Aufstieg von Berwang spart man sich etwa 350 Höhenmeter.
Info · Karten T +43 (0)5373 81000-20 karten@tiroler-festspiele.at www.tiroler-festspiele.at
Free from giddiness, courageous and intrepid, she climbed and scaled the peaks of the Lechtal Valley and Allgäu Alps. Marie of Bavaria, mother of King Ludwig II, was one of the first female alpinists.
her, however, the Achsel was “her first”. The experience was not only profound for her, but also for the ladies and gentlemen of the court who accompanied - or had to accompany - the 19-year-old. Dressed in fabric-rich skirts and thin little shoes, the enthusiasm of the panting, stumbling and sliding entourage was obviously limited. Marie of Bavaria must have known this, because she immediately founded an order, the Alpine Rose Order, named after her favourite flowers, to encourage her companions.
It was love at first sight. This was also said to be the case with her future husband, but the moment when the then Crown Prince Maximilian of Bavaria (1811-1864) made Marie of Prussia’s (1825-1889) heart leap for the first time was and remains private. Marie of Prussia’s other love, however, her love for the Tyrolean Mountains, is different. It is eternally comprehensible because the panorama never changes. When the young woman saw it for the first time, she was so intoxicated by it that it was to determine a wonderfully exciting part of her life and awaken extraordinary daring in her.
Until 1844, Marie of Bavaria approached the mountains bit by bit. She explored the surroundings on foot, climbed a bit here and there, but then she decided to go big. The 1,150-meter-high Achsel near Musau is today mainly perceived as a peak because Marie of Bavaria had it marked with a large cross in 1869. For

Climbing mountains occurred to only a few women in the 19th century, and if it did, they had to have enough money, independence, and a satiable sense of indifference to social constraints to do it. Against this background, Marie was quite lucky, as her husband was able to understand her passion for the mountains and only forbade her to climb the Zugspitze because it seemed too dangerous to him. In order to be able to realize her commitment to mountaineering over and over again, she nevertheless had to break taboos. For example, with her mountaineering costume, which she reportedly designed herself. She had long trousers and a light skirt made of loden. A cane and a stopsel hat completed the outfit, which must have been like highend functional equipment for Marie.
Marie had already reduced the pace of her mountain tours after her husband died, and after the first bouts of articular rheumatism, it came to a complete halt. Before Marie passed away on May 17, 1889, at the age of 64 in Hohenschwangau Castle, she said: “I am going from a beautiful country to an even more beautiful one. God bless Bavaria, Prussia, my dear Tyrol.”
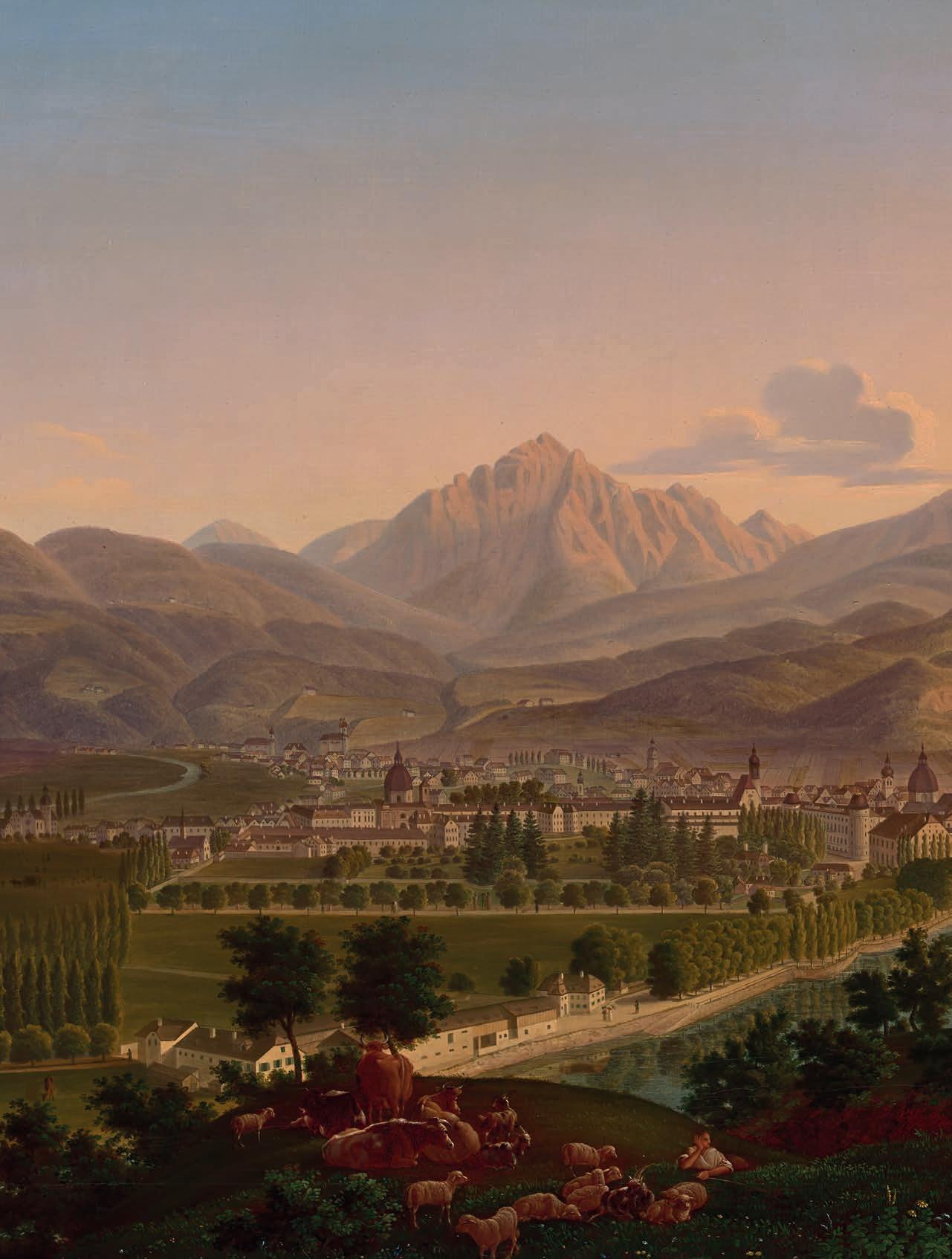

Zwischen dem 18. und 22. August 2022 steht am Fuße des Wilden Kaisers in St. Johann in Tirol wieder alles im Zeichen des Radsports. Bei der 54. Auflage des Radweltpokals werden wieder mehr als 3.500 Teilnehmer erwartet. Damit zählt die Veranstaltung, bestehend aus dem Internationalen Radweltpokal, dem Juniors Cycling Cup, dem Airport Sprint, dem Bergsprint, der Vintage WM und der World Masters Cycling Classic Championship, zu den größten Radsportveranstaltungen der Welt. Weltpokal-Gründer Franz Baumann war damals ein Rennen vorgeschwebt, das es ehemaligen Radrennfahrerinnen und Radrennfahrern ermöglichte, ihren geliebten Sport in ihren jeweiligen Altersklassen auszuüben. Ambitionierten Sportlern bietet die Veranstaltung vor der einzigartigen Kulisse des Wilden Kaisers die Möglichkeit, eine Woche lang mit Begeisterung den schönsten Sport der Welt auszuüben.
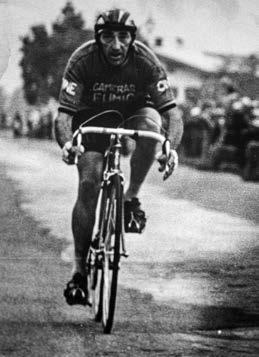




„Beim Ötztaler Radmarathon sind keine Abkürzungen möglich, wer A sagt, muss auch B sagen und die Runde fahren oder – wenn der Traum platzt - im Besenwagen gefahren werden“, beschreibt der langjährige OK-Chef Ernst Lorenzi den Reiz der Veranstaltung, die dem Radsport im Ötztal zu höchster Popularität verholfen hat. Der als extrem schwierig geltende Radmarathon geht am 8. August 2022 zum 41. Mal über die Bühne. „Die Teilnehmer sind heutzutage wesentlich besser vorbereitet und trainiert als früher. Heute werden ultraleichte, fast ausschließlich aus Carbon gefertigte Räder gefahren, früher kamen harte, schwere, bockige Stahlrahmen zum Einsatz“, erinnert sich Lorenzi. Der Radmarathon, der die facettenreiche Tiroler Landschaft mit seiner harschen Gletscherwelt, dem sanften Mittelgebirge und den idyllischen Südtiroler Weinbergen zur Kulisse hat, ist nach wie vor eine unglaubliche Herausforderung: 227 Kilometer, 4 Alpenpässe, 5.500 Höhenmeter und ein Kampf gegen sich selbst erwarten jeden Einzelnen der rund 4.000 Teilnehmer.




Dass der Dolomitenmann als absoluter Extrembewerb nur für die „Härtesten unter der Sonne“, wie es Event-Erfinder Werner Grissmann zu formulieren pflegt, in Frage kommt, ist bekannt und trägt zur besonderen Faszination der Veranstaltung bei, die am 10. September 2022 ihr 35-jähriges Jubiläum feiern darf. Der Red Bull Dolomitenmann wird seit 1988 alljährlich ausgetragen und gilt als härtester Teambewerb der Welt, bei dem es heißt: laufen, fliegen, treten und paddeln, was der geschundene Körper hergibt. Für viele Athleten ist das Event ein Erlebnis, bei dem der unbändige Wille letztlich über den Körper triumphiert. Werner Grissmann erinnert sich an die Premiere: „Viele Starter haben den Wettbewerb total unterschätzt. 54 Teams sind gestartet und 25 kamen ins Ziel. Die Paragleitschirme waren nur Fetzen und es gab keine Mountainbikes. Da kam es vor, dass die Räder einfach gebrochen sind. Heute arbeiten alle Athleten mit dem besten Equipment und versuchen sich durch die Technik einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Doch eines bleibt immer, die Dolomiten sind der härteste Gegner.“ Das Material ist heute viel besser, die Herausforderung dadurch jedoch kein bisschen kleiner. Aber spektakulär ist er wie eh und je, der Dolomitenmann.



„Die Legende lebt!“ ist das Motto des Karwendelmarschs, der am 27. August 2022 nach der neuen Zeitrechnung zum 13. Mal ausgetragen wird. Premiere hatte die sportliche Durchquerung des imposanten Karwendelgebirges von Scharnitz bis nach Pertisau am Achensee bereits 1969, ehe die Veranstaltung 1990 auf Eis gelegt wurde und es bis ins Jahr 2009 gedauert hat, bis die Legende zurückkehren durfte. Das Teilnehmerfeld ist auf 2.500 Startplätze begrenzt, um die sensible Natur im imposanten Naturpark Karwendel nicht über Gebühr zu beanspruchen. Während beim Marsch das Motto „Der Weg ist das Ziel“ lautet, zählt in der Laufklasse jede Sekunde. Zu den Siegern darf sich aber jeder zählen, der die 52 Kilometer lange Strecke, knapp 2.300 Höhenmeter und dabei nicht zuletzt sich selbst überwunden hat.

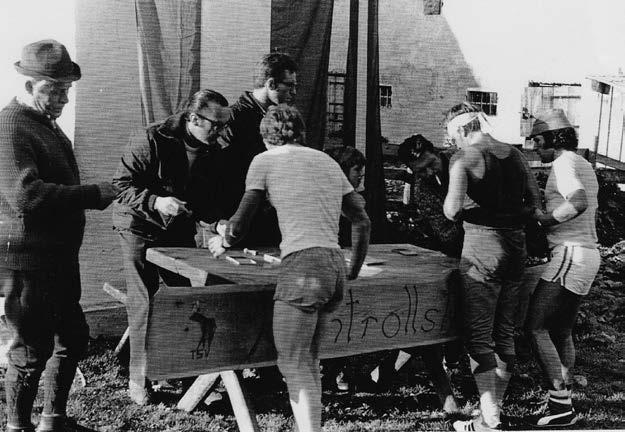

as Regionale, Echte und Unverfälschte ist fest in der DNA der Marke Tirol verankert. Darum wird auch bei der Kollektion Tirol besonderes Augenmerk darauf gelegt, wo die Produkte herkommen und welche Geschichte in ihnen steckt.
Der achtsame Umgang mit Ressourcen wird großgeschrieben und bei der Wahl der Partner und Produzenten haben Qualität, faire Produktionsbedingungen sowie möglichst kurze Transportwege höchste Priorität. „Alles, was technisch und wirtschaftlich möglich ist, wird in Tirol und im Alpenraum produziert“, gibt Claudia Pichler, Geschäftsführerin des Tirol Shops, ein klares Statement zur Regionalität ab. So entsteht beispielsweise das gesamte Sortiment der Traditionslinie ausschließlich in Zusammenarbeit mit heimischen Designern und Herstellern. „Und wir wollen uns auch nicht dem Diktat der Modeindustrie und Fast Fashion mit teilweise jährlich zwölf Kollektionen unterwerfen“,

denn ganz egal, ob es sich um einen schicken Mantel, ein lässiges Shirt, eine kuschelige Decke oder Edles für den Tisch handelt – sämtliche Produkte „Marke Tirol“ zeichnen sich durch Zeitlosigkeit und Langlebigkeit aus. Sie sind gemacht, um viele Jahre Freude daran zu haben – unabhängig davon, ob man etwas Schönes für sich selbst kauft oder jemanden anderen damit beschenken will.


Maria-Theresien-Str. 55 6020 Innsbruck Mo.–Fr. von 08.00 bis 18.00 Uhr Sa. von 09.00 bis 13.00 Uhr
Burggraben 3 6020 Innsbruck Mo.–Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr Sa. von 10.00 bis 17.00 Uhr







„Kasanova“ Benjamin Schmidhofer hat die weltweit vermutlich erste völlig autarke mobile Käserei entwickelt.

Käse ist ein wertvolles Lebensmittel, das in Tirol Tradition und Konjunktur hat. Davon zeugt das Auftreten von immer neuen Kleinsennereien, die aus einem guten Rohstoff – der Milch, nicht selten in Heumilchqualität – hervorragenden Käse machen.

 Harald Weidacher
Harald Weidacher
Es ist kein Geheimnis, dass ein Milcherzeugnis nur so gut sein kann, wie es der Ausgangsrohstoff zulässt. Beim Käse, der durch die Gerinnung des Kaseins, eines Milchproteins, entsteht, ist dieser Rohstoff, auf den es ankommt, die Milch, die in Tirol von besonders hoher Qualität ist. Hier dürfen die Milchkühe in den Sommermonaten nämlich vielfach auf die Alm, wo sie saftige Gräser und beste Kräuter fressen, im Winter überwiegend Heu. Für die Ziegen und Schafe im Land gilt dasselbe, nur dass diese noch in weit höheren alpinen Lagen weiden können.
Die Heuwirtschaft ist die ursprünglichste Form der Milcherzeugung. Heumilch weist laut einer Studie der Universität für Bodenkultur in Wien unter anderem einen rund doppelt so hohen Wert an Omega-3-Fettsäuren auf wie herkömmliche Milch. Größere Artenvielfalt im Futter schlägt sich außerdem im Aroma der Milch nieder. Das macht besonders die Heumilch zum idealen Rohstoff für Käsespezialitäten. Das heißt freilich nicht, dass konventionelle Milch nicht auch zur Käseherstellung taugen würde, aber aus gutem Grund wird in Tirol viel und gerne mit Heu- und Almmilch gekäst.
Käseland im Gebirg.
Einer, der sich mit Käse bestens auskennt, ist Harald Weidacher. Er unterrichtet an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser in St. Johann und ist
Österreichs Käsesommelier des Jahres 2021, der sein Fachwissen nicht nur an Schüler weitergibt, sondern auch Lehrkräfte zum Käsesommelier ausbildet. Ähnlich wie beim Wein musste sich in Österreich und speziell in Tirol in den vergangenen Jahrzehnten erst allmählich ein Bewusstsein dafür herausbilden, dass man auch ein sehr gutes Käseland ist mit einer Vielzahl an Sor-

ten, die den internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. Als Botschafter des Käses hat Weidacher seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Kaum ein Tag vergeht, an dem der Sommelier nicht irgendeinen Käse probiert und sein Wissen vertieft, um es weiterzugeben und Menschen für dieses hochwertige Lebensmittel zu begeistern.
Zum Einsteigen beginnt der Sommelier mit seinen Schülern üblicherweise bei den milden Käsesorten, die wohl massenkompatibler sind als länger gereifte, geschmacks- und geruchsintensivere Käse mit Ecken und Kanten. „Käsekompetenz gehört für mich zur gastronomischen Allgemeinbildung, die wir unseren Schülern unbedingt vermitteln wollen“, sagt Weidacher. Die käsekundigen Absolventen und Käsesommeliers wirken als Multiplikatoren, die den Konsumenten die Vorzüge der heimischen Käsepalette näherbringen. Dadurch entsteht auch eine größere Wertschätzung für das äußerst arbeitsintensive Lebensmittel Käse. Ein Käselaib entsteht nicht von selbst, sondern braucht unzählige Arbeitsschritte, die sich von der Herstellung über die Reifung bis hin zur richtigen Lagerung erstrecken. „Tirols Käsereien haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und leisten allesamt wirklich gute Arbeit. Wir brauchen jedoch die großen Erzeuger genauso wie die kleinen und haben insgesamt sowohl bei herkömmlicher Milch als auch bei der Heumilch einen durchwegs sehr hohen Milchstandard“, weiß Weidacher.
Die Voraussetzungen für ganz großen Käse aus dem Land im Gebirg stimmen, die Produktqualität sei, versichert der Kenner, quer durchs Sortiment gut. Gegenüber seinem pasteurisierten Pendant weist Rohmilchkäse einen etwas komplexeren Geschmack auf, erklärt Weidacher: „Durch das Erhitzen der Milch gehen nämlich gewisse Töne verloren, deshalb ist Rohmilchkäse in der Regel geschmacklich komplexer. Manche Käsesorten brauchen Rohmilch als Grundlage, damit der Käse überhaupt erst richtig heranreifen kann.“ Das heißt natürlich nicht, dass Käse aus pasteurisierter Milch nicht auch großartig schmecken kann.

Tirols Käseschatz besteht aus hervorragenden Weich- ebenso wie aus Schnittkäsen – dazu gehören etwa Tilsiter und Appenzeller – und Hartkäsen wie diversen Bergkäsen sowie zunehmend auch Frischkäsen auf hohem Niveau. Den Tiroler Graukäse als Vertreter der Gattung Sauermilchkäse hält der Experte für kulinarisch meist unter seinem Wert geschlagen. Mit einem Fettanteil von nicht mehr als zwei Prozent F. i. T. (Fett in der Trockenmasse) ist der Graukäse zudem ein ebenso eiweißreiches wie fettarmes und damit gesundes Lebensmittel.
Eine Frage des Terroirs.
Was die Franzosen als „Terroir“ bezeichnen und heute vor allem in Bezug auf Weinbau verwendet wird, gilt genauso für den Käse. Der Ort, an dem
Käse / Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse: Hartkäse: < 59 %
Halbharter Schnittkäse: 52–60 % Schnittkäse: 54–63 % Halbweicher Schnittkäse: 61–69 % Sauermilchkäse: 60–73 % Weichkäse: > 67 % Frischkäse: > 73 %
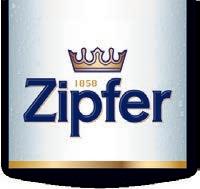
Mit Mühlviertler Naturhopfen.
Hopfen-Liebhaber schmecken in unserem Pils so vieles: Die Kraft des Mühlviertels, das Geschick unseres Braumeisters – und vor allem die Noten von 4 Sorten Naturhopfen, besonders fein abgestimmt, durchgehend zart hopfig und … urtypisch.
 ©
TIROL WERBUNG / JÖRG KOOPMANN
©
TIROL WERBUNG / JÖRG KOOPMANN
der Käse gelagert wird – das kann zum Beispiel ein Felsenkeller sein –, hat großen Einfluss darauf, wie sich der Käse während der Reifung entwickelt und wie er letztendlich schmeckt. „Die Mikroorganismen und damit die Aromatik sind in jedem Raum anders. Dafür gibt es kein Rezept, das man einfach weitergeben kann“, sagt Weidacher. Routinierte und talentierte Käser können schon bei der Produktion Unterschiede in der Milch feststellen und darauf reagieren. „Manch alter Käser, der noch händisch käst, merkt zum Beispiel an der Milch, ob es kürzlich ein Gewitter gegeben hat. Das klingt unglaublich, aber es ist so. Dieses alte Wissen, das Gespür und Gefühl hat in der Käseherstellung eine große Bedeutung“, sagt Weidacher. Daran lässt sich erahnen, dass Käse tatsächlich ein höchst sensibles Lebensmittel ist, das nicht immer exakt gleich schmecken muss. Das trifft freilich bei den größten Erzeugern weniger zu als bei den kleinen Käsereien, weil Erstere danach trachten, reproduzierbare Herstellungsbedingungen zu schaffen, und viele Konsumenten erwarten, dass der Käse immer genauso schmeckt wie gewohnt.

Käse als Kulturfrage.
Auf immer höherem Niveau gekäst wird in Tirol nicht allein in den großen und kleinen Sennereien, sondern auch in den Schulen, zum Beispiel in der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Tirol in Rotholz, die heute zu Recht als Kompetenzzentrum für Milchverarbeitung gilt. Gekäst wird außerdem heut-
Aus diesen Sennereien kommen heimische Käse, von denen manche das „Qualität Tirol“Siegel tragen dürfen. Dieses steht für Produkte, die in Tirol gewachsen sind und hier veredelt wurden. Ein echtes Stück Tirol also.
• Sennerei Grins, Grins
• Sennerei Ried, Ried im Oberinntal
• Arlbergsennerei, Flirsch im Stanzertal
• Dorfsennerei See, See im Paznaun
• Sennerei Westendorf, Westendorf
• Schaukäserei Wilder Käser, Kirchdorf, Gasteig
• Biosennerei Kolsass, Kolsass
• Lechtaler Natursennerei, Steeg im Lechtal
• HBLFA Tirol, Rotholz
• Sebastian Danzl’s Sennerei, Schwendt
• Sennerei Hatzenstädt, Hatzenstädt
• Bergkäserei Biedermann, Grän
• Alpbachtaler Heumilchkäserei, Reith im Alpbachtal
• Biokäserei Walchsee, Walchsee
• Lieb Graukäse, Weerberg
• Kaiserwinkl Sennerei, Kössen
• Sennerei Reutte, Reutte
• Käserei Plangger, Niederndorf
• Zillertaler Heumilchsennerei, Fügen
• Bergkäserei Zillertal, Schlitters
• Erlebnissennerei Zillertal, Mayrhofen
• Sennerei Zell, Zell am Ziller
• Milchbuben, Hopfgarten
• Figerhof, Kals
• Scheibers Hofkäserei, Silz
• Hofkäserei Huber, Galtür
zutage sogar schon mobil. Der 28-jährige Zillertaler Käsemeister Benjamin Schmidhofer hat sich eine vollwertige, mit Pelletsofen beheizte mobile Käserei zunächst ersonnen und dann mit Freunden realisiert. Platz findet sie auf einem Lastwagen. Mit diesem Gefährt ist Schmidhofer als Kasanova im ganzen Land unterwegs. „Das ist sicher die weltweit erste völlig autarke mobile Käserei“, erklärt der Käsemeister. Beim Kasanova kommt nicht die Milch zur Sennerei, sondern die Sennerei zur Milch.
Bewegung ist auch in Schmidhofers beruflicher Laufbahn ein wiederkehrendes Motiv. Nach der Lehre und Meisterprüfung in Tirol sammelte er in Vorarlberg und der Schweiz wertvolle Erfahrung und half in Südamerika monatelang mit, eine Käserei umzustrukturieren. „In der Schweiz, beim siebenfachen Käseweltmeister Willi Schmid, habe ich ganzheitliches Denken gelernt. Es gibt sehr viele Faktoren, die sich auf die Qualität der Milch auswirken. Ein guter Käser muss diese erkennen und berücksichtigen“, sagt Schmidhofer, der gute Milch als absolute Grundvoraussetzung für einen guten Käse betrachtet und ein feines Sensorium für die verschiedenen Faktoren entwickelt hat, die über die Milch Einfluss auf den Käse nehmen. Seine Käsekulturen züchtet er aus einem Sauerkraut heraus selbst. „Meine Kulturen sind meine Visitenkarte“, sagt der Käser.
Käse ist also im Wesentlichen eine Frage der richtigen Kultur. Bei der Auswahl der geeigneten Milchsäure-
„ICH PROFITIERE VOM WISSEN DER BAUERN ÜBER IHR PRODUKT UND KANN DARAUS EINEN TOLLEN KÄSE MACHEN.“
Benjamin Schmidhofer
bakterien und Kulturen orientiert sich Schmidhofer an den jeweils vor Ort herrschenden Gegebenheiten, stellt seine mobile Käserei direkt beim Bauern bzw. auf dessen Alm ab und verarbeitet die frische Milch binnen weniger Stunden zu Käse. Die Molke bleibt vor Ort, die Käselaibe nimmt Schmidhofer zur fachgerechten Reifung in sein Lager mit, weggeworfen wird nichts. In Sachen Käse ist der Zillertaler Perfektionist, der bis ins kleinste Detail überhaupt nichts dem Zufall überlässt. Das Lab bezieht er eigens aus einer kleinen Manufaktur in Frankreich. Der Einsatz Schmidhofers zahlt sich schon bei wenigen Hundert Litern Milch aus, maximal kann der Kasanova mit seiner Edelkäsemanufaktur auf Rädern 1.800 Liter pro Tag zu Käse veredeln. Dann ist allerdings ein echter Käsemarathon von früh bis spät angesagt.

Der Austausch mit den Bauern, die mit ihren Kühen für das weiße Gold, aus dem die Käse sind, verantwortlich zeichnen, ist Schmidhofer besonders wichtig. „Ich profitiere vom Wissen der Bauern über ihr Produkt und kann daraus einen tollen Käse machen“, meint der Käser, der sein Wissen an einen Lehrling weitergibt. Es mache einen geschmacklichen Unterschied, von welcher Rinderrasse die Milch komme, betont Schmidhofer. Das hat er von Willi Schmid in der Schweiz gelernt. „Der hatte fünf verschiedene Milchsorten. Die Milch von einem Braunvieh ergibt zum Beispiel einen ganz anderen Käse als die von einem Fleckvieh. Jersey-Rinder geben die beste Milch für Blauschimmelkäse, und Büffelmilch harmoniert am besten mit Trüffel“, führt Schmidhofer aus. „Diese Raffinessen möchte ich zukünftig in meinem Käse zur Entfaltung bringen. Und mit Bauern zusammenarbeiten, die meine Qualitätsphilosophie teilen.“ Das Steckenpferd des Zillertalers ist der Appenzeller, ein Rohmilch-Schnittkäse mit Schweizer Wurzeln. Bis ein Käse fertig zum Ver-
zehr ist, geht er dutzende Male durch die kundigen Hände des Käsemeisters, der in Söll für die nächsten 20 Jahre eine Käserei gemietet hat. Ein zweites, stationäres Standbein, das das mobile Angebot ergänzt. Dort hat Schmidhofer ein Käselager mit Innenwänden aus Backstein errichtet. „Der Backstein unterstützt als natürliches Material die Reifung“, weiß der Käser. Im Frühjahr, sobald die Kühe nach einem langen Winter wieder auf den Feldern im Freien grasen dürfen, ist beim Kasanova Hochsaison.
Die Richtung, die Tirol in Sachen Käse eingeschlagen hat, stimmt. Könnte sich Harald Weidacher, der Käsesommelier des Jahres, etwas wünschen, wäre es, dass im Land noch mehr Rohmilchkäse produziert wird und man beim Affinieren – dem Veredeln innen wie außen – noch mehr wagen würde. „Gekonnte

Raffiniert affiniert: Benjamin Schmidhofer massiert kaltgepresstes Hanfnussöl in seine Laibe ein.
Affinage kann aus einem guten Käse einen hervorragenden Käse machen“, meint Weidacher. Irgendwann, später im Ruhestand, würde er gerne in Innsbruck eine große Käsemesse veranstalten, um das Lebensmittel zu zelebrieren, um das die Leidenschaft des Kenners kreist. Eine Leistungsschau der heimischen Käser und ein großes Fest für die Gaumen der zahlreichen Käseliebhaber. Kasanova Benjamin Schmidhofer ist angetreten, auf Grundlage bester Heumilch das Thema Käse weiterzudenken, weiter zu veredeln und neue Sorten zu kreieren.
Man darf jedenfalls gespannt sein und muss kein Hellseher sein, um dem Käseland Tirol insgesamt eine gute Zukunft prophezeien zu können. Dafür ist gesorgt, weil es Leute wie Harald Weidacher und Benjamin Schmidhofer gibt, die leidenschaftliche Käsekenner und -kreateure sind, die das edle Milchprodukt ins Zentrum ihres Tuns gerückt haben. Marian_Kröll
© KASANOVAZutaten Teig
400 g Roggenmehl 250 ml Milch oder Wasser 10 g Butter etwas griffiges Weizenmehl zum Ausrollen des Teiges
Zutaten Füllung
ca. 500 g Erdäpfel 250 g Gemisch aus Topfen, Graukäse und Ziegerkäse 1 Zwiebel, Schnittlauch, Salz etwas heißes Wasser oder Milch Butterschmalz zum Ausbacken
» Für den Teig die Butter in der heißen Milch auflösen, über das Mehl gießen, zu einem festen Teig zusammenkneten und rasten lassen.
» Für die Fülle die Erdäpfel kochen und anschließen passieren. Die klein geschnittene Zwiebel, Salz, Topfen, Graukäse und Ziegerkäse zufügen und mit etwas Milch zu einer sämigen Masse vermengen.
» Den Teig zu einer Rolle formen (ca. 5 cm Durchmesser), anschließend kleine Scheiben abschneiden und diese schön dünn und rund austreiben. Die Teigblättchen in der Mitte mit Fülle belegen und zusammenschlagen. Die Ränder gut zudrücken, damit die Fülle nicht auslaufen kann.
» Danach die Krapfen in heißem Butterschmalz goldbraun ausbacken.
Wer keine Zeit oder Muße hat, seine Krapfen selbst zu machen, dem empfehlen wir als Alternative jene von der dengg krapfen & knödel manufaktur aus Hall, die Deflorian-Spezialitäten aus Gnadenwald oder die Gaumenfreuden von Knödel Geri aus Reith im Alpbachtal.


400 g Knödelbrot (evtl. eine Kartoffel) 400 g Käse (200 g Graukäse, 200 g Bergkäse)
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen 200 ml warme Milch
3 Eier Butter und Öl zum Herausbraten (Öl, damit die Butter nicht braun wird) etwas Mehl Petersilie, Schnittlauch, Majoran Salz, Pfeffer, Muskatnuss
» Zuerst das Knödelbrot fein würfeln und mit der warmen Milch übergießen, die Eier untermischen und den Teig ziehen lassen
» Zwiebeln und Knoblauch hacken und in einer Pfanne in Butter und Öl leicht anrösten. Kräuter in die Pfanne zugeben und kurz mitrösten (alles etwas abkühlen lassen)
» Die gerösteten Zwiebeln, Knoblauch und Kräuter und den fein gewürfelten Käse zu einem Knödelteig verkneten und würzen (mit Kräutern, Salz, Pfeffer und Muskatnuss), dann mit etwas Mehl bestäuben
» Die Hände befeuchten und dann immer einen Esslöffel voll Teig nehmen, daraus einen Knödel drehen und diesen auf ca. 2 cm Höhe plattpressen (darum heißt er Pressknödel)
» In einer Pfanne mit etwas Butter für den Geschmack und etwas Öl die Knödel goldbraun herausbraten (ca. 4 Minuten auf jeder Seite)
Servieren kann man die Kaspressknödel mit Sauerkraut, Salat, als Suppeneinlage (traditionell in einer kräftigen Rinderbrühe) oder als gebratener Knödel mit Ei.
Das Rezept stammt von der 91-jährigen Klara Ziernhöld aus Pettnau, die uns mit dem Geheimnis des perfekten Kaspressknödels vertraut gemacht hat.
Cheese is a valuable product that has a long tradition in Tyrol. This is proven by the appearance of ever new small alpine dairies, which make excellent cheese from a good raw material - milk, not seldom in hay-milk quality.
It is no secret that a milk product can only be as good as the starting raw material allows it to be. In the case of cheese, which is made by coagulating casein, a milk protein, this raw material that matters is the milk, which in Tyrol is of particularly high quality. Here, dairy cows are often allowed to graze on alpine pastures in the summer months, where they eat lush grasses and the best herbs, and mainly hay in the winter. The same applies to the goats and sheep in the country, except that they can graze at much higher alpine altitudes.
One person who certainly knows a thing or two about cheese is Harald Weidacher. He teaches at the Tourism Schools at Wilder Kaiser in St. Johann and is Austria’s Cheese Sommelier of the Year 2021. Not only does he share his expertise with students, but he also trains teachers to become cheese sommeliers. Similar to the situation with wine, Austria and especially Ty-
rol have had to gradually develop an awareness over the past decades that they are also a very good cheese country with a large number of varieties that do not have to shy away from international comparison.
Tyrol’s cheese treasure consists of excellent soft cheeses as well as semi-hard cheeses - such as Tilsiter and Appenzeller - and hard cheeses such as various mountain cheeses and also increasingly high-quality fresh cheeses. The expert considers Tyrolean gray cheese as a representative of the sour milk cheese genre to be mostly beaten below its value in culinary terms. With a fat content of no more than two percent FDM (fat in dry matter), gray cheese is also a food that is as rich in protein as it is low in fat and therefore healthy. To get started, the sommelier usually introduces the mild cheeses, which are probably more compatible with the masses than cheeses with a longer aging period and a more intense taste and aroma.

Mehr als 120 Metzgereien versorgen die Tiroler*innen täglich mit qualitativ hochwertigen Fleischprodukten direkt aus der Region. Mit der neuen Onlineplattform www.tirol-schmeckt.at/tiroler-metzger bieten die heimischen Metzger spannende Einblicke in ihr tägliches Tun.


egionalität ist in aller Munde, denn das Bewusstsein und die Nachfrage nach heimisch erzeugten Lebensmitteln ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen. „Die Tirolerinnen und Tiroler konsumieren bewusster regionales Fleisch. Dabei achten sie mehr auf die Herkunft und das Tierwohl. Dieses steigende nachhaltige Bewusstsein stärkte uns Metzger und brachte insgesamt mehr Kundinnen und Kunden in den letzten Jahren“, erklärt Peter-Paul Schweighofer, Metzger-Innungsmeister in der Wirtschaftskammer Tirol.
R
Diesen positiven Trend möchten die heimischen Fleischerbetriebe nutzen und verstärkt auf ihre vielfältige
handwerkliche Tätigkeit aufmerksam machen. Seit neun Monaten begeistert die neue Onlineplattform www.tirolschmeckt.at tausende User*innen mit exklusiven Backstage-Einblicken in die Metzgereien, Bäckereien, Konditoreien und Genussmittelbetriebe Tirols. Neben den Geschichten und Porträts der Mitgliedsbetriebe bietet die Website auch eine kompakte Übersicht über alle regionalen Lebensmittelbetriebe in der Region. Mit dieser Initiative werden nicht nur neue Kund*innen, sondern auch potenzielle Mitarbeiter*innen erreicht. „Junge Menschen, die eine Metzgerlehre absolvieren, sind begeistert vom breiten Aufgabengebiet. Es ist ein nachhaltiger und krisenresistenter Beruf“, informiert
der Metzger-Sprecher. Jetzt reinklicken und die spannende Welt der Tiroler Metzger*innen entdecken!
Sobald die warme Jahreszeit beginnt, ist auch die Grillsaison eröffnet. Mit Lebensmitteln mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ wird es Ihnen beim Grillen mit Freunden und Familie an nichts fehlen.

rillen ist viel mehr als eine Form des Kochens. Die älteste Weise, Fleisch zu garen, steht heute für Geselligkeit, Unterhaltung und Genuss. Damit das Grillen neben einem gesellschaftlichen auch zu einem kulinarischen Erlebnis wird, gibt es einige Dinge zu beachten. In erster Linie ist die Qualität ein entscheidender Faktor. Gutes Fleisch schrumpft am Grill nicht zusammen, sondern bleibt saftig und zart. Fleisch- und Fischspezialitäten mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ sind dabei eine echte Besonderheit. Almrind, Hofschwein, Berglamm, Bio-Sommerrind und Kwell-Saibling mit der Herkunftsgarantie „gewachsen und veredelt in Tirol“ gelingen am Grill besonders gut. Die Würste Edelweiße und Edelbrater runden das regionale Grillangebot ab.
Die Bio-Topfkräuter der Gärtnerei Strillinger in Söll bringen geschmacks- und vitaminreichen Genuss in die Küche. Basilikum, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Liebstöckel, Salbei, Zitronenmelisse und Co geben jeder Speise eine ganz besondere Note. Besonders beim Grillen sind Kräuter ideal, um Fleisch oder Saucen das gewisse Etwas zu verleihen.

Auf einem Grill lässt sich heute fast alles zubereiten: ob Fisch, Schweine- oder Rindfleisch, Obst oder Gemüse. Mit Besonderheiten wie den Kaiserschmarrn-Muffins werden Sie bei Ihrer nächsten Grillfeier bestimmt punkten.
als ideale Beilage.
Auch das Angebot an Gemüse mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ ist vielfältig und umfangreich. Erdäpfel, Frühlingszwiebeln oder Karotten gehören ebenso zum Sortiment wie Tomaten oder Zucchini. Der Frischevorteil liegt in der täglichen Gemüseernte und den kurzen Transportwegen.
Weitere Infos und Bezugsquellen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter qualität.tirol
Zutaten für 9 Stück
400 g Faschiertes vom „Qualität Tirol“ Almrind
5 EL Semmelbrösel
1 kl. „ Bio vom Berg“ Zwiebel
1 „Qualität Tirol“ Goggei
1 roter Paprika (optional)
» Das Faschierte in eine Schüssel geben.
» Die Zwiebel und den Paprika fein schneiden und zum Fleisch geben.
» Das Ei und die Brösel in die Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer würzen und vermischen.
» Holzspieße (in Wasser einweichen) verwenden und das Fleisch zu ca. 27 Kugeln formen und jeweils 3 Stück auf jeden Spieß geben.
» Die Fleischbällchen mit etwas Öl bepinseln und auf den bereits heißen Grill geben.
» Die Spieße auf allen Seiten knusprig grillen (mehrfach wenden).

Zutaten
4 cl „Qualität Tirol“ Sirup (Holler und schwarze Johannisbeere) 4 cl weißer Wodka
150 ml Soda je ein Zweig Rosmarin für „WoSi“ rot je ein Zweig Zitronenmelisse für „WoSi“ weiß 3–4 Eiswürfel
» Die Eiswürfel in ein Glas geben.
» Den Sirup und den Wodka in das Glas geben und mit Soda aufspritzen.
» Je nach Geschmacksrichtung mit Rosmarin oder Zitronenmelisse garnieren und servieren.

3 „Qualität Tirol“ Goggei
1 Prise Salz
20 g Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
130 ml Milch
80 g „Qualität Tirol“ Wieshofer’s Weizenmehl (Type 700)
„Qualität Tirol“ Modlbutter Staubzucker
ca. 500 g Früchte (Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren etc.)
1 EL Zucker
1 EL „Qualität Tirol“ Modlbutter
4 cl Rum (zum Flambieren)
Vanilleeis Zitronenmelisse
» Eine hitzebeständige Muffinform „ausbuttern“ und den Grill auf ca. 180 bis 200 Grad vorheizen.
» Die Eier trennen und das Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen.
» Die Dotter mit dem Zucker schaumig mixen.
» Den Vanillezucker und die Milch dazumixen und anschließend das Mehl einarbeiten.
» Den Schnee zügig unterheben.
» Die Masse in die Form füllen, in den Griller geben (geschlossener Deckel) und für 13 bis 15 Minuten grillen.
» In der Zwischenzeit Butter in der Pfanne goldbraun schmelzen und den Zucker dazugeben. Unter ständigem Rühren die Beeren dazugeben und köcheln lassen. Kurz vor dem Servieren den Rum hinzufügen und flambieren.
» Den Kaiserschmarrn-Muffin mit Zucker bestreuen, mit den Früchten und einer Kugel Vanilleeis sowie einem Zweig Zitronenmelisse garnieren und sofort servieren.


„Meine Bedenken, dass die Gäste wellwasser® nicht akzeptieren, waren vollkommen unbegründet. Ganz im Gegenteil. Die beste Investition seit Jahren.“
Thomas
Hackl Hotel Goldener Adler, Innsbruck„Mit dem Um- und Neubau hat sich das wellwasser® Konzept angeboten. Im Nachhinein betrachtet - ich hätte mich schon früher dafür entscheiden sollen.“
Roland
Haslwanter Hotel Habicher Hof , Ötz„wellwasser® ist so einfach und immer frisch vom Hahn, pur und zum Mixen, ALLE sind glücklich und zufrieden mit dem guten wellwasser®“
Devta Ghamal Bonsai Sushi Bar & Cafe Bar Restaurant Hungerburg
Fris„Mit wellwasser® still und perlend bieten wir unseren Gästen ein top regionales Produkt von höchster Qualität an - während wir gleichzeitig auf unsere Umwelt achten und unseren CO2 Abdruck verringern.“
Familie Raitmayr Gasthof Isserwirt, Lans bei Innsbruck
„Ich muss dankbar für das wellwasser® Konzept sein. Kann nicht mehr dazu sagen. Ich spare Platz, Arbeit, Zeit & Geld in meinen Lokalen und habe mit wellwasser® das beste Getränk!“
Dil Ghamal Sensei Sushi Bar, Innsbruck Momoness – Taste of Nepal, Innsbruck
wellwasser®
Partnerbetriebe:
aus Leitungswasser wird wellwasser® still oder perlend
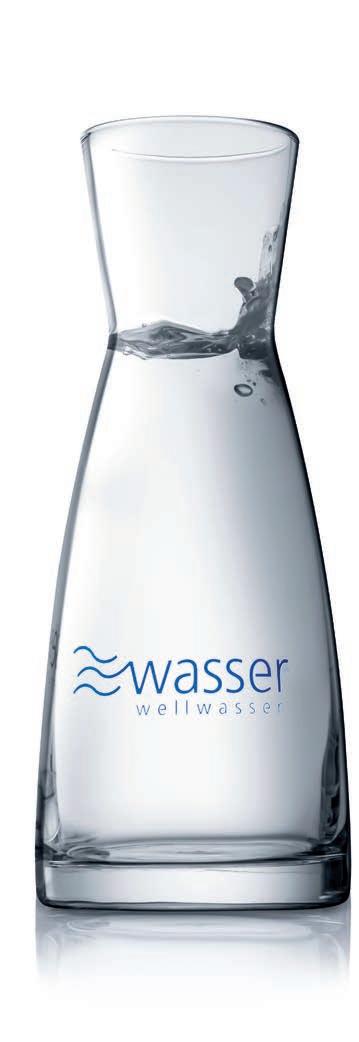
wellwasser® – umweltfreundlich, keine Transportwege, kein Plastik, Wegfall von Kühlung, Lagerung und Entsorgung, keimfrei gefiltert, natürlicher Mineralstoffgehalt
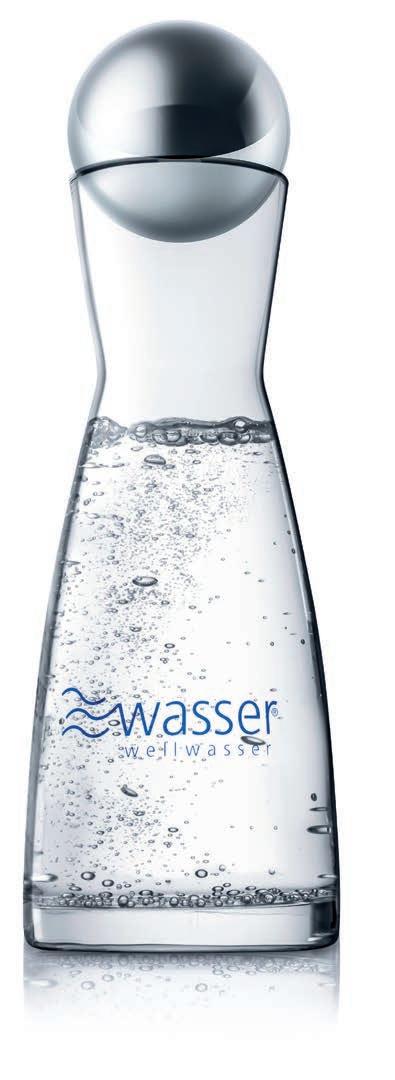

Kann man ein 5-Sterne-Hotel der Oberklasse mit mehr als hundert Betten ganz und gar ökologisch bauen und betreiben? Das Naturhotel Waldklause im Ötztal hat sich einem konsequenten Konzept verpflichtet. Wie aus einer Vision eine Erfolgsgeschichte wurde.

Rein ins Tal, rauf nach Längenfeld, dann rechts abbiegen Richtung Ötztaler Ache. Dort steht es, und es ist nicht zu übersehen. Aber fast. Ein prägnantes Gebäude, mehrgeschossige holzverkleidete Rundbauten umgeben von heimischen Nadelbäumen. Gelungene Architektur, ungewohnt, aber stimmig, neigt man als Besucher zu murmeln. Aber das Staunen fängt erst an, wenn man nah kommt, ganz nah. Wenn man auch hinter die Fassaden des großen Holzbaus blickt.
Errichtet wurde das Hotel in Massivholzbauweise ohne Leim und Schrauben, die Dämmung besteht aus Tiroler Schafwolle, verwendet wurden für Fassaden und Statik nur Hölzer aus dem Tal, dazu ein regionales Lieferantennetzwerk: Das Naturhotel Waldklause ist öko. Aber kein Jutebeutel-Öko, eher ein supermodernes Design-Öko. 5 Sterne und Nachhaltigkeit – geht das wirklich?
2001 begannen die Planungen, drei Jahre später öffnete die Waldklause dann ihre Pforten. Halb im Wald, am Ortsrand von Längenfeld im Ötztal ge-
legen. Damals war das Hotel der größte Holzbau Österreichs. Nur die beiden Treppenhäuser mit den Notausgängen und Fahrstuhlschächten, die mussten aus Beton sein. „Das war Vorschrift und dürfte selbst heute nicht anders gebaut werden“, erzählt Johannes Auer. Er ist einer der beiden Söhne der Erbauer und Köpfe hinter der Waldklause. Irene und Edmund Auer planten das Hotel, bis heute ist es ein Familienbetrieb.
Johannes Auer spricht gerne über die ökologische Ausrichtung des Hau-
ses, zeigt die Holzdübel in den Massivholzwänden aus Zirbe oder Fichte, die hier die Funktion von Schrauben, Nägeln und Leim übernehmen. Aber damals, vor knapp 20 Jahren, „wurden wir eher belächelt. Viele haben uns erklärt, wie man das anders und viel wirtschaftlicher bauen soll“, erinnert er sich. Doch da traf der Idealismus der Auers auf eine Eigenschaft der Tiroler im Allgemeinen und der Ötztaler im Speziellen. „Man sagt uns nach, dass wir sehr stur sein können“, erklärt Johannes Auer und lächelt verschmitzt. Heute sieht er es mit einem gewissen Pragmatismus: „Wir haben zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt.“ Als 5-Sterne-Hotel mit einer durchschnittlichen Auslastung von 94 Prozent und damit der höchsten im Ötztal weiß er, wovon er spricht. Im Großen lässt sich der eigene Anspruch – mit den nötigen Mitteln – durchaus umsetzen und belegen: Zertifikate über den 100-prozentigen Bezug von Ökostrom, Empfehlungen und Auszeichnungen des Klimabündnisses Tirol, ecotirol und des Naturparks Ötztal, eine Platin-Auszeichnung als Öko-Spitzenreiter von tripadvisor, das Europäische Umweltzeichen und jenes des Österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Johannes Auer schafft es, den Spagat zwischen Luxus und Nachhaltigkeit zu meistern.
toffeln vom Bett einer Suite. „Es gab keine Wäscherei, keinen Anbieter, der sie nach der Reinigung nicht in Plastik verpackt hat. Also haben wir selbst eine Lösung entwickelt.“
Sie haben eine passende Einstecktüte aus Papier – natürlich 100 Prozent Recycling – entworfen und von einer lokalen Druckerei gestalten lassen. Jetzt stecken alle Waldklause-Pantoffeln in Papiertüten und werden in der hauseigenen Wäscherei gereinigt. Auf einem kleinen Schild im dritten Stock können die Gäste lesen, dass hierfür ausschließlich Öko-Reinigungsmittel verwendet werden. Wieder eine dieser kleinen Stellschrauben.

Umwelt und Wasserwirtschaft. Dafür muss viel erfüllt sein: Von den Lieferantenketten über die verwendeten Lebensmittel und die Erstellung von Printpublikationen bis hin zum hoteleigenen Abfallwirtschaftskonzept, alles wird unter die Lupe genommen. Den wirklichen Herausforderungen jedoch begegnen Johannes Auer, seine Familie und die 70 Angestellten des Hotels im Kleinen. Im Alltag. 59 Zimmer und fünf Sterne unter ein ökologisches Dach zu bekommen, sei ein immerwährender Spagat.
Erdbeeren und Pool-Temperatur.
Der ökologische Anspruch in Kombination mit einem gehobenen Preissegment ist Fluch und Segen zugleich. Das beginnt schon beim Buffet. „Es gab einen großen Aufschrei, als wir uns dazu entschlossen haben, im Winter keine Erdbeeren anzubieten“, erinnert sich Johannes Auer. Dennoch: Die Ötztaler
Sturheit und das Wissen um den ökologischen Fußabdruck eingeflogener Erdbeeren haben gesiegt. Wenn er durch das Hotel läuft – durch die hölzernen Flure, die nach Zirbenholz duftenden Behandlungsräume im Spa-Bereich, am Pool entlang – hat er ein Auge fürs Detail, aber eben auch für weitere Potentiale. Die Temperatur des Pools oder des Außenbeckens um ein bis zwei Grad reduzieren, zum Beispiel. Hat er schon probiert – die Rückmeldungen kamen prompt und waren deutlich: Keine Änderungen bei der Temperatur! Hier hat er sofort eingelenkt.
Doch genau darauf kommt es bei diesem täglichen Spagat an: auf Kommunikation, auf das Miteinander und das Eruieren von Möglichkeiten und Stellschrauben. Im besten Fall sogar gemeinsam mit den Gästen. „Hierfür haben wir sehr lange nach einer guten Lösung gesucht und keine gefunden“, sagt er und nimmt zwei verpackte Pan-
Doch was bedeutet das eigentlich: „ökologisch sein“? Was, wenn man sich entscheiden muss: bio oder regional? „Im Zweifel setze ich Regionalität über ein Bio-Siegel“, sagt er – bei Bio-Schnittlauch aus Venezuela könne er nur den Kopf schütteln. Irene Auer sicherlich ebenfalls. Sie ist für die Pflege des Kräutergartens auf der Terrasse im ersten Stock verantwortlich. Auch in der Küche versucht man so gut es geht auf Produkte regionaler Bauern zu setzen.
Bei den Getränken geht es weiter: Auf der Suche nach einer guten Alternative zu Plastik-Trinkhalmen – Papier ist zu schnell aufgeweicht, Glas war nicht praktikabel – kam der entscheidende Hinweis von einem Gast: Ein Unternehmen in Südtirol fertigt Trinkhalme aus einem komplett kompostierbaren Kunststoff. Diese werden heute im Hotel verwendet. Einziger Nachteil: Sie sind ihren unökologischen Vorgängern
so ähnlich, dass die Gäste den Unterschied nicht erkennen.
Es gibt noch weitere Bereiche, erzählt Auer, in denen Kompromisse kaum auffallen. Thema Wasser. Daran hat ein Hotel – ganz besonders eines mit Spa-Bereich – nun mal einen großen Bedarf. Ein Energieberater hat sich diesen angeschaut und Optimierungspotenzial gefunden: Spar-Perlatoren in Wasserhähnen, Toiletten, Duschköpfen – bei Letzteren wurde der durchschnittliche Verbrauch beispielsweise pro Dusche von 15 auf weniger als 7 Liter pro Minute gesenkt. Gemerkt hat den Unterschied niemand.


Vom Badezimmer in die Garage: Das hoteleigene Fahrzeug ist natürlich ein E-Auto, ein Renault Zoe. Geladen wird es an einer der drei Strom-Ladesäulen. Wie im Rest des Hotels fließt hier Ökostrom. Die Energie für Heizung, Warmwasser und Ähnliches wiederum kommt via Fernwärme komplett aus dem Längenfelder Biomassekraftwerk, keine zwei Kilometer Luftlinie entfernt. Ein Glücksfall, denn mit Solaranlagen auf dem Dach ließe sich der Wärmebedarf in dieser Größenordnung niemals abbilden. Ursprünglich wurde das Kraftwerk für die Therme „Aqua Dome“ gebaut, heute versorgt es den kompletten Ort mit Fernwärme. Beheizt wird es durch Holz-Hackschnitzel aus der Region – vergleicht man seine Leistung mit einer entsprechenden Energiegewinnung durch das im Alpenraum immer noch durchaus gängige Heizöl, spart das Kraftwerk jährlich knapp 13.800 Tonnen CO2 ein.
Nicht nur draußen, auch drinnen ist es grün.
Die Vermessung des Waldes.
Während die Herkunft von Wärme und Strom unsichtbar ist, ist etwas anderes omnipräsent beim Gang durch das Hotel und dessen Außenbereich: Holz. Überall. Bei den Wänden im Innen- (Fichte oder Zirbe) und Außenbereich (Lärche), beim Blick durch die bodenhohen Fenster auf den umliegenden Wald und beim Wandeln über den Baumsteg, der in mehreren Metern Höhe um das Hotel herum durch die vielen Lärchen und Fichten hindurchführt, die bis auf wenige Zentimeter an das Gebäude heranragen. „Was wäre die Waldklause ohne Wald?“, sagt Johannes Auer und bleibt vor einem alten, etwa fünf Meter hohen, abgestorbenen Baumstamm stehen. Prüfend schaut er hinauf: „Da hat sich jetzt tatsächlich ein Specht eingenistet. Gut, dass wir den stehen gelassen haben.“ Der Tipp dazu kam vom örtlichen Förster – mit dem arbeiten die Auers eng zusammen. Genau wie vor circa zehn Jahren, als das Hotel erweitert wurde, als die hölzernen Rundbauten hinzukamen. „Wir haben damals jeden

Baum im Wald vermessen lassen, um genau zu wissen, welche Bäume sich für die Konstruktion eignen, wo ihr Holz eingesetzt werden kann, um letztendlich so wenig Bäume wie möglich fällen zu müssen.“ Sämtliches Holz kam aus dem Wald rund um Längenfeld. Anschließend wurde alles wieder vom Förster aufgeforstet – mit regionalen Arten wie Kiefer, Fichte, Lärche.
Fragt man den Architekten Markus Kastl nach der Massivholzbauweise, betont dieser zwar die Verbindung eines nachhaltigen Hotelkonzepts, das sich gleichzeitig der Region verpflichtet und technisch am Stand der Zeit agiert. Doch auch hier gab es Hürden. „Der Holzbau hatte seine Tücken bezüglich der schalltechnischen Anforde-
rungen“, erklärt Kastl. An diese Tücken erinnert sich Johannes Auer gut. Heute kann er darüber lachen und erzählen. Zu Beginn des Projektes, sagt er, wäre der Bau der Waldklause fast gescheitert. Zu viel Schall wurde übertragen, zu hellhörig waren die ersten beiden Prototypen für die Zimmer. Gemeinsam mit einem Baubiologen der Universität Innsbruck wurde geforscht und eine Lösung gefunden. Natürlich, wieder aus Holz: Korkplatten. Jedes Zimmer ist eine Art eigene Einheit und durch eine Korkschicht komplett entkoppelt. Kein Durchkommen für Schall. Dementsprechend ruhig ist es beim Laufen durch Gänge oder Zimmer. Besonders dann, wenn man über die Filzläufer schreitet, die man überall im Hotel findet. Wo der Filz herkommt? „Das ist alles aus Schafwolle und kommt aus dem Ötztaler Schafwollzentrum“, erklärt Auer. Dazu war man sozusagen historisch verpflichtet – sein Großvater war ein ortsansässiger Schäfer.
Auch in Zukunft wird Johannes Auer mit einem aufmerksamen und prüfenden Blick durch die Räume laufen. Der tägliche Spagat, die Suche nach Verbesserungspotentialen, das Drehen an kleinen und großen Stellschrauben, das Finden von Kompromissen – all das wird weitergehen. Macht aber nichts. Schließlich sind die Ötztaler ja für ihre Sturheit bekannt. Und die kann sehr positiv sein. Alexander_Zimmermann
In der Küche werden fast ausschließlich regionale Zutaten verwendet.



Dass Komfort und Nachhaltigkeit einander auch im Urlaub nicht ausschließen müssen, zeigen zahlreiche Tiroler Biohotels. Diese setzen insbesondere, aber nicht nur in Sachen Wellness und Verköstigung voll auf Natur.

Schwaz. Auf hochwertige regionale Bioküche setzt das am Pillberg gelegene Grafenast. Als Träger einer „Grünen Haube“ bietet der über 100 Jahre alte Familienbetrieb auf seiner Speisekarte auch für Vegetarier und Veganer mehr als genug Auswahl. Die individuell gestalteten Gästezimmer sind ebenfalls ökologisch und bio, als besonderes Highlight wartet der Spa-Bereich mit einem Hamam sowie einer speziellen Waldsauna auf, die traditionellen Jurten nachempfunden wurde.


Obsteig. Im Bio-Wellnesshotel Holzleiten dominiert Lärchenholz – und das ist kein Zufall, schließlich liegt es mitten im größten Lärchenschutzgebiet des Kontinents. Doch auch abgesehen vom rötlich-braunen Holz, das einem vor allem in Lounge, Lobby und den Gästezimmern begegnet, ist das Haus am Mieminger Plateau zu 100 Prozent bio. Dies schlägt sich nicht nur in der Küche nieder, wo der Fokus auf regionale Lebensmittel gelegt wird, sondern ebenso im Natur-Spa des Hotels, das unter anderem eine Zirben-Infrarotsauna umfasst.
Leutasch. Der Leutascher Hof ist nicht nur klimaneutral, sondern auch 100-prozentig bio. Dementsprechend werden in der mit einer „Grünen Haube“ ausgezeichneten Küche des 1.130 Meter hoch gelegenen Hotels nur Lebensmittel verarbeitet, die aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Neben hochwertiger Kulinarik steht Gästen ebenso ein Wellnessbereich mit Salzsteinsauna, Kraxenöfen und Brechlbad zur Verfügung, wo unter anderem Himalayasalz, Bioheu sowie reine ätherische Öle zum Einsatz kommen.
Going am Wilden Kaiser. Dass Regionalität und Nachhaltigkeit beim Stanglwirt großgeschrieben werden, zeigt sich bereits an den Materialien, die im Fünfsternehaus Verwendung finden: So bestehen etwa Mobiliar sowie Textilien im Hotel aus natürlichen Werkstoffen wie Vollholz, Rosshaar oder Schafwolle, die Zimmer sind zudem rundum mit Zirbenholz ausgestattet. Die Wärme wird aus einem eigenen Biomasse-Heizkraftwerk und der Ökostrom zur Gänze aus Tiroler Kleinwasserkraft bezogen, und auch in Bezug auf Wellness und Küche spielt Bioqualität eine wichtige Rolle.
Weitere nachhaltige Hotels und viele weitere Unterkünfte finden Sie unter: www.tirol.at/nachhaltige-unterkuenfte


Bücher von und über Tirol. Unterhaltsames, Informatives, zum Schauen, Lesen und Schmökern.
Die Eroberung der Höttinger Au, Wilhelm Giuliani, Wagner’sche, 200 Seiten, EUR 11,99
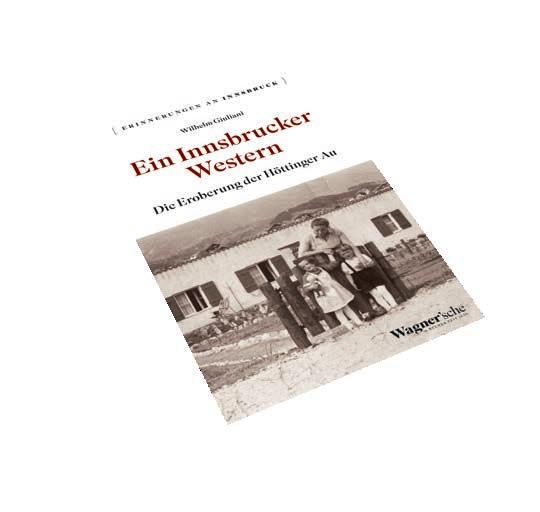

Die Reihe „Erinnerungen an Innsbruck“ bietet sehr persönliche Zugänge der AutorInnen zu den Innsbrucker Stadtteilen. So ist es auch bei Wilhelm „Willi“ Giuliani, dessen Großeltern zu den Siedlerpionieren in der Höttinger Au zählten. Akribisch hat der Autor die Geschichte des recht jungen Stadtteiles in Archiven und Zeitzeugengesprächen nachverfolgt und dabei so manche „heiße Story“ ausgegraben. Nach der Lektüre versteht man, warum in der Höttinger Au ein bisschen Wilder Westen war.

Anton Prock, Tyrolia-Verlag, 208 Seiten, EUR 24,00
Durch eine Stadt zu spazieren und gleichzeitig etwas über deren Geschichte, Kultur und Architektur zu erfahren, ist einfach ideal, um sich ihr zu nähern. Das gilt aber keinesfalls nur für Touristen, auch Einheimische erfahren in diesem Buch sicher noch Neues.
es kann sein, dass dann die schatten kommen
Hans Haid, Haymon Verlag, 216 Seiten, EUR 19,90
Die markante Stimme von Hans Haid, die im Ötztaler Dialekt spricht, ist nicht mehr. Doch dieses Buch, ein Romanfragment, ist sein letztes Vermächtnis. Darin sinniert der „Alte vom Berg“ über das Bergbauerndasein. Daher kommen natürlich Haids große Themen: Einfachheit, Naturzerstörung, Massentourismus, echte und unechte Volkskultur …
Florian Pedarnig. Dem Land Tirol die Treue.
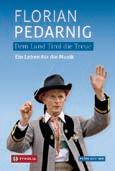
Ein Leben für die Musik Peter Kostner, Tyrolia-Verlag, 256 Seiten, EUR 24,00
Der Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ ist zum Symbol geworden für ein überpatriotisches Land, widerspenstig gegen alles, egal ob Wien, Corona, Fremde… Dass es aber höchst unfair wäre, dessen Komponisten Florian Pedarnig nur auf dieses eine Werk zu reduzieren, beweist das Buch von Peter Kostner auf eindrucksvolle Weise.
Besucht uns inWattens


dr.-Felix-bunzl-strasse 1 • a-6112 wattens • tel.+43 5224/57402 • mail. ruth@apfis.at • www.apfis.at geöffnet: MO-fr 09.00 bis 12.00 uhr und 15.00 bis 18.00 uhr • SA 09.00 bis 12.00 Uhr 1 Stunde kostenlos parken (Tiefgarage gegenüber)


Vera Wiedermann ist eine, die gerne mit den Händen arbeitet; in der Töpferei fand sie schließlich ihre Bestimmung. Es ist schön, wenn man das für sich sagen kann. In dem Fall ist es auch schön für uns, weil sie ihre Objekte nicht nur für sich, sondern für alle fertigt. Jedes Teil erzählt seine ganz eigene Geschichte, ist handgemacht in einem kleinen Töpferatelier in Innsbruck und somit immer ein Unikat. Für ihre Objekte verwendet Wiedermann Ton in fünf verschiedenen Farben, der doppelt gebrannt wird. Heraus kommen zauberhafte Schüsseln und wunderbare Tassen in verschiedenen Formen und Größen, die so praktisch wie schön sind und sich sohin als stilvolles Dekoelement ebenso eignen wie zum Gebrauch. www.verawiedermann.com

Vor rund vier Jahren haben Anna und Johanna in Innsbruck ihr Label „For people who care“ gegründet, unter dem sie auf ganzer Linie nachhaltige und zeitlos-stylische Taschen herstellen. Die Power-Paperbags bestehen aus waschbarem (!) Papier und halten ordentlich was aus, die lässigen Bauchtaschen aus Piñatex, also Ananasfasern. Genäht und gewerkelt wird in Innsbruck – in echt cooler Location in der Mentlgasse 12 in Wilten, wo man die Bags auch kaufen kann. Geöffnet ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, die restliche Zeit wird produziert und an neuen Ideen gearbeitet. Echt nachhaltigen T-Shirts zum Beispiel. www.forpeoplewho.care

Très bien. Rillettes klingen Französisch und sind es auch. Der Tiroler Topkoch Armin Leitgeb gibt ihnen jedoch einen heimischen Touch. Gibt’s in verschiedenen Sorten ab 10 Euro zum Beispiel im s’Regional in Innsbruck oder online unter arminleitgeb.com
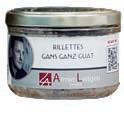
Steffen Albers
Das CL Curio von Swarovski Optik ist das leichteste und kompakteste Fernglas seiner Klasse, klein, handlich, faltbar und jederzeit bereit für seinen Einsatz. Intuitive Anwendung trifft auf perfekten Sehkomfort, der preisgekrönte Designer Marc Newson sorgt dazu für ein tolles Aussehen. Zeitlos, elegant und klar. Erhältlich ab 760 Euro in Schwarz oder Burnt Orange im ausgewählten Fachhandel oder unter swarovskioptik.com.

Gin-derassa. Im Lechtaler Handcraft-Gin „Biber & Engel“ finden sich unter anderem Bibernelle und Engelwurz, daher auch der Name. 36 Euro. biberundengel.at
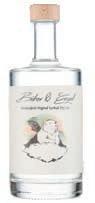
Bis 2. Oktober beschäftigt sich „….uund Schnitt! Film und Kino in Tirol“ genau damit. Die Ausstellung im Zeughaus lässt ihre Besucher auf mehr als hundert Jahre Filmgeschichte blicken und zeigt, wie sich die Tiroler Kinolandschaft unterdessen gewandelt hat. Angefangen bei den technischen Errungenschaften der Vorfilmzeit führt die Zeitreise entlang von bewegenden und bewegten Bildern sowie namhaften Persönlichkeiten des Tiroler Films bis ins 21. Jahrhundert. Tatsächlich wurden in Tirol bis dato über 500 Spielfilme gedreht! Zahlreiche Zeitzeugnisse aus der historischen Sammlung der Tiroler Landesmuseen lassen auch einen Hauch Nostalgie aufkommen.

„Es gibt Momente im Leben, in denen es gesagt werden muss: Jetzt erst recht!“Standbild aus dem Film „Winter in Tirol“ von Theo Hörmann, 1967 © FILMARCHIV WALTER HÖRMANN, MILS
Wie schaffen es Tiere und Pflanzen, hoch in den Alpen zu überleben? Wie trotzen sie den extremen Gegebenheiten, Wind und Wetter oder anderen Launen der Natur? Die zweite Ausstellung in der Weiherburg beim Innsbrucker Alpenzoo nimmt Besucher mit auf einen Streifzug jenseits der Baumgrenze auf über 2.000 Metern. Unter dem Titel „Alpine Grenzgänger. Über Leben im Extremen“ stellt sie die Überlebenskünstler der alpinen Tierund Pflanzenwelt vor. Und einen Pinguin. Das Schöne an der Ausstellung: Während man in anderen Museen fürs Angreifen gern mal geschimpft wird, ist es hier an ausgewählten Streichelpräparaten ausdrücklich erwünscht. Kommen Sie, streicheln Sie – das geht noch bis 28. Feber 2023.

Edel und gut. Schokolade geht immer, die „Tiroler Edle“ ganz besonders. Darin steckt die beste Milch vom Tiroler Grauvieh! Erhältlich in vielen Geschmacksrichtungen – unter anderem als köstliche TirolEdition. 22,50 Euro im Tiroler Edles in der Innsbrucker Altstadt. tiroleredles.at
Genau genommen handelt es sich in dem Fall nicht um Lamas, sondern um Alpakas, aber da drücken wir gern mal ein Auge zu. Ein paar Hundert Höhenmeter von der Gampe im Ötztal entfernt wohnt Caroline Steiner. Die junge Ingenieurin lebt ihren Traum von der eigenen Alpakazucht. Neben Wanderungen bietet sie dabei auch Yoga mit ihren Tieren an. www.soelden-alpakas.at

In schöner Regelmäßigkeit bringt die Wagner’sche Universitätsbuchhandlung im eigenen Verlag zauberhafte Kinderund Wimmelbücher sowie Spiele mit Tirol- und Innsbruck-Bezug heraus. „Mein Tiroler Naturschätze-Buch“ ist ein ganz besonderes Mal- und Geschichtenbuch für alle, die Tirol und die Natur lieben und beides noch besser kennenlernen wollen. Erhältlich um 9,95 Euro in der Wagner’schen in der Innsbrucker Museumstraße, die auch abseits davon einen Besuch lohnt.
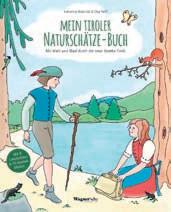
Erscheinungsweise: 2 x jährlich _Auflage pro Magazin: 25.000 Stück
Herausgeber & Medieninhaber: eco.nova Corporate Publishing Senn & Partner KG, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at _Chefredaktion: Uwe Schwinghammer _Redaktion: Alexandra Keller, Christiane Fasching, Marian Kröll, Marina Bernardi, Ivona Jelčić _Mitarbeit: Martin Weissenbrunner, Ümmü Yüksek _Layout: Tom Binder _Anzeigenverkauf: Ing. Christian Senn, Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin, Matteo Loreck, Mag. Daniel Christleth Fotoredaktion: Andreas Friedle, Marian Kröll, Isabelle Bacher, Tom Bause _Übersetzungen: Steve Rout, alpineconcepts Lektorat: Mag. Christoph Slezak _Druck: RWf Frömelt Hechenleitner GmbH _Unternehmensgegenstand: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art _Coverbild: Hans Salcher

Klima. Zukunft. Lebensraum. Clima. Futuro. Habitat.
Bis 15. Juni können innovative Umwelt- und Klimaschutz-Projekte in drei Kategorien – Großprojekte, Start-Ups und Grassroots-Projekte – beim ARGE ALPKlimaschutzpreis eingereicht werden. Machen auch Sie mit!


Die ARGE ALP ist ein Zusammenschluss von zehn Alpenländern und wurde vor 50 Jahren in Tirol gegründet. Zur ARGE ALP zählen neben Tirol auch Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gallen, Südtirol, Tessin, Trentino und Vorarlberg. Ziel ist, gemeinsame Probleme und An-
liegen des Alpenraums zu behandeln und in der Gemeinschaft mehr Gewicht zu haben als jede Region für sich alleine. Im heurigen Jahr setzt die ARGE ALP einen Klimaschutz-Schwerpunkt und lobt in dem Zusammenhang den ARGE-ALPKlimaschutzpreis aus.
Bezahlte Anzeige Bildnachweis: shutterstock.com