
ANNA • JOSEPH • ICON
EXPLORE THE NEW COLLECTIONS








EXPLORE THE NEW COLLECTIONS






Hier Gletscher, die Sommer für Sommer unaufhaltsam ihrem nahen Ende entgegenschmelzen. Dort die Inszenierung der Hannibal’schen Alpenüberquerung mit Pistenbullys, Hubschraubern und Hunderten Akteuren auf dem Rettenbachferner im Ötztal. Ja, so ambivalent kann Tirol sein. Und weil es die Realität im Land abbildet, sehen wir auch keinen Grund, nicht beides im selben Heft darzustellen. Bildgewaltig, ganz so, wie es unsere Art ist.
Damit sind wir schon mittendrin in dieser Ausgabe und die Ambivalenz geht weiter. Wir waren beim Krampuslauf in Oberlienz und haben davon neben dessen Geschichte auch viele Bilder mitgebracht. Selbst wenn im Krampusbrauch viele Widersprüchlichkeiten liegen, ist die Tradition ungebrochen – das gilt für jene, die sich für die Umzüge in das schwere Krampuszeug werfen ebenso wie für die Schnitzer der furchterregenden Holzlarven. Neben solch lebendem und lebendigem Brauchtum trägt auch das baukulturelle Erbe wesentlich zur Tiroler Eigenheit und zum Erscheinungsbild von Orten und Landschaft bei. Doch zuweilen geht es diesem Erbe so wie
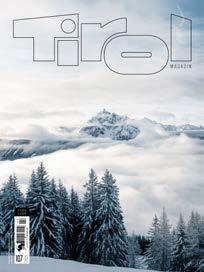
Majestätisch und geheimnisvoll erhebt sich die Serles aus dem Nebelmeer, über dem auch unser Fotograf in winterlicher Landschaft wandert.
Foto: Christian Mair Instagram: chris.ma__
den Gletschern: Es droht für immer zu verschwinden. Dass das nicht passiert, darauf schaut unter anderem Tirols oberste Denkmalschützerin, Landeskonservatorin Gabriele Neumann.
Ganz eindeutig indes zählt Juan Amador aus Wien zu den besten Köchen Österreichs. Seine rechte Hand – und gehandelter Nachfolger – ist David Fleckinger. Ein Tiroler. Unbestritten ist auch, dass die Milchbuben im Unterland ganz ausgezeichneten Käse machen.
Zu guter Letzt nehmen wir Sie in dieser Ausgabe mit in den äußersten Westen Tirols: nach Steeg nämlich. Dort wurde 1892 Anna Dengel geboren. Sie war Ärztin und Ordensschwester und weil sie das damalige Kirchenrecht daran hinderte, im Habit medizinisch tätig zu werden, gründete sie vor genau 100 Jahren die Missionsärztlichen Schwestern. Bis heute sind diese weltweit im Kampf gegen Armut, Unterernährung, mangelnde Bildung und unzureichende Wasserversorgung tätig.
Wir wünschen Ihnen eine vielfältige Lektüre und einen wunderbaren Winter!
In der vergangenen Ausgabe ist uns beim Fotonachweis zum Beitrag von Köchin Marina-Selina Sapper (Tirol Magazin #106, Seite 136–143) ein Fehler unterlaufen. Die Bilder sind nicht von Jürgen Schmücking – er hat den Text dazu geschrieben –, sondern von Kathrin Buschmann, die auch ganz wunderbare Hochzeitsfotos macht. Wir bitten um Entschuldigung. Kathrin Buschmann Fotografie, St. Michael im Lungau, www.kathrinbuschmann.com













„Ewiges Eis“ waren die Gletscher einst für mich. Als ferne, gefährlich schöne, mystische Eisriesen blieben sie eine Konstante meiner Kindheit und Jugend. Mit dem zunehmenden Klimawandel wurden wir jedoch alle mit der Verletzlichkeit und auch Vergänglichkeit unserer Gletscher konfrontiert.
Schon in meiner Zeit als Profisportler und später als Filmemacher bot mir die alpine Landschaft die Grundlage für meine Tätigkeiten. Ob im Tourismus oder im Sport blieb meine filmische Basis weiterhin auf die uns umgebenden Bergwelten gerichtet. Dabei rückten die ökonomischen Anforderungen und deren ökologische Folgen immer weiter in meinen Fokus.
In kritischer Auseinandersetzung widmete ich mich beispielsweise den Zusammenhängen der Nutzung von Wasserkraft und dem damit einhergehenden Verlust an Biodiversität und Freiflächen in Tirol. Durch mein letztes Projekt, das sich mit der Gletscherschmelze auseinandersetzt, durfte ich einen Einblick in die damit verbundene Komplexität der widerstrebenden Sachverhalte gewinnen. Vielen sind die Gefahren und Risiken nicht bekannt, die mit dem Abschmelzen der Gletscherflächen einhergehen. Unsere Gletscher sind nicht nur ökonomische Grundlage von Tourismusgebieten und Alpinisten, sondern stellen auch große Wasserspeicher dar. Verschwinden diese, verändert sich auch das Abflussverhalten des
Niederschlags und damit eine wesentliche Grundlage für die Ökologie unserer Flusslandschaften. Damit gehen Herausforderungen für die Landwirtschaft und auch multiple Probleme für den Tourismus einher. Gerade Gegenden, die stark auf die touristische Nutzung ihrer Naturflächen ausgerichtet sind, werden erkennen, dass sich diese natürlichen Voraussetzungen stark verändern. Ein „Weiter wie bisher“ wird unter den täglich erlebten Veränderungen durch den Klimawandel wohl nur noch ein Wunschdenken sein.
Ziehen die Gletscher sich zurück, und zurückziehen werden sich die Tiroler Gletscher in den nächsten Jahrzehnten nahezu vollständig, bildet sich eine wertvolle Pioniervegetation mit Pflanzen, die für ihr Überleben auf genau diese Flächen angewiesen sind. Neue natürliche Attraktionen könnten dabei entstehen. Mit Baggern, Steinbrechern und Planierraupen zerstören wir allerdings diese Flächen. Die Umgestaltung der Landschaft für Skipisten vernichtet Naturflächen und diese planierten Autobahnen werden auch in zehntausend Jahren noch im Hochgebirge sichtbar sein. Hochsensible Lebensräume und Heimstätten der Artenvielfalt werden dabei für immer zerstört.
Die Entwicklung des Tiroler Tourismus in den großen Skigebieten ist für die einen ein beispiellos rühmliches Erfolgsprojekt, für die anderen aber auch bedenklich. Und beide haben Recht.
In den stark expandierenden Tourismusgebieten fühlt sich dieses andauernde Wachstum vielleicht nachvollziehbar und notwendig an, die Nachfrage muss bedient und das Potenzial ausgeschöpft werden. Der Blick auf die zu erzielenden Umsätze und auf die wachsende Wirtschaftsleistung kann den Blick auf die damit verbundenen Verluste an überlebenswichtigen und schützenden Naturgebieten zumal versperren. Noch dazu sollte bedacht werden, dass dies die wirtschaftliche Abhängigkeit ganzer Regionen vom Tourismus immer weiter verstärkt.
Um Pisten am Gletscher für den Skibetrieb zu bewahren, werden über die Sommermonate Abdeckvliese verwendet. Diese Vliese stoßen Mikroplastik aus, welches ins Schmelzwasser und über den Wind in alle Bereiche unserer Umwelt gelangt. Pistenpräparation braucht Diesel und schweres Gerät im Hochgebirge. Durch die Schneegewinnung und das dafür notwendige Anlegen von Speicherteichen verändert sich der Wasserhaushalt am Berg. Der Stromverbrauch der Kunstschnee- und Liftanlagen ist extrem hoch. In Tirol ist der Ausbau der alpinen Infrastruktur zu der astronomischen Möglichkeit gewachsen, stündlich 1,4 Millionen Menschen auf den Berg zu bringen. Den größten Anteil der Emissionen eines Urlaubs stellt aber der Individualverkehr bei An- bzw. Abreise der Gäste dar.
In meinen Filmen versuche ich, neue Denkwege und Perspektiven anzubieten. Ist ein Wirtschaften auf Kosten der Natur, der Lebensqualität und auf
Kosten der Jugend noch zeitgemäß? Abwanderung ist in den stark expandierenden Tourismusgebieten ein Faktum. Ein deutliches Zeichen. Es stellt sich die Frage, wie viel Raubbau an Mensch und Natur noch begangen werden kann, bis selbst die Gäste das Interesse an diesen künstlichen Erlebniswelten in den Bergen verlieren. Aber in Tirol könnten mit wegweisenden Innovationen auch Projekte entwickelt werden, die in eine sich verändernde Zukunft weisen und damit Pioniergeist zeigen.
Mit meiner Kamera und meinen Recherchen kann ich einen Blickwinkel anbieten, der vielleicht nicht leicht einzunehmen ist und manchmal verborgen bleibt. Dabei wurde für mich deutlich, dass es langfristiger Entwicklungsziele bedarf.
Die Öffentlichkeit sollte informiert, sensibilisiert und in Entscheidungsprozesse über ihren Lebensraum eingebunden werden. Unsere Kinder, denen wir diese so wunderbare Tiroler Naturlandschaft hinterlassen, sollten in all unseren Überlegungen berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit ist kein Marketingslogan, sondern bedeutet, dass wir wirtschaftlich und ökologisch für unsere Nächsten und Nachkommenden lebenswerte und innovative Zukunftsmodelle anstreben und dabei auch die unverwechselbare Natur, in der wir leben, bewahren und wiederherstellen. Den Ort, nach dem sich auch die meisten Urlauber und Gäste sehnen, wenn sie nach Tirol kommen.
Ihr Harry Putz
Harry Putz ist Filmemacher, Tourismuskind, ehemaliger Snowboardprofi und Kulturschaffender. Der Gründer und Kurator des Freeride Filmfestival widmet seine Filmarbeit Natur- und umweltaktivistischen Themen in Tirol. Mit seiner aktuellen
Doku „Requiem in Weiß – über das würdelose Sterben unserer Gletscher“ reflektiert Putz das Gletschersterben anhand vielfältiger Sichtweisen aus Tirol. Einige Bilder daraus haben wir im Anschluss für Sie. freiluftdoku.com


Mit „Requiem in Weiß“ inszeniert Filmemacher Harry Putz eine eindringliche filmische Hommage an das Sterben der Gletscher in den Alpen. Durch tiefgehende Interviews verwebt er Wissenschaft und Emotion zu einer bewegenden Dokumentation. Gedreht an 14 Gletschern in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz stellt der 60-minütige Film am Ende die unumgängliche Frage: Wie wollen wir unsere Gletscher verabschieden? www.requieminweiss.com
















































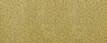

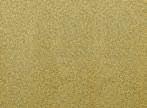
34_Open-Air Laboratory
At Lake Gossenköllesee in Kühtai, researchers are studying the development of the highalpine ecosystem. In the icy mud, they are discovering both new viruses with protective properties and traces of microplastics carried from distant regions.
63_Terrifying Delight
In Oberlienz, a small village in East Tyrol, a very special time begins with the first frost: the Krampus season.
70_The State Conservator
Gabriele Neumann bears ultimate responsibility for around 5,000 listed buildings across Tyrol.
98_Social Pioneer
Anna Dengel made the impossible possible.
106_A Tyrolean in Vienna
Tyrolean Schlutzkrapfen in a Michelin-starred restaurant? Yes, says David Fleckinger.
115_Tyrol in Superposition
Tyrol has become a centre for quantum research – thanks in part to Rainer Blatt.
122_Hard Days, Soft Cheese
With their cool, contemporary image, the Milk Boys are shaking up the local cheese scene.
132_A Heart for Steel
In a small garage in Imst, Wolfgang Leiter has realised a dream: he forges knives of extraordinary quality and elegance.

28_Freiluftlabor
Am Gossenköllesee im Kühtai wird zur Entwicklung des hochalpinen Ökosystems geforscht. Im eisigen Matsch finden sich neue Viren mit Schutzfunktion genauso wie Mikroplastik aus entfernten Regionen.

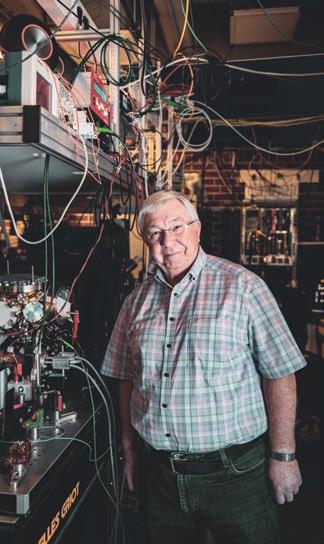

52_Furchtbare Freude
Im Osttiroler Dorf Oberlienz liegt in der Zeit um den Krampustag etwas Besonderes in der Luft.
58_Wie früher, nur besser
Bert Steiner schnitzt Krampuslarven im traditionellen Oberlienzer Stil –auf seine ganz eigene Weise.
64_Die Landeskonservatorin
Gabriele Neumann ist letztverantwortlich für rund 5.000 denkmalgeschützte Gebäude in Tirol.
74_Alpen. Gletscher. Hannibal. Als Hannibal am Rettenbachferner den Weg ins Ötztal fand.
92_Sozialpionierin
Anna Dengel hat Unmögliches möglich gemacht.
100_Ein Tiroler in Wien Schlutzer im Sternerestaurant? Ja, findet David Fleckinger.
108_Tirol in Superposition
Der Quantenstandort Tirol hat sich entwickelt – auch dank Rainer Blatt.
116_Harte Tage, weicher Käse
Mit einem coolen und modernen Auftritt rocken die Milchbuben im Moment die heimische Käseszene.
126_Ein Herz für Stahl
In einer kleinen Garage in Imst hat sich Wolfgang Leiter einen Traum erfüllt. Er schmiedet Messer von unfassbarer Qualität und Eleganz.
4_Editorial | 6_Kommentar | 14_Tirol in Bildern
36_Nationalpark Hohe Tauern | 42_Am Wilden Kaiser 46_Bucketlist | 144_Kurz und bündig | 146_ Impressum
Raus aus dem Alltag – hinein ins Abenteuer. Tirol entfaltet seine ganze Pracht in atemberaubenden Landschaften, idyllischen Plätzen und versteckten Naturjuwelen. Hoch oben am Berg, entspannt am See oder mittendrin: Wir nehmen Sie mit zu den schönsten Plätzen zum Träumen und Entdecken.

Still und klar liegt er zwischen angezuckerten Bergen und unter einer Decke aus kalter Luft, das Wasser spiegelglatt. Im Winter entfaltet der Achensee seinen ganz besonderen Zauber, ruhiger als im Sommer, friedlicher vielleicht. Wegen seiner Tiefe von bis zu 133 Metern friert der See nicht zu, die Achenseeschifffahrt legt auch in der kalten Jahreszeit ab.


Die einzigartig-urige Kamelisenalm in Osttirol ist beliebter Rastplatz, begehrtes Fotomotiv und der Inbegriff eines Wintermärchens. Die Winterwanderung zur Alm nimmt Sie mit auf eine Reise durch die unberührte Schönheit des Villgratentals und eröffnet fantastische Ausblicke.
Einer silbernen Kobra gleich erhebt sich die Bergiselschanze hoch über die Stadt. Entworfen von Stararchitektin Zaha Hadid, wurde die Schanze nach dem Abriss der alten im Jahr 2002 neu aufgebaut. Am Bild gleitet der Blick auf die gegenüberliegende Talseite, hinauf auf die Seegrube im Norden der Stadt.




Ein atemberaubender Wintermorgen am Wilden Kaiser: Die ersten Sonnenstrahlen tauchen die schneebedeckten Gipfel in goldenes Licht, während Nebelschwaden sanft durch das Tal ziehen. Die klare Bergluft und die Farben des Sonnenaufgangs schaffen eine magische, winterlich-märchenhafte Atmosphäre, die einem Augen und Herz aufgehen lässt.
Der Galzig gilt im Winter als der Knotenpunkt des Skigebiets St. Anton am Arlberg, eine der schneesichersten Regionen der Alpen. Hier vereinen sich alpine Abenteuer und unvergleichliche Bergerlebnisse zu Momenten für die Ewigkeit. Und wenn sich der Nebel lichtet, ist die Aussicht so prickelnd wie faszinierend.




Der sanfte Winter ist ein Gegenentwurf zur Hektik des Alltags. Er lehrt uns, dass Geschwindigkeit nicht immer gleichbedeutend mit Erfüllung ist. Dass das wahre Erlebnis oft im Einfachen liegt: in der frischen Luft oder im rhythmischen Klang der eigenen Schritte. Skitouren sind dabei die wohl schönste Einladung, den Bergen zuzuhören – wie hier in Galtür zur Breitenspitze/Zeinisjoch.

Kaum eine Wintersportart verbindet Bewegung, Natur und Genuss so leichtfüßig miteinander wie der Langlauf. Der Sonne entgegengleiten und durchatmen: Langlaufen in der Region Seefeld ist eine echte Wohltat für Körper und Geist.
20.01. Bonnie Tyler, Finkenberg
24.02. DJ Ötzi Gipfeltour, Tux-Lanersbach
27.03. Die Crème de la Crème der Kölner Kultbands: Cat Ballou, Höhner, Rabaue Hintertuxer Gletscher
09.04. BBQ-Frühschoppen mit Grillweltmeister Adi Bittermann & DJ Realize Hintertuxer Gletscher

18.04. Oimara Talstation Hintertuxer Gletscher


Der Gossenköllesee im Kühtai ist ein einzigartiges Freiluftlabor auf über 2.400 Metern Höhe. Forscherinnen und Forscher wie Birgit Sattler, Ruben Sommaruga und Alessandra Cera untersuchen die Entwicklung eines hochalpinen Ökosystems – und finden dabei Nährstoffe im eisigen Matsch, neue Viren mit Schutzfunktion und Mikroplastik aus entfernten Regionen.
„VIELE KOLLEGEN SCHERZEN, DASS DER GOSSENKÖLLESEE
Ruben Sommaruga
Die Gosse, ja, das ist meine zweite Heimat“, lacht Birgit Sattler, die weder zählen noch sich daran erinnern kann, wie oft sie schon hier heroben war. Hier, das ist auf 2.416 Metern Höhe, über dem Kühtaisattel in den Stubaier Alpen. Hier, das ist am Gossenköllesee, von den Limnologen liebevoll Gosse genannt. Zu Beginn der 1990er-Jahre war sie zum ersten Mal hier, damals noch Studentin der Biologie. Heute ist Birgit Sattler eine fixe Größe am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und international ausgewiesene Expertin für die Ökologie von Eis und Gletschern. „Und Hüttenwirtin“, ergänzt sie lachend. Denn beim Gossenköllesee steht eine kleine Hütte. Laborplätze, Schlafmöglichkeiten, Küche und Sanitäranlagen machen sie zur hochalpinen Forschungsstation.
Das vielfältige Leben im Eis.
Die Forschung an Hochgebirgsseen als einzigartige Ökosysteme geht an der Universität Innsbruck auf Roland Pechlaner zurück. In den 1950er-Jahren startete er seine wissenschaftliche Arbeit auf der anderen Talseite des Kühtais an den Finstertaler Seen. Mit dem Bau des Staudamms für das Wasserkraftwerk Sellrain-Silz wurde das Finstertal samt seinen Seen geflutet, Pechlaner fand mit dem Gossenköllesee eine Alternative. Ab 1975 wurden hier für unterschiedliche Projek-
Der Gossenköllesee ist als einziger Hochgebirgssee Österreichs in die zwei globalen Langzeitforschungsnetzwerke LTER (Long-Term Ecological Research, seit 2014) und GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network, seit 2015) eingebunden. Beide Netzwerke sammeln und interpretieren weltweit Daten, um die Entwicklung von Ökosystemen unter dem Aspekt des Klimawandels zu beobachten, zu vergleichen und besser zu verstehen. GLEON legt ein besonderes Augenmerk auf die Langzeitdaten von Seen. Ist der See zugefroren, werden die Eisbedeckungsdauer, die Eisdicke und die Zusammensetzung des Eises festgehalten. Das ganze Jahr über werden die Leitfähigkeit des Wassers, sein pHWert, der Sauerstoffgehalt, der Chlorophyll-Anteil im Wasser sowie die gesamte Wasserchemie gemessen, die gewonnenen Daten werden an der Universität analysiert.
te Daten erhoben, die ursprüngliche Forschungsstation wurde Anfang der 1990er-Jahre unter der Leitung von Pechlaners Nachfolger Roland Psenner saniert. Den Umbau mitbetreut hat damals schon „Hüttenwirtin“ Sattler. „Das Ziel war, die Station nicht nur für punktuelle Arbeiten zu nutzen, sondern sie auch fit für Langzeitbeobachtungen zu machen. Eine Voraussetzung dafür war etwa die Umstellung auf eine emissionsfreie Heizung“, erinnert sich Sattler.
Seit 2014 ist der Gossenköllesee als einziger Hochgebirgssee Österreichs Teil der weltweiten Langzeitforschungsnetzwerke LTER (LongTerm Ecological Research) und GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network), für die hier umfassend Daten erhoben werden. Aber auch alte, schriftliche Quellen sind von Interesse. Im Hüttenbuch ist 1988 etwa das überraschend hohe Maximum der Wassertemperatur von 16 °C vermerkt, im Jahr 2020 lag sie bei 20 °C. Andere Langzeitdaten bestätigen den Trend: Der See friert später zu, die Eisdecke verschwindet immer früher, die Dicke der Eisschicht nimmt im Durchschnitt ab. Für LTER und GLEON kommt Sattler das ganze Jahr über allein oder mit anderen Forschern einmal im Monat zum See, um die Standardbeprobung vorzunehmen. „Während der Skisaison können wir die KaiserBahn der Kühtaier Bergbahnen nutzen, von der Bergstation sind es dann noch 15 Minuten“, ver-
weist sie auf das gute Einvernehmen mit den Liftbetreibern. Ansonsten geht es mit den Tourenski oder zu Fuß zum See. „Die gute Erreichbarkeit ist sicher ein Vorteil“, sagt die bergaffine Forscherin, die über den Gossenköllesee zu ihrem heutigen Spezialgebiet, dem Eis, besser gesagt, dem vielfältigen Leben im Eis, gefunden hat.
„Im Eis leben viele Mikroorganismen. Sie fühlen sich dort wohl, weil sie sicher vor Räubern sind und gut versorgt werden“, weiß Sattler. Schicht für Schicht ist die Eisdecke aufgebaut, die den Gossenköllesee in der Regel von Oktober bis Juni bedeckt. Im Herbst beginnt das Wasser zu gefrieren, dann fällt Schnee auf diese erste Eisschicht. In diesem Klareis bilden sich feine Risse, durch die Wasser dringt, das den Schnee flutet. Dieser Matsch gefriert zu Trübeis, auf das wieder Schnee fällt. „Auf diese Art entsteht eine Eisdecke wie eine dicke Mannerschnitte. Die Schokoschichten sind die nährstoffreichen Matschschichten, in denen die Mikroorganismen leben“, erzählt Sattler, die ihre „Mannerschnitte“ mit ausgebohrten Eiskernen analysiert. Wenn die Eisschicht im Sommer schmilzt, werden alle Nährstoffe und die darin lebenden Mikroorganismen in das Seewasser abgegeben. „Das ist wie ein ‚First Flush‘“, vergleicht Sattler dieses Ereignis mit der ersten nährstoff- und aromenreichen Teeernte im Frühjahr. Für die im Gossenköllesee lebenden Organismen ist dieser First Flush jedenfalls ein lebensnotwendiger Dünger und somit ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems.
Als Birgit Sattler in den 1990er-Jahren auf Kongressen über die Vielfältigkeit und Bedeutung von „Leben im Eis“ berichtete, „wurde ich fast ausgelacht“, erinnert sie sich. Doch schon bald stieß sie auf reges Interesse. Ob sie denn nicht ihr im alpinen Hochgebirgssee gewonnenes Know-how in eine Antarktis-Expedition einbringen

„IM EIS LEBEN VIELE MIKROORGANISMEN. SIE FÜHLEN SICH DORT WOHL, WEIL SIE SICHER VOR RÄUBERN SIND UND GUT VERSORGT WERDEN.“
Birgit Sattler
möchte, wurde sie 1996 bei einer Tagung in den USA gefragt. Sattler sagte zu, seither nahm sie an 19 Forschungsreisen in die Arktis und Antarktis teil, um die dortige mikrobielle Artenvielfalt zu untersuchen. Auch Gletschereis beherbergt solch ein Mikrobiom, das eine entscheidende Rolle für Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe in den Gletscherregionen spielt. Um dieses Mikrobiom zu schützen, arbeitet Sattler auch mit den heimischen Gletscherbahnen zusammen an einer nachhaltigen Lösung zur Gletscherabdeckung, die ökologisch gesehen immer ein Kompromiss ist. „In einer Studie konnten wir zeigen, dass herkömmliche Vliese, mit denen Gletscherflächen abgedeckt werden, Einfluss auf die mikrobielle Artenvielfalt nehmen. Zudem gelangt durch sie Mikroplastik in das Eis“, sagt Sattler. Auf den Bericht meldete sich ein Faserhersteller, aktuell wird in Kooperation mit Gletscherbahnen an biologisch abbaubaren Vliesen geforscht, die weniger Einfluss auf die Mikroorganismen und das sensible Ökosystem nehmen und gleichzeitig den Anforderungen der Bahnbetreiber entsprechen.
Aufsteigen, um zu lernen.
Von der KaiserBahn war noch nichts zu sehen, als Sattlers Institutskollege Ruben Sommaruga das erste Mal zum Gossenköllesee aufstieg. Für den Forscher aus Uruguay war das im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. „Uruguay ist so hügelig wie die Toskana, der höchste ‚Berg‘ ist knapp über 500 Meter hoch“, erzählt der Ökologe, der Anfang der 1990er-Jahre für das Doktorat und später im Rahmen eines EU-Projekts nach Innsbruck gekommen (und der Liebe wegen in Tirol geblieben) ist. Für Sommaruga war es daher eine richtige Challenge, es fehlte die alpine Erfahrung „und auch das Training“, meint er mit einem Schmunzeln. Der Gebirgs-
see nahm ihn aber sofort gefangen. Bis dahin hatte er sich mit nährstoffreichem, daher trübem Wasser beschäftigt, auf über 2.000 Meter Höhe konnte er metertief auf den Grund sehen. „Ich stellte mir gleich die Frage, wie sich die Lebewesen im Wasser, von Mikroorganismen bis hin zu kleinen Krebsen, vor UV-Strahlung schützen“, erinnert sich der Forscher.
Die Suche nach der Antwort machte aus dem Biologischen Ozeanografen einen international anerkannten Limnologen, einen Experten für Binnengewässer. Sommaruga konnte erstmals zeigen, dass Algen auch im Gossenköllesee und in anderen Hochgebirgsseen unsichtbare Sonnenschutzfaktoren –sogenannte Mycosporin-ähnliche Ami-


nosäuren (MAAs) – produzieren und diese dann über die Nahrungskette in andere Organismen, zum Beispiel den Ruderfußkrebs, gelangen, die damit vor der UV-Strahlung geschützt werden. Aufgrund dieses Potenzials wird weltweit an MAAs als Basis für einen natürlichen Sonnenschutz für Menschen geforscht. Sommaruga konnte aber auch zeigen, dass der Stickstoffgehalt des Wassers dabei eine wichtige Rolle spielt. Je weniger Stickstoff, desto weniger MAA produzieren die Algen, sie behelfen sich aber, indem sie einen anderen inneren Sonnenschutz oder besser gesagt Antioxidantien – Carotinoide –produzieren. Für den Algen fressenden Ruderfußkrebs bedeutet dies, dass er eine knallrote Farbe annimmt.
Algen, MAAs, Carotinoide und Ruderfußkrebs sind für Sommaruga nur ein Beispiel, „aus dem wir lernen können, wie sich Organismen an diese harschen Bedingungen angepasst haben“. Hochgebirgsseen als Ökosysteme sind keinem bzw. nur geringem direkten menschlichen Einfluss ausgesetzt, ihre Organismen sind hochspezialisiert. Ein spezielles Bakterium, das 2019 im Gossenköllesee erstmals nachgewiesen wurde, ist etwa ein „Hybridbakterium“. „Das Bakterium nutzt, je nach Lichtverhältnissen, unterschiedliche Methoden der Energiegewinnung. Bei niedrigen Temperaturen und wenig Licht greift es zur Photosynthese, bei hoher Lichtintensität und etwas höheren Temperaturen kommt ein anderer Mechanismus
Am Gossenköllesee wird geforscht –zum vielfältigen Leben im Eis und der Entwicklung von Ökosystemen. Es werden Langzeitdaten gesammelt zur Eisdicke oder dem Sauerstoffgehalt im Wasser und dabei neue Viren gefunden oder Nährstoffe im eisigen Matsch.
zum Tragen – eine Rhodopsin-basierte Protonenpumpe“, berichtet Sommaruga, für den sich nun die Frage stellt, ob auch andere Organismen in Hochgebirgsseen, etwa Algen, beide Mechanismen nutzen. „Das wäre eine unglaubliche Entdeckung nach mehr als 100 Jahren Forschung“, ist Sommaruga überzeugt, der diese Arbeit mit Kollegen aus Tschechien durchgeführt hat.
Kleiner See, grosse Forschung.
„Am Gossenköllesee forschen nicht nur wir, sondern viele Kollegen aus anderen Ländern“, betont Birgit Sattler die Einzigartigkeit des alpinen Freiluftlabors. Eine dieser Kolleginnen ist Alessandra Cera. Die italienische Limnologin arbeitet aktuell an der Universität Wien in dem EU-Projekt FLOAT, das die Emission, die atmosphärische Verbreitung und den Niederschlag von Mikroplastik simuliert. „Diese Simulation und die geschätzte Konzentration von Mikroplastik, das durch atmosphärische Prozesse wie Wind oder Regen in Binnengewässern abgelagert wird, überprüfen wir durch Messungen. Eines dieser Gewässer ist der Gossenköllesee“, erklärt Cera. Im Juli 2025 entnahm sie erstmals Wasserproben, zudem wurden rund um den See zehn Messgeräte aufgebaut. Zwei Monate später war sie wieder in Tirol, entnahm wieder Wasserproben und baute die Messgeräte ab. Die Daten werden in den kommenden Monaten analysiert und mit Daten anderer Standorte verglichen. „Es wird interessant sein, die Häufigkeit von Mikroplastik in städti-
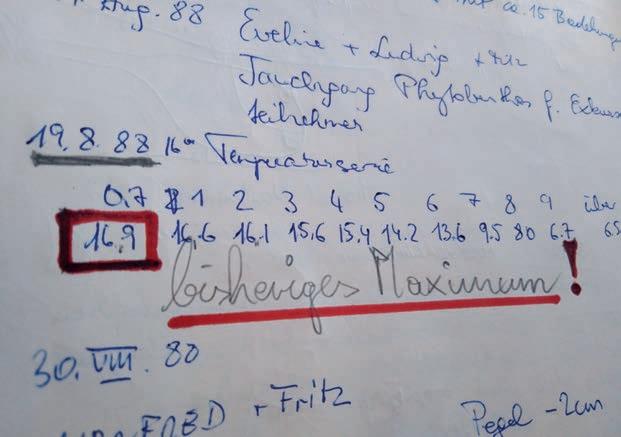
schen Ballungszentren und abgelegeneren Gebieten zu vergleichen. Es ist möglich, dass der Wind Mikroplastik weit von den Quellen wegträgt und so selbst scheinbar unberührte Umgebungen kontaminiert. Unsere Forschung trägt dazu bei, diese Informationen zu überprüfen“, beschreibt Cera einen Teil des FLOAT-Projekts, dem wohl noch die wissenschaftliche Veröffentlichung folgen wird.
„Viele Kollegen scherzen, dass der Gossenköllesee gemessen an seiner kleinen Fläche von gerade mal 1,6 Hektar die größte Dichte an wissenschaftlichen Publikationen hat“, meint Ruben Sommaruga über den „Output“ des Hochgebirgssees. Er selbst zeigt sich immer wieder überrascht, was der See noch in sich verbirgt. „Bergwanderer, die uns hier bei der Forschungsar-
beit begegnen, fragen oft, ob hier denn irgendetwas lebt“, erzählt er. Seit ein paar Jahren kann er von einer neuen Virengruppe berichten, die er mit Institutskollegen entdeckt hat. Dabei handelt es sich um besondere Viren – sie schützen Algen vor anderen Viren, den sogenannten Riesenviren. „Riesenviren sind darauf spezialisiert, Algen zu töten. Die neu entdeckten Viren befallen entweder gleichzeitig mit den Riesenviren die Algen oder infizieren die Algen direkt. In beiden Fällen hemmen sie den Vermehrungsmechanismus der Riesenviren und tragen so dazu bei, das ökologische Gleichgewicht des Systems zu stabilisieren“, berichtet Sommaruga. In der Zwischenzeit hat eine Gruppe der neuen Viren auch einen Namen –Gosseviren. „Sie machen den Gossenköllesee noch berühmter“, lacht der Forscher. Andreas_Hauser
The Gossenköllesee in Kühtai is a unique open-air laboratory at 2,400 metres above sea level – Austria’s only high-alpine lake within the international research networks LTER and GLEON.

For decades, measurements of temperature, ice thickness, water chemistry and biological processes have provided crucial data on how climate change affects alpine lakes. One of the leading researchers is Innsbruck ecologist Birgit Sattler, who has been studying how microorganisms survive in ice since the 1990s. Within the layered ice structures – comparable, as she likes to say, to a Manner wafer – bacteria thrive in nutrient-rich bands whose meltwater in summer fertilises the lake’s ecosystem.
Sattler also explores microorganisms in glaciers and has developed biodegradable, environmentally friendly glacier covers. Her colleague Ruben Sommaruga, originally from Uruguay, focuses on how organisms adapt to extreme alpine conditions such as intense UV radiation. Among his findings: certain algae produce compounds called MAAs (mycosporine-like amino acids) as natural sun protection, and when nitrogen is scarce, they form carotenoids that turn crustaceans a vivid red. Sommaruga also disco-
vered a “hybrid bacterium” that changes how it gains energy depending on the light – a clue to previously unknown survival strategies. Adding yet another layer to the research, Alessandra Cera from the University of Vienna studies microplastics, examining within the EU project FLOAT how plastic particles find their way even into the most remote alpine regions.
Despite its modest size of just 1.6 hectares, the lake provides a wealth of scientific insights. Sommaruga and his team recently identified an entirely new group of viruses there – the so-called Gosseviruses –which protect algae from harmful giant viruses, helping to stabilise the lake’s delicate ecological balance. The lake Gossenköllesee thus stands as a model for the complex, fragile yet remarkably resilient systems of alpine waters. It reveals how closely intertwined biological, chemical and physical processes are – and how vital long-term, interdisciplinary research is for understanding the transformations unfolding in a changing climate.

PANORAMA-BAD
PENTHOUSE-SPA
ERLEBNIS-GASTRO
LAKESIDE-GYM
BOULDER-HALLE
FAMILY-ELDORADO
SEE-BAD


KINDER


Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit insgesamt 1.856 km2 der größte der Ostalpen und erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol. Gletscherfläche: 126 km2 | Osttiroler Anteil: 611 km2
Tourismus und Natur auf Augenhöhe im Nationalpark Hohe Tauern.
Wenn der Winter Tirol in ein weißes Kleid legt, liegt ein anderer Klang in der Luft. Das Rauschen der Bäche verstummt, über den Gipfeln ist Ruh’, ja selbst das Licht scheint gedämpfter. Für viele ist dies der Moment, in dem die Sehnsucht nach der Natur, nach dem Draußen, am stärksten wird. Die Sehnsucht nach Weite, Stille, einem Schritt hinaus ins Weiß, das vom Trubel des Alltags abzulenken weiß. Doch gerade in dieser Zeit, in der der Mensch den Zugang zur Natur sucht, beginnt für diese – ganz besonders für die Tierwelt – die Zeit größter Empfindlichkeit.
Der Winter ist für die Tiere im Nationalpark Hohe Tauern kein Ruhezustand, sondern ein Ausnahmezustand. Sie drosseln ihren Energieverbrauch, leben größtenteils von den spärlichen Reserven, die sie in der warmen Jahreszeit aufgebaut haben, und meiden jede Anstrengung. Was für uns ein kurzer Aufstieg durch den Tiefschnee ist, kann für ein Reh oder Birkhuhn zu einer Frage des Überlebens werden, wenn es denn gezwungen ist, durch Störungen unvermittelt die Flucht anzutreten. Die Auswirkungen machen sich oft erst zeitverzögert bemerkbar, sind
Geführte Schneeschuhund Winterwanderungen mit Nationalpark-Ranger
Nature Watch – WILDe Überlebenskünstler in Kals am Großglockner:
Montags von 15. Dezember 2025 bis 16. März 2026, freitags von 19. Dezember 2025 bis 20. März 2026
Nature Watch – auf Spurensuche im Defereggental: Dienstags von 16. bis 30. Dezember 2025, Mittwoch, 7. Januar 2026 und dienstags von 13. Januar bis 17. März 2026
Nature Watch – Magische Naturschätze im Matreier Tauerntal: Donnerstag, 18. Dezember 2025, Dienstag, 23. Dezember 2025, Freitag, 2. Januar 2026 und jeweils donnerstags vom 8. Januar bis 19. März 2026
NEU: Winterwanderung mit Nationalpark-Ranger: Winterzauber am Sonnenbalkon von Prägraten am Großvenediger Mittwoch, 17. Dezember und Dienstag, 23. Dezember 2025 sowie jeweils mittwochs vom 31. Dezember 2025 bis 11. März 2026
aber dafür umso schwerwiegender, wie Wildtierbiologe Dr. Gunther Greßmann vom Nationalpark Hohe Tauern ausführt: „Tiere, die dauernd ausweichen müssen, haben ein höheres Stresslevel und geringere Fettreserven. Das wirkt sich auch nachteilig auf die Nachwuchsraten aus in dem Sinne, dass Würfe ausbleiben oder die Anzahl der Jungen sinkt. Das wiederum wirkt sich auf der Populationsebene aus. Die Auswirkungen werden oft erst nach zehn, fünfzehn Jahren richtig sichtbar.“ Wer sich im Winter im Naturraum bewegt, trägt eine besondere Verantwortung. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Der winterliche Naturraum ist ein sensibles Geflecht, das empfindlich auf Störungen reagiert. Dennoch soll er ein Ort bleiben, an dem sich Menschen bewegen, Natur genießen und erleben und staunen dürfen.
Koexistenz statt Konkurrenz.
Wie kann das gelingen? Indem man den scheinbaren Gegensatz auflöst. Tourismus und Naturschutz sind keine Gegner, wenn sie denselben Raum mit demselben Respekt teilen. Besucherlenkung, markierte Aufstiegsrouten, digitale Orientierungshilfen oder klar
Nationalparkranger Andreas Rofner betont das intensive Naturerleben beim Schneeschuhwandern, weil man sich dabei –langsam und rücksichtsvoll –abseits gängiger Infrastrukturen bewegt.


definierte Ruhezonen sind heute keine Einschränkung, sondern Ausdruck von Rücksicht. Wo alle Beteiligten – Alpenvereine, Tourismusverbände, Naturschutz und Gemeinden – an einem Strang ziehen, entsteht ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit, das über Appelle hinausreicht. Es entsteht ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch nicht über den Dingen steht, sondern Teil eines Ökosystems ist und damit direkt von diesem abhängt. Eine gesunde und natürliche Umwelt ist zum Nutzen aller.
Initiativen in Tirol zeigen, dass sanfte Steuerung funktionieren kann, wenn sie gut kommuniziert und von allen Stakeholdern mitgetragen wird. Wer weiß, warum ein Hang zur Ru-
Exklusiv für Sie, Ihre Familie, Betriebsausflüge, Firmenevents oder Gruppenreisen. Wir planen für Sie eine Wildtierbeobachtung als Winter- oder Schneeschuhwanderung mit Ihrem persönlichen Nationalparkranger.
Kontakt und Buchung
Tel.: +43 4875 5161-10 nationalparkservice.tirol@hohetauern.at www.hohetauern.at
hezone erklärt wurde, akzeptiert das leichter. Schutz braucht Wissen. Das funktioniert weit besser als Zwang. Wissen schafft Akzeptanz. Es gehört zu den Kernaufgaben des Nationalparks Hohe Tauern, dieses Wissen in den Köpfen der Besucherinnen und Besucher zu verankern. Das geschieht spielerisch und gruppendynamisch, etwa im Rahmen geführter Rangertouren. Bewusste Naturerfahrung, erzählerisch gepaart mit Wissensvermittlung, schafft Bewusstsein und macht aus Besucherinnen und Besuchern bestenfalls Botschafter des Nationalparkgedankens.
Die Sprache der Rücksicht, Aufklärung und Bewusstseinsbildung sind die vielleicht wichtigsten Werkzeuge dieser neuen Balance. Nachhaltigkeit beginnt nicht auf dem Papier, sondern im Kopf und in der Kommunikation. Gäste, die verstehen, wie sensibel der Naturraum, wie fragil das ökologische Gleichgewicht ist, werden zu Mitwirkenden, nicht zu Störfaktoren. Empathie statt Verbote. Wer erlebt, dass Stille selbst ein Erlebnis ist, begreift, dass man sie nicht brechen muss, um sie zu genießen. Im hektischen Alltagsleben der Menschen kann der Nationalpark mit seiner stillen Weite zum gigantischen Ruheraum werden, zum Kraftort. Im Nationalpark gibt es Platz zur Entschleunigung, Platz für ein Miteinander. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man der Tierwelt ihren Platz lassen muss. Sonst funktioniert es nicht. Es braucht Zurückhaltung, auch wenn das dem Zeitgeist zuwiderläuft. „Der Wintersport geht viel mehr in die Fläche. Das macht es für viele Tierarten schon schwierig, noch ausreichend ruhige Lebensräume vorzufinden“, weiß Greßmann. Auch Nationalparkranger Andreas Rofner plädiert dafür, den Tieren ihren Lebensraum so weit wie möglich zu lassen.
Das Schneeschuhwandern ist eine Möglichkeit, Naturgenuss und
„BEIM SCHNEESCHUHWANDERN NIMMT MAN DIE NATUR GANZ ANDERS WAHR, WEIL MAN SICH ABSEITS GÄNGIGER INFRASTRUKTUREN BEWEGT.“
Andreas Rofner
den Schutz der Fauna zu vereinbaren. Es ist eine sanftere Art des Tourismus, kommt ohne Infrastrukturen – Piste, Loipe, Rodelbahn – aus. Es braucht nur Winterkleidung und Schneeschuhe. Für die Tierwelt ist der gut hörbare Schneeschuhwanderer mit seinen langsamen Bewegungen berechenbarer als der Tourengeher, der vor allem beim Abfahren die Tiere in Unruhe versetzt. Schneeschuhwandern ist inklusiv. „Dazu braucht es kein Vorwissen und Können“, sagt Rofner. „Die Natur nimmt man dabei ganz anders wahr, weil man sich abseits gängiger Infrastrukturen bewegt.“ Naturnäher kann man sich im Winter im Nationalpark Hohe Tauern nicht bewegen. Damit geht aber auch eine Verantwortung einher, sich dessen bewusst zu sein, dass die Natur keine gewaltige Freiluftsport- und Freizeitarena ist. Auf seinen Touren vermittelt Rofner den Menschen das. „Man tut den Tieren auch nichts Gutes, wenn man sie füttert. Das Beste, was man machen kann, ist, ihre Lebensräume zu respektieren und sie in Ruhe zu lassen.“
Besonders gut und verträglich lässt sich der Winter im Nationalpark im Rahmen geführter Rangertouren erleben. Den erfahrenen Ranger zieht es vor allem in die wunderbare Gegend um den Staller Sattel mit seinem kupierten Gelände oder ins Kalser Ködnitztal, das eine großartige Aussicht auf den Großglockner bietet. Bewusstseinsbildung endet nicht an den Rändern des Nationalparks. Sie setzt sich dort fort, wo Gäste ankommen. In den Betrieben, die Verantwortung als Teil ihres Angebots

Das ganze Angebot der Rangertouren im Nationalpark Hohe Tauern auf einen Blick aufs Handy holen: www.hohetauern.at

Im Reich des Adlers: Mit etwas Glück lassen sich bei den geführten Schneeschuhwanderungen die majestätischen Könige der Lüfte aus unmittelbarer Nähe beobachten.

„DER NATIONALPARK HOHE TAUERN WIRD VON DEN GÄSTEN ALS WILLKOMMENE GELEGENHEIT GESEHEN, NATURNAHEN UND NACHHALTIGEN URLAUB ZU MACHEN.“
Christoph Rogl

Das Hotel Taurerwirt in Kals am Großglockner zeigt als langjähriger Nationalpark-Partnerbetrieb konsequent vor, wie Tourismus und der Nationalparkgedanke in Einklang zu bringen sind.
verstehen. So wie beim Taurerwirt in Kals am Großglockner, den Christoph Rogl mit seiner Familie führt.
Natur als Geschäftsgrundlage.
Ein Tourismus, der die Sprache der Natur spricht, hat Zukunft. Immer mehr Regionen betonen Werte wie Ruhe, Ursprünglichkeit und Achtsamkeit. Der Winter wird vielerorts nicht länger nur als Bühne für Aktivitäten nach dem Schema „Schneller, höher, weiter“ verstanden, sondern als Raum der Wahrnehmung. Das verändert nicht nur das Verhalten, sondern auch das Selbstverständnis einer Destination.

Einer, der mit seiner Familie dieses Verständnis um die Balance zwischen Natur und Tourismus seit Gründung des Nationalparks vorlebt, ist Hotelier Christoph Rogl. Das Wanderhotel Taurerwirt in Kals am Großglockner gehört zu den Leitbetrieben in der Region und ist Gründungsmitglied der Nationalpark-Partnerbetriebe. „Der Nationalpark Hohe Tauern wird von den Gästen als willkommene Gelegenheit gesehen, naturnahen und nachhaltigen Urlaub zu machen.“ Für das Hotel ist der Nationalpark also durchaus buchungsrelevant. Im Winter verbringen dort neben Skifahrern auch zunehmend Schneeschuhwanderer und Erholungsuchende ihren Urlaub. Dort, am Eingang zum Dorfertal, herrscht Ruhe. Der Hotelier und seine Familie setzen zunehmend auf Alternativtourismus. „Wir identifizieren uns vollkommen mit dem Nationalpark Hohe Tauern“, sagt Rogl, der mit der Lage in einem sensiblen Gebiet auch eine Verantwortung verbunden sieht. „Diese ökologische Verantwortung teilen wir mit unseren Gästen. Wir machen ihnen bewusst, was es bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben.“ Und zu wirtschaften.
Beim Taurerwirt wurde in den letzten Jahren viel investiert. Die Hardware ist top, die Einstellung auch. Rogl ist bestrebt, die Saison länger zu machen. Der Nationalpark ist gerade im Frühjahr und Herbst reizvoll. Für Christoph Rogl ist es nach wie vor keine Selbstverständlichkeit, in dieser Umgebung leben und arbeiten zu dür-
fen. „Ich schätze das jeden Tag, heute vielleicht sogar noch mehr als früher, wenn ich sehe, wie chaotisch es überall auf der Erde zugeht.“ Der Taurerwirt ist insofern auch ein Stück heile Welt, eine Ruheoase. Im Hotel ist man schon vom Zimmer aus beinahe mittendrin in der Natur. „Man kann direkt aus den Zimmern das Steinwild beobachten. Das ist für unsere Gäste ein Highlight. Deshalb sind auch unsere nordseitig gelegenen Zimmer gefragt, nicht nur die südseitigen.“ Der Aktionsradius ist im Winter natürlich etwas beschränkt, im Dorfertal und Teischnitztal herrscht Lawinengefahr. Es gibt aber mit dem Ködnitz- und Lesachtal lohnende Alternativen. Als Nationalpark-Partnerbetrieb der ersten Stunde schätzt Rogl besonders den regionalen Einkauf von Lebensmitteln aus der alpinen Landwirtschaft. Damit bleibt die Wertschöpfung in der Region. „Die Partnerbetriebe sind ein cooles Netzwerk, das in Sachen Nachhaltigkeit an einem Strang zieht“, sagt der Hotelier. Der Taurerwirt verfügt bereits seit den 1980er-Jahren über ein eigenes Wasserkraftwerk und ist damit energieautark. Auf einen Infinitypool im Haus verzichtet Rogl aus ideologischen Gründen. „Wir haben unser Schwimmbad bewusst in einen Wintergarten eingehaust, weil wir hier im Nationalpark nicht einfach Energie verschwenden wollen.“ Naturschutz und Tourismus sind für Christoph Rogl und seine Familie kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Das eine ist die Grundlage für das andere. Intakte Natur ist kein Bonus, sondern die Geschäftsgrundlage.
Verantwortung als Haltung.
Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, ein ständiges Ausbalancieren von Interessen, das nie aufhört. Der Tourismus lebt von der Landschaft, die er nutzt, und trägt zugleich Verantwortung für sie. Diese Erkenntnis ist nicht romantisch, sondern zutiefst ökonomisch: Nur was intakt ist, bleibt erlebbar. Verantwortung bedeutet hier, die eigenen Grenzen zu kennen, als Betrieb, als Gemeinde, als Gast. Aufenthaltsqualität gibt es langfristig nur dort, wo auch Maß gehalten wird. Der Osttiroler Tourismus ist diesbezüglich noch gut mit der Nationalparkidee kompatibel. Phänomene wie Overtourism gibt es hier noch nicht. Es gibt von allem genug und von nichts zu viel.
Entschleunigung pur: Den leise knirschenden Schnee unter den Schuhen kann man im Winter der Hektik des Alltags Schritt für Schritt davongehen.
Der Klimawandel zwingt zu einem neuen Denken. Schnee ist keine Selbstverständlichkeit mehr, Energieverbrauch und Naturverträglichkeit werden zu Gradmessern der Glaubwürdigkeit. Doch in diesem Wandel liegt auch eine Chance. Ein Wintertourismus, der auf Qualität, Regionalität und Naturverbundenheit setzt, kann stärker, resilienter, authentischer und damit zukunftsfähiger werden. Denn das, was die Nationalparkregion im Winter wirklich auszeichnet, ist nicht unbedingt die perfekte Spur bei der Skitourenabfahrt im freien Skiraum, sondern die Fähigkeit, auch einmal innezuhalten. Nicht allein die Grenzen der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit als Maßstab der eigenen winterlichen Sportaktivitäten anzulegen, sondern die Grenzen der Natur mitzudenken. „Wenn nicht jeder ohne Rücksicht auf Verluste für sich in Anspruch nimmt, alles zu tun, wozu er gerade Lust hat, finden wir in der Natur alle einen Platz“, ist Ranger Andreas Rofner überzeugt. Zwischen unberührter Natur und touristischer Nutzung liegt ein Gleichgewicht, das immer neu gesucht werden muss – und vielleicht gerade darin seine Schönheit findet
Marian_Kröll

Abseits der meist gut besuchten Skipisten und Langlaufloipen hat sich in der Region Wilder Kaiser eine neue Wintersportaktivität etabliert. Beim Winter- und Schneeschuhwandern auf verschneiten Pfaden findet man innere Ruhe und setzt sprichwörtlich große Fußstapfen in ein glitzernd verschneites Winterwonderland.

Die Ruhe einer verschneiten Winterlandschaft genießen, abschalten und mit jedem Schritt sanft eintauchen in den glitzernden Schnee. Nur das leise Knirschen des Schnees ist zu hören, wenn man in der tief verschneiten Bergwelt einen Fuß vor den anderen setzt. „Winter- und Schneeschuhwandern hat sich zu einer beliebten Alternative im Wintersportbereich entwickelt“, erzählt Sabrina Brandauer, Tiroler Bergwanderführerin in der Ferienregion Wilder Kaiser. „Vor allem wenn es frisch geschneit hat, ist es besonders schön, durch den fluffigen Schnee zu stapfen und die wunderbare Natur um sich herum zu genießen.“ So beschaulich und entschleunigend so eine Schneeschuhwanderung ist, so gibt es doch einiges zu beachten, bevor man zu einer winterlichen Outdoor-Route aufbricht.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Wer noch nie schneeschuhgewandert ist, sollte sich zu Beginn in einem einfachen Gelände mit den Schneeschuhen anfreunden. „Es ist anfangs ungewohnt und man muss mit Schneeschuhen etwas breiter gehen. Auch wenn sich Schneeschuhe in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, so ist die Gehbewegung insbesondere beim Aufwärts- und Abwärtsgehen doch eine andere. Nach ein wenig Übung gewöhnt man sich jedoch an die Gehtechnik

„VOR
ZU STAPFEN UND
WUNDERBARE NATUR UM SICH HERUM ZU GENIESSEN.“
Sabrina Brandauer
und kann die herrliche Winterpracht unserer Region mit allen Sinnen genießen. Deshalb rate ich beim ersten Schneeschuhwandern entweder zu einer geführten Gruppenwanderung oder zu einem Probegehen an einem sicheren Ort, damit es dann auf der Tour zu keinen Schwierigkeiten kommt“, rät die Bergwanderführerin. Zudem gilt es natürlich, die Schneeschuhe vorab richtig einzustellen und sich mit der Handhabung der technischen Anpassungen vertraut zu machen.
Gut gerüstet die Natur geniessen.
Schneeschuhwandern ist ein Ausdauersport und so kommt man dabei schon auch mal ins Schwitzen. Deshalb empfiehlt Sabrina Brandauer, sich am Anfang nicht zu hohe Ziele zu setzen und wie beim Langlaufen oder Skitourengehen atmungsaktive Funktionswäsche mit verschiedenen Schichten und ausreichend Wechselgewand im Rucksack mit dabei zu haben. Damit es beim breitgängigen Schneestapfen auch den Füßen gut geht, die uns durch die schöne Winterlandschaft tragen, ist natürlich auch auf stabile, hohe und wasserdichte Bergschuhe mit guter Passform zu achten. „Wichtig ist auch, ausreichend Getränke und Verpflegung einzupacken und bei Schönwetter auf adäquaten Sonnenschutz zu achten“, hält die Naturliebhaberin wertvolle Tipps bereit und weiß auch immer um die aktuell schönsten Touren Bescheid.


Abwechslungsreiche Winterrouten gibt es in allen vier Kaiserorten. In Scheffau trifft man Sabrina mit etwas Glück im Tourismusbüro – es sei denn, sie ist gerade wieder mit einer Gruppe draußen unterwegs, beim Winterwandern oder Waldbaden. Doris_Helweg
Hier finden Sie die schönsten Routen und weitere Infos zum Schneeschuhwandern in der Region Wilder Kaiser.
Ein paar wichtige Tipps für Schneeschuhwanderer:
• Auswahl des Tourenziels an die individuelle Kondition anpassen.
• Aktuelle Schnee- und Wetterverhältnisse checken (Lawinengefahr, gesperrte Wege und Touren) und sich dementsprechend anpassen.
• Auf gute Ausrüstung und ausreichend Verpflegung achten.
• Mobiltelefon mitführen und vertraute Personen über Ziel, Route und Rückkehr informieren.
• Frühzeitig aufbrechen, da die Dämmerung im Winter bereits ab 16 Uhr einsetzt.
• Bei vereisten Wegen und Schneeverhältnissen ist von einer Winter- oder Schneeschuhwanderung abzuraten.
• Schneeschuhwandern ist ein Ausdauersport. Die positiven Belastungsreize für Herz und Kreislauf setzen Gesundheit und eine realistische Selbsteinschätzung voraus. Vermeiden Sie Zeitdruck und wählen Sie das Tempo so, dass niemand in der Gruppe außer Atem kommt.
• Zum Schutz der Natur: Schutz- und Schongebiete für Tiere und Pflanzen respektieren, keinen Müll hinterlassen und sich aus Rücksicht zu den Tieren ruhig verhalten und Wildfütterungsgebiete großräumig umgehen.
• Wanderkarten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über Länge, Höhendifferenz, Schwierigkeit und über die aktuellen Verhältnisse.



Fünf
Dinge, um
Tirol in allen Facetten des Winters kennenzulernen.
Unsere To-dos für lässige Ta-daas!
1. Sich in Geduld üben
Der Weidachsee in Leutasch bekommt in kalten Wintern eine prächtige Eisdecke geschenkt. Und unter dieser Eisdecke tummelt sie sich: die Beute der Eisfischer. Hier oben auf 1.123 Metern Seehöhe herrschen ideale Bedingungen dafür, die Eislöcher werden vom Fischereiteam gebohrt. Was das Fischen am Eis von allen anderen Arten unterscheidet, ist nicht nur die Dunkelheit des Eislochs, das jeden Versuch so spannend macht, sondern auch die dabei verwendete Fischerrute, die mit ihren knapp 20 Metern Länge sehr klein ist. Der geübte Eisfischer sieht mit dem Handgelenk und spürt sofort, ob da unten ein Fisch mit seiner Schnauze am Köder schnuppert. Wer keine kurze Eisangel besitzt, kann sie auch leihen.
www.gebirgsforelle.at
2. Nächtlichen Winterflow spüren
Im Paznaun, dort, wo Ischgl liegt, kann man winters nicht nur lässig Ski fahren und spektakulär feiern, man kann hier auch wunderbar langlaufen. Zwischen Ischgl und Galtür erstreckt sich auf über 80 zusam-
menhängenden, perfekt präparierten Loipenkilometern ein echtes Langlaufparadies für Wintersportfans aller Leistungsklassen. Und selbst wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, ist der Langlauftag hier noch nicht vorbei. Dank moderner Flutlichtanlagen lassen sich ausgewählte Loipen auch abends nutzen. Schön ist die insgesamt 5,5 Kilometer lange Route von Galtür nach Wirl und retour, die durch herrlich verschneite Genusslandschaften führt. 2,2 Kilometer davon sind bis 22 Uhr abends beleuchtet. Von Ischgl aus wurde die Nachtloipe bis Mathon verlängert.
3. Herzhafte Krapfen essen
Der Freitag ist bei Anni und Andreas Ritter Krapfentag. Seit Jahren. Da wird gepresst, was das Zeug hält. Gelernt hat Anni Ritter das Krapfenmachen von ihrer Großmutter, die es wiederum von ihrer Großmutter, der Bäuerin z’Hachtler am Stummerberg, gelernt hat. Die Geheimnisse (die längst keine Geheimnisse mehr sind) des alten Rezepts: dünn getriebene Blattl’n, Graukas, Bröseltopfen, Erdäpfel, Schnittlauch, Salz.
Das war’s. Bei der Qualität der Zutaten schwören die Ritters auf Produkte aus biologischer Landwirtschaft. Geöffnet hat die Bauernkuchl nur Freitag, Samstag und Sonntag. Neben den großartigen Zillertaler Krapfen gibt’s die Klassiker der heimischen Wirtshausküche. In erfreulich guter Qualität. Unbedingt reservieren. www.bauernkuchl.at
4. Bewusst hässlich sein
Für viele ist es der geilste Tag im Jahr: der Ugly Skiing Day – kurz USD – in der Axamer Lizum. Schräge Outfits, Dosenbier und Freiheit im Schnee. Es war das Jahr 2011, als zehn halbstarke Jungs sich auf den Weg machten, um dem Gott der schlechten Musik ein Opfer zu bringen, und alles begann damit, dass einer davon zu seinem Geburtstag mit ein paar Freunden in hässlichen Retro-Skianzügen Ski fahren gehen wollte. Die Idee jodelte sich rasch durchs Land, sodass beim zweiten Ugly Skiing Day bereits 30 Menschen dem Spektakel beiwohnten. Mittlerweile kommen Unmengen von Ugly Skiern zum wohl größten Geburtstagsfest Tirols. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie am 11. April 2026 auch in Innsbruck Stadt einige sonderbar gekleidete Menschen antreffen. Danke Toni! Unter www.uglyskiingday.com gibt’s einen ersten Eindruck.
Unser Tipp fürs Frühjahr: Nach der Ski- beginnt auf der Innsbrucker Nordkette die Figl-Saison. Figl steht für Firngleiter. Sie sehen aus wie extrem kurze, etwas breitere Ski, auf denen die Bindung ganz hinten montiert wird. Und wenn der Schnee im Frühjahr so richtig matschig und sulzig wird und das eigentliche Skifahren keinen rechten Spaß mehr macht, beginnt auf der Seegrube oberhalb von Innsbruck die Figl-Saison. Einheimische und Eingeweihte warten dann schon ungeduldig auf den Termin, an dem der Skibetrieb beendet und die Bahn im wahrsten Sinn des Wortes für die Figlerinnen und Figler freigemacht wird. Dann gibt’s sogar einen eigenen Lifttarif. Anfänger, die keine eigenen Figl besitzen, können welche ausleihen. Der Sport ist hierzulande längst Kult. Es geht dabei weniger um die perfekte Haltung, sondern um den puren Spaß. Nach unten kommt man immer irgendwie.





Eine Reise in die Tiroler Zugspitz Arena.
enn die Berge in glitzerndes Weiß getaucht sind und die Luft klar nach Schnee duftet, beginnt in der Tiroler Zugspitz Arena jene Jahreszeit, die ihrem Namen alle Ehre macht: der echte Winter. Umgeben von majestätischen Gipfeln, am Fuße der Zugspitze, entfaltet sich eine Landschaft, die Ruhe und Abenteuer zugleich verspricht.
Sieben charmante Orte liegen eingebettet zwischen den Hängen – jeder mit seinem eigenen Charakter, alle verbunden durch ein Gefühl von Freiheit. Familien, Paare oder Freundesgruppen finden hier, was Winter ausmacht: Bewegung in der Natur, stille Mo-
mente im Schnee und unvergessliche Tage, die lange nachwirken.
Vielfalt auf Skiern.
Wer in der Tiroler Zugspitz Arena auf die Bretter steigt, merkt schnell, warum die Region als Paradies für Wintersport gilt. 143 Pistenkilometer verteilen sich auf sieben Skigebiete – darunter ein Gletscher, der das Skifahren bis in den Frühling hinein ermöglicht. Besonders Familien ziehen die zertifizierten Familienskigebiete – die Ehrwalder Almbahn, die Ehrwalder Wettersteinbahnen und die Skiarena Berwang-Bichlbach – an, wo


kindgerechte Abfahrten, faire Tarife und geduldige Skilehrer*innen für unbeschwerte Tage sorgen.
In der Funslope und im Familypark glitzert die Luft vor Lachen, während Anfänger*innen in den Skischulen ihre ersten Kurven ziehen. Auch Menschen mit Einschränkungen erleben hier Wintersport in seiner inklusiven Form: Die Initiative „No Handicap“ in Lermoos ermöglicht mit Bi-Skis und speziell geschulten Lehrer*innen grenzenlose Freiheit im Schnee.
Die Top Snow Card öffnet nicht nur die Lifte auf österreichischer Seite, sondern auch die Tore zu den Pisten in Bayern – grenzenloses Skivergnügen mit nur einem Ticket. Wer lieber abends unterwegs ist, erlebt beim Nachtskilauf und stimmungsvollen Skishows magische Stunden unter funkelndem Sternenhimmel.
Grenzenlose Freiheit und purer Winterzauber.
Hoch hinaus – und doch ganz bei sich: In nur zehn Minuten schwebt die Tiroler Zugspitzbahn fast 3.000 Meter über dem Alltag. Oben öffnet sich ein Panorama, das den Atem stocken lässt. Bei klarer Sicht reicht der


Blick über 400 Gipfel in vier Ländern, während unter den Füßen das ewige Eis glitzert.
Zwei Erlebnismuseen erzählen vom Werden der Berge und der Geschichte der Seilbahn – ein spannender Kontrast zu der stillen Weite draußen. Wer mag, kehrt im Panoramarestaurant „Gipfelgenuss“ ein, wo sich Tiroler Küche mit Aussicht auf die Welt verbindet. Hier oben schmeckt der Winter nach Freiheit.
Winterwandern und Schneeschuhtouren.
Abseits der Pisten entfaltet sich der leise Winter. 60 Kilometer gepflegte Winterwanderwege und verschneite Schneeschuhrouten führen durch Wälder, über sonnige Lichtungen und entlang gefrorener Seen. Rund 120 Kilometer Loipen verbinden die sieben Orte miteinander – kostenfrei und voller weicher Stille. In urigen Hütten knistert das Kaminfeuer, während der Duft von Kaspressknödeln und Kaiserschmarrn in der Luft liegt. Auf den digitalen Erlebniswegen in Ehrwald, Berwang und Heiterwang am See wird Wandern zum Abenteuer: Videos, Rätsel und kleine Spiele begleiten Familien auf Schritt und Tritt.
Neu in dieser Saison: der ganzjährige Stempelpass – digital oder gedruckt. Ob auf Langlaufloipen (nur digital) oder Wanderwegen, das Sammeln von Stempeln über SummitLynx ist zu einem kleinen Ritual geworden – eine Erinnerung an jede Etappe im Schnee. Und als Belohnung gibt es die beliebte Wandernadel.
Langlaufen, Rodeln und mehr.
Wenn der Schnee unter den Kufen knirscht und das Lachen von den Hängen hallt, beginnt der Spaß jenseits der Pisten. Rodeln in Ehrwald, Lermoos, Biberwier oder Berwang – bei Tag oder unterm Sternenhimmel – ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Auf der Eisbahn gleiten Schlittschuhläufer*innen über spiegelnde Flächen, während beim Eisstockschießen alpenländische Tradition lebendig bleibt.
Wer die Winterlandschaft lieber im gemächlichen Tempo genießt, kann sich in eine Decke kuscheln und bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt durch den Schnee gleiten. Wer Tiere liebt, kann auf einer Lamawanderung die Ruhe der Natur erleben, begleitet vom leisen Schnauben der sanften Lamas. Ganz anders, aber ebenso stimmungsvoll, ist eine Fackelwanderung durch die stille Nacht. Jede Aktivität erzählt ihre eigene kleine Wintergeschichte – immer begleitet von der Sonne, die hier besonders lange über den Hängen verweilt.
Unkomplizierte Anreise.
Nur wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze beginnt eine andere Welt – und doch ist sie so nah. Keine Vignetten, keine Passstraßen, kein Stress. Wer in die Tiroler Zugspitz Arena reist, erlebt, wie entspannt Ankommen sein kann. Auch mit der Bahn geht es direkt ins Winterglück: Sechs Bahnhöfe verbinden die Orte mit München, Innsbruck oder Stuttgart. Vor Ort fährt man mit der Gästekarte kostenlos mit dem Skibus oder den Winterbussen – ein Netz, das alle Orte miteinander verbindet. Für E-Autos gibt es ein dichtes Netz an Ladestationen – nachhaltig, bequem und zukunftsorientiert.
Die Tiroler Zugspitz Arena vereint Vielfalt, Ruhe und Naturgenuss. Sie ist eine Region, in der der Winter noch echt ist – spürbar in jedem Atemzug, jedem Schwung und jedem Schritt durch den Schnee. So nah, so einfach – der Weg in die Freiheit führt in die Tiroler Zugspitz Arena. zugspitzarena.com




7 Orte: Ehrwald, Lermoos, Berwang, Biberwier, Bichlbach/Lähn-Wengle, Heiterwang am See und Namlos
Skigebiete: 7 zertifizierte Familienskigebiete: 3
Pistenkilometer: 143 km
Skianlagen: 58
Langlaufloipen: 120 km
Winterwanderwege: 60 km
Digitale Erlebniswege: 6 (3 davon auch im Winter begehbar)






















www.sportalm.net





BERGBAHNEN






















In der Sportalm im Pitztal erwartet Sie die perfekte Mischung aus Wellnessfreuden, Genussmomenten und stärkenden Naturerlebnissen in der tiefverschneiten Gletscherwelt.
ONLINE-TICKETSHOP & GUTSCHEINWELT
bergbahnen-langes.at

& WINTERERLEBNIS


›› 13 Seilbahnen + 40 Pistenkilometer
›› Beleuchtete Winterrodelbahn
›› Familienskigebiet Biberwier


›› Funpisten, Skimoviestrecke und Photopoint
›› Winterbetrieb 12.12.2025 bis 12.04.2026
›› Sommerbetrieb 13.05. bis 08.11.2026




Was sich im Oktober und November bereits angestaut hat, entlädt sich in der Krampuswoche mit einem Gewitter: Wildes Glockengeläut und markerschütterndes Gezeter und Geschrei zerreißen am 5. Dezember die adventliche Stille.

Aus den wilden Gesellen, die einst als Perchten in den Rauhnächten ihr Unwesen trieben, wurden die rauen Gesellen, die nun alljährlich als Krampusse am 5. Dezember die Nacht zum Tag machen. Im Osttiroler Dorf Oberlienz liegt in der Zeit um den Krampustag etwas in der Luft. Eine würzige Mischung aus Andacht, Vorfreude und Adrenalin. Heraus kommt ein sehenswertes Spektakel, bei dem besonders erlebnisorientierte Zuschauer auf ihre Kosten kommen.
In der kalten Jahreszeit, wenn die Tage immer kürzer und die Nächte länger werden, breitet sich eine gewisse Unruhe im ansonsten recht beschaulichen Dorf Oberlienz aus. Die Krampuszeit beginnt. Sie ist so etwas wie eine fünfte Jahreszeit im Osttiroler Dorf mit seinen rund 1.500 Einwohnern, das am Schuttkegel der Schleinitz und dem Eingang des Iseltals liegt. In so mancher Garage und Werkstatt wird im Herbst fleißig geschnitzt. Hier bekommt so manche Larve, wie die Krampusmasken genannt werden, ihr meist schauriges Gesicht. Was als uniformer Holzklotz beginnt, endet nach vielen Stunden Schnitzen und Bemalen als Kunstwerk, mit dem beim traditionellen Krampuslauf mitunter alles andere als zimperlich verfahren wird. So eine Krampuslarve ist kein Museumsstück, sie muss einiges aushalten.
Furchtbare Freude.
Die Stimmung in der Krampuszeit ist eigentümlich: Eine Mischung aus Andacht und Vorfreude, Demut und Übermut zugleich legt sich über das Dorf. Besonders die Kinder, Jugendlichen und jungen Männer können es kaum erwarten, bis der für nicht wenige wichtigste Tag im Jahr am Kalender steht: der 5. Dezember. Krampustag.
Vor allem Kraft und Kondition sind an diesem Tag gefragt, ein wenig Koordination ist auch nicht verkehrt. Was vordergründig chaotisch wirken mag, hat seine innere Ordnung und

Wenn draußen leise das Herbstlaub zu Boden fällt, hört man drinnen das Kratzen der Schnitzeisen. In Oberlienz wird geschnitzt, geschliffen und gemalt, bevor die Larven in der ersten Dezemberwoche zum Leben erwachen. Einer, der diesem Brauch ein Gesicht gibt, ist Bert Steiner. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 58.
folgt einer gewissen tradierten Choreographie. Das „Krampuszeug“, die traditionelle Adjustierung der Krampusse, besteht aus Larve, Fell und Glocken, ist schwer und wenn es regnet oder schneit, sogar noch schwerer. Bewegungsfreiheit und Sichtfeld sind eingeschränkt. Was sich im Oktober und November bereits angestaut hat, entlädt sich in der Krampuswoche mit einem Gewitter: Wildes Glockengeläut und markerschütterndes Gezeter und Geschrei zerreißen am 5. Dezember die adventliche Stille. Die Krampuszeit ist aufregend. Für die Kinder noch mehr als für die Erwachsenen. Für die Kleinen wird am 3. Dezember ein eigener Umzug veranstaltet, für die „Mittleren“, das sind die Jugendlichen, am 4. Dezember. So geht Nachwuchsarbeit. Dabei wird alles genauso gehandhabt wie am 5. Dezember, nur eine oder zwei Nummern kleiner.
Wenn der Percht mit dem Nikolaus…
Die Geschichte des „modernen“ Krampuslaufs geht in Oberlienz bis auf das Jahr 1945 zurück, in Oberdrum setzte das schaurige Treiben 1949 ein. Einige der ersten Larven wurden anno dazumal vom einarmigen Schnitzer Hansl Schneeberger vulgo Zeiner angefertigt. Karl C. Berger, Volkskundler und Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums, stammt selbst aus Matrei in Osttirol und kennt die regionalen Bräuche wie kaum ein anderer, deren Wurzeln – wie vielerorts in Tirol – bis
ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Aus dieser Zeit stammt nämlich der sogenannte Perchtenbrauch, bei dem in den Rauhnächten (zwischen Weihnachten und Dreikönigstag) maskierte Figuren, die sogenannten Perchten, durch die Orte ziehen, um böse Wintergeister zu vertreiben und Glück für das neue Jahr zu bringen. Namensgebend war die Sagengestalt Perchta.
Ein zweiter Vorgängerbrauch des Krampuslaufs sind die sogenannten Nikolausspiele, die bis ins 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen. Diese Spiele fanden einst in den Wohnhäusern statt und sollten den katholischen Glauben repräsentieren. „Das kann man sich wie ein Bauerntheater vorstellen“, sagt Karl C. Berger. In der Zeit der Aufklärung wurden diese Nikolausspiele verboten, doch man umging dieses Verbot, indem man die Aufführung kurzerhand ins Freie verlagerte. „Die Nikolausspiele verlagerten sich vors Haus und damit begannen die Umzüge“, erzählt der Volkskundler. Schrittweise kam es zu einer Vermischung der beiden Bräuche, die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten. Der heutige Krampuslauf hat also heidnische und christliche Wurzeln. Überlieferungen zu den ersten Anfängen in Oberlienz und Oberdrum reichen laut Überlieferungen ungefähr bis ins Jahr 1850 zurück.
Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Anfänge nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs waren bescheiden: Die Larven waren einfacher, die Glocken kleiner, vieles improvisiert. „Trotzdem hatten wir als Kinder wahnsinnig Angst“, sagt ein Zeitzeuge. Nachsatz: „Vor dem Nikolaus fast noch mehr.“ Der war es schließlich auch, der den Sack zumachen konnte, ohne dass es etwas zum Naschen gegeben hat. Ein anderer Zeitzeuge erinnert sich: „In unserer Stube hat’s ausgeschaut… fast




wie in der Hölle.“ Das hängt auch mit dem Brauch des Tischziehens zusammen. Dabei stürmen Krampusse die alten Bauernstuben und versuchen, den Tisch umzuwerfen oder aus der Stube zu bugsieren. Dabei geht es manchmal hoch her. „Man hat sich immer schon eine Woche vor dem Krampustag gefürchtet und gefreut zugleich“, bringt eine Zeitzeugin die damals wie heute herrschende Stimmung auf den Punkt.
Vom Stubenbrauch zum Spektakel.
Brauchtum verändert sich. Tradition ist nicht starr. Geht sie nicht mit der Zeit, geht sie mit der Zeit. Nicht jeder
Wandel ist wünschenswert. In den 1980er- und vor allem 1990er-Jahren hat – übrigens nicht nur in Osttirol –eine zunehmende „Eventisierung“ des Krampuslaufs stattgefunden. Aus einer Tradition wurde mehr und mehr Show. Das traditionelle Tischziehen wurde zum Outdoor-Spektakel und bekam einen wettkampfähnlichen Charakter. Das kann man goutieren, muss man aber nicht.
In Oberlienz hat man allerdings damit begonnen, den Rückwärtsgang einzulegen. Rückbesinnung ist angesagt, back to the roots. Spektakulär ist es aber allemal, wenn eine ganze Horde Krampusse auf den massiven Tisch


zustürmt und sich darauf türmt. Körper auf Körper. Die wilden Kerle treiben es bunt. Derart entsteht ein ganzes Potpourri an Larven, Fellknäueln und Glocken, kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Das Treiben in den Bauernstuben ist jedenfalls um einiges uriger. Die Kinder fürchten sich auch heute noch nicht nur vorm Krampus, auch der Nikolaus flößt immer noch Respekt ein. „Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass die Kinder mehr Angst vor dem Nikolaus als vor dem Krampus haben“, verrät ein langjähriger Oberdrumer Nikolaus, der die Gemütslage der Kinder aus eigener Anschauung kennt.
zu Mitternacht am Kirchplatz.
Seit Mitte der 1970er-Jahre findet der Krampuslauf in Oberlienz und Oberdrum am Kirchplatz vor dem Gasthof Mosmeir seinen würdigen Höhepunkt und Abschluss. Hier riecht es nach Adrenalin, nach Glühwein, Rauch und Ruß. Besonders erlebnisorientierte Zuschauer begeben sich auf eigene Verantwortung – und Gefahr – vor die Absperrungen, um ihre Kräfte mit den wilden Kerlen zu messen. Ein Krampuswurf – jene traditionelle Wurftechnik, die fast jedes männliche Volksschulkind im Dorf aus dem Effeff beherrscht – ist schnell angesetzt. Bumm, zack! Die Landung ist selten sanft. Eine am Kirchplatz aufgebrachte Schneeunterlage sorgt dafür, dass Verletzungen die Ausnahme bleiben. Friedl Tschurtschenthaler, pensionierter Polizist, stammt aus einer Krampusund Nikolausdynastie und läuft seit seinem 15. Lebensjahr mit – heute, als über 70-Jähriger, immer noch. „Ich bin als Krampus gegangen, als Nikolaus, als Lotter und Litterin. Nur als Engel nie“, erzählt er.
Der Krampusbrauch ist bis heute fast ausschließlich Männersache, Frauen spielen meist nur als „Engele“ eine
kleine Rolle. „Das ist eine andere Welt“, sagt Tschurtschenthaler. Sein persönliches Highlight ist der Beginn des Umzugs der Oberlienzer Krampusse beim Kohler, der hinunter nach Lesendorf führt. „Es geht abwärts, da hat jeder noch Kraft und Schmalz – da entsteht eine richtige Gruppendynamik.“
Neue Larve, neues Fell.
In neuerer Zeit wurde das Brauchtum von Schnitzern geprägt, die diesem Brauch ein Gesicht gegeben haben. Meistens ein furchterregendes, manchmal aber auch ein kurioses oder ein lustiges, aber jedenfalls ein markantes. Einer, der dem Krampuslauf mit seinen imposanten und unverwechselbaren Larven einen ganz besonderen Stempel aufgedrückt hat, ist Anton Baumgartner, der sich auch als Bildhauer zeitlebens einen Namen gemacht hat. Stilprägend für die neuere Generation von Larven war auch der Schnitzer Friedl Lercher, im Brotberuf ebenfalls Polizist. Er war einst aus Matrei, einer weiteren Krampus- bzw. Klaubaufhochburg in Osttirol, nach Oberlienz gezogen. Von Matrei in Osttirol ausgehend hat sich auch so etwas wie ein neuer Osttiroler Stil breitgemacht, der heute fast nur noch in Oberlienz erhalten geblieben ist. „Der Betrachter schaut nicht mehr durch die Augen der Larve, sondern durch die Nasenlöcher. Dadurch werden die Masken größer und wirken imposanter“, erklärt Karl C. Berger. Lercher fand viele Nachahmer. „Bis man einen eigenen Stil entwickelt, dauert es sehr lange“, sagt er.

Den wilden Mann spielen.
Immer wieder geriet der Krampuslauf in Verruf, wenn der Brauch als Vorwand dazu diente, über die Stränge zu schlagen. Verletzungen sind beim wilden Treiben nicht völlig auszuschließen. Doch das Kräftemessen zwischen Krampussen und Zuschauern bleibt üblicherweise freiwillig. „Jedes Mal, wenn ich einen Krampus- oder Klaubaufbrauch sehe, ist das etwas Faszinierendes“, meint Volkskundler Berger. Die Bräuche seien regional unterschiedlich, aber doch miteinander verbunden. „Es gibt diese lokalen Ausprägungen – und zugleich ein europäisches Moment. Ähnliche Bräuche findet man auch in anderen europäischen Ländern.“ In Oberlienz brennt man jedenfalls dafür, den Krampuslauf weiter zu pflegen und das Be-
währte sorgsam zu bewahren. Ein nicht ganz neutraler Beobachter spricht sich sogar dafür aus, den Status als immaterielles Weltkulturerbe zu beantragen. Noch ist das Wunschdenken. „Dieser Brauch ist über viele Jahre gewachsen, und man kann ihn nicht einfach abstellen, da bin ich mir absolut sicher“, ist Friedl Lercher überzeugt. Und so wird auch heuer – wie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten – in Oberlienz wieder die Spannung steigen, wenn sich der November dem Ende zuneigt.
Die Fiebertage stehen vor der Tür, und am 3., 4. und 5. Dezember sind sie wieder unterwegs – die wilden Kerle mit ihrem Geläut und beeindruckenden Larven. Sie bringen Furcht und Freude, wenn sie die Dunkelheit zum Klingen bringen.
Marian_Kröll

Schon als Jugendlicher begann Bert Steiner, Krampuslarven zu schnitzen. Der Schnitzer und Tätowierer interpretiert den traditionellen Oberlienzer Stil auf seine Weise – mit Respekt vor dem Überlieferten und Gespür für das Eigene. Entscheidend ist für ihn, dass am Ende ein stimmiges Gesamtbild entsteht.


Bert Steiner hält eine E-Gitarre in der Hand. Immer wieder nähert und entfernt er sich von seinem Gitarrenverstärker, um jenen eigentümlichen Feedbackeffekt zu simulieren, den Guns-N’Roses-Saitenvirtuose Slash im Solo von „Estranged“ so effektiv eingesetzt hat. Der Song läuft leise im Hintergrund. Estranged bedeutet so viel wie entfremdet. Dabei ist Bert Steiner einer, der angekommen ist. Wenn er in seiner Werkstatt an einer Krampuslarve arbeitet, ist er ganz bei sich.
Schnitzen als Kreation und Interpretation.
In seiner Werkstatt hängen Krampuslarven neben selbstgemalten Bildern in verschiedenen Maltechniken und Erinnerungsstücken aus Neuseeland, Australien und den USA. Alles fügt sich dort ganz selbstverständlich zusammen. Es braucht viel handwerkliches Geschick und Durchhaltevermögen, um eine Krampuslarve im Oberlienzer Stil entstehen zu lassen. So manchen Kniff hat
Steiner von Friedl Lercher, einem der prägendsten Schnitzer der Umgebung, gezeigt bekommen. Bei Besuchen sieht er Lercher beim Schnitzen und Malen über die Schulter und saugt dabei alles auf, was er lernen kann. Kein Wunder also, dass Friedl Lercher bis heute Bert Steiners maßgeblicher Einfluss ist. „Immer, wenn ich bei ihm in den Keller gegangen bin, ist mein Puls gestiegen, weil man nie wissen konnte, was dort gerade Neues zu sehen war. Mich hat seine Kunstfertigkeit tief und nachhaltig beeindruckt.“ Im Gegensatz zum Tätowieren, das in einem genau getakteten Prozess abläuft, muss sich Steiner bei der Arbeit am Holz nach niemand anderem richten. Tätowieren ist notwendigerweise eine sterile Arbeit, beim Schnitzen wird es schon einmal laut, es fliegen die Späne und ein betörender Zirbenduft liegt in der Luft.
Wie vielen anderen im Dorf liegt auch Bert Steiner dieses Brauchtum im Blut. Er stammt aus einer Familie, in der der Krampuslauf seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert hat. Schon der Groß-
vater, Vater und seine Onkel waren eng mit der Entwicklung des Krampuslaufs im Dorf verbunden. Als Kind verband Steiner eine gewisse Angstlust mit dem Krampuslauf. „Wir hatten zwar Angst vor dem Krampus, wollten aber doch selbst mitlaufen“, beschreibt er die Gemütslage. 1993, mit zehn Jahren, lief Steiner das erste Mal bei den kleinen Krampussen in Oberlienz mit. Heutzutage sind die Kinder um einiges jünger, wenn sie mit Larve, Fell und Glockengeläut um die Häuser ziehen.
Papier, Holz und wildes Zeug.
„Nach den ersten Schnitzversuchen als Kind hat mir mein Vater irgendwann einen großen, zusammengeleimten Zirbenholzklotz und einen Satz Schnitzeisen besorgt“, erinnert er sich. Eine Werkstatt war bereits vorhanden, für die notwendige Ausstattung sorgte der Vater. Talent war auch reichlich vorhanden. Begonnen hat die Schnitzerkarriere Steiners aber früher, gewissermaßen bereits am Papier. Das Zeichnen ging dem Schnitzen voraus.
Schon im Kindergartenalter ist Steiner durch sein Zeichentalent aufgefallen. Auch heute noch entwirft er seine Larven zunächst am Papier oder fertigt Modelle aus Ton, Plastilin oder anderer Modelliermasse, ehe er die wilden Gesichter aus dem Zirbenklotz, in dem sie sich verbergen, geschickt herausarbeitet. Als Inspiration dienen – so wie schon früher beim Zeichnen – nicht selten Filme und die Musikindustrie mit ihren eindrucksvollen Plattencovers. So manche Larve ist „Eddie“, dem ebenso furchterregenden wie kultigen Maskottchen der britischen Band Iron Maiden, nachempfunden. Bereits die Vorgänger der heutigen Schnitzer haben sich bei Hollywood bedient. Als in den 1930ern das Kino aufgekommen ist, gab es auf einmal Larven, die an King Kong erinnerten. Urheber derselben waren die Matreier Schnitzer Tobias Trost und Burkhard
Köfler. Sie haben damit ein eigenes Genre begründet. „Das Übersteigerte, Überzogene dieser Larven geht auf diese Zeit zurück. Die Schnitzer haben weniger den Anspruch gehabt, anatomisch korrekt zu sein, die Larven sind in ihren Elementen – Augen, Nase, Mundpartie – bewusst übertrieben, um ihre Ausdruckskraft zu steigern“, erklärt Steiner. „Das könnte man sogar als karikaturhaft bezeichnen.“ Gemein sind den meisten Larven ihr hämisches Grinsen, ihre ausdrucksstarken, wilden Augen, die „lefzenden“ Lippen und der Umstand, dass man durch die Nasenlöcher nach draußen schaut. Diesen Stil hat Friedl Lercher aus Matrei mitgenommen und über Jahrzehnte hinweg in Oberlienz weiterentwickelt und verfeinert.
Die Larven sind im Laufe der Zeit dabei tendenziell etwas kleiner geworden. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass schwere und riesengroße Larven sich nicht gut zum „Tischziehen“ und Krampuslauf eignen. Die Nase ist heute kleiner und kompakter, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. „Es ist außerdem wichtig, dass der Träger genug Luft bekommt“, meint Steiner. Besonders bei Kindern hinterlassen die wilden Gesichter der Larven Eindruck. Das weiß der Larvenschnitzer aus eigener Erfahrung. Er erinnert sich, wie er sich als Kind davor gefürchtet hat, an einer Hexe vorbeizugehen, die in einem Stiegenhaus gehangen hat. „Diese Hexe hatte so einen irren Blick“, denkt er mit Schaudern zurück.
Die Suche nach dem Flow.
Bert Steiners erste Larve ist 1998 entstanden. Sie war eine Koproduktion
mit seinem Mentor Friedl Lercher, von dem er nicht nur beim Schnitzen, sondern auch beim Malen viel lernt. „Er hat eine ganz eigene Maltechnik. Ich mache das heute noch genau so, wie ich es vor über 25 Jahren bei ihm gesehen habe.“ Malen ist einer der befriedigendsten Arbeitsschritte im ganzen Prozess. „Malen heißt, der Larve Leben einzuhauchen.“ Es ist der Moment, in dem das Werk zu sprechen beginnt. Beim Malen muss man genau sein und eine ruhige Hand haben. Der Künstler gerät dabei in einen Flow-Zustand, wie man ihn aus dem Sport und der Musik kennt. Alles andere tritt in den Hintergrund und wird unwichtig. „Ich denke nur an diese eine Sache und bin dabei völlig im Moment“, sagt Steiner. „Wahrscheinlich habe ich auch deshalb schon als Kind so viel gezeichnet, mich dabei in meine eigene Fantasiewelt begeben und viele
Stunden dort verbracht.“ Kunst hat in der Menschheitsgeschichte schon immer auch dem Eskapismus gedient. Bert Steiner zeichnete schon als Kind wilde Tiere und Gesichter, Piraten – und natürlich auch Krampusse. Als Bub hatte er in seinem Zimmer eine Graffitiwand über dem Stockbett mit allerlei finsteren Zeichnungen. „Das war alles eher wildes Zeug“, meint er rückblickend.
Wie früher, nur besser.
„Schnitze ich im Oberlienzer Stil, mache ich im Prinzip dasselbe wie mit 15, nur heute um einiges besser“, sagt er. Dabei verfolgt Steiner immer den Anspruch, seinen Einflüssen qualitativ gerecht zu werden. „Friedl Lercher hat die Latte ziemlich hoch gelegt.“ Dessen Schnitzstil weiterzuverfolgen, ist ihm eine Her-

zensangelegenheit. Der Künstler lässt sich aber auch gerne von den vielen verschiedenen Schnitzstilen Osttirols und der umliegenden Bundesländer inspirieren. „Wenn ich eine Larve mit Bart schnitze, wird schon einmal ein Wikinger daraus. Manchmal schnitze ich auch ein menschlicheres Gesicht und arbeite näher an der anatomischen Realität“, erzählt er. Alles hat seinen Platz. Diese Experimentierfreude manifestiert sich in neuen Kreationen abseits des Althergebrachten. „Andere erkennen darin einen eigenen Stil, eine künstlerische Handschrift“, sagt er. Seinen eigenen Stil will er aber nicht definieren. Das sollen andere tun.
Die Ästhetik des Wilden.
Steiner legt Wert darauf, dass seine Krampuslarven in sich stimmig sind und ein gewisser „Schwung“ drinnen ist. „Ich mag es, wenn eine Larve schön geschnitten ist“, sagt er. „Nicht übertrieben geschmirgelt, die Spuren der Werkzeuge dürfen sichtbar bleiben.“ Eine Larve zu schnitzen erfordert
„WIR HATTEN ZWAR ANGST VOR DEM KRAMPUS, WOLLTEN ABER DOCH SELBST MITLAUFEN.“
Bert Steiner
viel Geduld und Zeit, bis alle Schnitte schließlich so sitzen, wie sie sein sollen. Der Betrachter sieht lediglich die finalen Schnitte. Larven können heutzutage auch mittels maschineller Hilfe – Kettensäge, Fräsen, Schleifmaschinen – gefertigt werden. Steiner setzt sie bewusst sparsam ein. Der Hände Arbeit und die Spuren der Schnitzeisen sollen präsent bleiben. „Ich mag dieses Gefühl, wenn das scharfe Eisen seine Spuren im Holz hinterlässt, sich dort vergräbt“, sagt er.
Das Schnitzen ist einerseits ein bewusster Prozess, andererseits gibt es auch ein Überraschungsmoment, in dem sich der Schnitzer intuitiv leiten lässt. Ein Beispiel: „Die Larve sucht sich ihr Fell selbst aus“, erklärt Steiner. Nicht

weil sie einen eigenen Willen hätte, sondern weil Larve und Fell miteinander einen harmonischen Gesamtcharakter bekommen. So wie nicht jedem Menschen die gleiche Frisur steht, gilt das auch für die geschnitzten Gesichter. „Das Gesamtbild muss harmonisch sein.“ Besonderes Augenmerk legt Steiner auf die Augen. Sie sind nicht nur beim Menschen das Spiegelbild der Seele, sondern geben auch jeder Larve das gewisse Etwas, das den Betrachter in ihren Bann zieht.
Im Flow zwischen Haut und Holz.
Die Zwangspause in der Pandemie hat Steiner dazu genutzt, zu sich selbst und in die Heimat zurückzufinden, nachdem er jahrelang in Graz gelebt und als Tätowierer gearbeitet hatte. Heute teilt er seine Arbeitszeit zwischen Tätowieren und Schnitzen. Unlängst absolvierte er einen intensiven Bildhauerlehrgang in Hallein. Nun will er sich verstärkt dem Skulpturalen widmen und sich auch an anderen Materialien versuchen, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Die Krampuslarven waren immer ein Fixstern in seinem Schaffen – und so etwas wie ein vertrauter Anker, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Zugleich sucht Steiner nach neuen Wegen, seinen Ausdruck zu erweitern. Langeweile kommt dabei garantiert nicht auf. Manchmal greift er zwischendurch wieder zur Gitarre. Dann erklingt wieder „Estranged“, und jener Flow, den man in seinen Larven sieht, wird auch hörbar. Bert Steiners Kunst geht unter die Haut. Marian_Kröll
English Summary
In Oberlienz, a small village in East Tyrol, the first frost marks the beginning of a very special season: Krampus time.

From the wild figures who once roamed as Perchten during the mystical Rauhnächte – the rough nights between Christmas and Epiphany – emerged the fearsome companions who now take centre stage each year as Krampusse on 5 December, turning night into day. In Oberlienz, as Krampus Day draws near, something lingers in the air – a heady blend of reverence, excitement and pure adrenaline. The result is a spectacle that thrills especially those who seek intense, sensory experiences.
As soon as the leaves begin to fall, one can hear the faint scratching of carving tools in garages and workshops. From unremarkable blocks of wood, skilled hands bring forth intricate, fearsome masks that soon become part of one of the most electrifying traditions of the year. The air hums with anticipation, filled with awe and a spark of thrill. For the children and young people, only one date matters: 5 December. That’s when the Krampusse march through the village, weighed down with furs and heavy bells that thunder with every step. What seems chaotic is, in truth, a ritualised performance. And when the wild roars tear through the quiet Advent night, everyone knows: the moment has come.
The custom itself reaches far back in time, blending ancient pagan winter rites with the Christian
tradition of Saint Nicholas. Today, Oberlienz cherishes its roots with pride and intention. Much may have become wilder, but the essence remains the same: a game of fear and joy, courage and enchantment.
Between Tradition and Personal Touch.
One of the men who carves masks for the Krampusse of the region is Bert Steiner. A sculptor and tattoo artist, he interprets the traditional Oberlienz style in his own way – with deep respect for heritage and an instinct for individuality. What matters most to him is that each creation feels coherent and alive. A distinctive feature of the Oberlienz style is that the wearer looks out through the mask’s nose. This approach was introduced by Friedl Lercher from Matrei, who developed and refined it in Oberlienz over several decades.
Bert Steiner carved his first mask in 1998, a collaboration with his mentor Lercher, from whom he learned not only carving but also painting techniques. “He has a very unique way of painting,” Steiner recalls. “I still do it exactly the way I saw him do it more than 25 years ago.” Painting, he says, is one of the most satisfying steps in the whole process: “Painting means breathing life into the mask.” It is the moment when the work begins to speak.
Seit etwas mehr als einem Jahr trägt Gabriele Neumann den ein klein wenig seltsam anmutenden Titel einer Landeskonservatorin. Damit ist sie letztverantwortlich für rund 5.000 denkmalgeschützte Gebäude in Tirol. Im Interview spricht sie über neue Kirchen, die ziemlich alt aussehen, über Freud und Leid der Besitzer von Häusern unter Denkmalschutz und warum alte Mauern für den Tourismus wichtig sind.
Wenn man heute durch Tiroler Orte geht, scheint es kaum mehr eine architektonische Identität zu geben, sondern eher beliebige Austauschbarkeit. Wann hat dieser Verlust begonnen und wo kommt er her? Gabriele Neumann: Der Verlust unserer historischen Ortskerne ist ein Phänomen, das auch mit einem gewissen Wohlstand zu tun hat: Einerseits die Notwendigkeit der Nachverdichtung, aber auch der Wunsch nach Wandel, Wachstum und Modernität, oft ausgedrückt durch moderne Materialien, die nicht in historische Zentren passen. Nicht nur wir, die wir für einen gewissen Ausschnitt von historischen Objekten, nämlich nur rund 1,5 Prozent der Bausubstanz in Österreich zuständig sind, kämpfen darum, dass das, was wir noch an historischen, stimmigen Ortskernen haben, mit in die Zukunft genommen wird. Mit an unserer Seite stehen auch einige Abteilungen des Amtes der Tiroler Lan-
Gabriele Neumann studierte an der Universität Innsbruck Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften, bevor sie 1994 in den Dienst des Bundesdenkmalamtes trat. Während ihrer mehr als 30-jährigen Tätigkeit im Landeskonservatorat für Tirol war sie mit verschiedensten Themenbereichen befasst. Seit 1. Oktober 2024 ist die gebürtige Innsbruckerin neue Landeskonservatorin.
desregierung wie die Kulturabteilung, die Dorferneuerung oder der Ortsbildschutz. Einerseits geht es um die Erhaltung unseres baukulturellen Erbes, andererseits um Qualität, wenn Neues in diese Ortskerne hineinkommt. Nur so wird es gelingen, die Identität unserer Ortschaften weiter in die Zukunft zu tragen.
Man hat das Gefühl, andere Länder machen das besser oder jedenfalls anders. Etwa in Südtirol scheint noch viel intakte Substanz vorhanden zu sein. Woran liegt das? Das ist in Süd- und auch in Osttirol der Fall, dass man noch mehr Bewusstsein für regional tradierte Bauweisen, historische Materialien und gute handwerkliche Lösungen hat. Man schaut darauf, dass sich neuere Objekte gut einfügen. In Nordtirol hat man in manchen Regionen das Gefühl, dass jeder nur sein Ding sieht. Das zeigt sich oft schon in der Darstel-

„WER DENKMÄLER BESEITIGT, LÖSCHT
Spruch im Büro der Landeskonservatorin
lung von Einreichungen, wo immer nur das einzelne Objekt dargestellt ist und zur Beurteilung herangezogen wird. Viel zu selten gibt es ein Umgebungsmodell. Dabei geht es doch um das Einfügen in eine größere Gesamtheit: Wie sind die Ausrichtungen der umliegenden Gebäude, was sind die Proportionen, regionaltypische Dachformen, traditionelle Materialien? Das Ausreizen individueller Möglichkeiten erscheint bei uns – mit Ausnahme der wenigen Ortsbildschutzzonen oder von der Abteilung Dorferneuerung begleiteten Projekten – oft wichtiger als das Gesamterscheinungsbild eines Ortes zu sein.
Gäste kommen zu uns zum Skifahren und zum Wandern, doch sie wollen auch Baukultur sehen. Sollte nicht gerade in einem Tou -
rismusland wie Tirol diesbezüglich einfach mehr geschehen? Es gibt Untersuchungen zur Relevanz von denkmalgeschützten Objekten, gerade für den Tourismus und die Akzeptanz einer Region. Da sind es oft die Gäste, die uns die Augen öffnen, was wir an malerischen Ecken, schönen, noch intakten Höfen, tollen Almen oder auch einfachen Wirtschaftsgebäuden in unserer Kulturlandschaft haben. Es wäre natürlich gut, wenn auch der Tourismus seinen Beitrag finanzieller Art leisten würde. Wir haben aktuell knapp 5.000 denkmalgeschützte Objekte in Tirol, in der Bandbreite von Pfarrkirchen über öffentliche Bauten, Altstadthäuser und Wohnhäuser bis hin zu Mühlen, Brücken und auch manchen Wegkreuzen. Die Eigentümer und Eigentümerinnen dieser Objekte tragen die Hauptlast, um unser aller baukulturelles Erbe zu

erhalten. Die schönen Bilder für den Tourismus, die gibt es jedoch nur, wenn man gepflegte und nicht vor sich hin verfallende Objekte präsentieren kann. Daher wäre es wünschenswert, wenn eine noch bessere Zusammenarbeit bestünde. Wir sind inzwischen auf einem guten Weg, weil die Tirol Werbung im Moment genau diesen Punkt herausarbeitet, nämlich wie wichtig die Kultur – die Baukultur – für den Tourismus ist.
Die Unterschutzstellung ist die eine Sache, die Erhaltung und vor allen Dingen die sinnvolle Nutzung von Objekten eine ganz andere. Ist das nicht die grösste Herausforderung? Mit der rechtlichen Unterschutzstellung ist erst ein geringer Teil der Arbeit getan. Die eigentliche setzt erst danach an. Wie können wir die Erhaltung schaffen? Und die geht in der Regel mit einer sinnvollen Nutzung einher, die dem Objekt gerecht wird, die adäquat und nicht überschießend ist. Überschießend in dem Sinn, dass man so viel verändern müsste, dass es nicht mehr das ist, was man eigentlich schützen wollte. Und ja, wir
In der Hofgasse 5 in Innsbruck fanden sich bei der Restaurierung und Umwandlung in ein Boutique-Hotel wertvolle Wandmalereien.
haben natürlich auch einige Sorgenfälle, die vor sich hin verfallen und wo wir versuchen müssen, diese Objekte notdürftig zu sichern und zu überlegen, was man damit anfangen könnte. Wir brauchen die Eigentümer und Eigentümerinnen, die investieren, immer als Partner, auch wenn es Förderungen gibt, vom Bundesdenkmalamt sowie von anderen Landesstellen, die Maßnahmen an baukulturellem Erbe ebenfalls unterstützen.
Es gibt Menschen, die Angst davor haben, ein denkmalgeschütztes Objekt zu erben oder dass ihr Besitz unter Denkmalschutz gestellt wird. Ist die Angst begründet? Aus unserer Sicht natürlich nicht und wir versuchen auch immer, diese Ängste durch Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlungstätigkeit oder dem Tag des Denkmals abzubauen. Wenn Leute mit uns in Kontakt treten oder wir gerade in einem Unterschutzstellungsverfahren sind, versuchen wir, über Best-Practice-Beispiele Perspektiven zu zeigen und Denkmaleigentümer untereinander in Kontakt zu bringen, damit sie sich aus unserer Sicht gelungene ähnliche Beispiele anschauen können. So etwas hat bisher gut gewirkt, gerade auch wenn es um die Revitalisierung von Bauernhöfen geht. Vor einigen Jahren haben wir uns dem Schwerpunktthema „Weiterbauen am Land“ gewidmet und gemeinsam mit einigen Landesabteilungen und der Universität Beispiele in einer Ausstellung und in einem Katalog gezeigt. Für den einen oder anderen Hof, wo es über Jahrzehnte praktisch Leerstand und Verfall gab, haben sich dann doch noch erfreuliche Perspektiven ergeben – zum Beispiel beim Heissangererhof und beim Ornthof in Tulfes, oder auch in Mieming Fronhausen und in Untermieming, wo die Eigentümer ihre historischen Bauernhäuser generalsaniert haben und nun bewohnen. Eine zunehmend attraktive Nutzung für historische Gebäude sind Boutiquehotels

„DAS
Gabriele Neumann
in touristischen Zentren: Angefangen hat das Kontor in Hall, das Boutiquehotel Rattenberg und das Weiße Kreuz oder Hofgasse 5 in Innsbruck sind gefolgt. Die haben genau aus dieser Individualität und Unverwechselbarkeit des einzelnen Objektes das Maximale herausgeholt, so dass sie gänzlich unterschiedliche Zimmersituationen haben. Auswechselbare Hotelzimmer, die überall gleich ausschauen, das ist etwas, wenn man dringend eine Unterkunft braucht, doch wenn man ein Aufenthaltserlebnis haben will, ist man in solchen Objekten gut aufgehoben. Das findet zunehmend Anklang. Diese Wertschätzung der Gäste ist Anreiz für andere, das auch zu probieren. Dafür haben wir inzwischen auch am Land Beispiele wie den Buchhammerhof im Kaunertal, der 2024 den Österreichi-
schen Bauherrenpreis gewonnen hat. Und vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem Eigentümerinnen und Eigentümer erkennen, dass – wenn die Nachfrage der Gäste vorhanden ist – es auch für den Eigenbedarf oder zur dauerhaften Vermietung attraktiv wird, solche Objekte zu revitalisieren.
Wie kann den Besitzerinnen und Besitzern solcher denkmalgeschützten Gebäude zur Seite gestanden werden? Wir versuchen vor allem, sie gut zu beraten. Wir haben Erfahrungen von vielen vergleichbaren Objekten, die wir einfließen lassen können. Wir schauen, dass wir die Grundlagen sehr gut erheben: Eine gute Vermessung, eine intensive Untersuchung des Objektes wie in einer Bauforschung gehören zum Ausgangspunkt jeder Be-
„IN
Gabriele Neumann

Das Rimml-Areal in Oberhofen gilt als ein Beispiel für eine gelungene Revitalisierung und behutsame Modernisierung alter Bausubstanz.

arbeitung. Weiters, indem man den Bauherren und Bauherrinnen Vergleichsbeispiele von Architekten und Architektinnen zeigt, die viel Erfahrung mit historischen Objekten haben. Wenn eine erfahrene Projektgruppe zusammenarbeitet, stellt sich meistens nicht mehr die Frage, ob man aus dem Objekt etwas Tolles entwickeln kann, sondern es geht eigentlich nur mehr um das Wie. Andererseits gehört auch die Förderung dazu. Der Denkmalschutz ist dabei immer eher die kleine Gießkanne. Wir haben ungefähr 1,1 Millionen Euro in Tirol im Jahr für alle geschützten Objekte zur Verfügung. Der wichtige Punkt ist, dass wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Landes Tirol haben, die ihren Förderbeitrag leistet, wo immer es geht, ebenso wie die Landesinstitutionen wie Dorferneuerung oder der Ortsbildschutz. Und in Tirol darf man für öffentliche und kirchliche Bauten auch nicht vergessen, dass die Landesgedächtnisstiftung meistens einen sehr wesentlichen Beitrag für größere Restaurierungs- und Renovierungsmaßnahmen leistet. Das gibt es sonst in keinem Bundesland.
Wie viele Objekte gibt es aktuell, bei denen dringender Handlungsbedarf bestünde? Gerade was die Sakralbauten angeht, gibt es in Tirol bisher keine Diskussionen. Wir haben keine gefährdeten Kirchen, Kapellen oder Pfarrhäuser. Außer bei einigen modernen Kirchen, wo ein Sanierungsstau entstanden ist und wir uns zusätzlichen oder anderen Nutzungen stellen
müssen, wie bei der 1968 bis 1972 nach Plänen von Architekt Horst Parson errichteten Pfarrkirche Petrus Canisius in Innsbruck, die für eine Mitnutzung als Boulderhalle adaptiert werden soll.
Wo liegen also die Problemzonen?
Vielmehr ist es das bäuerliche baukulturelle Erbe am Land, das uns Sorgen bereitet. Wenn das Objekt oft keine Nutzung mehr hat, Wassereintritte durch Löcher im Dach länger unbemerkt bleiben, sodass ein immer größerer Instandsetzungsaufwand entsteht. Wir führen eine Liste der besonders gefährdeten Denkmale, die wir an die Zentrale in Wien melden, um in Richtung Erhaltungspflicht oder Sicherungsmaßnahmen etwas zu unternehmen. Auch da unterstützen wir die Eigentümer und Eigentümerinnen, dass sie dringende Erhaltungsmaßnahmen umsetzen. Wir können leider nicht alle Rettungsaktionen gleichzeitig angehen. Mit unseren bescheidenen budgetären Mitteln ist nicht allzu viel möglich. Aber wir haben uns dennoch die Aufgabe gesetzt, pro Jahr drei bis fünf Objekte zu sichern.
Was wäre in Ihrer Wunschvorstellung ein realistischer Idealzustand in der Denkmalpflege? Das baukulturelle Erbe ist keine Ressource, die beliebig verfügbar ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir oft vorschnell Unersetzbares verlieren, und wir müssen damit genauso sorgsam umgehen wie mit unserer Ressource Natur. Es ist erstaunlich, wie viele Hinweise, Anfragen, ja Aufforderungen wir aus der Bevölkerung bekommen: Kümmert euch darum! Das ist mir wichtig! Da geht was verloren! Wieso tut ihr da nichts? Das Bewusstsein für die eigene gebaute Umgebung wäre oft schon noch vorhanden. Da wäre es wünschenswert, wenn bereits auf lokaler Ebene eine Kultur des bewussten Umgangs mit unserer gebauten Umgebung, mit unserer Kulturlandschaft insgesamt verankert wäre.
Uwe_Schwinghammer

27. Dez bis 06. Jän
25|26

Weihnachtsoratorium
Applaus für die Gebrüder Strauss Lucia di Lammermoor
La sonnambula
Silvesterkonzert
Neujahrskonzert
Geistervariationen
Lesung mit Musik Abschlusskonzert

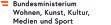



When Gabriele Neumann speaks about Tyrol, it sounds like a love letter to walls, beams and plaster. Since 2024, she has been the region’s chief conservator –guardian of some 5,000 listed buildings, from rustic farmhouses to grand parish churches. Her view of Tyrol’s villages is one of both admiration and concern. “The loss of our historic village centres has much to do with prosperity and the desire for modernity,” she explains.
English Summary
In South and East Tyrol, traditional building methods and craftsmanship are still part of everyday life, while in parts of North Tyrol the region’s architectural identity is changing. “Too often, people see only the individual building and not the whole picture,” says Neumann. Yet it is precisely the balance between old and new that gives a place its unmistakable character –and draws visitors in. For those who come to ski or hike are looking for more than just beautiful landscapes; they seek atmosphere, history and authenticity. Well-kept farmhouses, old mills and dignified churches shape the image of Tyrol that travellers carry home in their hearts. “Tourism benefits enormously from this rich architectural heritage,” Neumann points out, adding that she hopes it will also invest more in its preservation.
More and more property owners are discovering the opportunities it brings: historic houses are being turned into boutique hotels or lovingly restored homes. These buildings tell stories no modern construction could ever replace. Yet the road to revitalisation demands patience, expert guidance and passion – qualities that Neumann and her team bring to their work each day. A motto in her office reads: “Those who destroy monuments erase memories; those who preserve them earn the right to create anew.” For Neumann, this is more than a slogan – it is a conviction. Old buildings, she says, are more than just walls; they are keepers of identity, community and humanity.
And perhaps, she adds, a time will come when owners once again recognise the potential of their historic homes. When guests appreciate the charm of the old, it becomes worthwhile for them, too, to breathe new life into these walls. For every restored house is a piece of living history – and a promise that Tyrol’s soul will remain firmly anchored in stone for generations to come.

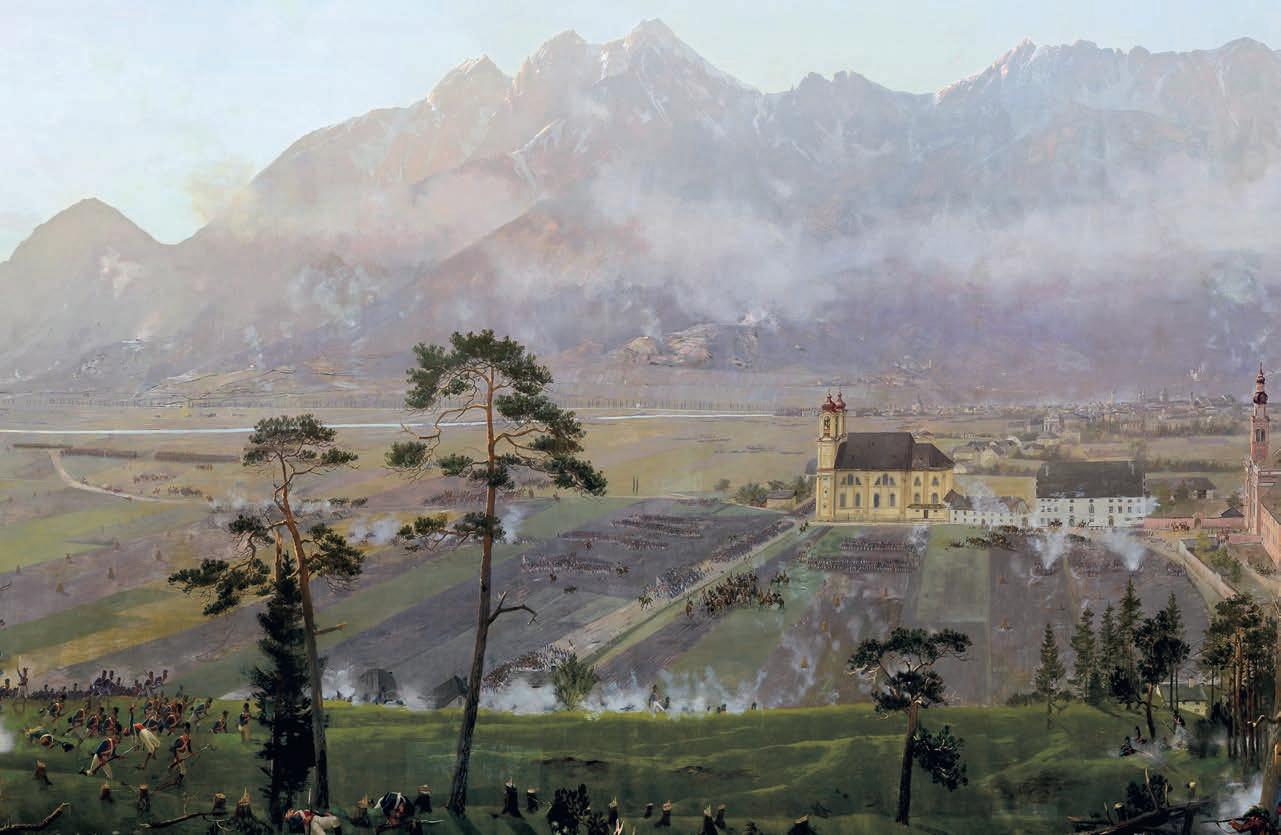




Wer glaubt, Hören sei einfach nur eine alltägliche Sinneswahrnehmung, wird im AUDIOVERSUM eines Besseren belehrt. Das Science Center im Herzen von Innsbruck widmet sich ganz dem Thema Akustik –und zwar auf faszinierende, interaktive Weise.
In der europaweit einzigartigen Erlebnisausstellung stehen nicht nur Informationen, sondern das aktive Erleben im Mittelpunkt. Besucher*innen können virtuell durch ein Ohr surfen oder überdimensionale Haar-Sinneszellen ertasten. Auch eine Virtual-Reality-Achterbahnfahrt, die mit dem Thema Hören verknüpft ist, gehört zu den Höhepunkten der Ausstellung. Anfassen, Mitmachen und Staunen sind ausdrücklich erwünscht.
Herzstück des Science Centers ist die Dauerausstellung „Abenteuer Hören“. Hier wird deutlich: Hören ist weit mehr als das Wahrnehmen von Geräuschen – es ist ein komplexer Sinn, der oft unterschätzt wird. Auf anschauliche Weise vermittelt die Ausstellung wissenschaftliche Hintergründe, macht Zusammenhänge begreifbar und sensibilisiert für das Thema Hörgesundheit. Ergänzt wird das Angebot durch wechselnde Sonderausstellungen, die aktuelle Themen aufgreifen und das interaktive Konzept weiterführen.
Brain Gym AI
Aktuell laden gleich zwei Sonderausstellungen zum Entdecken ein: In der neuen Ausstellung „BRAIN GYM AI“
erwartet Besucher*innen jeden Alters ein interaktives Gehirntraining. An vielseitigen Stationen können Konzentration, Reaktionsfähigkeit und logisches Denken spielerisch getestet und verbessert werden. Die Ergebnisse werden auf einer digitalen Karte gespeichert, sodass der persönliche Fortschritt jederzeit nachvollziehbar ist. Geistige Fitness wird hier zum Erlebnis für Jung und Alt. Ergänzend geben Leihgaben der MedUni Innsbruck faszinierende Einblicke ins Gehirn.
Um alles in der Welt
Die Ausstellung „UM ALLES IN DER WELT“ hingegen lädt dazu ein, die globalen Verflechtungen unseres täglichen Lebens zu entdecken und über die Auswirkungen des eigenen Handelns nachzudenken. Besonderes Augenmerk liegt auch dieses Mal wieder auf Interaktivität. Neugierig geworden?
AUDIOVERSUM Science Center
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck +43(0)5 7788 99, www.audioversum.at Öffnungszeiten: Di. bis So. von 10 bis 18 Uhr

Alpen-Gletscher-Hannibal. Mit dieser Assoziation begann vor 25 Jahren die Erfolgsgeschichte einer Inszenierung auf dem Rettenbachferner im Ötztal, die es so kein zweites Mal gibt: Die moderne Nachempfindung der Alpenüberquerung durch den Feldherrn Hannibal mit seinen Soldaten und Kriegselefanten vor über 2.000 Jahren.

Die Inszenierung von Hannibal sieht auf den ersten Blick wie ein Megaspektakel aus, auf den zweiten geht sie laut Regisseur Hubert Lepka in die Tiefe.

„DER RETTENBACHFERNER IST DIE SCHÖNSTE, EINZIGARTIGE BÜHNE. SO ETWAS WIE HANNIBAL KÖNNTE MAN IN KEINER ARENA DER WELT AUFFÜHREN.“
Jakob Falkner
Im Spätherbst 218 vor Christus überlistete der karthagische Feldherr Hannibal zu Beginn des Zweiten Punischen Krieges den römischen Gegner. Er zog nämlich nicht der Küste entlang vom heutigen Frankreich nach Italien, sondern umging die Römer, indem er nördlich von ihnen die Alpen überquerte. Sagenhafte 50.000 Fußsoldaten, 9.000 Reiter und sogar 37 Kriegselefanten marschierten in einem endlosen Zug über die Cottischen Alpen. Zwar hatten die Karthager große Schwierigkeiten zu überwinden, sie schafften jedoch den Übergang und überraschten den Feind in seinen Winterquartieren.
Doch was hat diese Geschichte aus grauer Vorzeit mit Sölden zu tun? Seit 25 Jahren wird diese historische Leistung Hannibals am Rettenbachferner in einer modernen, spektakulären Inszenierung nachgestellt. Dass es dazu kam, war einer Begegnung auf dem
Termin: Freitag, 10. April 2026, 19.30 bis 21 Uhr
Ticketpreise: 32 bis 100 Euro. Im Eintrittspreis ist der Shuttlebus von Sölden zum Gletscher und retour enthalten. Für genaue Ticketinfos scannen Sie bitte den QR-Code.
Tipps: Auffahrten sind auch mit dem eigenen Auto über die geräumte Gletscher-PanoramaStraße möglich. Es wird empfohlen, warme Kleidung und festes, warmes Schuhwerk zu tragen. Der Zuschauerraum liegt auf 2.670 Metern.
Parkplatz des Rettenbachferners im August 2000 geschuldet. Der Gestalter und Choreograph Hubert Lepka und der Sölder Tausendsassa Ernst Lorenzi trafen dort auf Wunsch von Seilbahnbetreiber Jakob Falkner zusammen, um über ein neues Projekt, eine Aufführung, eine Show zu sprechen. Was es werden sollte, wussten beide noch nicht so recht, im Hinterkopf hatten sie nur, dass der Gletscher eine gute Kulisse sein würde. Die beiden erblickten zwei abgestellte Pistenbullys und Lorenzi sagte: „Die schauen aus wie Stiere.“ Und Lepka antwortete: „Nein, eher wie Elefanten.“ Vielleicht war es auch umgekehrt. Darüber scheiden sich die Geister. Jedenfalls war für Lepka in dieser Sekunde die Entscheidung gefallen: „Alpen-Gletscher-Hannibal.“ Es sollte eine Inszenierung von dessen Alpenüberquerung werden und die Pistengeräte mussten dabei eine gewichtige Rolle spielen. Ebenfalls gleich klar war für Lepka, dass es kein histo-

risches Reenactment, kein „Kostümschinken“ werden würde. Besonders fasziniert war der Autor dabei vom Ort des Geschehens: Einerseits Natur, gleichzeitig hochtechnische Erschließung. Lepka wollte diese Ambivalenz in vielerlei Hinsicht darstellen: „So eine Alpenüberquerung hat ja immer den Aspekt der Überwältigung der Natur, umgekehrt aber auch von der Überwältigung des Menschen durch die Natur.“ Dieses Mythische an der Geschichte des Hannibal wollte Lepka herausarbeiten.
Jetzt spinnen sie!
Jeder Plan ist bekanntlich nur so gut, wie die Geldbörse es zulässt. Daher mussten von Jakob Falkner, Chef der Söldener Bergbahnen, Red Bull und der Tourismusverband mit ins Boot geholt werden. Falkner erinnert sich: „Wir haben entschieden, dass Hubert Lepka
ERNST LORENZI
HAT SEIT ANBEGINN
DIE AUFGABE, ALLE LEUTE FÜR DIE AUFFÜHRUNG ZU KOORDINIEREN.
uns ein Konzept machen soll. Das kostete Geld, das wir bereit waren, vorab zu investieren.“ Danach konnte Lepka loslegen und präsentierte seinen Plan von Hannibals Alpenüberquerung. Als ruchbar wurde, was am Rettenbachferner über die Bühne aus Schnee und Eis gehen sollte, waren durchaus nicht alle im Tal begeistert, erzählt Jakob Falkner: „Die Leute haben gesagt: Jetzt spinnen sie. Jetzt fangen sie an, Theater zu spielen.“
Und was für ein Theater das war:
Die besagten Pistenbullys, Hubschrauber der Red-Bull-Flotte, Kohorten von Skilehrern, Fallschirmspringer … Sie alle waren und sind beteiligt an der Aufführung. Ernst Lorenzi hat seit Anbeginn die Aufgabe, diese Leute für die Aufführung zu koordinieren: „Das sind 645 Menschen auf und hinter der Bühne. Das ist einfach unglaublich. Die Akteure kommen aus ganz Tirol, nicht nur aus dem Ötztal.“

„AUF UND HINTER DER BÜHNE ARBEITEN 645 MENSCHEN. DIE AKTEURE KOMMEN AUS GANZ TIROL, NICHT NUR AUS DEM ÖTZTAL.“
Ernst Lorenzi

„DAS WETTER UND DIE NATUR SPIELEN IMMER DIE HAUPTROLLE.“
Hubert Lepka
Das Wetter als wichtigster Komparse.
Choreograph Hubert Lepka schildert die Mehrschichtigkeit seines Hannibal so: „An der Oberfläche ist es einfach ein wunderbares Spektakel. Aber das ist nur der Zugang und sobald der erfolgt ist, geht es in die Tiefe, in die Stille, in die Natur.“ Die Menschen kämen am Anfang mit fröhlicher Erwartung, „und am Ende ist es basses Erstaunen. Es hinterlässt die Zuschauerinnen und Zuschauer im Herzen berührt. Da findet während der Aufführung eine Veränderung statt.“ Apropos: Verändert hat sich das Stück in den letzten 25 Jahren absolut nicht, sagt er: „Es ist immer noch exakt 67 Minuten und 30 Sekunden lang.“ Was sich sehr wohl verändert hat, sind der Gletscher, das Wetter, die Umwelteinflüsse. Jakob Falkner gesteht, dass ihm das vor jeder Aufführung Bauchweh bereitet: „Spielt das Wetter mit und werden wir den Hannibal durchführen können?“ Abgesagt wurde er tatsächlich noch nie. Lepka: „Es gibt keinen Plan B. Die Aufführung wurde bis jetzt immer durchgezogen, weil es ein Wahnsinn wäre, das zu verschieben. Wir reagieren auf das Wetter wie auf einen Mitspieler. Diesen Umstand haben wir bis zur Virtuosität entwickelt.“ Dass der Gletscher unbestritten zurückgeht, ist das geringere Problem, denn zum jeweiligen Aufführungsdatum im Frühjahr liegt immer ausreichend Schnee.
Bei allen Veränderungen, die der Rettenbachferner in den letzten 25 Jahren durchgemacht hat: Er ist die ideale Hannibal-Kulisse geblieben. Die Elefantenhaut, wie Lepka sie einst beim ersten Anblick sah. Für den Chef der Söldener Bergbahnen, Jakob Falkner, ist Hannibal das, was für die Salzburger der Jedermann am Domplatz ist: „Der Rettenbachferner ist die schönste, einzigartige Bühne. Das ist kein kleiner, begrenzter Raum. So etwas wie Hannibal könnte man in keiner Arena der Welt aufführen.“ Uwe_Schwinghammer

AB 13. NOVEMBER TÄGLICH GEÖFFNET 09:00–16:00

Wenn Hannibals Horde von Kriegselefanten über den Rettenbachferner wandert, sind die Bilder so beeindruckend, wie das Spektakel selbst.





Der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld geht mit einem neuen Saunakonzept, mehr Thermenqualität und neuen Thermal-Longevity-Programmen in den Winter.
m größten Wellnessbereich
ITirols stehen stattliche 20.000 Quadratmeter für ganzheitliches Wohlfühlen zur Verfügung. Mit einem großen Um- und Ausbau wurde kürzlich in noch mehr Qualität investiert. Ab sofort schwebt man mit einem gläsernen Aufzug von der Schluchtensauna in den neu gestalteten Saunagarten, zudem präsentiert sich der Außen-Whirlpool neuerdings
in leuchtendem Türkis. Und auch die Ruhebereiche haben ein deutliches Upgrade bekommen. Fünf neue Ruheräume bieten noch mehr Komfort und persönlichen Freiraum. Dazu hat der Thermendom als Herzstück des AQUA DOME ein stylisches Facelift bekommen. Das i-Tüpfelchen indes ist das neue und eigens für den AQUA DOME entwickelte Saunakonzept, das das Erlebnis „Berge, Wasser, Kraft“ der Ötzta-





ler Alpen mit einzigartigen Aufgüssen, Infusionen und Peelings thematisiert. Wenig verwunderlich, dass der AQUA DOME einmal mehr mit dem „World Spa Award 2025“ ausgezeichnet wurde.
Wintertipp: In den Schalenbecken unter freiem Himmel schweben oder tiefer einsteigen und das neue Thermal-Longevity-Konzept in den Kick-offoder Deep-dive-Retreats testen.





















-ORIGINAL REQUISITEN
-NEUN GALERIEN AUF 1300M²
-MAKING OF & BEHIND THE SCENES
-ATEMBERAUBENDE FREILUFTPLAZA
JETZT AUF GEHEIMMISSION BEGEBEN
Ab 13. November täglich geöffnet von 09.00 bis 16.30 Uhr ZUM





Die Zukunft ist autonom. Autonomous Ropeway Operation für Sesselbahnen (AURO CLD) ermöglicht den Fahrgastbetrieb ohne Personal in der Bergstation. Durch die KI-gestützte Bildverarbeitung werden Bild- und Videodaten in Echtzeit analysiert, bewertet und wenn nötig reaktionsschnell in eine Handlung überführt. Dies kann eine automatische Verlangsamung oder Stillsetzung der Anlage sein. Durch AURO CLD können qualifizierte Mitarbeitende flexibel für andere Tätigkeiten eingesetzt und Personalmangel-Effekte abgefedert werden, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit und Förderleistung einzugehen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über AURO CLD zu erfahren.
doppelmayr.com/auro
Wildspitze 3.768 m

Mittelbergferner
ice Q Restaurant 007 ELEMENTS BIG3 Tiefenbachkogl 3.250 m
Tiefenbachgletscher 2.796 m
bergbahnen.soelden.com
m
Rettenbachjoch 2.986 m
Gaislachkogl Mittelstation 2.174 m
Rettenbachgletscher 2.675 m

Alle Infos und mehr gibts hier ...
Bei den Bergbahnen Sölden geht’s immer bergauf – mit neuen Ideen und spannenden Projekten! Auch heuer wurde wieder kräftig investiert: Die neuen 8er-Sesselbahnen Einzeiger und Silberbrünnl sorgen für noch mehr Komfort und Leistung auf der Piste, und die neue Pistenverbindung macht das Winterskigebiet jetzt komplett.
Pistenverbindung 7 und 22
Inbetriebnahme: November 2025
Zusätzliche Pistenfläche: 2,13 HA
Pistenlänge: 1.800 m
Neue Schneileitung: 2.750 m
Neue Schneeerzeuger: 32
Pistengefälle: ca. 10%
Absturzsicherungen: 1.500 m
8SK Silberbrünnl
Inbetriebnahme: November 2025
Typ: 8er-Sesselbahn mit 83 Sesseln Maximale Förderleistung:
3.800 Personen pro Stunde
Hersteller/Modell:
Doppelmayr D-Line-Generation
Fahrzeit: ca. 5,3 Minuten bei 6 m/s Geschwindigkeit
Features: Einstiegsförderband, Schließbügel zum sicheren Personentransport (Kinder), Wetterschutzhauben.
Inbetriebnahme: November 2025
Typ: 8er-Sesselbahn mit 59 Sesseln Maximale Förderleistung: 4.000 Personen pro Stunde
Hersteller/Modell:
Doppelmayr D-Line-Generation
Fahrzeit: ca. 3,5 Minuten bei 6 m/s Geschwindigkeit
Features: Einstiegsförderband, Schließbügel zum sicheren Personentransport (Kinder), Wetterschutzhauben, windstabil.

Anna Dengel war eine Sozialpionierin. Und eine Frau, die aus ihrer tiefen Überzeugung heraus Unmögliches möglich gemacht hat: Ihr Wirken trägt noch heute Früchte rund um den Erdball.

Geboren 1892 in Steeg, gründete die Ärztin Anna Dengel vor hundert Jahren die Ordensgemeinschaft der Missionsärztlichen Schwestern, in der noch heute 430 Schwestern in 23 Ländern in ihrem Geiste handeln. Darüber hinaus erkämpfte sie eine Änderung im Kirchenrecht.
„Am Ende der Welt“, genau genommen im Tiroler Lechtal, sei sie als ältestes von neun Kindern geboren, wie sie selbst immer wieder humorvoll, mit einem Lächeln auf den Lippen, zu sagen pflegte. Im Jahr 1899 übersiedelte die Familie nach Hall in Tirol. Anna Dengel absolvierte zuerst die Pensionatsschule, anschließend wagte sie sich erstmals hinaus in die
große Welt. Zuerst ins französische Lyon, um dort Deutsch zu unterrichten. Nach ihrer Rückkehr hörte sie von der schottischen Ärztin Dr. Agnes McLaren, die zu einer ihrer wichtigsten Mentorinnen wurde. McLaren suchte damals Ärztinnen für ein Krankenhaus in Rawalpindi (Indien, heutiges Pakistan), das gegründet worden war, um die muslimischen Frauen der Region medizinisch zu versorgen, die von der Behandlung durch männliche Ärzte ausgeschlossen waren. Auf diesen Aufruf meldete sich nur eine einzige Interessentin: Ein junges Mädchen aus Tirol. Anna Dengel.
„IHR DÜRFT KEINE ANGST HABEN, ETWAS ZU VERÄNDERN, WENN ES
Anna Dengel
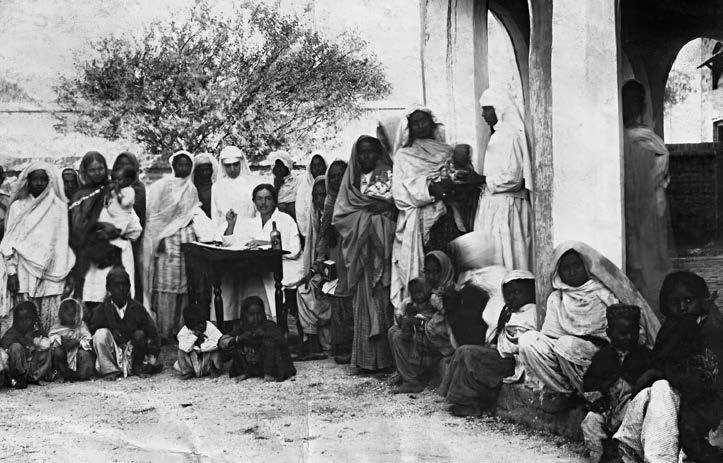

Feuer und Flamme.
Die beiden Frauen begannen eine rege Korrespondenz. Anna Dengel war sofort „Feuer und Flamme“ – diesen Leitsatz, der ihr immer wieder über die Lippen kam, assoziiert man noch heute mit ihr. Sie schrieb Agnes McLaren: „Das ist die Antwort auf meinen größten Wunsch und meine tiefste Sehnsucht: eine Missionarin zu sein mit einem bestimmten Ziel im Auge, eine dringend notwendige Aufgabe zu übernehmen, die nur Frauen erfüllen können. Es ist der Traum meiner Kindheit.“
Dengel selbst indes hat McLaren, die 1913 verstarb, vor deren Tod nie persönlich kennengelernt. Dennoch war sie entschlossen, den Weg konsequent weiterzuverfolgen, und studierte Medizin in Österreich, Frankreich und Irland. Ihre Heimat Tirol trug sie immer im Herzen und nicht nur da: Im Gepäck fand sich stets ein Foto ihres Elternhauses in Steeg.
Nachdem Anna Dengel 1920 promoviert hatte, begann ihre ärztliche
Anna Dengel hält eine Sprechstunde im indischen Rawalpindi im Jahr 1921.
Die ersten vier Missionsärztlichen Schwestern, 1925 in Washington, USA. Anna Dengel ist die Zweite von links.
Tätigkeit am St. Catherine’s Hospital in Rawalpindi. Die Tirolerin war die einzige Ärztin im Spital – nach päpstlichem Recht durften Ordensschwestern nämlich nicht medizinisch tätig sein. Anna aber war überwältigt vom Leid, das sie umgab. Diese festgefahrene und aussichtslos scheinende Situation führte sie schließlich zur totalen Erschöpfung, heute würde man wohl ein Burnout diagnostizieren. Sie selbst beschrieb diese tiefe, innere Dunkelheit als „Nacht der Seele“. In ihrer Ratlosigkeit vertraute sich Anna Dengel einem Priester in Rawalpindi an, der ihr riet, in einen Missionsorden einzutreten. Kurze Zeit – bis eine indische Ärztin als Nachfolgerin gefunden war – folgte Anna Dengel diesem Rat. Im Frühjahr 1924 verließ sie Rawalpindi schweren Herzens und verbrachte einige Monate mit Reisen, nicht allerdings zum Zwecke der Erholung, sondern um auf die medizinischen Bedürfnisse in Indien aufmerksam zu machen. Im Rahmen vieler Gespräche stieß sie immer wieder auf dasselbe Hindernis, nämlich das Verbot im Kirchenrecht. Schließlich kam Dengel zu dem Entschluss, dass sie eine eigene, neue Ordensgemeinschaft gründen muss – im Juni 1925 wurde ihr von der römisch-katholischen Kirche die Erlaubnis erteilt, einen medizinisch orientierten Orden zu gründen. Die Missionsärztlichen Schwestern, meist kurz MMS genannt, starteten zu viert und waren anfangs in einem alten Haus in Washington einquartiert, 1926 wurde die erste Ärztin nach Indien geschickt.

Anna Dengel bei der Grundsteinlegung für das Fatima Hospital in Pare-Pare/Indonesien im Jahr 1954

Anna Dengel im Jahr 1966 im Rahmen der Verleihung des Ehrenringes des Landes Tirol. Im Bild mit dem ehemaligen Tiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer.
Unmögliches gewagt.
Schon die Mentorin von Anna Dengel, Agnes McLaren, kämpfte für die Aufhebung der Einschränkung im Kirchenrecht, auch sie hat sich bereits zuvor in einer Petition an den Vatikan gewandt. Verbunden mit der Bitte, dass auch Ordensfrauen als Ärztinnen tätig sein dürfen. Anna Dengel gelang schließlich das Unmögliche: Nach mehr als 700 Jahren hat sie 1936 die Aufhebung jenes kirchlichen Verbotes erreicht –infolgedessen wurde Ordensleuten fortan der volle medizinische Dienst erlaubt. Dengel und ihre Schwestern legten die Ewigen Gelübde in ihrer neuen Gemeinschaft ab und Schwester Anna Dengel wurde zur ersten Generaloberin gewählt.
Dr. Anna Dengel gründete im Laufe ihres Lebens weltweit knapp 50 (!) Krankenhäuser und gab „ihren“ Schwestern eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: „Ihr müsst euch den Nöten der Zeit anpassen. Die Nöte werden sich nicht uns anpassen. Ihr dürft keine Angst haben, etwas zu verändern, wenn es notwendig ist.“ Diese Worte Anna Dengels waren ein Auftrag und Vermächtnis an die Missionsärztlichen Schwestern weltweit. Nur kurze Zeit später, nachdem sie diese Worte an ihre Ordensgemeinschaft richtete, erlitt Anna Dengel einen Schlaganfall, der sie von nun an für den Rest ihres Lebens ans Bett fesselte. Am 17. April 1980 starb Anna Dengel in Rom und wurde am Campo Santo Teutonico begraben.
Auf ihre Worte folgten Taten: Das Arbeitsfeld der Missionsärztlichen
Verein Freunde
Anna Dengel
Zwei Menschen, Reinhard Heiserer und Anna Dengel, verbindet so einiges: Beide sind gebürtige Außerferner und beide verschreiben bzw. verschrieben sich in ihrem Leben der Hilfe von Menschen in Entwicklungsländern. Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt“, stieß vor Jahren im Rahmen einer Projektreise in Ghana auf die Arbeit der Missionsärztlichen Schwestern. „Auch wenn mir ihr Name schon vorher bekannt war, bin ich dort erstmals auf die Arbeit der Schwestern aufmerksam geworden“, erzählt Reinhard Heiserer, der 2012 den Verein „Freunde Anna Dengel“ gründete, um das Leben und Wirken der großen Tirolerin mehr in den Fokus zu rücken. Zum Zweck der Bewusstseinsbildung wurde bereits ein Buch (Titel: „Unmögliches wagen“) publiziert, ebenso ein Theaterstück auf die Bühne gebracht und auch eine Anna-Dengel-Holzstatue in Auftrag gegeben. Das Schwerpunktprojekt des Vereins und der Entwicklungsorganisation liegt derzeit im Bereich der Förderung einer Klinik in Ghana. In Kulmasa, dem ärmlichen Norden des Landes, wird derzeit in Kooperation mit Jugend Eine Welt und unter anderem dem Land Tirol ein Krankenhausprojekt umgesetzt. Die zweite Baustufe konnte im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen werden. Für ein Personalhaus werden noch Spenden gesucht.
Wer helfen möchte:
Spendenkonto RLB Tirol, Freunde Anna Dengel – Jugend Eine Welt, IBAN: AT57 3600 0002 0002 4000
Schwestern hat sich ausgeweitet –heute steht das ganzheitliche Heil im Mittelpunkt. Das 100-jährige Bestehen der Ordensgründung wurde mehrfach, unter anderem in der Heimatgemeinde von Anna Dengel, in Steeg im Lechtal, unter Beisein zahlreicher Missionsärztlicher Schwestern aus aller Welt gefeiert.
Nach wie vor erinnert vieles an die große Tirolerin: Bücher, Gemälde, Statuen, Tafeln, Auszeichnungen, Filme, Fotos, Zeitungsartikel, Briefmarken oder Straßennamen sind Spuren, die sich noch lange nach dem Tod von Anna Dengel finden. Anna Dengel war aber schon zu Lebzeiten eine große Persönlichkeit: So war sie die erste Ehrenringträgerin des Landes Tirol, 1967 erhielt sie außerdem das Große Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich. Im Jahr 1992 wurde von der Österreichischen Post zur Feier ihres 100. Geburtstags eine Sonderbriefmarke herausgegeben.
Zeit ihres Lebens war Anna Dengel von großen Persönlichkeiten umgeben. Sie besuchte Kaiserin Zita, ebenso den früheren Bundeskanzler Leopold Figl. 1959 erhielt sie eine Audienz bei Papst Pius XII. Auch zu Mutter Teresa bestand eine Verbindung: Mutter Teresa absolvierte 1948, bevor sie mit ihrer Gemeinschaft die Arbeit in den Slums von Kalkutta aufnahm, eine Ausbildung in Krankenpflege in Patna (Indien) in der von Anna Dengel gegründeten Krankenschwesternschule. Und auch als Anna Dengel nach einem Schlaganfall im Krankenhaus lag, erhielt sie Besuch von Mutter Teresa. Elisabeth_Zangerl






























































































































































































































































































































































































































Anna Dengel was a pioneer with the courage to make the impossible possible. Guided by deep conviction, she shaped a life of purpose, and her work continues to bear fruit across the world to this day.
Anna Dengel was an extraordinary woman who crossed boundaries with courage, faith and vision. Born in Steeg, a small village in the Lech Valley of Tyrol, she was the eldest of nine children and grew up with a strong sense of responsibility. After completing her education, her curiosity and compassion drew her out into the wider world – first as a teacher in Lyon, and later as a medical student in Austria, France and Ireland.
Inspired by the Scottish doctor Agnes McLaren, Anna discovered her true calling: to bring medical care to women in India, who were forbidden by religious custom to be treated by male physicians. In 1920 she began working at a hospital in Rawalpindi (today in Pakistan) – the only female doctor under extremely challenging conditions. The suffering she witnessed, combined with the Church’s restriction that nuns could not practise medicine, pushed her to her limits. Yet rather than give up, Anna sought a new path forward. In 1925, she received permission from the Church to found a new community – the Medical Mission Sisters (MMS). Together with four pioneering women in Washington, D.C., she began her mission, and soon the first medical sister was sent to India.
Anna Dengel continued to fight tirelessly for the recognition of religious sisters as medical professionals. In 1936, after more than seven centuries, she achieved what had long seemed impossible: the Church lifted its ban on nuns practising medicine. This breakthrough laid the foundation for a worldwide movement of women doctors devoted to faith and service. Under her leadership, nearly fifty hospitals were established across several continents. Even after suffering a stroke

in 1960, Anna remained mentally active and followed the work of her community with keen interest. She passed away in Rome in 1980 and was laid to rest at the Campo Santo Teutonico near St Peter’s Basilica. Today, around 430 Medical Mission Sisters continue her mission in 23 countries around the globe.
Anna Dengel’s legacy lives on through the Friends of Anna Dengel Association, founded in 2012 by development worker Reinhard Heiserer. Through publications, plays, monuments and medical projects – such as the construction of a clinic in Ghana – the association keeps her spirit alive. Anna Dengel remains a shining symbol of faith, compassion and the courage to attempt the impossible – a woman from Tyrol whose life’s work continues to touch the world.

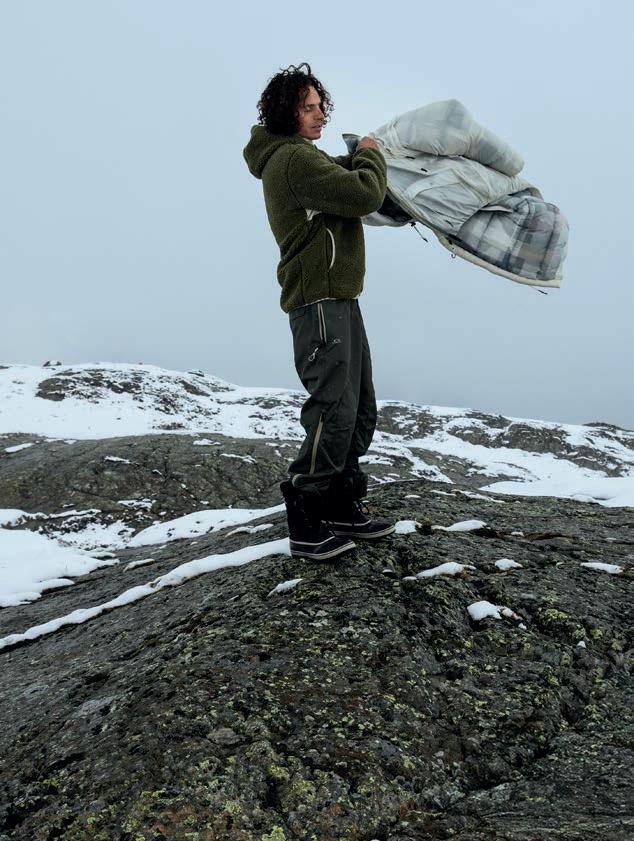


David Fleckinger ist Küchenchef im Restaurant Amador in Wien und rechte Hand von Juan Amador –einem der einflussreichsten Köche Europas.

Ein Tiroler Koch steht seit Jahren an der Seite eines der am höchsten dekorierten Köche Österreichs.
Mittlerweile wurde der Mentor zum Partner, Gerichte werden gemeinsam entwickelt, und immer wieder blitzen im Menü Erinnerungen an die Heimat auf.
Fotos: Jürgen Schmücking
Im Restaurant Amador in Wien ist es ruhig in der Küche. Nicht weil das Restaurant geschlossen oder weil wenig los ist. Eher, weil Juan Amador und David Fleckinger es so wollen. Es herrscht Präzision. Kein Chaos, kein Lärm. Nur konzentrierte Stille, das rhythmische Schaben eines Messers, ein kurzes Zischen aus der Pfanne. Hier arbeitet David Fleckinger, Küchenchef und rechte Hand von Juan Amador – einem der einflussreichsten Köche Europas. Fleckinger ist keiner, der die Bühne oder den großen Auftritt sucht. Kein Selfie-Koch, kein Showmensch. Er ist derjenige, der den Betrieb am Laufen hält, der Ideen einbringt, diese Ideen in Abläufe umsetzt und der jeden Teller zur Punktlandung bringt. „Timing ist alles“, sagt er, ohne den Blick vom Pass zu nehmen. Ein Satz, der banal klingt, bis man ihm bei der Arbeit zusieht. Jeder Handgriff sitzt, jedes Detail hat einen Grund. Nichts wird dem Zufall überlassen. „Wenn du in dieser Liga spielst, ist Präzision keine Tugend – sie ist Überlebensstrategie.“
Kindheit als Fundament einer Leidenschaft.

Auf die Frage, wie er zum Kochen kam, kommen wie aus der Pistole geschossen die Erlebnisse seiner Kindheit in Gries am Brenner. Er erzählt von seiner Mutter, einer erfolgreichen Köchin, und von seinen Sommern
„DAS ZIEL IST NICHT, DASS DER
ZIEL IST, DASS ER VERSTEHT, OHNE DASS WIR ERKLÄREN MÜSSEN.“
David Fleckinger
am Berg. Vom Granten- und Schwarzbeerensammeln und vom Einlegen danach. Vom Garten der Familie, in dem vieles angebaut und geerntet wurde, und von der Idee, sich mit Lebensmitteln selbst zu versorgen. All das hat den jungen David fasziniert. Es sind die Dinge, die das Fundament für seine Leidenschaft für Lebensmittel und fürs Kochen gelegt haben. Der erste Dämpfer kam mit der ersten Stelle in einer Profiküche. Die Hektik und der raue Ton setzten ihm zu. Ein schwieriges erstes Jahr. Hat er aber weggesteckt, und im zweiten Jahr war sein Interesse geweckt. Ab da wollte er es genau wissen und ging den Dingen auf den Grund. Was passiert in Lebensmitteln, wenn sie erhitzt, gekocht werden? Was genau spielt sich in einem Ei ab, wenn es gekocht wird? Und warum. Wer sich derart intensiv mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt, kommt irgendwann unweigerlich am Thema der molekularen Küche vorbei. In diesem Jahr, es war 2009, hat sich Fleckinger ein Bein gebrochen. Sein Gehalt, und zwar so ziemlich das gesamte, nutzte er damals, um sich mit Kochbüchern einzudecken, die freie Zeit nach dem Unfall dafür, diese Bücher zu lesen und durchzuarbeiten.
Machen wir das mit den Stationen kurz. Grand Hotel, Johanna Maier. Unter anderem. Dann landete Fleckinger recht schnell bei Juan Amador in Mannheim. Er ging mit ihm nach Wien und war stets an dessen Seite. Zuerst in Amadors Wirtshaus und Greißlerei, das von Mitte 2016 bis Ende 2017


betrieben wurde. Dann kamen neue Ideen, ein neues Konzept, ein neuer Name und 2019 der dritte Stern im renommierten Guide Michelin. Nicht dass vorher wenig los gewesen wäre. Aber seither brummt der Laden, und zwar täglich. Das Restaurant Amador war Österreichs erster und einige Jahre einziger Drei-Sterner.
Die alte Gewölbearchitektur, die offene Küche, das gedämpfte Licht – alles wirkt wie ein Kontrastprogramm zur Präzision auf den Tellern. Hier entstehen Gerichte, die auf den ersten Blick simpel wirken und beim zweiten Bissen explodieren. Ein Carabinero aus Huelva mit (grüner) Ajo Blanco und (grünen) Mandeln. Eine Ballontine von der Wachtel mit Gänseleber, die aus handwerklicher Sicht nichts weniger als Weltklasse ist, oder der Seehecht mit Escabeche und Percebes. Umwerfend. Kein Showeffekt, nichts wirkt überladen. Nur Balance. Immer wieder tauchen Klassiker des Amador-Schaffens in aktuellen Menüs auf. Eine geeiste Beurre blanc mit Kaviar und pochierter Auster zum Beispiel. Oder die Miéral-Taube, ein frühes Signature Dish aus der Feder des Kochs.
Es tut sich was.
Auch wenn Juan Amador für David Fleckinger immer Mentor und eine väterliche Figur ist (und bleiben wird), mittlerweile kochen die beiden auf Augenhöhe. Sie sind gleichberechtigte Partner in der Küche, und das Entwi-
ckeln neuer Gerichte ist ein cokreativer Prozess. Für das aktuelle Menü schlägt Fleckinger – die Tiroler Ader lässt grüßen – Schlutzkrapfen vor. Eine Hommage an die Heimat. Amador ist begeistert und schlägt vor, die Schlutzer mit einer handgetauchten Jakobsmuschel zu kombinieren. Spinat ist auch im Spiel und weil gerade Trüffelsaison ist, wird vor dem Servieren noch einmal ordentlich Späne von weißer Alba-Trüffel über das Gericht gehobelt. Die Art, wie es entstanden ist, die Art, wie es schmeckt – einfach großartig. Später im selben Menü, beim ersten Dessert, um genau zu sein, lässt Fleckinger auch noch einmal den Tiroler raushängen. Es heißt „Omelette Surprise“ und ist ein süßer Traum aus Blancmanger, Amaretto und Stanzer Zwetschken aus dem
„WIR REDUZIEREN, BIS ES WEHTUT.“
David Fleckinger
höchsten Anbaugebiet für Zwetschken in Europa.
Und doch. „Wir reduzieren, bis es wehtut“, sagt Fleckinger. „Wenn etwas nicht unbedingt nötig ist, fliegt es raus.“ Diese Haltung zieht sich durch das ganze Menü – klar, reduziert, technisch perfekt. „Das Ziel ist nicht, dass der Gast staunt. Das Ziel ist, dass er versteht, ohne dass wir erklären müssen.“ Der Umgang mit Druck gehört zum Alltag. Ein Service mit dreißig Gästen, fünfzehn Gänge, drei Sterne über dem Haus – das ist kein Kochabend, das ist Hochleistungssport. „Fehler passieren. Aber sie dürfen nicht auffallen. Das ist die Regel.“ In seiner ruhigen Art steckt Autorität. Keine Lautstärke, kein Drama. Nur Konsequenz. Auch menschlich.

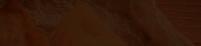
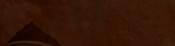



Das Restaurant Amador war Österreichs erster und einige Jahre einziger Drei-Sterner.
ENTSTEHEN GERICHTE, DIE AUF DEN ERSTEN BLICK SIMPEL WIRKEN UND BEIM ZWEITEN BISSEN EXPLODIEREN.

„In der Küche darf keiner Angst haben“, sagt er. „Du kannst Perfektion nicht erzwingen, du kannst sie nur ermöglichen.“ Wer Fleckinger erlebt, merkt: Er führt nicht über Kontrolle, sondern über Vertrauen. Junge Köche beschreiben ihn als „ruhig, aber immer präsent“.
Neben der Arbeit im Restaurant hat Fleckinger gemeinsam mit Kollegen das Label Goûtez gegründet – Saucen und Fonds aus der Sterneküche, abgefüllt für den Alltag. Ein Projekt, das nach Spaß klingt, aber denselben Anspruch trägt. „Wir wollten zeigen, dass Geschmack nicht elitär sein muss“, sagt er. „Wenn du Qualität einmal verstanden hast, willst du sie überall haben –auch daheim.“
Juan Amador nennt ihn „den Motor der Küche“. Tatsächlich ist Fleckinger der, der den Laden auf Kurs hält. Während Amador Konzepte entwickelt, sorgt er dafür, dass sie funktionieren. „Wir denken unterschiedlich“, sagt Fleckinger. „Er ist der Visionär, ich bin der Techniker. Das ergänzt sich perfekt.“ Aber irgendwann wird Juan Amador leiser treten. Er ist nicht nur ein großartiger Koch, sondern auch ein passionierter Maler. Es wird eine Zeit geben, in der das Atelier wichtiger wird als die Küche. Noch stehen sie Seite an Seite. Es wird allerdings kein harter Schnitt sein. Ein Mann wie Juan Amador verabschiedet sich nicht von heute auf morgen. Warum auch? Vielmehr wird der Übergang ein fließender sein. Aber David Fleckinger ist bereit. Und es wird gut werden.
Wie gesagt, Fleckinger ist kein Mann der großen Bühne. Aber ohne ihn gäbe es sie nicht. Er ist das, was man in der Gastronomie selten laut feiert, aber still bewundert: die Perfektion im Hintergrund. Und wer einmal im Amador gegessen hat, wird sie spüren – in jeder Gabel, in jedem Geschmack, der bleibt, wenn das Licht im Keller längst gedimmt ist. Jürgen_Schmücking

S e i t übe r 140 J a h ren e i n e s d e r sc hö n ste n Ka ffeeh äuser Europ a s und der centr ale Tr e f fpunk t i n Innsbruc k .
With David Fleckinger, a Tyrolean chef has stood for years alongside one of Austria’s most highly decorated culinary masters.

At the three-Michelin-star restaurant Amador in Vienna, there is no noisy rush, only focused calm. Here, Juan Amador works with his long-time head chef and now partner, David Fleckinger. Fleckinger is not a showman; he stands for perfection behind the scenes, precise timing and absolute control in every movement.“Timing is everything,” he says, and by that he means more than just plating – it’s an attitude: in this league, perfection isn’t a virtue, it’s a survival strategy.
Fleckinger’s roots lie in Gries am Brenner. His passion for cooking was born in a childhood shaped by gardening, berry-picking and a mother who was also a cook. The early years in professional kitchens were
tough, but instead of being discouraged, he began to approach the culinary world scientifically. A broken leg in 2009 became a turning point: he invested all his money in cookbooks and immersed himself in the craft.
After stations such as the Grand Hotel and Johanna Maier, he soon found his way to Juan Amador – first in Mannheim, later in Vienna. Since 2019, Restaurant Amador has held three Michelin stars and ranks among the international elite. The dishes follow a clear principle: simplicity that deceives. What appears calm on the plate bursts with flavour – Carabinero with green ajo blanco, or the legendary Miéral pigeon.
It’s about balance, never showmanship.
Today, Fleckinger and Amador work as equals. Memories of home flow into the menu when Tyrolean Schlutzkrapfen with scallops, spinach and white truffle appear, or when a dessert with Stanzer plums is served. The philosophy remains strict: “We reduce until it hurts. The goal is not for the guest to marvel, but for them to understand – without us having to explain.”
Fleckinger leads with calm, trust and consistency. Perfection cannot be forced, he says; it can only be enabled. Alongside his work at the restaurant, he runs the label “Goûtez”, which makes high-quality sauces from fine dining accessible for everyday use. Juan Amador calls him “the engine of the kitchen” – and when the visionary eventually steps back, it’s clear that David Fleckinger will carry the future forward. His perfection may be quiet, but it endures.



JETZT IHR PASSENDES ANGEBOT FINDEN! Scan me

AN BERGEN UND SEEN


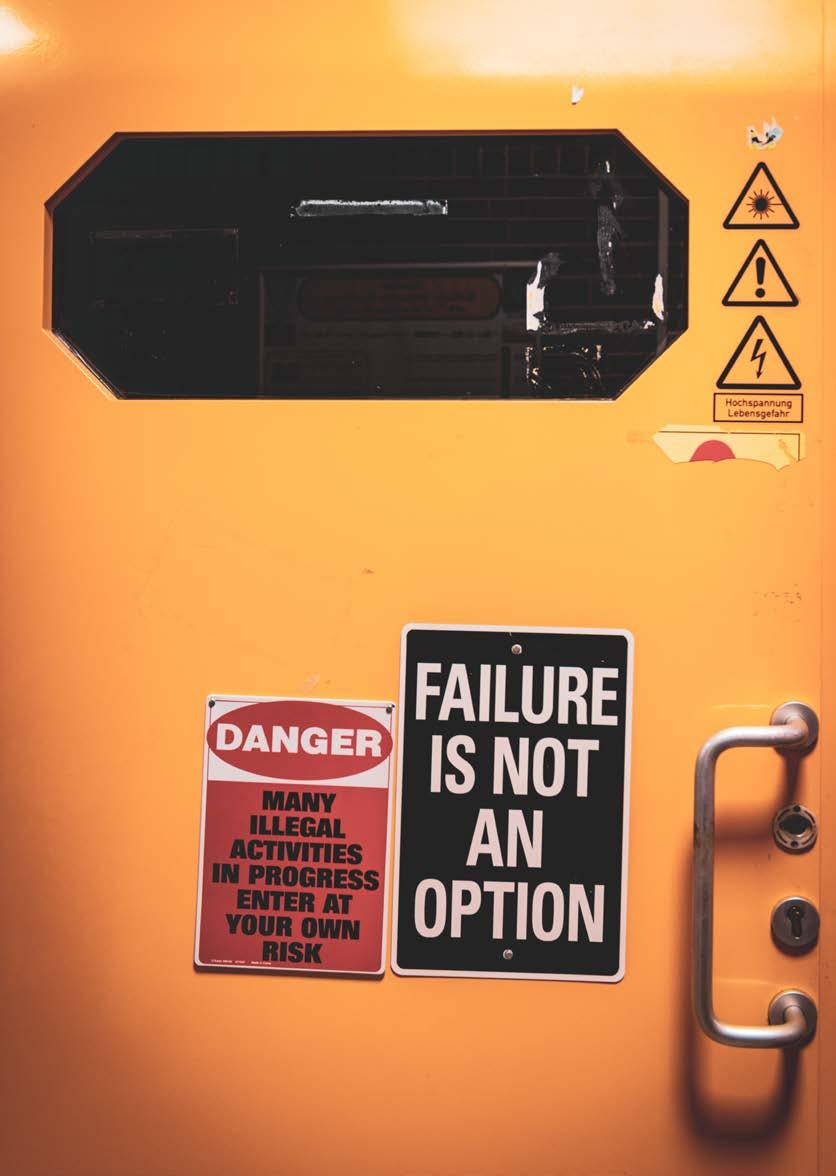
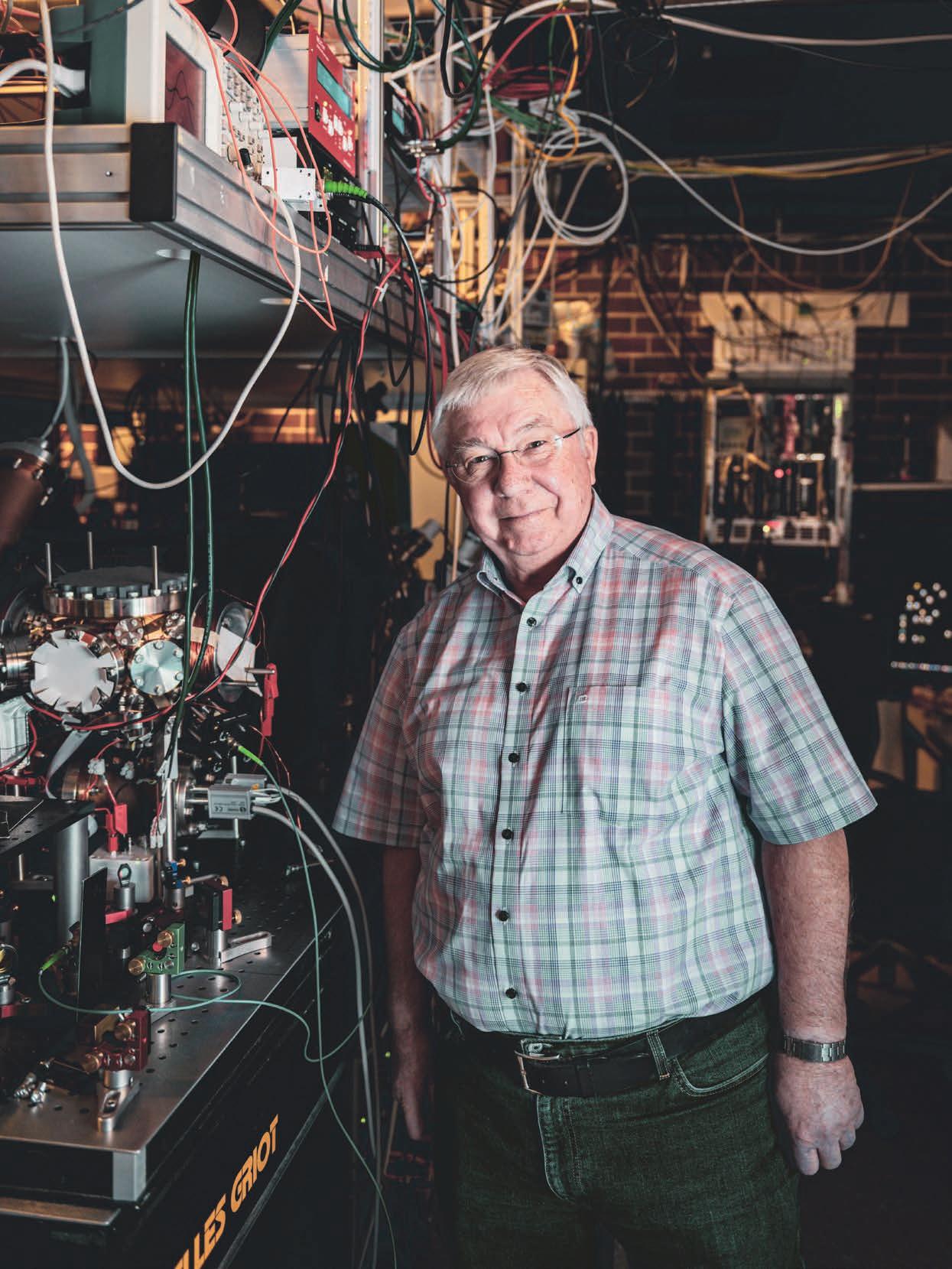
Tirol ist heute ein Quantendorado, geschaffen in den 1990er-Jahren von Forschern wie Rainer Blatt, Anton Zeilinger und Peter Zoller mit ihrer spektakulären Grundlagenforschung im unsichtbaren Reich der Quanten. In den Innsbrucker Labors wurde verschränkt und gebeamt und die Basis für den Quantencomputer gelegt, der das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Rainer Blatt war fast von Anfang an dabei und arbeitet auch nach seiner Emeritierung weiter daran, die Sprache der Natur zu verstehen.
Der Experimentalphysiker Rainer Blatt sitzt in seinem Büro im ICT-Gebäude am Campus Technik der Universität Innsbruck. Der Eingangsbereich im dritten Stock ist von zahlreichen Urkunden gesäumt. Eine Petersburger Hängung wissenschaftlicher Exzellenz. Sein einstiges, größeres und repräsentativeres Büro hat Blatt nach seiner Emeritierung am Institut seinem Nachfolger als Professor für Experimentelle Quantenphysik, Hannes Bernien, überlassen. Am Beginn des Gesprächs wirft der Physiker drei Zettel, auf denen handschriftliche Formeln und Gleichungen stehen, in den Papierkorb. Statt mathematischer Formeln hätten das in einem Paralleluniversum auch Noten sein können. Rainer Blatt wollte nämlich Musiker werden. Sein Traum scheiterte daran, dass er nicht ausreichend Klavier spielen konnte, um ein Konservatorium zu besuchen. Also wollte er Toningenieur werden. Als es auch damit nichts wird, beginnt Blatt in Mainz Mathematik und Physik zu studieren. Auf Lehramt. Schon damals machte ihm die Physik Spaß. Das Unterrichten an der Schule weniger. Zudem war dem jungen Blatt das ganze Schulsystem zu ideologisch: „Wenn ich Brechungsindex unterrichtet habe, hätte ich dabei sozialkritische Komponenten einfließen lassen sollen.“
Fortan widmete der junge Mann seine ganze Aufmerksamkeit der Physik. Er promoviert in Mainz und geht in die USA, wo ihn in Boulder im US-Bundesstaat Colorado der spätere Nobelpreisträger John Lewis Hall unter seine Fittiche nimmt. Dort lernte Rainer Blatt

Rainer Blatt (geb. 1952 in IdarOberstein, Deutschland) ist einer der führenden Experimentalphysiker auf dem Gebiet der Quanteninformationsverarbeitung. Seit den 1990er-Jahren forscht und lehrt er an der Universität Innsbruck, wo er mit seinem Team bahnbrechende Experimente mit gefangenen Ionen realisierte –zentrale Schritte auf dem Weg zum Quantencomputer. Er ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde vielfach international ausgezeichnet.
auch Peter Zoller kennen und schätzen, mit dem er später in Innsbruck für Furore sorgen sollte. Nach der Habilitation in Hamburg 1988 folgte er 1995 einem Ruf auf einen Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck. Damals gab es dort neun Professoren der Physik und rund 50 Studienanfänger pro Jahr. Die Fokussierung auf den aufstrebenden Bereich der Quantenoptik war eine politische Entscheidung gewesen. Zeilinger, Zoller und Blatt bauten in der Folge die Atomare, Molekulare und Optische Physik (AMO) in Innsbruck auf. Es herrschte Aufbruchsstimmung. „Das war eine besondere Situation, weil ich mit Peter Zoller schon in Boulder kollaborativ zusammengearbeitet habe. Diese Arbeitsweise wollten wir hier fortsetzen“, erinnert sich Blatt, der in diesem Zusammenhang auch von Blue-Sky-Research spricht. Einfach forsch ins Blaue forschen.
Kritische Masse.
Mehrmals spricht Rainer Blatt von der kritischen Masse. Eine solche braucht es, damit die Forschung eine gewisse Eigendynamik bekommt. Als Anton Zeilinger 1999 nach Wien geht und auch Peter Zoller und Rainer Blatt attraktive Angebote anderer Universitäten auf dem Tisch haben, steht die junge Quanten-Erfolgsgeschichte in Innsbruck auf der Kippe. „Wir hatten das Fachgebiet etabliert, aber die Fliehkräfte waren groß“, sagt Blatt.
Mit Ignacio Cirac forschte in Innsbruck am Institut zur gleichen Zeit ein weiteres Schwergewicht. Die Quanten-
forschung lief wie eine gut geölte Maschine, der wissenschaftliche Output war beachtlich. Damals wurden die Grundlagen für den Quantencomputer gelegt. Zoller und Cirac wurden 2020 in einem Beitrag der Fachzeitschrift Nature Review Physics dafür gewürdigt und reichten das Lob umgehend weiter: „Während wir die Lorbeeren für die Idee und Vision einheimsen dürfen, wäre dieser Erfolg ohne die wirklich herausragenden experimentellen Entwicklungen von Rainer Blatt, Dave Wineland, Chris Monroe und anderen nicht möglich gewesen. Die Tatsache, dass unsere Ideen den Lauf der Geschichte überlebt haben und dass sogar einige Unternehmen sie aufgegriffen haben, ist Menschen wie ihnen und ihren Gruppen zu verdanken und, im weiteren Sinne, einer ganzen Reihe von Theoretikern
FÜR RAINER BLATT WAR DIE
und Experimentalphysikern, die auf diesem Gebiet herausragende Beiträge geleistet haben.“ Letztlich siegte die Vision, in Innsbruck ein Zentrum zu etablieren und auch externe Leute in die universitäre Forschung hereinzuholen, um so eine kritische Masse zu schaffen. Blatt und Zoller blieben und beantragten bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) die Schaffung eines eigenen Instituts unter der Leitung von Blatt, Zoller und Zeilinger-Nachfolger Rudolf Grimm sowie Hans Briegel. Das Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) ist geboren, zunächst noch ohne eigenes Gebäude. Rainer Blatt war dessen Gründungsdirektor. Die Quantenphysiker zogen später gemeinsam mit der Informatik in das neu errichtete ICT-Gebäude. „Der Neid war groß“, erin-
Besseres Studium, bessere Chancen.



Master-Studien für das Gesundheitswesen
Geblockte Lehrveranstaltungen und innovative Online- und Blended-Learning Elemente garantieren, dass die Master-Studien an der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL mit dem Beruf vereinbar abgewickelt werden.
Die Master-Studien für Health Professionals:
▪ Health Care Management (CE)
▪ Pflegewissenschaft (ANP, Pflegepädagogik, Pflegemanagement)

▪ Public Health
▪ Medizinische Informatik (CE) (Online Studium)
▪ Health Information Management (Online-Studium) Infos

nert sich Blatt, der in der Folge bereits 2007 damit begann, an einem Konzept für ein neues Haus der Physik zu arbeiten. Ein solches ist – nach jahrelanger Verzögerung – mittlerweile in Bau. „Sie könnten ein Buch darüber schreiben“, sagt Blatt achselzuckend. Den Rückhalt des Landes Tirol hebt er ausdrücklich positiv hervor.
Der Quantenstandort Tirol hat sich entwickelt. Heute gibt es dort die von Rainer Blatt beschworene kritische Masse an Wissenschaftlern, die nach wie vor die Grenzen des Denk- und Machbaren Quantum für Quantum verschieben. Das liegt an einer glücklichen Personalpolitik und daran, „dass uns die Universität relativ freie Hand gelassen hat“. Heute umfasst die Physik 24 Professuren und zwischen 100 und 150 Studienanfänger pro Jahr. Blatt ist glücklich, dass das Haus der Physik nun tatsächlich gebaut wird, aber kritisch, was dessen Dimensionierung betrifft. Statt den ursprünglich geplan-
Vom Hafelekar zur Quantenwelt: Bereits 1931 erforschte Victor Franz Hess hier die kosmische Strahlung. In den 1990er-Jahren legten Anton Zeilinger, Rainer Blatt und Peter Zoller an der Universität Innsbruck den Grundstein für eine neue Ära der Quantenphysik. Heute zählt Innsbruck mit dem IQOQI und Start-ups wie Alpine Quantum Technologies zu den globalen Zentren der Quantenforschung. Ein jüngstes Symbol dafür ist die 2025 errichtete quantenoptische Bodenstation Marietta Blau am Hafelekar. Sie ist eine Schnittstelle zwischen Weltraum und Labor und ein Schritt in Richtung Quanteninternet.
ten fünf Stockwerken gibt es aufgrund von Sparzwängen nur noch vier. „Das halte ich für extrem kurzsichtig. Sobald das Haus eröffnet ist, ist es auch schon wieder zu klein. Die Universität krankt immer daran, dass sie keine Platzreserven hat.“ Ausgerechnet jenen, die an den kleinsten Teilen forschen, kann es gar nicht groß genug sein.
Wie andere Quantenforscher betont auch Rainer Blatt die Notwendigkeit der Kooperation über die Universität hinaus. „Wir sind hier in Innsbruck heute an die 200 Personen, die Quantenphysik machen. Das ist eine kritische Masse mit einer Expertise, die nicht zu breit, aber extrem tief ist“, sagt er. Dass ihm auch die Wissensvermittlung am Herzen liegt, zeigt sich, als er gefragt wird, ob er denn einem Laien die Funktionsweise einer Ionenfalle erklären könne. „Ja, sicher“, sagt er. Blatt nimmt ein leeres Blatt und einen Stift zur Hand und beginnt zu skizzieren, erklärt geduldig und stellt selbst immer wieder Fragen,
um zu überprüfen, ob man denn das Gesagte auch nachvollziehen konnte.
Säen und ernten.
Die Innsbrucker Quantenphysiker sind aber auch was die Kommerzialisierung ihrer Technologien betrifft keineswegs untätig. So baut das Spin-off AQT Ionenfallen-Quantencomputer und ParityQC entwickelt und vertreibt Quantenarchitekturen. „Da stecken 30 Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit dahinter“, sagt Blatt. In Innsbruck ist man physikalisch dazu in der Lage, den Quantencomputer zu skalieren. Die Unternehmen wachsen aber bedeutend langsamer als etwa die Konkurrenz im anglophonen Raum. Langsamer, organischer, aber vielleicht auch gesünder. „Die Konkurrenz kauft reihenweise Unternehmen auf, es kommt aber im Moment dabei nicht viel mehr Physik heraus“, meint der Forscher. In Europa gibt es weniger Wagniskapital als in den USA und eine konservativere Einstellung. „Es gibt in Europa keine Kultur des Scheiterns“, sagt Blatt. Wer unternehmerisch baden geht, ist verbrannt. Außerdem haben Akademiker noch immer Berührungsängste mit der Industrie. Die teilt Blatt nicht. „So kann es nicht sein. Wir brauchen Technologie, um diese Art von Physik machen zu können. Topphysik braucht Toptechnologie. Wir machen heute Physik anders als noch vor 30 Jahren“, sagt er. Technologie schiebt wissenschaftlichen Fortschritt an, und der bringt wiederum die Technologie voran. „Bei alledem heißt mein Mantra: Physics first!“, hält Blatt fest. Ob der Industriestandort Tirol ernten kann, was der Wissenschaftsstandort gesät hat, wird die Zukunft zeigen.
Heureka!
So wie in der Musik braucht es auch in der Physik viel Übung, um gut darin zu werden. „Musik ist Handwerk, nicht nur Kopfwerk. Man muss sich manchmal quälen. Das ist auch die Voraussetzung in der Physik“, vergleicht Rainer Blatt, der auch in der Musikkapelle Inzing aktiv musiziert. In der Physik brauche es eine unglaubliche Frustrations-
Schnelle Versorgung, persönliche Begleitung und ganzheitliche Genesung in Tirol.
Mit dem Winter verändert sich Tirol: Schnee, Ruhe in den Tälern, lebendige Pisten. Wintersport gehört hier zur Lebensart – und manchmal reicht ein kurzer Moment für einen Unfall. Dann braucht es Hilfe: schnell, präzise und nah. Die Einrichtungen der medalp bieten in den alpinen Regionen Tirols rasche Versorgung nach Ski- und Wintersportunfällen und begleiten Menschen von der ersten Untersuchung bis zur Genesung – professionell, strukturiert und menschlich
Schnelle medizinische Versorgung.
Nach einem Unfall zählt Klarheit. Ist etwas geprellt, gezerrt oder verletzt? In den medalp Kliniken erfolgt die Abklärung sofort. Moderne Bildgebung wie Röntgen, MRT oder CT steht direkt vor Ort bereit – ohne lange Wege oder Wartezeiten. So entsteht rasch ein klares Bild für die passende Behandlung. Wichtig ist in dieser Phase nicht nur Technik, sondern auch Ruhe und Orientierung. Das medalp-Team begegnet Patientinnen und Patienten aufmerksam, erfahren und verständnisvoll.
Präzision im Operationssaal.
Viele Verletzungen können konservativ behandelt werden, manche erfordern jedoch eine Operation. Dafür stehen spezialisierte Teams bereit, die häufig minimalinvasiv arbeiten – gewebeschonend und effizient. Im Operationssaal greifen Expertise, Konzentration und Teamarbeit ineinander. Vertrauen entsteht dabei durch Erfahrung, Sorgfalt und den Fokus auf den Menschen – nicht nur auf die Verletzung.
Ein Netzwerk, das Sicherheit gibt.
Die medalp verbindet spezialisierte Kliniken und Einrichtungen zu einem verlässlichen Gesamtangebot. Behandlungsschritte greifen ineinander, Entscheidungen werden abgestimmt getroffen, Wege bleiben kurz. An sieben Tagen in der Woche sorgt die medalp für schnelle Termine und unmittelbare Versorgung –für das Gefühl von Sicherheit, Kompetenz und Nähe.
www.medalp.at
„MUSIK IST HANDWERK, NICHT NUR
Rainer Blatt
toleranz. „Nach außen hin werden immer nur die Glanzleistungen sichtbar. Über Misserfolge redet niemand.“ Physik und Musik seien beide potenziell sehr kreativ. „Man muss versuchen, aus dem, was existiert, etwas Neues zu machen.“
In Rainer Blatts akademischer Laufbahn gibt es viele kleine und größere Heurekamomente. Die eindrücklichsten sind dabei nicht einmal die wegweisenden Quantenexperimente, die ihm gelungen sind. „Mein erstes Heureka habe ich am Ende meiner Diplomarbeit erfahren. Damals habe ich mehr Chemie gemacht – das war Voodoo, viele Resultate für das Journal of Non-reproducible Results“, scherzt Blatt. Am letzten Tag, kurz vor Abgabe der Diplomarbeit, sei es ihm dann geschossen. „Ich habe eine physikalische, sehr viel elegantere Lösung für das Problem gefunden, das ich chemisch angegangen bin“, erinnert er sich. Heureka! 1986 kommt ein weiterer Heurekamoment im Leben des Physikers: „Ich habe zum ersten Mal sogenannte Quantensprünge gesehen.“ Für Rainer Blatt war die Beobachtung dieses Quantensprungs damals eine riesengroße Sache.
Gamechanger Quantencomputer.
Die gegenwärtige Quantenforschung steht auf den Schultern der Giganten, die auch in Tirol gearbeitet haben und noch arbeiten. „Der Quantencomputer wird ein Gamechanger“, legt sich Rainer Blatt fest. Dieser Computer, ist er erst einmal skaliert, wird gängige Su-
percomputer in manchen Bereichen deutlich übertreffen. „Wir sind momentan auf dem Stand der Röhrentechnologie“, vergleicht Blatt. Das heißt, der Quantencomputer steckt noch in den Kinderschuhen. Das Potenzial ist riesengroß. „Die Welt ist quantenmechanisch“, sagt Blatt. Auch wenn Quantenphysik abstrakt klingt, ist sie buchstäblich treibende Kraft hinter jedem Computerchip, jedem Laserpointer und jedem GPS-Signal und jedem MRT-Scanner. Ohne Quantenphysik sähe unsere heutige Welt ganz anders aus. „Das alles ist Quantentechnologie. Das muss den Leuten bewusst gemacht werden“, meint Blatt. Auf seinem Computer zeigt Blatt eine mittels CCD-Kamera aufgenommene Fotografie lasergekühlter Ionen. Was für den Laien wie einige Pixelhäufchen aussieht, versetzt Wissenschaftler in Verzückung.
Beste Zukunftsaussichten.
Danach gefragt, wie es in Innsbruck weitergehen soll, sagt Blatt: „Wir haben eine hervorragende junge Mannschaft, Peter Zollers Nachfolger ist da, mein Nachfolger ist da.“ Und auch Blatt und Zoller sind noch da und übergeben sukzessive das Zepter. „Ich mache nur noch das, was mir Freude macht, und unterstütze, wenn ich gebraucht werde.“ Noch mehr als gute politische Rahmenbedingungen und das Geld der öffentlichen Hand brauche der Wissenschaftsstandort Tirol „die Eigeninitiative von Forschern, die etwas bewegen wollen“. Wissenschaftler wie Rainer Blatt, Peter Zoller und einige mehr haben in Innsbruck viel bewegt. Miteinander haben sie Tirol als Quantenstandort in eine super Position gebracht. Marian_Kröll
Chronologie Quantenforschung in Innsbruck
Victor Franz Hess gründet am Hafelekar eine Forschungsstation zur kosmischen Strahlung.
Marietta Blau nutzt Daten vom Hafelekar und entdeckt neue Teilchenprozesse – ein Meilenstein der Kernphysik.
Berufung von Anton Zeilinger, Rainer Blatt und Peter Zoller: Beginn der modernen Quantenforschung in Innsbruck.
Gründung des IQOQI (Institut für Quantenoptik und Quanteninformation) der ÖAW in Innsbruck.
Entstehung von Alpine Quantum Technologies (AQT) –Brücke zwischen Forschung und Anwendung.
Errichtung der quantenoptischen Bodenstation Marietta Blau am Hafelekar – ein Tor zum Quanteninternet.
Today, Tyrol is a true Eldorado for quantum research, brought to life in the 1990s by pioneering scientists such as Rainer Blatt, Anton Zeilinger, and Peter Zoller, whose groundbreaking work opened up the invisible world of quantum physics.

Tyrol’s rise to an international centre for quantum research was shaped above all by Rainer Blatt, Anton Zeilinger and Peter Zoller. In the 1990s, working in Innsbruck, they laid the foundations for modern quantum science and built an academic environment that gained worldwide recognition. Rainer Blatt – one of the leading experimental physicists of his generation – played a particularly central role. Originally set on becoming a musician, Blatt eventually chose to study physics, earned his doctorate in Mainz, and went on to work in the United States under Nobel Prize winner John Lewis Hall. After a period in Hamburg, he was appointed to Innsbruck in 1995, where together with Peter Zoller he helped establish the field of quantum optics and launched a new era of intensive basic research.
Despite moments when researchers considered leaving, strategic decisions and a shared determination to build a strong scientific base led in 2003 to the founding of the Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI). Today, physics in Innsbruck
encompasses 24 professorships and attracts more than 100 new students each year. The region has achieved the “critical mass” of scientists needed for long-term success. At the same time, spin-offs such as AQT and ParityQC have emerged, developing ion-trap quantum computer technologies – a clear sign of the growing economic impact of decades of fundamental research. Blatt emphasises the importance of technological advances in supporting scientific progress and foresees a major transformation ahead: quantum computers will surpass classical supercomputers in certain tasks, revolutionising both science and technology. Although still in its early stages, the potential of this technology is immense.
Alongside scientific excellence, Blatt highlights the need for collaboration, creativity, and resilience. As in music, he says, constant practice is key to mastery. And in Innsbruck, his outlook remains optimistic: with strong young researchers and a clear vision for the future, Tyrol is well positioned as a leading hub for quantum science – and Blatt himself continues to contribute where it brings him the most joy.

Es geht um die Milch: Die Brüder Thomas (li.) und Markus Ehammer machen Käse zum Lifestyle. Geschmacklich ohnehin top haben sie ihm auch ein lässiges Drumherum gegeben – in Sachen Verpackung ebenso wie beim Onlineauftritt.

Mit einem coolen und modernen Auftritt rocken die Milchbuben im Moment die heimische Käseszene. Dass ihre Camemberts auch noch großartig schmecken, tut das Seine zur Sache. Jetzt machen die zwei Revoluzzer auch noch Mozzarella. Ob das gut geht?
Fotos: Jürgen Schmücking
ERFOLG. ES IST DAS BEDÜRFNIS, DAS LAND, AUF DEM SIE LEBEN, IN GESCHMACK ZU ÜBERSETZEN. IHR KÄSE IST EIN
Der Weg hinauf zum Penningberg im Unterland windet sich über sattgrüne Hänge, vorbei an Bauernhöfen, deren Dächer sich tief ins Land ducken. Es riecht nach Heu, Harz und frischer Milch – ein Duft, der schon erahnen lässt, was hier oben entsteht: Käse, der nach Tirol schmeckt. Auf einem Hof, der seit Jahrhunderten in Familienhand ist, arbeiten zwei Brüder an einer modernen Interpretation bäuerlicher Tradition – die Milchbuben.
Thomas und Markus Ehammer heißen sie, zwei junge Männer mit kräftigem Händedruck und leuchtenden Augen, die lachen, wenn sie von ihrer Arbeit erzählen. Der Hof ihrer Familie steht seit 1654 auf dem Penningberg bei Hopfgarten im Brixental, ein Stück Tiroler Geschichte mit Aussicht auf das Wilde Kaiser-Gebirge. Hier, wo einst die Eltern noch Milch an die Molkerei lieferten, entschieden sich die Brüder, selbst zu Käsern zu werden – mit einer Idee, die so einfach wie radikal ist: aus bester Heumilch handwerklich hergestellten Weichkäse zu machen. „Wir wollten etwas Eigenes schaffen“, sagt Markus, während er in der kleinen Käserei den Deckel eines Edelstahlkessels hebt. Die Luft ist warm und duftet leicht säuerlich – der Geruch von Milch, die gerade zu Käse wird. Einen Stall sucht man vergeblich. Ein wesentlicher Schritt in Richtung Professiona-


lisierung war, dass die Tiere von Partnern gehalten und gemolken werden. Nachbarn mit Bio-Zertifikat. Gefüttert werden Heu und frisches Gras. Sonst nichts. Silage? Fehlanzeige!
Die Milchbuben – der Name klingt keck, fast trotzig. Und das ist Absicht. Die beiden wollten bewusst einen Kontrapunkt setzen zu den altehrwürdigen Käsemarken, die in traditionellem Pathos schwelgen. Ihr Camembert trägt Namen wie „Walnuss“, „Kräuter“ oder schlicht „Original“. Er ist weich, cremig, manchmal leicht nussig – und längst weit über Tirol hinaus bekannt. Viele sehen in den Brüdern Pioniere einer neuen Generation von Landwirten, die ihr Erbe nicht verwalten, sondern neu denken. Doch der Weg dorthin war kein Selbstläufer.
Ein Produkt, das Geschichten erzählt.
Thomas, der ältere Bruder, ist gelernter Tischler. Markus hat Milchtechnologie studiert. Erst als sie den elterlichen Hof übernahmen, merkten sie, dass sie mit Käse etwas erschaffen können, das nicht nur schmeckt, sondern erzählt. 2016 gründeten sie die Marke Milchbuben, 2017 kam der erste Käse auf den Markt. Heute reifen in ihrem Kühlraum hunderte runde Laibe – ein kontrolliertes, lebendiges Biotop aus Schimmel,
Zeit und Geduld. Die Brüder haben ihre Arbeit auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Sie sind biozertifiziert, arbeiten gentechnikfrei und produzieren in überschaubaren Mengen.
In Tirol, wo Bergkäse lange das Maß aller Dinge war, galt ein Weißschimmelkäse aus heimischer Milch zunächst als Wagnis. Camembert – das klang nach Frankreich, nach den Hügeln der Normandie, nicht nach den schroffen Tiroler Alpen. Wer je durch das Dorf Camembert gewandert ist, weiß, dass es größer ist als Penningberg. Groß ist der Unterschied allerdings nicht. Für die Milchbubenbrüder lag genau darin der Reiz. „Wir wollten zeigen, dass das auch hier geht. Dass Tirol mehr kann als Hartkäse“, sagt Thomas. Heute beliefern sie Feinkostläden und Restaurants in ganz Österreich, einige Sorten sind sogar in Gourmetgeschäften in Deutschland erhältlich.
Ein Blick in den Süden.
Orts- und Szenenwechsel. Der Morgen über Kampanien beginnt mit Nebel, der schwer über den Feldern liegt. Zwischen den Olivenbäumen schimmern silberne Tropfen auf den Gräsern, und aus der Ferne hört man das Muhen der Wasserbüffel. Hier, unweit von Caserta, schlägt das Herz der Mozzarellaproduktion – jener zarten, glänzenden Käsekugeln, die längst zum Symbol italienischer Lebensfreude geworden sind. Mozzarella di Bufala Campana –das klingt nach Sonne, nach Tomaten, Basilikum und einem Hauch Dolce Vita. Doch hinter dem cremigen Genuss verbirgt sich eine Welt, die weniger romantisch ist, als die Werbebilder glauben lassen.
Am Beginn eines jeden Käselaibs steht die Milch, und sie ist zugleich der Kern des Problems. Denn die etwa 400.000 Wasserbüffel, die in Süditalien für die Mozzarellaproduktion gehalten

Der Camembert trägt Namen wie „Walnuss“, „Kräuter“ oder schlicht „Original“. Er ist weich, cremig, manchmal leicht nussig – und längst weit über Tirol hinaus bekannt.

werden, leben meist unter Bedingungen, die nur entfernt an die Idylle erinnern, die Touristen auf Landstraßen zu sehen glauben. Viele Tiere stehen in engen Ställen, auf Betonböden, ohne Zugang zu Weide oder Wasserlöchern. Ihre Haltung erfordert enorme Mengen an Wasser und Futtermitteln, oft importiert aus Übersee. Und: Nicht alle Kälber, die geboren werden, dürfen leben. Die weiblichen Tiere liefern später Milch – die männlichen gelten als „Abfallprodukt“ der Produktion. Tausende von ihnen werden jedes Jahr kurz nach der Geburt getötet oder unter katastrophalen Bedingungen aufgezogen, weil sie wirtschaftlich wertlos sind. Tierschutzorganisationen haben in den letzten Jahren wiederholt Missstände dokumentiert: vernachlässigte Tiere, unbehandelte Infektionen, erschöpfte Mutterkühe. Manche Betriebe haben reagiert, ihre Haltungsbedingungen
verbessert, Zertifikate erworben. Doch in einem Markt, der vom Preisdruck großer Handelsketten bestimmt wird, bleibt Ethik oft ein Luxus. Hinzu kommt die Schattenwirtschaft, die in der Region Kampanien eine lange Tradition hat. Immer wieder werden Betriebe mit der sogenannten „Agromafia“ in Verbindung gebracht – Netzwerke, die Milchpreise manipulieren, Produkte fälschen oder Kuh- in Büffelmilch mischen. 2014 erschütterte ein Skandal die Branche, als tonnenweise Mozzarellas beschlagnahmt wurden, die nicht den DOP-Vorgaben („Denominazione di Origine Protetta“) entsprachen. Für viele kleine Produzenten war das ein Schock, aber auch ein Ansporn, Transparenz zu schaffen. Heute arbeiten einige Molkereien mit Rückverfolgungssystemen, lassen DNA-Analysen der Milch durchführen, um die Herkunft eindeutig zu garantieren.

Die Brüder haben ihre Arbeit auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Sie sind biozertifiziert, arbeiten gentechnikfrei und produzieren in überschaubaren Mengen.
DIE MILCHBUBEN – DER NAME KLINGT KECK, FAST TROTZIG. UND DAS IST ABSICHT.

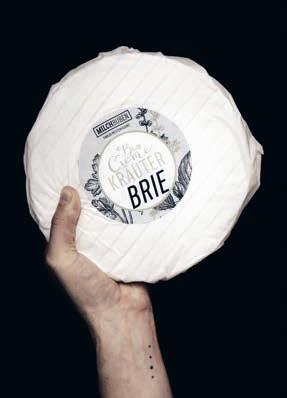
Am Ende des Tages, wenn die Sonne über den Feldern versinkt, legt sich wieder Stille über die Molkerei. Antonio schließt die Türen, während im Kühlraum hunderte Kugeln in klaren Wasserbädern glänzen. Sie sehen aus wie Perlen, rein und makellos. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Das „weiße Gold“ Italiens hat auch dunkle Schatten.
Alpine Feldversuche.
Zurück ins Unterland. Gemeinsam mit den Jungs von der Käserei Höflmaier in Oberösterreich und Michael Kerschbaumer von der Sennerei Kaslab’n Nockberge in Kärnten haben die Milchbuben den Käsereiverband „Karmage“ gegründet. Den nach eigenen Angaben „geilsten“ Käsereiverband. Zu dritt haben sie sich auf den Weg nach Italien gemacht, um das Mozzarellamachen zu lernen. Der Aufbruch war mitten in der Nacht, am Vormittag gab es schon die ersten Bilder auf Instagram. Im typischen weißen Kittel und mit Netzhaube am Kopf. Das Projekt „Mozzarella“ ist vielversprechend. In Oberösterreich, in Kärnten, aber auch in Tirol. Aus genannten Gründen wollen die Handelspartner mehr als verfügbar sein. Kurz, die Milchbuben kommen mit der Produktion kaum nach.
Was die Ehammers mit ihrem Mozzarellaprojekt zeigen, ist vielerlei. Dass Landwirtschaft nicht notwendigerweise festgefahrene Tradition bedeutet, sondern ebenso Innovation und Erfindergeist. Dass gute Lebensmittel auch sauber und fair produziert werden können und schließlich, dass sich Tirol nicht hinter einer Bergkäsewand verstecken muss. Wir können auch anders. Wir können auch weich. Und Thomas und Markus Ehammer von den Milchbuben können das ganz besonders gut. Eingangs haben wir die Frage gestellt, ob das mit dem Mozzarella gut gehen kann. Kann es! Jürgen_Schmücking
High above Hopfgarten in the Brixental Valley, on the slopes of the Penningberg, two brothers are working to redefine Tyrol’s cheese landscape: Thomas and Markus Ehammer – better known as Milchbuben (the Milk Boys).

The Ehammer family’s farm has stood on this spot since 1654, firmly rooted in agricultural tradition – and yet the young cheesemakers are forging their own path. Unlike generations before them, they no longer deliver milk to the dairy. Instead, they craft their own soft cheeses by hand, using the finest hay milk. It was a bold and visionary idea: in a region where hard cheese reigns supreme, they chose to specialise in soft-ripened cheese. With varieties such as “Original”, “Walnut”, and “Herb”, they have created a Tyrolean Camembert that is now recognised far beyond Austria’s borders. Their approach combines traditional knowledge, biodynamic farming, and contemporary brand philosophy – organic certified, free from genetic modification, and made in deliberately small batches.
The cows that provide their milk don’t live on the farm itself. Instead, the brothers work with regional organic farmers who feed their animals exclusively on hay and fresh grass – silage is strictly off limits. In doing so, the Ehammers have created a model that uni-
tes professional standards with genuine farming values. Thomas, originally a carpenter, and Markus, a qualified dairy technologist, founded the Milchbuben brand in 2016. Just a year later, their first cheese appeared on shop shelves. Today, hundreds of wheels mature in their ageing room – a fragrance of time, patience, and microbial magic. Their cheese, they say, is more than a product: it’s a taste of Tyrol itself. “We wanted to create something of our own,” Markus explains. And they certainly have.
These days, the Milchbuben are no longer limited to Camembert. Together with partners such as cheese expert Höflmaier and the Kaslab’n dairy in Carinthia, they are venturing into mozzarella made from Austrian hay milk. Demand is high, production can barely keep up, and the message is clear: Tyrol is capable of more than just hard cheese. Tradition doesn’t have to mean standing still – it can be the starting point for fresh ideas that reimagine both region and flavour. And the Milchbuben prove that soft can, indeed, be strong.


OLYMPIAHALLE
Die neue Show HORIZONS verbindet die kreative Kraft von HOLIDAY ON ICE mit Eiskunstlauf der Spitzenklasse, atemberaubender Akrobatik und einer innovativen, technisch ausgefeilten Performance. Das dynamische und frei bewegliche Bühnenbild formt sich immer wieder zu neuen Szenerien und wird aktiv von den Darsteller:innen genutzt.
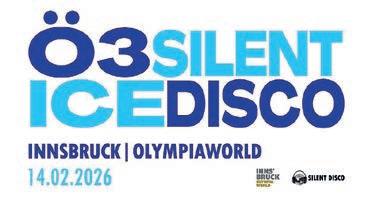
14.02.2026
AUSSENEISRING
VORSCHAU AUF DIE
NÄCHSTEN EVENTS

07.03.2026
OLYMPIAHALLE
Der “Freestyle Firestorm” zieht auf – denn die spektakulärste Freestyle Show Masters of Dirt kehrt zurück! Die weltbesten Freestyle Athleten bieten Actionsport-Family-Entertainment vom Feinsten und verwandeln die Olympiahalle in eine Welt des Unfassbaren!
13. Dezember 2025
Sascha Grammel Wünsch dir was!
09. Jänner 2026
Der Nussknacker
International Festival Ballet
31. Jänner 2026
Super 90´s Party
06. – 08. Februar 2026
Taekwondo
Austrian Open
13. – 15. März 2026
Dance Unit
Austria
04. April 2026
Hans Zimmer
The Immersive Symphony
11. April 2026
Pentatonix Tour 2026
28. – 31. Mai 2026
Dance Unit Finals
03. Juni 2026
Gigi d´ Agostino Tour 2026
Österreichs most unique Party gibt es auch “on Ice” und kommt natürlich auch nach Innsbruck. Sei dabei und tanz mit uns über das Eis. Stell dir vor, du bist von singenden und tanzenden Menschen umgeben, obwohl keine Musik zu hören ist! ALLE EVENTS FEEL THE CITY BEAT
ticketcorner@olympiaworld.at


Liebe geht durch den Magen – und genau diese Liebe spürt man in jedem einzelnen Krapfen, Knödel und Schlutzkrapfen, die in der Manufaktur von Heidi und Roland Dengg entstehen.
eit mehr als zwanzig Jahren widmet sich der Familienbetrieb in Tirol der handwerklichen Herstellung von Köstlichkeiten, die ihren ursprünglichen Charakter bis heute bewahrt haben. Vom ersten bis zum letzten Bissen schmeckt man die Verbundenheit zur Heimat, zur Regionalität und zur echten Handwerkskunst.
Besonders beliebt sind die klassischen Spinatschlutzkrapfen und Spinatknödel – jene Produkte, mit denen die Erfolgsgeschichte der Manufaktur begann. Viele Kundinnen und Kunden verbinden damit Kindheitserinnerungen, denn der Geschmack erinnert an Omas Küche: ehrlich, unverfälscht und mit viel Gefühl zubereitet. Gleichzeitig entstehen immer wieder neue Varianten, entwickelt aus Erfahrung, Inspiration und dem Austausch mit den Menschen, die die Denggs seit Jahren begleiten.
Von Beginn an stand fest: Die Denggs wollen kein Teil der industriel-
len Massenproduktion sein. „Wir fertigen unsere Produkte so, wie es echtes Handwerk verlangt – ohne künstliche Aromen, ohne Geschmacksverstärker und ohne Konservierungsstoffe“, betont Roland Dengg. Diese klare Linie prägt den Betrieb seit über zwei Jahrzehnten und ist für die Familie nicht verhandelbar. Die Natur liefert den Geschmack –

krapfen & knödel manufaktur GmbH
Innsbrucker Straße 11 6060 Hall in Tirol Tel.: +43 (0)5223/22441 office@dengg.info www.dengg.info
hochwertige, regionale Rohstoffe machen Zusätze schlicht überflüssig.
Bis ein Produkt fertig verpackt ist, wird es sechs bis sieben Mal von Hand bearbeitet. Jeder Schritt bleibt bewusst im eigenen Haus, um Qualität, Konsistenz und Geschmack zu gewährleisten. „So behalten wir die volle Kontrolle –und jedes Stück wird ein kleines Unikat“, erklärt Heidi Dengg. Kein Schlutzkrapfen gleicht dem anderen, und genau das macht die Spezialitäten so besonders.
Teilweise wird nach alten Tiroler Rezepturen gearbeitet, die über Generationen weitergegeben wurden. Diese dienen als Basis und werden saisonal neu interpretiert, um Abwechslung und Frische zu garantieren.
Neben dem Verkauf im eigenen Geschäft beliefert der Familienbetrieb auch den Gastronomiegroßhandel –ein verlässlicher Partner für ehrliche Tiroler Küche, nachhaltige Produktion und handgemachte Qualität, die man schmeckt.



In einer kleinen Garage in Imst hat sich Wolfgang Leiter einen Traum erfüllt. Er schmiedet Messer von unfassbarer Qualität und Eleganz. Seine Unikate sind mittlerweile gefragt und preisgekrönt, seine Auftragsbücher voll und die Wartezeiten entsprechend lang.
Fotos: Jürgen Schmücking
Ich treffe Wolfgang Leiter in seiner Garage. Dort, wo andere ihre Autos abstellen und Krempel lagern, hat sich der Messerschmied seine Werkstatt eingerichtet. Eine Garagenschmiede sozusagen. Der Ort der Schmiede ist nicht nur eine praktische Lösung. Weine von Garagenwinzern gehören zu den besten der Welt, und in einer anderen Garage in Los Altos in Kalifornien schraubten Steve Jobs und Steve Wozniak ihre ersten AppleComputer zusammen. Kurz, in Garagen kann Großartiges entstehen. Das gilt auch für die von Wolfgang Leiter in Imst. Hier lebt der Schmied seine Leidenschaft für Damaststahl aus, und hier entstehen hochwertige Messer für Köche und für Jäger und Sammler.
16 Jahre ist es her, dass sich Leiter in einer müßigen Stunde ein paar YouTube-Videos reingezogen hat, in denen es um das Schmieden von Messern ging. Als Schlosser und praktizierender Spengler war das Arbeiten mit Metallen längst Teil seines Lebens. Aber das mit den Messern, das faszinierte ihn. Immer wieder hat er sich das Video angesehen, hat recherchiert, was es mit diesem ominösen „Damast“ auf sich hat. Es hat ihm keine Ruhe gelassen. Also hat er mit dem Experimentieren begonnen. Das erste Blatt aus Eisen, ein selbst zusammengebastelter Ofen, ein Hammer. Mehr war da nicht am Anfang. Die ersten Versuche sind gescheitert. Die Lagen (dazu kommen wir noch) haben nicht gehalten. Das bedeutet, sie haben sich nicht zu einer festen Klinge gefügt. Wieder ins Netz und schauen, wie andere das machen.


Das Geheimnis des Damaszener Stahls liegt in der Kombination aus zwei oder mehr Sorten Stahl. Klassisch wird ein harter, kohlenstoffreicher Stahl mit einem weicheren, zähen Stahl verbunden. Der harte Anteil sorgt für Schneidleistung und Standzeit, der weichere für Elastizität und Bruchsicherheit. So entsteht ein Material, das in seiner Funktionalität kaum zu übertreffen ist. Während der Schmied die Lagen verschweißt und faltet, entsteht ein immer feineres Muster – ein Fingerabdruck des Herstellers, einzigartig bei jedem Stück.
Was genau sie machen und was nicht. Irgendwann die ersten Erfolge. Ein halbes Messer hat funktioniert, die andere Hälfte nicht. Ein Misserfolg zwar, aber perfekt, um zu analysieren, was man bei der einen Hälfte richtig und bei der anderen falsch gemacht hat. Leiter ist ein geduldiger Tüftler. Andere hätten wahrscheinlich schon längst alles hingeschmissen. Leiter hat weitergehämmert. Und irgendwann hat es dann gepasst. Das erste Unikat.
Der Blick nach Japan.
Damaststahl – oder „Damaszener Stahl“ – ist weit mehr als nur ein Material. Er ist eine Symbiose aus Technik, Handwerk und Ästhetik. Sein charakteristisches Muster, das an sanfte Wellen, Wasserwirbel oder Holzmaserung erinnert, entsteht nicht durch Gravur, sondern durch den Schichtaufbau verschiedener Stähle. Diese werden miteinander verschweißt, gefaltet, verschmiedet und erneut gefaltet –manchmal dutzende Male. Aus zwei oder mehr Sorten entsteht so ein Verbundstahl, dessen Struktur sowohl Härte als auch Zähigkeit vereint.
Das Herstellen von Damast erfordert Erfahrung, Geduld und ein tiefes Verständnis für die Eigenheiten der einzelnen Stähle. Bereits beim Feuerschweißen, wenn die Metallschichten bei rund 1.200 Grad miteinander verbunden werden, entscheidet sich, ob das Endprodukt gelingt. Zu wenig Hitze – und die Lagen verbinden sich nicht. Zu viel – und der Kohlenstoff, der für die
Härte sorgt, verbrennt. Anschließend folgt das Falten: Der Schmied verdoppelt die Schichten immer wieder, bis aus ursprünglich wenigen Lagen Hunderte oder gar Tausende werden. Nach dem Schmieden wird das Rohmesser geschliffen, gehärtet und geätzt. Erst durch das Ätzen mit Säure tritt das charakteristische Muster sichtbar hervor –dunkle und helle Linien, die den Verlauf der Schichten nachzeichnen. Das ist der Moment, in dem aus einem Stück Stahl ein Kunstwerk wird.
Doch Damast ist nicht nur schön. Er ist funktional. Ein gutes Damastmesser vereint Eigenschaften, die sonst schwer zu kombinieren sind: extreme Schärfe und gleichzeitig hohe Bruchfestigkeit. Es lässt sich leicht nachschärfen, bleibt jedoch lange schnitthaltig. Gerade in der Küche, bei der Jagd oder im Handwerk schätzen Profis diese Balance. Zudem sorgt die feine Struktur des Stahls für einen sauberen Schnitt – empfindliche Lebensmittel wie Fisch oder Gemüse werden nicht gequetscht, sondern glatt durchtrennt.
Neben dem klassischen Schweißverbunddamast gibt es heute auch industriell hergestellte Varianten, bei denen der Lagenaufbau maschinell erfolgt. Dennoch bleibt der handgeschmiedete Damast das Maß der Dinge – nicht nur, weil er in seiner Qualität oft überlegen ist, sondern weil jedes Messer eine individuelle Seele trägt. Kein Muster gleicht dem anderen, keine Linie wiederholt sich exakt.
Am Ende, wenn die Schneide geschliffen und der Griff montiert ist, liegt das fertige Messer in der Hand wie ein Stück Geschichte. Jede Welle, jede Linie im Stahl erzählt von Hitze, Druck und Geduld. Von der Verbindung zweier Metalle, die zusammen stärker sind als allein. Und von der Kunst, in der Präzision und Leidenschaft verschmelzen – so wie die Stähle im Feuer. Ein handgeschmiedetes Damastmesser ist da-

In Garagen kann Großartiges entstehen. Das gilt auch für die von Wolfgang Leiter in Imst, der dort einzigartige Damastmesser herstellt.



mit nicht einfach ein Werkzeug. Es ist ein Symbol für das, was Handwerk im besten Sinne bedeutet: Wissen, Können und die Liebe zum Detail.
„Mein Schatz“
Jetzt ist während unseres Gesprächs in der Schmiede noch etwas anderes passiert. Dazu ist vorweg vielleicht noch zu erwähnen, dass ich selbst eine Passion für gute Messer habe. Als leidenschaftlicher Jäger, Koch und Sammler bin ich quasi ein Volltreffer in Leiters Zielgruppe. Mit den Damastmessern war es bei mir allerdings keine Liebe auf den ersten Blick. Zuerst erschloss sich mir die Sinnhaftigkeit nicht. Die Idee mit dem Damast entstand, weil es bei Schlachten im Krieg existentiell wichtig war, dass ein Schwert nicht brach, wenn es gegen die Knochen des Gegners prallte. Für den nächsten Schwertkampf wäre das nämlich fatal gewesen. Aber wer braucht härtesten Stahl, wenn der Gegner eine Gurke oder eine Zwiebel ist? Heute sehe ich das anders. Messer aus Damast sind nicht nur funktionell und unglaublich scharf, sie sind auch geheimnisvolle Schönheiten. Ein Fest fürs Auge.
AM ENDE, WENN DIE SCHNEIDE GESCHLIFFEN
UND DER GRIFF
MONTIERT IST, LIEGT DAS FERTIGE MESSER IN DER HAND WIE EIN STÜCK GESCHICHTE.
Irgendwann sind wir am Thema der maßgefertigten Messer angekommen. Spätestens als Wolfgang Leiter davon zu erzählen begann, dass nach einem Erstgespräch die Dimension der messerführenden Hand abgemessen wird, hatte er mich. Wir haben das Interview kurz für ebendieses Erstgespräch und das Abmessen meiner Hand unterbrochen. Beim Material für den Griff haben wir uns nach einer längeren Diskussion für stabilisiertes Zwetschkenholz entschieden. „Stabilisierte“ Hölzer sind mit Acryl- oder Methylmethacrylat-Harz behandelte Hölzer, die dadurch formstabil, rissfest und wasserresistent werden. Eigenschaften, die für Messergriffe unerlässlich sind. Außerdem betont der Stabilisierungsprozess auch noch die Maserung des Holzes. Mein Griff, die Zwetschke, ist dunkel, fein strukturiert und bildet einen starken Kontrast zur etwas helleren Klinge. Womit wir beim Kern der Sache, der Klinge, wären. Es war der erste Rohling, der mir auffiel, als ich die Werkstatt betrat. Stattliche Klingenlänge und eine atemberaubend elegante und feingliedrige Maserung. Ein einzigartiges Muster, das an eine Vogelfeder erinnert. Dieses Muster entsteht nicht zufällig. Es ist das Ergebnis chirurgischer Präzision beim Schmieden, macht eine Heidenarbeit und zeugt von handwerklicher Meisterschaft. Letztlich macht mich Wolfgang Leiter noch darauf aufmerksam, dass das Messer nackt sein wird, und bietet mir auch gleich eine passende „Hose“ dafür an. Eine Lederscheide, ebenfalls von ihm selbst genäht.
Letztlich ist es genau das, wofür Wolfgang Leiter und seine Tiroler Messerschmiede stehen: solides Handwerk, hochwertiger Stahl. Messer in „Erbstückqualität“, wenn man so will. Leiter schmiedet aber auch Gröberes. Schwerter und Dolche zum Beispiel. Oder – für die ganz Mutigen – Verlobungs- oder Eheringe aus Damast. Jürgen_Schmücking


In a small garage in Imst, Wolfgang Leiter has fulfilled a dream. He forges knives of extraordinary quality and elegance.

What began as a private experiment inspired by a YouTube video has, over 16 years, evolved into a masterful craft and a sought-after brand. Wolfgang Leiter, originally a locksmith and tinsmith, gradually immersed himself in the world of Damascus steel – a material that unites tradition, technique, and aesthetics. His early attempts often failed, but through patience, experimentation, and persistence, he eventually achieved a breakthrough. Today, his knives are award-winning, his order books full, and waiting times long.
erties. Damascus knives combine extreme sharpness with high fracture resistance and lasting edge retention. They are not just tools, but works of art – each one a unique piece with its own soul and story. Etching reveals the patterns, transforming the steel into a visual experience.
Leiter’s knives go far beyond mere functionality. He creates custom pieces, precisely tailored to the user’s hand. Even the handle materials are carefully chosen, with high-quality resources such as stabilised plum wood that is durable, robust, and aesthetically striking. Every detail – from the blade to the leather sheath – is crafted by hand. In this way, Leiter’s work epitomises the fascination with skilled craftsmanship and the value of true handiwork in an automated world. His Damascus knives are tools of “heirloom quality” – timeless objects for chefs, hunters, collectors, and lovers of traditional metal art.
Damascus steel owes its character to a unique manufacturing process: different steels are welded together at extreme heat, folded, and reforged repeatedly until hundreds or even thousands of fine layers are created. These layers not only produce the distinctive wavy pattern but also give the steel exceptional propEnglish Summary


1 stunde kostenlos parken (tiefgarage gegenüber)



Als Tourismusland ist Tirol stark von Gastfreundschaft geprägt. Mit all ihren vielfältigen Angeboten trägt die Branche dabei ganz nebenbei zu einer sehr hohen Lebensqualität für die Tiroler Bevölkerung bei.
s war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als speziell die Bergtäler Tirols von bitterster Armut betroffen waren und tausende Kinder während der Sommermonate unter äußerst beschwerlichen Umständen zum Arbeiten ins Schwabenland pilgerten, um ihre armen Bergbauernfamilien zu unterstützen. Blickt man heute in die landschaftlich imposanten Täler Tirols, zeigt sich wahrlich ein ganz anderes Bild. Die Idylle der beeindruckenden Bergwelt ist geblieben, die bittere Armut indes ist gewichen.
Tirol hat sich vom Armenhaus Europas zu einem der begehrtesten Lebensräume der Welt entwickelt. Zu
verdanken ist diese Tatsache vielfach auch den zahlreichen Tourismuspionieren im Land, die mit unermüdlicher Kraftanstrengung touristische Angebote in den entlegenen Tälern geschaffen haben, an denen Gäste aus aller Welt ganz offensichtlich großen Gefallen finden.
Gewachsene Strukturen.
„Es ist eine Gastfreundschaft, die aus sich heraus über Generationen gewachsen ist“, betont Alois Rainer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol. „Wir haben in Tirol eine un-
glaublich tolle Struktur an Betrieben, die immer im Einklang mit der Natur gewachsen sind, vom ursprünglichen landwirtschaftlichen Betrieb über das Gasthaus und die Pension bis zum Hotelresort. Der Tiroler Tourismus denkt in Generationen, nicht in nackten Zahlen und evaluiert sich dabei ständig neu, indem er auf die Bedürfnisse der Gäste eingeht. Und vor allem schafft er eine touristische Infrastruktur, die den Lebensraum auch für die Tiroler Bevölkerung sehr attraktiv macht und eine hohe Lebensqualität schafft. Wir hätten ohne florierender Tourismuswirtschaft in Tirol bei weitem nicht so ein vielfältiges Freizeitangebot. Angefangen von Wanderwegen, Kletterstei-

„DIE TIROLER GASTFREUNDSCHAFT
IST AUS SICH HERAUS ÜBER GENERATIONEN GEWACHSEN.“
Alois Rainer
gen, den erlebnisreichen Angeboten der Bergbahnen im Sommer wie im Winter, Tourenski- und Rodelstrecken, die gastronomische Vielfalt – um hier nur einige zu nennen. Die touristische Infrastruktur kommt ja auch der heimischen Bevölkerung sehr zugute, die sämtliche Angebote ohne lange Anfahrtswege nutzen kann“, führt Rainer weiter aus.
Heimische Wertschöpfungskette.
Nebst der Tatsache, dass der Tourismus mit seiner Summe der regionalen Wertschöpfungsketten zum wirtschaftlichen Motor des Landes gewachsen ist, bringen die familiär geprägten Betriebe auch eine gute Durchmischung der gewerblichen Strukturen mit sich. „Rund 70 Prozent aller Ausgaben eines Tourismusbetriebes werden in der eigenen Region getätigt, 20 Prozent in Österreich und lediglich zehn Prozent der Leistungen werden aus dem Ausland importiert. Das unterstreicht, wie wichtig diese regionale

„DIE REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSKETTE DURCH DIE HEIMISCHEN TOURISMUSBETRIEBE IST WICHTIG FÜR DIE JEWEILIGEN REGIONEN.“
Thomas Geiger
Wertschöpfungskette in der jeweiligen Region ist“, unterstreicht Thomas Geiger, MBA, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol. Dem Vorwurf des „Overtourism“ in Tirol erklärt er eine ganz klare Absage: „Nein, wir haben keinen Overtourism in Tirol. Wir haben vielmehr ein Problem mit dem touristischen Durchzugsverkehr. Denn selbst in der Wintersaison 2021, als alle Grenzen dicht und Hotels geschlossen waren, gab es im Stubai- und Zillertal Stau von den Einheimischen zu den Skigebieten.“ Ein gewisses Maß an Entzerrung bringt auch die Öffnung der Branche zu anderen Buchungstagen, doch sehr viele Gäste nutzen – vermutlich auf Grund der Schulferien oder auch aus Gewohnheit – immer noch sehr gerne den Samstag als An- und Abreisetag.
Generationenübergreifende Gastfreundschaft.
Mit dem „Tiroler Weg – Perspektiven für eine verantwortungsvolle Touris-
musentwicklung“ setzt das Land ganz klar auf Qualität statt Quantität. Dass Tirol mit seiner unglaublichen Dichte an hochqualitativen Betrieben vor allem in puncto Qualität ganz weit vorne liegt, liegt wohl auch an der Tatsache, dass die meisten Häuser über Generationen familiengeführte Betriebe sind.
Es ist ein besonderer Charme, der in den Tiroler Hotels schon beim Betreten für ein Gefühl des Wohlfühlens und des Willkommenseins sorgt. Man spürt als Gast die Liebe zum Detail und die Leidenschaft der Gastgeber. Darin sieht auch Mag. Franz Staggl, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol, den Grund für die hohen Standards in den Tiroler Betrieben: „Die Hotelbetriebe sind über Generationen gewachsen und haben sich vielerorts aus landwirtschaftlichen Betrieben heraus entwickelt. Hier wird für die weiteren Generationen investiert, nicht für nackte Zahlen. Hier machen die Hoteliers keinen Job für ein Gehalt, sondern arbeiten aus innerem Antrieb heraus für ihren eigenen

Mag. Franz Staggl, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, und Anna Kurz, BA, Obfrau der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Tirol
„UNSERE TIROLER GASTGEBER WOLLEN NICHT NUR EIN WIRT SEIN, SIE WOLLEN IHR BESTES BIETEN.“
Anna Kurz
Generationenbetrieb. Die berühmte Tiroler Gastfreundschaft wird von den Hoteliersfamilien mit großer Leidenschaft gelebt und mit viel Liebe zum Detail zelebriert – das ist authentisch und kommt beim Gast gut an“, so Staggl. „Ein weiterer Vorteil dieser besitzergeführten Betriebe liegt auch darin, dass die Branche auf die Wünsche von den Gästen schnell reagieren kann. So findet aktuell gerade eine Verschiebung in Richtung Appartements und hochwertige Campingplätze statt. Dank unserer kleinteiligen Struktur können Betriebe ihr Angebot schnell anpassen. In Tirol findet man kaum große Blöcke von Appartementanlagen, die meisten sind kleine, besitzergeführte Häuser mit wenigen und individuellen Ferienwohnungen“, erläutert Spartenobmann Rainer.
Kreative Ideen in der Gastroszene.
Die gelebte Gastfreundschaft spiegelt sich auch in den zahlreichen Gast-
ronomiebetrieben wider. Auch hier findet sich eine hohe Dichte an Hauben- und Sternelokalen, Genuss mit allen Sinnen aus hochwertigen Lebensmitteln steht dabei im Vordergrund. „Auch wenn in den letzten Jahren ein gewisses Gasthaussterben stattgefunden hat, ist das Gasthaus nach wie vor ein Ort der Geselligkeit für Einheimische wie Gäste gleichermaßen“, betont Anna Kurz, BA, Obfrau der Fachgruppe Gastronomie. „Es ist ein Ort, wo unser Leben bis zu einem gewissen Grad stattfindet, wo sich Menschen zu unterschiedlichsten Anlässen treffen, wo Austausch stattfindet und Ideen geboren werden. Unsere Tiroler Gastgeber wollen nicht nur ein Wirt sein, sie wollen ihr Bestes bieten“, sagt Kurz über ihre Branchenkollegen. 92 Prozent der Tiroler Gastronomiebetriebe sind Familienunternehmen, die mit ihren unterschiedlichsten Kochkünsten auch einen öffentlichen Auftrag zur Versorgung von heimischen wie Urlaubsgästen, die in Ferienwohnungen oder Appartements nächtigen, erfüllen. „Wir
verspüren bei allen unseren Gästen einen Trend hin zu mehr Qualität statt Quantität. Sie konsumieren etwas verhaltener, legen jedoch mehr Wert auf hochwertige Qualität, ganz nach dem Motto: lieber ein gutes Glas Wein statt zwei Spritzer.
Angepasst an die Kundenwünsche versucht sich die Branche mit neuen und kreativen Konzepten von innen heraus zu stärken, beispielsweise mit neu interpretierten Frühschoppen, Lesungen oder diversen Brunchvarianten. Sehr am Herzen liegt der jungen Funktionärin auch die Nachtgastronomie, die vor allem für junge Menschen ein attraktives Angebot bieten kann. Hier würde sie sich von Seiten der Politik ein paar Erleichterungen wünschen, damit Barbetreiber wieder etwas einfacher ihre Konzepte umsetzen und verwirklichen können, um so der Jugend einen geschützten Raum für ihre geselligen Treffen zu bieten, in dem auch kulturelle Angebote wie Konzerte stattfinden können. „Generell stehen wir vor einer großen Übergabephase, bis 2030 werden an die 50 Prozent unserer Gastronomiebetriebe zur Übergabe anstehen. Es ist uns ein großes Anliegen, alle Unternehmensnachfolger zu bestärken, dass dies auch stattfinden wird“, so Kurz. Damit die leidenschaftliche Gastfreundschaft in Tirol auch weiterleben kann und Einheimische wie Gäste die kulinarische Vielfalt und das breite Freizeitangebot auch in Zukunft noch nutzen können.
Doris_Helweg






extra nativen Olivenöl, über aromatische Essige bis hin zu
Sie sind noch auf der Suche nach dem perfekten Geschenk? Egal ob Rot. Weiß. Rosé. Still oder prickelnd. Vom grüngoldenen Olivenöl, über aromatische Essige bis hin zu alkoholfreien Weinen. Bei uns finden Sie garantiert für jeden Geschmack das Richtige. Mit unserem umfassenden Geschenkservice können Sie sich nach Ihrer Auswahl relaxed zurücklehnen.
Wer sich gerne persönlich beraten lässt, dem steht unser Team in der Vinothek, Heiliggeiststraße 10 in Innsbruck (Kundenparkplatz vor der Türe) mit Rat und Tat zur Seite. So einfach und bequem geht Weinkaufen!

Crémant de Loire Rosé Brut Zartrosa und fruchtig mit schönem Schmelz, Aromen von roten Beeren, Rosen und Kräutern. Lebendig, elegant mit feiner Struktur.
€ 12,-

[statt Listenpreis € 13,95 je 0,75-l-Flasche] Sonderpreis pro Flasche
„Wir stehen dieses Jahr als helfende Hände des Christkindls bereit! Unser Geschenkservice sorgt dafür, dass Ihre Liebsten edle Präsente erhalten – stressfrei und perfekt für die Weihnachtszeit.“ - Elisabeth Gottardi
„Als Helfer des Christkinds sorgen wir dafür, dass Ihre Liebsten sich über liebevoll ausgewählte Geschenke freuen dürfen – entspannt und perfekt für die Weihnachtszeit.“- Elisabeth Gottardi
Ihre Vorteile beim Schenken mit Gottardi:
Ihre Wunschadresse
eine große Auswahl an Weinen aus aller Welt handverlesene Geschenkpakete – einfacher geht’s nicht! verlässliche Zustellung an Ihren Wunschort personalisierte Etiketten ab 36 bestellten Flaschen Beilage von persönlichen Grußkarten (passend zum Anlass)
Grußkarten, passend zum Anlass



D‘ASTI 2022 CHRISTMAS EDITION
Cascina Castlèt, Costigliole d‘Asti, Piemont

Der Barbera d‘Asti in der limitierten Weihnachtsedition bringt festliche Stimmung direkt auf den Tisch! Ein Klassiker verpackt im charmanten Weihnachtslook – das perfekte Geschenk oder Begleiter für genussvolle Momente.
Jetzt erhältlich, nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht!
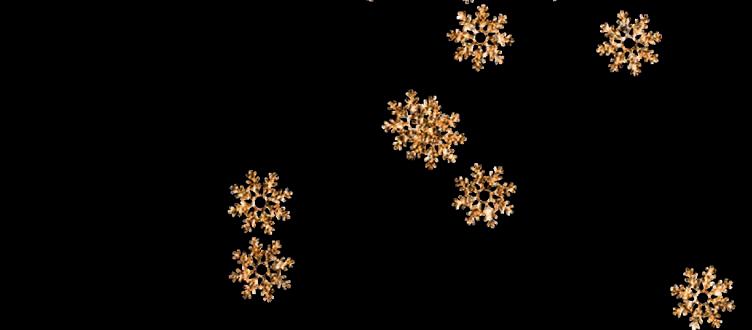
Crémant de Loire Brut Feinperlig und elegant mit Noten von Zitrus, grünen Äpfeln und wildem Honig. Ein klassischer
Ein herrlicher Duft, der an Blumen und frische rote Früchte erinnert. In der Nase saftige Noten von frischen Trauben, Kirschen und Zwetschken kombiniert mit Anklängen von roten Beeren und einer leichten Würze.
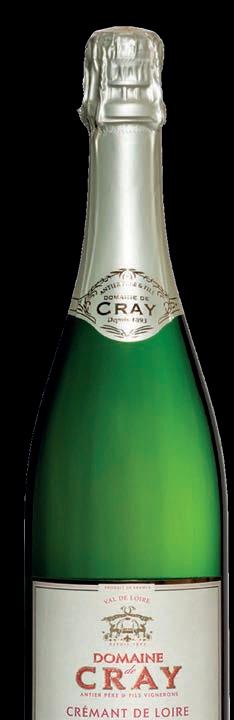
Unser Genusstipp: Der Barbera d‘Asti passt perfekt zu warmen Vorspeisen, Nudelgerichten, gegrilltem Fleisch und nicht allzu reifem Käse.
[statt Listenpreis € 13,95 je 0,75-l-Flasche] Sonderpreis pro Flasche
EXKLUSIV BEI GOTTARDI IN DER 0,75-L UND 1,5-L FLASCHE
Crémant – frisch, harmonisch und perfekt zum Anstoßen. € 12,-
Jetzt alle aktuellen Angebote entdecken!

Das ganze Jahr über ist unsere Heimat reich an regionalen Genüssen. Das Gütesiegel „Qualität Tirol“ steht für Produkte, die in der Region gewachsen und veredelt sind, und damit für das Herkunftsland Tirol und dessen hochwertige Lebensmittel. Unser wärmendes Menü für kalte Tage.
1–2 „Qualität Tirol“ Camembert
2 „Qualität Tirol“ Goggei
Semmelbrösel
„Qualität Tirol“ Wieshofer’s Weizenmehl
(Type 700)
1 Glas „Qualität Tirol“ Butterschmalz
Salz, Pfeffer
Salate nach Verfügbarkeit
Preiselbeermarmelade
Dressing
1 EL „Qualität Tirol“ Waldhonig
1 EL „Qualität Tirol“ Senf pur
1 EL Olivenöl
1 EL Zitronensaft
3–4 EL Wasser
Salz, Pfeffer
» Camembert in je 12 Stücke (Ecken) schneiden.
» Etwas Mehl und Semmelbrösel auf je einen Teller geben, die Eier in einer flachen Schüssel aufschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen (Panierstraße vorbereiten).
» Die Käsestücke im Mehl wenden, in die Eimasse tauchen und in den Bröseln wälzen. Anschließend die Stücke erneut in die Eiermasse tauchen und ein zweites Mal in Bröseln wenden. (Darauf achten, dass die Käsestücke komplett mit Panier bedeckt sind, damit der Käse beim Herausbacken nicht austritt.)
» Salate waschen und in mundgerechte Stücke teilen.
» Alle Zutaten für das Dressing in eine Schüssel geben und kräftig vermengen.
» Salate auf einem Teller mit Dressing und Preiselbeeren anrichten.
» Butterschmalz in einem Topf erhitzen und den Camembert schwimmend auf beiden Seiten goldbraun backen. Den Camembert etwas abtropfen lassen und mit dem Salat noch heiß servieren.

Dauer: 30 Minuten
1 „Qualität Tirol“ Wieshofer’s
Backmischung Bauernbrot
4–6 Beinscheiben vom „Qualität Tirol“
Grauvieh Almochs
3 „Bio vom Berg“ Zwiebeln
3 „Bio vom Berg“ Knoblauchzehen
3–4 „Qualität Tirol“ Karotten
½ Tiroler Sellerie
½ Tiroler Lauch
2 EL Tomatenmark
2 Zweige Rosmarin
300 ml Rotwein
1 l Rindssuppe
1 EL Wieshofer’s Weizenmehl
Salz, Pfeffer
2 EL „Qualität Tirol“ Butterschmalz (zum Anbraten)
1 EL „Qualität Tirol“ Modlbutter
Cremepolenta
800 ml Wasser
140 g „Bio vom Berg“ Polenta
60 g „Qualität Tirol“ Modlbutter
80 g „Qualität Tirol“ Tiroler Almkäse g. U.
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
1 Lorbeerblatt
1 TL Salz
Zubereitung
» Wurzelgemüse grob schneiden und zur Seite stellen.
» Beinscheiben salzen und in Butterschmalz auf beiden Seiten scharf anbraten. Anschließend aus dem Bräter nehmen und das übrige Butterschmalz abgießen. Das Wurzelgemüse mit etwas Butter in den Bräter zum Bratensatz geben und bei mittlerer Hitze anrösten.
» Das Gemüse mit dem Mehl stauben und kurz anrösten, dann das Tomatenmark zugeben und sobald sich ein oranger Belag am Boden gebildet hat, mit Rotwein ablöschen. Diesen stark einreduzieren lassen und anschließend mit Suppe aufgießen.
» Die Beinscheiben und die Rosmarinzweige in den Bräter geben und abgedeckt bei 140 °C Heißluft ins bereits vorgeheizte Backrohr geben. Falls notwendig, die Beinscheiben mit etwas Wasser aufgießen und zirka 3 Stunden schmoren lassen.
» Für die Cremepolenta Wasser mit Salz, Rosmarin, Thymian und Lorbeerblatt aufkochen, zur Seite stellen und ca. 5 Minuten ziehen lassen, anschließend die Gewürze aus dem Wasser nehmen.
» Wasser erneut aufkochen lassen und die Polenta in das kochende Wasser einrühren. Die Polenta ca. 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis sie aufgequollen ist. Zum Schluss die Butter und den geriebenen Tiroler Almkäse g. U. unterrühren, bis der Käse mit der Polenta verschmolzen ist.
» Die cremige Polenta mit den Beinscheiben, Wurzelgemüse und etwas Sauce anrichten und gleich servieren.
Dauer: 3,5 Stunden


Zutaten für 4 Waffelherzen
2 „Qualität Tirol“ Goggei
60 g Staubzucker
60 g „Qualität Tirol“ Wieshofer’s Weizenmehl (Type 700)
1 TL Zitronensaft
1 Prise Salz
1 Msp. Backpulver
250 ml „Bio vom Berg“ Schlagrahm
200 g Zartbitterschokolade
Minze (frisch)
» Zartbitterschokolade in Stücke brechen und in eine Schüssel geben. Den Schlagrahm kurz aufkochen lassen und heiß über die Schokolade gießen. Die Masse rühren, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist und sich mit dem Schlagrahm verbunden hat.
» Das Schokoladen-Schlagrahm-Gemisch (Ganache) etwas abkühlen lassen und anschließend mind. 6 Stunden im Kühlschrank kaltstellen.
» Eier trennen und das Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Den Zucker nach und nach zum Schnee geben, den Zitronensaft dazugeben und mixen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
» Die Dotter nacheinander unter den Eischnee mixen. Das Mehl mit dem Backpulver zügig unter die Masse heben.
» Das Waffeleisen aufheizen und nach Anleitung vorbereiten (einfetten).
» Etwas Teig in die Mitte vom Waffeleisen geben und schließen. Waffeln ca. 2–3 Minuten goldbraun backen und auf einem Gitter auskühlen lassen.
» Die Ganache aufmixen und in einen Spritzsack füllen.
» Die Waffelherzen zerteilen und die Ganache aufspritzen, so werden die Waffeln mit der Creme aufgeschichtet. Bis zum Servieren kühlstellen. Vor dem Servieren mit Staubzucker, Schokoraspeln und etwas frischer Minze garnieren.
Dauer: 1 Stunde (+ mind. 6 Stunden Kühlzeit)
Weitere Infos zu sämtlichen Produkten mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ und deren Bezugsquellen sowie einen Überblick über aktuelle regionale Produkte finden Sie unter qualität.tirol
Viele weitere Rezepte finden Sie hier.

Die auf 2.344 Metern Seehöhe hoch über Schwaz thronende Kellerjochkapelle bietet einen atemberaubenden Blick bis ins Karwendel – ein Ort, der seit Jahrhunderten Menschen berührt und ein echter Herzensplatz. Heuer ging sie bei der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ als Tirol-Vertreter ins Bundesländerrennen und wurde letztlich als zweitschönster Platz Österreichs ausgezeichnet. Erbaut im 16. Jahrhundert von den Schwazer Knappen, wurde die Kapelle nach einem Brand 1928 zu Ehren des heiligen Antonius von Padua neu errichtet.

Das traditionsreiche „Badl“ in Längenfeld ist zurück. Kostenlose Becken mit dem original Längenfelder Schwefel-Heilwasser sowie eine Ausstellung zur 450-jährigen Bädergeschichte schlagen dabei eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das Wasser stammt aus der Bohrung „Therme 1“ in rund 920 Metern Tiefe und tritt mit einer Temperatur von 24,8 °C zu Tage. Das Längenfelder Schwefel-Heilwasser ist für seine wohltuende Wirkung beispielsweise bei Gelenkserkrankungen, Muskel- und Nervenschmerzen, Gefäßerkrankungen oder zur Rehabilitation nach Unfällen bekannt.

DER WERT DER TRADITION
Tirol hat mehr Musikkapellen als Gemeinden, sie sind tragende Säulen des sozialen Gefüges. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Tiroler Blasmusikverband gehen die Tiroler Landesmuseen in der Ausstellung „Spielweisen. Was Blasmusik sein kann“ im Tirol Panorama der Frage nach, wann und warum Blasmusik diesen herausragenden Stellenwert erlangt hat, und werfen einen tiefen sowie kritischen Blick auf die Geschichte. Die Ausstellung ist bis 6. Juli 2026 zu sehen.

Luftgetrocknet. André Vögele züchtet auf seinem 300 Jahre alten Schlotthof in Innsbruck Pustertaler Sprinzen und macht daraus etwas ganz Besonderes: Alpenjerky nämlich, also eine Art Trockenfleisch, das man snacken kann oder das sich auch ganz gut auf Wanderungen als Proviant macht. alpenjerky.at

Zitronen-Bussi. Ein Soda-Zitron ist der ultimative Frischekick – auch im Winter. Seit einiger Zeit gibt’s eine 100 Prozent natürliche Version aus Schwoich und uns gefällt alles daran. Von der Verpackung über den Inhalt bis zum Onlineauftritt. soda-zitron.at
Schneeflocken sind die Schmetterlinge des Winters.

Anfang Oktober wurde der Hotelguide 2026 von Gault&Millau veröffentlicht. Dabei schlug die große Stunde der heimischen Hotellerie. Im Mittelpunkt stand ein Genießerhotel, das in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Kulinarikszene gerückt ist: der Sonnenhof von Christina und Rainer sowie Madlen und Patrick Müller in Grän im Tannheimer Tal. Mit der Ernennung zu Österreichs „Gourmethotel des Jahres“ hat sich das 4-Sterne-Superior-Haus nun endgültig unter den alpinen Topadressen etabliert. Und mit dem Gewinn des „Ambiente Awards“ reiht sich mit dem Boutiquehotel Rattenberg von Barbara Simmer und Martin Partoll ein weiterer Sieger aus Tirol ein. Die kleinste Stadt Österreichs hat damit ein ausgezeichnetes, neues Aushängeschild.

Wenn Viktoria Fahringer den Kochlöffel schwingt, duftet es nach Heimat – und nach Zukunft. Schon als Kind war sie mittendrin im Gasthaus ihrer Eltern. Am Salatposten in der Küche, bei den Gästen im Restaurant. Mittlerweile ist aus dem neugierigen Gasthauskind eine Zweihaubenköchin geworden und der Tirolerhof in Kufstein zu dem, was er eigentlich immer schon war: Viktorias Home. Kürzlich hat Viktoria Fahringer ihr erstes Kochbuch „Meine Tiroler Welt“ (Brandstätter Verlag, 224 Seiten, EUR 36,–) veröffentlicht, in dem sie wunderbare saisonale Wohlfühlrezepte mit Reportagen über Land und Leute kombiniert. Dazu ist der gleichnamige Film erschienen – zum Ansehen scannen Sie einfach den QR-Code.
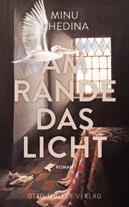
Atmosphärisch. Bereits der Debütroman „Die Korrektur des Horizonts“ der Autorin Minu Ghedina wurde mit großer Begeisterung aufgenommen, nun legt die Innsbruckerin mit „Am Rande das Licht“ (Otto Müller Verlag, 384 Seiten, EUR 28,–) ihren neuen Roman nach. Er erzählt von der Suche nach dem eigenen Weg und fragt, was noch zählt, wenn die Werte, mit denen man aufwächst, später nicht mehr gelten.

2016 ist Maximilian Moser mit der Mission gestartet, ein natürliches Deo zu entwickeln, das auch wirklich hält, was es verspricht. Nach zwei Jahren Arbeit war es so weit. 2018 hat PIMO seine erste Deocreme auf den Markt gebracht und eine klare Philosophie: Was dem Menschen guttut, wird verwendet, alles andere und jeglicher Schnickschnack wird weggelassen. Neben der natürlichen Deocreme gibt es heute noch viel mehr im PIMO-Sortiment. Produziert werden alle Produkte zu 100 Prozent in Tirol. www.pimo.at
Auch für 2026 gibt es wieder den beliebten Tirol-Kalender aus dem heimischen TyroliaVerlag – diesmal mit eindrucksvollen Stimmungsbildern aus allen Jahreszeiten vom Innsbrucker Fotografen Peter Umfahrer, der Tirol in all seiner Einzigartigkeit einfängt: Ein modernes Land mit wilder Berglandschaft, schimmernden Seen, lieblichen Tälern und Dörfern, in denen manchmal die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Das Land im Gebirge weiß immer zu faszinieren, in jedem Monat neu.

Erscheinungsweise: 2 x jährlich _Auflage pro Magazin: 25.000 Stück
Herausgeber & Medieninhaber: eco.nova Corporate Publishing Senn & Partner KG, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/290088, info@dastirolmagazin.at, www.dastirolmagazin.at _Chefredaktion: Uwe Schwinghammer _Redaktion: Marian Kröll, Elisabeth Zangerl, Andreas Hauser, Jürgen Schmücking, Marina Bernardi, Doris Helweg _Mitarbeit: Martin Weissenbrunner _Layout: Tom Binder _Anzeigenverkauf: Ing. Christian Senn, Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin, Yvonne Knoll, BA _Fotoredaktion: Andreas Friedle, Marian Kröll, Isabelle Bacher, Tom Bause _Übersetzungen: Viktoria Leidlmair _Lektorat: Mag. Christoph Slezak _Druck: RWf Frömelt Hechenleitner GmbH _Unternehmensgegenstand: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art _Coverbild: Christian Mair
Tirol Magazin


Durch frischen Pulverschnee stapfen und reine Bergluft einatmen. Tagsüber Sonne tanken und nachts unterm Sternenhimmel träumen - Lass dich von der Ruhe und Stille der Natur inspirieren und spüre, wie sich die Sinne öffnen. Genieß die Freiheit Osttirols, rundum verwöhnt und begleitet von heimischen Gastgeberfamilien. Erlebe dein Bergabenteuer in Osttirol nach unseren Grundsätzen:
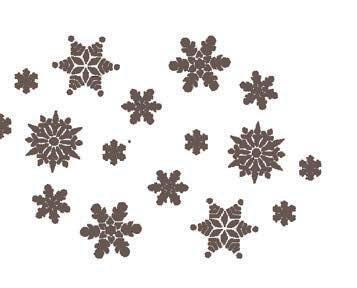
Natur erhalten • Natur schmecken • Natur erleben
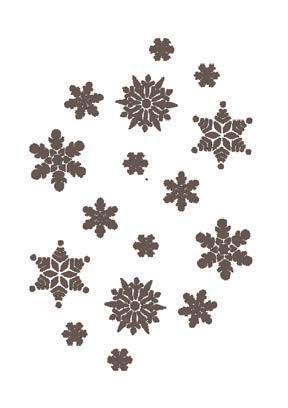
In unseren Nationalpark Partnerbetrieben wird Nachhaltigkeit großgeschrieben, das ist Urlaub mit kleinem Fußabdruck und großen Erlebnissen. Genieß die regionale Küche mit traditionellen Gerichten aus frischen, saisonalen Zutaten. Lass dich von den natürlichen Aromen verführen und tauche ein in die kulinarische Vielfalt Osttirols.
Wir geben dir eine persönliche Empfehlung zum Abschalten - Lass deine Sinne arbeiten – und entdeckte den Nationalpark Hohe Tauern bei einer geführten Schneeschuhwanderung, Nature Watch WILDe Überlebenskünstler, Magische Naturschätze oder Winterzauber am Sonnenbalkon stehen auf dem Programm.
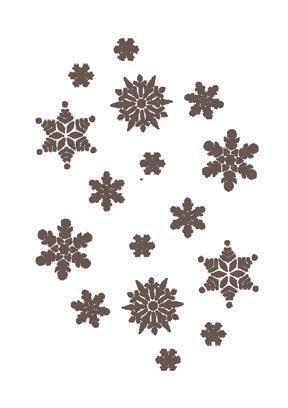
Nachhaltig reisen mit gutem Gefühl
05.12.2025 bis 20.03.2026
• 7 Nächte im Partnerbetrieb deiner Wahl
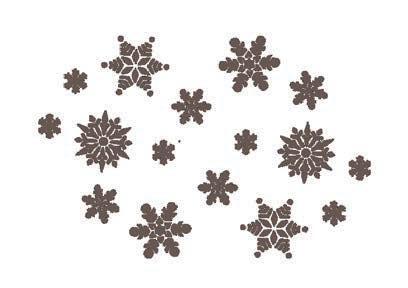
• Nationalpark Rangerwanderung mit Nature Watch
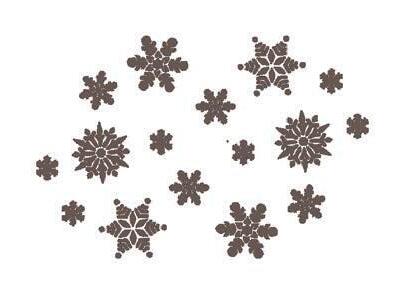
• Kostenlose Benutzung der Busse in ganz Osttirol
• Regionaler Willkommensdrink in deiner Unterkunft
• Nationalpark*gut*schein im Wert von 20 € zum Kennenlernen der Nationalpark Kulinarik
• Leitfaden zum Abschalten „Die Sinne arbeiten lassen“

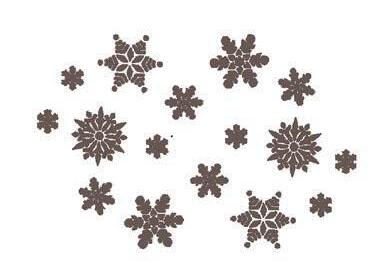
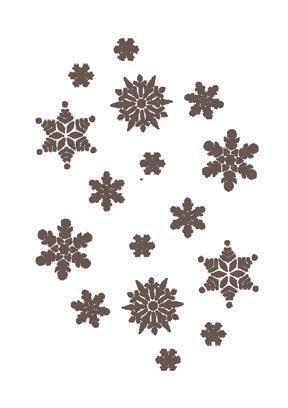
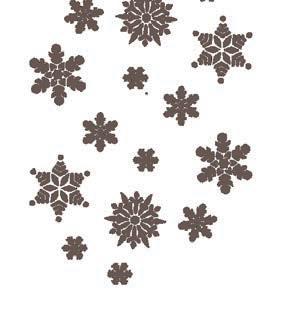

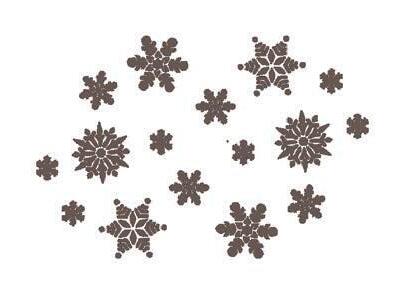
Jetzt in deiner gewünschten Kategorie buchen (Privatzimmer, Bauernhof, Gasthof oder 4* Hotel).
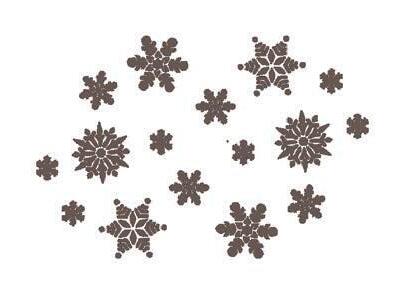
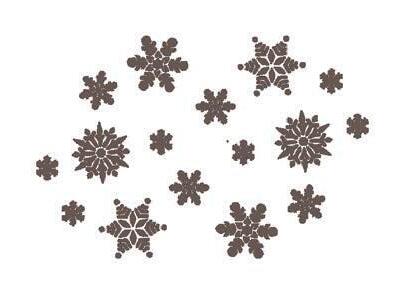
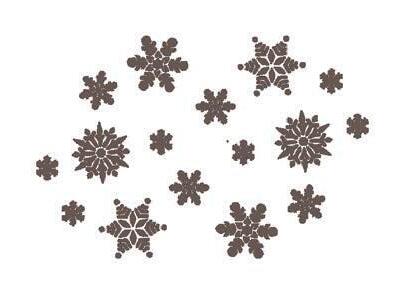
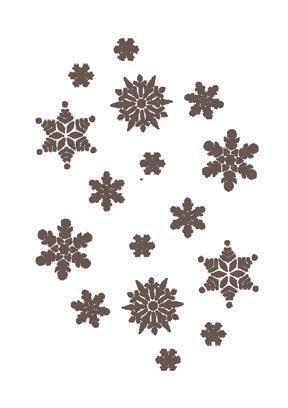

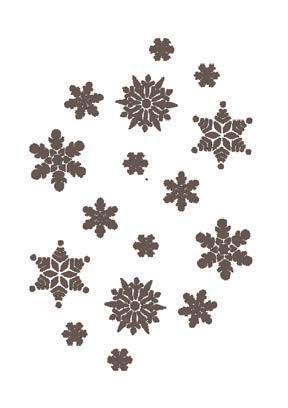
Präsidentschaft Tirol 2025 - 2027 Grenzenlose Kraft.

