GENDERMEDIZIN: Neue Daten zur Frauengesundheit verpflichten.
BRUSTKREBS: Ein von Innovationen getriebenes Forschungsgebiet.
MENTALE ÜBERFORDERUNG: Mit Selbstfürsorge zurück ins Lot.


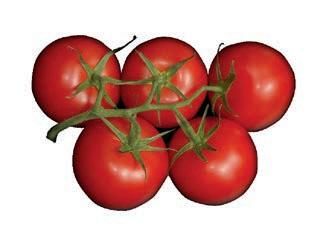
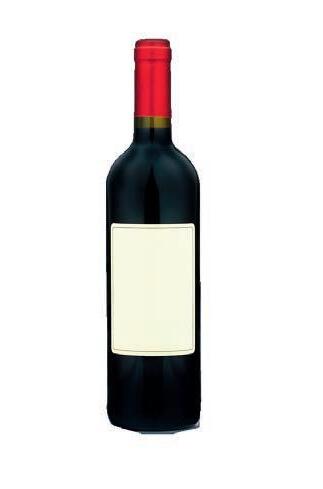







Weitere Infos unter www.alles-essen.at



GENDERMEDIZIN: Neue Daten zur Frauengesundheit verpflichten.
BRUSTKREBS: Ein von Innovationen getriebenes Forschungsgebiet.
MENTALE ÜBERFORDERUNG: Mit Selbstfürsorge zurück ins Lot.


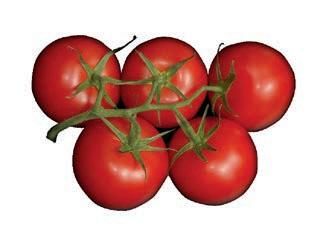
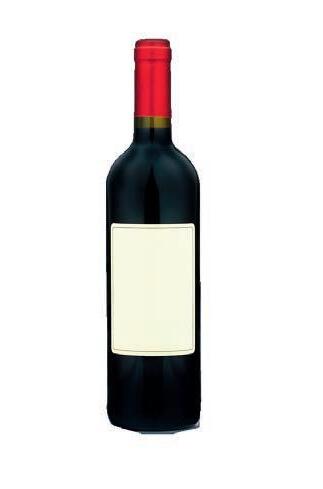







Weitere Infos unter www.alles-essen.at


Ein großartiger Marathon durch die Welt der Frauengesundheit liegt hinter uns – und nun liegt er vor Ihnen. Sie halten die zweite Ausgabe von medica – dem Podcastmagazin für Frauengesundheit – in Ihren Händen und wir freuen uns sehr, Sie darin wieder in spannende, erstaunliche, erschütternde, hoffnungsreiche und überraschende Themenwelten zu entführen. Themenwelten, die um die Frauengesundheit kreisen selbstverständlich. Denn Frauengesundheit ist die Triebfeder des medica-Magazins und der medicaPodcasts, die es Ihnen ermöglichen, die Gespräche mit den Expertinnen und Experten zu hören, wo auch immer Sie gerade sind und was auch immer Sie gerade machen.
Der Spannungsbogen dieser Ausgabe ist so groß wie breit. Er reicht von einer Lücken offenbarenden Befragung der Frauen zur tatsächlichen beziehungsweise von ihnen erlebten Gesundheitsversorgung über Themen wie Endometriose, Migräne, mentale Überforderung, unspezifischen Schwindel oder Brustkrebs bis hin zu den Tücken der Schilddrüse und des weiblichen Knies, den faszinierenden Eigenschaften der Gebärmutter oder dem Erste-Hilfe-Wissen, das bei Notfällen mit Babys und Kleinkindern unbedingt nötig ist, sind Babys doch keine kleinen Erwachsenen.
Ein wenig beunruhigen können die Einblicke auch, weil die Ausgangslage, die Lage der Frauengesundheit, ein Mehr an Wissen und Wissenschaft so dringend wie zwingend macht. Es kann nicht oft genug betont werden: Über Jahrzehnte galt in der medizinischen Forschung der junge, weiße Mann als Maßstab für Diagnosen, Therapien und Dosierungen. Frauen wurden als leichte Männer betrachtet – eine Leichtfertigkeit, die für Frauen fatale bis lebensgefährliche Folgen haben kann. Um Frauen die gleichen Voraussetzungen für ein gutes, gesundes Le-

ben zu bieten, wie Männer sie gewohnt sind, muss noch unfassbar viel getan, geforscht und umgesetzt werden.
Unsere wunderbaren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner helfen dabei, Frauen bewegende Fragen zu beantworten, und sie animieren auch dazu, Fragen ohne Zurückhaltung zu stellen. Die Regisseurin und Produzentin Karin Berghammer tut das etwa im Zusammenhang mit dem Hebammenwesen und regt Schwangere dazu an, ihre Bedürfnisse klar zu formulieren. Und Marlies Raich, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Welt, tut’s, indem sie junge Spitzensportlerinnen auffordert, über alles, was sie bewegt, offen zu reden.
Offen zu reden, Fragen zu stellen und mit den Antworten die Frauen zu stärken ist es auch, wozu das Podcastmagazin medica beitragen will. Weil Wissen nicht nur gesund macht – Wissen macht stark.
Viel Spaß beim Lesen und Hören wünscht Alexandra Keller, Chefredakteurin
Wie Sie vom QR-Code zum Podcast kommen:
1. Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Smartphone.
2. Halten Sie die Kamera über den QR-Code, bis ein Hinweis/Link erscheint.
3. Tippen Sie auf den Link, der eingeblendet wird, und schon sind Sie beim Podcast.

„EIN SPIEGEL DER ERLEBTEN QUALITÄT IM GESUNDHEITSWESEN“
Frauengesundheit: Verpflichtender Datenschatz
Simone Davidsen Soziologin am Tirol Institut für Qualität im Gesundheitswesen der fh gesundheit – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol

„FÜR MICH HAT ES NIE ZWEIFEL GEGEBEN“
Tabubrüche für Athletinnen
Marlies Raich Weltklasse-Skirennläuferin mit 35 Slalomsiegen, Unternehmerin, Moderatorin und Mutmacherin

„ICH SEHE EINE SEHR POSITIVE ENTWICKLUNG“
Endometriose: Schmerzhaftes Chamäleon
Beata Seeber Gynäkologin und Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität Innsbruck

„SIE DARF NICHT ALS ISOLIERTES ORGAN BETRACHTET WERDEN“
Die Schilddrüse: Motor des Körpers
Gudrun Metzler Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin an der Longevity Clinic Lanserhof in Lans

„ES GIBT KEIN VERGLEICHBARES ORGAN“
Die Gebärmutter: ein Wunderwerk
Stephan Kropshofer Gynäkologe und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

„GEWICHTSREDUKTION BEWEGT ZAHLREICHE MENSCHEN“
Medizinische Ernährungsberatung
Stefan Riml Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Leiter von riml aesthetics in Sistrans

„DIE BESTE ZEIT FÜR MIGRÄNEPATIENTINNEN“
Im Bann der Attacken
Gregor Brössner Facharzt für Neurologie und Leiter der Ambulanz für Kopfund Gesichtsschmerzen an der Uniklinik Innsbruck

„DAS GEFÜHL, DIE MACHT ÜBER SICH ZU VERLIEREN“
Schwindel: Symptom, das Angst macht
Claudia Unterhofer Neurochirurgin, Wirbelsäulenspezialistin und Fachärztin für manuelle Medizin in Hall und Innsbruck
In Kooperation mit der


„DIE FRÜHE DIAGNOSE IST ENTSCHEIDEND“
Brustkrebs: Gute Nachrichten
Michael Hubalek Gynäkologe und Spezialist für Brustkrebs und Brustrekonstruktion in Schwaz und Innsbruck

„MENTALE GESUNDHEIT IST ZENTRALE GRUNDLAGE“
Die Kraft der Selbstfürsorge
Melanie Robertson
Klinische, Neuro- sowie Gesundheitspsychologin unter anderem im Gesundheitszentrum Park Igls

„LEBENSQUALITÄT IST SO WICHTIG WIE DER BEHANDLUNGSERFOLG“
Onkologie: Quality of Life
August Zabernigg Internist, Hämatologe sowie Onkologe und seit 2015 Leiter der Inneren Medizin am BKH Kufstein

„MIT ERSTER HILFE KANN ICH GANZ VIEL BEWIRKEN“
Beherzt handeln bei Baby-Notfällen
Daniela Scholer
Kinder- und Jugendkrankenpflegerin, Expertin für Baby- und Kleinkind-Themen und Gründerin von Nestlingszeit in Innsbruck

„DIE GUTE OP IST DIE HALBE MIETE“
Frauensache Kreuzbandriss
Katja Tecklenburg Unfallchirurgin, Orthopädin und Kniespezialistin an der Sportclinic medalp in Imst

„SO SCHNELL WIE MÖGLICH RETOUR“
Selbstheilungs-Kick mit Eigenblut
Jürgen Oberladstätter Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im Team der Praxisgemeinschaft Unfallchirurgie in Innsbruck

„DER IDEALZUSTAND WÄRE EINE EINS-ZU-EINSBETREUUNG“
Hebammenwesen: Frauenberuf unter Druck
Karin Berghammer Österreichische Regisseurin, Produzentin und FranzGrabner-Preisträgerin mit vielen Jahren Berufserfahrung als Hebamme

Mit einer Befragung, die essenzielle Daten für die Tiroler Frauengesundheitsstrategie lieferte, wurden nicht nur wichtige Wissenslücken zur tatsächlichen beziehungsweise alltäglichen Gesundheitsversorgung der Frauen geschlossen. Mit der Studie wurde den Tiroler Frauen auch eine starke Stimme gegeben. In einigen Bereichen – wie etwa dem Gewaltschutz – schreit sie förmlich nach Veränderungen und Verbesserungen.
Simone Davidsen war als Mitglied des Forschungskonsortiums an der Erarbeitung wie Auswertung der Studie beteiligt – und sie sagt: „Die Befragung ist wirklich ein Spiegel der erlebten Qualität im Gesundheitswesen und da zeigen sich sowohl positive als auch negative Seiten – Licht und Schatten.“
Der Schatten zuerst. Denn er ist sprichwörtlich gewaltig. Jede dritte Tirolerin gibt an, psychische oder physische Gewalterfahrungen gemacht zu haben. Und nur 17,1 Prozent der betroffenen Frauen fühlten sich in dem Zusammenhang gut betreut. „Die Zahlen sind schockierend. Ich denke, das ist ein unerwartetes Ergebnis gewesen“, sagt Simone Davidsen. Die auf Qualität und Prozessmanagement im Gesundheitswesen speziali-
Simone Davidsen ist Soziologin und auf Qualität und Prozessmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert. Sie war für die die fh gesundheit maßgeblich an der Erarbeitung und Auswertung der Studie zur Tiroler Frauengesundheit beteiligt.
„Mehrfachbelastungen sind auf jeden Fall real und wirken sich auch direkt auf die Gesundheit der Frauen aus.“
Simone Davidsen
sierte Soziologin bezieht sich damit auf die zielgruppenspezifische Befragung zur Frauengesundheit in Tirol, deren Endbericht im November 2024 vorgelegt und die Grundlage für die im März 2025 beschlossene Tiroler Frauengesundheitsstrategie wurde. In dem umfangreichen strategischen Papier wurden 34 konkrete Handlungsfelder und die Schwerpunkte Prävention, Sexualpädagogik, psychische Gesundheit und Gewaltschutz genannt beziehungsweise festgehalten. In ihrem Vorwort zur Strategie betonte die Tiroler Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele, dass diese „ein breites Spektrum an potenziellen Handlungsfeldern zur unmittelbaren Verbesserung der Frauengesundheit in Tirol bietet“. Denn die Daten verpflichten.
„Die Qualität im Gesundheitswesen besteht auch sehr viel daraus, dass man zuhören muss, dass man die Personen – in dem Fall die Frauen – ernst nehmen muss und sensibel kommunizieren sollte.“
Simone Davidsen
Daten verpflichten
Die Studie, welche die Datenbasis für die zielgerichteten Maßnahmen lieferte, war im Auftrag des Landes Tirol von einem Forschungskonsortium erarbeitet worden, dem Expert:innen der Unternehmerischen Hochschule MCI, der Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie UMIT TIROL und der fh gesundheit – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol angehörten. „Der Auftrag an unser Forschungskonsortium bestand in erster Linie darin, dass wir ein umfassendes Bild erheben sollten von der Frauengesundheit in Tirol – und zwar zielgruppenspezifisch –, da es bislang in dem Bereich nur unzureichende Daten gegeben hat“, erklärt Simone Davidsen. Sie war für die fh gesundheit am richtungsweisenden Projekt beteiligt. Um den Schock zu begreifen, den die Tatsache, dass 28,4 Prozent der Tirolerinnen Gewalterfahrungen gemacht haben, auch bei ihr auslöst, ist vielleicht die kühle Definition von Gewalt hilfreich.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gewalt der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation (Anm.: Entbehrung, Entzug, Verlust, Isolation, Benachteiligung) führt. Gemeinhin wird dabei in körperliche Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt und finanzielle oder ökonomische Gewalt unterschieden und so umfangreich
die Definitionen, Beschreibungen und wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema auch sind, bleibt es schwer bis unmöglich, die individuellen Gewalterfahrungen in Worte zu fassen. „Die Ergebnisse bringen einen wirklich zum Nachdenken und machen einem sehr sehr deutlich, dass wir im Bereich Gewaltschutz und Gewaltnachsorge einen langen Weg vor uns haben“, stellt Simone Davidsen fest.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie am Gespräch teilnehmen – erzählt die studierte Soziologin und Betriebswirtschaftlerin über ihren eigenen Bildungs- und Erfahrungsweg, der sie nach Norwegen, Dänemark und wieder zurück nach Innsbruck an das Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol/fh gesundheit führte. Und sie erzählt über die Wege, die mit den Ergebnissen der Frauenbefragung geebnet wurden, war das Forschungskonsortium doch dazu angehalten, die Grundlage für zukünftige Interventionsstrategien zu schaffen.
„Empfohlen wurde, bestehende Unterstützungsangebote auszubauen und bekannter zu machen. Und das Ganze auch niederschwelliger zugänglich zu machen“, hält Simone Davidsen beispielhaft zu den potenziellen Maßnahmen fest, die sich aus den Gewalterfahrungen der Tiroler Frauen ergeben. Dazu zählen auch der Ausbau regionaler Anlaufstellen und die Verkürzung der Wartezeiten für psychologische Hilfe sowie gezielte Schulungen des medizinischen Personals, „um Gewalt zu erkennen, aber dann auch sensibel damit umgehen zu können und unterstützen zu können“. Die Frauengesundheitsstrategie spiegelt diesen Handlungsbedarf wider, indem dort etwa zu den Themen Unterstützung von Gewalt-
und Opferschutzgruppen, Implementierung von Gewaltschutz und -prävention in der Anamnese und Fortbildungsangebot zum Umgang mit Gewaltopfern strategische Ziele und Handlungsfelder genannt werden, die den betroffenen Frauen selbst optimierte und erweiterte Unterstützungsangebote und jenen Berufsgruppen, an die sich diese Frauen wenden, ein Fortbildungsangebot zur Steigerung ihrer Kompetenzen bringen soll. Allein im Zusammenhang mit diesem, die Tiroler Frauen regelrecht brutal treffenden Thema, das den Begriff Frauengesundheit auf dunkle Weise ausreizt, ist ein entsprechender Maßnahmen- und Unterstützungskatalog jedenfalls genauso ein Gebot der Stunde wie die Aufklärung und die Sensibilisierung der Gesellschaft. Davor, dass jede dritte Frau Gewalterfahrungen gemacht hat, können die Augen nicht verschlossen werden.
Codewort Viola
Schon 2024 hat das Land Tirol die Expertinnengruppe Gewaltprävention ins Leben gerufen, das Rote Kreuz hat ebenso im Jahr 2024 eine Schulungsoffensive seiner Mitarbeiter:innen in Bezug auf häusliche Gewalt gestartet und die internationalen Handzeichen, die diskret auf eine Gewaltsituation hinweisen, werden zunehmend ebenso bekannter wie das „Codewort Viola“ beziehungsweise der Satz „Ich muss zu Dr. Viola“, als verklausulierter Hilferuf nach Schutz und Hilfe in der Klinik. Es tut sich was. Das muss es auch. In diesem wie in anderen, die Frauen und ihre Gesundheit betreffenden Bereichen.
Im medica-Podcast betont Simone Davidsen den Wert der umfangreichen Befragung

GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
BEZIEHUNGSWEISE EINE GUTE UND ANGEMESSENE MEDIZINISCHE BEHANDLUNG
beziehungsweise Studie, die ein Spiegel der von Frauen erlebten Qualität im Gesundheitswesen ist. Das Forschungskonsortium war mit Expert:innen aus verschiedensten Bereichen besetzt. „Das hat auch die Qualität unserer Arbeit gesteigert. Und natürlich dieses Gefühl, dass wir mit der Befragung etwas bewirken können und es Grundlage dafür ist, die etwas bewegen sollte. Das hat uns alle motiviert“, sagt die Soziologin.
Den Tiroler Frauen wurde durch die Befragung erstmals eine Stimme gegeben und Bewegung ist es auch, was diese Stimme fordert. In seinem Vorwort zur Frauengesundheitsstrategie hält beispielsweise der Präsident der Ärztekammer für Tirol, Stefan Kastner, fest: „Dieses Strategiepapier soll einen Beitrag dazu leisten, dass Frauen eine umfassende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung erhalten, die ihren Bedürfnissen gerecht wird.“ Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass die aktuelle Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen der Frauen nicht gerecht wird. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen das auf teils eindrückliche Weise. „Positiv habe ich gefunden, dass sehr viele Frauen sehr wertschätzend über das Personal im Gesundheitswesen – Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonen, Hebammen, aber auch sonstige unterschiedliche Berufsgruppen – berichtet haben“, sagt Simone Davidsen, „aber es hat auch Aussagen gegeben, die mich berührt und gleichzeitig sogar ein bissl wütend gemacht haben.“
Diese Emotionen wurden bei ihr beispielsweise getriggert, wenn Frauen berichtet haben, dass sie mit gewissen Beschwerden nicht ernst genommen worden sind – vor allem auch bei Frauengesundheits-Themen wie Endometriose, den Wechseljahren oder bei der psychischen Gesundheit: „Solche Geschichten zeigen, dass die Qualität im Gesundheitswesen auch sehr viel daraus besteht, dass man zuhören muss, dass man die Personen – in dem Fall die Frauen – ernst nehmen muss und sensibel kommunizieren sollte.“
Gerechte
Gesundheitsversorgung
Kommunikation ist natürlich ein Grundelement für eine angemessene Gesundheitsversorgung und nicht minder natürlich ist, dass Bedürfnisse der Frauen in den unterschiedlichen Lebensphasen andere sind. Frauengesundheit kann nicht als Einheitskategorie gesehen werden, weswegen die Befragung dezidiert zielgruppenspezifisch und dabei so angelegt wurde, dass Frauen aus unterschiedlichen Lebenssituationen
und Altersgruppen miteinbezogen wurden – von jugendlichen Frauen über Frauen, die im Berufsleben stehen, hin zu Frauen nach der Menopause. „In den Interviews wurde dann auch auf lebensspezifische, aber auch altersspezifische Themen eingegangen“, erklärt Simone Davidsen die Vorgangsweise, die es ermöglichte, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufzuzeigen, „weil man diese Differenzierung braucht, um Maßnahmen so zu gestalten, dass sie möglichst allen Frauen in Tirol gerecht werden können.“
Im medica-Podcast beschreibt Simone Davidsen ihr Interesse beziehungsweise ihre persönliche Triebfeder, sich derart intensiv mit der Qualität im Gesundheitswesen zu befassen. Sie sagt: „Wichtige Punkte für mich sind, wie Gesundheitsversorgung so gestaltet werden kann, dass sie bei allen Menschen gleich ankommt, für alle gleich zugänglich und verständlich, aber natürlich auch gerecht ist. Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich in diesem Zusammenhang ja immer wieder.“
Stimmt. Die Gerechtigkeitsfrage ist eine der stärksten Triebfedern für den so notwendi-
gen weiblichen Blick auf die Medizin. Nicht umsonst ist Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise eine gute und angemessene medizinische Behandlung für alle Menschen das Ziel, das Gendermedizin oder Diversität in der Medizin anstrebt. Dass Frauen anders krank werden, anders krank sind und anders behandelt werden müssen als Männer, ist jedoch eine Tatsache, die erst seit Ende des 20. Jahrhunderts und nach wie vor nur verstörend langsam in das Blickfeld der medizinischen Forschung, der klinischen Behandlungspläne oder der Gesundheitspolitik rückt. „Heute wissen wir, dass eine geschlechtssensible Betrachtung für eine ganzheitliche und gerechte Gesundheitsversorgung unerlässlich ist“, hält die Tiroler Frauenlandesrätin Eva Pawlata dazu in ihrem Vorwort zur Frauengesundheitsstrategie fest. Die Unterschiede sind einfach viel zu groß, um alle Menschen über einen medizinischen Kamm zu scheren.
Dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer nur ein X- und ein kürzeres Y-Chromosom, ist an sich schon ein riesiger Unterschied und Grund dafür, dass männliche und weibliche Körper anders reagieren – auf so gut wie alles. Das X-Chromosom wurde im Jahr 1891 entdeckt und 1905 wurde – erstmals bei Insekten – festgestellt, dass Männchen XY- und Weibchen XX-Geschlechtschromosomen haben. Es dauerte viele Forschungsjahrzehnte, bis dann auch die Rolle der unterschiedlichen Geschlechtshormone in Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten erkannt wurde. Das Interesse daran hielt sich dennoch in Grenzen und ist, wie beispielsweise die deutsche Kardiologin und Autorin des 2020 erschienenen Buches Gendermedizin, Vera Regitz-Zagrosek festhält, erst gewachsen, seitdem bekannt ist, dass auch Männer im Laufe ihres Lebens hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind, die Einfluss auf ihre Gesundheit haben. Auch das ist ein Beispiel für die männliche Dominanz im Gesundheitswesen. Sie reicht weit über den standardisierten männlichen Körper, der für Krankheitsbilder, Therapien und Medikamentengaben oder Wirkstoff-Dosierungen als Vorbild genommen wurde, hinaus.

Wissenslücken gefüllt. Im medica-Podcast erzählt Simone Davidsen , wie das Forschungskonsortium, bestehend aus Expert:innen von fh gesundheit, MCI und UMIT, mit der zielgruppenspezifischen Befragung die großen Wissens- und Datenlücken zur Frauengesundheit in Tirol gefüllt und dem Land Tirol die Grundlage für diesbezügliche Maßnahmen geliefert hat. „Über alle Altersgruppen hinweg hat sich gezeigt, dass die Frauen gut informiert sein wollen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen wollen. Das war ein zentrales Ergebnis“, nennt die Mitarbeiterin der fh gesundheit –Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol einen wichtigen Punkt, der auch als Informationsauftrag verstanden werden darf.
Sind diese Unterschiede, die zu gefährlichen Mängeln in der medizinischen Versorgung führen, den Tiroler Frauen bewusst? „Man hat in einigen Interviews feststellen können, dass den Frauen schon klar ist, dass da Unterschiede bestehen. Gerade in dem Bereich, wo sie sagen, nicht ernst genommen zu werden, ist darauf verwiesen worden, dass das als Mann nicht passiert wäre“, berichtet Simone Davidsen aus Interviews mit den Frauen. Gleichzeitig habe es auch Frauen gegeben, die sehr überrascht waren, als das Thema angesprochen wurde und sie gefragt wurden, ob sie empfinden, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt: „Diese Frauen konnten damit eigentlich nichts anfangen. Sie gehen davon aus, dass das für alle gleich ist. Da zeigt sich schon, dass da noch kein allgemeines Bewusstsein für dieses Thema in der Bevölkerung vorherrscht.“
Darüber und allgemein über medizinische Themen informiert zu sein, scheint bislang mehr eine Hol- als eine Bringschuld zu sein. Gemischt ist das Bild, das die Befragung zum subjektiven medizinischen Informationsstand der Frauen ergeben hat. Vor allem, wenn sie aktiv selbst nachgeforscht und sich eingelesen haben, oder aber im Bereich etablierter Vorsorgeprogramme wie Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs (HPV) fühlen sich die Tirolerinnen gut informiert. „Wo wir aber definitiv Lücken gesehen haben, sind beispielsweise Themen wie Menopause, Endometriose, aber eben auch psychische Gesundheit, wo zum Teil noch Bewusstsein und Information fehlt. Besonders auffällig war, dass manche Angebote gar nicht bekannt gewesen sind oder Frauen unsicher waren, wo man verlässliche Informationen herbekommen kann“, sagt die Soziologin.
Im medica-Podcast geht Simone Davidsen auch auf die im Zuge der Befragung thematisierte Zufriedenheit der Tiroler Frauen mit ihrem Sexualleben und dem gynäkologischen Angebot ein. Jüngere Frauen sind demnach in der Regel sowohl mit ihrem Sexualleben zufriedener als auch mit dem gynäkologischen Angebot. „Frauen am
„Die Ergebnisse bringen einen wirklich zum Nachdenken und machen einem sehr sehr deutlich, dass wir im Bereich Gewaltschutz und Gewaltnachsorge einen langen Weg vor uns haben.“
Simone Davidsen
Land haben immer wieder berichtet, dass sie lange Wege haben oder es schwierig finden, Termine zu bekommen oder rechtzeitig Termine zu bekommen“, sagt sie.
Das Frauenleben am Land weist bezüglich der Gesundheitsversorgung zahlreiche Hürden auf. Dass Frauen in den Städten mehr Auswahl, kürzere Wege und auch bessere Chancen auf schnelle Termine bei Gynäkolog:innen oder anderen spezialisierten Angeboten haben, liegt aufgrund der größeren Versorgungsdichte in urbanen Räumen auf der Hand. Lange Anfahrten, eingeschränkte Öffnungszeiten, weniger Auswahl oder die Schwierigkeit, Termine zu bekommen, kann für Frauen am Land aber auch die Konsequenz haben, dass sie Vorsorge- oder Beratungstermine verschieben beziehungsweise gar nicht wahrnehmen. „Die Bedürfnisse sind die ähnlichen – ob Stadt oder Land –, aber die Chancen, wirklich auch zeitnah und wohnortnah Termine zu erhalten, sind unterschiedlich“, spricht Simone Davidsen einen essenziellen Punkt an, der ein weiteres Schlaglicht auf die Gerechtigkeitsfrage wirft und die Rolle der Wohnortnähe der
Versorgungs- oder Beratungseinrichtungen schwerwiegend macht.
Als schwerwiegend im wahrsten Sinn des Wortes hat sich im Rahmen der zielgruppenspezifischen Befragung zur Frauengesundheit in Tirol die psychische Gesundheit der Frauen regelrecht in den Vordergrund gedrängt. „Über alle Altersgruppen hinweg war die psychische Gesundheit ein gemeinsames, großes Thema. Es hat sich durchgezogen, dass das eine große Rolle spielt. Die jüngeren Frauen haben teils schon sehr direkt über Stress und Ängste erzählt und berichtet. Die älteren Frauen haben dieses Thema teils indirekter angesprochen – und nicht so deutlich auf psychische Gesundheit oder Stress verwiesen“, berichtet Simone Davidsen aus dem intensiven Interviewreigen, in dem zahlreiche Frauen berichteten, dass sie oft an ihre Grenzen gehen, „weil sie einerseits niemanden im Stich lassen wollen und es ihnen andererseits auch schwerfällt, Zeit für sich selbst einzuplanen. Man kann sagen, Mehrfachbelastungen sind auf jeden Fall real und wirken sich auch direkt auf die Gesundheit der Frauen aus.“ Den Studienergebnissen zur psychischen Gesundheit der Frauen entsprechend bestimmt
diese Herausforderung auch einen großen Teil und einige konkrete Handlungsfelder der Frauengesundheitsstrategie. „In Tirol bildet die neue Frauengesundheitsstrategie ab sofort eine fundierte Grundlage, um die Gesundheitsversorgung und Prävention für Frauen gezielt zu verbessern und nachhaltig zu stärken“, wurde vom Land Tirol betont, als die Strategie Anfang März 2025 präsentiert wurde. Gute Ziele sind das. Gute Ziele und viele Schritte.
Auf die Frage, ob es spannend wäre, die Entwicklung zu beobachten und die zielgruppenspezifische Befragung beispielsweise in fünf Jahren zu wiederholen, um zu sehen, was die Frauengesundheitsstrategie bewirkt, meint Simone Davidsen: „Ja, das wäre unglaublich spannend und sehr wichtig, dass man sich das immer wieder anschaut, um zu sehen, ob die Maßnahmen zur Umsetzung der Frauengesundheitsstrategie wirklich wirken und ob die Stimmen der Frauen wirklich zu Veränderungen geführt haben. Ich bin definitiv bereit dazu.“ Die Tiroler Frauen sind das sicher auch.
Alexandra Keller

Im Interview macht die Tiroler Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele deutlich, welche Handlungsgebote sich aus der Befragung der Tiroler Frauen zur Frauengesundheit ergeben und in der Frauengesundheitsstrategie eingeflossen sind. „Was mich persönlich besonders nachdenklich stimmt, ist, dass viele Frauen sich in medizinischen Settings nicht ernst genommen fühlen“, sagt sie.
Grundlage für die Frauengesundheitsstrategie, die im März 2025 von der Tiroler Landesregierung beschlossen wurde, war eine in der Art einzigartige Befragung zur Frauengesundheit, die teils überraschte, teils erschütterte und jedenfalls den Handlungsbedarf unterstrichen hat. Als Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Wissenschaft und Forschung sind Sie auch so etwas wie eine Anwältin der Tiroler Frauen, wenn es um die Verbesserung ihrer Versorgung geht. Was motiviert Sie dabei am meisten? CORNELIA HAGELE : Mir ist es enorm wichtig, die echten Bedürfnisse der Tirolerinnen zu kennen – nicht abstrakt auf dem Papier, sondern ganz konkret aus ihrem Alltag heraus. Genau das leistet die Frauengesundheitsstrategie. Sie zeigt klar, wo es Handlungsbedarf gibt. Und sie erlaubt es uns, praxisnahe und innovative Lösungen zu entwickeln. Was mich dabei motiviert? Der direkte Dialog mit Expert:innen und mit den Frauen selbst. Nur wenn wir genau zuhören, können wir ihre gesundheitlichen Anliegen in allen Lebensphasen auch wirklich ernst nehmen und bestmöglich unterstützen.
In der Frauengesundheitsstrategie sind 34 Handlungsfelder und für jedes Handlungsfeld Ziele festgehalten. Wie werden diese Ziele konkret umgesetzt und wer kümmert sich darum? Umsetzen und nicht nur planen, ist unser Anspruch. Die Ziele werden je nach Bereich gemeinsam mit den zentralen Akteur:innen angegangen. Von Beratungsstellen über die Medizinische Universität bis hin zu Sozialversicherung und Ärztekammer werden alle involviert. Die Koordination liegt bei der Abteilung für Öffentliche Ge-
Cornelia Hagele ist Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Bildung, Wissenschaft und Forschung.

sundheit – dort laufen die Fäden zusammen. Dies ist vor allem notwendig, damit es nicht nur beim guten Willen bleibt, sondern echte Veränderungen spürbar werden.
Ist die laufende Legislaturperiode der Zeitrahmen, in dem entsprechende Bewegung in die 34 Handlungsfelder gebracht werden soll? Was ist Ihr Ziel? Ja, aber mit Prioritäten. Gemeinsam mit Expert:innen haben wir bewertet, was am dringendsten ist und was im aktuellen Budgetrahmen realistisch machbar ist.
Die ersten Schritte sind bereits gesetzt. Der Fokus liegt zunächst auf Informationsangeboten, sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für Laien. 2026 folgen weitere Maßnahmen. Das Rad ist also in Bewegung, und es wird sich weiterdrehen.
Gibt es Ergebnisse aus der zielgruppenspezifischen Befragung, die Sie besonders aufhorchen ließen? Ja, tatsächlich sehr viele. Vor allem der große Wunsch nach qualitativ hochwertiger, verständlicher Information.
Viele Frauen fordern zu Recht einen einfachen, niederschwelligen Zugang zu medizinischem Wissen. Und sie berichten von langen Wartezeiten bei Fachärzt:innen – ein strukturelles Problem, das wir nur gemeinsam mit Sozialversicherung und Ärztekammer lösen können. Was mich persönlich besonders nachdenklich stimmt, ist, dass viele Frauen sich in medizinischen Settings nicht ernst genommen fühlen. Ihre Anliegen werden bagatellisiert. Da müssen wir in der Aus- und Fortbildung der Gesundheitsberufe klare Akzente setzen.
Dass jede dritte Tirolerin physische oder psychische Gewalterfahrungen gemacht hat, ist die vielleicht erschütterndste Tatsache, welche die Befragung aufzeigt. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Was muss unbedingt geschehen? Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Es ist eine gravierende Verletzung
„NUR WENN WIR GENAU ZUHÖREN, KÖNNEN WIR DIE GESUNDHEITLICHEN
ANLIEGEN DER FRAUEN IN ALLEN LEBENSPHASEN AUCH WIRKLICH ERNST NEHMEN UND UNTERSTÜTZEN.“
der Menschenrechte und ein gesellschaftliches Problem. Wir brauchen Schutzräume, Beratung, Begleitung. Mit dem neuen Gewaltschutzzentrum Tirol – an drei Standorten in Innsbruck, Kitzbühel und Landeck – haben wir einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Der Kampf gegen Gewalt braucht dauerhafte Aufmerksamkeit, Ressourcen und Mut zur Veränderung.
Ist geplant, die Befragung in absehbarer Zeit zu wiederholen, um die Fortschritte und auch
die noch offenen Lücken im Zusammenhang mit der Tiroler Frauengesundheit auszuloten? Im Moment ist keine Wiederholung geplant. Aber wenn neue Fragestellungen auftauchen, kann das durchaus sinnvoll sein. Wichtig ist, dass die Daten nicht in der Schublade landen, sondern weiterverarbeitet werden. An den Unis und Fachhochschulen werden die Daten analysiert, fließen in Abschlussarbeiten ein und geben wichtige Impulse für die Praxis. Wir bleiben im Dialog – mit der Wissenschaft, mit den Einrichtungen und vor allem aber mit den Frauen selbst.
Egerdachstraße, Innsbruck Pradl
» Moderne Neubauwohnungen, zeitlose Ausstattung
» Innerstädtischer Lage, hohe Vermietbarkeit garantiert
» 2- bis 4-Zimmer Wohnungen (ab 38 m²)
» Immobilien als sichere, wertstabile Anlage
» Langfristige Wertsteigerung durch Lageentwicklung
Kontakt: Nicole Bletzacher +43 664 8247117 nicole.bletzacher@zima.at zima.at

Im Rahmen der vom Land Tirol in Auftrag gegebenen Befragungen zur Frauengesundheit wurden 2024 quantitative und qualitative Daten erhoben, die Daten und Fakten zu Themen wie allgemeine Gesundheit, subjektiv empfundene Lebensqualität, sexuelle Gesundheit, gynäkologische Versorgung, Gewalterfahrungen sowie psychische Belastungen und Work-Life-Balance liefern. Ein Überblick.
69 % der Frauen bewerten ihren allgemeinen Gesundheitszustand als (sehr) gut.
78 %
sind mit ihrer Gesundheit zufrieden.
80 %
bewerten ihre Lebensqualität in den vergangenen zwei Wochen als (sehr) gut. Nur 2 % bewerten diese negativ, 18 % mittelmäßig.
Info: Befragt wurden 493 Frauen, aufgeteilt in drei Altersgruppen (19–45, 46–60, 61+). Ziel war es, einen umfassenden Einblick in die gesundheitsbezogenen Bedürfnisse und Lebensbedingungen von Tiroler Frauen zu erhalten. Die altersrepräsentative Stichprobe weist einen hohen Bildungsstand auf, rund die Hälfte der Befragten hat Matura oder mehr. Dies ist typisch für gesundheitsbezogene Umfragen und wird durch das Onlineformat verstärkt. Beruflich zeigt sich eine breite Streuung mit vielen Teilzeitbeschäftigten, unselbständig tätigen Frauen in Vollzeit und Pensionistinnen. Der Großteil lebt in ländlichen oder vorstädtischen Gebieten, nur ein kleinerer Anteil in Städten. Fast 90 % sind in Österreich geboren und sprechen primär Deutsch. 70 % der Frauen haben Kinder, meist ein bis zwei. 54 % sind verheiratet oder verpartnert, 40 % leben im Zwei-PersonenHaushalt. Finanziell schätzen 59 % ihre Lage als gut ein, wobei 81 % unerwartete Ausgaben von 1.300 Euro decken können. Zahlen gerundet.
2,4
Im Durchschnitt zeigt sich auf einer Skala von 1 bis 5 eine mittlere Zufriedenheit der Frauen mit ihrem Sexualleben, wobei einige das Gefühl haben, dass in ihrem Sexualleben etwas fehlt (Mittelwert: 3,5).
Signifikante Unterschiede sind bei Frauen ab 61 Jahren erkennbar: Diese Gruppe ist weniger zufrieden mit ihrem Sexualleben, berichtet seltener von sexuellen Kontakten und Selbstbefriedigung und fühlt sich weniger fähig, ihre sexuellen Wünsche zu äußern.
21 %
der Frauen sind durch (sehr) starke Beschwerden vor oder während ihrer Regelblutung von Einschränkungen in ihrem Arbeitsalltag betroffen. 31 % mit mittelmäßigen Einschränkungen.
75 %
der Frauen sind mit ihrer gynäkologischen Versorgung (sehr) zufrieden .
2,6
Für Müdigkeit und Erschöpfung, gemessen mit der Subskala „Persönliches Burnout“ des Copenhagen Burnout Inventory (CBI), liegt der Durchschnittswert bei 2,6, was seltene bis gelegentliche Müdigkeit und Erschöpfung andeutet. Insgesamt erleben jüngere Frauen signifikant häufiger Müdigkeit und Erschöpfung und sind weniger zufrieden mit ihrer Work-Life-Balance, während ältere Frauen tendenziell weniger von persönlichem Burnout betroffen sind und eine höhere Zufriedenheit in der Balance zwischen Berufs- und Privatleben erfahren.
28 %
der befragten Frauen haben physische oder psychische Gewalterfahrungen gemacht.
57 %
der Frauen nahmen das Betreuungsangebot nach einer Gewalterfahrung als unzureichend wahr.
Viel zu lange war Endometriose so etwas wie ein Stiefkind der Gynäkologie. Die chronische Krankheit, die für betroffene Frauen mit teils starken Schmerzen und nicht minder starken Ängsten einhergeht, ist nicht leicht zu diagnostizieren und auch nicht leicht zu behandeln. Doch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Frauen zu unterstützen, zu therapieren und die Chancen auf eine Schwangerschaft bei jenen zu erhöhen, die diese Chancen gerne hätten. Das Endometriosezentrum Innsbruck arbeitet auf recht außergewöhnliche Weise daran, der Krankheit die Ohnmacht zu nehmen. Beata Seeber leitet dieses Zentrum und sagt: „Es ist sehr wichtig, die Lebensqualität der Frauen zu verbessern.“ Ein sehr gutes Ziel.
Schmerz. Jeder Mensch mag ihn anders empfinden, doch eines ist er immer: ein Alarmsignal. Dort, wo sich die komplexe Sinneswahrnehmung von unangenehm bis unerträglich konzentriert, stimmt etwas nicht im oder mit dem Körper. Dass Frauen Schmerzen anders empfinden als Männer und damit vielfach nicht ernst genommen und unzureichend behandelt werden, ist eine so bekannte wie anhaltend erschütternde Tatsache, die auch mit dem so genannten Gender Pain Gap beschrieben wird. Ja, neben dem Gender Pay Gap, der sich auf die Lohn-
VON DER PUBERTÄT BIS ZUR
MENOPAUSE HABEN MEHR ALS
50 PROZENT ALLER FRAUEN
WÄHREND IHRER PERIODE
SCHMERZEN – UND DIE MÜSSEN
IN DER REGEL NICHT SEIN.

Beata Seeber ist stellvertretende Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck. Und sie ist Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität, das im Herbst 2024 für weitere drei Jahre zertifiziert wurde.
lücke zwischen Männern und Frauen bezieht, dem Gender Pension Gap, der Selbiges bei den Pensionen aufzeigt, und dem Gender Health Gap, der die Benachteiligung der Frauen in der medizinischen Versorgung und Forschung beschreibt, hat auch diese für Frauen äußerst schmerzhafte Lücke zwischen den Geschlechtern einen Namen. Zum Gender Pain Gap gibt’s auch eine Hymne, die ihn mit schriller Tonalität begleitet. „Schmerzen gehören zum Frauensein. Das ist ganz normal“, ist der Refrain dieses schrecklich langlebigen Hits, der Frauen still leiden lässt. Nicht wenige von ihnen im monatlichen Takt. Und das über einige Lebensjahrzehnte. Von der Pubertät bis zur Menopause haben mehr als 50 Prozent aller Frauen während ihrer Periode Schmerzen – und die müssen in der Regel nicht sein.

BEI FRAUEN
„Wenn man Befragungsstudien macht, sagen fast alle jungen Frauen, dass sie bei der Regelblutung Schmerzen haben. 20 Prozent haben sogar starke oder sehr starke Schmerzen“, weiß Beata Seeber. Die in den USA aufgewachsene und ausgebildete Gynäkologin hat sich schon früh mit Endometriose beschäftigt, 2011 zum Thema „Biomarker der Endometriose“ habilitiert und sich schließlich auch auf Endometriose spezialisiert. Sie nimmt die Schmerzen der jungen Frauen sehr ernst und sieht sie durchaus als potenzielles Alarmsignal, weil Schmerzen während der Regelblutung bei jungen Frauen ein erstes Zeichen für Endometriose sein können. „Wir wissen, dass Frauen, die Endometriose haben, schon Beschwerden hatten, als sie noch ganz jung waren“, sagt sie.
Jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist von dieser Erkrankung betroffen, was Endometriose zu einer der häufigsten gutartigen Erkrankungen bei Frauen macht. Dabei bilden gebärmutterschleimhautähnliche Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle so genannte Endometriose-Herde, Knoten oder Zysten, die zu teils starken Schmerzen während der Regelblutung, beim Geschlechtsverkehr oder ganz allgemein im Unterbauch, zu Problemen beim Schwangerwerden oder zu Unfruchtbarkeit führen können.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – berichtet Beata Seeber über die verschiedenen Theorien, die erklären wollen, warum sich die Zellen der Gebärmutterschleimhaut dort ansiedeln, wo sie nicht hingehören. Am Darm etwa oder an der Blase. „Eine komplette Erklärung haben wir leider nicht“, sagt sie. Setzt die Menstruation sehr früh ein, kann das ein Risikofaktor sein.
„Mein Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber Endometriose zu steigern und vor allem die Patientinnen evidenzbasiert zu therapieren, um ihre Lebensqualität zu verbessern“, sagt die Ärztin. Endometriose kann noch nicht geheilt werden. Die Frauen sind herausgefordert, mit dieser chronischen Krankheit zu leben. Die Ver-
besserung ihrer Lebensqualität bleibt der Gradmesser für die Therapie und Beata Seeber sagt: „Trotz der Diagnose weiter die Arbeit ausüben können, gut sozial verknüpft zu sein, das ist das Ziel. Das sollte auch das Outcome der Endometriosestudien sein.“
Jede Patientin wahrnehmen
Beata Seeber ist stellvertretende Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in Innsbruck. Und sie ist Leiterin des Endometriosezentrums der Medizinischen Universität, das im Herbst 2024 für weitere drei Jahre zertifiziert wurde. Dass im Rahmen dieses Zentrums Spezialist:innen aus Gynäkologischer Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Operativer Gynäkologie,
Endometriose-Alarm.
Endometriose kommt typischerweise im kleinen Becken vor:
• im Eierstock
• hinter der Gebärmutter
• an Darm oder Harnblase
• an den Eileitern
• am Beckenbindegewebe Selten kann Endometriose an anderen Körperstellen, wie Lunge oder Operationsnarben, auftreten. Eine Sonderform der Endometriose stellt die Adenomyose dar. Dabei finden sich gebärmutterschleimhautähnliche Zellen im muskulären Anteil der Gebärmutterwand.
Folgende Faktoren können das Risiko von Endometriose erhöhen:
• frühe erste Regelbutung
• starke und verlängerte Blutung über sieben Tage
• familiäre Vorbelastung: Mutter oder Schwester mit Endometriose (6-fach erhöhtes Risiko)
Schmerzen und Unfruchtbarkeit sind die vorherrschenden Symptome bei Endometriose. Zu den spezifischen Symptomen der Endometriose zählen:
• Schmerzen vor und während der Regelblutung
• Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
• Unterbauchschmerzen unabhängig von der Regelbutung
• starke Regelblutungen
• Unfruchtbarkeit
• schmerzhaftes Harnlassen während der Regelblutung
• Verdauungsstörungen und Schmerzen während der Regelblutung

„Mein Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber Endometriose zu steigern und vor allem die Patientinnen evidenzbasiert zu therapieren, um ihre Lebensqualität zu verbessern.“
Beata Seeber
Chirurgie, Urologie, Anästhesie – Schmerzmedizin, Radiologie, Pathologie, Psychiatrie und Psychosomatik, Physiotherapie und Diätologie im Sinne und zum Wohle der unter Endometriose leidenden Patientinnen zusammenarbeiten, zeigt die medizinische Bandbreite und Komplexität der Endometriose recht eindrücklich auf. Gerne wird diese chronische Krankheit als Chamäleon bezeichnet. Es aufzuspüren, einzufangen und aus medizinischer Sicht dingfest zu machen beziehungsweise zu diagnostizieren, gleicht oftmals einer Odyssee, einer von Schmerzen und Ängsten geprägten Irrfahrt für die Frauen. In dieser Szenerie ist das Endometriosezentrum Innsbruck so etwas wie ein Leuchtturm, der auch gegenüber anderen Zentren dieser Art hervorsticht. Der Leiterin ist wichtig, zu betonen: „Viele Frauen haben Angst, sie müssen operiert werden, wenn sie zu uns kommen. Das ist nicht der Fall. Die Diagnose wird immer öfter nicht invasiv ge-
stellt und auch wenn man die Endometriose schon sieht, muss die Therapie nicht operativ sein. Die medikamentöse Therapie ist in vielen Fällen gleichwertig mit der operativen.“
Im medica-Podcast erzählt Beata Seeber, was das Endometriosezentrum in Innsbruck so speziell und zu einem Unikum macht. Nicht nur wegen der wissenschaftlichen Studien, die am Zentrum durchgeführt werden. „Wir nehmen jede Patientin als Individuum wahr und besprechen, welche Therapie für sie am besten ist“, sagt sie – und betont: „Die Schmerzen sollten so schnell wie möglich anerkannt und auch therapiert werden.“
So schnell wie möglich ist ein Schlüsselsatz, sind die Leidenswege von Endometriose-Patientinnen bis die Diagnose gestellt und eine Therapie in die Wege geleitet werden kann, doch vielfach zermürbend lang. Weil Regelschmerzen so verbreitet sind, hochpräva-
lent nennen das die Mediziner:innen, ist die Differenzierung für junge Frauen nicht einfach. „Es ist sehr schwierig zu unterscheiden: Handelt es sich da um eine Dysmenorrhoe durch die klassische Verkrampfung der Gebärmutter, oder sind das eigentlich die ersten Zeichen für Endometriose“, beschreibt Beata Seeber das erste Problem. Weil die Hymne, dass Schmerzen zum Frausein gehören, nach wie vor zu gerne angestimmt wird, wird es für die Frauen schwer, sich zu fragen, ob diese Schmerzen vielleicht etwas Pathologisches sein könnten und unbedingt medizinischer Rat eingeholt werden sollte. Und wenn die Schmerzen schließlich chronisch werden und unabhängig vom Zyklus zu verschiedensten Symptomatiken führen – Reizblase etwa, Reizdarm, Müdigkeit, Erschöpfung und mit der Zeit auch depressive Verstimmungen –, wird es noch viel schwieriger, die Beschwerden auf Endometriose zurückzuführen. Verschärft wird diese Si-
tuation auch dadurch, dass die Krankheit offenkundig nach wie vor nicht zum breiten Allgemeinwissen zählt.
Laut der zielgruppenspezifischen Befragung zur Frauengesundheit in Tirol, die im November 2024 fertiggestellt und eine entscheidende Grundlage für die Frauengesundheitsstrategie des Landes Tirol wurde, sind 31,14 Prozent der Tiroler Frauen nicht über Endometriose informiert. Jede dritte Frau würde demnach gar nicht auf die Idee kommen, dass ihre eigenen Schmerzen oder die Schmerzen ihrer Freundinnen, Töchter oder Enkeltöchter auf Endometriose zurückzuführen sind und behandelt werden könnten. Um das Bewusstsein gegenüber der Krankheit zu schärfen, geht das Innsbrucker Endometriosezentrum unterschiedliche Aufklärungswege – etwa im Sexualunterricht in Schulen oder der Sensibilisierung und Fortbildung der niedergelassenen Gynäkolog:innen, den meist ersten Ansprechpartner:innen für die Betroffenen.
Riesen-Diagnostikschritte
Einen internationalen Wendepunkt für die Bekanntheit der Krankheit brachte die US-amerikanische Schauspielerin Lena Durham, die sehr offen und vor allem öffentlich von ihren jahrelangen, endometriosebedingten Schmerzen berichtete, deren Heftigkeit schließlich dazu führten, dass sie sich im Alter von 33 Jahren die Gebärmutter entfernen ließ. Eine so traumatische wie folgenschwere Entscheidung, um dem schmerzhaften Teufelskreis zu entkommen.
Im medica-Podcast erklärt Beata Seeber, warum der radikale Schritt der Schauspielerin möglicherweise vermeidbar gewesen wäre und warum die Entfernung der Gebärmutter als ultimativer Schritt aus dem Schmerzkreislauf in Österreich beziehungsweise im deutschsprachigen Raum sehr selten vorkommt, eben weil sich hier zahlreiche Endometriosezentren etabliert haben, die zertifiziert sind, intensiv zusammenarbeiten und forschen. „Ich sehe eine sehr positive Entwicklung“, sagt sie.

Knackpunkt Lebensqualität.
Im medica-Podcast klärt Beata Seeber umfangreich und gespickt mit guten Neuigkeiten über Endometriose auf. Die Leiterin des Endometriosezentrums Innsbruck erzählt darin, warum sie schon seit über 20 Jahren zur Endometriose forscht und arbeitet, was die Tücken bei der Diagnose und Behandlung sind, wie schwer es ist, Biomarker zu finden, um die Krankheit früh zu entdecken, oder wie individuell inzwischen die Therapiemöglichkeiten geworden sind. Vor allem auch, wenn ein Kinderwunsch besteht.
Unbedingt als positiv zu bezeichnen ist die Entwicklung, eben weil die Diagnostik in den letzten Jahren riesengroße Schritte gemacht hat. Galt ein operativer Eingriff lange Zeit als einziger Weg, Endometriose zu diagnostizieren und auch zu therapieren, indem die Endometriose-Herde auf diesem Weg entfernt werden, so wurde zwischenzeitlich nicht nur die Diagnostik mittels Ultraschall und MRT massiv verfeinert. Auch die medikamentösen Behandlungspläne werden immer ausgefeilter und können individueller auf die Patientinnen abgestimmt werden. „Auf die medikamentöse Therapie wird viel mehr Wert gelegt. Erstens die Schmerztherapie, zusätzlich die hormonelle Therapie und vor allem multimodale Therapien – das sind Therapien, die die Patientinnen selber in die Hand nehmen müssen“, erklärt Beata Seeber. Ernährung, Physiotherapie und Psychotherapie sind entscheidende Teile dieser multimodalen oder komplementären Therapien, bei denen auch das Engagement der Patientinnen selbst gefragt ist beziehungsweise ihre eigene Wirkungsmacht gestärkt und der Ohnmacht, die mit der chronischen Krankheit einher gehen kann, ein positives Schnippchen geschlagen wird. Beata Seeber: „Die operative Therapie bleibt natürlich wichtig, es müssen viele Frauen operiert werden, um die Herde, die Zysten zu entfernen. Ziel ist, dass das nicht mehr alle zwei, drei Jahre passieren muss – sondern eine OP und weiter medikamentöse Behandlung, sogenannte Rezidivprophylaxe, damit die Endometriose nicht wiederkommt.“
Bis die Wissenschaft das Mysterium klärt und im schönsten Fall dazu beiträgt, die Entstehung der Krankheit oder Bildung der schmerzhaften Endometriose-Herde zu verhindern, ist Endometriose ein Schicksal, mit dem die betroffenen Frauen leben lernen müssen und jede Form der Hilfe nutzen dürfen. Diese Hilfe so früh wie möglich anzunehmen, kann nicht nur die Leidenswege verkürzen, sondern für Frauen entscheidend sein, wenn der Wunsch besteht, schwanger zu werden.
Im medica-Podcast zeigt Beata Seeber die Möglichkeiten auf, Frauen mit Endometrio-
se und Kinderwunsch zu unterstützen, und erklärt, welche krankheitsbedingten Probleme dies notwendig machen. „Die Frauen brauchen oft Hilfe, um schwanger zu werden. Man muss die Patientinnen gut aufklären, die Hoffnungen sollten realistisch bleiben“, weiß sie.
Das Endometriosezentrum Innsbruck ist in der Klinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin angesiedelt, der besten Adresse also, um betroffene Patientinnen mit Kinderwunsch zu unterstützen. Was etwa wichtig geworden ist, ist die Konservierung von Eizellen – vor allem wenn die Endometriose die Eierstöcke betrifft.
„Egal wie schonend große Zysten operiert werden, gibt es einen Abfall der Eizellenre-
ES AUFZUSPÜREN,
EINZUFANGEN UND AUS MEDIZINISCHER
SICHT DINGFEST ZU MACHEN, GLEICHT OFTMALS EINER ODYSSEE, EINER VON SCHMERZEN UND ÄNGSTEN GEPRÄGTEN IRRFAHRT FÜR DIE FRAUEN.
serve. Deswegen bitten wir Patientinnen, Eizellen einzufrieren. Auf diese können sie später zugreifen“, sagt die Ärztin, die viel Wert auf die Forschung legt und viel Energie in Studien steckt, um die Endometriose-Nebel zu lichten, neue Wege bei der Erkennung, Behandlung und Therapie zu finden und das gynäkologische Chamäleon
zu zähmen, das so viele Schmerzen verursacht. Schmerzen, die nicht sein müssen. Schmerzen, die nicht akzeptiert werden dürfen. Sie gehören nicht zum Frausein. Sie sind nicht normal. Sie sind ein Alarmsignal.

Geschwächtes, sprödes Haar zählt oft zu den Begleiterscheinungen der Wechseljahre und stellt eine Folge des hormonellen Ungleichgewichts dar.
Höchste Zeit, Ihr Haar und sich selbst mit BIOSCALIN ® wieder in Balance zu bringen!



Vor einer Geburt ist die Gebärmutter groß wie ein großer Geburtstagsluftballon, sechs Wochen danach ist sie wieder so groß wie eine kleine Birne.

Sie ist das mit Abstand faszinierendste Organ und gleichzeitig einer der stärksten Muskeln im weiblichen Körper. Monat für Monat macht sich die Gebärmutter bei gebärfähigen Frauen dafür bereit, eine befruchtete Eizelle aufzunehmen. Tut sie das, passiert Epochales mit ihr und in ihr. „Sie ist ein ausgeklügeltes Wunderwerk“, weiß Stephan Kropshofer. Der Gynäkologe verneigt sich regelrecht vor diesem Organ und sagt: „Es gibt kein vergleichbares.“
„Was der Körper und besonders die Gebärmutter leisten muss, damit alles funktioniert, ist faszinierend.“
Stephan Kropshofer
Stephan Kropshofer ist Gynäkologe, stellvertretender Klinikdirektor und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Im August 2025 sind phänomenale Bilder um die Welt gegangen. In Barcelona war es Forschenden erstmals gelungen, einen Embryo dabei zu filmen, wie er sich in die Wand der Gebärmutter einnistet, ja sich regelrecht dort hineingräbt, um den mütterlichen Blutkreislauf anzuzapfen und seine Versorgung in die Wege zu leiten. Nachdem sich Spermium und Eizelle im Eileiter begegnet haben und dort verschmolzen sind, beginnt die befruchtete Eizelle, sich zu teilen und in Richtung Gebärmutter zu wandern. Aus dem Zellhaufen wird eine so genannte Blastozyste, die unbedingt Nährstoffe und Sauerstoff braucht, um weiter zu wachsen. Darum hat sie es ziemlich eilig, ans Ziel zu kommen. Die Gebärmutter hilft ihr dabei mit kleinen Härchen und rhythmischen Bewegungen – nur so funktioniert der Transport.
In Barcelona wurde diese durchaus abenteuerliche und nicht unbedingt von Erfolg gekrönte Reise an einer künstlichen Gebärmutterwand imitiert und der 0,2 Millimeter große Embryo dabei beobachtet, wie er das macht. „Es handelt sich um einen überraschend invasiven Prozess“, wurde der Leiter der Studie, Samuel Ojosnegros, vom Magazin GEO zitiert. Überraschend waren die Kräfte, die beim knapp neun Tage alten Embryo beobachtet werden konnten. Dieser Kraftakt des Einnistens macht sich bei gerade schwanger gewordenen Frauen nicht selten durch Bauchschmerzen und leichte Blutungen bemerkbar. Für ihre Gebärmutter liefert dieser Moment einen kleinen Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Monaten passiert. Da geht – gelinde gesagt – die Post ab. „Vor der Geburt ist die Gebärmutter wirklich groß, wie ein ganz großer Geburtstagsluftballon.

Nach der Geburt ist sie so groß wie eine große Orange und nach sechs Wochen schon wieder so groß wie eine kleine Birne“, beschreibt Stephan Kropshofer, zu welch elastischer Meisterleistung die Gebärmutter fähig ist. Ganz zu schweigen von dem, was im Verlauf einer Schwangerschaft alles in ihr passiert.
Stephan Kropshofer ist Gynäkologe, stellvertretender Klinikdirektor und stationsführender Oberarzt an der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. In seinen knapp 30 Jahren als Facharzt für Frauenheilkunde hat er unzählige Frauen auch in der Geburtshilfe begleitet und seine Begeisterung für die Gebärmutter ist dabei nicht geringer geworden. Im Gegenteil. Vor allem natürlich bei der Beobachtung einer Schwangerschaft. „Was der Körper und be-
sonders die Gebärmutter leisten muss, damit das alles funktioniert, ist faszinierend“, sagt er und weist im Zusammenhang mit diesen Höchstleistungen beispielsweise auf den Energiehaushalt hin.
Bei einer nicht schwangeren Frau verbraucht die Gebärmutter etwa ein Prozent der Körperenergie. Im Vergleich zum Gehirn, das rund 20 Prozent derselben absaugt, ist das fast verschwindend gering. In einer Schwangerschaft holt die Gebärmutter aber rasant auf und zieht gewissermaßen mit dem Gehirn gleich. Am Ende der Schwangerschaft fließen nämlich ebenso bis zu 20 Prozent der Körperenergie in die Gebärmutter und das ganze schwangere Rundum. Das ist auch nötig und Stephan Kropshofer weiß: „Es ist enorm, was die Gebärmutter leisten muss.“
Im medica-Podcast – Handy zücken, im Fotomodus an den QR-Code halten und schon sind Sie dabei – erzählt Stephan Kropshofer, wie die Gebärmutter aufgebaut ist und welche ausgeklügelten Haltesysteme sie ins kleine Becken der Frau betten, wo sie auch ohne Schwangerschaft viel zu tun hat. „Sie ist eigentlich ein Muskel, ein sehr kluger Muskel“, sagt der Gynäkologe.
Die Klugheit dieses Muskels wird in so gut wie jeder Phase seines Seins von Hormonen gesteuert. Nähert sich mit der Geburt der Höhepunkt des organischen Superreigens, ist Oxytocin der Dirigent. Gibt das Liebesund Kuschelhormon bald den letzten Takt an, beheimatet die Gebärmutter mit Embryo, Mutterkuchen und Fruchtwasser zwischen fünf und sechs Kilo Menschenwundermasse. Wenn es dann so weit ist, beweist die Gebärmutter ihre unglaubliche Muskelkraft und bewegt durch rhythmische Kontraktionen das Baby durch den Geburtskanal und hinaus in die Welt. Schaffen Mutter und Baby das nicht allein beziehungsweise mit Hilfe von Hebammen, weil eine vaginale Geburt ein Risiko für Mutter und Kind darstellt, kann ein Kaiserschnitt notwendig sein. Dafür muss in Bauchdecke und Gebärmutter geschnitten werden und dabei ist wieder Außergewöhnliches zu beobachten. „Wenn man einen Kaiserschnitt machen muss und man anfängt, zu operieren, blutet es ein bisschen. Es ist eine sehr schnelle Operation, normal dauert sie so zwischen 15 und 20 Minuten, und wenn ich dann wieder beim Hautschnitt ankomme, dann hat bis dorthin die Blutung einfach aufgehört. Da ist nichts mehr“, erzählt der Gynäkologe. Bei anderen Operationen an der Gebärmutter, einer Gebärmutterentfernung etwa, ist das ganz und gar nicht so, doch führt nach der Geburt ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus Blutgerinnung und dem so raschen Zusammenziehen der Gebärmutter und all ihrer Gefäße dazu, dass die Blutung auf vergleichsweise wundersam flotte Weise aufhört. Stephan Kropshofer: „Das Trauma, das man setzt, wenn man reinschneidet, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber zu beobachten, wie rasch die Blutung stoppt, ist jedes Mal ein Faszinosum.“

Im medica-Podcast erklärt Stephan Kropshofer, was den Mutterkuchen über seine Uraufgabe der Versorgung beziehungsweise Ernährung des Embryos hinaus so speziell und essenziell macht. Auch für die Geburt. „Was sie auslöst, wissen wir nicht ganz genau. Es wäre toll, wenn wir es wüssten“, sagt er.
Dass die Gebärmutter schon sechs bis acht Wochen nach der Geburt wieder so groß ist wie vor der Empfängnis, ist jedenfalls sensationell. Doch mag sie dann auch nur noch so groß sein wie eine kleine Birne, der sie ja wirklich gleicht, so kann sie sich nicht wirklich ausruhen. Das kann sie zwischen der Pubertät und der Menopause eigentlich nie.
Ein Faszinosum.
Im medica-Podcast über die Gebärmutter und was sie alles kann, beantwortet Gynäkologe Stephan Kropfshofer auch Fragen zur verstörenden Vorstellung eines künstlichen Uterus, in dem menschlicher Nachwuchs gezüchtet wird, sowie zu Gebärmuttertransplantationen. Seit im Jahr 2000 die erste Gebärmutter erfolgreich transplantiert durchgeführt wurde, ist diese Operation ein Hoffnungsschimmer für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. „Eine große Geschichte“, weiß der Arzt.
Wunderwerk mit Wunderrad
Bevor Mädchen in die Pubertät kommen, ist die Gebärmutter noch ganz klein und hat die Form eines Zylinders. Mit der Pubertät bekommt sie langsam die klassische Birnenform, wird in der Länge zwischen sechs und zehn, in der Breite zwischen vier und fünf Zentimeter groß – und bereitet sich monatlich darauf vor, befruchtet zu werden. Dabei verdickt sich die Schleimhaut und wartet geduldig auf eine befruchtete Eizelle. Kommt keine, wird die Schleimhaut abgestoßen und über die Regelblutung ausgeschieden. Das Blut stammt von den zerrissenen Schleimhautgefäßen. Das klingt alles recht wild und anstrengend. „Das ist es auch“, bestätigt Stephan Kropshofer. Beim so genannten Turnover der Zellen beziehungsweise dem ständigen Prozess, bei dem für die Aufrechterhaltung der Gewebefunktion alte Zellen durch neue ersetzt werden, steht die Gebärmutter bei Frauen im gebärfähigen Alter an erster Stelle. Die Regeneration der Darmschleimhaut etwa dauert zwischen sechs und acht Wochen. „Die Gebärmutter muss das alle vier Wochen leisten und kann das in der Regel auch“, weiß der Arzt.
In der Regel funktioniert das Wunderwerk mit seinem monatlichen Wunderrad tadellos. Doch zu den Spezialfächern Stephan Kropshofers zählen auch die operative Gynäkologie und die Urogynäkologie, weswegen er viel mit
PROBLEMEN ODER KRANKHEITEN DER MENSCHLICHEN
ORGANE UND SYSTEME VOR ALLEM DAMIT ZUSAMMENHÄNGT,
DASS SIE NICHT AUF DAS ALTER AUSGELEGT SIND, DAS ZWISCHENZEITLICH ERREICHT WIRD. AUCH DIE GEBÄRMUTTER
WAR WOHL NICHT FÜR EIN DURCHSCHNITTSALTER
VON KNAPP 85 JAHREN GEDACHT.
Problemen, Beschwerden oder Krankheiten konfrontiert ist, die dann ein noch komplexeres Licht auf die Gebärmutter richten. Wo Systeme derart rasant arbeiten und viel Reparatur stattfindet, kann auch etwas schiefgehen. Stephan Kropshofer glaubt, dass die Häufung von Problemen oder Krankheiten der menschlichen Organe und Systeme vor alle damit zusammenhängt, dass sie nicht auf das Alter ausgelegt sind, das zwischenzeitlich erreicht wird. Auch die Gebärmutter war wohl nicht für ein Durchschnittsalter von knapp 85 Jahren gedacht. Im Laufe eines Frauenlebens können jedenfalls einige Probleme und Krankheiten rund um und mit der Gebärmutter auftreten, die unangenehm, schmerzhaft, lebensqualitätseinschränkend und auch lebensgefährlich sein können. Die häufigsten Gebärmutterbeschwerden, mit denen die Spezialist:innen an der Uniklinik Innsbruck konfrontiert werden, sind Blutungsstörungen, Gebärmuttersenkungen, Schmerzen – ausgelöst etwa durch Endometriose oder Narben nach Operationen, Zysten, Polypen oder Myome. „Blutungsstörungen und Myome sind unsere Hauptindikatoren, etwas zu tun“, so Stephan Kropshofer.
Im medica-Podcast beschreibt Stephan Kropshofer, wie tricky Myome – diese gutartigen Muskelknoten, die je nach Studie zwischen 25 und 40 Prozent aller Frauen irgendwo haben – werden können. Heikel wird’s beispielsweise, wenn Myome plötzlich sehr schnell wachsen und bösartig zu werden drohen, wenn sie Blutungsstörungen verursachen oder starke Schmerzen. Es gibt zahlreiche Behandlungs- beziehungsweise Therapiemöglichkeiten. „Eine Gebärmutterentfernung steht immer an letzter Stelle“, betont er.
Die so genannte Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter, stand lange Zeit an erster Stelle, wenn es darum ging, Myome oder sonstige Probleme mit der Gebärmutter zu behandeln. „Viel zu häufig war das der Fall, weil man das Organ als Gesamtes weggenommen hat, wo man Gezielteres mit feinerer Klinge machen kann“, stellt der Gynäkologe fest, der mit ebendieser feinen Klinge auch in seinem Spezialgebiet, der Urogynäkologie, vorgeht, in dessen Rahmen er sich etwa mit Senkungsbeschwerden beschäftigt, die vor allem bei älteren Frauen zu starken Beeinträchtigungen der Lebensqualität führen können. Denn die Komplexität der Gebärmutter liegt auch darin, dass sie sehr eng mit ihrer Umgebung verbunden ist.
In der ersten Ausgabe des medica-Magazins und der ersten medica-Podcaststaffel hat die Innsbrucker Gynäkologin Karin Matthä den Beckenboden erklärt, der mit seinen kunstvoll angeordneten Muskeln, bindegewebigen Faszien und Sehnen eine Art Hängematte bildet, von der nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Harnblase und der Enddarm gehalten werden. Eine Schwangerschaft und eine Geburt können dieses Haltesystem stark herausfordern. „Ja, die Hauptrisikofaktoren für alle Probleme, die bei Frauen in höherem Alter auftreten können – wie Senkung, auch Harnverlust, Harndrang oder Inkontinenz –, sind die Geburten. Nicht nur die Geburten selber, sondern auch die Schwangerschaften“, erklärt Stephan Kropshofer. „Der Druck auf den Beckenboden, der den Bauch nach unten abschließt, ist während der letzten Monate so groß, dass immer kleine Verletzungen entstehen.“ Große Kinder auf die Welt gebracht oder eine Bindegewebsschwäche zu
haben, können das Risiko zudem erhöhen, dass die Hängematte ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen und es zur Senkung der Gebärmutter wie der Blase kommen kann. In diesen Fällen konzentriert sich die feine medizinische Klinge der Spezialist:innen darauf, die Haltungsstrukturen zu reparieren oder mittels anderer Therapieformen die Senkungsbeschwerden zu behandeln. Auch in diesen Fällen ist die Entfernung der Gebärmutter die letzte Option.
Die einst viel zu alltäglichen radikalen Lösungen für Gebärmutterprobleme werden im Klinikalltag zunehmend von verfeinerten und individualisierten Ansätzen abgelöst. Stephan Kropshofer ist in dem Zusammenhang überzeugt, dass ein höherer Anteil an Gynäkologinnen in leitenden Funktionen genau diese Verfeinerung pushen würde. „Ich glaube, das würde der Medizin sehr gut tun, weil du als Gynäkologin oft einen anderen Zugang hast. Medizinmäßig würde das einen fundamentalen Unterschied machen“, sagt er. Gerne weist er in dem Zusammenhang auf den Stand der Forschung und der Behandlungsmöglichkeiten bei Endometriose hin, der schmerzhaften und folgenschweren Erkrankung im Zusammenhang mit der Gebärmutter, die ebenso Thema dieser medica-Ausgabe und -Podcaststaffel ist (siehe Seite 18). An neuen Ansätzen, die Endometriose in den Griff zu bekommen, wird auch an der Uniklinik Innsbruck gearbeitet, und Stephan Kropshofer sagt: „Wenn es sich um ein Medikament für Prostatabeschwerden handeln würde, wäre das wahrscheinlich schon viel früher passiert. Da gibt es noch viel zu tun.“ Stimmt.
Alexandra Keller
ANÄSTHESIE
Dr. Beiler David 0512 / 234 - 0
Dr. Dodojacek Roland 0512 / 234 - 0
Dr. Finsterwalder Thomas, MBA 0512 / 234 - 0
Dr. Heider Denise 05224 / 54 408
Dr. Korschineck Regine 0512 / 234 - 0
Priv.-Doz. Dr. Mitterlechner Thomas 0512 / 234 - 0
Dr. Rainer Bernhard 0512 / 234 - 0
Dr. Rainer Daniel 0664 / 153 3959
Dr. Ruckensteiner Karin 0512 / 234 - 0
Priv.-Doz. Dr. Tiefenthaler Werner 0512 / 234 - 0
AUGENHEILKUNDE UND OPTOMETRIE
Dr. Gschließer Andreas 0512 / 31 20 20
Dr. Hartlieb Elisabeth 0512 / 250 - 333
Dr. Heinzle Thomas 0512 / 58 58 58
Dr. Huber Stefan 05223 / 422 80
Ao. Univ.-Prof. Dr. Kieselbach Gerhard 0512 / 234 - 262
Dr. Kremser Bernhard 0512 / 234 - 262
Dr. Lechner Herbert 05412 / 687 37
Dr. Luger Martina 0512 / 901 050 80
Dr. Madl-Wiedner Theresa 05224 / 53 464
DDr. Mariacher Martina FEBO 0664 / 998 848 49
Priv. Doz. DDr. Mariacher Siegfried FEBO 0664 / 998 848 58
Dr. Parisi Albino 05224 / 551 22
Dr. Theurl Milan 0512 / 582 410
Dr. Till Andreas 05672 / 653 88
Dr. Waltl Inga 0512 / 234 - 0
Dr. Widmann-Schuchter Barbara 05223 / 426 68
Univ.-Prof. Dr. Wolf Armin FEBO 0512 / 573 269 CHIRURGIE
Univ.-Doz. Dr. Bammer Tanja 05372 / 60 888
Mag. Dr. Bermoser Katrin 05223 / 214 14
Dr. Harpf Christoph 05223 / 225 70
Dr. Kastner Stefan 0512 / 34 23 00
Dr. Laimer Michael 05442 / 209 09
Priv.-Doz. Dr. Mühlmann Gilbert 0512 / 58 17 68
Dr. Pittl Thomas 05223 / 214 14
Dr. Sauper Tonja 0512 / 58 17 68
Dr. Wachter Bernhard 0512 / 57 45 33
Dr. Zehm Sarah 0512 / 55 20 41
DERMATOLOGIE
Dr. Petter Anton 0512 / 20 90 14
Dr. Spötl Ludwig 05223 / 45 48 58
GYNÄKOLOGIE
DDr. Abendstein Burghard 05223 / 54 999 0
Dr. Ehm Andrea 0512 / 56 07 10
Dr. Kirchebner Peter 05242 / 627 90
Dr. Pinzger Gerald 05442 / 941 10 HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
Dr. Freudenschuss Kurt 0664 / 88 23 40 79
Dr. Kirschner Hannes 04852 / 677 00
Dr. Rainer Thomas 0512 / 58 66 04
INNERE MEDIZIN
DDr. Ebner Karl-Martin 0676 / 40 72 914
Univ.-Prof. Dr. Gastl Günther 0676 / 69 29 769
Dr. Gritsch Walter 0512 / 55 05 02
Dr. Hammer Alexander 0660 / 5513314
Dr. Lisch Christoph 0512 / 234 - 529
Dr. Niederwanger Andreas 0512 / 34 10 57
Dr. Sahanic Ajisa 05223 / 52 48 6
Dr. Schauer Norbert 0512 / 56 30 60
Dr. Strasser-Wozak Elisabeth 05223 / 224 43
Dr. Vill David 05224 / 544 08 MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE
Univ.-Doz. Dr. Dr. Jank Siegfried 05223 / 20 45 65 NEUROCHIRURGIE
Dr. Barnas U. Bedran 0512 / 57 53 83
Univ.-Doz. Dr. Galiano Klaus 0512 / 234 - 0
Dr. Girod Pierre-Pascal 0660 / 78 92 075
Univ.-Prof. Dr. Kostron Herwig 0512 / 57 14 76
Dr. Kreil Wolfgang 05412 / 234 - 0
Dr. Mehmeti Arjeta 0660 / 15 54 810 NEUROLOGIE
Dr. Biedermann Birgit 0699 / 11 45 45 03
Dr. Karosin Christina 05224 / 52 846 ORTHOPÄDIE UND ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE
DDr. Abermann Elisabeth 0512 / 39 70 30
Dr. Achammer Thomas 0512 / 56 47 00
Dr. Agreiter Mark 0512 / 56 25 93
Dr. Bitschnau Bertram 0512 / 55 22 10
Dr. Brabec Erich 0512 / 31 90 53
Prof. Dr. Braun Sepp 0512 / 39 70 30
Dr. Druml Christian 0660 / 60 400 60
Ao. Univ.-Prof. Dr. Fink Christian 0512 / 39 70 30
Dr. Frischhut Stefan, MSc. 0664 / 88 41 29 60
Priv.-Doz. Dr. Grubhofer Florian 05356 / 94 141
Dr. Heppner Rene 0660 / 72 51 034
Ing. Dr. Hernegger Gerald 0664 / 65 52 703
Dr. Hochholzer Thomas 0512 / 34 18 91
Dr. Luze Thomas 05262 / 66 5 32
Informationen zu allen aktiven Belegärztinnen und Belegärzten finden Sie auf unserer Website www.privatklinik-hochrum.com

Von allen rund 200 Kopfschmerzarten ist Migräne eine der belastendsten. Ab der Pubertät sind Frauen dreimal häufiger davon betroffen als Männer und lange wurde davon ausgegangen, dass nur hysterische Frauen darunter leiden. „Das ist falsch und das ist sexistisch“, sagt Gregor Brössner. Der Leiter der Innsbrucker Kopfschmerzambulanz ist international anerkannter Migränespezialist und forscht intensiv an der neurologischen Erkrankung, die bei 15 Prozent der Weltbevölkerung regelmäßig das Gehirn verrückt spielen lässt. Er betont: „Es ist im Moment wahrscheinlich die beste Zeit für Migränepatient:innen, weil so wahnsinnig viel Entwicklung passiert.“
Dieser Realismus ist so faszinierend wie verstörend und beweist offenkundig, dass der halbseitige Kopfschmerz keine Geißel der modernen Menschheit ist. Das rund 2.000 Jahre alte Bild zeigt einen jungen Mann, dessen linker Mundwinkel schlaff herabhängt und deutlich macht, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er war Ägypter und in Ägypten, dem alten Ägypten versteht sich, war es eine Zeit lang üblich, die Mumien mit einem Totenbild zu versehen. Ähnlich wie die Parten unseres Totenkultes zeigten diese Bilder ein realistisches Abbild der Verstorbenen. Über 200 ägyptische Totenbilder, die ab Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus gemalt wurden, haben zu Beginn der 2000er-Jahre nicht nur Altertumsexpert:innen, sondern auch Neurolog:innen brennend interessiert, und sie haben sie eingehend studiert. Bei dem jungen Mann führten die Untersuchungen zu einer späten Diagnose. Er könnte am so genannten Parry-Romberg-Syndrom gelitten haben, einer seltenen Erkrankung, die mit Epilepsie und Migräne einhergehen kann. „Die Erstbeschreibung von Migräne geht vermutlich schon zurück auf die alten Ägypter. Dort gibt es Zeichnungen, die darauf schließen lassen, dass ein halbseitiger Kopfschmerz bekannt war“, bestätigt Gregor Brössner die lange Geschichte jener Art von Kopfschmerz, die zu seinen Spezialgebieten zählt.
Gregor Brössner ist Facharzt für Neurologie, Intensivneurologie und Schmerzmedizin. Seit 2007 leitet er die Ambulanz für Kopfund Gesichtsschmerzen an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck – kurz Kopfschmerzambulanz –, wo Migräne aus gutem Grund ein großes Thema ist. „Wir gehen davon aus, dass in Österreich etwa eine Million Menschen von Migräne betroffen sind, weltweit ungefähr 1,2 Milliarden. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung leiden unter Migräne“, sagt er und betont: „Die schiere Zahl der Patient:innen ist so hoch, dass wir wirklich das gesamte Gesundheitssystem brauchen, um die Patient:innen richtig versorgen zu können.“ Kopfschmerzen sind nach Schlaganfall und Demenz der dritthäufigste Grund für einen krankheitsbedingten Verlust an gesunden Lebensjahren beziehungsweise eine der häufigsten Ursachen
Gregor Brössner ist Facharzt für Neurologie, Intensivneurologie und Schmerzmedizin, seit 2007 Leiter der Ambulanz für Kopf- und Gesichtsschmerzen an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck und international anerkannter Migränespezialist.
„Wir gehen davon aus, dass in Österreich etwa eine Million Menschen von Migräne betroffen sind, weltweit ungefähr 1,2 Milliarden.“
Gregor Brössner
für mit Behinderung erlebten Jahren. Migränepatient:innen wissen genau, warum. Der Leiter der Kopfschmerzambulanz weiß das selbstverständlich auch: „Migräne ist meistens eine chronische Erkrankung, sie verläuft meist dauerhaft. Das heißt, wir haben einen langen Zeitraum und zusätzlich auch einen sehr hohen Behinderungsgrad – sprich, die Lebensqualität ist dementsprechend beeinträchtigt.“
Unter dieser Beeinträchtigung können alle Menschen leiden. Die jüngsten Migränepatient:innen an der Innsbrucker Klinik sind zwischen zwei und vier Jahre alt, die ältesten weit über 80. Sind jüngere Kinder davon betroffen, ist es jedoch schwerer, die Krankheit zu diagnostizieren. „Kinder neigen dazu, alle Schmerzen auf den Bauch zu zentrieren“, erklärt Gregor Brössner, „immer dann, wenn ein Kind sagt, es hat immer wieder Bauchschmerzen oder zyklisches Erbrechen, für das keine Ursache gefunden werden kann, sollte man auch an Migräne denken. Besonders wenn Migräne in der Familie liegt.“
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – entführt Gregor Brössner in die attackenreiche Geschichte der Migräne, die ein Stück weit auch seine Geschichte ist. Nicht nur, weil er selbst unter Migräne leidet, sondern weil er vor über 20 Jahren begonnen hat, sich wissenschaftlich mit dieser neurologischen Erkrankung auseinanderzusetzen. Der stellvertretende Direktor der Innsbrucker Uniklinik für
Neurologie ist international anerkannter Migränespezialist und sagt rückblickend: „In der Kopfschmerzforschung muss man sich lange und sehr intensiv mit den Patient: innen auseinandersetzen. Das war das ausschlaggebende Argument, mich mehr dafür zu interessieren.“
Charles Darwin hat seine Migräneattacken recht bildhaft beschrieben – mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und zyklischem Erbrechen. Andere berühmte Migräniker waren Vincent van Gogh, Sigmund Freud, Karl Marx, Wilhelm Busch, Gustav Mahler, Richard Wagner oder Alfred Nobel. Die Liste lässt sich lange fortsetzen und mit Marie Curie ist auch eine Frau im historischen Migräne-Who-is-who zu finden. Sie hätte fast ihr Studium abgebrochen, weil sie an derart heftigen Migräneattacken gelitten hat. In derart honoriger Gesellschaft zu sein, bleibt für Betroffene ein schwacher Trost. Und mag die Geschichte der Migräne möglicherweise auch so alt sein wie die Menschheit selbst, so ist die Forschung dazu sehr, sehr jung.
Alte Krankheit, junge Forschung
Erst Ende der 1980er-Jahre wurden die unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen offiziell differenziert und definiert. „Die international gültige und auch anerkannte Definition einer Migräneattacke existiert erst seit 1988. Damals wurde durch die inter-


nationale Kopfschmerzklassifikation festgelegt, welche klinischen Charakteristika erfüllt sein müssen, damit man von einer Migräne sprechen kann“, erklärt Gregor Brössner. Mit der Kopfschmerzklassifikation wurde die Basis geschaffen, um auf dem Gebiet überhaupt wissenschaftlich arbeiten und forschen zu können, ist das exakte Klassifizieren dafür doch das Um und Auf.
Als dann vor etwa 30 Jahren die Bildgebungsmöglichkeiten mit MRT und CT fein und immer feiner wurden, erfuhr die Kopfschmerzforschung einen regelrechten Schub. Einen Schub, der weiter anhält, auch immer mehr Geheimnisse über die Migräne ans Tageslicht bringt und damit Möglichkeiten eröffnet, die längst als neurologische Erkrankung identifizierten Attacken im Kopf zu behandeln. Gregor Brössner: „Durch diese nichtinvasiven Untersuchun-
MAG DIE
SEHR, SEHR JUNG.
gen wie MRT oder funktionelles MRT können wir tatsächlich dem Gehirn beim Arbeiten zusehen und letztlich auch jene Bereiche sichtbar machen, die während der Migräne verrückt spielen.“ Diese Einsichten ins Allerheiligste der Menschen und das Identifizieren von so genannten Biomarkern beziehungsweise Neurotransmittern – das sind chemische Botenstoffe, die im Zuge einer Attacke ausgeschüttet werden – sind entscheidend dafür, weitere Therapieschritte setzen und den Migränepatient:innen helfen zu können.
Im medica-Podcast beschreibt Gregor Brössner den Unterschied zwischen primären Kopfschmerzerkrankungen, bei denen der Schmerz selbst die Erkrankung ist, und sekundären Kopfschmerzerkrankungen, bei denen der Kopfschmerz ein Symptom – etwa eines Hirntumors – ist. „Unser wichtigstes

Wesentliche Fortschritte.
Im medica-Podcast macht der Innsbrucker Migränespezialist Gregor Brössner, der auch Vorstandsmitglied der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft ist, den Migränepatient:innen durch seine wissenden Blicke in die Therapiemöglichkeiten, die es bereits gibt, und jene, die er in den nächsten Jahren erwartet, Hoffnung auf mehr Lebensqualität. „Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die aktuell beforscht werden, wo ich damit rechne, dass ein Teil davon in den nächsten zwei bis drei Jahren für die Attackenbehandlung und die Prophylaxe auf den Markt kommen“, stellt er etwa fest und sagt auch: „Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch wesentliche Fortschritte machen werden und dass die Medikamente nicht nur besser, sondern auch besser verträglich werden.“
Tool ist, zu unterscheiden, hat der oder die Patientin einen primären oder sekundären Kopfschmerz. Der sekundäre ist potenziell lebensbedrohlich. Der primäre ist zweifelsohne unangenehm, aber nicht lebensbedrohlich“, sagt er.
Migräne ist also eine primäre Kopfschmerzerkrankung, bei der die Geschichte, die die Patient:innen erzählen, der Schlüssel zur Diagnose ist. Dabei sind die Ärztinnen und Ärzte gefordert, die richtigen Fragen so zu stellen, damit die Patient:innen sie richtig beantworten können. Als sehr hilfreich für die Diagnose bezeichnet Gregor Brössner ein Migräne-Tagebuch, in dem die Patient:innen zwei bis drei Monate lang Aufzeichnungen führen. „Und der dritte, ganz wichtige Punkt, ist Zeit“, so der Spezialist, „Kopfschmerzmedizin braucht Zeit und auch ich, der schon über 20 Jahre die Kopfschmerzambulanz leitet, nehme mir für das erste Gespräch durchaus eine knappe Stunde Zeit. Die brauche ich auch, um die richtige Diagnose zu stellen und die Patient:innen in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen und auch die Lebenssituation mitzuberücksichtigen, damit man dann die richtige Therapie findet.“
Die Innsbrucker Kopfschmerzambulanz ist gemessen am Patient:innenaufkommen die größte Österreichs und weil die Ambulanz nicht nur bestens vernetzt ist, sondern auch in wissenschaftlichen Fragen die Nase weit vorne hat, können die Patient:innen vom Fortschritt rasch profitieren. Federführend war das Zentrum beispielsweise bei den Zulassungsstudien im Zusammenhang mit der so genannten „Migränespritze“ beteiligt, die durchaus als Highlight der letzten Jahre bezeichnet werden darf. Zwischenzeitlich gibt es bereits vier Migränespritzen zur Prophylaxe, wobei drei monatlich unter die Haut gespritzt werden und eine im Drei-Monats-Rhythmus als Infusion verabreicht wird. Mit den Wirkstoffen dieser Medikamente werden die erwähnten Neurotransmitter geschickt wegblockiert. „Das sind Therapien, die längerfristig angewendet werden müssen – über Monate und auch Jahre, wobei wir da einen exzellenten Erfolg sehen. Bei 70 bis 80 Prozent der Patient:innen
kann die Migräneausgangsfrequenz halbiert werden“, erzählt Gregor Brössner.
Gewitter im Kopf
Die Frequenz von Migräneattacken kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die mehrmals wöchentlich, andere, die monatlich, und wieder andere, die unregelmäßig vom Gewitter im Kopf regelrecht ausgeknockt werden. Immer unterbrechen diese Attacken, bei denen einzelne Areale des Gehirns nachweislich anders funktionieren, den Lebensfluss und wenn die Häufigkeit halbiert wird, ist der Gewinn an Lebensqualität enorm. „Wir sehen auch manche Patient:innen, die nach dieser Therapie gar keine Attacken mehr haben – das ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme“, stellt der Neurologe fest. Und dass 20 Prozent der Patienten:innen gar nicht darauf ansprechen, ist wieder so ein Hinweis auf die individuellen Spielarten dieser verflixten chronischen Krankheit.
Im medica-Podcast beschreibt Gregor Brössner auch besondere Untergruppen der Migräne, erklärt, welche externen Einflüsse die Attackenhäufigkeit beeinflussen können, und das so genannte Drei-Säulen-Modell der Behandlung, wobei die erste Säule nichtmedikamentöse Vorbeugung betrifft, die zweite Säule aus der so genannten Attackentherapie und die dritte Säule aus der manchmal notwendigen medikamentösen Prophylaxe besteht. „Wir wissen, dass Hunger ein extrem potenter Auslöser ist. Der Trugschluss führt bei vielen Patient:innen dazu, dass sie eine Migränediät machen, die meistens nicht erfolgversprechend ist“, sagt er.
Selbstkasteiung, Alkohol und auch der Aufenthalt in höheren Höhen können eine Migräneattacke triggern. Der klassische Tiroler Föhn kann das auch, selbst wenn der harte wissenschaftliche Beweis dafür noch aussteht beziehungsweise aufgrund der unterschiedlichen Wetterdaten oder der großen Beweglichkeit der Patient:innen schwer bis gar nicht erbracht werden kann. „Ähnliche Wetterszenarien gibt es auch in Kanada oder
Israel und auch dort gibt es Beschreibungen, dass Föhn ungünstig ist für das Auslösen von Migräneattacken“, weiß Gregor Brössner, „man kann schon einen Zusammenhang erkennen.“
Ohne Zweifel wissenschaftlich belegt ist längst, dass Frauen häufiger, ja zwischen Pubertät und Menopause bis zu drei Mal öfter unter Migräne leiden, als Männer. In Mitteleuropa ist bis zu jede dritte Frau von Migräne betroffen. Das ist eine riesengroße Zahl, die wohl – wieder einmal – dem eigentümlichen Spiel der weiblichen Hormone zu verdanken ist. Gregor Brössner: „Die Mehrzahl der betroffenen Frauen haben während des Zyklus die heftigsten, längsten und am schwierigsten zu therapierenden Migräneattacken. Manche Frauen haben das gleiche Phänomen auch um den Eisprung
herum.“ Eine Schwangerschaft kann sich positiv auf die Migräne auswirken und nach der Menopause nehmen die Attacken und ihre Heftigkeit meist ab.
Lange, viel zu lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass nur hysterische Frauen unter Migräne leiden. „Das ist falsch und das ist sexistisch. Wir können heute durch eine Vielzahl von wissenschaftlich exzellent fundierten Untersuchungen behaupten, dass die Migräne eine Erkrankung ist, die eine neurobiologische Grundlage hat“, stellt der Experte klar. Dieses Wissen hat seinen Vorgängern
gefehlt und sie bei der Migräne – wie auch bei anderen, nicht sichtbar zu machenden Erkrankungen – das bitterböse Vorurteil pflegen lassen, dass nur hysterische Frauen betroffen sind. Harte wissenschaftliche Fakten haben diesem Sexismus den Garaus gemacht. Und angesichts all der Fortschritte in Forschung und Behandlung von Migräne ist Gregor Brössner froh, feststellen zu können: „Es ist im Moment wahrscheinlich die beste Zeit für Migränepatient:innen, weil so wahnsinnig viel Entwicklung passiert.“
Alexandra Keller
Besseres Studium, bessere Chancen.


Geblockte Lehrveranstaltungen und innovative Online- und Blended-Learning Elemente garantieren, dass die Master-Studien an der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL mit dem Beruf vereinbar abgewickelt werden. Die Master-Studien für Health Professionals:
▪ Health Care Management (CE)
▪ Pflegewissenschaft (ANP, Pflegepädagogik, Pflegemanagement)
▪ Public Health
▪ Medizinische Informatik (CE) (Online Studium)
▪ Health Information Management (Online-Studium)


Brustkrebs. Die Diagnose ist und bleibt für jede betroffene Frau erschütternd. Doch ist die Brustkrebserkrankung derart von Innovationen getrieben, dass der Angst mit guten und immer besseren Nachrichten begegnet werden kann. Für Michael Hubalek sind die großen Heilerfolge eine Motivation, seiner Berufung mit viel Engagement zu folgen. Der Gynäkologe ist Spezialist für Brustchirurgie und sagt: „Wir können 80 Prozent der Patientinnen, die an Brustkrebs erkranken, wirklich heilen.“ Eine wirklich gute Nachricht.
LAUT STATISTIK ERKRANKEN
JÄHRLICH RUND 5.000
ÖSTERREICHERINNEN AN BRUSTKREBS.
Alles beginnt mit einer einzelnen Zelle. Einer Zelle, die entartet. „Wir wissen, dass jeden Tag hunderttausende Zellen in unserem Körper verändert werden, die das Immunsystem dann repariert. Wir wissen auch, dass es ganz viele Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Was aber letztendlich dazu führt, dass Brustkrebs so eine häufige Erkrankung ist, das wissen wir nicht“, sagt Michael Hubalek. Er ist Gynäkologe und Spezialist für Brustchirurgie und arbeitet in seiner eigenen Praxis und im Brustzentrum in Schwaz sowie am Brustinstitut der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck. Die Gretchenfrage im Zusammenhang mit der Entstehung von Brustkrebs kann auch er nicht beantworten. „Könnte ich das in drei Sätzen, würde ich wahrscheinlich den Nobelpreis bekommen“, meint er. Stimmt.
Die Ursachen für das Entarten von Zellen scheinen so vielfältig zu sein wie die Menschen selbst. Doch auch wenn das ein Mysterium bleibt, können viele, ja immer mehr Fragen beantwortet werden. Vor allem auch jene, die Frauen mit der Diagnose Brustkrebs regelrecht niederschmettern und sie im Verlauf der Behandlung beziehungsweise Therapie begleiten. Viele sind’s. Fragen wie Frauen.
Viele Fragen, immer mehr Antworten
Laut Statistik erkranken jährlich rund 5.000 Österreicherinnen an Brustkrebs. Brustkrebs ist damit hier wie überall auf der Welt die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Das ist auch der befeuernde Hin-
Michael Hubalek ist Gynäkologe und Spezialist für Brustchirurgie mit eigener Praxis in Schwaz. Außerdem ist er im Brustzentrum in Schwaz sowie am Brustinstitut der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck tätig.

„Ich kann nur appellieren, dass sich Frauen zusammenschließen und über ihre Erkrankung und die Nebenwirkungen der Therapie oder auch Nachfolgekomplikationen, die auftreten, sprechen.“
Michael Hubalek
tergrund dafür, dass das Thema Brustkrebs international ein extrem dynamisches Forschungsfeld ist. Und die Antworten werden immer positiver. „Wir können 80 Prozent der Patientinnen, die an Brustkrebs erkranken, wirklich heilen“, stellt Michael Hubalek klar. Natürlich gibt es Patientinnen, denen er weniger vorteilhafte Diagnosen mitteilen muss. Dann etwa, wenn der Krebs sehr spät diagnostiziert wurde oder sehr aggressiv ist, „aber der allergrößte Teil der Patientinnen kommt in einem sehr frühen Stadium und damit kann man sie sogar zu fast 100 Prozent heilen. Das ist das Mo-
tivierende für mich, weil ich mich nicht mit einer Krankheit beschäftigen muss, die kaum bis schlecht behandelbar oder nicht heilbar ist.“
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – erzählt Michael Hubalek, was ihn dazu motivierte, sich auf Brustkrebs und Brustchirurgie zu konzentrieren. „Speziell die Brustkrebserkrankung wird durch Innovationen getrieben. Es war sehr spannend, zu beobachten, wie dynamisch sich die Behandlung der Erkrankung entwickelt hat“, erklärt er.

Mit seiner Habilitation hat sich Michael Hubalek 2014 die Tore in die wissenschaftliche Welt geöffnet, wo er dieselbe umsichtige Neugier walten lässt, wie in seiner Praxis oder dem OP. 2014 war auch das Jahr, in dem das Österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ins Leben gerufen wurde. Gratis wird den Frauen seither die regelmäßige Mammographie angeboten, die es möglich macht, eine Erkrankung der Brust früh erkennen zu können. „Die frühe Diagnose dieser Erkrankung bedeutet – wie erwähnt – auch die Heilung. Das ist letztendlich, was motivieren sollte, diese Gratisuntersuchung in Anspruch zu nehmen“, sagt der Arzt.
Um das Risiko im Zaum zu halten und die potenziellen Chancen für eine Heilung sowie auf eine möglichst schonende Therapie vorsorglich ausreizen zu können, sind nicht nur die Hochachtung gegenüber der eigenen Brustgesundheit beziehungsweise das richtige Abtasten der Brust, sondern ebendiese radiologische Bildgebung und eine Ultraschalluntersuchung entscheidend. Es gibt auch familiär bedingte Faktoren oder Dispositionen, bei denen es besonders ratsam ist, die Brust gut zu beobachten. „Wir müssen unterscheiden zwischen familiärer Disposition und genetischen Veränderungen“, sagt Michael Hubalek. Eine genetische Veränderung, die so genannte BRCA1-Mutation, wurde beispielsweise wegen einer Berühmtheit berühmt. Nachdem Schauspielerin Angelina Jolie öffentlich gemacht hatte, dass sie von dieser Mutation betroffen ist, die mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit dazu führt, im Laufe des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, war die mediale Aufmerksamkeit gegenüber dieser genetisch begründeten Gefahr sehr hoch. „Das ist immer familiär bedingt. Es wird immer von Vater
oder Mutter an die Nachkommen weitervererbt und tritt nicht spontan auf“, sagt der Gynäkologe und hält zur Statistik fest: „Eine von 600 Frauen trägt diese Mutation.“
Im medica-Podcast beschreibt Michael Hubalek eine zweite familiäre Situation, wegen der das Brustvorsorgeprogramm engmaschiger geplant werden sollte: „Wenn in einer Familie häufiger Brustkrebs auftritt, ohne dass diese Mutation nachweisbar ist.“ Ist Brustkrebs Teil der Familiengeschichte – sind beispielsweise zwei oder drei Brustkrebsfälle in der Familie bekannt –, kann das ein erhöhtes Risiko bedeuten, „hier sollte die Mammographie nicht alle zwei Jahre, sondern jährlich durchgeführt werden“.
Als Brustkrebs-Spezialist ist Michael Hubalek zwingend oft mit sehr aufwühlenden, angstvollen und für die betroffenen Frauen sehr belastenden Situationen konfrontiert. Die Diagnose Krebs bleibt schrecklich. Sie löst trotz aller Behandlungs- und Heilungserfolge ein dramatisches Kopfkino aus. Und rasch auch das, was fast immer als Kampf bezeichnet wird. Eine glückliche Wortwahl? „Es ist immer die Frage, wie ich Kampf definiere, ob ich Kampf eher positiv oder negativ sehe. Ich denke, dass letztendlich vor allem der Kampf gegen die Angst im Vordergrund stehen sollte – nicht die Angst vor der Erkrankung selber“, animiert der Arzt die betroffenen Frauen dazu, sich gegen die eigenen Ängste zu stellen, „das ist die wesentliche Herausforderung.“
Zu dieser Herausforderung gesellt sich gewissermaßen auch jene, all die neuen und meist unbekannten Begriffe zu entwirren, die mit einem Mammakarzinom zusammenhängen. „Es gibt verschiedene Arten von Brustkrebs“, stellt Michael Hubalek klar. So gibt es etwa jenen, der sich sehr langsam entwickelt und meist jenseits des 60. Lebensjahres auftritt. Der so genannte Altersbrustkrebs ist ein hormonabhängiger Brustkrebs, der meistens keinen genetischen Ursprung hat und dessen Entstehung von Umweltfaktoren beeinflusst oder ausgelöst wird. Je älter die Frau wird, umso mehr Um-
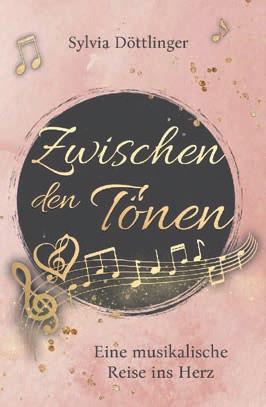
Als Silvia Döttlinger die Diagnose Brustkrebs erhalten hat, hat diese ihr Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Das Festhalten ihrer Gedanken und Gefühle war ihr dabei ein hilfreiches Ventil, denn auf einem Blatt Papier hat alles Platz: Angst, Ohnmacht, Wut, Hoffnung und versteckte Sehnsüchte. So wurde Döttlinger in dieser schicksalhaften Zeit selbst zur Autorin. Das Buch „Zwischen den Tönen – eine musikalische Reise ins Herz“ ist ihr mittlerweile viertes: „In diesem sehr persönlichen Werk nehme ich meine Leser:innen mit auf eine Reise, die von Musik, Emotionen, Krisen und der Kraft des inneren Wandels geprägt ist. Inspiriert von fünf bewegenden Liedern verbinde ich persönliche Erfahrungen mit Impulsen, die zum Innehalten und Nachspüren einladen.“ Das Buch ist mehr als eine autobiografische Geschichte. Es ermutigt sanft, ehrlich und mit Herz dazu, dem eigenen Rhythmus zu folgen.
182 Seiten, EUR 14,90. Erhältlich unter www.buchschmiede.at
weltfaktoren ist sie ausgesetzt. „Die Brustdrüse ist per se ein hormonabhängiges Organ. Jede Frau spürt das im Laufe des Zyklus, wenn die Brust anschwillt und abschwillt“, so der Gynäkologe. Weil Tumorzellen ebenfalls hormonabhängig sind, wird diese Art des Tumors meist damit behandelt, dem Körper das Hormon zu entziehen, um ein Wachstum der Brustzellen zu verhindern. Zirka 70 Prozent der Frauen sind von diesem hormonabhängigen Brustkrebs betroffen.
Weder von Hormonen noch von Umweltfaktoren oder sonstigen Dispositionen abhängig sind die so genannten Triple-negativen Tumore. Michael Hubalek: „Sie wachsen extrem schnell, extrem aggressiv. Meistens ist bei dieser Art von Brustkrebs eine Chemotherapie notwendig. Das ist eigentlich auch die Erkrankung, die derzeit mit der schlechtesten Prognose einhergeht.“
Die allerhöchsten Heilungschancen werden bei der so genannten HER2-positiven Brustkrebserkrankung verzeichnet. Auch diese Tumore wachsen sehr aggressiv, doch stehen den davon betroffenen Frauen zwischenzeitlich spezielle Antikörper, also Immuntherapien, zur Verfügung, mit denen die Krankheit so effektiv wie ausgezeichnet behandelt werden kann. Hintergrund dafür ist die intensive Brustkrebsforschung, die auf vielen Gebieten bahnbrechend ist. So auch bei der HER2-positiven Erkrankung. „Man hat teilweise neue Immuntherapien entwickelt, die nur auf Brustkrebs bezogen sind. Wir können inzwischen auch bestimmte Mutationen, wie die BRCA1-Mutation mit spezifischen Medikamenten behandeln“, nennt der Gynäkologe Beispiele für die positive Dynamik.
Im medica-Podcast erzählt Michael Hubalek, dass die meisten Tumore nach wie vor chirurgisch entfernt werden. „Aber es gibt jetzt zunehmend Strategien, wo man versucht auf die Operation zu verzichten“, spricht er die Möglichkeit an, hormonabhängige Tumore ausschließlich mit einer antihormonellen Therapie zu behandeln – vor allem dann, wenn eine Operation zu gefährlich oder nicht möglich ist.

Zum Podcast
Diagnose Brustkrebs.
Im medica-Podcast mit dem Schwazer Gynäkologen und Spezialisten für Brustchirurgie Michael Hubalek steht jene Krebserkrankung im Mittelpunkt, von der Frauen am häufigsten betroffen sind. Dabei spricht der Arzt auch über die Herausforderung, im dynamischen Forschungsfeld stets up to date zu bleiben, oder etwa über den in sozialen Medien kursierenden Begriff der Brustkrebspersönlichkeit, für den es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. „Letztendlich ist natürlich der gesunde Geist in einem gesunden Körper ein Schlagwort, das wir seit vielen Jahrhunderten kennen“, sagt er.
MAMMOGRAPHIE ANGEBOTEN.
Was auf eine Brustkrebsdiagnose folgt, kann durchaus als wilder Ritt durch emotionale Höllen bezeichnet werden. Die dann – bestenfalls – nur einen Lebensabschnitt bestimmende Gemengelage aus Krebs, eventueller Bestrahlung, medikamentöser oder Chemotherapie ist bei allen Krebserkrankungen eine fast schon unmenschliche emotionale Herausforderung. Und betrifft die Erkrankung die Brust, steht zudem jenes Organ im Mittelpunkt, das die Weiblichkeit definiert. „Trotz aller Fortschritte müssen wir nach wie vor bei manchen Frauen die Brust vollständig entfernen“, beschreibt Michael Hubalek den Supergau für das Körperund Selbstwertgefühl der betroffenen Frau. Durch die Amputation einer Brust wird die Symmetrie, die das Frauenbild bestimmt, zerstört. Das Gefühl der Unvollständigkeit macht den Blick in den Spiegel zur Qual. „Ich glaube, dass das Reden, das Reden über die Ängste und die Nebenwirkungen der Therapie ganz wichtig ist. Ich kann nur appellieren, dass sich Frauen zusammenschließen und über ihre Erkrankung und die Nebenwirkungen der Therapie oder auch Nachfolgekomplikationen, die auftreten, sprechen“, sagt Michael Hubalek. Wenn betroffene Frauen mit betroffenen Frauen sprechen, helfe ihnen das sehr viel weiter und er wäre froh, wenn es in Tirol mehr Selbsthilfegruppen gäbe, in denen das ermöglicht wird.
Körpergefühl
„Wir können in den meisten Fällen die Brust wieder aufbauen, insofern können wir da von medizinischer Seite viel beitragen, um das Körperbild zu erhalten“, lenkt Michael Hubalek den Blick zurück in den Operationssaal. Brustrekonstruktion ist eines seiner Spezialgebiete und auch auf diesem Gebiet sind die Fortschritte groß. „Inzwi-
schen gibt es auch so genannte onkoplastische Operationsverfahren, wo wir einen relativ großen Teil – ein Viertel der Brust zum Beispiel – entfernen können und ein gutes Ergebnis durch die Kombination einer kosmetischen Operationstechnik und der onkologischen Operationstechnik erzielen“, erklärt der Brustchirurg. „Manchmal muss man natürlich auch die gesunde Seite noch anpassen, um die Symmetrie zu erreichen.“ Inzwischen – auch das ist eine schöne Folge des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms – können 80 Prozent der betroffenen Frauen brusterhaltend operiert werden und bei über 90 Prozent wird die Brust sofort – also in derselben Operation, bei welcher der Tumor entfernt wird – rekonstruiert.
Im medica-Podcast erklärt Michael Hubalek die zwei Techniken, die bei einem Wiederaufbau der Brust angewendet werden –mit einem Implantat oder mit Eigengewebe. „Wenn ich weiß, dass eine Patientin nach der OP der Brust bestrahlt werden muss, dann biete ich eher einen Eigengewebsaufbau an“, sagt er.
Viel Können und nicht minder viel Einfühlungsvermögen sind nötig, um die von Brustkrebs betroffene Frau so zu begleiten, dass sie auch den medikamentösen Therapieparcours – durch die Krebserkrankung und bestenfalls aus ihr heraus – motiviert absolviert. „Dann weiß ich, ich habe ihr richtig gut erklärt, warum das sinnvoll ist, und sie hat es verstanden“, sagt Michael Hubalek und betont: „Aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, dass die Patientinnen aufgeklärt sind, sämtliche Informationen bekommen und dass man ehrlich mit ihnen ist.“ Es sind ja auch viele gute Nachrichten dabei.
Alexandra Keller


Dass das Bezirkskrankenhaus Kufstein als außergewöhnlich aktiver medizinischer Forschungsstandort bezeichnet werden darf, ist August Zabernigg und seinem Team zu verdanken. Der Leiter der Inneren Medizin widmet sein wissenschaftliches Engagement auch speziellen Brustkrebs-Fragen und vor allem der so genannten Quality-of-LifeErhebung in der Onkologie. Seit 2004 ist die Methode bereits Teil der onkologischen Routineversorgung im Haus und August Zabernigg sagt: „Die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten ist besonders wichtig, genauso wie der Behandlungserfolg selbst.“

„Mein persönlicher Forschungsschwerpunkt liegt bei der Lebensqualität. Wir behandeln ja nicht Tumore, sondern tumorkranke Menschen.“
August Zabernigg
Im ersten Moment wirkt es überraschend. Im zweiten dann nicht mehr. Das Bezirkskrankenhaus (BKH) Kufstein – mit seinen 14 Fachgebieten und über 1.300 Mitarbeiter:innen – ist auch als wissenschaftlicher Standort bekannt, nimmt teil an zahlreichen medizinischen Studien und ist in einigen Spezialbereichen auch Initiator derselben. „Natürlich darf man uns nicht vergleichen mit einer Universitätsklinik. Das Spektrum unserer wissenschaftlichen Aktivitäten ist natürlich deutlich kleiner, aber wir sind aktiv“, stellt August Zabernigg klar.
August Zabernigg ist Internist, Hämatologe sowie Onkologe, stellvertretender ärztlicher Direktor und seit 2015 Leiter der Inneren Medizin am BKH Kufstein. Sein Spektrum ist also ziemlich breit und sein persönliches Interesse ist der Ursprung dafür, dass das BKH Kufstein auch ein Standbein in der akademischen Welt hat. Auf die Frage, was ihn antreibt, betont der Arzt: „Ich habe Freude an dem Beruf und liebe besonders in der Hämatologie und Onkologie nicht nur die Betreuung schwerkranker Patientinnen und Patienten sondern die sehr intensive Verknüpfung von Wissenschaft und klinischer Tätigkeit.“ Eine spannende Mischung ist das. Eine Kombination, die eine wichtige Brücke zwischen medizinischem Fortschritt und dem Krankenbett schlägt beziehungsweise Fragen, die sich in der praktischen Betreuung der Patient:innen stellen, in die Wissenschaft trägt.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie beim Gespräch dabei sein – erzählt August Zabernigg über die entscheidenden Wendepunkte in seinem beruflichen Leben
und berichtet beispielsweise über jenen einschneidenden Schritt von der medizinischen Biologie hin zur klinischen Medizin – insbesondere zur Hämatologie, die sich mit Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe befasst. Er sagt: „Das sind zwar zwei unterschiedliche Fächer, aber als jemand, der gerne Mikrobiologie betreiben wollte, war die Hämatologie ein sehr naheliegendes Fach. Es ist die Art zu denken.“
Die Art zu denken, die der Primar da anspricht, ist eine recht abstrakte. Eine auch, die für klinische, also ganz direkt mit kranken Menschen arbeitende beziehungsweise sie behandelnde Ärztinnen und Ärzte, außerhalb von Universitätskliniken eher ungewöhnlich ist. Als August Zabernigg 1989 ans BKH Kufstein kam, brachte er die wissenschaftliche Neugier jedoch mit und begann, sie knapp vor Beginn des neuen Jahrtausends auch auf die Onkologie, also jene medizinische Wissenschaft, die sich mit Krebs befasst, zu konzentrieren.
Erkenntnissprünge
Vor rund 30 oder 40 Jahren war das Wissen über Tumore noch gering. „Die Onkologie hat sich dann rapide entwickelt. Das war Ende der 1990er-Jahre – mit neuen Chemotherapien, mit neuen Erkenntnissen und neuen zielgerichteten Therapien. Und plötzlich wurde die Onkologie auch für den vormals schwerpunktmäßig in der Hämatologie tätigen Arzt sehr attraktiv“, beschreibt August Zabernigg den Wendepunkt.
Der im Volksmund gängige Ausdruck „Geschwulst“ für die Krankheit Krebs wurde
zwar durch eine zwischenzeitlich rund 300 verschiedene Krebsarten unterscheidende Differenzierung abgelöst, doch gehört er –wie August Zabernigg weiß – nach wie vor nicht der Vergangenheit an: „Es ist ein volkstümlicher Begriff, der auf einfache Weise das Richtige benennt.“ Der Begriff Tumor leitet sich vom lateinischen Wort für „Schwellung“ ab und eine krankhafte Gewebewucherung, die durch übermäßiges Zellwachstum entsteht, kann sich eben als Schwellung oder Knoten zeigen. Und auch als solches wahrgenommen beziehungsweise ertastet werden – etwa in der Brust.
Die Behandlung von Brustkrebs – der Schwazer Gynäkologe Michael Hubalek berichtet in dieser zweiten medica-Ausgabe und Podcast-Staffel über die bei Frauen am häufigsten auftretenden Krebserkrankung sowie die Brustrekonstruktion – wurde im Zuge der großen Erkenntnissprünge der vergangenen zwei Jahrzehnte auch am BKH Kufstein zu einen Schwerpunktthema. Nicht nur, weil das Haus eine zentrale Rolle in der überregionalen Koordination der Krebsversorgung einnimmt, sondern eben auch, weil es an medizinischen Studien beteiligt ist. „Wir sind in der ganz besonderen Situation, dass wir eine eigene wissenschaftliche Assistentin haben, die ausschließlich für die Dokumentation wissenschaftlicher Projekte zuständig ist“, betont August Zabernigg die Rolle der Studienkoordinatorin Sabine Kriesche, die so etwas wie den Dreh- und Angelpunkt für die wissenschaftliche Arbeit am BKH Kufstein personifiziert. Dort haben alle Hämatologinnen und Hämatologen die Ausbildung, um wissenschaftliche Studien durchführen zu können. „Und wir haben uns über die Jahrzehnte ein Netzwerk aufbauen dürfen“, sagt August Zabernigg.
Im medica-Podcast erklärt der Primar, wie sich die Behandlung von Brustkrebs-Patientinnen in den vergangenen Jahren verändert hat. „Ein ganz großer Sprung war die Erkenntnis, dass eine alleinige Operation, vielleicht auch mit begleitender Strahlentherapie, vielen Patientinnen kurzfristig eine
Verbesserung der Situation ermöglicht, aber nicht zur Heilung führt“, sagt er.
Wie andere Tumorerkrankungen ist Brustkrebs in vielen Fällen eine so genannte systemische Erkrankung. Das heißt, der sichtbare Tumor ist relativ klein, hat sich aber in mikroskopischer Form schon über den Körper verteilt. August Zabernigg: „Diese Erkenntnis hat dann zur Entwicklung von Medikamenten geführt, die genau diese mikroskopische Erkrankung, die sich über den Körper verteilt hat, behandelt oder bekämpft und damit einen Rückfall der Tumorerkrankung verhindert und nach einer Operation die Chance, geheilt zu werden, deutlich verbessert hat.“
Internationale Studien – es handelt sich dabei um sogenannte vergleichende randomisierte Phase-III-Studien, an denen die Expert:innen des BKH Kufstein derzeit teilnehmen –, beschäftigen sich etwa mit der begleitenden antihormonellen Therapie nach erfolgreicher Brustkrebs-Operation.
Eine Eigenstudie führt der Primar aktuell zum Thema Quality of Life bei Brustkrebspatientinnen durch, die mit intensiver Chemotherapie behandelt werden. Als Nebenwirkung kann dabei beispielsweise eine Polyneuropathie auftreten, also eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, die zu Symptomen wie Kribbeln, Taubheit, Schmerzen oder Muskelschwäche und auch zum Abbrechen der Behandlung führen kann. August Zabernigg untersucht, welchen Effekt Maßnahmen, wie beispielsweise die Kühlung der Hände und Füße, auf die Abbruchrate haben. „Mein persönlicher Forschungsschwerpunkt liegt bei der Lebensqualität“, rückt August Zabernigg jenes Thema in den Mittelpunkt, das bei der aktuellen Studie eine wichtige Rolle spielt und das ihn schon seit über 20 Jahren beschäftigt. Er sagt: „Wir behandeln ja nicht Tumore, sondern tumorkranke Menschen.“ Das ist der entscheidende Punkt, der menschliche und gleichzeitig jener, welcher die Lebensqualitäts- beziehungsweise Quality-of-Life-Erhebung so wichtig für die Patientinnen und ihre Behandelnden macht.

Auch für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern wird zudem über das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden eines Menschen definiert. Medizinische Behandlungen sollten demnach nicht allein die Symptomverbesserung, sondern eine Lebensqualitätsverbesserung der Patient:innen zum Ziel haben.
Tief verwurzelt. Es sind auf allen erdenklichen Ebenen herausfordernde und belastende Lebensabschnitte, Lebensabschnitte mit der Diagnose Krebs, die im medicaPodcast mit August Zabernigg thematisiert werden. Der Hämatologe, Onkologe und Primar der Inneren Medizin im Bezirkskrankenhaus Kufstein begleitet seine Patient:innen mit viel Fachwissen und nicht minder viel Menschlichkeit auf diesen Lebensabschnitten. Die Quality-of-Life-Methode, die ihm besonders – auch am wissenschaftlichen – Herzen liegt, ist ein Fachgebiet, das Empathie mit Wissenschaft verbindet. „Lebensqualität kann auch eine messbare Größe sein“, sagt er.
Im medica-Podcast erklärt August Zabernigg, warum der so rasant gewordene medizinische Fortschritt auch Schattenseiten hat. Die Behandelnden sind großem Druck ausgesetzt, auch Medikamente, deren potenzielle Nebenwirkungen noch nicht detailliert beobachtet werden konnten, einzusetzen. „Ich glaube aber, dass grundsätzlich der positive Aspekt überwiegt – der schnelle Zugang zu wirksamen Medikamenten“, sagt er.
An der so genannten gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Health-Related Quality of Life, HRQoL) wird weltweit geforscht. Die Universitätsklinik Innsbruck ist auf diesem Gebiet international führend. Im April 2025 erst wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass unter der Leitung der Med Uni Innsbruck mit LifeBoost ein innovatives Unterstützungsprogramm für Krebspatientinnen und Krebspatienten während der Immuntherapie entwickelt wird. „Die Uniklinik Innsbruck spielt hier wirklich eine Vorreiterrolle“, lenkt August Zabernigg den Blick etwa auf die Psychonkolog:innen der Med Uni und vor allem auf Professor Bernhard Holzner (Leiter Klinische und Gesundheitspsychologie), mit dem er beziehungsweise das BKH Kufstein intensiv zusammenarbeitet. „Wir durften schon sehr früh dabei sein und das ist ein ganz großer Gewinn. Die Kooperation ermöglichen uns auch die Teilnahme an Studien. Und sie ermöglicht uns die praktische Durchführung und die Auswertung unserer Erhebungen.“
Blick auf die Lebensqualität
Das standardisierte Verfahren, für dessen praktische Umsetzung im klinischen All-
August Zabernigg ist Internist, Hämatologe sowie Onkologe, stellvertretender ärztlicher Direktor und seit 2015 Leiter der Inneren Medizin am Bezirkskrankenhaus Kufstein. Er beschäftigt sich vorrangig mit der Lebensqualität von Krebs-Patient:innen.

„Die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten ist genauso wichtig wie der Behandlungserfolg selbst.“
August Zabernigg
tag das BKH Kufstein eine Vorreiterrolle einnimmt, setzt sich im Wesentlichen aus einem Fragebogen und dem Gespräch mit den behandelnden Ärzt:innen zusammen.
Der sogenannte „EORTC Core Quality of Life Questionnaire“ (QLQ-C30) beinhaltet 30 Fragen zur Lebensqualität onkologischer Patientinnen und Patienten. Sie beziehen sich unter anderem auf die physische, kognitive, emotionale und Rollenfunktion der Befragten, ihren allgemeinen Gesundheitszustand sowie Symptome wie Schmerzen, Erschöpfung, Übelkeit oder Atemnot. Diese 30 plus zwei Fragen zu Geschmacksstörungen beantwortet beispielsweise eine Brustkrebspatientin am BKH Kufstein vor dem Gespräch mit ihrer Onkologin oder ihrem Onkologen. „Die Behandelnden sehen diesen Fragebogen vor dem Gespräch und können sich sofort ein Bild machen, wo die wirklichen Probleme der Patientin liegen“, erklärt August Zabernigg, „und das sind häufig Probleme, die im Routinegespräch nicht einmal tangiert oder falsch eingeschätzt werden.“
Der Fragebogen beziehungsweise die darin angekreuzten Antworten lenken den medi-
zinischen Blick sofort auf jene Bereiche, in denen die Lebensqualität der Patientin leidet. Auf sie konzentriert sich dann das Gespräch und die Ergebnisse fließen in den Behandlungsplan ein. Das ist der wesentliche Sinn der Lebensqualitäts-Erhebung. „Manchmal hilft es einfach auch, nur darüber zu sprechen und dass sich die Ärztin, der Arzt genau dafür Zeit nimmt“, beschreibt der Primar eine fließende Grenze zur Psychoonkologie, jener multidisziplinären Fachrichtung, die sich mit den psychischen und sozialen Bedürfnissen und Belangen von Krebspatient:innen und deren Angehörigen beschäftigt und im Zusammenhang mit der Lebensqualitäts-Erhebung eine so wichtige Rolle spielt.
Die praktischen Erfahrungen, die August Zabernigg über viele Jahre im Rahmen der Integration der Quality-of-Life-Erhebung sammeln konnte, hat er aufbereitet und 2025 im Rahmen einer Europäischen Krebskonferenz zum Thema Lebensqualitätsforschung in Barcelona vorgestellt. „Ich bin dort nicht als Wissenschaftler aufgetreten, sondern als jemand, der die Lebensqualitäts-Erhebung in der täglichen Routine
macht. Ich habe Expertinnen und Experten aus ganz Europa auseinandergesetzt, wie man diese Methode, die von ihnen selbst sehr wissenschaftlich betrieben wird, ganz praktisch umsetzen kann und wie man den positiven Effekt optimiert, indem man die Lebensqualitäts-Erhebung in ein System, ein Netzwerk, ein Versorgungsnetzwerk einbettet“, berichtet August Zabernigg.
Wieder scheint es der Brückenbau zwischen Wissenschaft und Krankenbett zu sein, die dem Primar gelungen ist. Sein Wunsch ist, dass die Lebensqualitäts-Erhebung, mit denen das BKH Kufstein so gute Erfahrungen macht, selbstverständlicher, integraler Bestandteil der medizinischen Versorgung in der Onkologie wird. Überall. Denn er weiß: „Die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten ist genauso wichtig wie der Behandlungserfolg selbst. Durch die systematische Erhebung können wir Therapien noch besser auf individuelle Bedürfnisse abstimmen und die Lebensqualität langfristig verbessern.“
Alexandra Keller

Starte deine Ausbildung am Pflege Campus Kufstein. Weitere Informationen unter pflegecampus.at
PROMOTION OFZ
Mit steigenden Lebensjahren mehren sich insbesondere bei Frauen Beschwerden und Schmerzen in der seitlichen Hüftgegend. Der Grund dafür liegt häufig ganz woanders, als es eine tradierte Verdachtsdiagnose vermuten lässt. Priv.-Doz. Dr. Mag. Michael
Liebensteiner, PhD, rät daher bei anhaltenden Schmerzen zu einer genauen Diagnostik.
Es beginnt mit Schmerzen bei längerem Stehen oder langsamem Gehen beispielsweise bei einem gemütlichen Stadtbummel. „Typischerweise klagen Patient:innen über Schmerzen im Bereich des großen Rollhügels, das ist die gut spürbare knöcherne Stelle seitlich an der Hüfte, die man fälschlicherweise oft dem Hüftgelenk zuordnet. Doch Letzteres ist deutlich weiter innen und würde Beschwerden mehr im Bereich der Leiste verursachen. Es geht eigentlich um den großen Rollhügel (Trochanter major), an dem ein starker Sehnen-Muskel-Apparat ansetzt, nämlich der mittlere und der kleine Gesäßmuskel – die sogenannte Rotatorenmanschette der Hüfte “, erklärt Priv.-Doz. Dr. Mag. Michael Liebensteiner.
Auf den ersten Verdacht hin werden Pathologien in diesem Bereich tradiert als Bursitis (Schleimbeutelentzündung) diagnostiziert. „Nicht jeder seitliche Gesäßschmerz ist eine Schleimbeutelentzündung. In lediglich zehn Prozent der Fälle ist eine Bursitis die präzise Diagnose. In den überwiegenden Fällen handelt es sich um Sehnenpathologien der Rotatorenmanschette der Hüfte“, erläutert Liebensteiner. Daher sei es wichtig, eine präzise Abklärung durchzuführen.
Überwiegend Frauen betroffen
Auffällig ist, dass diese Pathologien der Rotatorenmanschette der Hüfte zu einem überwiegenden Teil Frauen betreffen, nur ein bis zwei von zehn Betroffenen sind männlich. Warum das so ist, dazu gibt es laut dem Mediziner wenig harte Evidenz. „Letztlich ist der Hauptrisikofaktor das Alter. Die Beschwerden treten meist zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr auf und zeigen wie gesagt eine starke weibliche Prädilektion.“
Man geht demnach davon aus, dass es sich dabei um chronisch degenerative Veränderungen in der großen Familie der Sehnenansatzleiden handelt, sogenannte Insertionstendopathien, wie man sie auch aus dem Schulterbereich kennt.

Anatomische Übersicht über das rechte Gesäß von hinten. Sichtbar ist der große Gesäßmuskel (Musculus glutaeus maximus).
Ursache dafür sind Überlastungen oder Entzündungen, die über die Zeit zu feinen Einrissen bis hin zum kompletten Riss fortschreiten können. Neben der Schmerzsymptomatik zeigt sich dabei auch oft ein hinkender, watschelnder Gang oder ein eingeknicktes Stehen. Getriggert wird die Symptomatik häufig durch ein Bagatelltrauma.
Gekommen, um zu bleiben
Werden die Schmerzen chronisch und führen zu Einschränkungen im täglichen Leben, ist es jedenfalls ratsam, eine weiterführende Diagnostik durchzuführen. „Der Goldstandard in der Abklärung ist eine Magnetresonanztomografie. Mittels MRT können sowohl Schädigungen der Sehnen, die von einer
„NICHT
JEDER SEITLICHE GESÄSSBZW. HÜFTSCHMERZ IST EINE SCHLEIMBEUTELENTZÜNDUNG.
LÄSIONEN DER ROTATORENMANSCHETTE
DER HÜFTE SIND HÄUFIG UND
VERDIENEN AUS MEINER SICHT VIEL MEHR BEACHTUNG.“
Michael Liebensteiner
Verdickung bis hin zur Ruptur der Sehne reichen können, aber auch indirekte Zeichen wie eine Verfettung der Muskulatur oder Vergrößerungen anderer Hüftmuskeln als Folge einer Kompensation festgestellt werden. Wichtig ist es dabei auch, Differenzialdiagnosen mit ähnlicher Symptomatik wie Hüftgelenkspathologien wie Arthrosen, Pathologien im unteren Lendenwirbelbereich mit Ausstrahlung in die Gesäßgegend, im Kreuz-Dammbein-Bereich sowie die vorhin erwähnte Schleimbeutelentzündung auszuschließen“, sagt Liebensteiner und ergänzt: „Über einen längeren Zeitraum Kortisoninfiltrationen auf die Verdachtsdiagnose ‚Schleimbeutelentzündung‘ hin zu verabreichen, könnte sich im Falle von Läsionen der Glutealsehnen negativ auswirken.“
Erfolgversprechende Therapien
Je nach Ausprägungsgrad kommen unterschiedliche Therapieformen zur Anwendung. „Bei Überlastungen oder chronisch entzündlichen Prozessen können Physiotherapie, Stoßwellentherapie oder Eigenblutplasmainjektionen Linderung verschaffen. Diese nichtoperativen Therapien versprechen meist gute Prognosen. Bei stärkeren Einrissen oder einem Komplettabriss wird jedoch letztlich eine operative Refixation der Sehnen am Trochanter major empfohlen. Diese Operation ist an sich nicht besonders schwierig. Dabei wird mit vier resorbierbaren Fadenankern die ruptierte Sehne wieder mit den Knochen verbunden. Etwas unangenehmer ist dabei die lange Rekonvaleszenz von sechs Wochen, bis die Sehne wieder mit dem Knochen verwachsen ist. Diese lange Nachbehandlungsbzw. Schonzeit ist deshalb so wichtig, da es sonst erneut zu einer Reruptur kommen kann“, betont der erfahrene Orthopäde. Im Anschluss an die sechswöchige Schonzeit erfolgt ein schrittweiser Belastungsaufbau mit Physiotherapie. In seltenen Ausnahmefällen kann es bei schweren Schädigungen auch notwendig sein, synthetisches Gewebe oder Muskelgewebe aus anderen Teilen des Körpers, vorwiegend aus dem Bereich des Musculus gluteus maximus, zu entnehmen und damit das zerstörte Gewebe zu ersetzen.

Zur Person
Priv.-Doz. Dr. Mag. Michael Liebensteiner, PhD, ist Facharzt für Orthopädie, Traumatologie und orthopädische Chirurgie sowie diplomierter Sportwissenschaftler. Nach erfolgreicher Laufbahn an der Innsbrucker Klinik ist er seit 2022 in der Privatpraxis „Orthopädie für Hüfte, Knie & Fuß im Zentrum“ gemeinsam mit Priv.-Doz. Dr. Gerhard Kaufmann und hält stationäre Betten im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck sowie im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams.
Die Erfolgsaussichten sowohl der nichtoperativen Behandlungsmethoden wie auch der operativen Refixation sind jedenfalls je nach Ausprägungsgrad der Läsionen gut, vorausgesetzt, dass nach eingehender Untersuchung auch die richtige Diagnose gestellt wurde. www.ofz-innsbruck.at
Anatomische Übersicht über das rechte Gesäß von hinten. Nach Entfernung der Darstellung des großen Gesäßmuskels sieht man nun den mittleren Gesäßmuskel (Musculus glutaeus medius). Angezeigt ist jene Stelle, an der es typischerweise zum Riss kommt (Rotatorenmanschettenruptur der Hüfte).
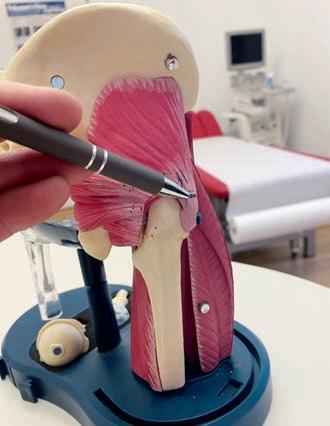
Das weibliche Knie tickt anders als das männliche. Zahlreiche Sportlerinnen können da etwa ein schmerzhaftes Lied über das vordere Kreuzband singen, reißt es bei Frauen doch zwei- bis achtmal häufiger als bei Männern. Ein Riss des vorderen Kreuzbandes bedeutete für Katja Tecklenburg das Ende ihrer Karriere im Skirennsport aber auch den Beginn für ihre Karriere als Unfallchirurgin und Orthopädin. In der medalp Imst operiert sie viele Frauenknie – und sagt: „Ich wünsche mir mehr Studien mit dem Fokus auf weibliche Patientinnen.“
Es ist verflixt. Und wirkt verhext. Im Knie und dort ganz speziell im vorderen Kreuzband steckt für Sportlerinnen oft ein Damoklesschwert. Weil dieses Band, das den Oberschenkelknochen mit dem Schienbein verbindet, bei Frauen auffällig leicht reißt und nicht nur prächtige Ski- oder Wandertage, sondern auch Sportlerinnen-Karrieren jäh unterbrechen, ja beenden kann. Vor der Frauen-Fußball-WM 2023 hatte eine wahre Kreuzbandriss-Flut zahlreiche Spielerinnen auf die Zuschauer:innen-Bänke katapultiert. Und von der Fußball-Europameisterschaft 2025 bleiben die Tränen der deutschen Kapitänin Giula Gwinn in Erinnerung, als sie das Spielfeld humpelnd verlassen musste. In diesem Fall war die Erleichterung groß, weil „nur“ ein Innenband verletzt war. Sowohl das linke als auch das rechte Kreuzband waren Gwinn in ihrer Fußballkarriere schon einmal gerissen und ein weiteres Mal hätte ihre Laufbahn möglicherweise ins Wanken gebracht. „Frauen haben vor allem bei Ballsportarten ein zwei- bis achtfaches Risiko für vordere Kreuzbandrupturen. Manche sprechen von drei- bis sechsfachem Risiko. Das
beobachten wir auch im Skisport. Skisport ist auch in diesem Bereich frauenlastig – im negativen Sinne“, sagt Katja Tecklenburg. Sie weiß genau, wovon sie spricht. Und das aus allen Blickwinkeln. Katja Tecklenburg hat sich als Unfallchirurgin und Orthopädin auf das Knie spezialisiert, das größte Gelenk des menschlichen Körpers also, das so entscheidend ist für den aufrechten Gang und jede dynamische Bewegung, die Zweibeiner:innen von Vierfüßler:innen unterscheidet.
Schmerzhaft war der Trigger, der für die 1978 in München geborene Ärztin das Knie in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit gerückt hatte. Ein vom Vater geprägter starker Tirol-Bezug und eine ausgeprägte Skifahr- beziehungsweise vielversprechende Skirenn-Leidenschaft hatten sie im Alter von 14 Jahren an das Skigymnasium Stams geführt, doch schon im ersten Jahr beendete der Riss eines vorderen Kreuzbandes alle
Katja Tecklenburg ist Unfallchirurgin und Orthopädin und hat sich auf das Knie spezialisiert. Sie praktiziert in der medalp Imst.


VONEINANDER
Hoffnungen auf eine Rennkarriere. „Das hat sehr viel durcheinandergebracht“, erinnert sie sich. Innerhalb von zweieinhalb Jahren wurde sie dreimal am gleichen Kniegelenk operiert – vom Tiroler Unfallchirurgen Karl Benedetto. „Ich fand es einfach toll, was er macht. Immer, wenn ich wieder dort war, habe ich mir gedacht – wow, das will ich auch machen“, beschreibt Katja Tecklenburg die an sich ziemlich negativen Momente, die ihr Leben ziemlich positiv prägen sollten.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie direkt am Gespräch teilnehmen – erzählt Katja Tecklenburg von ihrem sportlichen und medizinischen Lebensslalom, der sie von München über Westendorf und Stams nach Colorado und wieder zurück nach Österreich führte, wo sie dem Skirennlauf in zahlreichen Funktionen, wie etwa als Vizepräsidentin des Tiroler Skiverbandes, treu geblieben ist.
SONDERN SIE SICH FÜR DIE CHIRURGIN AUCH WÄHREND DER OP ANDERS ANFÜHLEN.
„Ich wollte gar nicht Medizin studieren, sondern Kniespezialistin werden. Ich habe den einen Teil eigentlich überspringen wollen“, bringt Katja Tecklenburg ihre vom damaligen Großmeister geweckte Leidenschaft für das Knie recht anschaulich auf den Punkt. Weil sie selbst eine so genannte Coperin ist, die im Gegensatz zu Non-Coper:innen unter keinen Folgebeschwerden leidet und somit trotz ihrer damals schicksalhaften Probleme mit dem vorderen Kreuzband heute keinerlei Einschränkungen verspürt beziehungsweise „alles machen kann“, genießt sie das Skifahren weiterhin in vollen Zügen. Skifahren ist ja auch eine großartige Sportart, wenngleich sie die menschliche Anatomie ziemlich herausfordert. „Ich weiß nicht, ob
die Evolution darauf ausgelegt war, solche Sportarten zu machen. Vielleicht sind wir ja noch in der Evolution, vielleicht wird’s noch besser“, sagt Katja Tecklenburg mit hoffnungsvollem Augenzwinkern auf die Frage, ob das Knie mit all seinen Verletzungs- und Verschleißmöglichkeiten vielleicht so etwas ist wie eine Fehlkonstruktion der Evolution.
Doch so erfindungsreich und verspielt die Evolution auf dem Entwicklungsweg vom Vier- zum aufrecht stehenden, gehenden und laufenden Zweibeiner auch war, auf
„Frauen haben vor allem bei Ballsportarten ein zwei- bis achtfaches Risiko für vordere Kreuzbandrupturen.“
Katja Tecklenburg
Carvingski festgeschnallte Menschen, die mit 60 oder noch viel mehr Kilometern pro Stunde einen steilen Schneehang hinunterrasen, hatte sie wohl nicht auf dem Schirm. Genauso wenig wie solche, die auf akrobatisch anmutende Weise mit einem Ball spielen und dabei Kräfte auf ihre Kniegelenke wirken lassen, die selbige durchaus an die Grenzen der Belastbarkeit bringen können. Tun sie das zur Winterszeit auf Pisten im Tiroler Oberland, dann stehen die Chancen nicht allzu schlecht, dass Katja Tecklenburg das Knie in der medalp Sportclinic Imst zu sehen bekommt. „Ich würde sagen, dass fast zwei Drittel der Kreuzbandverletzungen, die wir behandeln, Frauen betreffen. Interessanterweise sind es oft Verletzungen, die bei niedrigeren Geschwindigkeiten passiert sind. Ein Kreuzbandriss geschieht ganz oft fast in Zeitlupe oder beim Aussteigen vom Lift – ohne große Stürze“, erzählt sie. Männer ziehen sich mit ihrer stärker ausgeprägten Risikofreude und Geschwindigkeitslust hingegen gerne komplexere Verletzungen zu. Rund ein Drittel aller skilaufbedingten Verletzungen betreffen das Kniegelenk und eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes ist die häufigste Diagnose. Vor allem bei Frauen.
Spannend ist, dass sich weibliche und männliche Knie nicht nur äußerlich voneinander unterscheiden, sondern sie sich für die Chirurgin auch während der OP anders anfühlen. Das Bindegewebe rund um das Knie sei bei Frauen meistens „etwas weicher“. Und schließlich gibt es auch auffallende anatomische Faktoren, die bei Frauen anders sind, als bei Männern. „Zum Beispiel weiß man, dass der so genannte Interkondylärraum – der Torbogen tief im Knie, in dem
das Kreuzband liegt – bei Frauen anlagebedingt im Schnitt enger und schmäler ist. Damit ist das Kreuzband, das da drinnen liegt, gefährdeter“, nennt die Ärztin einen anlagebedingten Risikofaktor, der durch die weibliche Neigung zur X-Bein-Stellung regelrecht verschärft wird.
Die für Fußballer so typischen O-Beine sind zwar ganz und gar kein Garant für knietechnische Glückseligkeit, doch kann die weibliche Tendenz zum X vor allem dann in einem schmerzhaften Riss münden, wenn die Sportlerin aus einem Sprung landet. Knickt sie mit größerer Geschwindigkeit in dieses X, kann das der Grund für eine Kreuzbandruptur sein. „Frauen haben tendenziell auch eine eher schwächere Beugemuskulatur. Ein gut angespannter Beugemuskel schützt davor, dass diese Knieschublade nach vorne geht“, zeichnet Katja Tecklenburg das wenig standhaft anmutende Bild des weiblichen Kniegelenkes weiter.
Im medica-Podcast berichtet die Unfallchirurgin und Orthopädin auch von den Forschungsansätzen, welche die Reißanfälligkeit des weiblichen Kreuzbandes mit den Hormonen beziehungsweise den Zyklusphasen der Frauen in Verbindung bringen. „Der Zyklus ist ein extrem spannendes Gebiet, auf dem geforscht wird. Doch da gibt es sicher noch viel Arbeit“, weiß Katja Tecklenburg.
Mehr als über den potenziellen Einfluss von Hormonen oder auch psychologischen Faktoren auf die frauenspezifische Rissfreudigkeit des Kreuzbands ist jedenfalls über die Knieanatomie bekannt. Die von Katja Tecklenburg bereits beschriebenen Schwä-

Dreh- und Angelpunkt. Im medica-Podcast seziert Katja Tecklenburg das weibliche Knie und deckt dabei durchaus unangenehme Wahrheiten über das so rissfreudige vordere Kreuzband auf. Verbesserungspotenzial ortet die Unfallchirurgin und Orthopädin, die in der medalp Imst praktiziert und operiert, bei den wissenschaftlichen Datenlagen zum Frauenknie. Sie erklärt auch die unterschiedlichen OP-Techniken, die aktuellen Trends oder warum die Physiotherapie nach einer Operation so entscheidend ist –und sagt: „Ein guter Chirurg kann alle Implantate.“
„Ein Kreuzbandriss geschieht beim Skifahren ganz oft fast in Zeitlupe oder beim Aussteigen vom Lift – ohne große Stürze.“
Katja Tecklenburg
chen könnten zu einer gewissen Ernüchterung führen, würden sie nicht auch Türen hin zu Präventionsmaßnahmen öffnen. Vor allem für fuß- oder handballende Sportlerinnen, deren äußere Spielbedingungen stets ähnlich sind. „Sie spielen immer auf dem gleichen Untergrund – Rasen- oder Hallenboden – und die Ursachen für den Riss sind fast immer die gleichen Bewegungen, nämlich die Landung aus einem Sprung, relativ streckungsnahe mit etwas X-Bein-Stellung und wenig Beugung. Das ist immer der gleiche Mechanismus“, erklärt die Ärztin. Koordinative Fähigkeiten zu schulen, die Beugemuskulatur zu stärken und an der Technik der Landung zu feilen, indem die Sportlerin lernt, tiefer in die Beugung zu gehen, kann die Riss-Risikofaktoren positiv beeinflussen. Katja Tecklenburg: „Im Skisport ist die Sache leider komplexer.“
Ja, leider. 2004 schon hatte die Unfallchirurgin zusammen mit Kolleg:innen die damalige Nachwuchsmannschaft der ÖSV-Frauen mit dem Fokus auf das vordere Kreuzband untersucht. Dabei war die Zahl der Kreuzbandrisse höher als die Anzahl der 15- bis 17-jährigen jungen Skirennfahrerinnen. „Es gab schon einzelne, die noch nichts hatten, aber auch solche, die schon zwei oder drei Kreuzbandrisse hatten. Die Problematik ist keine neue, wir kennen sie schon relativ lang“, lenkt Katja Tecklenburg den Blick auf die stets unterschiedlichen Skirennpistenverhältnisse, die den Kniegelenken und Unterschenkeln der Athletinnen im Zusammenspiel mit den Winkeln und Geschwindigkeiten ein hochkomplexes Gemisch an Kräften bescheren. Torsionskräfte, Scherkräfte, Kurvenfliehkräfte und Stauchungskräfte gilt es da in flotter und gekonnter Harmonie auszugleichen, wobei Präventiv-
maßnahmen, wie extrem gute Muskelkraft, bei den Athletinnen teilweise auch dazu führen, noch extremere Linien zu fahren und damit wieder höhere Kräfte wirken zu lassen. Da beißt sich die Prävention dann regelrecht in den Hintern.
Mit den Freuden der Freizeitsportlerinnen sind die Herausforderungen dieser Hochleistungswelten nicht zu vergleichen. Genusswedlerinnen können den Risiken leichter entgegentrainieren als Spitzensportler:innen. Functional Training – also die Kombination aus Krafttraining und koordinativen Fähigkeiten – ist die beste Vorbereitung auf die Piste. Nicht weniger wichtig ist diese motivierte Selbstdisziplin auch nach einer Operation am Knie. „Die gute OP ist die halbe Miete. Die anderen 50 Prozent müssen sie selber erarbeiten. Mit Therapie und Reha“, stellt Katja Tecklenburg klar.
Im medica-Podcast streift die Kniespezialistin auch durch die Operationssäle, in denen Risse des vorderen Kreuzbandes „repariert“ werden. Sie erklärt das Menü à la carte, für das die Bedürfnisse der Patient:innen entscheidend sind, spricht über die OP-Techniken, die unterschiedlichen Transplantate und die quirlige Forschungslandschaft rund um das Knie und das Kreuzband.
„Es gibt tausende veröffentlichte Studien zum Kreuzband. Ich wünsche mir mehr Studien mit Fokus auf weibliche Patientinnen“, sagt sie. Daran, dass diese Forschungsrichtung im Sinne der Frauen beziehungsweise der weiblichen Kniegelenke befeuert wird, ist Katja Tecklenburg nicht unbeteiligt. Als Mitglied großer Fachgesellschaften, wie der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGS) etwa oder
der AGA (Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie), vor allem aber als Vorsitzende von Women in ESSKA. ESSKA steht für European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (Europäische Gesellschaft für Sporttraumatologie, Kniechirurgie und Arthroskopie). Katja Tecklenburg ist schon zu Beginn ihrer Facharztausbildung zu diesem großen wissenschaftlichen und beruflichen Netzwerk gestoßen, in dem Frauen fast schon traditionell unterrepräsentiert waren. Unfallchirurgie ist extrem männlich besetzt. Zu Beginn der 2020er-Jahre zählte die ESSKA weniger als sechs Prozent weibliche Fachmitglieder, was dem damaligen Präsidenten dieser Fachgesellschaft skandalös vorkam. „Es gab da eine legendäre Party und um zwei in der Früh hatte er mit mehreren Frauen geredet und gesagt, wir müssen da was machen“, erinnert sich die Unfallchirurgin gerne an diese entscheidenden Morgenstunden, die schließlich darin mündeten, dass mit Women in ESSKA eine Fraueninitiative ins Leben gerufen wurde, die sich sehr dynamisch nicht nur darum kümmert, dass der Frauenanteil steigt – zwischenzeitlich auf elf Prozent –, die Karrieren der Sporttraumatologinnen unterstützt und berufliches Networking betrieben wird. Auf die Frage, ob dadurch, dass sich Sporttraumatologinnen vernetzen, auch der männlich dominierte Forschungsblick geändert und verstärkt in Richtung Versorgung und Behandlung weiblicher Patientinnen gerichtet wird, sagt Katja Tecklenburg: „Das will ich hoffen, das will ich schwer hoffen. Wir müssen schon auf unsere Anliegen schauen. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen und da setzen wir auch an.“
Alexandra Keller

AbimDezember Handel oder 2 x jährlich als Abo!

Im Blutplasma jedes Menschen stecken körpereigene „Zauberstoffe“, die bei Schmerzen, Verletzungen oder Verschleißerscheinungen unterschiedlichster Arten die Selbstheilungskräfte befeuern können. Seit vielen Jahren setzt der Tiroler Unfallchirurg Jürgen Oberladstätter bei der Behandlung seiner Patient:innen auch auf Eigenbluttherapie in Form der ACP-Therapie der Firma Arthrex und sagt: „Bei zahlreichen Pathologien ist die ACP-Therapie mittlerweile in den Behandlungsalgorithmus eingeflossen.“ Weil’s hilft. Und heilen kann.
Blut ist ein ganz besonderer Saft, lässt Johann Wolfgang von Goethe seinen Mephisto in der Tragödie erster Teil sagen. Und recht hat er. Dass Blut für den Pakt des Tragödienhelden Faust mit dem Teufel eine so große Rolle spielt, liegt schlicht daran, dass Blut für die Menschheit im Allgemeinen und die einzelnen Menschen im Speziellen überaus besonders ist. Blut wird auch als flüssiges Organ bezeichnet und es ist – tatkräftig unterstützt vom Herz-Kreislauf-System – ein wunderbares und lebenswichtiges Transportmittel für Sauerstoff, Nährstoffe und Hormone. Der besondere Saft ist außerdem für den Abtransport von Kohlendioxid und Stoffwechselprodukten zuständig, aber auch für die Wärmeregulation des Körpers oder die Immunabwehr. Zwischen sechs und acht Prozent des Körpergewichtes fließen derart geschäftig durch Arterien und Venen. Dieser Kreislauf war zu Lebzeiten Goethes schon bekannt, während es bis zur Entdeckung der Blutgruppen und all der anderen blutigen Geheimnisse noch ein paar Forschungsjahrzehnte dauern sollte.

Ein Highlight in der teils so verrückt erscheinenden wie spannenden wissenschaftlichen Geschichte des Blutes war, als es mit Hilfe einer Zentrifuge geschleudert und dabei unter anderem festgestellt wurde, dass Blut aus festen und flüssigen Anteilen besteht. Circa 45 Prozent des Blutes besteht aus Blutzellen – also den roten und weißen Blutkörperchen sowie den Blutplättchen –und rund 55 Prozent aus Blutplasma, in dem jene Kräfte stecken, die in einer besonderen Form der Eigenbluttherapie, der so genannten ACP-Therapie, angewendet werden, um bei Patient:innen mit Hilfe ihres eigenen „Saftes“ die Selbstheilungskräfte zu boostern. Seit über zehn Jahren zählt diese Form der Therapie beispielsweise zum Behandlungsportfolio der Praxisgemeinschaft Unfallchirurgie in Innsbruck. Im Interview erklärt Unfallchirurg Jürgen Oberladstätter, wie die Therapie funktioniert und was dabei passiert.
Jürgen Oberladstätter ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie.

„Wir wollen für unsere Patient:innen erreichen, dass sie so schnell wie möglich und so wenig invasiv wie möglich retour in ihr Leben kommen. Hier ist die ACP-Therapie ein Tool, das sich etabliert hat.“
Für die Eigenbluttherapie wird den Patientinnen und Patienten erst einmal venöses Blut –also sauerstoffarmes Blut auf dem Weg zurück zum Herzen – abgenommen, um dann die festen von den flüssigen Bestandteilen zu trennen. Seit Blutzellen getrennt werden, werden dafür Zentrifugen genutzt. Ist das Prinzip das gleiche geblieben? JÜRGEN OBERLADSTÄTTER :
Ja, das Prinzip ist das gleiche geblieben, doch die Technik wurde verbessert und die Zeit wurde verkürzt. Wir haben eine Fünf-Minuten-Zentrifuge, die genau eingestellt ist auf das, was wir brauchen. Es ist ein standardisiertes Gerät mit einem ausgeklügelten Spritze-in-Spritze-System.
Was ist das Besondere an dem Spritz- in-Spritze-System? Die Sterilität ist in der Unfallchirurgie und Orthopädie ein Riesenthema, um die Sicherheit der Patient:innen und der Behandelnden garantieren zu können. Beim Spritze-in-Spritze-System der Firma Arthrex werden 15 Milliliter Blut abgenommen und zentrifugiert. Durch das Spritze-in-Spritze-System kann man die Spritze mit dem Plasma einfach herausziehen. Es muss nicht pipettiert werden, was höchste Patientensicherheit und höchste Behandlersicherheit garantiert. Steriler geht’s nicht. Das ist eine wunderbare Geschichte für alle Beteiligten.
Das Grundprinzip der ACP ist die Selbstheilung … ja, du boostest die Selbstheilung durch das Potenzial, das im eigenen Blut vorhanden ist, das man aber herausfiltern muss.
Das Plasma ist der Stoff, der bei der ACP-Therapie verwendet wird, wobei ACP für Autologes Conditioniertes Plasma steht. Autolog bedeutet körpereigen und biologisch. Conditioniert bedeutet aufbereitet. Was heißt das genau? Aufbereitet heißt in dem Fall, dass die Thrombozyten zerschleudert und die Wachstumsfaktoren freigesetzt werden. Man macht
nichts anderes, als die Wachstumsfaktoren an die Front zu setzen.
Man pickt sich die Rosinen raus? Genau, aber es kommt nichts dazu. Das ist ganz wichtig. Rosinen ohne Zucker sozusagen.
Wie lange dauert es, das Blut derart aufzubereiten? Im Prinzip läuft es so: Der Patient oder die Patientin legt sich auf die Liege, man macht eine Blutabnahme und gibt die Spritze in die Zentrifuge. Das Zentrifugieren für das normale beziehungsweise die Standard-ACP dauert fünf Minuten. Zwischenzeitlich wird der Patient desinfiziert, dann kann man das
ACP direkt am Patienten applizieren. Man muss es nicht zwischenlagern. Es geht alles in einem durch. In 20 Minuten ist alles erledigt.
Wo wird das ACP appliziert? Je nach Pathologie natürlich. Ein Patient mit Kniearthrose bekommt die Infiltration ins Knie, eine Patientin mit Sehnenproblemen bekommt die Infiltration – manchmal auch ultraschallgesteuert – an die Stelle appliziert, wo die Sehne eingerissen ist. Ich vergleiche das Blutplasma gerne mit einem Kleber. Wer sich in die Haut schneidet, kennt diese weiße Flüssigkeit, die das zusammenhält. Dieser Kleber kommt dann genau dorthin, wo er hinsoll.
ACP-Therapie.
Seit etwa 20 Jahren wird autonomes konditioniertes Blutplasma zur Therapie verschiedenster Pathologien auch in der Sporttraumatologie eingesetzt. ACP ist die Abkürzung für „Autologes Conditioniertes Plasma“. Autolog bedeutet im medizinischen Sprachgebrauch „körpereigen und biologisch“. Conditioniert bedeutet in diesem Zusammenhang aufbereitet. Und das P steht für Plasma, ein Bestandteil des Blutes.
Peripher venös gewonnenes Vollblut wird zu Beginn der Behandlung zentrifugiert. Unterschiedliche Zellgewichte führen dabei dazu, dass ein Überstand von Blutplasma mit einer zwei- bis dreifach konzentrierten Anzahl an Wachtumsfaktoren tragenden Thrombozyten entsteht. Neben den Erythrozyten wird außerdem der Großteil einiger weißer Blutkörperchen, wie neutrophile Granulozyten, die in hoher Konzentration Heilungsvorgänge behindern können, abzentrifugiert. Das mit Wirkstoffen angereicherte Plasma wird direkt im Anschluss in die betroffene Region injiziert.
Die ACP-Therapie ist eine Form der Eigenbluttherapie. Diese speziell aufbereitete Form des Eigenblutes wird in der Schmerztherapie vor allem zur Behandlung von Beschwerden durch Gelenkverschleiß (Arthrose), Knorpelschäden, degenerative Sehnenverletzungen (z. B. Tennisellenbogen, Achillessehnenreizung), akuten Sportverletzungen und Rückenbeschwerden (Bandscheibenvorfall) verwendet.
Weitere Infos unter acp-therapie.at
Tut das weh? Im Gelenk ist es überschaubar. Aber bei Sehnen- oder Sehnenansatzproblematiken tut’s schon ein bissl weh. Etwa einen Tag lang. Es ist auszuhalten. Wenn’s funktioniert hat, sind die Schmerzen auch rasch vergessen.
Denken Sie an die ACP-Therapie erst, wenn andere Behandlungsmethoden keine Besserung gebracht haben – oder bei bestimmten Diagnosen oder Verletzungen auch sofort? In den Anfängen war es so, dass man erst alle Karten gespielt und dann die ACP angewendet hat. Mittlerweile ist es so, dass man versucht, eine individuelle Lösung für den Patienten zu finden. Bei Teilverletzungen von Achillessehnen, Tennisellbogen, Gonarthrosen, die nicht reif für eine Prothese sind, oder bei Sprunggelenkpathologien ist das ACP mittlerweile im Behandlungsalgorithmus eingefasst. Auch bei konservativen Behandlungen von Kreuzbandverletzungen – vorne sowie hinten – ist es so, dass man den Patient:innen empfiehlt, das zusätzlich zu machen. Aus medizinischer Sicht macht es auf jeden Fall Sinn.
Sie sprechen Kreuzbandverletzungen an … Ja, wir haben über Jahre die Erfahrung gemacht, dass bei allen Sachen, die verheilen sollen –ligamentär, also Bandverletzungen, oder auch Überlastungsgeschichten – eine ACP-Therapie auf jeden Fall einen Benefit in der Behandlung bringt, bevor man an eine Operation denkt. Bei Sehnenpathologien, die man konservativ behandelt, ist die ACP-Therapie mittlerweile in unseren Behandlungsalgorithums eingeflossen. Bei uns ist das ganz einfach. Wenn etwas funktioniert, machen wir es weiter. Wir wollen für unsere Patient:innen erreichen, dass sie so schnell wie möglich und so wenig invasiv wie möglich retour in ihr Leben kommen. Hier ist die ACP-Therapie ein Tool, das sich etabliert hat.
Wie lange dauert die Behandlung? Die Standardbehandlung von ACP ist fünfmal im wöchentlichen Abstand. Viermal ist signifikant schlechter, sechsmal ist meiner Erfahrung nach signifikant um nichts besser. Ich wende das wirklich schon lange an und die fünfmal haben sich als passend herauskristallisiert.

Profession meets passion. Seit über zwei Jahrzehnten beschäftigen sich die Ärzte der Praxisgemeinschaft Unfallchirurgie in Innsbruck mit der konservativen und operativen Therapie von Sportund Gelenksverletzungen. Die auch wissenschaftlich hohe Expertise und Spezialisierung ist nicht nur auf die enorme Erfahrung, sondern auch auf die langjährige Ausbildung des Teams an renommierten Fachzentren im In- und Ausland zurückzuführen. Der Vorteil für die Patient:innen, zu denen schon traditionell Spitzensportler:innen zählen: Einerseits deckt jeder Arzt sein Fachgebiet ab, andererseits stehen die Ärzte aber auch im engen Austausch untereinander. Probleme werden interdisziplinär diskutiert, Fachwissen unter den Kollegen auf dem neuesten Stand gehalten. Alle stationären und ambulanten operativen Eingriffe werden in der Privatklinik Kettenbrücke durchgeführt.
Tel.: 0512/20 10 01 praxis@unfall.cc www.unfall.cc
Ist die Behandlung teuer? Das Kit kostet für uns 90 Euro - mit Spritze-in-Spritze und allem Drum und Dran. Wir versuchen, das halbwegs normal an die Patient:innen weiterzugeben. Eine ACP-Serie kostet rund 750 Euro. Wir begleiten die Patient:innen auf dem ganzen Weg und versuchen, sie so schnell und sicher wie möglich zurückzubringen zu dem, was sie wollen. Mit welchen Mitteln auch immer. Da ist ACP ein Teil unseres Gesamtpakets.
Wird es auch bei Spitzensportler:innen angewendet? Ja. Es ist auch Thema bei Muskelfaserverletzungen. Wenn man sich im sportlichen High-End-Bereich bewegt – so schnell und gut wie möglich –, muss man das als ernstzunehmende Behandlungsoption mit anbieten.
Werden Eigenblut und Sport zusammen gedacht, landet der Geist rasch bei entsprechend Aufsehen erregenden Dopingfällen, bei denen das Blut manipuliert wurde, um die Sauerstoffversorgung des Körpers zu verbessern. Die ACP-Therapie ist kein Doping? Nein, die ACP ist kein Doping. Ganz klar. Es ist bei der Weltdopingorganisation nicht gelistet.
Ist es möglich, durch die ACP-Therapie Operationen zu verhindern? Absolut. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Achillessehne war eingerissen und wir haben schon überlegt, zu operieren, haben es aber mit ACP versucht. In drei Monaten war ich völlig beschwerdefrei, die Sehne voll belastbar. Auf den MRT-Bildern, die wir zur Kontrolle der Fortschritte bei den Patient:innen machen, kann man die Verbesserungen deutlich sehen, das ist schon beeindruckend. Oft können große Operationen – wie ein prothetischer Gelenksersatz – mit der Therapie auch hinausgezögert werden.
Können Sie ein Beispiel nennen? Das klassische Beispiel ist die Kniearthrose, wo wir die ACP-Therapie relativ oft anwenden. Ich habe viele Patient:innen die ganz schlimme Röntgenaufnahmen haben und alle zwei Jahre zu einer ACP-Serie kommen. Es ist natürlich ein Unterschied für die Patient:innen, ob sie alle zwei Jahre fünf Spritzen ins Knie bekommen oder eine Knieprothese. Heute ist es ja so, dass die Abnützungen im Knie nicht mit 90 anfangen, sondern mit 40, und wenn man da eine Operation rauszögern kann, ist das natürlich super. Es hängt immer vom Leidensdruck der Patient:innen ab. Vorauszusehen ist da leider nichts, man weiß erst nach der Behandlung, ob es funktioniert, das muss man auch ganz klar sagen. Aber, einen Versuch ist es wert. Und der Output ist einfach gut.


Sie war, ist und bleibt eine der erfolgreichsten Rennläuferinnen der Ski-Weltcupgeschichte. Wenn Marlies Raich (ehemals Schild) über ihr Leben als Spitzensportlerin spricht – den großen Spaß, schmerzhafte Verletzungen, die unbändige Leidenschaft für den Flow zwischen den Slalomstangen oder auch darüber, wie intensiv sie an ihrem Körpergefühl gearbeitet hat – wird die Urkraft der Ausnahmesportlerin noch einmal so richtig deutlich.
„Ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich erleben durfte, dass ich bei etwas Weltklasse bin.“
Marlies Raich
Das Bild ist ganz wunderbar und irgendwie verrät es recht viel über ein Gefühl, das sie sich über all die Pistenjahre hinweg bewahren konnte. „Als Kind habe ich gesungen beim Skifahren und habe alles gesehen, was neben dem Pistenrand war“, sagt Marlies Raich. Mit dieser Leichtigkeit hat Mitte der 1980er-Jahre eine außergewöhnliche Rennkarriere begonnen und diese Leichtigkeit bestimmt den Bewegungsdrang der Sportlerin auch heute. „Ich mache nur, was Spaß und Lust macht – und das brauche ich auch“, sagt sie.
Unter ihrem Mädchennamen Marlies Schild wurde die gebürtige Saalfeldenerin berühmt. Als sie sich am 2. September 2014 mit den Worten „Ich sag’s jetzt einfach grad heraus. Ich werde mit dem heutigen Tag meine Karriere beenden“, vom internationalen Skizirkus verabschiedete, hatte sie mit 35 Slalomsiegen im Weltcup neue Maßstäbe gesetzt. Zu der Zeit war dieser Rekord nur vom Schweden Ingmar Stenmark übertroffen worden und zu der Zeit war Mikaela Shiffrin gerade auf dem Weg, sie alle zu übertreffen und auch geschlechterübergreifend die erfolgreichste Skifahrerin der Weltcupgeschichte zu werden. „Es hat mich irrsinnig irritiert, wenn sie nach mir gefahren ist, das muss ich echt gestehen“, erzählt Marlies Raich beim Gedanken an ihre letzten Rennjahre – es waren gleichzeitig die ersten der US-amerikanischen Gigantin –, als auf der Rennpiste ihr Rücken schmerzte und sie bemerkte, dass sie nicht mehr so fahren konnte, wie sie es sich vorstellte. Und zum perfekten Zeitpunkt Abschied nahm. Marlies Raich: „Ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich erleben durfte, dass ich bei etwas Weltklasse bin.“
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie zuhören – erzählt Marlies Raich von ihrer Kindheit, die im Kreis der Großfamilie erst geprägt war von vielen Aktivitäten und Sport auch ohne Schnee, bis ihre Eltern das Skiklubtraining übernommen hatten und sie ihre ersten Skirennen fuhr. „Es hat immer Spaß gemacht, zum Training zu gehen, aber ich war kein Supertalent“, sagt sie.
Das Supertalent schlummerte auch noch eine Zeit lang unentdeckt in ihr, nachdem sie sich dazu entschlossen hatte, das Skigymnasium Stams zu besuchen. Dass dort aus dem Spaß Ernst wurde, mag sie so nicht sagen: „Dort wurde es dann professioneller – ernst klingt so streng.“ Jedenfalls war die junge Salzburgerin als Teenie viel mit dem Zug unterwegs, oft über Wochen nicht zu Hause und neben dem Plan A – der
Weltspitze im Skirennsport – gab es auch einen Plan B. Sich mit der Matura alle Türen offen zu halten und auch nach dem Skirennsport die Basis für weitere berufliche Herausforderungen zu legen. Vorerst konnte sie jedoch ihr Hobby – ihr größtes Hobby, wie sie betont – zum Beruf machen. Das klingt nun zwar wirklich ernst, doch scheinen sich Ernst und Spaß recht harmonisch die Waage gehalten zu haben, als sie sich zwar sukzessive, aber nicht ohne Zwischenfälle in Richtung Weltspitze entwickelte. „Ich habe früh schon Verletzungen gehabt, war vielleicht körperlich den anderen ein bissl unterlegen“, sagt sie, „ich habe ein wenig länger gebraucht, aber ich habe einen Riesenspaß gehabt. Für mich hat es nie Zweifel gegeben und das war das Wichtigste.“
Für angehende Leistungssportlerinnen mit derart zweifelsfreiem und konzentriertem Blick auf die Weltklasse fühlt sich die Jugend anders an. Relativ früh trennt sich da die Spreu vom Weizen, was in einer Sportart, die derart prominent und satt mit Nachwuchstalenten ist, vom Start weg ein kompetitives Umfeld bedeutet. Gleichaltrige und Gleichgesinnte sind fast per se Konkurrentinnen. Das werde immer extremer, je älter man werde, und dann kristallisiere sich heraus, wer wirklich die Freunde sind. „Aber man sucht ja auch den Wettkampf“, stellt Marlies Raich klar. Mit wissendem Auge beobachtet sie da gerade gerne ihre eigenen Kinder. Zusammen mit ihrem Mann Benjamin Raich, der ein echt guter Grund für sie war, Tirolerin zu werden, hat Marlies Raich zwei Söhne und eine Tochter. Bei ihnen dürfte Spaß am Wettkampf auf Ski möglicherweise bereits in der DNA nachzuweisen sein, und „die Mama“ sagt: „Sie fahren irrsinnig gerne Ski und sie lieben es auch, Rennen zu fahren – mit einem Lachen im Gesicht. Was kann besser sein für die Entwicklung, als so ein Umfeld mit vielen Gleichgesinnten zu haben.“ Das hatte sie ja auch.
Mentale und körperliche Stärke
Wird der Spaß dann professioneller betrieben, werden die Trainingspläne knackiger und die Pisten mit den Aufgaben härter, stellt sich für junge Leistungssportlerinnen früher als für andere die Herausforderung, mit Konkurrenzsituationen umzugehen und zur richtigen Zeit das Sportliche vom Privaten zu trennen. Und nur nicht neidisch zu werden. „Ich habe das oft erlebt, den Neid. Immer das zu sehen, was der andere hat und erreicht, kann dich auch fertig machen“, weiß Marlies Raich.

Marlies Raich, ehemals Schild, hat mit 35 Slalomsiegen im Weltcup neue Maßstäbe gesetzt. 2014 beendete sie ihre Karriere. Seither widmet sie ihre Energie der Familie, ist Unternehmerin, Moderatorin bei Skiübertragungen oder Dokumentationsreihen und sie macht sich für junge Athletinnen stark.
MARLIES RAICH ANIMIERT ATHLETINNEN DAZU, „ALLES ANZUSPRECHEN, ALLES ZU SAGEN –AUCH WIE MAN SICH FÜHLT UND WAS MAN DENKT“. UND SIE BRICHT MIT EINEM TABU, WENN SIE VOM STRESS MIT IHREN ERSTEN MONATSBLUTUNGEN ERZÄHLT, UND SAGT: „DA IST ES WICHTIG, DASS JUNGE MÄDELS ANLAUFSTELLEN BEKOMMEN.“
INITIATIVEN WIE DAS PROJEKT FEMALE ATHLETE
SETZEN SICH MIT FRAUENSPEZIFISCHEN THEMEN IM SPITZENSPORT AUSEINANDER UND GEBEN IHNEN
Im medica-Podcast erzählt Marlies Raich nicht nur davon, wie „beinhart“ sie gelernt hat, mit Grenzen umzugehen, die Signale ihres Körpers kennenzulernen und ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Sie erzählt auch vom fürsorgenden Weitblick ihres Vaters, der ihr schon früh einen Mentaltrainer an die Seite stellte, der ihr dabei half, sich besser kennen zu lernen und mit Stress umzugehen. „Das war ganz wesentlich dafür, dass ich am Ende so erfolgreich war“, sagt sie.
Das frühe Mentaltraining stärkte ihr Selbstvertrauen und ermöglichte ihr, aus Fehlern zu lernen, sie zu analysieren und kein zweites Mal zu machen – oder auch mal die Bremse zu ziehen und die Richtung zu wechseln. „Mein Mann, der Benni, hat das nie gebraucht. Für ihn war das alles ganz logisch. Aber wir Frauen sind halt doch noch kopflastiger. Ich habe es gebraucht“, stellt sie klar, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen oder Buben und Mädchen eine große Rolle im Leistungssport spielen kann – auch jenseits der körperlichen Voraussetzungen und auch, wenn die Rahmenbedingungen die gleichen sind.
Die Zeit am Skigymnasium in Stams, der ältesten Skisportschule und einer der erfolgreichsten Sportschulen der Welt – Marlies Raich ist heute Mitglied des Vorstands dieser Schule – startet für Buben wie Mädchen üblicherweise im Alter von 14 oder 15 Jahren. Es ist das Alter, in dem die Pubertät Vollgas gibt und die Körper sich – dirigiert von den Hormonen – wandeln. „Sportlich gesehen war es ein positiver Wandel für mich. Ich war als junge Erwachsene körperlich eher ein bissl eine Spätentwicklerin“, erzählt Marlies Raich. Die Pubertät hat ihrem Körper einen Kraftschub verpasst und das bislang schlummernde Supertalent endgültig geweckt. Ihre bald unschlagbare Kombination aus körperlicher und mentaler Fitness, Kondition und einer guten Veranlagung zum Aufbau von Muskelmasse begann mehr und mehr, sich durch richtig schnelles und immer schnelleres Skifahren zu zeigen. „Aber – ich erzähle das jetzt einfach so – am Anfang mit der Monatsblutung war das schon schwierig. Ich war nicht zu Hause, hatte nicht wirklich Ansprechpartner“, sagt Marlies Raich, „und dann bist du da im Winter, mit Rennanzug, weißt nicht, ist es jetzt so weit oder nicht. Es waren schon irre Stresssituationen, bis man das Ganze in den Griff und auch ein Gefühl für seinen Körper bekommt, in welchen Phasen man sich gerade befindet.“
Dass in diesen Sätzen der 44-Jährigen nach wie vor so etwas wie ein Tabubruch steckt, scheint erstaunlich. Doch es ist so. Der Zyklus, die Monatsblutung, die teils stark verunsichernden Herausforderungen der Pubertät waren bis weit hinein in die 2020er-Jahre kein Thema im Skirennsport. Die jungen Frauen waren dabei schlicht auf sich allein gestellt. „Das habe ich mich gar nicht getraut, irgendwo anzusprechen. Das war schon schwierig und es hat Zeit gebraucht, bis ich wirklich damit umgehen konnte“, erzählt Marlies Raich.
Als Mikaela Shiffrin Anfang 2023 im Rahmen eines ORF-Interviews erklärte, dass sie ziemlich müde sei, weil sie gerade nicht den besten Moment in ihrem monatlichen Zyklus habe, führte das nicht nur wegen des Reporterlapsus zu einer bizarren Aufmerksamkeitswelle. Zur Erinnerung: Im journalistischen Rennfieber hatte der Reporter „Cycle“ nicht mit „Monatszyklus“, sondern mit „Rad fahren“ übersetzt und dafür recht viel heitere Häme geerntet. Doch ist ihm das wirklich nicht zu verdenken, war es doch das allererste Mal, dass eine Skirennsportlerin vor laufender Kamera über ihren Zyklus gesprochen hat. „Ich hätte mich nie getraut, das in einem Interview zu sagen“, sagt Marlies Raich.
Damals vielleicht nicht. Heute jedoch sehr wohl, ist es ihr doch ein Anliegen, dass es Nachwuchssportlerinnen leichter haben. „Da ist es wichtig, dass junge Mädels Anlaufstellen bekommen und man ganz individuell schaut, wie kann das jede für sich am besten lösen, um ein gutes Gefühl zu haben und die Sicherheit“, regt Marlies Raich einen klaren, absolut tabulosen und auch aufgeklärten Umgang mit den Themen an, die ausnahmslos alle Frauen betreffen. Auch Athletinnen. Ja, Athletinnen vielleicht noch intensiver, ist ihr Ziel doch, an ganz bestimmten Tagen Höchstleistungen zu erbringen. Und ein Rennplan nimmt keine Rücksicht auf den Zyklus der Rennfahrerinnen. Auch Marlies Raichs Zyklus und die damit verbundenen Phasen wurden erst gegen Ende ihrer Karriere in den Trainingsplänen nach Möglichkeit berücksichtigt.
Im medica-Podcast beschreibt Marlies Raich, wie es ihr gelungen ist, den Zyklus zu timen und auch gut mit den einzelnen Zyklusphasen umzugehen, indem sie sich in müderen Phasen etwa auf das Training technischer Elemente konzentrierte und nicht ganz ans Limit ging. „Da braucht es ein gutes Selbstwertgefühl und Körpergefühl“, weiß sie.
Auch diese Gefühle wollen gelernt und trainiert werden. Initiativen wie das Projekt Female Athlete setzen sich mit frauenspezifischen Themen im Spitzensport auseinander und geben ihnen zunehmend die Öffentlichkeit, die sie verdienen. Menstruation spielt dabei genauso eine Rolle wie Verhütung oder Ernährung und selbstverständlich auch die Verletzungsrisiken, die bei Frauen andere sind als bei Männern. Im Alter von 19 Jahren hatte Marlies Raich schon fünf Knieoperationen hinter sich. „Die erste Verletzung, die ich hatte, war ein knöcherner Ausriss des vorderen Kreuzbandes. Mit 13. Ich glaube, das ist eine klassische Verletzung bei Mädchen. Mein Körper war wahrscheinlich noch nicht bereit für diese Art des Drucks“, erinnert sie sich. Es kamen noch einige folgenschwere Stürze hinzu und am Höhepunkt ihrer Karriere passierte die letzte große Verletzung. Ein Trümmerbruch in Schien- und Wadenbein sowie ein Bruch des Schienbeinkopfes, die sie sich in Folge eines schweren Sturzes im Herbst 2008 beim Riesenslalomtraining am Rettenbachferner zuzog, ließ sie noch einmal auf wilde Weise die Grenzen ihres Körpers, ihres Willens und ihres Geistes ausloten. „Ich bin damals am Gletscher gelegen und habe Riesenschmerzen gehabt. Der Fuß war sofort dick und ich dachte, super, jetzt hast du es geschafft“, erinnert sie sich. „Ein halbes Jahr vorher ist ein guter Freund von mir, Matthias Lanzinger, in Norwegen verunglückt. Ihm wurde das Bein abgenommen und das war der erste Gedanke. Oh Gott.“ Das Jahr, das folgte, war eines ihrer schwersten. Nach vier Monaten konnte sie noch nicht gehen, der Knochen war nicht zusammengewachsen, weitere Operationen waren nötig geworden und nach vielen Höhen und Tiefen in der Rehabilitation näherte sie sich step by step wieder der Piste. „Ich bin im August wieder Ski gefahren, habe zwar die Bindung nicht zudrücken können und auch nicht mit den Skischuhen gehen können, aber Skifahren hat einigermaßen geklappt“, sagt sie. Ihre Osteopathin fand dann die Zauberformel gegen den so präsenten Schmerz: „Sie sagte, akzeptiere das, das gehört jetzt dazu, und fokussiere dich aufs Skifahren, auf das, was du gerne tust.“ Das tat sie. Und wie.
War Marlies Raich zuvor in allen vier Disziplinen Weltklasse, so konzentrierte sie sich nun auf den Slalom, und sie sagt: „Der Sieg war nicht das vorderste Ziel, sondern ich wollte das Gefühl wieder spüren, dass alles wie von selber geht und ich wirklich wieder in den Flow komme.“ Schon im vierten Slalomrennen nach ihrem Comeback fuhr sie mit zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel, als Siegerin. Den Flow spürte sie noch viele Male, bis sie sich 2014 aus dem Rennsport zurückzog. Seither widmet sie ihre Energie der Familie, ist Unternehmerin, Moderatorin bei Skiübertragungen oder Dokumentationsreihen wie „Land der Berge“, und sie macht sich für junge Athletinnen stark. Ihnen wünscht sie nicht nur ein gutes Umfeld, das stets das Beste für sie will, sondern auch die Fähigkeit, zu kommunizieren und offen zu reden. Dass sie sich trauen, „alles anzusprechen, alles zu sagen – auch wie man sich fühlt und was man denkt“, sagt Marlies Raich – die Mutmacherin.
Alexandra Keller

Zum Podcast
Ganzheitlich betrachtet. Im medica-Podcast lässt Marlies Raich – ehemals Schild – ihre Karriere im Spitzensport auf außergewöhnliche Weise Revue passieren. Sie erzählt nicht nur davon, wie sie die Pubertät erlebte, und bricht eine Lanze für absolut offene Kommunikation junger Athletinnen bei allen ihre Frauenkörper betreffenden Fragen. Sie stellt auch klar, wie wichtig es für sie war, sich nicht über Leistung zu definieren. Eine wichtige, ja vielleicht entscheidende (Selbst-) Erkenntnis aus ihrer Zeit als eine der besten Skirennläuferinnen der Welt beschreibt sie so: „Ich bin die Marlies, bin ein Mensch mit Hobbys, Freunden, Familie – mit auch anderen Fähigkeiten als nur Ski zu fahren. Ich bin nicht nur gut, wenn ich ganz oben stehe.“
„Für mich ist die moderne MayrMedizin tatsächlich personalisierte Medizin in Vollendung.“
Gudrun Metzler

Ihre Form gleicht einem Schmetterling und sie beeinflusst so gut wie alles im Körper. Stimmung, Schlaf, Körpergewicht, Körpertemperatur, Stoffwechsel, Haut und Haare etwa, aber auch das innere Gleichgewicht. Nicht von ungefähr wird die Schilddrüse als das Wohlfühlorgan schlechthin bezeichnet. Funktioniert sie nicht so, wie sie sollte, kann sich das auf zahlreichen, komplex verwobenen körperlichen und geistigen Ebenen zeigen. Einer intensiven detektivischen Arbeit gleicht es, wenn sich Gudrun Metzler auf die Suche nach den Ursachen für eine Störung der Schilddrüsenfunktion begibt. „Die Schilddrüse darf nicht als isoliertes Organ betrachtet werden“, sagt die Ärztin.
Ein ganzheitlicher Zugang drängt sich geradezu auf.
Geschichten der menschlichen Evolution haben immer etwas Seltsames an sich. Vielleicht, weil es so schwer ist, sich mit einem vergleichsweise mickrigen Lebensalter von 80 bis 90 Jahren Zeitspannen vorzustellen, die Millionen oder gar Milliarden Jahre umfassen. Vielleicht, weil das comichafte Bild, das die Stammesgeschichte des Menschen zeigt, beim Schimpansen beginnt und den Hominiden Entwicklungsschritt für Entwicklungsschritt aufrechter gehen und stehen lässt, trotz der unverkennbaren Verwandtschaft ein bisschen befremdlich bleibt. Diese Erfolgsgeschichte der Menschheit begann vor sechs bis sieben Millionen Jahren und noch bizarrer wird’s, wenn mehr als 3,5 Milliarden Jahre zurück und tief hinein ins wilde Urmeer geblickt wird. Dorthin, wo alles Erdenleben seinen Ursprung hat.
Gudrun Metzler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und in der Longevity Clinic Lanserhof tätig.
Der Gedanke, dass wir mit Fischen verwandt sind, kann schon überfordern – und doch blitzt diese Verbindung bei einer der wichtigsten menschlichen Drüsen auf: der Schilddrüse. In ihrer Entstehungsgeschichte ist von Kiemen die Rede oder von Knochenfischen und rasch kehrt man zu den Anfängen der Evolution zurück, zurück ins Meer, wo sich mit Jod eben jenes Spurenelement sattsam tummelt, das in unmittelbarer Verbindung zur Schilddrüse steht. „Jod ist ein Baustein der Schilddrüsenhormone. Das heißt, ohne Jod kann die Schilddrüse keine Hormone herstellen. Und wir brauchen die Schilddrüsenhormone letztendlich zum Leben. Der Körper kann kein Jod selber herstellen. Das bedeutet, wir Menschen müssen Jod von außen zuführen“, sagt Gudrun Metzler. In fünf Sätzen fasst die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin damit die Essenz dieses kleinen Superorgans zusammen, das der Form eines Schmetterlings ähnelt, im Hals knapp unter dem Kehlkopf liegt und von dort aus wie eine nimmermüde Dirigentin so gut wie alle Funktionen des Körpers
HEIMISCHEN SPEISESALZ JOD BEIGEMENGT. VIELE MENSCHEN
ERSETZEN DAS JODIERTE SPEISESALZ ALLERDINGS GERNE DURCH
STEIN- BEZIEHUNGSWEISE HIMALAYA-SALZ. SUCHT MAN FOLGLICH
NICHT NACH EINER ALTERNATIVEN JODQUELLE, KANN JODMANGEL TATSÄCHLICH WIEDER ZU EINEM PROBLEM WERDEN.
steuert beziehungsweise beeinflusst. Darunter etwa Stimmung, Schlaf, Körpergewicht, Körpertemperatur, Stoffwechsel, Haut, Haare oder inneres Gleichgewicht. „Die Schilddrüse ist der Motor unseres Körpers und die Schilddrüsenhormone sind wie das Gaspedal“, zeichnet Gudrun Metzler ein bewegtes Bild – mit der dann logischen Konsequenz: „Wenn wir zu wenig Schilddrüsenhormone haben, fährt der Körper untertourig. Haben wir zu viel, fährt er übertourig.“
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie direkt in das Gespräch eintauchen – erzählt Gudrun Metzler, was sie an der Schilddrüse so fasziniert und warum der ganzheitliche Ansatz der modernen FX-Mayr-Medizin, auf den sich die Ärztin in der Longevity Clinic Lanserhof in Lans konzentriert, auch im Zusammenhang mit Schilddrüsenproblemen oder Schilddrüsen-Funktionsstörungen so heilende Antworten bereithält.
Ist die Schilddrüse der Motor und sind die Schilddrüsenhormone das Gaspedal, dann ist Jod der Treibstoff. Hauptsächlich kommt dieses Spurenelement in Meeresorganismen vor – in Meeresfischen, Meeresfrüchten oder Algen. Geringe Mengen können auch in Böden vorkommen. In Österreich tun sie das allerdings nicht wirklich, weswegen die Alpenrepublik ein Jod-Mangelgebiet ist.
Der wohl auch der Ferne zu den Weltmeeren zu verdankende Jodmangel konnte sich in früheren Zeiten durchaus eindrücklich zeigen – mit Kröpfen. Ein Kropf – der Fachausdruck lautet Struma – kann jedenfalls
ein unübersehbarer Hinweis darauf sein, dass der davon betroffene Mensch unter Jodmangel leidet, vergrößert sich die sonst nicht sichtbare Drüse dabei doch zu einem wahren Blickfänger. „Hat die Schilddrüse zu wenig Jod, kann sie zu wenig Schilddrüsenhormone herstellen. Dies wird in einer übergeordneten Steuerungszentrale im Gehirn registriert und die feuert daraufhin die Schilddrüse zu vermehrter Arbeit an“, erklärt Gudrun Metzler. Und wie reagiert die Schilddrüse? „Sie vergrößert das Fabrikationsgebäude der Schilddrüsenhormone, das heißt, sie vergrößert sich selbst und der Kropf wächst.“
Mögen richtig große Kröpfe in unseren Breitengraden auch kaum noch vorkommen, so könnten sich die kleineren wieder vermehren. Um den folgenschweren Jodmangel auszugleichen, wurde und wird dem heimischen Speisesalz Jod beigemengt. „Viele Menschen ersetzen das jodierte Speisesalz durch Steinbeziehungsweise Himalaya-Salz. Wenn man da nicht nach einer alternativen Jodquelle sucht, dann kann Jodmangel tatsächlich wieder zu einem Problem werden“, bestätigt Gudrun Metzler, worauf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erst im Sommer 2024 aufmerksam gemacht hat – dass Menschen in der europäischen Region der WHO nämlich wieder zunehmend unter Jodmangel leiden. Mit all den Schilddrüsenproblemen oder -Funktionsstörungen, die damit einhergehen können. „Wenn Jodmangel die Ursache der Schilddrüsenstörung ist, der Schilddrüsenunterfunktion etwa, dann kann die Gabe von Jod oder die Verwendung von jodiertem Salz bereits das Problem lösen“, nennt Gudrun Metzler die einfachste Lösung für die vielleicht einfachste beziehungsweise
am leichtesten zu behebende Störung der Schilddrüse.
Im medica-Podcast erklärt Gudrun Metzler, warum Funktionsstörungen der Schilddrüse für sie wie eine Art Chamäleon sind, weil die Symptome für eine Störung auch ganz andere Ursachen haben können. Darum ist für eine exakte Anamnese neben Labor-, Tast-, Bauch- und Bildbefunden auch richtig viel Zeit nötig. „Wenn ein Patient oder eine Patientin zu mir kommt, unterhalte ich mich beim Erstkontakt sehr ausführlich mit ihnen, um möglichst viel von ihnen zu erfahren“, sagt die Ärztin.
Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion – also einem Zuwenig an Schilddrüsenhormonen – können beispielsweise Gewichtsabnahme, Depression, Konzentrationsstörung, vermehrtes Schlafbedürfnis, Verstopfung oder Haarausfall sein. Eine Schilddrüsenüberfunktion – also ein Zuviel an Hormonen – kann sich in Symptomen wie hoher Blutdruck, hoher Puls, Nervosität und ebenfalls in Schlafproblemen oder Haarausfall zeigen. „Haarausfall kann Folge einer Schilddrüsenunterfunktion sein oder Folge einer Schilddrüsenüberfunktion. Er kann aber auch hormonell bedingt sein, stressbedingt oder die Folge eines Eisenmangels“, beschreibt Gudrun Metzler das Labyrinth, in dem sie sich – einer Detektivin gleich – auf die Suche nach der Ursache macht.
Bei Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen wie Hashimoto Thyreoiditis oder Morbus Basedow, ist diese medizinische Detektivarbeit besonders tricky, gibt es doch nicht nur erbliche Veranlagungen beziehungsweise genetische Prädispositi-
Schilddrüsenwickel mit alten Heil- und Hausmitteln wie Topfen, Bienenwachs oder Heilerde können helfen, die Schilddrüse bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Im Lanserhof wird auch mit Lymphdrainagen, speziellen osteopathischen Faszientechniken oder Schilddrüsenmassagen dem kleinen Superorgan Gutes getan.

onen, die zur Entwicklung dieser Erkrankungen führen. „Da kommen noch Umweltfaktoren dazu“, öffnet Gudrun Metzler den Deckel zu einer Ursachenkiste, die ein umfangreiches Sammelsurium an möglichen Auslösern enthält. Psychischer, aber auch körperlicher Stress zählen genauso dazu wie extremer Sauerstoffmangel, extreme Kälte oder extremer Schlafmangel. Zu den Umweltfaktoren, welche die Ärztin anspricht, gehören außerdem Probleme im Darm, Infektionen etwa mit dem Epstein-Barr-Virus oder Toxine. Gudrun Metzler: „Deswegen ist es für mich wichtig, sehr viel von diesen Patient:innen zu erfahren. Um auf der einen Seite zu verstehen, welche Abklärungen ich gegebenenfalls noch durchführen muss, und vor allem auch, was ich für die Patient:innen tun kann, damit ich ihnen tatsächlich gut helfen kann.“ Im Idealfall können der Körper beziehungsweise die Schilddrüse
„Die Schilddrüse ist der Motor unseres Körpers und die Schilddrüsenhormone sind wie das Gaspedal.“
Gudrun Metzler
selbst – angeregt durch die „gute Hilfe“ beziehungsweise die punktgenaue Therapie – die Funktionsstörung ausgleichen und die Schilddrüse wieder ins Lot bringen.
Im medica-Podcast erklärt Gudrun Metzler, warum die Schilddrüse als Wohlfühlorgan bezeichnet wird. Müssen die Schilddrüsenhormone etwa bei Menschen, de-
ren Schilddrüse operativ entfernt werden musste, supplementiert beziehungsweise medikamentös ersetzt werden, kann die Einstellungsphase auch sonst lebensfrohe Menschen depressiv werden lassen. „Um uns wirklich wohl in unserer Haut zu fühlen, brauchen wir ausreichend und eine gesunde Menge an Schilddrüsenhormonen“, sagt sie.
Dass Frauen öfter von Erkrankungen oder Funktionsstörungen der Schilddrüse betroffen sind, ist so bekannt, wie die exakte Erklärung dafür unbekannt ist. „Ein Erklärungsmodell ist, dass das Hormonsystem der Frauen komplexer ist als jenes der Männer. Und tatsächlich treten Schilddrüsen-Funktionsstörungen häufig in Zeiten von hormonellen Veränderungen auf“, stellt Gudrun Metzler fest. Hashimoto Thyreoiditis tritt beispielsweise sehr häufig in den Wechseljahren auf, aber auch in der Pubertät, „und etwa vier Prozent der Frauen entwickeln nach der Geburt eines Kindes eine sogenannte Post-partum Thyreoiditis.“
Die hormonelle Lebensreise einer Frau hält ganz offenkundig viele Überraschungen bereit und Hashimoto Thyreoiditis ist eine der übelsten beziehungsweise spannungsreichsten, erhöht diese chronische entzündliche Erkrankung der Schilddrüse doch nicht nur das Risiko von Krebserkrankungen oder auch der Entwicklung von Arteriosklerose. Typisch für Hashimoto ist eine Schilddrüsenunterfunktion, aber es kann durchaus auch Phasen einer Überfunktion geben oder Phasen einer normalen Schilddrüsenhormonproduktion. „Deswegen ist es besonders wichtig, dass sich Patienten mit einer Hashimoto Thyreoiditis von einer Ärztin oder einem Arzt begleiten lassen. Erstens natürlich, um die Schilddrüse optimal zu unterstützen und zu behandeln. Und zweitens, damit man diese Patient:innen auch optimal präventivmedizinisch beraten kann“, macht Gudrun Metzler darauf aufmerksam, dass Betroffene ein Leben lang begleitet werden sollten, um mit den Schilddrüsenhormonen auch die Lebensqualität zu optimieren.
Die Therapie einer Schilddrüsen-Funktionsstörung hängt natürlich von der Ursache ab, die zu finden – wie erwähnt – kein Spaziergang ist. Bei Schilddrüsenunterfunktionen werden die fehlenden Hormone beispielsweise standardmäßig durch die Gabe von

Die große Welt des kleinen Superorgans.
Im medica-Podcast lädt Gudrun Metzler zu einer spannenden Reise mit der Schilddrüse durch den Körper ein. Dieses kleine Superorgan, das gleichzeitig die größte endokrine Drüse ist, ist ein tonangebender Teil im Hormon-Regelkreis des Körpers. Verrückt kann das Temperaturempfinden spielen, wenn die Schilddrüse verrückt spielt. „Patient:innen mit einer Schilddrüsenunterfunktion haben eine reduzierte Kältetoleranz, das heißt, sie frieren zum Beispiel auch im Sommer in der Hitze. Und umgekehrt – bei einer Überfunktion haben die Patient:innen eine reduzierte Wärmetoleranz. Sie haben immer zu heiß und schwitzen sofort“, erklärt die Ärztin.
Levothyroxin, auch bekannt als L-Thyroxin oder T4, einem synthetisch hergestellten Hormon, ersetzt. „Das ist eine Art Speicherhormon mit einer Halbwertszeit von etwa einer Woche. Aus diesem kann der Körper die Schilddrüsenhormone herstellen und das reicht auch in den meisten Fällen völlig“, erklärt die Ärztin. Selten wird das aktive Hormon T3, ein weiteres synthetisch hergestelltes Hormon, in kleinen Mengen gegeben. Und daneben gibt es auch natürliche, gefriergetrocknete Schilddrüsenhormone oder -extrakte vom Schwein oder vom Rind.
Neben diesen Möglichkeiten, die Schilddrüse bei ihrer Arbeit zu unterstützen oder die lebensnotwendigen Hormone komplett zu ersetzen, gibt es aber auch regelrechte Wohlfühlprogramme, mit denen der flatterhafte Schmetterling bei Laune gehalten und zur Regeneration angeregt werden kann. „Zum Beispiel Schilddrüsenwickel. Dafür verwenden wir alte Heil- und Hausmittel wie Topfen, Bienenwachs oder Heilerde“, erzählt Gudrun Metzler von schilddrüsenspezifischen Anwendungen am Lanserhof. Auch mit Lymphdrainagen, speziellen osteopathischen Faszientechniken oder Schilddrüsenmassagen kann dem kleinen Superorgan Gutes getan werden. „Bei diesen Massagen verwenden wir Kräuter, die – je nachdem, welche wir einsetzen – stimulierend, ausgleichend oder beruhigend wirken“, beschreibt die Ärztin beispielhaft den großen Blick und ganzheitlichen Zugang, mit dem im Sinne der Patient:innen Rosinen aus den unterschiedlichen medizinischen Konzepten und Methoden gepickt und gewissermaßen alle Register gezogen werden können. Ein Zugang, den die Schilddrüse mit ihrem so breiten und diffizilen Wirkspektrum auf allerlei Körperfunktionen und Regelwerke wirklich verdient hat. Die Patientinnen, bei denen sich die Funktionsstörungen des Chamäleons auf so unterschiedliche Arten zeigen können, haben das auch. Und Gudrun Metzler betont: „Für mich ist die moderne Mayr-Medizin tatsächlich personalisierte Medizin in Vollendung.“
Alexandra Keller










Wirklich gesund und anhaltend abzunehmen, ist ein Bedürfnis, das zahlreiche Menschen bewegt – und nicht selten scheitern lässt. „Uns ist ein Vakuum an seriösen Angeboten auf diesem Gebiet aufgefallen“, sagt Stefan Riml, Arzt und Gründer von riml aesthetics in Sistrans. Mit medizinischer Ernährungsberatung, die wissenschaftlich fundiertes Ernährungswissen mit medizinischem Know-how verbindet, wird die Lücke nun in der Praxis für Ästhetik geschlossen.
Im Interview erklären Stefan Riml und Ernährungswissenschaftlerin Ines Straub, wie nachhaltiger Gewichtsverlust funktionieren kann und wie sie die Patient:innen dabei begleiten.
Sie sind Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und haben eine beeindruckende klinische Erfahrung – etwa im Zusammenhang mit Brust- und Handchirurgie. In Ihrer Praxis für Ästhetik in Sistrans konzentrieren Sie sich nun auch auf medizinische Ernährungsberatung. Das klingt überraschend. Warum haben Sie die Ernährung in Ihr Angebotsportfolio aufgenommen? STEFAN RIML : Wir sind darauf bedacht, dass wir uns dem Thema Ästhetik nachhaltig und vor allem holistisch zuwenden. So kommen immer wieder Patient:innen mit dem Wunsch nach einer Fettabsaugung bei Übergewicht zu mir. Diesen Patient:innen kann mit einer Liposuktion nicht nachhaltig geholfen werden. Die Liposuktion ist eine tolle Technik, um Problemzonen zu beherrschen, aber nicht, um Übergewicht zu reduzieren. Auch ist uns ein Vakuum an seriösen Angeboten auf diesem Gebiet aufgefallen. Gewichtsreduktion ist ein Thema, das zahlreiche Menschen bewegt. Viele Frauen und Männer haben schon diverseste Diätversuche seriöser oder weniger
seriöser Natur hinter sich und viele haben damit nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Wir bieten unseren Patient:innen medizinisch fundierte Ernährungsberatung zur Gewichtskontrolle an.
Wodurch unterscheidet sich die medizinische Ernährungsberatung von anderen Angeboten?
STEFAN RIML: Da sind mehrere Dinge zu nennen. Zum einen haben wir mit Ines Straub eine Ernährungswissenschaftlerin in unserem Team und können somit wissenschaftlich fundierte Ernährungsempfehlungen abgeben. Von ärztlicher Seite ist die Indikation zu Blutabnahmen möglich, um Erkrankungen, Nährstoffmängel, oder Hormonmängel aufzudecken und auch zu therapieren. Und wir haben natürlich auch Zugriff auf Medikamente, um den Abnehmprozess
„Eine Gewichtsreduktion macht nur Sinn, wenn ich bereit bin, mein Leben dauerhaft zu ändern.“
Stefan Riml

Mit medizinisch fundierter Ernährungsberatung schließen Stefan Riml und Ines Straub eine Lücke, damit Gewichtsreduktion und Gewichtskontrolle nachhaltig funktionieren.
schneller und für die Patient:innen einfacher gewährleisten zu können.
Durch die medizinische Begleitung wird sozusagen eine gesunde Variante ermöglicht, um Gewicht zu reduzieren? STEFAN RIML: Genau. Ich halte es für unseriös, den Leuten die berühmt gewordene Abnehmspritze zur Gewichtsreduktion unkontrolliert und unbegleitet abzugeben. Die Spritze wirkt nur, solange sie verwendet wird. Dann aber würde das Gewicht wieder nach oben gehen – es sei denn, man hat in der Zwischenzeit die Ernährung umgestellt. Die Abnehmspritze oder die Abnehmtablette, die ganz frisch auf dem Markt ist, wirken zwar gut, aber sie müssen sorgsam eingesetzt werden.
Gibt es Langzeitstudien zur Wirkung der Abnehmspritze? STEFAN RIML: Die Abnehmspritze wurde ursprünglich bei Diabetikern eingesetzt. Wir können nun auf gute Langzeitdaten zurückgreifen, obwohl sie in der Gewichtsreduktion erst recht kurz eingesetzt wird.
Wie hängen Ernährung und Schönheit zusammen? STEFAN RIML: Es sind mehrere Faktoren, die hier einen Einfluss haben. So ist Normalgewicht nicht nur gesünder, es wird von den meisten auch als schöner empfunden als Übergewicht. Zusätzlich ist es beispielsweise nachgewiesen, dass die Ernährung Einfluss auf den Kollagen-Stoffwechsel und somit die Festigkeit der Haut hat.
Sich richtig zu ernähren ist der Knackpunkt, um abzunehmen und gesund zu bleiben. In dem Zusammenhang, Sie haben es schon erwähnt, gibt es zahlreiche auch wenig seriöse Angebote. Was unterscheidet diese von einer Beratung durch eine Ernährungswissenschaftlerin? INES STRAUB: Wie schon der Name sagt: Alles was ich gelernt habe und auch weitergeben möchte, ist durch jahrelange Forschung sowie durch medizinische Begleitung wissenschaftlich belegt.
Spielt die medikamentöse Unterstützung bei den abnehmwilligen Patient:innen eine große Rolle? STEFAN RIML: Wir bieten den Patient:innen einerseits eine konventionelle

Ines Straub Medizinische Fachangestellte, Studium der Ernährungswissenschaften an der Euro-FH Hamburg, leitende medizinische Praxisassistentin bei riml aesthetics. Jahrelange Erfahrung in der Spitzengastronomie wie dem Lanserhof oder dem Stock Resort.
Doz. Dr. Stefan Riml Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Handchirurg. Habilitation an der Uni Innsbruck. Mehr als 20 Jahre klinische Erfahrung. Weit über 4000 durchgeführte Operationen. Leiter von riml aesthetics.
Ernährungsberatung zur Gewichtsreduktion an. Das heißt, sie müssen ihre Ernährung umstellen und werden damit Erfolge erzielen – auch nachhaltig, aber halt langsamer. Bei der zweiten Variante spielt die Ernährungsumstellung auch die entscheidende Rolle – der Abnehmprozess wird aber gepusht durch gewichtsreduzierende Medikamente. Das heißt, die Patient:innen haben die Wahl, ob sie es sich etwas leichter machen wollen oder ob sie den traditionellen Ansatz wählen möchten.
Was sind die Gründe dafür, dass so viele Menschen an ihren Abnehmversuchen scheitern? INES STRAUB: Ich glaube zum einen, weil der Informationsfluss falsch ist oder durch die falschen Kanäle zu den Menschen gelangt. Es gibt ein unfassbar großes Spektrum an Diäten, an Tipps und Tricks, an Nahrungsergänzungsmitteln, an Pulvern. Da weiß man gar nicht so wirklich, wo man starten soll. Zudem ist unser Ernährungsangebot sehr
geprägt von industriellem Zucker und Fett. Das macht es umso schwieriger, sich natürlich und gesund zu ernähren. Das und weil die Menschen oft allein sind mit ihrem Problem und nicht richtig wissen, wohin sie sich vertrauensvoll wenden können, sind Gründe dafür, dass sie mit ihren Versuchen scheitern.
Können diese Versuche auch gefährlich sein?
STEFAN RIML: Oh ja, sehr viele Diäten sind gesundheitsgefährdend. Das muss man ganz klar sagen. Viele Diäten sind sehr einseitig, führen zwangsläufig zu Nährstoff-Mangelerscheinungen und sind von Anfang an so konzipiert, dass das die Leute nur für gewisse Zeit durchhalten. Eine Gewichtsreduktion macht aber nur Sinn, wenn ich bereit bin, mein Leben dauerhaft zu ändern.
So genannte Crashdiäten bringen demnach nichts?
STEFAN RIML: Nein, sie schlagen sich natürlich auf der Waage nieder, das aber meistens nur, weil die Menschen Wasser oder Muskulatur verlieren. Das ist ein entscheidender Punkt, den wir hier anders und besser machen wollen. Mit unserer Bioimpedanzanalyse der neuesten Generation können wir messen, wie viel Fett die Person wirklich verliert. Und wir können ausschließen, dass der Gewichtsverlust rein aufgrund von Entwässerung oder Muskelabbau passiert. Das reine Körpergewicht sagt nämlich gar nichts aus.
Wie wird verhindert, dass während der Diät Muskeln abgebaut werden? INES STRAUB: Die meisten Diäten zielen einfach nur darauf ab, ein hohes Kaloriendefizit zu erreichen. Es wird aber nicht aufgeklärt, dass wir verschiedene Kalorientypen haben – also 400 Kilokalorien von einem Donut sind andere Kalorien als die von Hühnchen oder von Reis. Und das ist oft das Hauptproblem, dass wir in ein massives Kaloriendefizit rutschen und dadurch kein Fett, sondern nur Muskelmasse verlieren. Beispielsweise brauchen wir Kohlenhydrate, um zu funktionieren, damit die Organe arbeiten und wir fit sind für den Alltag. Aber wir brauchen die richtigen Kohlenhydrate. Mit den richtigen Kohlenhydraten und mit dem richtigen Defizit von Kohlenhydraten schaffen wir es, Fett zu
„Wir geben keinen fixen Ernährungsplan vor, weil die meist nicht einhaltbar sind.“
Ines Straub
reduzieren, die Muskeln zu erhalten oder sogar aufzubauen.
Welche Blutwerte werden im Rahmen einer medizinisch kontrollierten Gewichtsreduktion gemessen? INES STRAUB: Die Kontrollparameter der Organfunktionen sind immer mit dabei. Dann aber auch eine große Vitamin- und Mineralstoffanalyse, eine Analyse des Omega-3- zu Omega-6-Haushalts, alle Entzündungsparameter, die Stressparameter in unserem Blut und die Hormone – sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wichtig sind auch die Werte, die unsere Zellgesundheit abbilden und zeigen, wie gut wir bezüglich des oxidativen Stresses aufgestellt sind.
Wie gehen Sie vor, wenn diese Analysen Dysbalancen aufzeigen? STEFAN RIML: Entdecken wir ein Defizit, dann müssen wir den Ernährungsplan entsprechend anpassen. Liegt beispielsweise ein Selenmangel vor, sollte der Plan mehr Nüsse enthalten. Wenn ein Defizit über die Ernährung nicht oder nicht ausreichend ausgeglichen werden kann, muss es supplementiert werden.
Es geht um mehr als den Verlust von Gewicht? STEFAN RIML: Eigentlich richtet sich unser Angebot an alle. Es ist also auch ein Longevity-Thema – für Menschen, die sagen: Ich fühle mich jetzt gesund, aber ich möchte das auch bleiben.
Was ist neben den Laborwerten wichtig bei der Anamnese? INES STRAUB: Für mich ist die erste Frage: Wie geht es der Patientin oder dem Patienten, wie fühlt sich der Mensch wirklich, wenn er ganz ehrlich sein darf zu sich selber. Dazu kommt der Alltag, der Job, der Stresslevel, Vorerkrankungen,

die Familiengeschichte und die Medikamente, die genommen werden.
Legen Sie ein Zielgewicht fest, ein Ideal? INES STRAUB: Zuerst möchte ich schauen, wohin die Patient:innen wollen. Wie werden sie sich wohl, gesund und zufrieden fühlen? Erst im zweiten Schritt wird dann eine Zahl festgelegt, ein Ziel. STEFAN RIML: Die Zielsetzung muss natürlich im Gespräch mit den Patient:innen erfolgen. Es gibt normalgewichtige Patient:innen, die aber ausdefinierter sein möchten. Und es gibt krankhaft fettleibige Patient:innen, die einfach nur gesünder werden möchten. Das sind unterschiedliche Zielsetzungen. Wir geben keine ästhetischen Ideale vor. Unsere Grenzen sind jedoch ganz klar die physiologischen Werte von BMI und Fettgehalt. Ein Abgleiten ins Untergewicht unterstützen wir nicht.
Welche Rolle spielt die Bewegung? STEFAN RIML: Sport ist sehr gesund und wir animieren alle PatientInnen zu mehr Bewegung. Mit Sport alleine wird ein Übergewichtiger jedoch kaum abnehmen. Bei einer Gewichtsreduktion werden etwa 80 Prozent durch die Ernährung erreicht und nur 20 Prozent durch den Sport. INES STRAUB: Wir geben keine fixen Ernährungspläne vor, weil die meist nicht einhaltbar sind. Das heißt, es geht eher darum, sie aufzuklären, was gut für sie ist und was nicht. Wir arbeiten
hier mit Apps, die auch Rezeptsammlungen enthalten und Ideen liefern. Aufzuschreiben, dass heute Abend beispielsweise 300 Gramm Reis auf dem Teller sein sollen, funktioniert nicht, das ist praxisfremd.
Wie lange werden Sie Ihre abnehmwilligen Patient:innen begleiten? INES STRAUB: Das ist natürlich sehr individuell – je nach Ziel und wie weit der Weg sein wird. Ganz grob geschätzt zwischen acht Wochen und einem halben Jahr. Wir stehen den Patient:innen natürlich auch weiterhin zur Verfügung, insbesondere dann, wenn es Rückschläge gibt, die ja menschlich sind. STEFAN RIML: Je höher die Gewichtsreduktion ausfallen soll, desto länger begleiten wir die Patientinnen. Longevity-Interessierte erreichen ihre Ziele natürlich schneller als krankhaft fettleibige PatientInnen. Hier muss von einem Abnehmprozess von vielen Monaten ausgegangen werden. riml aesthetics
Unternehmerzentrum 23 6073 Sistrans Tel.: 0512/20 90 45 info@riml-aesthetics.com riml-aesthetics.com


Wenn die Welt leicht schwankt, der Boden verschwimmt, Benommenheit den Kopf erfüllt oder die Augen mit unklaren Bildern verzerrte Informationen ans Gehirn senden, können Hilflosigkeit und Angst die Betroffenen in einen schrecklichen Teufelskreis schicken. Auch wenn der Schwindel keinen organischen Grund hat, bleibt er ein Schwindel. Sich auf die Suche nach den funktionellen Ursachen für derart unspezifische Schwindelsymptome zu machen, ist eine sensible detektivische Aufgabe, mit der die Tiroler Neurochirurgin Claudia Unterhofer oft konfrontiert wird. Oft von jungen Frauen.
„Beim Schwindel bekommt man das Gefühl, die Macht über sich selber zu verlieren. Angst ist beim Schwindel ein großes Thema.“
Claudia Unterhofer
Dass das Wort Schwindel zwei so unterschiedliche Bedeutungen hat, wirkt bizarr. Warum kleine Gaunereien, Täuschungen, Mogeleien, Schummeleien, Fakes oder Bluffs den gleichen Übernamen tragen wie das Gefühl zu torkeln, zu schwanken, beduselt, benommen oder benebelt zu sein, ist offenkundig im Alt- und dann im Mittelhochdeutschen zu finden. Dort wurde mit „swindeln“ das in Ohnmacht fallen und das Taumelgefühl im Kopf beschrieben. Irgendwie und irgendwann wurde dieser wirre Zustand dann auch für Lumpen verwendet, die bewusst täuschten. Tja, jener Schwindel, der den körperlichen Zustand beschreibt, war zuerst da. Und er ist den Menschen erhalten geblieben – als immer unangenehmes und beängstigendes Gefühl. Kontrollverlust und Ohnmacht sind keine erstrebenswerten Zustände. Sie machen Angst.
Wohl keiner hat Angst derart gänsehautreich auf die Leinwand und in die Eingeweide der Zusehenden gebannt wie Alfred Hitchcock. Eines seiner Meisterstücke schafft es sogar, den Weißen Hai zum Goldfisch zu schrumpfen. Der 1958 erschienene Psychothriller „Vertigo – aus dem Reich der Toten“, in dem James Stewart die Höhenangst und den durch sie bedingten Schwindel auf atemberaubende Weise personifiziert, wird anhaltend unter den besten Filmen aller Zeiten geführt. Vertigo ist die medizinische Bezeichnung für Schwindel. Und Schwindel ist ein Zustand, der Menschen immer öfter schwanken lässt. Der Deutschen Hirnstiftung zufolge erkrankt einer von zehn Menschen jährlich neu an Schwindel, was ihn zu einem der häufigsten Krankheitssymptome – und dementsprechend vielen Menschen Angst macht. „Das Interessante beim Schwindel ist, dass Schwindel eigentlich kei-
ne Diagnose ist. Schwindel ist ein reines Symptom, ein Empfinden, das die Patientin oder der Patient dir mitteilt“, sagt Claudia Unterhofer.
Die Angst vorm Schwindel
Claudia Unterhofer ist Neurochirurgin, Wirbelsäulenspezialistin und Fachärztin für manuelle Medizin. Wirbelsäule, Gehirn, Schädel, peripheres und zentrales Nervensystem zählen demnach zu ihrem medizinischen Fokus – sowohl im Wirbelsäulenzentrum der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck als auch in ihrer Praxis in Hall. Dort wird sie erstaunlich oft mit Schwindelsymptomen konfrontiert, die meistens einhergehen mit Übelkeit oder Sehveränderungen und einem Gefühl von Gleichgewichtsstörungen. Die Ärztin erklärt: „Das ist ein sehr breit gefächertes Symptom und meistens auch mit Angst assoziiert, Schwindel macht ängstlich – wie im Film Vertigo auch, weil man das Gefühl bekommt, die Macht über sich selber zu verlieren und ohnmächtig zu werden. Angst ist beim Schwindel ein großes Thema.“
Auf der anderen Seite kann auch Angst den Schwindel auslösen. Wie eben die Angst vor der Höhe, wenn den Augen beim Blick in die Tiefe optische Fixpunkte fehlen und der Körper mit weichen Knien und einem flauen Gefühl in der Magengegend, mit Unsicherheit beim Gehen und Stehen, mitunter mit Herzrasen, Schweißausbrüchen und verkrampfter Muskulatur darauf reagiert. „Es ist dann die Kunst, herauszufinden, wie viel Rolle spielen Angst oder Druck und wie viel der Schwindel. Wo fängt es an und wo hört es auf? Es kann wirklich ein Perpetuum sein“, weiß die Neurochirurgin.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie zuhören – erzählt Claudia Unterhofer, warum sie sich dazu entschlossen hat, das Gehirn und die Wirbelsäule in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu rücken. Einerseits operativ, andererseits in ihrer Praxis, wo sie sich mit Störungen bei Menschen beschäftigt, die oft schwer erklärlich sind. Den Alltag teils massiv einschränkende chronische Schmerzen zählen beispielsweise dazu – und die Schwindelsymptomatik.
„Mich hat immer schon fasziniert, Probleme zu erkennen, Fehlfunktionen zu ertasten, strukturelle Störungen zu finden und dann die Lösung zu finden, die damit verbunden ist“, erzählt die Ärztin. Das Streben nach Perfektion und das Beherrschen der absoluten Fokussierung auf genau den richtigen Weg zur Lösung des Problems sind Kunstfertigkeiten, die sie nicht nur im Operationsraum beherrscht, sondern auch in ihrem klinischen Alltag, „wo man lernt, Menschen zuzuhören und zu verstehen, wo genau der Schuh drückt, weil – Gott sei Dank – ganz häufig die Struktur nicht gestört ist.“ Strukturelle Störungen, wie etwa ein Hirntumor, ein Bandscheibenvorfall oder massive Drehschwindel verursachende Probleme im Innenohr, sind meist schon mittels allerlei exakter Bildgebungsverfahren oder Messungen abgeklärt und ohne Befund, wenn die Patient:innen zu Claudia Unterhofer kommen. Einerseits sind sie glücklich, dass keine strukturelle Störung vorliegt, andererseits sind sie weiterhin verunsichert, weil die unspezifischen Schwindelzustände ja nach wie vor auftreten – mit allen ihren die Lebensqualität teils zerrüttenden Folgen. „Ich kann mich dann auf die funktionellen Störungen fokussieren“, erklärt die Ärztin. Um den Ausgangspunkt ihrer Ursachensuche zu verstehen, ist es so wichtig wie

Claudia Unterhofer ist Neurochirurgin, Wirbelsäulenspezialistin und Fachärztin für manuelle Medizin. Sie praktiziert sowohl im Wirbelsäulenzentrum der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck als auch in ihrer Praxis in Hall.

Elektrotherapie ist eine von mehreren therapeutischen Anwendungen, mit denen Claudia Unterhofer in ihrer Praxis arbeitet - und mit Hilfe von Strom physikalische wie chemische Prozesse auslöst, um einen heilenden Mechanismus in Gang zu setzen.
DER DEUTSCHEN HIRNSTIFTUNG ZUFOLGE
ERKRANKT EINER VON ZEHN MENSCHEN JÄHRLICH
KRANKHEITSSYMPTOME MACHT.
spannend, die Anatomie kennenzulernen beziehungsweise den faszinierenden Informationsfluss, der das Gehirn dazu animiert, die Patientin mit dem Schwindel zu verunsichern. Neben dem Ohr, dem Gleichgewichtsorgan oder dem Kleinhirn gibt es zahlreiche Sinneszellen, die das Gehirn mit Informationen darüber versorgen, wie der Körper und vor allem wie der Kopf im Raum steht oder liegt. „Deshalb sind auch Antworten von Muskelzellen, von Gelenken, von Knochen Informatoren für das Gehirn“, sagt Claudia Unterhofer. Gehen ist beispielsweise nicht nur eine mechanische, sondern auch eine sensorische Aktion des Körpers. Die Füße fühlen den Untergrund. Sie wissen gleichsam, ob der Mensch nun auf Kies geht, auf Gras oder auf einem rutschigen Boden – und dementsprechend wird die Muskulatur angespannt oder locker gelassen. „Wenn dieser
Informationsfluss nicht gut ist, dann gehe ich auf einem Asphaltboden, als würde ich mich auf einem Spiegel bewegen. Da ist der Tritt ganz anders“, erklärt die Ärztin, „das heißt, es ist eine verzerrte Information. Diese Verzerrung führt zu Unklarheit und diese Unklarheit zu einem Schwanken.“
Im medica-Podcast berichtet Claudia Unterhofer davon, dass hauptsächlich Frauen mit unspezifischen Schwindelsymptomen ihre Praxis aufsuchen. Über die Hintergründe kann sie nur mutmaßen – und sagt beispielsweise: „Es sind viele junge Frauen, die eine sehr breit gefächerte Belastungssituation haben. Sie sind junge Frauen, junge Mütter, junge Mitarbeiterinnen, junge Ehefrauen – all diese Teilbereiche möchten sie perfekt vereinen und das ist natürlich schwierig.“
Dass der grassierende und durch Social-Media-Kunstfiguren angeheizte Superperfektionismus die jungen Frauen schwindelerregend unter Druck setzt, ist eine Theorie. Fakt ist, dass sich bei ihnen viele Stressoren anhäufen können, die in der geballten Form durchaus als ungesund bezeichnet werden dürfen. Im gesunden Leben sind die sensorischen Künste so genannter Stellungszellen dafür verantwortlich, dass sich der Kopf immer stabil im Raum bewegt beziehungsweise dortselbst in neutraler Position gehalten wird. Darum ist es möglich, einen Salto zu schlagen oder eine Buckelpiste hinunterzufahren, ohne schwindlig zu werden. Sind die Nackenmuskeln entspannt, ist das kein Problem. Sind sie es aber ganz und gar nicht beziehungsweise sind die Nackenmuskeln massiv verspannt, kann diese Verspannung die Stellungszellen regelrecht verwirren und das Austarieren erschweren. Ist der Kopf nicht in der Harmonie des Gleichgewichtes, versucht er stets, die Mitte zu erwischen. Das ist nicht nur permanent anstrengend, das ist auch eine Ursache für den unspezifischen Schwindel mit all seinen subtilen Symptomen wie Benommenheit, Watte im Kopf oder Brainfog, Unsicherheit beim Gehen und unscharfes Sehen. „Man fühlt sich schrecklich hilflos“, bringt Claudia Unterhofer die Schwindelessenz auf den Punkt.
Der sensible und durch Nerven miteinander gekoppelte Bereich des Nackens, des Schlundes und des Kauapparates ist ein Hotspot für eventuelle funktionelle Störungen, die zu Schwindelsymptomen führen können. „Da gilt es dann herauszufinden, wo beginnt dieser Kreislauf. Beginnt der im Nacken, im Kiefer, bei den kurzen Nackenmuskeln, im Kopf – wo? Das Herauszufinden ist das Spannende an meinem Beruf in der Ordination“, sagt die Ärztin, die auch geprüfte Therapeutin für die Atlastherapie nach Arlen ist.
Der Titan im Nacken
In der Mythologie ist Atlas jener Titan, der das Himmelsgewölbe stützt. Der Name passt auch ganz gut zum ersten Halswirbel und seiner durchaus heroischen Aufgabe, das Haupt der Menschen zu tragen. Der Atlas und sein kleiner Bruder Axis, der zweite Halswirbel, gehören zu den kleinen Kopfgelenken und die unterscheiden sich von den restlichen Halswirbelgelenken sowohl in ihrer anatomischen Struktur als auch in ihrer Funktion. Mit dem Bild des Wackeldackels im Auto beschreibt Claudia Unterhofer diese Funktion recht anschaulich, sind die beiden kleinen Kopfgelenke doch für das Vornicken, das Rücknicken und die Drehung bei der Seitnickung zuständig. Atlas und Axis werden beispielsweise dann gehörig herausgefordert, wenn die Menschen stundenlang auf das Handy schauen und dabei den immer schweren Kopf nach unten hängen lassen. Auch bei der Friseurin ermöglichen die kleinen Kopfgelenke, dass der Kopf zum Haarewaschen in die Schale gelegt werden kann – oder eben nicht, weil die Muskulatur schmerzt und Schwindel den Kopf erfasst. Fehlbildungen oder funktionelle Störungen im Atlas können Ursache für Schwindel, aber auch andere überaus unangenehme Symptome wie etwa Tinnitus sein. Die ursprünglich für Säuglinge und Kinder entwickelte Atlastherapie nach Arlen ist eine manualmedizinische Therapietechnik, die von dafür ausgebildeten Ärzten und Ärztinnen auch bei Erwachsenen angewendet wird, um atlasbedingte Störungen zu behandeln.

Im medica-Podcast erklärt Claudia Unterhofer, wie punktgenau sie analysieren beziehungsweise testen kann, ob die sanfte Atlastherapie eine Option zur Behandlung des Schwindels ist. Sie beschreibt im Podcastgespräch all die weiteren Behandlungsmöglichkeiten und auch, welche Rolle der Kiefer beziehungsweise die Kaumuskulatur beim Schwindel spielen kann. Eine überaus bissige.
Aus dem Gleichgewicht.
Im medica-Podcast beschreibt Neurochirurgin Claudia Unterhofer auf wunderbar verständliche Weise die psychische und auch anatomische Komplexität, die hinter unspezifischen Schwindelattacken stecken kann. Etwa, wenn die betroffenen Frauen derart angespannt sind, dass sie in der Nacht die Zähne wild zusammenbeißen, also versuchen, sich durchzubeißen.
„Es ist eine Kampfbereitschaft nach der anderen und das ist dem Körper dann zu viel“, sagt sie. Der Körper wehrt sich und Schwindel kann ein Symptom sein, das die Betroffene auf bittere Art zur Ruhe zwingt.
Der Kaumuskel ist der stärkste aller Muskeln im menschlichen Körper. Dieser Musculus masseter kann eine Kaukraft von bis zu 80 Kilogramm aufbauen. Das klingt nicht nur gigantisch, das ist es auch. Und diese Kraft geht nach hinten los, wenn der Muskel in der Nacht zum Abbau von Spannungen herhalten muss. Dass es kein entspannter Schlaf sein kann, wenn der Kaumuskel die ganze Nacht hindurch Schwerarbeit leistet und in besonders hartnäckigen Fällen sogar Zähne spaltet, ist nachvollziehbar. Genauso nachvollziehbar wie die Folge, dass die derart schwer arbeitenden Muskeln sich verspannen und durch das bereits beschriebene Zusammenspiel der Nerven beziehungsweise der Störung ihrer Bahnen eine Schwindelkaskade in Gang setzen können.
Die Ursache für die Schwindelsymptome erkennen und benennen zu können, ist der erste Schritt, den die Neurochirurgin zusammen mit ihren Patientinnen setzt. Die Erkenntnis, wo das Problem liegt und es zu behandeln, ist aber erst die halbe Miete. Meist bleibt der Schwindel eine Achillesferse für die Betroffenen. Bei Unsorgsamkeit oder schlampigem Umgang mit sich selbst kann er wiederkommen. Entspannung ist in all ihren psychischen und physischen Spielarten ein erfolgreicher Schlüssel, um die Symptome in den Griff zu bekommen – auch durch spezielle Dehnungsübungen, welche die Ärztin den Betroffenen mitgibt. Diese Selbstermächtigung kann, wie Claudia Unterhofer betont, essenziell sein: „Es ist ein Weg heraus aus der Hilflosigkeit.“ Ein Weg – raus aus dem Schwindel.
Alexandra Keller
Stockt das innere Erleben oder geraten Menschen aus dem Lot, nimmt mit der Lebensfreude auch die Lebensqualität ab. Mentale Überforderung kann gerade bei Frauen ganz schön viele Gründe haben. Und nicht weniger – richtig gute – Gründe gibt es dann, die Selbstfürsorge nachhaltig zu aktivieren. Psychologin Melanie Robertson unterstützt derart überforderte Menschen dabei, mentale Schieflagen zu erkennen, gegenzusteuern und wieder zurück ins Lot zu finden. Mit kleinen Schritten und kleinen Zielen.
„Die großen Pläne scheitern ja oft“, sagt sie.
Manchmal ist es das Gegensätzliche, das die Augen öffnet. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) lautet die Definition für mentale, psychische oder geistige Gesundheit so: „Mentale Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann.“ Mag der einen oder dem anderen auch das Wörtchen glücklich darin fehlen, so wurde die Definition wohl klug durchdacht und der oft federleichte, flüchtige, gewissen Umständen zu verdankende, mal kurze, mal längere und jedenfalls hochgradig individuelle Zustand des Glücks bewusst weggelassen. Trotzdem steckt das ganze Leben in dieser Definition – ein gutes Leben eben, ein mental gesundes. Das Wohlbefinden ist der Motor. Läuft er rund, können Lebensqualität und Lebensfreude das auch tun. Stottert er, stottert vieles. „Grundsätzlich umfasst der Begriff mental unser inneres Erleben, also Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Erinnerungen, innere Bilder, Haltungen“, erklärt Melanie Robertson. Während das Physische oft gut messbar und sichtbar ist – wie der Blutdruck beispielsweise oder die Muskelkraft –, bezieht sich das Mentale auf Prozesse, die nicht unbedingt direkt beobachtbar, dafür aber spürbar und höchst wirksam sind. Melanie Robertson ist klinische, Neuro- sowie Gesundheitspsychologin und ihr beeindruckendes Portfolio lässt auf einen
sehr menschenneugierigen Menschen schließen. Ihre Arbeit reicht von akuten Kriseneinsätzen über Neurorehabilitation nach Hirnverletzungen etwa oder neurologischen Erkrankungen bis hin zu Prävention in Organisationen oder auch Begleitung im Bereich von nachhaltiger und vor allem auch praktikabler Lebensstiländerung. Auf Letzteres konzentriert sich Melanie Robertson im Gesundheitszentrum Park Igls und um sich dem Mentalen zu nähern, vergleicht sie den Menschen mit einem Computer. „Der Körper ist die Hardware und die mentale Ebene die Software. Wenn die Software blockiert oder überlastet ist, dann funktioniert auch die beste Hardware nicht mehr ganz zuverlässig. Mentale Gesundheit ist nicht nur eine Zugabe, sondern eine zentrale Grundlage auch für Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und Wohlbefinden“, sagt sie.
Im medica-Podcast – der QR-Code ist Ihr Schlüssel, um daran teilzunehmen – beschreibt Melanie Robertson, wie sie in die große Welt der Psychologie eintauchte und sie mit positiver Neugier für sich eroberte. Sie skizziert auch den Vergleich mit dem Computer weiter und sagt: „Wie bei einem guten
Melanie Robertson ist klinische, Neuro- sowie Gesundheitspsychologin und unter anderem im Gesundheitszentrum Park Igls dafür zuständig, bei den dortigen Gästen eine nachhaltige Änderung ihres Lebensstils anzustoßen.


„Mentale Gesundheit ist nicht nur eine Zugabe, sondern eine zentrale Grundlage auch für Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und Wohlbefinden.“
Melanie Robertson
Computersystem braucht es auch im psychischen Bereich eine Art Antivirenprogramm, also Strategien und Schutzmechanismen, um Schädigendes fernzuhalten und auch die eigene Stabilität zu bewahren.“
Mit der eigenen Stabilität ist das so eine Sache. Beim Gedanken an Stabilität taucht vor dem geistigen Auge sofort das Lot auf, mit dem auf einfache und doch clever die Erdanziehung nutzende Weise gemessen werden kann, ob ein Objekt lotrecht beziehungsweise senkrecht ist. Wenn nun der kluge Volksmund davon spricht, dass jemand aus dem Lot ist, ist er nicht in seiner Mitte und auch nicht stabil. Der immer individuell wackelige Zustand kann auf mentale Überforderung hinweisen. Und mentale Überforderung ist fast schon ein gewaltiges Wortpaar geworden. Es scheint an fast jeder Ecke, jedem Arbeitsplatz und in jedem Wohnzimmer zu lauern, dort eben, wo Menschen aus verschiedensten Gründen aus dem Lot geraten können. „Mentale Überforderung entsteht, wenn die Anforderungen die persönlichen Ressourcen, also die Energiereserven, und die persönlichen Möglichkeiten in dem Moment übersteigen. Wenn die Waage zwischen Belastung und Bewältigung kippt“, erklärt Melanie Robertson. „Es geht also nicht nur um objektive Belastung, sondern vor allem auch um die subjektive Bewertung.“ Was für den einen Menschen eine locker und gut lösbare Herausforderung ist, kann für den anderen eine kaum zu stemmende Überforderung sein. In der Folge können Gefühle von Kontrollverlust, Erschöpfung, Überreiztheit oder dem Totalverlust des Überblicks aufkeimen. Wie sich eine mentale Überforderung zeigt, ist ebenso individuell wie die Auslöser. „Ein Klassiker ist das Glas, das einem runterfällt. Am einen Tag lacht man über die eigene Tollpatschigkeit und an einem anderen Tag könnte man fast in Tränen ausbrechen“, sagt die Psychologin. Dass der Volksmund mit „nervlich am Ende zu sein“ noch eine treffliche Definition für diese unangenehme geistige Situation parat hat, zeigt, dass diese Zustände wohl nicht allzu neu oder ungewöhnlich sind, sondern zum Menschsein gehören. Und als kleine oder auch größere Alarmsignale eine wichtige Rolle in den Leben spielen.
Im medica-Podcast geht Melanie Robertson auch auf die Frage ein, ob die alltäglichen Lebensbelastungen gerade bei
Frauen vermehrt zu mentaler Überlastung führen. „Studien zeigen, dass Frauen öfter über Stress und innere Erschöpfung sowie depressive Symptome berichten“, sagt sie und hält fest: „Frauen tragen sicher in vielen Gesellschaften nach wie vor eine größere Mehrfachbelastung. Das muss man –glaube ich – schon so anerkennen.“
Ja, das muss man wohl. Der gesellschaftliche Druck, den Frauen vielleicht auch noch durch fatale Selbstoptimierungsversuche verstärken, hat eben die Kraft, sie mental zu überlasten. Die auch strukturbedingt schwere Mischung aus Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und Haushaltsorganisation ist nicht ohne – und vielleicht zu viel.
In seinen Körper hineinhören
Männer gehen anders mit Überlastung um, sie äußern sie später und kompensieren eher. Werden Krisen oder Erschöpfungssituationen aber erst in fortgeschrittenem Stadium sichtbar, ist die Behandlung nicht unbedingt leichter. „In Summe kann man sagen, Frauen sind häufiger und früher mit Überlastung konfrontiert, während Männer die Belastungen oft länger unsichtbar mit sich tragen und dadurch ein anderes, aber nicht minder großes Risiko haben“, erklärt die Psychologin.
Der Körper ist ein perfekter Verbündeter, wenn es darum geht, mentale Überlastungs- oder Erschöpfungszustände zu erkennen und Alarm zu schlagen. Wer hinhört, kann sich auf dieses Warnsystem verlassen, doch ist es nicht immer leicht, die Signale als solche zu deuten. „Ganz typisch sind Schlafstörungen. Der Großteil der Schlafstörungen ist – vereinfacht gesagt – psychisch bedingt aufgrund von Belastungen oder Überlastungen“, macht Melanie Robertson darauf aufmerksam, dass dauerhafte Einschlaf- oder Durchschlafprobleme und das direkte Eintauchen in Grübeleien nach dem Aufwachen so wahr- wie ernstgenommen werden sollten. Nicht weniger Aufmerksamkeit verdienen körperliche Beschwerden wie Rücken- oder Bandscheibenprobleme, Nackenverspannungen, Infektanfälligkeiten oder psychisch bedingte Magen-Darm-Beschwerden und natürlich die psychischen Warnsignale selbst, die sich mit Gereiztheit, Kon-

zentrationsschwierigkeiten, innerer Unruhe oder Nervosität, „oft auch in Kombination mit einem Tremor, einem Zittern“, bemerkbar machen. Das Gefühl innerer Leere oder soziale Rückzugstendenzen deuten ebenso deutlich auf ein „viel zu viel“ hin – und schlagen Alarm.
Gesundes Gesamtkonzept.
Im medica-Podcast beschreibt Melanie Robertson nicht nur, wie entscheidend die mentale Gesundheit für ein gutes Leben ist – oder eben umgekehrt – und wie mentale Überforderung das Leben zu beeinträchtigen vermag. Die Psychologin zeigt auch Wege aus den Schieflagen auf und betont – etwa im Zusammenhang mit Burnout und Work-Life-Balance –, dass Arbeit und Privatleben sich gegenseitig ergänzen sollen. „Arbeit kann sehr viel Positives bringen“, betont sie, „allem voran Struktur, natürlich soziale Eingebundenheit, Wertschätzung, Anerkennung, Sinn und auch persönliche Weiterentwicklung. Entscheidend ist eben, dass die Arbeit nicht das ganze Leben dominiert und dadurch andere Lebensbereiche verdrängt, sondern dass sie in ein gesundes Gesamtkonzept eingebettet ist.“
Im medica-Podcast seziert die Psychologin mit feiner Klinge die Begriffe Work-Life-Balance, Resilienz oder auch das Burnout, das einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, psychische Gesundheit aus der Tabuzone zu holen. Und sie grenzt das meist auf arbeits- und belastungsbezogene Erschöpfungssyndrome bezogene Burnout gegenüber der Depression ab. „Bei einer Depression handelt es sich um eine klinisch psychische Erkrankung, die jetzt nicht zwingend mit Arbeit oder Überlastung in Zusammenhang stehen muss“, sagt sie.
Eine klare Einordnung von psychischen Krisen ist natürlich entscheidend für die Psychologin, gezielt helfen und passende Schritte planen zu können: „Für die Betroffenen selbst bringt diese Klarheit oft schon Erleichterung. Eine Krise zu benennen, macht sie greifbar, nachvollziehbar. Plötzlich wird das eigene Leben nicht mehr chaotisch und unkontrollierbar, sondern verstehbar und auch bearbeitbar.“
Ist glasklar geworden, dass der Bogen überspannt wurde und zum Wohl der körperlichen wie mentalen Gesundheit eine Reißleine gezogen werden muss, stehen die Betroffenen gewissermaßen am Beginn eines neuen Lebens. Klingt nach schwerer Geburt. „Ja, der Moment ist tatsächlich oft schmerzhaft. Weil der Moment eben auch Veränderung verlangt“, beschreibt Melanie Robertson den entscheidenden Wendepunkt, „wir sind Gewohnheitstiere, ohne dass ich das jetzt abwertend meine, aber wir machen gerne das, was wir gewohnt sind. Veränderung ist oft nicht ganz so einfach. Aber genau darin steckt eigentlich auch eine große Chance.“ Ein aufmerksames Innehalten, eigene Grenzen anerkennen, Prioritäten sortieren, Belastungsfaktoren identifizieren und Unterstützung annehmen sind die ersten Herausforderungen eines mentalen Resets. Melanie Robertson: „Es sind eben oft diese kleinen Veränderungen, die im Alltag entscheidend sind – dass man sich kleine Schritte und Ziele setzt. Die großen Pläne scheitern ja oft an der Umsetzung.“
Für ein Jahr auf eine Insel auszubrechen oder auf eine Hütte in den Anden, mag für kurze Momente die Lösung aller Mühsalprobleme sein. Alltagstauglich sind sie nicht. Zum kleinen Einmaleins an Zielsetzungen und Maßnahmen zählen vielmehr kleine, bewusst genutzte Pausen – vielleicht verbunden mit einem Spaziergang – gesunde Routinen oder ein feiner Schlaf. „Wir schlafen heute um eineinhalb Stunden weniger als noch in den 1960er-Jahren. Eineinhalb Stunden, das ist doch eine ganz nette Menge“, stellt Melanie Robertson fest und macht auf die elektronischen Schlafräuber aufmerksam, die leicht kontrolliert oder eliminiert werden können, wenn der Wille dazu vorhanden ist.
Eine schwer unterschätzte Stimmungskanone – im positiven wie im negativen Sinn – ist die Ernährung. Das ist das Themengebiet, bei dem Melanie Robertson regelrecht das Herz aufgeht: „Wir können Schicksalsschläge nicht oder zumindest meistens nicht verhindern und auch anderen Krisen nur bedingt ausstellen. Aber die Ernährung ist etwas, wo wir Einfluss nehmen können, und die Ernährung spielt einfach eine viel größere Rolle für unsere psychische Gesundheit, als man lange angenommen hat.“ Heute ist bekannt, dass was wir essen nicht nur den Körper, sondern auch die Stimmung, die Stressregulation und sogar die kognitive Leistungsfähigkeit beeinflusst. Die so genannte Darm-Hirn-Achse ist eine faszinierende Verbindung, die psychische Gesundheit in ein ganz neues Licht setzt – nicht zuletzt, weil die Menschen die eigene Ernährung in der Hand haben und damit auch eine wirkmächtige Handhabe, um mentalen Dysbalancen vorzubeugen und die psychische Gesundheit ganz direkt und einfach zu beeinflussen. Mit der richtigen Ernährung. Melanie Robertson: „Der Darm beherbergt Milliarden von Bakterien, kleine Mitbewohner, die Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin oder GABA produzieren, und die sind für unsere Stimmung, die Stressregulation mitverantwortlich.“ Etwa 90 Prozent des als Glückshormon bekannten Serotonins, das eine Vielzahl physischer und psychischer Funktionen steuert, befinden sich im Darm. Und nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen wird, etwa in Schokolade. Tja.
Auf vielen physischen und psychischen Ebenen überraschen Herausforderungen ein Leben lang. Um sie zu meistern und auch mentale Überforderungen zu vermeiden, ist Selbstfürsorge ein passender Schlüssel. „Selbstfürsorge heißt im Grunde, gut für sich zu sorgen, um auch langfristig leistungsfähig, empathisch und beziehungsfähig zu bleiben“, betont Melanie Robertson und stellt klar: „Selbstfürsorge ist eigentlich kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für psychische und körperliche Gesundheit und vor allem auch für ein gutes Miteinander.“ Und für gute Balancen.
Alexandra Keller

Dr. Daniela Almer, MBL ist Notarpartnerin in Innsbruck.
Das Erbrecht regelt die Rechtsnachfolge einer verstorbenen Person. Man unterscheidet die gesetzliche von der testamentarischen Erbfolge oder die Erbfolge durch Erbvertrag.
Gesetzliche Erbfolge
Sie gilt, wenn kein (gültiges) Testament existiert, nicht das gesamte Vermögen von einer letztwilligen Verfügung umfasst ist oder eingesetzte Erben wegfallen (zb. Verzicht oder Tod).
• Ehe-/eingetragene Partner:in mit Kindern: Ehe-/eingetragene Partner:in erhält 1/3, Kinder 2/3. Adoptiv- und uneheliche Kinder sind gleichgestellt. Verstorbene leibliche Kinder werden durch ihre Nachkommen repräsentiert.
• Kinderloses Paar: Ehe-/eingetragene Partner:in erbt 2/3, Eltern 1/3.
• Lebensgefährt:innen: Sofern Kinder vorhanden sind, erben diese. Ohne Nachkommen erben Eltern oder andere Verwandte. Fehlen solche, kann dem/der Lebensgefährten:in unter bestimmten Voraussetzungen ein außerordentliches Erbrecht zukommen.
Testament und Erbvertrag
Damit lässt sich die Nachfolge individuell gestalten. Eine Einschränkung besteht im Pflichtteilsrecht. Ehe-bzw. eingetragene: Partner:in sowie Kinder (Kindeskinder) haben ein sogenanntes Noterbrecht sodass ihnen jedenfalls ein gewisser Teil (Pflichtteil) der Verlassenschaft zuzukommen hat. Bei Fragen zum Erbrecht oder Testament unterstützt Sie Ihr:e Notar:in – damit Ihr letzter Wille zählt.
Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg
Maximilianstraße 3, 6020 Innsbruck ihr-notariat.at

Findet man das Kind bewusstlos auf, braucht es zuerst einen Bewusstseinscheck. Man öffnet die Kleidung, um den Brustkorb freizulegen, dann geht man nach dem Motto „Hören, sehen, fühlen“ vor: Man hört, ob es ein Atemgeräusch gibt, man fühlt mit der Wange, ob Atem aus dem Mund strömt, und man schaut auf den Brustkorb, ob er sich hebt und senkt. Man kann auch in den Füßchen einen Schmerzreiz setzen, um zu sehen, ob das Kind reagiert.

Dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, ist auch dann entscheidend, wenn eine Erkrankung oder ein Notfall eintritt. Derart herzrasende Situationen können Eltern oder Betreuende verunsichert verzweifeln lassen oder gar in Schockstarre versetzen. Um genau das zu verhindern und ihnen Sicherheit, Wissen und Können mitzugeben, die sie im Ausnahmemoment schnell und richtig handeln lassen, bietet Daniela Scholer Erste-Hilfe-Kurse für Babys und Kleinkinder an. „Wenn man das im Kopf und praktisch trainiert hat, traut man sich“, sagt sie und betont: „Mit Erster Hilfe kann ich ganz viel bewirken.“
„Das Wichtige ist, zu handeln, weil die Sekunden zählen, und dann ist das meiste eh schon gerettet.“
Daniela Scholer
Adrenalin. Auf Gefahr reagiert der Körper damit, dieses Stresshormon auszuschütten und den Menschen in den so genannten Flightor-fight-Modus zu versetzen. Der Herzschlag steigt, der Blutdruck auch und der Körper mobilisiert ungeahnte Kräfte, um die bedrohliche Situation zu meistern. Die Natur hat sich echt viele clevere Dinge einfallen lassen, um das Überleben der Menschen zu sichern. Adrenalin ist auf jeden Fall eines davon. Eines, das Eltern allzu bekannt sein dürfte. Vor allem dann, wenn ihr Kind den Alarm auslöst, der den Körper mit dem Hormon flutet – weil es vom Wickeltisch gefallen ist, das Körperchen vom Fieberkrampf verzerrt wird, ein Karottenstück im Hals stecken geblieben ist, das Heiße aus der Tasse auf seinen Oberschenkelchen landete, es überraschend den Wohnzimmerschrank erklimmen wollte oder nach einem Sturz vom Dreirad bewusstlos liegen geblieben ist. Schier endlos scheint die Liste der Situationen zu sein, bei denen das sonst so herrliche Größerwerden und Weltentdecken einen kleinen
Dämpfer erfährt, bei dem Trost allein zu wenig ist. „Solche Situationen machen einem Angst“, weiß Daniela Scholer, „die Eltern haben immer Angst, etwas falsch zu machen.“ Der viel zu große Respekt davor, nicht das Richtige zu tun oder die Notfallsituation vielleicht sogar zu verschärfen, mag nachvollziehbar sein. Hilfreich ist er nicht. „Mit Erster Hilfe kann ich ganz viel bewirken. Das Wichtige ist, zu handeln, weil die Sekunden zählen, und dann ist das meiste eh schon gerettet“, gibt Daniela Scholer dem Drama eine positive Wendung, ja ein Happy End. Ein Happy End, das trainiert werden kann.
Daniela Scholer ist erfahrene Kinder- und Jugendkrankenpflegerin, hat von 2007 bis 2021 als Neointensiv-Kinderkrankenpflegerin auf der Frühgeborenenstation der Universitätskliniken Innsbruck gearbeitet und unzählige Zusatzausbildungen rund um Babys – ihren gesunden Schlaf etwa, das Stillen oder die Beikost – absolviert. Sie ist selbst Mutter von zwei Jungs und mit der Gründung von Nestlingszeit hat sie

sich voll und ganz der Baby- und Kleinkindberatung verschrieben. „Eltern haben viele Fragen, das weiß ich auch von mir selber“, erzählt sie.
Weil ihr Zweitgeborener ein miserabler Schläfer gewesen war, drängte sich eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Babyschlaf geradezu auf. „Ich habe mit unserer Kinderärztin gequatscht und sie sagte, das sei wirklich ein großes Thema – wo in der Kinderarztpraxis nicht immer genug Zeit ist, alle Fragen zu beantworten“, erinnert sich Daniela Scholer an den Auslöser dafür, ihr Beratungsunternehmen zu gründen und die Lücke, von der die Kinderärztin gesprochen hatte, nicht nur im Zusammenhang mit Babyschlaf, sondern mit allen essenziellen Babyfragen beziehungsweise den Antworten darauf zu füllen.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie dabei sein – etwa, wenn Daniela Scholer im Gespräch zurückblickt in ihre Zeit auf der Neointensiv-Station, wo Frühgeborene oder kranke Neugeborene ihr Leben im wahrsten Sinn des Wortes intensiv beginnen. Sie berichtet über die schönen Fortschritte in Richtung familienzentrierte und entwicklungsfördernde Pflege, die auch den Eltern Selbstvertrauen gibt. „Sie sind Experten Ihres Kindes“, sagt sie.
Im Erste-Hilfe-Kurs wird an der Puppe unter anderem die richtige Herzdruckmassage geübt. Im Fall des Falles ist es Gold wert, die dafür richtige Position des Kindes oder den richtigen Druck der Finger abrufen zu können.

Daniela Scholer ist Kinder- und Jugendkrankenpflegerin, hat als Neointensiv-Kinderkrankenpflegerin auf der Frühgeborenenstation der Universitätskliniken Innsbruck gearbeitet und zahlreiche Zusatzausbildungen rund um Babys absolviert. Sie ist selbst Mutter von zwei Jungs und hat sich mit der Gründung von Nestlingszeit in Innsbruck voll und ganz der Baby- und Kleinkindberatung verschrieben.
Wissen, was zu tun ist
Als Expertin für alle Baby- und Kleinkind-Themen, die Eltern bewegen, wurde Daniela Scholer im Rahmen der Beratungen oder auch im Freundeskreis immer wieder mit Fragen konfrontiert, wie: Was tun, wenn das Baby einen Fremdkörper verschluckt, und was, wenn etwas im Hals stecken bleibt? Was tun, wenn das Baby Fieber hat? Was, wenn das Kind auf den Kopf fällt? Wann den Notruf wählen? Daniela Scholer: „Da dachte ich, es wäre doch ideal, einen umfassenden Erste-Hilfe-Kurs zu machen, wo nicht nur die Notfallsituationen Thema sind, sondern auch alles andere. Damit die Eltern gestärkt sind und wissen, was zu tun ist.“
Eine gute Idee war das und mit Kinderärztin
Karina Wegleiter, die im September 2025 ihre neue Praxis für Kinder- und Jugendheilkunde in Mötz eröffnete, hat die Kinderkrankenpflegerin auch rasch eine perfekte Partnerin gefunden: „Wir kennen uns von der Neointensiv-Station, es war immer ein wunderbares Zusammenarbeiten. Sie war sofort dabei.“ Die fachlichen Wissens- und praktischen Handlungsanleitungen, welche das kindernotfallkundige Team im Rahmen der Erste-Hilfe-Kurse seither vermittelt, haben stets das Ziel, den Kursteilnehmenden – ob Eltern, Großeltern oder Betreuungspersonen – den Stress zu nehmen und ihr Selbstvertrauen in Notfällen zu stärken, „sodass sie sich trauen, beherzt zu handeln“.
Beherzt handeln ist das ultimative Motto in Momenten, die nach Erste Hilfe schreien.
Dabei Ruhe zu bewahren, wird zwar ebenso stets betont, doch ist das echt leichter gesagt oder geschrieben als getan. Wenn urplötzlich Stress die Szenerie beherrscht und die eigene emotionale Beteiligung alles andere als Coolness auslöst, rät Daniela Scholer dazu, kurz durchzuatmen, die Situation abzuchecken und dann zu handeln. So zu handeln eben, wie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Und zwar nicht im Kurs für große Menschen, sondern dem Kurs für Babys und Kleinkinder. Denn die sind keine kleinen Erwachsenen. „Die Unterschiede sind enorm. Kinder haben eine ganz andere Anatomie, eine andere Physiologie – beispielsweise viel kleinere Atemwege, eine schnellere Herzfrequenz, eine schnellere Atmung“, zählt Daniela Scholer auf. Und atemlos geht es weiter: „Bei den Kindern kommt

Bei Erwachsenen wird im Fall einer Blockade der Atemwege der so genannte Heimlich-Griff angewandt. Bei Babys nicht. Ihnen schlägt man beherzt auf den Rücken.
der Notfall schneller. Wir haben weniger Zeit. Bei schweren Notfällen – wenn’s um Basic Life Support, also Wiederbelebung, geht – handelt es sich bei Kindern meistens um ein Atem-, bei Erwachsenen eher um ein Herzproblem.“ Die Unterschiede zwischen Erwachsenen und Babys führen beispielsweise auch dazu, dass es bei Babys in Folge von Verbrennungen oder Verbrühungen schneller zu einem fulminanteren, also intensiveren Verlauf kommen kann, oder dass der Kinderkörper einen anderen Schwerpunkt hat, was in Verbindung mit Wasser fatale Folgen haben kann.
Im medica-Podcast erzählt Daniela Scholer, warum sie im Zusammenhang mit den auf Social-Media-Kanälen in großer Zahl angebotenen Utensilien und Hilfsmitteln, mit denen Babys oder Kinder überwacht werden können, zu Vorsicht und Zurückhaltung rät. „Besser ist, das Kind kennenzulernen, zu beobachten, zu wissen, was tut ihm gut. Diese Tools stehen nicht in den Leitlinien, werden von offizieller Stelle nicht empfohlen – wir tun das auch nicht“, stellt sie klar.
Gut zu beobachten kann ein Schlüssel dafür sein, Notfälle zu verhindern. Prävention ist auch im Leben mit Babys und Kleinkindern ein entscheidendes Stichwort. Dass Gefahrenquellen wie Treppen, Fenster, wackelige Regale, Schubladen mit giftigen Putzmitteln oder Ähnliches gesichert beziehungswei-
se verschlossen werden sollten, versteht sich wahrscheinlich von selbst. Doch gibt es auch Gefahrenquellen, an die möglicherweise nicht oder zu spät gedacht wird. „Die Kinder sind oft schneller, als wir denken. Vom Wickeltisch runterfallen passiert beispielsweise immer noch häufig“, sagt Daniela Scholer. Und sie erklärt: „Irgendwann ist halt der Tag da, an dem sie sich zum ersten Mal drehen, doch die Eltern haben es noch gar nicht so präsent im Kopf, dass das jetzt so weit sein könnte.“ Weil die Kinder immer zu ihren Eltern wollen, kann ein unbedachtes sich Abwenden vom wickelbereiten Spross zum gefürchteten Absturz führen. Immer die Hand drauf, lautet da der Rat der Expertin. Und werden die Kleinen allzu mobil, sollten sie einfach am Boden gewickelt werden. Daniela Scholer: „Wir müssen immer einen
VIELMEHR, WEIL ES DIE
AUFMERKSAMKEIT DER
BETREUUNGSPERSON VERSCHLINGT.
Schritt vorausdenken.“ Wo könnten sie raufklettern? Wo runterfallen? Kippt der Kinderwagen, wenn sie allzu lustig darin turnen? Oder hängt das Kabel des Wasserkochers tief genug, dass die Kinderhand daran ziehen könnte? Bei den potenziellen Gefahren auf Rädern ist Daniela Scholer kaum zu stoppen, wenn sie den Blick der Eltern schult: „Da gibt es sehr rasante Bobbycar-Fahrer, die sich da runterstürzen. Das kann es zu intensiven Stürzen kommen. Es gehören Helme getragen, ob am Bobbycar, am Rad, am Roller oder – oh Gott – am Elektroroller. Der Helm ist ganz wichtig.“
Eine total unterschätzte Gefahrenquelle ist das Handy. Nicht etwa, weil das Kleinkind es verschlucken könnte, sondern vielmehr, weil süchtiges oder „nur mal schnelles“ Scrollen am Bildschirm die Aufmerksamkeit der Betreuungsperson verschlingt. Badeunfälle von Kindern sind häufig auf handybedingte Ablenkung zurückzuführen. „Da muss man sich an der Nase nehmen“, sagt Daniela Scholer und hält – nach Hause zurückgekehrt – fest: „Kinder sind sehr kreativ. Es macht Sinn, durch die Wohnung zu gehen und bewusst zu schauen.“
Im medica-Podcast gelingt es der Baby- und Kleinkind-Expertin auf außergewöhnlich sympathische Art, ihr Wissen über die gängigsten Baby- und Kleinkind-Notfälle zu vermitteln. Sie liefert Handlungsempfehlungen etwa im Zusammenhang mit Fieber, Fieberkrampf, Pseudokrupp oder den richtigen Erste Hilfe-Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit des Babys und betont den Wert des Trainings im Erste-Hilfe-Kurs: „Der praktische Teil ist essenziell.“
Man kann noch so viel darüber hören oder lesen – den Umständen entsprechend zu
handeln, gelingt erst dann, wenn die Handgriffe „sitzen“. Das Gedächtnis der Muskeln kann ein wunderbarer Schatz sein, wenn der Kopf vom inneren Blaulicht leicht überfordert ist. „Jeder weiß, wenn man etwas einmal gemacht hat, kann man es besser. An das eigene Tun erinnert man sich am meisten“, sagt Daniela Scholer. Wenn das Baby aus welchem Grund auch immer plötzlich bewusstlos ist und eine Herzdruckmassage notwendig wird, gibt das auch mit den Fingern gefühlte Training, das im Erste-Hilfe-Kurs an einer Puppe geübt wird, jene Sicherheit, die das beherzte Handeln erst möglich macht. In dem Moment ist es Gold wert, die dafür richtige Position des Kindes oder den richtigen Druck der Finger einfach abrufen zu können.
Nicht minder wertvoll ist diese Abrufbereitschaft, wenn ein Fremdkörper die Atemwege des Kindes blockiert, es keine Luft mehr bekommt und blau anläuft. Bei Erwachsenen wird in dieser Situation der so genannte Heimlich-Griff angewendet. Bei Babys nicht. „Da gibt es diese fünf Rückenschläge – im Fall auch im Wechsel mit fünf Thoraxkompressionen. Da zeigen wir, wie man das richtig macht“, sagt Daniela Scholer und betont: „Erst wenn die Kinder größer sind, ist der Heimlich-Griff anzuwenden.“
Wer derart klipp und klar gesagt und praktisch gezeigt bekommt, wie’s richtig geht und was im Notfall wirklich wichtig ist, kann das Familienleben weit sorgloser genießen. Im Wissen darum, gewappnet zu sein – und den Adrenalinschub bestmöglich nutzen zu können. „Wissen schützt“, schreibt Daniela Scholer auf der Homepage der Nestlingszeit. Wie recht sie doch hat.
Alexandra Keller

Erste-Hilfe-Rüstzeug.
Im medica-Podcast gibt Daniela Scholer den Zuhörer:innen nicht nur ein theoretisches Rüstzeug mit, um in Kindernotfällen das Richtige zu tun. Sie verrät auch, warum Zwiebel, Thymian oder Kochsalzlösung unbedingt in die Kinder-Hausapotheke gehören oder warum sie und Kinderärztin Karina Wegleiter den Teilnehmenden der ErsteHilfe-Kurse die Notfalltasche von Dr. Till ans Herz legen: „Da ist alles drin, was man braucht, und das Geld dafür wird in die Forschung investiert.“
www.nestlingszeit.at

Sieben Jahre lang arbeitete die österreichische Regisseurin und Produzentin Karin Berghammer als Hebamme. „Der Transformationsprozess, durch den gebärende Frauen hindurchgehen, hat mich sehr beeindruckt. Während der Geburt habe ich immer wieder erlebt, dass da so etwas wie die Wahrheit herauskommt“, sagt sie. Diese Momente der Wahrheit prägen zum Teil auch das Filmschaffen der zweifachen Franz-Grabner-Preisträgerin. Ihr Kurzfilm „Midwifery: knowledge, skills and practices“ etwa hat dazu beigetragen, dass die UNESCO das Hebammenwesen 2023 in die Repräsentative Liste des Immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen hat. „Eine Notwendigkeit“, ist Karin Berghammer überzeugt.
„Der Idealzustand wäre eine Eins-zu einsBetreuung, also dass jede Frau eine Hebamme hat, die sie durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett begleiten kann.“
Karin Berghammer
Es ist ein Meilenstein und doch ist es bizarr. Seit Urzeiten begleiten, schützen und unterstützen Hebammen Frauen vor, während und nach der Geburt. Der Beruf der Hebamme ist einer der ältesten Frauenberufe und auf der ganzen Welt ist es ihr fundamentales medizinisches, anatomisches, geburtshilfliches und emotionales Wissen, das einen essenziellen Beitrag für Leben und Werden, ja den Fortbestand der Menschheit selbst leistet. Denn Hebammen stellen den immer epochalen Übergang des Kindes vom Mutterleib in die Welt und jenen von der Schwangerschaft zur Mutterschaft sicher.
Es mag an einem vielleicht sogar ehrenhaften oder aber an einem über die Jahrhunderte erblindeten Selbstverständnis gegenüber diesem Wissensschatz liegen, dass es so lange dauerte, bis das Hebammenwesen als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt und in die Repräsentative Liste der UNESCO aufgenommen wurde. Nach fast 500 anderen Traditionen aus allen Weltregionen – darunter der spanische Flamenco, die Falknerei, die Wanderweidewirtschaft oder die neapolitanische Kunst des Pizzabackens.
2023 war es jedenfalls so weit. Nach fünf Jahren großen Engagements mehrerer nationaler und internationaler Hebammenverbände, die die Nominierung initiiert hatten, wurde das Hebammenwesen von der UNESCO geadelt. Nicht unwesentlich dazu beigetragen hat der die Nominierung begleitende Kurzfilm „Midwifery: knowledge, skills and practices“. Midwifery ist der englische Begriff für Hebammenwesen und für den Film, der Hebammen aus zahlreichen Ländern zeigt, sie erzählen und mit ihrem Wissen auch die Weisheit des Berufes strahlen lässt, zeichnet die österreichische Regisseurin und Produ-
zentin Karin Berghammer verantwortlich und sie sagt: „Für mich war es ganz toll, das machen zu dürfen. Dass das Hebammenwesen tatsächlich aufgenommen wurde, ist eigentlich eine Notwendigkeit.“ Karin Berghammer weiß, wovon sie spricht. Bevor der Film ihre Kreativarena für Antworten auf essenzielle Fragen des Lebens wurde, war sie selbst als Hebamme tätig.
Im medica-Podcast – über den QR-Code können Sie am Gespräch teilnehmen – beschreibt Karin Berghammer, warum sie beschlossen hatte, Hebamme zu werden. Der recht geburtenreiche Lebensabschnitt auf einem Bauernhof war ein Auslöser, ernüchternde und ihren feministischen Kampfgeist kitzelnde Erlebnisse in einem Krankenhaus ein anderer: „Fragen waren da überhaupt nicht erlaubt. Da dachte ich, das kann nicht sein. Das ist nicht fair“, sagt sie.
Die Suche nach dem, was dahintersteckt, was wirklich ist, ist eine starke Triebfeder der gebürtigen Oberösterreicherin. Dass sie vor dem, was dahintersteckt und wirklich ist, nicht zurückschreckt, darf als starke Charaktereigenschaft bezeichnet werden. Und in ihrer Fähigkeit, das Ungesehene oder Ungehörte zu entdecken, sichtbar, hörbar und in Filmen erlebbar zu machen, steckt jedenfalls eine starke gestalterische Kraft der Regisseurin, die teils auch in ihrer Hebammenzeit wurzelt. „Während der Geburt habe ich immer wieder erlebt, dass da so etwas wie die Wahrheit herauskommt. Keine Frau macht einem etwas vor in diesem Moment“, erzählt sie von Aufgeladenem, Emotionalem und Schönem, das eine Geburt begleitet – und sie erzählt: „Wehen sind eine ordentliche Herausforderung. Es hat mich beeindruckt, wie die Frauen während der Geburt lernen, damit umzugehen, wie sie die
Karin Berghammer ist Regisseurin und Produzentin. Bevor sie das wurde war sie Hebamme. Ihre diesbezüglichem Erfahrungen hat sie unter anderem in einen Film gepackt, der dazu beitrug, dass das Hebammenwissen seit 2023 in die Repräsentative Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.
Herausforderung bewältigen und wie schön sie dann geworden sind, in diesem Prozess.“
Raum geben
Weil keine Geburt gleich, jede Frau anders und Karin Berghammer stets der Wahrheit hinterher war, sammelte sie in ihrer Zeit als praktizierende Hebamme nicht nur unzählige Eindrücke, sondern entdeckte auch, was den Frauen fehlt beziehungsweise was ihre Bedürfnisse sind. „In dem kleinen Landkrankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, haben wir versucht, intime Situationen für die Frauen zu schaffen, und wir haben es den Frauen ermöglicht, ihre Kinder in jeder erdenklichen Position zu bekommen“, erinnert sie sich. Es waren die 1980er-Jahre. Die Frauenbewegung war in voller Fahrt, auch im Bereich der klinischen Geburtshilfe bewegte sich langsam was und Karin Berghammer engagierte sich, indem sie ausgerüstet mit einer Diaserie in anderen Krankenhäusern Werbung für die Vorzüge von vertikalen Gebärpositionen machte. „Um die Idee eben auch praktisch in die Köpfe reinzubringen, dass diese aufrechte Gebärposition physiologisch viel sinnvoller ist und dass sie hilft, viel Pathologie zu vermeiden.“ Flach auf dem Bett liegend die Kraft der Wehen durch sich durchzulassen, ohne die Möglichkeit, die Schwerkraft zu nutzen, ist von allen Gebärpositionen nachgewiese-

KARIN BERGHAMMER HAT DIE
FÄHIGKEIT,
ODER UNGEHÖRTE ZU ENTDECKEN, SICHTBAR, HÖRBAR UND IN FILMEN
ERLEBBAR ZU MACHEN.
nermaßen die schwierigste für Mutter und Kind. „Abgesehen vom Kopfstand“, meint Karin Berghammer, „der wäre physiologisch noch ungünstiger.“
Im medica-Podcast erzählt Karin Berghammer davon, dass die Lust der Ärzte und Hebammen auf eine am Boden kniende Position verständlicherweise nicht allzu groß war, weswegen sie zusammen mit Iris Podgorschek ein Gebärbett entwickelte, das es den Frauen erlaubt, ihre Position selbst auszusuchen. „Das Bett ist super, aber viel wichtiger ist die Person, die die Gebärende begleitet – die muss es ermöglichen, ihr den Raum geben und das Gefühl, dass sie frei ist, ihren eigenen Impulsen zu folgen“, sagt sie.
Nachdem die beiden Erfinderinnen das internationale Patent für das Gebärbett erhalten hatten, folgte Karin Berghammer ihren Impulsen, die sie erst rund um die Welt und dann in die Filmwelt führten. Auf die Frage,
ob so eine Geburt ein recht gutes Vorbild für den perfekten Spannungsbogen einer Geschichte ist, entdeckt sie durchaus Parallelen zwischen den Frauen, die durch die Bewältigung des Schmerzes eine Transformation erfahren, und den Protagonist:innen in Spielfilmen, wo der Konflikt eine Schlüsselrolle spielt und sie irgendwohin bringen soll. „… irgendwo anders, als sie am Anfang waren. Das ist etwas Transformatives, etwas Kathartisches, das beide Gebiete gemeinsam haben“, sagt die Regisseurin, deren Erfahrung als Hebamme ausschlaggebend wurde, mit dem 1995 veröffentlichten populärwissenschaftlichen Film „Gebären und Geboren werden“ einen Klassiker zu schaffen.
Der damalige Primar der Universitätsklinik für Frauenheilkunde der MedUni Wien wollte für die Studierenden einen Film über die Physiologie der Geburt. „Er hat sich gedacht, da haben wir ja jemanden, die fragen wir“, erzählt Karin Berghammer. Mit dem Film ist
ihr – basierend auf dem damaligen Wissen darüber, was die Physiologie einer Geburt unterstützt – ein Grenzgang zwischen den emotionalen und physiologischen Seiten einer Geburt gelungen. Der Film, der dann nicht nur im Medizinstudium, sondern auch in Geburtsvorbereitungskursen gezeigt wurde, hatte durchaus eine subversive Seite. Für die Dreharbeiten hatte Karin Berghammer intime Raumsituationen geschaffen, welche die Frauen in der Klinikrealität nicht vorfanden. „Durch die Beschwerden der Frauen, die so ein Setting haben wollten wie im Film und das auch gefordert haben, hat sich da wirklich etwas verändert“, weiß sie. Für „Gebären und Geboren werden“ ließ die Regisseurin den Weg des kindlichen Kopfes durch das Becken in 3D animieren. Die Tatsache, dass der Film in neun Sprachen übersetzt wurde und auch 30 Jahre später noch an Universitäten gezeigt wird, macht ihn zum Klassiker und Karin Berghammer sagt: „Das war politisch tatsächlich der wirksamste Moment meines Lebens.“
Im medica-Podcast macht Karin Berghammer darauf aufmerksam, was gerade schiefläuft in der österreichischen Welt der Gebärenden und der Hebammen. Die Kaiserschnittrate von 32,5 Prozent gehört genauso dazu wie der massive Hebammenmangel, der laut Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich, zu „unzumutbaren Bedingungen für Gebärende, Babys und Hebammen“ führt. Karin Berghammer ortet zudem zu wenig Wertschätzung gegenüber dem Hebammenwesen, „und dass Frauen damit die Chancen nicht nützen können, die ihnen bei diesem Geschehen geboten werden“.
Das Gesundheitswesen war und ist immer und überall ein Spiegel der Politik und der Interessen, die sie verfolgt. Das Interesse daran, Frauen in einer der prägendsten Zeit ihres Lebens durch ein angemessenes und wertschätzendes Hebammennetz zu unterstützen, scheint im ewigen Streit um die Mittel enden wollend zu sein. In Österreich wurden im Sommer 2025 rund 2.900 Hebammen und 2024 insgesamt 76.852 Geburten gezählt. „Der Idealzustand wäre eine Eins-zu eins-Betreuung, also dass jede Frau eine Hebamme hat, die sie durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett begleiten kann“, sagt Karin Berghammer im Einklang mit dem

„Es hat mich beeindruckt, wie die Frauen während der Geburt lernen, damit umzugehen, wie sie die Herausforderung bewältigen und wie schön sie dann geworden sind, in diesem Prozess.“
Karin Berghammer
DAS
Österreichischen Hebammengremium, der Standesvertretung der Hebammen, das ebendiese verlässlichen Rahmenbedingungen vehement fordert. Die aktuellen Zahlen deuten schon darauf hin, dass eine Eins-zu-eins-Betreuung der werdenden Mütter ganz und gar nicht garantiert werden kann. Mit ein Grund ist eine Diskrepanz zwischen den Stellenplänen der geburtshilflichen Abteilungen und dem tatsächlichen Personalbedarf. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Hebammen unter dem Arbeitsdruck das Handtuch werfen, und dem voraussehbaren Aderlass durch die nahenden Pensionierungen droht die Lage der Gebärenden nicht besser zu werden. „Wenn jemand im Sport eine Hochleistung erbringen muss, bekommt diese Person auch einen Coach zur Seite, wenn’s um was geht. Bei jeder Geburt geht es wirklich um was, es geht um Leben oder Tod, aber auch darum, wie die Frau aus diesem Transformationsprozess herauskommt. Ist sie gestärkt oder hat sie das Gefühl, die anderen haben’s für sie gemacht“, unterstreicht die Regisseurin ihre Forderung nach dem Idealzustand.
Hebammenkunst
Mit ihren intensiven Einblicken in die globale Hebammenarbeit hat sich bei ihr die Erkenntnis verfestigt, „dass die Bedingungen für Frauen immer sehr von der Stellung der Frau in der Gesellschaft abhängen und dass man die proaktiv gestalten muss. Sonst passiert etwas mit uns, worüber wir dann keine Kontrolle haben.“ Zusammen mit der gesellschaftlichen Stellung der Frauen war diese Kontrolle allzu gerne Spielball der Macht beziehungsweise der Mächtigen. In der Geschichte der Hebammenkunst spiegelt sich das wider, wurde ihre Arbeit doch meist streng reglementiert, früh schon aber auch als Fachberuf anerkannt. Im Alten Testament heißt es beispielsweise im 2. Buch Mose: „Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürch-
teten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte.“ Für den griechischen Philosophen Sokrates spielten Hebammen aus dem besten Grund eine recht zentrale Rolle. „Seine Mutter war Hebamme gewesen, er selbst nannte sich Geburtshelfer der Erkenntnis und die Technik der dialogischen Gesprächsführung nannte er Mäeutik, also Hebammenkunst“, weiß Karin Berghammer.
Zu Sokrates’ Zeiten im antiken Griechenland zählte zum Aufgabengebiet der Hebammen neben der Anregung oder Reduzierung der Wehen und der Entbindung eines Kindes auch die Ehevermittlung und der Schwangerschaftsabbruch. Dass Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche traditionell zum Können von Hebammen zählten, rückte sie vor allem im europäischen Mittelalter ins brutale Zwielicht der christlichen Moralvorstellungen. „Niemand schadet dem katholischen Glauben mehr als die Hebammen“, hatte etwa der Autor des berüchtigten Hexenhammers festgehalten, mit dem die Hexenverfolgungen legitimiert wurden, deren frauenfeindlicher Irrsinn jeder Beschreibung trotzt. Weit heiterer liest sich da schon eine preußische Verfügung aus dem Jahr 1568, mit der Hebammen verboten wurde, betrunken zu arbeiten. In der frühen Neuzeit lieferten Geburten oft Anlässe, Feste zu feiern. Mögen die Gründe für diese Gelage auch mehr mit Stammhaltergedanken zu tun gehabt haben als mit der vollbrachten Höchstleistung der Frauen, so verdienen Geburten genau das. Ein Fest für die Mütter. Im Film „Midwifery: knowledge, skills and practices“ stellt eine Hebamme aus Zypern fest, dass eine Geburt „das Überschreiten der eigenen Grenzen und kein einfacher Prozess, sondern ein göttlicher Akt ist“. Schöne Worte aus einer schönen Dokumentation von Karin Berghammer, die dazu beigetragen hat, das Hebammenwesen als immaterielles Weltkulturerbe anzuerkennen. Ein Meilenstein und doch bizarr spät.
Alexandra Keller

Zum Podcast
Essenzielle Fragen. Im medica-Podcast erzählt Karin Berghammer sehr bildund lebhaft von den Geburten ihrer eigenen Kinder, von ihrer Überzeugung, bereits intrauterin Feministin gewesen zu sein, und von ihrem Leben als Filmschaffende. Für ihre Filme „Leben für den Tod“ und „Weg damit – Die Kunst der Entsorgung“ wurde sie beispielsweise 2020 und 2023 mit dem Franz-Grabner-Preis in der Kategorie Bester TVDokumentarfilm ausgezeichnet. Die Regisseurin arbeitet auch an einer Krankenhausserie, die von zwei jungen Hebammen handelt und in den frühen 1980er-Jahren spielt, „… als die Geburtshilfe komplett männlich dominiert war, was ja eigentlich absurd ist. Es geht um den Frauenkörper, doch Frauen hatten überhaupt nichts zu melden.“
Bei CORTHEA Innsbruck geht es um den Menschen als Ganzes.
Gesundheit ist mehr als das Fehlen von Krankheit. Sie ist Ausdruck von innerer Balance, Lebendigkeit und Selbstfürsorge – besonders in einer Zeit, in der viele Frauen zwischen Karriere, Familie und Selbstverwirklichung täglich Höchstleistungen erbringen. Im CORTHEA Holistic Health Club in Innsbruck wird Gesundheit neu definiert. Hier trifft moderne Diagnostik auf tiefgehende Achtsamkeit, Wissenschaft auf Intuition. Unter der Leitung von Irina Juen, Health Journey Director und Expertin für Epigenetik, Longevity und psychoemotionale Gesundheit, entsteht ein Ort, an dem Frauen lernen, ihre Gesundheit ganzheitlich zu verstehen – und aktiv zu gestalten. „Wir betrachten jede Frau als einzigartiges System aus Körper, Geist und Seele“, erklärt Juen. „Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie wirklich braucht, um ihr volles Potenzial zu leben.“
Viele Frauen kennen ihre Blut- oder Vitalwerte nicht, verlassen sich auf Normbereiche oder allgemeine Empfehlungen. Doch Gesundheit lässt sich nicht standardisieren. CORTHEA arbeitet mit innovativen Analysen, die weit über klassische Laborwerte hinausgehen: DNA-Analysen und epigenetische Analysen (Healthy Aging), Mikrobiom- und Vitalstofftests liefern tiefere Einblicke in Stoffwechselprozesse, Zellgesundheit sowie -alterung und hormonelle Balance. Stresslevel-Messungen liefern zudem wichtige biologische Daten über das vegetative Nervensystem. „Wir nutzen diese Informationen, um Prävention auf ein neues Niveau zu heben“, so Juen. „Unsere Kundinnen

Die NovoTHOR-Lichttherapie stimuliert die Mitochondrien und fördert Regeneration, Zellenergie und Wohlbefinden.
verstehen dadurch, wie stark ihr Lebensstil ihre Genexpression beeinflusst – und dass sie selbst aktiv ihre Gesundheit steuern können.“ Das Ziel: nachhaltige Selbstwirksamkeit. Denn wahre Frauengesundheit beginnt dort, wo Wissen, Bewusstsein und Selbstverantwortung ineinandergreifen.
CORTHEA – Holistic Health Club Innsbruck
Ein Ort, wo Wissenschaft und Herz sich zusammenfinden. Wo Gesundheit nicht nur gemessen, sondern gelebt wird. www.corthea.com
Es gibt unzählig viele Tests, die heutzutage angeboten werden, Nahrungsergänzungsmittel boomen und unreflektierte Meinungen selbsternannter Gesundheitsfanatiker kursieren durch die sozialen Medien. Wie kann man wissen, was für jeden wirklich sinnvoll ist? „Diese Frage begegnet uns bei CORTHEA quasi täglich“, antwortet Irina Juen. „Wir merken bei unseren Kunden oft eine große Verunsicherung. Es gibt so viele Tests und Mittel am Markt, die zwar ein Angebot schaffen, aber keinen nachhaltigen Mehrwert für den Kunden liefern. Dafür ganz bestimmt ein starkes Umsatzplus am Konto diverser Anbieter, da sie nur das Produkt liefern, entkoppelt von persönlichen Terminen, wo Austausch und menschliche Verbindung entsteht. Für mich kein Wunder, dass sich in den meisten Fällen kaum eine Veränderung des Wohlbefindens

Irina Juen ist Health Journey Director bei CORTHEA und Expertin für Epigenetik, Longevity und psychoemotionale Gesundheit.
einstellt. Wir verfolgen ganz klar einen ganzheitlichen Ansatz und klären immer die Frage, welche Werte es braucht, um die Ziele des Einzelnen zu erreichen. Ich muss mich also mit dem Menschen befassen, der vor mir sitzt, zuhören und wissen, wo seine Herausforderungen liegen.“
Hightech trifft Herzintelligenz
In Innsbruck vereint CORTHEA modernste Technologie mit menschlicher Berührung. Anwendungen wie die NovoTHOR-Lichttherapie stimulieren die Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen“ – und fördert Regeneration, Zellenergie und Wohlbefinden. Neu im Programm ist EvoCell, ein medizinisch zertifiziertes Therapiegerät, das durch sanfte mechanische Impulse tief im Gewebe körpereigene Regenerationsprozesse aktiviert. Es wird erfolgreich bei orthopädischen Beschwerden, neurologischen Erkrankungen, Narbenbehandlungen und Hautstraffung eingesetzt – ebenso in der Begleitung chronischer Entzündungen oder Lymphgefäßschwächen. Doch trotz aller Hightech bleibt der Mensch im Mittelpunkt. „Technologie kann unterstützen, aber Heilung geschieht in Verbindung“, sagt Juen. „In der Verbindung mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, mit dem Leben.“
Frauengesundheit im Wandel
Ob hormonelle Veränderungen, Stress, Hautprobleme oder Erschöpfung – jede Lebensphase einer Frau bringt neue Herausforderungen. CORTHEA begleitet Frauen dabei, wieder in ihre natürliche Balance zu finden. Durch maßgeschneiderte Health Journeys wird das persönliche Wohlbefinden durch gezielte Anpassungen im Lebensstil in Einklang gebracht. Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit und Regeneration bilden die vier Säulen des Konzepts – getragen von einem klaren Ziel: Frauen in ihre Kraft zu führen. „Länger zu leben ist eine Sache“, fasst Irina Juen zusammen, „es gesund, strahlend und erfüllt zu tun, ist unsere Mission.“
Neuheit: der EvoCell –für Gesundheit und Schönheit
EvoCell, ein innovatives, medizinisch zertifiziertes Therapiegerät, das auf der sogenannten Mechanotransduktion basiert, erzeugt niederenergetische, rhythmischpulsierende Stoßwellen, die auf sanfte Weise tief ins Gewebe eindringen. Diese Stimulation aktiviert körpereigene Regenerationsprozesse, fördert die Durchblutung und verbessert die Zellkommunikation. In der Orthopädie unterstützt es bei Beschwerden wie Arthrose, Morbus Bechterew, Muskelverspannungen, Fersensporn oder chronischen Gelenk- und Wirbelsäulenproblemen. Nach chirurgischen Eingriffen dient es der gezielten postoperativen Regeneration – etwa bei Prothesen, Narbenbehandlungen oder BandscheibenOPs. Auch bei neurologischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Schlaganfall oder Multipler Sklerose zeigt EvoCell unterstützende Effekte. Im internistischen Bereich wirkt es bei Lymphgefäßschwächen, Asthma oder rheumatischen Erkrankungen regulierend. HNO-Beschwerden wie chronische Rhinitis oder Tinnitus profitieren ebenfalls von der verbesserten Mikrozirkulation durch EvoCell.
Ein besonderer Fokus liegt auf der medizinischkosmetischen Anwendung: Hier wird EvoCell zur Straffung von Haut und Gewebe, bei Cellulite sowie zur Behandlung chronisch-entzündlicher Hautbilder wie Psoriasis, Neurodermitis oder Ulcus Cruris eingesetzt. Durch die Förderung der Kollagenbildung und Wundheilung eignet sich die Behandlung ideal zur Hautregeneration und Narbenpflege.


MENTAL HEALTH
Im Alltag übersehen wir oft, was uns wirklich stärkt: Momente der Ruhe, ein bewusster Atemzug, ein Gedanke, der Platz schafft. Gesundheit betrifft nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Mental Health bedeutet dabei nicht, ständig an sich zu arbeiten, sondern sich zwischendurch immer wieder selbst Raum zu geben.
Es gibt Orte, an denen sich innere Ruhe fast von selbst einstellt. Orte, die Kraft schenken, ohne laut zu sein. Ein solcher Platz ist das Grand Tirolia Kitzbühel als Teil der Hommage Luxury Hotels Collection. Inmitten der Kitzbüheler Alpen entfaltet sich hier eine ganz besondere Atmosphäre – zur Findung neuer Inspirationen. Schon das Haus an sich ist eine echte Kraftquelle und prädestiniert dafür, sich eine Zeitlang nur auf sich selbst zu konzentrieren. Spezielle YogaRetreats und Wochenendprogramme schaffen zusätzlich Raum, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die hauseigene Lehrerin Claudia Salchner ist immer da, wenn man sie braucht, immer wieder sind auch Yogalehrer:innen von auswärts zu Gast – im Oktober war es zum Beispiel die wunderbare Patricia Thielemann, Gründerin von Spirit Yoga, 2026 lädt Claudia Salcher zu drei Retreat-Terminen im Jänner, März und August. Reinklicken unter www.hommage-hotels. com/grand-tirolia-kitzbuehel (Wellness & Sport / Grand Alps Yoga).



Bei Sojourn treffen Wohlbefinden und Selbstfürsorge auf nachhaltigen Luxus. Die wunderbaren Ritual-Sets bestehen aus jeweils sechs Edelsteinen und einem Edelstein-Spray und bringen Leichtigkeit und Tiefe in den Alltag. Das Energy-Set ist eine Einladung, frische Kraft für die täglichen Herausforderungen zu tanken. Um 45 Euro unter www.sojourn-xo.com.
Inmitten der Tiroler Berge liegt ein Ort, an dem Luxus, Natur und Wohlbefinden eins werden: In der 5-Sterne-Wellnessresidenz Alpenrose am Achensee trifft alpine Eleganz auf herzliche Gastfreundschaft – ein Refugium für Körper, Geist und Seele. Auf über 8.500 Quadratmetern Spa-Fläche entfaltet sich ein Paradies der Entspannung: vom Naturbadeteich über exklusive Saunen bis hin zu wohltuenden Beauty- und Massagebehandlungen. Wer Bewegung sucht, findet sie im modernen Fitnessbereich oder in der Natur rund um den Achensee. Auch Familien fühlen sich hier wohl: Kinder erleben Abenteuer im betreuten Club, während Eltern Ruhe und Genuss finden. Kulinarische Höhepunkte begleiten den Tag, vom vitalen Frühstück bis zum Gourmetabend.
TIPP: Meditationswoche mit Qigong-Lehrerin Manuela Jacob. Qigong ist eine jahrtausendealte chinesische Kunst der Lebenspflege und verbindet fließende Bewegungen, bewusste Atmung und meditative Achtsamkeit. In der Alpenrose stehen dabei drei Themen zur Wahl: Qigong-Detox-Woche, Shaolin-Qigong-Woche und QIWO – fernöstliche Entspannung. Weitere Infos unter www.alpenrose.at


Das Selbstfürsorge-Buch, Heike Hermann, Patmos Verlag, 184 Seiten, EUR 20,–Oft haben wir verinnerlicht, erst die anderen zu versorgen, bevor wir uns um uns selbst kümmern. Und meist bleibt dann weder Zeit noch Energie dafür übrig. Dabei es ist es so wichtig, auch auf sein eigenes Wohlbefinden zu schauen. Heike Hermann hat gemeinsam mit renommierten Therapeut:innen die zehn wichtigsten Strategien und Kompetenzen zusammengetragen, wie wir uns selbst gut unterstützen können. Es geht um den gesunden Umgang mit Wut, Ärger und Ängsten, um Selbstmitgefühl und das Loslassen alter Muster. Frank Wowra liefert die Illus dazu.



„Du hast das Recht, genau die Person zu sein, die du wirklich sein willst.“
Michelle Obama
RHYTHMUS SEIN. ES IST OKAY, SICH ZEIT ZU LASSEN. MANCHMAL IST GENAU DAS DER WEG – NICHT SCHNELLER WERDEN, SONDERN ACHTSAMER. NICHT MEHR TUN, SONDERN BEWUSSTER SPÜREN . TIPP
MAN MUSS NICHT IMMER IM PERFEKTEN
Das Hotel Hochschober in Kärnten liegt inmitten von Lärchen- und Zirbenwäldern, umgeben von den sanft schwingenden Kuppen der Nockberge. Im Winter bedeckt eine feste Eisfläche den Turracher See, Loipen und Winterwanderwege verlaufen über den See und durch die Natur. Auf den schneesicheren Pisten ziehen Skifahrer und Snowboarder ihre Schwünge. Das Haus ist zudem wie gemacht zum Abschalten und Energietanken. Die großzügige Wellnesslandschaft und das Kristall-Spa machen es leicht, zu entspannen. Das Inklusivprogramm bietet unter anderem Bewegungsstunden an (Yoga, Wassergymnastik, Pilates), begleitete Ausflüge in die Natur, die chinesische Teezeremonie, Lesungen und Kamingespräche.
TIPP: Für eine kraftvolle Auszeit empfehlen wir das Retreat „Frau sein & ME-Time“ mit Dr. Anna Maria Cavini. Das Package stärkt Körper, Geist und Seele –mit bewegenden Workshops, achtsamer Selbstfürsorge, Wellness und Natur. www.hochschober.com


Gut genug. Den eigenen Selbstwert stärken, Isabelle Meier, Patmos Verlag, 176 Seiten, EUR 18,–
Dr. phil. Isabelle Meier hat eine Weiterbildung in Analytischer Psychologie C. G. Jung sowie in Kathatym-Imaginativer Psychotherapie (KIP) absolviert. Nach langjähriger journalistischer Tätigkeit promovierte sie in Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich und ist heute Lehranalytikerin, Dozentin und Supervisorin am C. G. Jung-Institut Zürich. In ihrem Buch gibt sie praktischen Hilfestellungen, die den Leser:innen ermöglichen, in Kontakt mit ihrem innersten Kern zu kommen und auf diese Weise ein stabiles und souveränes Selbstwertgefühl aufzubauen.
Planen Sie kleine regelmäßige Dates mit sich selbst ein. Manche Tage brauchen kein großes Programm, nur ein gutes Gefühl.
Rituale statt Routine
Eine Tasse Tee nachmittäglich am Balkon oder eine kleine, abendliche Beautysession im Bad. Es sind die wiederkehrenden Rituale, die aus einem Tag ein Lebensgefühl machen.
Digital Detox Light
Ein bisschen Stille, ein gutes Buch, ein echtes Gespräch. Legen Sie bewusste Phasen ohne Handy ein.
Weniger außen, mehr innen Bewegung führt uns zurück zu uns selbst. Es muss nicht gleich ein ganzes Workout sein, manchmal reicht ein bisschen Stretching oder ein unbeschwerter Tanz zum Lieblingssong. Bewegung baut Stress ab und hebt die Stimmung.
Me-Time im Badezimmer
Atmen Sie vor oder nach dem Zähneputzen ein paar Mal tief ein und aus. Das beruhigt und bringt Achtsamkeit in den Alltag. Gönnen Sie Ihrem Gesicht und Ihren Füßen beim Eincremen eine kleine Selbstmassage und lächeln Sie sich für einen kleinen, aber wirksamen Selbstliebe-Moment bewusst im Spiegel zu.

Abwarten und Tee trinken
Die Tees von Tateetata schmecken nicht nur richtig gut, wir mögen auch die Verpackung sehr. Perfekt zum Verschenken und um damit auch anderen eine kleine Freude zwischendurch zu bereiten. Um je 9,95 Euro erhältlich im APFIs in Wattens.

Die Liebe deines Lebens bist du
„Andere Menschen können eine großartige Quelle für Glück, Gesundheit, Unterstützung, Liebe und Verbundenheit sein. Das alles und mehr verdienst du. Du verdienst Beziehungen, die dich erhöhen, deine Seele nähren und die Lieben und den Respekt für dich selbst reflektieren. Entscheidend aber ist das hier: Die Grundlage für diese unglaublichen Beziehungen liegt darin, wie du mir dir selbst umgehst … Du bist der einzige Mensch, mit dem du garantiert den Rest deines Lebens verbringen wirst. Es geht nicht darum, egoistisch zu werden oder andere auszuschließen. Es geht darum, dass Liebe, der Respekt und die Umsicht für dich selbst die Standards für jede andere Beziehung deines Lebens setzen.“
Aus: Die LET THEM Theorie, Mel Robbins, Goldmann Verlag, 368 Seiten, EUR 20,–
Mel Robbins ist New-York-TimesBestsellerautorin und renommierte Expertin für Mindset, Motivation und Verhaltensänderung. Ihre Bücher wurden in über 50 Sprachen übersetzt, ihr Buch „The Let Them Theory“ ist mit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb eines Monats nach Erscheinen in den USA das am erfolgreichsten gestartete Sachbuch aller Zeiten. Mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Podcast erreicht sie Millionen Hörerinnen und Hörer in 194 Ländern.

Das MY MAYR MED Resort in Bad Birnbach, das „Hotel nur für mich“, stellt Gesundheit und persönliches Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Hier gibt es den Raum und die Zeit, sich selbst wertzuschätzen und neue Energie zu tanken. MY MAYR MED ist dabei weit mehr als Wellness. Im exklusiven Resort betreut ein kompetentes Ärzt:innen- und Expert:in nenteam Gäste, die entschlacken, auftanken und ein neues Lebensge fühl entwickeln möchten. Das Gesundheitszentrum im Haus wird ergänzt durch Wellness, Physiotherapie, Kosmetik, Spa und Fitness. Ein Gesamt konzept, das sich der nachhaltigen Entspannung und dem guten Körper gefühl widmet.
UNSER TIPP ZUM HINEINSCHNUPPERN : die Drei-Tages-Auszeit für sie und ihn, ins Medical Day Spa kann man auch ohne Zimmerbuchung. www.mymayr.de

Schreiben Sie’s auf
Schreiben Sie regelmäßig vorm Schlafengehen drei Dinge auf, für die Sie dankbar sind, die Sie heute glücklich


Positive Affirmationen sind bewusst gewählte, stärkende Sätze, die man regelmäßig wiederholt, um das eigene Denken, Fühlen und Handeln positiv zu beeinflussen. Damit lenkt man die Aufmerksamkeit darauf, was man erreichen oder fühlen möchte, anstatt auf Ängste oder Zweifel. Viele Menschen sprechen innerlich kritisch mit sich, Affirmationen ersetzen dieses Muster nach und nach durch unterstützende Gedanken und helfen dabei, sich selbst mit der gleichen Achtsamkeit und dem gleichen Respekt zu begegnen, wie wir es anderen gegenüber tun. Die Worte „Ich bin“ gehören dabei ganz allein Ihnen, niemand anderer kann sie für Sie sagen.
1. Ich bin einzigartig und wertvoll.
2. Ich bin ruhig und ganz bei mir selbst.
3. Ich bin achtsam und treffe bewusste Entscheidungen.
4. Ich bin geerdet, verwurzelt und voller Energie.
5. Ich bin selbstbewusst.
6. Ich bin mir selbst gegenüber liebevoll und nachsichtig.
7. Ich bin offen und neugierig.
8. Ich bin im Einklang mit mir selbst.
9. Ich bin gut zu mir und begegne mir mit Respekt.
10. Ich bin genau richtig, so wie ich bin.

Nehmen Sie sich eine Pause vom Trubel. Die folgenden Seiten sind eine Einladung für mehr Ruhe und Achtsamkeit. Unsere Tipps für kleine Glücksmomente, die den Alltag ein kleines bisschen leichter machen.
„WENN MAN DER LANGEWEILE BEACHTUNG SCHENKT, WIRD ES UNGLAUBLICH INTERESSANT.“
Jon Kabat-Zinn

Die Gefühle sind verwirrt, das Gedächtnis hat einen Hänger, das Temperaturempfinden dreht durch und auch der Schlafrhythmus ist aus dem Takt. Das hormonell gesteuerte emotionale Tohuwabohu rund um die Menopause wird viel zu oft noch gesellschaftlich ignoriert. Dabei sind in der Lebensmitte eben nicht nur ein paar Hormone „im Wechsel“. Vielmehr beginnt jetzt für jede Frau eine Phase des Umbruchs, in der sie als Mensch – vielleicht erstmals nach langer Zeit – wieder im Mittelpunkt stehen darf. Denn diese sensible Zeit birgt für jede Frau die Chance, sich noch einmal neu zu erfinden und den Blick ganz bewusst auf ihre eigenen Bedürfnisse zu lenken. Der Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa in Bayerisch Gmain ist der perfekte Ort, um wieder zu sich selbst zu finden, und bietet immer wieder spannende Retreats zu unterschiedlichen Themen, unter anderem um Frauen auf dem Weg in ihre neue Lebensphase zu begleiten oder einfach entspannte Me-Time in den Bergen zu verbringen. www.klosterhof.de


Alt, fit und selbstbestimmt, Petra Thees & Lutz Karnauchow, Kohlhammer Sachbuch, 242 Seiten, EUR 29,–
Der 1. Oktober als Internationaler Tag älterer Menschen erinnert daran, wie vielfältig und engagiert Senior*innen heutzutage leben. Alter könnte so schön sein, doch ältere Menschen werden in unserer Gesellschaft nach wie vor (unbewusst) diskriminiert. Das Ehepaar Petra Thees und Lutz Karnauchow plädiert dafür, das Alter neu zu denken und es als glückliche Zeit zu sehen.

Im Hotel Krallerhof in Leogang ist Longevity kein kurzfristiger Wellnesstrend, sondern fester Bestandteil einer ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie. Mit dem Konzept „Regeneration & Longevity by Krallerhof“ werden neueste Erkenntnisse aus der Longevity-Forschung, dem Hochleistungssport und Biohacking praxisnah umgesetzt. Das Ziel: Regeneration fördern, Vitalität steigern und ein bewusstes, langes Leben unterstützen.
TIPP : Mehrmals jährlich finden im Krallerhof exklusive Longevity Retreats mit renommierten Expert:innen statt. Im Blog auf www.krallerhof. com und dem hauseigenen Podcast „Longevity by Krallerhof“ wird das Thema zusätzlich vertieft.


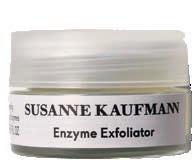




CORTHEA Balance vereint ausgewählte Pflanzenextrakte mit bioaktiven Vitaminen und Mineralstoffen – eine fein abgestimmte Komposition zur ernährungsphysiologischen Unterstützung in Phasen hormoneller Veränderungen, wie Zyklusschwankungen, PMS oder Wechseljahre. Mit Yamswurzel, Maca, Heidelbeere, Acerola, Zink und aktiviertem Vitamin B6 trägt CORTHEA Balance zur Erhaltung eines hormonellen Gleichgewichts sowie des allgemeinen Wohlbefindens bei.
Erhältlich um 44,80 Euro online unter www.corthea.com oder im CORTHEA Shop im Palais Trapp, Maria-TheresienStraße 38, 6020 Innsbruck.
1. Wellness für trockene Haut. Power-FirmGesichtsmaske von QMS Medicosmetics. Um 100 Euro im Kosmetikinstitut Aurora in Innsbruck.
2. Die Glow-Collection von Susanne Kaufmann kommt in der Kombi aus Enzyme Exfoliator und Vitamin C Complex Serum. Duo um 95 Euro im Resort in Innsbruck. 3. Das sanfte Enzympeeling +C von Dr. Hauck befreit die Haut schonend von abgestorbenen Hautschüppchen. Um 49,90 Euro gesehen im Kosmetikinstitut Aurora in Innsbruck.
4. Die Cure Cream regeneriert die Haut und sorgt für einen ebenmäßigen Teint. Babor erhältlich in der Innsbrucker Parfümerie Weigand. 5. Die nährende Augenpflege der Apothekermarke Saint Charles wirkt ausgleichend, abschwellend und straffend für die zarte Augenpartie. Um 44,80 Euro gesehen im Resort in Innsbruck.

In einer Welt voller To-do-Listen und Ablenkungen sollten wir uns selbst immer wieder die Einladung aussprechen, ausschließlich im Moment zu sein. Yoga hilft dabei und muss auch nicht immer den gesamten Körper einbeziehen. Claudia Granig, die Sie in der ersten medica-Ausgabe kennengelernt haben, ist GesichtsyogaLehrerin und hat vor fünf Jahren das Online-Face-YogaStudio Bare Skin gegründet. Gesichtsyoga beschäftigt sich mit der Muskelwelt unserer Haupt-Körperregion, und zeigt, wie viel Potenzial im gezielten Training der 57 Muskeln im Kopf-, Nacken-, Hals- und Gesichtsbereich steckt. Gesichtsyoga ist nicht nur gesund, es macht und hält uns schön. Mittlerweile hat Claudia Granig auch ein Buch geschrieben (erschienen bei Irisiana), in das sie auf rund 180 Seiten viele Infos und Übungen hineingepackt hat. Ein Buch, um sich selbst besser kennenzulernen. www.faceyoga.cc
Tipp: Um in die Podcast-Folge mit Claudia reinzuhören, scannen Sie einfach den QR-Code.
Gesundheit beginnt im Alltag – mit gezielten Routinen und bewussten Veränderungen. Im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf finden Körper und Geist durch vielfältige Impulse zu neuer Balance.
Die Entscheidung für einen gesunden Lebensstil entfaltet hier ihre nachhaltige Wirkung – weit über die dreiwöchige Kur oder Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) hinaus.
Kur & GVA: der Drei-Wochen-Booster
Beim dreiwöchigen Aufenthalt in den REDUCE Kurhotels verbindet sich innovative Lebensstilmedizin mit der geballten Kraft der Naturheilmittel. Das Konzept der Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) bietet ein hochwertiges Therapieprogramm zur Stärkung des Bewegungs- und Stützapparates. Ergänzend werden individuelle Schwerpunkte aus Bewegung, bewusster Ernährung und mentaler Gesundheit gesetzt –in enger Abstimmung mit Ärzt:innen und Therapeut:innen. Besonders Rückenprobleme stehen im Fokus: Die speziell in Bad Tatzmannsdorf entwickelte Hydroextension sorgt durch sanfte Streckung der Wirbelsäule im Thermalwasser für spürbare Entlastung und Regeneration der Bandscheiben.
Natur trifft auf Wissenschaft
Von der Natur reich beschenkt, entfalten im REDUCE Gesundheitsresort gleich drei kraftvolle Heilmittel ihre Wirkung: Entzündungshemmende Moorpackungen helfen bei
Gelenk- und Muskelschmerzen, prickelnde Kohlensäurebäder fördern die Durchblutung und regulieren den Kreislauf, während wohlig warmes Thermalwasser für Tiefenentspannung sorgt.
Bewusster Genuss
Ein Kuraufenthalt ist die perfekte Gelegenheit, Essgewohnheiten zu überdenken. Wer möchte, kann sich durch die Vorzüge der pflanzlichen Ernährung regelrecht durchkosten (V-Label zertifiziert). Vom Frühstück bis zum Abendessen stehen klassische, leichte sowie vegane Gerichte zur Auswahl.
Neu: REDUCE BodyLAB
Von der 3D-Körpervermessung über die HRV-Messung (Herzratenvariabilität) bis hin zur individuellen Ernährungsberatung: hier trifft Innovation auf Prävention. Highlight ist die Kryotherapie in der Kältekammer bei –110 °C: eine Anwendung, die neue Maßstäbe in den Bereichen Schmerzlinderung, Leistungssteigerung und Regeneration setzt.


Gut zu wissen
Die Unterbringung erfolgt in einem der vier REDUCE Kurhotels in komfortablen Einzelzimmern – direkt mit dem Kurmittelhaus, dem Zentrum aller Therapien, verbunden und idyllisch am Kurpark gelegen. Für Begleitpersonen stehen Doppelzimmer zur Verfügung.
Mit dem Upgrade-Angebot im REDUCE Hotel Vital****S genießt man die Kur oder GVA mit dem Extra an Komfort: tagsüber gezielte Therapien und Gesundheitsprogramme, abends Entspannung in großzügigen Thermen- und Saunawelten sowie kulinarisch bewusste Genussvielfalt auf 4****S-Niveau.
REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf I Kurhotels Am Kurplatz 2, 7431 Bad Tatzmannsdorf Tel.: 03353/8200-40 kurhotels@reduce.at kurhotels.reduce.at
WOHFÜHLREZEPT DER AUSGABE

1 kg reife Tomaten
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen, ungeschält
3 EL Olivenöl
1 TL getrockneter Thymian
2 TL Misopaste, dunkel
500 ml Gemüsebrühe
Salz und Pfeffer nach Geschmack
Für die Crostini:
1 Baguette
1 EL Butter oder Olivenöl
150 g geriebener Käse (z. B. Cheddar oder Bergkäse)
1 Den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Tomaten halbieren, die Zwiebel grob würfeln und den Knoblauch ungeschält lassen. Alles auf ein Backblech legen, mit Olivenöl beträufeln, mit Salz, Pfeffer und Thymian bestreuen und im Ofen ca. 30 Minuten rösten, bis das Gemüse leicht karamellisiert ist.
2 Das geröstete Gemüse in einen Topf geben, den Knoblauch aus der Schale drücken, die Misopaste und Gemüsebrühe hinzufügen und alles zu einer glatten Suppe pürieren. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei Bedarf mit etwas zusätzlicher Brühe verdünnen.
3 Für die Crostini das Baguette in Scheiben schneiden, mit Butter oder Olivenöl bestreichen, mit Käse belegen und unter dem Grill oder im Ofen goldbraun überbacken. Die Suppe heiß mit den Crostini servieren.
Noch cremiger wird’s mit:
Ein Schuss Sahne oder Kokosmilch bringt extra Samtigkeit, und ein Klecks Basilikumpesto setzt frische Akzente –perfekt zum Dippen oder als Topping.

Sandra Mühlberg, Callwey Verlag, 224 Seiten, EUR 41,40
Comfort Food beschreibt Gerichte, die uns ein Gefühl von Geborgenheit, Glück und Zufriedenheit vermitteln. Diese Speisen haben die Kraft, unsere Stimmung positiv zu beeinflussen und uns vor allem in stressigen Zeiten Trost zu spenden, schreibt Sandra Mühlberg in ihrem Kochbuch. In über 80 Rezepten zeigt sie, wie abwechslungsreich und sinnlich vegetarische Küche sein kann, und doch ist es mehr als ein reines Kochbuch: Es ist ein Plädoyer für Gelassenheit und Selbstfürsorge in der Küche. Tipps für Vorratshaltung, Anregungen zum Meal-Prep und kleine Self-Care-Ideen verwandeln die alltägliche Küchenroutine in einen Moment der Ruhe und Freude. Übersichtlich strukturiert, mit tollen Fotos versehen und in ein lässiges Layout gepackt: So muss Wohlfühlbuch!


Das Faszien-Antistress-Programm, Patrick Nehmzow, herbig Sachbuch, 160 Seiten, EUR 24,–
Mit gezieltem Faszientraining Stress reduzieren? Inzwischen weiß man: Das geht! Denn das feine Gewebenetzwerk ist nicht nur empfänglich für mechanische Reize, es reagiert auch auf Hormonausschüttungen unter Stress und Anspannung und nimmt direkten Einfluss auf unsere emotionale Befindlichkeit. Faszientherapeut Patrick Nehmzow zeigt in seinem Buch, warum psychische Belastungen die Faszien beeinflussen und wie man Spannungen und Schmerzen gezielt lösen kann.
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: Alexandra Keller, www.alexandrakeller.at & eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at/medica GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin IDEE, KONZEPT & CHEFREDAKTION: Alexandra Keller REDAKTION: Marina Bernardi, Doris Helweg ANZEIGEN -VERKAUF: Ing. Christian Senn, Sandra Nardin, Christoph Loreck, Yvonne Knoll, BA FOTOS: Julia Türtscher, BLICKFANG photographie LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-BergerPrint GmbH COVERFOTO: Dino Bossnini COVERMODEL: Sarah Wastian
GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft & Wellness beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
Das Astoria in Seefeld, inspiriert von der Noblesse großer Grandhotels, stand über Jahrzehnte hinweg für alpine Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Unter der Leitung von Elisabeth Gürtler entwickelte sich das Haus zu einer Ikone exklusiver Hotellerie. Nach sorgfältiger Veredelung erstrahlt das Haus seit 2022 als Alpin Resort Sacher Seefeld mit zeitloser Eleganz als das höchstgelegene Sacher Hotel in der Geschichte. Kurz darauf erfolgte die Aufnahme in die exklusive Vereinigung der Leading Hotels of the World. Heute ermöglicht das Sacher sowohl Rückzug als auch Inspiration – stilvoll, kultiviert und mit Liebe zum Detail gestaltet. Der 4.700 Quadratmeter große Sacher Spa ist dabei ein Refugium der Sinne. Großzügige Ruhezonen, stilvoll gestaltete Wasserlandschaften inklusive Naturbadesee mit Alpinstrand und ein umfangreiches Treatment-Angebot schaffen Raum für echte Erholung.
TIPP: Sacher Detox Retreat für eine neue Leichtigkeit im Leben. seefeld.sacher.com

Bioscalin® TricoAGE+ wurde speziell für Frauen ab den ersten Anzeichen der Menopause entwickelt. Die einzigartige Formel mit Biogenina-Wirkstoffkomplex und AlfaBiomeria enthält sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe wie Omega-6-Fettsäuren, Rutin und Soja-Isoflavone. Dank Retard-Technologie genügt eine Tablette täglich. Für die äußere Pflege eignen sich ergänzend das Serum und Shampoo aus der Bioscalin®-TricoAGE+-Linie. Sie pflegen das Haar, verleihen ihm Geschmeidigkeit und sorgen für ein gepflegtes, vitales Aussehen. Die Kombination aus innerer und äußerer Anwendung bietet ein ganzheitlich abgestimmtes Pflegekonzept – für schönes Haar und ein gutes Gefühl in jeder Lebensphase. Erhältlich in Ihrer Apotheke oder unter www.bioscalin.at

Wenn es um den Kauf oder Verkauf von Immobilien geht, sind wir Ihr zuverlässiger Partner in Innsbruck. Unser erfahrenes Team bietet Ihnen kompetente Beratung und professionelle Betreuung - von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Abschluss.
Raiffeisen Immobilien Innsbruck - Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Elisa Wankmüller
staatl. geprüfte Immobilientreuhänderin
Gerhard Cramer Geschäftsführung
Elena Grumser Assistenz der Geschäftsführung
Mag. Michael Schwab staatl. geprüfter Immobilientreuhänder
Mag. Claudia Elzenbaumer staatl. geprüfte Immobilienmaklerin

Bahnhofstraße 24 a, b und c, 6121 Baumkirchen
2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen, zur Sonne hin ausgerichtet größtmögliche Gärten, Terrassen, Balkone und Dachterrassen barrierefrei für jede Lebensphase heizen und kühlen mittels nachhaltiger Grundwasserwärmepumpe Stromerzeugung mit Hilfe der Photovoltaik-Anlage energieeffizient, langlebig und hochwertig Feinsteinzeug auf den Balkonen und Dachterrassen provisionsfrei direkt vom Bauträger

PREMIUM WOHNEN IM HERZEN VON MILS
Jagdweg 1, 6068 Mils bei Hall in Tirol
WILLKOMMEN IN DER KOMFORTZONE.
Grundstück in absoluter Ruhelage mit herrlicher Aussicht perfekte Süd-Westausrichtung der Wohnungen großzügiges, offenes Wohnen, lichtdurchflutet und barrierefrei geräumige Außenflächen mit maximaler Privatsphäre hochwertige Materialwahl und geschmackvolle Ausstattung individuelle Planung möglich Parkplätze in der Tiefgarage, Personenlift provisionsfrei direkt vom Bauträger

WO STADT AUF
Innsbruck, Schützenstraße 35 a, b, c

Modernes Wohnen in zentraler Lage in Neu-Arzl 3 Baukörper, 37 Wohnungen, Gewerbefläche im EG 2- bis 4-Zimmer Wohnungen mit 39 bis 78 m² Wohnfläche barrierefrei für jede Lebensphase, hochwertige Ausstattung Gärten, Terrassen oder Loggien mit viel Privatsphäre Grünraumgestaltung mit Gemeinschaftsgarten Gemeinschafts-Dachgarten mit Biodiversitätsdach Parkplätze in der Tiefgarage nachhaltige Fernwärmeheizung zeitgemäße Photovoltaik Anlage zur Stromerzeugung Sonderwünsche möglich, schlüsselfertig & provisionsfrei

KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER: Telefon: +43 5223 90 909, E-Mail: office@realbau.at
