





Unterberger Denzel Innsbruck
Griesauweg 32, 6020 Innsbruck Telefon 0512/33435
Unterberger Lienz
Peggetzstraße 10, 9900 Lienz Telefon 04852/63333-50
www.unterberger.cc
Unterberger Kufstein
Endach 32, 6330 Kufstein Telefon 05372/6945
Unterberger Telfs Wildauweg 1, 6410 Telfs Telefon 05262/66766-0
Unterberger St.Johann
Anichweg 1, 6380 St. Johann/T. Telefon 05352/62389
Unterberger Landeck
Innstraße 32, 6500 Landeck Telefon 05442/63076

eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi
Cybercrime ist kein Stoff mehr für Hollywood-Drehbücher oder nerdige Randphänomene. Längst ist digitale Kriminalität im Alltag der Wirtschaft angekommen. Und es kann jeden treffen. Vermutlich wird es das auch. Ignorieren ist keine Option.
Das Geschäft mit der Unsicherheit boomt. Cybercrime hat sich professionalisiert und gleicht heute einer globalen Schattenwirtschaft. Angreifer werden raffinierter, die Bedrohungen vielfältiger. Kriminelle Banden arbeiten nach 9-to-5-Strukturen, bieten ihre Tools im Darknet an und organisieren sich wie klassische Unternehmen – nur ohne Aufsichtsrat und Finanzamt. „Crime as a Service“ nennt sich dieses Geschäftsmodell und es bewegt Milliarden. Angriffe sind mittlerweile derart ausgeklügelt, dass selbst geschulte Augen kaum noch erkennen, ob eine Mail echt ist oder ein Link sicher. Und das Bittere daran: Früher oder später wird es jeden erwischen, glauben Experten. Vom Ein-Personen-Unternehmen über Start-ups bis zum internationalen Konzern. Für die Wirtschaft und uns alle heißt das, achtsam zu bleiben und sich bewusst zu sein, dass Cyberkriminalität kein Nischenthema mehr ist. Die größte Gefahr sitzt vor dem Computer und das auf beiden Seiten. Wer glaubt, dabei mit einer einmal installierten Software vor Angriffen gefeit zu sein, wiegt sich in falscher Sicherheit. Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Es braucht regelmäßige Backups, klare Prozesse, geschulte und aufmerksame Mitarbeiter*innen und vor allem die Einsicht, dass Cybersicherheit in Unternehmen nichts Geringeres als Chefsache ist. Redakteurin Isabella Walser-Bürgler hat für unsere Titelgeschichte mit heimischen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen gesprochen und sich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Die gute Nachricht: Cyberangriffe machen uns nicht ohnmächtig und wir haben die Möglichkeit, eine effektive und wirksame Sicherheitskultur zu schaffen. Auch die Künstliche Intelligenz kann dabei helfen. Doch Technik allein reicht nicht. Was letztlich zählt, ist der Faktor Mensch. Cyberkriminalität ist ein Thema, das uns alle angeht. Gesundheit übrigens auch. Und auch hier geht es um Achtsamkeit, in diesem Fall sich selbst gegenüber. Traditionell widmen wir uns in der Oktober-Ausgabe dem breiten Themenfeld Gesundheit und beschäftigen uns dieses Mal unter anderem mit dem zunehmenden Problem von Antibiotikaresistenzen. Doch keine Sorge, auch hier gibt̕s Lösungen.
Passwörter sind wie Unterwäsche: Niemand sollte sie sehen, sie gehören regelmäßig gewechselt und man teilt sie nicht – auch nicht mit Freunden.
Bleiben Sie wachsam und schauen Sie auf sich, Ihre Redaktion der eco.nova

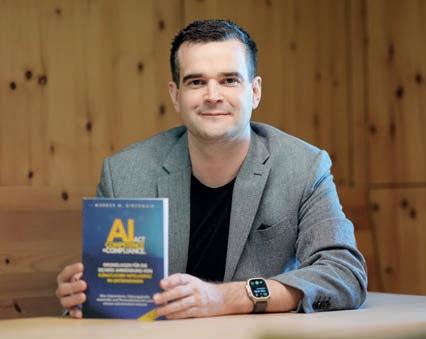





12 HACK ME, IF YOU CAN
Cyberkriminalität ist längst von einem reinen IT-Thema zum strategischen Risiko für Unternehmen aller Größen geworden. Die Angriffe werden raffinierter und verursachen mitunter hohe wirtschaftliche Schäden.
18 CRIME AS A SERVICE
Aus dem Klischee vom einsamen Hacker im Keller ist ein Milliardenbusiness geworden. Cybercrime funktioniert heute nach denselben Mechanismen wie klassische Industrie: Arbeitsteilung, Outsourcing, Plattform-Ökonomie.
26 CRIME SCENE TIROL
Cyberkriminalität macht auch vor Tirol nicht Halt. Dies belegen nicht zuletzt die aktuellen Kriminalitätszahlen. Plus: Lösungsansätze und Praxistipps.
42 KI MISCHT DIE KARTEN NEU Welche Folgen hat die Künstliche Intelligenz für Unternehmen, Beschäftigte und Europa im globalen Wettbewerb? KIExperte Markus Kirchmair sieht ökonomische Chancen, aber auch gesellschaftliche Herausforderungen.
52 QUANTENSTANDORT TIROL Tirol ist längst ein QuantenDorado. Eine lebendige Community aus internationalen Wissenschaftler*innen schlägt gemeinsam mit Startups die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung.
90 ZWISCHEN MARKT UND MEDIZIN
Die „World AMR Awareness Week“ macht weltweit auf die alarmierende Zunahme von Infektionen mit resistenten Mikroorganismen aufmerksam. Wir erklären, warum diese ein solches Problem sind.
100 NOTFALLMEDIZIN NEU DENKEN
Im internationalen Vergleich leistet sich Österreich ein durchaus hochwertiges Gesundheitssystem. Doch es gibt Potenzial zur Verbesserung – nicht nur im Offensichtlichen, auch im Verborgenen.
104 DAS WOHLFÜHLORGAN
Als Steuerzentrale vieler lebenswichtiger Funktionen ist die Schilddrüse ein echtes Multitalent.
ECO.MOBIL
112 MINI - PURISMUS
Auch im Mini Cooper S bleibt das Gokart-Feeling spürbar.
114 VÖLLIG LOSGELÖST
Mit dem neuen #5 löst sich Smart vom Kleinwagen-Segment.
ECO.LIFE
120 ALPIN - URBANE LEBENSFREUDE
Stadtmarketing-Chefin Heike Kiesling über die Kraft der Marke Innsbruck.
03 EDITORIAL 08 KOMMENTAR 10 KREATIVE IMPULSE 34 DIE JUNGE SICHT 66 ECO.SERVICE 126 IM.GESPRÄCH
jetzt reservieren: weihnachtsfeiern im grander. FOR WORK. FRIENDS. FAMILY. weihnachten stressfrei. auf den punkt.
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi TITELGESCHICHTE: Isabella WalserBürgler REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, DI Caterina MolzerSauper // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // eco.life: Marina Bernardi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Yvonne Knoll, BA LAYOUT: Tom Binder COVER: Conny Wechselberger LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
MENSCHEN & UNTERNEHMEN

Laut einer Studie von Dun & Bradstreet Austria steht in Österreich jedes achte Unternehmen ohne potenziell geregelte Nachfolge da. Dabei zeigt sich: Je kleiner der Betrieb, desto eher fehlt eine Regelung, und auch regional tun sich deutliche Unterschiede auf: In Kärnten, Salzburg und auch in Tirol liegt der Anteil der Betriebe ohne Nachfolgeregelung über dem Österreichschnitt, was vor allem damit zu tun hat, dass in diesen Bundesländern der Anteil an kleinen, familiengeführten Unternehmen besonders hoch ist. Selbst wenn in Tirol im Jahr 2024 rund 760 Betriebe erfolgreich übergeben wurden (Übernahmeintensität: 1,49 %) und damit ein neues Hoch verzeichnet werden konnte, sind die großen Nachfolgelücken nach wie vor ein Problem. Denn die Nachfolgefrage entscheidet nicht nur über die Zukunft des jeweiligen Unternehmens, sondern auch den Standort im Allgemeinen. Gelingt der Wechsel nicht, gehen wertvolles Wissen und Arbeitsplätze verloren. Gerade in Zeiten des Wandels ist es deshalb wichtig, frühzeitig an die Zukunft des eigenen Unternehmens zu denken. Ähnlich sieht das eine aktuelle Studie der österreichischen Notariatskammer: „Um Lebenswerk und Arbeitsplätze zu sichern, ist Unternehmensvorsorge entscheidend“, so Oskar Platter, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg. „Besonders in Familienunternehmen stehen Themen wie Gesellschaftsverträge, Vorsorgevollmachten und Erbrecht im Fokus. Wir sehen immer wieder, dass eine frühzeitige und klare Regelung der Nachfolge viel Unsicherheit und Stress aus dem Unternehmen nimmt.“
Die vollständige Studie von Dun & Bradstreet inklusive Infos zu den meistbetroffenen Branchen, kritischen Faktoren der Unternehmensnachfolge und vielen weiteren Zahlen und Fakten finden Sie zum Download hinter dem QR-Code.

Karl Christian Handl (CEO von Handl Tyrol und Präsident der Tiroler Adler Runde), Ökonom Philipp Bagus und Klaus Mark (Geschäftsführer von MK Illumination und Pressesprecher der Tiroler Adler Runde)
Die Tiroler Adler Runde zieht eine erste Bilanz zur Entbürokratisierungsoffensive und die sieht nicht sonderlich erquicklich aus. Auch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Laut IMD World Competitiveness Ranking 2024 liegt Österreich bei der „Government Efficiency“ auf Rang 40 von 67, bei der „Tax Policy“ sogar nur auf Rang 64. „Wir verwalten uns zu Tode. Klein- und Mittelunternehmen verbringen jährlich bis zu 250 Stunden mit bürokratischen Vorgaben. Das sind fast zwei Monate Arbeitszeit und Milliardenkosten, die Innovation und Wachstum verhindern“, sagt Karl Christian Handl, Präsident der Tiroler Adler Runde. Trotz eines umfassenden Forderungskatalogs und intensivem Dialog mit der Landespolitik bleibe die tatsächliche Entlastung für Unternehmen aus. Die Adler Runde habe bereits im Frühjahr konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, darunter die Einführung eines digitalen „One-Stop-Shop“-Systems für Verwaltungsdienstleistungen, Praxischecks für Gesetzesfolgen und die systematische Reduzierung von Dokumentationspflichten. Viele Initiativen seien zwar angekündigt, der Reformstau jedoch hält an. Die größten Bremsklötze indes liegen beim Bund: Gewerberecht, komplexe Genehmigungsverfahren und fehlende Digitalisierung sind Aufgaben, die in Wien entschieden werden. „Der Mut zu echten Reformen fehlt oft – die Umsetzung bleibt schleppend und wird durch Zuständigkeitswirrwarr und politische Kompromisse gebremst“, so Handl.

Die Zusammenarbeit zwischen STIHL Tirol und der FH Kufstein Tirol zeigt, wie praxisnahe Hochschulprojekte einen echten Mehrwert für alle Seiten schaffen. Seit dem ersten Projekt im Jahr 2012 wurden Produktion und Lehre vielfach gemeinsam gestaltet und zahlreiche Initiativen umgesetzt. Die Projekte leben dabei von einem offenen Austausch und einer engagierten Begleitung durch STIHL Tirol – für die Studierenden eine wertvolle Erfahrung mit echtem Praxisbezug. Besonders beliebt bei den Student*innen ist auch die Nutzung der externen Vorlesungsräume bei STIHL Tirol, die ein Lernen direkt am Standort ermöglichen. Heute sind zahlreiche FH-Absolvent*innen beim Gartengerätehersteller in Langkampfen tätig, die Weiterführung der Kooperation in Folgeprojekten ist bereits beschlossen.

Marina Bernardi, Chefredaktion
Resilienz entsteht im Unbequemen, nicht im Komfort.
Die Welt ist gerade wahrlich kein gemütlicher Ort. Globale Spannungen, Krisen, Unsicherheiten. Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, wir bekommen momentan mehr Steine auf die Schultern gepackt, als wir tragen können. Es fühlt sich an, als ob die Welt auf vielen Kanälen gleichzeitig Druck macht, und doch steckt genau darin ein paradoxes Geschenk. Druck, so unbequem er ist, formt uns. So wie Kohlenstoff nur unter Druck zum Diamanten wird.
Niemand sehnt sich nach Krisen, doch genau die zwingen uns, anders zu denken, uns neu auszurichten und Gewohnheiten zu hinterfragen. Wer sich jemals in einer Situation wiederfand, die unüberwindbar schien, kam oft zur überraschenden Erkenntnis, dass man stärker ist, als man denkt. Persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen passieren selten in stabilen, planbaren Zeiten, sondern dann, wenn Routinen zerbrechen, man alte Muster abstreifen und neue Wege gehen muss.
Krisen bleiben Krisen. Schmerz bleibt Schmerz. Schönzureden gibt‘s da nichts, doch wir haben immer selbst die Wahl, wie wir damit umgehen. Zerbrechen oder kristallisieren. Die aktuelle Lage ist unbequem, doch sie bietet auch die Möglichkeit, Schärfe und Fokus zu gewinnen. Kein romantisches Versprechen, sondern eine pragmatische Einladung: Druck nicht nur als Belastung zu sehen, sondern als Katalysator dafür, was wir im besten Fall daraus machen können. Und vielleicht liegt das Gute an dieser unwirtlichen Zeit darin, sie sich nicht wegzuwünschen, sondern als das anzunehmen, was sie ist: Eine Chance, herauszufinden, was für einen selbst wirklich wichtig ist.
Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at
7

Inflation ist mies. Sie killt Wettbewerbsfähigkeit, lässt Sparguthaben verdampfen und befeuert sich ständig selbst. Immerhin wird jetzt gegengesteuert. Doch Symbolpolitik allein wird nicht reichen.
Wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Österreich war in den vergangenen drei Jahren unter den europäischen Ländern mit der höchsten Inflation. Knapp 20 Prozent Entwertung zwischen 2022 und 2024 haben deutliche Spuren hinterlassen. Und jetzt schrammen wir wieder an der Vier-Prozent-Marke. Offenbar ist die Inflation gekommen, um zu bleiben. Warum ausgerechnet bei uns? Sind wir Opfer finsterer Kräfte? Das will uns die Politik weismachen. Die Wahrheit ist: Wir haben uns einen Gutteil selbst eingebrockt.
Mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise hatten alle zu kämpfen, andere Länder waren aber deutlich erfolgreicher. Sie haben Preise gedämpft, wir nicht. Während Deutschland oder Spanien die Energiepreise deckelten, verteilte Österreich den weitgehend wirkungslosen, aber teuren Klimabonus. Es war der verzweifelte Versuch, ein Problem, das mit Geld nicht zu lösen ist, mit viel Geld zu lösen. Dazu kam: üppige Beamtenabschlüsse, die die Privatwirtschaft unter Zugzwang setzten – und zu Lohnabschlüssen führten, die inzwischen viele Firmen wirtschaftlich ins Eck treiben. Die Politik spricht zwar von Inflationsbekämpfung – ist aber selbst der größte Pyromane, wenn es ums Anheizen geht. Einer der wenigen Hebel, welche die Regierung wirklich selbst in der Hand hat, sind Abgaben und Gebühren – und da langt die öffentliche Hand ungeniert zu. Einige Verwaltungsgebühren wurden gerade um fast 50 Prozent angehoben.
Immerhin gibt es mittlerweile ein bisschen Licht im finsteren Inflationstunnel – das zeigen drei Beispiele. Erstens: Die Regierung ist bei einem Drittel der Pensionisten leicht unter der Inflationsrate geblieben. Selbst wenn die erzielte Einsparung mit 350 Millionen Euro (bei einem 23-Milliarden-Budget-Loch!) eher symbolisch ist, handelt es sich immerhin um einen Schritt in die richtige Richtung. Zweitens: Auch die Metaller haben bewiesen, dass es anders geht. Eine einzige, sachliche
Verhandlungsrunde, ein Abschluss unter der Inflationsrate –ohne das übliche Getöse. Viele metallverarbeitende Betriebe sind exportorientiert und wissen längst, was auf dem Spiel steht: großartige Produkte, die wegen überzogener Lohnkosten international keine Käufer mehr finden. Und drittens: Der Beamtenabschluss wurde aufgeschnürt und eine durchschnittliche Steigerung für drei Jahre von 1,5 Prozent vereinbart.
Ob die erzielten Kompromisse reichen, muss sich erst zeigen, Symbolik allein reicht jedenfalls nicht. Eine Nulllohnrunde wäre ein wirklich mutiger Schritt gewesen, der aber offenbar alle überfordert hat. Und: Trotz aller Bemühungen wurde sofort wieder gezündelt. Gleich war von „Pensionsraub“ die Rede – und selbst Parteikollege Hans Peter Doskozil konnte nicht widerstehen, seinem Lieblingsgenossen Andreas Babler Versagen vorzuwerfen. Auch bei den Metallern hat es nicht lange gedauert, bis wieder österreichische Normalität einkehrte: Vertreter anderer Branchen erklärten umgehend, dass der Metallerabschluss „ein Sonderfall“ sei und für sie keinerlei Vorbildwirkung habe. Es ist erstaunlich, wie tief bei uns dieses Konfliktdenken sitzt. Hinter jedem Kompromiss – selbst einem gelungenen – wird Verrat gewittert. Das Ergebnis: Wir bekommen das Notwendige nicht auf die Reihe. Das schlägt sich in drastischen Zahlen nieder: Laut einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria fühlen sich 80 Prozent der Österreicher politisch nicht gehört. Das Publikum wendet sich offenbar angewidert vom politischen Hickhack ab – und läuft scharenweise ausgerechnet zu jenen, die noch viel stärker auf Krawall gebürstet sind, aber einfache Lösungen versprechen. Dabei bräuchten wir jetzt das Gegenteil: Eine Pause bei kleinlichem Anspruchsdenken, gegenseitigen Schuldzuweisungen und billigen Profilierungsversuchen. Nur dann lässt sich die Inflation bremsen und das Budget sanieren. Die drei Beispiele sind endlich erste Schritte in die richtige Richtung –weitere müssen folgen: Der viel zu fett gewordene Staat braucht eine radikale Schlankheitskur und die Bürokratie die Kettensäge. Jetzt bloß nicht mittendrin aufhören!




Die Ärztespezialisten
Kaiserjägerstraße 24 · 6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 59 8 59-0 · Fax: DW-25 info@aerztekanzlei.at w w w.aerztekanzlei.at
Montag bis Donnerstag
8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr Freitag
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzteund das seit 40 Jahren Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vor teil!
beraten Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 50 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet
das seit über 40 Jahren Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vor teil!
Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.
Unser ressourcenreiches Team steht für bestes Ser vice und maximalen Klientennutzen.
Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.
Er war ten Sie von uns ruhig mehr, denn wir sind die Spezialisten!
v. li. Mag. Johannes Nikolaus Erian, Raimund Eller, Mag Dr Verena Maria Erian, Karin Fankhauser
Wer kommt, will bleiben.
Wir haben neue Räumlichkeiten mit mehr Platz für Sie und für uns Kostenlose Parkplätze direkt vor unserer Haustüre
v. li. Raimund Eller, Karin Fankhauser, Dr Verena Maria Erian, Mag. Johannes Nikolaus Erian für
Unser Team freut sich auf Sie.
Unser

Warum gerade in Krisenzeiten das Streichen von Werbebudgets ein Bumerang ist – und weshalb Tirols Kreative weit mehr draufhaben, als man ihnen zutraut. Ein Klartext-Gespräch mit Tiefe, Tempo und dem Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation: Kurt Höretzeder.
VON DOMINIQUE PFURTSCHELLER UND PETER EINKEMMER
Wir müssen aufhören, uns kleiner zu machen, als wir sind“, betont Kurt Höretzeder, neuer Fachgruppenobmann Werbung und Marktkommunikation, im Gespräch. Tatsächlich wird die Branche noch immer auf bunte Logos reduziert – dabei schafft sie längst mehr: über 1,2 Milliarden Euro Umsatz und jede Menge Kompetenz im Bereich der Strategie und Zukunftsfragen.
HERAUSFORDERUNG: WAHRNEHMUNG UND SELBSTBEWUSSTSEIN
Die Tiroler Kreativszene ist vielfältig und schlagkräftig –Architektur, Werbung, Fotografie, Film, Musik, Design. Doch sie wird wesentlich eindimensionaler wahrgenommen. „Wir brauchen ein gemeinsames Denken, ein Auftreten als Branche.“ Nur so könne man das geltend machen, wofür man längst steht. Denn während Tourismus oder Landwirtschaft lautstark ihre Anliegen vertreten, bleibt die Kreativwirtschaft oft zu leise. Projekte wie ein geplantes Kreativquartier in Innsbruck werden so zum Lackmustest.
LOKALE STÄRKE STATT VIENNA CALLING
„Warum nach Wien schauen, wenn wir hier ausgezeichnete Arbeit haben?“, fragt Höretzeder. „In den vergangenen 20 Jahren haben Tirols Agenturen enorm Fahrt aufgenommen. Junge Talente, internationale Preise und die enge Kenntnis des regionalen Marktes sprechen für sich – oder besser gesagt für uns.“ Wer ein Produkt oder eine Marke in Tirol, Südtirol oder Süddeutschland erfolgreich positionieren will, muss sich nicht Großagenturen von weither holen, sondern findet hervorragende Partner*innen vor der Haustür.
AUSBILDUNG, ZUKUNFT & KI
Ein Thema, das die Branche vor Herausforderungen stellt, ist die Ausbildung. Es fehlen Einrichtungen im tertiären Bildungsbereich – aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, in Tirol die Berufsschule zu absolvieren. Daher setzt sich die Fachgruppe aktuell besonders vehement für Reformen und neue Möglichkeiten im Bildungsbereich ein. „Eine Fach-

Dominique Pfurtscheller (GF northlight) und Kurt Höretzeder (Fachgruppenobmann Werbung & Marktkommunikation)
hochschule mit den Schwerpunkten Design und touristische Markenführung wäre ein klares Signal – Talente könnten hier bleiben und neue nach Tirol kommen“, unterstreicht Höretzeder. Denn junge Fachkräfte sind der Schlüssel, um den Standort langfristig zu stärken.
Und dann ist da die Künstliche Intelligenz. Bedrohung? „Im Gegenteil. KI ist die zweite große Revolution in der Branche nach dem PC.“ Sie übernehme zeitraubende Routineaufgaben wie Recherche oder Bildbearbeitung und schaffe damit Freiraum für das Wesentliche: echte Kreativität, Intuition, den Dialog mit Kund*innen. „Das, was uns als Menschen auszeichnet – Ideen kuratieren, Vertrauen aufbauen, Märkte verstehen –, kann keine Maschine ersetzen.“
WARUM WERBUNG KEIN LUXUS IST
Gerade in Krisenzeiten treten Unternehmen beim Marketing die Bremse und zücken den Rotstift. „Ein Fehler“, warnt Höretzeder. „Wer aufhört zu kommunizieren, verschwindet
aus den Köpfen der Kund*innen. Und das Zurückkommen kostet mehr, als man glaubt.“
Werbung ist kein Luxus, sondern Treiber der Nachfrage – sie hält Marken lebendig und sorgt dafür, dass Unternehmen ihre PS auch wirklich auf die Straße bringen. Allerdings funktioniere dies nur, wenn die Kundenseite mitzieht. „Wir brauchen kompetente Gegenüber, die sowohl den Wert von Markenpflege verstehen und kreative Impulse zulassen als auch langfristig denken.“
Tirols Kreativwirtschaft steht an einem Wendepunkt. Sie muss sich bündeln, ihre wirtschaftliche Bedeutung sichtbarer machen und das Selbstbewusstsein entwickeln, das ihrer Stärke entspricht. Die Qualität ist vorhanden, die Innovationskraft auch.
Für die Unternehmer*innen des Landes heißt das: „Versteht Werbung und Kommunikation nicht als Nebensache, sondern als Motor eures Erfolgs. Die richtigen Partner*innen dafür sind da“, gibt Kurt Höretzeder abschließend mit auf den Weg. Denn eines ist klar: Ohne Kreativität bleibt jede Wirtschaft stehen, mit ihr aber fährt sie auf der Überholspur – selbst im Transitland Tirol …

Was ist Ihrer Meinung nach der Motor für wirtschaftlichen Erfolg? Wir freuen uns über Ihre Impulse!
btv.at/nachhaltigegeldanlage
Investieren mit Geist und Haltung bedeutet: Ich will, dass mein Geld nachhaltig Gutes für die Umwelt tut.
Mutig voran!
Cyberkriminalität ist längst von einem reinen IT-Thema zum strategischen Risiko für Unternehmen aller Größen geworden. Dabei werden die Angriffe immer raffinierter und verursachen mitunter hohe wirtschaftliche Schäden. Doch wie sehen die gängigen Angriffsmuster aus und wie kann man sich effektiv vor digitalen Attacken schützen?
TEXT: ISABELLA WALSER-BÜRGLER // FOTOS: ANDREAS FRIEDLE

etrachtet man die Sache nüchtern, ist Cyberkriminalität ein logisches Nebenprodukt der modernen Informationsgesellschaft. Die Geschichte der Cyberkriminalität ist auf Engste mit der Entwicklung des vernetzten Rechners (Computer und Internet) verbunden. Spätestens seit sich in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren die Elemente der Informations- und Kommunikationstechnik mit Elementen der Unterhaltungsindustrie zu vermischen begannen, erhöhte sich auch das Risiko von digitalen Angriffen. Heute ist unsere Gesellschaft vom Volksschulkind bis zum Pensionisten zu 95 Prozent durchdigitalisiert. Wir konsumieren Videos und Nachrichten online, kommunizieren online, kaufen online und verkehren sogar mit den Behörden online. Und mit jedem User
ES AUF BUCHSTÄBLICH JEDEN ABGESEHEN. SO KÖNNEN
SOWOHL PRIVATPERSONEN ALS AUCH GANZE ORGANISATIONEN ZU OPFERN WERDEN.

und jeder noch so kleinen Expansion des digitalen Raumes wachsen auch die Anzahl, die Möglichkeiten und die Dimensionen gezielter krimineller Handlungen. Peter Stelzhammer, Geschäftsführer der in Innsbruck ansässigen und weltweit tätigen Cybersecurity-Firma AV-Comparatives GmbH und Sprecher der IT-Security Experts Group an der Wirtschaftskammer Tirol, meint dazu trocken: „Wenn man sich professionell mit der Thematik beschäftigt, sieht man erst, was tatsächlich alles passieren kann, dass alles passieren kann und dass auch alles passiert.“
Da die virtuelle Welt, auf die sich der Begriff „Cyber“ bezieht, weder orts- noch zeitgebunden ist, stellt die Cyberkriminalität eine globale Herausforderung dar.
Laut Global Cybersecurity Outlook 2025 des World Economic Forum beobachten 72 Prozent aller Organisationen weltweit eine beständig wachsende Angriffslage, während 91 Prozent in den nächsten drei Jahren einen noch deutlicheren Anstieg aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) erwarten. Allein im DACH-Raum kam es im Jahr 2024 zu ca. 20 Prozent mehr Cybercrime-Attacken als noch im Vorjahr. Zwar gelten E-Mails dabei nach wie vor als primärer Angriffskanal, daneben mehren sich aber die sogenannten „Multi-Channel-Angriffe“, die sich auch Messaging-Apps, Social-Media-Plattformen und Sprachanrufe zunutze machen. Über diese Methode (bei der zum Beispiel zuerst per E-Mail ein Link versandt und dann per Messenger nachgefragt wird, ob man den Link auch erhalten hat) ahmen Angreifer*innen nicht nur unsere gängigen Kommunikationsmuster nach und lassen sie „glaubhafter“ erscheinen, sondern sie umgehen damit auch traditionelle Abwehrmechanismen. Mit anderen Worten: Die Attacken werden strategischer und effizienter. Wer glaubt, das sei für einen selbst irrelevant, täuscht sich, denn: Cyberkriminelle haben es auf buchstäblich jeden abgesehen. So können sowohl Privatpersonen als auch ganze Organisationen zu Opfern werden. Privates und Professionelles lässt sich in diesem Zusammenhang ohnehin aus drei Gründen nicht strikt voneinander trennen: Erstens zielen Angreifer nicht mehr nur direkt auf die unternehmenseigenen Netzwerke ab, sondern nutzen die persönlichen Daten von Einzelpersonen häufig indirekt als potenzielles Einfallstor in Organisationen. Zweitens tragen die meisten Menschen sämtliche Unternehmensda-
„Wenn man sich professionell mit der Thematik beschäftigt, sieht man erst, was tatsächlich alles passieren kann, dass alles passieren kann und dass auch alles passiert.“
Peter
Stelzhammer, AV-Comparatives GmbH
ten permanent auf ihren Privatgeräten mit sich herum, indem sie sich etwa via Handy in ihren Unternehmens-E-Mail-Account oder ins Intranet einloggen, wodurch die Grenzen zwischen privater und beruflicher Nutzung verschwimmen. Drittens ist jeder Unternehmer und jeder Mitarbeiter auch immer ein Privatmensch, und wer sich im Privatleben achtsam oder unachtsam durch den digitalen Raum bewegt, wird dies auch im beruflichen Bereich ähnlich handhaben. Trotz aller besorgniserregenden Trends nehmen allerdings auch die Möglichkeiten zu, wie man sich vor cyberkriminellen Handlungen schützen kann. Mit dem entsprechenden Bewusstsein dafür, dass Cyberattacken immer personalisierter, großflächiger und schwerer erkennbar werden, können wir alle – zumindest im Rahmen unserer jeweiligen Handlungsspielräume – dagegenhalten. „Wir können uns als Menschen schützen, da das Angriffsziel letztlich ja immer der Mensch und nicht die Maschine ist“, so Chefinspektor Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention am Landeskriminalamt/LKA Tirol. Darüber hinaus profitieren nicht nur die Angreifer*innen, sondern auch die potenziellen Opfer, IT-Spezialist*innen und Cyberforensiker*innen von den Entwicklungen der KI. KI kann etwa sinnvoll eingesetzt werden, um präventiv mit Trainings auf Szenarien vorzubereiten, mithilfe von smarten Simulationen Schwachstellen im eigenen System ausfindig zu machen oder über automatisierte Anomaliedetektion auf ungewöhnliche Muster aufmerksam zu werden. Auf der reaktiven Ebene wird KI bereits ein-
gesetzt, um Täter*innen zurückzuverfolgen und schädliche Datensätze zu scannen.
BEGRIFFE UND DELIKTE
Cyberkriminalität (oder auch Cybercrime) umfasst ein komplexes Themenfeld, das sich in viele verschiedene Teilbereiche gliedert. Die Bandbreite reicht von Kreditkartenmissbrauch und der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten über Cyberstalking und Cybermobbing in den sozialen Medien bis hin zu Urheberrechtsverletzungen und Hacking. Eine verbindliche Definition von Cyberkriminalität existiert nach wie vor nicht. Im Grunde versteht man unter dem Begriff das komplette Register an Straftaten, die unter Zuhilfenahme der Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT) und/ oder gegen diese begangen werden. Synonym kursieren dafür auch die Begriffe Online-Kriminalität bzw. Internet-Kriminalität. Innerhalb dieses weiten Feldes begegnet man in der gängigen Literatur drei spezifischeren Definitionen von Cyberkriminalität, die gleichzeitig auch Aufschluss über die Deliktsdimensionen geben: Cyberkriminalität im engeren Sinn (oder auch Cyberdependent Crime), Cyberkriminalität im weiteren Sinn (auch Cyberenabled Crime) und Identitätsverschleierung. Während Erstere sich auf Straftaten bezieht, die ausschließlich online erfolgen können (z. B. die Verbreitung von Viren), umfasst Zweitere Straftaten, die auch offline begangen werden, wobei Computer und Internet verwendet werden, um das Verbrechen überhaupt erst zu ermöglichen. Dies ist besonders häufig der Fall bei Identitätsdiebstahl. Die Identi-
MIT JEDEM USER UND JEDER NOCH SO KLEINEN EXPANSION DES DIGITALEN RAUMES WACHSEN AUCH DIE ANZAHL, DIE MÖGLICHKEITEN UND DIE DIMENSIONEN GEZIELTER KRIMINELLER HANDLUNGEN.
tätsverschleierung schließlich bezieht sich auf Täter*innen, die über die Anonymität eines Online-Avatars kriminelle Handlungen vollziehen, wie etwa die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut auf Online-Plattformen.
Cyberkriminelle Delikte werden selten aus der Perspektive von Privatpersonen betrachtet. Wann immer in Österreich die Rede auf den „Kampf gegen die Cyberkriminalität“ fällt, wird vor allem auf Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen Bezug genommen. Zentrale Fragen von Legislative und Exekutive lauten diesbezüglich: Ab welchem Zeitpunkt gilt eine Handlung als kriminell? Wie lassen sich in der anonymen, global vernetzten digitalen Welt Beweise sichern? Wie können Ziel, Zweck und Ursprung einer kriminellen Handlung verstanden und analysiert werden? Um diese Fragen besser beantworten zu können, unterscheidet man drei Formen von Attacken: ungerichtete, zielgerichtete und skalpellartige Attacken. Während ungerichtete Attacken willkürlich jede Person treffen können und möglichst großflächig Schaden anrichten sollen (etwa durch Spam-E-Mails oder Computerviren), sind bei zielgerichteten Attacken bestimmte Opfer im Visier der Täter, die diesen persönlich bekannt oder unbekannt sein können. Bei skalpellartigen Attacken handelt es sich um eine erweiterte Form der zielgerichteten Attacken, die einer intensiven Vorbereitung bedürfen und die bezwecken, Infrastruktur zu zerstören. Dabei wird zum Beispiel eine ganze Rechnergruppe mit Schadsoftware infiziert, um sie zu gegebenem Zeitpunkt als Ausgangsbasis für einen Angriff auf das eigentliche Zielsystem zu nutzen. Unter all den verschiedenen Angriffsmustern, die von Kriminellen gezielt und oft hochprofessionell eingesetzt werden, gibt es natürlich auch zeitgebundene Trends. Unternehmen stehen in diesem Kontext vor der Herausforderung, ihre individuelle Risikolage realistisch einzuschätzen, um gezielt vorbeugen zu können.

Peter Stelzhammer ist Geschäftsführer der in Innsbruck ansässigen und weltweit tätigen Cybersecurity-Firma AV-Comparatives und Sprecher der IT-Security Experts Group an der Wirtschaftskammer Tirol.
Laut den Tiroler Experten Peter Stelzhammer (AV-Comparatives GmbH), Thomas Unterleitner (Finin GmbH) und Philip Graf (Seraforce AG) zählen derzeit insbesondere die folgenden Angriffsmuster zu den größten Bedrohungen für Wirtschaft und Unternehmen –wobei sich viele davon überschneiden bzw. ergänzen.
Unter Malware versteht man schädliche Software, die den Betrieb von IT-Systemen stört oder diesen im schlimmsten Fall sogar vollständig lahmlegt. Die Bandbreite reicht von Trojanern und Viren bis hin zu Würmern, die sich eigenständig im Netzwerk ausbreiten. Großes Aufsehen erregte etwa der großangelegte Malwareangriff auf Yahoo im Jahr 2017, im Zuge dessen rund drei Milliarden Nutzerdaten gestohlen wurden. Malware verfügt darüber hinaus über die Besonderheit, dass sie auch in sogenannte Botnetz-Programme implementiert werden kann. Mithilfe dieser Programme werden mit Malware infizierte Rechner ohne das Wissen der eigentlichen Benutzer*innen ferngesteuert („Zombies“) und für koordinierte Angriffe missbraucht. Die Folgen für Unternehmen sind gravierend: Neben Produktionsstillständen und Schließungen droht aufgrund des üblichen Verlustes sensibler Daten ein enormer Reputationsschaden.
Supply-Chain-Attacken betreffen die Software-Lieferkette. Moderne Software besteht aus hunderttausenden Code-Bausteinen, die auf verschiedenen Repositorien (digitalen Speicherorten) gelagert sind. Gelangen manipulierte Komponenten während der Kompilierung zu einer funktionierenden Software in die Software selbst hinein, kann schädlicher Code unbemerkt in fertige Produkte eingeschleust werden, lange bevor sie beim Endkunden ankommen. Das kann im Prinzip bei jeder gekauften Software der Fall sein. Cyberforensiker Thomas Unterleitner hält dazu fest: „Niemand kann kontrollieren, was in der Supply-Chain passiert. Selbst seriöse Unternehmen können solche Angriffe kaum erkennen oder verhindern, da sie oft weit ‚unterhalb‘ ihrer eigenen Sicherheitskontrollen stattfinden.“ Erst im vergangenen Juli wurden beim US-Ableger der Allianz-Versicherung Millionen Kundendaten kompromittiert, nachdem Angreifer eine (oder mehrere) Komponenten in der Softwarelieferkette manipuliert hatten.

Social Engineering beschreibt eine allgemeine Methode, bei der Angreifer gezielt individuelle Schwachstellen von Personen ausnutzen, um Zugang zu sensiblen Informationen zu erlangen. Dabei kommen psychologische Manipulation und Täuschungsmethoden zum Einsatz, mitunter sogar ohne Einsatz technischer Hilfsmittel. Als klassisches Beispiel fungiert der Anruf bei der Unternehmenssekretärin. Dabei geben sich Angreifer *innen etwa als IT-Support oder Geschäftsführer*in aus und erschleichen sich so Passwörter oder interne Informationen, mit denen sie im Anschluss ins Unternehmensnetzwerk eindringen. Dank KI-gestützter Deepfake-Technologie lassen sich heute Stimmen ebenso authentisch imitieren, wie Gesichter ohne grafische Defizite in Calls ausgetauscht werden können. Social Engineering dient häufig als Eintrittspforte für weiterführende Angriffe wie Identitätsdiebstahl oder Systemmanipulationen.
Phishing gilt als der häufigste Angriffsvektor, der die größte Schwachstelle im System konsequent ausnutzt: den Menschen. Täuschend echt gestaltete E-Mails, SMS oder Websites zielen darauf ab, sensible Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen. Mit KI-gestützten Tools lassen sich solche Nachrichten heute so authentisch gestalten, dass selbst geschulte Augen sie kaum noch von echten Mitteilungen unterscheiden können. Besonders perfide sind gefälschte Rechnungen, die scheinbar von vertrauten Geschäftspartner*innen oder Geschäftsführer*innen stammen (CEO-Fraud), in täuschend echter Manier versehen mit Logos, Unterschriften und Stempeln. In Tirol erregte etwa im Frühsommer dieses Jahres der Fall der Marktgemeinde Steinach für Aufsehen, als Betrüger im Zuge der Arbeiten am Volksschulneubau eine Originalrechnung in der Höhe von 166.000 Euro manipulierten und mit dem Vorwand, die Teilrechnung sei abhandengekommen, mit einer gefälschten IBAN-Nummer erneut an die Gemeinde schickten. Im August und September wurden in einer großflächigen Betrugskampagne Wirtschaftskammer-Mitgliedsunternehmen aufgefordert, ihre Kammerumlage zu zahlen und WKO-Anmeldedaten einzugeben. Von solchen konkreten Fällen abgesehen, sind besonders Personalabteilungen ein beliebtes Ziel, indem Angriffe oft als Bewerbungen in Form von verseuchten PDF-Anhängen getarnt werden, die beim Öffnen eine Schadsoftware installieren.

Ransomware gilt als besonders aggressive Form von Malware, indem sie Daten verschlüsselt oder ganze Systeme sperrt, damit die Angreifer*innen im Anschluss ein Lösegeld für deren Freigabe fordern können. Meist werden die Schadprogramme über Anhänge oder Links in PhishingE-Mails, den Besuch unsicherer Websites oder Schwachstellen im System eingeschleust. Das Problem ist, dass solche Attacken lange unentdeckt bleiben. Von der Infektion bis zur Entdeckung vergehen im Schnitt 270 Tage. Das bedeutet, dass die Malware knapp neun Monate im Unternehmen liegt, bis man hellhörig wird. Während dieses Zeitraums kartieren Angreifer*innen Netzwerke, lesen Daten aus, verkaufen persönliche Daten im Darknet und bereiten ihre Erpressung vor. Der Tiroler Leuchtenhersteller EGLO etwa musste 2024 für 14 Tage dichtmachen – Produktionsstillstand und Imageschaden inklusive –, nachdem das international tätige Unternehmen Opfer eines großangelegten Ransomware-Angriffs geworden war. Doch so verheerend Ransomware-Angriffe im Einzelfall auch sein mögen, sind sie laut Peter Stelzhammer „keineswegs ein Massenphänomen“. Dazu seien sie viel zu komplex und bedürfen einer intensiven Vorbereitung.
Beim Identitätsdiebstahl stehlen Angreifer*innen persönliche oder geschäftliche Identitätsdaten – darunter Namen, Adressen, Zahlungsinformationen oder Log-in-Daten. Diese Informationen werden entweder für den direkten Zugriff auf Konten und Systeme verwendet oder im Darknet weiterverkauft. Prominente Beispiele zeigen, wie einfach selbst öffentliche Figuren aus der Onlineszene angreifbar sind: So gelang es Hackern im Jahr 2016, die Twitter- und Pinterest-Konten von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu übernehmen, nachdem sie sein Passwort (das er offensichtlich für mehrere Konten gleichzeitig verwendete) im Zuge eines zuvor bei LinkedIn gestohlenen Datensatzes ergattert hatten. Doch nicht nur die sozialen Medien, sondern auch der E-Commerce, der in Österreich in den letzten 15 Jahren eine enorme Zuwachsrate verzeichnet, öffnet dem Identitätsdiebstahl Tür und Tor. Konsument*innen fühlen sich derart sicher im Netz, dass sie ihre Finanzdaten ohne große Bedenken bei Anbietern wie Amazon, Apple oder Zalando hinterlegen. Dieses Vertrauen täuscht jedoch darüber hinweg, dass Identitätsdiebstahl unter die häufigsten Cyberdelikte der Gegenwart fällt.
Philipp Graf ist Gründer von Cyber Tirol und Seraforce und Ethical Hacker im Security-Bereich.

Aus dem Klischee vom einsamen Hacker im Keller ist ein Milliardenbusiness geworden. Cybercrime funktioniert heute nach denselben Mechanismen wie klassische Industrie: Arbeitsteilung, Outsourcing, Plattform-Ökonomie. Wer genügend Kapital mitbringt, kann sich beinahe jede Form des Angriffs kaufen, maßgeschneidert wie ein Servicepaket im Darknet. Wie Angriffe funktionieren und was im Bedarfsfall zu tun ist.
iner der größten Mythen, der sich nach wie vor hartnäckig in den Köpfen vieler Menschen hält, ist das Bild des stereotypen Cyberkriminellen. Philip Graf, Gründer von Cyber Tirol und der Seraforce AG, seines Zeichens ein Ethical Hacker im Security-Bereich, spricht deutliche Worte: „Das klassische Kellerkind, das im schwarzen Pulli mit über den Kopf gezogener Kapuze und Sonnenbrille zuhause sitzt und Computer hackt, ist völlig veraltet. Mittlerweile divergiert das Profil von Cybercrime-Tätern so stark, dass sich kaum verallgemeinernde Aussagen treffen lassen.“
Ein Grund für die Auflösung des vorurteilsbehafteten Bildes ist unter anderem die zunehmende Kommerzialisierung von Cyberkriminalität. Neben Einzeltäter*innen sind weltweit überall sowohl privat organisierte Banden als auch staatlich unterstützte Gruppen in verschiedenen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Motiven und IT-Kompetenzen tätig. Im Moment erweisen sich besonders größere Gruppen als erfolgreich, von denen man nicht viel mehr weiß, als dass sie sich mehrheitlich (zu mindestens 75 Prozent) aus männlichen Kriminellen zusammensetzen. Diese Statistik mag auch nicht weiter verwundern, da Männer generell häufiger zu kriminellen Handlungen neigen und üblicherweise aufgrund kultureller Prozesse eine höhere technische Affinität aufweisen. Was man bislang über Gruppen- und Einzeltäter in Erfahrung bringen konnte, basiert einzig auf bekannten Strukturen krimineller Netzwerke im Cyberraum bzw. auf den Aussagen überführter Einzeltäter. Immerhin lassen sich von der Art eines Angriffs auf die jeweils dahinterstehende Formation Rückschlüsse ziehen: Je komplexer eine Attacke, desto wahrscheinlicher wurde sie von einer Gruppe durchgeführt. Was den Angriffsort anbelangt, können Angriffe von überall im In- oder Ausland aus verübt werden. Die meisten größeren Netzwerke agieren international, zumal der virtuelle digitale Raum keine klassischen geografischen Grenzen kennt. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen IT-Dienstleister und Softwareunternehmen diverse Analysen zur Herkunft und Ausrichtung solcher Angriffe. Diese Studien sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sie meist nicht auf wissenschaftlich repräsentativen Stichproben basieren und in der Regel keiner standardisierten wissenschaftlichen Methodik folgen. Dennoch lassen sich daraus gewisse Tendenzen ableiten. So ergab etwa eine aktuelle Untersuchung von Kaspersky Lab, dass ein Großteil der gegenwärtigen Angriffe in Österreich aus Asien und Russland stammen, gefolgt von Südamerika. Die geringsten Angriffsaktivitäten verzeichnet man in Österreich hingegen aus Ländern wie Schweden, den mitteleuropäischen und mittelamerikanischen Staaten, Südafrika und Australien.
WAS GERADE KMU IM VERGLEICH ZU GRÖSSEREN UNTERNEHMEN
GEFÄHRDET, IST DAS SCHMALERE BUDGET. INFORMATIONSSICHERHEIT IST EBEN NICHT FÜR ALLE GLEICHERMASSEN ZUGÄNGLICH. WER MEHR GELD IN PERSONELLE UND FINANZIELLE RESSOURCEN
INVESTIEREN KANN, HAT SCHLICHT MEHR MÖGLICHKEITEN, DIE EIGENE RESILIENZ ZU STÄRKEN.
Fragt man nach dem Zweck cyberkrimineller Handlungen, unterscheidet die forensische Sozialpsychologie zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Intrinsisch motivierte Täter*innen handeln aus persönlichem Antrieb heraus. Sie suchen den Nervenkitzel, die intellektuelle Herausforderung oder schlicht die Befriedigung, Sicherheitsbarrieren zu überwinden. Extrinsisch motivierte Cyberkriminelle hingegen verfolgen ein pragmatisches Ziel mit ihrer Tat: Sie wollen Geld verdienen. Genau diese extrinsische Motivation ist es, die in den vergangenen Jahren eine beispiellose Industrialisierung des Cybercrime-Sektors in Gang gesetzt hat. Was einst die Domäne einzelner, hochspezialisierter Hacker war, ist mittlerweile zu einem profitablen globalen Geschäftsmodell avanciert. Man spricht dabei auch von „Cybercrime as a Service“, analog zu etablierten Begriffen wie „Software as a Service“. Der Markt dieser Schattenwirtschaft folgt denselben Prinzipien wie legale Märkte und weist ähnliche Probleme auf – von der Konkurrenz um Marktanteile über Innovationsdruck bis hin zu Fachkräftemangel und Skalierung durch Outsourcing. „Die meisten kriminellen Gruppen sind heutzutage wie klassische Wirtschaftsunternehmen organisiert, nur agieren sie in Jurisdiktionen, in denen sie nicht greifbar sind“, so Cyberforensiker Thomas Unterleitner. Er ist Geschäftsführer der Finin GmbH und ehemaliger Pionier der „Tiroler Brandwand“ beim späteren Firewall-Weltmarktführer phion AG, heute Teil des kalifornischen Unternehmens Barracuda Networks. „Teams arbeiten nach festen Zeitplänen in 9-to-5-Jobs mit klarer Aufgabenverteilung. Manche Akteure programmieren Tools, andere übernehmen deren Verbreitung, wieder andere verkaufen Zugangsdaten oder betreiben Plattformen für gestohlene Datensätze. Wie klassische Unternehmen bieten Gruppen ihre Dienste gegen Provision an, oftmals in anonymisierten Darknet-Marktplätzen, auf denen wie in einem B2B-Ökosystem gehandelt wird.“
Dieser Markt, in dem Dienstleistungen angeboten und verkauft werden, bewegt Milliarden und ist kaum regulierbar. Und je mehr Geld zirkuliert, desto professioneller wird das Angebot. Wer über ausreichend Kapital verfügt, kann sich heute nahezu jeden Angriff zusammenkaufen, sei es Ransomware (inklusive Bedienoberfläche über kompromittierte Zugangsdaten) oder seien es Zero-Day-Exploits, also bislang unbekannte Sicherheitslücken, die naturgemäß zu Höchstpreisen gehandelt werden. „Eines ist also klar“, resümiert Philip Graf, „nicht jeder Cyberkriminelle muss heute noch ein technisches Genie sein.“
WAS GESCHIEHT BEI EINER ATTACKE?
Es ist zweifellos eine bittere Pille, doch schlucken müssen wir sie alle: Früher oder später erwischt es jeden. Darin sind sich Thomas Unterleitner, Philip Graf und auch Peter Stelzhammer einig. „Wo immer Sicherheitslücken vorliegen, werden sie vermutlich ausgenutzt werden“, bestätigt auch Hans-Peter Seewald vom Landeskriminalamt Tirol. Dabei spielt die Branchenzugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Zwar gibt es immer bestimmte branchenbezogene Schwerpunkte – mal sind die Banken, mal die Versicherungen, mal Energieträger im Visier der Kriminellen, ebenso wie kritische Infrastruktur oder die Auto- und Luftfahrtindustrie im Dauerfokus stehen –, aber ein Pauschalurteil lässt sich nicht fällen.
Auch hinsichtlich der Größe von Unternehmen gibt es keine Garantie. Größere Unternehmen erscheinen auf den ersten Blick aufgrund ihrer Umsatzstärke als offensichtliche Hauptziele, doch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und sogar Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sind grundsätzlich derselben Gefahr ausgesetzt. „Für die Täter ist die Größe der Firma unwesentlich, denn der Einstiegspunkt ist stets gleich groß“, erklärt Thomas Unterleitner. Was KMU und EPU ganz umsatzunabhängig für Täter*innen interessant macht, ist, dass sie über ihre geschäftlichen Tätigkeiten Verbindungen zu anderen, eventuell größeren Unternehmen bieten.“ Das Ein-Personen-Marketingunternehmen in Kitzbühel mag im Einzelfall also zwar für die Angreifer*innen irrelevant sein, aber dessen E-Mails können theoretisch trotzdem dazu verwendet werden, um bei anderen Firmen ins System reinzukommen. Peter Stelzhammer bringt es auf den Punkt: „Jeder Einzelne von uns – egal ob Privatperson oder Businessmensch – ist heute Teil eines eng verzweigten digitalen Netzes, in dem sich ein einziger Angriff schockwellenartig auf andere Unternehmen und Personen ausbreiten kann.“ Was gerade auch KMU im Vergleich zu größeren Unternehmen gefährdet, ist das schmalere Budget. Informationssicherheit ist eben nicht für alle gleichermaßen zugänglich. Wer mehr Geld in personelle und finanzielle Ressourcen investieren kann (wie große Konzerne oder Firmen in stark regulierten und hochtechnologisierten Sektoren wie der Finanzbranche), hat schlicht mehr Möglichkeiten, die eigene Resilienz zu stärken.
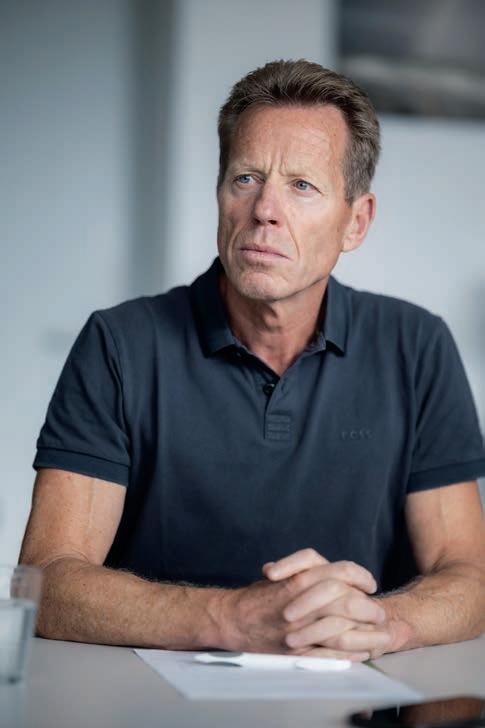
„Wo immer Sicherheitslücken vorliegen, werden sie vermutlich ausgenutzt werden.“
HANS - PETER SEEWALD, LANDESKRIMINALAMT TIROL
Doch wie läuft so eine Attacke eigentlich ab? „Bevor man überhaupt bemerkt, dass etwas passiert ist, stand man schon seit geraumer Zeit im Fokus der Angreifer“, sagt Thomas Unterleitner. „Da schlägt naturgemäß auch die Firewall nicht an. Die Angreifer dringen dann entweder durch technische Hintertüren in die Systeme privater oder firmeninterner Rechner ein oder man klickt als Opfer mal auf einen Link, öffnet ein Dokument oder geht auf eine gefälschte Website. Ab diesem Moment beginnt die eigentliche Attacke.“ Danach wird gewissenhaft „nachgeladen“: Die Angreifer*innen installieren auf dem attackierten Computer eine sogenannte Command-and-Control-Software (C2-Software), mittels derer eine Verbindung zum Computer der Angreifer*innen (z. B. in Nigeria) aufgebaut
Thomas Unterleitner ist Geschäftsführer der Finin GmbH und ehemaliger Pionier der „Tiroler Brandwand“ beim späteren Firewall-Weltmarktführer phion AG, heute Teil des kalifornischen Unternehmens Barracuda Networks.

MELDEPFLICHT VON CYBERANGRIFFEN GEGENÜBER DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN. WER VORFÄLLE VERSCHWEIGT ODER VERZÖGERT, RISKIERT SENSIBLE STRAFEN UND IRREPARABLE REPUTATIONSSCHÄDEN.
wird. Die Controller sitzen in diesem Fall in Nigeria und kontrollieren von dort aus das attackierte Gerät. Sie geben auf ihrem Computer Kommandos ein, um die attackierte Festplatte nach Daten zu untersuchen und sämtliche Passwörter aus dem Cache von Webbrowsern abzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Sicherheitssysteme des attackierten Gerätes erstmals, Alarm zu schlagen. Da diese Systeme aber häufig zu Fehlalarmen neigen, wird dieser Alarm gern mal ignoriert – frei nach dem Motto: Wer einmal lügt, … „Hellhörig wird man letztlich als Opfer erst dann, wenn das eigene Gerät etwa anfängt, sich mit Nigeria zu unterhalten, oder wenn der Cursor auf dem Bildschirm ein Eigenleben entwickelt“, so Unterleitner. So oder so brauche es in Unternehmen in diesen Fällen aber jemanden, der aufmerksam genug ist, um diese Auffälligkeiten zu bemerken, und versteht, wie das
eigene System arbeitet. Mit anderen Worten: Gerade im Unternehmensbereich bedarf es der Wachsamkeit eines geschulten IT-Personals bzw. einer klaren Monitoringstrategie. Sollte es zu Lösegeldforderungen kommen (was im Übrigen durchaus realistisch ist, wie Peter Stelzhammer bestätigt), kann es profitabler sein, das Lösegeld zu zahlen, als sonstige aus dem Angriff resultierende Verluste in Kauf zu nehmen. Ob die Angreifer*innen nach erfolgter Zahlung einen korrekten Schlüssel liefern, ist eine andere Geschichte. Am Ende einer Attacke herrscht im Organisationsbereich stets die Frage, wer dafür haftet und wer für die Schwachstelle verantwortlich war (je nachdem, wo der Einfall passiert ist). Das angegriffene Unternehmen? Der Kunde? Der Dienstleister? Diese Fragen kommen meist im Zuge des sogenannten Incident Response Management auf.

gemeinsam besser leben
Jetzt online berechnen!

„Cybersecurity gehört für mich eindeutig in die Geschäftsführung, weil eine Cyberattacke eines der größten Risiken darstellt, das zum Konkurs führen kann.“
PETER STELZHAMMER, AV - COMPARATIVES GMBH
VORBEREITUNG IST DIE HALBE RETTUNG
Die Fähigkeit von Unternehmen, in kürzester Zeit eine koordinierte und wirksame Reaktion einzuleiten, entscheidet über das Ausmaß des Schadens. Je komplexer die Bedrohungslage wird, desto stärker wird diese Kapazität auf die Probe gestellt. Ein wirkungsvolles Incident Response Management beginnt lange vor dem eigentlichen Angriff. Es lebt von einer Unternehmenskultur, die Transparenz fördert und Fehler nicht bestraft. Studien zeigen: Unternehmen mit hoher Widerstandskraft schaffen Anreize für frühzeitige Meldungen, etwa durch regelmäßige Trainings, unterstützende Teams oder sogar anonyme Meldekanäle. Denn nur wer Vorfälle offen kommuniziert, kann kollektiv richtig reagieren. „Als sinnvoll erweist es sich auch stets, das Vorfallsmanagement mindestens einmal im Trockenen durchzuspielen, um zu sehen, ob die entwickelten Prozesse auch greifen“, empfiehlt Oberstleutnant Philipp Rapold, stellvertretender Abteilungsleiter des LKA Tirol. Backup-Systeme und Notfallpläne seien wertlos, wenn sie vor dem eintretenden Ernstfall nicht getestet wurden. Im schlimmsten Fall müssen Firmen zusperren, wenn ihre Infrastruktur nach einer erfolgten Attacke zerstört ist, die IT nicht hochgefahren und die Produktion nicht aufrechterhalten werden kann oder wenn Sozialleistungen und Gehälter nicht ausgezahlt werden können.
Hat ein Angriff stattgefunden, lautet die oberste Regel, Ruhe zu bewahren und systematisch zu handeln. Zunächst sollte man die betroffenen Systeme schnellst-
möglich vom Netz nehmen und offline gehen, um den Angriff zu unterbinden. Die für das IT-System zuständige Person sollte wissen, wen sie in einem nächsten Schritt anruft. Der erste Anruf gilt in der Regel dem eigenen IT-Betreuer (sofern es einen solchen gibt), der die Lage entsprechend einschätzen und Empfehlungen geben kann. Parallel dazu können betroffene Unternehmen in Tirol die Cybersecurity-Hotline der Wirtschaftskammer kontaktieren. Die IT Security Experts Group ist gut vernetzt und hat einen guten Überblick darüber, wer über einen Decoder für welche Verschlüsselungen verfügt oder welcher Cybersecurity-Hersteller für eine Entschlüsselung angefragt werden könnte. Auf diese Weise gelang es etwa letztes Jahr einem Landecker Betrieb nach einem Ransomware-Befall, dank eines von Peter Stelzhammer kurzfristig zur Verfügung gestellten Entschlüsselungstools binnen vier Minuten den Betrieb wieder aufzunehmen. Die IT Security Experts Group kann zudem auch Kontakte zu spezialisierten Cyberforensikern wie Thomas Unterleitner herstellen, deren Aufgabe weniger darin liegt, Systeme übereilt wieder hochzufahren, sondern den Einbruchspfad nachzuvollziehen, Spuren zu sichern und die Integrität der geschädigten Infrastruktur wiederherzustellen. „Wer sofort alles neu startet, zerstört Beweise und weiß am Ende nicht, was wirklich passiert ist“, warnt Unterleitner. Ein solches Szenario ist insofern wenig zielführend, da ein Angriff mit Blick auf die Zukunft stets reflektiert werden sollte. Die konsequente Aufarbeitung und die Anpassung von Prozessen sind entscheidend, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. „Ja, ein Einbruch mag passiert sein, aber er kann isoliert werden. Wichtig ist, daraus zu lernen und die Organisation weiterzuentwickeln“, betont Unterleitner.
Mindestens ebenso zentral wie die technische Reaktion ist die Kommunikation. Betroffene Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Partner*innen transparent über einen Angriff informieren. Dabei geht es nicht nur um die rechtlichen Vorgaben, sondern auch um den Vertrauenserhalt. Laut DSGVO besteht zudem eine gesetzliche Meldepflicht gegenüber den zuständigen Behörden. Wer Vorfälle verschweigt oder verzögert, riskiert sensible Strafen und irreparable Reputationsschäden. Schuldzuweisungen an einzelne Mitarbeiter*innen sollten in professionell geführten Unternehmen übrigens keinen Platz haben. Die Person, die auf einen geschickt getarnten Phishing-Link klickt, ist nicht der Täter, sondern das Opfer einer mangelhaften Sicherheitsarchitektur, für die letztlich immer die Geschäftsführung verantwortlich ist. Peter Stelzhammer findet in diesem Kontext klare Worte: „Cybersecurity gehört für mich eindeutig in die Geschäftsführung, weil eine Cyberattacke eines der größten Risiken darstellt, das zum Konkurs führen kann. Die Umsetzung von Maßnahmen und Monitoring geht natürlich in der IT-Abteilung vonstatten, aber die Verantwortung darüber darf die Geschäftsführung nie abgeben. Wer die Sicherheit im Betrieb umsetzt, sollte sich nie selbst überprüfen müssen.“
32.990,– 1)
1) Alle Preise und Aktionen gelten als unverb. empf. inkl USt, NoVA und Boni iHv € 2.000,–, gültig für Privatkunden bei Kaufvertragsabschluss bis 31.10.2025. Preis ist gültig mit einem im Aktionszeitraum eingereichten und bei Auslieferung des ausgelobten Fahrzeugs abgeschlossenen Finanzierungs- und Versicherungsvertrages bei Mobilize Financial Services (eine Marke für RCI Banque SA Niederlassung Österreich) und beinhaltet Boni iHv € 500,– mit folgenden Konditionen: Finanzierungsbonus (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis) & Versicherungsbonus (gültig bei Finanzierung über Mobilize Financial Services und bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpflichtversicherung bei carplus (Wr. Städtische) – Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. Kombinierter Verbrauch von 6,3–4,6 l/100 km, CO2-Emission von 143–105 g/km, homologiert gemäß WLTP.
renault.at

STANDORTE
Innsbruck Neu-Rum, Serlesstraße 1
Tel. +43 50 2611, office@dosenberger.com
Dosenberger-Plaseller Zams, Buntweg 8
Tel. +43 50 2611 53, zams@dosenberger.com

Neurauter, Stams-Mötz, Staudach 23, Tel. 05263/6410 Schöpf, Imst, Industriezone 54, Tel. 05412/64526 Hangl, Pfunds, Nr. 432, Tel. 05474/5273 Wolf, Bach, Stockach 29, Tel. 05634/6156
Cyberkriminalität macht auch vor Tirol nicht Halt. Dies belegen nicht zuletzt die aktuellen Kriminalitätszahlen. Zwar wird die Statistik dadurch leicht verzerrt, dass Cybercrime-Delikte in Österreich erst seit dem Jahr 2006 erfasst werden und in den letzten zehn Jahren sukzessive mehr Delikte aufgenommen wurden, ein grundlegender Anstieg lässt sich aber nicht von der Hand weisen.
Insgesamt wurden im Jahr 2024 in Tirol 5.087 Internetdelikte angezeigt (Privatpersonen und Unternehmen zusammengenommen), wobei das Spektrum von Mobbing über Kinderpornographie bis zum CEO-Fraud reichte. Die Aufklärungsquote lag bei 35,4 Prozent. Obwohl das für Internetdelikte eine respektable Zahl darstellt, darf nicht übersehen werden, dass einerseits eine Anzeige nicht mit einer Verurteilung gleichzusetzen ist und dass andererseits die Dunkelziffer der nicht zur Anzeige gebrachten Delikte ungemein höher sein dürfte. „Wenn man seriös bleiben will, lassen sich hierzu allerdings keine konkreten Vermutungen anstellen“, sagt Oberstleutnant Philipp Rapold vom Landeskriminalamt Tirol. „Man kann einzig davon ausgehen, dass viele Unternehmen sich wohl aus Reputationsgründen nicht melden, viele Privatpersonen aus Scham.“ Im Vergleich mit den anderen Bundesländern positioniert sich Tirol entsprechend der relativen Bevölkerungszahlen im Mittelfeld. So kam es etwa 2024 österreichweit zu etwas über 260.000 Internetdelikten, womit sich die 5.087 bekannten Fälle in Tirol auf circa acht Prozent beliefen. Die genannten 5.087 Delikte stehen dabei

„Cybercrime löst offensichtlich ähnliche Gefühle im Menschen aus wie Naturkatastrophen. ‚Da können wir eh nichts tun‘, heißt es dann oft.“
PHILIP GRAF, SERAFORCE AG
41.975 allgemein kriminellen, zur Anzeige gebrachten Delikten in Tirol gegenüber, was anteilig 12,1 Prozent ausmacht. Soll heißen: Etwas mehr als jedes zehnte Delikt fiel in Tirol im letzten Jahr unter die Rubrik „Cyberkriminalität“.
Im Angesicht dieser Bedrohungslage präsentiert sich die Tiroler Wirtschaft dem Thema Cybersicherheit gegenüber in der Praxis bis dato noch erstaunlich zwiegespalten. Selbst wenn in der jüngsten Vergangenheit das theoretische Bewusstsein für die Gefahren von Internetkriminalität innerhalb von Unternehmen stark gestiegen ist, bilden diejenigen Unternehmen, die gut aufgestellt sind, nach wie vor die Minderheit. „Ich bin immer wieder mit Fällen konfrontiert, bei denen ich mir denke, sowas sollte eigentlich gar nicht möglich sein“, so Ethical Hacker Philip Graf, Gründer von Cyber Tirol sowie der Seraforce AG, der sich auf Penetrationstests spezialisiert hat. Solche Tests simulieren einen Hackerangriff unter kontrollierten Bedingungen, um potenzielle Schwachstellen im IT-System von Firmen ausfindig zu machen, bevor Angreifer*innen sich diese zunutze machen. Am Ende entsteht ein Bericht mit den aufgelisteten Schwachstellen, inklusive Risikoeinschätzung sowie konkreten Handlungsempfehlungen zur Behebung. Entsprechende Maßnahmen umzusetzen, sieht Graf dabei als das eigentliche Problem. „Wenn man den Unternehmer*innen die Ergebnisse des Penetrationstests präsentiert, reagieren sie oft mit einem Gefühl von Ohnmacht. Cybercrime löst offensichtlich ähnliche Gefühle im Menschen aus wie Naturkatastrophen. ‚Da können wir eh nichts tun‘, heißt es dann oft oder ‚Das würde zu viel Geld kosten‘.“ Mit anderen Worten: Die Gefahr des abstrakten Risikos führt dazu, dass das Problem trotz eindeutiger Belege im ersten Schritt ignoriert wird. Peter Stelzhammer beobachtet noch ein weiteres Phänomen: „Wenn Unternehmen über eine Cybersecurity-Software verfügen, geben sie sich gern schon damit zufrieden. Aber nur einen Server aufzustellen und eine Software draufzuspielen, genügt nicht. Man muss erstens den Server nach dem Aufsetzen so einstellen, dass er sich selbst gegen Malware schützen kann (so genanntes „Server-Hardening“), und zweitens muss
ETWAS

„Wenn man seriös bleiben will, lassen sich über die Zahl der Internetdelikte keine konkreten Vermutungen anstellen.“
PHILIPP RAPOLD, LANDESKRIMINALAMT TIROL
man auch die Software richtig konfigurieren und regelmäßig warten. Das ist keine ‚Set-and-Forget‘-Geschichte. Es kommt tatsächlich häufig vor, dass eine Software seit Jahren läuft, aber nicht mehr richtig funktioniert – und keiner merkt es! Die Funktionstüchtigkeit muss regelmäßig protokolliert werden. Da führt kein Weg drum herum.“ Als besonders immun gegenüber dieser Vorgehensweise erweisen sich Start-ups. Da deren Fokus in der Regel darauf liegt, herauszufinden, was der Markt braucht, um dann schnellstmöglich online zu gehen, wird Sicherheit schnell zum Nachgedanken, der mit dem Start-up-Mindset „Move fast, break things“ kollidiert. Damit gehen Start-ups ein hohes Sicherheitsrisiko ein. „Wenn ein Startup zum Beispiel ein Software-Programm schreiben lässt, werden meist nur die Initialkosten in die Kalkulation miteinbezogen. Dass es aber neben den zwei Millionen Euro Initialkosten auch laufend pro Jahr zum Beispiel 200.000 Euro bräuchte, um die Software aktuell zu halten, wird schlicht überse-
JEDES
hen“, meint Graf kopfschüttelnd. Als weitere klassische Sicherheitslücke in vielen Firmen gilt gerade in Start-ups, aber auch in vielen KMU, die Arbeit der sogenannten Citizen Developer. Dabei handelt es sich um fachliche Mitarbeiter*innen, die keine ausgebildeten Software-Entwickler*innen sind, mit Hilfe von Low-Code- oder No-Code-Plattformen aber selbst Softwareanwendungen (meist zur Automatisierung oder Optimierung firmeninterner Arbeitsprozesse) entwickeln. Gegenwärtig basteln Citizen Developer mit besonderer Vorliebe mithilfe von KI Webanwendungen, ohne sich jedoch intensiv mit dem Thema Cybersecurity auszukennen. Diese Art der Software in einen Zustand zu bringen, in dem sie wartbar ist, halten Expert*innen für schier unmöglich, da die KI binnen kürzester Zeit ein derart enormes Programmiervolumen liefert, dass keiner mehr einen Überblick über den Code haben kann. Aus der Perspektive von Sicherheit und Wartung erweist sich diese Handhabe als durchwegs problematisch, denn von der KI abgesehen ist kaum jemand noch realistisch in der Lage, diese Software weiterzuentwickeln. „Solche Webanwendungen mithilfe von KI zu schreiben und zu benutzen, bedeutet für Unternehmen einen Schuss vor den eigenen Bug“, resümiert Graf.
Mit dem Anstieg der Cyberkriminalität wächst auch die Notwendigkeit für Schutz. Regierungen haben daher weltweit eine Vielzahl an Strukturen geschaffen, um auf die Bedrohung zu reagieren.
In Österreich teilen sich gleich mehrere Ministerien die Zuständigkeiten, auf EU-Ebene bildet die NIS-Richtlinie das Herzstück einer gemeinsamen Cybersicherheitsstrategie. Sie verpflichtet die Mitgliedsstaaten dazu, nationale Behörden und Incident-Response-Teams einzurichten, Sicherheitsstandards festzulegen und Meldepflichten zu verankern. Ergänzend dazu trat Ende 2018 der „Cybersecurity Act“ in Kraft, der europaweit einheitliche Zertifizierungsrahmen für IT-Produkte vorsieht. Auf dem Papier existiert also bereits seit Längerem ein engmaschiges Sicherheitsnetz. Doch Regulierung ist nur die eine Seite der Medaille. In der Praxis wird die Umsetzung für Unternehmen schnell zum Balanceakt. Mehr Pflichten führen zu höheren Kosten, zusätzlicher Bürokratie und komplexeren Prozessen. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sparen Firmen daher ausgerechnet bei der Sicherheit, weil es dort nicht unbedingt augenscheinlich ist, dass gespart wird (anders etwa als in Marketing
oder Vertrieb). Diese Kürzungen ziehen jedoch einen Rattenschwanz an langfristig spürbaren Effekten nach sich: Die allgemeinen Sicherheitsstandards sinken, Fachpersonal wird abgebaut, Systeme veralten. Hinzu kommt ein psychologischer Faktor, den Thomas Unterleitner schon etliche Male beobachten durfte: „Viele Manager sind es einfach leid geworden, den immer neuen Anforderungen hinterherzulaufen, zumal Cybersecurity ohnehin selten als wertschöpfend gilt.“ Gleichzeitig hat sich parallel zu diesen durchaus bedenklichen Verschleißerscheinungen eine privatwirtschaftlich orientierte Dienstleistungsindustrie herausgebildet, die IT-Sicherheit an Unternehmen und Staaten verkauft, um die raffinierter werdenden Angriffsformen und die zunehmende Regulierungsdichte per Geschäftsmodell abzufedern. Von Antivirensoftware über Sicherheitsberatung bis hin zu Weiterbildungsangeboten boomt das Geschäft mit der Sicherheit. Für die Wirtschaft mag das zwar neue Jobs und eine Fülle an Angeboten
bedeuten, doch ist auch in diesem Kontext Vorsicht geboten: Vielfalt garantiert nicht automatisch Qualität. Nicht jede technische Lösung hält, was sie verspricht, und Compliance-Beratung ersetzt noch lange keine nachhaltige Sicherheitskultur.
Neben der Regulierung, der Technologie und der Beratung hat sich mit Cyberversicherungen in den letzten Jahren eine vierte Säule in Sachen Prävention herauskristallisiert. Der globale Cyberversicherungsmarkt blüht und soll von derzeit 14 Milliarden Dollar auf satte 29 Milliarden im Jahr 2027 anwachsen. Auf den ersten Blick macht das Sinn, denn eine Cyberversicherung bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich gegen Schäden durch Datenlecks oder Attacken finanziell abzusichern. Allerdings profitieren vom Versicherungsmodell vor allem große Konzerne, die die hohen Prämien und komplexen Anforderungen auch stemmen können. Kleinere und mittlere Betriebe setzen zwar ebenfalls vermehrt auf Cyberversicherungen, scheitern aber oft an den umfangreichen Auflagen.

„Viele Manager sind es einfach leid geworden, den immer neuen Anforderungen hinterherzulaufen, zumal Cybersecurity ohnehin selten als wertschöpfend gilt.“
THOMAS
FININ GMBH
Experten wie Thomas Unterleitner warnen daher vor der überhasteten Annahme, eine Versicherung sei eine Garantie für Sicherheit. Im Schadensfall wird die versprochene Summe häufig nicht in voller Höhe ausgezahlt –entweder, weil ein Detail in den Compliance-Anforderungen nicht erfüllt wurde oder bestimmte Angriffsszenarien nicht gedeckt sind. Gerade für KMU, die im Vertrauen auf ihre Police andere Sicherheitsinvestitionen reduzieren, kann das fatal enden.
Eines bleibt in Sachen Schutzmaßnahmen letzten Endes aber stets unerlässlich: nämlich sich vom falschen Glauben zu lösen, dass es so etwas wie absolute Sicherheit gibt. „Sicherheit ist kein Produkt, das man kauft, sondern ein Prozess“, betonen die Sicherheitsexperten Stelzhammer und Unterleitner unisono, „und wir haben es kulturell noch nicht internalisiert, dass man Sicherheit heutzutage anders denken muss.“ Unternehmen müssen sich ultimativ von der Vorstellung verabschieden, dass eine einmalig installierte Software langfristigen Schutz bietet. Entscheidend hingegen ist eine Sicherheitskultur, die Prozesse, Technik und Menschen gleichermaßen umfasst.
UBIT-Kongress 2025: Diana Kinnert über die neue Einsamkeit –und warum sie unsere Demokratie gefährdet.
Am 23. Oktober findet ab 8:30 Uhr in der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck der diesjährige UBIT-Kongress statt – der wichtigste Branchentreffpunkt für Unternehmensberater*innen, Buchhalter*innen und IT-Dienstleister*innen in Tirol. Ein Höhepunkt des Tages ist die Keynote von Diana Kinnert, Unternehmerin, Autorin und Politikerin. Sie greift mit ihrem Vortrag „Die neue Einsamkeit. Wie Digitalisierung und Rationalisierung zur Gefahr für die Demokratie werden“ ein hochaktuelles gesellschaftliches Thema auf. Kinnert beschreibt dabei eine Entwicklung, die in der modernen Leistungsgesellschaft zunehmend sichtbar wird: Die Digitalisierung hat uns zwar vernetzter, aber nicht zwingend verbundener gemacht. Virtuelle Kommunikation ersetzt persönliche Begegnungen, Arbeit und Leben werden rationalisiert, Effizienz wird zum Maß aller Dinge – und genau darin sieht Kinnert eine
Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Einsamkeit, so ihre These, ist längst kein individuelles, sondern ein politisches Problem. Wer sich dauerhaft ausgeschlossen oder ungehört fühlt, verliert Vertrauen – in sich selbst, in andere und letztlich auch in die demokratischen Institutionen. Damit wird Einsamkeit zu einem Nährboden für Polarisierung und Populismus.
Beim UBIT-Kongress spricht Kinnert darüber, wie Unternehmen, Politik und Gesellschaft diesem Trend entgegenwirken können – durch echte Begegnungen, durch Werteorientierung in der digitalen Transformation und durch neue Formen des Miteinanders. Ihr Appell: Nur wenn wir wieder lernen, Beziehungen zu pflegen, statt Prozesse zu optimieren, bleibt unsere Demokratie lebendig. Der UBIT-Kongress bietet neben dieser spannenden Keynote zahlreiche Impulse, Praxisbeispiele und Ver-

netzungsmöglichkeiten für Fachleute und Interessierte. Zum Anmelden scannen Sie einfach den QR-Code. PR


Welche Vorkehrungen empfehlen die Experten, um die wesentlichen Voraussetzungen für eine wirksame Sicherheitskultur zu schaffen.
STANDARDAUSRÜSTUNG
Firewalls, Virenscanner und E-Mail-Filter gehören seit gut 25 Jahren zur Grundausstattung. Sie sind ausgereift und bieten zumindest gegen bekannte Bedrohungen eine Schutzwirkung von bis zu 99 Prozent. Doch sie stoßen an Grenzen, wenn es um neue Angriffsmethoden wie Zero-Day-Exploits oder hochentwickelte Phishing-Mails geht. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, sich nicht in falscher Sicherheit zu wiegen, sondern kontinuierlich nachzurüsten. Auch Smartphones dürfen dabei nicht vergessen werden (Antivirus-Software und Anti-Stalkerware bieten grundlegenden Schutz).
BEWUSSTE SOFTWAREWAHL
Bei Sicherheitssoftware zählen zertifizierte Namen. Ob Kaspersky, McAfee oder Microsoft – die großen Anbieter liefern verlässliche Produkte. Wer nur die kostenlosen Versionen nutzt, spart am falschen Ende. Für wenige Euro im Monat sind solide Unternehmenslösungen erhältlich (etwa die Microsoft-Businesslösung für monatlich drei Euro), die nachweislich besseren Schutz als ihre kostenlosen Pendants bieten. Der Unterschied zeigt sich insbesondere bei Phishing-Angriffen, wo die Erkennungsraten stark variieren.
DATENSICHERUNG
Regelmäßige und/oder automatisierte Backups gelten als Lebensversicherung jedes Unternehmens. Sie sollten auf externen Datenträgern oder in der Cloud erfolgen und konsequent vom System getrennt werden, um Ransomware keine Angriffsfläche zu bieten. Wichtig: Backups sollte man auch mindestens zwei Monate lang aufbewahren, da Hacker oft mit dem Faktor Zeit arbeiten. Wer diese Routine pflegt, kann im Ernstfall innerhalb von 24 Stunden wieder arbeitsfähig sein.
IDENTITÄTEN SCHÜTZEN
Starke Passwörter und Multifaktor-Authentifizierung (MFA) fügen eine zusätzliche Hürde für potenzielle Angreifer*innen hinzu. Zusätzlich sollten Passwörter regelmäßig erneuert werden. Vor allem KMU sind bekannt dafür, über Jahre hinweg dieselben Passwörter zu verwenden, oft mit fatalen Auswirkungen. Bei der Passworterneuerung gelten zwei Maxime: Erstens erschweren lange, komplexe Passwörter in Kombination mit MFA Angreifer*innen den Zugang erheblich. Zweitens sollte man Passwörter nicht von Standard-KI
erstellen lassen, da diese Passwörter häufig nach denselben (bekannten) Mustern kreiert.
REGULIERUNG VON REMOTE WORK
Mit der Verbreitung von Telearbeit sind auch die Angriffsflächen gewachsen. Unternehmen sollten klare Richtlinien für den Zugriff auf Ressourcen definieren, Geräte mit Festplattenverschlüsselung sichern und Remote-Verbindungen ausschließlich über VPNs mit MFA zulassen. Zusätzlich lohnt es sich, ungewöhnliche Aktivitäten im Netzwerk aktiv zu überwachen und Mitarbeitende regelmäßig für die Risiken der Telearbeit zu sensibilisieren. Denn auch Achtsamkeit gehört wiederholt geschult und geht über einmalige Trainings während der Onboarding-Phase hinaus.
DIFFERENZIERTES
TECHNOLOGIEVERSTÄNDNIS
Nicht jede neue Technologie ist automatisch ein Gewinn für die Sicherheit. Standard-KI-Systeme beispielsweise, die auf alle Daten zugreifen können, bergen massive Risiken. Besser ist es, spezialisierte Modelle einzusetzen und sensible Datensätze voneinander zu isolieren. Genauso wichtig sind bewährte Basics wie Least-Privilege-Zugriffe, saubere Trennung von Verantwortlichkeiten und regelmäßige Prüfungen von Seiten der Berechtigungen.
VORSICHT STATT ANGST
Neben dem technischen Aspekt bleibt der Faktor Mensch zentral. Mitarbeiter*innen sollten lernen, IBANs oder Absenderadressen genau zu prüfen und bei Zweifeln lieber einmal mehr nachzufragen. Dieses gesunde Misstrauen schützt vor Fehlern ebenso wie vor Angst, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wer panisch reagiert, trifft meist die falschen Entscheidungen. Klare Prozesse und ein eingeübter Incident-Response-Plan dienen als ergänzende Mittel gegen die Ohnmacht im Ernstfall.

Zwei Drittel der Arbeitnehmer*innen in Deutschland haben bereits auf unbekannte Links geklickt, die potenziell Malware enthalten. Das zeigt die repräsentative Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ von der G DATA CyberDefense AG, Statista und brand eins. Der Hauptgrund: Neugier. Die kann letztlich die IT-Sicherheit ganzer Firmen gefährden. Auf dem ersten Platz der größten Risiken: Pop-up-Werbung, die beispielsweise mit falschen Gewinnspielen lockt. Fast ebenso viele Menschen öffnen unsichere Webseiten, die als seriöses Angebot getarnt sind, oder scannen unbekannte QR-Codes, die manipuliert sein und auf eine betrügerische Seite weiterleiten könnten. Eine erfolgreiche IT-Sicherheitsstrategie berücksichtigt neben technischen Sicherheitsmaßnahmen deshalb vor allem den den Faktor Mensch – zum Beispiel mit Hilfe von speziellen Security-Awareness-Trainings. In Österreich dürfte die Situation nicht recht viel besser sein. „Cybersicherheit in Zahlen“ gibt‘s zum Download hinter dem (sicheren!) QR-Code.

Laut einer aktuellen Value-in-Motion-Studie von PwC könnte Künstliche Intelligenz (KI) das weltweite Wirtschaftswachstum bis 2035 um bis zu 15 Prozentpunkte steigern – ein Impuls vergleichbar mit dem der Industriellen Revolution. Damit KI jedoch ihr volles wirtschaftliches Potenzial entfalten kann, muss sie als sicher, verlässlich und regelkonform im Sinne ethischer Standards gelten. Fehlt dieses Vertrauen – sowohl bei Unternehmen als auch in der Öffentlichkeit –sinkt das zusätzliche Wachstumspotenzial je nach Szenario auf acht Prozentpunkte bis lediglich einen Prozentpunkt. Eine globale Studie von Kyndryl, einem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Technologiediensten, indes zeigt, dass ein Großteil der Firmen noch gar nicht in der Lage ist, das volle Potenzial von KI überhaupt zu nutzen. Lediglich 14 Prozent haben ihre KI-Investitionen erfolgreich mit einer Strategie kombiniert, die nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf die Weiterbildung und Vorbereitung ihrer Beschäftigten setzt, 45 Prozent der CEOs glauben gar, dass ihre Mitarbeiter*innen die Technologie ablehnen. Eine überwiegende Mehrheit der Unernehmen hat zwar in KI investiert, aber nur rund ein Fünftel setzt sie auch für neue Produkte oder Dienstleistungen ein. Meist wird sie vor allem zur Effizienzsteigerung genutzt.

Die betriebliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) bietet Österreichs Unternehmen ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte sie Österreichs BIP um 40 Milliarden Euro erhöhen. Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt Unternehmen dabei, dieses Potenzial für sich zu entdecken und fit für die Nutzung dieser Schlüsseltechnologie zu werden. Das sichert den langfristigen Erfolg der Betriebe und stärkt den Wirtschaftsstandort Österreich. Unter anderem hat die Wirtschaftskammer KI-Guidelines für Klein- und Mittelbetriebe zusammengestellt, um ihnen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der ihnen bei der Integration und dem Einsatz von KI-Anwendungen helfen soll. Zum Download scannen Sie bitte einfach den QR-Code.
www.watchlist-internet.at
Die Seite informiert unabhängig und aktuell zu Internetbetrug und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Fallen und Fakes immer im Blick.
www.it-safe.at
Die Seite der Wirtschaftskammer Österreich bietet wichtige Infos, wie Sie sich und Ihr Unternehmen gegen Cyberangriffe wappnen können.
0800 888 133
Wenn Ihr Unternehmen Opfer einer Cyberattacke, von Ransomware oder Verschlüsselungstrojanern wurde, erhalten Sie unser dieser Notfallnummer der Wirtschaftskammer rund um die Uhr und kostenlos rasche telefonische Erstinformation und Notfallhilfe.
Seit einem Jahrzehnt analysiert die Studie „Cybersecurity in Österreich“ von KPMG und KSÖ systematisch die aktuelle Lage in Österreich. Die diesjährige zehnte Ausgabe markiert dabei einen Wendepunkt. Lagen die Schwerpunkte in den vergangenen Jahren auf den Säulen der Informationssicherheit (Vertraulichkeit/Confidentiality und Verfügbarkeit/ Availability) zeigt sich 2025 ein neues, drängendes Problem: Die Integrität/Integrity von Daten, Systemen und Prozessen wird zum zentralen Sicherheitsfaktor. Die Key-Findings.

53 %
DES DATENDIEBSTAHLS ERFOLGEN DURCH GEZIELTES PHISHING.
64 %
38 %
DER UNTERNEHMEN HATTEN SCHÄDEN DURCH CYBERANGRIFFE IN FORM VON KOSTEN FÜR ERMITTLUNGEN UND ERSATZMASSNAHMEN.
WISSEN NICHT, WELCHE AUSWIRKUNGEN ANGRIFFE AUF DIE LIEFERKETTE FÜR SIE HÄTTE. 48 %
DER TÄTER*INNEN STAMMEN AUS DEM UMFELD ORGANISIERTER KRIMINALITÄT
24 %
DER SOCIALENGINEERINGVERSUCHE LAUFEN ÜBER BEWERBUNGEN AUF STELLENANZEIGEN.
10 %
JEDER 10. SOCIALENGINEERINGVERSUCH NUTZT BEREITS DEEPFAKE FÜR SPRACH- UND VIDEONACHRICHTEN.
14 %
JEDER SIEBTE CYBERANGRIFF IN ÖSTERREICH IST ERFOLGREICH
32 %
BEI JEDEM DRITTEN UNTERNEHMEN WAREN LIEFERANT*INNEN ODER DIENSTLEISTER*INNEN OPFER VON CYBERANGRIFFEN, DIE WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DAS EIGENE UNTERNEHMEN HATTEN.
28 %
MEHR ALS JEDER VIERTE ANGRIFF IST AUF STAATLICH UNTERSTÜTZTE AKTEUR*INNEN ZURÜCKZUFÜHREN.
62 %
KONNTEN CYBERANGRIFFE MITHILFE DER EIGENEN MITARBEITER*INNEN IDENTIFIZIEREN – VOR TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND SYSTEMEN.
41 %
DER ANGRIFFE KAMEN AUS DEM ASIATISCHEN RAUM 29 % DER ANGRIFFE HATTEN EUROPÄISCHEN URSPRUNG, KEINE DAVON KAMEN AUS ÖSTERREICH. 8 % KAMEN AUS NORDAMERIKA, 2 % AUS SÜDAMERIKA. SO WEIT DIE BEKANNTEN REGIONEN. 43 % DER BEFRAGTEN UNTERNEHMEN WISSEN ALLERDINGS NICHT, WOHER DIE CYBERATTACKEN GEGEN SIE KOMMEN.
25 %
FÜR JEDES VIERTE UNTERNEHMEN WAREN EIN INEFFEKTIVES UND UNZUREICHENDES PATCHMANAGEMENT*) UND DER SCHUTZ VOR SCHWACHSTELLEN AUSLÖSER FÜR ERFOLGREICHE ANGRIFFE.
SAGEN, DASS ÖSTERREICH NICHT
GUT DARAUF VORBEREITET
IST, AUF SCHWERWIEGENDE
CYBERANGRIFFE GEGEN DIE
KRITISCHE INFRASTRUKTUR ZU REAGIEREN.
Inmitten all dieser Umbrüche bleibt der Mensch der entscheidende Faktor für die Cyberabwehr. Man könnte es als Ironie bezeichnen, dass ausgerechnet der Mensch, der oft als Einfallstor für Cyberangriffe gilt, es ist, der gleichzeitig eine Barriere gegen die immer ausgeklügelteren Angriffe darstellt. Arbeiten Algorithmen und Sicherheitssysteme mit mathematischer Präzision, sind es am Ende doch Intuition, kritisches Denken und menschliche Erfahrungswerte, die den Unterschied machen. 55 %
60 %
WÜRDEN BEVORZUGT SECURITY-LÖSUNGEN VON ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN EINSETZEN.
DAS IST EINE ZUNAHME UM 23 % GEGENÜBER DEM VORJAHR.

17 %
SAGEN, DASS KI DIE CYBERSICHERHEIT VERBESSERT HAT. KI HAT ALSO NOCH NICHT DIE
ERHOFFTEN FORTSCHRITTE GEBRACHT.
22 %
HABEN EINEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GLOBALEN GEOPOLITISCHEN KONFLIKTEN UND CYBERANGRIFFEN AUF IHR UNTERNEHMEN FESTGESTELLT.
CYBERSECURITY IN ÖSTERREICH
Zum zehnten Mal in Folge zeichnet die KPMG in Kooperation mit dem Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ) mit der Studie „Cybersecurity in Österreich“ ein aktuelles Lagebild. Basierend auf den Erfahrungen von 1.391 heimischen Unternehmen zum Thema Cyberkriminalität und -sicherheit sowie Interviews mit 26 Expert*innen gibt die Studie einen Überblick über aktuelle Trends und neue Herausforderungen.
Die Studie können Sie kostenlos unter www.kpmg.com/cyber und nach Scan des QR-Codes anfordern.



Marc Alwers und Jannik Küchler, Head of Sales bei icons – consulting by students
Wenn künstliche Intelligenz gleichzeitig angreift und verteidigt.
VON MARC ALWERS UND JANNIK KÜCHLER
Ein Klick und das Videomeeting beginnt. Auf dem Bildschirm erscheinen vertraute Gesichter: Der Finanzvorstand aus der Londoner Zentrale sowie mehrere Kollegen. Die Stimmen sind klar, die Anweisungen präzise. Es geht um eine dringende Transaktion, die sofort getätigt werden muss. Bestätigt durch den CFO führt man die Anweisungen als gewissenhafter Mitarbeiter der Hongkonger Niederlassung aus, Überweisung nach Überweisung, insgesamt fließen rund 25 Millionen US-Dollar. Die Bestätigung scheint Formsache. Ein Meeting, das in dieser Form überall auf der Welt tagtäglich stattfindet. Erst später, in einem echten Telefonat mit der Zentrale, der Schock. Es gab kein Meeting: Die Personen auf dem Bildschirm, ihre Mimik, ihre Stimmen, alles eine Fälschung, generiert von künstlicher Intelligenz.
Dieser reale Vorfall ist keine ferne Zukunft, er ist eine Warnung aus der Gegenwart und katapultiert eine Frage aus den IT-Abteilungen direkt in die Vorstandsetagen: Wer gewinnt im neuen Wettrüsten der KI-Systeme – die Angreifer oder die Verteidiger? Dieses digitale Kräftemessen gleicht einem permanenten Schlagabtausch, bei dem die KI auf beiden Seiten genutzt wird. Die Offensive nutzt KI, um ihre Angriffe auf ein neues Niveau zu heben. Phishing-EMails sind nicht länger plumpe Massennachrichten, sondern psychologisch raffinierte, personalisierte Anschreiben, die auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen über das Ziel perfekt zugeschnitten werden. Voice-Cloning-Technologien benötigen heute nur noch wenige Sekunden Audiomaterial, um eine Stimme täuschend echt zu klonen und damit Vertrauen zu erschleichen. Parallel dazu entwickeln Angreifer adaptive Malware, die nicht mehr statisch ist, sondern wie ein lebender Organismus agiert. Sie kann ihren
eigenen Code verändern, um Virenscannern zu entgehen, sich im Netzwerk verstecken und auf Gegenmaßnahmen intelligent reagieren.
Doch die Verteidigung schläft nicht. Im Gegenschlag setzt sie auf eine KI-gestützte Anomalieerkennung, die wie ein digitales Immunsystem für das Unternehmen agiert. Sie lernt das „normale“ Verhalten wie typische Datenflüsse, übliche Anmeldezeiten, gewöhnliche Transaktionsmuster und schlägt sofort Alarm, wenn eine Aktivität aus diesem Rahmen fällt. Der adaptiven Malware begegnet sie mit vorausschauender Bedrohungsanalyse. Anstatt nur auf bekannte Signaturen zu warten, scannen diese Systeme das Internet, das Darknet und globale Bedrohungsdaten, um Angriffsinfrastrukturen zu identifizieren und neue Taktiken zu erkennen, bevor sie überhaupt zum Einsatz kommen. Die nächste Evolutionsstufe dieser Dynamik, die als gewaltiger Katalysator für beide Seiten dienen wird, ist „Agentic AI“. Hier agieren autonome KI-Schwärme: Offensive Agenten werden koordiniert Aufklärung betreiben, Schwachstellen finden und Angriffe durchführen, während defensive Schwärme ebenso autonom Netzwerke überwachen, Bedrohungen neutralisieren und sich in Echtzeit anpassen.
WER GEWINNT DAS KRÄFTEMESSEN?
Offensive KI ermöglicht neue Wege der Täuschung und entdeckt ständig unerwartete Schwachstellen, defensive KI hingegen pariert durch skalierbare Überwachungsprotokolle und präventive Abwehrmechanismen. Doch diese Betrachtung eines reinen Maschinenkriegs greift zu kurz. Führende Sicherheitsexperten sind sich einig, dass KI ein „Force Multiplier“ ist, ein Kraftverstärker. Sie verstärkt, was bereits da ist: Menschliche Genialität auf der Angreifer- und menschliche Wachsamkeit auf der Verteidigerseite. Die eigentliche
VERSTÄRKT, WAS BEREITS DA IST: MENSCHLICHE GENIALITÄT AUF DER ANGREIFER- UND MENSCHLICHE WACHSAMKEIT AUF DER VERTEIDIGERSEITE.
Frage lautet daher nicht, ob eine KI eine andere besiegen kann, sondern: Können KI-gestützte menschliche Verteidiger den Vorteil gegenüber KI-gestützten menschlichen Angreifern behaupten? Der Konflikt wird nicht zwischen autonomen Algorithmen entschieden, sondern bleibt ein zutiefst menschlicher, der durch Technologie lediglich beschleunigt und verstärkt wird. In diesem neuen Paradigma wandelt sich die Rolle des Sicherheitsexperten vom Techniker, der Alarme abarbeitet, zum „AI-Shepherd“, einem strategischen Hirten, der die KI-Systeme anleitet und ihre Taktik vorgibt. Für Unternehmer und Führungskräfte bedeutet diese neue Dynamik vor allem eines: Passivität ist die teuerste und gefährlichste Option. Es ist an der Zeit, den Status quo der eigenen Sicherheitsstrategie grundlegend zu hinterfragen und sich von der reaktiven Denkweise zu verabschieden. Der erste Schritt ist eine ehrliche Analyse. Ist Ihre Organisation darauf vorbereitet, einer Welt zu begegnen, in der Sie einem Anruf Ihres eigenen CEOs nicht mehr blind vertrauen können? Falls nein, dann muss durch ein kulturelles Umdenken ein Bewusstsein für KI und zugehörige Bedrohungen geschaffen werden. Zweitens rückt die menschliche Expertise in
den Mittelpunkt. Der IT-Sicherheitsbereich erfordert eine Erweiterung um KI-Kompetenzen, die durch die Weiterbildung bestehender Experten oder die Einstellung neuer Talente gewonnen wird. Sicherheit kann also nicht einfach als fertiges KI-Produkt gekauft werden, sondern erfordert einen fähigen Anwender, weshalb der Aufbau interner Fähigkeiten zur Steuerung dieser Systeme unabdingbar ist. ,Somit wird der menschliche Faktor in diesem neuen Zeitalter des permanenten digitalen Konflikts noch kritischer und erfordert eine breitere und tiefere Expertise als je zuvor.
Im Jahr 2006 von einer Gruppe Studierender als Innsbruck CONsulting gegründet und inzwischen mit insgesamt drei Standorten in Innsbruck, Wien und Graz vertreten, ist icons – consulting by students eine studentische (und damit von konventionellen Unternehmen unterscheidbare) Unternehmensberatung. Das Ziel der Organisation ist es, Unternehmen innerhalb von Beratungsprojekten bei Problemen und Ambitionen von der Gründung bis hin zu Fragen des Alltags in großen Konzernen zu unterstützen. www.icons.at
www.immobilien-jenewein.at HERZTRANSPLANTATIONEN ÜBERNEHMEN CHIRURGEN.
IHRE IMMOBILIE VERKAUFEN WIR.

Im exklusiven Rahmen des Rasmushofes am Fuße der Streif in Kitzbühel findet am 17. und 18. Juni 2026 das elfte Kitzbüheler Führungsforum statt. Das spannende Thema der hochkarätigen Vortragsreihe lautet „Leadership & Verantwortung im KI-Zeitalter“.

Wenn Private Banker Christian Blaschke zum Kitzbüheler Führungsforum lädt, dann teilen Topreferent*innen aus den verschiedensten Bereichen ihr wertvolles Wissen und ihren langjährigen Erfahrungsschatz mit den Teilnehmer*innen. Darüber hinaus bietet das Forum eine hervorragende Gelegenheit für Networking, um Kontakte mit anderen Führungskräften und Branchenexpert*innen zu knüpfen.
ECO.NOVA: Das Kitzbüheler Führungsforum findet im Juni 2026 bereits zum elften Mal statt. Wie kam es zur Idee, diese Veranstaltung ins Leben zu rufen? CHRISTIAN
BLASCHKE: Die Idee entstand aus einer Wette heraus. Ein Freund wettete mit mir bei einem Seminarbesuch, dass ich eine Kiste Wein bekomme, wenn ich es besser mache. Da ich ja schon seit über 20 Jahren Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen hatte, nahm ich die Wette an. Das Kitzbüheler Führungsforum ist das Ergebnis und dass es sich über die Jahre so erfolgreich entwickelt hat und bereits zum 11. Mal stattfindet, freut mich sehr und ist für mich auch eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Worin unterscheidet sich das Kitzbüheler Führungsforum von anderen Veranstaltungen? Zum einen wähle ich die Vortragenden frei aus, ohne an irgendwelche Sponsoren gebunden zu sein. Es ist uns für 2026 wieder gelungen, absolute Topreferenten nach Kitzbühel zu holen. Zum anderen möchte ich den Rahmen exklusiv und gediegen halten. Wir starten traditionell am Vortag mit einem netten Ausflug zu einem Highlight in der Kitzbüheler Gegend und treffen uns dann am Vorabend zu einem spannenden Kamingespräch mit einem interessanten Gesprächspartner. Im Juni 2026 werden Dr. Bernhard Baumgartner als Spezialist für Familienunternehmen und Topwinzer Toni Bodenstein spannende Inputs weitergeben. Am Seminartag erwarten uns wie immer inspirierende Vorträge, die nicht nur informativ sind, sondern auch Mut machen, Verantwortung in unsicheren Zeiten zu übernehmen.
An wen richtet sich das Kitzbüheler Führungsforum? Unsere Teilnehmer*innen sind vorwiegend Unternehmer und Führungskräfte aus Tirol, Südtirol und dem süddeutschen Raum. Etwa zwei Drittel sind Wiederholungsbucher und somit schon zu
Christian Blaschke, Private Banker und Veranstalter des Kitzbüheler Führungsforums, bringt wieder hochkarätige Referent*innen nach Kitzbühel.
Stammgästen geworden. Es ist über die Jahre ein schönes Netzwerk mit wertvollen Kontakten entstanden – es wird ausreichend Zeit für den Austausch untereinander eingeplant wie beispielsweise beim vorabendlichen Kamingespräch oder beim viergängigen Mittagsmenü, zu dem auch gerne ein gutes Glaserl Wein serviert wird.
Was ist Ihre Intention dahinter? Es ist für mich neben meiner Tätigkeit als Direktor im Private Banking der Alpen Privatbank Innsbruck eine sehr spannende und schöne Aufgabe, die mir Spaß macht und die ich in meiner Freizeit mit meiner Frau und meinen Töchtern mit großer Freude ausübe. Wir arbeiten schon jetzt voller Euphorie daran, das Kitzbüheler Führungsforum wieder zu einer exklusiven und inspirierenden Veranstaltung gedeihen zu lassen.
Für weitere Infos und Anmeldungen scannen Sie bitte den QR-Code.
Leadership und Verantwortung im KI-Zeitalter.
Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Technologien, sondern auch das Verständnis von Führung. Im Zeitalter von Automatisierung, Datenmacht und lernenden Systemen sind neue Formen von Leadership gefragt. Wie Sie im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Ethik führen können, zeigen Ihnen Expertinnen und Experten beim 11. Kitzbüheler Führungsforum. Das Programm und die Vortragenden:





1 7. JUNI 2026
Ab 15 Uhr Ausflug zum Wildpark Aurach, wo Dr. Bernhard Baumgartner über Familienunternehmen und deren Zukunftsgestaltung spricht, und Sie mit einer Speckjause gestärkt werden. Ab 18 Uhr Aperitif und Kamingespräch mit Toni Bodenstein vom Weingut Prager zum Thema Verantwortung und Nachhaltigkeit im Weinbau.
1 8. JUNI 2026
9 Uhr: Begrüßung und Eröffnung
Der Bürgermeister von Kitzbühel Dr. Klaus Winkler und die Wirtin des Rasmushofs, Signe Reisch, eröffnen das 11. Kitzbüheler Führungsforum 2026.
NICOLA FRITZE: SPEAKERIN, AUTORIN & TRAINERIN
V ERANTWORTUNG: EINFACH. MACHEN!
W IE KOMMEN WIR INS HANDELN?
In diesem aktivierenden Vortrag erklärt die inspirierende Speakerin, wie es uns gelingen kann, ins Machen zu kommen. Raus aus der Komfortzone, hin zu Veränderung und Wachstum!
MATTHIAS WASINGER, MOS, PHD:
OBERST DES GENERALSTABSDIENSTES
F ÜHREN IM ZEITALTER DER ALGORITHMEN: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ,
K RIEG UND DIE ZUKUNFT VON LEADERSHIP
Oberst Matthias Wasinger wirft einen Blick auf die Realität moderner Kriege, die Macht und das Potenzial der Algorithmen sowie die Frage, wie sich Leadership in einer Welt wandelt, in der Geschwindigkeit und Daten als die neue Währung gehandelt werden.
DR. HERMANN HAUSER: BUSINESS ANGEL UND VENTURE-CAPITALIST
V ON MUSKELKRAFT ZU DENKKRAFT: KI ALS TREIBER DER NÄCHSTEN EPOCHE
Hermann Hauser zeigt in seinem Vortrag, wie KI unsere Denkkraft erweitert, welche Rolle technische Entwicklungen in Rechenzentren und Chipdesign spielen und warum Energie dabei zum Schlüsselfaktor wird.
GERHARD KÜRNER:
AI BASED BUSINESS EXPERT & INVESTOR | CEO 506.AI
L EADERSHIP IM KI - ZEITALTER – RADIKALER WANDEL UND V ERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT
Die Keynote des KI-Experten zeigt, warum Leadership im KI-Zeitalter radikalen Wandel zulassen muss – nicht aus Kaltherzigkeit, sondern aus Verantwortung für die Zukunft.
ASTRID BRÜGGEMANN: KEYNOTE SPEAKERIN & KI-SPEZIALISTIN
K I ALS DRITTE GEHIRNHÄLFTE – WER KI NICHT NUTZT, D ENKT MIT HALBER KRAFT
Astrid Brüggemann spricht inspirierend, fundiert und unterhaltsam. Freuen Sie sich auf ihre ansteckende Begeisterung für die clevere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
Nicht nur ansprechend und heimelig, sondern auch nachhaltig und gesund: der Holzbau bietet im Privatbereich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Faszination für den Baustoff Holz mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten begleitet Andreas Plunser schon lange. Dieser Funke ist auch auf seinen Sohn Christof übergesprungen, der als einer der jüngsten Holzbaumeister Tirols das Familienunternehmen Holzbau Aktiv mit großer Begeisterung in die Zukunft führen wird.
TEXT: DORIS HELWEG
Es war am Josefitag 2007, dem Tag des Schutzpatrons der Zimmerer, an dem Andreas Plunser den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und seinen Zimmereibetrieb Holzbau Aktiv gründete. Mit einem großen Erfahrungsschatz im Gepäck und seiner unabdingbaren Leidenschaft für den Holzbau startete er sein Business vorerst eingemietet in einer Gewerbehalle in Zirl mit einer Partie, also einem Trupp aus drei bis vier Handwerkern. Sein gnadenloser Anspruch an sich selbst, mit sauberer Arbeit und hoher
Qualität zu überzeugen, bescherte ihm mehr und mehr anspruchsvolle Aufträge, angefangen von herausragenden Privatvillen bis hin zu gewerblichen Bauten wie Reitanlagen in Inzing oder Sportanlagen in Sistrans. Heute beschäftigt das Holzbauunternehmen um die 20 Mitarbeiter*innen und hat 2012 mit einem eigenen Unternehmensstandort ein Holzbauobjekt in Passivhausstandard geschaffen. „Holz ist das umweltfreundlichste Baumaterial der Welt“, erklärt Andreas Plunser. „Wir beziehen unser Holz ausschließlich aus österreichischen Wäldern mit kurzen
Transportwegen.“ Das Rohmaterial Holz bietet unschlagbare Vorteile: Es reguliert auf natürliche Weise Wärme und Feuchtigkeit und schafft ein ideales Raumklima. Dank seiner optimalen Dämmwerte spart es Energie, ist vibrationsdämpfend und bietet einen wunderbaren Schallschutz. „Holzbauweise bedeutet außerdem: Bauen ohne Schadstoffe und ohne Chemie von Lacken, Kunststoffen oder herkömmlichen Dämm-Materialien. Familien und Allergiker können demnach aufatmen, denn in Holzhäusern ist schadstofffreies und gesundes Leben und Arbeiten
möglich.“ Das riecht man auch beim Betreten des Bürogebäudes und der Werkshallen. Nur der angenehme Geruch von Holz strömt einem durch die Nase – ein Wohlfühlfaktor, den auch die Belegschaft zu schätzen weiß.
QUALITÄT VOR QUANTITÄT
Mit seinem eigenen Gewerbebau repräsentiert Holzbau Aktiv gleichermaßen seine hohen Passivhausstandards, die es in seinen Bauten umsetzt. Denn Holz beeindruckt nicht nur durch seine besondere Ästhetik, seine behagliche Ausstrahlung und Wohlbefinden, sondern auch in der Summe seiner technischen Möglichkeiten. „Der Baustoff Holz ermöglicht enorme gestalterische Freiheit und ein Höchstmaß an Individualität für seine Bauherren. Das Öko.Aktiv Haus vereint Massivholz-Bauweise mit den Vorzügen des Element-System-Baus, was bedeutet, dass wir so viel wie möglich in unserer Halle vorproduzieren. Das ermöglicht eine äußerst kurze Bauzeit auf der Baustelle von etwa ein bis zwei Wochen“, erklärt Andreas Plunser.
Auch Sohn Christof Plunser teilt die Leidenschaft für den Holzbau und bringt sich nach Abschluss der HTL Hochbau und dem Holzbaumeister mit bereits 22 Jahren schon aktiv ins Unternehmen ein. Ihm ist es auch zu verdanken, dass kürzlich mit der Anschaffung des ROBOT-Compact 650 in eine zukunftsfähige Holzbearbeitungstechnik investiert wurde und so stetig neue Maßstäbe in Qualität und Effizienz gesetzt werden. „Diese Investition macht uns ein Stück mehr unabhängig und lässt uns noch schneller und nachhaltiger agieren“, erklärt Christof Plunser. In den kommenden Jahren wird er mehr und mehr in die Geschäftsführung eintauchen und das Familienunterneh-

„HOLZ IST DAS UMWELTFREUNDLICHSTE BAUMATERIAL DER WELT. WIR BEZIEHEN UNSER HOLZ AUSSCHLIESSLICH AUS ÖSTERREICHISCHEN WÄLDERN MIT KURZEN TRANSPORTWEGEN.“
Andreas Plunser
men übernehmen. Auf den wertvollen Erfahrungsschatz seines Vaters will er jedenfalls noch einige Zeit zurückgreifen und mit seinen neuen Ideen ineinanderfließen lassen.
Firmengründer Andreas Plunser will sich in den kommenden Jahren nach und nach zurückziehen und den Junior tatkräftig in die Richtung unterstützen, dass er in spätestens fünf Jahren die Geschäftsleitung übernehmen kann. Die nähere Zukunftsvision beider ist jedenfalls die Erweiterung des Gewerbegrundstücks um weitere 2.000 bis 3.000 Quadratmeter für die Errichtung

einer zweiten Montagehalle. „Individuelle Holzhäuser so weit wie möglich vorzuproduzieren braucht neben professioneller Handwerkskunst auch ausreichend verfügbaren Platz“, so Plunser. Deshalb soll der Zusammenbau der vorgefertigten Teile künftig in der neu errichteten Halle stattfinden. Und so sind Andreas und Christof Plunser mit dem gesamten Team immer auf der Suche nach neuen holzbaulichen Ideen, die den zeitgemäßen Ansprüchen von Innovation, Ästhetik, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit entsprechen.
Mit seinem eigenen Betriebsgebäude in Passivhausstandard zeigt Holzbau Aktiv, dass Holzbau auch im Gewerbebau bestens funktioniert.


Das in Berlin gegründete Unternehmen Moss hat sich zu Europas führender Lösung für Ausgabenmanagement im Mittelstand entwickelt und bietet Unternehmen in Echtzeit volle Transparenz und Kontrolle über ihre Ausgaben. Insgesamt hat Moss bereits über 130 Millionen Euro eingesammelt und mittlerweile über 6.000 Kunden in Europa. Im Sog des starken Wachstums in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien setzt Moss nun seinen Expansionskurs fort – mit Österreich als nächstem Kernmarkt. Die Plattform richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen und ermöglicht die umfassende Digitalisierung ihrer Finanzprozesse von Firmenkarten über Reisekosten bis hin zur Rechnungsverarbeitung. „Digitalisierung wird oft gewünscht, aber nicht gelebt. Einerseits wollen Unternehmen heute nicht mehr mit Excel-Listen, Papierbelegen und komplexen Freigabeprozessen arbeiten, andererseits fehlt Zeit, Personal oder die richtige Lösung“, erklärt Anton Rummel, Co-Gründer von Moss und für den österreichischen Markt verantwortlich. Moss wolle hier vieles vereinfachen und zählt bereits hunderte Unternehmen in Österreich zu seinen Kund*innen – von Start-ups wie HelloBello bis hin zur Bergsportmarke Alpin Loacker. „Dass wir in den letzten Monaten Dutzende Neukunden gewinnen konnten, zeigt uns, dass gerade Themen wie fehlende Transparenz bei laufenden Ausgaben oder zeitaufwändige manuelle Eingaben und Freigabeprozesse die meisten Unternehmen beschäftigen. Wir sehen, dass aktuell die Bereitschaft, etwas zu verändern, wächst“, so Rummel. Die Software setzt dabei auf vollständige Lokalisierung inklusive österreichischer Per-Diem-Regelungen (Tagespauschalen), Umsatzsteuercodes und Rechnungsstandards. Hinzu kommt eine direkte Schnittstelle zur lokalen Buchhaltungssoftware BMD (Business Management Dynamics). Trainiert werden die KI- und Machine-Learning-Modelle mit lokalen Belegen, Rechnungen und Lieferantendaten. Dadurch erkennt die Software automatisch österreichische Steuercodes und Informationen und weist Ausgaben automatisch korrekt zu. Und: Die Lösung fügt sich nahtlos in die bestehenden Prozesse von Finanzteams ein, inklusive der Programme, die im Unternehmen bereits genutzt werden. getmoss.com

Anfang Oktober feierte das Bildungshaus St. Michael in Matrei am Brenner sein 80-jähriges Bestehen, wenige Tage zuvor wurde es mit dem Bildungsinnovationspreis des Landes Tirol ausgezeichnet. Die Ehrung im Spiegelsaal des Tiroler Bildungsforums würdigte ein zukunftsweisendes Konzept zur inklusiven Erwachsenenbildung. Das Projekt „Mittendrin statt außen vor – Inklusion im Bildungshaus weiterdenken“ knüpft dabei an bestehende Freizeit- und Lernangebote für Familien mit behinderten Angehörigen an. Die breite Palette an Angeboten wird längst nicht mehr allein aus Kirchenbeitragsgeldern finanziert. Förderungen, Projektpartner*innen und Neustrukturierungen machen aus dem Bildungshaus St. Michael heute weit mehr als ein Seminarzentrum. Es ist ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen, sich weiterentwickeln und Gemeinschaft erleben können. st.michael.dibk.at

Hochwertige und frisch zubereitete Gerichte rund um die Uhr – das ist das Ziel des Unternehmens happyBytz. Hinter dem Anbieter stehen der Lebensmittelgroßhändler Wedl und der Tiroler Agrarbetrieb Giner, technologischer Partner ist das Hamburger Tech-Start-up goodBytz, das robotergestützte Küchenassistenten entwickelt. Für diese werden nun unter dem Namen „happyBytz“ neue kulinarische Konzepte erarbeitet. Wedl und Giner entwickeln eigens hierfür lizenzierte Rohzutaten sowie kundenspezifische Rezepte und befüllen die Küchenassistenten mit den entsprechenden Lebensmitteln. Die je nach Modell zwischen sechs und zwölf Quadratmeter großen Küchenmodule sind vielseitig einsetzbar und können zum Beispiel als 24/7-Angebot in Kantinen, Kliniken, Bürogebäuden, Schulen, Universitäten, Bahnhöfen oder Flughäfen eingesetzt werden. Wie das funktioniert? Reinklicken unter happybytz.com. ©

Dr. Verena Lorenz LL.M. ist öffentliche Notarin in Kufstein mit Leidenschaft für rechtssichere Lösungen, analog und digital.
Die digitale Beurkundung eröffnet neue Wege.
Ob private Vorsorge wie Testament, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, Schenkungs- und Übergabsverträge, Immobilienkauf oder Unternehmensgründung: Notar*innen stehen Ihnen in allen Lebenslagen beratend zur Seite – und das zunehmend auch online. Viele notarielle Dienstleistungen lassen sich heute bequem per Videokonferenz erledigen, etwa Unterschriftsbeglaubigungen, Vertragsunterzeichnungen oder Gesellschaftsgründungen. Zunächst erfolgt dabei die rechtliche Beratung – persönlich oder digital –, bei der alle Fragen und Anliegen ausführlich besprochen werden. Erst wenn sich die Beteiligten für eine digitale Beurkundung entscheiden, folgt die gesetzlich vorgeschriebene Identifikation.
Praxisbeispiele zeigen, wie flexibel das funktioniert: familieninterne Übergabe mit Beteiligten vor Ort und online, Kaufverträge mit Parteien im In- und Ausland, eine digitale Generalversammlung mit Gesellschafter*innen ortsunabhängig oder einfach eine digitale Unterschriftsbeglaubigung ohne lange Anreise. Dabei müssen nicht alle Parteien digital teilnehmen, auch hybride Formen sind möglich: Eine Partei wird digital zugeschaltet, während andere persönlich im Notariat anwesend sind.
Ich begleite Sie Schritt für Schritt in Ihren rechtlichen Belangen und führe Sie auch durch den Ablauf der digitalen Beurkundung – klar, verständlich und zuverlässig. Gemeinsam mit meinem Team bin ich persönlich und online für Sie da. PR
NOTARIATSKAMMER
FÜR TIROL UND VORARLBERG
Maximilianstraße 3, 6020 Innsbruck ihrnotariat.at

Künstliche Intelligenz gilt als zukünftiger Produktivitätsmotor. Doch welche Folgen hat sie für Unternehmen, Beschäftigte und Europa im globalen Wettbewerb? KI-Experte Markus Kirchmair sieht ökonomische Chancen, aber auch gravierende gesellschaftliche Herausforderungen. Er fordert mehr Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein im unternehmerischen wie privaten Umgang mit KI.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Hand aufs Herz: Haben Sie KI eingesetzt, um dieses Buch über Künstliche Intelligenz zu schreiben? MARKUS KIRCHMAIR: Ja. Es wäre kaum glaubwürdig gewesen, ein Praxisbuch über den Einsatz von KI zu machen und sich zugleich der KI zu verweigern.
Wie haben Sie KI eingesetzt? Die KI hat mich bei der Strukturierung des Buches unterstützt, um während des Schreibprozesses den roten Faden nicht zu verlieren. KI entwickelt sich ungeheuer dynamisch, weshalb bis zur Veröffentlichung sehr viele Überarbeitungen notwendig waren. Und natürlich hat mich die KI auch bei Recherche und sprachlichem Feintuning unterstützt: Es war mir wichtig, eine möglichst objektive Tonalität hinzubekommen. Scheinbar objektive Dokumente wie jene der EU-Kommission sind auch subjektiv gefärbt, da sie mit gewissen Wünschen angereichert sind. Zum Beispiel heißt es von offizieller Seite, dass der AI-Act den Wettbewerb fördere und die Innovationskraft stärke.
Wann sind Sie zum ersten Mal mit der Künstlichen Intelligenz in Berührung gekommen? Ich habe mich seit meiner Kindheit mit Computern beschäftigt. „Intelligente“ Funktionen haben damals
noch nach dem starren Prinzip If...Then...Else –wenn…dann…sonst – funktioniert. Programmierung hat mich schon als Kind fasziniert. Die KI hat sich dann subtiler – und früher – in unseren Alltag eingeschlichen, als man annehmen könnte. Durch banal wirkende Funktionen wie den Vorschlag des nächsten Wortes in SmartphoneTastaturen bis hin zu fortgeschrittenen Tools in der Grafikbearbeitung. Als OpenAI dann im November 2022 mit ChatGPT die ganze Technologiebranche wachgerüttelt hat, war das auch für mich ein verblüffend großer Entwicklungssprung.
„NUR WEIL DIE KI IMMER MEHR ‚DENKT‘, DÜRFEN WIR MENSCHEN
NICHT DAS DENKEN EINSTELLEN.“
Wie haben Sie KI bzw. Large Language Models zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen und inwieweit hat sich Ihre Einschätzung mit der Zeit verändert? Ich habe mich sofort dafür begeistert. Je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr haben sich dann aber auch die Schwächen und Risiken dieser Technologie gezeigt. Noch heute geht
44
es im öffentlichen Diskurs überwiegend um die offensichtlichen, direkten Konsequenzen. Dabei werden allerdings auch viele indirekte Auswirkungen von KI auf Wirtschaft und Gesellschaft oft übersehen.
Können Sie das konkretisieren? Ein Beispiel für indirekte Auswirkungen ist der Entfall der Sprachbarriere. Was wird es für den Arbeitsmarkt bedeuten, wenn man plötzlich mit jedem Menschen auf der Erde in derselben Sprache kommunizieren kann, weil die KI die Übersetzung in Echtzeit übernimmt? Das globalisiert den Arbeitsmarkt. Viele indirekte Konsequenzen sind uns vielleicht noch gar nicht richtig bewusst. Gleichzeitig haben wir auch auf absehbare direkte Konsequenzen noch keine Antworten gefunden. Wenn unsere Produktivitätsgewinne in vielen Bereichen dazu führen, dass wir plötzlich in kürzester Zeit ein Vielfaches leisten können, droht uns ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
Das würde Produktivitätszunahme bedeuten, der gerade in Europa ohnehin alle hinterherjagen. Ja, aber was bedeutet es für unseren Arbeitsmarkt? Wenn Einzelne mit KI plötzlich die Arbeit von mehreren verrichten, müssen wir auch beantworten, woher die entsprechend höhere Nachfrage kommen soll. Damit Unternehmen ihre Angestellten in diesem kompetitiven Umfeld weiter beschäftigen können, brauchen sie also auch ein entsprechend hohes Wachstum. In diesem Kontext sind auch die anhaltenden Debatten über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sehen. Arbeit hat für viele Menschen auch eine sinnstiftende Funktion. Was heißt das für diejenigen, die in einer hocheffizienten, KI-optimierten Wirtschaftswelt nicht mehr gebraucht werden?
Glauben Sie, dass durch KI schon in den nächsten Jahren mit nennenswerten Umwälzungen in der Arbeitswelt zu rechnen ist? Ich denke, dass die Konsequenzen weitreichender sein werden, als viele er-
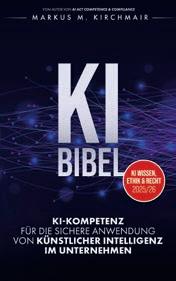
Markus M. Kirchmair
402 Seiten, EUR 38,40
Künstliche Intelligenz ist die mächtigste transformative Kraft unserer Zeit und definiert die Spielregeln in der Wirtschaft neu. Von generativen Modellen, die kreative Prozesse revolutionieren, bis hin zu autonomen Agenten, die komplexe Aufgaben übernehmen: Die Chancen sind immens. Doch mit ihnen wachsen auch die Herausforderungen – durch komplexe Risiken, ethische Grauzonen und den wegweisenden EU AI-Act. Die „KI Bibel“ als Nachfolgewerk von Markus Kirchmairs „AI-Act Competence + Compliance“ übersetzt die komplexe Welt der künstlichen Intelligenz in eine verständliche, praxisnahe und strategische Landkarte für Ihr Unternehmen.
warten. Der öffentliche Diskurs ist immer noch stark in Annahmen verhaftet, wonach KI beispielsweise nie kreativ sein könne oder wir künftig als Prompt Engineers arbeiten würden. Beide Sichtweisen halte ich für falsch und überholt. Zumal gerade der niederschwellige Zugang zu KI-Tools ja das Wesen dieser Entwicklung ausmacht. Sie werden immer einfacher zu bedienen und lernen dabei fortlaufend hinzu. Das ist positiv, weil dadurch auch der Zugang zu Wissen demokratisiert wird und man unterschiedslos jedem Nutzer ein sehr mächtiges Werkzeug an die Hand gibt. Zugleich besteht das Risiko, dass durch die Allgegenwart von KI und ihre zunehmende Leistungsfähigkeit das menschliche Wissen und menschliche Fähigkeiten entwertet werden.
„ICH DENKE, DASS DIE KONSEQUENZEN DER KI AUF DEN ARBEITSMARKT WEITREICHENDER SEIN WERDEN, ALS VIELE ERWARTEN.“
Braucht es nicht ein neues Mindset, wenn man so will eine gesellschaftliche Wertedebatte, die menschlicher Arbeit, die mit der zur Verfügung stehenden Arbeitskraft limitiert ist, einen inhärent höheren Wert beimisst als KIgenerierter, die fast grenzenlos ist? Das ist eine interessante Idee. Langfristig wird sich allerdings die Frage stellen, ob menschliche Produkte tatsächlich die höher zu bepreisende Qualitätsware sind, wenn das KI-Pendant besser ist.
Vielleicht muss man das von Menschen für Menschen Gemachte aus Prinzip – als Wert an und für sich – höher einschätzen? In Kunst und Handwerk kann ich mir das gut vorstellen. Auch in körpernahen Berufen und der Pflege bleibt der Faktor Mensch im Vordergrund. In vielen anderen Bereichen wird der Markt viel direkter nach dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis suchen. Hier muss es uns gelingen, mit Mensch und Maschine im Tandem den besten Output zu schaffen.
Welche Missverständnisse gibt es rund um die Künstliche Intelligenz in der wirtschaftlichen Praxis? Ein Kernproblem ist, dass KI in Unternehmen oft zu sehr als IT-Thema betrachtet wird. Dabei muss KI als umfassendes Change-Thema ganzheitlich angegangen werden. Es gibt organisatorische Aspekte ebenso wie kommunikative – wie bringe ich eine Kultur im Umgang mit KI unter die Mitarbeiter*innen? Das ist ganz wichtig, weil es nämlich so etwas wie „Shadow AI“ in den Unternehmen bereits heute gibt. Mit Schatten-KI ist der informelle KI-Einsatz von Mitarbeiter*innen im Arbeitsalltag in Unternehmen gemeint, die sich offiziell noch nicht der KI geöffnet haben. Unternehmen bekommen oft gar nicht mit, auf welche Art und Weise und wie intensiv ihre Mitarbeiter*innen KI bereits nutzen. Wird das im Betrieb nicht offiziell geregelt, tun sich auch große Datenschutzrisiken auf. Viele Unternehmen unterschätzen das.
Unternehmen sind folglich gut beraten, sich mit dem Einsatz von KI zu beschäftigen und das Thema in ihre Organisationskultur einzubinden? Genauso ist es. Da spielt auch die Kompetenzpflicht hinein, die im AI-Act der EU angelegt ist. Sie ist eine unternehmerische Sorgfaltspflicht.
Unternehmen haben dafür Sorge zu tragen, dass Menschen, die im Arbeitsalltag KI einsetzen, die notwendigen Fähigkeiten haben und auch für die Risiken sensibilisiert sind.
Überwiegen die Chancen oder Risiken beim Einsatz von KI? Damit die Chancen überwiegen, müssen Unternehmen aktiv werden. Das größte Risiko, das ich in der Praxis sehe, ist, vom Mitbewerb abgehängt zu werden, weil man zu schwerfällig, zu langsam, zu unflexibel ist. Gerade kleinere Unternehmen haben oft den Vorteil, dass sie schneller und flexibler reagieren können. Dafür muss man sich intensiv mit KI befassen. Man kann es sich nicht leisten, nicht mitzumachen. Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig damit auseinandersetzen, wie sie ihre Arbeitsprozesse mit Hilfe von KI verbessern und effizienter machen, droht schon ein großer Kostennachteil, der sich nicht ohne weiteres durch andere Faktoren kompensieren lässt. Das ist ein Dilemma.
Wie kann man die anderen Risiken im Umgang mit KI beherrschen? Die Risiken sind branchenabhängig unterschiedlich. Es gibt Branchen, die – in unterschiedlicher Ausprägung – disruptiert werden und sich neu erfinden werden müssen. Allen voran die Unterhaltungsindustrie, aber auch meine eigene Branche – die Beratung – ist genauso betroffen wie beispielsweise Verlagshäuser oder Agenturen. Auch Onlineportale erleben gegenwärtig einen Einbruch bei den Besucherzahlen, weil Nutzer*innen zunehmend KI fragen, anstatt Websites selbst zu besuchen. In einer KI-geprägten Umgebung werden viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle überdenken und sich neu positionieren müssen. Darüber hinaus gibt es auch generelle Risiken, die beherrscht werden müssen. Dazu zählen technische Risiken, Sicherheitsrisiken, Recht bzw. Compliance und daran anknüpfend auch Ethik. Setzt man beispielsweise im Recruiting auf KI, besteht die Gefahr, dass ein Bias zu unfairen Verzerrungen in der Bewerberauswahl führt.

Markus Kirchmair ist Berater für Marken, Führung und digitale Transformation. Er verbindet Kreativität und Strategie mit einem breiten Erfahrungsschatz aus Stationen bei Swarovski, Prolicht, Planlicht und Merkle. Seine akademische Laufbahn reicht vom BA in Marketing bis zum LL.M. in Digital Business & Tech Law, ergänzt durch Projektmanagement- und Digital-MarketingZertifizierungen. 2025 veröffentlichte er sein erstes Buch über den AI-Act und einen Fachbeitrag zum Digital Markets Act. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet er Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien und Transformationsprojekten.
erkennbar. Grundsätzlich greifen in der KI ethische und rechtliche Themen stark ineinander. Der AI-Act greift viele davon auf. Man kann sich ein Stück weit absichern, indem man den Ansatz „Human-in-the-loop“ verfolgt. Er besagt, dass bei allen KI-Prozessen ein Mensch anleitet und kontrolliert.
Das kritische Urteilsvermögen darf man gerade im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht an der Türschwelle abgeben? Keinesfalls. Eine kritische Grundhaltung ist wichtig, denn die Regulierung allein wird hier nicht ausreichen.
KI ist nicht gleich KI. Der AIAct unterscheidet zwischen vier verschiedenen Kategorien. Der AI-Act ist ein risikobasiertes Regelwerk. Je höher die Risiken eingeschätzt werden, desto strenger sind die Auflagen. Transparenz- und Kennzeichnungspflichten greifen besonders dann, wenn die Möglichkeit einer Täuschung oder Irreführung besteht. Beim Einsatz von KI in der Kundenkommunikation muss klar sein, dass es sich um KI-generierte Antworten handelt und KI-generierte Inhalte wie Texte, Bilder, Videos müssen ebenso klar als solche erkennbar sein. Wie streng das tatsächlich
Der AIAct der Europäischen Union ist das erste Regelwerk, das den Umgang mit Künstlicher Intelligenz umfassend regelt. Wie bewerten Sie diesen zunächst aus fachlicher und in Folge ökonomischer Perspektive? Der AI-Act enthält viele richtige und wichtige Aspekte. Eine ganze Reihe von KI-Anwendungen, die als inakzeptabel eingestuft werden, werden vom AI-Act verboten. Darunter sind biometrische Kategorisierungssysteme, die sensible Merkmale wie politische oder religiöse Überzeugungen, sexuelle Orientierung oder ethnische Zugehörigkeit nutzen. Die EU verfolgt mit dem AI-Act also ganz klar das Ziel, unsere Grundrechte zu schützen. Andererseits be-
Dadurch, dass ChatGPT & Co. eine Art Blackbox sind, lassen sich Biases wohl kaum nachvollziehen, weil man als User keinen Einblick in die Trainingsdaten hat? Ja. Es gibt zwar Expertentools, um Verzerrungen in KI-Modellen aufzuspüren, doch für die Anwender sind Biases oft nicht ausgelegt wird, bleibt abzuwarten. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass sich gerade Akteure mit krimineller Absicht nicht an solche Pflichten halten. Es braucht also ein gesundes Maß an Skepsis, dass theoretisch jedes Bild, jeder Text, jedes Video – auch jede E-Mail und jeder Anruf – KI-generiert sein könnte. Der AI-Act könnte da möglicherweise eine falsche Sicherheit suggerieren, weil eben trotz Regularien längst nicht alles, was nicht als KI-generiert gekennzeichnet ist, tatsächlich echt sein muss.
„EIN KERNPROBLEM IST, DASS KI IN UNTERNEHMEN OFT ZU SEHR ALS IT-THEMA BETRACHTET WIRD. DABEI MUSS KI ALS UMFASSENDES CHANGE-THEMA GANZHEITLICH ANGEGANGEN WERDEN.“
tont man aber auch die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Diesbezüglich vernehme ich zunehmend Skepsis. Im aktuellen Kopf-anKopf-Rennen zwischen den USA und China spielt Europa bei der KI-Entwicklung – außer in Nischen – leider kaum eine Rolle.
Dann darf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft bei gleichzeitiger Einschränkung des KIEinsatzes wohl der Kategorie „Wunschdenken“ zugeschlagen werden? BigTech aus Europa ist eine Fehlanzeige. Ja. Beim Einfluss der DSGVO auf internationale Anbieter sprach man damals von einem Brüssel-Effekt. Ich vermute, dass man mit dem AIAct hinsichtlich der internationalen Wirkung ähnlich hohe Ambitionen hatte. Die eigentliche Nagelprobe für den AI-Act sehe ich aber tatsächlich im Hochrisikobereich. Da entscheidet sich, ob der Schutz unserer Grundrechte mit dem AI-Act wirksam gelingt. In anderen Bereichen wie der generativen KI werden hingegen in den USA und China Tatsachen geschaffen, denen sich Europa kaum entziehen kann.
Sie haben in Ihrem Buch der Kompetenzpflicht viel Raum gegeben. Worum geht es dabei? Alle Personen, die KI-Systeme entwickeln, betreiben oder beruflich nutzen, müssen über angemessene Kompetenzen verfügen. Mein Buch ist ein erster Versuch, diese vage Vorgabe zu interpretieren. Man sollte die Kompetenzpflicht in erster Linie einmal als unternehmerische Sorgfaltspflicht verstehen, Mitarbeiter*innen entsprechende Kompetenz im Umgang mit den von ihnen eingesetzten KI-Tools zu vermitteln. Zusätzlich sollten sie auch die ethischen, rechtlichen und technischen Grundlagen verstehen – inklusive Chancen und Risiken. Die Kompetenzpflicht betrifft dabei nicht nur die eigenen Mitarbeiter*innen, sondern auch Partner und Lieferanten. Wer in meinem Auftrag arbeitet und dabei
KI nutzt, muss die entsprechenden Kompetenzen haben.
Mit welchen anderen Gesetzesmaterien kann der Einsatz von KI in Unternehmen in Konflikt geraten? Besonders mit der DSGVO, in der Datenminimierung ein Grundprinzip ist. Die KI wird grundsätzlich mit steigender Datenmenge und -qualität besser. Diesen Widerspruch aufzulösen ist nicht immer leicht und relativiert für viele Unternehmen die beabsichtigte Rechtssicherheit. Wer aus datenschutzrechtlichen Überlegungen auf KI verzichtet, muss im Gegenzug möglicherweise Nachteile in Kauf nehmen. Unternehmerische Entscheidungen werden also oft zu einer Risikoabwägung. Auch hinsichtlich Haftung, Urheberrecht und Verbraucherschutz sind noch viele Fragen offen.
Die Wirtschaft ächzt unter der Bürokratie. Kommt mit dem AI Act noch eine weitere bürokratische Hürde dazu? Das hängt stark davon ab, welcher Risikokategorie die unternehmerischen Aktivitäten zuzuordnen sind. In Hochrisikobereichen gibt es Dokumentations- und Protokollierungspflichten und die Notwendigkeit eines umfassenden Risikomanagements. Da bedeutet die KI-Verordnung tatsächlich zusätzliche Bürokratie. Es ist aber in dieser Regulierungsfrage noch nicht das letzte Wort gesprochen, eine teilweise Aufweichung der Regulierung ist denkbar. Der AI-Act ist ein flexibles Rahmenwerk, das entsprechende Änderungen zulässt.
Wie werden Verstöße gegen den AIAct sanktioniert? Gerade im Hochrisikobereich und beim Einsatz verbotener Systeme sind die Strafrahmen drakonisch und können bis zu sieben Prozent des weltweiten Umsatzes ausmachen. Das soll abschreckend wirken. In der Praxis wird das tatsächliche Sanktionsmaß von der Schwere etwaiger Verstöße abhängen.
Bei KIUnternehmen und deren Bewertung bekommt man den Eindruck, dass das Geld abgeschafft ist. Zugleich werden erste Vergleiche mit der DotcomBubble laut, weil die meisten Unternehmen von der Profitabilität weit entfernt sind. Glauben Sie, dass es zu einer Konsolidierung kommen wird? Platzt die Blase? Aktuell herrscht tatsächlich Goldgräberstimmung. In den USA werden hunderte Milliarden Dollar in gigantische Rechenzentren investiert. Gleichzeitig ist noch immer unklar, wann und in welcher Form sich in diesem hochkompetitiven Umfeld Gewinne erwirtschaften lassen. Wenn sogar OpenAI-CEO Sam Altman nun öffentlich sagt „Someone is going to lose a phenomenal amount of money“ sollten Tech-Investoren vorsichtig werden. Mir persönlich scheint eine Marktkonsolidierung sehr wahrscheinlich. Wichtig ist allerdings, dass man von der möglichen Blasenentwicklung an den Börsen nicht darauf schließt, dass KI nur ein Hype sei. In der breiten Wirtschaft nimmt die Etablierung von KI mit all den zu erwartenden Produktivitätsgewinnen gerade erst Fahrt auf.
Darf man annehmen, dass Sie als KISpezialist allgemein eher optimistisch sind, was die Zukunft der Künstlichen Intelligenz betrifft? Ich sehe zwei Seiten: KI mischt die Karten neu. Unternehmen, die sich jetzt aktiv damit befassen, wie sie sich KI strategisch aufstellen, haben allen Grund zu Optimismus. Aber: Nur weil wir in kürzester Zeit um ein Vielfaches produktiver werden, heißt das nicht, dass der Markt im selben Ausmaß und Tempo wächst. Der Wirtschaft stehen also intensive Verteilungskämpfe bevor, bei denen es Gewinner und Verlierer geben wird. In Bezug auf die Gesellschaft lesen wir viel von Utopie- und Dystopieszenarien. Im Idealfall schaffen wir es, irgendwo in der Mitte dieser beiden Extreme herauszukommen.
Eine Gesellschaft kann man ein Stück weit gegen negative Auswirkungen wappnen, wenn man sie gut ausbildet, informiert und sensibilisiert. Ja. Es braucht mehrere Dinge: Kritisches Denken, stetiges Hinterfragen und sich selbst ein Bild von den KI-Tools machen und diese bewusst anwenden. Nur weil die KI immer mehr „denkt“, dürfen wir Menschen nicht das Denken – und besonders das kritische Denken – einstellen.
Es war ein visionärer Schritt, den die IKB 1995 mit der Investition in Glasfasertechnologie setzte. 30 Jahre später profitieren Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Haushalte von der leistungsstarken Infrastruktur und machen Innsbruck zu einer der führenden Städte im Bereich digitaler Netze.
TEXT: DORIS HELWEG

Innsbrucks Bürgermeister Ing. Mag. Johannes Anzengruber, B.Sc., mit Ing. Mag. Thomas Stotter, IKB-Geschäftsbereichsleiter Telekom, elitec-Geschäftsführer Simon Geiler, B.A., IKB-Vorstandsvorsitzender DI Helmuth Müller und IKB-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Pühringer
Während in den 1990er-Jahren noch viele andere in Kupferleitungen investierten, startete die IKB erste Pilotprojekte mit der damals noch visionären Glasfasertechnologie – ein Investment, das sich gelohnt und die IKB und somit den Standort Innsbruck zu einem Vorreiter in Sachen Glasfasertechnologie gemacht hat. 1995, also vor genau 30 Jahren, war der erste Glasfaserkilometer der IKB errichtet. Erste Pilotprojekte für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen folgten, bis schließlich im Jahr 2004 erste Privatkundenanschlüsse hinzukamen. Seither wurde das Netz kontinuierlich ausgebaut. So nutzen heute rund 24.900 Haushalte und Unternehmen 750.571 Meter Glasfaserkabel.
Als Schlüsseltechnologie ist schnelles Internet eine Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes. Dass die IKB sehr früh auf den Aufbau von Glasfasernetzen gesetzt hat, ist ein heute noch spürbarer Vorteil für Innsbruck. „Glasfaser
ist stabil, zukunftssicher und bleibt damit unersetzlich. Die Entwicklung zeigt eindrucksvoll, wie weit wir schon gekommen sind: Während Kundinnen und Kunden Anfang der 2000er-Jahre mit 2 Mbit/s auskommen mussten, ermöglichen wir heute Bandbreiten von über 1.000 Mbit/s“, betont Dr. Thomas Pühringer, Vorstandsmitglied der IKB. Ing. Mag. Thomas Stotter, Geschäftsbereichsleiter Telekommunikation, hat den Auf- und Ausbau der Glasfasertechnologie unermüdlich vorangetrieben: „Mit dem bereits hohen Ausbaugrad, der hohen Verfügbarkeit und der intensiven zukünftigen Ausbaustrategie haben wir Standortvorteile, die andere nicht bieten können.“ Mittlerweile betreibt die IKB die Glasfaserinfrastruktur auch als offene Plattform – unter anderem in Kooperation mit Magenta und A1. „Diese nutzen unser Glasfasernetz zusätzlich zu ihren bestehenden (meist) Kupfernetzen. Der zukünftige Ausbau wird vorrangig durch uns realisiert“, so Stotter. Das spart Baustellen
und stellt sicher, dass die Infrastruktur optimal genutzt wird und Innsbruck digital vorne bleibt. Neben Innsbruck setzen bereits weitere 54 Gemeinden in Tirol auf die leistungsstarke Glasfasertechnologie der IKB. Für die Zukunft plant die IKB, das Netz konsequent zu erweitern: Bestehende Gebiete werden nachverdichtet, Neubaugebiete standardmäßig mit Glasfaser erschlossen und neue Technologien für Smart-City- sowie IoT-Anwendungen werden eingebunden. Von Seiten der Wirtschaft betont Simon Geiler, B.A., Geschäftsführer des langjährigen IKB-Businesskunden elitec GmbH, den hohen Stellenwert einer stabilen Glasfaserinfrastruktur: „Für uns als Unternehmen ist Glasfaserinternet unverzichtbar. Schnelles Internet ist die wichtigste Grundlage für unsere digitale Arbeit.“ Das bisherige Gesamt-Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro hat sich also gelohnt und Innsbruck zu einer der führenden Städte Österreichs im Bereich digitaler Netze gemacht.
ANTITHESE

Traditionen sind der Gegenentwurf zur digitalen Gesellschaft. Warum wir Bräuche brauchen.
TEXT: MARINA BERNARDI
Tina Rieser-Winkler ist Geschäftsführerin des Radiosenders U1.
In einer Zeit, in der sich nahezu unser gesamtes Leben ins Digitale verlagert, beruflich wie privat, in der wir uns per Mausklick die ganze Welt in Echtzeit nach Hause holen können und oft Unechtes als echt und Meinungen als Fakten präsentiert bekommen, brauchen wir ein solides Fundament. Ein Wertegerüst, das uns trägt, gibt Orientierung und innere Stabilität. Je instabiler das Außen, desto mehr Resilienz brauchen wir im Innen.
Kleine Rituale, bewusst gepflegte Traditionen oder persönliche Gewohnheiten können helfen, sich selbst zurück in den Moment zu holen, zur Ruhe zu kommen und das oft chaotische Drumherum einzuordnen. „Traditionen sind wichtig. Sie geben Halt, Orientierung, Sicherheit und spenden Trost. Ich sehe darin nur Positives“, sagt Tina Rieser-Winkler, Geschäftsführerin des Radiosenders U1. Als Heimatsender vermittelt U1 genau das: Verwurzelung, Erdung, Werte und Traditionen. Begriffe, die in unserer schnelllebigen Welt nicht immer leicht zu vermitteln sind und in den letzten Jahren leider vermehrt einen negativen, oft nach rechts gerückten Beigeschmack bekommen haben. „Ich wollte immer etwas tun, womit man etwas bewegen kann. Radio ist ein sympathisches Medium, das nach wie vor zahlreiche Menschen erreicht. Ich finde es schön, dass ich mit meinem Beruf transportieren darf, dass Tradition nichts Rückwärtsgewandtes sein muss, sondern vielfältig ist und offen. U1 wurde früher oft belächelt, doch wir sind jetzt das meistgehörte Privatradio in Tirol.“
Tradition und Brauchtum schubladisieren nicht, sondern schaffen Raum für alle. Sie sind wie ein Sicherheitsnetz, das uns sowohl individuell als auch kollektiv Halt gibt und uns hilft, in einer schnelllebigen Welt standhaft zu bleiben. „Traditionen sollen verbindend wirken“, so Tina Rieser-Winkler. „Es geht um Vielfalt. Es darf alles sein. Man kann lieben, was man tut, und trotzdem offen sein für Neues, Anderes.“ Auch der Heimatbegriff ist weit gefasst. Es geht nicht um einen konkreten Wohnort oder das Geburtsland. Heimat sind verlässliche Ankerpunkte, von denen man weiß, dort kann man hin, auch wenn alles um einen zusammenbricht.
„Heimat hat etwas mit Verlässlichkeit zu tun.“
TINA RIESER - WINKLER
Werner Kogler, damals noch Grünenchef, hatte in einer Parlamentssitzung durchaus recht, als er sagte: „Wir lassen uns den Heimatbegriff von den Rechtsradikalen nicht länger fladern.“ Heimat hat nichts mit Religion oder politischer Gesinnung zu tun, sondern mit Verlässlichkeit.
Auch ein Baum kann nur dann stark in die Höhe wachsen, wenn seine Wurzeln kräftig sind. Traditionen und Rituale verbinden uns mit unseren Wurzeln und unserer Kultur. Sie schaffen bewusste Momente, in denen wir unsere Identität reflektieren, und gerade in Zeiten ständiger Veränderung sind sie ein wichtiger Anker. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, stärken das Zugehörigkeitsgefühl und lassen uns Teil einer Gemeinschaft sein. Psychologisch gesehen reduzieren feste Rituale Stress, schaffen Struktur im Alltag und machen uns widerstandsfähiger gegenüber Krisen. „Jeder für sich, jede Partnerschaft, Familie und auch jedes Unternehmen pflegt bestimmte Rituale, die für Zusammenhalt sorgen und Orientierung geben“, so Tina Rieser-Winkler. Traditionen sind dabei nicht altmodisch oder starr, Tradition kann sich weiterentwickeln, anpassen, neu entdeckt oder interpretiert werden. Und es ist auch nichts Schlechtes, wenn in unserer chaotischen Welt manche Dinge einfach bleiben dürfen, wie sie sind. Fortschritt ist wichtig, doch es braucht den Mut, auch mal zurückzugehen, wenn man merkt, dass der eingeschlagene Weg der falsche ist. „Man sollte immer open-minded bleiben, doch das heißt nicht, dass man alles von der Pike auf verändern muss und das Alte damit automatisch schlecht ist. Wir brauchen Fortschritt, doch die Frage ist, wie man damit umgeht. Das ist bei der Tradition nicht anders.“
„Im Leben geht es immer um den Blickwinkel: Will ich alles kritisieren und schlechtreden, oder will ich positiv durchs Leben gehen und das Schöne sehen.“
TINA RIESER - WINKLER

Ein stabiles Wertegerüst dient uns dabei als innerer Kompass. Es leitet unser Handeln, erleichtert Entscheidungen und trägt zur Verantwortung innerhalb der Gesellschaft bei. Viele Traditionen transportieren grundlegende Prinzipien, die das Zusammenleben regeln und Orientierung bieten. „Auch Selbstbewusstsein, im Sinne dessen, dass man sich seiner selbst bewusst ist und seinen eigenen Wert kennt, macht einen offener und toleranter“, ist Tina Rieser-Winkler überzeugt. Wer emotional verankert ist, kann das Andersartige besser aushalten. Man hat keine Angst vor dem Fremden, sondern sieht es als Bereicherung des eigenen Horizonts.
DER MENSCH, DAS SOZIALE WESEN
Sich irgendwo zugehörig zu fühlen, ist wichtig für das soziale Gefüge. „Auch dass man aufeinander schaut, sollte selbstverständlich sein“, findet Tina Rieser-Winkler. „Es ist schön, Zeit mit sich selbst zu verbringen, und es ist wichtig, mit sich selbst allein sein zu können, für langfristiges Wohlbefinden aber brauchen wir andere Menschen.“ Das muss sich nicht zwingend im klassischen Brauchtum wiederfinden. „Nicht jeder muss etwas mit Almabtrieben oder Schützenvereinen anfangen können, aber es ist wichtig, eigene Traditionen und Werte zu haben. Rituale, die uns erden, sind etwas sehr Schönes.“ Oder Mitglied in einem Verein zu sein. Wir brauchen Orte des Miteinanders. Heute dringender denn je.
Letztlich geht es im Zusammenleben dabei immer um gegenseitigen Respekt: „Wir haben das Prinzip ‚Leben und leben lassen‘ ein wenig aus den Augen verloren“, findet
Tirol hat mehr Musikkapellen als Gemeinden, sie sind tragende Säulen des sozialen Gefüges. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Tiroler Blasmusikverband gehen die Tiroler Landesmuseen in der Ausstellung „Spielweisen. Was Blasmusik sein kann“ der Frage nach, wann und warum Blasmusik diesen herausragenden Stellenwert erlangt hat, und werfen einen tiefen sowie kritischen Blick auf die Geschichte, ihre militärischen Wurzeln und die große Bedeutung, die Blasmusik heute noch in Tirol hat. Diese Ausstellung war ursprünglich für das Ferdinandeum geplant, umbaubedingt findet sie nun aber im Tirol Panorama statt – die Ausstellung „Schauplatz Tirol“ wurde dafür umgebaut. Die Ausstellung ist bis 6. Juli 2026 zu sehen.
Tina Rieser-Winkler. „Jeder sieht die Welt durch seine eigenen Augen. Man kann das Positive sehen oder überall nur das Negative suchen. Meistens sind es genau jene Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, die dem Leben mit Offenheit und Toleranz begegnen. Wenn man mit einem positiven Mindset durchs Leben geht, passieren einem auch die guten Dinge, die andere vielleicht übersehen oder nicht sehen wollen.“ Und auch wenn es derzeit an vielen Stellen hakt, „objektiv gesehen ging es uns hierzulande nie so gut wie heute. Und trotzdem wird gejammert. Wir befinden uns in einer Phase einer Art Wohlstandsverwahrlosung. Wir sind gewohnt, alles zu bekommen und alles zu haben, und vergessen dabei, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir müssen aus dieser Negativspirale dringend herauskommen. Wie wir das aktuelle gesellschaftliche Dilemma und das Auseinanderdriften aufgelöst bekommen? Ich weiß es nicht. Doch mit U1 und persönlich möchte ich zeigen, dass es neben Herausforderungen auch viele schöne Geschichten gibt – über Tirol, Österreich und die Welt.“ Und es sind genau diese Geschichten, die verbinden, erden und Orientierung geben: Traditionen, Werte und Heimat als feste Anker in bewegten Zeiten.
„Ich bin ein Freund davon, offen und ehrlich miteinander umzugehen – aber immer mit Respekt voreinander.“
TINA RIESER - WINKLER


HIER WERDEN SIE GEHÖRT!
IN TIROL, ÖSTERREICH UND DER WELT
Immer wenn vom metaphorischen Quantensprung die Rede ist, stirbt irgendwo ein Germanist. Todesursache: Semantische Fehlleistung.
Denn die Quantenphysik beschäftigt sich nicht mit großen Sprüngen, sondern mit Zustandsänderungen, die so klein sind, dass sie erst im 20. Jahrhundert entdeckt wurden. In Innsbruck kennt man sich nicht erst seit gestern damit bestens aus.
TEXT: MARIAN KRÖLL
Tirol – und vor allem Innsbruck –ist längst ein Quantendorado. In den 1990er-Jahren legten Anton Zeilinger, Peter Zoller und Rainer Blatt mit bahnbrechenden Arbeiten zu Quantenverschränkung und Superposition den Grundstein für ein Forschungsumfeld, das heute weltweit strahlt. Eine lebendige Community aus internationalen Wissenschaftler*innen arbeitet an der Universität Innsbruck und am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und schlägt gemeinsam mit Start-ups die Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung.
AUSSAAT UND ERNTE
Die Zukunft hat in Innsbruck bereits begonnen. „Innsbruck ist ein weltweites Zentrum. Forscher wie Anton Zeilinger und Peter Zoller sind in der Quanten-Community absolute Megastars“, sagt ParityQC-CEO Wolfgang Lechner. Aus dieser reichen wissenschaftlichen Tradition sind Spin-offs wie ParityQC und AQT hervorgegangen. Sie stehen beispielhaft für die Kommerzialisierung einer
Mit dem heuer ins Leben gerufenen Quanten-Hub Tirol will das Land Tirol seine Spitzenstellung in der Quantenforschung weiter ausbauen und die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärken. Die Initiative wurde von Wissenschaftslandesrätin Cornelia Hagele, Vizerektor Gregor Weihs, Jasmin Güngör (Onsight Ventures) und Thomas Monz (AQT) vorgestellt und erhält 2025 eine Landesförderung von 150.000 Euro. Ziel ist es, Tirol als internationales Zentrum für Quantentechnologie zu positionieren – mit Fokus auf Innovation, Wissenstransfer und Unternehmensansiedlungen im Bereich Quantum Computing. Der Hub wird von der Standortagentur Tirol getragen und soll neue Ausbildungsangebote, Forschungskooperationen und Arbeitsplätze schaffen. Tirols weltweit anerkannte Quantenforschung – etwa durch die Universität Innsbruck und Unternehmen wie AQT oder ParityQC – bildet dabei die Grundlage für den weiteren Ausbau der „Quantenregion Tirol“.
Zukunftstechnologie, deren gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Impact noch kaum abzusehen ist. Ob der Wirtschaftsstandort Tirol ernten kann, was der Wissenschaftsstandort gesät hat, bleibt offen. Das Inntal ist nicht das Silicon Valley: Hier werden kleinere Brötchen gebacken. Doch gerade der Mangel an Überfluss kann beflügeln.
ZWEI UNTERNEHMEN IM FOKUS
Hardware trifft Software, Pragmatismus trifft Vision. Mit AQT und ParityQC hat Innsbruck zwei Unternehmen hervorgebracht, die nicht als Konkurrenten, sondern als komplementäre Bausteine desselben Ökosystems gelten. Ob Europa die Chance nutzt, die sich durch diese neue Technologie auftut, hängt nicht nur von Forschungsexzellenz, sondern auch von politischem Mut und einem entsprechenden wirtschaftlichen Rahmen ab. Am Innovationsgeist im Inntal jedenfalls mangelt es nicht.
Thomas Monz ist Geschäftsführer von AQT (Alpine Quantum Technologies) und quasi professioneller (Ionen)-Fallensteller.

Thomas Monz und sein Team von AQT (Alpine Quantum Technologies) machen Quantencomputer industriefähig: modular aufgebaut verbrauchen sie nicht mehr Strom als ein haushaltsüblicher Wasserkocher und sind dazu noch „Made in Austria“. Das Innsbrucker Spin-off zeigt, dass sich Spitzenforschung und Unternehmertum erfolgreich verbinden lassen.
Thomas Monz ist professioneller Fallensteller. Der Physiker und Quanteningenieur entwickelt und baut Ionenfallen-Quantencomputer, die für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Industrien geeignet sind. Dafür hat er sich 2018 mit den Quantenkoryphäen Rainer Blatt und Peter Zoller zusammengetan und das Unternehmen AQT – Alpine Quantum Technologies – als universitäres Spin-off gegründet. In Innsbruck habe man schon immer einen starken Fokus auf die Hardware-Seite gelegt, erzählt Monz. Mit der Etablierung von Programmiersprachen ist der Quantencomputer mittlerweile tatsächlich auch für Endanwender interessant geworden, weil User durch die Abstraktionsebene „Programmiersprache“ nicht mehr die exakte Funktionsweise des Quantencomputers nachvollziehen müssen. Damit E-Mails zu schreiben, wäre verfehlt. „Der Quantencomputer ist, wie es das Wort schon sagt, überall dort gut, wo Quantenmechanik mitspielt. In der Materialwissenschaft, in der Chemie, immer dann, wenn es um das Kleine und Kleinste geht“, erklärt Monz.
Der Quantencomputer war ursprünglich als Gerät für die akademische Anwendung konzipiert. Vom Quantenforscher, für den
Quantenforscher. Dabei war es sogar ein Feature, dass alle Bauteile offen manipulierbar gewesen sind. „Dem Mechaniker wäre auch das Auto ohne Motorhaube am liebsten, damit er gleich am Motor herumschrauben kann“, bringt Monz einen Vergleich. Bei AQT hat man es in den letzten Jahren geschafft, den Quantencomputer fit für die Anwendung zu machen. Neuerdings auch für Rechenzentren, in sogenannten HPC-Umgebungen. HPC steht für High-Performance-Computing. „Quantenbeschleuniger sind für HPC-Rechner eine neue und spannende Möglichkeit, weil sie in der Lage sind, bestimmte Probleme in der Chemie oder den Materialwissenschaften deutlich rascher zu lösen, als dies klassischerweise möglich wäre“, sagt Monz. Bei AQT denkt – und baut – man den Quantencomputer heute modular, eingehaust, so dass er in industrieübliche 19-Zoll-Serverracks
passt. „Wir sind die Ersten und nach wie vor die Einzigen, die das können“, definiert Thomas Monz die USP des Unternehmens. Das hat man mit überschaubarem Energieverbrauch geschafft. „Unser Quantencomputer verbraucht in etwa so viel Strom wie dieser Wasserkocher“, deutet Monz auf das entsprechende Gerät in der Kaffeeküche. Der AQT-Quantencomputer lässt sich also einfach mit Haushaltsstrom aus der stinknormalen Schuko-Steckdose betreiben und läuft im Vakuum auf Raumtemperatur. Es war dem Unternehmer auch ein Anliegen, bei den Lieferketten möglichst unabhängig von globalen Verwerfungen zu sein. Deshalb ist die AQT-Technologie „Made in Austria“, die Komponenten stammen weit überwiegend aus Österreich, ein paar auch aus Deutschland, Italien und Polen. Bei AQT hat man sich im Hinblick auf das geistige Eigentum eine hybride Strategie auferlegt. Manches
„WIR
SOLLTEN IN EUROPA QUANTENCOMPUTER NICHT NUR
SELBST PRODUZIEREN WOLLEN, SONDERN AUCH DEREN ANWENDUNG
IN DER HAND HABEN.“
Thomas Monz
wird patentiert, wieder anderes bleibt als Betriebsgeheimnis unter Verschluss. Beides hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Die Zukunft des Quantencomputers sieht Monz jedenfalls in der Cloud und nicht in der Heimanwendung à la Personal Computer. Dabei spielt natürlich das Thema Datensouveränität eine wichtige Rolle. „Wir sollten in Europa Quantencomputer nicht nur selbst produzieren wollen, sondern auch deren Anwendung in der Hand haben“, betont der Physiker. Das wäre ein Gegenentwurf zum gängigen Modell der Social-Media-Plattformen, wo die meisten Server – und damit so gut wie alle „Geheimnisse“ bzw. sensiblen persönlichen Daten – außerhalb Europas gehostet werden.
Beim Rennen um den Quantencomputer ist Europa auch dank Zentren wie Innsbruck noch gut im Rennen. Geschichte muss sich also nicht wiederholen. Dass die finanziellen Möglichkeiten für Start-ups in den USA anders – und in mehrfacher Hinsicht besser – sind als in Europa, ist jedoch evident. Monz will aber von einem Abgesang auf den Wirtschaftsstandort nichts wissen und unterscheidet bewusst zwischen Kultur und Personen. „Österreich hat zehnmal weniger Einwohner als Deutschland, aber annähernd gleich viele Quanten-Start-ups“, sagt er. Das zeuge davon, dass in Österreich im Quantenbereich ein unternehmerisches Mindset herrsche. Dass nicht nur geforscht, sondern auch kommerzialisiert wird. „Die Leute trauen sich etwas zu, gründen ein Unternehmen und wollen sich kommerziell erfolgreich aufstellen“, sagt Monz, der genau das mit AQT vorgemacht hat.
Der Wille allein indes ist zu wenig, es braucht ein entsprechendes Ökosystem, in dem sich Quantenpioniere entfalten können und aus dem sie Personal rekrutieren können. Da ist Tirol mit Innsbruck, aber auch Gesamtösterreich nicht schlecht aufgestellt. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit hegt Monz die Befürchtung, dass europäische Exportkontrollen für Quantentechnologie nicht hilfreich sein dürften. Er argumentiert, dass Abwanderung von vielversprechenden Quanten-Start-ups nicht zu befürchten sei, würde man die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.
PERSONAL SCHLÄGT WAGNISKAPITAL
An den finanziellen Mitteln sieht der Unternehmer in Europa die Kommerzialisierung der Quantentechnologie übrigens nicht

primär scheitern. Da spielt eher die unternehmerische Freiheit bzw. der Mangel an derselben eine entscheidende Rolle. „Es ist auch keine staatliche Aufgabe, Wagniskapitalgeber zu spielen“, sagt Monz, dem die Fokussierung auf Geld widerstrebt. „Es geht wesentlich mehr darum, ob Personen mit einem entsprechenden Netzwerk, Knowhow und Erfahrung greifbar sind, mit denen man sich fachlich austauschen kann.“ Dieser kontinuierliche Austausch hilft dabei, aus Fehlern anderer zu lernen und diese nicht zu wiederholen. Das stärkt das gesamte Ökosystem. Personal ist wichtiger als Wagniskapital. „Hat ein Unternehmen eine gute Idee, ist in der richtigen Marktnische aktiv und verfügt über fähiges Personal, das das Zeug dazu hat, diese Idee zu verwirklichen, dann findet sich auch das notwendige Kapital“, ist der Physiker überzeugt und meldet Zweifel an Geschäftsmodellen an, bei denen der Unternehmenswert und die Gewinnaussichten in einem massiven Missverhältnis stehen. Astronomische Bewertungen sieht Monz skeptisch. Die Umsätze, die das rechtfertigen würden, gibt der Markt aus seiner Sicht – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht her. „Schießt die Bewertung nach oben, der Umsatz bleibt aber konstant, dann wird es irgendwann schwierig“, sagt der Unternehmer.
Exzellenz sei ein Faktor, der Innsbruck auf die Quantenlandkarte gebracht hat. Das allein reicht aber nicht aus. Die großen Würfe gelingen durch den Austausch der Wissenschaftler*innen. Ein Musterbeispiel für fruchtbare Zusammenarbeit ist die gemeinsame Aufbauarbeit von Rainer Blatt und Peter Zoller, die in Innsbruck miteinander großartige Grundlagenarbeit geleistet haben. Thomas Monz erzählt in diesem Kontext auch die Erfolgsgeschichte eines österreichischen Fördervehikels, das zwar
nicht viel Geld zur Verfügung stellt, aber die geförderten Forschungseinrichtungen und Unternehmen zur Zusammenarbeit verpflichtet. Dieser akademische Austausch zwischen Theoretikern und Praktikern generiert einen Mehrwert, der monetär schwer messbar ist. Mittlerweile sind nicht mehr allein Physiker*innen, sondern zunehmend auch Informatiker*innen mit der Materie befasst. Das bringt auch den Quantencomputer voran. „Die geografische Kleinheit Österreichs ist diesbezüglich sogar ein Vorteil“, so Monz. Durch die Enge entsteht eine positive Friktion.
MEHR VERSUCH UND IRRTUM
Thomas Monz ist grundsätzlich optimistisch, was die Zukunft der kommerziellen Quantentechnologie in Österreich betrifft. Das liegt an der guten Grundlagenforschung, die hier seit den 1990er-Jahren gemacht wurde. Und an einem Quanten-Ökosystem, in dem man nicht stur nebeneinanderher entwickelt, sondern der Austausch gepflegt wird, von dem letztlich alle profitieren können. Auch Monz wünscht sich in Europa generell mehr Mut zum Risiko und eine bessere Kultur des Scheiterns. „Play it Safe“ ist das Grundrezept für Stagnation, nicht für Wachstum. Was im Labor gang und gäbe ist, ja sogar die wissenschaftliche Methode, Versuch und Irrtum, das muss auch in der Wirtschaft in größerem Maß möglich sein. „Im Labor und in der Forschung sind Fehler erlaubt, das braucht es auch in der Wirtschaft“, sagt Monz. Unternehmerischer Erfolg wird niemals hundertprozentig kalkulierbar sein. Bei AQT sieht es derweil gut aus. 2018 hat man mit zwei Mitarbeiter*innen begonnen, mittlerweile sind es an die 40. Zur Zukunft sagt der CEO: „Wir erweitern unsere Produktpalette, steigern unsere Umsätze. Dann werden wir sehen, was sich ergibt.“
Eine Idee, zu gut, um wahr zu sein, und Unternehmergeist haben zur Gründung von ParityQC geführt. Das Innsbrucker Spin-off schreibt schwarze Zahlen, wo andere noch Geld verbrennen, und hat mit seiner proprietären Quantenarchitektur den Schlüssel in der Hand, für Quantencomputer aller Art anwendbar zu sein. Die CEOs Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner geben Einblick in Strategie, Standort und Quantenzukunft. Dabei geht es auch um Europas Wettbewerbsfähigkeit.
ParityQC ist ein gemeinsames Spinoff der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das das Innsbrucker Quanten-Ökosystem seit 2020 bereichert. Geleitet wird es von Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, die bevorzugt, wenn nicht sogar ausschließlich, im Tandem für die richtige Außendarstellung ihres Unternehmens sorgen. „ParityQC ist das einzige Quantenarchitektur-Unternehmen der Welt und hat zum Ziel, Europa im Quantencomputing an der Weltspitze zu halten“, hieß es in einer Presseaussendung der Universität Innsbruck im vergangenen Jahr. Hier wird zumindest schon einmal nicht tiefgestapelt. Wir haben den Gründer gefragt, ob diese Aussage so noch stimmt. „Wir entwickeln Baupläne für Quantencomputer und entsprechende Algorithmen“, sagt Wolfgang Lechner. Er ist Universitätsprofessor am Institut für Theoretische Physik der Universität Innsbruck. „Wir sind weder ein Hardware- noch ein Softwareunternehmen,
„WIR SIND EINES DER WENIGEN QUANTENUNTERNEHMEN, DAS PROFITABEL IST.“
Magdalena Hauser
sondern ein Architekturunternehmen“, sagt er, um im selben Atemzug zu bekräftigen: „Damit sind wir die Einzigen auf der Welt.“ ParityQC ist demnach tatsächlich konkurrenzlos, und Lechner zeigt sich durchaus optimistisch, dass das auf absehbare Zeit so bleiben wird. In Innsbruck sei in der Vergangenheit sehr viel Pionierarbeit in der Quantenforschung geleistet worden. „Jetzt befinden wir uns in einer Phase, in der der Wettbewerb um die Quantentechnologie zunehmend kommerzialisiert wird“, so Lechner. Normalerweise gerät in genau dieser Phase Europa, vor allem gegenüber den USA und China, ins Hintertreffen. So hat man es in der Vergangenheit bereits bei anderen



„UNSER ANSATZ IST EINE FUNDAMENTAL ANDERE ART, QUANTENCOMPUTER ZU BAUEN.“
Wolfgang Lechner
neuen Technologien, die zwischenzeitlich zu Schlüsseltechnologien avanciert sind, beobachten müssen. Leider.
Heute wird ordentlich Geld in die Kommerzialisierung der Quantentechnologie gesteckt. Da weniger, dort mehr. Da ist Europa, dort sind die USA und China. Hardwareseitig sind Unternehmen im Rennen um die Massenmarkttauglichkeit des Quantencomputers, die – wie Wolfgang Lechner es formuliert –„sehr tiefe Taschen“ haben. Darunter Krösusse wie Google-Mutter Alphabet, IBM und einige mehr. „Wer da mithalten möchte, muss irgendwann in dieses finanzielle Rennen einsteigen“, beschreibt Lechner die Ausgangssituation. Das ist aus der üblicherweise risikoaversen europäischen Perspektive ein wenig so, wie mit einem Maultier zum Pferderennen zu kommen. In puncto
©
finanzieller Ressourcen wird man gegen Big Tech in der Tiroler Landeshauptstadt kaum ankommen. Bei ParityQC ist man sich dessen bewusst. „Unsere Strategie ist es, uns nicht als Konkurrent dieser Unternehmen zu positionieren, sondern als Zulieferer einer kritischen Komponente, konkret der Systemarchitektur“, erklärt Lechner. „Hardwareproduzenten können unsere Architektur und unsere gesamte IP lizenzieren“, ergänzt CoCEO Magdalena Hauser.
Im Gegensatz zu Olympia, wo entgegen anderslautender Behauptungen Dabeisein keineswegs alles ist, sieht Wolfgang Lechner genau darin die richtige Strategie für Europa. Es geht ein Stück weit darum, sich mit dem hierzulande erarbeiteten Wissen rund um die kleinsten Teilchen unverzichtbar zu machen. Kaufangebote sind nicht ausgeblieben, es ging noch vor Firmengründung los damit, nachdem Lechner 2015 gemeinsam mit Philipp Hauke und Peter Zoller an der
Universität Innsbruck bzw. am IQOQI (Institut für Quantenoptik und Quanteninformation Innsbruck) einige aufsehenerregende Patente angemeldet hatte. „Wir haben dankend abgelehnt und stattdessen selbst eine Firma gegründet“, erinnert sich Lechner. Und mit eben dieser Firma, ParityQC, ist man Europa und den Wurzeln in Innsbruck treu geblieben. „Wir sind eines der wenigen Quantenunternehmen, das profitabel ist“, sagt Magdalena Hauser. Seit 2023 schreibt man nach eigenem Bekunden schwarze Zahlen. Der erste Kunde, die japanische NEC Corporation, konnte gerade einmal zwei Wochen nach Unternehmensgründung an Land gezogen werden. „Wir haben von Anfang an Produkte verkauft“, sagt Magdalena Hauser. Von der Patentanmeldung bis zur Gründung des Unternehmens sind rund fünf Jahre ins Land gezogen. Einerseits könnte man meinen, dass ein Schnellschuss anders aussieht, andererseits hat es nicht einmal fünf Jahre gedauert, um aus einem fundamentalen mathematischen Prinzip ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. „Das wäre in jedem anderen Bereich außer der Quantenphysik undenkbar“, weiß Lechner.
In der Führungsebene des Unternehmens herrscht mit dem Duo Hauser und Lechner Geschlechterparität. Und Parity ist zugleich der Kern der IP des Innsbrucker Spin-offs. Eine genaue Beschreibung der Funktionsweise der Quantenarchitektur überstiege sowohl das Platzangebot als auch das Denkvermögen des Autors. Hier nur so viel: „Unser Ansatz ist eine fundamental andere Art, Quantencomputer zu bauen“, sagt Wolfgang Lechner. Das Zustandekommen des zugrundeliegenden mathematischen Patents ist einigermaßen kurios. „Es handelte sich ursprünglich um eine Idee aus der Kategorie ‚Too good to be true‘, und binnen kürzester Zeit haben wir auch bewiesen, dass sie nicht funktionieren kann. Aus irgendeinem Grund habe ich aber weitere eineinhalb Jahre daran geforscht.“ Die wissenschaftliche Neugier – oder Sturheit –Lechners wurde belohnt. Heureka! Nicht die Idee war falsch gewesen, sondern der Beweis, mit dem sie widerlegt wurde. Retrospektiv hat sich das als absoluter Glücksfall erwiesen, weil Lechner nie mit jemandem aus der Quanten-Community darüber gesprochen und es auch keine Lehrveranstaltungen dazu gegeben hat. „Deshalb konnten wir unseren Durchbruch überhaupt erst patentieren.“ Die Gründung von ParityQC
verdankt sich folglich wissenschaftlichem Eifer – und einer gesunden Portion Glück.
GENERALSCHLÜSSEL
Normalerweise ist es ja so, dass erst eine „Killerapplikation“ einer neuen Technologie zum Durchbruch verhilft. Beim Quantencomputer ist es umgekehrt. Zuerst gab es die Killerapplikation, und erst danach wurde am Computer geforscht, der damit etwas anfangen kann. Der Mathematiker Peter Shor veröffentlichte 1994 den heute nach ihm benannten Shor-Algorithmus. „Damit lässt sich die gängige Kryptographie aushebeln“, sagt Lechner. Den Impact dieser Anwendung kann man erahnen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass alle schützenswerten Daten heutzutage irgendwie verschlüsselt und damit – vermeintlich – sicher sind. Die Entwicklung eines Quantencomputers, der mit dem Shor-Algorithmus performant umgehen kann, ist eine große Sache. Eine Sache der nationalen, internationalen, ja globalen Sicherheit. Dementsprechend sind auch Regierungen daran interessiert, diese Technologie zu besitzen. Naturgemäß wird unter höchster Geheimhaltung und hinter verschlossenen Türen dazu geforscht. Man braucht also nicht auf entsprechende Presseaussendungen und Erfolgsmeldungen zu warten. Die Frage, ob heute gängige Kryptographieverfahren durch Quantencomputer obsolet werden könnten, quittiert Lechner mit einem knappen „Ja.“ Die Behörden sind alarmiert, an quantensicheren Verschlüsselungsverfahren wird bereits gearbeitet. Der Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie soll in allen EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2026 beginnen, kritische Infrastrukturen sollen spätestens jedoch bis Ende 2030 umgestellt werden. In Sicherheit wiegen sollte man sich davon nicht lassen, sagt Wolfgang Lechner: „Wir sollten generell davon ausgehen, dass alles, was wir digital machen, völlig offen ist. Wer eine E-Mail schreibt, sollte sie so formulieren, dass sie auch in der Zeitung stehen könnte.“
QUANTEN - HAUSVERSTAND
Nun tun sich die meisten Menschen schon einigermaßen schwer damit, die klassi-
sche, newtonsche Physik zu begreifen. Bei der Quantenphysik ist dann endgültig das Ende der Fahnenstange erreicht. Das wird sich auch mit der zunehmenden Verbreitung von Quantencomputing nicht fundamental ändern, argumentiert Magdalena Hauser: „Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Anwender plötzlich Quantenmechanik verstehen wird. Quantencomputer werden sich eher inkrementell in unser Leben einschleichen.“ Zunächst dürften sie in großen Datenzentren eingesetzt werden, wo sie Aufgaben schneller und energieeffizienter lösen können, als das mit heutigen Supercomputern möglich ist. Das, was technisch möglich ist, deckt sich nicht immer mit dem, was der Markt nachfragt. Das gilt auch für den Quantencomputer und dessen konkrete Anwendungen. Ein mögliches Gebiet, auf dem dieser umrühren könnte, ist die Chemie. „Chemische Vorgänge sind quantenmechanische Vorgänge“, sagt Lechner. Auch für die Lösung sogenannter globaler Optimierungsprobleme eignet sich der Quantenrechner. Das würde auch ökonomisch so richtig Wind machen, könnte man damit doch beispielsweise Verkehrs- oder Warenflüsse gesamthaft optimieren.
WAGNISBÜROKRATIE
In Europa ist Venture Capital knapper bemessen als in den Vereinigten Staaten, wo man weit weniger risikoavers ist. Das erleichtert es nicht gerade, von hier aus zu skalieren. Dennoch gibt es von den CEOs ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort. Mit den ökonomischen Vorzügen des österreichischen Steuersystems und den verschachtelten Ebenen der Bürokratie hat das wenig zu tun. „Es gibt viele persönliche Gründe für uns, hier zu bleiben“, sagt Wolfgang Lechner. Dankbarkeit könnte man einen davon nennen: „Ich bin hier aufgewachsen, habe, vollständig staatlich finanziert, die Schule und Universität besuchen dürfen. Das wäre wahrscheinlich an kaum einem anderen Ort der Welt möglich gewesen.“ Er findet es moralisch nicht richtig, der Ausbildungsstätte und Heimat den Rücken zu kehren, wenn es gut läuft. Das ist Loyalität. Langfristig wird es aber bedeutend zu wenig sein, die Konkurrenzfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts an der Heimatverbundenheit innovativer Menschen aufzuhängen. Das ist keine Strategie. Die finanziellen Möglichkeiten in den USA könne man „mit dem Faktor 1.000 multiplizieren“, meint Lechner. Doch es ist längst nicht alles schlecht.
ParityQC war in der glücklichen Lage, bei der letzten Kapitalbeschaffung zwischen ausländischen und österreichischen Kapitalgebern wählen zu können. Die österreichische B & C Innovation Investments (BCII), ein Unternehmen der B&C Gruppe, ist bei einer international wettbewerbsfähigen Bewertung in das Unternehmen eingestiegen. „Das ist eine sehr positive Ausnahme zum europäischen Normalzustand gewesen“, streicht Magdalena Hauser die Bedeutung dieses Einstiegs hervor. Von einzelnen Lichtblicken abgesehen fällt ihr Urteil über die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts eindeutig aus: „Wir haben in Europa eine Bürokratie, die unerträglich ist, um ein Unternehmen zu skalieren.“ Wachstum ist zwar auch in Europa möglich. Einfach ist es nicht. Mittlerweile ist ParityQC neben Innsbruck auch in Hamburg, London und Paris mit Niederlassungen vertreten. Das ist betriebswirtschaftlich notwendig, weil staatliche Förderungen üblicherweise an den Standort gebunden sind und die Europäer diesmal sichergehen wollen, dass die IP, das geistige Eigentum, in Europa bleibt. Vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht. „Viermal Arbeitsrecht, viermal Steuerrecht, viermal Gründung, vier unterschiedliche Risikoprofile durch unterschiedliche Gesellschaftsformen“, zählt Hauser auf. Am einfachsten und unbürokratischsten sei die Firmengründung im Vereinigten Königreich gewesen. „Wären wir in den USA angesiedelt, sähe das Unternehmen heute sicher ganz anders aus.“ Vermutlich größer und noch dynamischer. Aber das ist hypothetisch. „Europa“, hofft Hauser, „hat dazugelernt und weiß, dass Quantum Computing ein extrem wichtiger Faktor für die Zukunft ist.“ Europa müsse dabei nicht alles alleine machen. Es reiche, die „Missing Links“ in der Quantentechnologie bereitzustellen, glaubt sie. Technologieführerschaft muss der Anspruch sein, darunter darf es Europa diesmal nicht

„EUROPA HAT DAZUGELERNT UND WEISS, DASS QUANTUM COMPUTING EIN EXTREM WICHTIGER FAKTOR FÜR DIE ZUKUNFT IST.“
Wolfgang Lechner
machen. Wer vorangeht, ist nicht in Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
EXZELLENZ ALS PULL - FAKTOR
Derzeit arbeiten rund 60 Menschen aus 16 Nationen für ParityQC. „Wir haben ein fantastisches Team und konnten Forscher*innen aus der ganzen Welt begeistern, bei uns anzufangen“, sagt Magdalena Hauser. Sie will sich nicht festlegen, wohin die Reise in personeller Hinsicht geht. „Wir brauchen so viel Exzellenz, wie wir bekommen können.“ Wolfgang Lechner freut sich, dass das Unternehmen den besten Köpfen im Feld etwas bieten kann, was sie weltweit in dieser Form kaum irgendwo finden. Wegen der hohen Tiroler Lebensqualität kommen diese Menschen nicht hierher. Sie rangiert bei den Kriterien unter „ferner boten“ und dürfte als Standortfaktor allgemein überschätzt sein. „Die Lebensqualität bei uns ist sehr gut, aber das ist für diese Leute nicht das
Ausschlaggebende. Sie genießen es, mit anderen exzellenten Leuten zu arbeiten. Wir haben einen Ort geschaffen, an dem man als Physiker exzellent arbeiten kann“, sagt Lechner, der diesbezüglich eine „kritische Masse“ überschritten sieht. Das Unternehmen ist als Arbeitgeber gefragt. „Wir haben über 1.400 Bewerbungen im Quartal und stellen zwei bis drei Personen ein“, sagt Hauser. Fachkräftemangel herrscht hier also nicht. ParityQC kann aus dem Vollen schöpfen.
Der Quantencomputer kann signifikant Rechenzeit einsparen, mit AI und der Gralssuche nach der Artificial General Intelligence (AGI) sollte man ihn aber nicht in einen Topf werfen. Damit würde man Dinge vermengen, die nicht viel miteinander zu tun haben. Der AI-Hypetrain läuft derzeit unter Volldampf, nicht auszuschließen, dass er schon bald entgleist, weil kein AI-Unternehmen auch
nur annähernd den Profit abwirft, den der Börsenwert verheißt. Beim Quantencomputing werden kleinere Brötchen gebacken. „Quantum hat viel zu wenig Hype“, ist Lechner überzeugt. Zum einen, weil Regierungen aus Sicherheitsinteressen kein großes Aufhebens davon machen. Zum anderen, weil auch die großen Player in Big Tech zwar investieren, sich aber auch eher schmallippig zeigen. Die ParityQC-CEOs sind von den ständigen Vergleichen zwischen Quantencomputing und AI mittlerweile einigermaßen genervt. Sie sind sich allerdings darin einig, dass der Quantencomputer durchaus noch mehr Hype vertragen könnte. Patente allein immunisieren nicht dagegen, kopiert zu werden. Man muss es sich erst einmal leisten können, auf der ganzen Welt juristisch gegen Patentverletzungen vorzugehen. Was zur Unnachahmlichkeit des Tiroler Spin-offs beiträgt, ist das hervorragende Ökosystem aus Quantenforscher*innen, in das es eingebettet ist. Es wächst und gedeiht auf dem Boden, den Quantenkoryphäen in Innsbruck bereitet haben. Die Architektur von ParityQC – sie ist das Hauptprodukt – hat den großen Vorteil, dass sie unabhängig von der Hardware auf allen Plattformen lauffähig ist. Es ist Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner folglich einerlei, welche Hardware sich im Rennen um die Massenmarkttauglichkeit durchsetzen wird, weil man jedenfalls die richtigen Produkte in petto hat. „Innsbruck ist global ein Leuchtturm in der Quantenphysik“, sagt Wolfgang Lechner. Hier gibt es Exzellenz, so wie es in der überschaubaren Quanten-Community noch so etwas wie echten Pioniergeist gibt. Man kann sich noch an den Erfolgen anderer erfreuen, weil sie das gesamte Feld voranbringen. Mit der fortschreitenden Kommerzialisierung nimmt naturgemäß der Wettbewerbsdruck zu und der Teamspirit ab. Es geht um Geld. Viel Geld. Mit ihrem Unternehmen tragen Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser dazu bei, dass Innsbruck ein guter Boden bleibt, wenn es um die kommerzialisierte Anwendung der jahrzehntelangen Grundlagenarbeit geht. „Die Rahmenbedingungen sind, wie sie nun einmal sind. Wir können nicht den Wind ändern, sondern nur unsere Segel entsprechend ausrichten“, schließt Wolfgang Lechner. Und er hofft, dass Europa in der Quantentechnologie mit einem „Sputnik-Effekt“ noch einmal ein großes ökonomisches Lebenszeichen sendet. Magdalena Hauser hat noch einen anderen Wunsch: Weniger Round Tables und mehr Mut zum Risiko. Denn wer nichts wagt, kann auch nichts gewinnen.

AbimDezember Handel oder 2 x jährlich als Abo!

Tirols Industrie treibt die grüne Transformation voran: Mit Investitionen in Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energie wird Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft übernommen – und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gesichert.
Die Dekarbonisierung und Ökologisierung der heimischen Industrie zeigt sich nicht in großen Ankündigungen, sondern im täglichen Handeln der Betriebe: Investitionen in energieeffiziente Anlagen, die Nutzung von Prozesswärme, die konsequente Digitalisierung von Abläufen oder die Rückführung wertvoller Rohstoffe in den Kreislauf sind längst gelebte Realität in Tirols Produktionshallen. Sie machen Unternehmen unabhängiger, senken Kosten und eröffnen neue Spielräume. „Tirols Industrie steht seit jeher für technologischen Fortschritt und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Umwelt und Gesellschaft. Dass wir diesen Anspruch ernst nehmen, zeigen die Zahlen: 2024 wurde derselbe industrielle Output wie 2014 mit 757.492 Tonnen weniger CO₂e*) erreicht – ein klares Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Max Kloger, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Tirol.
GUTE ZUKUNFT FÜR
MENSCHEN UND BETRIEBE
Die Tiroler Industrie verbindet wirtschaftliches Handeln konsequent mit Verantwortung für kommende Generationen. Es geht längst nicht mehr nur darum, Prozesse effizienter zu gestalten, sondern darum, mit Investitionen in neue Technologien die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung von Betrieben, Arbeitsplätzen und Gesellschaft zu sichern: „Wir nehmen unsere Rolle als treibende Kraft für Wohlstand und Fortschritt ernst. Investitionen in neue Technologien sichern nicht nur die Zukunft unserer Unternehmen, sondern auch die Lebensqualität kommender Generationen“, betont Max Kloger. „Jede eingesparte Kilowattstunde, jede vermiedene Tonne CO₂ ist ein Gewinn – für die Betriebe, für die Menschen im Land und für die Wettbewerbsfähigkeit Tirols.“

„INVESTITIONEN
IN NEUE TECHNOLOGIEN SICHERN NICHT NUR DIE ZUKUNFT
UNSERER UNTERNEHMEN, SONDERN AUCH DIE LEBENSQUALITÄT KOMMENDER GENERATIONEN.“
IV-Tirol-Präsident Max Kloger
FORTSCHRITT, KLIMAFREUNDLICH UMGESETZT Wie breit und konkret dieser Transformationskurs in Tirol bereits verfolgt wird, zeigen zahlreiche Projekte quer durch die Industrie: Die EGGER Group investiert rund 80 Millionen Euro in eine neue Kraft-Wärme-Kopplung mit biogenen Brennstoffen. Damit versorgt das Werk in St. Johann künftig nicht nur sich selbst fast ohne fossile Energie, sondern liefert auch erneuerbare Fernwärme an umliegende Gemeinden. Die Plansee Group hat ihre Emissionen seit 2020 um mehr als 25 Prozent gesenkt und gleicht seit März 2025 alles aus, was technisch noch nicht vermeidbar ist – ein Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung. Die Montanwerke Brixlegg produzieren das klimafreundlichste Kupfer der Welt: 100 Prozent Recyclingmaterial, betrieben mit erneuerbarer Energie – ein internationaler Maßstab am Beginn vieler Wertschöpfungsketten. Diese Beispiele stehen stellvertretend für
viele. Ob große Industriegruppe oder spezialisierter Mittelstand: Alle Tiroler Unternehmen arbeiten daran, ihre Produktions-, Energie- und Logistiksysteme zu dekarbonisieren und resilienter zu machen. Wer früh in Zukunftstechnologien investiert, verschafft sich Wettbewerbsvorteile – und übernimmt Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt.
ZEIGEN, WAS DIE TIROLER INDUSTRIE LEISTET
Die ökologischen Fortschritte der heimischen Industrie sind beachtlich, ihre öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung bleibt jedoch oft hinter den unternehmerischen Leistungen zurück. Deshalb hat es sich die IV Tirol zum Ziel gemacht, sichtbar zu machen, an welchen konkreten Nachhaltigkeitsprojekten Tirols Industrieunternehmen arbeiten.
*) Das Kürzel CO₂e steht für „CO₂-Äquivalente“ und bezieht alle klimawirksamen Gase mit ein.
Vier IV-Tirol-Mitgliedsbetriebe zeigen stellvertretend für alle engagierten Industrieunternehmen Tirols, wie Nachhaltigkeit in der Praxis wirkt –technologisch innovativ, ressourcenschonend und international beispielgebend.
C AMPUS KUNDL TREIBT DEKARBONISIERUNG VORAN
Novartis setzt am Campus Kundl wichtige Schritte, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und bis Ende 2025 die Produktion mit CO₂-freiem Dampf zu versorgen. Der Dampfbedarf in der pharmazeutischen Industrie ist hoch. Dampf gilt als wichtigster Energieträger für Prozesswärme, die in vielen Bereichen zum Einsatz kommt. Am Standort wurde ein konkreter Fahrplan entwickelt, der auf drei Säulen basiert. Erstens tragen Energieeffizienzmaßnahmen wie die Installation von Wärmepumpen und andere innovative Technologien dazu bei, den Dampfverbrauch erheblich zu reduzieren. Zweitens prüft der Campus Kundl die Möglichkeit, Biogas aus Abwasser selbst zu erzeugen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Erdgas zu verringern. Drittens wird der benötigte Dampf künftig grün in Elektrokesseln hergestellt.
RHI MAGNESITA
K REISLAUFWIRTSCHAFT NEU GEDACHT
RHI Magnesita setzt unter anderem im Werk Hochfilzen konsequent auf Ressourcenschonung und CO₂-Reduktion. Bereits heute stammen bis zu zehn Prozent der eingesetzten Rohstoffe aus Recycling – pro Tonne recycelten Materials spart das Unternehmen rund eine Tonne CO₂. Auch beim Transport verfolgt der Weltmarktführer im Feuerfestbereich innovative Lösungen: In Fieberbrunn befördern zwei Seilbahnen Magnesit über fünf Kilometer energieeffizient ins Werk Hochfilzen. Zusätzlich bringt ein 1,2 Kilometer langes, energieautarkes Förderband Material aus dem Dolomitbergbau direkt in die Produktion. Ergänzt durch die Schienenanbindung und moderne Containerverladung werden große Teile des Rohstofftransports vom LKW auf umweltfreundlichere Systeme verlagert. Ein integriertes Logistiksystem, das nicht nur Straßen entlastet, sondern auch die CO₂-Emissionen um rund 60 Prozent senkt.
W ELTPREMIERE BEIM WAFFELBACKEN Mit „OptiBake“ testet Loacker in Heinfels seit Mai 2025 den weltweit ersten elektrischen Waffelofen mit Induktionsheizung – eine gemeinsame Entwicklung mit der Bühler Group. Der Ofen verursacht keine direkten Emissionen von CO₂, Kohlenmonoxid (CO) oder Stickoxiden (NOx), senkt den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent und erhöht zugleich die Flexibilität in der Produktion. Nach behördlicher Genehmigung wird der Ofen in den operativen Betrieb integriert werden. Begleitet wird das Projekt von weiteren Nachhaltigkeitsinitiativen: So arbeitet Loacker mit der Universität Innsbruck an Verfahren zur Herstellung von BioLNG aus Abfällen, prüft die Anbindung an die Fernwärme und baut die Nutzung von Photovoltaik aus. Damit setzt das Familienunternehmen ein starkes Signal für Klimaschutz, Ressourceneffizienz und technologische Innovation.
R EGENWALDSCHUTZ IN COSTA RICA
For the love of nature – aus Liebe zur Natur – ist das Leitmotiv bei SWAROVSKI OPTIK. Biodiversität ist ein zentraler Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens: vor der eigenen Haustüre genauso wie weltweit. Dem Leitmotiv gerecht werden in einem selbst verwalteten Projekt eine 115 ha große Regenwaldfläche auf der Halbinsel Osa in Costa Rica geschützt: der SWAROVSKI OPTIK Regenwald. Osa gilt als einer der „artenreichsten Ort der Erde“, hier leben auf einer Fläche von nur 1.813 km2 2,5 Prozent aller auf der Erde vorkommenden Arten. Der SWAROVSKI OPTIK Regenwald liegt an einer Schlüsselstelle zwischen zwei Nationalparks und ist als Teil eines biologischen Korridors für den Naturschutz von besonderer Bedeutung. Mit diesem ambitionierten Naturschutzprojekt übernimmt das Unternehmen aktiv Verantwortung in Zeiten der Artenkrise.
Mit einem innovativen Betonmischwerk und einer effizienten Photovoltaikanlage setzt die Firma Paul Stöckl GmbH in Erpfendorf auf nachhaltige Entwicklung in der Baubranche. Geschäftsführer Jannik Otterbein spricht über zukunftsweisende Investitionen, Recyclingbeton und die Bedeutung mehrerer Standbeine für ein mittelständisches Familienunternehmen.

Henning Appel – Hypo Tirol Leitung Großkunden Innsbruck und Unterland, Christian Jäger –Vorstand Hypo Tirol, Jannik Otterbein und Erwin Otterbein – Stöckl Beton, DI (FH) Andreas Stadler – Vorstand Hypo Tirol

Mehr Infos unter: hypotirol.com/innovationen
ECO.NOVA: Die Firma Paul Stöckl wurde 1921 als Pferdefuhrwerkbetrieb gegründet. Ab 1949 widmete sie sich der Schottergewinnung, 1969 kam die Betonherstellung dazu. Ihr Vater, Erwin Otterbein, hat das Traditionsunternehmen 2006 übernommen. Wie kam es dazu? JANNIK OTTERBEIN: Mein Vater ist bereits 2002 als Geschäftsführer in das finanziell schwer angeschlagene Unternehmen eingestiegen. Nach Jahren kontinuierlicher und kluger Investitionen in Fuhr- und Maschinenpark, nach internen Strukturänderungen sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder waren 2016 sämtliche Altlasten beglichen. Seither reinvestieren wir laufend in die Entwicklung.
Mittlerweile leiten Sie die Paul Stöckl GmbH. Was hat sich in den letzten Jahren getan? Im Jahr meines Einstiegs ins Unternehmen 2016 haben wir eine neue

Kiesaufbereitungsanlage mit Brecher-, Sieb- und Waschanlage errichtet. Die Paul Stöckl GmbH hat ja den großen Vorteil, zwei eigene Kiesabbaugebiete zu besitzen, eines gleich hier am Gelände, das andere, nur wenige Kilometer entfernt, in Waidring. Das heißt, wir verfügen selbst über ein wesentliches Rohmaterial für die Betonherstellung. 2020/2021 kam ein neues Bürogebäude hinzu. Die größte Investition erfolgte mit der neuen Betonmischanlage, die vergangenes Jahr eingeweiht wurde. Hier haben wir sechs Millionen Euro investiert.
Warum wurde das nötig und worin bestehen die Vorzüge der neuen Anlage?
Die alte Anlage stammte aus den 1980ern und entsprach nicht mehr den Anforderungen. In der neuen Anlage erfolgt die Mischung der benötigten Rohstoffe vollautomatisch. Das Speichervolumen umfasst rund 1.300 Kubikmeter Gestein, 600 Tonnen Zement, 14 Zusatzmittel und rund 200.000 Liter Wasser. Zehn Gesteinskammern und fünf Silos, zwei können geteilt werden, ermöglichen es uns, bis zu sieben verschiedene Zemente einzubringen. Damit können wir rund 300 Beton- und Sonderbetonsorten herstellen – wie etwa Faser-, Farb- und Recyclingbeton.
Das Recycling von Beton ist einer der Schwerpunkte des Unternehmens. Erfolgt die Wiederverwertung ohne Qualitätseinbußen? Ja, Beton ist ein echtes Naturprodukt, für das eigentlich nur Kies, Zement und Wasser benötigt werden. Aus dem recycelten Beton wird wieder ein hervorragender langlebiger Baustoff. Auch hier ist die neue Anlage natürlich Gold wert. Wir leisten einen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz und bieten un-

seren Kundinnen und Kunden einen recycelten Baustoff in höchster Qualität.
Ein sicher relevanter Punkt. Gerade die Bau- und Gebäudebranche steht ja im Ruf, starke CO2Emissionen zu verursachen. Wie immer hängt es davon ab, wie verantwortungsbewusst man agiert. Zum einen haben wir sehr kurze Transportwege dank eigener Abbaugebiete. Diese renaturieren wir fachgerecht, sodass wieder ein natürlicher Lebensraum für Tiere und Pflanzen entsteht. Zum anderen benötigt die Herstellung des Zements – er ist ja gebrannter Ton und Kalkstein – zwar viel Energie. Aber wir setzen konsequent auf Greentech-Zement der Salzburger Firma Leube. Ihr ist es gelungen, den Energiebedarf bei der Zementherstellung um rund 30 Prozent zu senken – ein wahrer Quantensprung in diesem Bereich. Nicht zu vergessen die Photovoltaikanlage, die wir im Zuge des Neubaus der Mischanlage 2024 errichtet haben. Sie deckt 75 Prozent unseres Energiebedarfs.
Derart umfangreiche Investitionen müssen natürlich wohlüberlegt sein. Wie liefen die Verhandlungen mit der Hausbank? Die Hypo Tirol Bank war schon Hausbank, als mein Vater Geschäftsführer der Paul Stöckl GmbH wurde. Sie hat uns seit dieser ersten sehr schwierigen Zeit durch alle Entwicklungen hindurch begleitet, daraus ist eine vertrauensvolle und wertschätzende Geschäftsbeziehung gewachsen. Unsere Kundenbetreuerinnen und -betreuer haben sich immer sehr für unsere Projekte eingesetzt, uns kompetent beraten und unterstützt.
Als familiengeführter mittelständischer Betrieb auf einem hart umkämpften Markt – worauf setzen Sie gegenüber Mitbewerberinnen und Mitbewerbern?
Wir investieren in der Region für die Region, sind ein zuverlässiger Geschäftspartner mit schlanken Strukturen und der nötigen Flexibilität, um auf unterschiedliche Kundenwünsche einzugehen. Gerade in Nischenbereichen können wir mit der neuen Betonmischanlage unsere Stärken voll ausspielen. So bieten wir zum Beispiel Zement- und Anhydritfließestrich an. Das heißt für unsere Kundinnen und Kunden, dass der Estrich an einem Tag ausgeführt werden kann und mit nur wenig „Manpower“ ganze Häuser innerhalb von zwei bis drei Stunden komplett mit dem notwendigen Estrich aufgefüllt sind. Besonders in Zeiten von immer mehr Haussanierungen anstelle von Neubauten birgt die Estrichproduktion ein enormes Potential. Wir sind die Ersten im Tiroler Unterland, die diesen Baustoff in dieser Form anbieten.
Neben der Kies und Betonerzeugung führt die Paul Stöckl GmbH Erdarbeiten und Winterdienste durch. Welche Vorteile bringen diese Bereiche? Unser Fuhrpark mit 25 Fahrzeugen ist so das ganze Jahr über ausgelastet. Wenn es – wie etwa zurzeit in der Baubranche – stockt, können wir das mit unseren anderen Angebotsfeldern ausgleichen. Zusatzeffekt bei den Aushubarbeiten: Mit dem Material befüllen wir unsere Abbaugebiete, bringen also wertvollen Boden wieder ein.
Als regionaler Arbeitgeber setzen Sie auf Kontinuität und Verlässlichkeit. Wie viele Personen beschäftigen Sie derzeit? Wir haben in Erpfendorf 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle aus der Region stammen. Sie sind wesentlicher Teil unseres Erfolgs. Gemeinsam garantieren wir die hohe Qualität, Verlässlichkeit und den umfassenden Service der Paul Stöckl GmbH. PR
TEXT: VERENA MARIA ERIAN, RAIMUND ELLER
Mit dem Gewinnfreibetrag (GFB) können Sie auch heuer wieder bis zu 15 Prozent Ihrer Gewinne steuerfrei lukrieren. Zusätzlich gibt es seit zwei Jahren einen zehnprozentigen Investitionsfreibetrag (im Bereich Ökologisierung 15 %), der sich in Kürze sogar verdoppeln soll. Um in den maximalen Genuss dieser Freibeträge zu kommen, bedarf es nichts weiter als einer guten Planung und darauf basierend dem richtigen Timing sowie das rechte Maß an Investitionen.
RAUS AUS DEM NEBEL
Auf Basis der Buchhaltung der ersten drei Quartale ist es gepaart mit entsprechender Expertise und Erfahrungswerten ein Leichtes, eine Hochrechnung für das gesamte Jahr zu erstellen. So ist es möglich, Ihr noch brachliegendes Optimierungspotential zu erkennen und auszuschöpfen. Bitte betrauen Sie mit dieser Aufgabe Ihren persönlichen Steuerberater. Derartige Hochrechnungen erfordern ein nicht zu unterschätzendes steuerliches und fallspezifisches Know-how.
HANDLUNGSBEDARF GEWINNFREIBETRAG
Alles, was Sie dann noch zu Ihrem „Steuerglück“ tun müssen, ist, das bekannt gegebene Volumen vor dem 31. Dezember 2025 in bestimmte Positionen zu investieren und diese vier Jahre lang in Ihrem Betriebsvermögen zu halten. Da es seit 2023 für bestimmte Wirtschaftsgüter auch einen Investitionsfreibetrag (IFB) gibt, sollte der Gewinnfreibetrag (GFB) seither immer mit Wertpapieren abgedeckt werden. Eine Doppelbelegung ein und derselben Position mit beiden Freibeträgen ist nämlich nicht möglich und anders als der Gewinnfreibetrag kann der

Investitionsfreibetrag nur für körperliche Wirtschaftsgüter geltend gemacht werden. Davon ausgenommen sind Gebäudeinvestitionen. Dafür gibt es keinen Investitions-, wohl aber einen Gewinnfreibetrag. Somit ist bei einem ausreichenden Volumen an baulichen Investitionen aus steuerlichen Gründen kein zusätzlicher Kauf von Wertpapieren indiziert. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an Ihre Bank, um sicherzustellen, dass sich die richtigen Wertpapiere dann tatsächlich noch vor Jahresende auf dem Depotauszug Ihres betrieblichen Wertpapierdepots wiederfinden.
Alternativ können auch Bundesschatzscheine (siehe www.bundesschatz.at) gekauft werden.
TIPP: Kürzlich hat die Regierung angekündigt, den Investitionsfreibetrag im Zeitraum 1. November 2025 bis 31. Dezember 2026 von derzeit 10 bzw. 15 Prozent (Ökologisierung) auf 20 bzw. 22 Prozent zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, mit anstehenden Investitionen noch bis zur Gesetzwerdung dieser Änderung zuzuwarten, um in den Genuss dieser wundersamen Verdoppelung zu kommen.
Eine Idee mit Weitblick
Vor 100 Jahren wurde beim ersten internationalen Sparkassenkongress in Mailand der Weltspartag ins Leben gerufen. Mitinitiiert vom österreichischen Sparkassenvertreter Dr. Walther Schmidt sollte der 31. Oktober künftig dem verantwortungsvollen Umgang mit Geld gewidmet sein. Seither steht dieser Tag für wirtschaftliche Bildung und die Förderung von Finanzkompetenz, insbesondere bei jungen Menschen.
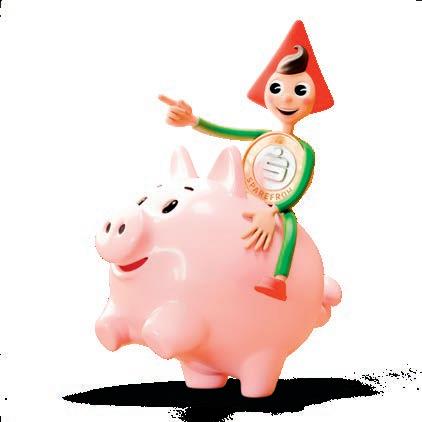
Ziel war und ist es, Sparen nicht als Verzicht, sondern als bewusste Entscheidung für die Zukunft zu verstehen. Dieses Verständnis hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt: Sparen bedeutet heute mehr als das klassische Sparbuch. Neben dem Aufbau von Reserven und dem Ansparen für Anschaffungen steht heute auch die Vorsorge
im Fokus. Je nach Ziel und Risikobereitschaft können dazu moderne Anlageformen wie Wertpapiere oder Versicherungen zählen. Im Zentrum steht der persönliche Austausch: Vertrauen, Beratung und gemeinsames Gestalten von Perspektiven – damals wie heute. PR
Die Tiroler Sparkasse lädt alle Kinder ein: Am 31. Oktober gibt es am Sparkassenplatz in Innsbruck eine Sparefroh-Rallye mit spannenden Spielen und kleinen Geschenken.

Aktuelle Problemfelder und Haftungsrisiken für Lohnabgabenprüfungen.
TEXT: HANNES HAUSER & CLAUDIA RIECKH-RUPP
In der derzeit prekären Budgetsituation nehmen wir in der Praxis verstärkte Prüfungsaktivitäten der Behörden bei Lohnabgaben wahr. Die GPLB (Gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben) ist für viele Unternehmer*innen ein zentrales Thema geworden und kann bei falscher Vorbereitung erhebliche finanzielle Risiken für das Unternehmen mit sich bringen. Gerade in einer Zeit, in der der bürokratische Aufwand für Betriebe stetig wächst, ist es entscheidend, sich mit den typischen Problemfeldern auseinanderzusetzen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die häufigsten Fallstricke und bieten Tipps, wie Sie Ihr Unternehmen bestmöglich darauf vorbereiten können.
STEUERPFLICHT DES FEIERTAGSARBEITSENTGELTS:
NEUE REGELUNGEN AB 2025
Ein brandaktuelles Thema, das branchenübergreifend fast alle Unternehmen betrifft, ist die geänderte lohnsteuerliche Behandlung des Feiertagsarbeitsentgelts. Diese Änderung greift rückwirkend ab dem 1. Jänner 2025 und basiert auf einer Entscheidung des Bundesfinanzgerichts (BFG) aus dem Dezember 2024.
Festgestellt wurde, dass das Entgelt für Arbeitsleistungen an einem gesetzlichen Feiertag, bekannt als Feiertagsarbeitsentgelt, grundsätzlich keinen steuerfreien Fei-
ertagszuschlag mehr im Sinne des § 68 Abs. 1 EStG darstellt, sondern steuerpflichtig ist. Diese Entscheidung steht im Gegensatz zur bisherigen Vollzugspraxis, die eine steuerliche Begünstigung des Feiertagsarbeitsentgelts vorsah.
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat sich dieser Rechtsmeinung angeschlossen und festgelegt, dass das Feiertagsarbeitsentgelt ab dem 1. Jänner 2025 lohnsteuerpflichtig abgerechnet werden muss. Nur mehr unter Einhaltung bestimmter Kriterien können Lohnbestandteile für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen steuerfrei abgerechnet werden (z. B . im Kollektivvertrag normierte zusätzliche Zuschläge für Feiertagsarbeit). Für Zeiträume bis zum 31. Dezember 2024 behalten die bisherigen Begünstigungen ihre Gültigkeit.
Es ist wichtig, dass alle Feiertagsentgelte gemäß der neuen Rechtslage steuerpflichtig in der Lohn- und Gehaltsabrechnung erfasst werden. Für alle bereits abgerechneten Feiertagsarbeitsentgelte seit Jänner 2025 sollte
eine rückwirkende Anpassung der Lohnund Gehaltsverrechnungen durchgeführt werden – eine sogenannte Aufrollung. Diese Anpassungen sind zwingend erforderlich, um den steuerrechtlichen Vorgaben des BMF zu entsprechen.
DER PKW-SACHBEZUG: FAHRTENBUCHFÜHRUNG ALS DAUERBRENNER IN DER GPLB
Ein immer wiederkehrendes Thema bei Lohnabgabenprüfungen ist die Privatnutzung von Personenkraftwagen, welche sich im Betriebsvermögen von Unternehmen befinden, sowie die dazugehörige, ordnungsgemäße Führung des Fahrtenbuchs. Häufig scheitern Unternehmer*innen daran, dem Prüforgan gegenüber eine ausschließliche betriebliche (z. B. von Poolautos) oder eine nur geringe private Nutzung (halber Sachbezugswert) von Firmen-PKW nachzuweisen. Dies kann schnell zu einer hohen Nachforderung führen, da meistens Sozialversiche-
EIN IMMER WIEDERKEHRENDES THEMA BEI LOHNABGABENPRÜFUNGEN
IST DIE PRIVATNUTZUNG VON PKW, DIE SICH IM BETRIEBSVERMÖGEN VON UNTERNEHMEN BEFINDEN.
rungs- und Lohnsteuerbeträge in Höhe von ca. 80 Prozent (bei einem Grenzsteuersatz des Mitarbeiters von 40 %) des Sachbezugswertes vorgeschrieben werden. Bei einem Sachbezugswert von 960 Euro führt dies zu einer Nachforderung in Höhe von 768 Euro monatlich bzw. bei einem fünfjährigen Prüfungszeitraum in Höhe von 46.080 Euro für ein einziges Firmenauto!
Damit der Nichtansatz eines Sachbezugs steuerlich anerkannt wird, muss ein Fahrtenbuch fortlaufend, zeitnah, übersichtlich und in chronologischer Reihenfolge geführt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine Lücken entstehen und alle relevanten Informationen präzise erfasst werden.
Ein Fahrtenbuch muss folgende Angaben umfassen:
• das Datum jeder Fahrt
• den Kilometerstand am Beginn und Ende der Fahrt sowie die Fahrtstrecke in Kilometern
• Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie die Dauer der Fahrt
• den Ausgangsort und Zielort jeder Fahrt;
• die Reiseroute, um die Fahrt nachvollziehen zu können
• den Zweck jeder einzelnen Fahrt;
• das verwendete Fahrzeug, einschließlich Kennzeichen
Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn bei einer einzigen beruflichen Fahrt mehrere Kund*innen besucht werden. Hier müssen die Kund*innen mit Namen und Anschriften in zeitlicher Reihenfolge aufgelistet werden, wobei hinsichtlich des Kilometerstandes eine Gesamtangabe der gefahrenen Kilometer ausreicht, solange keine Privatfahrt dazwischenliegt.
Ein per Computerprogramm geführtes Fahrtenbuch wird nur dann anerkannt, wenn nachträgliche Veränderungen entweder technisch ausgeschlossen sind oder diese dokumentiert bzw. offengelegt werden. Aufgrund dieser Anforderungen werden Excel-geführte Aufzeichnungen in der Regel nicht anerkannt, insbesondere dann, wenn die beruflich bedingten Fahrten nicht durch andere Unterlagen bestätigt werden können (z. B. Tankrechnungen, Maut etc).
Die Gefahr einer Sachbezugszurechnung ist ebenso bei wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführern gegeben. Wird dem wesentlich (mehr als 25 %) beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer seitens der Kapitalgesellschaft ein Firmenfahrzeug zur Privatnutzung zur Verfügung gestellt, ist

nämlich ein Sachbezug nach den Bestimmungen der Verordnung über die Bewertung von Sachbezügen betreffend Kraftfahrzeuge anzusetzen, selbst wenn ein Privatanteil an die Gesellschaft entrichtet wird, aber es über die tatsächlich durchgeführten Privatfahrten keine Nachweise (wie Fahrtenbuch) gibt. Eine Befreiung von der Sachbezugsbesteuerung besteht lediglich für Elektroautos für Dienstnehmer*innen und Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft.
STEUERFREIE ÜBERSTUNDENZUSCHLÄGE UND ALL-INVEREINBARUNGEN/GLEITZEIT
Die aktuelle Prüfpraxis zeigt eine verschärfte Haltung der Finanzverwaltung hinsichtlich steuerlicher Begünstigungen, insbesondere bei steuerfreien Überstundenzuschlägen bei Bezug eines All-in. Damit diese Zuschläge aus dem All-in-Gehalt herausgeschält werden können, müssen ab sofort folgende Kriterien erfüllt sein – und dies nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“:
• Es müssen im Jahresdurchschnitt entweder 18 Überstunden monatlich geleistet worden sein (ab 2026 wird die Grenze auf zehn Überstunden reduziert)
• oder der maximale Freibetrag muss erreicht werden (für 2025: 200 Euro; ab 2026: 120 Euro)
Außerdem darf es zu keiner missbräuchlichen Verteilung der Überstunden kommen – also etwa Leistung der Überstunden in den ersten sechs Monaten und Auszahlung verteilt über das ganze Jahr.
In Kombination mit Gleitzeit gelten zudem zusätzliche Einschränkungen: Werden während der Gleitzeit nur Gleitstunden und keine echten Überstunden geleistet (mit denen im Jahresdurchschnitt eine der Höchstgrenzen erreicht wird), können keine steuerfreien Überstundenzuschläge herausgeschält werden. Echte Überstunden während der laufenden Gleitzeitperiode liegen nur vor, wenn die tägliche/wöchentliche Normalarbeitszeit überschritten oder außerhalb des Gleitzeitrahmens gearbeitet wird bzw. wenn Arbeitsleistungen über die gesetzliche Normalarbeitszeit hinaus angeordnet werden. Liegen am Ende der Gleitzeit nicht übertragbare Stunden vor, werden diese zu Überstunden und können bei einem Überstundenpauschale zu diesem Zeitpunkt steuerfreie Überstundenzuschläge herausgeschält werden. Bei Bezug eines
DAS EINKOMMENSTEUERGESETZ DEFINIERT TRINKGELDER
DRITTEN FREIWILLIG BEI EINER ARBEITSLEISTUNG GEWÄHRT
WERDEN. DABEI DARF ES KEINEN RECHTSANSPRUCH
DARAUF GEBEN UND DAS TRINKGELD MUSS ZUSÄTZLICH
ZUR GEZAHLTEN VERGÜTUNG GEWÄHRT WERDEN.
All-ins ist dieses Vorgehen jedoch nicht zulässig, da die Überstunden nicht gesondert abgegolten werden. Die Überstunden müssen anhand von Arbeitszeitaufzeichnungen nachgewiesen werden können – das bedeutet insbesondere bei Gleitzeit, dass gesonderte Zeitkonten für die echten Überstunden zu führen sind. Ob diese Sichtweise der Finanzverwaltung hält, wird sich anhand der künftigen Rechtsprechung der Höchstgerichte zeigen.
TRINKGELDER UND TRINKGELDPAUSCHALEN IN DER ABRECHNUNG: WACHSENDE AUFMERKSAMKEIT BEI PRÜFUNGEN
Im Rahmen der GPLB-Prüfungen erkennen wir österreichweit einen verstärkten Fokus auf die Überprüfung von Trinkgeldpauschalen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen hier einen umfassenden Überblick über die geltenden Regelungen und mögliche Änderungen.
TRINKGELD IN DER SOZIALVERSICHERUNG
Sozialversicherungsrechtlich gelten Trinkgelder als Entgelt, da sie im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis von Dritten gewährt werden. Daher müssen Trinkgelder grundsätzlich in die Beitragsgrundlage der Sozialversicherung einbezogen werden. Für bestimmte Berufsgruppen gibt es jedoch Trinkgeldpauschalierungen, die die aufwändige Führung detaillierter Aufzeichnungen durch den Dienstgeber erübrigen. In Tirol betrifft dies folgende Gewerbe:
• Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe
• Friseure
• Kosmetiker, Fußpfleger und Masseure
• Lohnfuhrwerkgewerbe (Taxi, Mietwägen, Autobusse)
Mitarbeiter*innen, die nach glaubwürdigen Aufzeichnungen weniger als die Hälfte oder
doppelt so viel Trinkgelder im Vergleich zur Pauschale erhalten, sind von der Pauschalierung ausgeschlossen. In solchen Fällen muss der tatsächliche Betrag sozialversicherungspflichtig angesetzt werden. Besteht keine Trinkgeldpauschale, sind für jeden Arbeitnehmer detaillierte Aufzeichnungen erforderlich.
Das Einkommensteuergesetz (EStG) definiert Trinkgelder als steuerfrei, wenn sie ortsüblich sind und von Dritten freiwillig bei einer Arbeitsleistung gewährt werden. Dabei darf es keinen Rechtsanspruch darauf geben und das Trinkgeld muss zusätzlich zur gezahlten Vergütung gewährt werden. Die Ortsüblichkeit von Trinkgeldern wird durch Branchenüblichkeit und Angemessenheit am Ort der Leistung bestimmt. Machen Trinkgelder eines Arbeitnehmers mehr als 25 Prozent des Bruttolohns aus, werden sie laut BFG nicht mehr als ortsüblich angesehen, was steuerliche Probleme verursachen kann, insbesondere in Tourismusregionen, wo großzügigere Trinkgelder üblich sind. Trinkgelder, die seitens des Unternehmens fix in Rechnung gestellt werden (z. B. pauschal 10 % der Rechnungssumme), erfüllen nicht die Voraussetzung der Freiwilligkeit. Sind die Kriterien für die Steuerfreiheit nicht erfüllt, müssen solche Trinkgelder als steuerpflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis abgerechnet werden.
AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND REGIERUNGSPLÄNE
Bedenken sie, dass Trinkgelder bei Kartenzahlungen bestens dokumentiert sind, was es den Prüfer*innen sehr einfach macht, die tatsächlich gezahlten Trinkgelder mit den angesetzten Trinkgeldpauschalen zu vergleichen. Dies birgt das Risiko, dass die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nachweisbar nicht mehr vollständig erfüllt sind und Nachforderungen seitens der Finanzbehörden entstehen könnten.
Die österreichische Bundesregierung hat angekündigt, Trinkgeldpauschalen ab dem 1. Jänner 2026 im Hotel- und Gastgewerbe österreichweit zu vereinheitlichen. Die neue SV-Pauschale wird für Kellner*innen mit Inkasso auf 65 Euro und für jene ohne Inkasso auf 45 Euro festgelegt. Ein entscheidender Punkt dabei ist, dass das tatsächliche Trinkgeld – selbst wenn nachweislich oder geschätzt höher – nicht mehr in die Sozialversicherungs-Beitragsgrundlage aufgenommen wird. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Rechtssicherheit zu schaffen und das Risiko von SV-Beitragsnachforderungen bei Lohnabgabenprüfungen zu beseitigen. Für laufende Verfahren soll es eine Generalamnestie geben, die bedeutet, dass diese Verfahren ohne Sozialversicherungsnachzahlung eingestellt werden. Zudem wurde für bereits abgeschlossene Fälle, in denen Betriebe hohe Nachzahlungen auf Basis der tatsächlichen Trinkgelder entrichten mussten, eine Härtefallregelung angekündigt.
Derzeit scheint zwar für das Gastgewerbe in der Sozialversicherung eine rechtssichere Regelung gefunden worden zu sein, allerdings gilt diese derzeit nicht für andere Branchen. Außerdem gilt diese gesetzliche Änderung nur in der Sozialversicherung und nicht in der Lohnsteuer. Hier herrscht weiterhin Unklarheit – trotz geringfügiger Anpassung der Lohnsteuerrichtlinien. Es wäre aus Gründen der Rechtssicherheit wünschenswert, dass ebenso das Einkommensteuergesetz gesetzlich angepasst wird. Neben diesen Problemfeldern gibt es noch zahlreiche andere bekannte Themen bei GPLB-Prüfungen wie korrekte Zeitaufzeichnungen und Reisekostenabrechnungen, korrekte Abwicklung der Corona-, Teuerungsoder Mitarbeiterprämien, Aufwendungen für betriebliche Gesundheitsförderung oder steuerfreie Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen. Wir begleiten Unternehmen gerne bei dieser herausfordernden Thematik. www.deloitte.at/tirol

Wir unterstützen Sie bei Ihrer GPLB und analysieren sämtliche Aspekte und Haftungsrisiken für zukünftige Lohnabgabenprüfungen – individuell für Unternehmen jeder Größe.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Deloitte Innsbruck Wilhelm Greil Strasse 15/ 5. Stock, 6020 Innsbruck
Deloitte Imst Eduard-Wallnöfer-Platz 1, 6460 Imst
Deloitte St. Anton Im Gries 22, 6580 St. Anton am Arlberg www.deloitte.at/tirol
© 2025 Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH

Generationenübergreifend: Was vor 25 Jahren mit einem Zusammenschluss von sechs Steuerberatern begann, ist über die Jahre zu einer vielschichtigen Kanzlei mit einem 65-köpfigen Team herangewachsen, das mit Kompetenz und Spaß an der Arbeit seine Kund*innen professionell und verlässlich in Steuer- und Finanzangelegenheiten begleitet.
Die Geschäftsführung v. l.: Armin Rauter, Gründungspartner Mag. Peter Pfleger, Mag. Hannes Krimbacher, B.Sc., MMag. Simon Lentner, Mag. Marion Mittendorfer, Hugo Huber, M.Sc., Andreas Eppacher und Erwin Jäger
Mit gebündelten Kompetenzen, einer großen Portion Freude an der Arbeit und einem positiven Teamspirit ist die wtt während ihres 25-jährigen Bestehens zu einer sehr großen Steuerberatungskanzlei in Westösterreich herangewachsen.
TEXT: DORIS HELWEG
Es war zur Jahrtausendwende, konkret am 19. Mai 2000, als sich sechs niedergelassene Steuerberater zusammengeschlossen und in der wtt Steuerberatungskanzlei ihre Kompetenzen gebündelt haben. Zuerst in einem kleinen Haus am Rennweg, das jedoch binnen eines Jahres schon viel zu klein wurde, weshalb die Kanzlei bereits 2001 in ihren nunmehrigen Standort am Rennweg 18 übersiedelte. Hier gab es Raum zum Wachsen und das war gut so, denn aus den anfänglich 30 Köpfen ist über die Jahre ein 65-köpfiges Team geworden.
Die komplexe Welt der Steuern und Finanzen ist ihre berufliche Heimat, mit seinem vollumfänglichen Wissen und langjähriger Erfahrung steht das professionelle Team seinen zahlreichen Mandant*innen nahbar und engagiert zur Seite.
Abgesehen von Peter Pfleger haben sich die restlichen fünf Gründungsmitglieder Norbert Zagler, Günter Krassnitzer, Gerhard Hauser, Franz Seekircher und Herbert Rauth bereits in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Diese Lücken wurden jedoch stetig mit neuen Partnern gefüllt. Heute sind acht Partner in der Geschäftsführung tätig, mit Marion Mittendorfer erstmals auch eine Frau. Sie leitet seit 2023 den Standort in Stans mit zehn Mitarbeiter*innen, um noch näher an den zahlreichen Kund*innen in der Region dran zu sein. Mit einem Altersdurchschnitt von 35 Jahren repräsentiert die Kanzlei einen veritablen Mix aus langjähriger Erfahrung und jungem Spirit. „Wir verschließen uns den Neuerungen der Zeit nicht, aber wir hinterfragen und besprechen alles, um dann

„BEI ALLER ERNSTHAFTIGKEIT SOLL DIE ARBEIT AUCH SPASS MACHEN.“
Erwin Jäger
mit vollem Elan mit Neuerungen durchzustarten“, sagt Pfleger als letztes noch aktiv tätiges Gründungsmitglied. „Mit dem stetigen Wachstum war es in den letzten Jahren notwendig, eine Teamstruktur mit einem Buddy- und Mentoringsystem zu integrieren, damit Mitarbeiter*innen auch wissen, wo sie sich hinwenden können“, erklärt Mittendorfer.
wtt .AKADEMIE
Im Sinne der gemeinsamen Weiterentwicklung wird in der wtt.Akademie ein Umfeld geschaffen, in dem Lernen zur Kultur gehört und Austausch selbstverständlich ist. Regelmäßige Jours fixes, bei denen erfahrene Teammitglieder ihr spezielles Fachwissen teilen, maßgeschneiderte Weiterbildungen und das Buddy-System für neue Kolleg*innen tragen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung ebenso bei wie zum Teambuilding. „Ziel unserer wtt.Akademie ist Entwicklung mit System, jedoch ohne Druck. Denn wir sind überzeugt: Wer Raum bekommt, um zu wachsen, bringt schlussendlich auch das Unternehmen weiter“, so Mittendorfer über die spürbar angenehme Teamphilosophie. Neben gemeinsamen Betriebsausflügen, Wander- und Skitagen, Feiern und Törggelen treffen sich manche Mitarbeiter*innen auch in ihrer Freizeit und gehen nach der Arbeit miteinander sportlichen Aktivitäten nach. „Trotz der Größe haben wir einen sehr menschlichen Zugang zu unseren Kund*in-
nen und freundschaftlichen Umgang untereinander“, freut sich Pfleger.
So nahbar und freundlich das Team untereinander agiert, so greifbar ist es für seine Klient*innen. Mit einem stets offenen Ohr für die Belange und Anliegen werden Mandant*innen verlässlich durch steuerliche und finanzielle Herausforderungen begleitet. Neben den Kernleistungen wie laufende Buchhaltung, Personalverrechnung, Unternehmensberatung, Unternehmensnachfolge, Jahresabschluss und Steuererklärungen hält das kompetente Team auch in zahlreichen Spezialbereichen fachkundige Expert*innen bereit, beispielsweise Bauträger und Immobilien, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Freiberufler, Umgründungen und Transaktionen, Bewertung, Finanzierung und Planrechnung, Gutachten und internationale Sachverhalte.
Bei aller Ernsthaftigkeit und Professionalität darf bei der wtt Steuerberatungskanzlei auch gelacht werden, denn Arbeit soll Spaß machen. „Wir verstehen uns als Einheit und darum soll sich das gesamte Team wohlfühlen“, ist Partner und Geschäftsführer Erwin Jäger überzeugt: „Mit Freude an der Arbeit und einem generationenübergreifenden freundschaftlichen Miteinander gelingt es uns auch zu Stoßzeiten immer für unsere Klient*innen da zu sein.“ Das spürt man bei jedem Kontakt.
SPANNENDE MATERIE
Dass das große Themengebiet des Rechnungswesens durchaus spannend sein kann, unterstreicht allein schon die Spannbreite der Unternehmen, die von der wtt betreut werden. Vom Freiberufler über Handwerker, Friseur*innen oder Hotels bis hin zu
„ICH WÜRDE ES JEDERZEIT WIEDER SO MACHEN.“
Peter Pfleger

internationalen Konzernen spannt sich das abwechslungsreiche Portfolio an zufriedenen Mandant*innen, zu denen man einen persönlichen Kontakt pflegt. „Rechnungswesen ist eigentlich etwas Lebendiges und durchaus Spannendes“, finden die Experten unisono.
Junge Talente mit Interesse für die Sache und einer gewissen Portion Hausverstand sind demnach bei der wtt immer herzlich willkommen. Eingebettet in ein dynamisches Team erwartet insbesondere HAK-Abgänger*innen und Absolvent*innen höherbildender Schulen oder Studiengänge eine ansprechende Tätigkeit mit langfristigen Karrierechancen. „Denn gemeinsam schaffen wir mehr“, lautet der Tenor der aktuell acht Geschäftspartner*innen, die voller Motivation die wtt Steuerberatungskanzlei in eine weiterhin erfolgreich wachsende Zukunft führen wollen.

„STEUERBERATUNG IST EIN VIELSEITIGER BERUF, DER TOLLE KARRIEREMÖGLICHKEITEN BIETET.“
Marion Mittendorfer
Die Inflation geht an den meisten Menschen nicht spurlos vorüber, im Alltag ebenso wie bei der Geldanlage. Fondssparpläne könnten eine interessante Alternative darstellen.

„ANLEGER*INNEN SOLLTEN AUF JEDEN FALL IHRE GELDANLAGEN UNTER DIE LUPE NEHMEN.“
Jessica Bräu, Landesdirektorin, Union Investment Austria
Obwohl die Inflation im Vergleich zu den Vorjahren bereits deutlich gesunken ist, liegt sie mit 3,5 Prozent (Stand Juli 2025) in Österreich immer noch über dem angestrebten Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Da auch die Zinsen rückläufig sind, führt dies dazu, dass das Ersparte an Wert verliert. Man spricht dabei von negativen Realzinsen. Eine aktuelle Umfrage von Union Investment zeigt, dass nach wie vor über 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher auf ein Sparkonto oder ein Sparbuch setzen. „Anleger*innen sollten auf jeden Fall ihre Geldanlagen unter die Lupe nehmen, denn der Kaufkraftverlust aufgrund des negativen Realzinses ist enorm“, rät Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria. „Nur wer Renditen oberhalb der Inflation erzielt, bildet überhaupt real Vermögen. Bei

„DIE TOPAUSGEBILDETEN BERATER*INNEN DER VOLKSBANK TIROL UNTERSTÜTZEN SIE
GERNE BEI DER WAHL IHRER GELDANLAGE.“
Mario Zangerl, Bereichsleiter Vertrieb, Volksbank Tirol
klassischen Sparformen sind die Zinsen derzeit dafür zu niedrig“, so Bräu.
SCHRITTWEISE ZUM ZIEL
Mario Zangerl, Bereichsleiter Vertrieb bei der Volksbank Tirol, hat für die aktuelle Marktsituation den passenden Tipp: „Legen Sie renditeorientiert an, zum Beispiel mit Investmentfonds. Sie investieren die Gelder an den Kapitalmärkten, etwa in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, und in andere Vermögensgegenstände, wie Immobilien und Rohstoffe. Damit können sich langfristig gesehen Chancen auf interessante Erträge eröffnen.“ Im Gegenzug bringe eine Anlage in Investmentfonds aber auch einige Risiken mit sich, wie etwa das Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie das Ertragsrisiko. „Wählen sie deshalb einen Fonds, der Ihren Wünschen und Zielen entspricht“, so Zan-
gerl. Jessica Bräu ergänzt: „Setzen Sie auf ein bewährtes Instrument zum langfristigen und zugleich flexiblen Investieren: zum Beispiel mit Fondssparplänen. Legen Sie damit laufend einen bestimmten Betrag an. Damit können Sie langfristig Schwankungsrisiken begegnen.“ Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde. Neukund*innen, die sich jetzt bei der Volksbank Tirol für das Fondssparen entscheiden, erhalten für das erste Jahr eine Befreiung der Gebühren für ihren Fondssparplan. Veranlagungen in Finanzinstrumente können mit erheblichen Verlusten verbunden sein. „Die topausgebildeten Berater*innen der Volksbank Tirol beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Wahl Ihrer Geldanlage“, fasst Mario Zangerl zusammen. PR
Hol dir dein Depot und deinen ersten Union Investment Fondssparplan und genieße 1 Jahr ohne Depotgebühren und Spesen*. Gleich Beratungstermin vereinbaren für deine individuelle Lösung!
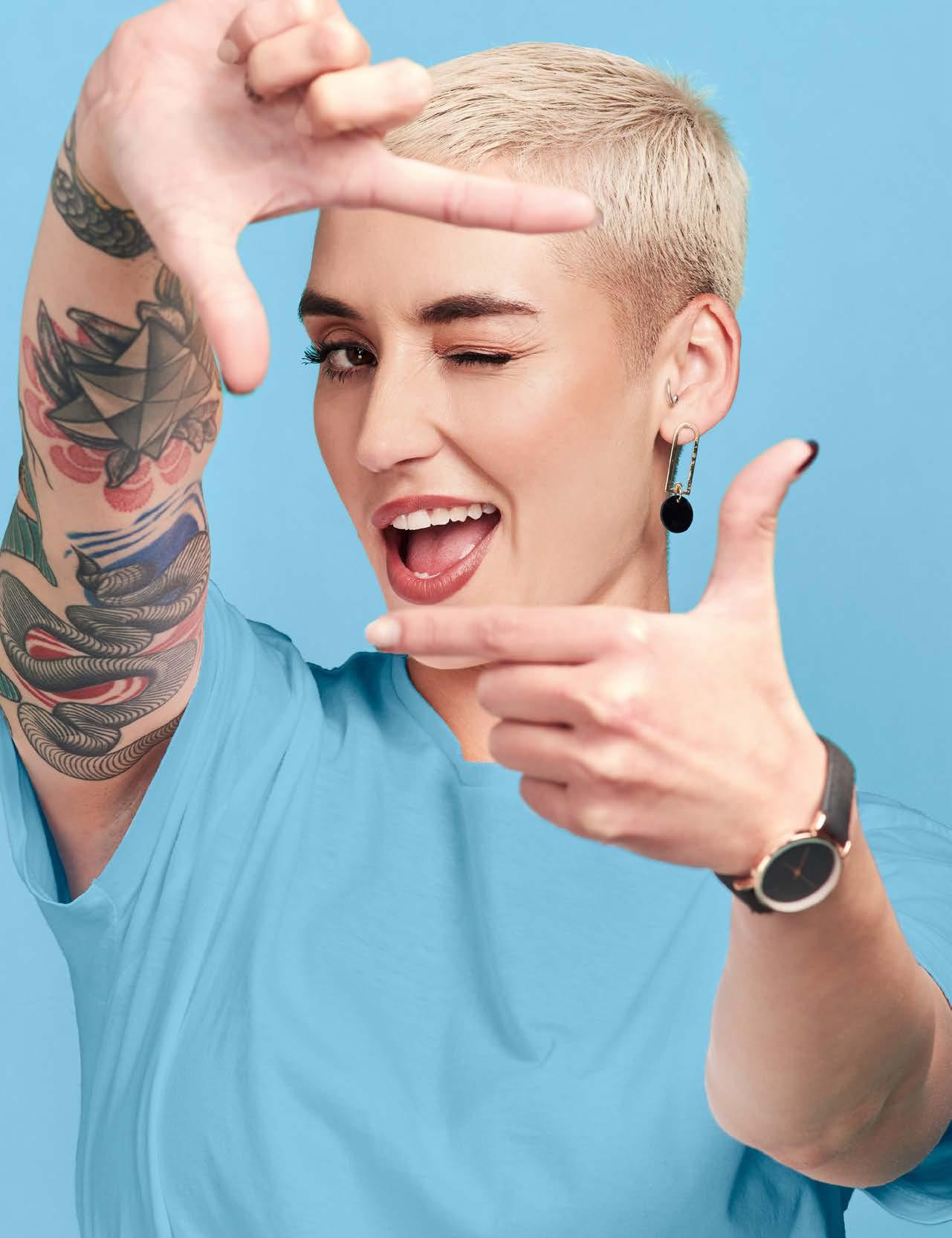
1 Jahr gebührenfrei bei VeranlagungenDepoteröffnung!* in Investmentfonds können mit erheblichen Verlusten verbunden sein.
*Aktion gültig für Personen, die am 31.08.2025 keine Fonds der Union Investment im Depot bei einer Volksbank halten und zwischen 01.09. und 31.12.2025 einen Fondssparplan der Union Investment eröffnen. Bei gleichzeitigem Abschluss eines neuen Depots und eines Fondssparplans der Union Investment entfallen sowohl die Depotgebühr als auch die Spesen (Transaktionsgebühr) für ein Jahr ab Eröffnung. Bei bestehendem Depot entfallen lediglich die Spesen (Transaktionsgebühr) für den Fondssparplan; die Depotgebühr bleibt aufrecht. Die Aktion gilt nicht bei Investitionssparen und Sonderkonditionen. Details im Konditionenblatt.
volksbank.tirol/legs_drauf_an
Mag. Fabian Bösch ist Rechtsanwalt bei GPK Pegger Kofler & Partner Rechtsanwälte, Innsbruck. www.lawfirm.at

Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen: Was Unternehmen jetzt wissen müssen.
TEXT: FABIAN BÖSCH
SELBSTLÄUFER. UNTERNEHMEN MÜSSEN
AKTIV UND NACHWEISBAR FÜR DEN
SCHUTZ IHRER SENSIBLEN INFORMATIONEN
SORGEN. AUCH EINE VERTRAGLICHE VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG
REICHT NICHT AUS, WENN TECHNISCHE
SCHUTZMASSNAHMEN FEHLEN.
b innovative Start-ups, etablierte Industriebetriebe oder Dienstleister – jedes Unternehmen besitzt Informationen, die im Wettbewerb den entscheidenden Vorsprung bedeuten können: Kundenlisten, Preisstrategien, technische Abläufe oder Rezepturen. Ein aktueller Fall zeigt, wie schnell diese Daten in Gefahr geraten: Eine ehemalige Mitarbeiterin verschafft sich nach ihrem Ausscheiden weiterhin Zugang zu sensiblen Firmendaten und nutzt dieses Wissen für den neuen Arbeitgeber. Der Schaden für das betroffene Unternehmen kann enorm sein – rechtlicher Schutz ist jedoch kein Selbstläufer.
WAS SIND GESCHÄFTS - UND BETRIEBSGEHEIMNISSE?
Das österreichische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) schützt Geschäftsund Betriebsgeheimnisse umfassend. Doch nicht jede betriebliche Information fällt automatisch unter diesen Schutz. Nach § 26b UWG müssen drei Voraussetzungen gemeinsam erfüllt sein:
• Geheimhaltung: Die Information darf in den relevanten Fachkreisen nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich sein.
• Wirtschaftlicher Wert: Die Information darf nicht belanglos sein. Sie muss über einen tatsächlichen oder künftigen Handelswert verfügen, wobei es ausreicht, wenn bei Verletzung der Geheimhaltung die finanziellen Interessen des Inhabers beeinträchtigt werden.
• Angemessene Schutzmaßnahmen: Der Inhaber muss aktiv Maßnahmen setzen, um die Information zu schützen – etwa durch technische, organisatorische und vertragliche Vorkehrungen.
Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, greift der gesetzliche Schutz und der Inhaber kann gegen unrechtmäßige Offenlegung seiner Geschäftsgeheimnisse Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz geltend machen.
Besonders die „angemessenen Schutzmaßnahmen“ sind in der Praxis oft der Stolperstein. Die aktuelle Entscheidung 4 Ob 195/24s des Obersten Gerichtshofs (OGH) bringt dazu entscheidende Klarstellungen. Im Anlassfall hatte ein Unternehmen nach dem Ausscheiden einer leitenden Mitarbeiterin deren IT-Zugang nicht sofort gesperrt. Die Ex-Mitarbeiterin konnte sich noch Monate später in die firmeneigene Plattform einloggen und auf sensible Daten zugreifen. Der OGH stellte klar: Wer
seinen Schutzpflichten nicht nachkommt – etwa durch verspätete Sperrung von Zugängen –, verliert den gesetzlichen Schutz. Es reicht nicht, dass Mitarbeiter eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Unternehmen müssen konkrete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um den Zugang zu vertraulichen Daten nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern sofort zu unterbinden. Auch ein allgemeiner „Geheimhaltungswille“ genügt nicht mehr. Im Verfahren muss der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses offenlegen und beweisen, dass er angemessene Schutzmaßnahmen gesetzt hat.
Die Entscheidung betont: Wird der Zugang zu sensiblen Daten nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses nicht umgehend gesperrt, fehlt es an der notwendigen Schutzmaßnahme – und damit am gesetzlichen Geheimnisschutz. Der OGH sieht darin keine bloße Formalität, sondern eine zentrale Voraussetzung für den Schutzumfang nach dem UWG. Auch eine vertragliche Verschwiegenheitsverpflichtung reicht nicht aus, wenn technische Schutzmaßnahmen fehlen.
Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist kein Selbstläufer. Die aktuelle OGH-Entscheidung macht deutlich: Unternehmen müssen aktiv und nachweisbar für den Schutz ihrer sensiblen Informationen sorgen. Wer hier nachlässig ist, riskiert nicht nur wirtschaftlichen Schaden, sondern auch den Verlust des gesetzlichen Schutzes. Es lohnt sich, die eigenen Prozesse und Maßnahmen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und all das auch gut zu dokumentieren.
• Schließen Sie Geheimhaltungsvereinbarungen und nennen Sie darin exemplarisch („insbesondere“) und möglichst konkret die wichtigsten geheimzuhaltenden Informationen.
• Zugänge zu IT-Systemen und Datenbanken bei Ausscheiden von Mitarbeitern sofort sperren.
• Vertrauliche Informationen klar kennzeichnen.
• Technische Maßnahmen wie Passwortschutz, Verschlüsselung und Zugriffsprotokolle einsetzen.
• Regelmäßige Schulungen und Sensibilisierung der Belegschaft zum Umgang mit sensiblen Daten durchführen.
• Vertraulichkeitsvereinbarungen regelmäßig überprüfen und anpassen.
• Lassen Sie ehemalige Mitarbeiter nicht weiter auf interne Systeme zugreifen –auch nicht „aus Versehen“.
• Dokumentation der getroffenen Schutzmaßnahmen – Inhaber von Geschäftsgeheimnissen müssen vor Gericht belegen können, dass sie angemessene Maßnahmen gesetzt haben.

Im Rahmen einer Post-Covid-Kinderstudie, finanziert vom Land Tirol und durchgeführt von der Medizinischen Universität Innsbruck, füllten Tiroler Eltern, Kinder und Jugendliche im Herbst 2024 insgesamt 953 Fragebögen mit dem Fokus auf Resilienz aus, die von Expert*innen unter der Leitung von der klinischen und Gesundheitspsychologin Silvia Exenberger ausgewertet wurden. „Die Belastungen bei den Kindern und Jugendlichen sind spürbar und schlagen sich im psychischen Befinden nieder. Es geht ihnen nicht gut“, fasst Kathrin Sevecke, Direktorin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Ergebnisse zusammen. Besonders bemerkenswert ist für Silvia Exenberger, wie weit die Wahrnehmungen von Eltern – vorwiegend nahmen Mütter an der Untersuchung teil – und Kindern zum Teil auseinandertriften. Bezeichnend sei dabei vor allem die unterschiedliche Einschätzung von Erwachsenen und ihrem Nachwuchs in Bezug auf dessen Resilienz: „Kinder schätzten ihre eigene Resilienz im Mittel niedriger ein als Eltern. Diese nahmen sich wiederum als fürsorglicher wahr, als die Kinder das empfanden“, schildert Exenberger. Die Kinder/Jugendlichen gaben an, dass ihre Eltern oder nahen Bezugspersonen sie nicht besonders gut kennen würden und sie nicht mit ihnen über ihre Gefühle sprechen könnten. „Vielleicht signalisieren Eltern ihre Unterstützung nicht deutlich genug oder sie nehmen es nicht ausreichend wahr, wenn die Kinder signalisieren, dass sie Unterstützung möchten“, mutmaßt Exenberger. „Die Eltern überschätzen ihre Kinder. Die Tatsache, dass sich die Kinder als weniger resilient einschätzen, ist Ausdruck davon, dass sie Belastungen spüren und das Gefühl haben, nicht mit allem zurechtzukommen“, folgert Kathrin Sevecke. Klinischen Studien zufolge nehmen psychische Störungen und Erkrankungen in der Bevölkerung allgemein zu. Damit einher geht ein Anstieg der psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. „Die Belastungen sind da und es gibt derzeit keinen Anlass zur Annahme, dass es zu einem Rückgang kommen sollte“, sagt Sevecke. Wichtig ist ihr, die Pandemie und die damaligen Begleitumstände nicht als alleinige Ursache für die anhaltende Belastung heranzuziehen. „Die Pandemie ist nur ein Faktor von vielen. Es sind Multiprobleme. Der Trend geht zu komplexeren Fällen und langwierigen Krankheitsgeschichten“, so Sevecke. Die Studienlage zeige beispielsweise auch, dass ein hoher Instagram-Konsum mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Essstörungen und Depressionen einhergeht. Im Moment laufen die Auswertungen der Fragebögen aus der Nachfolgebefragung im Sommer.
©

Der Marathonboom bringt jedes Jahr neue Läufer*innen an den Start, doch während manche fast mühelos das Ziel zu erreichen scheinen, machen andere trotz monatelangem Training nur schleichende Fortschritte. Das hat nicht ausschließlich mit Disziplin zu tun. „Unsere DNA bestimmt mit, ob wir für Langstrecken gemacht sind“, sagt Molekularbiologe und Genforscher Dr. Daniel Wallerstorfer. Er erforscht mit seinem Unternehmen NovoDaily (www.novodaily.com) den Zusammenhang zwischen Genetik, Ernährung, Gesundheit und Fitness und stellt personalisierte Nahrungsergänzungsmittel basierend auf entsprechenden Genanalysen her. Nur etwa 20 Prozent der Menschen bringen demnach von Natur aus die idealen Voraussetzungen für Ausdauer über lange Strecken mit. Sollten die restlichen 80 Prozent also das Langlauftraining einstellen? Nein, denn „wer seine Genetik kennt, kann Training und Ernährung sinnvoll abstimmen – das spart Zeit und bringt bessere Ergebnisse“, so Wallerstorfer. „Evolutionär bedingt war die Auslegung des menschlichen Körpers auf lange Strecken wichtig für das Überleben. Ohne starke Sehnen, langanhaltende Energiereserven und entsprechend geformte Füße hätten wir nicht lange in der afrikanischen Savanne überlebt“, erklärt der Genforscher. Während diese Grundlagen allen Menschen zugutekommen, ist bei jedem unterschiedlich, inwieweit der Körper auf Ausdauer ausgelegt ist. Das liege unter anderem am ACTN3-Gen: „Je nachdem, wie gut es funktioniert, können die Muskeln entweder Energie konstant über längere Distanzen hinweg verwerten oder in kurzer Zeit enorme Kraftaufwände meistern.“ Deshalb macht es Sinn, über seine genetischen Veranlagungen Bescheid zu wissen, um Trainingspläne und Ernährungsgewohnheiten entsprechend anzupassen.

Lára R. Hallsson (Koordinatorin des Programms für Causal Inference in Science) und Uwe Siebert (Leiter des Institutes für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment/IPH der Privatuniversität UMIT)
Anfang September fiel der Startschuss für das EU-Projekt UNCAN-Connect (Decentralized Collaborative Network for Advancing Cancer Research and Innovation), das die Krebsforschung entscheidend voranbringen soll. Im Rahmen dieses fünfjährigen Projektes mit einem Forschungsvolumen von 30 Millionen Euro arbeiten europaweit 53 Partnerorganisationen und -unternehmen zusammen. Das Institut für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment (IPH) der Privatuniversität UMIT TIROL leitet dabei einen Anwendungsfall mit einem Forschungsvolumen von einer Million Euro. „Ziel des Projektes ist es, den nahtlosen Zugang zu Krebsdaten zu erleichtern, die offene Wissenschaft zu fördern und die Krebsforschung und -behandlung durch die gemeinsame Entwicklung einer Open-Source-Plattform – ‚UNCAN.eu‘ – zu revolutionieren“, erklärt Projektleiterin Dr. Lára Hallsson vom Institut für Public Health der UMIT TIROL. Die Plattform wird anhand spezifischer Anwendungsfälle getestet, die sich auf sechs wichtige Krebsarten konzentrieren, die UMIT TIROL übernimmt hierbei den Anwendungsfall des Eierstockkrebs. Außerdem wird an Krebserkrankungen bei Kindern, Lymphdrüsen-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungenund Prostatakrebs geforscht.
SCHNELL ZUR RICHTIGEN HILFE
Ob finanzielle Sorgen, familiäre Herausforderungen, Wohnungsnot oder eine psychische Ausnahmesituation: Wer auf der Suche nach Unterstützung ist, findet mit dem Sozialroutenplan Tirol einen Überblick und mittels Such- und Filterfunktionen rasch das passende Angebot. Die Website ist im Juni online gegangen und richtet sich an Hilfesuchende, Angehörige und Fachkräfte. Aktuell bündelt die Seite bereits über 600 Angebote mit einem breiten Spektrum von Finanzen, Gesundheit, Beziehung und Gewalt über Wohnen und Recht bis hin zu spezifischen Angeboten für Menschen mit Behinderungen oder für Kinder und Jugendliche. Die Informationen sind barrierefrei zugänglich und neben Deutsch in neun Fremdsprachen verfügbar. Damit die Plattform immer aktuell und qualitätsgesichert bleibt, wird sie vom Verein unicum:mensch betreut. Das Land Tirol unterstützt das Projekt mit 35.000 Euro. sozialroutenplan.at/tirol

Trotz steigender Sensibilisierung für das Thema Gesundheit bleibt der Vorsorgetrend niedrig, vor allem bei Männern. Laut der Österreichischen Gesundheitskasse nahmen nur knapp zwölf Prozent der männlichen Bevölkerung 2022 eine Vorsorgeuntersuchung in Anspruch. Zudem liegen die österreichischen Männer mit rund 63 gesunden Lebensjahren unter dem EU-Durchschnitt. Vorsorge ist der Schlüssel zur Früherkennung und Bekämpfung potenzieller Gesundheitsrisiken. Darum ist es wichtig, das Bewusstsein für präventive Maßnahmen und regelmäßige Gesundheitschecks zu stärken. In Tirol macht man dies unter anderem mit der Eröffnung der ersten Männervorsorge-Gondel auf die Muttereralm. Dort können sich Fahrgäste über die internationale „Loose Tie“-Kampagne informieren, die Männer dazu motiviert, das Thema Vorsorge ernst zu nehmen und aktiv Schritte zu setzen. „Mit dieser Gondel setzen wir ein starkes Symbol für die Männergesundheit. Unser Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und zu zeigen, dass Vorsorge einfach und wichtig ist“, erklärt Florian Klotz, Geschäftsführer der Krebshilfe Tirol.

Im heurigen Juni sind wir mit unserem neuen Projekt medica gestartet, das sich in einer einzigartigen Kombination aus Printmagazin und Podcasts dem breiten Feld der Frauengesundheit widmet. Ideengeberin und Mitherausgeberin Alexandra Keller spricht darin mit Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen und schon der Themenbogen der ersten Ausgabe war abwechslungsreich – es ging unter anderem um die Geschichte der Gendermedizin, die Wirkung von Aspirin, den Beckenboden und Gesichtsyoga. Für Ausgabe #2 haben wir Marlies Raich zum Gespräch gebeten, wir reden über mentale Überforderung, Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern, Migräne und vieles mehr. Erscheinungstermin ist der 7. November.
Reinklicken unter www.econova.at/medica oder einfach den QR-Code scannen. Lesen, hören, klüger werden.
Rund 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit dem Humanen Papillomavirus (HPV). In vielen Fällen verläuft die Infektion unbemerkt, kann jedoch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Deshalb wurde in Österreich das kostenlose HPV-Impfangebot mit Juli 2024 befristet bis Dezember 2025 auf alle Personen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr ausgeweitet. Insgesamt knapp 11.500 junge Erwachsene haben das Angebot in Tirol seither in Anspruch genommen. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Gratis-Impfaktion nun bis Mitte 2026 verlängert. Achtung: Die Erstimpfung muss noch heuer bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen – die Zweitimpfungen sind bis zum 30. Juni 2026 kostenlos.

Die Global Health Care AG (CHG AG) aus der Unternehmensgruppe des Tirolers Christian Jäger goes Japan und war offizieller Aussteller bei der Expo 2025 in Osaka. Mit dem Beitrag will man zeigen: Gesundheit ist kein Trend, sondern die Grundlage für ein langes, selbstbestimmtes Leben. Und Muskelkraft spielt dabei eine zentrale Rolle. Unter dem Motto „Healthness & Longevity“ präsentieren die drei Marken der GHC AG – EasyMotionSkin, milon und five – ihre Trainings- und Gesundheitslösungen. Ob kabellose Elektromuskelstimulation, smartes Kraft-Ausdauer-Training oder modernstes Muskellängentraining – hier verschmelzen technologische Innovation, Know-how und Alltagstauglichkeit zu einem ganzheitlichen Konzept für Prävention, Leistungssteigerung und Lebensqualität. Dass Muskelgesundheit dabei sogar über die Erde hinaus Bedeutung hat, beweist EasyMotionSkin als Teil internationaler Astronautenprogramme wie der ESA-Mission „Cosmic Kiss“ oder der Mars-Simulation „Amadee-24“ des österreichischen Weltraumforums. In der Schwerelosigkeit hilft das System, dem Verlust von Muskel- und Knochensubstanz entgegenzuwirken, und setzt ein starkes Signal für die Relevanz funktionierender Muskelarbeit auch im Alltag auf der Erde. www.ghc.ag
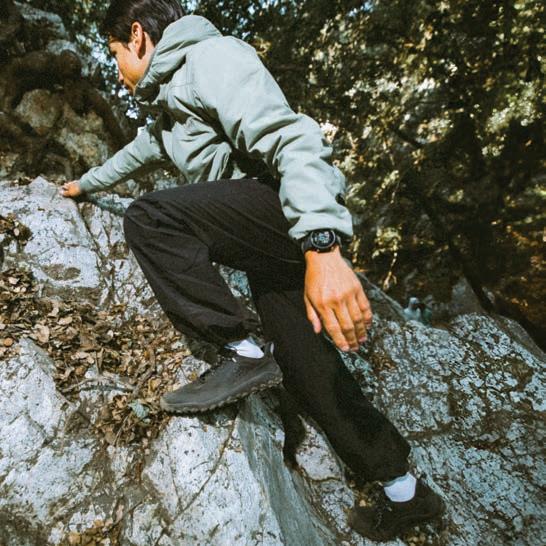
Vivobarefoot, gegründet von den Cousins Galahad und Asher Clark aus der traditionellen Schusterfamilie, ist ein Lifestyle-Gesundheitsunternehmen, das die Mission verfolgt, die Menschen wieder mit der Natur zu verbinden und das von Grund auf, Fuß für Fuß. Während der Großteil der Menschen mit gesunden Füßen geboren wird, entwickeln laut Studien 77 Prozent im Laufe ihres Lebens Fußprobleme – vielfach durch einengendes, unflexibles Schuhwerk, in das wir von klein auf gesteckt werden. Waren Schuhe früher vor allem praktisch, sind sie heute vorrangig modisch. „Unsere Vorfahren machten Schuhe, um ihre Füße zu schützen – niemals, um sie zu trennen“, sagt Galahad Clark. „Wenn wir unsere Füße befreien, erwacht der ganze Körper, der Geist folgt, und wir finden zurück zu unserem natürlichen Selbst“, ist er überzeugt. Im Sortiment finden sich Schuhe für Frauen, Männer und Kinder, zum Sport und draußen unterwegs sein, Sneakers, Stiefel, Lifestyle- und Perfomancekollektionen. Kürzlich hat das Unternehmen zudem die Kampagne „Free Your Feet“ lanciert, mit der es dazu auruft, sich von eingeschränkten Komfortzonen zu befreien und die ursprüngliche Verbindung zu Körper, Erde und Natur wiederzufinden. Vivobarefoot möchte damit auf die negativen Auswirkungen herkömmlicher, stark gepolsterter Schuhe aufmerksam machen und zeigen, dass Freiheit nicht in der Polsterung liegt, sondern darin, den Boden wieder zu spüren. „Freiheit beginnt bei den Füßen“, so Clark. „Wer den Boden nicht spürt, verpasst etwas Wesentliches – nicht nur körperlich, sondern auch im Leben.“ Man muss die Schuhe übrigens nicht nur aus dieser Überzeugung heraus tragen. Vivobarefoot hat es nämlich hinbekommen, dass die Modelle auch richtig gut ausschauen.
Weitere Infos zur Kampagne „Free Your Feet“ und zur Wissenschaft des Barfußlaufens gibt‘s im Video hinter dem QR-Code oder unter www. vivobarefoot.com

Aktuell schwirren wieder einige angebliche Wunder-Wirkstoffe durch unseren Feed, die Falten glätten, Zellen reparieren und Glow garantieren sollen. FORMEL-SKIN-Gründerin (www. formelskin.de) und Dermatologin Dr. Sarah Bechstein hat den Reality-Check gemacht und findet tatsächlich nicht alles schlecht, auch wenn sie vor allem im aktuell viel gepriesenen Schneckenschleim mehr Hype als Nutzen sieht. Immerhin ist er in der Regel günstig und gut verträglich. Im körpereigenen Coenzym NAD+ (Nicotinamidadenindinukleotid), das eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel der Zellen spielt, sowie dem ebenfalls körpereigenen Stoff Spermidin – beides wird vorrangig als Anti-Aging-Wirkstoff gehandelt – sieht sie indes spannende Ansätze, wenngleich noch zu wenig Forschung und klinische Evidenz. Besonders kritisch hingegen seien nicht regulierte Produkte mit Hydrochinon, die häufig zur Behandlung von Melasma oder Altersflecken beworben werden: Zwar sind sie stark hautaufhellend, aber auch potenziell reizend. Vorsicht ist außerdem bei hormonaktiven Inhaltsstoffen wie Phytoöstrogenen geboten: Sie bergen hormonelle Risiken, abhängig von der individuellen Hormonlage, und sollten daher nur gezielt und in Rücksprache mit Fachpersonen eingesetzt werden. Tipp: Besser nicht jedem Trend blind vertrauen und in Sachen Hautgesundheit auch nicht auf do it yourself setzen.
Mehr als 10.000 Beschäftigte, knapp vier Milliarden Euro Branchenumsatz: Tirol ist längst zum etablierter Life-Sciences-Standort geworden. Mit dem vom Land initiierten Health Hub Tirol soll der nun langfristig abgesichert und gestärkt werden. Der Hub ist in der Innsbrucker Exlgasse angesiedelt und bietet modernste Laborflächen sowie ein innovatives Umfeld für Unternehmen aus Medizin, Biotechnologie, IT, Engineering und Digitalisierung. Hier soll zukunftsweisende Zusammenarbeit entstehen, wie Standortagentur-Tirol-Geschäftsführer Marcus Hofer sagt: „Wir begleiten Unternehmen von der ersten Idee bis zur Umsetzung mit individueller Förderberatung, Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung, Unterstützung bei Betriebserweiterung oder -ansiedlung und konkreten Services rund um Innovation und Entwicklung.“ healthhub.tirol

Endlich Wochenende. Und zwar für immer. Wer in Pension geht, erlebt nicht nur den Abschied vom Wecker, sondern den Einstieg in einen Lebensabschnitt, der das Zeug dazu hat, der aufregendste überhaupt zu sein. Das große Finale. Biohacker und Podcaster Stefan Wagner beschreibt diesen Übergang so, wie er ist: chaotisch, emotional, befreiend. Erst der Schreck, dann die Erleichterung und schließlich die Erkenntnis, dass jetzt ein völlig neuer Raum aufgeht, einer ohne Durchgangstür, ohne nächste Pflichtstation. Ruhestand bedeutet aber nicht Stillstand, sondern vielmehr die Möglichkeit, sich das Leben noch einmal ganz neu einzurichten. Mit all den Dingen, die bisher zu kurz gekommen sind.
TEXT: MARIAN KRÖLL
ie Jahrzehnte davor, das Berufsleben, war geprägt von einem Kampf mit Excel-Sheets, nötigen und notwendigen Feedbackschleifen, Karotten vor der Nase, manchmal frisch, oft schon verschrumpelt. Ruhestand heißt Freiheit. Aber die will genutzt werden. Denn der neue Lebensabschnitt kann Jahrzehnte dauern – vielleicht drei oder vier, vielleicht sogar noch länger. Wer das nur als Landeanflug betrachtet, verpasst die eigentliche, große Chance: Es geht nicht ums passive Absitzen, sondern um funkensprühende Erlebnisse, um kleine wie große Abenteuer. Die Französin Jeanne Calment nahm noch mit 85 Fechtunterricht. Sie starb 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen. Mehr geht fast nicht.
Stefan Wagner verquickt in seinem Buch „Endlich 7 Tage Wochenende“ (erschienen bei ars Edition) Anekdoten mit handfesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dass der eigene Gemüsegarten nicht nur knackige Radieschen liefert, sondern auch Glückshormone, ist ebenso belegt wie die Macht des Waldbadens. Wer mit bloßen Händen in der Erde wühlt, kurbelt das Serotonin an, das Cortisol vertreibt. Das ist Biochemie in Gummistiefeln. Aber auch der Blick aufs große Ganze fehlt nicht: Sterblichkeit akzeptieren, sagt Wagner, ist keine Trauerübung, sondern – ganz im Gegenteil – ein Turbo für Lebensintensität.
Gesundheit ist dabei mehr als ein lästiges Pflichtprogramm. Es geht nicht um Kalorienzählerei und Selbstkas-

Tirols modernes Krankenhaus und Ärztezentrum
Persönlich betreut vom Facharzt Ihrer Wahl
Einfühlsame und kompetente Pflege
Hochwertige Medizintechnik, modernste OP-Säle
Freundliche, helle Zimmer am sonnigen Plateau über Innsbruck Vorzüglich speisen, Wahlmenüs und Diätküche, frisch zubereitet SANATORIUM DER KREUZSCHWESTERN GMBH A-6063 Rum · Lärchenstr. 41 · Tel. 0043 512 234-0
E-Mail: office@pk-hochrum.com · www.privatklinik-hochrum.com

teiung, sondern um einfache, wirksame Routinen: bewegen, kräftigen, atmen – und ja, auch einmal loslassen können. Mit dem Alter drohen Stürze? „Trainieren Sie die Muskeln!“, rät der Autor. Die Neuroplastizität nimmt ab? „Spielen Sie Klavier oder malen Sie, schreiben Sie Tagebuch oder treten Sie einem Chor bei.“ Kunst ist für Wagner nämlich nichts Esoterisches, sondern das beste Gehirnjogging, das es gibt.
Und weil der Mensch ein soziales Wesen ist, rückt er die Beziehungen ins Zentrum. Nicht Geld, nicht Luxus, nicht Kreuzfahrten machen dauerhaft zufrieden, sondern Nähe. Die jahrzehntelange Harvard-Grant-Study belegt, dass Glück zuallererst von gelingenden Beziehungen abhängt, besonders in der Paarbeziehung. Stephen Covey bringt es nüchtern auf den Punkt: Liebe ist ein Verb. Sie will gepflegt werden, so selbstverständlich wie Zähneputzen. Dazu gehören gemeinsame Ziele, Zuhören, Humor und nicht zuletzt auch ein gesundes Maß an Körperlichkeit.
Wagner gibt sich dabei nie moralinsauer. Der Autor sieht Platz für Ausnahmen, Freiräume und sogar Unfug. Selbst Nietzsche wird bemüht: „Fast überall, wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn.“ Also ruhig ein wenig Unsinn treiben, Karaoke singen, in Pfützen springen. Steven Pressfield nennt das den „inneren Widerstand“ überwinden: Gerade das, was wir am meisten vermeiden wollen, ist oft das, was uns weiterbringt. Angst, Zweifel, Scham, alles Wegweiser. „Innerer Widerstand zeigt immer die richtige Richtung an. Was Sie am dringendsten vermeiden möchten, ist genau das, was Sie am dringendsten tun sollten“, wird Pressfield zitiert. Und nicht zuletzt sind es Bücher, die geistig fit halten. Wagner plädiert für massives Lesen, nicht nur zum Zeitvertreib, sondern als Lebenselexier. Jeder Roman ein Abenteuer, jede Seite ein Workout fürs Hirn. Wer viel liest, lebt nicht nur länger, sondern klüger, und bleibt dabei im Denken beweglich und offen für andere Perspektiven.
Am Ende fügt sich alles zu einer klaren Botschaft: Der Ruhestand ist kein Abstellgleis, sondern eine Einladung zum größten Abenteuer. Die Tür steht offen, den Schlüssel hält man selbst in der Hand. Beziehungen, Natur, Kunst, Unsinn und eine gesunde Demut vor der Endlichkeit. Wagner serviert all das nicht als Pflichtprogramm, sondern als Baukasten. Man darf zugreifen, wo man Lust hat. Wichtig ist nur, dass man es tut. Eines ist sicher: Wir haben nur dieses eine Leben. Aber wenn wir Glück haben, fühlt sich das große Finale, das nach dem Arbeitsleben beginnt, wie ein 7-Tage-Wochenende an.

Stefan Wagner wurde 1968 in Wien geboren. Als Werber, Autor, Biohacker, Podcaster und Tennisspieler versucht er seit bald vier Jahrzehnten, die Prinzipien zu entschlüsseln, die hinter Erfolg und Erfüllung, hinter Lebensenergie und Lebensfreude stehen. Seine Wiener Werbeagentur „Union Wagner“ arbeitet für eine Reihe von Kunden der unterschiedlichsten Dimensionen und Branchen. Er lebt, arbeitet und plant seinen Ruhestand in einem ehemaligen Bauernhof auf 800 Metern Seehöhe im Süden Wiens.
Die ebenso schicken wie funktionellen Gutscheinkarten des Tiroler Lebensmittelhändlers MPREIS sind insbesondere für Businesskunden ein ideales Geschenk. Denn ein Gutschein für den Lebensmitteleinkauf im regionalen Supermarkt kommt immer gut an.
Wer als Businesskunde größere Mengen der Karten bestellt, genießt besondere finanzielle Vorteile und profitiert von der innovativen Funktionalität der Karten.
FLEXIBLER KARTENWERT
Die Höhe des Guthabens auf den Karten ist bis zu einer Höhe von maximal 500 Euro frei wählbar. Außerdem sind die Karten wiederverwendbar und lassen sich beliebig oft wiederaufladen, und zwar nicht nur von den Karteninhabern selbst, sondern auch zentral vom Unternehmen. Bestellungen sind für Unternehmen bereits ab einem Gesamtwert von 200 Euro möglich. Geschenke an Mitarbeitende in Form von Gutscheinen sind bis zu 186 Euro pro Jahr steuerfrei. Darüber hinaus profitieren Businesskunden von gestaffelten Preisen. Je höher der eingekaufte Wert, desto höher sind die Ra-
batte. Bis zu vier Prozent Rabatt sind bei der Gutscheinsumme möglich.
VERSCHIEDENE DESIGNS
STEHEN ZUR WAHL
Die Gutscheinkarten sind in drei verschiedenen Designs erhältlich, die sowohl für ein generelles Dankeschön als auch für festliche Anlässe geeignet sind. Bei der Verpackung stehen eine edle Geschenkbox und vier verschiedene Kuverts zur Wahl. In einem einfachen Bestellvorgang können die Kunden auf der MPREIS-Website Design, Verpackung und Anzahl auswählen. Die Zustellung erfolgt direkt an die gewünschte Adresse.
AUSGEZEICHNETES DESIGN
Ganz im Sinne der Unternehmenswerte sind die MPREIS-Gutscheinkarten nicht nur ansprechend gestaltet, sie bestehen auch aus
besonders innovativen und nachhaltigen Materialien. Die Karten aus recyceltem und recyclingfähigem Kunststoff sind auf einem Träger aus innovativen Graspapier aufgebracht. Alle Bestandteile werden regional in Tirol hergestellt. Das durchdachte Konzept wurde mehrfach mit dem German Design Award „herausragende Designqualität“ ausgezeichnet. PR
MPREIS - GUTSCHEINKARTEN IM ÜBERBLICK:
• Verschiedene Designs für jeden Anlass
• Einfach online bestellbar
• Betrag bis 500 Euro frei wählbar
• Beliebig oft wiederaufladbar
• Abfrage des Guthabens über QR-Code oder am Kassabon
• Aus ökologischen Materialien lokal produziert
• Gestaffelte Mengenrabatte für Geschäftskunden
Ganz einfach online bestellen!
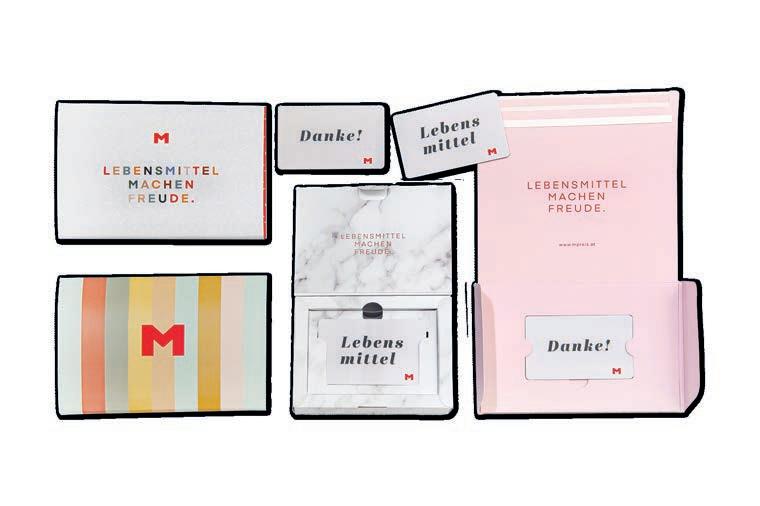
SCHENKEN SIE IHREN MITARBEITER*INNEN DEN TÄGLICHEN EINKAUF. MIT DER GUTSCHEIN KARTE VON MPREIS –WIEDER AUFLADBAR, KOSTEN SPAREND & STEUERBEG Ü NSTIGT.
MPREIS.AT/GESCHEN KE
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Bücher, die inspirieren, Wohlbefinden ganzheitlich zu betrachten: stark im Kopf, fit im Körper.
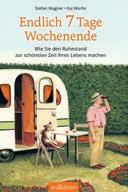
ENDLICH 7 TAGE WOCHENENDE
STEFAN WAGNER, ARS EDITION, 144 SEITEN, EUR 15,15
Wer hat eigentlich gesagt, dass man sich in der Pension nur langweilt und das Leben einfach so geschehen lässt?
Alles Humbug, findet Autor Stefan Wagner, bekannt durch den Podcast „Die Biohacking-Praxis“. Mit Wortwitz, authentischer Sprache, wachem Blick und klugen Geschichten wirft er einen ehrlichen Blick auf das Altern.

PETRA THEES, LUTZ KARNAUCHOW KOHLHAMMER SACHBUCH, 242 SEITEN, EUR 29,–
Der 1. Oktober als Internationaler Tag älterer Menschen erinnert daran, wie vielfältig und engagiert Senior*innen heutzutage leben. Alter könnte so schön sein, doch ältere Menschen werden in unserer Gesellschaft nach wie vor (unbewusst) diskriminiert. Das Ehepaar Petra Thees und Lutz Karnauchow plädiert dafür, das Alter neu zu denken und es als glückliche Zeit zu sehen.
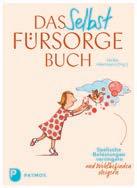
HEIKE HERMANN, PATMOS VERLAG, 184 SEITEN, EUR 20,–
Oft haben wir verinnerlicht, erst die anderen zu versorgen, bevor wir uns um uns selbst kümmern. Und meist bleibt dann weder Zeit noch Energie dafür übrig. Dabei ist es so wichtig, auch auf sein eigenes Wohlbefinden zu schauen. Heike Hermann hat gemeinsam mit renommierten Therapeut*innen die zehn wichtigsten Strategien und Kompetenzen zusammengetragen, wie wir uns selbst gut unterstützen können. Es geht um den gesunden Umgang mit Wut, Ärger und Ängsten, um Selbstmitgefühl und das Loslassen alter Muster. Frank Wowra liefert die Illus dazu.
DR. MED. STEFAN WÖHRER, KNEIPP VERLAG, 160 SEITEN, EUR 24,–
Warum wirkt eine Diät bei der einen Person, während sie bei einer anderen wirkungslos bleibt oder sogar gegenteilige Effekte zeigt? Die Antwort liegt in unseren Genen. Mit wissenschaftlicher Präzision und verständlicher Sprache führt Stefan Wöhrer in seinem Buch in die Welt des aktuellen Trendthemas Nutrigenetik ein – jenes Forschungsfeld, das entschlüsselt, wie genetische Anlagen bestimmen, ob wir Fette optimal verarbeiten, Kohlenhydrate effizient nutzen oder wie wir auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren. Selbsttests, Ernährungstagebuch und mehr als 50 personalisierbare Rezepte inklusive.
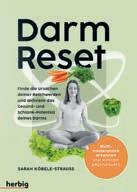
SARAH KÖBELE-STRAUSS
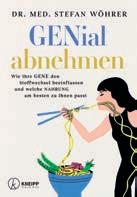
HERBIG VERLAG, 184 SEITEN, EUR 22,–
Viele Menschen leiden regelmäßig unter Magen-DarmBeschwerden – oft, ohne die Ursachen zu kennen. Häufig stecken eine oder sogar mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten dahinter. In ihrem Buch zeigt Darmexpertin Sarah Köbele-Strauß, wie Betroffene ihre Beschwerden mithilfe verschiedener Selbsttests besser verstehen und gezielt angehen können, und unterstützt mit alltagstauglichen Rezepten. Ratgeber und Kochbuch in einem.
Zuwachs bei Studienanfängern – Erfolge in der Forschung.
Mit einer akademischen Feier startete die Privatuniversität UMIT TIROL – Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie – am Campus in Hall in das akademische Jahr 2025/2026. Interim. Rektor Univ.-Prof. i. R. Dr. Rudolf Steckel begrüßte dabei rund 360 neue Studierende – ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit den ersten 19 Studienanfängern im Jahr 2001 haben bereits über 6.000 Absolventinnen und Absolventen ihr Studium an der UMIT TIROL abgeschlossen. Aktuell zählt die Universität rund 1.250 Studierende und ist damit ein fester Bestandteil der Tiroler Hochschullandschaft sowie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region Hall.
FORSCHUNG MIT STRAHLKRAFT
Neben exzellenter Lehre setzt die UMIT TIROL starke Akzente in der Forschung. Ein

HERZLICH WILLKOMMEN BEI TIROLS GRÖSSTEN EVENTS ALLE EVENTS AUF

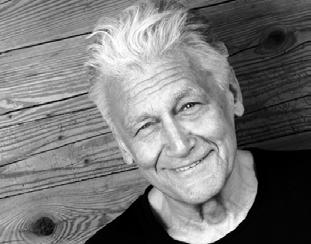
28. 10.2025
OLYMPIAHALLE
Er gilt als DIE stimmliche Reinkarnation des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury und ist zweifelsohne weltweit einer der besten und gefragtesten
Interpretatoren der großen Rocklegende: Marc Martel begeisterte allein im deutschsprachigen Raum bereits mehr als 250.000 Zuschauer mit einer grandiosen Live-Show.
31.10.2025 RAINHARD FENDRICH
OLYMPIAHALLE
2025 wird ein großartiges Jahr für RAINHARD FENDRICH-Fans! Im Februar feierte die Musiklegende seinen 70. Geburtstag, das 45-jährige Bühnenjubiläum steht ins Haus, wie auch die Veröffentlichung des neuen Studio-Albums „Wimpernschlag“ und als Sahnehäubchen folgt die große Jubiläumstournee.
Beispiel ist das EU-Projekt UNCAN-CONNECT, das Anfang September startete. Gemeinsam mit 53 europäischen Partnern arbeitet die Universität daran, die Krebsforschung entscheidend voranzubringen.
AUSZEICHNUNG FÜR EXZELLENTE LEHRE
Für besondere Freude sorgte der österreichische Staatspreis Ars Docendi 2025, der an Ass.-Prof. Dr. Michael Netzer vom Department für Biomedizinische Informatik und Mechatronik verliehen wurde. „Die Erfolge in Forschung und Lehre zeigen, dass die UMIT TIROL weit über Tirol hinaus Wirkung entfaltet und zugleich tief in der Region verwurzelt bleibt“, betonte Rektor Steckel. www.umit-tirol.at PR
Rektor Univ.-Prof. i.R. Dr. Rudolf Steckel

16. – 18.01.2026
HOLIDAY ON ICE
OLYMPIAHALLE
Mit der neuen Produktion HORIZONS knüpft HOLIDAY ON ICE nahtlos an die Erfolge vergangener Jahre an und feiert erneut ein spektakuläres Showerlebnis. Die weltbesten Eiskunstläufer:innen entfesseln auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann.
Körperliche Vitalität fühlt sich gut an. Der Weg dorthin führt über ein individuelles Maß an Bewegung zu einem besseren Körperbewusstsein und somit auch zu mehr mentaler Stärke. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort individuell, denn sportwissenschaftliche Berater*innen holen Menschen genau dort ab, wo sie gerade stehen.
TEXT: DORIS HELWEG

Dass Bewegung Körper und Geist fit hält, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Denn körperliche Betätigung baut Stresshormone ab, die wir im beruflichen und privaten Alltag ansammeln. „Wie sich der Körper fühlt, so fühlt man sich auch als Mensch“, erklärt Hannes Mörtl, Sportwissenschaftler, Personal Trainer und Berufsgruppensprecher der sportwissenschaftlichen Berater in der Wirtschaftskammer Tirol. Während Ausdauersport eher für Entspannung im Körper sorgt, fördert Krafttraining ein positives Körpergefühl. „Manche Stresshormone bauen sich binnen weniger Stunden wieder ab, andere wirken jedoch über Wochen und können, wenn man sich nicht bewegt, zu erhöhtem Blutdruck und Gefäßverengungen führen“, weiß Mörtl. Für ein gutes Körpergefühl ist es in erster Linie wichtig, schmerzfrei zu sein. „Gezielte Bewegung ist dabei die einzige Therapie, die für sich allein Wirkung zeigt. Andere Interventionen wie Arbeitsplatzergonomie oder Massagen sollten miteinander kombiniert werden“, erklärt der Sportwissenschaftler. „Dabei reicht schon eine Einheit Krafttraining pro Woche aus, um nachhaltig
WEITERE INFOS
Für Ernährungsberatung und sportwissenschaftliche Beratung durch Profis in deiner Nähe klicke unter firmen.wko.at/suche_ lebensberater oder scanne einfach den QR-Code.

schmerzfrei leben zu können. Will man einen Muskelaufbau oder Körperumbau erzielen, sind mindestens zwei Trainings die Woche erforderlich.“ Umso wichtiger ist es vor allem für Bürohengste, auf regelmäßige Bewegung und im Falle von Schmerzen auf gezielte Übungen zu achten. Großes Augenmerk sollte demnach auch auf betriebliche Gesundheitsvorsorge gelegt werden, denn eine Verbesserung der Gesundheit und Vitalität der Mitarbeiter*innen wirkt sich nicht nur auf ein besseres Arbeitsklima aus, sondern steigert auch nachweislich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. „Wichtig auf dem Weg zu körperlicher Fitness ist es jedenfalls, jeden dort abzuholen, wo er gerade steht, und ihn in seiner Individualität persönlich zu beraten und zu begleiten“, rät Mörtl. Dass man sich für ein persönliches Gesundheitstraining ausgewiesenen Expert*innen anvertrauen soll, deren Expertise wissenschaftlich fundiert ist, ist dem Berufsgruppensprecher dabei ein besonderes Anliegen. Schließlich geht es um die individuelle körperliche Fitness und die sieht bei jedem Menschen anders aus. Die Bandbreite der sportwissenschaftlichen

Berater ist groß und umfasst bei einigen Coaches auch die mentale Ebene.
DANDELIONS
Mit fundierten Trainings arbeiten beispielsweise Christina Hoiß und Daniel Nodes von Dandelions. Mit innovativen Methoden, ihrer Leidenschaft für Entwicklung und ihrem Fachwissen begleiten die beiden seit 2017 Menschen, Teams und Unternehmen bei ihren nachhaltigen Entwicklungsprozessen. „Lebenslanges Lernen ermöglicht persönliche und organisatorische Entwicklung mit der Entfaltung vorhandener Ressourcen, Kompetenzen und Potenziale für eine gesunde und nachhaltige Leistungsstärke“, lautet die Vision. Neben ihrem Fokus auf mentales Coaching bringen sie Erfahrung, Wissen und Sportwissenschaft ein. Dabei setzen sie auf erprobte Techniken und Trainingsmethoden sowie innovative Synergieeffekte aus Business und Leistungssport – für nachhaltig gesunden Erfolg, sei es im Beruf, im Sport oder im privaten Alltag.
CHRISTIAN OSTERMANN
Unterstützung in Form von Mentalcoaching für sportliche Spitzenleistungen bietet auch Christian Ostermann. Um die Leistungsfähigkeit im Sport über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, findet er je nach Persönlichkeitstyp – visuell, auditiv oder kinästhetisch – gemeinsam mit seinen Klient*innen Techniken heraus, um sich mental optimal auf Wettkämpfe vorzubereiten, die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und zugleich Ruhe zu bewahren. Darüber hinaus liegt sein großer Fokus darin, Menschen wieder in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. „Wir sind oft in Problemen und Gedan-

„MANCHMAL BRAUCHEN WIR NUR EINEN
PERSPEKTIVENWECHSEL, UM DAS
VERBORGENE SICHTBAR ZU MACHEN UND NEUE IMPULSE ZU ERHALTEN.“
Christian Ostermann
kenspiralen gefangen, dabei hilft oft schon ein Perspektivenwechsel, um den Tunnel zu verlassen und die Aufmerksamkeit wieder auf Positives zu lenken“, ist Ostermann überzeugt. Seine Erfahrung als Einsatzleiter und Dienstführer einer Einsatzorganisation ist insbesondere bei Führungskräften gefragt, denn in herausfordernden Momenten oder Konfliktsituationen ruhig und effektiv zu handeln und zu entscheiden, zählt zu den wesentlichen Eigenschaften erfolgreicher Führung.
HERBERT HANDLER, BEWEGUNGSWERKSTATT
Der Balance von mentaler und körperli-

Herbert Handler bietet Bewegungsspiele, Workshops und Ausbildungen für die individuell passende Bewegung im Spiel des Lebens.
cher Gesundheit hat sich Herbert Handler schon seit mehr als 20 Jahren verschrieben. Als ehemaliger Leichtathlet hat er früh erkannt, dass körperliches Training allein nicht ausreicht, um in Balance zu sein. Als Sportwissenschaftler und Humanenergetiker mit Schwerpunkt Kinesiologie bringt er Menschen mit einem Mix aus Bewegung und Achtsamkeit wieder in ihre Mitte. Dafür hat er sogar ein Spiel für alle Altersgruppen entwickelt: „Die Balanceness-Spiele helfen Menschen, dank einer intuitiv gewählten Bewegung eine kurze körperliche wie mentale Auszeit zu schaffen und auf spielerische Weise in Balance zu kommen“, sagt Handler. PR

Eva Littringer ist pharmazeutische Technologin und hat jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Medikamenten. 2021 hat sie gemeinsam mit Martin Schwarz und Alexander Liolios das Start-up revIVe Medtech GmbH gegründet.

Vom 18. bis 24. November macht die von der WHO initiierte „World AMR Awareness Week“ (WAAW) weltweit auf die alarmierende Zunahme von Infektionen mit resistenten Mikroorganismen aufmerksam. Das ist ein Thema von globaler Bedeutung, das nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommt. Resistenzen beeinträchtigen heute schon die Gesundheitsversorgung. Wird der Umgang mit Antibiotika nicht besser, wird diese Situation sich zukünftig gravierend verschlechtern. Eine Innovation aus Tirol könnte einen Beitrag zur Verbesserung leisten.
TEXT: MARIAN KRÖLL
nter antimikrobieller Resistenz (AMR) versteht man das Phänomen, dass vor allem Bakterien, aber auch Viren, Pilze oder Parasiten nicht mehr auf entsprechende Medikamente ansprechen. Dadurch verlieren Antibiotika und andere antimikrobielle Mittel ihre Wirkung, Infektionen werden zunehmend schwer oder gar nicht mehr behandelbar – mit gravierenden Folgen wie längeren Krankheitsverläufen, erhöhter Ansteckungsgefahr und steigender Sterblichkeit. Bereits im Jahr 2019 starben Schätzungen zufolge über 1,2 Millionen Menschen an Infektionen durch antibiotikaresistente Erreger. Sollte dem Trend nicht mit wirksamen Gegenmaßnahmen begegnet werden, rechnet die WHO damit, dass diese Zahl bis 2050 auf bis zu zehn Millionen ansteigen könnte.
AUS BEHANDELBAR WIRD UNBEHANDELBAR
Wenn gängige Arzneimittel nicht mehr funktionieren, ist das für ein Gesundheitswesen, das ohnedies unter Druck steht, eine zusätzliche Herausforderung. Das ist die systemische Ebene. Dann gibt es noch eine individuelle: Menschen sterben an Infektionen, die bei besserem, sprich bewussterem Umgang mit und dem Einsatz von Antibiotika normalerweise nicht sterben müssten. Aus behandelbaren Krankheiten könnten unbehandelbare werden.
Resistenzen können sich zum einen entwickeln, wenn bei der Nahrungsmittelproduktion Antibiotika in großem Stil eingesetzt werden und in geringer Konzentration in die Umwelt gelangen. Resistenzen entstehen aber auch, wenn Antibiotika im Körper in nicht ausreichender Konzentration vorhanden sind. Das gibt den Bakterien Raum, sich zu verändern, sich an das An-
EUREGIO - INNOVATIONSPREIS 2025
„Wettbewerbsfähigkeit“ lautete das Motto des diesjährigen Euregio-Innovationspreises. Dieser wurde im Rahmen der Euregio Days beim Europäischen Forum Alpbach verliehen. Den ersten Platz sicherte sich das Kufsteiner Start-up revIVe Medtech, das für sein Projekt Care@home ausgezeichnet wurde. Care@home macht intravenöse Antibiotika auch außerhalb des Spitals sicher verfügbar. Herzstück ist ein In-Use-Mischkonzept, das die Zubereitung von Infusionslösungen exakt dann ermöglicht, wenn sie gebraucht werden. Damit werden Stabilitätsprobleme gelöst, die richtige Dosis ist jederzeit verfügbar und die Anwendung ist auch für Nichtexpert*innen sicher möglich. Für Patient*innen bedeutet das mehr Sicherheit und Zugänglichkeit. „Die Siegerprojekte beweisen, dass Unternehmen in der Euregio nicht nur am internationalen Wettbewerb teilnehmen, sondern diesen aktiv mitgestalten“, lobte Jurypräsident Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle betont: „Gerade für die Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten braucht es innovative Lösungen, Kreativität und Ehrgeiz. revIVe zeigt eindrucksvoll, wie daraus konkrete Mehrwerte für unsere Region entstehen.“ Der Euregio-Innovationspreis wird jährlich verliehen. Gestiftet wird er von der Wirtschaftskammer Tirol sowie den Handelskammern von Bozen und Trient. Dieses Jahr gab es insgesamt 46 Einreichungen.
tibiotikum anzupassen. Dem liegt auch ein Verabreichungs- und Dosierungsproblem –gepaart mit einer intrinsischen chemischen Instabilität vieler Antibiotika, sobald sie in Kontakt mit Wasser kommen – zugrunde. Das ist vor allem bei intravenös zu verabreichenden Medikamenten relevant. Intravenöse Therapien müssen zielgerichtet und zeitlich richtig getaktet verabreicht werden, neuesten Studien zufolge zeigt auch die kontinuierliche Verabreichung über 24 Stunden Vorteile im Behandlungserfolg. Jedoch haben viele Antibiotika das Problem, dass sie, sobald sie in Lösung vorliegen, sehr schnell abbauen und bestenfalls nicht mehr wirksam sind, schlechtestenfalls sogar toxische oder allergene Abbauprodukte bilden. Um für gewisse Antibiotika kontinuierlich hohe Wirkstoffkonzentrationen im Blut sicherzustellen, müsste das medizinische Personal mehrmals täglich frisch die Lösung aus dem Antibiotikapulver herstellen und diese den Patient*innen verabreichen. Das lässt sich bei Personalknappheit und Ressourcenengpässen in den Krankenhäusern nicht immer optimal bewerkstelligen.
Neue Studien würden zeigen, dass „es angesichts der Herausforderungen durch antimikrobielle Resistenzen besonders wichtig ist, das bestehende Antibiotika-Portfolio holistisch betrachtet wirksam zu halten“, betont Eva Littringer. Die pharmazeutische Technologin verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Medikamenten und hat 2021 gemeinsam mit Martin Schwarz und Alexander Liolios das Start-up revIVe Medtech GmbH gegründet, das heuer den Euregio-Innovationspreis gewonnen hat. Die Betonung liegt auf einer holistischen Betrachtungsweise, die alle Stakeholder mitdenkt. „Eine rein ökonomische Optimierung

„MAN MUSS NIEMANDEM ERKLÄREN, WIE WICHTIG EINE SICHERE ENERGIEVERSORGUNG FÜR EUROPA IST.
WIE UNABDINGBAR WIRKSAME ANTIBIOTIKA FÜR DAS FUNKTIONIEREN UNSERES GESUNDHEITSSYSTEMS SIND, IST DAGEGEN WENIGER BEKANNT.“
Eva Littringer
des Antibiotikaeinsatzes ist aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive nicht zielführend“, sagt Littringer.
VOM MEDIKAMENT ZUR WARE
Während in der Medizin um jedes wirksame Antibiotikum gerungen wird, zieht sich die Industrie aus der Entwicklung neuer Wirkstoffe zurück – unter anderem ausgerechnet deshalb, weil diese so sparsam eingesetzt werden sollen. Die Produktion von Antibiotika ist für die pharmazeutische Industrie gerade in Ländern mit vergleichsweise hohen Arbeits- und Energiekosten nicht mehr besonders lukrativ. Die geopolitischen Entwicklungen haben die Verwundbarkeit globaler Lieferketten offengelegt. Es ist daher im strategischen Interesse Europas, die wichtigsten Medikamente auf dem Kontinent herzustellen. So wurde das zumindest in der Vergangenheit formuliert. Konkrete Maßnahmen sind allerdings noch Mangelware geblieben. Die global zunehmende Arzneimittelresistenz übertrifft die Entwicklungsgeschwindigkeit von Antibiotika für die am schwierigsten zu behandelnden Infektionen. Die meisten größeren pharmazeutischen Unternehmen haben sich aus der Entwicklung von neuen Antibiotika zurückgezogen, da diese zunächst als Reserveantibiotika so wenig wie möglich eingesetzt werden sollen,
um die Geschwindigkeit der Resistenzbildung zu reduzieren. Auf dieser Grundlage lässt sich kein positiver Business Case darstellen. Einzelne Länder wie das Vereinigte Königreich haben versucht, mit innovativen Erstattungsmechanismen – sogenannte „Pull incentives“ – diesem Problem gegenzusteuern. Der Erfolg lässt aber noch auf sich warten. Das ist problematisch.
Eva Littringer kritisiert, dass viele gängige Antibiotika heute als einfache Commodity gehandelt würden. Aus lebensrettenden Medikamenten, die sie grundsätzlich sind, ist banale Handelsware geworden. „Man muss niemandem erklären, wie wichtig eine sichere Energieversorgung für Europa ist. Wie unabdingbar wirksame Antibiotika für das Funktionieren unseres Gesundheitssystems sind, ist dagegen weniger bekannt“, sagt die Wissenschaftlerin.
Antibiotika werden nicht nur direkt gegen Infektionen angewendet, sondern auch begleitend in der onkologischen Behandlung von Krebspatient*innen und prophylaktisch bei medizinischen Eingriffen. „Antibiotika sind aus der modernen Medizin nicht wegzudenken. Das ist uns vielfach überhaupt nicht bewusst“, so Littringer. Der renommierte Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss betont im nachfolgenden Interview, dass Antibiotika „zu den wirksams-
ten medizinischen Waffen gehören, die je erfunden wurden“.
Der sorgsame Umgang mit bestehenden und die Entwicklung neuer Antibiotika bzw. Wirkstoffklassen scheinen im Zusammenspiel mit Strategien, um die weitere AMR-Verbreitung zu verhindern, angesichts der Bedrohungslage absolut notwendig. Doch es gibt auch begleitend dazu noch einen weiteren, innovativen Ansatz: Die revIVe Medtech GmbH entwickelt eine Infusionsplattform der nächsten Generation, die eine sichere und einfache intravenöse Therapie (IV) sowohl im Krankenhaus als auch im häuslichen Umfeld ermöglicht. Ziel ist es, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung zu verbessern und gleichzeitig Kosten und Personalaufwand im Gesundheitswesen zu senken. Das System kombiniert ein medizinisches Gerät mit vorgefüllten Kartuschen und Arzneimitteln in Pulverform. Die Infusionslösung wird automatisch und steril direkt im Gerät hergestellt. Damit entfallen aufwendige Vorbereitungsschritte, während zugleich Stabilität, Sicherheit und Handhabung verbessert werden. Diese Plattform ist geeignet, zwei der zentralen Herausforderungen der europäischen Gesundheitsversorgung zu adressieren: den demografischen Wandel mit zunehmendem Pflegebedarf und die wachsende Bedrohung durch AMR. „Unsere Plattform ermöglicht kontinuierliche Infusionen und bedarfsgerechte Zubereitung von Infusionslösungen, wodurch Patient*innen das richtige Medikament in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit erhalten“, erklärt Littringer. revIVe könnte damit zur Entlastung stationärer Einrichtungen beitragen, das Risiko von Krankenhausinfektionen reduzieren und den Zugang zu IV-Therapien auch in Regionen mit begrenzter Infrastruktur erweitern. Der weltweite Markt für Heim-Infusionstherapien wird bis 2027 auf rund 49 Milliarden US-Dollar geschätzt, was die Relevanz und Skalierbarkeit des Ansatzes unterstreicht. Antimikrobielle Resistenzen sind eine Gefahr, die öffentlich zwar noch recht wenig Aufsehen erregen mag. Die Gefahr jedoch ist real. Ärzt*innen müssen täglich damit umgehen. Deswegen sollte man ihnen auch die Werkzeuge an die Hand geben, damit die Verbreitung von AMR zumindest eingedämmt werden kann. Und damit Antibiotika, mit die wirksamsten Waffen, die der Medizin zur Verfügung stehen, nicht stumpf werden.
Impulse setzen. Netzwerke leben. Zukunft gestalten.

MCI-Alumni kombinieren fundiertes Fachwissen mit Unternehmergeist und sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
Am MCI | Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck treffen Neugier, Unternehmergeist und internationale Vernetzung aufeinander. Hier entwickeln Studierende Ideen, die über den Campus hinaus Wirkung entfalten, knüpfen Kontakte, die ein Leben lang halten, und erwerben Kompetenzen, die für Karriere und Gesellschaft entscheidend sind.
STUDIEREN FÜR VERANTWORTUNG UND INNOVATION
Über 30 Bachelor- und Masterprogramme sowie zwei internationale Doktoratsstudien in Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences verbinden Praxis und Theorie. Micro-Credentials ergänzen das Portfolio durch kompakte, digitale Lerneinheiten, die gezielt Management- und Wirtschaftskompetenzen stärken. Studierende werden zu Gestalter:innen, die selbstbewusst neue Wege gehen. Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot
I NTERNATIONALE ERFAHRUNGEN, G LOBALES NETZWERK
Rund 3.500 Studierende aus über 60 Ländern lernen hier in einer weltoffenen Atmosphäre. Ein internationales Semester und mehr als 300 Partneruniversitäten – darunter Top-Unis wie Berkeley und Yale – ermöglichen einmalige Erfahrungen und legen den Grundstein für internationale Karrieren.
Projekte, Start-ups, Praktika und Career Services bereiten optimal auf die Berufswelt vor. Forschung und Entwicklung am MCI schaffen innovative Produkte und Geschäftsmodelle – ein Gewinn für Studierende, Unternehmen und Gesellschaft. Mehr erfahren: mci.edu/f&e
INFO & BEWERBUNG
• OnlineInfosessions: 21. und 22. Oktober 2025 → mci.edu/online-infosession
• Bewerbungsfrist: 9. November 2025 → mci.edu/bewerbung
• Open House: 31. Januar 2026 in Innsbruck

Biotechnology
Business Psychology & Management
Digital Business & Software Engineering
Entrepreneurship & Tourismus
European Health Economics & Management
International Business & Law
International Business & Management
International Health & Social Management
Lebensmitteltechnologie & Ernährung
Management, Communication & IT
Im Wettbewerb um öffentliche Aufträge sollen neben großen Unternehmen auch KMU in den Vergabeverfahren berücksichtigt werden.
Mechatronics – Smart Technologies
Mechatronik – Automation, Robotics & AI
Medical & Sports Technologies
Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management
Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik
Wirtschaftsingenieurwesen
PhD Program for Executives
MSc | DBA Double Degree Program
MBA General Management
MBA Health Management*
MBA International Management
MSc Management & Leadership
LL.M. Digital Business & Tech Law
LL.M. Compliance & Corporate Governance
BA General Management
Zertifikats-Lehrgänge
Micro-Credentials
Management-Seminare
Technische Weiterbildung
Maßgeschneiderte Programme
informed
Während viele Pharmakonzerne längst nach Asien abgewandert sind, produziert Sandoz in Kundl weiterhin Penicilline – von der Fermentation bis zur Tablette. Standortleiterin Stephanie Jedner erklärt, warum Europas letzte integrierte Antibiotikaproduktion systemrelevant ist, wie geopolitische Krisen die Lieferketten verändern und weshalb das Gesundheitssystem vom Billigstbieter- zum Bestbieterprinzip umdenken muss.
ECO.NOVA: Sandoz gilt als größter Antibiotikaproduzent Europas – und produziert in Tirol. Wie gelingt es Ihnen, die Versorgung trotz globaler Lieferengpässe sicherzustellen? STEPHANIE JEDNER: Seit fast 80 Jahren machen wir in Kundl das, was wir am besten können: Wir produzieren Antibiotika für die Welt. Kundl ist heute die letzte große voll integrierte Produktion für Penicilline in der westlichen Welt und umfasst alle Schritte von der Fermentation über die Wirkstoffherstellung bis hin zur Tablette. In den vergangenen Jahren wurden über 200 Millionen Euro in den Tiroler Standort investiert, um die Produktion wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu machen und die Kapazität auf 240 Millionen Arzneimittelpackungen pro Jahr auszubauen – ausreichend, um den europäischen Bedarf an Penicillinen zu decken und die Abhängigkeit von Asien zu reduzieren. Neben Investitionen sind jahrzehntelange Expertise, kontinuierliche Optimierungen und der Pioniergeist unserer Mitarbeiter*innen entscheidend, um uns im globalen Wettbewerb zu behaupten. Lokale Produktion kann geopolitische Abhängigkeiten verringern und – gemeinsam mit stabilen Rahmenbedingungen und fairen Preisen – für eine sichere Versorgung in Europa sorgen.
Die Entwicklung und Produktion von Antibiotika gilt als ökonomisch wenig attraktiv. Welche Maßnahmen wären notwendig, damit sich die Herstellung in Europa langfristig wieder rechnet? Antibiotika sind das Rückgrat der modernen Medizin. Ohne sie sind selbst kleine Eingriffe oft nicht möglich, banale Infektionen können lebensbedrohlich werden. Doch ihre Herstellung ist sehr ressourcenintensiv. Der Energiebedarf unserer Produktion in Kundl entspricht dem der Stadt Innsbruck. Hohe Kosten für Energie, Rohstoffe und Löhne bei gleichzeitig niedrigen Medikamentenpreisen

stellen uns vor große Herausforderungen. Neben industriepolitischen Maßnahmen braucht es auch einen Paradigmenwechsel: Gesundheitssysteme müssen weg vom Billigstbieter- hin zum Bestbieterprinzip. Nur durch einen Schulterschluss von Politik und Industrie kann Europas Souveränität in der Arzneimittelversorgung gesichert und die Medikamentenproduktion als Schlüsselindustrie gestärkt werden.
Antibiotika werden häufig als Commodity gehandelt. Wie kann man sich als produzierendes Unternehmen aus der Spirale von Preisdruck und Margenknappheit befreien? Gerade in der Wirkstoffproduktion herrscht intensiver Wettbewerb, und der Kostendruck hat zu einer massiven Konsolidierung der Hersteller geführt. Asien hat Europa bei Neuzulassungen von Wirkstoffzertifikaten deutlich überholt. Wir haben in Kundl über Jahrzehnte großes Know-how aufgebaut und setzen auf Prozessoptimierung zur Steigerung der Produktivität. Durch Innovation erzielen wir eine kontinuierliche Steigerung der Wirkstoffmenge. Auch neue Wege in der Rohstoffversorgung brin-
gen nachhaltige Lösungen: Seit Beginn der Penicillinproduktion wird Zucker als Hauptnährstoff für den Penicillin-Pilz verwendet. Angesichts instabiler Lieferketten und steigender Preise haben wir alternative Quellen in der Region gefunden. Seit letztem Jahr nutzen wir verstärkt Laktose – ein Nebenprodukt aus der Käseproduktion – als Nährstoff. Sie stammt aus Tiroler Milch und wird von einem regionalen Betrieb geliefert.
Pharmaunternehmen tragen eine große Verantwortung im Umgang mit Antibiotika. Welche Rolle spielt die Industrie bei der Prävention von Resistenzen? Viele Menschen glauben heute, dass tödliche Infektionskrankheiten der Vergangenheit angehören. Dies verdanken wir dem „Wunder“ moderner Antibiotika, die die Lebenserwartung um bis zu 20 Jahre erhöht haben. Antimikrobielle Resistenzen (AMR) stellen jedoch eine wachsende Bedrohung dar. Es braucht gemeinsame Anstrengungen aller Sektoren, um ihre Ausbreitung zu verlangsamen und die Folgen zu minimieren. Wir konzentrieren uns auf drei Bereiche: verantwortungsvolle Produktion, Zugang und Verwendung.In Kundl nutzen wir moderne Technologien und setzen laufend Maßnahmen um, die entscheidend dazu beitragen, Resistenzen in der Produktion langfristig zu minimieren – vom sorgfältigen Abwassermanagement über strenge Hygieneprotokolle bis hin zur Prozessautomation. Unsere Produktionsstätte ist die erste weltweit, die den internationalen Standard des British Standards Institute (BSI) zur Minimierung von AMR-Risiken erfüllt. Verantwortungsvoller Zugang bedeutet, das richtige Medikament zur richtigen Zeit an den richtigen Patienten zu bringen – unterstützt durch moderne Diagnostik und schließlich unterstützen gezielte Schulungen eine verantwortungsvolle Verwendung.
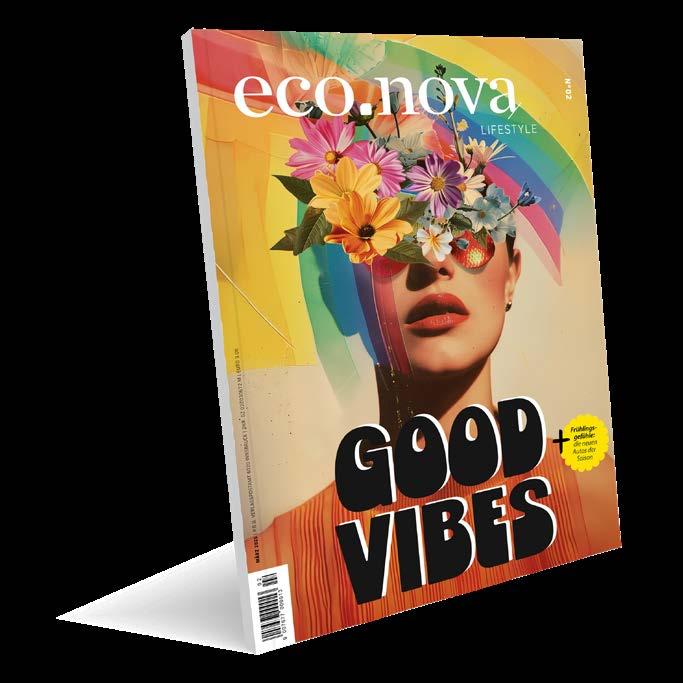
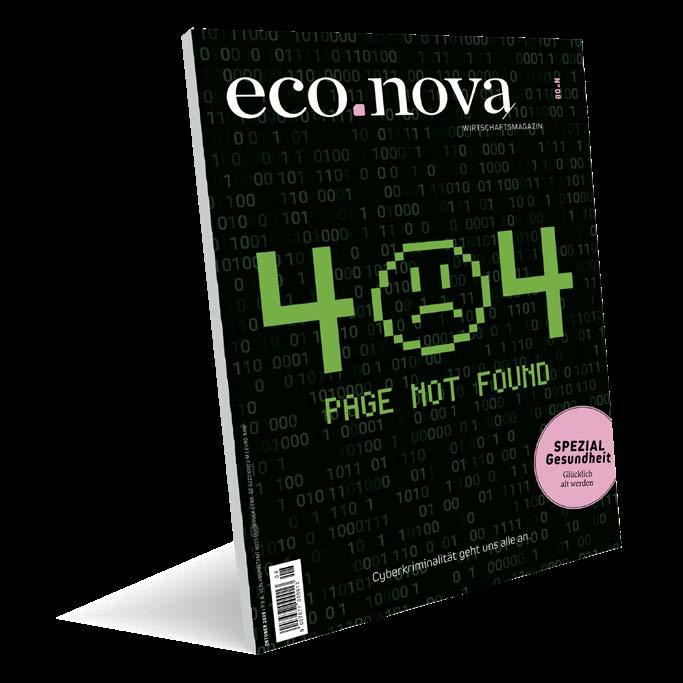
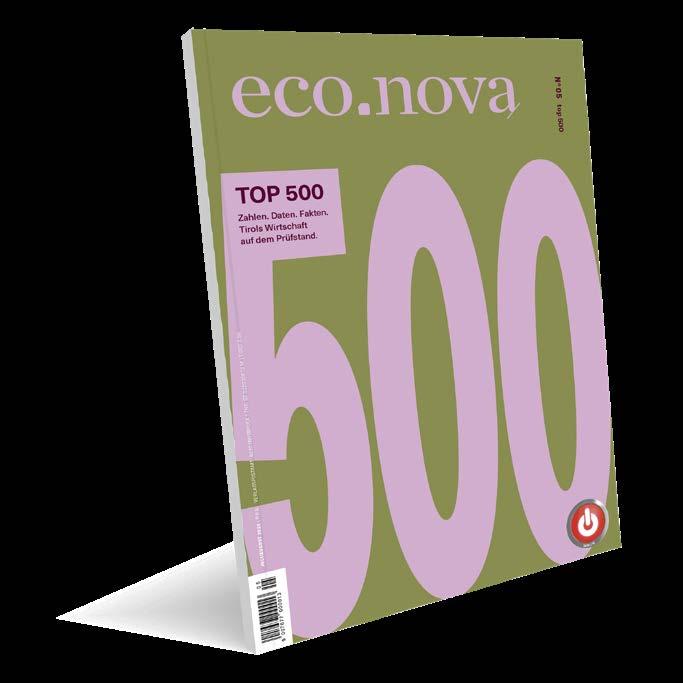

Der Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss beschreibt die Herausforderungen, die durch antimikrobielle Resistenz (AMR) entstehen, und mahnt zum
Wohl der Patient*innen und des Gesundheitssystems einen verantwortungsvolleren Umgang mit Antibiotika an. Um die Innovationslücke bei den Antibiotika zu schließen und Europas Versorgungssicherheit sicherzustellen, wird es auch Geld brauchen.
ECO.NOVA: Was ist antimikrobielle Resistenz? GÜNTER WEISS: Antimikrobielle Resistenz bedeutet, dass bestimmte Krankheitserreger im Laufe der Zeit nicht mehr auf bestimmte Antibiotika ansprechen. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich: Bakterien vermehren sich ständig, und dabei treten zufällige genetische Veränderungen (Mutationen) auf. Manche dieser Mutationen können dazu führen, dass ein Bakterium gegen ein Antibiotikum unempfindlich wird. Darüber hinaus können Bakterien Resistenzgene auch voneinander übernehmen. Dieser sogenannte horizontale Gentransfer erfolgt über Plasmide, Transposons oder
gelegentlich Bakteriophagen. Das sind Viren, die Bakterien infizieren. Auf diese Weise können auch ursprünglich empfindliche Bakterien resistent gegenüber Antibiotika werden.
Warum ist das so problematisch? Antibiotika gehören zu den wirksamsten medizinischen Waffen, die je erfunden wurden. Sie haben viele Millionen Menschenleben gerettet. Fast jeder Erwachsene hat irgendwann ein Antibiotikum gebraucht – sei es bei einer leichten oder schweren Infektion. Früher sind viele Menschen an einer einfachen Lungenentzündung gestorben, heute kommt

das zum Glück viel seltener vor. Aber: Je häufiger wir Antibiotika einsetzen, desto stärker geraten Bakterien unter Druck, Resistenzen zu entwickeln. Dieses Risiko nimmt zu, wenn Antibiotika über einen längeren Zeitraum oder in zu geringen Dosierungen eingesetzt werden oder über die Landwirtschaft in die Nahrungskette gelangen.
Wo sind diese resistenten Erreger anzutreffen? Diese Erreger kann es überall geben. In der Umwelt, am Patienten, aber auch in der Nahrungskette. In Regionen, wo Antibiotika „Over the Counter“ erhältlich sind, gibt es sehr viele Resistenzen. Ist dort jemand krank, wird häufig einfach ein Antibiotikum – nicht selten ein Breitbandantibiotikum – gekauft und verabreicht.
Eine bessere Verabreichungspraxis würde also den Selektionsdruck senken. Was kann man sonst tun, um gegen resistente Keime anzukämpfen? Ja. Das Wichtigste ist der zielgerichtete Einsatz von Antibiotika. Ein solches sollte nur bei bakteriellen
„ALLGEMEIN
GILT: ANTIBIOTIKA SIND SO SPEZIFISCH WIE MÖGLICH, IN AUSREICHENDER KONZENTRATION UND SO KURZ WIE MÖGLICH ZU VERABREICHEN.“
Infektionen angewendet werden, und dann möglichst spezifisch. Je schmäler das Antibiotikum, desto geringer ist der Selektionsdruck auf Bakterien. Ein Breitbandantibiotikum, das möglichst viele unterschiedliche Keime umfasst, macht die Entstehung bzw. Selektion von Resistenzen sehr viel wahrscheinlicher. Zweitens müssen Antibiotika richtig dosiert werden. Die Patient*innen müssen vor allem im niedergelassenen Bereich gut instruiert werden, wie Antibiotika richtig einzunehmen sind. Drittens sollten unnötig lange Antibiotikatherapien vermieden werden. Solche Therapien müssen zu-
„JE MEHR WIR MIT RESISTENZEN ZU TUN HABEN, DESTO WENIGER GELINGT ES, BAKTERIELLE INFEKTIONEN EINFACH ZU BEHANDELN.“
dem rechtzeitig beendet werden, wenn Befunde eintreffen, die gegen eine bakterielle Infektion sprechen, oder die Patient*innen geheilt sind. Allgemein gilt: Antibiotika sind so spezifisch wie möglich, in ausreichender Konzentration und so kurz wie möglich zu verabreichen.
Was lässt sich prophylaktisch gegen die Ausbreitung resistenter Keime machen?
Im Krankenhausalltag spielt die Händehygiene eine ganz wesentliche Rolle. Viele resistente Erreger werden über die Hände übertragen. Bei Personen, die sich in Regionen aufgehalten haben (auch im Rahmen eines rezenten Urlaubs), in denen es viele resistente Erreger gibt, ist bei Aufnahme in einem hiesigen Krankenhaus ein Screening auf resistente Erreger sinnvoll. Ist ein solcher Erreger nämlich erst einmal ins Krankenhaus eingetragen, bekommt man ihn kaum mehr weg.
Sind AMR im klinischen Alltag noch ein eher theoretisches Thema oder gibt es in der Praxis bereits einen Leidensdruck? Resistenzen sind präsent, multiresistente Erreger spielen im Krankenhaus zunehmend eine Rolle. Die Medizin entwickelt sich ständig weiter, sei es in der Transplantationsmedizin oder Onkologie. Wir behandeln heute vermehrt ältere Menschen, auch auf den Intensivstationen. Sie haben ein schwächeres Immunsystem und sind für Infektionen anfälliger, brauchen häufiger Antibiotika. Je länger ein Krankenhausaufenthalt dauert und je häufiger jemand mit Antibiotika behandelt werden muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung multiresistenter Erreger. In Österreich ist das Risiko glücklicherweise noch überschaubar, in manchen Bereichen haben wir aber schon zu kämpfen: bei Harnwegsinfekten, Infektionen im Blut (Sepsis) und Lungenentzündungen.
Stellen AMR schon heute eine Belastung für die Ressourcen der Krankenhäuser dar? Multiresistente Erreger sind per se nicht pathogener oder gefährlicher. Aber sie werden oft später erkannt und die richtige Therapie beginnt damit verspätet. Dadurch
ist der Outcome oft schlechter. Die Therapieoptionen bei multiresistenten Erregern (MRE) sind mitunter limitiert. Es gibt dann beispielsweise keine Therapeutika mehr, die oral eingenommen werden können, sondern nur noch intravenös. Das ist ein Problem. Diese Reserveantibiotika sind außerdem mitunter kostenintensiver. Es braucht entsprechendes Know-how, um bei MRE richtig therapieren zu können, und eine gute Kooperation mit den mikrobiologischen Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, die Erreger zu identifizieren.
Was bedeutet es für die moderne Medizin, wenn es durch Resistenzen immer weniger wirksame Antibiotika gibt? Ein führendes medizinisches Journal hat vor Jahren einmal die zunehmende antibiotische Resistenz als „medizinische Version des Treibhauseffekts“ bezeichnet. Je mehr wir mit Resistenzen zu tun haben, desto weniger gelingt es, bakterielle Infektionen einfach zu behandeln. Es braucht dann öfter einen Rückgriff auf Reserveantibiotika, Patient*innen müssen öfter stationär und länger aufgenommen werden. Alternativ dazu braucht es neue, innovative Verfahren, die es Patient*innen ermöglichen, auch zu Hause mit einer intravenösen Therapie behandelt zu werden. Genau damit beschäftigt sich Dr. Eva Littringer in ihrem Unternehmen. MRE üben Druck auf die Krankenhausinfrastruktur aus, weil die Patient*innen mit multiresistenten Erregern isoliert werden müssen. Das kann zu Kapazitätsengpässen führen. Patient*innen, die in Einzelzimmern isoliert sind, sind immer schlechter versorgt als Patient*innen in Mehrbettzimmern, weil die Isolation immer auch eine Barriere darstellt. Wir haben immer wieder mit Patient*innen zu tun, die gegen alle möglichen Antibiotika resistent gewesen sind. Die Keime stammen häufig aus dem Ausland, die Krankenhausaufenthalte dauern in solchen Fällen mehrere Wochen.
Inwiefern ist die ambulante intravenöse Therapie von Patient*innen angesichts der Situation im Gesundheitswesen erwünscht? Auch bei uns sind Betten auf-
grund der bekannt schwierigen allgemeinen Pflegesituation gesperrt. Zudem steht die kalte Jahreszeit vor der Tür, in der wir ohnehin an die Kapazitätsgrenzen kommen und nicht immer alle Patient*innen stationär aufnehmen können. Bei Infektionen, die eine lange Behandlungsdauer brauchen, wäre es natürlich wünschenswert, das teilweise auch ambulant machen zu können. Es ist ein Problem, dass manche Antibiotika dreimal täglich verabreicht werden müssen. Eine kontinuierliche intravenöse ambulante Therapiemöglichkeit wäre da tatsächlich sehr hilfreich. Das würde die Lebensqualität der Patient*innen heben und Bettenkapazitäten schonen. Das wäre für Patient*innen mit gewöhnlichen, aber auch multiresistenten Erregern vorteilhaft, die über Wochen hindurch behandelt werden müssen. Das wäre eine Win-win-Situation.
Würde die ambulante intravenöse Verabreichung auch dazu beitragen, die Bildung von MRE hintanzuhalten? Natürlich. Ist ein Antibiotikum optimal dosiert, kommt es seltener zur Resistenzselektion. Dazu gibt es sehr gute Daten. Eine solche ambulante Therapie ist für die Krankenanstaltenträger im Moment nicht sonderlich attraktiv, weil ambulante Therapien nicht kostendeckend abgegolten werden. Unterm Strich ist es für das Gesundheitswesen aber viel billiger, wenn Patient*innen ambulant versorgt werden können und kein Krankenhausbett belegen. Da ist das ökonomische Denken leider noch ein wenig in den Kinderschuhen stecken geblieben. Das muss sich ändern.
Gibt es alternative Behandlungsmöglichkeiten, wenn Antibiotika aufgrund multiresistenter Erreger wirkungslos bleiben? Es wird versucht, Antibiotika höher zu dosieren oder Kombinationen einzusetzen. Das ist knifflig und es ist bald das Ende der Fahnenstange erreicht. Das kommt aber nur ganz selten vor. Patient*innen sind zunehmend ausgemergelt, wenn sie an einer langwierigen Infektion leiden. Funktioniert das Immunsystem nicht, ist auch die Wirksamkeit der Antibiotika limitiert. Es braucht ein fittes Immunsystem und die
entsprechenden Antibiotika, um eine Infektion effektiv behandeln zu können. An einer ambulant erworbenen Pneumonie sterben selbst bei optimaler antibiotischer Therapie zehn Prozent der Patient*innen. Früher waren es 80 Prozent. Wir müssen mit Antibiotika sehr verantwortungsvoll umgehen. Verantwortungsvoller als heute. Es ist ein Zeit- und Systemproblem, wenn Patient*innen, die mit einem respiratorischen Infekt, der meistens viral bedingt ist, eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen und dann häufig trotzdem Antibiotika verabreicht bekommen. Es muss gezielter therapiert und mit einfachen Maßnahmen zwischen viralen und bakteriellen Infektionen unterschieden werden.
Im Krankenhausbereich gibt es bereits ein Bewusstsein für die zahlreichen Komplikationen, die durch MRE verursacht werden. Ist das im niedergelassenen Bereich auch der Fall? Das Verständnis steigt. Man weiß aber auch, dass im niedergelassenen Bereich der Großteil der antibiotischen Verschreibungen auf die Behandlung von respiratorischen Infektionen zurückzuführen ist. Mehr als 70 Prozent dieser Infektionen sind aber nachweislich viraler Genese. Das heißt im Umkehrschluss: Mehr als zwei Drittel der Antibiotikaverschreibungen sind nicht indiziert. Da gibt es noch viel Aufholbedarf.
In der Pandemie hat die Politik getönt, wie wichtig die Unabhängigkeit Europas in der Medikamentenproduktion sei. Sind den Sonntagsreden bereits Taten gefolgt? Diese Diskussion gab es schon vor der Pandemie. Sie betrifft nicht nur Antibiotika, sondern auch andere Medikamente, etwa gegen Bluthochdruck. Der Großteil der Medikamentenproduktion wurde ausgelagert, vor allem nach Indien und China. Ich sehe es für die Autarkie Europas als gravierendes Problem an, dass wir nicht mehr in der Lage sind, notwendige Medikamente in ausreichender Menge selbst herzustellen. In Tirol gibt es mit Sandoz den größten Antibiotikaproduzenten in Europa. Dennoch haben wir in den letzten Jahren mehrfach Versorgungsengpässe bei ganz gewöhnli-

Günter Weiss ist Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin II und einer der führenden Experten für Infektiologie, Immunologie und Eisenstoffwechsel. Er forscht unter anderem zu immunologischen Mechanismen der Infektionsabwehr. Weiss ist Sprecher des Comprehensive Center für Infektiologie, Immunologie und Transplantation an der MedUni Innsbruck und behandelte 2020 die ersten Covid-19-Patient*innen Österreichs. 2015 wurde er in die Österreichische Akademie der Wissenschaften und 2022 in die Academia Europaea aufgenommen. 2024 erhielt er den Tiroler Landespreis für Wissenschaft.
chen, oral einzunehmenden Antibiotika gesehen. Man muss sich bewusst sein, dass Europa bei der Medikamentenversorgung unabhängiger werden muss. Das wird etwas kosten. Ist man beispielsweise aufgrund geopolitischer Verwerfungen plötzlich von der Versorgung mit diesen Medikamenten abgeschnitten, wird das ein großes Problem. Wir bekommen jede Woche von unserer Anstaltsapotheke eine Liste mit Medikamenten, die momentan nicht lieferbar sind. Diese Liste wird immer länger.
Kann man sich aus der AMRProblematik herausforschen und entwickeln? In der Forschung und Entwicklung von Antibiotika und Antiinfektiva gibt es generell ein Problem. Die WHO hat nach erfolgreicher Ausrottung der Pocken Ende der 1970er-Jahre sehr optimistisch verkündet, dass im Jahr 2000 Infektionskrankheiten global kein Problem mehr darstellen würden. Daraufhin sind viele Unternehmen aus der Forschung und Entwicklung ausgestiegen. Heute wissen wir, dass diese Einschätzungen keineswegs richtig waren und zwischen 1980 und 2000 zu einer Innovationslücke geführt haben. Die wichtigsten antibiotischen Substanzen, die wir heute haben, sind bereits in den 1940er- bis 1960er-Jahren entwickelt worden. Das Geld, das für Infektionsforschung ausgegeben wird, ist bis heute limitiert. Es wird vermehrt an Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen geforscht. Das will ich nicht schmälern, aber ein Drittel aller Menschen sterben bis heute an den Folgen von Infektionskrankheiten. Hier braucht es dringend mehr Fördermittel zur Erforschung von neuen antiinfektiven Therapien. Wir brauchen zukünftig auch ein besseres Verständnis dafür, wo es Reservoirs für MRE gibt. Dafür benötigt es eine engere Kooperation mit der Veterinärund Umweltmedizin. Dann kann man auch verstärkt präventiv tätig werden.
„IST EIN RESISTENTER ERREGER ERST
EINGETRAGEN,
Es braucht also eine Vernetzung aller Bereiche, in denen Antibiotika eingesetzt werden? Ja. Ich bin überdies der Meinung, dass Antibiotika generell mit mehr Umsicht und gezielter eingesetzt werden müssen.

Im internationalen Vergleich leistet sich Österreich ein durchaus hochwertiges Gesundheitssystem. Die Versorgungskapazitäten sind verhältnismäßig hoch, ebenso wie der medizinische Standard. Doch es gibt Potenzial zur Verbesserung – nicht nur im Offensichtlichen, auch im Verborgenen. In der Feedback- und Fehlerkultur zum Beispiel oder der notfallmedizinischen Fortbildung. Die Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck (IGNI) hat sich zur Aufgabe gemacht, dort anzusetzen.
TEXT: MARINA BERNARDI

Notfallmedizin ist eine komplexe Materie. Kaum ein anderes Gebiet in der Medizin ist derart interdisziplinär. Als Querschnittsmaterie braucht es in der Notfallmedizin Kenntnisse verschiedenster Fachbereiche von unfallchirurgischem bis internistischem Verständnis. Unterschiedliche Einsatzorganisationen und Institutionen treffen aufeinander. Jede davon leistet für sich gute Arbeit, die Vernetzung funktioniert jedoch nur mäßig. Auch die aktuelle Situation in der notärztlichen Aus- und Fortbildung ist vielfach alles andere als ideal. Selbst wenn die Voraussetzungen für die Notarztausbildung in Österreich verschärft wurden, so kann fast jeder Arzt unabhängig von seinem Fachgebiet eine solche absolvieren. Eine laufende Fortbildung nach Erlangung des Notarztdiploms ist anschließend nur in sehr begrenztem Ausmaß erforderlich, zudem fehlt vielerorts eine strukturierte Qualitätssicherung. Doch die Medizin ändert sich, die Notfallmedizin ganz besonders. Behandlungsmethoden werden invasiver und komplexer, die Diagnosemög-
„WIR SIND ALS IGNI EINE UNABHÄNGIGE STIMME ZUR PROFESSIONALISIERUNG DER NOTFALLMEDIZIN. ES BRAUCHT IN DIESEM BEREICH NOCH EINIGES AN ENTWICKLUNGSARBEIT.“
Jakob Gruber
lichkeiten am Einsatzort steigen kontinuierlich, auch innerklinisch im Schockraum nehmen die Anforderungen an Notfallmediziner schnell zu. Entwicklungsarbeit braucht es ebenso auf Seiten der Sanitäter*innen. Im europäischen Vergleich ist die Ausbildung von Sanitätern hierzulande deutlich kürzer, so gibt es für den Sanitäter keinen Berufsschutz. Es ist einiges zu tun. Hinzu kommt eine Vielfalt an unterschiedlichen Einsatzorganisationen, Institutionen und Einrichtungen. Jede davon arbeitet für sich, Standards sind uneinheitlich, es fehlt an einer lebendigen Feedback- und Fehlerkultur. Statt voneinander zu lernen, entstehen Inseln: Ausbildungsstätten entwickeln eigene Konzepte, evaluieren sich kaum gegenseitig und bleiben so im eigenen System gefangen. Gerade in einem hochsensiblen Bereich wie der Notfallmedizin hat das Folgen: Nachwuchsmediziner*innen erleben eine Ausbildung, die eher formal denn praxisorientiert wirkt, und wichtige Kompetenzen, die im Ernstfall Leben retten können, werden in der Folge unzureichend trainiert. Fehler werden im Alltag zu selten offen angesprochen, dabei kann gerade eine konstruktive Fehlerkultur dazu beitragen, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Fehlendes Feedback führt dazu, dass im Alltag Unsicherheiten bleiben. „Die Notfallmedizin ist ein wenig der Wilde Westen der Medizin“, beschreibt es Jakob Gruber. Er ist Assistenzarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und aktuell Vorsitzender der Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck.
Die IGNI ist keine staatliche Institution und kein verpflichtendes Programm, sondern eine freiwillige, private Initiative, die vor rund zehn Jahren von engagierten Sanitäter*innen und Medizinstudent*innen ins Leben gerufen wurde und sich das Ziel gesetzt hat, die prä- und innerklinische Notfallmedizin weiterzuentwickeln und deren Professionalisierung voranzutreiben. Und es ist gerade dieses freiwillige Engagement, das den Wert von IGNI ausmacht: Der Verein ist frei von institutionellen Zwängen, bürokratischen Hürden und formalen Hierarchien. Den Mitgliedern geht es ausschließlich darum, die Patient*innensicherheit sowie notfallmedizinische Versorgungsqualität nachhaltig zu verbessern. Dazu schafft IGNI Räume, in denen sich Interessierte unabhängig von Dienststellen und Trägern begegnen, Erfahrungen austauschen und interdisziplinär voneinander lernen können. Statt jede Institution für sich entwickeln die Mitglieder der IGNI gemeinsame, übergreifende Standards
„IN ÖSTERREICH WIRD AN SEHR VIELEN STELLEN GUTE MEDIZIN GEMACHT, DOCH VOR ALLEM IN DER NOTFALLMEDIZIN HEISST ES, AUCH
IN DEN KLEINSTEN DETAILS UND NUANCEN DIE BESTE LEISTUNG ZU ERBRINGEN.“
Andreas Zoller
und teilen Best Practices. Etwas, das in der bisherigen Ausbildungs- und Weiterbildungslandschaft und im klinischen Umfeld oft fehlt. „Unser Ansatz ist, Wissen und Erfahrungen, die bereits vorhanden sind, miteinander zu verknüpfen und Synergien zu nutzen, um davon in unserem beruflichen Alltag zu profitieren“, so Gruber. Dafür bietet die IGNI unter anderem Workshops und Vorträge zu unterschiedlichen Themenfeldern an sowie regelmäßige Trainings, bei denen Menschen zusammenkommen, die im beruflichen Alltag in verschiedensten Situationen aufeinandertreffen könnten. Teams in der Notfallmedizin müssen oft adhoc zusammengestellt werden. „Die IGNI versteht sich als Schnittstelle zwischen den unterschiedlichsten Disziplinen. Normalerweise arbeitet jeder für sich, dabei ist die Notfallmedizin ein großes Ganzes. Der Patient betrifft alle gleichermaßen, deshalb ist eine Zusammenarbeit so wichtig. Die Medizin ist stets dieselbe, die Sprache jedoch oft eine andere“, sagt Lisa Kohler. Sie ist Medizinstudentin im letzten Jahr, Rettungssanitäterin und ebenfalls IGNI-Vorstandsmitglied. „Bei uns ist es völlig egal, aus welcher Organisation die Menschen kommen und welche Position sie dort innehaben. Wir stellen die nötige Infrastruktur zur Verfügung und haben es über die Zeit geschafft, dass Sanitäter*innen mit Ärzt*innen und Student*innen mit Pfleger*innen regelhaft gemeinsam trainieren – und das auf Augenhöhe. Es gibt keine Hierarchien und wir versuchen, dass bei jedem Training ein Vertreter jeder Berufsgruppe dabei ist, was in den Organisationen selbst oft schwierig ist“, ergänzt Andreas Zoller, Assistenzarzt für Innere Medizin – und langjähriges Vorstandsmitglied. Letztlich ist es in der Medizin wie im Sport: Um besser zu werden, braucht es regelmäßiges Training. „Es geht darum, Routinen zu entwickeln, dass man auch in Situationen, die man selten erlebt, seine beste Leistung abrufen kann“, sagt Zoller. Besonders wichtig ist dabei eine gelebte Feedbackund Fehlerkultur. Während Fehler andernorts oft tabuisiert oder nur hinter verschlossener Tür diskutiert werden, versteht die IGNI diese als wertvolle Lernchance. Durch eine offene, konstruktive Auseinandersetzung entstehen neue Impulse, die mit ins Training einfließen. Das schafft Sicherheit im Handeln, stärkt das Selbstvertrauen und verbessert am Ende die Patient*innenversorgung. „Bei uns ist es ausdrücklich erwünscht, Fehler zu ma-
chen“, erklärt Jakob Gruber. „Wir versuchen, bei jedem Training an unser persönliches Limit zu gehen und damit unsere eigenen Grenzen auszuloten. Unterm Strich kann nichts Besseres passieren, als Fehler im geschützten Rahmen zu machen, um daraus zu lernen. Notfallmedizin ist ein Bereich, in dem man zeitweise extrem unter Druck steht, in dem schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, die potenziell eine große Tragweite haben. Dabei profitiert man von Routinen, Checklisten und Strategien, wie man persönlich mit Stress umgeht. Und auch wie man im Team kommuniziert.“
Im medizinischen Alltag finden zudem kaum Feedbackrunden statt. Während im Sport – um den Vergleich noch einmal heranzuziehen – Spielanalysen zum Standard gehören, gibt es diese in der Medizin kaum. Bei der IGNI wird jedes Training nachbesprochen. Offen und ehrlich. Lisa Kohler: „Bei uns gibt es keine Hierarchien. Ein Sanitäter kann einem Notarzt genauso Vorschläge und Ideen unterbreiten wie umgekehrt. Es geht um den Erfahrungsaustausch und manchmal ist ein anderer Blickwinkel nicht verkehrt. Im Alltag kommt das Feedback meist von oben nach unten. Damit bleiben viele Möglichkeiten ungenutzt.“ Die IGNI versucht dort Fortbildungsangebote zu schaffen, wo die Ausbildung der unterschiedlichen Organisationen endet, und damit

Im Herbst 2014 haben sich in der Notfallmedizin tätige und engagierte Sanitäter*innen und Medizinstudent*innen zusammengefunden, um über Möglichkeiten zur besseren Vernetzung und Fortbildung in Innsbruck zu sprechen. Man kannte sich zum Teil seit vielen Jahren aus dem Innsbrucker Rettungsdienst, es bestanden Beziehungen in die Einsatzorganisationen hinein und darüber hinaus, außerhalb traf man sich bei Fortbildungen, die es in Tirol nicht gab. Die Gemeinschaft wuchs, sodass am 31. Oktober 2016 offiziell ein Verein gegründet wurde. Damals umfasste die Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck (IGNI) bereits über 30 Personen. Es wurden Partnerschaftsabkommen mit allen Innsbrucker Einsatzorganisationen geschlossen, auf deren Verbindungen ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Das Angebot an Vorträgen, Workshops und anderen Veranstaltungen wuchs stetig, regelmäßig finden Trainings statt, bei denen die Mitglieder zusammenkommen, um gemeinsam ungezwungen zu üben und an ihren Skills zu arbeiten. Aktuell zählt der Verein über 250 Mitglieder aus den unterschiedlichsten (Fach-)Bereichen und Erfahrungslevels, vom Medizinstudenten bis zum Oberarzt. Einige davon sind seit dem Start weg dabei und mit dem Verein „mitgewachsen“. Sie sind selbst in der prä- und innerklinischen Notfallmedizin tätig und wollen Mitglied werden, Sie wollen den Verein finanziell, materiell oder mit Ihrer Expertise unterstützen oder sich weiter informieren? Einfach reinklicken unter www.igni.at

Jakob Gruber (li.), Assistenzarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und aktuell Vorsitzender der Interessengemeinschaft Notfallmedizin Innsbruck, mit seinen IGNI-Vorstandskolleg*innen Lisa Kohler, Medizinstudentin und Rettungssanitäterin, und Andreas Zoller, Assistenzarzt für Innere Medizin
Gutes noch besser zu machen. „Gut“ sollte in der Medizin nicht der Maßstab sein, findet Andreas Zoller: „Es geht um Entwicklung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, um den Aufbau solider Teamstrukturen und darum, Hierarchien zu überdenken. Grundsätzlich gut zu sein, ist nicht, was wir wollen. Wir möchten bestmögliche Leistung erreichen. Das geht nur mit regelmäßigem Training.“ Mittlerweile zählt IGNI über 250 Mitglieder und auch wenn es eine von jungen Menschen getragene Bewegung ist, bildet der Verein ein breites Spektrum von Menschen aus den unterschiedlichsten Positionen ab. Und der Verein wächst weiter – nach wie vor mit ausschließlich Freiwilligen, die unentgeltlich und in ihrer Freizeit daran arbeiten, ein System, das für uns alle essentiell ist, weiterzuentwickeln und besser zu machen.
EIN GROSSES DANKE
Generell spielt der Freiwilligenbereich in Österreich stärker als in vielen vergleichbaren Ländern eine zentrale Rolle im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Gründe, warum sich Menschen ehrenamtlich und freiwillig engagieren, sind meist eine Mischung aus altruistischen, persönlichen und sozialen Motiven. Es ist der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, aber auch jener nach persönlicher Entwicklung. Das Österreichische Gesundheitssystem wäre nicht, was es ist, wäre die intrinsische Motivation der dort Tätigen nicht derart hoch. Die Menschen hinter der IGNI leisten einen wertvollen Beitrag hin zu einem
„ES
KOMMUNIKATION IN ALLE RICHTUNGEN FUNKTIONIERT UND NICHT NUR VON OBEN NACH UNTEN GESCHEHEN DARF.“
Lisa Kohler
neuen Selbstverständnis in der Notfallmedizin – hin zu mehr Eigeninitiative, Vernetzung und kollegialer Unterstützung. In einer Zeit, in der die Anforderungen an die Notfallmedizin stetig steigen, ist die IGNI ein entscheidender Baustein: Sie füllt Lücken, die andere Strukturen bislang offenlassen, und beweist, dass die Gemeinschaft selbst den größten Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Disziplin leisten kann. Um das Gesundheitssystem im Allgemeinen und die Notfallmedizin im Speziellen voranzubringen, braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, Missstände offen ansprechen und die Aus- und Weiterbildung aktiv verbessern wollen. Die IGNI ist ein Beispiel dafür, wie das gelingen kann, und die Botschaft ist klar: Eine gute notfallmedizinische Ausbildung darf kein Zufall sein. Solche Initiativen verdienen definitiv mehr Sichtbarkeit und all unseren Respekt.

Als Steuerzentrale vieler lebenswichtiger Funktionen ist die Schilddrüse ein echtes Multitalent. Sie produziert Hormone, die folglich eine Reihe von unterschiedlichsten Vorgängen in unserem Körper regeln. Ist sie in ihrer Funktion gestört, kann dies zu Problemen führen – kleinen und richtig großen.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
ie Schilddrüse ist eine kleine, schmetterlingsförmige Drüse im Hals, die vor der Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes liegt und für den Körper eine ganz wesentliche Rolle spielt. Vorrangig produziert sie die Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), die in weiterer Folge den gesamten Stoffwechsel steuern. Die Schilddrüse bestimmt also mit, wie schnell oder langsam der Körper Energie verbrennt. Eine Überfunktion (Hyperthyreose) macht den Stoffwechsel zu schnell, eine Unterfunktion (Hypothyreose) zu langsam. Beides ist suboptimal. Um zu funktionieren, braucht die Schilddrüse unter anderem Eisen, Jod und Selen. Stehen diese nicht zur Verfügung, bekommt wiederum die Schilddrüse ein Problem. „Die Schilddrüse ist ein wichtiger Produzent in unserem Körper. Und ohne Produzent kein Produkt. So einfach ist das“, sagt Dr. Alexander Smekal, Schilddrüsenexperte und Konsiliararzt des Park Igls. Im Park Igls wird die fast unscheinbare Schilddrüse immer wieder zum Thema, vor allem, wenn es ums Übergewicht geht. „Übergewicht ist ein typisches Symptom einer Schilddrüsenunterfunktion“, erklärt Dr. Peter Gartner, Chefarzt im Gesundheitszentrum Park Igls. Im Umkehrschluss heißt das allerdings nicht, dass die Schilddrüse zwangsläufig an zu viel Gewicht schuld ist. „Manchmal wird sie auch ganz gern zum Sündenbock gemacht.“ Wann Gartner tatsächlich hellhörig wird, das haben wir nebst anderem im Doppelinterview erörtert.
ECO.NOVA: Was sind erste Anzeichen einer Schilddrüsenerkrankung? PETER GARTNER: Schilddrüsenerkrankungen sind oft gar nicht so eindeutig zu erkennen. Durch Abtasten lassen sich grobe Veränderungen der Drüse meist gut feststellen, beispielsweise ist ein Kropf ein deutliches, sichtbares Zeichen. Daneben gibt es eine Reihe sehr unspezifischer Symptome. Eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel kann zu Müdigkeit, Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Depressionen führen. Diese werden primär oft nicht auf eine Störung der Schilddrüsenfunktion zurückgeführt. Wir haben auch Gäste mit Fatigue, das seit der Pandemie meist auf eine Post-Covid-Erkrankung geschoben wird. Das mag in vielen Fällen

„Die Aufgabe der Schilddrüse ist es, Hormone zu produzieren, die unseren Stoffwechsel regulieren. Deshalb ist ihr Funktionieren so wichtig.“
ALEXANDER SMEKAL
stimmen, kann hingegen auch an einer Unterfunktion der Schilddrüse liegen. ALEXANDER
Dr. Alexander Smekal ist Nuklearmediziner und Radiologe mit ÖAK-Diplom für Orthomolekulare Medizin, Diagnose und Therapie sämtlicher Schilddrüsenerkrankungen, Geschäftsführer des Schilddrüsenzentrums Tirol sowie Konsiliararzt im Park.
SMEKAL: Diese Medaille hat tatsächlich zwei Seiten: Auf der einen Seite sehen wir Patienten, die aufgrund ihrer Symptome wie Übergewicht denken, sie hätten eine Schilddrüsenerkrankung, die letztlich keine ist. Auf der anderen Seite gibt es Krankheitsbilder, für deren Ursache die Schilddrüse nicht in Betracht gezogen wird, obwohl sie der Auslöser ist. Hier braucht es viel Fingerspitzengefühl und Achtsamkeit dem Patienten gegenüber.
GARTNER: Die Schilddrüse regelt den Energiestoffwechsel und damit auch unsere Emotionen. In dem Moment, in dem ein Patient überschießende Emotionen zeigt, könnte es sich theoretisch um eine Überfunktion handeln, Traurigkeit oder Konzentrationsschwächen könnten eine Unterfunktion anzeigen. Sobald ein Mensch aus dem emotionalen Gleichgewicht gerät, sollte man die Schilddrüse in seiner Diagnostik mitdenken.

„Die Funktion der Schilddrüse ist eng mit dem Darm verbunden –sowohl im gesunden als auch im krankhaften Zustand.“
PETER GARTNER
Welche Untersuchungen werden zur Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen durchgeführt? SMEKAL: Prinzipiell gibt es zur Diagnose drei große Ansätze. Mittels Ultraschall können wir die Schilddrüse sehen und strukturell beurteilen. Im Zuge laborchemischer Untersuchungen untersuchen wir nicht das Organ direkt, sondern dessen Produkte, die Hormone, und die so genannte Szintigraphie dient schließlich zur funktionellen Beurteilung und hilft dabei, Schilddrüsenknoten auszumachen.
Welche Parameter sollten im Zuge von Schilddrüsenscreenings gemessen werden? SMEKAL: Vielfach wird bei Screenings nur der TSH-Wert ermittelt, das so genannte Thyreoidea (= Schilddrüse)-stimulierende Hormon, nicht aber jene Hormone, die die Schilddrüse letztlich produziert, das T3 und T4. Der TSH-Wert allein hat allerdings überhaupt keine Aussagekraft, sondern ist nur der Regulator, über die Hormonsituation an sich sagt er nichts aus. Stellen Sie sich eine Schaf-
herde vor, die von einem Hirtenhund von A nach B getrieben werden soll. Die Schafherde will das nicht und bricht nach links und rechts aus. Der Hund ist also damit beschäftigt, ständig von einer Seite zur anderen zu rennen, um die Herde zusammenzuhalten. Betrachtet man nur den Hund, hat man keine Ahnung, was auf dem Feld vor sich geht. Man sieht zwar seine Bewegungen, weiß jedoch nicht, wo die Schafe sind. Nimmt man die mit ins Bild, ergibt alles plötzlich Sinn. So ist es mit dem TSH-Wert. Auch der macht nur gemeinsam mit den T3- und T4-Werten Sinn. Sie sollten obligat bestimmt werden und zum Standardlabor gehören.
Wie kann eine Moderne MayrKur die Schilddrüsenfunktion beeinflussen?
GARTNER: Der Darm steht bei allen unseren Diagnostiken und Behandlungen im Zentrum. Man weiß seit geraumer Zeit, dass ein gesundes Mikrobiom unseren Körper in vielerlei Hinsicht positiv beeinflusst. Wir wissen, dass es einen wesentlichen Zusammenhang
zwischen Darm und Haut oder den Gefäßen gibt. Es ist inzwischen belegt, dass zum Beispiel Arteriosklerose, bei der sich die Arterien zu verengen beginnen, eher ein Produkt unserer Darmbakterien ist und weniger des Cholesterinverzehrs. Mittlerweile weiß man außerdem, dass es neben der Darm-Hirn-Achse, mit der wir uns unter anderem in der eco. nova-Ausgabe vom Oktober 2024 beschäftigt haben, auch eine Darm-Schilddrüsen-Achse gibt. Dazu wurden inzwischen zahlreiche Studien in namhaften Journalen veröffentlicht. Sie zeigen deutlich, dass unser Mikrobiom die Funktion der Schilddrüse maßgeblich beeinflusst – und damit in weiter Folge unter anderem Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse wie Morbus Basedow oder Thyreoiditis Hashimoto. Eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht in den Darmbakterien, kann sogar mit einem erhöhten Schilddrüsenkrebsrisiko assoziiert sein. Es ist äußerst bemerkenswert. Ein gesunder Darm ist deshalb das Um und Auf und die Moderne Mayr-Kur ein äußerst probates Mittel dafür.
Sind Schilddrüsenerkrankungen entsprechend eine Folge von falscher Ernährung und einem schlechten Lebensstil oder können sie auch genetisch bedingt sein?
SMEKAL: Beides. Damit die Schilddrüse ihre Aufgaben erfüllen kann, braucht sie Mikronährstoffe wie Jod, Selen oder Eisen, die wir vorrangig durch unsere Nahrung aufnehmen. Hier spielt wiederum das Mikrobiom eine Rolle, das dafür verantwortlich ist, diese Stoffe zu resorbieren und dem Körper – in diesem Fall konkret der Schilddrüse – zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre Arbeit verrichten kann. Thyreoiditis Hashimoto, eine Entzündung der Schilddrüse aufgrund einer Fehlreaktion des Immunsystems, ist zum Beispiel häufig eine Folge chronischen Eisenmangels. Der Darm ist wesentlich für unser Immunsystem und damit auch Treiber sämtlicher Autoimmunerkrankungen. Veranlagungen für Autoimmunerkrankungen werden häufig vererbt. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Krankheit auch ausbrechen muss. Dafür braucht es einen externen Auslöser und den hat man oft selbst in Form seines Lebensstils in der Hand. GARTNER: Bei Hashimoto wissen wir zum Beispiel, dass ein solcher Trigger eine psychische Belastungssituation sein kann, also Stress. Hier können Programme wie unser De-Stress und die Moderne Mayr-Kur sehr gut helfen. Um eine schwache Schilddrüsenfunktion zu unterstützen, hilft auch die gezielte Gabe von Supplements. Diese sollte
jedoch unbedingt individuell abgestimmt und dosiert sein. Wichtig ist auch, die Schilddrüse in der Folge mit den entsprechenden Mikronährstoffen zu versorgen, um sie wieder bestmöglich zum Arbeiten zu bringen. In den meisten Fällen macht auch eine psychologische Begleitung Sinn. In unserem Haus stehen unseren Gästen dafür alle Türen offen. SMEKAL: Der psychologische Aspekt ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Zu mir kamen Patienten mit einer wenig fortgeschrittenen Thyreoiditis, die unter extrem hohem Stress standen. Als die Stressoren beseitigt waren, hat sich auch die Schilddrüse wieder merklich verbessert. Die negativen Veränderungen waren verschwunden und wir haben eine wunderschöne, reine Schilddrüse gesehen. Auch wenn es unmöglich ist, Thyreoiditis Hashimoto zu heilen, so können wir doch deren Verlauf positiv beeinflussen.
Kommen Gäste bereits mit einer entsprechenden Diagnose ins Park Igls oder handelt es sich um Zufallsbefunde? GARTNER: Die meisten Gäste kommen bereits andiagnostiziert. Meist wurde diese Diagnose aber nie nachhaltig kontrolliert. Dazu gibt es immer wieder Fälle, bei denen aufgrund der gezeigten Symptomatik anzunehmen
„Die Schilddrüse ist ein wichtiger Produzent in unserem Körper. Und ohne Produzent kein Produkt.“
ist, dass ein Problem mit der Schilddrüse vorliegen könnte. Dann veranlassen wir ein entsprechendes Laborscreening sowie eine Sonografie, ein hochauflösendes Ultraschallgerät haben wir ja im Haus. Anschließend entscheiden wir, ob es sinnvoll ist, Alexander Smekal für ein Konsil hinzuzuziehen und die Patienten zu ihm zu überweisen. So weiß der Patient genau, wo er steht und was der weitere Plan ist.
Welche Ursachen und Folgen haben Überbzw. Unterfunktionen der Schilddrüse?
SMEKAL: Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Thyreoiditis Hashimoto zum Beispiel ist eine Unterfunktionserkrankung, bei der die Schilddrüse dauerhaft angegriffen wird und sich entzündet. Die Ursache ist eine Fehlreaktion des Immunsystems, mit der Folge, dass die Schilddrüse nicht mehr genug Hormo-
ne bildet und sich der Energiestoffwechsel verlangsamt. Morbus Basedow hingegen ist eine Überfunktionserkrankung, bei der die Schilddrüse durch Auto-Antikörper dazu gezwungen wird, zu viele Hormone zu produzieren. Folgen sind Nervosität und Herzrasen, es kann sich eine Struma, also ein Kropf, bilden oder die Augen können hervortreten. Dramatischer ist eine Überfunktion, weil diese den Patienten tatsächlich in lebensbedrohliche Situationen bringen kann. GARTNER: Nicht wenige Schilddrüsenerkrankungen sind Autoimmunerkrankungen. Wir wissen, dass sich 70 bis 80 Prozent der immunkompetenten Zellen in der Schleimhaut des Dünndarms befinden. Das zeigt, wie wichtig ein gesunder Darm für ein funktionierendes Immunsystem ist. Je besser ausgeprägt dieses ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung.

WO STADT AUF NATUR TRIFFTUND LEBENSQUALITÄT ENTSTEHT
Innsbruck, Schützenstraße 35 a, b, c

Modernes Wohnen in zentraler Lage in Neu-Arzl 3 Baukörper, 37 Wohnungen, Gewerbefläche im EG 2 bis 4 Zimmer Wohnungen mit 39 bis 78 m² Wohnfläche barrierefrei für jede Lebensphase, hochwertige Ausstattung Gärten, Terrassen oder Loggien mit viel Privatsphäre Grünraumgestaltung mit Gemeinschaftsgarten Gemeinschafts-Dachgarten mit Biodiversitätsdach Parkplätze in der Tiefgarage nachhaltige Fernwärmeheizung zeitgemäße Photovoltaik Anlage zur Stromerzeugung Sonderwünsche möglich, schlüsselfertig & provisionsfrei
VERKAUFSSTART! KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER: Telefon: +43 5223 90 909, E-Mail: office@realbau.at





Wer sich eine bewegende und entspannende Auszeit vom Alltag gönnen will, findet im sonnenverwöhnten Bad Tatzmannsdorf neben gesundheitlicher Regeneration jede Menge Genuss- und Wohlfühlmomente.
TEXT: DORIS HELWEG
Zugegeben, Bad Tatzmannsdorf liegt für uns Tiroler nicht gerade ums Eck. Inmitten sanfter, dicht bewaldeter Hügel schmiegt sich der größte Kurort des Burgenlandes in die idyllische Landschaft. Seit Jahrhunderten wird der Ort für seine natürlichen Heilvorkommen Heilmoor, kohlensäurehaltiges Heilwasser und Thermalwasser von zahlreichen Gästen geschätzt und ist somit der einzige Kurort in Österreich, der mit gleich drei Heilmitteln aufwarten kann. Demzufolge dreht sich in Bad Tatzmannsdorf alles um die Themen Gesundheit, Regeneration, Wohlfühlen und Genuss. „Das Leben spüren“ lautet die Wohlfühlformel im beschaulichen Kurort, eine Thermen- und Saunavielfalt zum Abtauchen und ein breit gefächertes Hotelangebot mit komfortablen Thermenhotels für gehobene Ansprüche lassen keine Wünsche offen. Wir durften in vier Leitbetriebe der Region eintauchen. Allen voran haben der Tiroler Pionier in Sachen Wellnesstourismus Karl J. Reiter und seine Frau Nikola in Bad Tatzmannsdorf mit den Häusern Reiters Supreme und Reiters Finest Family einen – wie sie es selbst bezeichnen – „Zurückzugsort“ geschaffen, in dem sie mit Leidenschaft ihren Visionen
als Gastgeber von Herzen nachgehen und einen Place to be verwirklicht haben, der mit großzügigen Wellness- und Spa-Bereichen, kulinarischer Vielfalt und einzigartigen Golfangeboten unvergessliche Eindrücke und genussvolle Momente verspricht.
Mit einer weitläufigen Therme, die schon dreimal zur Wellnesstherme des Jahres gewählt wurde, und dem angeschlossenen 4-Sterne-Superior-Hotel wartet das AVITA Resort & Therme Bad Tatzmannsdorf auf. Insgesamt 15 Pools und 24 Wohlfühlsaunen erstrecken sich hier über ansprechende Innen- und Außenbereiche und sorgen für unvergessliche Wohlfühlmomente für jeden Anspruch und alle Altersgruppen.
KUR & MEHR
Gesundheit und nachhaltiges Wohlbefinden stehen im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf im Mittelpunkt. Neben den vier Kurhotels und dem Kurmittelhaus für stationäre Kuraufenthalte und Gesundheitsvorsorge-Aktivprogramme kann man sich in den beiden 4-Sterne-Superior-Häusern REDUCE Hotel Thermal und REDUCE Hotel Vital nach seinen individuellen Wünschen ganzheitlich verwöhnen lassen. Herrlich prickelnde Kohlensäurebäder oder ent-
spannende Moorpackungen in Kombination mit Thermalbädern und erholsamen Wellnessbereichen lassen Gäste die Hektik des Alltags vergessen und neue Energie tanken. Im kürzlich eröffneten BodyLAB steht neben einem Cardioscan und einer 3D-Körperanalyse auch eine Kältekammer für eine leistungsstarke Ganzkörper-Kryotherapie bereit. Die mit der grünen Haube ausgezeichnete Küche trägt ihr Übriges zur ganzheitlichen Regeneration bei, die insbesondere in den Herbstmonaten durch ein vielfältiges Wanderangebot ergänzt wird.
Mit einer ausgezeichneten Küche wartet auch das Hotel Simon auf, das von den Brüdern Matthias und Jakob Simon bereits in dritter Generation mit viel Liebe geführt wird und die ihren bunt gemischten Gästen die Freude und Leichtigkeit des Seins während ihrer Genusstage im sonnenverwöhnten Südburgenland näherbringen.
Nicht von ungefähr werden die meisten (Kur-)Gäste zu Wiederholungstätern und genießen die Gastfreundschaft mit vielen genussvoll entspannten Wohlfühlmomenten im charmanten Bad Tatzmannsdorf. Denn nichts ist so wohltuend wie eine ganzheitliche Auszeit, die man mit allen Sinnen genießen kann. bad.tatzmannsdorf.at
AB 07. NOVEMBER

Wie groß die Fortschritte bei der Brustkrebsbehandlung sind?
Warum das Endometriosezentrum der Uniklinik Innsbruck so außergewöhnlich ist?
Welche Tabus Marlies Raich (ehem. Schild) für junge Spitzen-Athletinnen bricht?
Wo die Schwachstellen in der Gesundheitsversorgung der Frauen in Tirol liegen?
Was bei Babynotfällen unbedingt beachtet werden muss?
Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in der zweiten Ausgabe und Podcaststaffel der medica.
Folgt uns auf Instagram oder unseren anderen Plattformen:

Seit seiner Einführung wurde Volkswagens T-Roc mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Nun steht der Nachfolger in den Startlöchern. Die komplett neu entwickelte zweite Generation des Bestsellers kommt mit innovativen Antrieben und hoher Wertigkeit daher. Der große Entwicklungssprung des Modells spiegelt sich dabei bereits im kraftvoll-cleanen Design wider, das sich die charakteristische T-Roc-DNA mit ihrem coupéartigen Heck bewahrt und sich gleichzeitig die Vorteile von zwölf Zentimetern mehr Gesamtlänge zunutze macht. Das sorgt nicht nur für mehr optische Dynamik, sondern auch für mehr Platz. Innen wurde das Cockpit neu designt, Blickfang ist definitiv der bis zu 13 Zoll große Infotainment-Screen, die Ambientebeleuchtung sorgt für Loungeatmosphäre. Das breite Spektrum an Assistenzsystemen und Technologien kennt man bis dato nur aus höheren Fahrzeugklassen. In Europa schickt Volkswagen seinen neuen T-Roc ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern auf den Markt, den Start markieren zwei 48-Volt-Mild-Hybrid-Antriebe mit 116 und 150 PS, zwei Vollhybride folgen. Aktuell sind die Modelle ausschließlich mit Frontantrieb zu haben, wie beim Vorgängermodell soll es zeitversetzt auch Allradversionen geben. Der T-Roc ist ab sofort bestellbar und samt Boni bereits ab 24.690 Euro zu haben.

Der Q3 von Audi war schon immer ein souveräner Allrounder für den Alltag. Das ändert sich auch mit der dritten Generation nicht. Außen zeigt sich das kompakte SUV-CoupéCrossover selbstbewusst und mit einer schönen Balance aus fließenden Kurven und präzisen Linien, im Interieur steckt richtig viel Charakter. Zahlreiche innovative Funktionen machen den neuen Ingolstädter außerdem zum perfekten digitalen Begleiter. Vor allem die Digitalisierung des Lichts sorgt dabei nebst zahlreichen Assistenzsystemen für hohen (Sicherheits-)Nutzen. Den Einstieg bildet ein 1.5 TFSI mit 150 PS und Mild-Hybrid-Technologie ab 46.900 Euro, die Topvariante S line mit 265 PS beginnt bei 65.900 Euro, Audi-typisch ist die Liste an Extras lang.
Mit dem EV4 präsentiert Kia seinen neuen kompakten Elektriker, mit dem die Koreaner scharf gezogene Linien mit markanter Technik verbinden. Die niedrige Motorhaube und die fließenden Formen sorgen für eine optimale Aerodynamik, zur Wahl stehen zwei Batterievarianten mit einer Kapazität von 58,3 bzw. 81,4 kWh, nach WLTP sind bis zu 630 Kilometer Reichweite machbar. Und auch sonst zeigt sich der neue Elektro-Kia maximal flexibel. Ab 39.590 Euro als klassischer Hatchback (Bild) und progressiver Fastback zu haben.


Mit seinem IONIQ 9 will Hyundai nichts weniger, als die Elektromobiliät neu definieren. In Sachen Platzangebot kriegt man das schon ganz gut hin, denn in die durchaus ansehnliche und selbstbewusste Karosserie wurden drei Sitzreihen gepackt, die tatsächlich angenehm Platz für sieben Personen bieten. Der Innenraum ist klug gestaltet, die Technik fortschrittlich. Die im Unterboden verbaute Lithium-Ionen-Batterie bringt eine Kapazität von 110,3 kWh mit, nach WLTP soll eine elektrische Reichweite von 620 Kilometern machbar sein. Geladen ist der IONIQ 9 in 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Das Basismodell kommt mit Heckantrieb und 218 PS (ab 69.990 Euro), bei der Allradversion kommen 95 PS über einen zusätzlichen Frontmotor dazu (ab 73.990 Euro).

Bei Leapmotor, einem chinesischen Autobauer, an dem mittlerweile Stellantis im Zuge eines Joint Ventures 51 Prozent der Anteile hält, sind mit Anfang Oktober über eine Million Fahrzeuge von Band gerollt und vor allem die Beschleunigung ist erstaunlich: Vom 500.000. Fahrzeug bis zum Auto mit der Nummer eine Million sind gerade einmal 343 Tage vergangen. Von Jänner bis August 2025 überstieg das kumulierte Auslieferungsvolumen des E-Auto-Start-ups 320.000 Einheiten. Das neueste Modell der Marke ist das vollelektrische Kompakt-SUV B10, das seit August auch hierzulande bestellbar ist. Nach der Markteinführung in China im April des Jahres gingen innerhalb von nur einer Stunde mehr als 10.000 feste Kundenbestellungen ein. Kein Wunder: Der Leapmotor B10 ist hübsch anzuschauen, technologisch top, vielseitig und intelligent und soll bis zu 435 Kilometer Reichweite erzielen. Und das bei einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro.

Erstmals Anfang der 1960er-Jahre auf den Markt gekommen, hat MINI Ende letzten Jahres die mittlerweile fünfte Generation seines beliebten Stadtflitzers lanciert und ist dabei weiterhin dem klassischen Verbrenner treu geblieben.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Eine prinzipientreue Optik, modernste Technologie im Innenraum und das legendäre Gokart-Feeling versprechen Fahrspaß pur. Wir durften den neuen MINI Cooper S als 3-Türer in der Classic-Trim-Variante – MINI nennt seine Ausstattungsvarianten Trims – testen. Das Exterieur zeigt sich dabei überaus charakterstark und doch eigenständig. So vereint das Design markante MINI-typische Elemente wie die eindeutig als solche zu identifizierende Flitzer-Silhouette und die Front mit ihrem cleanen oder, wie MINI selbst sagt, puristischen Look samt völlig neuinterpretierten, dreieckigen Matrixleuchten am Heck, die dem Gesamtkonzept einen futuristischen Ausdruck verleihen. Nachdem sich die optischen Neuerungen in Grenzen halten, legt das Exterieur einen gewohnt guten, MINI-typischen Auftritt hin. Das liegt nicht zuletzt an der schicken Außenfarbe Ocean Wave Green, die um ein Dach und Spiegelkappen in Weiß ergänzt wurde. Optional verpasst MINI dem Cooper S wie in unserem Fall noch LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen und drei wählbaren Lichtsignaturen an der Front sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.
RUNDUM RUND
Im Innenraum fällt der Blick – wie das beim Cooper schon lange der Fall ist – auf das rund ausgeformte, zentral platzierte Infotainment-
system. Ganz nach neuer Machart erhält der Cooper wie beispielsweise auch der Countryman erstmals ein völlig rundes OLED-Display mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern. Dessen Anzeige lässt sich nach Lust und Laune konfigurieren, über die MINI-typische Togglebar kann man dank voreingestellter sogenannter MINI-Experience-Modes auch das Ambiente im Cockpit durch ein Zusammenspiel mit Licht und Klang völlig frei je nach Stimmungslage individualisieren. Im Übrigen spart sich MINI durch das große Display auch ein Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad. Heißt als Konsequenz: Ohne optionales Head-up-Display wird die Geschwindigkeit nur am Zentraldisplay angezeigt, was dank seiner großen Anzeige allerdings nicht weiter problematisch ist. Auch sonst funktioniert die Bedienung sämtlicher Infotainment- und Fahrassistenten sowohl über Touch als auch Sprachbefehl einwandfrei.
Platz genommen wird im Cockpit auf im Classic Trim enthaltenen Sportsitzen, die mit einer Kombination aus Vescin und Stoff überzogen sind. Neben den insgesamt vier erhältlichen Trim-Paketen (Essential, Classic, Favoured und JCW) sind von XS bis XL weitere Ausstattungspakete bestellbar. Als Teil des L-Pakets erhält der Cooper S für einen Preis von 4.005 Euro beispielsweise ein Panorama-Glasdach, ein Head-up-Display und Harman-Kardon-Surround-Sound-System.
MINI COOPER S? GEFÄLLT UNS! BESONDERS FREUEN WIR UNS ÜBER DAS NACH WIE VOR EINZIGARTIGE GOKART-FEELING.


Antrieb: Front
Leistung: 150 kW/204 PS
Drehmoment: 300 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 6,6 sec
Spitze: 242 km/h
Verbrauch: 6,1 bis 6,4 l/100 km
Spaßfaktor: 9 von 10
Testwagenpreis: 41.628 Euro
GOKART- FEELING VOM FEINSTEN Wie das bei einem MINI sein soll, kommt auch im Cooper S der neuesten Generation absolutes Gokart-Feeling auf. Möglich macht das MINI-typische Fahrverhalten die Kombination aus wunderbarer Agilität, direkter Lenkung und kernigen Bremsen. Möglich macht das mitunter der Vierzylinder-Turbobenziner mit einer Systemleistung von 150 kW (204 PS) und einem maximalen Drehmoment von 300 Newtonmetern. So beschleunigt der 1.360 Kilogramm schwere MINI Cooper S in 6,6 Sekunden auf 100 km /h, Schluss ist erst bei 242. Den Verbrauch gibt MINI ab Werk mit ca. 6,4 Litern auf 100 Kilometer an, wenngleich die Realität bei sportlicher Fahrweise – und ein Cooper S lädt nun einmal gerne dazu ein – eher etwas nach oben tendiert. Übrigens: Neben dem Dreitürer mit einer Länge von unter 3,9 Metern gibt es auch eine Fünftürer-Variante mit knapp über vier Metern Länge. Das führt im Ergebnis zu einem angewachsenen Kofferraumvolumen (275 statt 210 Liter). Das legendäre Fahrverhalten sollte aber auch beim 5-Türer aufkommen. Als Dreitürer sind für den MINI Cooper S mindestens 32.950,20 Euro fällig, mit Classic Trim, L-Paket und 18-Zöllern beläuft sich die Summe unterm Strich auf insgesamt 41.628 Euro. Dafür gibt es nicht nur die erwähnten Zusatzausstattungselemente, sondern auch nahezu alle verfügbaren Fahrsicherheits- und Assistenzsysteme wie einen Driving Assistant oder auch Parking Assistant Plus.

Mit dem neuen #5 vollzieht Smart den konsequenten Schritt, sich von der ursprünglichen Firmenphilosophie des Kleinstwagens endgültig zu lösen.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Als unfassbar leistungsstarkes Topmodell nimmt der #5 BRABUS – wie schon die Modelle #1 und #3 – das Sportwagensegment ins Visier und angesichts der beeindruckenden Leistungswerte und der dynamischen Ausrichtung ist es durchaus wahrscheinlich, dass er das Segment kräftig aufmischt. Mit sportlich-elegantem Design, State-of-the-Art-Antrieb und einem Preis, der in dieser Leistungsklasse als kalkulierter Angriff auf die Premium-Konkurrenz gewertet werden muss, stehen die Zeichen für
einen wirtschaftlichen Erfolg ausgezeichnet. Wir sind das beeindruckende Ergebnis des 50:50-Joint-Ventures von Mercedes-Benz und Geely, das durch die BRABUS-Ingenieure den letzten, sportlichen Schliff erhielt, Probe gefahren.
AUS FÜR DEN AGILEN STADTWAGEN
Smart verabschiedet sich mit dem #5 endgültig von jeglichen Abmessungsängsten. Der #5 ist derart gewachsen, dass er seine Ahnen wohl nur noch von oben grüßt. Mit einer Länge von knapp 4,7 Metern, 1,9 Metern
Breite und 1,7 Metern Höhe gibt es keine Spur mehr von der alten Längspark-Legende. Der neue #5 tritt als ausgewachsenes SUV mit eindrucksvoller Präsenz auf. In der BRABUS-Variante steht er serienmäßig auf 21 Zoll großen Monoblock-Rädern – ein klares Statement in puncto Design. Dass es sich hier um die Top-Performance-Ausführung handelt, signalisieren die dezent, aber wirkungsvoll platzierten roten Bremssättel und weitere dynamische Akzente. Die Lichtsignatur vorne wie hinten sorgt dafür, dass man auch im Rückspiegel erkannt wird.
800 - VOLT-TECHNIK
Den Antrieb beim sportlich hochgezüchteten BRABUS bildet ein Dual-Motor-Gespann mit einer Systemleistung von 475 kW (646 PS) und einem maximalen Drehmoment von 710 Newtonmetern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt dank Launch-Mode in atemberaubenden 3,8 Sekunden. Das ist die Art von Beschleunigung, die man bei einem Smart nicht erwartet, allerdings sofort zu schätzen lernt. Bei 210 km/h endet der Vortrieb – eine dezente elektronische Begrenzung, die den Alltagseinsatz jedoch nicht limitiert. Ebenso beeindruckend wie die Beschleunigung ist der Ladevorgang, ermöglicht durch die moderne 800-Volt-Technologie. Die maximale Ladeleistung beträgt bis zu 400 kW. Damit lässt sich die 100 kWh große Batterie unter optimalen Bedingungen in lediglich 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Das sind Werte, die Geschäftsreisende und Langstreckenfahrer in dieser Klasse schlichtweg fordern und hier auch erhalten.
LUXUS - LOUNGE MIT
IT- INFRASTRUKTUR
Obgleich seiner Sportlichkeit unter der Haube, steht im Innenraum der Komfort im Vordergrund. Neben viel Technologie überzeugt der Innenraum mit großzügigen Platzverhältnissen. Sowohl Bein-, Schulter- als auch Kopffreiheit fallen auf den DINAMICA-Mikrofasersitzen trotz grundsätzlich humaner Abmessungen von außen mehr als großzügig aus. Man sitzt selbst mit annähernd zwei Metern immer noch wunderbar entspannt – und das auch im Fond. Selbiges gilt für die Ladeabteile (ja, Plural!). So bietet der #5 einen 47 Liter großen Frunk sowie ein Kofferraumvolumen von 630 Litern, das sich bei umgeklappter zweiter Sitzreihe


auf 1.530 Liter vergrößert. Gefühlsmäßig mutet das Auto innen sogar noch etwas größer an, wozu nicht unwesentlich das übergroße, per Knopfdruck abdunkelbare Halo-Panoramadach beiträgt. Zu den technologischen Highlights zählen unter anderem das Sennheiser-Signature-Sound-System mit 20 (!) Hochleistungslautsprechern und einem ausfahrbaren, zentralen Lautsprecher hinter dem Infotainment sowie die faszinierend große Bildschirmlandschaft. Das Infotainmentsystem besteht aus zwei 13 Zoll großen OLED-Bildschirmen, die sich über der Mittelkonsole beginnend fast bis zur Beifahrertüre erstrecken. Dank intuitiver Bedienung ist eine überlange Einlernphase zum Glück obsolet, wenngleich einige wenige Funktionen vielleicht etwas tiefer vergraben wurden. Obendrauf gibt es eine 10,25 Zoll große Full-HD-Instrumententafel und als ob das noch nicht genug wäre ein Augmented-Reality-Head-up-Display. Bedienen lässt sich das Ganze wahlweise
Antrieb: Allrad
Leistung: 475 kW/646 PS
Drehmoment: 710 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 3,8 sec
Spitze: 210 km/h
Reichweite (lt. WLTP): 540 km
Ladedauer (von 10 auf 80 %): 18 Min.
Spaßfaktor: 9,8 von 10
Preis: ab 64.000 Euro
über das mit BRABUS-Schriftzug versehene Multifunktionslenkrad, via Touch oder ganz komfortabel über die einwandfrei funktionierende Sprachsteuerung.
Erstaunlich intensiv bleibt uns das Fahrgefühl in Erinnerung. Kurz und knapp: Mit dem Smart #5 BRABUS lässt man selbst ausgewachsene Sportwägen mühelos stehen. Abzüge gibt es in Sachen Sportlichkeit lediglich bei der etwas legeren Lenkung und der etwas sperrigen Kurvenlage – die bei einem 2,4 Tonnen schweren SUV ohnehin nur eine Nebenrolle spielt. Überraschend ist vor allem das komfortable Fahrwerk. Fast schon unpassend, wenn man sich die Leistungswerte anschaut. Einmal gefahren, wird es der Rücken einem allerdings danken, insbesondere bei längeren Ausfahrten, und dafür ist der #5 ebenfalls gemacht. Das zeigt schon der Blick auf die Reichweite. So ermöglicht das SUV laut Datenblatt eine elektrische Reichweite von bis zu 540 Kilometern, bei realistischer Bedienung sind 420 Kilometer durchaus im Bereich des Möglichen. Und das im exklusiven BRABUS-Modus sogar mit musikalischer Untermalung durch simulierte Motorengeräusche.
Zu haben gibt es das schicke Sport-SUV in Österreich ab 64.000 Euro. Im Ergebnis also ein wunderbar gelungenes Auto zu einem vernünftigen Preis, das selbst von Mitfahrern in den Himmel gelobt wurde.
E-Mobilität ist ein Zug, der zwar noch nicht mit Höchstgeschwindigkeit fährt, jedoch nicht mehr aufzuhalten ist. Und so schreitet der Ausbau der E-Ladestationen der IKB mit der eigens dafür gegründeten e-laden Tirol GmbH (ELT) tirolweit mit großen Schritten voran.
INTERVIEW: DORIS HELWEG
Als heimische Energieversorgerin ist es der IKB ein großes Anliegen, für die Bevölkerung auch in Sachen E-Ladeinfrastruktur eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Die e-laden Tirol GmbH, eine Tochtergesellschaft der IKB, verantwortet diesen Geschäftsbereich. Lukas Wallner und Michael Salk leisten dabei als Geschäftsführer ganze Arbeit und treiben das Projekt E-Laden mit Höchstgeschwindigkeit voran. Wir haben die beiden zum Gespräch getroffen und zur aktuellen Lage und Herausforderungen befragt.
ECO.NOVA: Wie sieht die Ladeinfrastruktur in Tirol derzeit aus? LUKAS WALLNER: Die Ladeinfrastruktur in Tirol ist generell gut ausgebaut. Es gibt tirolweit derzeit über 4.400 Ladepunkte, davon sind fast 900 Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung > 50 kW. Die e-laden Tirol betreibt aktuell 420 Ladepunkte an 120 Standorten und der Ausbau wird stetig vorangetrieben. Die E-Mobilität ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Mit dem Ausbau der Ladestationen insbesondere im Schnellladebereich ist die Reichweitenangst mittlerweile unbegründet und auch preislich gleichen sich die E-Autos langsam an. Auch bezüglich Wartung und Instandhaltung ist der E-Motor mit etwa 20 Bestandteilen dem Verbrennermotor mit rund 700 beweglichen Teilen überlegen. Die Elektromobilität leitet eine Mobilitäts- und Energiewende ein, E-Autos sind umweltfreundlich, leise und effizient. Um den Nachhaltigkeitsaspekt noch zu untermauern, werden die ELT-Ladestationen aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen gespeist.
Wie geht der weitere Ausbau voran?
MICHAEL SALK: Zum einen erweitern wir die öffentliche E-Ladeinfrastruktur entlang der Inntalautobahn. Zum anderen bauen wir

auch den Ladebereich bei Einkaufscentern massiv aus, da hier das Auto sowieso für eine gewisse Zeit steht. In diesem Bereich möchten wir unsere Kooperation mit dem Lebensmittelhandel wie SPAR noch weiter vorantreiben. Damit wird Ladeinfrastruktur noch stärker in den Alltag integriert und Elektromobilität attraktiver gestaltet. Unser Ziel ist es, mit dem kontinuierlichen Ausbau und einem ausgewogenen Angebot von DC-Schnellladepunkten und AC-Ladestationen eine flächendeckende Infrastruktur in Tirol bereitzustellen. Um den Ladevorgang auch dann abwickeln zu können, wenn das Auto sowieso längere Zeit steht, werden neben dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur insbesondere auch individuelle Ladelösungen für Unternehmen und Mehrparteienhäuser forciert.
Wie gestalten sich Ihre angesprochenen individuellen Ladelösungen für Unternehmen? LW: Ganz nach dem IKB-Motto „Eins für alle“ liefert die e-laden Tirol GmbH maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, beginnend von der Beratung, Planung und professionellen Installation der leistungsfähigen und modernen E-Ladestationen bis hin zur fahrzeugspezifischen Abrechnung von Mitarbeitenden oder Gästen. Wir übernehmen mit unserem Produkt „e-laden@home business“ auch die Abrechnung für das Personal gemäß der Sachbezugsverordnung und entlasten damit die jeweilige HR-Abteilung. Dies ist auch möglich, wenn die Ladestation zu Hause nicht von uns errichtet wurde. Mit einem intelligenten Lastmanagement zur Reduktion von Leistungsspitzen und einer Schnittstelle für die Integration in das Energiemanagement-System des Unternehmens wird ein weiterer Beitrag in Richtung nachhaltigem Energiemanagement geleistet. Zudem kann das Unternehmen die Ladestationen auch für öffentliches Laden bereitstellen und unsere Mitarbeiter-Ladekarte funktioniert auch bei all unseren öffentlichen Ladepunkten und
„MIT
DEM AUSBAU DER LADESTATIONEN INSBESONDERE IM SCHNELLLADEBEREICH IST DIE REICHWEITENANGST MITTLERWEILE UNBEGRÜNDET.“
Lukas Wallner
Partnerladestationen. Wir möchten E-Mobilität für unsere Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich gestalten.
Ein großes Manko in den Anfangszeiten waren Lademöglichkeiten in Mehrparteienhäusern. Welche Lösung bieten Sie Hausgemeinschaften? MS: Wir haben gut funktionierende Gemeinschaftslösungen entwickelt, die aktuell schon bei vielen Mehrparteienanlagen in Betrieb und bei weiteren in Vorbereitung sind. Von der Beratung, der Planung und Umsetzung bis zur professionellen Installation der gesamten Infrastruktur mitsamt der Wallboxen sowie der automatischen Abrechnung der Ladevorgänge mit der IKB-E-Ladekarte kommt dabei alles aus einer Hand. Bei Bedarf leisten wir auch Hilfestellung bei der Abwicklung von Förderungen. Sei es im Neubau oder als Nachrüsten bei Bestandswohnbauten, durch eine intelligente Steuerung der Ladepunkte und ein faires Lastmanagement können wir ein optimales Laden garantieren. Insbesondere beim Nachrüsten gilt es natürlich alle Brandschutzvorgaben zu erfüllen, wobei in Summe die Brandgefahr beim E-Auto geringer ist als bei einem Verbrennermotor.
Mit der IKBLadekarte hält die IKB ein sehr kundenfreundliches Konzept bereit. Wie genau funktioniert das Laden mit der IKBLadekarte? LW: Unser größtes Ansinnen ist ein unkompliziertes Handling für unsere Kundinnen und Kunden. Wir gewähren aktuell einen Tarif von 0,39 Cent/
„ZUM EINEN ERWEITERN WIR DIE ÖFFENTLICHE E-LADEINFRASTRUKTUR
ENTLANG DER INNTALAUTOBAHN. ZUM ANDEREN BAUEN WIR AUCH DEN LADEBEREICH BEI EINKAUFSCENTERN MASSIV AUS.“
Michael Salk
kWh für AC-Ladungen und 0,54 Cent/kWh für DC-Ladungen an all unseren eigenen Ladepunkten. Bei all unseren Ladestationen ist es möglich, mittels QR-Code einfach mit einer Kreditkarte oder Paypal zu bezahlen.
Wie funktioniert die IKBLadekarte im Rest von Österreich? LW: Salopp gesagt, kann man mit der IKB-Ladekarte an jedem zweiten Ladepunkt in Österreich laden. Dies bedeutet, dass man mit der IKB-Ladekarte österreichweit an derzeit über 13.000 Ladepunkten problemlos laden kann – und auch der Ausbau von Ladestationen unserer Partnerinnen und Partnern geht genauso stetig weiter, sodass das Ladeangebot täglich wächst. PR
Sauber, günstig und nachhaltig vor Ort erzeugt: Bei den ELT-Ladestationen wird Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen eingespeist.


Nach über vier Jahrzehnten als feste Größe in der deutschen HighEnd-Fashion-Szene expandiert EMERSON RENALDI erstmals über die Landesgrenze hinaus: Im September eröffnete der dritte Store des Luxusmodehauses in Telfs und mit ihm nach Nürnberg und Augsburg der erste Standort außerhalb Deutschlands. In wirklich lässigem Ambiente unter einer beeindruckenden Glaskonstruktion präsentieren die Geschwister Lloyd und Olivia Pfeiff sowie Olivias Ehemann Jacopo de Manzolini fein kuratierte Mode internationaler Luxuslabels. emerson-renaldi.com
Mit ihrer ersten Einzelausstellung „STOFF in flagranti“ verwandelt die junge Osttiroler Künstlerin Alena Schneider das RLB Atelier in Lienz in eine bunte Kulisse. Perfekt, wenn̕s draußen unwirtlich wird. Stoffe und Körper werden dabei zu lebendigen Protagonisten einer kunstvollen Installation. Dabei ziehen sich Assoziationen zum Freibad wie ein roter Faden durch die Ausstellung: ein Ort sommerlicher Freiheit zwischen Gossip, Spaß und sportlicher Kürze. Zu sehen noch bis 20. November 2025.
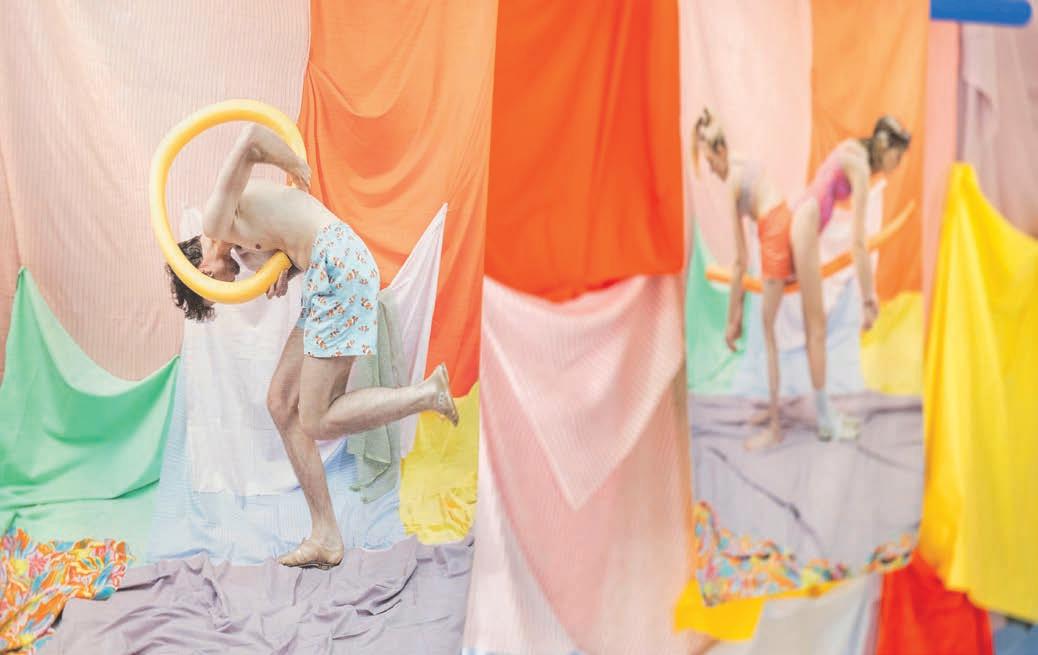

Achtung: Auch heuer fällt Weihnachten wieder auf den 24. Dezember. Es ist also durchaus an der Zeit, sich über passende Geschenke Gedanken zu machen. Mit dem 1. Dezember beginnt dabei die offizielle Vorweihnachtszeit mit dem Öffnen des ersten Türchens des Adventkalenders. Und für einen solchen ist man nie zu alt! Mittlerweile gibt es zum klassischen Schokikalender zahlreiche Alternativen und jene von Loberon mögen wir ganz besonders. In jedem Päckchen findet sich eine wunderbare Winterüberraschung von der Dekoschale in Nussknackeroptik bis zum Schneeflocken-Teelichthalter. Daher kommt der Kalender als lässig-elegante Box, aus der man jeden Tag ein kleines Geschenk herausnimmt. Limitierte Auflage, erhältlich unter www.loberon.at um 198 Euro.
Die Berufsgruppe Tiroler Bäder der Wirtschaftskammer Tirol zog kürzlich Bilanz über die vergangene Sommersaison 2025. Die zeigt sich trotz Wetterkapriolen zwar zufriedenstellend, die wirtschaftliche Situation für die Betriebe bleibt aber angespannt. Die Umsätze konnten – vor allem durch Tarifanpassungen – leicht gesteigert werden, die hohen Energie- und steigenden Personalkosten drücken allerdings auf das Ergebnis. Hinzu kommen notwendige Sanierungen und laufende Instandhaltungen, die viele Betriebe zusätzlich belasten. Dafür stellt das Land Tirol bis 2029 insgesamt 75 Millionen Euro zur Verfügung, 50 Millionen für Neubauten und Sanierungen sowie 25 Millionen für laufende Betriebszuschüsse. Der Bedarf übersteige laut Berufsgruppensprecher Michael Kirchmair die Fördersumme jedoch deutlich. Für die kommende Wintersaison zeigen sich die Tiroler Bäder indes optimistisch. Im vergangenen Winter stagnierte die Zahl der Eintritte, heuer hofft man auf eine Steigerung.
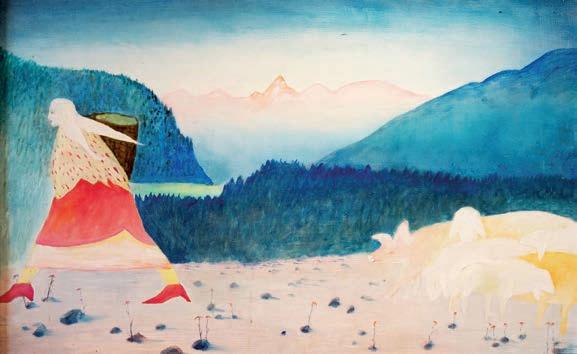


Die Kunst von Dora Czell (Ölbilder auf Holz, oben) und Elisabeth Ehart-Davies (Keramik, darunter) hat sich nie dem Zeitgeist angebiedert und dadurch ihre Glaubwürdigkeit bewahrt. Sie ist subtile Gesellschaftskritik und widersetzt sich vorherrschenden Kunstmarkttendenzen. In einer sich ständig wandelnden Welt lassen sich die beiden Künstlerinnen nicht verbiegen – trotz Gegenwind.
Aktuell treffen in der Innsbrucker Galerie Nothburga in der Ausstellung „Gegenwind“ die Arbeiten der Oberländer Künstlerinnen Dora Czell und Elisabeth Ehart-Davies aufeinander. Auch wenn ihr Zugang ein höchst unterschiedlicher ist, so eint die beiden ihre Liebe zur Natur, ihre Erdung und Authentizität. Dora Czells Bilder sind realistisch gemalt, oft mit der akribischen Genauigkeit alter Meister, verknüpft mit dem freien Schweifen der Fantasie oder mit ungewohnten und überraschenden, schönen Kombinationen, die zum Nachdenken anregen sollen: „Meine Bilder sind friedliche Bilder, Bilder der Liebe zur Natur, der Liebe zwischen Menschen. Doch in den letzten Jahren geschieht so viel Unrecht auf dieser Welt – wir haben das Recht bzw. die Pflicht zum Ungehorsam, wenn Unrecht geschieht.“ Auch Elisabeth Ehart-Davies beschäftigte sich erst mit der Malerei, ehe sie ihren Zugang zum keramischen Gestalten entdeckte. In der Ausstellung zeigt sie eine Bandbreite von einfachen Gefäßformen bis zu Figuralem, verweist auf Diversität und Verletzlichkeit und formt ihren Wunsch nach Frieden. „Die Keramik ist einerseits wortwörtlich das geerdetste Material, andererseits lässt es die Künstlerin mit abstrakten, aber dennoch fließenden und lebendigen Formen spielen“, sagt Tochter Sarah Davies. Die Ausstellung ist noch bis 8. November zu sehen und schließt mit dem dialog.gegenwind um 16 Uhr anlässlich der Premierentage (www.premierentage.at).
GALERIE NOTHBURGA, Innrain 41, 6020 Innsbruck, info@galerienothburga.at, www.galerienothburga.at Mi. bis Fr. von 16 bis 19 Uhr, Sa. von 11 bis 13 Uhr Ausstellungsdauer: 14. Oktober bis 8. November

„Innsbruck steht für ein 360° alpin-urbanes Erlebnis und eine sportlichrelaxte Atmosphäre. Es zeigt sich als weltoffene und verbundene Stadt, als ökologischer Vorreiter und Wissens-Hub.“ Auf dieses Zukunftsbild bauen die vielfältigen Aktivitäten des Stadtmarketing Innsbruck als Hüterin der Marke. Wir haben Mag. Heike Kiesling getroffen und mit ihr über unsere einzigartige Stadt und wie man das Lebensgefühl spürbar macht, gesprochen.
INTERVIEW: DORIS HELWEG
ECO.NOVA: Sie haben nach langjähriger Erfahrung in internationalen Unternehmen im August 2022 die Leitung des Stadtmarketing Innsbruck übernommen. Was reizt Sie persönlich an dieser Aufgabe?
HEIKE KIESLING: Ich finde diese Stadt einfach faszinierend. Innsbruck ist einzigartig und für mich persönlich die attraktivste Stadt in Österreich. Diese Gegensätze der alpin-urbanen Lebenskultur prägen das Stadtleben und machen die Aufgabe unglaublich spannend.
Wie sind Sie Ihre Aufgabe als Markenbotschafterin von Innsbruck angegangen? Zuerst habe ich einige Wochen und Monate viel zugehört, die Stadt mit ihren Stakeholdern und Bürger*innen in all ihren Facetten kennengelernt, versucht, ihre Dynamik und Vernetzungen zu verstehen. In einer Markenbefragung haben wir eruiert: Wie lebt die Marke? Wie steht die Bevölkerung dazu? Dabei hat sich herausgestellt, dass die Marke an sich eine unglaubliche Stärke hat, mit dem Potential, noch lebendiger und emotionaler zu werden. Eine Marke ist ein dynamisches Gebilde, das immer wieder hinterfragt werden muss. Passt sie noch zu den aktuellen Entwicklungen und dem Status quo der Stadt? Und so haben wir in einem ersten Schritt analysiert, welche Leistungsmerkmale vorhanden sind, wie wir diese mit emotionalen Elementen besetzen und diese alpin-urbane Lebensfreude transportieren können.
„Neben einer pulsierenden Innenstadt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch in die Stadtteile zu gehen und vor Ort Netzwerke zu schaffen.“
Was macht unsere Landeshauptstadt so einzigartig? Die alpin-urbanen Gegensätze machen das Leben bei uns aus. Ich kann mit dem Rad zur Skipiste fahren und danach mit den Sportklamotten neben Business-Outfits in der Stadt shoppen gehen oder einen Drink genießen. Das gibt es sonst nirgends. In unserer Arbeit geht es darum, wie man diese Gegensätze verbindet. Innsbruck ist eine Stadt der kurzen Wege. Von der Innenstadt zum Flughafen in weniger als 15 Minuten, die alpine Bergwelt mit all ihren Sportmöglichkeiten zum Greifen nah und dennoch ist Innsbruck neben dem Tourismus auch ein extrem attraktiver Wirtschafts- und mit fünf Universitäten und rund 38.000 Studierenden Wissenschaftsstandort. Das alles macht Innsbruck zu einer einzigartigen Stadt.
Wie sieht das Zukunftsbild der Stadt Innsbruck aus? Wir haben das Zukunftsbild der Stadt Innsbruck so formuliert: „Gemeinsam gestalten wir den zukunftsfähigsten Lebens-
raum Europas, dessen Anziehungskraft alpin-urbane Lebensfreude ist.“ Das ist natürlich ein hehres Ziel. Denn Lebensfreude ist ein sehr individuelles und persönliches Empfinden, das nicht für jeden gleich ist. Es geht darum, wie man die alpin-urbanen Gegensätze verbinden kann, unsere hohe Lebensqualität in einer sicheren Stadt der kurzen Wege erlebbar machen und das große Ganze mitgestalten kann. Wir wollen die Bevölkerung auf diese Reise mitnehmen und mit ihr das alpin-urbane Lebensgefühl feiern. Dazu bieten sich zahlreiche öffentliche Plätze an, die wir bespielen können – wie die Altstadt, die Maria-Theresien-Straße, der Marktplatz und künftig nach der Neugestaltung auch der Bozner Platz, der in Verbindung mit dem RAIQA als Tor zur Innenstadt komplett neu aufgeladen wird. Hier wird ein öffentlicher städtischer Raum mit Konsumzonen und konsumfreien Aufenthaltszonen zu einem völlig neuen Lebensraum. Wir gehen aber mit unseren Aktivitäten auch in die einzelnen Stadtteile.

„Innsbruck ist einzigartig und für mich persönlich die attraktivste Stadt in Österreich.“
Sie wurden bereits als Hüterin der Marke Innsbruck bezeichnet. Was möchten Sie mit Ihren Aktivitäten im Stadtmarketing bewirken? Wir haben im Innsbruck Marketing die Ehre, die Marke Innsbruck zu besitzen und das Management der Marke mit Leben zu füllen. Wir sind die Lizenzgeber und arbeiten mit unseren Hauptkooperationspartnern Innsbruck Tourismus und der Stadtverwaltung eng zusammen. Unser Hauptaugenmerk richtet sich jedoch auf die Bürger*innen und Wirtschaftstreibenden in Innsbruck, um mit ihnen das städtische Leben noch lebendiger und emotionaler zu gestalten. Urbanität umfasst mehr als Gebäude und Straßen – sie entsteht aus Infrastruktur, sozialem und kulturellem Miteinander sowie der gestalterischen Qualität des öffentlichen Raums. Unser Ansinnen ist es, den Menschen die „alpin-urbane Lebensfreude“ bewusst zu machen, Impulse zu setzen, dieses Lebensgefühl in die Stadt zu bringen. Wir möchten die Menschen einladen, diese Lebensfreude mit uns im öffentlichen Raum zu feiern. Und das machen wir mit zahlreichen Veranstaltungen, die mit kostenlosem Zugang das ganze Jahr über stattfinden und unglaublich gut angenommen werden.
Kürzlich wurde bei der Shopping Night in Innsbruck wieder begeistert gefeiert. Auf
welche Veranstaltungen können sich die Innsbrucker*innen noch freuen? Wir sind sehr dankbar für das Commitment der Gesellschafter, uns auch im nächsten Jahr wieder alle Veranstaltungen zu ermöglichen. Das beginnt beim Innsbrucker Bergsilvester, das neben unseren Bürger*innen auch zahlreiche Gäste anlockt, in unserer schönen Stadt zu feiern, und geht weiter mit dem Familienfasching am Faschingsdienstag, der zweimal jährlich stattfindenden Shopping Night, dem Bridge Beat Festival oder dem Bogenfest, um nur einige zu nennen. Ein wesentlicher Bestandteil sind auch unsere Stadtteilfeste, die sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt haben. Im Oktober fand in St. Nikolaus das Stadtteilfest „Anpruggen“ statt, das sich ähnlich dem Bogenfest zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.
Die Stadtteilfeste erfreuen sich großen Zustroms. Was macht diese so besonders? Neben einer pulsierenden Innenstadt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch in die Stadtteile zu gehen und vor Ort Netzwerke zu schaffen. Dieses neue Zusammenwirken zeigt sich im gesamten Stadtteil, was man beispielsweise an der positiven Veränderung der Bogenmeile durch das Bogenfest gut sehen und spüren kann. Mit dem gemeinsamen Ziel, den Menschen eine gute
Zeit zu bescheren, ist ein verbindendes Miteinander aller Beteiligten entstanden, das von der Start-up-Szene über die Betriebe bis hin zur Kirche, der Ferrarischule und der ÖBB reicht. Durch das Bogenfest, das vom Kind bis zum Pensionisten tausende Besucher anlockt, wurde die früher gemiedene Gegend zu einer sehr attraktiven, spannenden und aufgewerteten Meile. Das Gleiche geschieht gerade in St. Nikolaus mit „Anpruggen“. Die Stadtteilfeste bringen nicht nur die Bürger*innen zusammen, sondern schaffen auch eine bessere Vernetzung und ein verständnisvolleres Miteinander der Wirtschaftsbetriebe und Institutionen im jeweiligen Stadtteil.
Sie haben von Innsbruck als attraktivem Wirtschaftsstandort gesprochen. Was macht Innsbruck diesbezüglich stark? Neben einer unglaublich starken Unternehmensstruktur mit einer Vielfalt an handwerklichen Betrieben in den städtischen Mischgebieten gehört auch das Gewerbegebiet Rossau mit rund 1.000 Arbeitgebern und über 13.000 Beschäftigten zur Stadt Innsbruck. Um dem dynamisch gewachsenen „Stadtteil“ mehr Struktur zu verleihen und den dort ansässigen Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, haben wir vor zwei Jahren im Auftrag der Stadt das Quartiersmanagement Rossau ins Leben gerufen, das als niederschwellige Schnittstelle zwischen allen Akteur*innen fungiert und sich bereits bestens etabliert hat. Wir moderieren und managen das Netzwerk zwischen Unternehmer*innen, Grundstückseigentümer*innen, Politik, Stadt und städtischen Einrichtungen, Wirtschaftskammer Tirol, Standort- und Energieagentur Tirol und anderen relevanten Organisationen. Unser Ziel ist dabei die Stärkung der Rossau als attraktives und zukunftsorientiertes Wirtschaftszentrum.
Ihr Fazit nach gut drei Jahren als Markenbotschafterin in Innsbruck? Das große Netzwerk, das wir uns aufgebaut haben, der aktive Dialog mit allen Kooperationspartner*innen und Akteur*innen in der Stadt und der rege Zustrom zu all unseren Events zeigt, dass wir ein authentisches und belastbares Miteinander in der Stadt gestalten dürfen. Das Ergebnis sind viele sich gegenseitig stärkende Projekte, Ideen, Veranstaltungen und eine verbindende Identifikation in der Stadt. Innsbruck hat viele Stärken, die nicht selbstverständlich sind, und ich bin dankbar, sie bewusst machen und sie feiern zu dürfen.
Mit der Eröffnung der Kinderkrippe „Wabini“ im neuen RAIQA setzt die Raiffeisen-Landesbank Tirol gemeinsam mit ihren Partner*innen Tiroler Wohnbau, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und UNIQA ein klares Bekenntnis zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die RLB-Tirol-Vorstände Gabriele Kinast (2. v. li.), Christof Splechtna (3. v. li.) und Thomas Wass (5. v. li.) mit den Partnern Michael Zentner (UNIQA, li.), Helmuth Müller (IKB, 4. v. li.) und Christian Switak (Tiroler Wohnbau, re.).
Seit September 2025 werden in der neuen Einrichtung am Raiffeisenplatz 4 in Innsbruck Kinder im Alter von ein bis drei Jahren liebevoll und flexibel betreut – und das ganzjährig, ganztägig sowie mit individuell anpassbaren Betreuungsmodellen. „Die Raiffeisen-Landesbank Tirol hat in den vergangenen Jahren bereits viele wichtige Schritte gesetzt, um ein familienfreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Die Eröffnung einer eigenen Kinderkrippe ist nun eine logische Weiterentwicklung dieser Strategie – und ein klares Bekenntnis zu den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter*innen“, betont Thomas Wass, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Landesbank Tirol. Die neue
Kinderkrippe im RAIQA entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinderkrippe Wabini“, der die pädagogische Leitung übernimmt. Gemeinsam mit der Tiroler Wohnbau, der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und UNIQA konnte ein zukunftsweisendes Projekt realisiert werden. „Wir beteiligen uns gerne an der Kinderkrippe, denn sie stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bietet auch unseren Mitarbeiter*innen ein wertvolles Betreuungsangebot“, erklären die Partnerunternehmen unisono.
FLEXIBLES BETREUUNGSKONZEPT Neben modern ausgestatteten Räumlichkeiten erwartet die Kinder ein Spielplatz
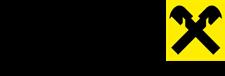



Wabini-Leiterin Jacqueline Fankhauser und Architektin Brigitte Eckelt (re.)
und ein flexibles Betreuungskonzept, das sich an den realen Bedürfnissen berufstätiger Eltern orientiert. Besonders attraktiv: Die Anmeldung für Nachmittagsbetreuung und Mittagessen ist auch kurzfristig möglich – ein echter Mehrwert für Eltern mit dynamischem Arbeitsalltag.
Mit der neuen Kinderkrippe stärken die Raiffeisen-Landesbank Tirol, die Tiroler Wohnbau, die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und UNIQA nicht nur ihre Position als verantwortungsvolle Arbeitgeber*innen, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur sozialen Infrastruktur im RAIQA und zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Tirol. PR

Wenn es draußen winterlich wird, ruft ein feiner Lebkuchen förmlich nach einem gemütlichen Moment. Mit jenen von der Konditorei Peintner wird’s so richtig behaglich. Die sind auch das perfekte Geschenk – das man sich natürlich gern selbst machen kann. Oder man hüllt es in ein individuelles Verpackungsdesign, für das persönliche Stück vom Glück als kleine Aufmerksamkeit.


Lebkuchen sind einfach unschlagbar und vereinen den perfekten Mix aus süß und würzig. Zimt, Nelken und Kardamom zaubern dabei ein wohlig-winterliches Gefühl. Die weiche Konsistenz trifft auf eine knusprige Glasur oder Schokolade, was jedem Bissen seine ganz besondere Textur und dezenten Knack verleiht. Lebkuchen bringen uns in Weihnachtsstimmung und wecken Kindheitserinnerungen. Und das Beste? Es gibt sie in so vielen Variationen, dass für jeden etwas dabei ist. Aus der Konditorei Peintner kommen gleich zehn verschiedene Sorten – mit viel Liebe, Geduld und höchster Handwerkskunst nach alten Familienrezepten in der Lebkuchenmanufaktur gefertigt und behutsam immer wieder neu interpretiert. Tradition und Moderne treffen kaum wo genussreicher zusammen. Hinein dürfen nur die besten Zutaten. Die meisten Grundzutaten kommen aus der Region, vieles wird in der Konditorei selbst hergestellt. Die exzellenten Füllungen zum Beispiel, bei denen die jeweilige Frucht wunderbar am Gaumen erkennbar ist, oder die himmlischen Schoko-

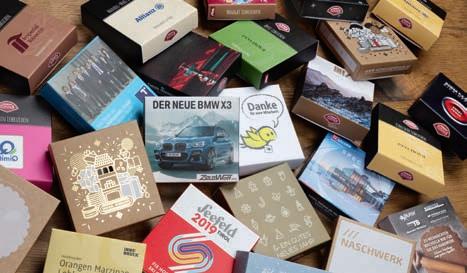
lade- und Trüffelcremen, die den Lebkuchen überziehen – süß, aber nicht aufdringlich. Einfach perfekt.
SCHENKEN MACHT FREU ( N ) DE Auch wir können es kaum erwarten, wenn Anfang November in der Manufaktur wieder die Arbeit aufgenommen wird und sich der sommerliche Frozen-Yoghurt-Store in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße folglich in Peintner’s Lebkuchen-Store verwandelt, in dem all die Köstlichkeiten zum Verkosten einladen. Dann suchen wir wieder unsere liebsten Sorten für unsere Kund*innen und Geschäftspartner*innen aus. Quasi selbstredend muss jede einzelne davon von unseren Mitarbeiter*innen getestet werden. Auf Wunsch werden die zarten Lebkuchen in ein individuell gebrandetes Design verpackt und so ein noch persönlicheres – und rundum genüssliches – Präsent. Das Verpackungsdesign können Unternehmen selbst kreieren, wer es noch einfacher haben möchte, legt es vertrauensvoll in die Hände der Familie Peintner, die sich von der Auftrags-
erteilung an vom Design bis zur Logistik um alles kümmert. Für eine genussreiche Vorweihnachtszeit ohne Stress. PR

Persönlich verkosten kann man die saisonalen Feinheiten aus der Lebkuchenmanufaktur im Schokoladen- und Lebkuchen-Store in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. Hier kann man sich bequem und unkompliziert durchs Sortiment kosten, seine persönliche Lieblingssorte(n) entdecken und natürlich auch gerne weiterschenken. www.konditoreipeintner.at peintner.tirol
Peintner Manufaktur







Li.: Alfred Müller (Schuldirektor i. R. Zillertaler Tourismusschulen), Peter Paul Mölk (Obmann TVB Innsbruck), Bellutti-Geschäftsführer Michael Arnold, Raimund Flörl (Vizebürgermeister a. D. Fügenberg) und Klaus Exenberger (Bergbahnen EllmauGoing) // Re.: hinten: Christian Mayerhofer und Stefan Kleinlercher (Congress Messe Innsbruck), Roland Weinhart (LUBCON), Manuela Schallhart (XBuild) und Jürgen Pichler (Doppelmayr), vorne: Dietmar Kratzer (alps.sens), Tobias Rieser (XBuild) und Kamran Kiafar (alps.sens)
SCHÖNES
Die INTERALPIN feierte im Mai 2025 50 Jahre „Peak Experience“ und damit ein halbes Jahrhundert Innovation, Wachstum und internationale Themenführerschaft in alpinen Technologien. Über 650 Aussteller*innen aus mehr als 50 Nationen präsentierten ihre Neuheiten in Sachen Seilbahntechnologien, nachhaltiger Beschneiung oder digitaler Betriebs- und Sicherheitslösungen. Rund 36.800 Fachbesucher*innen aus etwa 130 Ländern nutzten die Gelegenheit zum intensiven Austausch. Nach dem Gipfelerlebnis ging es bei der INTERALPIN Golftrophy sportlich weiter. Der Sportevent ist über die Jahre bereits zu einem festen Treffpunkt für die Seilbahn- und Tourismusbranche geworden und auch heuer genossen wieder rund 60 Teilnehmer*innen beste Platzbedingungen. Den Nettosieg sicherte sich der 5erFlight mit Kamran Kiafar, Manuela Schallhart, Tobias Rieser, Dietmar Kratzer und Roland Weinhart. Bruttosieger wurden Johannes Wiedorfer, Florian Heigl, Johann-Benedikt Koller, Volker Miklautz und Claudia Schneeberger. Die Auszeichnung „Nearest to The Pin“ konnten Alois Raich und Martin Dolezal für sich erspielen. Die siegreichen Teams wurden anschließend im Olympia Golfclub Igls gebührend gefeiert. Die 26. INTERALPIN findet vom 20. bis 23. April 2027 statt.


Marcus Hofer (Geschäftsführer der Standortagentur Tirol), Hermann Hauser (Schirmherr des Hermann Hauser Frontier Labs), Jasmin Güngör (Geschäftsführerin Onsight Ventures) und Klaus Grössinger (Geschäftsführer Onsight Ventures)
Im September wurde Innsbruck fünf Tage lang zum Schauplatz der internationalen Innovationsszene: 20 internationale Start-up-Gründer*innen aus sechs Ländern trafen sich beim ersten Hermann Hauser Frontier Lab, organisiert von der Standortagentur Tirol und Onsight Ventures. Geboten wurde ein praxisnahes Programm für Deep-Tech-Unternehmen, das vor allem den Austausch mit Mentor*innen und Branchenexpert*innen fördern soll. Die jungen Innovativen hatten dabei die Gelegenheit, ihre Geschäftsideen zu präsentieren und wertvolles Feedback für den Markteintritt zu erhalten. Ziel ist es, die Jungunternehmen in der Gründungsphase vor allem bei der Suche nach Investor*innen zu unterstützen. hermann-hauser-frontier-lab.com
Vielstimmig, inklusiv und voller Zukunftsfreude: Das Bildungshaus St. Michael feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. Rund um das Haus am sogenannten „Kraftsee“ in Matrei am Brenner, das seit Jahrzehnten für inklusive Erwachsenenbildung steht, versammelten sich Anfang Oktober Gäste aus Kirche, Bildung, Politik und Zivilgesellschaft, um gemeinsam auf eine bewegte Geschichte zurückzublicken – und mutig nach vorne zu schauen.
Im Bild: Landesrat René Zumtobel, Andreas Wild (Geschäftsführer St. Michael Alpin Retreat), Magdalena Modler-El Abdaoui (Leiterin Bildung St. Michael), Angelika Stegmayr (Leiterin BILDUNG.gestalten), Matreis Bürgermeister Patrick Geir und Bischof Hermann Glettler




Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Talk am Schiff“ setzt die Achenseeschifffahrt ein Zeichen für anspruchsvolle Debattenkultur in besonderem Rahmen. Zum Auftakt war der renommierte Nahostexperte und ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary an Bord der MS Achensee zu Gast. Unter dem Titel „Wohin bewegt sich der Nahe Osten?“ sprach er mit Josef Grill über die tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Verschiebungen in der arabischen Welt – mit besonderem Blick auf die Entwicklungen in Israel und Gaza, in Syrien, im Iran und im weiteren regionalen Kontext. Die besondere Kulisse – eine ruhige Abendfahrt über den Achensee, umgeben von der Tiroler Bergwelt – verlieh dem Gespräch eine stille Tiefe. Die Schwere der Themen fand Resonanz in einer Atmosphäre, die Raum zum Innehalten und Weiterdenken bot. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft, das Publikum mit Aufmerksamkeit und klugen Fragen dabei. Wir freuen uns auf mehr!

Hartmann Hinterhuber (Mitgründer und Ehrenpräsident der pro mente tirol), Klient*innenvertreterin Bianca Engeler, Birgit Müller (Genesungsbegleiterin und Vorstandsmitglied), Klient*innenvertreterin Barbara Schmolmueller und Geschäftsführer Markus Walpoth
Seit ihrer Gründung 1975 begleitet pro mente tirol Menschen in psychischen Krisen und setzt sich für ein selbstbestimmtes Leben sowie für mehr Bewusstsein rund um psychische Gesundheit ein. Mit einer großen Fachtagung und Jubiläumsausstellung im Congress Innsbruck feierte die so wichtige Einrichtung Anfang Oktober ihr 50-jähriges Bestehen. Rund 700 Teilnehmer*innen – darunter Fachleute, Betroffene und Angehörige – blickten gemeinsam auf fünf Jahrzehnte psychosozialer Versorgung zurück und diskutierten aktuelle Herausforderungen. promente-tirol.at



Das Tiroler Landestheater wurde beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2025 in der Kategorie „Wiederentdeckung“ ausgezeichnet. Prämiert wurde „Des Simplicius Simplicissimus Jugend“ von Karl Amadeus Hartmann, das unter der musikalischen Leitung von Hansjörg Sofka und der Regie von Eva-Maria Höckmayr im März 2024 seine österreichische Erstaufführung in den Innsbrucker Kammerspielen feierte. Intendantin Irene Girkinger nahm den Preis stellvertretend für das gesamte Team entgegen. Weitere Nominierungen in den Kategorien „Gesamtproduktion Oper“ (Die Liebe zu den drei Orangen), sowie „Gesamtproduktion Operette“ (Frau Luna) und dem Vorschlag von Jennifer Maines als beste weibliche Nebenrolle unterstreichen die künstlerische Vielfalt des Hauses.
Bei den EuroSkills 2025, der größten europäischen Bühne für junge Fachkräfte, kämpften heuer im dänischen Herning rund 600 Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Nationen in 38 verschiedenen Berufen um den Titel des Europameisters bzw. der Europameisterin. Österreich behauptete sich dabei erneut in der europäischen Spitzengruppe: Team Austria gewann sechs Mal Gold, drei Mal Silber, drei Mal Bronze sowie 17 Medallions for Excellence. Die 44 österreichischen Jung-Fachkräfte traten dabei in 36 Berufen an und zeigten ihr Können auf höchstem Niveau. Einmal Gold ging auch nach Tirol: Johannes Gstrein vom Betrieb Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal sicherte sich im Bewerb Sanitär- und Heizungstechnik den Spitzenplatz.

Bernhard Weide, Albrecht Erlacher und Dietmar Waldeck
Vor fünf Jahren wurde die Führungsriege der GHS – der gemeinnützigen Hauptgenossenschaft des Siedlerbundes – neu zusammengestellt. Mit der Entwicklung des gemeinnützigen Bauträgers ging es seither steil bergauf. Die Bilanz, seit Martin Mimm als kaufmännischer Vorstand und Eduard Wallnöfer zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurden, spiegelt eine einmalige Erfolgsgeschichte wider. So hat sich das Bauvolumen seit 2020 von 14 auf rund 28 Millionen Euro beinahe verdoppelt, die Großinstandsetzungen von einer auf vier Millionen Euro vervierfacht. Allein im Jahr 2024 wurden 140 Wohnungen übergeben, insgesamt werden fast 6.500 Wohnungen verwaltet.


Inhaber und Präsident Georg Stampfer (li.), CEO Ewald Wiedenhofer (re.) und Wolfgang Passler (Geschäftsführer der Niederlassung Osttirol, 3. v. re.) mit Mitarbeitern, die für ihre langjährige Firmentreue ausgezeichnet wurden
Alles beginnt vor 50 Jahren mit einer Idee in einer Garage im Südtiroler Marling – und dem Mut von Helmut Kostner. Aus dem kleinen Handwerksbetrieb wird ein Unternehmen, das bei eleganten Glaslösungen im DACH-Raum und darüber hinaus Maßstäbe setzt. Vor 15 Jahren hat Georg Stampfer METEK übernommen und die Weichen für die Zukunft gestellt: „Für mich war das damals absolutes Neuland, aber genau das hat mich gereizt. Diese Erfahrung treibt mich bis heute an.“ METEK bearbeitet Glas in all seinen Formen und konzentriert sich auf die drei Bereiche Fassaden, automatische Schiebetüren sowie Weinräume und -schränke. Mit dem Produktionsstandort Assling, der vor 25 Jahren eröffnet wurde, feiert METEK zudem ein zweites Jubiläum.

Li.: Bundesinnungsmeister und Landesinnungsmeister Tirol Simon Kathrein mit Wirtschaftskammer-Tirol-Vizepräsident Anton Rieder und htt15Gründungsmitglied Peter Lengauer-Stockner // re.: htt15-Geschäftsführer Rüdiger Lex mit Karl-Heinz Eppacher und dessen Frau Sabine (Dach+Fach) und Franz Binder (binderholz)
In feierlichem Rahmen hat der Verband htt15 – Holzbau Team Tirol sein 25-jähriges Bestehen mit seinen Mitgliedsbetrieben gefeiert. Rund 80 Gäste – zahlreiche Partner*innen aus den Zulieferbetrieben sowie weitere Vertreter*innen aus der Wirtschaft und Bildungseinrichtungen – feierten auf der geschichtsträchtigen Burg Trautson in Matrei am Brenner. Der Verband, bestehend aus 15 innovativen Tiroler Holzbaubetrieben, hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zu einer lebendigen Gemeinschaft entwickelt; vertrauensvolle Zusammenarbeit, kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsansprüche prägen seither den gemeinsamen Erfolg. Die Stimmung war ausgelassen und geprägt von einem inspirierenden Miteinander. Musikalische Umrahmung und ein Karikaturist sorgten für zusätzliche Unterhaltung und Leichtigkeit.

GPK Pegger Kofler & Partner (GPK) ist im aktuellen JUVE Handbuch Österreich 2025/2026 als Marktführer in Westösterreich positioniert und überzeugt landesweit erneut mit starker Präsenz in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Mergers & Acquisitions (M&A). Die Innsbrucker Wirtschaftskanzlei zählt damit weiterhin zu den profiliertesten Einheiten in der Region und genießt für ihre fachliche Expertise und Mandatsarbeit österreichweit hohes Ansehen. Besonders hervorgehoben werden im Ranking die häufig empfohlenen Partner Rechtsanwalt Franz Pegger sowie die Rechtsanwältinnen Barbara Egger-Russe (li.) und Andrea Pegger.
Im Zuge der Innsbrucker Shopping Night Anfang Oktober feierte Einwaller „40 Years of Fashion“ und gleichzeitig mit seinem Firmenjubiläum auch die Eröffnung des komplett neuen ANNA-Stores in der Altstadt.









1 Ingeborg und Josef Einwaller // 2 Barbara Wolf-Einwaller, Landesrat Mario Gerber, Ingeborg & Josef Einwaller, Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber und Theresa Minatti-Einwaller // 3 Barbara Wolf-Einwaller und Theresa Minatti-Einwaller mit Steuerberater Philipp Hagele (Bangratz & Hagele Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft)
Ikonische Designerstücke, persönlicher Service und ein familiärer Umgang: Das Modehaus Einwaller vertraut seit 40 Jahren auf Tugenden, die den Gegenentwurf zu hektischen Shoppingcentern und unpersönlichen Onlinestores darstellen. „Menschen ziehen Menschen an.“ Der Firmenslogan spiegelt die Philosophie von Familie Einwaller und ihrem Team bis heute wider. Was als „EINWALLER – Exklusive Mode für Damen und Herren“ vor vier Jahrzehnten begann, ist heute Innsbrucks erste Adresse für Designermode mit vier Modegeschäften und einer feinen Auswahl an exklusiven Marken. Im Zuge der Jubiläumsfeier wurde zudem der völlig neu gestaltete ANNA-Store eröffnet. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ziel der neuen
ANNA war es, eine Wohlfühloase für unsere Kundinnen zu schaffen“, so die beiden Geschäftsführerinnen und Schwestern Theresa Minatti-Einwaller und Barbara Wolf-Einwaller. Für das gelungene Interior zeichnet Star-Innenarchitektin Stephanie Thatenhorst verantwortlich. Eröffnung und Jubiläum wurden gemeinsam mit hunderten Stammkund*innen und Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft gefeiert, zahlreiche Programmhighlights und Specials inklusive: Von der Frauscher-Boots-Präsentation mitten in der Altstadt und der Special Edition von Philipp Plein über eine exklusive Stylingberatung und Fotosession bis hin zum Livekonzert der O-Tones oder dem Einwaller × out of office icon Clubbing war alles dabei.



Mi.: Brigitte Aufschnaiter, Christine und Hubert Berger (Bergers Feinste Confiserie) und Hans Aufschnaiter / Re.: Markus Kilga (Möbelagentur Kilga) mit Christian Wimmer (Service & More)
Nach intensiven Umbauwochen im Sommer hat Aufschnaiter in St. Johann Ende September sein neues House of Interior (HOI) eröffnet. Zahlreiche Besucher*innen erlebten die besondere Atmosphäre des wirklich beeindruckenden Hauses bei feinen DJ-Sounds, raffinierten Drinks, hervorragendem Essen und inspirierenden Gesprächen. Die jüngsten Gäste waren im Kids Corner bestens aufgehoben. Mit dem House of Interior schlägt das Familienunternehmen gleichzeitig ein neues Kapitel auf und bringt seine Vision von zeitgemäßem Interiordesign, hochwertigem Handwerk und lässiger Architektur auf den Punkt. Und schon auf den ersten Blick zeigt sich: Hier entstand mehr als ein klassischer Showroom. Das House of Interior ist ein Ort der Begegnung, des Gestaltens und Ankommens geworden. Chapeau!




Oben li.: Galerist Martin Duschek, Sax-Virtuosin Maria Kofler und Künstler „GHiii“ Gerald Huber // re.: Hubert Innerebner (ISD), Iris Zangerl-Walser und Manuel Flatscher (Präsident Lions Club) // unten li.: Karin Bauer, Bernhard Triendl (ORF) und Johanna Penz (ARTfair) // re.: Waltraud Heschl, Michael Martys und Künstlerin Patricia Karg
Was entstehen kann, wenn sich ein Galerist, ein Maler und eine Musikerin zusammentun und einen Charityevent planen, erlebten zahlreiche Besucher*innen bei der Veranstaltung „Icons und Legends“. Galerist Martin Duschek verwandelte den Innsbrucker Claudiaplatz in eine Konzertarena, Künstler „GHiii“ Gerald Huber schuf poppige „Look-twice“-Kunstwerke von Legenden, die Geschichte geschrieben haben, und Saxofonistin Maria Kofler setzte mit ihrem unverwechselbaren sax’n’more-Sound jedes dieser Legenden-Kunstwerke musikalisch in Szene. Eines der Bilder wurde zugunsten des Lions Club Innsbruck-Igls verlost, der damit die „Gotlpack“-Aktion der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) unterstützt.
Das Projekt FairPlusService zeigt, wie Unternehmen in Österreich von gezielter Frauenförderung, Unternehmensberatung und Mitarbeiterinnen-Coaching profitieren können. Betriebe stärken damit nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern schaffen auch ein Arbeitsumfeld, in dem Frauen ihre Kompetenzen entfalten und Perspektiven für die berufliche Zukunft entwickeln können. Das Ergebnis: Das Fördern von weiblichen Talenten im eigenen Betrieb führt zu motivierteren Teams und weniger Fluktuation. Ein Best-Practice-Betrieb aus Osttirol zeigt dabei, dass das Projekt in der Praxis funktioniert. Im Rehabilitationszentrum Ederhof in Osttirol – einer Einrichtung der Rudolf Pichlmayr Stiftung – ist der Blick auf das Team gesamtheitlicher geworden: So werden nun auch Mitarbeiterinnen des Rehabilitationszentrums für Kinder, Jugendliche und Familien vor und nach Organtransplantationen, die nicht unmittelbar mit Patient*innen arbeiten, stärker in die Abläufe eingebunden. Das fördert den Zusammenhalt und steigert die Motivation. Das kommt letztlich auch den Patient*innen zugute. Für Betriebe und deren Mitarbeiterinnen ist das Beratungsangebot kostenfrei. fairplusservice.at

Kale Orhan, Geschäftsführer der Kale Group GmbH, betreut mit seinem motivierten Team der KCSGEBÄUDEREINIGUNG von den Standorten Hall und Salzburg aus seit vielen Jahren verschiedenste TOP-Unternehmen. Mit seinen ausgebildeten Experten unterstützt er in unterschiedlichsten Branchen –vom Arzt bis zum Industriebetrieb –seine begeisterten Kunden bei deren verschiedensten Anliegen in Bezug auf Sauberkeit und Hygiene.
Weiters hat er die KALEVERA Gastronomie ins Leben gerufen und begeistert in Innsbruck und in Hall täglich seine Kunden mit frischen Mehlspeisen, Torten und verschiedenen Brotsorten, beliebten Mittagsmenüs, Eis und Snacks. Derzeit baut er gerade dieses Konzept als Franchisesystem auf und setzt auch hier auf Expansion.
Gebäudereinigung | Unterhaltsreinigung | Fensterreinigung | Sonderreinigungen | Hotelreinigung | Ordinationsreinigung | Bauendreinigung | Fassadenreinigung | Industriereinigung
KALE Group GmbH, GF Kale Orhan, Milser Straße 41, A-6060 Hall i. T., www.kale-group.at +43 660 148 74 00



In den abwechslungsreichen zweistündigen FinanzFit-Workshops für die 7. bis 13. Schulstufe werden finanzielle Inhalte, wie der Überblick über die eigenen Finanzen, Themen rund ums Bezahlen oder die Bedeutung der Inflation interaktiv erarbeitet.
Diese finden in der OeNB in Innsbruck statt und können mit einer Führung durch die aktuelle Ausstellung ergänzt werden. Ebenso ist es möglich, die Workshops in der Schule abzuhalten.
Informationen und Anmeldung unter finanzbildung.oenb.at
Folgen Sie uns auf Social Media!
@nationalbank_oesterreich
@nationalbankoesterreich
Oesterreichische Nationalbank

@oenb
OeNB

