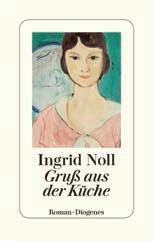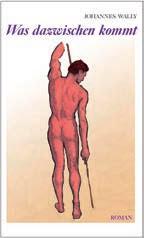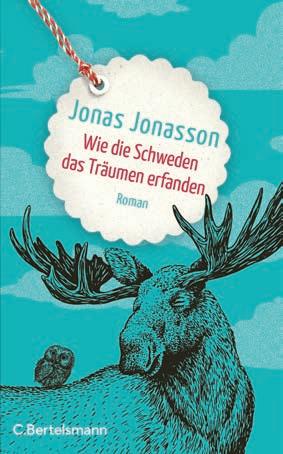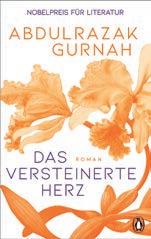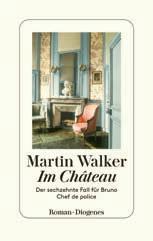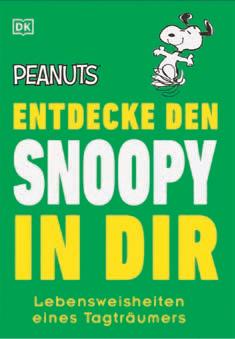Künstliche Intelligenz? Auf jeden Fall besser als natürliche Dummheit.
WOLFGANG MOCKER

N° 05 JUNI 2024 | P.B.B. VERLAGSPOSTAMT 6020 INNSBRUCK | ZNR. GZ 02Z030672 M | EURO 3.00
MANUFACTURE Classic Power Reserve Big Date
BEYOND CONVENTIONS









eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin
Marina Bernardi
VON MENSCHEN UND MASCHINEN
Über künstliche und natürliche Intelligenz.
Wie fast alle neuen Technologien teilt auch die Künstliche Intelligenz die Menschen in zwei Gruppen: Es gibt jene, die voller Begeisterung mitten hineinhüpfen in die neue Welt der Möglichkeiten, die so genannten Early Adopters, und jene, die das alles schon mal überhaupt und gar nicht brauchen, weil es sie mit Sicherheit aktuell und künftig ohnehin nicht betreffen werde. Meist lag letztere Gruppe ziemlich daneben. So sah etwa Trendforscher Matthias Horx 2001 keine große Zukunft für das Internet und der ehemalige Microsoft-CEO und Bill-Gates-Nachfolger Steve Ballmer gab dem iPhone keine Chance. Grandiose Fehleinschätzungen gab’s indes schon um einiges früher, als etwa Kaiser Wilhelm II. das Auto für eine „vorübergehende Erscheinung“ hielt und stattdessen auf das Pferd setzte. Vor allem technologische Entwicklungen machen uns zuallerst meist eines: nämlich Angst – vor allem geboren aus einer Unsicherheit, die wir Menschen nur sehr schwer aushalten. Wir haben’s lieber gemütlich und bewegen uns gerne dort, wo wir uns auskennen.
Neue Entwicklungen, besonders jene der disruptiven Art, stören diese Behaglichkeit, weil sie uns nicht nur aus unserer geliebten Komfortzone herausholen, sondern meist auch nach neuen Kompetenzen und (persönlicher) Entwicklung verlangen. Wir sind also gefordert, etwas zu tun.
Wie und wohin sich die Künstliche Intelligenz entwickeln wird, können wir natürlich nicht sagen. Die Glaskugel ist in der Regel nicht das Werkzeug unserer Wahl. Was wir aber mit ziemlicher Sicherheit sagen können:
Die Künstliche Intelligenz geht nicht mehr weg. Die ist gekommen, um zu bleiben. Das hat Auswirkungen auf unser Leben und wird sie weiterhin haben. Menschlich intelligent eingesetzt, kann Künstliche Intelligenz allerdings viele Chancen eröffnen, das Arbeiten erleichtern und uns Möglichkeiten aufzeigen, von denen wir heute noch gar nichts ahnen. Den Menschen als solches zu ersetzen, wird sie vermutlich dennoch nie können. Ums Selberdenken kommen wir also auch künftig nicht umhin.
Bleiben Sie aufmerksam, Ihre Redaktion der eco.nova

#gemeinsam weiter
AMS ist mehr als du denkst!
Werde jetzt Teil unseres Teams. www.ams.at/karriere-beim-ams
eco. edit 4
© depositphotos_601218034 © depositphotos_601218034
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE

Unfallchirurgie Orthopädie Rehabilitation In Bewegung bleiben
www.medalp.com







eco. inhalt 6 58 80 26 102 14 22 122
FOTOS: MARIAN KRÖLL, ANDREAS FRIEDLE, AUDI, UNI INNSBRUCK
ECO.TITEL
12 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND REALE VERNUNFT
Technologie ist ein nützlicher Diener, aber ein gefährlicher Meister, befand bereits Nobelpreisträger Christian Lous Lange.
14 REALISMUS IM KI - HYPE - ZYKLUS
Künstliche Intelligenz gehört für den Statistiker Wolfgang Trutschnig zum Tagesgeschäft. Eine Bestandsaufnahme.
22 ORDNUNG UND MORAL
Universitätsprofessor Matthias Kettemann über KI-Ethik, Recht und Verantwortung.
26 MENSCH UND MASCHINE
Worum es in Sachen Künstlicher Intelligenz geht: Andreas Eckhardt, Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation, im Gespräch.
ECO.WIRTSCHAFT
36 TOP - ARBEITGEBER
Warum trotz aller MaschinenArbeit immer noch das Humankapital zählt.
Plus: Tirols beste Arbeitgeber.
ECO.ZUKUNFT
58 LEHRENDE LEHREN
Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Das erfordert neue Kompetenzen – im Alltag und im Berufsleben. Dies wiederum stellt das Schulsystem vor Herausforderungen.
66 HYPE MIT TÜCKEN
In Warp-Geschwindigkeit infiltriert die Künstliche Intelligenz so gut wie alle medizinischen Bereiche – das birgt Chancen. Und weckt Ängste.
74 SCHÖNE NEUE WELT
Rechtliche Aspekte des 3D-Drucks mit Künstlicher Intelligenz.
ECO.GELD
80 WISSENSCHAFTLICH VERANLAGT
Wie Erkenntnisse aus der theoretischen Forschung einen Mehrwert für die praktische Vermögensverwaltung liefern können.
86 INVESTIEREN IN NISCHEN
Lukrative Nischenthemen mit Mainstream-Potenzial.
ECO.MOBIL
102 HAPPY VIERTEL JAHRHUNDERT
Zum Jubiläum des RS 4 bringt Audi eine Sonderedition.
106 ZIEMLICH SMART
Der Smart #3 präsentiert sich als SUV-Coupé der Extraklasse.
110 SPORTLICH UND SCHICK
Mit dem Seal ist das nächste Modell von BYD am Markt.
112 DIE NEUE GS IST DA ... und es ist „die beste GS aller Zeiten“. Ein Realitätscheck.
ECO.LIFE
122 WEIT WEG VON SCHWARZ - WEISS
Ingrid Margreiter: Einblicke in ein bewegtes Leben.
04 EDITORIAL
10 KOMMENTAR
42 EMPLOYER BRANDING
92 ECO.SERVICE
120 KULTUR.TIPP
124 BÜCHER
128 IM.GESPRÄCH
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, Christiane Fasching, DI Caterina Molzer-Sauper // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // eco.life: Marina Bernardi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck, Daniel Christleth LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH
UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
jubiläum & geburtstag auf den punkt.
menü 4 gänge inkl. aperitif, wein, bier, mineralwasser & kaffee // 75 €
dj H.nes
18.30 bis 2 uhr
eco. inhalt
das grander +43 (0) 52 24 52 6 26 info@das-grander.at das-grander.at
WIRTSCHAFT

Mario Zanier (CTO) und sein Vater Werner Zanier (CEO) verkaufen Fahrräder und Fitnessgeräte über Fitstore24.
Es lebe das Bike!
Die Coronapandemie hat die Sport- und Fitnessbranche dereinst ziemlich durcheinandergewirbelt. Das Geld floss im ersten Lockdown häufig in neue Sportgeräte. Viele haben dabei das Bike für sich (wieder-)entdeckt, was – auch der Gesamtsituation geschuldet – mitunter zu Lieferengpässen führte. Als der Nachfragehype schließlich abflachte, stellte das die Branche abermals vor Herausforderungen, weil viele Händler*innen aufgrund wirtschaftlicher Fehlentscheidungen und zu euphorischer Orders nun mit vollen Lagern dasaßen. Die Folge war eine Pleitewelle, die den Fahrradmarkt bis heute nicht zur Ruhe kommen lässt. Seit etwa zwei Jahren ist der Fahrradmarkt im Keller und wird es laut zahlreichen Berichten auch noch mindestens so lange bleiben. Das gilt indes nicht für alle Händler. Fitstore24 ist Österreichs größter Onlinehändler für Bike und Fitness und wächst seit 2020 konstant. „Nach jedem Tief folgt ein Hoch“, ist sich Geschäftsführer Werner Zanier nach über 30 Jahren Branchenerfahrung sicher. Dem Unternehmen kommt dabei sein Geschäftsmodell zugute: So vertreibt Fitstore24 an Händler*innen als auch Endverbraucher*innen. Den Löwenanteil des Umsatzes erwirtschaftet der Webshop, der bereits seit Ende der 1990er-Jahre kontinuierlich aufgebaut und laufend professionalisiert wurde und heute von Mario Zanier verantwortet wird. In Nußdorf/Debant betreibt Fitstore24 außerdem ein stationäres Geschäft. Zudem verfügen die Osttiroler über ausreichend Eigenkapital, um die auch dort vorhandenen Übermengen im Lager finanzieren zu können. Conclusio: Vorausschauendes Wirtschaften zahlt sich aus.
wirtschaft & unternehmen
8

VOM HANDEL BIS ZUM BRAUHAUS
Nach etwas mehr als einem Jahr sind die Bauarbeiten des Genusszentrums Kaiserreich Kiefersfelden planmäßig abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit den atp Architekten und Ingenieure hat die Unterberger Gruppe hier einen hochmodernen und ökologisch durchdachten Gewerbepark errichtet und damit das größte Projekt seiner Geschichte abgeschlossen. Insgesamt stehen verteilt auf bis zu vier Ebenen 12.000 Quadratmeter Mietflächen zur Verfügung, darunter auch günstige Büroeinheiten für Start-ups. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten für Entertainment, Gastronomie, Wellness und Handel, die ersten Geschäfte haben bereits geöffnet. In das Projekt wurden über 30 Millionen Euro investiert, wobei ein großes Augenmerk auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt wurde. Großflächige Photovoltaikanlagen und eine Wasser-Wärmepumpe treffen auf eine großflächige Begrünung von Dachflächen und Parkplätzen. www.kaiserreich.de

WEITER AUFWÄRTS
Trotz weltweiter Absatzrückgänge in der Gartengerätebranche durch den Abschwung der Sonderkonjunktur während der Coronapandemie, hoher Lagerbestände beim Handel und ungünstiger Witterung ist STIHL Tirol auch im Geschäftsjahr 2023 gewachsen. So konnten die Langkampfener den Umsatz auf über 950 Millionen Euro steigern, was einem satten Plus von 24 Prozent entspricht. Die Zahl der Mitarbeiter*innen stieg von 799 auf aktuell 887, von denen einige nun auch im neuen Büro in Innsbruck tätig sind. Investiert wurde sowohl in neue innovative Produkte als auch neue Montagebänder für einen erhöhten Automatisierungsgrad. Die Exportquote lag 2023 bei 98 Prozent, mehr als die Hälfte des Jahresumsatzes wurde dabei in Europa erwirtschaftet.

Schein und Sein
Wir zeigen, was wir haben, und nicht mehr, wer wir sind.
Die sozialen Medien haben uns zu ihren Anfangszeiten völlig neue Welten eröffnet, mittlerweile haben sie vielfach unsere gesamte Art zu leben verändert. Wir haben begonnen, jedes Ereignis unseres Lebens durch eine Linse zu betrachten, anstatt den Augenblick zu genießen. Wir suchen unsere Umgebung nach Instagram-tauglichen Motiven ab (oder wählen sogar unsere Urlaubsziele danach aus) und übersehen damit all das tatsächlich Schöne und Besondere, das uns umgibt. Jeder will einzigartig sein, gleichzeitig kommt uns jegliche Authentizität abhanden.
In einer Welt, die immer digitaler wird und stetig mehr zwischen Schaupiel und Realsatire mäandert, wünsche ich mir das Echte, das Wahrhaftige zurück. Weniger Schein, mehr Sein! Ich möchte mich mit Menschen unterhalten und ihnen dabei in die Augen sehen. Ihre Freude erleben, auch ihre Trauer oder Wut. Wir sollten wieder beginnen, unser Leben für uns selbst zu leben und es nicht für andere darzustellen. Was nützt uns ein gephotoshopptes Bild für Likes unbekannter Leute, wenn wir uns nicht mehr an die Klänge einer fremden Stadt, den Geruch des Meeres oder den Geschmack neuer Aromen erinnern, weil das Essen schon kalt geworden ist, bevor man den perfekten Shot hinbekommen hat? Ich will nicht am Social-Media-Fake-Leben anderer teilhaben, sondern den Menschen dahinter sehen – ohne Weichzeichner und Filter, dafür mit Ecken und Kanten. Weil jeder Mensch spannend ist, genau so wie er ist!
Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at
eco. wirtschaft 9
Marina Bernardi, Chefredaktion
eco. mmentar
Jan Grigor Schubert, Geschäftsführer STIHL Tirol GmbH
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE © ALEX GRETTER

FERN VON EUROPA
Die Österreicher sind Europa-Muffel. Die Spitzenkandidaten für die EU-Wahl und die EU-Führung tragen auch nicht gerade dazu bei, dass das besser wird.
Fern von Europa“ lautete der Titel eines vor über hundert Jahren verfassten Büchleins von Carl Techet, der sich darin nicht besonders charmant über die angebliche Grobschlächtigkeit der Tiroler lustig machte. Dadurch seien sie fern von Europa, ferner als andere Volksgruppen. Dass in Tirol mehr steckt als Klischees und Rückständigkeit, hat unser Land mittlerweile hinlänglich bewiesen. Der Befund, dass Tirol und ganz Österreich, letztlich alle Mitgliedsstaaten der EU, jedoch fern von Europa sind, der ist geblieben. Zwischen dem in Sonntagsreden strapazierten Bekenntnis zur EU und der europäischen Realität klafft ein tiefes Loch. Vor den anstehenden EU-Wahlen wird wieder einmal künstliche Euphorie getrommelt, damit die Wähler in Scharen ihre Stimme für europafreundliche Kräfte abgeben. Dass das nicht ganz gelingen wird, ist schon jetzt unschwer zu erraten. Und es gibt auch handfeste Gründe dafür. Ein Blick auf das personelle Angebot der Parteien reicht. Die frustrierten Wähler stehen vor der schier unlösbaren Aufgabe, entweder ein Kreuz bei ausgemusterten Partei–Dinosauriern zu machen oder bei der bislang gänzlich unbedeutenden Kandidatin der Grünen, die charakterlich für diese Aufgabe nicht besonders geeignet scheint. Es löst bei den Wählern jedenfalls Verwirrung aus, wenn man von der Champions League spricht, aber die B-Mannschaft aufs Spielfeld schickt. Wer eine Wahlkarte beantragt hat, erlebt eine zusätzliche Enttäuschung: Die Bezeichnungen der Parteien sind in großen Lettern geschrieben, die Namen der Kandidaten gehören in die Kategorie „Kleingedrucktes“. Die Botschaft kommt an: Die Partei ist alles, der Kandidat nichts. Also genau das Gegenteil dessen, was in Pressestunde & Co verbreitet wird. Wenig hilfreich ist auch der Stehsatz, den praktisch alle Kandidaten auf Lager haben: Sie behaupten, dass 80 Prozent der österreichischen Gesetze in der EU beschlossen würden. Dass dieser Mythos weit verbreitet ist,
ist keine Entschuldigung, als Spitzenkandidaten sollten sie es besser wissen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen nämlich, dass der so genannte Europäisierungsgrad der österreichischen Gesetze zwischen 30 und 40 Prozent liegt. Was das für einen Unterschied macht? Einen wesentlichen. Denn einerseits versuchen die Kandidaten damit, ihre Bedeutung größer zu machen, als sie ist. Andererseits richten sie einen Kollateralschaden an. Wenn die behauptete Zahl richtig wäre, würden für die heimische Gesetzgebung gerade mal 20 Prozent übrigbleiben. Diese vermeintliche Brüsseler Übermacht löst bei vielen Bürgern einen Abwehrreflex aus. Das ist aber das Letzte, was der europäische Gedanke brauchen kann, denn die Zustimmungsraten zur EU sind, gerade in Österreich, ohnehin nicht berauschend. Nur 42 Prozent der Österreicher sehen die Mitgliedschaft laut Eurobarometer positiv, das ist der schlechteste Wert in der EU. Die EU selbst agiert auch nicht immer gerade glücklich. Der italienische Ex-Regierungschef Enrico Letta hat im Auftrag des Europäischen Rates einen umfassenden Bericht zur Lage des europäischen Binnenmarktes veröffentlicht und kommt zum niederschmetternden Schluss, der Binnenmarkt müsse „neu erfunden“ werden. Beim Zukunftsthema Klimaschutz ist es ähnlich. Der „Green Deal“ der EU ist bürokratisch und kompliziert. Die USA erreichen mit dem „Inflation Reduction Act“ dasselbe Ziel auf einem kerzengeraden, einfachen und wirtschaftsfreundlichen Weg. Und dass die EU-Kommission zwar Umwelt- und Gesundheitsziele zelebriert, aber gleichzeitig den Weg für eine Transitklage Italiens gegen Österreich freigemacht hat, passt auch nicht zusammen.
Wenn schon ständig ein geeintes Europa beschworen wird, dann sollten sich die Politiker in Brüssel und Wien gegenseitig an der Nase packen und endlich personelle, inhaltliche und kommunikative Angebote machen, welche die Bürger nicht von Europa fernhalten, sondern sie dem europäischen Gedanken näherbringen.
10
eco. mmentar
VON KLAUS SCHEBESTA
TECHNIK
TECHNIK
Dass die westliche moderne Gesellschaft von Technik geprägt ist, sei, meint Philosoph Armin Nassehi, ein Allgemeinplatz erster Güte. Das, was man „technische Zivilisation“ nennt, oszilliere stets „zwischen einerseits einem Fortschrittsoptimismus und andererseits einer Bedrohung durch die Technisierung der Welt“. Euphorie und Kritik in Bezug auf die Technisierung moderner Produktionsformen und Lebenswelten kommen immer gemeinsam vor. „Technikeuphorie ist gewissermaßen die praktische Seite des Fortschrittsdenkens und der Idee der Gestaltbarkeit der Welt, Technikkritik nimmt den Platz eines skeptischen Beobachters ein, der die Kosten der Gestaltbarkeit im Blick hat“, beschreibt Nassehi dieses Verhältnis.
Die Debatte über die Klimakrise sieht er als paradigmatischen Fall. Die technikeuphorische Seite verspricht sich von Innovation emmissionsärmere Formen der Produktion, Mobilität und Alltagsgestaltung, die andere Seite macht darauf aufmerksam, dass „das Problem gerade nicht technisch lösbar ist, sondern die Umstellung von Lebensweisen, Verzicht und die Veränderung gesellschaftlicher Routinen erfordert“. Beim Klimawandel soll die Technik bzw. der fossile technische Fortschritt, der das Problem überhaupt erst verursacht hat, nun zugleich dessen Lösung sein. Das kann schon allein aus logischen Gründen nicht recht funktionieren.
Der einflussreiche Philosoph Jürgen Habermas hat 1968 mit seinem Aufsatz „Technik und Wissenschaft als Ideologie“ die Tonart festgelegt, in der bis heute Fragen rund um die Technik als Ideologie verhandelt werden. Er betonte, dass im
Spätkapitalismus Wissenschaft und Technik die zentralen Produktivkräfte seien, nicht der Klassenkampf. Er kritisiert die Entpolitisierung durch Verwissenschaftlichung, die normative Kritik erschwere und Technik und Wissenschaft zur Ideologie macht. Dieses Thema spiegelt sich in aktuellen Debatten wie dem Klimawandel, wo technische Lösungen gesellschaftliche Veränderungen verhindern. In Habermas’ linker Ideologiekritik des Wissenschaftlich-Technischen, insbesondere der Entpolitisierungsthese, finden sich Parallelen zur konservativen Technikkritik, wie etwa bei Martin Heidegger. Beide kritisieren die Sinnentleerung und Verselbständigung der Technik. Heidegger beschreibt, wie die moderne Technik, insbesondere die Kybernetik, die Welt auf Informationen reduziert, wodurch der Mensch der Maschine unterworfen wird. Diese Technikkritik betont, dass sich das Technische gegenüber dem Menschlichen verselbständigt. Technikkritische Denkweisen wie bei Günther Anders, Helmut Schelsky, Friedrich Georg Jünger, Arnold Gehlen und Ivan Illich thematisieren sämtlich die Verselbständigung und Entfremdung durch Technik. Anders in „Die Antiquiertheit des Menschen“ sowie andere Kritiker beschreiben, wie die wissenschaftlich-technische Zivilisation den Menschen entfremdet. Diese Motive finden sich auch in der marxistischen Technikkritik und in der Kritik der Digitaltechnik. Die Funktionsweise der Technik – die Vereinfachung komplexer Vorgänge – ermöglicht ihre reflexionsfreie Nutzung und reduziert den Bedarf an Konsens. Technik wird vor allem dann sichtbar und zum Gegenstand der Reflexion, wenn sie nicht funktioniert.
Technik verändert sich rapide – der Technikbegriff dagegen weniger. KI und Machine Learning erweitern die Möglichkeiten des Technischen, die vormals eindeutige Beziehung zwischen Input und Output fällt weg. Nassehi schreibt: „Die Verunsicherung bezüglich intelligenter Technik besteht darin, dass die Ergebnisse als unsicher erlebt werden. Das könnte sich dadurch ändern, dass sie genutzt wird und dass man sich daran gewöhnt.“ Generell gibt es im Technischen schon immer einen Vorrang des Funktionierens vor der Transparenz. Das sei immer schon eines der wichtigsten Kriterien für das Technische gewesen. Es tue letztlich wenig zur Sache, ob diese Maschinen denken. Sie funktionieren.

GESELLSCHAFTLICHE GRUNDBEGRIFFE
Ein Glossar der öffentlichen Rede Verlag C. H. Beck 399 Seiten, EUR 29,90
Armin Nassehi geht es in seinem Buch um die Rekonstruktion des Eigensinns und Sinnüberschusses von Begriffen, die allzu selbstverständlich klingen.
eco. wirtschaft 11

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ MIT VERNUNFT AUFWIEGEN
Technology is a useful servant but a dangerous Master.* Christian Lous Lange, Friedensnobelpreis 1921.
TEXT: MARIAN KRÖLL


AI (Artificial Intelligence) bzw. KI (Künstliche Intelligenz) ist momentan in aller Munde, medial on- und offline fast omnipräsent. Das ist unter aufmerksamkeitsökonomischen Gesichtspunkten nachvollziehbar, der Geist aus der Maschine fasziniert. Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ verspricht aber wahrscheinlich mehr, als er zu halten vermag.
In der Informatik sieht man das Thema überwiegend nüchterner und Machine- bzw. Deep Learning, das auf statistischen Algorithmen basiert. Die vermeintliche „Intelligenz“ des Computers ist dementsprechend Algorithmen im Zusammenspiel mit Daten geschuldet. Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT & Co. sind nichts anderes als computerlinguistische Wahrscheinlichkeitsmodelle, die auf Basis von Trainingsdaten etwas über die statistische Verteilung von Wort- und Satzfolge-Beziehungen gelernt haben. Das ist bedeutend weniger glanzvoll und aufregend als das Schwadronieren über die KI, die den Menschen ersetzen/überflüssig machen/verdrängen oder gar unterjochen möchte. Dabei kann KI gar nichts mögen oder ablehnen. Sie hat, anders als
wir Menschen, keine Agency, keine intrinsische Motivation, keine Hintergedanken. Sie wird uns genauso wenig überflüssig machen wie Webstuhl, Dampfmaschine, elektrischer Strom oder Computer.
Es ist eine wohlbekannte Melange aus Medienlogik, Sensationalismus und Angstlust, die den KI-Hype beflügelt. Das anthropomorphe Gerede von der KI ist verlockend. Man macht sich wohl lieber Gedanken über den Zeitpunkt, an dem der Mensch – nunmehr intellektuell von seiner Schöpfung überrundet – zum alten Eisen gehört, der Kreateur sich vor seiner Kreatur zu schämen beginnt. Der österreichische Technikphilosoph Günther Anders hat das in seinem Opus magnum „Die Antiquiertheit des Menschen“ als „prometheische Scham“ bzw. Dingscham bezeichnet. Der Mensch schämt sich dafür, gerade kein Ding zu sein. Diese Scham entsteht nach Anders aus dem Gefühl der Unvollkommenheit, das der Mensch gegenüber seinen perfekten Produkten empfindet. Dieses perzipierte Gefälle geht sogar so weit, dass Menschen aus Fleisch und Blut – überwiegend Männer – in ihrer fortgeschrittenen digitalen Vereinsamung Beziehungen mit ihren Chatbots eingehen. Das erschöpft sich

nicht in reiner Konversation, sondern dient auch der romantischen Erbauung und sogar erotischen Zweisamkeit, an der ebenso pikanten wie klebrigen Schnittstelle zwischen der Gefährtin aus Bits und Bytes im digitalen Äther dort und dem Tschurifetzen**, den der große Georg Danzer so unnachahmlich besungen hat, in der schnöden Analogwelt da. Da bekommt der Begriff Autoerotik gleich eine neue, hintersinnige Bedeutung. Das ist schon für sich genommen irgendwie sad, aber letztlich nichts anderes als ein Symptom der kollektiven Vereinzelung. Das Internet stiftet letztlich nicht Community, sondern ein trauriges Nebeneinander einsamer Individuen. Der Chatbot gibt sich mit einem ab, und für ein paar Euro Aufpreis macht er sogar Schweinkram.
RECHT UND ORDNUNG
Die EU ist nicht perfekt, aber immerhin bemüht. Wenn es darum geht, die Interessen ihrer Bürger*innen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu wahren, ist sie Vorreiterin. Das zeigte sich schon beim Datenschutz und wiederholt sich in der maßvollen Regulierung von AI. Natürlich tut sich Europa damit leichter, weil die überreichen

Tech-Bros dieser Erde mit ihren Digitalkonzernen überwiegend woanders beheimatet sind. Wenn von denselben immer vollmundigere KI-Ankündigungen ventiliert werden, sollte man die Motivlage dahinter mitdenken. Diese Menschen halten große Teile ihrer Vermögen in Tech-Aktien, die Fieberkurve des KI-Hype korreliert mit den Aktienkursen. Hype ist gut fürs Geschäft.
Dieser Tech-Elite kommt es durchaus zupass, dass in Bezug auf die Künstliche Intelligenz eine beinahe babylonische Sprachverwirrung herrscht und fast niemand genau benennen kann oder will, was nicht aus den Augen verloren werden sollte. Die technologische Singularität ist es vorerst einmal nicht. KI wird nicht die Weltherrschaft übernehmen. Die Mächtigen geben ihre Macht nicht her. Was die KI in ihrer überhaupt nicht umweltfreundlichen Wolke – der Cloud-Begriff ist für sich genommen ein Euphemismus – schon heute tut, ist Ressourcen fressen. Energie, Metalle, Seltene Erden, you name it. Ob immer mehr Rechenleistung dafür sorgen kann, dass der KI irgendwann so etwas wie ein Bewusstsein wächst, kann man aus heutiger Sicht nicht sagen. Die KI hat noch ein enorm tiefes Uncanny Valley*** zu durchschreiten, ehe man ihr auf ganzer Linie menschliche Qualitäten attestieren könnte. Grund genug, uns damit zu befassen, was es in der Substanz eigentlich noch ist, das uns von unseren Maschinen trennt und abhebt. Es wird freilich in der Wirtschaft auch kritisch beäugt, dass die EU der KI Fesseln anzulegen gedenkt. Dadurch geriete Europa ökonomisch bloß noch mehr ins Hintertreffen, wird allenthalben gewarnt. Man wird sehen, ob die Warner vor der überschießenden KI oder der überschießenden KI-Regulierung Recht behalten werden.
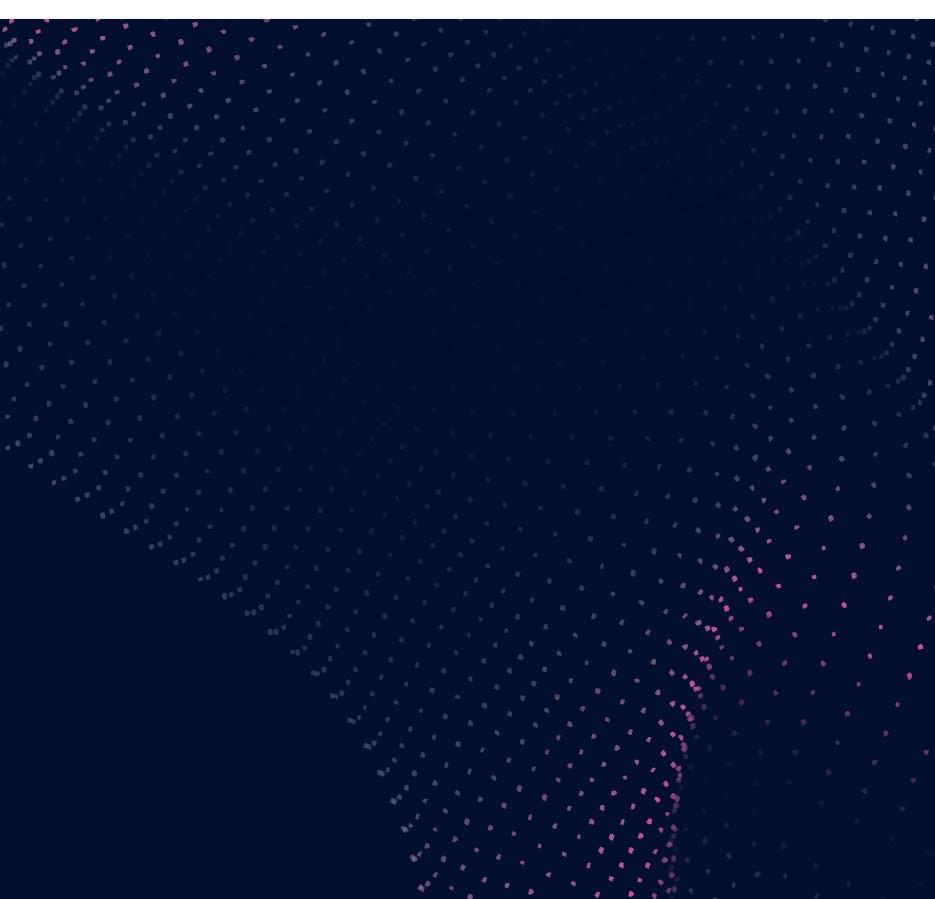

DIE KI TRÄUMT NICHT VON ELEKTRISCHEN SCHAFEN
Der KI wird zwar attestiert, sie verbessere sich laufend selber. Ohne menschliches Zutun ist das aber kaum zu bewerkstelligen. Das zeigt folgendes Zitat, übersetzt aus Phil Jones „Work without the Worker“: „Diese automatisierte Traumwelt ist mehr Fantasie als Realität. Hinter den Suchmaschinen, Apps und intelligenten Geräten stehen Arbeiter, oft solche, die an den Rand unseres globalen Systems gedrängt sind, die in Ermangelung anderer Möglichkeiten gezwungen sind, Daten zu bereinigen und Algorithmen für wenig mehr als ein paar Cents zu überwachen. Die Feeds von
VON SO ETWAS WIE
EINEM BEWUSSTSEIN IST DIE KI WEIT ENTFERNT.
MAN SETZT ANSCHEINEND
DARAUF, DASS VOR ALLEM MEHR DATEN MEHR
QUALITÄT BRINGEN.
Facebook und Twitter (nunmehr X, Anm. d. Red.) scheinen gewalttätige Inhalte mit automatischer Präzision wegzuwischen, aber Entscheidungen darüber, was Pornografie oder Hetze ist, werden nicht von Algorithmen getroffen. Eine Gesichtserkennungskamera scheint von sich aus ein Gesicht in einer Menschenmenge zu erkennen, ein autonomer Lastwagen fährt ohne menschliches Zutun. Doch in Wirklichkeit besteht die Magie des maschinellen Lernens in der mühsamen Arbeit des Data-Labeling. Hinter den Cargo-Kult-Ritualen des Silicon Valley verbirgt sich die zermürbende Arbeit, Hassbotschaften auszusieben, Bilder zu kommentieren und Algorithmen zu zeigen, wie man eine Katze erkennt.“
Es tut sich dennoch sehr viel im KI-Bereich. So wurde unlängst ChatGPT 4.0 ausgerollt. Das kleine o steht dabei für omni und gibt die Marschrichtung von OpenAI vor: „Das ist ein Schritt in Richtung einer viel natürlicheren Mensch-Computer-Interaktion. ChatGPT 4.0 akzeptiert als Eingabe eine beliebige Kombination von Text, Audio, Bild und Video und erzeugt eine beliebige Kombination von Text-, Audio- und Bildausgaben.“ Von so etwas wie einem Bewusstsein ist die KI dennoch weit entfernt. Man setzt anscheinend darauf, dass vor allem mehr Daten mehr Qualität bringen. Computerwissenschaftler Mike Pound hat diese Hoffnung so formuliert: „Man zeigt genug Katzen und Hunde, und irgendwann ist der Elefant impliziert.“ Der Geist ist aus der Flasche, die Künstliche Intelligenz entwächst recht rasant ihren Kinderschuhen. Sie redet mit uns, produziert (zunehmende bessere) Bilder und auch Videos und imitiert uns im-
mer besser. Das öffnet das Tor zur totalen Desinformation einen Spalt weiter. Vielleicht passiert aber auch nichts. Zumal es diesbezügliche Befürchtungen auch schon mit dem Aufkommen von Photoshop und CGI gegeben hat. Beides hat uns nicht ins Verderben geführt, sondern lediglich zu großartigen Memes und einer Schwemme vergessenswerter Marvel-Movies.

KI kann, ihren klugen Einsatz vorausgesetzt, unserer Produktivität – und damit der Wirtschaft – auf die Sprünge helfen. Das wird vermutlich noch immer nicht dafür sorgen, dass wir alle weniger arbeiten dürfen/können/sollen/müssen, weil das der inhärenten kapitalistischen Logik zu widersprechen scheint. Sei’s drum. Dune-Autor Frank Herbert (1920–1986) wusste bereits vor Jahrzehnten um des Pudels Kern: „What do such machines really do? They increase the number of things we can do without thinking. Things we do without thinking –there’s the real danger.” Schöne neue Welt der Koexistenz zwischen Künstlicher Intelligenz und – mit Blick aufs Weltgeschehen sei diese flapsige Einschätzung gestattet – natürlich gewachsener Dummheit (treffender wäre wohl Ignoranz). Die KI ist gekommen, um zu bleiben. Gerade deshalb sind, gewissermaßen als Gegengewichte, wieder mehr Menschenverstand und Vernunft gefordert.
* Technologie ist ein nützlicher Diener, aber ein gefährlicher Meister. ** Georg Danzer - Ballade vom versteckten Tschurifetzen. Dabei handelt es sich um ein Intimpflegetuch für besondere Anlässe. *** Uncanny Valley: Phänomen, dass bei steigendem Grad an Realismus künstlicher Figuren / Intelligenz ein bestimmter Punkt erreicht wird, an welchem die Figur / Intelligenz nicht mehr als realistisch akzeptiert wird, sondern vornehmlich Unbehagen aus löst.

14
REALISMUS IM KI-HYPE-ZYKLUS
Künstliche Intelligenz gehört für den Osttiroler Statistiker Wolfgang Trutschnig zum Tagesgeschäft. Er hat allerdings wenig Freude damit, wenn Unternehmen KI als die Katze im Sack verkauft wird und empfiehlt, selbst in Zeiten der Künstlichen Intelligenz nicht ganz auf den guten alten Hausverstand zu verzichten.
ECO.NOVA: Was ist Künstliche Intelligenz? WOLFGANG TRUTSCHNIG: Es gibt zwar einige wissenschaftliche Definitionen von KI, ich würde aber keine davon als beste bezeichnen. KI ist aus meiner Sicht im Wesentlichen maschinelles Lernen und alles drumherum. Alles, was man cleveren Algorithmen beibringen kann. KI gibt es nicht erst seit ChatGPT und Co., die Anfänge von KI reichen Jahrzehnte zurück. Die ersten auf Algorithmen basierenden Analysen bildgebender Verfahren in der Medizin gibt es seit mindestens zwei Jahrzehnten. Dafür hat sich außerhalb der Wissenschaft kaum jemand interessiert, seit ChatGPT interessiert sich plötzlich jeder für die Künstliche Intelligenz. Ich verstehe diesen Hype nur teilweise. Offensichtlich ist der Chatbot attraktiv und fasziniert die Leute, weil er ihnen zurückschreibt. KI ist aber weit mehr als Chatbots.
Vielleicht ist es der niederschwellige Zugang, der diesen Hype mit ausgelöst hat? Fingerabdruck- und Gesichtserkennung am Smartphone gibt es auch schon lange. Dahinter stehen ebenso Algorithmen. Oder das Navigationssystem im Auto. Niemand denkt allerdings darüber nach, was es braucht, damit das Navi einen möglichst effizient von A nach B lotsen kann. In der Theoretischen Informatik und der Mathematik gibt es das sogenannte Travelling-Salesman-Problem, ein kombinatorisches Optimierungsproblem, das alles andere als eine „gmahde Wiesn“ ist. Die meisten von uns verwenden regelmäßig das Navi. Gedanken über die Funktionsweise macht man sich aber nicht.
ZUR PERSON
Wolfgang Trutschnig (geb. 1977) hat Technische Mathematik studiert und darin promoviert, war fünf Jahre in Spanien und ist schließlich nach Salzburg an die Universität gekommen. Dort sind immer mehr regionale Unternehmen mit Fragestellungen vorstellig geworden, die Data Science und Künstliche Intelligenz betreffen. Trutschnig war in der Arbeitsgruppe Statistik tätig, die heute Teil des neuen Fachbereichs AIHI (Artificial Intelligence and Human Interfaces) ist. Aus der Notwendigkeit, eine zentrale Anlaufstelle für Data Science und KI in Salzburg aufzusetzen, ist das vom Land Salzburg großzügig geförderte IDA Lab Salzburg entstanden, das Wolfgang Trutschnig seit seiner Gründung 2020 leitet. Im IDA Lab arbeiten neben Mathematikern auch Machine-Learning-Experten, Geoinformatiker und Informatiker mit.
Sie haben die Algorithmen als wesentliches Merkmal von KI bezeichnet. Folglich ist KI hauptsächlich in der Mathematik zu Hause? Ich würde sagen, KI ist an der Schnittstelle Mathematik und Informatik anzusiedeln. Viele Konzepte kommen aus der Mathematik, die Algorithmen müssen aber möglichst optimal programmiert sein, und dafür braucht es Informatiker. Um optimale Lösungen für die unterschiedlichen Problemstellungen aus der wirtschaftlichen Praxis entwickeln zu können, braucht es Know-how aus verschiedenen Disziplinen – genau dieses Zusammenspiel macht den Bereich noch interessanter.
Die Wirtschaft in Tirol ist eher kleinstrukturiert, es gibt entsprechend viele KMU. Was kann die Künstliche Intelligenz in der praktischen wirtschaftlichen Anwendung leisten? Es gibt grundsätzlich unzählige Anwendungen. Für mittelständische Unternehmen, besonders im produzierenden Gewerbe, ist vor allem das Thema Predictive Maintenance* interessant. Dabei geht es im Wesentlichen um die frühzeitige Erkennung von Mustern und Anomalien, die oft vor Problemen oder Ausfällen auftreten. Gefragt sind auch Prognosen jeglicher Art, etwa Absatzprognosen. Dabei ist einmal ein
* Predictive Maintenance bzw. vorausschauende Instandhaltung bezeichnet einen Wartungsvorgang, der meist auf der Auswertung von Prozess- und Maschinendaten basiert. Durch die EchtzeitVerarbeitung zugrunde liegender Daten werden Prognosen möglich, die die Grundlage für eine bedarfsgerechte Wartung und folglich die Reduktion von Ausfallzeiten bilden. Predictive Maintenance ermöglicht es im Optimalfall, Techniker mit der Behebung eines Problems zu beauftragen, noch bevor es entsteht.
eco. titel 15
INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL
„Man muss nicht überall eine KI draufwerfen, wenn es auch anders –und einfacher – geht.“
Forecast der erste Schritt, in einem zweiten wird oft die Logistik entsprechend angepasst und in einem dritten versucht man, innerhalb der Spielräume zu optimieren.
Künstliche Intelligenz hat in diesem Zusammenhang also absolut betriebswirtschaftliche Relevanz. Definitiv. Wir haben Projekte abgewickelt, aus denen sich signifikante Einsparungspotenziale – vor allem im Material- und Energiebereich – ergeben haben. Es ist spannend, in der Praxis zu sehen, was mit derartigen Analysen erreicht werden kann. Im produzierenden Gewerbe geht es auch darum, Fehlerquellen im Produktionsprozess zu identifizieren. Wir haben derzeit ein großes Projekt mit einem börsennotierten Konzern am Laufen, bei dem im Produktionsprozess mehrere hundert Parameter aufgezeichnet werden, deren Einfluss auf die Produktqualität es zu analysieren gilt. Das ist überhaupt nicht trivial und man kommt mit reinem Machine Learning auch nicht mehr weiter, sondern mit einer Mischung aus Statistik und Machine Learning. Das macht mir Spaß. Es gibt aber auch spannende Problemstellungen und Herausforderungen in anderen Branchen. Wir haben zuletzt beispielsweise auch einige Projekte mit touristischem Hintergrund begleitet.
Worum ging es dabei? Was passiert, wenn das Wetter schlecht ist? Wohin weichen die Menschen dann aus? Welche Muster lassen sich erkennen? Man kann mit den zur Verfügung stehenden Informationen relativ viel herausfinden und dann, im zweiten Schritt, auch besser planen und optimieren.
Wie schlägt sich KI in wirtschaftlichen Anwendungen im Vergleich zu konventionellen Methoden? Wir verwenden bei vielen Projekten tatsächlich AI- bzw. Machine-Learning- parallel zu klassischen Methoden. Das tun wir, weil die klassischen Methoden oft vergleichsweise viel weniger aufwändig sind als das Trainieren ei-
nes neuronalen Netzes ... und damit viel schneller. Man muss nicht überall eine KI draufwerfen, wenn es auch anders – und einfacher – geht. Momentan wird aber oft vermittelt, dass man für alles und jedes KI verwenden muss. Für die Porsche Holding bzw. die Porsche Informatik haben wir uns die Kundenabwanderung – auch Customer Churn genannt – angesehen und sogar ein Paper darüber geschrieben. Das ist für jedes Unternehmen relevant. Die Fragestellung war, ob sich Churn aus den Daten heraus prognostizieren lässt. Es hat extrem gut funktioniert. Wir haben klassische mit Machine-Learning-Methoden verglichen und bei beiden Ansätzen die fast gleiche Präzision erreicht. Wenig überraschend haben wir uns schließlich für die klassischen Methoden – ein Regressionsmodell mit fünf bis zehn Parametern – entschieden, weil es dabei im Gegensatz zur KI keinerlei Interpretationsschwierigkeiten gibt.
Lässt sich anhand dieses konkreten Projekts illustrieren, wie weit man mit Hausverstand im Vergleich zu Werkzeugen aus dem Bereich Machine Learning kommen kann? Ja. Warum sollte man ein kompliziertes Modell verwenden, wenn man mit einem einfacheren dieselbe Qualität bekommt? Man kann bei derartigen Fragestellungen mit Hausverstand oft extrem weit kommen, Ideen sammeln, die relevanten Muster herausfinden und diese schließlich in entsprechenden Code übersetzen. Oft sind dabei auch sogenannte Domain Experts – also Fachleute mit jahrelanger Erfahrung – extrem hilfreich. In Vorträgen illustriere ich das gerne anhand konkreter Praxisbeispiele. Auf den Hausverstand sollte man auch in Zeiten der Künstlichen Intelligenz nicht ganz verzichten. Genauso wie man beim vermeintlich autonom fahrenden Tesla die Hände nie ganz vom Lenkrad weggeben sollte.
Wenn man sich nun als KMU für das Thema Künstliche Intelligenz interes-
siert, wie sollte man vorgehen, um die KI für sich nutzbar zu machen? Erstens sollte man seine Daten irgendwo in digitaler Form gesammelt haben. Das muss nicht unbedingt eine Datenbank sein, die perfekt organisiert ist, was bei KMU oft nicht leicht ist. Zweitens braucht man eine oder mehrere konkret ausformulierte Fragestellungen, die man beantwortet haben möchte, sowie einen Ansprechpartner, der sich gut mit den Daten und betrieblichen Vorgängen auskennt. Da können wir als IDA Lab* dann ansetzen. In der Regel arbeiten wir uns anhand von Grafiken in die Daten ein und versuchen, auf den Punkt gebracht, Muster zu erkennen, sei es mit modernen oder klassischen Methoden. Für Mittelständler gibt es übrigens in fast allen Bundesländern eine entsprechende Förderung.
Wie sehr hängt die Qualität der Datenanalyse von den zu analysierenden Daten ab? Hier gilt tatsächlich ein Prinzip, von dem immer wieder die Rede ist: „Shit in, Shit out“. Das wird sich auch nicht ändern. Je besser die Daten sind, desto eher wird man etwas herausfinden können. Es wird allerdings nie so weit gehen, dass alles prognostiziert werden kann. Eine gewisse Zufälligkeit, auch als Rauschen bezeichnet, wird man nie ausschließen können. Man kann allerdings versuchen, alles herauszufiltern, was an Mustern erkennbar wird. Wenn nur Rauschen da ist, nützt einem aber selbst das fortschrittlichste KI-Tool nichts. Gerade unter den KMU machen viele den Fehler, dass sie sich irgendwelche Consultants einkaufen, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Inmitten des heutigen KI-Hypes muss man realistisch bleiben – auch dabei unterstützen wir als IDA Lab.
Halten Sie die derzeitige Erregung rund um die Künstliche Intelligenz für überzogen? Ich finde, dass die Entwicklungen insgesamt sehr gut sind und man sehr viel mit KI machen kann. Aber man darf sich nicht erwarten, dass sich jedes Problem mit KI lösen lässt. Man muss zunächst einmal die grundlegenden Prozesse verstehen, damit man nicht alles glauben muss, was die KI ausspuckt. Ich habe keine Freude damit, wenn den Unternehmen nur eine Black Box verkauft wird. In der Regel muss man diese Black Box irgendwann modifizieren, und
* IDA (Lab for Intelligent Data Analytics): Kompetenzzentrum für Grundlagen- und angewandte Forschung sowie für Wissens- und Technologietransfer in den Bereichen Data Science, Machine Learning, KI und Statistik
eco. titel 16

dann geht nichts mehr, wenn man nicht versteht, was sich darin verbirgt.
Ist es tatsächlich so, dass KI eine Black Box ist, deren interne Wirkweise den Nutzer*innen und – so macht es den Anschein – teils selbst den Entwickler*innen verborgen bleibt? Na ja. Ein komplexes neuronales Netz wird wohl niemand mehr zur Gänze kennen und erfassen können. Bis zu einem gewissen Grad ist die KI also – im Gegensatz zu klassischen Methoden der Statistik – tatsächlich eine Black Box. Es ist aber sehr wohl meist bekannt, mit welchen Daten die KI trainiert wurde. Daraus folgend sollte man auch ein Gespür bekommen, was herauskommen kann. Es heißt zwar oft, die KI würde halluzinieren, dabei bildet sie lediglich Parallelen zu Daten, mit denen sie trainiert wurde.
Gilt auch hier wieder das eherne Prinzip „Shit in, Shit out“? Ja, aber nicht nur das. Wenn es heißt, die KI ist rassistisch oder sexistisch, dann reproduziert sie bloß Ver-
„Wir brauchen uns nicht vor der KI fürchten.“
zerrungen (Biases), die sie aus den Trainingsdaten gelernt hat. Darüber dürfen wir uns dann nicht wundern.
Es gab vor einigen Jahren ein Experiment mit dem Microsoft-Chatbot Tay, der sich via Social Media binnen weniger Stunden dermaßen radikalisiert hat, dass man ihn aus dem Netz nehmen musste. Es wäre wohl mehr Sorgfalt geboten, was die Trainingsdaten für KI betrifft. Wir haben diese Biases in den Modellen, weil die Trainingsdaten eben so sind, wie sie sind. Es gibt mittlerweile Forschung in diesem Bereich, die sich bemüht, mehr Fairness hineinzubringen.
An dieser Stelle setzt auch die Debatte um die Notwendigkeit einer sogenannten „Ethical AI“ an. Wie sehen Sie dieses Thema? Das ist wichtig. Wir haben das Thema deshalb in unser Curriculum des Bachelors AI an der Uni Salzburg eingebaut und arbeiten mit Philosophen zusammen. Es gibt viele ethische Fragestellungen, deren Beantwor-
eco. titel
tung nicht trivial ist. Der Datenschutz ist in diesem Zusammenhang nur einer von vielen Punkten, die berücksichtigt werden sollten.
Wie bringt man der KI bei, sich ethischer zu verhalten? Es wird politisch diskutiert, ob man nicht hart durchgreifen sollte. Ich bezweifle aber, dass es etwas bringt, Verbote zu fordern. Es braucht vielmehr eine Kombination aus vernünftigen Trainingsdaten und Eingriffen im Lernprozess, die Verzerrungen minimieren können.
Ist KI auch ein Hype, der ganz bewusst geschürt wird, um Produkte zu verkaufen? Gut möglich. Man sollte allzu vollmundige Ankündigungen immer mit Vorsicht genießen. Elon Musk redet zum Beispiel schon seit Jahren davon, dass seine Tesla-Fahrzeuge bald vollautonom fahren würden. Davon kann freilich noch keine Rede sein. Das ist pures Marketing. Generell braucht es mehr Bewusstsein dafür, dass vieles nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir brauchen uns nicht vor der KI fürchten. Terminator-Szenarien sind eindeutig fehl am Platz. Es wird also noch dauern, bis die Maschinen den Menschen ihre Position streitig machen und die Weltherrschaft übernehmen. Ich mache mir diesbezüglich überhaupt keine Sorgen!
Es lässt sich aber eine gewisse Korrelation zwischen der Konjunktur von KI und diversen Weltuntergangsszenarien beobachten. Müssen wir uns vor der technologischen Singularität* auch zukünftig nicht fürchten? Ich glaube, dass aktuell vor allem in den Medien viele Dinge herbeigeredet und -geschrieben werden, von denen wir noch sehr weit entfernt sind, wenn wir überhaupt jemals dort hinkommen. Die Geschwindigkeit, mit der sich KI derzeit weiterentwickelt, ist dennoch ohne Frage beachtlich. Eine Verselbständigung sehe ich aber derzeit absolut nicht.
Macht ist also im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz keine Kategorie? Doch. Macht ist sehr wohl ein relevanter Punkt, und zwar vor allem im Hinblick auf die Frage, worauf man der KI Zugriff gewähren sollte. Lässt man diese abgekapselt laufen,

„Schon beim Aufkommen des Computers wurde darüber geredet, dass der Mensch zukünftig überflüssig werden würde.“
wird nicht viel passieren können. Wie das in zehn Jahren sein wird, kann man nicht vorhersagen. Ich kann nur definitiv heute schon sagen, dass ich mich auch in einem Jahrzehnt nicht vor der KI fürchten werde. Von politischer Seite muss aber jedenfalls in Österreich mehr in diese Richtung getan werden.
Was meinen Sie damit konkret? Es braucht mehr Forschungsförderung. Nur wenn ich Geld in die Forschung investiere, wird es auch Leute geben, die die Entwicklung der KI verstehen und nachvollziehen werden können. Bei uns wird mehr geredet als gehandelt. Das finde ich nicht gut. Andere Länder sind wesentlich weiter als Österreich und investieren seit Jahren sehr viel Geld. Ich fürchte, dass wir das Thema verschlafen werden. Wir hatten einen Digitalisierungs-Staatssekretär, der allerdings lieber Innsbrucker Bürgermeister werden wollte. Das sagt auch einiges aus.
ob ein Mensch oder eine Maschine Urheber der Texte ist. Ich würde aber dennoch jedem empfehlen, ChatGPT und ähnliche KI auszuprobieren und selbst Erfahrungen zu sammeln. In Bezug auf die Arbeitswelt ist noch hinzuzufügen, dass Stellen in gewissen Bereichen wegfallen, aber viele andere in neuen Bereichen entstehen werden.
Dafür braucht es aber neue und andere Kompetenzen als heute? Diese Diskussionen wiederholen sich. Schon beim Aufkommen des Computers wurde darüber geredet, dass der Mensch zukünftig überflüssig werden würde. Was ist tatsächlich passiert? Die Arbeit hat sich verlagert, es sind neue Jobs und ganze neue Arbeitsfelder entstanden. Ähnliches ist auch heute beobachtbar.
In den Unternehmen entstehen zahlreiche neue Jobs, zum Beispiel für Data Science oder eben KI. Da steckt eine unglaublich große Dynamik dahinter.
* Unter dem Begriff technologische Singularität wird ein hypothetischer zukünftiger Zeitpunkt verstanden, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft und sich dadurch rasant selbst verbessern und neue Erfindungen machen würde, wodurch der technische Fortschritt irreversibel und derart beschleunigt würde, dass die Zukunft der Menschheit nach diesem Ereignis nicht mehr vorhersehbar wäre.
Was wird der Vormarsch der KI mit der Arbeitswelt machen? Diesbezügliche Sorgen kann ich nachvollziehen. Es wird Umwälzungen geben, die nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Wissenschaft betreffen. An der Universität wurde das Thema kontrovers diskutiert, manche Disziplinen waren da alles andere als entspannt. Es geht bei manchen Studienrichtungen viel um Textproduktion, und die Texte von ChatGPT und Co. werden mit jeder Version besser. Irgendwann wird es in Fächern, in denen Text produziert wird, schwierig zu überprüfen sein,
Es kann gesamthaft betrachtet auch mit dem Blick auf die Demografie wohl kaum ein großer Schaden sein, wenn repetitive und – offen gesagt – geistlose Tätigkeiten wegfallen? Das sehe ich ähnlich. Aus individueller Perspektive ist es natürlich ein Schaden, wenn Menschen ihre Jobs verlieren, die sie womöglich lange ausgeübt haben. Gesamtwirtschaftlich sieht das schon anders aus, vor allem dann, wenn die Leute entsprechend der Nachfrage umgeschult werden können und neue, vielleicht spannendere und dadurch erfüllendere Jobs bekommen.
18










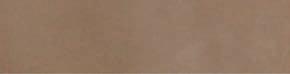
BREITETIEFE.COM B T WIR BERATEN SIE SICHER IN DER BREITE STRATEGY X BRAND BUILDING X TECHNOLOGY X MIT STRATEGISCHER TIEFE BREITETIEFE, das
für
am
neuen
DÜSSELDORF DE BERLIN DE BOZEN IT INNSBRUCK AT WIEN AT
Know-how Kollektiv
bedeutsame Markenerlebnisse
Schnittpunkt von Strategie, Branding und
Technologien.
BREITETIEFE BEGLEITET
MARKEN & UNTERNEHMEN IN
DIE ZUKUNFT
Die kommunikativen und technologischen Herausforderungen für Marken und Unternehmen werden immer komplexer. Um diesen gerecht zu werden, haben sich acht etablierte Agenturen aus Österreich, Deutschland und Italien zum Know-how-Kollektiv BREITETIEFE zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel: die fortschreitende Komplexität gewinnbringend zu nutzen und für die Zukunft sicher aufgestellt zu sein. Ganz aktuell beispielsweise beim Thema Künstliche Intelligenz.
Moderne Technologien bieten auf der einen Seite großes Potenzial, auf der anderen Seite erfordert ihr Einsatz fundiertes Fachwissen. Wir haben mit den vier BREITETIEFE-Standorten gesprochen, wie sie die Möglichkeiten, welche die Künstliche Intelligenz eröffnet, konkret nutzen. PR
SO FUNKTIONIERT DAS KNOW- HOW- KOLLEKTIV:
Das neue Agenturmodell besteht aus rund 80 Expert*innen, die über tiefes Wissen sowie großen Erfahrungsschatz in ihren Fachbereichen verfügen und standortübergreifend in dynamischen Teams zusammenarbeiten. Dadurch kann ein vielfältiges Angebot mit Umsetzungskraft kombiniert werden – besonders interessant für mittelständische Unternehmen und Großunternehmen.

Das Management Board von BREITETIEFE v. li. n. re.: Alexander Dresen, Matthias Lechner, Hubertus Winkler, Nikolaus Staudacher, Kai Engelmann, Dominik Jais, Joachim Krülls, Carsten Haupts, David Blaskowsky, Hanna Peluso-Nemec, Arnold Malfertheiner
SO SETZT SICH BREITETIEFE ZUSAMMEN:
Die Kommunikationsagentur engelmannhauptskrülls (EPS) und die Tochtergesellschaft Core Idea, Spezialagentur für Immobilienmarketing, sind die bundesdeutschen Partner des Kollektivs. Beide sowohl deutschlandweit als auch international erfolgreich seit rund 30 Jahren. Partner in Österreich ist die Innsbrucker Werbe- & Digitalagentur ACC. Sie gehört seit über vier Jahrzehnten zu den renommiertesten Branchenadressen Tirols. Die Bozner E-Commerce & Internetmanufaktur teamblau, die bereits seit mehr als 25 Jahren in Südtirol etabliert ist, komplettiert die internationale Partnerschaft. Ergänzt wird das Kollektiv durch die auf Web3 & Metaverse spezialisierte Agentur NFBrands.X, die Gaming- & E-Sports-Expert*innen von Leeeeroy und das mehrfach ausgezeichnete Designstudio KR888888 mit Sitz in Wien. www.BREITETIEFE.com
Fachliche Kernkompetenzen sind: Marke & Strategie, Digitale Ökosysteme, Performance & Sales, E-Commerce, Content & Story, Web3 & Metaverse, Gaming & E-Sport und alles, was daraus erwächst.
20 STRATEGY, BRAND BUILDING & TECHNOLOGY
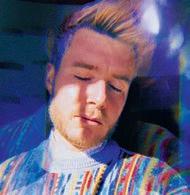
FLORIAN KOWATZ, CREATIVE DIRECTOR
KR8 | BUREAU FÜR BRAND IDENTITY, STRATEGIE & DESIGN, WIEN
AI-Tools, die immer zielgerichteter arbeiten und bereits außergewöhnliche Leistungen und Kreativität in ihrem Fachbereich zeigen, gewinnen zunehmend an Bedeutung in Design- und Branding-Studios. Obwohl der Output der KI niemals das endgültige Werk ersetzt, liefert sie schnelle Visualisierungen, Entwürfe oder akustische Untermalungen, die Konzepte schneller im Team, insbesondere jedoch bei Kund*innen, greifbar machen. Es ist jedoch klar: Der Trend in der Mediengestaltung geht zunehmend zum Analogen. Menschen schätzen die nostalgische Wirkung, manuelle Texturen und den menschlichen Touch. Die Ergebnisse von KI weisen derzeit noch eine andere Grundqualität auf als kreative Werke, die von Personen geschaffen wurden. Es steht ebenfalls fest, dass KI weiterlernen muss, um auf ein gewisses Level von State of the Art zu gelangen. Dazu bedarf es weiterhin der Inputs und der Arbeit realer Kreativer.
 ARNOLD
ARNOLD
MALFERTHEINER, CEO & SENIOR-BERATER E-COMMERCE, TEAMBLAU
INTERNETMANUFAKTUR, BOZEN
Wir begleiten Unternehmen mit Begeisterung erfolgreich in den Onlinehandel. Seit zwei Jahren definiert die KI dabei auch den Bereich E-Commerce völlig neu. Faszinierende Möglichkeiten in der Contenterstellung, automatisierte kundenorientierte Abläufe von Onlineshops, effizienzsteigernde Analysen des Kundenverhaltens, KI-geführte Chat Bots im Customer Care … alles praktische Anwendungen aus dieser tollen neuen Welt der KI. Als E-Commerce-Spezialisten im BREITETIEFE-Kollektiv setzen wir dabei auf das führende Shopsystem Shopware 6 und kombinieren dieses mit neuen innovativen KI-Lösungen. Das macht Onlineshops effizienter, erfolgreicher und vor allem zukunftssicherer. Das Ergebnis sind ganz neue hochindividuelle B2C- und B2B-Lösungen – personalisiert und nahtlos eingebunden in bestehende Technologien unserer Kund*innen. Die KI steigert dabei die Qualität des Shops und hilft gleichzeitig dem Unternehmen, massiv Zeit und Ressourcen zu sparen.

MAGNUS BUSCH, ART DIRECTOR, EPS AGENTUR FÜR KOMMUNIKATION, DÜSSELDORF
Bei BREITETIEFE setzen wir gezielt auf KI im Agenturalltag, um unsere Projekte effizienter zu gestalten und die neuen kreativen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die Vorteile sind klar: Wir können jetzt Ergebnisse auf hohem Niveau in kürzerer Zeit erzielen. Statt beispielsweise viele Stock-Bilder mit unterschiedlicher Bildsprache zu nutzen, ermöglicht uns die KI die Gestaltung eines einheitlichen Looks. Das führt zu deutlicher Zeitersparnis. Es gibt allerdings auch Herausforderungen: Die Nutzung von KI ermöglicht eine effizientere Arbeitsweise, die unser Können und unsere Kreativität ergänzt. Sind Ideen schnell visualisiert, bedarf es in der Konzeptionsphase weniger Worte. Doch wenn wohlmöglich der Eindruck entsteht, dass die Arbeit mit Hilfe von KI scheinbar automatisiert und eigenständig funktioniert, sind dennoch konzeptionelles Know-how und kreative Kompetenzen nötig, damit sie in der Gestaltung auch einen Mehrwert bietet.

DOMINIK JAIS, CTO UND MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG, ACC AGENTUR FÜR CREATIVE COMMUNICATION, INNSBRUCK
Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben, und das stellt uns als Dienstleister vor neue Herausforderungen. Persönlich empfinde ich diese Entwicklung als positiv und wertvoll. Ich bin überzeugt, dass KI uns nicht als Arbeitskräfte ersetzen wird – wir werden koexistieren. Vielmehr wird sie durch ihre korrekte Anwendung unsere Effizienz steigern, was unerlässlich ist, um am Markt bestehen zu können. Nahezu jede Branche und damit auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter steht vor ähnlichen Herausforderungen. Wir sind frühzeitig auf den Zug aufgesprungen und haben bereits die Tools, die nun mit der KI zur Verfügung stehen, für uns beansprucht und sind in der Entwicklung eines individuellen AI-Hubs schon sehr weit. Damit möchten wir ein Angebot schaffen, welches Hemmschwellen deutlich senkt und die Bedienung auf die spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes zuschneidet. Unser Ziel ist es, die KI sowohl innerhalb unserer Agentur als auch gegenüber unseren Kund*innen möglichst sinnvoll und effizient einzusetzen.
21 STRATEGY, BRAND BUILDING & TECHNOLOGY
Matthias Kettemann ist Universitätsprofessor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Uni Innsbruck. Zwischen den Polen „KI rettet die Menschheit“ und „Wird KI uns umbringen?“ sieht Kettemann noch viel Platz für eine sinnvolle gesellschaftliche Diskussion. KI-Regulierung hält er für gut und wichtig, menschliche Kontrolle für unverzichtbar.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL
ETHIK, RECHT UND VERANTWORTUNG
ECO.NOVA: Wie lautet die beste Definition von KI, an der Sie sich als Jurist orientieren? MATTHIAS KETTE -
MANN: Die Nutzung von Technologien des maschinellen Lernens zur Datenverarbeitung und die Entwicklung neuer Regeln auf deren Grundlage. Im Kern handelt es sich bei Künstlicher Intelligenz um Programme, die sich regelbasiert selbst verbessern können. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einem Kind einen Stapel Bücher gibt, aus denen es lernen kann und an denen es sich orientieren soll. Gleichzeitig funktionieren automatisierte Systeme natürlich ganz anders als wir Menschen. Sie haben keine Empathie, die für uns Menschen so wichtig ist.
Obwohl es sich um selbstlernende Systeme handelt, muss deren Datengrundlage zunächst einmal von Menschen geschaffen worden sein. Wie ist es um den Schutz des geistigen Eigentums an den Trainingsdaten für die KI bestellt? KI braucht ungeheure Datenmengen, um immer besser zu werden. Die Herkunft dieser Daten ist tatsächlich eine Herausforderung. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, hat sich zum Beispiel bei Wikipedia, den Archiven großer Zeitungsverlage sowie sämtlichen öffentlich einsehbaren Patenten bedient. Das geschah wohl überwie-
22
gend unter Missachtung des Urheberrechts. Die KI-Unternehmen räumen aber keine Urheberrechtsverletzung ein, sondern sehen ihre Systeme als eine Ausnahme, weil diese lediglich mit diesen urheberrechtlich geschützten Daten trainiert werden und – so die Argumentation – man anhand des generierten Outputs die ursprünglichen Inhalte nicht mehr erkennen könne. Aber: Es gibt zumindest einen großen Fall, in dem die New York Times OpenAI geklagt hat, weil nachgewiesen werden konnte, dass die KI bei sehr spezifischen Prompts teils wörtlich das zurückgibt, was sie in den Trainingsdaten gelernt hat. Auch mir selbst ist das schon aufgefallen: Bei etwas spezifischeren Anfragen ähnelt die Antwort teils wörtlich den Einträgen aus der Wikipedia.
Das bringt die Argumentationslinie der KI-Unternehmen zum Einsturz. Absolut. Die Betreiber der KI-Systeme wissen aber selbst nicht genau, warum das so ist. Sie können weder erklären, wie genau bestimmte Outputs generiert werden, noch können sie die Probleme effektiv lösen. An diesem Beispiel sehen wir, dass generative KI noch viele urheberrechtliche und datenschutzrechtliche Probleme mit sich bringen wird.
Das Thema ist folglich noch nicht einmal ansatzweise ausjudiziert? Das ist richtig. Aber die Urteile werden kommen. Auch die österreichische NGO NOYB um Max Schrems hat Anfang Mai gegen OpenAI geklagt, weil die Outputs Datenschutzrecht verletzen, indem Daten über Personen erfunden werden.
Steht zu erwarten, dass sich diesbezüglich auch in Europa bald etwas tun wird? Ja. Schon jetzt müssen die KI-Unternehmen durch das neue europäische KI-Gesetz, den AI Act der EU, viel mehr Transparenz bei der Auswahl der Trainingsdaten walten lassen und Grundrechte der Nutzer*innen beachten.
Mit dem AI Act ist die EU vorangegangen, was die Rechtsetzung beim Thema Künstliche Intelligenz betrifft. Was ist Ziel des AI Act? Die Rechte der Menschen im digitalen Zeitalter zu sichern und zu schützen und dabei KI-Systeme in die Schranken zu weisen. Das geschieht auf zwei Arten: Einerseits werden KI hinsichtlich ihres Risikos für die Gesellschaft klassifiziert. Das Risikoprofil reicht von komplett harmlos bis hochgefährlich; diese werden dann verboten. Es findet dabei immer eine Abwägung

„Wenn man ein Produkt nicht anbieten kann, weil es gegen das Gesetz verstößt, sagt das mehr über das Produkt aus als über das Gesetz.“
ZUR PERSON
Univ.-Prof. Mag. Dr. Matthias C. Kettemann, LL.M. (Harvard), geb. 1983, ist Universitätsprofessor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck. Nach Studien der Rechtswissenschaften in Graz, Genf und als Fulbright und BoasStipendiat an der Harvard School promoviert er mit einer Arbeit zur Rechtsstellung des Individuums im Völkerrecht. 2014 wurde er als Postdoktorand an den Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ der Goethe-Universität Frankfurt gerufen, wo er sich am Institut für Öffentliches Recht mit einer Arbeit zur normativen Ordnung des Internets habilitierte und die Lehrbefugnis für Völkerrecht, Internetrecht und Rechtstheorie erhielt.
zwischen Risiko und gesellschaftlichem Nutzen statt. Andererseits wird Transparenz großgeschrieben; Trainingsdaten müssen offengelegt werden; das Funktionieren der Systeme muss offengelegt werden. Es muss also klar nachvollziehbar sein, wie ein KI-System aufgebaut ist und aus welchen Daten es gelernt hat. Hinsichtlich den besonders wichtigen Empfehlungsalgorithmen für Inhalte auf sozialen Medien gibt es eine entsprechende Pflicht auch schon im Rechtsakt zu Digitalen Diensten, dem DSA.
Dadurch könnte man auch das bekannte Problem des Bias bzw. Vorurteils in der KI besser in den Griff bekommen oder zumindest die Herkunft der Vorurteile rekonstruieren? Ganz genau. Ein Beispiel dafür ist die Bilderkennung. Frühe Systeme waren schlecht darin, nichtweiße Hautfarbe zu erkennen. Das lag vor allem daran, dass in den Trainings-Bilddatenbanken weiße Menschen weit überrepräsentiert waren. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, zu wissen, mit welchen Daten ein System trainiert wurde. So wie man bei einem Kind von dessen Kinderstube gewisse Rückschlüsse auf das spätere Verhalten ziehen kann.
eco. titel 23
„KI
-SYSTEME HABEN
KEINE EMPATHIE, DIE FÜR UNS MENSCHEN SO WICHTIG IST.“
Die EU arbeitet also daran, die Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu erhöhen und gewissermaßen mit der Taschenlampe in die Black Box KI hineinzuleuchten? Ja. Es muss auch transparent werden, in welchem Kontext die KI-Systeme eingesetzt werden und was deren Ziele sind, auf was sie optimiert werden. Die meisten KI geben sich diese nämlich nicht selbst. Die Ziele sind von Menschen vorgegeben. Bei TikTok oder Instagram ist es beispielsweise das klare Ziel der Empfehlungsalgorithmen, die Verweildauer der Nutzer*innen zu maximieren. Zukünftig werden die Unternehmen mehr Einblick gewähren müssen, worauf ihre Systeme optimiert sind. Es wird in der Öffentlichkeit nicht besonders gut ankommen, wenn herauskommt, dass diese Plattformen einzig darauf ausgerichtet sind, ihre Nutzer*Innen möglichst lange zu beschäftigen. Etwas mehr Vielfalt, etwas mehr algorithmische Förderung von nachhaltigkeitsbezogenen oder qualitativ hochwertigen Informationen ist also zu erwarten.
Wie sehen Sie den EU AI Act im Hinblick auf dessen globale Vorbildwirkung? Schon mit der Datenschutz-Grundverordnung und später dem Digital Services Act ist so etwas wie ein Brüssel-Effekt sichtbar geworden. Europäisches Recht wirkt in die ganze Welt hinaus. Nicht über Zwang, sondern mit der Kraft der guten Idee, weil das Regelwerk sinnvoll ist. Und natürlich auch deshalb, weil für Unternehmen der Zugang zum großen europäischen Markt sehr wichtig ist. Trotz aller Kritik und Abgesänge ist Europa ein kohärenter und finanzkräftiger Markt, der für Unternehmen immer noch hochattraktiv ist. Europäisches Recht ist zudem eine gute Blaupause. Andere Staaten müssen nicht erst das Rad neu erfinden, sondern können sinnvolle rechtliche Lösungen übernehmen. Das ist ein praktikabler und pragmatischer Zugang. Wir gehen davon aus, dass Europa auch in der KI-Regulierung eine Vorreiterrolle einnimmt, die weltweit Nachahmer finden wird.
Im Silicon Valley dominiert augenscheinlich die Einstellung, dass zunächst die technologischen Dinge vorangetrieben werden müssen und die Gesetze schon irgendwann folgen werden. In Europa verfolgt man offenbar eine andere Strategie. Erkaufen wir uns den rechtlichen Vorsprung mit Nachteilen in der Innovation, was die Weiterentwicklung von KI und anderen Technologien betrifft? Das würde ich nicht so sehen. In den letzten Jahren gab es noch keinen KI-Rechtsakt. Niemand hat europäische Unternehmen also daran gehindert, Weltmarktführer in der Künstlichen Intelligenz zu werden. Die Regulierung ist sicher nicht das Problem. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum es kaum digitale Weltmarktführer aus Europa gibt. Vielleicht fehlt es am Mut zum Risiko und auch am notwendigen Risikokapital. Wenn man ein Produkt nicht anbieten kann, weil es gegen das Gesetz verstößt, sagt das außerdem mehr über das Produkt aus als über das Gesetz. Das ist ein klares Indiz dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Datenschutzrechtliche Grenzen und klarere Verantwortlichkeiten für KI sind sinnvoll. Wenn Produkte damit verhindert werden, heißt das, dass sie für die Gesellschaft nicht gut gewesen wären. Es ist ein lässliches Risiko, wenn durch sinnvolle Regulierung Innovation geringfügig erschwert wird.
Vor welche ethischen Herausforderungen stellt uns die Künstliche Intelligenz? In der Auslagerung von Verantwortung sehe ich ein Problem. KI wird in immer weiteren gesellschaftlichen Kontexten eingesetzt. Bei Kreditentscheidungen, bei Bewerbungen, auch im Straßenverkehr bei cleverer werdenden Autos. Es ist aus ethischer Sicht herausfordernd, wenn man den automatisierten Systemen eine zu große Entscheidungsmacht einräumt. Menschliches Wissen, Erfahrung und vor allem Empathie spielen eine große Rolle. Gerade
Empathie kann nicht nachgebildet oder simuliert werden. Wenn automatisierte Entscheidungen nicht von Menschen in großen Zügen kontrolliert und sozial eingebettet sind, kann es leicht zu Diskriminierungen kommen. Ein zentraler Regulierungsansatz im AI Act ist, dass immer dort, wo unmittelbar auf Rechte von Menschen eingewirkt wird, es die Möglichkeit einer menschlichen Überprüfung geben muss. Wir haben ein Recht auf Rechtfertigung. Gerade in sensiblen Bereichen sind Mensch und Maschine als Teilnehmer des Entscheidungssystems zu sehen. Der Auslagerung der Verantwortung an KI-Systeme ist entgegenzutreten, gerade auch vor dem Hintergrund der scheinbaren Objektivität von KI. Es ist verführerisch, die Entscheidung automatisierter Systeme nicht zu hinterfragen. Jede KI-Entscheidung ist aber nur das letzte Glied in einer Kette menschlicher Entscheidungen – wie baue ich das System auf, mit welchen Daten wird es trainiert, wie wird es eingesetzt, welche Macht gebe ich dem System? Wir dürfen all die menschlichen Vorentscheidungen, die zur vermeintlich objektiven Entscheidung der KI geführt haben, nicht ausblenden. Das ist die große ethische Herausforderung.
Lassen Sie mich etwas polemisch fragen: Wir dürfen zwar das Denken an die Maschine delegieren, nicht aber die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen? Ganz genau. Ethische Ansätze und Perspektiven versuchen uns daran zu erinnern, dass wir das Menschliche nicht vernachlässigen und keinesfalls den Maschinen zu große Macht über uns geben dürfen.
Im Zusammenhang mit der KI wird gerne der Teufel an die Wand gemalt und der Weltuntergang herbeigefürchtet. Sind derartige Befürchtungen bei Licht betrachtet nicht bloß Nebelgranaten, die von wesentlich unmittelbareren Gefahren des breitflächigen KI-Einsatzes ablenken sollen? Zum Beispiel ist KI bereits heute ungeheuer ressourcenintensiv und ökologisch fragwürdig, außerdem befördert die KI eine Wirtschaftsform, die wohl noch weniger als unsere heutige im Dienst des Gemeinwohls steht, sondern die Umverteilung von unten nach oben sogar noch beschleunigen dürfte. So sehe ich das auch! Wenn selbst KI-Expert*innen behaupten, KI werde uns umbringen, sie klaue unsere Jobs, KI-Systeme würden sich
eco. titel 24
bald selbst Ziele geben, die Roboter würden sich irgendwann gegen uns verschwören etc., sind das Teile einer Erzählung, die in erster Linie als Ablenkungsmanöver zu werten ist. Katastrophenszenarien sollen von den verhältnismäßig kleineren, aber lösbaren Problemen ablenken, deren Lösung den Unternehmen aber keinen Spaß macht, weil sie am Profit knabbert und an der Reputation der KI-Unternehmen nagt. Vorurteile und Stereotypisierungen in Bildgeneratoren lassen sich zum Beispiel mit besseren Trainingsdaten abbauen. Daran kann man gezielt arbeiten, wenn man das möchte. KI ist auch ökologisch fragwürdig. Der Cloud-Begriff, in dessen Rahmen die Künstliche Intelligenz agiert, suggeriert einen wolkigen und sauberen Charakter. Dabei handelt es sich um nichts anderes als riesige Rechenzentren, die aufwändig gekühlt werden müssen und enorm viel Energie verbrauchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Einsatz der Künstlichen Intelligenz – genauso, wie wenn wir um drei Euro ein T-Shirt kaufen – ökologische und soziale Kosten verursacht. Nur sind diese externalisiert, verlagert und versteckt. Wir
wissen mittlerweile, dass wir unter anderem in der Textilindustrie die Lieferketten im Blick behalten müssen. Ein derartiges Bewusstsein muss im Umgang mit KI erst noch entstehen. Die großen Unternehmen lagern die menschliche Arbeit, die in die Aufrechterhaltung dieser KI-Systeme fließt, in Drittweltländer aus, wo teils Minderjährige unter schlimmen Bedingungen ganz schreckliche Inhalte anschauen müssen, um diese Systeme immer besser zu machen. Das wird aber alles ausgeblendet. Da müssen wir viel genauer hinschauen.
Diese prekären Jobs wurden – in Anlehnung an den „Schachtürken“ – als Mechanical Turks bezeichnet und sind ein großes und zu wenig bekanntes Problem. Ja. Darüber wollen die großen Unternehmen nicht reden. Es ist viel einfacher und für viele Medien wohl auch attraktiver, entweder über die großartigen Fortschritte oder aber über die vermeintlich katastrophalen Gefahren zu berichten. Zwischen „KI rettet die Menschheit“ und „Wird KI uns umbringen?“ ist aber noch viel Platz für eine sinnvolle gesellschaftliche Diskussion.
Da treffen Angstlust und Aufmerksamkeitsökonomie aufeinander. Jeder kann sich darüber aufregen und sich davor fürchten, man muss aber nicht handeln, weil man ohnehin nichts dagegen tun kann. Es werden dann selbst auf Konferenzen gleich die großen Fässer aufgemacht und es wird diskutiert, wie man den Menschen vor seiner Technik retten könnte. Bequem, ganz ohne im Moment konkret etwas tun zu müssen. Dabei gäbe es genug kleinere Probleme, die anzugehen sind. Ironischerweise rufen heute genau die Unternehmen, die mit KI in den letzten Jahren groß geworden sind, nach mehr Regulierung.
Damit will man doch bloß verhindern, dass Konkurrenz aufkommen kann. Ganz genau. Das ist aus unternehmerischer Sicht zwar verständlich, aber unehrlich. Gleichzeitig darf das kein Argument gegen Regulierung sein: Regulierung an sich ist gut und wichtig. Man muss dabei aber die richtige Balance finden. Ich würde meinen, dass der KI-Akt der Europäischen Union, der ab Sommer 2024 schrittweise in Kraft treten wird, das im Kern gut hinbekommt.

eco. titel 25
RISIKOVORSORGE UNS GEHT’S UM SIE IM ERNSTFALL VERSORGT. generali.at Anzeige KUNDENSERVICE TIROL T +43 512 5926 0, office.tirol.at@generali.com
Verfasse ein Gedicht über die Innsbrucker Nordkette in Form eines Limerick mit drei Strophen.
ChatGPT
In Innsbrucks Bergen, so weit und so hoch, Die Nordkette ragt empor wie ein Joch. Mit Gipfeln aus Schnee, Und dem Himmel so nah, so schön und so weh, Ein Traum für den, der den Bergsteigerloch.
Die Gondel sie gleitet mit ruhiger Hand, Hinauf zu dem majestätischen Land. Der Blick wird weit, In die Täler so breit, Wo das Leben pulsiert wie ein Band.
Doch Vorsicht, du Wanderer, sei stets bereit, Die Nordkette ist wild, voller Herrlichkeit. Mit Felsen so steil, Und Abgründen im Eil, Ein Abenteuer, das niemals vergeht.
Sende eine Nachricht an ChatGPT
ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen
26 Du

WAHRSCHEINLICHKEIT UND NORDKETTENLIMERICKS
Andreas Eckhardt ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation. Mit ihm haben wir den KI-Hype analysiert und freigelegt, worum es im Grunde geht, was noch kommen könnte und dass letztlich (noch) immer menschliche Agency hinter dem Maschinenhandeln steht.
INTERVIEW MARIAN KRÖLL
„WIR MENSCHEN NEIGEN DAZU, DURCHZUDREHEN, WENN TECHNOLOGIE PLÖTZLICH HUMAN -LIKE, ALSO MENSCHENÄHNLICH DAHERKOMMT.“
ECO.NOVA: Welche Definition von Künstlicher Intelligenz erscheint Ihnen am schlüssigsten? ANDREAS ECKHARDT: Ich betrachte KI als etwas, was sich seit einem Dreivierteljahrhundert entwickelt. Die bekanntesten Definitionen gehen auf John McCarthy, Marvin Minsky und Alan Turing zurück und sind nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Es ging damals darum, Computersysteme zu entwickeln, die Aufgaben erledigen sollten, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern würden. Es gab den Terminus der „Intelligenten Maschine“, die unsere Intelligenz nachahmen sollte. Das hat über die Jahrzehnte in Hollywood eine ganze Lawine maschinenzentrierter Science-Fiction-Filme losgetreten. Terminator lässt grüßen. In diesen Tagen ist der Begriff sehr viel breiter. Und zunehmend stehen die Daten gegenüber den Algorithmen im Vordergrund, vor allem im Kontext der sogenannten Generativen KI. Dabei wird von Machine Learning bzw. Deep Learning gesprochen. Es geht in der heutigen Diskussion aber genauso auch um autonome Roboter, die in der industriellen Fertigung Aufgaben ausführen müssen, oder um Natural Language Processing. Das ist die Fähigkeit, menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und zu manipulieren. Es wird zunehmend schwieriger, KI-Anwendungen klar von Nicht-KI-Anwendungen abzugrenzen. Beim sogenannten Reinforcement Learning geht es darum, den menschlichen Trial-and-Error-Lernprozess nachzuahmen. Die Maschine bekommt Feedback – nicht zuletzt von Menschen – und lernt daraus.
Warum ist die Künstliche Intelligenz, die ja nicht neu ist, heute so stark in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt? Ein wesentlicher Grund dafür ist wohl, dass die zugrunde liegenden neuronalen Netze deutlich tiefer und damit größer geworden
sind. Grundsätzlich arbeitet das ganze System auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Die neuronalen Netze, auf denen ChatGPT und Co. basieren, die so genannten Large Language Models, sind wahnsinnig tief geworden. Technisch ist nicht viel Neues passiert, die verarbeiteten Datenmengen sind aber enorm gewachsen, die zugrunde liegende Rechenleistung ebenso. Das macht die Antworten dieser Chatbots um so vieles besser als früher. Das lässt diese KI plötzlich so bedeutsam erscheinen. Wir Menschen neigen dazu, durchzudrehen, wenn Technologie plötzlich human-like, also menschenähnlich daherkommt. Wenn ChatGPT plötzlich im Stande ist, Gedichte auf die Nordkette in Form von Limericks zu verfassen, hat das aber mit der Datenmenge im Hintergrund zu tun. Ganz grundlegend ist das immer noch Mathematik.
Sprache folgt in Syntax und Grammatik gewissen, gar nicht wenig rigiden Mustern. Das kommt mathematischen Modellen sehr entgegen. Deshalb ist Textuelles um so viel einfacher zu generieren als Visuelles. Es ist erstaunlich, wie trivial Sprache im Vergleich mit visueller Darstellung ist. Da sieht man bei der KI immer noch gravierende Fehler bei Fingern oder sogar ganzen menschlichen Gliedmaßen.
Haben wir es mit einem kurzlebigen Hype – wie er sich ums Metaverse unlängst ereignet hat – oder einem Paradigmen-
wechsel zu tun? Die KI-Entwicklung reicht – im Gegensatz zum Metaverse – Jahrzehnte zurück. Ich glaube aber auch, dass das Metaverse kein kurzlebiger Hype ist, sondern eine bedeutsame Zukunft haben wird. Der anfängliche Hype darum ist aber vielleicht noch zu früh gekommen. Es war noch keine Massentauglichkeit gegeben. Bei der KI glaube ich, dass sie sich schnell bei der breiten Masse durchsetzen wird, weil der Zugang insbesondere zu Chatbots so niederschwellig ist. Auch wenn ich derzeit einen gewissen Hang zur Übertreibung sehe, glaube ich, dass wir schnell lernen werden, mit der KI umzugehen. Im Vergleich dazu kann man die Informationssuche über Internetsuchmaschinen heranziehen. Diese hat sich besonders durch Google rasant verändert. Davor wurde noch in Enzyklopädien nachgeschlagen, die quasi über Nacht obsolet geworden sind. Meine Einschätzung: KI ist gekommen, um zu bleiben.
Worin liegen die Chancen der Künstlichen Intelligenz, worin bestehen die Gefahren? Die Potenziale von KI sind gewaltig, im positiven wie im negativen Sinne. Generative KI ist bzw. kann überall dort besonders gefährlich sein, wenn sie zur Imitation von Menschen eingesetzt wird. Das kann KI schon heute sehr gut und ist sehr problematisch. Mit einem kurzen Stimm-Sample bekommt man heute schon sehr gute Simulationen der eigenen Stimme. Unsere Forschung zeigt, dass gerade in aktuellen Konflikten und Kriegen mehr und mehr KI-Artefakte eingesetzt werden, um Meinungen zu beeinflussen und Polarisierung zu erzeugen. Im Gaza-Krieg ist beispielsweise der gezielte Einsatz von Deepfakes, um Hass zu säen und die Konfliktparteien gegeneinander aufzuwiegeln, besonders besorgniserregend.
Wird die Künstliche Intelligenz derart systematisch als gigantische Desinformationsmaschine missbraucht? Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von systematisch sprechen, aber KI kann definitiv als mächtiges Hilfsmittel zur Erstellung von Desinformation eingesetzt werden.
Im Hintergrund wirkt freilich noch der Mensch mit seinen jeweiligen Motivatio-
„KI IST GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN.“
eco. titel 28
nen als Akteur. Ganz richtig. Der Mensch ist der Akteur. Es gibt sehr viele Individuen und Institutionen, die mit der KI ein mächtiges Tool an die Hand bekommen haben, mit dem sie Zwietracht säen können. Das ist politisch extrem gefährlich und letztlich auch für demokratische Systeme eine Gefahr. Wir sehen gerade erst die Spitze des Eisbergs. Desinformation wird immer weiter zunehmen und wohl im kommenden US-Präsidentschaftswahlkampf ein ganz neues Level erreichen. Eine weitere Gefahr liegt in der bewussten Täuschung von Menschen, im Phishing und im Social Engineering, bei dem Menschen zu einem gewissen Verhalten gebracht werden sollen. Wir waren beispielsweise jahrelang darauf eingestellt, dass eine SPAM-Nachricht vom „Prinzen aus Nigeria“ kommt, der uns Geld überweisen möchte. Diese Scams sind mittlerweile deutlich ausgefeilter geworden und können durch Generative KI noch einmal ein ganz anderes Level erreichen, so dass es immer schwieriger wird, so etwas als versuchten Betrug zu erkennen.
Stehen wir vor diesem Hintergrund nicht gesellschaftlich vor der großen Aufgabe, uns gegen KI-generierten Content zu rüsten und vielleicht sogar eine Diskussion zu führen, die zu einer Renaissance des Wahrheitsbegriffs führen kann? Absolut. Das ist aus meiner Sicht das allerwichtigste Thema. Beim Thema Informationssuche und Verifizierung bin ich in Bezug auf die jüngeren Generationen mittlerweile sehr besorgt. Woher beziehen wir unsere Informationen, wie verifizieren wir diese? Das hat sich im Vergleich zu früher massiv verändert und es wird so weitergehen. Die Digital Natives haben ein anderes Informationsverhalten. Es braucht mehr Qualitätsjournalismus, der mit nachvollziehbaren und seriösen Quellen arbeitet und der Desinformation etwas entgegensetzt. Heute kann via Social Media jeder jegliche Art von Information in die Welt blasen. Das ist schwierig. Wir sollten den Studienanfänger*innen an der Universität eigentlich als Erstes die Grundlagen der Informationssuche beibringen.
Da bin ich ganz bei Ihnen, bin aber der Meinung, dass es am Beginn eines Studiums im Erwachsenenalter eigentlich schon zu spät dafür ist. Man müsste bereits in den Schulen damit anfangen, die Jugendlichen zu sensibilisieren. Da gebe ich Ihnen Recht. Ich mahne das bei jeder Gelegenheit an. Ich war anfangs begeistert, als in Tirol die digitale Medienbildung als
ZUR PERSON
Andreas Eckhardt ist seit 2020 Universitätsprofessor am Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und Logistik an der Leopold-FranzensUniversität Innsbruck. 2010 promovierte er mit summa cum laude an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Vor seiner akademischen Laufbahn arbeitete er als Projektmanager für DaimlerChrysler Taiwan in Taipeh. Seine Forschung zu Technology Adoption, Cybersecurity, Digital Innovation, Electronic Commerce, Ethical Design und der Virtualisierung von Organisationen wurde in Büchern, Buchkapiteln, Tagungsbänden sowie zahlreichen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht.
Schulfach eingeführt wurde. Häufig wird dort aber eher das Zehnfingersystem oder die Grundlagen von Microsoft Word und Excel unterrichtet, anstatt auf Themen wie Desinformation, Informationsverifikation und die Potenziale und Gefahren von KI einzugehen.
Da müsste man eigentlich in der Pädagog*innen-Ausbildung ansetzen. Ja, man muss die Bildenden bilden. Hierzu müssen die notwendigen Programme aufgesetzt und deren Umsetzung schnellstmöglich vorangetrieben werden.
Wie ist es um die Chancen durch KI bestellt? Das ist ebenso wie bei den Risiken ein riesiges Thema. KI ermöglicht Potenziale, die bis dahin fast ungeahnt waren. Häufig wird KI heute noch mit Automatisierung verbunden, die breiten Möglichkeiten der Augmentation – der Erweiterung des Handlungsspielraums für Menschen durch die Maschine –sind bisher noch deutlich zu wenig betrachtet worden. Mit der enger werdenden Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI ist sehr viel möglich, beispielsweise im Innovations-


Mit dem WIFI Tirol in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen!
Lernen Sie, KI-Technologien sinnvoll einzusetzen – optimieren Sie Ihren Alltag und Ihr Unternehmen mit unseren Kursen:
• Intensivkurs: Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen
• Einführung in die KI Programmierung
• KI Adaption für Unternehmer
• Copilot – KI im Office Management
• KI Akademie
• Daten und KI-getriebene Nachhaltigkeit
• und viele mehr!

Jetzt anmelden und Platz sichern!
t: 05 90 90 5-7256
e: patricia.hueber@wktirol.at
eco. titel 29
Bleib neugierig. tirol.wifi.at/KI
management und bei der Generierung von neuen Lösungsansätzen für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit. Wir haben uns zum Beispiel in einem Projekt angesehen, was KI für die Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen Sinniges beitragen könnte. Speziell für die Generierung neuer Ideen und Lösungsansätze kann die KI tatsächlich ein sehr gutes Werkzeug sein. KI kann aus vielen Ideen die interessantesten Aspekte miteinander verbinden und Synthesen erzeugen.
Hat KI als Co-Innovator gemeinsam mit dem Menschen großes Innovationspotenzial? Absolut. Der Mensch bleibt als maßgeblicher Akteur an Bord, die KI verwebt und synthetisiert Ideen. Das ist ein Prozess, der Menschen nicht so leicht fällt. Ein weiterer Aspekt ist das Prinzip der Serendipität. Die KI macht uns ständig mit Perspektiven und Lösungen bekannt, von denen wir vorher nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Wenn wir uns darauf einlassen können, können wir davon profitieren. KI könnte außerdem als neutraler Moderator in gesellschaftlichen Diskursen eingesetzt werden, die sich ohnehin zunehmend in die Onlinewelt verlagert haben.
Den von Ihnen skizzierten Chancen und Gefahren von KI ist gemein, dass der Künstlichen Intelligenz darin keinerlei Agency zugebilligt wird. Insofern hat die KI wohl – ganz anders als manchmal insinuiert – kein Eigenleben? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich halte es für gefährlich, wenn man der KI Agency unterstellt. Das führt dazu, dass wir menschliches Verhalten sehr viel stärker entschuldigen. KI ist nur dann mächtig – im positiven wie im negativen Sinne –, wenn menschliches Handeln dahintersteckt.
Vor der technologischen Singularität bzw. Superintelligenz brauchen wir uns folglich nicht fürchten? Ich finde die Diskussion darüber sehr spannend. Aus meiner Sicht müssen wir das nicht fürchten. Wir müssen unseren Blick für die tatsächlich problematischen Dinge im Zusammenhang mit KI schärfen. Dabei wird es auch darum gehen, den Einfluss von KI zu begrenzen, so dass Algorithmen nicht unbeschränkt lernen können. Die technologische Singularität steht uns mit Sicherheit nicht bevor, wir müssen uns aber sehr wohl damit befassen, wie wir weiterhin das Primat der Human Agency garantieren können. Auch hier, wie im Übrigen bei allen digitalen Themen, ist Awareness ganz wichtig. Es ist nicht erwünscht, dass KI allzu selbständig wird.
„DIE
KI MACHT UNS STÄNDIG
MIT PERSPEKTIVEN UND LÖSUNGEN BEKANNT, VON DENEN WIR VORHER
NICHT WUSSTEN, DASS SIE
ÜBERHAUPT EXISTIEREN.“
Apropos Awareness: Es gibt das Chinese-Room-Gedankenexperiment des Philosophen John Searle, in dem dieser die Ansicht widerlegen möchte, dass digitale Computer allein dadurch Bewusstsein erlangen könnten, dass sie ein passendes Programm ausführen. Halten Sie Searles These für anschlussfähig? Bis dato ist KI definitiv Mathematik und Wahrscheinlichkeit. Es gibt allerdings erste Forschungsansätze, die sich damit befassen, wie man der Maschine sehr viel mehr Daten – Hautleitwiderstand, Augenbewegungen, Herzfrequenz und vieles mehr – ihres menschlichen Gegenübers zur Interpretation zur Verfügung stellen kann. Die Ergebnisse dieser Forschung werden interessant zu beobachten sein. Wir müssen aber aufmerksam bleiben und die zugrunde liegenden Forschungsansätze ethisch deutlich unter die Lupe nehmen.
Das lässt sich aber auch wieder auf mathematische Prozesse reduzieren. Die Maschine bekommt eben mehr Daten, die Art ihrer Verarbeitung ändert sich nicht grundlegend. Richtig. Eine Maschine wird nie die menschliche Psyche verstehen können.
KI-Forscher Connor Leahy hat gesagt: „Das menschliche Gehirn ist etwa dreimal so groß wie das eines Schimpansen, unseres nächsten evolutionären Verwandten. Schimpansen fliegen nicht auf den Mond, Menschen schon. GPT4 ist etwa zehnmal größer als GPT3. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich auf Systeme treffen, die zehnmal größer sind als GPT4. Hoffen wir, dass sie uns freundlich gesinnt sind.“ Außerdem: „Wenn wir Maschinen bauen, die leistungsfähiger sind als alle
Menschen, dann wird die Zukunft ihnen gehören, nicht uns.“ Ist das Alarmismus? Ich denke ja. Das Grundprinzip der KI bleibt schließlich dasselbe, die Ergebnisse werden durch mehr Daten und höhere Rechenleistung lediglich besser.
KI ist sehr ressourcenhungrig. Wie lässt sich die Künstliche Intelligenz mit dem Thema Nachhaltigkeit vereinbaren? Sehr schwer. Je besser die Modelle werden, desto mehr Rechenleistung benötigen sie. Dadurch, dass wir mit KI-Unterstützung in komplexen Situationen klügere Entscheidungen treffen können, wird Energie eingespart werden können. Ob das den Ressourcenhunger der KI-Systeme aufwiegen kann, bleibt abzuwarten. Ich bin skeptisch.
Die KI ist nur so gut wie ihre Datenbasis. Gelegentlich wird das Prinzip „Garbage in, Garbage out“ bemüht, um das zu illustrieren. Wie sehen Sie den Umgang mit Trainingsdaten? Dieses Prinzip stimmt. Der verantwortungsbewusste und transparente Umgang mit Trainingsdaten gehört zu den größten Problematiken rund um die KI. Die KI reproduziert, was sie anhand dieser Daten gelernt hat. Sind die Trainingsdaten problematisch und eindimensional, wird es auch der Output streckenweise sein. KI, die mit primär US-amerikanischen Daten trainiert wurde, wird auch eine US-zentrierte Kulturperspektive verbreiten. Das muss man bedenken. Es bedarf wesentlich mehr Regulierung und Transparenz bei diesen Trainingsdaten. Außerdem muss in Europa in diesem Bereich mehr Entwicklung stattfinden. Es wird langfristig bedenklich, wenn wir Europäer nur den Microsofts, Googles und Apples dieser Welt ihre Modelle abkaufen, ohne selbst aktiv zu werden.
eco. titel 30
Unterberger Denzel Innsbruck Griesauweg 32, 6020 Innsbruck Telefon 0512/33435
Unterberger Lienz
Peggetzstraße 10, 9900 Lienz Telefon 04852/63333-50
Unterberger Kufstein Endach 32, 6330 Kufstein Telefon 05372/6945
Unterberger Telfs Wildauweg 1, 6410 Telfs Telefon 05262/66766-0
Unterberger St.Johann Anichweg 1, 6380 St. Johann/T. Telefon 05352/62389 www.unterberger.cc
BMW i5 eDrive40 Touring: Verbrauch elektrisch, kombiniert WLTP in kWh/100 km: 16,7–19,3; Elektrische Reichweite, WLTP in km: 483 - 556
* Angebot der BMW Austria Leasing GmbH, BMW Select Leasing für den BMW i5 eDrive40 Touring, Anschaffungswert höchstens € 70.297,10, Anzahlung € 20.590,-, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt € 469,- mtl., genaue Höhe abhängig von Sonderausstattung und Zubehör gem. individueller Konfiguration, 10.000 km p.a., Restwert € 30.370,94, Rechtsgeschäftsgebühr € 434,70, Bearbeitungsgebühr € 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, eff. Jahreszins 2,47%, Sollzins fix 1,99%, Gesamtbelastung € 74.167,64. Beträge inkl. NoVA und MwSt. Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt für sämtliche Fahrzeuge der Elektropalette von BMW bei Vertragsabschluss von Kauf- und Leasingvertrag von 07.02.2024 – 30.06.2024, Auslieferung bis 30.09.2024. Unterschiedliche Konditionen je nach Baureihe: 1,99% Fixzins bei BMW i5; 2,99% Fixzins bei BMW i4, iX3


und iX; 3,99% Fixzins bei BMW iX1
der Aktion
Modellbaureihe BMW i7. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die teilnehmenden BMW Partner zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit anderen Leasing-Angeboten. Angebot gültig bei allen teilnehmenden BMW Partnern. Abbildung Symbolfoto.
FÜR
Freude
Fahren. 100% Elektrisch.
und iX2. Ausgenommen von
ist die
1,99%* FIXZINSSATZ.
DEN BMW i5 TOURING.
am

DANKE, ROBOTER!
Das
Zeitalter der Künstlichen Intelligenz hat begonnen.
Die Verkäuferin des Modegeschäftes in einer Shopping Mall im kalifornischen Santa Clara sah den kleinen Lieferroboter auf sich zukommen. Sie drückte auf ihrer App einen Knopf und der Deckel des kühlboxgroßen Roboters auf vier Rädern öffnete sich. Nachdem sie ihm ein Plastiksackerl mit dem bestellten Mittagessen entnommen hatte, schloss sie den Deckel wieder und tätschelte den Roboter.
Ähnlich ging es in San Francisco, als ich Gäste aus Europa in einem der fahrerlosen Robotertaxis der Google-Schwesterfirma Waymo mitgenommen hatte. Nachdem wir am Ende der Fahrt ohne Fahrer durch die hügelige Stadt ausgestiegen waren, sagte einer der Gäste „Danke, Waymo!“ und posierte für ein Selfie mit dem selbstfahrenden Auto. „Die Zukunft ist bereits hier, sie ist bloß nicht gleich verteilt“, meinte der Science-Fiction-Autor William Gibson. Eine Zukunftstechnologie hat vor eineinhalb Jahren wie der Blitz eingeschlagen, fasziniert und weckt zugleich Ängste. Eine sogenannte generative Künstliche Intelligenz in Form eines Chatbots der in San Francisco beheimateten Firma OpenAI war veröffentlicht worden und Gespräche mit ihr klangen wie die mit einem menschlichen Gegenüber. Kein Wunder, dass ChatGPT in aller Munde war und Gespräche am Stammtisch, bei Familienfeiern und in der Öffentlichkeit dominierte.
So wie Menschen einen Lieferroboter oder ein Robotaxi vermenschlichen und sich bei ihm bedanken, genauso erschien vielen ChatGPT als verblüffend menschenähnlich.
Auch wenn die Anfangsversion dieses „großen Sprachmodells“ noch etliche Fehler – sogenannte „Halluzinationen“ –beging und oft munter darauflosfabulierte, konnte sie sehr rasch immer mehr. Auch Bilder, Videos oder Musik konnte sie auf Anweisung generieren und ein wahres Wettrennen begann, wer von den großen Softwareunternehmen wie Microsoft, Google oder Meta die bessere KI anbieten kann. Schon kurz nach der Veröffentlichung von ChatGPT wurde sie in Fertigungsprozesse, in Bürosoftware oder zur medizinischen Forschung eingesetzt. Die Zahl der Anwendungsgebiete stieg steil nach oben und es gab keine Profession und keine Branche, die nicht für sich Einsatzmöglichkeiten von KI sah. So rasch kommen die Fortschritte und Anwendungen der KI auf uns zu, dass es selbst Experten schwerfällt, Schritt zu halten. Die Amerikaner sagen „drinking from the firehose“, was wörtlich übersetzt bedeutet „aus dem Feuerwehrschlauch trinken“. Hunderte Sprachmodelle und „Generative Pre-trained Transformer“ eifern um die Gunst der Benutzer und Firmen, denn sie versprechen eine Umwälzung unseres Lebens und unserer Arbeit, wie wir sie das letzte Mal mit dem Internetbrowser erlebt haben. Wir müssen uns also nicht schämen, wenn wir der Entwicklung nur mit Mühe folgen können.
Wie schnell diese Entwicklung fortschreitet, lässt sich mit einem Beispiel zu einer anderen, uns vertrauten Technologie veranschaulichen. Das Web 1.0, das in den 1990er-Jahren noch von statischen Internetseiten mit blinkenden Grafiken geprägt war, wurde durch das Web 2.0 abgelöst, bei dem soziale Medien, dynamische Inhalte, Onlineshopping und
eco. mmentar 32
VON MARIO HERGER
ZUR PERSON
Mario Herger, geboren 1971 in Wien, lebt seit 2001 im Silicon Valley, forscht nach Technologietrends, schreibt Bücher dazu und berät Unternehmen zu Themen wie Innovation, Silicon Valley Mindset, Foresight Mindset, Automotive, Künstliche Intelligenz, Kreativität oder Intrapreneurship, zu denen er auch Vorträge und Workshops hält. Lange Jahre war Herger bei SAP unter anderem als Entwicklungsleiter und Innovationsstratege beschäftigt. Nun hilft er Unternehmen dabei, den innovativen und entrepreneurischen Spirit aus dem Silicon Valley auf ihre Organisationen zu übertragen, um innovativer zu werden, Trends und Tipping Points frühzeitig zu erkennen und sie mitzubestimmen. Herger empfängt immer Delegationen aus Europa im Silicon Valley und bringt sie in Kontakt mit Leuten und Unternehmen vor Ort. Im März hielt er am Innovationstag der Standortagentur Tirol in Innsbruck eine Keynote über die Potenziale von Künstlicher Intelligenz. derletztefuehrerscheinneuling.com
das Browsen mit Smartphones und Tablets vorherrschten. Das aktuelle Web 3.0 wandelt sich in eines, das virtuelle Realität, Kryptowährungen und das Metaverse beinhaltet.
Künstliche Intelligenz 1.0 hingegen begann, vereinfacht ausgedrückt, mit einzelnstehenden Chatbots wie ChatGPT, um im zweiten Schritt rasch mit anderer Software verknüpft zu werden – um beispielsweise als KI-Assistenten automatisch einen Flug umzubuchen und dabei gleichzeitig das Hotel und den Leihwagen zu verlängern. Stunden an Lebenszeit, die wir nicht am Telefon verbringen müssen, gibt uns diese KI 2.0 zurück. Existierte KI bis dahin nur im Computer oder in der Cloud, so erhält sie mit KI 3.0 einen Körper. Sie steuert Autos, fliegt in Drohnen mit und bewegt sich in Robotern, die uns langweilige oder gefährliche Aufgaben im Haushalt oder in der Fabrik abnehmen.
Benötigte das Web noch knapp 30 Jahre, um von Version 1.0 auf 3.0 zu kommen, so hat die KI in nicht einmal drei Jahren mehrere Versionsgenerationen durchlaufen. Wer hier zögert und zuerst mal abwarten will, ob dieser „Hype“ bleibt oder doch wieder vergeht, macht sich damit selbst obsolet. Nicht die KI wird Arbeitsplätze ersetzen und Firmen bedrohen, sondern Arbeitnehmer und Mitbewerber die KI einsetzen, werden diejenigen verdrängen, die meinen, KI nicht zu brauchen.
Zeit. Auch Videos lassen sich sehr viel günstiger drehen oder die Zeit von einem Sketch zu einem 3-D-Modell im Produktdesign drastisch verkürzen.
Mein persönliches Highlight des Jahres war die Entzifferung von Papyri, die beim Ausbruch des Vesuvs verkohlt wurden und die wir nun zum ersten Mal wieder lesen können. Zweitausend Jahre lang lagen hunderte dieser Schriftrollen verschüttet in einer Villa in Herculaneum, die dem Schwiegervater von Julius Cäsar gehört haben soll, nun geben sie ihre Geheimnisse preis. Vielleicht entdecken wir darunter auch unbekannte oder längst verloren geglaubte Texte griechischer und römischer Philosophen und Schriftsteller.
Existierte KI bis dahin nur im Computer oder in der Cloud, so erhält sie mit KI 3.0 einen Körper.
Mächtige Werkzeuge können in den falschen Händen allerdings auch Schäden anrichten. Mit einem Hammer können wir Häuser und Möbel bauen, aber auch Scheiben einschlagen oder Menschen verletzen. Mit KI stehen wir vor der Herausforderung, Voreingenommenheiten in den Daten zu verhindern, um eine Benachteiligung von Frauen oder Minderheiten zu vermeiden. Betrüger haben schon herausgefunden, wie KI für Deepfakes eingesetzt werden kann, um Stimmen zu klonen oder Videos zu fälschen und damit den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen oder ihren Ruf zu ruinieren. Auch die Erstellung und Verbreitung von Falschnachrichten lässt sich mit KI beschleunigen. Richtig eingesetzt hingegen können schon heute Softwareentwickler sehr viel rascher besseren Code schreiben. Lange E-Mail-Ketten, die ich erst mal mühsam durchlesen musste, kann ich nun einfach von der KI zusammenfassen lassen. Neue Medikamente lassen sich damit in kurzer Zeit durchtesten. Qualitätsüberprüfungen in der Fertigung lassen sich beschleunigen. Unterrichtsmaterialien schneller erstellen zu können, spart dem Lehrkörper
Künstliche Intelligenz erleichtert uns nicht nur viele Aufgaben, sie macht auch neue möglich. Sie kommt auf Zusammenhänge drauf, die aufgrund ihrer Komplexität von Menschen nicht oder nur mit großem Aufwand durchführbar gewesen wären. Aber nicht nur das: KI ist die erste Technologie, die Menschen geschaffen haben, die sich selbst verbessern kann. Sie kann ihren eigenen Softwarecode und ihre eigenen Algorithmen optimieren und neue entdecken. Statt einer exponentiellen kommt es zu einer superexponentiellen Entwicklung, also einer Beschleunigung der Beschleunigung des Fortschritts.
Wohin das führen wird, können wir genauso wenig vorhersagen wie vor 30 Jahren, als wir nur spekulieren konnten, was uns die Entwicklung des Internets bringen wird. Oder die Erfindung der Glühlampe oder des Satelliten. Dass wir damit mittels GPS einmal in selbstfahrenden Autos fahren, ein Restaurant oder unseren Lebenspartner in unsere Nähe finden werden oder dank den auf Knopfdruck abrufbereiten Informationen unser Leben lebenswerter gestalten können, war kaum voraussehbar. Doch eines ist klar: Wie wir uns ein Leben ohne künstliches Licht, Internet oder GPS nicht mehr vorstellen wollen, so wird es auch mit KI sein. Meine Elterngeneration erzählte mir mit einem Schauer über dem Rücken, wie sie ohne Fernseher auskommen mussten. Meine Generation wiederum erklärt heute jungen Menschen von der Zeit vor dem Handy oder Internet. Und bald wird die heutige junge Generation sich wundern, wie ein Leben ohne KI und Roboter gewesen sein musste. Sicher ist: Die einzige Konstante im Leben ist, dass es immer Veränderungen geben wird. Mit KI stehen wir am Beginn einer neuen Zeitenwende.
33 eco. mmentar

KI - FRAGEN und der Versuch von ANTWORTEN .
WIRD UNS DIE KI DOMINIEREN?
The Sky is the Limit. Man könnte annehmen, dass in Sachen KI die virtuellen Bäume tatsächlich in den Himmel wachsen. So rasant geht deren Entwicklung voran. Vieles davon ist freilich bei näherer Betrachtung Marketing. Manches wird angekündigt, um neues Venture Capital zu lukrieren und Kursfeuerwerke an den Börsen abzubrennen. Das ist legitim. Nur sollte man sich davon nicht einlullen lassen. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass KI tatsächlich „the greatest thing since sliced bread“ sein könnte und tatsächlich so etwas wie eine Zeitenwende einleitet. Das ist mit der auch in wissenschaftlichen Kreisen existierenden Erwartungshaltung verbunden, dass es mit dem Wachstum exponentiell weitergehen könnte. An dieser Annahme werden vermehrt Zweifel angemeldet, nicht zuletzt von Wissenschaftler*innen. Etwa in einem fundierten Paper*, das sich mit dem sogenannten Zero-Shot-Learning befasst. Das ist ein maschinelles Lernszenario, bei dem ein KI-Modell darauf trainiert wird, Objekte oder Konzepte zu erkennen und zu kategorisieren, ohne dass es zuvor in den Trainingsdaten Beispiele für diese Kategorien oder Konzepte gesehen hat. Vieles deutet darauf hin, dass immer größer werdende generative KI-Modelle keinen exponentiellen und nicht einmal linearen Zuwachs an Nutzen bringen. Es kann aber auch ganz anders kommen: OpenAI hat mit GPT-4o (das o steht für omni) eine erste starke Duftmarke für die Fähigkeiten multimodaler KI, die gleichzeitig Text, Audio, Fotos und Video kombinieren kann, hinterlassen. Ungemach droht dagegen von rechtlicher Seite, schlummert doch in den potenziellen Urheberrechtsverletzungen, die im KI-Bereich „part of the game“ zu sein scheinen, eine echte Bombe.

BUCHTIPP
SIMPLY. Künstliche Intelligenz


KI LL ER TE CH NO LO GIE
* Für Interessierte gibt’s hier das gesamte (englischsprachige) Paper
Hilary Lamb, Joel Levy, Claire Quigley, DK Verlag, 160 Seiten, EUR 12,95
Die Sachbuchreihe „SIMPLY“ von Dorling Kindersley macht selbst komplexe Themen auf originelle Art anschaulich und verständlich. Wir sind Fans der ersten Stunde. Das neueste Mitglied ist die perfekte Einführung in die Grundlagen der Artificial Intelligence. Mittels origineller Grafiken und kurzer Texterläuterungen wird die Themenvielfalt auf das Wesentliche konzentriert. Das visuelle Nachschlagewerk erläutert 120 Konzepte, Anwendungsfelder und Theorien der Künstlichen Intelligenz und beleuchtet ethische Fragestellungen und den wachsenden Einfluss der KI auf unser Leben. Reinlesen macht klüger!


IST KI GEFÄHRLICH?
Schwer zu sagen. Die größte Gefahr für den Menschen dürfte auf absehbare Zeit der Mensch bleiben. Als Elon Musk die Forderung nach einem Moratorium in der KI-Entwicklung unterstützt hat, dürfte das nicht aus Sorge um die Menschheit geschehen sein. Der exzentrische Multimilliardär wollte selbst Zeit gewinnen, um der Konkurrenz eine eigene KI entgegenzusetzen. Überhaupt nimmt sich das Rennen um die beste und leistungsstärkste KI aus der Ferne betrachtet wie ein Circle Jerk einer relativ überschaubaren Runde an Milliardären aus. KI ist zweifellos mächtig. Gerade auch als Buzzword, das die Brieftaschen potenzieller Investoren, die sich nicht ausreichend mit der Materie auskennen (können), öffnet. Es ist längst nicht gesagt, dass alle KI-Start-ups ihre Ideen und Versprechungen in ein nachhaltiges Geschäftsmodell überführen können. Interessanterweise wollen sehr viele Unternehmen, vom Start-up bis zum Konzern, plötzlich nicht mehr primär Autohersteller oder Tech-Companies, sondern vor allem „irgendwas mit AI“ sein. Außerdem findet durch die Allgegenwart des Claims, man greife bei den eigenen Produkten und Dienstleistungen auf KI zurück, etwas sei „powered by AI“, sogenanntes AI-Washing* statt. Es gibt nicht wenige Expert*innen, die in Bezug auf die KI-Ökonomie sogar das böse B-Wort, wie Bubble oder Blase, in den Mund nehmen. Einiges deutet darauf hin, dass manche Unternehmen in Bezug auf ihre KI-Kompetenz mehr versprochen haben, als sie halten können. Sollte dieses Worst-Case-Szenario eintreten, wird es an der Börse, wo die Kurse der eng mit KI assoziierten Unternehmen (Google, AMD, Amazon, Nvidia, Microsoft, SMCI, Meta, Palantir …) über eine grundsätzliche Schwächephase der Wirtschaft hinweggetäuscht haben, ein Blutbad geben. Während OpenAI und andere Player unverhohlen Kurs auf die sogenannte AGI (Artificial General Intelligence, welche bei der Lösung der meisten wirtschaftlich bedeutenden intellektuellen Aufgaben menschliche Fähigkeiten übertrifft) genommen haben, wird bereits gescherzt, dass bei Amazon das Akronym AGI für „A Guy in India“ stehe.
*Manipulation von Informationen über die Fähigkeiten, Grenzen oder Risiken von eingesetzten KI-Produkten


WIRD KI UNS IN DER ARBEITSWELT ÜBERFLÜSSIG MACHEN?
KI wird definitiv für Umwälzungen in der Arbeitswelt sorgen. Überflüssig zu werden droht der Mensch dadurch vorerst nicht, auch wenn es – abhängig von der Perspektive – sowohl Befürchtungen als auch Versprechungen in dieser Hinsicht gibt. OpenAI-CEO Sam Altman hat unlängst seine Vorstellung einer KI-zentrierten Welt vorgestellt: Zunächst war seinerseits noch von einem bedingungslosen Grundeinkommen die Rede gewesen, das in einer superautomatisierten Gesellschaft eine offensichtliche und einfache Möglichkeit wäre, das Problem einer robusten, produktiven Wirtschaft mit sehr wenigen Arbeitsplätzen für Menschen zu lösen. Wenn die Unternehmen florieren, es aber nicht mehr viele Arbeitsplätze gibt, kann man einfach jedem Menschen ein Grundeinkommen auszahlen. So die Theorie. Unlängst klang das dann aber so: „Ich frage mich, ob die Zukunft nicht eher wie Universal Basic Compute als ein universelles Grundeinkommen (Universal Basic Income) aussieht“, sagte Altman. Damit ist anstelle von Geld der universelle Zugang zu KI-Rechenleistung gemeint, die man entweder selbst nutzen oder verkaufen kann. Eine interessante, aber aus heutiger Sicht unrealistische Vorstellung aus dem Grund, dass man mit Compute im Gegensatz zu Geld keine Rechnungen zahlen kann. Nicht auszuschließen, dass sich das zukünftig ändert. Das optimale KI-Mindset für Arbeitnehmer*innen wie Wirtschaftstreibende dürfte zentral zwischen den Polen Leugnung (KI wird meinen Job nicht übernehmen können; Wir haben keine Zeit, uns um KI zu kümmern) und Panik (KI wird mich den Job kosten! Wir werden bankrottgehen!) zu finden sein und sich damit befassen, wie man durch KI sowohl individuell als Arbeitnehmer*in sowie im Gesamten als Unternehmen produktiver werden kann. KI kann den Weg von der Idee zum Endresultat mit Sicherheit drastisch verkürzen.

Prognosen bleiben wie immer schwierig, erfahrungsgemäß besonders dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Es ist nicht mit völliger Gewissheit vorhersehbar, ob die KI sich tatsächlich als alles transzendierendes und disruptierendes Element in unserer modernen Welt festsetzen wird oder aber sich lediglich als eine episodische Erscheinung „automatisierter Dummheit“ entpuppt. Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Künstliche Intelligenz genutzt wird. Die Gesellschaft täte jedenfalls gut daran, sich kollektiv zu wappnen und endlich eine der größten Krisen dieser Zeit anzugehen, die sie so vulnerabel für Bullshit jeglicher Art gemacht hat: Die Krise des kritischen Denkens.

 FAZIT
FAZIT
TOP ARBEIT GEBER
„Händeringend“ werden sie gesucht: Arbeitskräfte – und das quasi allerortens, in jeder Branche und in fast allen Positionen. Was aber macht Unternehmen aus, in denen Menschen gerne arbeiten?
eco. wirtschaft 36
ie Sache mit der Arbeit ist kompliziert. Die Herkunft des Wortes leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen „arebeit“ ab, das so viel heißt wie Beschwernis, Leiden oder Mühe. Tja. Da haben wir den Salat, denn viele Menschen sehen ihre Arbeit tatsächlich noch so. Natürlich muss der Großteil von uns arbeiten, um sich damit das Leben zu finanzieren. Das schafft fast zwangsläufig eine gedankliche Diskrepanz: Nämlich, dass das eine ein notwendiges Übel ist, um sich das andere – Schöne, Gute, Tolle und Abenteuerliche – leisten zu können. Radioslogans wie „Endlich Wochenende!“ sind dabei nur mäßig hilfreich, weil sie suggerieren, dass das Wochenende viel supriger ist als die Arbeitswoche. Abgesehen davon, dass es Menschen gibt, die samstags, sonntags oder feiertags arbeiten.
Wir verbringen während unseres erwerbsfähigen Alters (in der Regel) ganz schön viel Zeit bei der Arbeit, da kann man diese doch als etwas Sinnvolles, Schönes und Bereicherndes betrachten. Als etwas, das einen zwar fordert, auf der anderen Seite aber auch viel gibt. Nicht nur Geld. Arbeitgeber haben deshalb die Aufgabe, ihre Mitarbeiter*innen nicht nur adäquat zu bezahlen (davon gehen wir aus!), sondern ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich entfalten können und in dem sie ernst genommen werden. Kein Arbeitgeber ist für das persönliche Glück und die individuelle Zufriedenheit seiner Mitarbeiter*innen zuständig, das ist in der Tat die Sache jedes Einzelnen selbst. Man kann aber einen Rahmen schaffen, in dem man seine Mitmenschen zumindest nicht unglücklich macht. Das wiederum funktioniert selten ausschließlich mit monetären Anreizen, die im Allgemeinen nur sehr kurze Befriedigung bieten, sondern mit einer Kultur des gegenseitigen Respekts.
WERT SCHÄTZEN
Die Arbeitswelt ist im Wandel. Damit erzählen wir Ihnen nichts weltbewegend Neues. Es wäre auch eigenartig, wäre sie es nicht. Immer schon hat sich Arbeit verändert, angepasst, teils neu erfunden. Der industrielle und technologische Fortschritt hat seit jeher Berufsbilder verschwinden und neue entstehen lassen und jede Generation hat sich in irgendeiner Weise von der vorhergehenden emanzipiert. Neu ist, dass diese Veränderungen immer schneller vonstattengehen.
erfolgs. geschichten

Die INVIBE-Geschäftsführer Philip Zischke, Markus Hangl und Florian Streiter mit Hypo Tirol-Betreuer Johannes Rachel
Krise als Chance
Mit der Vision eines tirolweiten Fitnessverbundes startete INVIBE mit dem ersten Studio 2019 in Volders. Heute können INVIBE-Mitglieder mit nur einem Abo 17 Standorte von Tirols größtem Fitnessund Gesundheitsanbieter nutzen.
Irgendwie ging alles Schlag auf Schlag. Nach der Initialzündung im Oktober 2019 kam postwendend der absolute Tiefschlag mit dem Lockdown im März 2020 und der drohenden Betriebsschließung für alle Fitnessstudios für fast zwölf Monate. Aufgeben war allerdings keine Option. Aus der Not gelang es den Geschäftsführern als erstes Fitnessstudio österreichweit, dank medizinischer Trainingstherapie unter strengen Vorlagen ihre Tore wieder zu öffnen. Mit der Integration von INVIBE Physio und fünf weiteren Studios im Oberland wuchs die INVIBE-Familie 2022 bereits auf elf Standorte. Eine optimale Kombi, Fitness, Wellness und Physiotherapie unter einem Dach zu vereinen. So ging INVIBE als Sieger aus der Krise hervor und konnte in Folge mit den Übernahmen von Body & Soul Innsbruck und ACT Fitness Tivoli sowie der im März 2024 erfolgten Neueröffnung in Telfs am Obermarkt das tirolweite Angebot perfekt abrunden. Mittlerweile finden bereits mehr als 20.000 INVIBE-Mitglieder ihren persönlichen Weg zu mehr Gesundheit und Fitness und trainieren mit einem Abo in 17 INVIBE-Studios über ganz Tirol verteilt, von Kitzbühel bis nach Zams.
Die erfolgreiche Expansion in Innsbruck gelang auch dank des richtigen Partners in Finanzangelegenheiten, der Hypo Tirol. „Vom ersten Gespräch an hat man das Potenzial erkannt und an uns geglaubt. Bislang wurden alle Erwartungen weit übertroffen“, freuen sich die INVIBE-Chefs. Zudem zählt die Hypo Tirol zum Top-Firmenfitness-Partner von INVIBE. PR
eco. wirtschaft 37
JE MEHR DIE ARBEIT IN DIE NÄHE VON MASCHINEN RÜCKT, DESTO WICHTIGER IST DIE ARBEIT AM MENSCHEN.
Doch nicht nur die Art der Arbeit verändert sich, sondern auch die Art, wie wir arbeiten. Arbeit wird flexibler, unabhängiger. Mit dem eklatanten Fachkräftemangel und der Suche nach Arbeitskräften hat sich außerdem das Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmer quasi umgekehrt. Das heißt, dass sich Unternehmen heute noch mehr als bisher um ihre Mitarbeiter*innen bemühen müssen. Das hat zur Folge, dass sich nicht mehr nur Arbeitnehmer*innen verkaufen müssen, sondern auch Arbeitgeber*innen. Employer Branding ist der Begriff dazu, um gute Mitarbeiter*innen auf der einen Seite erst einmal zu finden und sie auf der anderen Seite – dauerhaft – zu halten. Denn auch wenn Arbeit mittlerweile projektbezogener ist, die Vielfalt an Möglichkeiten es erlaubt, sich auszuprobieren und Jobs quasi im Jahrestakt zu wechseln, so ist es im ureigensten Interesse eines Unternehmens, Mitarbeiter*innen und damit gewachsenes Know-how langfristig im Unternehmen zu halten.
Um das zu erreichen, braucht es mehr als ein angemessenes Gehalt. Nebst den Hard Facts geht es um weiche Faktoren, ums Wohlfühlen und Wertschätzung. Letztlich verbringen wir vielfach mehr Zeit in der Arbeit und mit Kolleg*innen als mit dem eigenen Partner. Ist man in der Arbeit unzufrieden, hat das zwangsläufig Auswirkungen auf das gesamte Leben. Dennoch: Arbeit ist kein Ponyhof und Wertschätzung
ARBEITSMARKT-
DATEN TIROL
Im April 2024 waren in Tirol insgesamt 20.516 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 11,3 % mehr als im Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag sohin bei 5,6 %. Dem gegenüber stehen 6.951 beim AMS gemeldete, sofort verfügbare offene Stellen, also 13,4 % weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Insgesamt gingen im ersten Quartal 2024 18.526 Stellenmeldungen beim AMS Tirol ein, die meisten im Bereich der Beherbergung und Gastronomie. Bei den Lehrstellen stehen 368 Lehrstellensuchende 1.275 gemeldeten offenen Lehrstellen gegenüber.
Im Laufe des Gesamtjahres 2023 gab es beim AMS Tirol insgesamt über 52.200 Stellenmeldungen, den Großteil davon (32,4 %) im Bereich der Beherbergung und Gastronomie. Im Schnitt betrug die Laufzeit offener Stellen 55 Tage. Überdurchschnittlich lange gesucht wird vor allem am Bau, am schnellsten wurden Stellen unter anderem in der öffentlichen Verwaltung und im Bereich Erziehung und Unterricht besetzt.
Quelle: AMS
keine Einbahnstraße. Arbeitgeber*innen können nicht ohne ihre Angestellten. Umgekehrt ist es jedoch genauso! Was einen „guten“ Arbeitgeber unterm Strich ausmacht, dafür gibt es eine Vielzahl an Kriterien. Und ob man sich irgendwo wohlfühlt oder eben nicht, hängt stark von den eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen ab. Mit schnöder Theorie kommt man an dieser Stelle also nicht weiter. Für eine wertschätzende Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung braucht es gegenseitiges Vertrauen, eine offene Kommunikation, Flexibilität, Sicherheit und persönliche Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Deshalb wird es als Arbeitgeber künftig umso wichtiger, nicht nur in die Weiterentwicklung seines Produktes oder seiner Dienstleistung zu investieren, sondern auch in die seiner Mitarbeiter*innen. Glaubhafte HR-Arbeit beginnt dabei bei der Qualität der Führungsetage. Der Bereich der Human Resources bildet das Fundament für den Gesamterfolg eines Unternehmens. Je mehr die Arbeit in die Nähe von Maschinen rückt, desto wichtiger ist die Arbeit am Menschen. Das bedeutet für die (Unternehmens-)Führung auch die laufende Auseinandersetzung mit sich selbst, um zu wissen, wer man ist – auch als Unternehmen in seiner Gesamtheit – und wo man in Zukunft hinmöchte. Nur so kann man glaubwürdig und authentisch auftreten und kommunizieren. Nach außen wie nach innen.
eco. wirtschaft 38

Ich. Du. Wir. Werde Teil der Volksbank-Familie. Infos über deine Chancen und Benefits findest du unter www.volksbank.tirol/karriere
TIROLS BESTE
Wie jedes Jahr ermittelte das Magazin trend. in Kooperation mit Statista, kununu und Xing auch heuer die Top-Arbeitgeber in Österreich. Wir haben uns die Tiroler herausgepickt.
Stellt das Ergebnis im trend.-Gesamtranking dar
METHODIK:
Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber basiert auf einer anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmer*innen, trend.-Leser*innen und Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing und kununu. Zusätzlich werden Bewertungen auf kununu herangezogen. Insgesamt flossen über 230.000 Urteile aus vier verschiedenen Bewertungskanälen in das Ranking ein (inklusive der Bewertungen des Vorjahres). Hierfür werden 8.000 Arbeitnehmer*innen zufällig und unter Berücksichtigung einer breiten regionalen und soziodemografischen Streuung im Rahmen eines Online-AccessPanels befragt, wie sehr sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Weiters wurden Mitglieder des beruflichen Netzwerks Xing, die in einem der abgefragten Unternehmen arbeiten, sowie die kununu-Community und die trend.-Leserschaft eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Zudem wurden mehr als 5.600 Arbeitgeberbewertungen der Onlineplattform kununu berücksichtigt. Um das Ergebnis zu ergänzen, werden außerdem alle befragten Arbeitnehmer*innen gebeten, auch ihnen bekannte andere Arbeitgeber der gleichen Branche zu beurteilen (indirekte Bewertung mit 100.000 Urteilen). Quelle: trend.EDITION, März 2024
eco. wirtschaft 40 PLATZ RANKING* FIRMENNAME ORT MITARBEITER SCORE 1 54 Egger St. Johann 1.630 7,98 2 59 Raiffeisen-Landesbank Tirol Innsbruck 400 7,93 3 76 Universität Innsbruck Innsbruck 5.582 7,85 4 77 STIHL Gruppe Langkampfen 830 7,85 5 99 Fröschl Hall 1.443 7,75 6 125 BTV – Vier Länder Bank Innsbruck 1.513 7,60 7 149 Volksbank Tirol Innsbruck 307 7,51 8 161 Sandoz Kundl 2.700 7,47 9 169 Fiegl & Spielberger Innsbruck 484 7,43 10 174 Pfeifer Imst 760 7,41 11 186 Plansee Reutte 2.356 7,36 12 197 MED-EL Innsbruck 1.430 7,32 13 201 MCI Management Center Innsbruck Innsbruck > 200 7,32 14 218 bofrost Ötztal-Bahnhof 500 7,26 15 234 Tiroler Versicherung Innsbruck 395 7,22 16 250 Innsbrucker Kommunalbetriebe Innsbruck 766 7,16 17 257 ilf Consulting Engineers Rum 750 7,13 18 262 Eurotours Kitzbühel 280 7,10 19 296 IGO Industries Innsbruck 3.660 7,00
*)
EIN ARBEITSPLATZ ZUM WOHLFÜHLEN
Die Auszeichnungen von kununu, sheconomy und dem Market Institut sind eine schöne Bestätigung für die jahrelangen Investitionen der Volksbank Tirol in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter*innen.
Nur gesunde und zufriedene Mitarbeiter*innen können Höchstleistungen erbringen und unsere Kund*innen damit begeistern“, weiß Markus Hörmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Tirol. „Während sich manche Unternehmen erst jetzt der Vorteile eines betrieblichen Gesundheitsmanagements bewusst werden, ist die Gesundheitsorientierung der Volksbank Tirol schon seit über 20 Jahren fest in ihrer Unternehmenskultur verankert.“ Mit „Volksbank-Fit“ gibt es seit Jahrzehnten ein Gesundheits- und Fitnessprogramm für die Mitarbeiter*innen: Vitaminwochen, finanzielle Unterstützung für Fitnesscenter, Vorträge und Kurse, Rauchentwöhnung und psychologische Beratung sind nur eine kleine Auswahl des wechselnden Angebots.
Seit über 15 Jahren gibt es in der Volksbank-Tirol-Hauptgeschäftsstelle in Innsbruck für Mitarbeiter*innen das Wohlfühlzentrum VITAREAL mit den Personal-Coaches Andrea und Gerhard Außerlechner. Im letzten Jahr startete die Volksbank Tirol das zweijährige Projekt der „Betrieblichen Gesundheitsförderung“ (BGF) gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse als Partnerin. „Wir sind davon überzeugt, mit diesem Projekt einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen zu leisten“, so Hörmann.
WERTSCHÄTZENDES
ARBEITSKLIMA
Die Volksbank Tirol setzt auf Stärke durch Diversität. „Ein wertschätzendes Miteinander und Begegnung auf Augenhöhe sind uns sehr wichtig“, bestätigt Personalleiterin Martina Kirchmair. Hilfsbereitschaft und Teamgeist sind im Arbeitsalltag selbstverständlich. „Wir bieten Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten, aktive Mitgestaltung und flexible Entwicklungsmöglichkeiten. Getreu dem Motto „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ des Gründungsvaters der Volks-

Personalleiterin Martina Kirchmair, Vorstandsvorsitzender Markus Hörmann und Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des MARKET Instituts
banken, Hermann Schulze-Delitzsch, bildet der genossenschaftliche Gedanke bis heute das Fundament der Teamarbeit und des Zusammenhalts in unserem Unternehmen“, so Kirchmair.
PREISGEKRÖNTE
ARBEITGEBERIN
Der Einsatz für das Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen wird belohnt. So wurde die Volksbank Tirol bereits zu Jahresbeginn mit dem kununu Top Company Award 2024 ausgezeichnet. Auch das Linzer MARKET Institut bestätigte mit seinem Qualitätspreis „Bester Arbeitgeber Tirol 2023“ die Exzellenz der Volksbank Tirol in der Hauptdimension „Wohlbefinden“, die sich aus den Einzeldimensionen Betriebsklima, Work-Life-Balance und flexibles Arbeitszeitmodell zusammensetzt. Und sheconomy und kununu kürten die Volksbank Tirol zuletzt zum „TOP FEMALE WORKPLACE 2024“.
REGER ZULAUF
„Die Auszeichnungen machen uns stolz und zeigen, dass wir mit unseren Bemühungen auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Markus Hörmann. „Die ständige Weiterentwicklung als Arbeitgeberin macht uns für den Arbeitsmarkt attraktiv. Im Vorjahr konnten wir insgesamt 57 neue Mitarbeiter*innen bei uns begrüßen und der Trend setzt sich fort: Seit Jahresbeginn haben 25 neue Kolleg*innen bei uns gestartet – ein schöner Zuwachs in der Volksbank-Familie.“ PR

Das erzählen die Mitarbeiter*innen der Volksbank Tirol über ihr Unternehmen
41
© DIE FOTOGRAFEN
VOLKSBANK TIROL
EMPLOYER BRANDING

Alexej Markolin, Head of Sales bei icons – consulting by students
DAS DING MIT DEM MARKETING
Glauben Sie, dass Marketing sich nur auf grelle Werbespots und bunte Plakate beschränkt? Lassen Sie sich eines Besseren belehren.
VON ALEXEJ MARKOLIN
Marketing ist das unsichtbare Rückgrat, das Produkten und Dienstleistungen
Leben einhaucht. Es ist der entscheidende Faktor, der Bedürfnisse identifiziert und die passenden Lösungen an die Hand gibt. Hinter der Fassade der Promotion verbergen sich ausgeklügelte Strategien der Marktsegmentierung, präzise Positionierung, durchdachte Preisgestaltung und innovative Produktentwicklung. Wer sich nur auf die grellen Bilder konzentriert, verpasst die eigentliche Kunst und Wissenschaft des Marketings.
Nehmen wir als Beispiel die Marktsegmentierung. Traditionelle Denkweisen begnügen sich mit demografischen Daten wie Alter und Geschlecht, wohingegen moderne Marketingstrategien tiefer eintauchen. Sie berücksichtigen psychografische und verhaltensbasierte Faktoren, die ein genaueres Bild der Zielgruppen zeichnen. Diese Informationen ermöglichen es, maßgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln, welche langfristige Wirkung zeigen und echte Verbindungen herstellen. Hierbei kann auch die Erstellung von Personas behilflich sein.
Ein umfassender Marketingansatz ist unerlässlich, um im heutigen dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu sein. Hierbei kann eine externe Perspektive, wie sie icons – consulting by students bietet, entscheidend sein. Wir helfen Unternehmen, ihre Marketingstrategien nicht nur zu entwickeln, sondern sie auch lebendig und wirkungsvoll zu gestalten. Unser letztes durchgeführtes Projekt im Bereich Branding unterstützte den Kunden dabei, seine Marke neu zu positionieren. Wir entwickelten eine Kampagne, die sich gezielt an umweltbewusste Verbraucher richtete, ein Segment, das oft durch traditionelle Ansätze übersehen wird.
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Regionalität im Marketing wächst stetig. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch lokal verwurzelte und umweltbewusste Werbe-
maßnahmen zu ergreifen. Ein effektives Beispiel hierfür ist die Monitorwerbung, die es ermöglicht, regionalspezifische Zielgruppen direkt und effizient zu erreichen. Gleichzeitig werden hierbei Ressourcen geschont, indem digitale Inhalte statt physischer Materialien verwendet werden. Employer Branding ist ebenfalls ein zentraler Aspekt des Marketings. Es geht nicht nur darum, Produkte zu verkaufen, sondern Unternehmen auch als Arbeitgebermarke zu stärken. Ein positives Image als Arbeitgeber kann Toptalente anziehen. Hier sind unsere studentischen Beraterinnen und Berater absolute Expertinnen und Experten, vor allem in Bezug auf Hochschulmarketing. Als MCI-Student im Bereich Business and Management und als leitender Berater bei icons – consulting by students sehe ich täglich, wie essenziell ein durchdachtes Marketing für den Erfolg jedes Unternehmens ist. Marketing ist mehr als nur eine Abteilung; es ist ein Mindset, das Innovation und Wachstum vorantreibt. Jedes Detail, von der Produktverpackung bis zur Art und Weise, wie Mitarbeitende engagiert werden, ist ein Teil des Dings mit dem Marketing.
Es ist an der Zeit, Marketing neu zu denken – nicht nur als Funktion, sondern als grundlegende Geschäftsphilosophie. Sind Sie bereit, diesen Wandel mitzugestalten? Tauchen Sie mit uns in die Tiefe des Marketings ein und entdecken Sie, wie strategisch und wirkungsvoll es wirklich sein kann.
ICONS
Im Jahr 2006 von einer Gruppe Studierender als Innsbruck CONSulting gegründet und inzwischen mit insgesamt drei Standorten in Innsbruck, Wien und Graz vertreten, ist icons – consulting by students eine studentische (und damit von konventionellen Unternehmen unterscheidbare) Unternehmensberatung. Das Ziel der Organisation ist es, Unternehmen innerhalb von Beratungsprojekten bei Problemen und Ambitionen, von der Gründung bis hin zu Fragen des Alltags in großen Konzernen zu unterstützen. www.icons.at
eco. mmentar 42


Die Tiroler Landesverwaltung beschäftigt derzeit rund 4.500 MitarbeiterInnen und zählt damit zu den größten und führenden Arbeitgebern Westösterreichs. Das Land Tirol versteht sich als serviceorientierter, fairer, vielfältiger und sozialer Arbeitgeber. Der dauerhafte Erfolg der Verwaltung hängt maßgeblich vom Engagement und der Kompetenz jeder einzelnen Person ab.
Und vielleicht passen wir zusammen. Wir bieten:
■ flexible Arbeitszeitmöglichkeiten
■ Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben
■ Weiterbildungsmöglichkeiten
■ krisensicherer Arbeitsplatz
■ finanzielle Unterstützungsleistungen (z.B. Jobticket, zum Mittagessen) Du suchst einen Job,
Komm zum nächsten BewerberInnen-Tag: 12. Juni und 11.September2024 Landhaus 1
Foto: Land Tirol/Charly Schwarz Bildnachweis: Land Tirol/Simon Rainer Bezahlte Anzeige www.tirol.gv.at/karriere
ein
suchen
neue MitarbeiterInnen!
Praktikum oder eine Lehrstelle? Wir
laufend

WO INNOVATION AUF
LEIDENSCHAFT TRIFFT
Seit über einem Jahrhundert prägt Tyrolit mit seinen innovativen Schleiflösungen die technologische Entwicklung zahlreicher Industrien weltweit. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des perfekten Zusammenspiels von langjährigem Know-how, hoher Expertise und vor allem motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihre Leidenschaft Tag für Tag in ihre Arbeit einbringen.
TEXT: DORIS HELWEG
Als weltweit führender Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie hat sich Tyrolit nicht nur in der Industrie weltweit einen Namen gemacht. Seit 1919 leisten die innovativen Werkzeuge einen wichtigen Beitrag bei der technologischen Entwicklung in zahlreichen Industrien. Tyrolit bietet dafür maßgeschneiderte Schleiflösungen für vielfältige Anwendungen sowie ein umfassendes Sortiment an Standardwerkzeugen für Kund*innen auf der ganzen Welt. Mit Wurzeln im Herzen
der österreichischen Alpen – genauer gesagt in Schwaz in Tirol – verbindet Tyrolit die Stärken familiärer Werte mit einer globalen Vision und über einem Jahrhundert individueller Unternehmens- und Technologieerfahrung. Seit 2022 wird Tyrolit von einem vierköpfigen Executive Board geführt, das die gelebten Werte der Gründerfamilie Swarovski mit Weitblick in die Welt trägt. In seiner nunmehr über hundertjährigen Geschichte wird das international führende und moderne Unternehmen den Anforderungen des Marktes mit jeder Menge Inno-
vationsgeist und professionellem Know-how immer wieder mehr als gerecht. Nicht nur in der Industrie hat sich Tyrolit über die Jahrzehnte einen Namen gemacht, sondern insbesondere auch als attraktiver Arbeitgeber.
KARRIERE BEI TYROLIT
„Bei Tyrolit zu arbeiten, mag vieles heißen, aber insbesondere bedeutet es, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln“, betont Ausbildungsleiter Patrick Permoser. Neben sicheren und modernen Arbeitsplätzen in den unterschiedlichsten Bereichen ist bei
44
TYROLIT





Patrik Permoser, Ausbildungsleiter: „Zu meinem Glück erhielt ich 2009 eine Lehrstelle als Maschinenbautechniker (heute Metalltechniker) bei Tyrolit. Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner Lehre sammelte ich praktische Erfahrungen in der internen Instandhaltung. Im Jahr 2016 absolvierte ich meine Meisterprüfung, was mir zwei Jahre später den Einstieg in die Lehrlingsausbildung ermöglichte, wo ich als Leiter der Lehrwerkstatt agierte. Im September 2022 schloss ich berufsbegleitend meine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur ab. Gleichzeitig erhielt ich die Möglichkeit, die Position des Ausbildungsleiters zu übernehmen und damit die gesamte Lehrlingsausbildung bei Tyrolit zu leiten.“
Tyrolit eine faire und leistungsgerechte Entlohnung genauso selbstverständlich wie attraktive Sozialleistungen. Ein bewährtes Patensystem gewährleistet insbesondere während der Einarbeitungszeit in den ersten Wochen eine persönliche Betreuung. Als persönliche Ansprechpartner unterstützen die Patinnen und Paten alle Neuzugänge dabei, sich im neuen Arbeitsumfeld zurechtzufinden. Ein sogenanntes Wohlfühlgespräch wenige Monate nach dem Start soll dann Gelegenheit für Feedback geben und eine gelungene Integration in das Unternehmen fördern.
Der Stammsitz in Schwaz ist zudem ein mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb, wo Nachwuchstalente im familiären Umfeld unter die Fittiche genommen werden. Zudem profitieren Lehrlinge während ihrer Ausbildungszeit von zahlreichen Benefits wie zum Beispiel Mittagessen, Leistungsprämien oder gar einem voll bezahlten Führerschein. „Die Lehrzeit war unglaublich interessant und abwechslungsreich“, erinnert sich Mario Nairz, heute Werksleiter, über seine Lehrzeit und
ergänzt: „Tyrolit hat damals wie heute stark in die Ausbildung investiert. Ich konnte einige Praktika absolvieren, was meinen Horizont erheblich erweiterte. Jetzt habe ich als Werksleiter an einem der modernsten Produktionsstandorte Tirols die Möglichkeit, die Industrielandschaft mitzugestalten.“
WEITERENTWICKELN IN STARKER GEMEINSCHAFT Nicht nur die Ausbildung liegt dem international tätigen Unternehmen am Herzen. Besonderes Augenmerk wird auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt. Dabei werden jährlich umfangreiche Schulungsprogramme angeboten, die es den Mitarbeiter*innen ermöglichen, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und sich beruflich weiterzuentwickeln. Attraktive Sozialleistungen wie das Klimaticket als Jobticket, Fahrradleasing, betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiter*innenrabatte sind ebenso Bestandteil zahlreicher Benefits wie vergünstigte Kantinenmahlzeiten. Die beliebte Werkskantine
in Schwaz sorgt dabei für das leibliche Wohl, ist gleichzeitig ein Ort des regen Miteinanders und fördert den sozialen Austausch. Die starke Gemeinschaft wird auch außerhalb der Arbeitszeiten hochgehalten, was die Aktivitäten der Werksbühne oder die zahlreichen Sportgemeinschaften bestätigen.
Im Gegenzug legt Tyrolit als Arbeitgeber Wert auf einen selbstständigen und verlässlichen Arbeitsstil. Das Verfolgen gemeinsamer Unternehmensziele und die Bereitschaft, neue und auch herausfordernde Tätigkeiten zu übernehmen, ist in einem sich stetig wandelnden industriellen Umfeld nahezu unerlässlich. Und für viele engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der willkommene Antrieb für persönliche Weiterentwicklung. PR
45
TYROLIT
WEGE GEMEINSAM
GEHEN
Seit Anbeginn ihres Bestehens weiß die Unterberger-Gruppe den Wert ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als ihr größtes Kapital zu schätzen. Das hat sich bis heute nicht geändert, wenn auch der Arbeitsmarkt einem großen Wandel unterliegt.
TEXT: DORIS HELWEG

Incentive: Jährlicher Ausflug in die BMW-Zentrale nach München mit den neu eingetretenen Lehrlingen
Langfristige Beziehungen aufbauen lautet das Leitmotiv im Hause Unterberger. „Dabei handelt es sich natürlich um Beziehungen zu den Kunden, gleichermaßen aber auch zu Lieferanten und eben auch Mitarbeitern. Die Kontinuität in diesen Beziehungen war seit Anbeginn unseres Wirkens unsere Prämisse“, betont Dieter Unterberger, geschäftsführender Gesellschafter der Unterberger-Gruppe. 20 Standorte verteilt in Tirol, Vorarlberg, dem Allgäu, in Südbayern und in Salzburg zählen mittlerweile zum Familienunternehmen – ein Netzwerk, das mit großer Dynamik die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden erfüllt.
BEGEGNUNG AUF AUGENHÖHE
Und was gibt es Schöneres, als persönliche Leidenschaft und Beruf zu vereinen? In den Autohäusern der Unterberger-Gruppe ist
diese Faszination für Autos an jedem Standort zu spüren – und bei jedem Mitarbeiter. Denn wie mit Kund*innen wird auch die Beziehung zu den Mitarbeiter*innen redlich gehegt und gepflegt: „Unsere Mitarbeiter sind seit jeher unser größtes Kapital, unser Gesicht nach außen. Und wir sind stolz, dass es Mitarbeiter gibt, die seit der ersten Stunde bei uns im Unternehmen sind. Das beweist auch, dass Beschäftigte bei uns großartige Entwicklungsmöglichkeiten haben und wir auf einige Karrieren verweisen können, die sich vom Lehrling zum Abteilungs- oder Betriebsleiter weiterentwickelt haben“, so Dieter Unterberger.
VON DER LEHRE ZUR FÜHRUNGSKRAFT
Generell hat der Bereich Personalentwicklung einen hohen Stellenwert im Unter-
nehmen. Es geht darum, möglichst viele Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu lukrieren und so wenig wie möglich vom externen Arbeitsmarkt zu besetzen. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Lehrlingsausbildung. „Wir investieren viel Energie in die Ausbildung unserer Lehrlinge und möchten diese auch mit verschiedensten Benefits und Aktivitäten an unsere Häuser binden“, sagt Unterberger. So wird beispielsweise alle drei Jahre ein Incentive-Tag veranstaltet, an dem die gesamte Geschäftsleitung einen Tag mit den Lehrlingen in Austausch ist. Auch ein jährlicher Ausflug in die BMW-Zentrale in München mit den neu eingetretenen Lehrlingen gehört dazu.
Obwohl die Unternehmensgruppe mittlerweile über 800 Mitarbeiter*innen zählt, gibt es keine zentrale Personalabteilung. Die einzelnen Standorte sind kleinstrukturiert,
46
UNTERBERGER

„Unsere Mitarbeiter sind seit jeher unser größtes Kapital, unser Gesicht nach außen.“
DIETER UNTERBERGER
so obliegen Personalangelegenheiten vielfach den jeweiligen Betriebs- oder Abteilungsleiter*innen, was wiederum die Beziehungsebene zu den Mitarbeiter*innen unterstreicht. „Den Beschäftigten auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen persönlich individuelle Vereinbarungen zu finden ist aus unserer Sicht der effizientere Weg unserer Personalpolitik“, glaubt Dieter Unterberger.
VON DYNAMIK INSPIRIERT
So überträgt die familiengeführte Unternehmensgruppe ihren Familiensinn und ihre Leidenschaft für Autos auch auf die vielen engagierten Mitarbeiter*innen an den Standorten und hält auch in Zukunft daran fest, die Beziehungsebene hochzuhalten, Mitarbeiter*innen in ihrer Individualität anzuerkennen und zu fördern. „Denn nur wenn wir alle motiviert an einem Strang ziehen und unsere Mitarbeiter das auch tatkräftig mittragen, können wir als Unternehmen erfolgreich sein und unsere Faszination für außergewöhnliche Automobile und Marken für unsere Kunden zum Erlebnis werden lassen“, hebt Dieter Unterberger abschließend die hohe Wertigkeit des Erfolgsfaktors Mitarbeiter für die gesamte Unternehmensgruppe hervor.

SO BRINGEN WIR TIROL ZUM BLÜHEN
Die #beeraiffeisen-Kampagne der Tiroler Raiffeisenbanken für mehr Artenvielfalt geht in ihr nächstes Jahr. Auch der #beeraiffeisenAWARD wird wieder vergeben.

WChristine Hofer, Geschäftsführerin der Raiffeisen Werbung Tirol und Projektleiterin von #beeraiffeisen
ir bringen Tirol zum Blühen – mit diesem Aufruf starteten die Tiroler Raiffeisenbanken erstmals vor vier Jahren eine Kampagne für mehr naturnahen Lebensraum und mehr Artenvielfalt in unseren Gärten und lobten dafür mit dem #beeraiffeisenAWARD einen eigenen Preis aus. „Mit diesem Preis wollen wir Projekte vor den Vorhang holen, die Wildbienen und anderen Insekten einen entsprechenden Lebensraum bieten. Gleichzeitig möchten wir damit möglichst viele Menschen in unserem Land dazu inspirieren, die eigene Garten- und Lebensraumgestaltung naturnaher und insektenfreundlicher anzulegen“, so Christine Hofer, Geschäftsführerin der Raiffeisen Werbung Tirol und Projektleiterin von #beeraiffeisen.
NACHHALTIGKEIT BEGINNT JETZT. Wenn wir unseren kostbaren Lebensraum gesund und resilient erhalten wollen, müssen wir jetzt handeln. Jede und jeder von uns kann ihren bzw. seinen Beitrag leisten. Etwa durch kleine Wildblumen-„Jausenstationen“ auf Fensterbrettern und Balkonen, die Gestaltung von naturnahen Gärten, durch das Anlegen von Blühstreifen auf brachen Flächen oder durch die Ansiedlung von Wildbienen in Bienenhotels. Ihr Garten ist bereits jetzt ein Tummelplatz für Insekten? Sie engagieren sich schon länger gemeinsam mit anderen für Artenvielfalt und naturnahen Lebensraum? Dann zeigen Sie uns Ihr Projekt und machen Sie mit beim #beeraiffeisen Award 2024. Für die Einreichung benötigen wir eine kurze Beschreibung des Projekts sowie ein paar Bilder. Infos und Anmeldung unter www.beeraiffeisen.at. Die Einreichfrist für den #beeraiffeisenAWARD 2024 endet am 30. Juni. PR

© RAIFFEISEN/OSS © RAIFFEISEN/ARIA SADRSALEK
47

DIE FREUDE AM SPIEL
Auch in einer sich rasant verändernden Welt ist die Freude am Spiel ungebrochen groß. Die Casinos Innsbruck und Seefeld erfreuen sich jedenfalls größter Beliebtheit und konnten 2023 ihr erfolgreichstes Jahr seit ihrem Bestehen verbuchen.
TEXT: DORIS HELWEG
Ein Besuch im Casino ist und bleibt etwas Besonderes. Auch wenn die vergangenen Jahre von wirtschaftlichen Turbulenzen geprägt waren bzw. sind, scheint die Affinität zum Glücksspiel konstant zu sein. Die beiden Tiroler Standorte von Casinos Austria, Innsbruck und Seefeld, konnten sogar das beste Ergebnis seit ihrem Bestehen einfahren.
Nach wie vor ist es für heimische wie ausländische Gäste ein außergewöhnliches Happening, einen Abend im gediegenen Am-
Mit rund 200 Mitarbeiter*innen gelten die Casinos Innsbruck und Seefeld als attraktiver Arbeitgeber.
biente der Casinowelt zu verbringen, auch wenn der Dresscode mit Smart Casual keine Abendrobe mehr verlangt. Mit einem Architektur-Award ausgezeichnet und mit einzigartigen Interieurs wie einer mundgeblasenen Lampe oder einem großflächigen Werk von Max Weiler ausgestattet, bietet das Casino Innsbruck einen edlen Rahmen für Besucher*innen – einen wunderschönen Ausblick auf die Innsbrucker Nordkette inklusive. Über kursierende Pläne eines Zu- oder Umbaus kann laut Direktor Martin
CASINO


„Wir sehen es als unsere Pflicht, der Region und den Menschen, die hier leben, etwas zurückzugeben.“
MARTIN KÖNIG
König derzeit noch nichts Konkretes berichtet werden. Eines kann auf jeden Fall verraten werden: Das Casino Innsbruck wird in jedem Fall für Besucher*innen geöffnet bleiben.
Etwas gediegener im Chaletstil präsentiert sich das Casino Seefeld, welches mit handwerklichen Raritäten aus Bauernstuben und einer Holzvertäfelung eine warme und wohlige Atmosphäre vermittelt und seit genau 55 Jahren beliebtes Reiseziel von Italiener*innen und Urlaubsgästen anderer Nationen ist. Genau dieses runde Jubiläum wird im Juni in Kooperation mit dem Golfclub Seefeld gebührend gefeiert.
SYNERGIEEFFEKTE
Seit 2023 ist Direktor Martin König mit der Geschäftsleitung beider Standorte betraut. Durch die Zusammenlegung der Casinos Innsbruck und Seefeld sieht er vor allem ein großes Potential für Synergieeffekte in Form von noch spannenderen Aktionen, Gewinnspielen und Promotions, die nun in beiden Häusern auf die Gäste warten. Generell liegt sein großes Augenmerk auf der Gästezufriedenheit und dem reibungslosen Ablauf der internen Organisation. Und weil die beiden Häuser gerade einmal 23 Kilometer auseinanderliegen, ist es für das standortübergreifende Team wie Geschäftsleitung und Marketing jederzeit möglich, persönlich am jeweiligen Standort anwesend zu sein.
BELIEBTE EVENTLOCATION
Die Casinos Innsbruck und Seefeld sind jedoch nicht nur besondere Orte des Spieles, sondern ebenso Austragungsorte zahlreicher Veranstaltungen und Events oftmals auch außerhalb ihrer Räumlichkeiten, etwa bei Charity-Golfturnieren.
Als äußerst beliebt entpuppen sich die Musical Dinner, die aktuell sechsmal im Jahr in den Räumlichkeiten des Casi-
no Innsbruck für einen gelungenen Mix aus Show-Act, exquisitem 4-Gänge-Menü und Spiel sorgen – ein Begrüßungsgetränk und Begrüßungsjetons im Wert von 15 Euro inklusive. An den Terminen im Oktober und Dezember steht „The Musical Sound of Non(n)sens“ am Programm. „Anstatt mit traditionellen Gesängen zu glänzen, zeigen die Nonnen eine Reihe von skurrilen und lustigen Gesangs- und Tanznummern, bringen das Publikum zum Lachen und berühren es zugleich mit ihrer Musik und ihren Geschichten“, freuen sich die Veranstalter schon auf prickelnde Vorstellungen im Casino Innsbruck. Generell bieten die Räumlichkeiten der Casinos Innsbruck und Seefeld den idealen Rahmen für Weihnachts- oder Firmenfeiern und präsentieren sich auch als außergewöhnliche Seminar- und Eventlocation. Ob für größere Teilnehmerzahlen im Saal oder im Cuisino für 25 Personen, das besondere Ambiente lässt jegliche Zusammenkunft zu einem ganz besonderen Happening werden.
Für Einheimische wie Gäste äußerst attraktiv gestalten sich die unterschiedlichsten Packages wie Fun & Friends, Genuss & Casino oder Dinner & Casino, wo zum Beispiel in einem Partnerrestaurant in Innsbruck ein viergängiges Dinner, der Eintritt ins Casino mit einem Glas Sekt oder alkoholfreiem Getränk sowie Begrüßungsjetons im Wert von zehn Euro inkludiert sind – also alles, was man für einen gelungenen Casinoabend benötigt.

49 CASINO
CHARITY
Nebst zahlreichen Poker- und Black-JackTurnieren lassen die Casinos Innsbruck und Seefeld auch immer wieder mit gelungenen Charity-Events aufhorchen. Sei es in Form von Poker- oder Black-Jack-Turnieren oder größeren Golf-Events wie das kürzlich stattgefundene „Casino Innsbruck in the City Golf Innsbruck 2024“. „Wir sehen es als unsere Pflicht, der Region und den Menschen, die hier leben, etwas zurückzugeben“, freut sich Direktor Martin König. So unterstützen die Casinos als Sponsor zahlreiche Initiativen wie Roll-on, Tiroler Krebshilfe, das Rote Kreuz Seefeld oder den Lion’s Club mit langjährigen Partnerschaften. Auch nimmt die im Herbst 2023 gegründete österreichweite Initiative von Casinos Austria „Unser Einsatz für Österreich“ heuer volle Fahrt auf und unterstützt in Form von Sponsoringpartnerschaften, Casino on Tour und Corporate Volunteering für lokal tätige humanitäre Einrichtungen. Bei Casino on Tour zum Beispiel wird zum Vergnügen, aber niemals um Geld gespielt. Gewonnen werden Sachpreise – eingesetzt eine freiwillige Spende. Der gesamte Spendenerlös kommt zur Gänze einer karitativen Organisation zugute.
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
Zudem gelten die Casinos Innsbruck und Seefeld mit ihren gesamt rund 200 Mitarbeiter*innen auch als erstklassiger Arbeitgeber. Wenngleich die Arbeitszeiten weit entfernt vom klassischen 9-to-5-Job sind, punktet die Arbeitswelt der Casinos mit attraktiven Gehältern und zahlreichen Benefits. Für die meisten Jobs sind allerdings Nachteulen gefragt, denn auf Grund des großen Gästeaufkommens am Abend bis in die frühen Morgenstunden hinein –

die Öffnungszeiten variieren zwischen drei und vier Uhr nachts – wird hier für viele Mitarbeiter*innen die Nacht zum Tag und somit zur Hauptarbeitszeit.
Neben den Croupiers und Supervisors finden sich auch Techniker*innen sowie kluge Köpfe in der Verwaltung der Häuser und Kreative im Marketing. Mathematisch auf Zack und vor allem gut im Kopfrechnen müssen die zahlreichen Croupieren und Croupiers sein. „Diese Jobs sind mathematisch sehr herausfordernd und man muss stets sehr aufmerksam sein“, erzählt uns Elias Tollinger bei unserem Besuch im Casino Innsbruck. Neben strengster Kameraüberwachung achten auch Supervisors genau über jedes Spielgeschehen, denn im quirligen Treiben an den unterschiedlichen Tischen könnte es sonst schon mal zu Verwechslungen kommen, zumindest aus Sicht der Spieler*innen. Ausgebildet werden die Croupieren und Croupiers in einem Schulungsprogramm von Casinos Austria, das zweimal jährlich stattfindet und das Regle-

ment, die Spielabwicklung sowie unternehmensinterne und gesetzlich relevante Inhalte umfasst.
Mit einer hauseigenen Kantine, die übrigens auf köstliche Art und Weise auch auf gesunde Ernährung achtet, winken Mitarbeiter*innen im Casino jede Menge weitere Benefits wie Mitarbeiterprämien, Bonifikationen, Gratis-Dienstkleidung und verschiedenste Gutscheine dank Kooperationen mit unterschiedlichsten Unternehmen aus der Reise- oder Bekleidungsbranche.
Eine offene Kommunikation auf Augenhöhe, gelebte Work-Life-Balance und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen zudem Vertrauen und Perspektiven für Mitarbeiter*innen in den Tiroler Standorten des Glücksspielkonzerns. PR
EVENTTIPPS
„THE MUSICAL SOUND OF NON( N )SENS“
Tickets ab 98 Euro inkl. Willkommensdrink und Begrüßungsjetons im Wert von 15 Euro unter www.oeticket.com und an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.
Termine: Mittwoch, 2. Oktober 2024 Donnerstag, 3. Oktober 2024
JUBILÄUMSTURNIER
55 JAHRE CASINO SEEFELD in Kooperation mit dem Golfclub Wildmoos Termin: 5.7.2024 ganztägig mit Abendveranstaltung und Siegerehrung im Casino Seefeld
7. BLACK JACK WELTMEISTERSCHAFT
Termin: Freitag, 22.11. & Samstag 23.11.2024, Casino Innsbruck
50 CASINO
winklerhotels.com






Orte tiefen Wohlgefühls Facettenreichtum, der begeistert PREMIUM-EXPERIENCES FÜR JEDEN ANSPRUCH
Entdecken Sie sie alle –in den vier Winklerhotels in Südtirol.
EINTAUCHEN IN EINE
FÜLLE AN MÖGLICHKEITEN
brandnamic.com
|
Foto: Manuel Kottersteger




Ein Ort der Freundschaften, der Lebensfreude und ein Platz, um sorglos alt zu werden: Die VITALITY Residenz Veldidenapark Innsbruck bietet aktiven Seniorinnen und Senioren wie auch Personen mit Pflegebedarf ein neues, schönes und sicheres Zuhause für den Lebensabend.
DEN HERBST DES LEBENS GENIESSEN
Altwerden ist nichts für Feiglinge, meinte schon der bekannte Entertainer Joachim Fuchsberger in seinem Buch über die Zeit, wenn die Blüte des Lebens langsam dahinwelkt. Womit er in gewisser Weise auch recht hatte. Den negativen Auswirkungen in betagten Zeiten kann man aber auch mutig entgegentreten und die richtigen Schritte in Richtung aktive Lebensgestaltung im Alter setzen.
TEXT: DORIS HELWEG
Jeder will alt werden, niemand will alt sein. So in etwa lässt sich die gesellschaftliche Gesinnung dem Altern gegenüber in einfachen Worten beschreiben. Neben körperlichen Einschränkungen ist es vor allem die Einsamkeit, die den Men-
schen in ihrem eigentlich wohlverdienten Ruhestand zu schaffen macht. „Diesem Dilemma kann man definitiv ausstellen“, sind sich Mag. Barbara Siller, Direktorin der Seniorenresidenz Veldidena, und Elvira Koidl als Interessentenberaterin einig. Am Tag der
offenen Tür laden sie herzlich in die VITALITY Residenz Veldidenapark ein, um den Menschen einen Einblick in das Leben in den speziell auf aktive Lebensgestaltung im Alter ausgerichteten Räumlichkeiten zu gewähren. Denn was für ältere Menschen anfangs
VITALITY RESIDENZ VELDIDENAPARK INNSBRUCK



vielleicht beängstigend erscheint, verliert in den hellen Räumlichkeiten, die sich jeder für sich individuell gestalten kann, schnell seinen Schrecken. „In unserer Residenz leben die Menschen in ihren eigenen und voll ausgestatteten Wohnungen und Apartments, können ihren Alltag völlig frei gestalten und ihren liebgewonnenen Lebensgewohnheiten auch weiterhin nachgehen. Mit dem Vorteil, dass sie im Falle gut betreut sind und vor allem nicht allein, wenn sie nicht allein sein möchten“, erklärt Elvira Koidl.
Eingebettet in einen Park in Wilten bieten die modernen und hochwertig ausgestatteten Apartments in den Größen von 25 bis 70 Quadratmeter jeglichen Komfort, den es für ein möglichst sorgloses Leben im Alter braucht. Größtenteils neu saniert findet sich in den Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit eigenem Balkon und modern ausgestatteter Küche samt Backofen, Induktionsherd und Mikrowelle alles, was man auch als Selbstversorger für das tägliche Leben braucht. Dazu können Bewohner*innen aus einem breiten Angebot an Verpflegungspauschalen wählen. Frei nach dem Motto „Genuss ist Leben“ liegt bei der täglichen Menüerstellung des Küchenteams der Fokus auf gesunder Vitalkost und Tiroler Küche mit regionalen und saisonalen Produkten. Frühstück, Mittag- und Abendessen werden gepflegt im Restaurant serviert. Bei Kaffee und Kuchen oder anderen Snacks lässt es sich mit Besucher*innen oder Mitbewohner*innen auf der Sonnenterrasse im Innengarten oder im Café ausgiebig plaudern und die gemeinsame Zeit vergeht wie im Flug.
VITALITY - MITTAGSTISCH
„Zu unserem Mittagstisch sind auch externe Gäste jederzeit gerne eingeladen, gegen einen geringen Kostenbeitrag ein gesundes, zweigängiges Vitalmenü zu genießen“, richtet Barbara Siller auch ein Angebot an externe Senior*innen, eine gesunde Mahlzeit in netter Gesellschaft einzunehmen. „Gerade für eine Person ist es oftmals mühsam, immer frisch zu kochen und allein zu Hause zu essen. Diesen Menschen möchten wir mit unserem Angebot den Alltag erleichtern, auch wenn sie nicht Bewohner*innen unserer Residenz sind.“
Herzlich eingeladen sind externe Gäste auch zum Musikbrunch, der jeden ersten Sonntag im Monat mit großem Buffet und Livemusik in der Residenz stattfindet. Frische hausgemachte Köstlichkeiten und allerlei Leckereien sorgen für das leibliche

„Unser Haus ist ein Ort der Freundschaften und der Lebensfreude, wo Bewohner*innen selbstbestimmt leben und ihr individuell gewünschtes Maß an Unterstützung in Anspruch nehmen können.“
BARBARA SILLER
TAG DER OFFENEN TÜR
8. Juni 2024 von 10 bis 17 Uhr Bei einem interessanten Rahmenprogramm können sich Besucher*innen ausführlich über das Leben in der Residenz informieren:
• Führungen durch die Residenz stündlich von 10 bis 15 Uhr
• Gesunde Jause für Besucher*innen von 10:15 bis 11:15 Uhr im Foyer
• Flohmarkt am Vorplatz der Residenz von 10 bis 13 Uhr
• Livemusik „Musik dein Leben“ auf der Terrasse von 11 bis 14:30 Uhr
• Vitalmenü für Besucher*innen im Café von 11:30 bis 13 Uhr
• Cocktailempfang für Besucher*innen von 12:30 bis 15 Uhr im Foyer
• Bildervorstellung und Einblicke ins Gedächtnistraining ganztägig im Clubraum
• Proseccoempfang im Clubraum ebenfalls ganztägig

Wohl, angenehme Livemusik und gute Gespräche für das seelische – so wird der erste Sonntagvormittag im Monat immer zu einem kleinen Highlight im täglichen Alltagstrott. „Diese kleinen Happenings in unserer Residenz sollen Außenstehenden nicht nur die Möglichkeit eines geselligen Miteinanders bei Speis und Trank ermöglichen, sondern ihnen auch auf sanfte Weise näherbringen, dass der Einzug in unsere VITALITY Residenz kein Beinbruch und schon gar keine Zäsur darstellt, sondern ein Neustart in ein sorgloses Leben ist. Unser Haus ist ein Ort der Freundschaften und der Lebensfreude, ein Ort, wo Bewohner*innen selbstbestimmt leben und ihr individuell gewünschtes Maß an Unterstützung in Anspruch nehmen können.
Ein Ort des Miteinanders und des Füreinanders, wo niemand einsam sein muss, aber jederzeit allein sein kann, wenn ihm danach ist. Ein Ort, der mit zahlreichen Angeboten für eine aktive Lebensgestaltung im Alter sorgt und auch das psychologische Wohl der Bewohner*innen im Auge hat. Ein Ort, an dem man rundum betreut wird, sollten die Tage schlechter werden“, findet Direktorin Barbara Siller treffende Worte über das Leben in der VITALITY Residenz Veldidenapark. PR
53
VITALITY RESIDENZ VELDIDENAPARK INNSBRUCK
FOTOS: © ANDREAS FRIEDLE, CHRISTIAN FORCHER
SCHAU AUF DICH UND DEINE LEUT’
Wenn uns die letzten Jahre eines gelehrt haben, dann ist es die Fähigkeit, unvorhergesehene Situationen oder Krisen durch die Nutzung von persönlichen oder sozial vermittelten Ressourcen zu meistern und im Idealfall für die weitere Entwicklung zu nutzen. Diese als psychosoziale Resilienz bezeichnete Fähigkeit spielt auch in Unternehmen eine immer größere Rolle.
INTERVIEW: DORIS HELWEG
Psychosoziale Resilienz bezeichnet im Wesentlichen die Fähigkeit, Krisen gesund und kompetent zu meistern, insofern kann sie auch als psychologisches Immunsystem verstanden werden. Dass es in unserer krisenbehafteten Zeit auch für Führungskräfte immer wichtiger wird, auf ein psychosozial intaktes Arbeitsumfeld zu achten, will die Fachgruppe der Personenbetreuer und Personenberater in der Wirtschaftskammer Tirol mit der Initiative „Schau auf Dich und Deine Leut’“ in den Fokus von Unternehmern und Unternehmerinnen rücken. Wir haben mit Bernhard Moritz, Obmann der Fachgruppe der Personenberater und Personenbetreuer, über das Thema psychosoziale Resilienz und was man als Unternehmer dazu beitragen kann gesprochen
ECO.NOVA: Was darf man unter psychosozialer Resilienz verstehen? BERNHARD MORITZ: Als Resilienz wird im Wesentlichen die Fähigkeit von Menschen verstanden, unvorhergesehene Situationen oder Krisen im Leben durch die Nutzung von persönlichen und soziale vermittelten Ressourcen zu meistern und dafür auch einen „Werkzeugkoffer“ zur Verfügung zu haben. Im Idealfall dann auch daraus für zukünftige, andere Situationen und Krisen zu lernen und präventiv zu agieren. Das heißt also, wenn mich heute zum Beispiel ein plötzlicher Verlust trifft, dann versuche ich mich an bisherige Trennungserfahrungen in meinem Leben zu erinnern und mich zu fragen: Was hat mir damals gut getan? Wie kann mir das jetzt in meiner Akutsituation helfen? Das Abrufen und Zurückgreifen auf bereits erlebte und durchlebte Situationen ist ein wesentlicher Bestandteil von Resilienz, die derzeit zu einem Modebegriff geworden ist.
 Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol
Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol
54
WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL
© ANDREAS FRIEDLE
Bernhard
Wie kann in einem Unternehmen auf psychosoziale Resilienz geachtet werden? Die psychosoziale Beratung hat hier einen sehr großen Auftrag, vor allem nach den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie. Das war nicht nur für die Menschen selbst herausfordernd, sondern auch für die Unternehmen. Die psychosoziale Beratung begleitet Menschen dabei, ihr persönliches „Lebens-Navigationssystem“ neu zu programmieren, um in bestehenden oder künftigen Krisensituationen auf bereits vorhandene Ressourcen und Kompetenzen zurückgreifen zu können. Sie hilft ihnen dabei, ihre Lebensumstände, ihre Gedanken, Gefühle, Handlungen und körperlichen Symptome ernst- und innere wie äußere Stressoren rechtzeitig wahrzunehmen. Meiner Meinung nach dient die psychosoziale Beratung auch als Hemmschwellenlöser für das Selbsteingeständnis und das „Outing“ von psychischen Schwierigkeiten, weil man als Betroffener eine Form des Coachings, der Beratung oder auch der Begleitung eher annimmt als eine Psychotherapie, die ja auf Diagnosen von psychischen Erkrankungen fokussiert ist. Die betriebliche Gesundheitsvorsorge hat den Aspekt der psychischen Gesundheit bislang großteils außer Acht gelassen. Nun sehen wir, dass dieser Bereich der Gesundheitsvorsorge zunimmt, und es braucht hier aktive, präventive und nachhaltige Konzepte und Lösungen.
Was macht eine psychosozial kompetente Führungskraft aus? Ein psychosozial resilientes Unternehmen kann sich als „Talentegemeinschaft“ denken, in der jeder mit seinen Fähigkeiten willkommen ist und hierarchisches Denken sehr abgeflacht ist, ohne den Führungsaspekt und die dazugehörige Verantwortung für Entscheidungen zu nivellieren. Diese Haltung der Talenteförderung braucht ein aktives Talentemanagement. So kann zum Beispiel ein formal als Hilfskraft eingestufter Mitarbeitender sehr wohl Führungskompetenzen aufweisen, weil er oder sie im Privatleben Vereinsobmann/-obfrau ist. Und da liegt der Aspekt der Talenteförderung. Das Potential von Mitarbeiter*innen hat eine starke Ausprägung auf die Unternehmenskultur. Was im zwischenmenschlichen Bereich die Empathie ist, ist im unternehmerischen Kontext die Förderung der Kreativität und Intuition. Den eingefahrenen Blickwinkel auch mal zu verlassen, einen Perspektivenwechsel zuzulassen oder sich die Zeit nehmen, das Unternehmen einmal
„Nur wer sich als Individuum selbst ernst nimmt und Selbstverantwortung übernimmt, ist auch als Führungskraft in der Lage, für ein psychosozial stabiles Arbeitsumfeld zu sorgen.“
BERNHARD MORITZ
ganz anders zu denken, birgt gerade in instabilen Zeiten ein sehr großes Ideen- und Gestaltungspotential.
Auf welche Aspekte sollten Führungskräfte noch achten? Einen weiteren wesentlichen Aspekt sehe ich in einer guten und klaren Arbeitsplatzbeschreibung, die über das reine Jobprofil weit hinausgeht. Gerade in Zeiten eines Arbeitskräftemangels ist die Attraktivität des Arbeitsplatzes von großer Bedeutung. Das englische Wort „Passion“ drückt das sehr gut aus. Es braucht Leidenschaft für das, was man tut. Die Menschen müssen in unserer defizitorientierten Gesellschaft wieder motiviert und gestützt werden in dem, wie sie sind und was sie tun. Ein klares JA zu einer Buntheit, zu Dingen, die vielleicht nicht „normal“ sind, eine Umgebung zu schaffen, die neugierig macht und Kreativität zulässt. Nur so kann Neues und Innovatives entstehen. Aus meiner Sicht sind nicht nur die naturwissenschaftlichen Fächer das Thema der Zukunft, sondern die Geisteswissenschaften. Das Beispiel der künstlichen Intelligenz zeigt das: Die Frage ist nicht „Was kann KI?“, sondern „Wie gehen wir damit um? Wie können wir im Unternehmen KI so nutzen, damit Zeit und Raum für das da ist, was den Menschen ausmacht: Neugier, Kreativität und Intuition.“ Es geht um den ethischen Umgang mit den Inhalten, die uns die Technik ermöglicht, und um die Verbindung zwischen der KI und den Talenten und Fähigkeiten der Menschen im Unternehmen. Beides gehört zu einer resilienten Unternehmenskultur.
Wenn wir von Ethik sprechen: Welchen Stellenwert nimmt die Wertschätzung in einem psychosozial resilienten Unternehmen ein? Einen sehr hohen. Würdigung und Wertschätzung sind essentielle Faktoren jedweder zwischenmenschlichen Beziehung und Kern jeder Kompetenzengemeinschaft. Sie ist die Basis für die weiteren Resilienz-, Kompetenz-, Lern- und Entwicklungsfelder wie Improvisations-
vermögen, Lernbereitschaft, Optimismus und positives Weltbild, Akzeptanz und Realitätsbezug, Lösungsorientierung und Kreativität, Selbstregulation und Selbstfürsorge, Selbstverantwortung und Gestaltungskraft, Beziehungen und Netzwerke, Zukunftsgestaltung, Visionen und Werte. Resiliente Menschen wissen und akzeptieren die Tatsache, dass Rückschläge und Widrigkeiten zum Arbeits- und Privatleben dazugehören, und verdrängen oder verleugnen diese nicht. Ihr Blick auf eine Krise ist nicht die auf unüberwindbare Hindernisse, sondern sie versuchen mit Gelassenheit und der Besinnung auf ihre Begabungen und Talente diese Krise zu meistern. Sie nehmen durch ihr positives Welt- und Selbstbild Krisen auch als wertvolle Erfahrungen auf dem Weg zum Erfolg. Resiliente Menschen nehmen ihre Gedanken, Gefühle, Handlungen und körperlichen Symptome ernst und sind auch bereit, sich beruflich neu zu orientieren, wenn die persönliche Resilienz im Privaten wie auch am Arbeitsplatz mitteloder langfristig nicht gefördert wird. Sie übernehmen Selbstverantwortung und sind entschlossen, ihr Schicksal selbst zu gestalten. PR
PSYCHOSOZIALE RESILIENZ
Psychosoziale Resilienz spielt nicht nur für jeden persönlich, sondern auch im Arbeitsumfeld eine große Rolle. Die Fachgruppe der Personenbetreuer und Personenberater in der Wirtschaftskammer Tirol will Führungskräfte dahingehend aufmerksam machen, auf das psychologische Immunsystem aller Teamplayer zu achten und gerade in unseren krisenbehafteten Zeiten psychosoziale Beratung als präventive Maßnahme in Betracht zu ziehen.

55
WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL
ZUKUNFT
forschung & innovation

Forscher*innen an der Universität Innsbruck haben eine KI-basierte Methode entwickelt, um Rechenoperationen auf Quantencomputern zu planen
KInnovationen
Die Künstliche Intelligenz reicht weit in unsere Lebens- und Arbeitswelten hinein. Sie mag ihre Schattenseiten haben, ist in vielen Fällen jedoch extrem hilfreich. Um Naturgefahren besser vorherzusehen, zum Beispiel. Ob Felsstürze, Murenabgänge oder Hangrutschungen: Extremereignisse werden immer häufiger. Um Schäden vorzubeugen und Personen sowie Infrastruktur weitestgehend zu schützen, wird vorrangig auf Prävention in Form von Schutzmaßnahmen gesetzt. Mit dem Projekt „DigiSchutz: Errichtung eines KI-basierten Frühwarnsystems für Naturgefahren“ wollen das MCI, das Institut für Mechatronik an der Universität Innsbruck sowie die GMD GmbH, die sich auf die Entwicklung intelligenter Lösungen zur Prävention von Naturgefahren spezialisiert hat, Naturgefahren vorhersehbar(er) machen. Im Rahmen des Technologieförderungsprogramms wird das Projekt im Bereich Digitalisierung auf Antrag von Wirtschaftslandesrat Mario Gerber mit insgesamt rund 190.000 Euro gefördert. Außerdem kann KI dabei helfen, technische Errungenschaften schneller und effektiver voranzutreiben. Forscher*innen der Universität Innsbruck zum Beispiel haben eine neue Methode zur Planung von Rechenoperationen auf einem Quantencomputer vorgestellt, bei dem ein generatives Machine-Learning-Modell verwendet wird. Die Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift „Nature Machine Intelligence“ veröffentlicht wurde, ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von Quantencomputern ausschöpfen zu können.
56
© UNIVERSITÄT INNSBRUCK/HARALD RITSCH
INTERNATIONAL
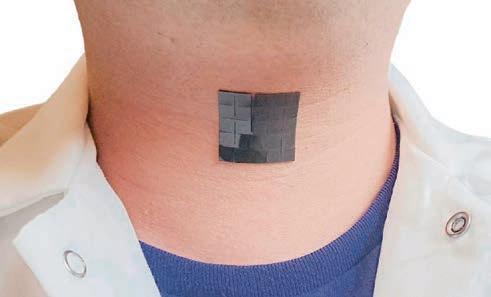
SPRECHEN OHNE STIMMBÄNDER
Wer temporär nach einer Kehlkopfoperation oder aufgrund einer chonischen Stimmbanderkrankung nicht mehr sprechen kann, kann dank einer Erfindung von Ingenieur*innen der University of California wieder auf Sprache hoffen. Sie haben ein neuartiges Gerät entwickelt, das einfach wie ein Pflaster auf die Haut geklebt werden kann und Sprachkommunikation ermöglicht, selbst wenn die Stimmbänder nicht mehr funktionieren. Das von Jun Chen, Assistenzprofessor für Bioengineering an der UCLA Samueli School of Engineering, und seinen Kolleg*innen entwickelte bioelektrische System kann die Bewegungen der Larynxmuskeln – der Muskulatur des Kehlkopfes – einer Person detektieren und diese Signale in hörbare Sprache übertragen. Und das mit einer Genauigkeit von nahezu 95 Prozent. Technisch möglich wird dies mittels eines KI-gestützten Algorithmus, der elektrische Signale in Wörter übersetzt.

LADY IN RED
Ein internationales Team von Biologen – unter ihnen Markus Möst von der Universität Innsbruck – hat in Heliconius-Schmetterlingen erstmals eine direkte Verbindung zwischen einem Gen und dem Balzverhalten nachgewiesen. Leuchtende Farben und Muster auf den Flügeln sind ein charakteristisches Kennzeichen der tropischen Schmetterlinge. Dieses auffällige Äußere schreckt nicht nur Fressfeinde ab – die Schmetterlinge sind giftig und schmecken für Vögel bitter –, es ist auch ein wichtiges Signal für die Partnerwahl. Ein bei der Kreuzung zweier Schmetterlingsarten weitergegebenes Gen ist verantwortlich dafür, dass Männchen beider Arten Weibchen mit roten Mustern bevorzugen. Das ist nicht nur eine Nice-to-know-Info, damit haben die Forscher*innen auch nachgewiesen, dass Hybridisierung bei der Evolution von Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen kann.

Michael Perger, Geschäftsführer der BTV Leasing GmbH
KAPAZITÄTEN-
LEASING
Können Leasingraten nach Objektnutzung bezahlt werden?
Die Verwendung eines Leasingobjekts unterliegt Schwankungen, deren Ausmaß oft schwer abschätzbar sind. Dadurch werden die Umsätze und die Liquiditätssituation eines Unternehmens beeinflusst. Um diesen Effekt abzufedern und ein Maximum an Flexibilität bieten zu können, haben wir das BTV Kapazitätenleasing entwickelt. Die Leasingraten orientieren sich an der Nutzung des Objekts und damit an den erzielten Deckungsbeiträgen. Extreme Spitzen nach unten oder oben werden abgefangen und Jahre mit einer guten Auslastung werden durch jene mit einer schlechten kompensiert.
WIE FUNKTIONIERT DAS BTV KAPAZITÄTENLEASING?
Unternehmer*innen melden uns zum Monatsende beispielsweise die beförderten Personen/Zutritte, die geflogenen Minuten oder die Betriebsstunden, davon abhängig wird die entsprechende Leasingrate vorgeschrieben. Sollten in einem Monat keine Kapazitäten (z. B. Stillstand) verbraucht werden, so fällt nur die Grundmiete in Höhe des Zinsanteils an. Der Leasingvertrag kann auch während der Laufzeit flexibel an die Bedürfnisse unserer Kund*innen angepasst werden. PR
FREIE LIQUIDITÄT DURCH LEASING SICHERN
Leasing ist mehr als die Finanzierung eines Objekts. Es bietet Unternehmer*innen erhebliche Mehrwerte wie die Steuerung der Bilanz und GuV, das Heben oder die Bildung stiller Reserven, die Optimierung der Finanzierungsstruktur oder die Auslagerung von Anlagevermögen bei geplanten Betriebsübergaben. btv.at/leasing
BTV LEASING GMBH
6020 Innsbruck, Stadtforum 1 Tel.: 0505 333 − 2028
E-Mail: info@btv-leasing.com
eco. expertentipp
© THOMAS SCHROTT © JUN CHEN LAB/UCLA

58 © ANDREAS FRIEDLE
LEHRENDE LEHREN
Künstliche Intelligenz (KI) in all ihren Ausprägungen ist gekommen, um zu bleiben. Das erfordert neue Kompetenzen – im Alltag und im Berufsleben.
Dies wiederum stellt das Schulsystem vor Herausforderungen. Welche –digitalen – Kompetenzen brauchen zukunftsorientierte Lehrpersonen und folglich auch jenes System, das diese ausbildet?
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt verändert und tut es weiterhin in rasanter Geschwindigkeit. Neue Technologien und das Aufkommen Künstlicher Intelligenz stellen vor allem das Bildungssystem vor Herausforderungen, weil es nicht nur von den aktuell bereits Lehrenden neue, digitale Kompetenzen einfordert, sondern naturgemäß auch die Ausbildung künftiger Lehrkräfte beeinflusst.
Die Pädagogische Hochschule (PH) Tirol bildet eben jene zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer aus. Neben dem bereits bestehenden berufsbildenden Lehramtstudium „Information und Kommunikation – Angewandte Digitalisierung“ wird es ab Herbst den Hochschullehrgang „Künstliche Intelligenz im IT-Unterricht der Berufsbildung“ für Lehrer*innen an berufsbildenden Schulen geben. Lehrgangsleiterin Gerlinde Schwabl ist maßgeblich an der Entwicklung des Lehrgangs beteiligt, der unter anderem das Verständnis von Zusammenhängen zwischen digitalen Innovationen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie die Auswirkungen von KI-Technologien auf die Wirtschaft und den Bildungsbereich unter Einbeziehung ethischer und rechtlicher Herausforderungen und Fragestellungen analysieren soll. Gemeinsam mit Patrick Pallhuber ist Schwabl Dozierende am Institut für Berufspädagogik. Wir haben die beiden an der PH Tirol zum Gespräch getroffen.
ECO.NOVA: Wie schätzen Sie den Status quo in Bezug auf das Wissen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei derzeit lehrenden Pädagog*innen in Tirol ein? GERLINDE SCHWABL: Wie immer, wenn es Veränderungen gibt, gibt es grob gesagt
PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE TIROL
Die Pädagogische Hochschule (PH) Tirol bietet verschiedene praxisorientierte Studiengänge in der Lehramtsausbildung für die Elementar-, Primarund Sekundarstufe. Neben der Erstausbildung stellt die PH Tirol auch ein breites Spektrum an Weiterbildungs- und Fortbildungsprogrammen für bereits im Dienst stehende Pädagog*innen bereit. Diese Programme zielen darauf ab, die berufliche Kompetenz und das pädagogische Wissen von Kindergarten-, Krippen- und Hortpädagog*innen sowie Lehrpersonen an Schulen kontinuierlich zu erweitern. Außerdem engagiert sich die Hochschule in der pädagogischen Forschung und Schulentwicklung. www.ph-tirol.ac.at
zwei Gruppen von Menschen: Die Early Adopters, die voranpreschen und von Anfang an mit dabei sind, und jene, die mit den neuen Entwicklungen vorerst gar nichts zu tun haben wollen, weil sie das Gefühl haben, nicht davon betroffen zu sein. So verhält es sich auch bei den Pädagog*innen. Wir merken allerdings, dass angebotene Weiterbildungen zum Thema Künstliche Intelligenz sehr gut angenommen werden. Die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wird also zunehmend erkannt.
Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt und unser gesamtes Leben in einer wohl nie dagewesenen Rasanz verändert. Der technologische Fortschritt schreitet nicht linear, sondern exponentiell voran. Wie geht man in der Ausbildung insbesondere im Bereich der Berufsbildung damit um? PATRICK PALLHUBER: Es ist tatsächlich die große Herausforderung gerade in der Berufsbildung im Kontext der so genannten Curriculum-Theorie, also der wissenschaftlichen Theorie hinter der Entwicklung von Lehrplänen, die Frage zu lösen, wie Curricula mit den gesellschaftlichen Änderungen halbwegs Schritt halten können. Berufsbilder und Tätigkeitsfelder ändern sich real derart schnell, dass wir mit den Lehrplänen immer hinterherhinken. Lehrerinnen und Lehrer sind deshalb besonders gefordert, die aktuellen Lehrpläne anders und neu zu interpretieren und sich gleichzeitig selbst neue Kompetenzen anzueignen. Jene, die aktuell zu Themen wie Künstlicher Intelligenz unterrichten, haben diesen Fokus in ihrer Ausbildung nie selbst erlebt. Das gilt es, nachzuholen, sich anwendungsorientierte Kompetenzen aufzubauen, den Umgang mit
eco. zukunft 59

„Neben Medien- geht es ganz stark um Begründungskompetenz.“
GERLINDE SCHWABL
KI selbst zu erproben und diese Erkenntnisse für jene zu übersetzen, die vor einem in der Klasse sitzen.
Aktuell scheinen junge Menschen, die mit diesen Technologien aufgewachsen sind, mehr Ahnung davon zu haben als ihre Lehrer*innen oder Eltern. Auf der anderen Seite scheint ihnen jedoch ganz viel Hintergrundwissen dazu zu fehlen.
GS: Das stellen wir auch fest. Man denkt immer, die so genannten Digital Natives können den Umgang mit digitalen Medien fast automatisch. Das Problem ist, dass es in all diesen Anwendungen vor allem um easy use geht. Fast all diese Anwendungen sind einfach zu handhaben, der Zugang ist niederschwellig, aber keiner macht sich tatsächlich über die Inhalte Gedanken oder darüber, wie die Anwendungen funktionieren und was dahintersteckt. Die jungen Menschen wischen und wischen und wischen über ihre Smartphones und benutzen Apps, ohne sich mit den dahinterliegenden Prozessen auseinanderzusetzen. PP: Gerade weil ihnen dieses Verständnis fehlt, können sie oft auch die ethischen Perspektiven nicht einordnen. Das zeigt sich manchmal sogar bei den Lehrerinnen und Lehrern, die ein neues Tool entdecken und einsetzen, sich aber die Didaktik dahinter nicht überlegen oder den sinnvollen methodischen Einsatz. Es geht in solchen Fällen um Toolerism, also
GERLINDE SCHWABL
geb. 1978, ist Dozierende am Institut für Berufspädagogik, eine Besonderheit an der PH Tirol, und beschäftigt sich in Lehre und Forschung mit digitaler Bildung in der Primar- und Sekundarstufe. Sie ist Studiengangsleiterin des berufsbildenden Lehramtstudiums mit Fokus Medien, Wirtschaft und Design „Information und Kommunikation – Angewandte Digitalisierung“. Schwabl setzt sich aktiv und praxisbezogen mit Künstlicher Intelligenz auseinander, im Rahmen der Lehre hat sie mit ihrem Kollegen Patrick Pallhuber Lehransätze zum kritisch-konstruktiven Umgang mit textgenerativer KI –Prompt-Engineering, Factcheck und AI-Cooperation – erprobt und entwickelt aktuell ein entsprechendes Lehrkonzept, das sich in Lehrveranstaltungen aller Fachrichtungen anwenden lässt.
darum, möglichst viele Tools einzusetzen, über deren Sinnhaftigkeit macht man sich allerdings keine Gedanken. Das ist ein Problem. Gerade auch in Bezug auf Social Media sind junge Menschen – und übrigens nicht nur die – oft sehr unreflektiert. Uns geht es an der PH Tirol darum, einen konstruktiv-kritischen Umgang mit KI und Medien im Allgemeinen zu vermitteln. Beides haben viele Jugendlichen nicht. Weder einen konstruktiven noch einen kritischen Umgang. Sie haben einfach einen Umgang. GS: Diesen konstruktiv-kritischen Umgang müssen wir unseren Studierenden als auch den Lehrenden an den Schulen mitgeben. Die Usability, die technische Nutzerfreundlichkeit, vieler Tools ist hoch, deshalb werden sie genutzt. Was beim Einsatz textgenerativer KI, die in der Bildung vor allem relevant ist, aber tatsächlich passiert, wer die KI mit welchen Inhalten füttert, was mit unseren Daten passiert, damit beschäftigt sich kaum jemand. Und wenn sich schon unsere Studierenden damit schwertun, die erwachsen sind und auf Lehramt studieren, wie sollen das Kinder hinkriegen?
Fehlt es jungen Menschen an Medienkompetenz? GS: Ja, und genau darum geht es. Medienkompetenz hat es im Grunde immer schon gebraucht, mit dem Aufkommen der KI hat diese nun allerdings ganz neue Dimensionen bekommen. Durch technische Hilfsmittel sollten wir eigentlich eine kognitive Entlastung erfahren, am Ende hat man allerdings viel mehr Informationen, die es zu verarbeiten gilt. Neben Medien- geht es also auch ganz stark um Begründungskompetenz. Man muss die Schüler*innen sensibilisieren und eine entsprechende KI-Kultur entwickeln. PP: Wir müssen lernen, Inhalte und Ergebnisse – egal, ob sie von einer KI oder der geistigen Leistung eines Menschen kommen – kritisch zu bewerten und einzuordnen. Dieses Verständnis gilt es, zu entwickeln. Das ist ein Prozess, der sich nicht von heute auf morgen entwickeln wird. Es braucht dafür mit Sicherheit neue Kompetenzen, Grundlagenwissen und die vermehrte Arbeit mit Originalquellen wie Fachliteratur und die Fähigkeit zur Quellenkritik, die von den Curricula nicht verschwinden darf.
Hat man früher die Zeitung gelesen oder Nachrichten im Fernsehen geschaut, hat man diese Informationen als gegeben hingenommen. Heute wird jede Meldung hinterfragt, jede noch so seriöse Quelle kritisch beäugt. Wir sind quasi permanent
eco. zukunft 60
© ANDREAS FRIEDLE
damit beschäftigt, alles zu hinterfragen.
GS: Das stimmt, was aber ist die Alternative? Mittels KI kann heute derart vieles gefakt werden. Das macht es nicht einfacher, Inhalte auf ihre Seriosität hin zu bewerten. Hier sind wir wieder bei der Medienkompetenz und Quellenarbeit. Das ist sicher anstrengender, als es früher war, aber unumgänglich. PP: KI hat viele gute Seiten und kann den Arbeitsalltag sehr erleichtern. Sie liefert für manche Einsatzbereiche inhaltlich gute Ansatzpunkte. Für bestimmte Gebiete ist textgenerative KI durchaus gut geeignet. Im Lernverlauf sehe ich sie allerdings kritisch.
GS: Am Ende muss man jedes KI-generierte Produkt zu seinem eigenen machen und darf ihm nicht blind vertrauen. Die KI ist ein digitaler Helfer, für das Ergebnis ist man jedoch selbst verantwortlich. Das müssen wir unseren Studierenden mitgeben. Den Einsatz von KI an Schulen zu verbieten, halte ich deshalb für wenig sinnvoll, weil wir lernen müssen, damit umzugehen und klug damit zu arbeiten. Unsere Studierenden brauchen die Fachkompetenz, KI-generierte Inhalte entsprechend zu bewerten und einzuordnen.
Welche Rolle wird der Mensch in einer immer digitaler getriebenen (Arbeits-) Welt künftig spielen? PP: Es braucht jemanden, der die Maschine mit Input füttert, und jemanden, der beurteilt, was diese ausspuckt. Die menschlich-geistige Leistung wird es also immer brauchen, nur ist sie anders verteilt. GS: KI kann eine Chance sein, wenn man jene Tools findet, die für einen sinnvoll sind. Es braucht allerdings ein entsprechendes Bewusstsein dafür. Heute nutzt man KI vielfach, um das Leben zu vereinfachen. Das ist an sich nichts Schlechtes, wenn man die Technik zielgerichtet einsetzt. Dennoch muss man die dahinterliegenden Prozesse, Besitzverhältnisse der Hersteller*innen, Datenqualität und vieles mehr kennen und verstehen.
Wie verändert die KI die Arbeit für Hochschulen? PP: Die Herausforderung für Hochschulen wird es künftig sein, die Aufgabenstellungen für die Überprüfung von Kompetenzen anzupassen. Die klassische Wissensabfrage-Klausur wird es nicht mehr brauchen. Es benötigt andere Aufgabenstellungen. Das heißt auch, Abschlussarbeiten anders zu betreuen, als Betreuer engmaschiger mit den Studierenden in Kontakt zu sein, sich inhaltlich mit dem Thema zu beschäftigen, um die Studierenden herauszufordern, ihnen konkrete Fragen zu stellen,
PATRICK PALLUBER
geb. 1985, hat unter anderem Wirtschaft & Management studiert und leitet seit 1. März die Stabsstelle Hochschulentwicklung an der PH Tirol, die sich unter anderem damit beschäftigt, wie KI proaktiv in der (Weiter-)Entwicklung der Hochschullandschaft eingesetzt werden kann. Auch er ist Lehrender am Institut für Berufspädagogik, arbeitet seit vielen Jahren zu Themen Qualität und Hochschule und setzt KI innovativ in der Lehre ein.
was ihre eigenen Erkenntnisse aus all den Informationen sind. Sonst läuft man Gefahr, vor einer Arbeit zu sitzen, der komplett die Eigenständigkeit fehlt. Als Betreuer kann ich folglich zum Sherlock Holmes der KI-Suche werden und mich darüber ärgern, dass sich jemand unerlaubt der KI bedient hat, oder ich gestalte meine Aufgabenstellung um und suche vermehrt den persönlichen Austausch. Das eröffnet vielleicht sogar die Chance, im Idealfall näher am Menschen zu sein, weil die Arbeit an sich so nahe an der Maschine ist. Für mündliche Prüfungen könnte man Formate finden, in die man die KI integriert, sich in der Livesituation Wissen aus der KI holt und diese Ergebnisse bewertet. GS: Wir haben vergangenen Oktober eine Leitlinie zur Verwendung textgenerativer KI an der PH Tirol herausgegeben, die unseren Lehrenden genau solche Formate ermöglicht. Unterm Strich geht es darum, KI-kompetente Pädagog*innen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Wir können uns also vor der KI in der eigenen Lehre nicht verschließen. Aber: kritisch-reflektiert. Am Ende muss man den Umgang damit lernen, um ihn lehren zu können.
© ANDREAS FRIEDLE

„Jene, die aktuell zu Themen wie Künstlicher Intelligenz unterrichten, haben diesen Fokus in ihrer Ausbildung nie selbst erlebt. Das gilt es, nachzuholen.“
PATRICK PALLHUBER
eco. zukunft 61
© OLIVER WOLF
ÖKOSYSTEM DES LERNENS
Informationstechnologien und ihre Anwendungsmöglichkeiten finden erst langsam ihren Platz im allgemeinen Bildungssystem. Dabei ist es wichtig, den Nachwuchs so früh wie möglich an die Technologien der Zukunft heranzuführen und ihn damit auf das sich wandelnde Arbeitsleben vorzubereiten.
Fast jeder nutzt die neuen Technologien und all ihre zahlreichen Spielarten, doch kaum einer weiß, wie sie tatsächlich funktionieren. Verschiedene Initiativen und Projekte versuchen niederschwellig und oft kostenlos, Kinder und Jugendliche an das Thema heranzuführen. Bereits 2017 startete etwa die Marketing- und Online-Agentur FACTOR Innsbruck mit ihrem Workshop Coding4Kids, bei dem Kinder zwischen zehn und 14 Jahren spielerisch in die Welt des Programmierens eintauchen – weil Theorie zwar schön ist, aber das Wissen um die Anwendung ungleich schöner. Nach wie vor laufen die Programme tirolweit erfolgreich, Infos und Termine finden Sie unter www.coding4kids.at.
ZUKUNFTSTECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Digitale Aufklärung betreibt auch die Web3-Software-Agentur Wavect aus Ampass, die sich auf Blockchain-bezogene Arbeiten wie Smart-Contracts und DApps sowie Produktmanagement spezialisiert hat. „Blockchain“ ist den meisten vermutlich in Zusammenhang mit Kryptowährungen untergekommen, für viele ist sie aber nach wie vor eine Art Blackbox, obwohl sie als echte Zukunftstechnologie gilt.
Vereinfacht gesagt, ermöglicht es die Technologie, Daten sicher auszutauschen und dezentral zu speichern. Eine Blockchain ist wie eine Art digitales Tagebuch, in dem alle Transaktionen und Informationen in einzelnen Datensätzen, also Blöcken/blocks, unveränderbar gespeichert und chronologisch aneinandergekettet (Kette = chain) werden und von allen Beteiligten jederzeit eingesehen werden können. Die Technologie kann im Rahmen von (internationalen) Finanz-Transaktionen zum Einsatz kommen und grundsätzlich überall dort, wo es einen sichern Datenaustausch braucht. Also quasi in sämtlichen Geschäftsfeldern. Gerade weil die Technologie so universell, sicher und damit zukunftsorientiert ist, setzt Wavect schon bei den Jüngsten an und bietet zielgerichtete Workshops für Zehn- bis 15-Jährige an. Die Workshops ermöglichen es den jungen Teilnehmer*innen, sich mit den Hintergründen der Blockchain vertraut zu machen und erste Programmierkenntnisse zu erwerben. Und das völlig kostenlos. Vorkenntnis-
se braucht es keine, sollte bei den Teilnehmer*innen schon Basiswissen vorhanden sein, können die Inhalte flexibel angepasst werden. Die Kurse finden stationär und gerne nach Absprache auch in Schulen statt, ergänzend werden Onlinekurse angeboten. Infos zu den Workshops, Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt’s unter products.wavect.io.

JUGEND FORSCHT IN DER TECHNIK
Dass junge Menschen neugierig sind und diese Neugierde auch in konkrete Projekte umzusetzen wissen, zeigt der Wett-bewerb „Jugend forscht in der Technik“, der gemeinsam von der Wirtschaftskammer Tirol, dem Land Tirol, der Industriellen-vereinigung und dem Förderverein Technik Tirol durchgeführt wird. Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren waren aufgerufen, mit der ganzen Klasse oder in Kleingruppen zu experimentieren, ihre Forschungsergebnisse aus den Fachgebieten Technik, Informatik/ Mathematik, Umwelttechnik/Energie sowie Chemie/Physik haben sie Mitte Mai im Haus Marie Swarovski in Wattens präsentiert. Erstmals wurde heuer auch ein Preis in der Sonderkategorie Nachhaltigkeit vergeben. Schüler*innen der 3. und 4. Klasse Volksschule, der Neuen Mittelschule, der AHS-Unterstufe, des Polytechnikums und der allgemeinen Sonderschule, Klein-gruppen und geschlossene Schulklassen ließen ihrem Forschergeist freien Lauf, übten sich im Programmieren, erkundigten sich bei Expert*innen über genaue Abläufe in der Natur oder fanden es selbst heraus. Wenn sie beim ersten Versuch scheiterten, probierten sie noch einmal und brachten ihre wertvollen Erfahrungen in digitaler Form als schriftliche Arbeiten ein. Insgesamt haben 200 Schüler*innen teilgenommen und 16 Projekte eingereicht. Infos zum Wettbewerb und den Siegerprojekten finden Sie unter www.jufotech.at
eco. zukunft 62



Kraftvoll

Der Multivan Vielfalt, die Träume weckt

für große Aufgaben Praktisch,

5 Jahre Garantie *



Multivan Business eHybrid für Privat- und Businesskunden ab € 62.990 Brutto inkl. Händlerrabatt
wirtschaftlich, innovativ, Crafter
Profitieren Sie zusätzlich von bis zu € 10.000,– Eintauschbonus* auf Ihren Familien-Van




Mit dem neuen, optionalen „Gute Nacht Paket“ für jedes Abenteuer gewappnet.



Mit 8-Gang-Automatik für alle Antriebsarten:


Frontantrieb ✔ Heckantrieb ✔ Allradantrieb 4MOTION ✔
Lieber klassisch oder modern? Lieber Life oder Style? Bei den Modellvarianten und den vielen Ausstattungspaketen sind Ihrem Freiheitsdrang kaum Grenzen gesetzt. Wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten. Kurz oder lang – Sie entscheiden!
* Erhalten Sie bis zu € 10.000,- brutto Bonus. Gesamtbonus enthält:
Family-Bonus: Bei Kauf eines Multivan erhalten Sie € 2.000,− Family-Bonus. Gültig für Privatkunden bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2024.
Eintauschbonus: € 5.000,- brutto Bonus bei Eintausch eines VW Sharan, VW Touran, Seat Alhambra und ähnlichen Modellen (Details bei Ihrem VW Betrieb). Gültig bei Kauf bis 30.06.2024. Nur solange der Vorrat reicht.
Porsche Bank Bonus: € 1.000,- Porsche Bank Bonus für Privatkunden bei Finanzierung eines Neuwagens über die Porsche Bank. Aktion gültig bis 30.06.2024 (Kaufvertrags-/ Antragsdatum). Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden.

Porsche Bank Bonus bei Eintausch: Zusätzlich € 1.000,- Porsche Bank Bonus für Privatkunden bei Finanzierung eines Neuwagens über die Porsche Bank und Erfüllung der Kriterien des Eintauschbonus. Aktion gültig bis 30.06.2024 (Kaufvertrags-/Antragsdatum). Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden.
Versicherungsbonus: € 500,- Bonus. Nur gültig bei Finanzierung (Leasing oder Kredit) über die Porsche Bank und dem Abschluss einer vollKASKO bzw. vollKASKO Plus über die Porsche Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate.
Servicebonus: € 500,- Bonus. Aktion gültig bis 31.12.2024 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) bei Porsche Bank Finanzierung im All Inclusive-Paket mit SERVICE oder topSERVICE. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 50 % vom Kaufpreis. Nicht gültig für Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden.
Alle Boni sind unverbindl. empf., nicht kartell. Preisnachlässe inkl. MwSt. und NoVA und werden vom unverbindl. empf., nicht kartell. Listenpreis abgezogen. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Nur mit ausgewählten Aktionen kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht.
* Sichern Sie sich kostenlos eine 3 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maximalen Gesamtlaufleistung von 200.000 km (je nachdem welches Ereignis als erstes eintritt). Über die weiteren Einzelheiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für werksseitigen Lieferumfang. Verbrauch: 8,4 – 13,1 l/100 km. CO2-Emission: 221 – 355 g/100 km. Symbolfoto.
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für Ihr Verständnis.
Verbrauch: 6,4 – 9,8 l/100 km. CO2-Emission: 167 – 221 g/km. Symbolfoto. 05/2024.
Innsbrucker Straße 59

www.porschetirol.at
STANDORTAGENTUR TIROL
REGIONALES ÖKOSYSTEM
In Tirol entsteht Europas erster regionaler Data Space.

In Unternehmen und Institutionen fallen tagtäglich enorme Mengen an Daten an. Der datahub.tirol schafft die Möglichkeit, diese Daten branchenübergreifend zu nutzen, um Innovation und neue Geschäftsmodelle zu fördern. „Wir bauen ein regionales
Ökosystem auf, in dem sich Anbieter und Nutzer von Daten treffen“, erläutert Fritz Fahringer von der Standortagentur Tirol. Mit dem datahub.tirol entsteht der weltweit erste regionale Data Space, der die EU-Regelungen in Bezug auf Datenschutz und -souveränität voll umsetzt. Der datahub. tirol schafft die Möglichkeit, diese wertvollen Datensätze nicht nur selbst zu nutzen, sondern auch anderen zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es nicht nur um den Zugang zu den Daten, sondern um das Management


„Die Datensouveränität bleibt jederzeit bei den Datenanbietern.“
FRITZ FAHRINGER
des Datenflusses. Der datahub.tirol fungiert dabei als Mittler und Verknüpfer von Datensätzen. „Der Hub speichert lediglich Metadaten, also Beschreibungen der bereitgestellten Datensätze. Dadurch bleibt die Datensouveränität jederzeit bei den Datenanbietern“, erklärt Fritz Fahringer. Die Standortagentur Tirol ist für die Umsetzung des datahub. tirol verantwortlich. Das Land Tirol stellt 1,5 Millionen Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung, um das Projekt zu finanzieren.
SO FUNKTIONIEREN
DATA SPACES
Bei einem Datenraum (engl. Data Space) handelt es sich um einen virtuellen Raum, der Anbieter*innen von Daten mit Abnehmer*innen zusammenbringt. Erstere werden als Data Provider bezeichnete, zweitere als Data Consumer. Die Datenpakete der Provider stellen einen Wert dar, sie heißen daher Data Assets. Diese sind jedoch nicht im Data Space selbst gespeichert. Hier findet sich lediglich eine Beschreibung jedes Datenpakets in Form von Metadaten. Außerdem sind Zugangs- und Nutzungsbestimmungen hinterlegt.
Anhand der Beschreibung der Datenpakete, welche im Data Space hinterlegt ist, können die zugrunde liegenden Daten gehandelt werden. Der eigentliche Austausch der Daten passiert jedoch außerhalb des Data Space, nämlich direkt zwischen Provider und Consumer anhand der festgelegten Nutzungsbestimmungen. Für jedes Data Asset können individuelle Nutzungsregeln
gelten. Die Datensouveränität bleibt bei den Datenanbieter*innen. Sie sind als User des Data Space für ihre Daten und deren Verarbeitung verantwortlich. Der Zugang zu Datenräumen kann nicht öffentlich zugänglich (privat), teilweise zugänglich oder offen zugänglich wie auch hierarchisch gegliedert sein. Jeder Datenraum stellt bestimmte Daten zur Verfügung und trägt somit zur Erweiterung des regionalen Datenmarktplatzes bei.
DATENSOUVERÄNITÄT IM FOKUS
Der datahub.tirol verfolgt zwei übergeordnete Ziele: Erstens soll durch branchenübergreifende Zusammenarbeit ein Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen werden. Zweitens soll die Entwicklung von EU-konformen Data Spaces vorangetrieben werden, um das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg von morgen zu legen. Datensouveränität sowie Interoperabilität stehen dabei im Fokus.
„Der datahub.tirol spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von EU-konformen Data Spaces“, so Fritz Fahringer. Eine entsprechende Infrastruktur ermöglicht einen sicheren, effizienten und fairen Austausch von Daten. Unternehmen werden ermutigt, eine Wertekultur zu fördern, die auf Vertrauen, Zusammenarbeit und Klarheit basiert, um nachhaltige Wertschöpfung und Innovation zu generieren. Dies trägt zur Exzellenz des Tiroler Lebensraums bei und unterstützt das Wachstum der europäischen Wirtschaft.
USE CASES
Im datahub.tirol können Nutzer*innen Daten austauschen und anhand verschiedener Datenräume Use Cases entwickeln. Der Hub dient als zentraler Anlaufpunkt für Personen und Organisationen, die Daten effizient verwalten und unter kontrollierten Bedingungen teilen möchten. Im datahub.tirol steht eine Vielzahl von Datenquellen für unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verfügung. Genutzt werden können diese unter anderem von Start-ups, Unternehmen, Vereinen, öffentlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen. Hier sind einige Beispiele für Use Cases, die bereits im datahub.tirol implementiert sind:
• INNERGY – Innovative Energielösungen mit Wärmedaten aus dem Inntal: Das Innovationslabor INNERGY soll Innovationsprojekte entwickeln, beschleunigen und begleiten. Ein erstes Leitprojekt zielt darauf ab, die Fernwärmeversorgung im Inntal flexibler zu gestalten. Wärmedaten spielen dabei eine zentrale Rolle, sie müssen erfasst und ausgetauscht werden, was über den datahub.tirol erfolgt.
• Unfallprävention im Wintersport: Alpinunfälle sind eine der häufigsten Ursachen für Verletzungen in Tirol. Insbesondere im Winter stellen die zahlreichen schweren Verletzungen von Wintersportlern die medizinische Gesundheitsversorgung vor große Herausforderungen. Das Bezirkskrankenhaus St. Johann sammelt Daten zu Art und Schwere von Verletzungen in einer Studie und verknüpft sie mit Informationen wie Wetterbedingungen, Schneequalität und Fitnesslevel. Ziel ist die Prävention von Unfällen.
• Länderübergreifende Erfassung von Elektroladestationen: Der datahub.tirol arbeitet gemeinsam mit europäischen Partnern an einem gemeinsamen Datensatz, der Informationen zu E-Ladesäulen in Österreich, Italien und Bayern enthält. Dies fördert die Elektromobilität im Alpenraum und trägt zur Entwicklung von Anwendungen rund um die E-Mobilität bei.
PR INFO
Aktuell besteht die Möglichkeit, als Vorreiter den datahub.tirol mit aufzubauen. Mehr Information: www.datahub.tirol
65
STANDORTAGENTUR TIROL
HYPE MIT TÜCKEN
In Warp-Geschwindigkeit infiltriert die Künstliche Intelligenz so gut wie alle medizinischen Bereiche – und weckt Ängste bei den Patient*innen. Weil Maschinen kein Allgemeinwissen haben können, nicht empathisch und auch nicht dazu fähig sind, der hochkomplexen menschlichen Vielfalt gerecht zu werden, ist diese Reaktion durchaus nachvollziehbar. Die Herausforderung liegt darin, die irren Möglichkeiten klug und KI ausschließlich als Werkzeug zu nutzen. Auch in Innsbruck wird intensiv daran gearbeitet.

Grenzen. Schon immer wurden Menschen von Grenzen gereizt – dazu, sie zu überschreiten. Der Drang, schneller zu werden und vor allem besser, befeuert nicht zuletzt die medizinische Forschung in ihrem Streben, das Wissen und Können zum Gesundheitswohl der Patient*innen zu verfeinern. Die Digitalisierung hat diesem Drang einen Turbo verliehen und mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) oder des Maschinellen Lernens passierte etwas, das auf den ersten Blick ein wenig absurd wirkt. Etwa, weil mit den Möglichkeiten der KI menschliche Grenzen erstens aufgezeigt und sie von ihr – zweitens – in einer Weise überwunden werden, die ihren Programmierer*innen selbst vollkommen unmöglich ist.
Radiologinnen und Radiologen zählten zu den Ersten, deren geschulte Augen von clever programmierten und mit großen Datenmassen gefütterten algorithmischen Systemen „überholt“ wurden. Darin, Krankheitsprozesse oder subtile Knochenbrüche zu erkennen, Veränderungen in allerfeinsten Gewebebereichen oder Auffälligkeiten in Mammografien zu identifizieren, sind die nimmermüden und immer lernenden Maschinen ziemlich gut. Ja, richtig gut. „Bei der Bildanalyse sind die KI-Systeme den Menschen schon weit überlegen. Wenn man sie richtig trainiert, übertreffen sie die menschlichen Fähigkeiten längst“, wurde Clemens Heitzinger von der Fakultät für Informatik und dem Center for Artificial Intelligence and Machine Learning (CAIML) der Technischen Universität (TU) Wien von der APA zitiert, als diese Anfang 2024 über das Symposium „AI in Medicine – Vision – Reality – Legal Aspects“ berichtete.
ALEXANDRA KELLER
TEXT:
eco. zukunft 66


Sabine Hofer leitet den Spezialbereich Diabetologie an der Innsbrucker Universitätsklinik für Pädiatrie. Zusammen mit Kolleg*innen der Medizinischen Universitäten Graz und Wien hat sie im Rahmen des von der EU gesponserten Wissenschaftsprojektes KidsAP ein KI-Steuerungssystem für Glukosesensoren und Insulinpumpen getestet.
Die Überlegenheit, von der der Wissenschaftler spricht, zeigt sich beispielsweise auch bei der Auswertung von EEG-Aufzeichnungen. Die Elektroenzephalographie (EEG) ist ein neurologisches Diagnoseverfahren zur Erfassung von elektrischen Strömen des Gehirns. Etwa beim Verdacht auf Nervenerkrankungen oder Hirnschädigungen werden EEGs gemacht, manchmal wird damit die Narkose überwacht und bei einer 24-stündigen Aufzeichnung entstehen über 5.700 Bildschirmseiten mit den charakteristischen Wellen. Sie auszuwerten wird vorzugsweise Computeralgorithmen überlassen, mit – und das ist stets entscheidend – anschließender menschlicher Kontrolle und Verifizierung.
Mit Künstlicher Intelligenz können Krebszellen in kürzester Zeit in Gewebeproben entdeckt werden, wodurch sich OP- und damit die Narkosezeiten für Patient*innen verringern. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um die Diagnose und Behandlung von lebensbedrohlichen Krankheiten wie etwa die einer Blutvergiftung zu verbessern, die besten Wirkstoffe zu finden oder Patient*innen lückenlos zu überwachen. So gut wie täglich wird von neuen potenziell die Medizinwelt revolutionierenden KI-Potenzialen gesprochen und im Rahmen der erwähnten KI-Veranstaltung sprach der Rektor der MedUni Wien, Markus Müller, diesbezüglich von einem „klassischen Hype“. Eine Diagnose, die Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, konkretisierte, indem er feststellte: „Derzeit werden rund hundert wissenschaftliche Publikationen zu KI in der Medizin veröffentlicht, ebenso rund 70 Studien zu Deep Learning. (...) KI in der Medizin ist unvermeidlich und wird uns überwältigen.“
Klingt überwältigend, klingt sogar bedrohlich. Und das könnte es auch sein. Dann, wenn die Magie der menschlichen Erfahrung, das unablässige kritische Hinterfragen und die Fähigkeit von Mediziner*innen, den Menschen als individuelles Ganzes zu sehen, einer puren Maschinendiagnostik geopfert wird. Allen maschinenerlernten Diagnosepotenzialen zum Trotz bleiben Mediziner*innen den Künstlichen Intelligenzen überlegen – und sei es aufgrund ihres „Bauchgefühls“ oder ihrer Verantwortung, die jenseits der ausgeklügelten Berechnung von Wahrscheinlichkeiten verortet werden darf.
KI - FORSCHUNG IN TIROL
Daran, mittels Künstlicher Intelligenz geschmiedete Werkzeuge zum Wohle der Patient*innen einzusetzen, wird selbstverständlich auch in Tirol gearbeitet und geforscht. Von Sabine Hofer beispielsweise, die den Spezialbereich Diabetologie an der Innsbrucker Universitätsklinik für Pädiatrie I leitet. Zusammen mit Kolleg*innen der Medizinischen Universitäten Graz und Wien hat sie im Rahmen des von der EU gesponserten Wissenschaftsprojektes KidsAP ein KI-Steuerungssystem für Glukosesensoren und Insulinpumpen getestet. „Eltern diabeteskranker Kleinkinder sind im Alltag enorm gefordert. Sechs bis zehn Mal am Tag muss der Zuckergehalt im Blut bestimmt werden. Vier bis sechs Mal täglich muss den Kindern Insulin gespritzt werden“, erklärte die Wissenschaftlerin zu Beginn des groß angelegten Projektes. Eltern von an Typ-1-Diabetes erkrankten Kindern haben wenige ruhige Minuten, führt die Autoimmunerkrankung doch dazu, dass jene Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, zerstört werden. Die ständige Überwachung der Blutwerte und die entsprechende Reaktion durch das

Der Mediziner und Physiker Clemens Dlaska personifiziert mit seinen zwei Schwerpunkten gewissermaßen einen neuen Wissenschaftlertypus. Mit ihm wurde im Februar 2024 die neue Innsbrucker Professur für Digitale Medizin besetzt.
68 eco. zukunft
Spritzen von Insulin sind wichtig, weil ein zu rasches und zu tiefes Sinken des Blutzuckerspiegels bei Kindern zu Krampfanfällen und Bewusstlosigkeit führen kann.
Um den Zuckerspiegel zu kontrollieren, werden schon länger technische Hilfsmittel eingesetzt, doch KidsAP geht weiter. Es ist ein so genanntes Closed-Loop-System, mit dem der Glucosesensor und eine Insulinpumpe über einen Algorithmus zusammengeschlossen sind. Das Monitoring und die Steuerung des Algorithmus passieren über eine Smartphone-App. Eine für Eltern wie Kinder unglaublich lebenserleichternde Verbindung, gelingt es damit doch, den Blutzuckerspiegel genauer und über längere Zeit „im Zielbereich“ zu halten. Dieser Einsatz der KI, gepaart mit hohem wissenschaftlichen Know-how, hat die Lebensqualität der an der Studie teilnehmenden Familien jedenfalls enorm verbessert und wenn Sabine Hofer davon spricht, dass die Rückmeldungen der Familien „auf persönlicher Ebene sehr bewegend waren“, ist das ein mehr als schöner Effekt.
Derartige KI-Effekte standen auch auf der Agenda des 26. Kardiologie-Kongresses, der Anfang März 2024 im Congress Innsbruck über die Bühne ging. Den Themen Künstliche Intelligenz und Digitale Medizin wurden dabei breite Programmspektren gewidmet, hat die Kardiologie Innsbruck darin doch hohe Expertise. Erst im Februar 2024 wurde die neue Innsbrucker Professur für Digitale Medizin in der Kardiologie mit dem Mediziner und Physiker Clemens Dlaska besetzt. Der in Matrei in Osttirol aufgewachsene Dlaska personifiziert mit seinen zwei Schwerpunkten Physik und Medizin gewissermaßen einen neuen Wissenschaftlertypus. Im Rahmen seiner Bestellung hielt er fest: „Die neue Position bedeutet für mich eine große Chance und ich freue mich darauf, das zukunftsträchtige und sehr facettenreiche Forschungsfeld der digitalen Medizin an der MedUni Innsbruck mitzugestalten. Das Zusammenführen von sehr unterschiedlichen Forschungscommunities bietet großes Potential für grundsätzlich neue Ansätze. In diesem Sinne sehe ich mich auch als Brückenbauer zwischen medizinischer und technologischer Expertise.“
Sein Interesse für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen war bei ihm während eines Forschungsaufenthaltes am Institut für Neuroinformatik und dem Institut für Biomedizinische Technik an der ETH Zürich geweckt worden – und der junge Wissenschaftler hat viel vor: „Mich interessiert vor allem, wie sich neue Technologien wie KI oder langfristig auch Quantentechnologien in der Medizin einsetzen lassen. Vor allem die Sensorik bietet hier eine neue Art von Präventionsmöglichkeit.“
Prävention ist es auch, die das seit September 2023 von der Innsbrucker Kardiologie geleitete Austrian Digital Heart Program befeuert. Das von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft mit acht Millionen

Bernhard Hollaus ist Experte für Health & Sports Technology und leitet den Forschungsschwerpunkt Health Tech am MCI Innsbruck.
NUR DAS ZUSAMMENSPIEL
Über Ängste, die Künstliche Medizin in der Medizin bei Menschen auszulösen vermag.
VON BERNHARD HOLLAUS
Die Ängste vor KI in der Medizin sind vielfältig. Müssen Leute in den Gesundheitsberufen um ihren Job bangen? Kommt es durch KI zu Fehldiagnosen? Werde ich bald vom Robo-Doc behandelt? Beinahe alle diese Ängste sind verständlich, jedoch häufig nicht berechtigt. Die gängige medizinische Praxis zeigt, dass KI im Großteil der Medizin schon längst angekommen ist. Sei es in der Radiologie zur Auswertung von MRT- oder CT-Daten oder in der Belastungssteuerung der Rehabilitation. In den meisten Fällen wird KI genutzt, um Menschen in Gesundheitsberufen zu unterstützen, Arbeitszeit einzusparen oder auch Menschen einen einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewährleisten. Dies bedeutet bessere Diagnosen und Behandlungen, mehr direkte Zeit am Patienten und dadurch eine bessere Versorgung für die ganze Gesellschaft. Es ist nicht nur ratsam, sondern essentiell, die KI in der Medizin als Möglichkeit zu verstehen, Dinge besser zu machen. Kritisch wird es dann, wenn Doktor Google oder Doktor ChatGPT blind vertraut wird. Nur das Zusammenspiel der KI mit den ausführenden Personen bringt eine erhebliche Verbesserung für die Menschen mit sich.
69
eco. mmentar

Axel Bauer ist seit Juli 2019 Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin III. Sein Team testet aktuell unter anderem eine App, um Vorhofflimmern direkt und einfach am eigenen Handy zu erkennen.
Euro geförderte Forschungsvorhaben zielt auf die frühe und bevölkerungsweite Diagnose und Therapie von Vorhofflimmern zur Senkung der Schlaganfallrate. Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung weltweit und erhöht das Sterblichkeitsrisiko deutlich. Weil diese Rhythmusstörung aber oft unerkannt bleibt und Früherkennung hier lebensrettend sein kann, wird im Rahmen des über acht Jahre laufenden Projekts eine auf digitalen Technologien und intelligenten Geräten – wie Smartphones – basierende Vorhofflimmer-Screeningund -Behandlungsstrategie entwickelt und überprüft. Diese soll österreichweit zum Einsatz kommen und letztlich in das Gesundheitssystem integriert werden. Eine maßgeschneiderte und einfach zu bedienende App wird es möglich machen, Vorhofflimmern direkt und einfach am eigenen Handy zu erkennen. „Vision des Projektes ist es, dass gerade ältere Menschen mit höherem Risiko für unerkanntes Vorhofflimmern die Vorsorge selbst in die Hand nehmen“, hielt Axel Bauer, seit Juli 2019 Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin III, dazu fest. Sein Team testet den Nutzen der App wie auch der vorbeugenden Behandlung – etwa eine blutverdünnende Therapie – in einer groß angelegten Studie mit rund 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern österreichweit. Das klinische Großprojekt ist in dieser Form einzigartig, auch, weil es die Gewinnung großer klinischer Datenmengen verspricht, die wiederum in Forschung und Therapieoptimierung investiert werden können. „Genau hier liegt die Chance, aber auch Verantwortung der universitären Medizin: Unser Auftrag ist es, in dem noch relativ neuen Bereich der digitalen Medizin qualitativ hochwertige Studien durchzuführen, um neue Konzepte für die Diagnose, Therapie und Prä-
vention von Herzerkrankungen entwickeln zu können“, ist Bauer überzeugt.
So gut wie alles Neue in der Medizin scheint mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz verknüpft zu sein. Auch in der Forschung der seit September 2022 zur Professorin für Sportmedizin an der MedUni und der Universität Innsbruck gemeinsam berufenen Anne Hecksteden spielen diese Verknüpfungen eine große Rolle. Die ehemalige Spitzensportlerin und Spitzenmedizinerin hat beispielsweise einen Algorithmus entwickelt, mit der Spitzensportler*innen und deren Trainer*innen den Regenerationsbedarf der Athlet*innen einschätzen können, der ein Risikofaktor für Verletzungen ist. Hecksteden weiß nicht nur um die Chancen, sondern auch um die Gefahren, die in der „blinden“ oder allzu euphorischen Nutzung der KI in der Medizin stecken. In ihrem Kommentar „Stabile Welt, klare Regeln“ beschreibt sie die Schwierigkeiten, Ansätze, sie zu umgehen, und sie zeigt die Grenzen auf.
Grenzen. Sie zu überschreiten mag die Menschen immer schon reizen, doch sie zu er- oder vielmehr anzuerkennen ist entscheidend – vor allem in der scheinbaren Grenzenlosigkeit der Künstlichen Intelligenzen.

DIGITALE ZUKUNFT
Im letzten Jahr führte das Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck das System KIS – Krankenhaus Informationssystem – ein und wurde damit zum digitalen Krankenhaus. Insgesamt wurden in das Projekt 1,5 Millionen Euro investiert. Von der Planung einer Aufnahme bis zur Entlassung der Patient*innen halten Mitarbeiter*innen und Ärzt*innen dabei die digitale Patientenakte stets auf dem neuesten Stand, Befunde und Daten sind damit jederzeit digital abrufbar. Das digitale System ist für die Ärzt*innen immer und überall mobil verfügbar, rund 400 User an der Privatklinik arbeiten mit KIS. „In Westösterreich zählen wir in vielen Teilbereichen der Digitalisierung zu den absoluten Vorreitern. Mit dem hohen Digitalisierungsgrad schaffen wir jetzt die Grundlage für die Einführung von KI-Tools“, erklärt Mag. Andreas Schnöller, Leiter Finanzcontrolling und IT an der Kettenbrücke. An der Privatklinik ist man überzeugt, dass angesichts des demografischen Wandels und des damit verbundenen Personalmangels in den nächsten Jahrzehnten der Einsatz von KI im Krankenhaus ein wichtiger Faktor wird.
eco. zukunft 70

Anne Hecksteden, ehemalige Spitzensportlerin und Spitzenmedizinerin, ist im September 2022 gemeinsam zur Professorin an die MedUni und Universität Innsbruck berufen worden.
STABILE WELT, KLARE REGELN
Etwa alle 30 Sekunden wird ein wissenschaftlicher Beitrag in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Selbst in einzelnen Fachgebieten sind es noch einige Hundert Artikel pro Tag. Kein Arzt kann hier immer auf dem neuesten Stand sein.
Klinische Erfahrung und die verfügbare Zeit pro Patient sind ebenfalls begrenzt. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) mit ihrer praktisch unbeschränkten Rechen- und Speicherkapazität könnte dazu beitragen, diese menschlichen Grenzen zu überwinden und die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern.
VON ANNE HECKSTEDEN
Die Nutzung von KI ruft bei vielen Menschen auch Ängste hervor.
Ein Teil dieser Sorgen könnte darauf zurückzuführen sein, dass ein menschliches Gegenüber fehlt, das nicht nur die Krankheit, sondern auch die Persönlichkeit und das Umfeld des Patienten wahrnimmt und berücksichtigt. Zudem sind aktuelle KI-Systeme häufig so komplex, dass ihre innere Logik selbst von Fachleuten nicht nachvollzogen werden kann. Eine solche „Black Box“ gibt also eine Beurteilung oder Empfehlung ab, aber diese bleibt ohne nachvollziehbare Begründung. Gerade bei weitreichenden Therapieentscheidungen trägt das verständlicherweise zur Verunsicherung des Patienten bei.
Wäre die Genauigkeit der KI dem menschlichen Experten zuverlässig überlegen, könnte man mit einer solchen „Black Box“ gut leben. Welcher Arzt könnte schon jede Laboruntersuchung oder Medikamentenwirkung bis ins molekulare Detail erläutern? Allerdings ist genau das bei der Anwendung im klinischen Alltag häufig nicht der Fall. KI braucht eine stabile Welt mit klaren Regeln, die in riesigen Mengen von Trainingsdaten gefunden werden können und dann auf neue Fälle übertragbar sind. Aber diese Bedingungen sind in der Medizin oft nicht erfüllt. Patientenpopulationen unterscheiden sich zwischen Kliniken, Ländern und Zeiträumen. Gleichzeitig ist die Menge an verfügbaren Daten
in der Regel nicht vergleichbar mit Feldern, auf denen die KI besonders erfolgreich ist, wie etwa dem Online-Marketing. Ein berühmtes Beispiel für die sich daraus ergebenden Probleme ist Watson for Oncology: ein Kooperationsprojekt von IBM und dem MD Anderson Cancer Center in den USA, das inzwischen eingestellt wurde, weil es Probleme gab, die Vielfalt und Komplexität klinischer Daten effektiv zu verarbeiten und konsistent sinnvolle Behandlungsempfehlungen zu generieren. Aber auch andere bereits zugelassene KI-Modelle scheiterten daran, die erwartete Leistungsfähigkeit im klinischen Alltag zu realisieren.
Dennoch sollte das Potential der KI für die Patientenversorgung unbedingt nutzbar gemacht werden. Zwei Ansätze, um die Schwierigkeiten mit komplexen „Black Box“-Algorithmen zu umgehen, sind das interpretierbare maschinelle Lernen, das besonders von Cynthia Rudin im medizinischen Bereich vorangetrieben wird, und die gezielte Kombination aus menschlichem Erfahrungswissen und der Rechen- sowie Speicherkapazität der KI, bekannt als hybride Intelligenz. Das Ergebnis sind nachvollziehbare Empfehlungen, die von Fachleuten noch an zusätzliche Faktoren, die in der KI nicht abgebildet sind, angepasst werden können. Diese Vorgehensweise hat sich nicht nur in der medizinischen Praxis, beispielsweise in der Intensivmedizin, bewährt, sondern kommt auch den Bedürfnissen und Ängsten der Patienten entgegen.
71 eco. mmentar
TIROLER INDUSTRIE
STARTET DIE
„MISSION: TOP20BIS2030“
Die Industriellenvereinigung (IV) Tirol hat sich unter Führung von IV-TirolPräsident Max Kloger das Ziel gesetzt, Tirol bis zum Jahr 2030 zu einer der 20 Top-Industrieregionen Europas zu machen. Ein Schlüssel, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Förderung innovativer, digitaler Technologien, die das Potenzial haben, die Fertigung zu revolutionieren.
Mit dem „Strategischen Aktionsprogramm der Tiroler Industrie 2030“ haben der neu gewählte IV-Tirol-Präsident Max Kloger und sein Führungsteam eine klare, anwendbare und vor allem messbare Strategie formuliert, wie sich die Tiroler Industrie in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. „Wir werden gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Partnern und der Tiroler Politik alles daran setzen, Tirol, das aktuell den 30. Platz im Ranking der europäischen Industrieregionen belegt, innerhalb der nächsten sechs Jahre zu einem der 20 innovativsten und wettbewerbsfähigsten Industriestandorte Europas zu machen“, bringt Kloger die Ziele des Strategiepapiers auf den Punkt.
Um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Tiroler Industrie weiter zu steigern, wurden in den fünf Aktionsfeldern „Moderner Staat“, „Infrastruktur“, „Talente & Arbeitskräfte“, „Energie & Umwelt“ sowie „Forschung, Technologie & Innovation“ 24 Leitprojekte definiert, die in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden sollen.
FORSCHUNG, TECHNOLOGIE UND INNOVATION ALS TREIBER Ein wesentlicher Pfeiler des Zukunftsprogramms ist das Aktionsfeld „Forschung, Technologie und Innovation“. Besonders die digitale Transformation der Industrie und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stehen dabei im Fokus. „Digitalisierung und KI bieten enorme Chancen für unsere Industriebetriebe. Sie sind die Schlüssel, um Effizienz zu steigern, nachhaltiger zu produzieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen“, betont der frischgebackene IV-Tirol-Präsident. „Während Unternehmen

Gemeinsam mit seinem Präsidiumsteam hat sich Max Kloger das Ziel gesetzt, Tirol bis 2030 zu einer der Top-20-Industrieregionen Europas zu machen. (Vizepräsident Simon Meinschad ist nicht am Bild zu sehen)
auf viele Parameter der Wettbewerbsfähigkeit, wie die Entwicklung von Löhnen und Gehältern, Kosten für Energie oder die viel zu hohe Steuerlast in Österreich, nur bedingt Einfluss nehmen können, haben sie mit Investitionen in die Erforschung von neuen Technologien und Fertigungsmethoden einen Hebel zur Hand, der sich direkt und äußerst positiv auf ihre Konkurrenzund Zukunftsfähigkeit auswirkt“, so Kloger weiter. Durch die gezielte Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie die engere Zusammenarbeit der Unternehmen mit Hochschulen und For-
schungseinrichtungen will die IV Tirol die Innovationskraft der Tiroler Industrie weiter stärken, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Industrie verbessern und vor allem auch kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, neue Erkenntnisse und Produktionsmethoden so schnell wie möglich im eigenen Betrieb einführen zu können.
DIGITALE TRANSFORMATION VORANTREIBEN
Denn eines ist klar: Die digitale Transformation ist der Motor, der die Tiroler Industrie in den nächsten Jahren stärker als alle an-
72
IV TIROL
„Unternehmen, die auf moderne, digitale Technologien setzen, sind besser gerüstet, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.“
MAX KLOGER
deren Faktoren voranbringen wird. „Unternehmen, die auf moderne, digitale Technologien setzen, sind besser gerüstet, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Um die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie zu erhöhen, müssen wir jetzt beim Einsatz von digitalen Technologien wie Robotik, Automatisierung, Künstlicher Intelligenz, Smart Manufacturing und Quantencomputing den Forschungs- und Umsetzungsturbo zünden, wenn wir weiter zur Weltspitze aufschließen wollen“, gibt Kloger klar die Richtung vor. Mit dem Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung, das 2018 auf Initiative der IV Tirol in Kooperation mit dem Management Center Innsbruck gegründet wurde, gibt es schon heute eine kompetente Service- und Anlaufstelle, in der sich alle Tiroler Industriebetriebe, unabhängig davon, ob sie Mitglied der IV Tirol sind, über die Möglichkeiten der Einführung neuer digitaler Technologien in ihrem Unternehmen beraten lassen können. Dieses Service soll weiter ausgebaut und neue Kooperationschancen mit weiteren Tiroler Forschungseinrichtungen, die direkt den heimischen Industriebetrieben zugutekommen, geschlossen werden.
KI: DIE ZUKUNFT
DER INDUSTRIE
Dank des immer stärkeren Einsatzes von KI in der Industrie steht der Branche in den nächsten Jahren ein Produktivitäts- und Innovationsschub bevor: „KI wird die Art und Weise, wie wir produzieren und arbeiten, grundlegend verändern. In Verbindung mit Automatisierung und Robotik bietet KI enormes Potenzial für die Industrie. Forschungsvorhaben und Produktinnovationen können zukünftig schneller und günstiger umgesetzt werden. Der Einsatz von KI wird die Fertigung effizienter und ressourcensparender machen. Wenn wir heute die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, kann es uns in den nächsten Jahren gelingen, dass in Europa nachhaltiger und effizienter produziert werden kann als irgendwo anders auf der Welt. Eine enorme Chance, vor allem für eine innovationsstarke Industrieregion wie Tirol“, ist sich Kloger sicher. Schon im letzten Jahr hat die IV Tirol eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema „Anwendungsfelder von KI in der Industrie“ gemeinsam mit führenden Experten organisiert. Diese Bemühungen werden in Form eines wiederkehrenden KI-Forums verstärkt werden, dank dessen Tiroler Industrieunternehmen ständig über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz informiert werden. „Mit dem Strategischen Aktionsprogramm der Tiroler Industrie 2030 haben wir einen klaren Plan formuliert, wie es uns gelingen kann, unser Bundesland zu einer der erfolgreichsten Industrieregionen Europas zu machen. Nun geht es darum, so schnell wie möglich in die Umsetzung zu kommen. Ich lade deshalb unsere Mitglieder, Partner und vor allem auch die Politik ein, gemeinsam mit uns die Transformation der Tiroler Industrie voranzutreiben, die sie stärker, wettbewerbsfähiger und innovativer machen wird!“, betont Kloger zum Abschluss. PR
MISSION: TOP20BIS2030
24 Leitprojekte in fünf Aktionsfeldern sind das Herzstück des Strategischen Aktionsprogramms Tiroler Industrie 2030, mit dem es gelingen wird, Tirol bis 2030 zu einer 20-TopIndustrieregion Europas zu machen:
MODERNER STAAT
Forcierung des E-Governments im Land Tirol Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung
INFRASTRUKTUR
Hochleistungsfähiges Internet Verbesserung des ÖPNV
Ausbau der Bahninfrastruktur für den Güterverkehr Grenzüberschreitende Kooperation mit Südtirol und Bayern für Transit und Verkehr Flugtechnische Erreichbarkeit Innsbrucks und Osttirols Vorsorgeflächen für Betriebserweiterungen
TALENTE & ARBEITSKRÄFTE ( NEW WORK )
Umsetzung der MINT-Zukunftsstrategie
Image der Lehre
Attraktivität von HTLs
Optimierung der Kinderbetreuung
Interesse für Industrie in der Bevölkerung, insbesonders bei Jugendlichen, wecken Willkommenskultur und -politik für internationale Fachkräfte
ENERGIE & UMWELT
Beschleunigung des Ausbaus der Wasserkraft Energiepreise und Versorgungssicherheit Green Jobs in der Industrie sichtbar machen Wasserstoff als Zukunftspfad Industrie als Ökologisierungs- und Klimavorreiter
Gezielter Ausbau der Forschungs- und Innovationsstrukturen für Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Klima
FORSCHUNG, TECHNOLOGIE & INNOVATION
Strategische Forschungsagenda – Hochschulstrategie Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie
Digitale Transformation der Industrie
Haus der Zukunft Tirols

73 IV TIROL
SCHÖNE NEUE WELT?
Rechtliche Aspekte des 3D-Drucks mit Künstlicher Intelligenz (KI): Chancen und Herausforderungen für Unternehmen.
TEXT: STEFAN WARBEK
Der 3D-Druck, auch bekannt als additive Fertigung, hat sich in den letzten Jahren rasant von einer visionären Technologie zu einer greifbaren Realität der Herstellung von Produkten entwickelt und revolutioniert mittlerweile viele Branchen. Der Prozess umfasst die Gestaltung eines 3D-Objekts mit Computer-Software, das dann an einen 3D-Drucker übermittelt wird, der das gewünschte Objekt durch das Hinzufügen aufeinanderfolgender Schichten von Druckmaterial herstellt. 3D-Druck wird häufig zur Herstellung von Ersatzteilen und kundenspezifischen Komponenten für die Verwendung in anderen Produkten eingesetzt und sogar schon beim Bau von Gebäuden und zur Herstellung von Medizinprodukten
und Arzneimitteln verwendet. Die Integration von KI in den 3D-Druckprozess bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Optimierung des Druckverfahrens, der Materialauswahl und der Qualitätskontrolle. KI kann beispielsweise durch maschinelles Lernen und neuronale Netze die besten Druckeinstellungen vorschlagen, um den Druck effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Zudem ermöglicht KI die Entwicklung neuer Materialien, die speziell auf die Anforderungen des 3D-Drucks zugeschnitten sind. KI-gesteuerte Softwarelösungen können den gesamten Workflow automatisieren, von der Erstellung der CAD-Datei über die Druckvorbereitung bis hin zur Nachbearbeitung. Diese Kombination bietet enorme Potenziale, aber auch Herausforderungen. Der „AI
Act“, der am 21. Mai 2024 endgültig vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde (das Gesetz greift allerdings erst ab Frühjahr 2026), klassifiziert KI-Systeme nach ihrem Risikopotenzial und legt spezifische Anforderungen für deren Einsatz fest. Hochrisiko-KI-Systeme, zu denen auch KI-Anwendungen im 3D-Druck gehören können, unterliegen strengen Vorgaben hinsichtlich Risikomanagement, Datenqualität, Protokollierung und menschlicher Aufsicht. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die KI im 3D-Druck einsetzen, sicherstellen müssen, dass ihre Systeme den neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der produzierten Teile zu gewährleisten. Für manche Produktgruppen gelten zudem spezielle (EU-)
74
WARBEK RECHTSANWÄLTE
Vorschriften mit eigenen Zulassungsverfahren durch die zuständigen Behörden.
NEUE MÖGLICHKEITEN
3D-Druck und KI eröffnen völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf Produktdesign, Individualisierung und Kosteneffizienz. Von der Medizintechnik über die Automobilindustrie bis hin zur Lebensmittelherstellung – schon nahezu überall kommt eine additive Fertigung zum Einsatz. Doch neben den zahlreichen Vorteilen bringt der 3D-Druck auch rechtliche Herausforderungen mit sich. So innovativ und vielversprechend die Technologie auch ist, wirft sie doch zahlreiche rechtliche Fragen auf. Unternehmen, die 3D-Druck nutzen, müssen sich mit Themen wie Patentrecht, Urheberrecht und Designschutz, aber auch Produkthaftung auseinandersetzen, um nicht in juristische Fallstricke zu tappen.
Ein zentraler Aspekt ist der Schutz des geistigen Eigentums. Viele der Technologien und Verfahren rund um den 3D-Druck sind patentrechtlich geschützt. Das erste Patent im Bereich des 3D-Drucks wurde bereits 1984 an Chuck Hull für seine Stereolithografie-Apparatur erteilt. Seitdem ist die Zahl der Patentanmeldungen rasant gestiegen.
SOLIDE PATENTSTRATEGIE
Für Unternehmen bedeutet dies einerseits, dass sie ihre eigenen Innovationen im 3D-Druck-Bereich durch Patente schützen können und sollten. Allerdings ist die Patentierbarkeit von 3D-Druckverfahren und -produkten nicht immer einfach zu beurteilen. Unternehmen, die in den 3D-Druck investieren, sollten daher frühzeitig eine solide Patentstrategie entwickeln. Andererseits müssen sie darauf achten, keine Patente Dritter zu verletzen. Unternehmen sollten daher sorgfältig prüfen, ob für die von ihnen verwendeten 3D-Druck-Technologien und -Materialien Patente existieren und ob sie gegebenenfalls Lizenzen benötigen. Das ist nicht immer einfach, da die Patentlandschaft unübersichtlich ist und sich ständig weiterentwickelt.
Auch das Urheber- und das Designrecht spielen beim 3D-Druck eine wichtige Rolle: Grundsätzlich genießen CAD-Dateien für den 3D-Druck als digitale Darstellung eines dreidimensionalen Objekts urheberrechtlichen Schutz, sofern sie eine eigene geistige Schöpfung darstellen. Das ist etwa der Fall, wenn ein Designer ein individuelles Objekt am Computer entwirft. Wer eine solche Datei ohne Erlaubnis vervielfältigt und aus-

Der 3D-Druck und die Künstliche Intelligenz sind zwei der bedeutendsten technologischen Entwicklungen unserer Zeit,
die zunehmend miteinander verschmelzen.
druckt, verletzt das Urheberrecht. Allerdings greift der Urheberrechtsschutz nicht, wenn jemand ein Objekt mit einem 3D-Scanner digitalisiert und dann nachdruckt. Denn beim Scannen entsteht keine persönliche geistige Schöpfung. Hier kann aber das Designrecht (Geschmacksmusterrecht) eingreifen. Es schützt die äußere Erscheinungsform eines Erzeugnisses, sofern sie neu ist und Eigenart hat. Wer ein geschütztes Design ohne Zustimmung des Rechteinhabers mit dem 3D-Drucker reproduziert, läuft Gefahr, eine Designrechtsverletzung zu begehen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Produkthaftung. Hersteller haften grundsätzlich verschuldensunabhängig, wenn ein Produkt fehlerhaft ist und dadurch Schäden entstehen. Bei konventionell hergestellten Produkten ist meist klar, wer als Hersteller gilt. Da jedoch beim 3D-Druck die Grenzen zwischen Hersteller, Vertreiber und Importeur fehlerhafter 3D-Drucker und Druckmaterialien sowie 3D-gedruckter Produkte oft verschwimmen, stellt sich im Schadensfall die Frage, wer für Produktmängel oder -schäden haftet. In der Praxis gibt es daher oft Grauzonen, insbesondere wenn ein fehlerhaftes Produkt ein 3D-gedrucktes Ersatzteil enthält. Selbst der, der eine 3D-Vorlage
erstellt, könnte als Hersteller des späteren Endprodukts anzusehen sein: Immerhin enthält die Vorlage die Steuerungsbefehle für den 3D-Drucker. Grundsätzlich unterliegen 3D-gedruckte Produkte denselben Produkthaftungsregeln wie herkömmlich gefertigte Waren. Der Hersteller haftet für Konstruktions-, Fabrikations- und Instruktionsfehler. Unternehmen müssen daher sorgfältig prüfen, in welcher Rolle sie im Produktionsprozess auftreten, und entsprechende technische und rechtliche Vorkehrungen treffen. Insgesamt bietet der 3D-Druck Unternehmen große Chancen, erfordert jedoch auch eine sorgfältige rechtliche Abwägung. Eine solide Patentstrategie und eine sorgfältige Vertragserstellung unter Beachtung der Produkthaftung sowie des Design- und Urheberrechts sind entscheidend, um die Vorteile dieser innovativen Fertigungsmethode voll auszuschöpfen und rechtliche Risiken zu minimieren.
WARBEK RECHTSANWÄLTE ist eine auf die Innovations- und Kreativwirtschaft spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. www.warbek.at
75
WARBEK RECHTSANWÄLTE
Dr. Stefan Warbek

Am Innsbrucker Bozner Platz entsteht aktuell ein neues Grundwassernetz, das mit der regionalen Ressource angeschlossene Gebäude heizen und kühlen wird.
GELUNGENE VERNETZUNG
Mit einem innovativen Grundwassernetz im Herzen von Innsbruck sorgt die IKB für eine alternative Wärme- und Kälteversorgung mehrerer namhafter Unternehmen.
TEXT: DORIS HELWEG
Es ist ein wegweisendes Projekt, das die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) am und rund um den Bozner Platz derzeit umsetzt. Seit September 2023 ist hier in mehreren Bauphasen ein neues Grundwassernetz im Entstehen, das mit der regionalen Ressource Grundwasser angeschlossene Gebäude heizen beziehungsweise kühlen wird. „Mittlerweile sind wir in der vierten Bauphase und freuen uns
sehr, dass bislang alles so reibungslos abgelaufen ist“, sagt IKB-Vorstandsvorsitzender DI Helmuth Müller über den Baufortschritt und ergänzt: „Ein vorbildliches Beispiel für Kreislaufwirtschaft, die kaum besser umgesetzt werden könnte. Besonders freut es uns, dass wir mit DAS RAIQA und der TIROLER VERSICHERUNG Projektpartner gefunden haben, die diese innovative Energiequelle zum Klimatisieren ihrer neuen Firmenge-
bäude nutzen werden.“ Im Gespräch bekräftigt Müller einmal mehr das Bekenntnis zum Klimaschutz: „Der Brennstoff, den wir liefern, ist Grundwasser.“
BRENNSTOFF GRUNDWASSER „Das Herzstück der Grundwassernetze bildet das Grundwasserentnahmebauwerk direkt am Bozner Platz. Aus einem zirka 30 Meter tiefen Brunnen wird das Grundwasser
IKB

IKB-Vorstandsvorsitzender DI Helmuth Müller mit TIROLER-Vorstandsdirektorin Mag. Isolde Stieg und Dr. Christof Splechtna, Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (RLB)
gefördert und über ein neues Leitungsnetz in die angeschlossenen Gebäude verteilt, in denen das Wasser in Wärmepumpen oder Kältemaschinen thermisch genutzt wird. Besonders hervorzuheben ist, dass über entsprechende hydraulische Schaltungen bei der Brunnenanlage und bei den Hausanschlussanlagen die Möglichkeit geschaffen wird, dieses Netz teilweise im geschlossenen Kreis zu betreiben, ohne die Grundwasserressourcen zu belasten. So wird die Möglichkeit geschaffen, für unterschiedliche Gebäude eine grundwasserschonende Wärme- und Kälteversorgung bereitzustellen.
Rund fünf Millionen Euro hat die IKB in dieses Grundwassernetz investiert, das natürlich auch rechtlichen Auflagen der Wasserrechtsbehörde unterliegt. „So darf das mit etwa zehn bis zwölf Grad entnommene Wasser nicht mehr als fünf Grad wärmer
oder kälter rückgeführt werden“, weiß Ing. Bernhard Larcher, IKB-Bereichsleiter Energieservices, und erwähnt weiters, dass die Grundwassernetze erweiterbar sind und der Anschluss weiterer Liegenschaften wie die Oesterreichische Nationalbank, der Hauptbahnhof Innsbruck sowie das Dampfbad Salurner Straße geplant ist.
DAS RAIQA
„Mit der IKB haben wir einen professionellen Partner an unserer Seite, der so wie wir aktiv die Zukunft gestaltet“, freut sich Dr. Christof Splechtna, Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (RLB), über die Kooperation mit der IKB und meint: „DAS RAIQA soll nicht nur eine Bank, sondern ein neuer Treffpunkt mit Hotel, Shops und Gastronomie in Innsbruck sein und war von Anfang an vollkommen auf Nachhaltigkeit


Ing. Bernhard Larcher, IKB-Bereichsleiter Energieservices
ausgerichtet. Durch den Einsatz von Geothermie sind wir bei der Wärme- und Kälteregulierung nahezu 100 Prozent energieautark. Und das mit umweltschonender und zukunftsweisender Technologie. Der bestehende Brunnen bei unserem Rechenzentrum und die erfolgreiche wasserrechtliche Prüfung waren wichtige Mosaiksteine bei der Umsetzung des Konzepts.“
TIROLER VERSICHERUNG
Auch TIROLER-Vorstandsdirektorin Mag. Isolde Stieg teilt diese Ansicht und ergänzt: „Unser Anspruch war von Beginn an, dass die neue TIROLER-Zentrale ein nachhaltiges Gebäude sein soll. Grundvoraussetzung dafür ist der Einsatz von erneuerbaren Energien. Mit dem Zugang zu den IKB-Grundwassernetzen und Wärmepumpen im Haus können wir zur Gänze auf fossile Energieträger verzichten – und das in zentraler Innenstadtlage. Damit erlangen wir den klimaaktiv-Gold-Standard, den bisher erst drei Bürogebäude in Tirol erhalten haben. Mit nur einer Sportbeckenfüllung pro Woche können wir künftig unser Leitprojekt in Sachen nachhaltiger städtischer Bauweise mit rund 350 Arbeitsplätzen kühlen und heizen.“ So geht nun genau zum richtigen Zeitpunkt der Fertigstellung der derzeit größten Bauwerke der Innsbrucker Innenstadt ein innovatives Leitungsnetz in Betrieb, welches mit einer Trassenlänge von einem Kilometer insgesamt 4.500 Megawattstunden Energie pro Jahr liefern wird, und das völlig fossilfrei mit der Ressource Grundwasser. PR
77
IKB
finanzieren & versichern

Auf Wachstumskurs
Monkee, Pionier der „Save-now-buy-later“-Bewegung, ist als Gegenentwurf zur „Buy-now-paylater“-Philosophie zu verstehen und zeigt einen Weg auf, wie (junge) Menschen bewusst für ihre Konsumziele sparen können. Monkee ermöglicht mit seiner App die einfache Anlage von spezifischen Sparplänen, hilft seinen Nutzer*innen damit, durch Gamification die finanziellen Mittel für diese konkreten Sparziele zu schaffen und fördert somit ein achtsames Spar- und Konsumverhalten. Mittlerweile wurde die App bereits 300.000 Mal heruntergeladen. Ihr zukunftsweisender Ansatz wurde bereits mit dem Austrian-Retail-Innovation-Award und dem Payment-Pioneer-Award ausgezeichnet. Sein aktuelles Wachstum setzt Monkee mit einem siebenstelligen Investment fort und ist unter anderem eine Partnerschaft mit der renommierten Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB) eingegangen. Dies ermöglicht Monkee-Nutzer*innen, ihre Spareinlagen auf verzinsten Konten der Bank aufzubauen, was einen fairen und wettbewerbsfähigen Zinssatz garantiert und zu einer weiteren Steigerung der Spareinlagen führt. monkee.rocks
Im Bild das Monkee-Gründungsteam Christian Schneider, Martin Granig und Jean-Yves Bitterlich
78
GELD

SPITZENPLATZIERUNG
Die Sparkasse Imst belegte beim Sparkassen-Award 2023 den ersten Platz aller österreichischen Sparkassen. Die Trophäen werden jährlich unter allen 47 selbstständigen Sparkassen Österreichs vergeben. Nur jene Institute erhalten die Auszeichnung, die mit hoher Kund*innenzufriedenheit, vorbildlicher Beratungs- und Servicequalität sowie einer positiven Entwicklung im Privat- und Kommerzkund*innengeschäft punkten. Ebenso entscheidend sind erstklassige betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Die Kriterien sind klar formuliert, die Anforderungen dementsprechend hoch. Die Sparkasse Imst holte bei der jüngsten Verleihung den Gesamtsieg, damit ging der erste Platz im Österreich-Ranking nach 2016 und 2017 zum dritten Mal ins Tiroler Oberland. Insgesamt betreut die Sparkasse Imst mit rund 150 Mitarbeiter*innen über 39.000 Kund*innen.

FINANZBILDUNGSOFFENSIVE
Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) modernisiert ihren Auftritt im Finanzbildungsbereich. Aus „Eurologisch“ wurde kürzlich „OeNB-Finanzbildung“. Mit neuen E-Learning-Angeboten, die ohne separaten Download oder Anmeldung genutzt werden können, werden aktuelle wirtschaftliche Themen wie Inflation, Geldpolitik und Geldanlage abgedeckt. Besucher*innen erhalten detaillierte Informationen und werden ermutigt, sich aktiv mit Finanzbildungsthemen auseinanderzusetzen. Natürlich setzt die OeNB dazu auch weiterhin auf eine umfassende Unterstützung von Bildungseinrichtungen und engagiert sich intensiv in der Ausund Fortbildung von Lehrkräften. So stehen auf der Website nach wie vor kostenlose Tools, Workshops und Lehrmaterialien zur Verfügung. Unbedingt reinklicken unter finanzbildung.oenb.at

Christopher Knapp (re) und Mathias Erler, Geschäftsführer von Knapp Versicherungen in Schwaz, sind auf individuelle Versicherungslösungen für Unternehmen spezialisiert.
WACHSENDE BEDROHUNG
Cyberversicherungen sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil des geschäftlichen Risikomanagements geworden, verrät Versicherungsexperte Christopher Knapp.
Der Anstieg von Cyberangriffen auf Unternehmen nimmt stetig zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um ein größeres oder kleineres Unternehmen handelt. Neben ihren beträchtlichen Auswirkungen auf das daily business können Cybervorfälle Ausfälle und hohe Kosten verursachen – zum Beispiel für die Wiederherstellung von Daten oder Rechtsstreitigkeiten.
Cyberversicherungen ergänzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen und bieten eine Deckung für Schäden durch Hackerangriffe, Datenlecks und andere Sicherheitsvorfälle. Dabei ist es essentiell, dass der Versicherungsschutz spezifisch auf die Risiken des Unternehmens abgestimmt ist. Wichtige Deckungsbereiche sind dabei: Kosten für Krisenmanagement, Wiederherstellung von Daten und die Haftung gegenüber Dritten. Als regulatorische Anforderung gilt die Einhaltung von Datenschutzgesetzen durch entsprechenden Versicherungsschutz. Die Auswahl und die Anpassung der Policen erfordert auf Grund deren Komplexität jedenfalls spezifisches Fachwissen. PR
KNAPP VERSICHERUNGSMAKLER GMBH Wopfnerstraße 9, 6130 Schwaz knapp-versicherungen.at
eco. expertentipp
WISSENSCHAFTLICH VERANLAGT
Können Erkenntnisse aus der theoretischen Kapitalmarktforschung einen spürbaren Mehrwert für die praktische Vermögensverwaltung liefern?
TEXT & FOTOS: MARIAN KRÖLL

Universitätsprofessor Jochen Lawrenz versucht, statistische Muster im Markthandeln zu identifizieren, die bei der Bildung eines Veranlagungsportfolios vorteilhaft sein können.
80

Universitätsprofessor Matthias Bank will sich nicht auf die Vorhersagen von KI-Modellen verlassen, sondern setzt auf transparente und nachvollziehbare Veranlagungsstrategien.
81
it dem wissenschaftlichen Zugang, Märkte zu verstehen und dazu Modelle zu entwickeln, haben die Innsbrucker Universitätsprofessoren Matthias Bank und Jochen Lawrenz das Spin-off Innfoliolytix – ein Kompositum aus Innsbruck, Portfolio und Analytics – gegründet. Bislang exklusiv im Rahmen der Vermögensverwaltung der BTV Vier Länder Bank, seit Jahresanfang mit eigener Konzession als Wertpapierfirma ausgestattet, darf die junge Firma nun auch eigenständig am Markt auftreten. Die Strategien, die Innfoliolytix anbieten möchte, sollen eine höhere Rendite erzielen als ein vergleichbarer globaler Marktindex – ein durchaus nicht unambitioniertes Ziel. „Es ist tatsächlich schwer, den Markt nachhaltig zu schlagen, das belegen unzählige Studien. Dennoch, es gibt auch etliche Belege, dass mit den richtigen Methoden und Ansätzen ein gewisser Mehrwert erreicht werden kann“, sagt Matthias Bank. Er ist Professor für Banking & Finance am Institut für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck.
Es ist diese Expertise, mit der die Firma im Markt für Vermögensverwaltung erfolgreich sein möchte. Jochen Lawrenz hält die Professur für Risikomanagement am selben Institut und hat im Zuge seiner Forschung Beobachtungen gemacht, welche die Grundlage für eine erste Strategie von Innfoliolytix darstellen. „Es ging anfangs darum, zu verstehen, ob und wie zukünftige Renditen am Aktienmarkt prognostiziert werden können. Dazu haben wir ein neues ökonometrisches Verfahren gewählt und untersucht, ob dieses die Rendite-Prognosekraft spürbar verbessert“, erklärt Lawrenz.
Mit dem Bestreben, die praktische Probe aufs Exempel zu liefern, wurde bereits 2019 die Innfoliolytix GmbH gegründet. „Die Gründung der Firma war ein evolutionärer Prozess, am Anfang stand unsere Forschung und mit der BTV haben wir eine exzellente Partnerin gefunden, die unser Spin-off gemeinsam mit der Uni-Holding
INNFOLIOLYTIX
Das bereits 2019 gegründete universitäre Spin-off Innfoliolytix, an dem neben den Innsbrucker Finanzwissenschaftlern Matthias Bank und Jochen Lawrenz auch die Universität Innsbruck (25 Prozent) sowie die BTV VIER LÄNDER BANK (26 Prozent) beteiligt sind, verfügt seit dem 1. Jänner über eine Konzession als Wertpapierfirma. Wie es das Gesetz vorsieht, wird Innfoliolytix von zwei hauptberuflichen Geschäftsführern geleitet, nämlich Ralf Baumann und Volker van Rüth. Die Universitätsprofessoren Bank und Lawrenz fungieren als Prokuristen. https://innfoliolytix.at
mittragen wollte“, so Lawrenz. Dabei ist es kein Zufall, dass das Unternehmen bereits seit einigen Jahren besteht, bevor man den Schritt an eine breitere Öffentlichkeit gewagt hat, erklärt Matthias Bank: „In diesem Bereich kommt es zuerst darauf an, einen sogenannten Track-Record aufzubauen, also über einen gewissen Zeitraum zu demonstrieren, dass die Anlagestrategien wie erwartet funktionieren.“ Die auf die Forschung von Innfoliolytix zurückgehende Strategie hat diesen Track-Record nun über bald drei Jahre aufbauen können und dabei die Erwartungen erfüllt. Auch dies sei zwar keine Garantie für die Zukunft, allerdings erhöhe es das Vertrauen in den Anlageprozess und bilde die Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung entsprechender Produkte, die – nun mit der FMA-Lizenz ausgestattet – jetzt richtig losgehen soll, erläutern die Professoren.
Der avisierte Kund*innenkreis setzt sich aus institutionellen Investor*innen, Stiftungen, Unternehmen oder auch vermögenden Privatpersonen zusammen. „Um für uns direkt als Kunde in Frage zu kommen, müssen wir schon allein aus regulatorischen Gründen leider einen gewissen Grad an Professionalität voraussetzen, einfach weil sich unsere Ideen sonst nicht wie gedacht umsetzen lassen“, sagt Jochen Lawrenz. Privatkund*innen sollen trotzdem nicht außen vor gelassen werden. Diese könnten die Produkte in Zukunft zwar nicht direkt von Innfoliolytix, dafür aber über ihre Hausbank kaufen, genau wie das jetzt schon über die BTV möglich ist. „Uns ist es wichtig, einen hoffentlich positiven Beitrag zum Anlageerfolg möglichst vieler Menschen in Tirol und in ganz Österreich zu leisten. Der Transfer von der Forschung zur Praxis ist auch ein großes Anliegen der Universität und mit ein Grund, weshalb sie sich in diesem Bereich im Rahmen ihrer Beteiligungsstrategie an unserem gemeinsamen Spin-off engagiert“, so Matthias Bank.
RENDITE UND RISIKO
Die den Innfoliolytix-Modellen zugeschriebene Prognosekraft resultiert aus einer wissenschaftlich überprüfbaren Herangehensweise. „Wir haben einen quantitativen und regelbasierten Ansatz. Das bedeutet, dass
„Forschung ist unsere DNA.“ MATTHIAS BANK
eco. geld 82
wir aus der Forschung abgeleitet glauben, sagen zu können, warum die Finanzmärkte sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten“, erklärt Matthias Bank. Das läuft – vereinfacht gesagt – anders als bei herkömmlichen Produkten, bei denen ein Portfoliomanager allerlei Daten und Meinungen sammelt und die Märkte beobachtet, bewertet und daraus eine Empfehlung ableitet. „Die Entscheidungen des Managers können durchaus sinnvoll sein, aber der tatsächliche Anlageerfolg ist aus unserer Sicht in der Regel nur schwer objektiv zu beurteilen. Unser Ansatz hingegen ist: Wir verwenden lange historische Datenreihen und fortgeschrittene statistische Verfahren, um zu belegen, warum eine Strategie funktionieren könnte.“
Die Ergebnisse, die sich auf Grundlage der Kapitalmarktanalysen von Innfoliolytix erzielen lassen, sind jedenfalls durchaus beachtlich. „Bei den existierenden Strategien reden wir zum Beispiel davon, dass wir uns von diesem Ansatz in etwa ein Prozent mehr erwarten als bei einem gängigen globalen Marktportfolios“, präzisiert Matthias Bank. Nachsatz: „Durchschnittlich ein Prozent mehr pro Jahr, das hört sich erst einmal nach nicht viel an, aber das ist schon ziemlich gut und wir müssen uns so gesehen sicher nicht verstecken.“ Als Vergleich dienen gängige Weltportfolio-Indizes. „Unsere Strategie ist darauf ausgelegt, das gleiche Risiko aufzuweisen, aber dennoch einen Mehrwert zu schaffen“, sagt Lawrenz.
SCHLANK AUFGESTELLT
Als primär ideengetriebenes Unternehmen ist Innfoliolytix bewusst schlank aufgestellt, auch um das eigene Produkt zum konkurrenzfähigen Preis anbieten zu können. „Wir wollen uns aus der Spin-off-Phase heraus zunächst am Markt etablieren und konsequent an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten,“ gibt Jochen Lawrenz die Richtung vor. „Mittel- bis langfristig geht unsere Strategie dahin, europäische Investoren davon zu überzeugen, über uns Kapital zu veranlagen und unsere Produkte ihrem Portfolio beizumischen“, sagt Matthias Bank.
Bisher wurde das Know-how von Bank und Lawrenz vor allem in der Vermögensverwaltung der BTV eingesetzt. Das wird auch zukünftig so bleiben, obwohl Innfoliolytix grundsätzlich unabhängig am Markt auftreten soll: „Es verbindet uns schon lange ein freundschaftlicher Kontakt mit der BTV. Ohne die BTV als unsere erste und immer
MATTHIAS BANK
war von 2013 bis 2021 Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Innsbruck. Er hält seit 2001 die Professur für Banking & Finance am Institut für Banken und Finanzen. Seine Forschungsfelder umfassen Finanzintermediationstheorie, Market Microstructure und Liquidität von Finanzmärkten sowie Kapitalmarkttheorie und Asset Pricing. Forschungsaufenthalte führten ihn in die USA, nach Australien und Südafrika.
noch wichtigste Kundin wäre die Gründung der Firma auch gar nicht möglich gewesen. Trotzdem war von Anfang an das Ziel, eigenständig zu sein“, erzählt Lawrenz. Dazu beabsichtigt das Unternehmen, nun mit der FMA-Lizenz in der Tasche, verstärkt selbst als Anlageberater und Portfoliomanager am Markt aufzutreten. Für die Geschäftsführung hat man dafür mit Ralf Baumann und Volker van Rüth zwei hochkarätige Praktiker gewinnen können, die viel Vertriebserfahrung mitbringen.
AKTUELLE PRODUKTE
Die Weiterentwicklung des Innfoliolytix-Produktportfolios wird dagegen weiterhin eng an die universitäre Forschung der Professoren geknüpft sein. „Forschung ist unsere DNA“, hält Matthias Bank fest. Der Kategorie FinTech fühlen sich die Innfoliolytix-Gründer nicht unbedingt zugehörig: „Wir versuchen natürlich, innovativ zu sein, und haben in den Bereichen Datenanalyse, Datenmanagement und Anlagemodellierung durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit Playern aus dem FinTech-Bereich. Beispielsweise brauchen unsere selbstentwickelten Methoden zur täglichen, computerbasierten Analyse von tausenden individuellen Wertpapieren einen externen Vergleich nicht zu scheuen. Allerdings denkt man bei einem klassischen FinTech wohl zuerst an Anbieter für Zahlungsdienstleistungen, neuartige Finanzplattformen und Ähnliches. Derartige Dienstleistungen stehen bei uns nicht im Vordergrund, Innfoliolytix ist ein Vermögensverwalter, der Anlageberatung nach wissenschaftlichen Kriterien bietet.“
BEI INNFOLIOLYTIX SETZT MAN AUF „ENHANCED INDEXING“, ZU DEUTSCH ETWA „SEMI -
eco. geld 83
PASSIVES INVESTIEREN“, EINEN HYBRIDEN ANSATZ AUS AKTIVEM UND PASSIVEM MANAGEMENT.
„Die bisherige Entwicklung gibt uns durchaus Anlass zu Optimismus.“
JOCHEN LAWRENZ
Mit dem Begriff „Enhanced Indexing“, zu Deutsch etwa „semi-passives Investieren“, einem hybriden Ansatz aus aktivem und passivem Management, kann man sich dagegen schon eher identifizieren. Die bereits verfügbaren Produkte sind diesem Ansatz zuzuordnen. Dabei werden einzelne passive Komponenten nach den Ergebnissen eines quantitativen Modells aktiv ausgewählt, gewichtet und sollen einen spürbaren Mehrwert gegenüber einer rein passiven Veranlagung erzielen. „Mit dieser Produktreihe möchten wir den Trend zum passiven Investieren aufnehmen, legen aber eine wissenschaftlich begründete, aktive Komponente darüber, die für einen zusätzlichen Mehrwert sorgen soll. Die bisherige Entwicklung gibt uns durchaus Anlass zu Optimismus“, sagt Lawrenz. Dabei seien die Enhanced-Indexing-Strategien besonders für Kund*innen geeignet, die ohnehin in die gängigen Weltaktien- oder Weltanleiheportfolios investieren wollen. Dabei denke man beispielsweise an Treasury-Abteilungen von Unternehmen, Stiftungen, aber auch an Versicherungen und andere institutionelle Investor*innen. „Wenn alles wie beabsichtigt funktioniert, dann erhält der Investor das gleiche Anlagerisiko wie bei einer Investition in den Index, allerdings mit einer zusätzlichen Rendite. Das ist dann wie die Extrakirsche auf dem Kuchen“, sagt Jochen Lawrenz.
Seit seinem Start hat das Innfoliolytix-Kernprodukt bereits allerlei Krisen mitgemacht – von der Coronapandemie bis zum Ukrainekrieg. Mit welchem Ergebnis? „Die Strategie hat genau das getan, was sie sollte“, hält Matthias Bank fest. Sie habe in den schwierigen Zeiten gezeigt, dass sie funktioniere. Eine Garantie für zukünftigen Erfolg könne es naturgemäß nicht geben, allerdings stimme sie das gute Ergebnis optimistisch, so die Professoren.
ZUKÜNFTIGES ANGEBOT
Geht es nach den Professoren, ist die Enhanced-Indexing-Produktreihe erst der Anfang. Mit zukünftigen Produkten möchte sich Innfoliolytix deutlicher vom globa-
JOCHEN LAWRENZ
ist Professor für Risikomanagement am Institut für Banken und Finanzen. Er ist stellvertretender Institutsvorstand sowie Sprecher der Gruppe der Professor*innen an der Fakultät für Betriebswirtschaft. Von 2020 bis 2022 war er Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirschaft (DGF). Lawrenz promovierte im Jahr 2005, war Gastforscher an der HEC Lausanne (Schweiz), hielt eine Vertretungsprofessur an der Leibniz-Universität Hannover (2012) und lehrt und forscht seit 2015 an der Universität Innsbruck.
tolerante Investoren wären wohl die richtige Zielgruppe für diese Produktideen. Die Fähigkeit zur richtigen Umsetzung muss gegeben sein, das ist einfach nicht für jeden etwas“, sagt Jochen Lawrenz. Nicht zufällig klingt die Analyse einer großen Zahl von Aktien in kurzen Zeitabständen verdächtig nach der derzeit allerorten gehypten Künstlichen Intelligenz. Diese spielt in den Innfoliolytix-Produkten allerdings noch nicht die erste Geige. „Wenn man sich intensiv mit statistischer Datenanalyse beschäftigt, dann nutzt man eigentlich bereits Methoden, die aktuell oft plakativ als Machine Learning oder KI klassifiziert werden. Das gilt auch für uns. Wir wollen uns zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht auf die Vorhersagen eines KI-Modells verlassen, da bisher nicht ausreichend verstanden ist, wie diese Modelle zu ihren Entscheidungen kommen. Unsere Strategien sollen klar nachvollziehbar sein. Eine Black Box können wir keine Anlageentscheidungen treffen lassen, das ist nicht unser Ansatz“, so Matthias Bank. „Wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, kann man bei der Geschwindigkeit der derzeitigen Entwicklung aber nur schwer abschätzen.“
MUSTERERKENNUNG
Mit Empfehlungen für Einzelaktien halten sich die Wissenschaftler indes vornehm zurück, man denke lieber in Portfolien. „Uns geht es vielmehr darum, Muster im Markthandeln zu erkennen, bei denen bei Analyse großer Datensätze Vorteile für die Bildung eines Portfolios entstehen könnten“, so Bank. „Wir versuchen statistische Muster zu erkennen“, bestätigt Lawrenz. „Statistik ist hierbei rational, wir lassen uns dabei nicht von irgendwelchen Gefühlen oder kurzfristigen Empfindungen und Marktstimmungen lenken.“
len Markt absetzen. „Dabei versuchen wir einen erheblichen Anteil des globalen Aktienuniversums mit quantitativen Methoden fundamental zu bewerten und daraus eine Portfoliozusammensetzung abzuleiten. Wir versprechen uns davon noch eine Steigerung des Renditepotentials, allerdings muss man auch hier klar verstehen, welche Risiken damit einhergehen“, erläutert Matthias Bank. Dieser Ansatz, der oft auch unter der Wortschöpfung „Quantamental“ – ein Kofferwort aus quantitativ und fundamental – firmiert, soll sich an risikofreudigere Investor*innen aus dem professionellen Kundensegment richten. „Family Offices und andere risiko-
Manche auch wissenschaftlich gut dokumentierte Börsenphänomene, beispielsweise der sogenannte Momentumeffekt, verheißen zwar auf dem Papier einen fixen Gewinn, lassen sich unter Berücksichtigung der Transaktionskosten aber dann doch nicht wirtschaftlich realisieren und bleiben daher von eher akademischem Interesse, so die Professoren. In jedem Fall steckt hinter Innfoliolytix und den Protagonisten eine ganze Portion wissenschaftlicher Ehrgeiz und auch Ethos und Integrität aus dem Wissenschaftsbetrieb. „Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind uns sehr wichtig“, wiederholt Matthias Bank. Man glaubt es ihm aufs Wort.
eco. geld 84




Ferienhaus in Apulien (Provinz Lecce) 3 Schlafzimmer
Meernähe
LUKRATIVE NISCHENTHEMEN MIT MAINSTREAMPOTENZIAL
Künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Industrieautomatisierung, aber auch die Raumfahrt: Diese Nischenthemen am Aktienmarkt sind gerade dabei – zumindest in den kommenden Jahren –, zum Mainstream aufzusteigen.
TEXT: MICHAEL KORDOVSKY
86 eco. geld
Laut MarketsandMarkets Research soll der Weltmarkt für KI von 2023 bis 2030 um 36,8 Prozent p. a. auf 1.345 Milliarden Dollar wachsen. Treibende Kräfte dafür sind
Fortschritte in Algorithmen und Machine-Learning-Technologien, Kostenreduktion bei und steigende Nachfrage nach autonomer KI. Ausgangspunkt des aktuellen KI-Booms war die Freigabe der kostenfreien Version von ChatGPT durch OpenAI am 30. November 2022. Am 14. März 2023 erschien offiziell die Version 4.0 von GPT, die auch die Fähigkeiten von Chat GPT erweitert. Das börsenrelevante Ereignis fand indes im Januar 2023 statt, als die Nachricht durch die Medien ging, dass sich Microsoft mit zehn Milliarden Dollar an OpenAI beteiligt und deren Chatbot-Software in eigene Dienste integriert. Dieser Zeitpunkt kann als wichtigster Ausgangspunkt des aktuellen KI-Aktienbooms gesehen werden.
ETFS BIETEN
EINE GUTE MÖGLICHKEIT, DAS KI -THEMA
BREITER GESTREUT ABZUDECKEN.
Der iSTOXX AI Global Artificial Intelligence Large 100 Index liegt per 17. Mai 2024 seit 2. Januar 2023 rund 70,7 Prozent im Plus. Der Index enthält als eine wesentliche Benchmark mit KI-Bezug 100 Aktien von Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum, die massiv in die Entwicklung neuer AI-Technologien investiert haben – darunter
KI-Profiteure wie Micron Technology AMD, Intel, Siemens und der Chirurgieroboter-Anbieter Intuitive Surgical. Hier geht es um die Anbieter der technologischen Basis aus der Halbleiterbranche und praxisorientierte KI-Spezialisten wie Alphabet, Meta und diverse Robotikunternehmen, die KI in ihre Produkte integrieren. Der harte Kern des KI-Booms sind aus der Wahrnehmungsperspektive der breiten Masse der Anleger wohl Microsoft und der Grafikprozessoren-Anbieter Nvidia als ein weltweit führender Anbieter von KI-Computing. Die Nvidia-Aktie ist in den vergangenen fünf Jahren bereits auf mehr als das 23-Fache gestiegen, alleine auf Jahressicht liegt sie fast 196 Prozent im Plus (per 17. Mai 2024). Microsoft liegt indessen in den vergangenen fünf Jahren um 228 Prozent im Plus. Sowohl Nvidia als auch Microsoft sind mit für 2024/25 erwarteten KGVs (Quelle: Zacks Investment Research) von je 38,1 bzw. 31,9 nicht mehr günstig, doch bei anhaltender Wachstumsdynamik winken weitere Gewinne.
GRUNDSTEIN DES AI - BOOMS Training und die Entwicklung neuer KI-Algorithmen erfordern hochleistungsfähige Halb -
87 eco. geld
DAS DISRUPTIVE ANWENDUNGSSPEKTRUM VON KI UMFASST NAHEZU ALLE BRANCHEN, WESHALB VOR ALLEM FIRMEN, DIE
ALS
HALBLEITERTECHNOLOGIE-
UNTERNEHMEN KI ERMÖGLICHEN,
DAVON PROFITIEREN.
leiter, wobei heute vor allem Chatbots eine treibende Kraft sind. Hinzu kommt der Einsatz am Smartphonemarkt und in der Datenanalyse sowie -auswertung. Dies betrifft unter anderem auch medizinische Bereiche. Das disruptive Anwendungsspektrum umfasst somit nahezu alle Branchen, weshalb vor allem Firmen, die als Halbleitertechnologieunternehmen KI ermöglichen, davon profitieren. Beispiele wären hier Qualcomm, Micron Technologies und Super Micro Computer. Letztere bietet beschleunigte Compute-Plattformen, die anwendungsoptimierte Server und Speicherplattformen für eine Vielzahl von Märkten sind. Von 2019 bis 2023 hat das Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt, während der freie Cashflow auf das 2,6-Fache stieg.
Im Bereich Big Data (Strukturierung großer Datenmengen) ist IBM ein Klassiker, unter den Wachtumsgiganten der Magnificent 7 noch Luft nach oben haben könnte die Google-Muttergesellschaft Alphabet. Im Laborbereich bei Sequenzierungsautomaten hat Illumina einen Marktanteil von ca. 80 Prozent. Das Unternehmen ermöglicht es, DNA-Sequenzen des menschlichen Genoms oder verschiedener Viren zu analysieren. Ein wachstumsstarkes Unternehmen im Bereich Datenanalyse ist auch Palantir Technologies.
Da aufgrund teils ambitionierter Bewertungen und diverser unternehmensspezifischer Risiken das KI-Thema breiter gestreut über einschlägige ETFs abgedeckt werden sollte, hier Beispiele möglicher interessanter ETFs:
WISDOM TREE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Der ETF bildet den Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index ab und liegt auf Fünfjahressicht (per 17.
Mai 2024) 125,2 Prozent im Plus. Der Index wurde in einer Zusammenarbeit zwischen WisdomTree und den Experten der NASDAQ sowie der Consumer Technology Association („CTA“) konzipiert. Der ESG-orientierte Index stuft Unternehmen in drei Gruppen ein: Wegbereiter (wichtige Akteure im Bereich KI, von denen einige ihrer Kernprodukte und Dienstleistungen die kontinuierliche Entwicklung von KI ermöglichen), Entwickler (Bereitstellung von KI-betriebenen Produkten und Dienstleistungen) und Verbesserer (Unternehmen, die eine bedeutende Kraft in KI sind, aber deren Produkte oder Dienste in KI derzeit nicht Kernstück ihres Umsatzes sind). In jeder Gruppe werden Unternehmen mit den besten KI-Intensitätswerten selektiert.
L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF
Der L&G Artificial Intelligence UCITs ETF bildet die Wertentwicklung des ROBO® Global Artificial Intelligence Index ab. Er führt eine globale KI-Unternehmensdatenbank von Firmen, die im Bereich KI und der Grundlagentechnologien tätig sind und dort einen Teil ihres Umsatzes erwirtschaften. Die ROBO Global® Industry Classification unterscheidet dabei gegenwärtig elf Teilsektoren des KI-Bereichs, deren Produkte und Technologien den richtigen Reifegrad für hohes Wachstums- und Renditepotenzial haben. Die Aktienauswahl erfolgt nach Handelsliquidität und KI-Faktoren. Per Ende März 2024 sind 58 Werte enthalten.
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF
Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF, der den Nasdaq Global Artificial Intelligence &
eco. geld 88
Big Date Index nachbildet, brachte es im gleichen Zeitraum auf fast 56 Prozent. Zwecks Aktienauswahl erfolgte eine Aufteilung des Marktes in sieben Segmente (Spracherkennung & Chatbots, Natural Language Processing, Deep Learning, Big Data, Cloud Computing, Bilderkennung und Cybersecurity). Die konkrete Auswahl der Titel im Index basiert auf den Patenten, die diese Unternehmen in mindestens einem der sieben genannten Segmente angemeldet haben, die für die Weiterentwicklung von KI wichtig sind. Eine weitere Rolle spielen Handelsliquidität und ESG-Kriterien.
ROBOTIK UND INDUSTRIEAUTOMATISIERUNG
Eng verzahnt mit dem KI-Boom sind die Robotik und Industrieautomatisierung. Laut The Insight Partners sollte der Weltmarkt für Industrierobotik von 2022 bis 2030 um 9,39 Prozent p. a. auf 30,47 Milliarden US-Dollar wachsen; laut Robotik-Weltverband IFR (International Federation of Robotics) stiegen bereits von 2011 bis 2021 die Roboterauslieferungen weltweit von 166.000 auf 487.000.
Der Platzhirsch in der Branche ist dabei die japanische Fanuc. Das 1956 gegründete Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabriksautomation, Industrierobotern, CNC-Systemen, Drahterodier- und Spritzgussmaschinen sowie vertikalen Bearbeitungszentren. Außerdem ist Fanuc Weltmarktführer bei größeren Industrierobotern, die beispielsweise in der Auto- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Zuletzt entwickelte das Unternehmen besonders bewegliche Schweißroboter, die auch hochpräzise Tätigkeiten durchführen können. Konjunkturelle Bremsfaktoren wie hohe Zinsen, aber auch eine Knappheit an Halbleitern führte im Geschäftsjahr 2023/24 zu einer rückläufigen Umsatz- und Ertragsentwicklung, doch in den kommenden Jahren erwarten Analysten wieder Zuwächse.
Ein Klassiker der Branche ist die US-amerikanische Rockwell Automation, einer der führenden Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen. Zu den Produkten des Unternehmens zählen beispielsweise Schutzmodule, Prozessleitsysteme, Antriebe und Motoren, Energieüberwachung, Industriecomputer und Monitore, Beleuchtungssteuerung, Achs- und Motorsteuerung, diverse Sensoren und Schalter, aber auch Softwarelösungen für die industrielle digitale Transformation. Trotz Coronakrise hat das Unternehmen von 2019 bis 2023 den Gewinn/Aktie um 19,7 Prozent p. a. gesteigert.
Mag. Josef Reitter ist öffentlicher Notar in Zell am Ziller

NEUE GEBÜHRENBEFREIUNGEN
Aufgrund der aktuellen Novelle zum Gerichtsgebührengesetz ist seit dem 01.04.2024 die grundbücherliche Eintragung von Hauptwohnsitzimmobilien begünstigt.
Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass es sich um einen entgeltlichen Erwerb, somit um den Kauf einer bebauten oder einer noch mit einem Wohnhaus zu bebauenden Liegenschaft handelt, der Erwerber dort seinen Hauptwohnsitz begründet und gleichzeitig seine bisherige Wohnstätte aufgibt. Der mittels amtlicher Meldebestätigung dem Grundbuchgericht gegenüber zu erbringende Nachweis der neuen Hauptwohnsitzbegründung muss bei Erwerb einer bezugsfertigen Liegenschaft spätestens 3 Monate nach Übergabe und bei Erwerb einer noch zu bebauenden Liegenschaft spätestens 5 Jahre nach der Grundbuchseintragung erbracht werden. Gleichzeitig muss nachgewiesen werden, dass der bisherige Wohnsitz aufgegeben wird, und zwar in der Weise, dass bei vorhandenem Eigentum an der bisherigen Wohnstätte diese verkauft, übergeben oder für zumindest 5 Jahre vermietet wird.
Zusätzlich zum Eigentumserwerb ist die Eintragung eines grundbücherlichen Pfandrechts begünstigt, soweit dieses der Besicherung von Krediten, für den Erwerb oder die Sanierung der neu angeschafften Liegenschaft dient. Beide Gebührenbefreiungen bestehen jeweils bis zu einer Bemessungsgrundlage von € 500.000,– Übersteigt die Bemessungsgrundlage den Betrag von € 500.000,–, ist für den darüberhinausgehenden Betrag jedoch die betreffende Eintragungsgebühr zu entrichten. Die Gebührenbefreiungen bestehen nicht, sofern die Bemessungsgrundlage € 2 Millionen beträgt bzw. übersteigt. Darüber hinaus gelten diese betraglich beschränkten Gebührenbefreiungen zeitlich befristet bis 01.07.2026. PR
NOTARIATSKAMMER
FÜR TIROL UND VORARLBERG
Maximilianstraße 3, 6020 Innsbruck www.ihr-notariat.at
eco. expertentipp
89
ROBOTIK UND INDUSTRIEAUTO -
MATISIERUNG SIND
ENG MIT DEM THEMA DER KÜNSTLICHEN
INTELLIGENZ VERWANDT. AUCH HIER
CHANCEN.
Ein klarer Wachstumswert ist auch der Operationsroboterhersteller Intuitive Surgical, dessen Branchenumsatzanteil von IBISWorld auf 53 Prozent geschätzt wird. Von 2017 bis 2023 lag das Gewinnwachstum/ Aktie bei 17,7 Prozent, laut Analystenschätzungen (Quelle: finanzen.at) sollte von 2024 bis 2028 der Gewinn/Aktie weiter um 16,4 Prozent p. a. wachsen. Allerdings ist das für 2026 geschätzte KGV (per 17. Mai 2024) mit 46,4 sehr ambitioniert. Günstiger ist da schon die Schweizer ABB, die auch stark im Energieinfrastrukturbereich tätig ist. Im ersten Quartal signalisiert eine Book-to-Bill-Ratio (Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz) von 1,14 Expansion. Hinzu kommt ein starker Anstieg des freien Cashflows. Mit einem KGV von 22,3 ist die Aktie bei einem Kurs von 52,20 USD noch immer bodenständig bewertet. Spannende ETFs in diesem Bereich:
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF
Als ETF in den vergangenen fünf Jahren per 17. Mai 2024 bereits rund 88 Prozent im Plus ist der iShares Automation & Robotics UCITs ETF, der den iSTOXX® FacSet Automation & Robotics Index nachbildet. Dieser enthält 152 Positionen.
L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION UCITS ETF
Mit 77 Positionen etwas konzentrierter ist der L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITs ETF, der auf fünf Jahre knapp 58 Prozent im Plus liegt. Der ETF bildet den ROBO Global® Robotics and Automation UCITs Index ab und enthält Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes in der Robotik und Automatisierungsbranche erwirtschaften.
RAUMFAHRT
Auch die Raumfahrt entwickelt sich immer weiter. In den kommenden Jahrzehnten wird eine Besiedlung von Mond und Mars wahrscheinlicher. Laut Spherical Insights soll der weltweite Raumfahrtsmarkt (Space Exploration) von 2022 bis 2032 um 16,21 Prozent p. a.
auf 1.879 Milliarden US-Dollar wachsen. In den USA sind es vor allem Rüstungskonzerne, die auch über eigene Raumfahrtabteilungen verfügen. Beispiele sind der Kampfflugzeughersteller Lockheed Martin oder Boeing, dessen Raumschiff „Starliner“ derzeit medial kritisch beäugt wird. Lockheed Martin baut für die beiden US-Behörden NASA und DARPA ein Raumfahrzeug mit Nuklearantrieb (Auftragswert ca. 500 Mio. USD). Ziel ist letztendlich, mit nuklearem Antrieb die Reisedauer zum Mars von 260 auf 120 Tage zu reduzieren. Das experimentale Raumfahrzeug soll 2027 ins All geschossen werden. Gleichzeitig baut das Unternehmen die Produktion kleiner Satelliten auf, eine wachstumsstarke Marktnische. Im Jahr 2023 fielen bei Lockheed Martin 18,6 Prozent der Umsätze auf die Raumfahrt, während der Löwenanteil nach wie vor in der Rüstung erwirtschaftet wird.
Eine besonders spannende Story für Anleger liefert der Rüstungs- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman, der mit SpaceX (gehört Elon Musk) an einem geheimen Spionagesatellitenprojekt arbeitet, das hochauflösende Bilder von der Erde erfasst. Des Weiteren soll Northrop Grumman für die DARPA das Konzept für ein Eisenbahnnetz auf dem Mond erstellen. Bis zum Jahr 2035 soll eine Mondinfrastruktur entstehen, die auch die Energieversorgung und Kommunikation gewährleistet. Hier auf der Erde ist Northrop Grumman bekannt für Drohnen, unbemannte Flugzeuge und für den Tarnkappenbomber B-2 Spirit sowie das Kampfflugzeug F-14.
Ebenfalls attraktiv ist der Raketenspezialist Raytheon Technologies, der 2020 mit United Technologies fusionierte und auch Flugzeugturbinen und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt anbietet. 2023 hat das Unternehmen seine Wachstums- und Ertragsziele erreicht. Für heuer erwartet das Management eine Steigerung des Umsatzes von 68,9 auf 78 bis 79 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow sollte von 5,5 auf 5,7 Milliarden US-Dollar steigen.
eco. geld 90
keine
GIBT ES GUTE
DISCLAIMER: Die hier erwähnten Aktien und ETFs sind plakative Beispiele und keinerlei Anlageempfehlungen. Einzelaktien bergen Totalverlustrisiken und auch bei einzelnen ETFs können erhebliche Verluste drohen. Es sind
Updates geplant.


QR-Code scannen und Exposé anfordern
Tolle großzügige Innenstadtwohnung in schmucker Stadtvilla
Wollen Sie herrschaftlich auf enormer Wohnfläche wohnen?
In einer wunderbaren Stadtvilla in bester Lage (nahe Klinik und Universität) der Landeshauptstadt Innsbruck kommt diese Stadtwohnung in die Vermietung. Vier gut eingeteilte Zimmer, eine große Küche mit Ausgang auf den Balkon, ein Abstellraum bzw. Speis sowie ein großzügiges Bad und ein separates WC vervollständigen das Angebot. Wunderbare Holzriemenböden, überhohe Räumlichkeiten, der Schick der Jahrhundertwende gepaart mit der modernen Gestaltung der Küche wie der Sanitäranlagen. Die Wohnung ist bis auf Küche, begehbaren Schrank und Sanitär unmöbliert. Eine Gartenbenützung im Erdgeschoß ist gegeben. Eine langfristige Vermietung wird angestrebt. Die momentanen Betriebskosten belaufen sich auf EUR 260,–. Das exklusive Appartement ist ab dem Frühsommer 2024 und nach Vereinbarung verfügbar.
WOHNFLÄCHE
CA. 147 M²
CA. 17 M²
MIETZINS
EUR 2.400,-
BALKON
+43 (0)512 551077 | Innsbruck@engelvoelkers.com engelvoelkers.com/tirol Engel & Völkers Kitzbühel GmbH | Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH INNSBRUCK
CYBERSEC RITY BETRIFFT ALLE UNTERNEHMEN
Der zunehmende Einsatz von Artificial Intelligence (AI) beeinflusst auch die Cybersicherheit von österreichischen Unternehmen maßgeblich. Warum der Zero-Trust-Ansatz in diesem Zusammenhang an Bedeutung gewinnt, erfahren Sie hier.
TEXT: GEORG SCHWONDRA
Die digitale Transformation ist einer der wichtigsten aktuellen Trends in der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang hat sich Cybersicherheit zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg von Unternehmen aller Größen entwickelt. Ob kleines Start-up, KMU oder multinationaler Konzern: alle sind von der zunehmenden Komplexität und den raffinierten Angriffsmethoden Cyberkrimineller betroffen. Unternehmen müssen deshalb geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Cyberbedrohungen setzen. Oft werden traditionelle Sicherheitsansätze dabei den modernen Anforderungen und neuen Rahmenbedingungen nicht mehr gerecht. Mit dem Sicherheitskonzept Zero Trust können Unternehmen unabhängig von ihrer Größe Cyberrisiken zeitgemäß und proaktiv managen.
REALES RISIKO FÜR ALLE UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Ransomware-Angriffe, bei denen versucht wird, wichtige Daten zu verschlüsseln, gehö-
ren für österreichische Unternehmen unabhängig von ihrer Größe zum Alltag. Ebenso erfolgen gezielte Angriffe auf sensible Datenbanken. Die Häufigkeit und Vielfalt der Attacken zeigt dabei: Die Methoden im Bereich CyberCrime werden immer ausgeklügelter und niemand ist immun gegen die Bedrohungen. Gleichzeitig hat das Bewusstsein hinsichtlich Cybersicherheit in Unternehmen durch die strengeren Vorschriften und die neue EU-Gesetzgebung wie NIS 2, AI Act, DSGVO, DORA und Cyber Resilience Act deutlich zugenommen. Diese Regulatorien spielen eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Cyberresilienz und betreffen auch mittelständische Unternehmen. So können etwa
auch kleine Unternehmen durch die Lieferkette und Unternehmen in wesentlich und wichtig eingestuften Branchen ab 50 Mitarbeiter*innen von der NIS 2 (Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie der EU), die am 17. Oktober 2024 in Kraft tritt, betroffen sein. Die DSGVO andererseits gilt auch für kleine Unternehmen, die personenbezogene Daten von Kund*innen und Mitarbeiter*innen verarbeiten. Insgesamt adressiert die Cybersicherheitsgesetzgebung der EU kleine und mittelständische Unternehmen, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um ihre Daten zu schützen, die Lieferkette sicher zu gestalten und sich vor Cyberangriffen zu verteidigen.
Ob kleines Start-up, KMU oder multinationaler Konzern: Alle sind von der zunehmenden Komplexität und den raffinierten Angriffsmethoden CyberKrimineller betroffen.
92 eco. service
FINANZIELLE UND REPUTATIONSSCHÄDEN: LANGFRISTIGE
AUSWIRKUNGEN
Cyberangriffe können große finanzielle Schäden verursachen. Darüber hinaus können der Ruf und das Vertrauen eines Unternehmens irreparabel beschädigt werden, wenn sensible Daten von Kund*innen oder Geschäftspartner*innen kompromittiert werden. Regulatorische Strafen und rechtliche Konsequenzen sind oft die Folge von Datenschutzverletzungen, was die finanzielle Belastung weiter verschärft. Die langfristigen Auswirkungen eines Cyberangriffs können die Existenz eines Unternehmens bedrohen. Dies gilt insbesondere für kleine oder mittelständische Betriebe, die möglicherweise nicht über die Ressourcen verfügen, um sich von einem schwerwiegenden Cyberangriff zu erholen.
RANSOMWARE - ANGRIFFE:
EINE ZUNEHMENDE BEDROHUNG
Der von Deloitte durchgeführte Cyber Security Report 2024 zeigt die Entwicklung österreichischer Unternehmen im Bereich Cybersicherheit. Er macht einmal mehr deutlich, dass Ransomware-Angriffe nicht nur häufiger, sondern auch effizienter und professioneller geworden sind. Die Anzahl der Unternehmen, bei denen es noch nie zu einem Ransomware-Angriff gekommen ist, hat sich in den letzten beiden Jahren beinahe halbiert. Technische Infrastrukturmaßnahmen können die Verbreitung von Ransomware-Angriffen nur noch in 34 Prozent der Fälle verhindern. Besonders die erhöhte Cyber Security Awareness bei Mitarbeiter*innen hilft, Ransomware-Angriffe zu verhindern. Im Vergleich dazu lag die Erfolgsquote solcher Maßnahmen im Jahr 2022 noch bei 76 Prozent.
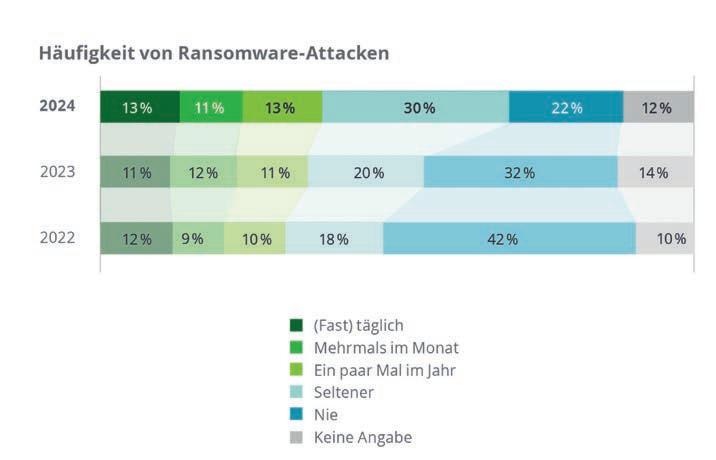
Ransomware-Angriffe werden zunehmend professioneller und dynamischer. Unternehmen, deren Daten infolge eines Angriffs verschlüsselt wurden, haben deutlich geringere Chancen, diese zu entschlüsseln oder über ein Backup wiederherzustellen als noch vor zwei Jahren. Während in den Jahren 2022 und 2023 noch in 37 bzw. 25 Prozent der Fälle die Daten entschlüsselt werden konnten, liegt diese Quote 2024 nur noch bei 17 Prozent. Ebenso ist die Erfolgsrate bei der Wiederherstellung von Daten durch Backups von 59 Prozent im Jahr 2022 und 41 Prozent im Jahr 2023 auf 28 Prozent in diesem Jahr gesunken. Diese Entwicklung zeigt auf, wie wichtig es ist, sich gegen solche Angriffe wirksam zu schützen.
ZERO TRUST: EIN MODERNER
CYBERSICHERHEITSANSATZ
Da die technologischen Grundsysteme in Unternehmen zunehmend vernetzter werden, reicht ein herkömmlicher statischer

Ansatz nicht mehr aus, um für Cyber-Sicherheit zu sorgen. Aus diesem Grund zählt Zero Trust mittlerweile zu den führenden Konzepten in diesem Bereich. Mit dem Ansatz können Unternehmen Cyber-Risiken proaktiv managen.
Das Motto des Sicherheitsansatzes Zero Trust lautet „Never trust, always verify“. Traditionelle Ansätze gehen davon aus, dass Benutzer*innen innerhalb des Netzwerks sicher und vertrauenswert sind. Im Gegensatz dazu wird beim Zero-Trust-Ansatz niemandem automatisch vertraut – jeder einzelne Datenzugriff wird verifiziert. Die Verifizierung ist unabhängig davon, ob der Zugriff intern oder extern erfolgt. Mit diesem Konzept kann Cyber-Sicherheit auch in einem modernen, dynamischen Umfeld sichergestellt werden. Gerade kleinere Betriebe können stark von diesem Ansatz profitieren, da vorhandene Personalressourcen optimal genutzt werden können. Bei der Umsetzung gibt es hier in Österreich noch viel Luft nach oben: Knapp die Hälfte der
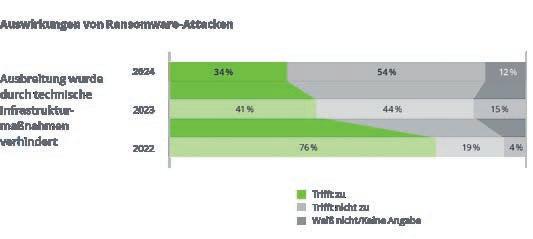
93 eco. service
 Georg Schwondra, Partner & Cyber-Experte, Deloitte Risk Advisory
Georg Schwondra, Partner & Cyber-Experte, Deloitte Risk Advisory

befragten Unternehmen hat noch nie von Zero Trust Security gehört.
AI IN DER CYBERSICHERHEIT: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN
Die Entwicklung von AI bietet Unternehmen fortschrittliche Analysefähigkeiten. Diese können helfen, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und proaktiv darauf zu reagieren. Andererseits können Angriffe mittels AI automatisiert und getarnt werden. Dies stellt herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen vor völlig neue Herausforderungen.
Derzeit steht beim Thema AI für viele Unternehmen der Nutzen als praktisches Werkzeug im Vordergrund. Allerdings bringen viele damit auch Cyberrisiken in Verbindung. Die im Rahmen des Cyber Security Reports befragten Unternehmen sehen die Gefahr vor allem beim automatischen Erstellen von Phishing-E-Mails und Generieren von Deep Fakes, also Stimm- und Videoanimationen, die betrügerisch eingesetzt werden können. Als weitere Gefahren werden das Finden von Schwachstellen in
Sicherheitssystemen oder auch das mangelnde Sicherheitsbewusstsein von Mitarbeiter*innen, das zu Datenlecks führen kann, identifiziert.
FAZIT: JETZT HANDELN!
Die digitale Vernetzung und die Nutzung von neuen Technologien schreiten laufend voran. Dadurch werden Cyberbedrohungen auch in Zukunft weiter zunehmen. Gleich-
zeitig bieten technologische Innovationen wie AI und maschinelles Lernen neue Möglichkeiten, sich gegen Cyberangriffe zu verteidigen. Dadurch wird es unerlässlich, dass Unternehmen Cybersicherheit als integralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie betrachten.
Um mit den sich ständig verändernden Bedrohungen Schritt zu halten, müssen sie weiter in die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Sicherheitslösungen investieren. Dazu gehören technische Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls und Antivirensoftware, aber auch die Förderung einer Sicherheitskultur innerhalb des Unternehmens. Mitarbeiter*innen müssen regelmäßig geschult werden, um sie für die Gefahren von Cyberangriffen zu sensibilisieren. Nur so werden sie in der Lage sein, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden. Darüber hinaus müssen Unternehmen auch in die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Incident-Response-Plans investieren, um im Falle eines Angriffs schnell und effektiv reagieren zu können. Und bitte nicht vergessen: Cyberbedrohungen betreffen auch klein- und mittelständische Unternehmen. Denn auch sie sind auf die Sicherheit ihrer Daten, auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Informationen angewiesen. www.deloitte.at/cyber

Hier geht’s zum Deloitte Cyber Security Report

94 eco. service



IM.ABO WIR MACHEN MAGAZIN. 7 AUSGABEN – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN 7 AUSGABEN – ECO.NOVA SPEZIAL ZUM VORZUGSPREIS VON 29 EURO (AUSLAND: 49 EURO) E-MAIL: REDAKTION@ECONOVA.AT | ABO-HOTLINE: 0512/29 00 88-10 WWW.ECONOVA.AT
GRUNDERWERB OHNE GRUNDBUCHSEINTRAGUNGSGEBÜHREN
Beim Erwerb von Immobilien kommt es zu erheblichen Nebenkosten. Alles in allem muss man inklusive Maklergebühren bis zu zehn Prozent des Kaufpreises zusätzlich einkalkulieren. Auf Grund der neuen Gesetzeslage können für Eigenheime unter bestimmten Voraussetzungen davon temporär nun in Summe bis zu 11.500 Euro eingespart werden.
TEXT: VERENA MARIA ERIAN, RAIMUND ELLER
Befreit ist die Eintragung des Eigentumsrechtes (1,1 %) an einer Liegenschaft zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro. Dieser Betrag ist als Freibetrag zu verstehen, das heißt, auch bei darüber liegenden Anschaffungskosten bleiben 500.000 Euro gebührenfrei. Ebenso von dieser Befreiung umfasst ist auch die Gebühr für die Eintragung eines Pfandrechtes zur Besicherung eines Darlehens (1,2 %). Dies gilt auch für Darlehen zur Errichtung oder Sanierung eines Eigenheimes. Luxusimmobilien (Liegenschaftswerte von mehr als zwei Millionen) sind allerdings zur Gänze ausgeschlossen.
BEDINGUNGEN
Die Befreiung ist bis zum 1. Juli 2026 befristet und kann unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden.
• Der Kaufvertrag/Pfandbestellungsvertrag wurde nach dem 31. März 2024 abgeschlossen.
• Der Antrag auf Eintragung darf erst ab 1. Juli 2024 bei der Behörde einlangen.
• Es muss sich um ein Eigenheim zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses handeln (Nachweis: Hauptwohnsitzmeldung).
• Ist das Wohngebäude noch nicht errichtet, so muss es spätestens drei Monate ab Fertigstellung bezogen werden. Dies muss spätestens fünf Jahre ab dem Tag der Eintragung der Fall sein.

Zur Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses ist man von den Gebühren zur Eintragung des Eigentumsrechts unter bestimmten Bedingungen befreit.
• Die Befreiung von der Gebühr für die Eintragung eines Pfandrechtes ist dann möglich, wenn der pfandrechtlich besicherte Kredit für den Kauf, die Errichtung oder die Sanierung eines Eigenheimes aufgenommen wurde. Dies ist mittels Bankbestätigung nachzuweisen.
• Das gebührenbefreite Objekt muss in weiterer Folge tatsächlich bezogen und fünf Jahre als Hauptwohnsitz genutzt werden.
Ist dies nicht der Fall, dann kommt es zu einer Nacherhebung der Gebühren. Konsultieren Sie in Zweifelsfällen bitte Ihren persönlichen Steuerberater und stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen zur Erlangung der Gebührenbefreiung erfüllt werden. Aktuell gilt es vor allem das Timing zu beachten, da eingelangte Anträge vor dem 1. Juli 2024 leider noch die volle Gebührenpflicht auslösen.
96 eco. service
Die Ärztespezialisten vom Team Jünger: StB Mag. Dr. Verena Maria Erian und StB Raimund Eller

BETRIEBSÜBERGABE LEICHT GEMACHT
Viele Unternehmer*innen von kleineren und mittleren Betrieben sind früher oder später damit konfrontiert, wie es denn mit dem Betrieb weitergehen soll, wenn die Pension vor der Tür steht. Die Berater*innen der Experts Group Übergabe der Wirtschaftskammer
Tirol (WKT) geben die Empfehlung ab: Es kann gar nicht früh genug sein, darüber nachzudenken, wie der Betrieb weitergeführt werden soll.
Um mit der Betriebsübergabe nicht allein dazustehen, hat die Experts Group der WKT kostenlose Sprechtage in allen Bezirksstandorten eingerichtet, die Unternehmer*innen eine Hilfestellung an die Hand geben, was zum Thema zu beachten ist. Und es gibt tatsächlich viele Themen, die bei einer Betriebsübergabe eine wesentliche Rolle spielen. Neben allgemeinen gewerberechtlichen und steuerrechtlichen Belangen treten auch immer häufiger die Fragen auf: Wer soll meinen Betrieb weiterführen? Ist die angedachte Person auch fachlich und betriebswirtschaftlich in der Lage dazu? Ist das derzeitige Geschäftsmodell des Betriebes zukunftsfähig?
Manche Unternehmer*innen haben das große Glück, dass die eigenen Kinder mit dem Betrieb groß geworden sind und diesen auf eigenen Wunsch auch weiterführen wollen. Besonders in solchen Fällen ist es wichtig, sich die Unterstützung von Expert*innen zu holen, da oft emotionelle Themen in die Übernahme mit hineinspielen. In den meisten
Fällen haben die Kinder ganz anderer Vorstellungen davon, ein Unternehmen zu führen, als ihre Eltern. Um hier möglichen Konflikten vorzubeugen und potenzielle Chancen nicht im Keim zu ersticken, ist es von großer Wichtigkeit, sich einen neutralen und sachlichen Standpunkt einzuholen, um für alle einen guten und gangbaren Weg zu gestalten. Und damit sind wir beim Kernthema einer Betriebsübergabe: Es gilt einen Weg zu gestalten, der die Erfahrungen der Übergeber und die Ideen der Übernehmer in Einklang bringt. Um diesen gemeinsamen Weg erfolgreich zu gestalten, braucht es Zeit und eine sachliche und wertschätzende sowie offene Gesprächskultur. Auch im Fall einer externen Übernahme durch einen Mitarbeiter oder einen anderen Betrieb ist dieser Prozess möglichst früh zu starten, um das Unternehmen ab dem Zeitpunkt der Übergabe erfolgreich weiterzuführen. Daher ist unsere klare Empfehlung, diese Reise früh genug zu beginnen und sich schon von Beginn eine erfahrene Prozessbegleitung an seine Seite holen. PR
EXPERTES GROUP ÜBERGABE
Wir verfügen neben dem eigenen Know-how über ein hervorragendes Netzwerk innerhalb der Wirtschaftskammer Tirol, um steuerrechtliche, gewerberechtliche und juristische Fragen zu beantworten. Nehmen Sie die Übergabe in den WKTStandorten war und erkundigen Sie sich. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können.
Für die Termine für die kostenlosen BetriebsnachfolgeSprechtage in allen Bezirken scannen Sie bitte den QR-Code.
WIRTSCHAFTSKAMMER 97
ALTERSVORSORGE NEU GEDACHT
Immobilien-Teilverkauf als lukrative Alternative: Bei Engel & Völkers LiquidHome können Hausbesitzer*innen bis zu 50 Prozent ihres Eigentums verkaufen, behalten dabei jedoch sämtliche Nutzungsrechte und Freiheiten und erhalten darüber hinaus neues Kapital.

Eine Immobilie zu besitzen, war schon immer ein fundamentaler Teil des Vermögensaufbaus. Durch die äußerst niedrigen Zinsen erwirtschaften herkömmliche Finanzanlagen nur geringe Renditen, wobei im Kontrast dazu aus Immobilienvermögen durchaus neue Liquidität entstehen kann. Wer in seinen eigenen vier Wänden lebt, hat dank des kontinuierlich wachsenden Immobilienwerts mehr Möglichkeiten als je zuvor. Dieses vorhandene Vermögen ist allerdings „eingemauert“. Aus der eigengenutzten Immobilie liquide Mittel freizusetzen, war nicht immer möglich und so konnten weder Wünsche noch das tägliche Leben daraus finanziert werden. Ein Immobilien-Teilverkauf ist daher die perfekte Lösung für alle
Eigentümer*innen eines Einfamilien- oder Reihenhauses, die Kapital aus ihrer Immobilie freisetzen möchten, ohne diese zu verlassen oder komplett verkaufen zu müssen. Bei Engel & Völkers LiquidHome können Hausbesitzer*innen bis zu 50 Prozent ihres Eigentums verkaufen, dieses jedoch weiterhin wie gewohnt bewohnen und nutzen. Sie behalten sämtliche Nutzungsrechte und Freiheiten und erhalten darüber hinaus neues Kapital. Mit der Auszahlung des Kaufpreises von Minimum 100.000 Euro nach Vertragsabschluss können beispielsweise die Rente aufgebessert oder größere Investitionen getätigt werden. Im Gegenzug dafür zahlen Sie – je nach Auszahlungssumme – eine monatliche Fruchtgenussgebühr.
TEILVERKAUF UND FRUCHTGENUSSRECHT
Die Wertermittlung des Ankaufanteils erfolgt durch unabhängige, zertifizierte Gutachter*innen. Engel & Völkers LiquidHome übernimmt dabei die Kosten für das Wertgutachten. Zudem wird das Fruchtgenussrecht im Grundbuch notariell verankert, was den Hausbesitzenden weiterhin umfassende Nutzungsrechte sichert. Sie haben damit die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent der Immobilie zu veräußern und trotzdem 100 Prozent der Wohnrechte zu behalten.
Das Fruchtgenussrecht gestattet es den Immobilieneigentümer*innen, die Immobilie weiterhin selbst zu nutzen oder zu vermieten und somit von potenziellen Wertsteige-
ENGEL & VÖLKERS
rungen zu profitieren. Für die Nutzung des verkauften Anteils zahlen die Teilverkäufer*innen eine monatliche Gebühr. Diese richtet sich nach dem Immobilienwert und dem Verkaufsanteil. Diese flexible Gestaltung bietet Vorteile gegenüber traditionellen Modellen wie Nießbrauch oder Leibrenten, die oft nur eingeschränkte Nutzungsoptionen bieten. „Der Immobilien-Teilverkauf bietet außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Einkünfte durch Mieteinnahmen zu generieren, was besonders attraktiv ist, wenn die Immobilienpreise steigen“, erklärt Gerald Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers LiquidHome. Darüber hinaus treffen die Eigentümer*innen weiterhin eigenständige Entscheidungen über Renovierungen oder Sanierungen. Eine Besonderheit: Steht bei Vertragsanbahnung bereits fest, dass das Geld aus dem Teilverkauf für Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen verwendet werden soll, so wird die daraus erwartete Wertsteigerung bei der Wertermittlung der Immobilie berücksichtigt. Teilverkäufer*innen oder ihre Erb*innen können den verkauften Anteil zum dann gültigen Marktwert jederzeit zurückerwerben, wenn dies gewünscht ist. Der Teilverkauf bietet sich besonders für Menschen ab 55 Jahren an. Bei jüngeren Hausbesitzer*innen ist die Laufzeit des Fruchtgenussrechts vorerst auf 20 Jahre begrenzt.
INSTITUTIONELLE
INVESTOR*INNEN ALS ZIELGRUPPE
Auch für institutionelle Investor*innen bietet der Immobilien-Teilverkauf eine attraktive Möglichkeit, in einen bislang wenig erschlossenen, stabilen und wachsenden Markt zu investieren. Das Ankaufspotenzial ist in Österreich hoch: Teilverkäufe ermöglichen eine Diversifizierung über verschiedene geografische Regionen und Objekttypen hinweg und bieten dabei Laufzeiten von sechs bis zehn Jahren, währenddessen die Zinsen in der Regel über denen von konventionellen Hypotheken liegen. Ein detailliertes Bewertungsverfahren minimiert das Risiko, indem sowohl die Lage als auch der Zustand der Immobilien genau geprüft werden. „Institutionelle Anleger*innen können von regelmäßi-
 Gerald Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers
Gerald Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers
LiquidHome
gen und sicheren Einkünften aus den Fruchtgenussgebühren profitieren und haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Anteile zu erwerben oder zu verkaufen“, so Gerald Beirer. Diese Flexibilität, kombiniert mit hoher Kapitalsicherheit, macht den Immobilien-Teilverkauf zu einer vielversprechenden Alternative für die Portfoliodiversifikation. Dieses Modell könnte besonders für Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds interessant sein, die nach langfristigen und stabilen Anlageoptionen suchen. Eine Wertsteigerung der Immobilie durch geplante Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen wird bereits bei der Wertermittlung berücksichtigt, was zusätzlich den Wert des investierten Kapitals steigert.
BEWEGGRÜNDE UND PERSPEKTIVEN
Der Immobilien-Teilverkauf revolutioniert die finanziellen Strategien zur Altersvorsorge, indem er sowohl Immobilieneigentümer*innen als auch institutionellen Investor*innen neue Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten bietet. Dieses Modell der Immobilienverrentung erfreut sich immer größerer Beliebtheit, wenngleich sich die Motive für einen Teilverkauf in den vergangenen Jahren geändert haben: „Lag vor ein paar Jahren das Hauptmotiv noch in
Der Immobilien-Teilverkauf revolutioniert die finanziellen Strategien zur Altersvorsorge.
der Erfüllung eines materiellen Wunsches oder Lebenstraums, besteht dieses heutzutage meistens in der Erhaltung des Lebensstandards bei Pensionseintritt“, sagt Beirer. Viele Menschen haben Angst, in ihrer Pension den bisherigen Lebensstandard nicht halten zu können. Für diese Personen kann ein Immobilien-Teilverkauf eine Option sein, das in der Immobilie vorhandene Kapital wieder verfügbar zu machen, ohne ihr Zuhause aufgeben zu müssen. Die wachsende Popularität des Modells spiegelt einen Wandel in der Wahrnehmung und Nutzung von Immobilien als Vermögenswerte wider. In der Zukunft könnte dieser Ansatz zu einer wesentlichen Säule der Altersvorsorge werden, insbesondere in einer Zeit, in der traditionelle Rentensysteme unter Druck stehen. PR
IMMOBILIEN -TEILVERKAUF
Der Teilverkauf verdeutlicht an einem konkreten Beispiel: Das Ehepaar Friedrich aus Klagenfurt am Wörthersee wollte sich den langersehnten Wunsch eines Campingwagens zum Reisen erfüllen. Dazu haben sie ihre Immobilie teilverkauft, um ihr festgesetztes Kapital freizusetzen. Die Immobilie wurde mit 790.000 Euro bewertet; sie haben diese zu 20 Prozent an Engel & Völkers LiquidHome veräußert. Damit betrug die Auszahlungssumme 158.000 Euro. Die Fruchtgenussgebühr, die das Ehepaar monatlich zahlt, beträgt 724 Euro.
ZEISLER GMBH
Kirchgasse 6, 6111 Volders +43 5224 56007, info@zeisler.at www.zeisler.at
99
ENGEL & VÖLKERS
MOBILITÄT

Outdoor-Spirit
„Noch mehr Dacia Duster.“ Nach diesem Motto fügt der rumänische Autobauer ein neues Kapitel zur Geschichte eines Modells hinzu, das sich zur Referenz in seinem Segment und zur echten Allrad-Ikone entwickelt hat. Der Duster verkörpert wie kein zweites Modell die Werte der Marke: Er steht für Robustheit und die Konzentration auf das Essentielle, ist dabei mittlerweile aber richtig cool und umweltfreundlich. Sein Debüt gab der Duster 2010, acht Jahre darauf folgte in Österreich die zweite Modellgeneration, nun kommt die dritte. Die neue SUV-Generation basiert auf der neuen CMF-B-Plattform, die generell eine zentrale Rolle in der Strategie von Dacia spielt und bereits im Sandero sowie im Jogger zum Einsatz kam. Der Duster bietet damit nochmals mehr Platz für Passagiere und Gepäck, wurde aber nur geringfügig länger. Außerdem werden Vibrationen und Fahrgeräusche reduziert und damit auch der Komfort um einiges erhöht. Optisch hat man dem Duster sein markantes Aussehen gelassen, hat jedoch an den Proportionen gefeilt, um das Design noch prägnanter und selbstbewusster zu machen. Wie das Exterieur ist auch der Innenraum davon geprägt, dass quasi sämtliche Details und Funktionen einen Zweck erfüllen. Firlefanz wird man im Dacia vergeblich suchen, braucht’s in Wahrheit aber auch nicht. In Sachen Umweltfreundlichkeit setzt man auf nachhaltige Materialien und Hybridantrieb. Und wer mit dem SUV tatsächlich mal ins Gelände will: In der 4x4-Version ist der Duster mit der neuen Terrain-Control und fünf Fahrmodi ausgestattet, damit man immer und üball gut vorankommt. Weiterhin fast konkurrenzlos bleibt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab einem Einstiegspreis von 20.990 Euro bekommt man bei Dacia ganz schön viel Auto.
100
auto & motor

SOMMERFRISCH
Mit mehr als sieben Millionen verkauften Einheiten ist der Octavia – mit Abstand – der Bestseller der Marke Škoda und gleichzeitig auch Österreichs meistverkauftes Auto. Die zwischenzeitlich vierte Modellgeneration kommt dabei deutlich aufgehübscht daher. Vor allem beim Karosseriedesign wurde ordentlich nachgeschärft und auch im Innenraum hat sich einiges getan. Aufgewertetes Infotainment trifft hier auf noch mehr nachhaltige Materialien. Wählen kann man aus insgesamt neun unterschiedlichen Designvarianten. Auch in Sachen Antrieb ist die Auswahl groß: Die Antriebspalette besteht aus zwei Diesel- und vier Benzinmotoren, zwei davon gerne mit optionaler Mild-Hybridunterstützung, mit einer Leistung zwischen 115 und 265 PS. Der Octavia steht weiterhin als Fließhecklimousine oder Kombi bereit. Die Preise starten bei 33.390 Euro.

EDEL UND STARK
Der neue Renault Rafale E-Tech 4x4 300 kommt als edle Topversion mit noch mehr Leistung angerollt. Der Neue kombiniert als Plug-in-Hybrid einen Verbrennungsmotor und Elektrotechnologie zu einem hocheffizienten Antrieb, der im Alltag bis zu 100 Kilometer rein elektrische Reichweite ermöglicht. Damit liegt der Rafale perfekt im Trend der Zeit und ist mit einer kumulierten Reichweite von bis zu 1.000 Kilometer hocheffizient. Der Turbobenziner ist mit insgesamt drei Elektromotoren gekoppelt, was für eine Systemleistung von satten 300 PS sorgt. Die exklusive Gipfel-Blau-Karosseriefarbe, der freischwebende Heckspoiler, die 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und das speziell abgestimmte Fahrwerk kommen von Alpine Cars. Eingestiegen wird bei rund 45.000 Euro.

Ursula Muigg, Landesdirektorin des ÖAMTC Tirol
MEIN VERNETZTES AUTO –FLUCH ODER SEGEN?
Das Datensammeln macht auch vor unseren Autos nicht halt.
Für mich als Konsumentin bringt die Digitalisierung der Mobilität viele Vorteile – etwa automatische Unfallmeldung, Diebstahlschutz etc. Informationen über den Zustand des Fahrzeuges helfen bei der Wartung und der Diagnose, Sicherheitssysteme wie Airbags, ABS oder ESP werden automatisch auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert und ich kann mir Routen einfach in Echtzeit planen lassen, der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen werden berechnet, während ich mir meine Lieblingsmusik, die natürlich auch schon automatisch gespeichert ist, anhöre. Aber die gesammelten Daten könnten auch anderweitig verwendet werden: zum Beispiel automatisch generierte Strafzettel oder höhere Versicherungsprämien für unsichere Fahrer – technisch machbar ist fast alles.
Selbstverständlich sind alle Benefits, die die Mobilität sicherer machen, zu begrüßen. Eine perfekt geplante Urlaubsnavigation mit aktuellen Verkehrsdaten ist angenehm, ein Warnsystem, dass die Bremsbeläge zu tauschen sind oder der Reifendruck nachlässt, erspart mir Geld, Ärger oder womöglich Schlimmeres. Das Problem ist, dass es derzeit keine gesetzliche Regelung zur Datensammlung und -übermittlung in Autos gibt. Zugriff auf die Daten hat faktisch nur der Hersteller.
Doch für mich als Konsumentin ist es äußerst wichtig, dass die Entscheidung bei mir liegt, ob und welche Daten weitergegeben werden und welche nicht. Ich möchte selbst entscheiden können, welchen Pannendienst ich anrufe oder in welche Werkstätte mein Auto gebracht wird. Der Zugriff auf die Daten meines Autos muss transparent und von mir kontrollierbar sein. Ich möchte wissen, welche Daten mein Fahrzeug sammelt und auch wie und von wem sie verwendet werden.

DER ÖAMTC IST DER MEINUNG:
Die Daten aus dem Fahrzeug gehören dem Besitzer. Gemeinsam mit der FIA setzt sich der ÖAMTC mit der Kampagne „My Car My Data“ für klare Regeln zur Datenerfassung und -weitergabe aus dem Auto ein.
101 FOTOS (WENN NICHT ANDERS VERMERKT): HERSTELLER
eco. mmentar
© ANDREAS FRIEDLE

HAPPY GEBURTSTAG
Anlässlich des 25. Geburtstages des RS 4 bringt Audi eine beeindruckende Sonderedition auf den Markt.
TEXT: FELIX KASSEROLER


Als Hommage an den RS4* Sport, der zur ersten Modellgeneration der quattro GmbH (jetzt Audi Sport GmbH) gehörte, hat sich Audi beim Design sowie der Motorisierung des Audi RS 4 Avant edition 25 years besonders ins Zeug gelegt. Das Ergebnis: ein 346 kW (470 PS) starkes Sondermodell, bei dem zahlreiche Merkmale an das Ursprungsmodell erinnern – nicht zuletzt das knallige Imola-Gelb.
URSPRUNGS - RS
Als die B5-Generation des Audi RS4 Avant 1999 das Licht der Welt erblickte, waren Kritiker der zuvor veröffentlichten Avant RS2 und S6 plus – beide entstammten nicht der 1983 gegründeten quattro GmbH – erst einmal verstummt. Eine im Vergleich zum Audi S4 verbreiterte Karosserie und ein 2,7-LiterBiturbo-Sechszylinder, der in Kooperation mit Cosworth entwickelt wurde und eine Systemleistung von 280 kW (380 PS) generierte, ließen wortwörtlich keinen Stein auf dem anderen. Den Höhepunkt erreichte die B5-Generation mit der Markteinführung des RS4 Sport im Jahr 2001. Neben einer tiefergelegten Aufhängung, Schalensitzen und einem Sportauspuff war auch ein Lederlenkrad im Wagen mit verbaut.
Mit der neuen Sonderedition möchte
Audi seinen Anfängen im Sportsegment gedenken und nebenbei noch eine Schippe obendrauf legen.
POWERUPGRADE
Mit der neuen Sonderedition möchte Audi seinen Anfängen im Sportsegment gedenken und nebenbei noch eine Schippe obendrauf legen. So zeigen die technischen Daten des V6-Biturbo eine im Vergleich zum RS 4 Avant um 15 kW (20 PS) erhöhte Leistung, nämlich insgesamt 346 kW (470 PS), und ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern. Ebenso verbessert wurde die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h mit 3,7 statt 4,1 Sekunden. Gleichbleibend
AUDI RS 4 AVANT
EDITION 25 YEARS
Antrieb: Allrad
Leistung: 346 kW/470 PS
Drehmoment: 600 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 3,7 sec
Spitze: 300 km/h
Preis: ab 142.905 Euro
sind – abgesehen vom Topspeed von 300 km/h – die Keramikbremsen und die Aufhängung, wobei letztere das Fahrzeug im Vergleich zum Standard-RS 4 um insgesamt 20 Millimeter absenken kann.
Für optimale Agilität und Rücklage sorgt das Quattro-Sportdifferential, im Besonderen im „Dynamic“-Modus. Ausschließlich für den RS 4 Avant edition 25 years wurde der negative Sturz an der Vorderachse um zwei Grad angehoben und zugleich steifere Querlenker eingebaut. Fazit: erhöhter Halt und besseres Handling vor allem bei rasanten Kurven. In Kombination mit den beiden enthaltenen Reifensets (Pirelli P Zero Corsa high-performance und die sensorisch erfassten Pirelli Zero Trofeo RS semi-slick mit Pirelli-Track-Adrenaline-System) sind sowohl Fahrten auf offener Straße als auch auf Rennstrecken kein Problem für das Traktionsmonster. Insbesondere das zweite Set trägt durch modernste Sensoren, die Daten
eco. mobil 104
unmittelbar auf eine App übersenden, dazu bei, das Beste aus den Reifen zu holen und sie entsprechend auf Temperatur zu bringen.
EINE HOMMAGE AN DEN RS4 SPORT
In Sachen Design erinnern zahlreiche Merkmale an den RS4 Sport von 2001. Sowohl die Außenfarbe – neben Imola-Gelb sind auch Nardo-Grau und Mythos-Schwarz erhältlich –, das Interieur mit den gelben Ziernähten als auch das optionale, exklusive, unten abgeflachte Lederlenkrad, ebenfalls mit gelben Ziernähten, könnten so auch in der B5-Generation verbaut worden sein. Passend zur Empfehlung von Audi gibt es mit dem Kauf auch ein paar Handschuhe von Alpinestars für die Rennstrecke. Erstmals enthalten die Rücklichter eine schwarze Einlage, um im Einklang mit den in schwarz glänzenden Audi-Schriftzügen für noch mehr Kontrast zu sorgen. Für eine sportlichere Silhouette wurde die Dachreling entfernt. Sollte die Sonderedition dann immer noch nicht als solche erkannt werden können, ändert sich das spätestens nach einem Blick auf die hinteren Seitenfenster mit ihrer Gravur„RS 4 edition 25 years“. Dasselbe spielt sich übrigens leicht abgewandelt im Inneren ab: Jedes Auto erhält auf der Mittelkonsole in matt die fortlaufende Autonummer von 1 bis 250. Als kleines Feature bietet Audi im Übrigen auch – ebenfalls auf 250 Stück limitiert – die Chronograph RS 4 Avant edition 25 years Armbanduhr an. Das Design passt quasi selbstredend perfekt zum Auto!
LIMITIERTER RS 5 SPORTBACK
PERFORMANCE EDITION
Neben dem RS 4 erhält auch der RS 5 sein Sondermodell. Unter der Bezeichnung RS 5 Sportback Performance edition kommt der bis dato stärkste RS 5 im Juni 2024 auf den Markt –ebenfalls auf 250 Stück limitiert. Angetrieben wird das Sondermodell wie der RS 4 Avant edition 25 years vom V6-Biturbo mit 346 kW (470 PS) mit dem ebenfalls identischen, maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 3,7 Sekunden und ist damit um 0,2 Sekunden schneller als der RS 5 Sportback. Schluss ist auch hier erst bei 300 km/h. Serienmäßig kommt der Sportwagen mit der RS-Sportaufhängung pro. Beide Modelle können ab Juni 2024 bestellt werden. Die Preise für den RS 4 Avant edition 25 years beginnen in Deutschland bei 142.905 Euro, jene für den RS 5 Sportback performance edition bei 128.420 Euro.



* Falls sich (wirklich sehr) aufmerksame Leser*innen über die unterschiedliche Schreibweise wundern sollten: Die Leerstelle zwischen RS und 4 kam erst mit späteren Modellgenerationen hinzu.

eco. mobil 105

eco. mobil 106

BRACHIALPOWER
Als SUV-Coupé der Extraklasse präsentiert sich der neue Smart #3 überaus dynamisch und sportlich. Insbesondere die Topvariante – der #3 BRABUS –lässt zumindest aus technischer Hinsicht keine Wünsche offen.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
107
Ein Antriebsstrang mit ausgeprägter Leistungsausbeute, eine umfassende Ausstattungsliste und hochwertige Verarbeitung in Kombination mit einem angemessenen Preis machen aus dem #3 BRABUS ein einwandfreies Auto, das noch dazu richtig Laune bringt. Wir durften das neue Modell kürzlich testen.
KRAFTVOLLER ANTRIEBSSTRANG
Wie schon beim Smart #1 BRABUS bildet auch im Fall des SUV-Coupés ein Doppelektromotorengespann mit einer Systemleistung von 315 kW (428 PS) und einem maximalen Drehmoment von 543 Newtonmeter den kraftvollen Antrieb. Ordentlich Power für das 4,4 Meter lange und knapp über 1,9 Tonnen schwere, in China produzierte Elektroauto. Korrespondierend damit fällt auch die Beschleunigung aus, vergehen beim Sprint von 0 auf 100 km/h doch gerade einmal 3,7 Sekunden (beim Smart #1 BRABUS sind es 3,9 Sekunden). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. In der BRABUS-Ausstattungsvariante kommt der #3 ausschließlich mit der größeren 66-kWh-Batterie, die bei einem Durchschnittsverbrauch von 17,6 kWh pro 100 Kilometer eine Reichweite von bis zu 415 Kilometern nach WLTP ermöglichen soll. Realistisch dürfte es der allradgetriebene #3 BRABUS auf rund 350 Kilometer schaffen. Das ist nicht zuletzt der modellspezifisch veranlagten sportlichen Fahrweise geschuldet. Erfreulich zeigt sich die Ladeleistung: An der Schnellladesäule lädt die Batterie dank der maximalen Ladeleistung von 150 kW von zehn auf 80 Prozent in weniger als 30 Minuten, an der herkömmlichen Wallbox dauert derselbe Ladevorgang mit 22 kW rund drei Stunden.
EBEN DOCH EIN SUV - COUPÉ
Die Karosserieform orientiert sich am letzten Schrei im Automobilsektor: dem SUVCoupé. Auch wenn die Abmessungen (4.400 x 2.045 x 1.556 mm) augenscheinlich nicht jenen eines SUV entsprechen und im Übrigen in Sachen Länge den Smart #1 BRABUS um nur zehn Zentimeter überbieten, hat der Smart #3 doch einiges an Platz mit dabei. So fasst das Ladeabteil immerhin 370 Liter, wobei ein variabler Ladeboden auch den

Transport größerer Gegenstände ermöglicht. Zum Verstauen des Ladekabels bietet der #3 einen Frunk mit einem Volumen von 15 Litern.
Im Fond gestaltet sich die Angelegenheit hingegen etwas komprimierter. Haupt(ur)sächlich die für SUV-Coupés typische, schräg nach hinten abfallende Dachlinie sorgt nämlich dafür, dass der Komfort etwas leidet. Denn um die Kopffreiheit möglichst hoch zu halten, wurde die Rückbank entsprechend zur Dachlinie schräg nach hinten abfallend positioniert und führt damit zwangsläufig zu einer bei langen Fahrten eher ungemütlicheren Sitzposition.
CLEANES INTERIEUR
In der ersten Reihe indes bieten sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrersitz mehr als ausreichend Komfort und schauen dabei mit dem Mikrofaserüberzug in Wildlederoptik und den roten Ziernähten auch richtig schick und sportlich aus. Technisches Highlight ist neben der 9,2-Zoll-HD-Instrumentenanzeige und dem zehn Zoll großen Head-up-Display das 12,8 Zoll große Zentraldisplay, über das sämtliche Funktionen intuitiv gesteuert werden können. Bis auf einige wenige Tasten erfolgt die Bedienung größtenteils über das Display. Die großzügig ausgeformte Mittelkonsole dient daher fast ausschließlich als Platzablage und induktive Ladestation für das Smartphone, das via Apple CarPlay oder Android Auto mit dem #3 verbunden werden und über das Beats-Soundsystem bestens Musik wiedergeben kann. Vom Cockpit des
Auch wenn der Verbrauch nach oben schießt, lädt insbesondere eine auf Grün schaltende Ampel zum Auskosten der immensen Beschleunigung ein.
SMART #3 BRABUS
Antrieb: Allrad
Leistung: 315 kW/428 PS
Drehmoment: 543 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 3,7 sec
Spitze: 180 km/h
Ladezeit: 30 Min. (10–80 %)
Spaßfaktor: 9,5 von 10
Preis: ab 52.200 Euro
Smart #1 BRABUS unterscheidet sich das Cockpit des #3 BRABUS optisch übrigens im Wesentlichen nur durch die runden Lüftungsdüsen. Hinsichtlich der Designsprache wurde besonders auf schneidige Kurven mit einem entsprechenden Wiedererkennungswert gesetzt, um bestmögliche Aerodynamik zu erzielen. Zeuge sachgemäßer Umsetzung ist der cW-Wert von 0,27. Für das entsprechend sportliche Design sorgen neben BRABUS-Schriftzügen die roten Bremssättel hinter den 20-Zoll-Leichtmetallrädern. Frontseitig erhält der #3 BRABUS CyberSparks-LED+ Matrixscheinwerfer mit durchgehendem Lichtband, das Heck wird von LED-Rückleuchten erleuchtet. Wie die Leistungsdaten vermuten lassen, fährt sich das von einem Joint Venture zwischen der Mercedes-Benz-Gruppe und der Geely Holding entwickelte SUV-Coupé mehr als sportlich. Auch wenn der Verbrauch damit einhergehend entsprechend rasant nach oben schießt, lädt insbesondere eine auf Grün schaltende Ampel zum Auskosten der immensen Beschleunigung ein. Daneben wird jeder Überholvorgang zum Klacks. Doch selbst gemütliches Cruisen ist vor allen Dingen im ECO-Modus ein Genuss und kommt damit nicht nur einer verlängerten Reichweite zugute. Nicht zuletzt der Startpreis von 52.200 Euro macht den Smart #3 BRABUS also zu einer ernst zu nehmenden Alternative.
eco. mobil 108
Fixer Sollzinssatz 3,99 %
Bis zu € 9.150,sparen!



Anders als die anderen.

Der Hyundai TUCSON Diesel & Plug-In.
UNTERBERGER EDITION – Limitierte Auflage.
Meistverkauft, prompt verfügbar und perfekt ausgestattet. Der TUCSON ist nicht ohne Grund das begehrteste Hyundai Modell in Österreich. Zukunftsweisendes Auftreten, visionäre Technik gepaart mit erstklassiger Ausstattung wie z.B. Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe. Bleibt nur die Frage nach dem persönlichen Favoriten?
TUCSON Diesel, Trend Line Plus 48V 4WD, 7DCT um € 39.990,-* inkl. Metalliclackierung oder um € 397,- monatlich
Gleich informieren und testen: hyundai.at



TUCSON Plug-In, Prestige Line 4WD, 7DCT um € 47.490,-* inkl. Metalliclackierung oder um € 471,- monatlich













Autowelt Innsbruck
Denzel-Unterberger
Griesauweg 28
6020 Innsbruck
T.: +43 512 33 23-0
E.: info@denzel-unterberger.cc
unterberger.cc
Autowelt Strass
Bundesstraße 109
6261 Strass im Zillertal T.: +43 5244 6100-0
E.: info.strass@unterberger.cc
Autowelt Kufstein
Haspingerstraße 12 6330 Kufstein
T: +43 5372 61060-0
E: autohaus@unterberger.cc
Unterberger Telfs
Wildauweg 1 6410 Telfs
T.: +43 5262 66766-0
E.: info.telfs@unterberger.cc
Plug-In, 4WD (T1PP0): Aktionen/Preise beinhalten bis zu € 8.650,- Hyundai GO! Bonus bestehend aus bis zu € 8.150,- Hyundai-Bonus und € 500,- Versicherungsbonus. Repräsentatives Beispiel für eine Leasingfinanzierung der Denzel Leasing GmbH: TUCSON Diesel Trend Line (T1DR0): Kaufpreis (Barzahlungspreis inkl. NoVA, MwSt und aller jeweils gültigen Boni): € 40.490,-, Anzahlung: € 12.147,-, Restwert: € 21.254,23, Bonitätsprüfungsgebühr: € 99,-, Laufzeit: 36 Monate, monatliche Rate: € 279,-, Sollzinssatz: 3,99 % p.a. fix, effektiver Jahreszins: 4,58 % p.a., Rechtsgeschäftsgebühr: € 245,19, Gesamtleasingbetrag: € 28.343,-, Gesamtbetrag: € 43.789,42. Versicherungsbonus gültig bei Abschluss eines Hyundai-Versicherungs-Vorteilsets über GARANTA Versicherung-AG Österreich, bestehend aus KFZ-Haftpflicht-, Kasko- und Insassenunfallversicherung, Mindestlaufzeit 36 Monate. Aktionen/Preise gültig für Kaufverträge mit Zulassung vom 29.04. bis 29.06.2024 (bis auf Widerruf) solange der Vorrat reicht, bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. TUCSON Diesel: CO2: 149 - 158 g/km, Verbrauch: 5,7 - 6,0 l/100 km. TUCSON PlugIn: CO2 gewichtet: 32 g/km, Verbrauch (gewichtet): 1,4 l/100 km, Stromverbrauch: 17,7 kWh / 100 km, elektrische Reichweite: bis zu 62 km. Alle Werte nach WLTP. Die Reichweiten und Verbräuche können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren. Ladeleistungen sind unter optimalen
deutlich variieren. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolabbildungen.
Hyundai Flatrate
* 1.6 CRDi, 4WD (T1DR0), 1.6 T-GDI
Bedingungen erreichbar und können durch Witterungseinflüsse

110
SPORTLICH UND SCHICK
Mit dem Seal, einer 4,8 Meter langen Sportlimousine, ist das nächste Modell der chinesischen Marke BYD vereinzelt bereits auf den heimischen Straßen zu sehen. Im Besonderen wirbt die Marke mit Hightech-E-Mobilität zu Preisen von vergleichbaren Verbrennermodellen. Ein Test.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Mit knapp über 1.000 Neuzulassungen in Österreich legte der chinesische Automobilhersteller BYD („Build Your Dreams“) respektive der hiesige Importeur – CCI Car Austria GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Wolfgang Denzel AG – im ersten vollen Verkaufsjahr 2023 einen absoluten Traumstart hin – und das, obwohl bis Oktober 2023 mit dem Atto 3 nur ein Fahrzeugmodell ausgeliefert wurde. Erst im November folgten die ersten Dolphin-Modelle, kürzlich legte man mit dem Seal nach.
ÜBERRAGENDE LEISTUNGSWERTE
Die Preise ab 42.980 Euro für den Hecktriebler und ab 45.980 Euro für den allradgetriebenen Seal (beide Preise beinhalten sämtliche in Österreich angebotenen Förderungen) sind angesichts der eindrucksvollen technischen Daten auf den ersten Blick durchaus beeindruckend. So kommt letztere von uns getestete Variante mit einer Systemleistung von sportlichen 390 kW (530 PS) und einem maximalen Drehmoment von stolzen 670 Newtonmeter daher. Entsprechend rasant präsentiert sich die Beschleunigungszeit. Gerade einmal 3,8 Sekunden vergehen beim Sprint von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Diese Werte können mit einem Verbrenner nicht nur mithalten, sondern lassen auch den ein oder anderen Sportwagen links liegen. Interessant wird es bei einem Elektroauto vor allem bei den BEV-spezifischen technischen Daten. Und auch hier bietet der Seal absolute Topwerte. Angefangen bei der Kapazität des Blade-Akkus auf Lithium-Eisen-Phosphat-Basis von 82,5 kWh über die maximale Reichweite von bis zu 520 Kilo-
metern nach WLTP bis hin zur Schnellladeleistung von 150 kW. Die sorgt im Übrigen für eine Ladezeit von 37 Minuten von zehn auf 80 Prozent und fällt damit nur minimal länger als bei vergleichbaren Modellen aus.
FOKUS AUF AERODYNAMIK
Das Designkonzept „Ocean Aesthetics“ hält was es verspricht – eine stromlinienförmige Karosserie sorgt für einen geringeren Luftwiderstand und führt zu einer besseren Beschleunigung und gleichzeitig einem niedrigeren Verbrauch. Dieser Drang nach der besten Aerodynamik wird im Übrigen auch durch die elektrisch einklappenden Türgriffe untermalt. Dazu erhält der Seal serienmäßig LED-Scheinwerfer samt Tagfahrlicht vorne und LED-Leuchten hinten. Als Zuckerl gibt es obendrauf dynamische Blinker, eine elektrische Heckklappe und nicht zuletzt 19-Zoll-Bicolor-Alufelgen, damit sich der Seal auch ordentlich und eindrucksvoll präsentieren kann.
Im Innenraum fällt der 15,6 Zoll elektrisch drehbare Touchscreen, wie es ihn auch im Dolphin gibt, direkt ins Auge. Einziges Manko: Auch wenn die Bedienung desselben intuitiv verläuft, verstecken sich vereinzelte Funktionen in diversen Untermenüs. Das kann insbesondere beim Fahren ablenken. Daneben findet sich hinter dem Leder-Multifunktionslenkrad ein weiteres 10,25 Zoll großes Informationsdisplay. Für entsprechenden Komfort sorgen Ledersitze mit ausgezeichnetem Halt, zwei Mittelkonsolen (vorne und hinten) und nicht zuletzt zwei induktive Ladestationen. Darüber hinaus bietet die vordere Sitzreihe neben Sitzheizung auch eine Sitzkühlung und integrierte Kopfstützen mit verstellbarer Lendenwirbelstüt-
ze. Für eine korrespondierende Atmosphäre sorgen eine mehrfarbige Ambientebeleuchtung sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern.
Besonderes Highlight: Das lang nach hinten ausgeformte Panoramaglasdach verleiht dem Seal ein coupéartiges Design, ohne dem Fond allzu viel Platz zu nehmen. Einzig der Kofferraum fällt mit 400 Litern und einer schmalen Ladeöffnung etwas beengt aus, doch dieser Kritikpunkt wird zumindest in Sachen Volumen durch den Frunk mit 53 Litern deutlich ausgebügelt, kann man in diesem doch zum Beispiel die Ladekabel unterbringen.
RESULTAT
Unterm Strich fällt das Fazit für die schicke Sportlimousine ausgezeichnet aus. Die enorme Power, die stetig zur Verfügung steht, verleitet zu sportlicheren Ausfahrten. Die entsprechenden Fahrmodi in Kombination mit dem einwandfreien Fahrwerk sorgen für die notwendige Traktion, um auch im österreichischen Winter nicht klein beigeben zu müssen. Einzig die technischen Fahrsicherheits- und Assistenzsysteme sowie andere Bereiche der Bordelektronik (beispielsweise Batterie-Ladelogistik) meinen es manchmal etwas zu gut, insbesondere die Verkehrszeichenerkennung hat deutlich Verbesserungsbedarf. Nichtsdestotrotz hat uns der BYD Seal definitiv überzeugt. Für ein gegenteiliges Urteil ist das Preis-Leistungs-Verhältnis eindeutig zu gut.

BYD SEAL AWD
Antrieb: Allrad
Leistung: 390 kW/530 PS
Drehmoment: 670 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 3,8 sec
Spitze: 180 km/h
Reichweite: 520 km (lt. WLTP)
Ladezeit: 37 Min. (10–80 %)
Spaßfaktor: 9 von 10
Preis: ab 45.980 Euro
eco. mobil 111

„DIE BESTE GS ALLER ZEITEN“
Die BMW GS 1300 überrascht mit einem völlig neuen, sportlichen Charakter und homogenem Design. Der legendäre Boxer sorgt einmal mehr für Kraft ohne Ende.
TEXT: KLAUS SCHEBESTA // FOTOS: TOM BAUSE
112
s gibt wenige Fahrzeuge, die es geschafft haben, mit einem Kürzel für das Ganze zu stehen. 911 ist beispielsweise ein solches. Es steht für den legendären 911er von Porsche, den Inbegriff eines hochwertigen Sportwagens. Bei den ambitionierten Alltagsautos war über viele Jahre das Kürzel GTI das Synonym für leistbare Sportlichkeit. Jeder wusste, dass es ein Golf ist und dass der wiederum von VW kommt. Bei den Motorrädern ist es so mit der GS. Der stolze GS-Fahrer antwortet auf die Frage, was er denn fahre, schlicht und einfach: eine GS. Dass diese das beste Pferd im Stall von BMW Motorrad ist, weiß ohnehin jeder, der diese Frage stellt.
DIE NEUE GS IST DA
Und nun wurde dieses Pferd neu aufgezäumt. Es galoppierte seit mehr als vier Jahrzehnten über Alpenpässe und wurde schon mehrfach für tot erklärt, vor allem wegen des Boxermotors, der bereits vor zwanzig Jahren für viele als „ausentwickelt“ galt. Dass dem ganz und gar nicht so ist, bewies schon die wassergekühlte GS 1200 vor zwölf Jahren und jetzt erst recht wieder die 1300er. Diese ist, bis auf einige belanglose Schrauben, komplett neu entwickelt worden. Herausgekommen ist einmal mehr „die beste GS aller Zeiten“, die sich tatsächlich in vielen Bereichen von der letzten „besten GS aller Zeiten“, der GS 1250, markant unterscheidet. Was hat sich geändert? Eigentlich alles. Während der kernige Charakter der 1250er schon an ihren Ecken und Kanten sichtbar war, kommt die Neue faltenfrei und höchst gefällig daher. Sie ist optisch „kleiner“, baut speziell vorne nicht mehr so wuchtig wie die Vorgängerin. Das fällt sofort beim Aufsitzen auf. Während die 1250 das Gefühl vermittelte, von der Kommandobrücke eines Flugzeugträgers aus zu operieren, kommt die Neue geradezu durchtrainiert und ungemein sportlich daher. Das mag vielleicht nicht jeder, aber jeder, der das mag, wird die Neue besser finden als die Alte. Der Gitterrohrrahmen ist ebenfalls Vergangenheit und wurde durch einen Blechschalen-Hauptrahmen und einem Heckrahmen aus Aluminium-Druckguss ersetzt. Das Getriebe sitzt
Die 1300er GS fährt genau so, wie sie aussieht: leicht, unkompliziert und unglaublich schnell.

Die neue GS pickt mit gnadenloser Stabilität in jeder Kurve, ohne jemals mit der Wimper zu zucken.
Antrieb: Zweizylinder Boxer
Leistung: 107 kW/145 PS
Drehmoment: 149 Nm bei 6.500 U/min
Spitze: 225 km/h
Sitzhöhe: 850 mm
Gewicht fahrbereit: 237 kg
Federwege: 190/200 mm
Preis: ab 21.990 Euro
nun unter dem Motor. Dass jede Menge modernste Elektronik mit an Bord ist, versteht sich von selbst.
Und wie fährt die Neue? Kurz gesagt: genau so, wie sie aussieht. Leicht, unkompliziert und unglaublich schnell. Auch der Sound passt zum Gesamtbild, die 1300er klingt aufgrund der strengen Abgasvorschriften verhaltener und schlanker als früher. Sie ist, natürlich, nach wie vor souverän, aber eben „anders“. Während die 1250er der „flie-
gende Teppich“ war, der alles Ungemach des Straßenbelags wegbügelte, ist die Neue wesentlich knackiger, sportlicher, direkter. Das betrifft auch das Vorderrad, das nun mit einer neuen Aufhängung mehr Rückmeldung von der Straße bringt. Alles in allem ist die GS 1300 in der Sitzposition und im Fahrverhalten der im Vorjahr getesteten R 1250 R näher als der bisherigen GS 1250. Das gilt auch für den Schaltassistenten, der spürbar präziser zu Werke geht. Die neue GS pickt mit gnadenloser Stabilität in jeder Kurve, ohne jemals mit der Wimper zu zucken. Und der Motor packt zu, als gäb’s kein morgen. In höheren Drehzahlen legt das Aggregat nochmals eine Schaufel nach, sodass man kaum mit dem Schalten nachkommt. Damit bleibt unter dem Strich einmal mehr: Ja, die neue GS ist – zwar ganz anders als alle anderen davor – wohl wieder einmal die beste GS aller Zeiten. Sie wirkt zwar nicht mehr so mächtig, ist dafür aber stabiler, präziser und sportlicher denn je.
eco. mobil 113
BMW GS 1300
Uta Kögelsberger lebt in London und Kalifornien und ist Professorin für Bildende Kunst an der Newcastle University, England. Sie ist Trägerin des renommierten Royal Academy Wollaston Awards.

Fotografie im Fokus
INN SITU ist ein Programm für Fotografie, Konzerte und öffentliche Dialoge im BTV Stadtforum in Innsbruck. (Internationale) Künstler sind dabei eingeladen, neue Arbeiten zu entwickeln, die vor Ort in der Region entstehen. Aktuell präsentiert Uta Kögelsberger noch bis bis 20. Juli ihre Ausstellung „Forest Complex“, in der sie sich mit der Schutzfunktion des Waldes sowie den sozialen und politischen Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzt. Kögelsberger erkundet mit den Medien Fotografie und Video sowie einer Soundinstallation den kontinuierlichen Zyklus von Versuchen, unsere Wälder zu schützen, während wir gleichzeitig unerbittlich zu ihrer Zerstörung beitragen. www.innsitu.at
ZUSATZTIPP: GLÜCKSKEKS - IMPROVISATION
Von 26. bis 28. Juni 2024 findet wieder die kleine, feine Konzertreihe toninton in der Ton Halle des BTV Stadtforums statt – heuer unter dem Titel „Glückskeks-Improvisation“, bei der an drei Abenden Glücksexpert*innen, Cello, Kontrabass und Klavier zum Thema Glücklichsein, Lebenskunst und Musik zusammenspielen. Für detaillierte Infos und Tickets scannen Sie einfach den QR-Code.

MIT HAUT UND HAAR
Unseren Haaren schenken wir mit Shampoos, Spülungen und Kuren jede Menge Aufmerksamkeit. Aber wie stehtʼs um unsere Kopfhaut? Lush hat dafür eine Drei-Schritte-Routine entwickelt und hebt damit Scalp Care auf ein neues Level. www.lush.com
OLÉ
Verdejo 2023 von der Bodegas Onerom ist ein junger und kräftiger Wein, personifiziert in einer Flasche. Er überrascht mit seiner Frische, begeistert mit lebendiger Säure und bezaubert mit komplexen Aromen von Zitrusfrüchten, exotischen Kräutern sowie einem Hauch von mineralischer Eleganz und passt hervorragend zu Lachs, Meeresfrüchten, Artischocken oder Feta. Entdeckt in der Weinhandlung Gottardi in Innsbruck um 9,50 Euro. www.gottardi.at


GUT FÜRS HIRN
Zink ist ein essenzielles Spurenelement und trägt zum optimalen Ablauf unterschiedlicher Stoffwechselprozesse bei. Außerdem unterstützt es kognitive Funktionen unseres Gehirns. Die Expert*innen des Health Performance Institute in Innsbruck haben dazu ein passendes Nahrungsergänzungsmittel kreiert.
114 kultur
& trends LIFESTYLE
© BTV / ANDREAS MOSER
TIPPS DER REDAKTION

DIE NATUR ALS LEHRMEISTERIN
Die Künstlerin und Kuratorin der Galerie Nothburga Elisabeth Melkonyan war vergangenes Jahr als „artist in residence“ einige Wochen in Südkorea, lernte dort über die Kunstakademie diverse Künstler*innen sowie Direktorin Lee Seguimi kennen und bot ihnen in Innsbruck eine Ausstellungsmöglichkeit. Im Juli ist es so weit. Unter dem Titel „Poesie der Natur” ist die Sommerausstellung der Galerie Nothburga vom 3. bis 13. Juli 2024 zu sehen. Sie fokussiert die Balance zwischen Natur und menschlicher Empfindung und gibt Einblick in die typischen Merkmale der koreanischen Kunst. Jeong So-Young, Park Tae-Jun und Woo Yong-Min werden direkt vor Ort zeichnen und stellen auch Arbeiten aus, die in Innsbruck und Umgebung entstehen. Ergänzt wird die Ausstellung um Arbeiten von Hyekyung Ahn und Kim Eun-Sook.

Esther Strauß ist Hauptpreisträgerin 2024 des RLB Kunstpreises
JUNGE KUNST
Vor 20 Jahren wurde der RLB Kunstpreis mit einer Gesamtdotierung von 18.000 Euro zum ersten Mal verliehen. Er richtet sich an alle im Bundesland Tirol geborenen oder lebenden Künstler*innen bis zum 40. Lebensjahr und wird alle zwei Jahre ausgeschrieben. Entsprechend wurde er heuer zum elften Mal verliehen, der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Performance- und Sprachkünstlerin Esther Strauß. Die zwei Förderpreise mit je 4.000 Euro wurden an Fabian Lanzmaier und Stephanie Stern verliehen. Seit 2006 ist mit dem Hauptpreis auch eine Einzelausstellung in Kooperation mit den Tiroler Landesmuseen in Innsbruck verbunden.
IN BESTEN HÄNDEN
In der medalp werden medizinische Dienstleistungen auf höchstem Niveau an fünf Standorten in Tirol erbracht.
Ob Skilauf, Eissport, Rodeln oder Winterwandern: Auch in der kalten Jahreszeit sind Freizeit- und Pro�isportler*innen gerne in der Tiroler Natur unterwegs. Wie bei allen sportlichen Betätigungen ist der gesundheitliche Nutzen groß. Dennoch kann es auch zu unerwarteten Verletzungen kommen, hauptsächlich im Bewegungsapparat. Knie- und Schulterverletzungen führen die Liste der Sportunfälle an.
ZUR MEDALP BEI VERLETZUNGEN UND SCHMERZEN.
Wenn es zu einem Unfall kommt, ist es besonders wichtig, dass die Versorgungskette lückenlos funktioniert und dass es vor allem schnell geht, bis die Diagnose gestellt und die Behandlung begonnen werden kann. Beginnend bei den Erstretter*innen über die Allgemeinmediziner*innen vor Ort bis zu den medizinischen Fachleuten der medalp arbeiten alle Beteiligten lückenlos Hand in Hand. Bei schwerwiegenden Verletzungen kommt der Helikopter zum Einsatz und Notärzt*innen entscheiden vor Ort rasch und kompetent über die weiteren Schritte. Durch eine schnelle Abklärung mittels klinischer Untersuchung, Bildgebung und MRT direkt in der medalp wird sofort Klarheit über das Ausmaß der Verletzung geschaffen und die Behandlungsoptionen können umfassend mit den Patient*innen besprochen werden. Sollte ein chirurgischer Eingriff notwendig sein, kann dieser zeitnah und, wo immer möglich, minimalinvasiv durchgeführt werden. Damit werden Heilungsprozess und Rehabilitation gefördert.
VON DER DIAGNOSE ZUR REHA LÜCKENLOSES PATIENTENERLEBNIS.
In vielen Fällen wird nach dem Eingriff ergänzend eine physiotherapeutische Behandlung empfohlen. In den medalp-Einrichtungen stehen hierfür mit den behandelnden Ärzt*innen bestens vernetzte Therapeut*innen zur Verfügung, die den Patient*innen ein individuell abgestimmtes Therapieprogramm anbieten. Dadurch lässt sich die Zeit von der Verletzung bis zur Wiederherstellung oft entscheidend verkürzen.
115
���.������.��
MEDALP
Woo Yong-Min, traditionelle Sumuk-Malerei
© RLB TIROL / GÜNTHER KRESSER

KULTURGENUSS UNTER FREIEM HIMMEL
Wenn Kammersängerin Elīna Garanča am 6. Juli ihr Konzert „Klassik in den Alpen“ gibt, spielt neben der Musik – heuer eine Hommage an Maria Callas – auch die besondere Location eine maßgebliche Rolle. Die Bergkulisse Kitzbühels bietet eine Konzertatmosphäre, die alle Sinne anspricht. Auftreten wird Garanča gemeinsam mit der spanischen Sopranistin Serena Sáenz und dem jungen Tenor Iván Ayón. Für das Programm zeichnet auch heuer wieder Maestro Karel Mark Chichon als künstlerischer Leiter verantwortlich. www.klassikindenalpen.at
SÄTZE, DIE DAS LEBEN LEICHTER MACHEN: *) Dann nehme ich es lieber leicht.

Ab dem 1. September 2024 übernimmt Jonas Kaufmann, einer der weltweit erfolgreichsten Klassikkünstler unserer Zeit, die Intendanz der Tiroler Festspiele Erl.
KOMPLETTPROGRAMM
Ende April stellte Jonas Kaufmann, ab Herbst neuer Intendant der Tiroler Festspiele Erl, das Programm für seine erste Saison vor – eine Neuheit in Erl, wurde doch bisher das Sommer- und Winterprogramm separat angekündigt. Kaufmann ermöglicht seinem Publikum damit, langfristig zu planen und die vier Saisonen (Erntedank, Winter, Ostern und Sommer) als ein großes Ganzes wahrzunehmen. In Fortschreibung der Gründungsidee wird auch in Zukunft die Musik in ihrer ganzen Vielfalt abgebildet, von Kammermusik bis Oper, von der Klassik bis zur Volksmusik, von Barock bis zu Zeitgenössischem. In seiner ersten Saison in Erl steht Jonas Kaufmann dabei „nur“ das Festspielhaus als Veranstaltungsort zur Verfügung, denn das Passionsspielhaus, sonst Ort der großen Wagner-Aufführungen, wird 2025 von den Passionsspielen selbst genutzt. Nun wird also das 2012 eröffnete Festspielhaus mit dem Ziel bespielt, den Festspielen einen festen und sichtbaren Platz im internationalen Spielgeschehen zu verschaffen.Einzelkarten für die unterschiedlichen Aufführungen sind ab 17. Juni erhältlich. www.tiroler-festspiele.at
FÜRS FREIE
Seit ein Colmar-Flagshipstore in die Innsbrucker RathausGalerien eingezogen ist, wissen wir ohne zu zögern, wo wir stylische Sportswear herbekommen. www.colmar.com

Unkomplizierte Bikerjacke aus Stretch-Softshell, 215 Euro

Leichte Damenjacke aus PolyesterTaft, 275 Euro

Herren-Steppweste mit SoftshellEinsätzen, 179 Euro

Wasserdichte HerrenSoftshelljacke, 225 Euro
eco. life 116
WANDER GARDE ROBE
*) Mehr davon? „50 Sätze, die das Leben leichter machen“, Karin Kuschik, rowohlt Verlag, 320 Seiten, EUR 15,–
© RINGLER




GANZ NAH DRAN AM GENUSS
Knackiges Gemüse, fangfrischer Fisch, Fleisch in bester Qualität garniert mit schmackhaften Raritäten: Eine wertvolle Möglichkeit, Leib und Seele mit ehrlichen Produkten Gutes zu tun, bietet die Bauernkiste. Wöchentlich werden Haushalte im Großraum Innsbruck und dem Tiroler Oberland mit den Erzeugnissen von rund 60 Bäuerinnen und Bauern versorgt. Immer wieder locken saisonale „Specials“ wie das aktuelle Grillangebot zum Verkosten.
Möglichst viele gesunde, hochqualitative bäuerliche Produkte aus der Region zu möglichst vielen Menschen in der Region zu bringen. Mit dieser Vision trat Agrarökonomin Therese Fiegl 1997 an, um in Tirol eine in dieser Form neuartige bäuerliche Direktvermarktung via Onlineshop zu etablieren. Mittlerweile umfasst das Angebot rund 550 verschiedene Erzeugnisse von ausgewählten Landwirt*innen. Die einzelnen Artikel werden von den Kund*innen direkt bei den bäuerlichen Produzent*innen eingekauft, die ihre Preise selbst festlegen und damit fair für ihre Arbeit entlohnt werden.
DIE BAUERNKISTE – EINE
LOGISTISCHE MEISTERLEISTUNG „Rundherum“ steckt eine bewährte Logistik: Bis Montagabend, 23.59 Uhr, sind Order
für die aktuelle Woche möglich. Die Produzent*innen rufen ihre Kundenbestellungen aus dem Webshop ab, das Bauernkiste-Team bringt die Gesamtlisten zu den drei Packstellen in Thaur und Stams. Bis Donnerstagmittag transportieren die Produzent*innen die gewünschten Lebensmittel zur Packstelle. Hier werden die Produkte gemäß den Bestellungen der Kund*innen in die Kisten sortiert. Am Donnerstagnachmittag bzw. Freitag übernehmen mehrere selbstständige Fahrer die Auslieferung an die Privathaushalte. Rund 700 stabile Mehrwegkisten mit sonnengelbem Bauernkiste-Logo werden pro Woche an die Frau/den Mann gebracht. Angesteuert werden dabei die Gebiete ab Stans im Unterland über den Großraum Innsbruck bis hinauf ins Tiroler Oberland über Telfs, das Seefelder Plateau, das Obere Gericht, Pitztal, Kaunertal und Stanzertal. PR

BAUERNKISTE
Das Sortiment der Bauernkiste ist vielfältig: Saisonal, frisch und „aus der Nachbarschaft“ werden die Lebensmittel direkt vor die Haustüre bewusster Genießer*innen von Singles über Großfamilien, Paare oder Wohngemeinschaften geliefert. Im Onlineshop gibt es ein wöchentlich aktualisiertes Angebot aus Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukten und vielem mehr. Infos und Bestellungen: www.bauernkiste.at.
117
BAUERNKISTE
DAS WALCHSEE AKTIVRESORT
AUF DER SEESEITE DES LEBENS
Mit dem brandneuen Refugium Das Walchsee Lakeside erweitert Das Walchsee Aktivresort sein attraktives Angebot um einen Wohlfühlort mit 22 exklusiven Suiten, atemberaubendem Panoramablick auf den kristallklaren Walchsee und das imposante Kaisergebirge sowie erlesene Kulinarik.
TEXT: DORIS HELWEG



 Wohlfühlrefugium mit direktem Seezugang: in einer einzigartigen Kulisse inmitten des imposanten Kaisergebirges finden Gäste in den stilvollen Suiten und im Restaurant Das Lakes alles, was es für einen genussvollen Rundum-Verwöhn-Aufenthalt braucht.
Wohlfühlrefugium mit direktem Seezugang: in einer einzigartigen Kulisse inmitten des imposanten Kaisergebirges finden Gäste in den stilvollen Suiten und im Restaurant Das Lakes alles, was es für einen genussvollen Rundum-Verwöhn-Aufenthalt braucht.

Die einzigartige Lage mit privatem Seezugang bietet zu jeder Jahreszeit einmalige Stimmungen und Eindrücke herrlich wohltuender Ruhe weit weg von der Alltagshektik. Ergänzt durch die hauseigene Move & Relax Philosophie kann man hier so richtig den Alltag hinter sich lassen, in behaglicher Atmosphäre entspannen und Körper und Seele in Einklang bringen. Denn nur ein ausgewogenes Wechselspiel aus Bewegung und Entspannung bringt mehr Balance ins Leben. Die wohltuende Wirkung von aktiver Bewegung, erholsamer Entspannung und vitaler Ernährung, eingebettet in die atemberaubende Natur am und rund um den malerischen Walchsee, lässt Sie neue Energie tanken. Das Wohlbefinden der Gäste steht im Das Walchsee Aktivresort mit dem neuen Refugium Das Walchsee Lakeside im Mittelpunkt.
22 NEUE WOHLFÜHLREFUGIEN
Dazu zählt natürlich auch das Wohlgefühl in den neuen Suiten, die auf ihren 50 Quadratmetern mit hochwertiger Ausstattung höchste Ansprüche erfüllen. Die großflächigen Panoramafenster lassen den Blick auf die beeindruckende Naturkulisse frei und die einladenden Sonnenbalkone inspirieren dazu, das Frühstück am Zimmer zu genießen, mit uneingeschränktem Blick auf den See und das umliegende Kaisergebirge, für herrliche Momente der Entspannung. Der persönliche Service wird im exklusiven Refugium Das Walchsee Lakeside auf ein neues Level gehoben. Vom persönlichen Check-In mit Gepäckservice und Begleitung auf die Suite bis zum Zimmerservice steht der Gast im Mittelpunkt. Das behagliche Ambiente und die einzigartige Lage am See sorgen für ein ganz besonderes Wohlbefinden.
DAS LAKES RESTAURANT & BAR Abgerundet wird dieser Service mit einem kulinarischen Angebot aus dem hauseigenen À-la-Carte Restaurant Das Lakes auf gehobenem Niveau mit alpin-mediterraner Küche und asiatischen Einflüssen. Zusätzlich zum

À-la-Carte Angebot können Gäste auch ein mehrgängiges Abendmenü – auf Wunsch mit Weinbegleitung – genießen oder im Haupthaus Das Walchsee Aktivresort dinieren. Die moderne und zwölf Meter hohe Bar und die private Seeterrasse laden zudem zum Verweilen bei einem erlesenen Drink ein.
MOVE & RELAX
Und weil neben dem Wohnen und Residieren auch die Bewegung nicht zu kurz kommen darf, kann man im Das Walchsee Aktivresort aus einem facettenreichen Aktivprogramm wählen. Direkt vor der Haustür des neuen Refugiums starten Wassersportler beim Stand-up-Paddling, Wasserski oder bei Bootsfahrten ebenso durch wie Wanderer oder Biker. In der vielfältigen Landschaft zwischen den sanften Chiemgauer Alpen und dem Kaisergebirge kann man in die faszinierende Bergwelt eintauchen oder den See als Ruhepol und Kraftquelle nutzen. Die sattgrünen und blühenden Almlandschaften sowie zahlreiche Gipfel laden zu gemütlichen bis hin zu anspruchsvollen Touren ein, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad. Etliche Kilometer Radvergnügen in der malerischen Landschaft laden zum Erkunden auf zwei Rädern ein – auf dem Mountainbike ebenso wie auf dem Rennrad oder E-Bike. Und auch Golfer kommen auf ihre Kosten und können auf den umliegenden Golfplätzen ihr Spiel verbessern und dabei die Natur genießen.
Im neuen See-Refugium wurden Wohnwelten in einem eleganten Ambiente geschaffen, die neben aktiver Erholung, innerer Balance und Regeneration sowie einem kulinarischen Genussprogramm für eine unvergessliche Auszeit sorgen.
Für welche Art der aktiven Bewegung man sich auch entscheidet, eines ist immer garantiert: Das weitläufige Panorama und die Ruhe sind ständiger Begleiter. Ein weiterer Pluspunkt: Das erfahrene Team im Das Walchsee Aktivresort empfiehlt gerne passende Touren und Orte für besondere Momente, die einem die Möglichkeit geben, ganz auf sich selbst und seinen Körper zu hören und dabei neue Kraft zu schöpfen. Bergeweise Entspannung verspricht nach der Bewegung schließich der Relax Bereich. Schwimmen im Indoor- und Outdoor-Pool, ein anregender Saunagang, ein Dampfbad oder eine stärkende Kräuterstempelmassage – eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag und neue Energie nach einem Tag in der Natur. PR
DAS WALCHSEE AKTIVRESORT
Johannstraße 1 6344 Walchsee in Tirol Tel.: 05374/5331 info@hotelwalchsee.at www.daswalchsee.at
OPENING - SPECIAL IM DAS WALCHSEE LAKESIDE
Wer seinen Aufenthalt noch bis 11. Juli 2024 bei uns verbringt, profitiert von einer Ermäßigung von 15 % auf den Tagespreis der Suiten „Lake View“ und „Mountain View“, inklusive Bestpreisgarantie und Eröffnungsspecials:
• Begrüßungsaperitif und Amuse-Gueule
• 10 % Ermäßigung auf Abendessen im À-la-carte-Restaurant
• inklusive Frühstück mit regionalen Spezialitäten (auf Wunsch in der Suite serviert)
• Zugang zur privaten Liegewiese mit direktem Seezugang
• großzügige Suiten mit über 50 m², Balkon und Panoramafenstern, mit Blick auf den See oder die umliegende Bergwelt
119
DAS WALCHSEE AKTIVRESORT



Vielfalt feiern
In RECLAIMING THE NUDE setzen sich die Bildhauerin Anna Schebrak und die Fotografin
Maria Noi intensiv mit dem Körper, insbesondere dem weiblich gelesenen, auseinander. Als Künstlerinnen ist es ihr Ziel, eine radikal neue Perspektive auf den weiblichen Akt zu schaffen und den Blick darauf eigenständig und respektvoll zu gestalten.
Über Jahrhunderte hinweg wurde der weibliche Körper durch eine männliche Brille definiert, kontrolliert, bewertet und oft unterdrückt. Die tradierten, meist von Männern umgesetzten Sehgewohnheiten in Film und bildender Kunst, bekannt als „Male Gaze“, prägen bis heute die Wahrnehmung und Bewertung von Körpern.
EIN WEIBLICHER BLICK
AUF DEN AKT
Anna Schebrak und Maria Noi sind der Ansicht, dass es alternative Blickwinkel bedarf, die aus der direkten Erfahrung und Wahrnehmung von Frauen* resultieren. In den gezeigten Werken dürfen die dargestellten Körper einfach sein, sich entspannen und ausdrücken. Die Künstlerinnen
GALERIE NOTHBURGA
Innrain 41, 6020 Innsbruck, info@galerienothburga.at, www.galerienothburga.at
Mi. bis Fr. von 16 bis 19 Uhr, Sa. von 11 bis 13 Uhr
RECLAIMING THE NUDE
Maria Noi & Anna Schebrak Dauer: 5. bis 29. Juni 2024
Rahmenprogramm:
4 Juni, 19 Uhr: Eröffnung mit Musik „ ATUM Ensemble“
6. Juni, 18 bis 21 Uhr: Künstlerinnenführung und Workshop„Celebrate Your Body “
plädieren für eine Betrachtung des Körpers als wertfreies Vehikel für die sinnliche Erfahrung der Umwelt und der Freude am Leben. Als junge Frauen bringen die Künstlerinnen ihre persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität ein. Sie erforschen die Bedeutung, in einem weiblichen Körper geboren und sozialisiert zu sein – in einer Umgebung, die oft von Ansprüchen und subtiler oder offensichtlicher Körperfeindlichkeit geprägt ist, aber auch in einem Umfeld von gesellschaftlichem Wandel und einem neuen Selbstbewusstsein.
RECLAIMING THE NUDE möchte inspirieren und zu einem positiven Körperbewusstsein beitragen, denn die Botschaft von Selbstbestimmung und Wertschätzung des eigenen Körpers ist universell.
eco. life 120
Maria Noi: Fotografin, Anthropologin, Psychologin, geboren 1985 in Tirol, lebt und arbeitet in Wien. www.marianoi.com
Anna Schebrak: Bildhauerin, Goldschmiedin, Zeichnerin, geboren 1993 in Tirol, lebt und arbeitet in St. Andrä-Wördern. www.annaschebrak.com

Jetzt erhältlich im Handel oder als Abo 2 x jährlich!

SEIT 1924 MAGAZIN EIN STÜCK TIROL ���.���������������.��

EINBLICKE IN EIN BEWEGTES LEBEN
Die 79-jährige Künstlerin Ingrid Margreiter war seit jeher ein offener, am Leben und an Menschen interessierter Charakter. Begegnet man ihr, trifft man eine Frau mit vielen Persönlichkeitsschichten.
TEXT: PATRICIA WIMMER
Betritt man die Wohnung in Kundl, fällt es einem schwer, sich voll und ganz auf deren Bewohnerin zu konzentrieren. Zu viele Gegenstände wie Reiseandenken, Bücher und Bilder schmücken die Räume und wollen betrachtet
werden. Grünpflanzen verleihen dem Ambiente eine tiefe Entspanntheit. Ingrid Margreiter hat die Ruhe, ihren Besucher*innen die Zeit zum Ankommen zu geben.
Eines fällt sofort auf: Hier wohnt eine Frau, die weder schwarz-weiß denkt noch
schwarz-weiß lebt. Geboren am 12. Juni 1944 in Polen, musste Margreiter mit ihrer Mutter aufgrund der Kriegsverhältnisse und der damit verbundenen Folgen im Alter von einem Jahr flüchten. Der Vater befand sich zu dieser Zeit in Kriegsgefangenschaft.
eco. life 122
Die junge Frau beschloss, mit ihrem Kind zu den Schwiegereltern in den Bezirk Judenburg in die nun wieder sichere Steiermark zu gehen. Als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, erweiterte sich die Familie um weitere vier Kinder.
Ingrid Margreiter war ein schüchternes Kind. Ihre Kindheit beschreibt sie als bescheiden, aber schön. Nach den Pflichtschuljahren war es ihr Traum, an die Kunstgewerbeschule nach Graz zu wechseln und Modezeichnerin zu werden. Das Geld indes reichte dafür nicht aus, weswegen sie den Lehrberuf der Verkäuferin absolvierte. Nach Beendigung der Lehre zog es Margreiter aus den vertrauten Bahnen. Die junge Frau wollte mehr sehen vom Leben. Sie beschloss, ins Gastgewerbe zu wechseln und auf Saison zu gehen. Anfangs als Zimmermädchen, später im Service war Margreiter unter anderem in St. Wolfgang, Mayrhofen, Saalfelden, am Achensee und im Montafon tätig. Weil sie begeisterte Skifahrerin war, versuchte sie, im Winter stets in einem Skigebiet unterzukommen. Um Englisch zu lernen, arbeitete sie zehn Monate in einem Londoner Hotel. Mit 30 Jahren und nach zehn Jahren auf Saison beendete Ingrid Margreiter diesen Lebensabschnitt. Beruflich hatte sie vor, nach München zu gehen, wurde aber von einem Statikbüro in Wörgl als Technische Zeichnerin angeworben. Zeitgleich wollte das Reiseunternehmen Neckermann sie als Reiseleiterin in Teneriffa, wo sie vor Jahren im Herbst auf Urlaub war, einsetzen. Margreiter entschied sich für Wörgl und übte den Beruf der Technischen Zeichnerin bis zu ihrem Pensionsantritt 1999 aus.

In jungen Jahren war Ingrid Margreiter auch begeisterte Motorradfahrerin.
Ingrid Margreiter ist eine Frau, die weder schwarz-weiß denkt noch schwarz-weiß lebt.
UMTRIEBIGE LEBENSLUST
MIT FESTEN WURZELN
1972 erwarb Ingrid Margreiter eine Wohnung in Wörgl, lernte 1974 ihren Mann Richard kennen und heiratete ihn ein Jahr später. 1983 erfolgte der Umzug in die jetzige Wohnung nach Kundl. Das abenteuerlustige Ehepaar unternahm neben etlichen Konzert- und Theaterbesuchen viele Reisen rund um die Welt, fuhr mit der Transsibi-

rischen Eisenbahn nach China und reiste nach Neuseeland. In Südamerika gingen sie oft ihrem Hobby, dem Schnorcheln, nach. Und auch kreativ war Margreiter schon zeit ihres Lebens. Neben dem Entwerfen und Herstellen eigener Kleidung hat es ihr vor allem das Malen angetan. Immer wieder versuchte sie sich an neuen Stilen und entdeckte das Fotografieren für sich. Vor rund 15 Jahren begann sie, Kurse und Weiterbildungen zu besuchen, Inspirationen holte sie sich beim Lesen und auf ihren Reisen. Als Margreiter 2014 einen Schlaganfall erlitt, musste sie Schreiben und Zeichnen wieder gänzlich neu erlernen. Mit Disziplin und Willenskraft kämpfte sie sich zurück. Ihre Ausstellungen führten sie schließlich quer durch das Tiroler Unterland und nach Innsbruck. Schon oft war sie bei der ARTirol zu Gast, einem Kunstverein mit Sitz in Wörgl, von 2011 bis 2024 war Margreiter außerdem Mitglied des Vereins „Treffpunkt Kreativ –Arte Unterland“, der leider aufgrund geografischer Veränderungen Anfang dieses Jahres aufgelöst wurde. Für ihre Zukunft wünscht sich Ingrid Margreiter vor allem eines: Gesundheit.
eco. life 123
Ingrid Margreiter in einem selbst designten Kleid im London der 1970er-Jahre
eco. life 124 PA
E UND EIN GUTES BUCH.
us
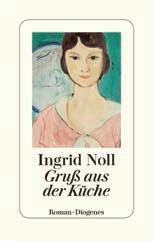
GRUSS AUS DER KÜCHE
INGRID NOLL, DIOGENES VERLAG, 304 SEITEN, EUR 26,80
Nachdem ihre Kinder das Haus verlassen hatten, begann Autorin Ingrid Noll Kriminalgeschichten zu schreiben und hat dabei ihren ganz eigenen Ausdruck und originellen Zugang gefunden. „Gruß aus der Küche“ ist ihr neuestes Werk, in dem sie die unterschiedlichsten Charaktere mit all ihren persönlichen Rucksäcken in einer Restaurantküche zusammenbringt. Mögen wir!
SCHAU NICHT HIN
EVELYN STEINTHALER, KREMAYR & SCHERIAU, 208 SEITEN, EUR 25,–
Wie weit sind Künstlerinnen bereit, für ihren Erfolg zu gehen? Die in Klagenfurt geborene Publizistin und Kommunikationswissenschaftlerin Evelyn Steinthaler untersucht und analysiert die Geschichte von vier Diven des NS-Films und geht damit zugleich gänzlich unaufgeregt der Frage nach Trennung von Künstler*in und Kunstwerk nach.

DER WALD
ELEANOR CATTON

BTB VERLAG, 512 SEITEN, EUR 25,70
Wenn eine ideologisch getriebene GuerillaGardening-Gruppe auf einen Milliardär trifft, der diese vermeintlich gänzlich uneigennützig finanziell unterstützen will, kommt man fast zwangsläufig in eine Zwickmühle. Geld nehmen oder lieber sein lassen? In „Der Wald“ prallen unterschiedliche Welt(sicht)en aufeinander, Eleanor Catton bewegt sich damit ganz nah an der gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität.
WAS DAZWISCHEN KOMMT
JOHANNES WALLY, VERLAG EDITION KEIPER, 248 SEITEN, EUR 24,–
Der Weg zur Erlösung ist lang und endet manchmal in einem Aktmodell. Wie im Fall von Haimo Wildners, der glaubt, vor vielen Jahren seinen Schulfreund auf der Maturareise umgebracht zu haben. Lange trug er das Geheimnis mit sich herum, bis er sich schließlich öffnen kann – vor allem gegenüber sich selbst. Eine vielschichtige Geschichte über Lieb-, Freund- und Feindschaften, die immer wieder wie zufällig zusammenfindet und sich Stück für Stück gemeinsam fortschreibt.
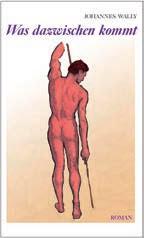

DER PAKT DER FRAUEN
JULIA KRÖHN, HEYNE VERLAG, 352 SEITEN, EUR 22,70
Wien 1976. Eine selbstbewusste junge Historikerin kämpft für Respekt und Frauensolidarität – und entdeckt dabei ihre eigene Familiengeschichte und dass Frauen schon immer Heldinnen waren, ohne sie zu romantisieren. Als studierte Historikerin ist Julia Kröhn Meisterin im Erzählen großer Geschichten. Sie taucht dabei tief in die Vergangenheit von Orten und Menschen ein – in diesem konkreten Fall in jene ihrer Mutter und Großmutter.

SIE SAGT. ER SAGT.
FERDINAND VON SCHIRACH
BTB VERLAG, 144 SEITEN, EUR 13,40
Ferdinand von Schirach erlangte unter anderem als Strafverteidiger in den Berliner Mauerschützenprozessen von 1991 bis 2004 Bekanntheit. 2009 veröffentlichte er sein erstes Buch, seine Geschichten polarisieren und sorgen vielfach für Diskussionen. „Terror – das Urteil“ wurde unter anderem zum größten Live-Experiment im deutschsprachigen Fernsehen, bei dem die Zuschauer über den Ausgang der Gerichtsverhandlung abstimmen konnten. Auch sein Theaterstück „Sie sagt. Er sagt.“ ist ein rasantes Spiel von Aussage gegen Aussage und der schlussendlichen Frage: Wem glaubt man mehr?
eco. life 125
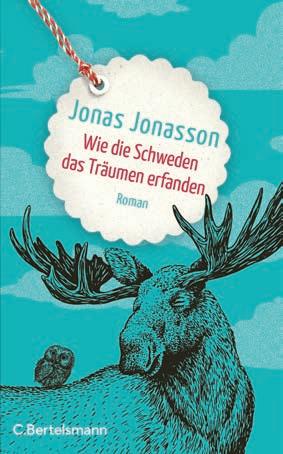
WIE DIE SCHWEDEN
DAS TRÄUMEN ERFANDEN
JONAS JONASSON, C. BERTELSMANN, 160 SEITEN, EUR 22,70
Seit wir Jonas Jonassons „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ gelesen haben, sind wir dem Schweden vollumfänglich verfallen. Auch wenn dieses Buch sehr viel kürzer ist als seine anderen, so hat er auf 160 Seiten dennoch herrlich viel Charme, Rasanz und Witz gepackt und erzählt eine Geschichte, die man am liebsten in einem Rutsch durchliest. Übersetzerin
Astrid Arz ist ein echter Glücksgriff!

CAFÉ SCHINDLER
MERIEL SCHINDLER, BERLIN VERLAG, 480 SEITEN, EUR 26,–
Das legendäre Café Schindler wurde 1922 nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs gegründet und schnell zum pulsierenden sozialen Zentrum von Innsbruck – bis die Nazis kamen. Meriel Schindler hat eine äußerst genau recherchierte und zutiefst berührende Familiengeschichte niedergeschrieben –teilweise sogar in Innsbruck.
TIPP: Das Tiroler Landestheater bringt „Café Schindler“ aktuell im Großen Haus unter der Regie von Jessica Glause feinfühlig und außergewöhnlich inszeniert auf die Bühne. Die Uraufführung fand Anfang April statt, gespielt wird bis 7. Juli.

SÜDBAHN NACH TRIEST
GÜNTER NEUWIRTH, GMEINER VERLAG, 375 SEITEN, EUR 18,50
Günter Neuwirths Inspector Bruno Zabini ist ein echter Triestiner, spricht mehrere Sprachen, liebt Kaffee und ermittelt in seinem vierten Fall im Wien des Jahres 1908. Dort macht er gerade Urlaub und weil der Tod der reichen Witwe Henriette Hohenau Bezüge zu Triest aufweist, wird Zabini hinzugezogen. Dem Titel des Buches folgend passiert auch auf dem Rückweg in seine Heimat noch einiges.
DER LÄNGSTE SOMMER IHRES LEBENS
AMELIE FRIED, HEYNE VERLAG, 432 SEITEN, EUR 22,70
Sommer ist super. So ganz prinzipiell. Dass das nicht immer zutrifft, zeigt Autorin Amelie Fried in ihrem neuen Buch, denn hier scheint ein einziger Sommer ein ganzes Dasein auf den Kopf und gleichzeitig vieles in Frage zu stellen. Die eigenen Ziele, die Beziehung zur Mutter, Erziehungsmethoden und eine vermeintlich funktionierende Ehe. Fried hat einen klugen und sensiblen Gesellschafts- und Familienroman geschrieben.


ALLMEN UND HERR WEYNFELDT
MARTIN SUTER, DIOGENES VERLAG, 224 SEITEN, EUR 26,80
Er ist ein Meister des eleganten Schreibens, des zwischenzeilig Humorigen und der klugen Ironie. Wie Martin Suter mit Hochstapler Johann Friedrich von Allmen lässig durchs Leben wandelt, ist eine einzige Freude. In der neuesten Auflage trifft Allmen in einer Bar auf keinen Unbekannten: Adrian Weynfeldt. Es kommt zu einer ungewöhnlichen Freundschaft. Und Allmens erstem Mord.
OLIVA DEL GARDA
KATHARINA EIGNER, GMEINER VERLAG, 279 SEITEN, EUR 16,–
Nachdem Katharina Eigner in ihrem letzten Gardasee-Krimi „Diva del Garda“ mit Restauratorin Rosina Gampa, deren bester Freundin und einem gutaussehenden Ex-Kardinal in den Ermittlermodus geschalten hat, verschlägt es Rosina nun mitten hinein in die Geheimisse einer Olivenbauern-Dynastie und einen vermeintlichen Selbstmord. Perfekte Sommerlektüre!

eco. life 126
DAS VERSTEINERTE HERZ
ABDULRAZAK GURNAH
PENGUIN VERLAG, 368 SEITEN, EUR 26,80
Abdulrazak Gurnah wurde 1948 im Sultanat Sansibar geboren und lässt auch seinen Roman rund um den Jungen Salim dort beginnen. Er erzählt über den Einfluss der (Familien-)Geschichte auf unser Leben und über die Suche nach dem eigenen Platz darin. Es sind laute und leise Töne, die Gurnah so kraftvoll wie berührend anschlägt und mit einer Eleganz, die die Geschichte noch tiefer sinken lässt. Eva Bonné hat sie mit viel Gefühl ins Deutsche transferiert.

PRIDE
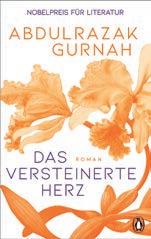
MICHAEL HUNKLINGER, KREMAYR & SCHERIAU, 128 SEITEN, EUR 20,–
Die essayistische Reihe „übermorgen“ der Verlags Kremayr & Scheriau setzt sich mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen auseinander – Politikwissenschafter Michael Hunklinger analysiert als Experte für Queer Politics in diesem Fall die aktuelle Debatte um LGBTQ+ und räumt mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse so manches Vorurteil aus dem Weg. Tolle Serie!
IM CHÂTEAU
MARTIN WALKER, DIOGENES VERLAG, 384 SEITEN, EUR 26,80
Es ist schon der 16. Fall, an dem Bruno, Chef de police im eigentlich beschaulichen französischen Örtchen Saint-Denis, zu knabbern hat, und jeden einzelnen davon haben wir mit Freude gelesen. Mit Spürsinn, Empathie und Feingefühl schreibt Martin Walker seinen Protagonisten durchs Perigord und lässt ihn auch immer wieder seine wunderbaren Kochkünste unter Beweis stellen. Und natürlich darf auch die Liebe nicht fehlen.

DIE HAND DES TODES
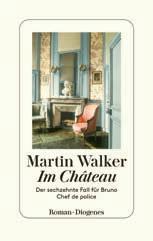
KATHY REICHS, HEYNE VERLAG, 368 SEITEN, EUR 22,70
Eine Reihe bizarrer Mordfälle führt die forensische Anthropologin Tempe Brennan dieses Mal auf die karibischen Turks- und Caicosinseln. Es ist schon der 22. Band aus der Reihe, funktioniert aber auch für sich allein. Dass Kathy Reichs unter anderem für gerichtsmedizinische Institute arbeitet, merkt man ihren Büchern an. Reichs hat außerdem die Serie „BONES –Die Knochenjägerin“ mitkreiert und -produziert.
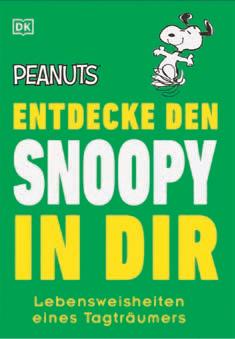
ENTDECKE
DEN SNOOPY IN DIR
NAT GERTLER
DORLING KINDERSLEY (DK) VERLAG, 64 SEITEN, EUR 7,95
Charlie Browns Haushund liegt meistens auf dem Dach seiner Hütte und geht philosophischen Gedanken nach. Und Snoopy zeigt, wo das Glück versteckt ist. Dieses entzückende Büchlein ist voller kluger Gedanken und schlauer Weisheiten für jede Lebenslage – verpackt in ein Layout, das gute Laune macht. We love!

DAS AUGE DER NACHT
CILLA & ROLF BÖRJLIND
BTB VERLAG, 416 SEITEN, EUR 18,50
Nordische Krimis sind quasi immer ein Garant für Spannung und ein bisserl Grusel. Das ist bei Cilla & Rolf Börjlind und ihrer Rönning/Stilton-Serie nicht anders. Der mittlerweile achte Band greift mit dem Ukrainekrieg wieder ein hochaktuelles Thema auf und strotzt vor Rasanz und Handlung. Selbst wenn man die vorigen Bände nicht gelesen hat, erhält man vom Autorenduo alle wichtigen Infos, um sich auch als „Außenstehender“ zurechtzufinden.
eco. life 127
SPECIAL TIPP
IM GESPRÄCH

Gabriele Kienast: neue Vorständin der Raiffeisen-Landesbank Tirol
Der Aufsichtsrat der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG konnte mit Gabriele Kinast eine Top-Bankerin aus Berlin für den Vorstand des Spitzeninstituts von Raiffeisen in Tirol gewinnen. Die 49-jährige Managerin ist seit 1994 im Finanzdienstleistungssektor tätig, verfügt über ein sehr breites Fachwissen und kennt den Genossenschaftssektor. Im Jänner 2025 wird sie ihre Position offiziell antreten, Reinhard Mayr bleibt bis Ende April 2025 Vorstandsvorsitzender. Danach wechselt er nach 46 Dienstjahren in den Ruhestand.
Kinast startete ihre Karriere in der Landesgirokasse Stuttgart, wo sie die Ausbildung zur Bankkauffrau und anschließend zur Bankfachwirtin durchlief. 2015 schloss sie die Ausbildung an der Frankfurt School of Finance & Management als Bankbetriebswirtin ab. 2019 absolvierte sie an der Harvard Business School in Boston das Advanced Management Program. Ihren beruflichen Werdegang begann sie als Privatkundenbetreuerin in der Landesbank Baden-Württemberg. Nach einer leitenden Funktion im Bereich Organisation/Informationstechnologie wechselte sie 2001 in die Berliner Volksbank eG in die Vertriebssteuerung. Es folgten Führungsfunktionen in den Bereichen Kredit und Risikomanagement sowie die Vertriebsverantwortung für eine Region. Aktuell leitete Gabriele Kinast den Bereich Human Relations und ist Generalbevollmächtigte der Berliner Volksbank eG.
128
news & events

PRÄSIDENTENWECHSEL
Max Kloger, geschäftsführender Gesellschafter der Tiroler Rohre GmbH, wurde anlässlich der Ordentlichen Vollversammlung zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung Tirol gewählt. Mit Kloger folgt ein erfahrener Interessenvertreter und Eigentümer eines Tiroler Industrieleitbetriebes Präsident Christoph Swarovski nach, der das Amt statutengemäß nach zwei vierjährigen Perioden abgibt. Gemeinsam mit Kloger bilden Eduard Fröschl (Fröschl), Holger König (Liebherr-Hausgeräte Lienz), Simon Meinschad (hollu Systemhygiene), Gabriele Punz-Praxmarer (Montanwerke Brixlegg) und Karlheinz Wex (Plansee Group) als Vizepräsidentin und Vizepräsidenten das neugewählte Präsidium der IV Tirol.


ZURÜCK DAHEIM
Nikolaus Waltl (35) verstärkt das Team des Bankhaus Spängler in dessen Niederlassung in Kitzbühel. Der Private Banker verantwortet in seiner neuen Position die Betreuung und Beratung der Kund*innen im Bereich Wertpapiere und Vermögensverwaltung. Waltl schlug nach dem Abschluss der Tourismusschule zunächst eine touristische Karriere ein, danach zog es den diplomierten Tanzmeister ins Finanzwesen. Er absolvierte die Ausbildung zum Anlageberater an der Volksbank Akademie und war über zehn Jahre in der Volksbank Wien tätig. Jetzt erfolgte mit dem Wechsel in die Kitzbüheler Niederlassung des Bankhaus Spängler die berufliche und private Rückkehr in seine Tiroler Heimat.
MARKENBOTSCHAFTER
Unterberger Automobile konnte Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck als Markenbotschafter für „Jensen Classics by Unterberger“ gewinnen. Der ehemalige Automobilrennfahrer, bekannt für seine Erfolge in der Formel 1, beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft, repräsentiert ab sofort die Exzellenz des traditionsreichen Oldtimer-Restaurationsbetriebes. Jensen Classics, ein Spezialbetrieb für die Restaurierung klassischer Automobile, wurde vor einigen Jahren von Unterberger Automobile übernommen und nach Kufstein verlegt. jensen-classics.cc



Das Wetscher-Innenarchitektenteam, das für das neue Poliform-Küchenstudio verantwortlich zeichnet:
Magdalena Bortolotti und Patrick Klausner
SP ITZENKÜCHEN AUS BELLA ITALIA
Anfang April feierte man in den Wetscher Wohngalerien in Fügen das exklusive Opening des Poliform-Küchenstudios. Auf 300 Quadratmetern präsentiert Wetscher nahezu alle aktuellen Modelle, darunter die Artex Pro sowie die Linien Alea Pro, Twelve, Phönix und viele weitere. Neben zeitloser italienischer Eleganz, echten Design-Highlights und kreativen Innovationen aus der Poliform-Küchenwelt erwartete die zahlreichen Eröffnungsgäste ein Treffen mit Starkoch Toni Mörwald, der im Gespräch mit Martin Wetscher aus dem Kochtopf plauderte – und anschließend live mit seinem Team kulinarische Köstlichkeiten auf die Teller zauberte.
im. gespräch 129
Gastgeber Martin Wetscher und 4-HaubenKoch Toni Mörwald
Gerald Unterberger und Hans-Joachim Stuck
Christoph Swarovski und Max Kloger
© IV TIROL / FRANZ OSS
Martin Stöckl,
© ALEX GRETTER

Fachgruppengeschäftsführerin Karolina Holaus, Gremialobmann Wolfgang Feucht und Keynote-Speakerin Maria-Theresa Schinnerl
MODISCH
Mitte April lud das Landesgremium des Handels zur bereits 60. Auflage der Tiroler Moderunde in die Wirtschaftskammer Tirol. Diesmal gab es wertvolle Tipps und Anregungen von Maria-Theresa Schinnerl zum Thema „Verkaufs-Turbo durch Menschlichkeit“. Die Expertin aus Salzburg zeigte auf unterhaltsame Weise, wie Professionalität, Persönlichkeit und Eigenverantwortung zu perfekter Servicequalität verschmelzen können und wieso diese gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt immer wichtiger wird. „Mit dieser Veranstaltungsreihe bieten wir unseren Mitgliedsbetrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig eine Infoplattform, bei der ihnen ausgewiesene Fachleute aktuelle Trends näherbringen. Dabei steht ganz nach dem Motto unserer Initiative ,Ich kauf lokal – mir ist’s nicht egalʻ stets die Stärkung und Weiterentwicklung des regionalen Handels im Fokus“, erklärt Gremialobmann Wolfgang Feucht.

Martin Bergerweiß (künftiger Obmann), Walter Hörtnagl (scheidender Obmann) und Harald Giesinger (Obmann-Stellvertreter)
OBMANNWECHSEL
In der Vollversammlung des Sparkassen-Landesverbands Tirol und Vorarlberg wurde Martin Bergerweiß, Vorstandsvorsitzender der Lienzer Sparkasse AG, zum neuen Obmann gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf Walter Hörtnagl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Reutte AG, der Mitte des Jahres 2024 in Pension gehen wird. Obmann-Stellvertreter bleibt Harald Giesinger, Vorstandsvorsitzender der Dornbirner Sparkasse Bank AG. Zum Landesverband zählen alle Sparkassen in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg und die Sparkasse Mittersill, in Summe 15 regionale Sparkassen.




CHARITY-KABARETT
Ende April lud der Lions Club Hall in Tirol zum Kabarettabend mit Nina Hartmann ins Kurhaus Hall. Der Abend, der jährlich stattfindet, wurde vom Präsidenten David Sulzenbacher mit herzlichen Begrüßungsworten und einer Vorstellung des Clubs eröffnet. Der Erlös des Abends wird für die schnelle und unbürokratische Hilfe bedürftiger Mitbürger in der Region verwendet. hall.lions.at
WIEDERBESTELLT
Bei der Delegiertenversammlung der Internationally United Commercial Agents and Brokers wurde Christian Rebernig (52) erneut als IUCAB-Generalsekretär bestellt. Rebernig ist seit 26 Jahren in der Wirtschaftskammer Österreich tätig und seit 2008 im Bundesgremium der Handelsagenten engagiert. Als Generalsekretär begleitet der Wahl-Wiener den Weltverband der Handelsagenten bereits seit acht Jahren.
NEU AUSGESTATTET
Der schwedische Möbelhersteller IKEA ist beispielgebend für Nachbarschaftshilfe und Übernahme sozialer Verantwortung. So hat der Möbelriese bereits in mehreren Bundesländern Sozialpädagogische Wohngemeinschaften von Pro Juventute bei der Einrichtung unter die Arme gegriffen. Das jüngste Beispiel setzt IKEA Innsbruck mit der kostenlosen Neuausstattung samt Möbelaufbau für die neue Kriseneinrichtung Kirchbichl. Das neue Angebot wird seinen Betrieb mit Juni 2024 aufnehmen.
Das IKEA-Team Innsbruck mit Patrick Wetter (Customer Relations Manager IKEA Einrichtungshaus Innsbruck, 4. v. r.) und David Altacher (Pro Juventute Regionsleitung Region West)
im. gespräch 130
© DIE FOTOGRAFEN
© IUCAB
ECHTES KNOW-HOW FÜR KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Kostenlose Webinar-Reihe
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Doch wie kann ich sie geschäftlich nutzen und effizient einsetzen? Unsere Webinar-Reihe zeigt, wie es gehen kann – einfach, kostenlos und praxisorientiert. Herzlich willkommen in der Zukunft Ihres Unternehmens! wko.at/ki
©
|
Gizmo
stock.adobe.com Der schnellste Weg zu unseren Services.









www.tiwag.at
100 %. 100 Ja h re. Wasser. K raft.
Gemeinsam feiern. Zurückblicken und nach vorne schauen. Für Tirol und seine Menschen. Zu






























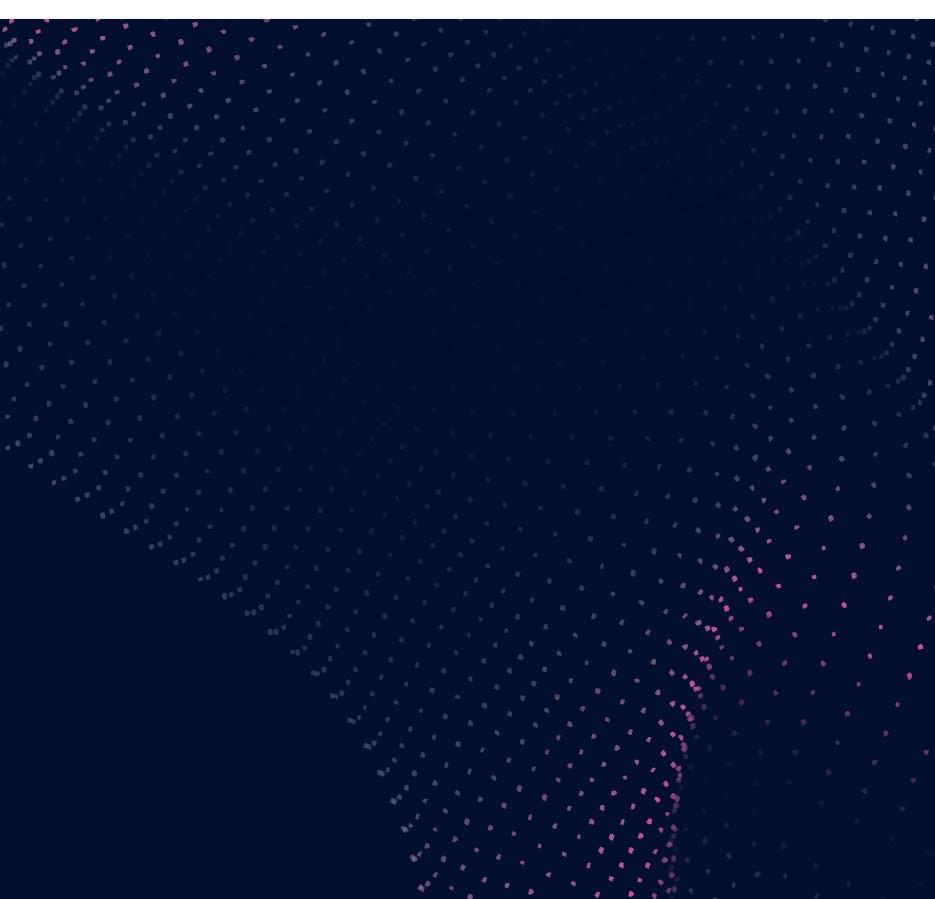














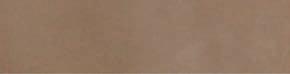

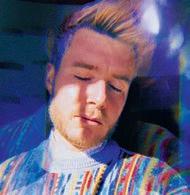
 ARNOLD
ARNOLD



















 FAZIT
FAZIT


































 Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol
Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol


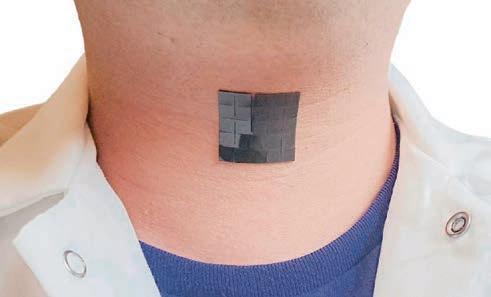
























































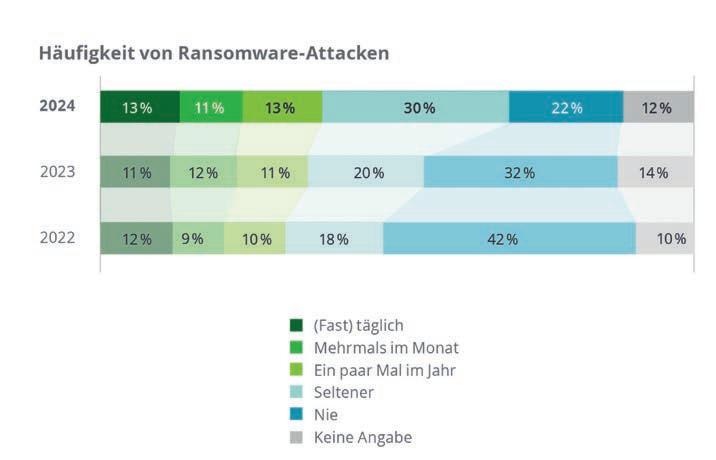

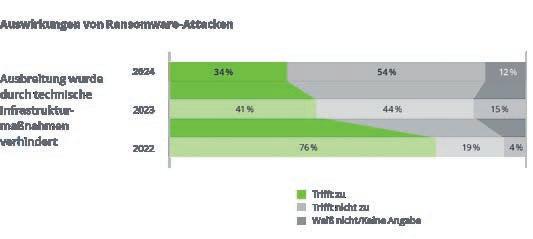
 Georg Schwondra, Partner & Cyber-Experte, Deloitte Risk Advisory
Georg Schwondra, Partner & Cyber-Experte, Deloitte Risk Advisory









 Gerald Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers
Gerald Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers













































 Wohlfühlrefugium mit direktem Seezugang: in einer einzigartigen Kulisse inmitten des imposanten Kaisergebirges finden Gäste in den stilvollen Suiten und im Restaurant Das Lakes alles, was es für einen genussvollen Rundum-Verwöhn-Aufenthalt braucht.
Wohlfühlrefugium mit direktem Seezugang: in einer einzigartigen Kulisse inmitten des imposanten Kaisergebirges finden Gäste in den stilvollen Suiten und im Restaurant Das Lakes alles, was es für einen genussvollen Rundum-Verwöhn-Aufenthalt braucht.