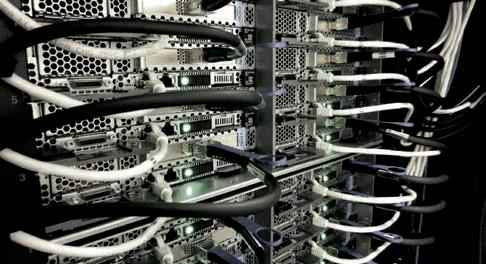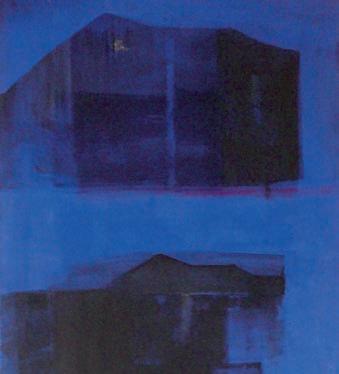WIR SIND DANN MAL
WARUM TIERE UND PFLANZEN LEBENSRAUM BRAUCHEN.

Und was das mit uns zu tun hat.
SINNVOLL: Nachhaltig wirtschaften
KUFSTEIN: Gegenwart und Zukunft
INNOVATIV: Kluges für morgen

TECH - GELD: Chancen im IT-Sektor

N° 03
MEHR ENERGIE , LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND

EINEN DEFINIERTEN KÖRPER ?
HOL DIR DEINEN KÄLTEKICK
FÜR MEHR GESUNDHEIT UND
WOHLBEFINDEN!


STOFFWECHSELINSTITUT INNSBRUCK Amraser-See-Straße 56, Menardicenter II, 4. OG 6020 Innsbruck Tel. +43 (0) 512 346437 termin@stoffwechsel-innsbruck.at www.stoffwechsel-innsbruck.at „FREEZING TO GO“ FÜR JUGENDLICHES, DYNAMISCHES AUSSEHEN, EINE FUNKTIONIERENDE FETTVERBRENNUNG UND GEWEBESTRAFFUNG! FÜHRENDE EXPERTEN BESTÄTIGEN DIE ERFOLGE DER GANZKÖRPER KÄLTEMEDIZIN Leistungssteigerung Anti-Aging Schmerzlinderung Energiebooster Stärkung des Immunsystems bei Müdigkeit und Schlafstörungen Stressabbau Verschönerung des Hautbildes Steigerung von Stimmung und Vitalität Vereinbare jetzt einen Termin für deinen Kryo-Energie-Booster!
DER MENSCH, DAS GEWOHNHEITSTIER
Gewohnheiten und Routinen sind für uns Menschen nicht nur praktisch, sondern sogar höchst nötig. Müssten wir all unser Tun bewusst steuern, würde das unser Gehirn überfordern und reichlich Energie verbrauchen. Die Crux an Gewohnheiten ist: Sie lassen sich schwer ablegen. Das gilt auch für die schlechten.
Von Tagesanfang bis -ende spulen wir vielfach immer wieder dieselben Muster ab, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Die meisten Gewohnheiten sind uns allerdings nicht angeboren, sondern das Ergebnis aus Erfahrungen und Lernprozessen. Je öfter wir Handlungen vollziehen, desto besser werden wir darin, wie sich etwa beim Spielen eines Instruments zeigt. Werden Abläufe also zuerst vom Bewusstsein gesteuert, wandern sie mit der Zeit in unser Unterbewusstsein ab. Und dort sind sie nur recht schwer wieder herauszukriegen. Das macht in manchen Bereichen durchaus Sinn, in anderen kann es zum Problem werden. Routinen sorgen nicht nur für effizientere Abläufe, sie machen uns auch ein Stück weit bequem. Deshalb lassen wir meist gerne einfach alles so, wie es ist. Weil’s eh gut funktioniert. Funktioniert hat, wird es vermutlich in Zukunft heißen, denn die Welt verändert sich – im Großen, aber auch im Kleinen. Und diesen Veränderungen müssen wir uns stellen.
Die Gesellschaft und soziale Strukturen sind im Wandel, Unternehmertum denkt sich selbst neu, vor allem aber verändert sich das Klima. Und damit unterm Strich alles. Wie in den vergangenen Jahren beschäftigen wir uns auch im heurigen Frühjahr mit der Nachhaltigkeit, haben uns dieses Mal jedoch ein ganz spezielles Thema herausgepickt. Bei allem Fokus auf den Klimawandel gerät nämlich eine Entwicklung aus dem Blickfeld, die mit diesem im Zusammenhang steht und nicht minder bedrohlich ist: der Verlust an Biodiversität. Dass auf der Welt ein ständiges Arten-Kommen und -Gehen herrscht, ist erdgeschichtlich nicht neu. Das war quasi naturgegeben schon immer so. Am derzeitigen Artensterben ist aber kein Asteroid schuld. Es ist der Mensch. Zumindest hauptursächlich. Das hat tatsächlich einen entscheidenden Vorteil: Weil der Verursacher bekannt ist und praktischerweise ein Homo sapiens – und damit zumindest per definitionem weise und vernünftig –, kann er bewusst gegensteuern. Dummerweise ist eben jener Mensch aber auch träge und äußerst leidensfähig. Bis er wirklich etwas in seinen Grundfesten verändert, muss der Leidensdruck sehr hoch sein. Wegen der Gewohnheit warat’s. Beim Klima läuft uns allerdings die Zeit davon, auch wenn wir hier in Österreich im Allgemeinen noch nicht wirklich unmittelbar viel davon merken. Und genau das ist das Problem. Es läge in unserem ureigensten Interesse, jene Ökosysteme, die wir zum kollektiven Überleben brauchen, nicht zu zerstören. Das bedeutet allerdings, alte Gewohnheiten abzulegen und über die eigene Komfortzone hinauszudenken. Das mögen die wenigsten, es wird uns allerdings kaum anderes übrigbleiben.
Stellen Sie sich vor, es geht und keiner probiert's. Ihre Redaktion der eco.nova

eco. edit 4
eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE
„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“
GUSTAV HEINEMANN, EHEM. DEUTSCHER BUNDESPRÄSIDENT












POOLKOMPETENZZENTRUM pools in edelstahl Ausgezeichnet mit dem Oscar der Schwimmbadindustrie Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin! Polytherm GmbH | A-4675 Weibern | Pesendorf 10 | Tel. +43 7732-3811 | office@polytherm.at www.polytherm.at was macht edelstahlpools so besonders? Es ist das elitäre Material, das elegante Erscheinungsbild, die lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit.







eco. inhalt 6 70 112 26 48 18 76 124
FOTOS: MARIAN KRÖLL, TOM BAUSE, UNI INNSBRUCK, SEEDCUP, TIROL WERBUNG/LISA HÖRTERER
ECO.TITEL
14 WIR SIND DANN MAL WEG
Durch den Fokus auf den Klimawandel gerät eine Entwicklung aus dem Blick, die nicht minder bedrohlich ist: der Verlust an Biodiversität.
18 IM INTERVIEW
Biodiversitätsexperte Johannes Rüdisser über die Klimaund Biodiversitätskrise. Und Lösungsmöglichkeiten.
ECO.WIRTSCHAFT
26 NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN
Universitätsprofessorin Kerstin Neumann über nachhaltige Unternehmensentwicklung.
32 SO GEHT NACHHALTIGKEIT
Regionale Projekte, Initiativen, Forschungen und andere nachhaltige Positivbeispiele.
40 SANFTES REISEN
Nachhaltigkeit im Tourismus –mehr als ein Trend.
48 WIRTSCHAFTS - KRAFT
Die aktuellen Herausforderungen für die Gesellschaft sind enorm. Auch im Bezirk Kufstein sucht man nach Antworten auf die großen Fragen der Zukunft.
60 FLEXIBEL SEIN
Jan Gregor Schubert, STIHL Tirol, über Unternehmertum in schweren Zeiten.
ECO.ZUKUNFT
70 KAFFEE IM KAFFEE
seedcup presst Kaffeesatz zu biologisch abbaubaren Bechern.
76 VERKEHRSSTROM
Der junge Physiker Alfons Huber möchte mit REPS, einem „grünen“ Energiewandler, seinen Beitrag zur Energiewende leisten.
ECO.GELD
88 TECH - GELD
Technologieaktien werden derzeit zunehmend günstiger. Ob und wo ein Einstieg lohnt.
98 ES BLEIBT SPANNEND
Hypo-Tirol-Private-Banker Georg Frischmann zur aktuellen Lage am Finanzmarkt.
ECO.MOBIL
112 KULTIGE NEUAUFLAGE
Der legendäre Bulli von VW wird elektrisch und heißt jetzt ID. Buzz.
116 CROSSOVER - FACELIFT
Dreieinhalb Jahre nach seiner Vorstellung erhält der XCeed von Kia sein verdientes Update.
118 TECHNIKAFFIN
Der 2er Active Tourer von BMW wird ordentlich aufgehübscht.
ECO.LIFE
122 KLEINE WELTRETTER -TIPPS Tipps, wie sich im Haushalt Energie sparen lässt.
1. bis 8. april
kochkurs
„frühlingserwachen“
am 22. april
10 bis 15 uhr
€ 110 pro person
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, Stefanie Kozubek // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // recht.aktuell: RA Mag. Dr. Ivo Rungg // eco.life: Shiva Yousefi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck, Daniel Christleth LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH
UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco. nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
eco. inhalt
das grander +43
52 24 52 6 26 info@das-grander.at das-grander.at
(0)
ostermenü
buntes ostern. auf den punkt.
&
04 EDITORIAL 08 KOMMENTAR 10 11 ¾ FRAGEN 102 ECO.STEUERN 107 ECO.RECHT 124 KULTUR.TIPP 126 IM.GESPRÄCH
ÜBER DIE VERHÄLTNISSE
Wir haben bestellt: „Koste es, was es wolle.“ Und: „Ich will alles –und das sofort.“ Jetzt bekommen wir die Rechnung dafür.
Irgendwo am langen Weg vom Sozialstaat über den Wohlfahrtsstaat hin zum Vollkaskostaat ist es wohl passiert. Wir müssen vor lauter Schwung eine Abzweigung verpasst haben. Inzwischen streichelt uns die öffentliche Hand in den Schlaf und hat uns eingelullt wie das Sandmännchen auf KIKA. Beim Staatsbudget gibt es spätestens seit Corona kein Halten mehr, da klingelt immer noch der Kampfruf „Koste es, was es wolle!“ in den Ohren nach. Aber Corona ist nicht an allem schuld. Wir hatten schon jahrzehntelang Budgetdefizite – auch in guten Jahren. Wen wundert’s, dass sich bei diesem öffentlichen Vorbild auch viele Bürger*innen dazu hinreißen lassen, über die Verhältnisse zu leben. Ratenzahlungen für das neue Handy und bei Urlaubsreisen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Das Motto ist unschwer erkennbar: Ich will alles – und das sofort. Hätten wir – der Staat und auch die Bürger*innen – in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr nur um ein paar Prozent bescheidener gelebt, hätten wir das kaum bemerkt. Dafür hätten wir aber jetzt, die Haushalte genauso wie der Staat, ein solides Budget mit Potenzial für Zukunftsinvestitionen. So viel „hätte“ – jetzt ist es zu spät dafür. Denn nun investieren wir nur mehr in die Vergangenheit und pulvern das Geld in die (rasant steigenden) Zinsen für unsere Schuldenberge.
Der Untergang der Credit Suisse passt nahtlos in diese Geschichte. Bis vor kurzem schien es undenkbar, dass das einer Schweizer Bank passieren könnte. Seit einer gefühlten Ewigkeit wird die Schweiz als der sichere Hafen für Finanzen, der stabile Anker in einer durchgebeutelten Welt, die unsinkbare Titanic auf den monetären Ozeanen betrachtet. Und jetzt ist ein verdammt großes eidgenössisches Flaggschiff auf Grund gelaufen. Wie man liest, wieder einmal aus ziemlich banalen Gründen, die sich auf einen Begriff reduzieren lassen: Gier. Wenn ein derartig kolossales Finanzgefährt aufgrund jahrelanger kapitaler Manage-
ment-Fehlentscheidungen einmal Leck schlägt, braucht es nicht mehr viel. In diesem Fall waren es die steigenden Zinsen, mit denen die Europäische Zentralbank die aus dem Ruder laufende Inflation einzufangen versucht. Im Übrigen viel zu spät, um – ja da ist es schon wieder, das Wort – aus bloßer Gier weiterhin über den Verhältnissen segeln zu können. Alle namhaften Fachleute nennen einen Faktor, der darüber entscheiden wird, ob sich die Pleite der Credit Suisse zu einem weltweiten Bankentsunami ausweiten wird oder nicht: Vertrauen. Aber genau das ist ja das Problem: Da inzwischen das Leben über die Verhältnisse zur Normalität geworden ist, traut eigentlich keiner keinem mehr.
Die Credit Suisse ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele. Putin lebt über seine Verhältnisse und tut so, als gäbe es die Sowjetunion noch. Amerika lebt über seine Verhältnisse und agiert, als ob es die einzige Supermacht wäre. Beim Klima leben wir schon lange über die Verhältnisse und wundern uns jetzt, dass es tatsächlich wärmer wird. Wir verheizen weiterhin mit Vollgas fossile Brennstoffe von Jahrmillionen. Und weil es immer mehr sein muss, bauen die Chinesen wöchentlich zwei neue Kohlekraftwerke, bohren die Amerikaner Öl in Alaska und erklärt die EU den Atomstrom zur grünen Energie. Und wie in Tirol der Ausbau der Wasserkraft weitergehen soll, wenn kein Wasser mehr von oben kommt, weiß auch keiner. Die Beispiele ließen sich endlos weiterführen, im Großen wie im Kleinen. Fest steht: Irgendwie ist das Maß abhanden gekommen. Das spüren die Jungen und schütten aus Verzweiflung Gemüsesuppe über weltberühmte Bilder oder kleben sich am Asphalt fest, was leider auch nicht viel hilft.
Wir kommen aus all dem wohl nur dann heraus, wenn wir – alle! – die Bodenhaftung wieder finden und nicht gleich durchdrehen, wenn wir ab und zu einmal – Achtung: böses Wort – auf etwas verzichten. Wir haben lange genug das Gegenteil probiert. Wo es uns hingeführt hat, zeigt uns der Blick auf die aus den Fugen geratene Welt.

eco. mmentar 8
VON KLAUS SCHEBESTA
ehrlich. direkt.
BESTE QUALITÄT
ehrlich.tirol bietet küchenfertiges & vakuumiertes Fleisch bester Qualität vom heimischen Rind, Kalb oder Lamm. Wir arbeiten mit Sorgfalt für beste Güte und Geschmack.


REGIONAL
Die Bäuerinnen und Bauern stehen mit ganzem Herzen hinter ihren Lebensmitteln. Der Bauernhof ist am Etikett angeführt – du weißt immer, woher das Fleisch kommt.

TIERWOHL
RIND FLEISCH IN
VERSANDKOSTENFREIE ZUSTELLUNG IN GANZ ÖSTERREICH! GANZ BEQUEM ONLINE BESTELLEN & CO2-NEUTRAL NACHHAUSE GELIEFERT BEKOMMEN.

EHRLICH
Die ehrlich.tirol Mischpakete ermöglichen den Bauern eine ganzheitliche Abnahme und regionale Wertschöpfung und Wertschätzung.
DIREKT
Die Transportwege sind für die Tiere so kurz wie möglich - CO2-neutrale Zustellung des Fleischs in der Isolierbox mit der Post direkt nach Hause. Jetzt
Tierfreundliche Haltung mit saisonaler Weide und Alm, bestes Futter und Vollmilch für die Kälber - die Bäuerinnen und Bauern schauen auf ihre Tiere.
Unsere Bauern, Rezept-Ideen & Shop
RINDERZUCHT TIROL EGEN
Brixner Straße 1 · 6020 Innsbruck
ehrlich.tirol
bestellen unter
www.ehrlich.tirol
BIOQUALITÄT KALB FLEISCH LAMM FLEISCH

eco. porträt 10 © UNIVERSITÄT INNSBRUCK
11¾ FRAGEN AN VERONIKA SEXL
1. Wer sind Sie? Ich bin eine begeisterte und neugierige Wissenschaftlerin, die gerne Fragen stellt und auch gerne dabei hilft, Antworten zu finden.
2. Warum, glauben Sie, haben wir Ihnen geschrieben? Wahrscheinlich nicht, weil ich gerne hier in Tirol bin, sondern weil ich seit Anfang März die neue Rektorin der Universität Innsbruck bin.
3. Wie lautet Ihr Lebensmotto? Gemeinsam geht es besser!
4. Was macht Sie stolz? Meine beiden Söhne.
5. Was bedeutet für Sie Luxus? Zeit für eine Skitour, Ski fahren oder einen ausgedehnten Spaziergang zu haben.
6. Mit welcher bereits verstorbenen Persönlichkeit würden Sie gerne einen Abend verbringen? Mit Astrid Lindgren und Christine Nöstlinger, weil ich ihre Bücher als Kind verschlungen habe.
7. Was ist das ungewöhnlichste Thema, über das Sie richtig viel wissen? Ich bin ja auch Krebsforscherin und hier weiß ich viel über Moleküle und Zellen oder Vorgänge innerhalb dieser Strukturen. Die meisten Menschen leben aber auch ohne dieses Wissen glücklich.
8. Ihr Leben in Büchern: Wenn Sie den größten Meilensteinen in Ihrem Leben je ein Buch zuordnen müssten, welche wären das? Warum? Das wäre ein sehr sehr langes Unterfangen. Daher nenne ich nur ein Buch, das mir hier passend erscheint: „Die 40 Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel – eine Assoziation an meine Schulzeit.
9. In welchen Bereichen möchten Sie Schwerpunkte in Ihrer Arbeit an der Universität Innsbruck setzen? Gemeinsam mit meinem Team und mit allen anderen Uniangehörigen wollen wir den erfolgreichen Weg fortsetzen. Wichtig ist mir dabei, dass wir den wissenschaftlichen Nachwuchs, das Rückgrat universitärer Forschung und Lehre, noch besser als bisher fördern können und dass es gelingt, die Vereinbarkeit von Familie und wis-
senschaftlicher Karriere insbesondere bei jungen Frauen besser zu gestalten.
10. Was ist Ihre erste Erinnerung an Ihr Berufsleben? Die großartige Chance, immer wieder Neues zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen.
11. Worin sehen Sie die größten (gesellschaftlichen) Herausforderungen in den kommenden Jahren? Für mich ist das einerseits der Klimawandel und unser Umgang damit und andererseits die Frage, wie es uns gelingen kann, die vielen medizinischen Durchbrüche und Erkenntnisse nicht allein fürs Heilen zu nutzen, sondern viel mehr noch für die Vorbeugung, um das Heilen gar nicht so sehr zu benötigen.
11¾ : WELCHE FRAGE WOLLTEN SIE SCHON IMMER BEANTWORTEN, NUR HAT SIE NOCH NIE JEMAND GESTELLT?
SEXL: Was war ihr größter wissenschaftlicher Misserfolg? Darauf würde ich gerne antworten, dass es in der Wissenschaft eigentlich keinen Misserfolg gibt. Man hat eine Idee und verfolgt diese. Wenn diese Hypothese falsch war, eröffnen sich aufgrund dieser Erkenntnis tausend neue Fragen, die es zu beantworten gilt! So funktioniert Wissenschaft, ein ständiger Prozess.
ZUR PERSON
Veronika Sexl ist eine international anerkannte Forscherin auf dem Gebiet der Krebsforschung mit Schwerpunkt auf Leukämien. Nach dem Medizinstudium in Wien und Forschungsaufenthalten in Seattle und Memphis, USA, wurde sie 2007 Professorin an der Medizinischen Universität Wien und 2010 Institutsleiterin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VetmedUni). Sexl ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem ERC Advanced Grant, dem Novartis-Preis für Medizin und dem Alois Sonnleitner-Preis der ÖAW. Sie ist seit 1. März 2023 neue Rektorin die Universität Innsrbuck und folgt dem langjährigen Rektor Tilmann Märk nach.
eco. porträt 11
Frag die Jugend!
Nun ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die ihr Verhalten für eine langfristig gelungene Zukunft ändern müssten – nämlich vorrangig die ältere Generation – meist selbst gar nichts mehr von ihrer Verhaltensänderung haben. Deshalb fällt es vielen auch so schwer, bequeme, aber halt leider wenig nachhaltige Verhaltensmuster abzulegen. In der Regel muss der eigene Leidensdruck wirklich hoch sein, damit man einen anderen Weg einschlägt, und auch wenn der Klimawandel bereits spürbar ist, so sind die faktischen negativen Auswirkungen auf jeden Einzelnen hier in Österreich noch gering. Im Gegenteil: Manch einer freut sich sogar über die steigenden Temperaturen. Ein großer Hebel in Sachen Nachhaltigkeit ist die Energie, die im Zuge der Blackout-Frage eine zusätzliche Dimension bekommt. Und weil es vor allem die jungen Menschen sind, die mit den Folgen zu leben haben werden, sind beim Euregio-Jungforscher*innenpreis auch genau sie gefragt. Der Förderpreis für Nachwuchsforscher*innen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino wird von den Wirtschafts- und Handelskammern der Europaregion gestiftet und dieses Jahr bereits zum zwölften Mal vergeben. Bewerben können sich Wissenschaftler*innen unter 35 Jahren (Stichtag 19. August 1988), die an Universitäten, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen in den drei Landesteilen zum Thema Energie forschen oder aus der Euregio stammen und international tätig sind. Einreichungen sind noch bis 15. Mai 2023 möglich. Das beste Projekt wird mit 5.000 Euro gewürdigt, der zweite Platz ist mit 2.500 Euro und der dritte mit 1.000 Euro dotiert. Ausgewählt werden die Projekte von einer Jury unter der Leitung von Ulrike Tappeiner, Präsidentin der Freien Universität Bozen.
Infos und Online-Anmeldeformular unter www.euregio.info (Euregio / Aktuelles / News)

wirtschaft & unternehmen
12
WIRTSCHAFT
BUCHTIPPS

Armut* – Daniela Brodesser

Kremayr & Scheriau / Reihe: Übermorgen
104 Seiten, EUR 20,–
2021 waren in Deutschland und Österreich etwa 15 bis 17 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, rund 14,5 Millionen Menschen. Warum wir dennoch nichts über Armut wissen? Die Betroffenen schweigen – aus Scham, Angst, Schuldgefühl. Daniela Brodesser hat den Teufelskreis aus Stigmatisierung und sozialer Entfremdung erlebt, der mit Armut einsetzt. Und redet darüber. Ein längst überfälliges Buch!
Solidarität* – Natascha Strobl

Kremayr & Scheriau / Reihe: Übermorgen
104 Seiten, EUR 20,–
Die Art, wie wir leben, produzieren und wirtschaften, muss sich grundsätzlich ändern. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, wenn die Lösung echte Solidarität ist – ein kollektiver Wert, der individuelle Befindlichkeiten überwindet.
* Im zweiten Halbjahr werden wir uns intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen. Anregungen dafür sind gerne willkommen. Schreiben Sie uns unter bernardi@econova.at
Marina Bernardi, Chefredaktion
Kleben für die Zukunft
Eines vorweg: Die Jugend hat recht, wenn sie für ihre Zukunft eintritt. Und noch mehr hat sie das Recht dazu. Über das Mittel der Wahl allerdings lässt sich streiten.
Kürzlich stand ich des Morgens an der Innsbrucker Grassmayr-Kreuzung im Stau, nachdem sich ein Grüppchen junger Menschen dort festgepickt hatte. Eh ok. Es entstand dahingehend kein großer Schaden, als dass es bei mir ziemlich egal ist, ob ich eine halbe Stunde früher oder später im Büro ankomme. Es geht ja bei uns nicht um Leben und Tod oder ähnliche Dringlichkeiten. Außerdem meinte es meine Playlist gut mit mir und spielte recht launige Musik. Der Cayenne-Fahrer neben mir sah das weniger entspannt. Nun ist die Sache die: Der gute Herr würde vermutlich eher dazu ansetzen, mit Anlauf über die Klimaprotestler zu rattern, als dass er jemals auf sein Auto verzichtete.
UNTERNEHMEN DER AUSGABE
Gebäudetechnik und -steuerung wird immer intelligenter. Da braucht's jemanden, der all diese technischen Wunderbarigkeiten auch den Kund*innen verständlich übersetzt. Das Wörgler Unternehmen Lengauer – Smarte Gebäudetechnik hat in der Innsbrucker Straße in Wörgl deshalb einen neuen, modernen Gira-Partner-Showroom für intelligente Gebäudetechnik eingerichtet, in dem sich Häuselbauer, Planer*innen, Bauträger und Architekt*innen über aktuelle Branchentrends in der Gebäudetechnik und -automation informieren und natürlich die neuesten Produkte des Smart-Home-Pioniers Gira kennenlernen können – von der Lichtsteurung per App, dem schlüssellosen Türöffnen bis zu raumklimaoptimierenden Jalousien ist alles dabei. www.gira.at

Ich verstehe das hehre Anliegen der Festgeklebten, Aufmerksamkeit zu generieren und den Leuten so lange auf die Nerven zu gehen, bis sich endlich etwas tut. Dennoch denke ich, dass der Adressat der Verkehrte ist. Menschen, die aktiv und bewusst ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten, tun das vermutlich bereits. Wer mit seinem SUV zehn Meter zum Supermarkt fährt, wird sich auch durch Klebeaktionen nicht davon abhalten lassen. Die Klimadebatte ist nicht neu, doch keine Regierung hat sie bis dato als wirklich dringendlich genug erachtet, um tatsächlich wirkungsvolle Maßnahmen durchzusetzen ... die unter Umständen bedeuten könnten, dass man das nächste Mal nicht wiedergewählt wird. Vielmehr gibt man die Verantwortung nach unten weiter – an „jeden Einzelnen“. Doch die Erfahrung sollte uns lehren, dass das mit der Eigenverantwortung hierzulande nur so medioker funktioniert. Ich bin nicht dafür, das ganze Leben zu regulieren, aber bei den großen Dingen braucht’s klare Ansagen – von ganz oben!
Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at
eco. wirtschaft 13
eco. mmentar
©
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE
GIRA/THORBEN JURECZKO
„Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun.“
MARK TWAIN, SCHRIFTSTELLER
BIODIVERSITÄT IST LEBENSQUALITÄT

Bei allem Fokus auf den Klimawandel gerät eine unheilvolle Entwicklung aus dem Blick, die mit diesem im Zusammenhang steht und nicht minder bedrohlich ist: Der Verlust an Biodiversität, der sich seit Jahrzehnten immer mehr beschleunigt und ganze Ökosysteme zum Kollabieren bringen kann, ohne die der Mensch nicht existieren kann. Es ist spät, aber noch nicht zu spät, etwas dagegen zu tun.
TEXT: MARIAN KRÖLL
Auf der Erde herrscht ein Kommen und Gehen. Das war schon immer so. Tiere und Pflanzen werden lebendig und gehen nach Ende ihrer Lebenszeit wieder unter. Sie sind, um eine biblische Metapher aufzugreifen, dem Erdboden entnommen und kehren nach ihrem Tod in die Erde zurück. Sie werden Teil des Substrats, auf und von dem ein wesentlicher Teil der Tiere, die auf dem Planeten kreuchen und fleuchen, und der Pflanzen, die, überwiegend unauffällig Photosynthese betreibend herumstehen, lebt. Dieses Werden und Vergehen betrifft aber auch ganze Arten. Manche sterben aus, wieder andere evolvieren neu oder werden erst vom Menschen entdeckt und kategorisiert. Beschleunigt sich dieses Aussterben und betrifft große Teile des Artspektrums, ist von einem Massenaussterben –im Englischen Extinction Event – die Rede. Große Aussterbeereignisse sollen im Laufe der Erdgeschichte bereits öfter vorgekommen sein, Ereignisse in der Dimension eines Extinction Event soll es bisher fünf gegeben haben, so der Stand der Wissenschaft. Das vorläufig letzte, das fünfte, soll durch einen Kometeneinschlag eingeleitet worden sein und mit den Dinosauriern den Großteil der mesozoischen Fauna von der Erde getilgt haben.
MASSENSTERBEN HAUSGEMACHT
Heute verdichten sich die Anzeichen, dass wir uns bereits seit einigen Jahrzehnten im sechsten Massenaussterben befinden. Asteroiden sind dieses Mal gänzlich unschuldig an der Misere. Das ist positiv, weil dadurch der Verursacher die Chance hat, einen Kurswechsel zu vollziehen und das Sterben, wenn es auch nicht vollständig umgekehrt werden kann, doch zu verlangsamen. Dieses Phänomen mit offenem Ausgang hat der Mensch diesmal allein angerichtet und zu verantworten.

Das Anthropozän, das gegenwärtige Erdzeitalter, das der Mensch geprägt und daher nach sich benannt hat, ist durch Überkonsum und Übernutzung der Ressourcen der Erde gekennzeichnet. Das führt dazu, dass es für Tiere und Pflanzen zunehmend eng wird auf diesem Planeten. Der Druck auf tierische
Lebensräume führt zu unangenehmen Nebenwirkungen, die für den Menschen heftiger ausfallen können als ein Schnupfen. Tiere, die bislang nicht regelmäßig Kontakt zu Menschen hatten, sind ein Reservoir für Viren aller Art. Das hat man global im Zuge der jüngsten Pandemie leidvoll erfahren dürfen. Gut möglich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entkommen ist, ursprünglich stammt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Tier. Doch das nur am Rande. Im Anthropozän fallen Erd- und Menschheitsgeschichte schicksalshaft zusammen, das eine ist ohne das andere nicht mehr zu denken, so dominant ist der Einfluss des Menschen auf den Planeten geworden. Das bringt ganze Ökosysteme ins Wanken, bei manchen scheint der Kollaps unabwendbar, bei anderen gibt es noch Hoffnung, dass die negative Entwicklung, wenn schon nicht umgekehrt, so doch noch aufgehalten oder zumindest verzögert werden kann.
Zweifellos leben wir in einem Zeitalter instrumenteller Naturbeherrschung, einer Geisteshaltung, die bisweilen in die Hybris hineinkippt und unser heutiges Selbstverständnis dominiert. Die Rolle des Menschen als „Herr und Eigentümer der Natur“, wie der französische Philosoph René Descartes es einst formulierte, ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir richten uns den Raum – dieser umfasst den ganzen Planeten und wohl bald auch den Mond –nach unseren Bedürfnissen und Wünschen ein und passen die Umwelt unserer Lebensweise an, ohne Rücksicht auf deren Belastungsgrenzen zu nehmen. Die Rechnung dafür bekommt die Menschheit im Kollabieren ganzer Ökosysteme präsentiert. Erst allmählich scheint der Gattung Homo sapiens –die sich selbst die Attribute „weise, gescheit, klug und vernünftig“ (sapiens) zugeschrieben hat – zu dämmern, dass die Grenzen der Natur auch ihre eigenen Grenzen sind. Klimawandel und, das wird erst langsam bewusst, Biodiversitätsverlust sind die gegenwärtig größten Herausforderungen für die Menschheit und zugleich eine einzige große Zumutung, verlangen sie doch danach, dass sich der Mensch ändert und seine Lebensweise und seinen
eco. titel
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“
ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY
Modus Operandi im Umgang mit den endlichen Ressourcen des Planeten überdenkt. Eine „Get Out of Jail Free Card“ in Gestalt der Technologie gibt es diesmal nicht, auch wenn das gelegentlich von nicht ganz ernst zu nehmenden politischen Akteuren suggeriert wird. Wir können uns aus diesem Fiasko nicht herausentwickeln, der technologische Fortschritt wird es allein nicht richten können. Er kann lediglich dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen. Es geht darum, den Menschen und seinen Platz in der natürlichen Ordnung neu zu denken, ihn als Teil der Natur, als Lebewesen unter Lebewesen zu sehen. Ein kollektives „nach uns die Sintflut“ geht sich nicht mehr aus.
AKTIVISMUS IST BESSER ALS PASSIVISMUS
Jedenfalls ist es besser, zu viel tun zu wollen als zu wenig. Aktivismus ist besser als Passivismus. Punkt. Man kann der heutigen Jugend nicht vorwerfen, eine Zukunft erfinden zu wollen, die sich von der ihrer Elterngeneration unterscheidet. Über Detailfragen auf dem Weg dorthin lässt sich trefflich streiten: Ob es beispielsweise sinnvoll ist, den Verbrennungsmotor, der auch mit alternativen Treibstoffen betrieben werden könnte und das Rückgrat der europäischen Automobilindustrie darstellt, abzustellen und stattdessen rein auf die Elektromobilität – die ihre ganz eigenen auch ökologischen Herausforderungen mit sich bringt – zu setzen, ist längst nicht abgemacht. Mehr noch als die Frage des „richtigen“ Antriebsprinzips würde aber die Frage nach dem „richtigen“ – das heißt in diesem Fall umweltverträglicheren – Mobilitätsverhalten bewegen können. Aber damit kommt man gleich in das trübe Fahrwasser des Verzichts, der in einer Welt des vermeintlichen Überflusses übel beleumundet ist. Lieber scheinen wir auf ein paar Tier- und Pflanzenarten verzichten zu wollen als auf ein paar Kilometer im Privatfahrzeug. Das ist insofern erklärbar, weil die individuelle Mobilität immer noch ein Statussymbol ist. Je größer der individu-

elle Aktionsradius, desto größer die gesellschaftliche Aufwärtsmobilität, so die allzu simple Rechnung, Bali > Balkonien.
Bei aller geschäftigen Reisetätigkeit geht meist unter, dass man nur dort, wo man zu Fuß war, auch wirklich gewesen ist. Das hat zwar nicht Goethe gesagt, aber es stimmt, dass nur zu Fuß die Seele Schritt zu halten vermag. So ist der Mensch evolutionär angelegt. Resignation ist, so viel scheint gewiss, die falsche Reaktion auf die gegenwärtigen multiplen Herausforderungen. Zu sagen, es sei ohnehin bereits zu spät, man könne nichts mehr machen, es komme, wie es eben komme, macht passiv. Dabei gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und ins Handeln zu kommen, um zu retten, was zu retten ist. Das ist eine Generationenaufgabe, eine Mammutaufgabe, der eine gewisse Gerechtigkeit innewohnt: Niemand wird zu retten sein, wenn nicht alle gerettet werden. Probleme, die im globalen Maßstab entstanden sind, müssen auch global gelöst werden. So einfach und zugleich unendlich schwierig verhält sich die Sache.
Die Voraussetzungen, gemeinsam die Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und zu erhalten, sind denkbar schlecht, auch wenn es in der Vergangenheit mit dem Montreal-Protokoll oder gegenwärtig dem UN-Vertrag zum Schutz der Hohen See (BBNJ-Abkommen) Beispiele für internationale Kooperation zum Schutz der Artenvielfalt gab. Die internationale Ordnung ist fragil wie lange nicht. Am Horizont zeichnet sich bereits ein neuer Kalter Krieg ab, diesmal stehen wohl der Westen und China mit einem russländischen Vasallen einander in neuer Unversöhnlichkeit gegenüber. Die Position der übrigen BRICS-Staaten, von denen vor allem in ökologischer Hinsicht Brasilien und Indien zu den großen globalen Sorgenkindern gehören, wird sich erst noch herauskristallisieren.
EINE WELT OHNE INSEKTEN
IST EINE TOTE WELT
Manche Tierarten werden ohnehin als lästig empfunden, vor allem aus dem Reich der Insekten, deren Biomasse in den vergangenen dreißig Jahren um bis zu 75 Prozent abgenommen haben soll. Das lässt sich ausgerechnet beim Autofahren selbst beobachten. Vor nicht allzu langer Zeit war die Windschutzscheibe nach zügiger Fahrt in der warmen Jahreszeit voller Insekten, heute klatscht noch sporadisch da und dort ein Insekt gegen die Scheibe. Eine Welt ohne Insekten ist eine tote Welt. Das ist keine Metapher, sondern eine nüchterne Feststellung. Mehr als 85 Prozent der Pflanzenarten sind abhängig von Bestäubung durch Insekten, darunter solche, die zu den weltweiten Nahrungsgrundlagen zählen. Man kann einzelne Plantagen zwar – wie das heute teilwei-
Das Anthropozän, das gegenwärtige Erdzeitalter, das der Mensch geprägt und daher nach sich benannt hat, ist durch Überkonsum und Übernutzung der Ressourcen der Erde gekennzeichnet. Das führt dazu, dass es für Tiere und Pflanzen zunehmend eng wird auf diesem Planeten.
eco. titel 16
Zu sagen, es sei ohnehin bereits zu spät, man könne nichts mehr machen, es komme, wie es eben komme, macht passiv. Dabei gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und ins Handeln zu kommen, um zu retten, was zu retten ist.


se in China bereits gemacht wird – mit dem Pinsel von Blüte zu Blüte von Hand bestäuben, in großem Maßstab ist das aber nur für Einfaltspinsel eine denkmögliche Alternative zur Bestäubung durch Insekten.
DIE NATUR ALS WICHTIGSTER DIENSTLEISTER
Mit Verzichtsappellen gewinnt man in der „Me, myself and I“-Gesellschaft keinen Blumentopf. Das Wort „Verzicht“ ist ähnlich kontaminiert wie der „Kompromiss“ in politischen Kontexten, dem ein fauliger Geruch anhaftet. Daher lohnt es, die Sache einmal von einer anderen Perspektive her zu betrachten. Wer sich egozentrisch fragen mag: „Was hat denn die Natur je für mich getan?“, dem sei die Befassung mit dem sperrigen Begriff Ökosystemdienstleistungen* ans Herz gelegt. Dabei handelt es sich um den Nutzen und die Vorteile, die der Mensch aus seinen Ökosystemen bezieht. Die schlaue Wikipedia kennt auch ein paar Beispiele, die klarmachen sollten, dass die Leistungen des Ökosystems unverzichtbar sind: Ökosystemdienstleistungen sind das Bestäuben von Obstblüten durch Insekten, die Bereitstellung von nutzbarem Bewässerungs- und Trinkwasser durch natürliche Filtration von Niederschlag, die Reproduktion von Fischpopulationen als Nahrungsmittel sowie die Bereitstellung von frischer Luft und einer ansprechenden Umwelt für Freizeit, Erholung und ästhetischen Genuss. Der moderne Mensch, der sich häufig selbst des Hedonismus bezichtigt, zeigt sich in Bezug auf die Natur plötzlich genügsam. Betonwüsten und Asphaltbrachen in der Stadt lassen uns – obwohl diese im Sommer zur lebensfeindlichen Hitzeinsel werden können – seltsam kalt. Dabei verschafft Grünland, das vielfältigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen wie für den Menschen bietet, gerade in der Stadt Erleichterung. Die grüne Infrastruktur ist die Infrastruktur der Zukunft. Biodiversität ist Lebensqualität. Über all das und mehr haben wir uns im Anschluss eingehend mit dem Ökologen und Biodiversitätsexperten Johannes Rüdisser von der Universität Innsbruck unterhalten.
Zuletzt und der Vollständigkeit halber drängt sich –zumal das hier ein Wirtschaftsmagazin ist – die Frage auf, ob Biodiversität denn auch für die Wirtschaft gut ist. Das ist sie. Denn ohne Biodiversität kommt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft auch der Mensch auf die Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Das ist auch für die Wirtschaft schlecht, denn Tote konsumieren nicht.
*Im Stubaital im Bereich der Telfer Wiesen gibt es eine Erlebniswanderung, die Besucher*innen auf ca. 2,5 Kilometern Länge und auf elf Stationen die vielfältigen und wertvollen Ökosystemleistungen unmittelbar näherbringen soll. Nähere Informationen im Netz unter www.oekosystemleistung.org
KLIMASCHUTZ MIT INNOVATION STATT VERBOTEN
Klimaschutz ist eine der großen Prioritäten dieser EU-Gesetzgebungsperiode. Mein Zugang dazu ist eindeutig: Ökologie und Ökonomie können nur durch Innovation und nicht durch Verbote verbunden werden – besonders mit Blick auf die soziale Balance und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das ist die Grundlage der ökosozialen Marktwirtschaft. Leider sind pauschale Verbote heute immer häufiger das Mittel der Wahl. Das Verbot des Verbrennungsmotors ist hierfür ein mahnendes Beispiel. Es ist nicht richtig, batteriebetriebene Autos als einzige Alternative zu forcieren. Sie werden ihren Platz im Markt finden und das ist gut so. Jedoch haben sie auch Schwachstellen, die teilweise schöngerechnet werden.
Ich plädiere deshalb für Technologieoffenheit: Besonders Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe haben das Potential, den Verbrennungsmotor klimafreundlich zu machen. Es gibt also mehrere Lösungen für einen CO2-neutralen Verkehr und Menschen sollen selbst entscheiden dürfen, welche sie nutzen möchten. Dafür braucht es kein Verbot, sondern Ingenieurskunst und Wettbewerb. So fördern wir europäische Innovation, schaffen europäische Arbeitsplätze und nutzen europäische Ressourcen. PR

17
kommentar
Barbara THALER, Tiroler Abgeordnete zum Europäischen Parlament
www.barbara-thaler.at thalerbarbara www.eppgroup.eu/de eppgroup
„Ökologie und Ökonomie können nur durch Innovation und nicht durch Verbote verbunden werden.“

18
KRISEN GEMEINSAM LÖSEN
Im Schatten der Klimakrise kommt es auf der Erde zu einem rasch zunehmenden Verlust der Artenvielfalt, der auch vor unserer Haustür nicht Halt macht. Wie die Situation derzeit aussieht und was getan werden muss, haben wir mit dem Biodiversitätsexperten Johannes Rüdisser erörtert.
INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Es wird immer wieder thematisiert, dass seit einigen Jahrzehnten ein zunehmender Biodiversitätsverlust zu beobachten sei. Trifft denn die unheilvolle Diagnose „Massenaussterben“, wie dieser Zustand verschiedentlich bezeichnet wird, zu? JOHANNES RÜDISSER: Ja. In wissenschaftlichen Publikationen ist bereits vielfach vom sechsten Massenaussterben die Rede. In der Evolution ist es normal, dass neue Arten kommen und auch Arten wieder verschwinden. Es gibt aber Untersuchungen, die belegen, dass derzeit die Aussterberate um ein Vielfaches größer ist als normalerweise. Man geht davon aus, dass diese um den Faktor 100 bis 1.000 erhöht ist.
In der Erdgeschichte hat es bereits mehrere dieser Extinction Events gegeben. Worin unterscheidet sich dieses von den vorangegangenen? Es ist davon auszugehen, dass wir erst am Beginn des Massenaussterbens stehen. Die Hinweise verdichten sich, dass wir auf ein solches zusteuern. Das bisher letzte Ereignis dieser Art führte unter anderem zum Aussterben der Dinosaurier und liegt 66 Millionen Jahre zurück.
Vom Menschen war da für Millionen von Jahren noch weit und breit keine Spur. So ist es. Die früheren, bekannten Massenaussterben gingen alle auf globale Naturkatastrophen zurück. Bei den Dinosauriern war vermutlich ein Meteoriteneinschlag ausschlaggebend, der die Erde massiv erschüttert hat und zu einem langjährigen globalen Winter geführt hat, weil so viel Staub in
der Atmosphäre gewesen sein dürfte. Beim heutigen Massenaussterben gibt es aber eigentlich nur eine Ursache, und die sind wir, die Menschen.
Ist das wirklich so monokausal? Das Massenaussterben ist einzig dem Menschen anzulasten, weil wir so viel an Natur und Lebensraum verändern und auch zerstören.
Wann hat dieses Massenaussterben dermaßen Fahrt aufgenommen? Daten, die ein solches Extinction Event nahelegen, wurden in den 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgenommen. Wir haben auch schon in früheren Zeiten – noch vor der Industrialisierung – unsere Umwelt massiv verändert. Im Alpenraum gab es schon einmal viel weniger Waldflächen als heute, wir haben vor ca. 200 Jahren Wolf, Luchs, Bär, aber auch einige Paarhufer fast ausgerottet. In Europa kam es zu einem
massiven Schub mit den 1950er-, 1960erund 1970er-Jahren durch die sich beschleunigende Industrialisierung, aber auch durch die industrielle Landwirtschaft. Vieles deutet darauf hin, dass der breite Biodiversitätsrückgang bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann.
Wie ist es um die Artenvielfalt derzeit –global sowie im Alpenraum – bestellt? Man muss zwischen Artensterben und Biodiversitätsverlust unterscheiden. Das Aussterben einer Art ist die Spitze des Eisbergs. Ein Extremereignis, das nicht mehr umkehrbar ist. Bevor es so weit kommt, passiert aber sehr viel. Die Arten gehen massiv zurück, haben weniger Raum, immer kleinere Populationen. Erst am Ende dieser Entwicklung steht das Aussterben. Die globale Situation und jene im Alpenraum ist schwer zu vergleichen. Prinzipiell ist mit Blick auf die Artenzahlen der Alpenraum sicher ein Hotspot der Biodiver-
eco. titel 19
„Die Biodiversitätskrise ist für uns mindestens so bedrohlich wie die Klimakrise. Diese Krisen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt derzeit, was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft, eine Art Goldgräberstimmung. Die Biodiversität verliert man dabei oft aus den Augen. Das wird nicht funktionieren.“
JOHANNES RÜDISSER
sität. Wir haben eine sehr hohe Biodiversität, nicht so hoch wie in den Tropen, aber im europäischen Vergleich herausragend. Allein in Österreich gibt es mehr Tagfalter als in ganz Deutschland, bedingt durch die vielfältigen Landschaftsformen – Alpenraum, Voralpenraum – mit ihren jeweils unterschiedlichen Klimazonen. Allein in Tirol gibt es gleich viele Tagfalterarten wie in ganz Deutschland.
Ist Tirol mit seiner landestypischen Almwirtschaft, die unter anderem dafür sorgt, dass die Waldgrenze niedriger liegt als sie läge, wenn man der Natur ihren Lauf ließe, für die Artenvielfalt ein positiver oder negativer Faktor? Die traditionelle, extensive Almwirtschaft ist positiv. Der Großteil unserer Flächen wäre bewaldet. Durch das Schaffen einer Kulturlandschaft sowohl auf Almen als auch in Tallagen sind Lebensräume für Wiesen- und Steppenarten entstanden. Diese mosaikartige Kulturlandschaft ist ein wesentlicher Grund, warum der Alpenraum heute so artenreich ist. Die Problematik entsteht durch zu intensive Nutzung. Das überleben nur Arten, die diese Intensivierung auch aushalten.
Wie entwickelt sich die Situation hierzulande? 60 Prozent aller in Österreich natürlich vorkommenden Lebensräume gelten als gefährdet, so wie ein Drittel der Pflanzenarten und Pilze. Bei den Tierarten gelten geschätzt 40 Prozent als gefährdet, bei den Wirbeltieren sind es sogar fast 60 Prozent.
Ist die Situation hierzulande besser oder schlechter als im globalen Durchschnitt?
Das ist schwer zu sagen, weil wir uns in unterschiedlichen Phasen befinden, was die Veränderung der Landwirtschaft betrifft. Man muss mitbedenken, dass unser lokales Handeln an anderen Orten zu Biodiversi-
tätsverlusten führt. Ein Beispiel: Milchkühe fressen heute sehr viel Kraftfutter, das zu einem großen Teil aus Südamerika kommt und für dessen Produktion in extrem intensiven Monokulturen extensive Graslandschaften zerstört und auch Regenwälder abgeholzt werden. Diese Monokulturen richten dort immensen Schaden an Mensch und Natur an, aber auch bei uns, weil über dieses Futter die Nährstoffkreisläufe bei uns gestört werden – und viele Landwirt*innen nicht mehr wissen, wohin mit der Gülle. Das Globale lässt sich also vom Lokalen nicht so einfach trennen. Der Amazonas-Regenwald steht durch seinen Rückgang vor einem kritischen Kipppunkt mit massiven Folgen für das globale Klima.
Folglich gilt für die globale Artenvielfalt dasselbe wie für das Weltklima. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen und es gibt Rückkopplungseffekte. Das ist global betrachtet auf jeden Fall so. Manche Biodiversitätseffekte können kleinräumig allerdings noch schneller wirken als klimatische Veränderungen – im Positiven wie im Negativen.
Bei welchen Tierarten ist der beobachtbare Rückgang am dramatischsten? Das hängt direkt mit der erwähnten Kulturlandschaft zusammen. In Österreich sind besonders diese Offenland-, Wiesen- und Steppenarten bedroht, im Osten zum Beispiel der Feldhamster, bei uns klassischerweise Schmetterlinge, die auf Extensivwiesen vorkommen. Generell bedroht sind Spezialisten. Das sind Arten, die auf ganz bestimmte Lebensräume und Umweltbedingungen spezialisiert sind und daher nicht leicht ausweichen können. Gibt es keine Feuchtlebensräume mehr, verschwinden auch die Arten, die exklusiv dort leben können.
Liegen die größten Sündenfälle, was die Feuchtbiotope betrifft, nicht bereits in der Vergangenheit? Mit Flussrenaturierungen, die unter anderem dem Hochwasserschutz dienen, dürften diese Lebensräume doch eher wieder größer werden. Ja, hier ist in der Vergangenheit viel zerstört worden – global geht man von 85 Prozent aller Feuchtgebiete aus –, aber mit Blick auf den Flora-Fauna-Habitat-Bericht gehen nach wie vor viele dieser Lebensräume verloren. Hauptgefährdungsursache für Feuchtwiesen und Moore ist nach wie vor die Entwässerung, die eigentlich verboten ist. Das ist ein Gesetzesbruch, der aber immer wieder passiert. Die Renaturierung einzelner Flusslandschaften ist eine wichtige und sinnvolle Maßnahme, wie viel sie ökologisch bringt, ist wissenschaftlich noch zu wenig erforscht. Die EU-Kommission hat 2022 einen Entwurf für ein Nature Restoration Law vorgelegt, ein bindendes rechtliches Instrument zur Wiederherstellung der Natur. Ein unheimlich wichtiges Instrument, über welches es in nächster Zeit wohl noch viele Diskussionen geben wird.
Wird zur landwirtschaftlichen Nutzung entwässert oder werden diese Flächen versiegelt bzw. verbaut? Beides. Großteils aber wahrscheinlich zur „Verbesserung“ der landwirtschaftlichen Flächen.
Lässt sich die Entwässerung rückgängig machen und das Ökosystem wiederherstellen? Die Wiedergutmachung dauert generell viel länger als die Zerstörung. Feuchtwiesen kann man prinzipiell wieder vernässen, ein trockengelegtes Moor braucht viele Jahre, bis es sich wieder erholt. Teilweise wird renaturiert, das ist aber viel aufwendiger als der Erhalt der Natur.
Die EU will Schäden an der Natur bis 2050 weiträumig beheben. Gibt es dafür entsprechende Budgetmittel, weil Renaturierung nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell aufwändig ist? Dafür werden die EU und die Mitgliedsstaaten entsprechende Finanzierungsschienen bereitstellen müssen. Beispielhaft ist in Österreich der neu eingerichtete Biodiversitätsfonds zu nennen, der bis 2026 mit 80 Millionen Euro ausgestattet wurde. Nötig – und daher vom Österreichischen Biodiversitätsrat so gefordert – wäre aber eine Größenordnung von einer Milliarde Euro.
Welchen Einfluss haben Neobiota – also vom Menschen eingeschleppte Tiere und
eco. titel 20
„Wir verbrauchen in Folge unserer Konsumgier wahnsinnig viel an Rohstoffen und Räumen. Schlägt man die Brücke zur Klimakrise, verbrauchen wir binnen Jahrzehnten mit den fossilen Brennstoffen jene Rohstoffe, die aus einem ganz anderen Erdzeitalter kommen. Ressourcen, die über Millionen von Jahren durch Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen entstanden sind.“
JOHANNES RÜDISSER
Pflanzen –, die sich in ihrer neuen Heimat verbreiten, auf die Artenvielfalt? Neozoen und Neophyten zeigen ein Phänomen, das wir als Vereinheitlichung des Artspektrums bezeichnen. Es handelt sich oft um Generalisten, konkurrenzstarke Arten, die im Gegensatz zu Spezialisten überall vorkommen können. Manche dieser Neophyten sind so konkurrenzstark, dass sie andere Arten verdrängen und ganze Lebensräume wie Monokulturen überwuchern. Das liegt natürlich auch an den fehlenden Fressfeinden oder Parasiten. In erster Linie ist das ein Phänomen der Globalisierung, das im Kontext des Biodiversitätsverlusts eine gewisse, aber nicht die größte Rolle spielt. Die meisten der eingeschleppten Arten werden uns erhalten bleiben und früher oder später wird sich ein Konkurrent bzw. Fressfeind finden.
Nimmt man auch beim Artensterben – analog zum Klimawandel – Kipppunkte an, bei deren Überschreiten der Biodiversitätsverlust nichtlinear zunimmt? Diese Kipppunkte gibt es definitiv. Ein gutes Beispiel ist ein See, der überdüngt wird, wodurch es zu einem sehr starken Algenwachstum kommt, das diesen zum Kippen bringt, weil der Sauerstoff ausgeht. Dieser See ist ökologisch tot. Es gibt diese Phänomene zweifellos. Generell sind Ökosysteme umso stabiler, je vielfältiger sie sind. Verschiedene Arten haben unterschiedliche Funktionen, die teilweise redundant sind. Verschwindet eine Art, ist das noch nicht so schlimm, weil andere Arten diese Funktionen übernehmen. Fehlen irgendwann zu viele Arten und damit Funktionen, ist ein Kipppunkt erreicht. Dann brechen die ökologischen Netzwerke zusammen und die Artenverluste steigen exponentiell an. Wie sich solche dynamischen Systeme verhalten, ist aber sehr schwer prognostizierbar, zumal ökologische Systeme lebendig sind und dort fortwährend Reparaturen stattfinden.
Können sich die Arten schnell genug an Veränderungen anpassen, oder ist Evolution dafür ein zu langsamer Prozess?
Bei der Biodiversität geht es nicht nur um Arten, sondern auch um Vielfalt innerhalb einer Art. Es kann sein, dass ein Individuum bereits jetzt eine genetische Anpassung hat, mit der es auf neue Verhältnisse reagieren kann. Deshalb ist die Vielfalt innerhalb einer Art und zwischen den Ökosystemen so wichtig.
Ist es ein Problem, wenn man versucht, Arten wieder anzusiedeln, von denen
ZUR PERSON
Dr. Johannes Rüdisser ist Landschaftsökologe am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Er engagiert sich im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrates (www.biodiversityaustria.at) an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und ist Initiator und Leiter des „Viel-Falter“-TagfalterMonitorings (www.viel-falter.at), bei dem engagierte Lai*innen ergänzend zu Expert*innen regelmäßig Schmetterlinge beobachten. Neben seinen Forschungstätigkeiten ist er auch als Natur- und Umweltpädagoge tätig.

es nur noch eine sehr kleine Population gibt? Sind diese Arten dann automatisch weniger resilient? Das ist richtig. Das haben wir beim Steinbock, der im Alpenraum genetisch auf weniger als 100 Individuen zurückgeht. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine Krankheit schnell die ganze Population gefährden kann.
Es lassen sich also Arten zwar retten, aber die Vielfalt innerhalb einer Art nicht mehr so einfach wiederherstellen? Ist die Population erst einmal auf sehr wenige Tiere reduziert, trägt sie diesen genetischen Flaschenhals sehr lange mit, bis wieder eine gewisse Variabilität erreicht ist.
Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Artensterben? Die wichtige Botschaft ist, dass es
eine gemeinsame Ursache gibt: der menschliche Ressourcenverbrauch. Wir müssen beide Krisen gemeinsam lösen. Es ist ein Denkfehler, wenn man die Klimakrise auf Kosten der Biodiversität lösen will. Das führt uns in eine noch größere Krise. Die beiden Krisen verstärken einander. Der Klimawandel bringt unsere Spezialisten, insbesondere alpine Arten, unter Druck, da sie irgendwann nicht mehr in höhere, kühlere Regionen ausweichen können. Ein breites Artenspektrum mit hoher Variabilität ist eine Rückversicherung unter sich verändernden Bedingungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns nicht zu katastrophalen Biodiversitätsverlusten kommt. Der Klimawandel wird aber jedenfalls zu massiven Veränderungen führen.
Was kann getan werden, um das Artensterben zu verlangsamen, wenn man es schon nicht völlig umkehren kann? Es kann noch sehr viel getan und wieder rückgängig gemacht werden. Wir können eine Art, die global ausgestorben ist, nicht wieder zurückholen. So viel ist klar. Aber die meisten Arten sind ja noch nicht gänzlich ausgestorben, sondern bedroht, weil wir ihnen ihre angestammten Lebensräume weggenommen haben. Gibt man diese Lebensräume wieder zurück, werden auch diese Arten, ihre Funktion in den Ökosystemen und damit auch die Leistungen, die wir aus diesen Ökosystemen beziehen, zurückkommen. Viele Populationen erholen sich erstaunlich gut, wenn wir ihnen wieder Lebensräume geben.
21
Wollte man daraus ein paar politische Handlungsempfehlungen stricken, wie würden diese lauten? Natürliche Lebensräume, in denen es noch Dynamiken gibt, müssen unbedingt erhalten bleiben und entsprechend geschützt werden. Von diesen Lebensräumen gibt es nicht mehr viele.
Reicht der Schutz, wie ihn Nationalparks bieten, aus? Der Nationalpark stellt die höchste Schutzkategorie dar und ist in weiten Bereichen gut. In einigen Bereichen braucht es bessere Pufferzonen, weil Schutzgebiete oft unmittelbar an intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen angrenzen. In der Biodiversitätsstrategie der EU und Österreichs gibt es das Ziel, 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen. Davon sind wir in Österreich, wenn man alle Schutzkategorien zusammenzählt, mit 27 Prozent nicht weit weg. Allerdings stellt sich die Frage nach der Qualität dieses Schutzes. In der EU gibt es das Ziel, zehn Prozent der Flächen streng zu schützen. Von diesem Ziel sind wir mit zwei, drei Prozent in Österreich noch weit weg. Wir brauchen noch mehr besser geschützte und auch gemanagte Schutzgebiete.
Was gilt es abseits der Schutzgebiete sonst noch zu tun? Die Landwirtschaft muss biodiversitätsfreundlicher werden, etwa durch Elemente in der Landschaft, die Lebensraum schaffen. Das nennt man auch Trittsteinbiotope, die Schutzgebiete miteinander verbinden. Die Landnutzung muss zugleich auch biodiversitätsfreundlicher werden. Der Pestizideinsatz muss massiv reduziert werden.
Die industrielle Landwirtschaft wird sich mit Biodiversität wohl kaum vereinbaren lassen? Da braucht es tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Produktivität darf nicht der einzige Fokus sein. In einer industrialisierten Landschaft bleibt kein Lebens-, aber auch kein Erholungsraum für den Menschen. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Agrarförderungen sind nach wie vor der größte Posten im Budget der EU. Das ist durchaus legitim, aber diese Förderung sollte gleichzeitig einen Mehrwert und Zusatznutzen für die Gesellschaft leisten. Mehr Raum für Biodiversität bedeutet auch mehr Raum für uns Menschen, angenehmere Erholungsräume, die auch für die touristische Nutzung interessant sind.

Was kann der Dauersiedlungsraum in dieser Hinsicht leisten? Dort muss es uns
gelingen, vermehrt Ersatzlebensräume zu schaffen, zum Beispiel mit begrünten Dächern. Auch der begrünte Kreisverkehr, Parkanlagen und Abstandsgrün können –ja müssen – biodiversitätsfreundlich gestaltet werden.
Das ist auch für das städtische Mikroklima von Bedeutung, vor allem dann, wenn man sich die urbanen Hitzeinseln im Sommer vor Augen führt. So ist es. Darum ist das Konzept der „grünen Infrastruktur“ so sinnvoll und aussagekräftig. Grünzüge bringen kühle Luft und Feuchtigkeit in die Städte. Mehr Grün im Siedlungsgebiet sorgt für mehr Lebensqualität.
„Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen.“ Dieses Zitat wird gerne fälschlich Albert Einstein untergeschoben. Wie ungemütlich kann dieses Massenaussterben für den Menschen tatsächlich werden? Sehr ungemütlich. Ein Großteil unseres Wohlstands und unserer Lebensqualität beruht auf natürlichen Ressourcen. Wenn wir zu viel davon zerstören, geht das mit einem massiven Verlust von Lebensqualität einher. Es geht bei der Biodiversitätskrise nicht nur darum, Orchideen oder seltene Schmetterlinge zu retten, sondern um unser
Leben. Unser Wohlstand hängt stark von Leistungen aus der Natur ab, den sogenannten Ökosystemleistungen. Das Bienenzitat ist nicht ganz abwegig. Gehen die Insekten extrem zurück, haben wir ein ernsthaftes Problem.
Ökosysteme sind in sich und in ihren Wechselwirkungen sehr komplex. Hat die Wissenschaft schon alle Zusammenhänge verstanden? Nein, wir stehen gerade erst am Anfang. Viele Versuche macht man in Modellen, mit Ökosystemen, die nur ein paar wenige Arten haben. Das entspricht nicht der Realität und lässt uns die Wechselbeziehungen und -wirkungen höchstens erahnen. Beim Klima haben wir weniger Variablen, und diese beruhen auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Ein lebendiges Ökosystem ist ungleich komplexer. Was wir verstanden haben, ist, dass wir in einer schweren Krise stecken.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen unseren Ernährungsgewohnheiten und dem Artensterben? Den gibt es, weil die industrialisierte Landwirtschaft eine der Hauptursachen der Biodiversitätskrise ist. Fleisch wird zumeist unter großem Energieund Kraftfuttereinsatz produziert, dessen Anbau große Lebensräume zerstört.
eco. titel
Let’s do business, George!


JOHANNES RÜDISSER
Nützte es etwas, wenn wir begännen, im großen Stil Insekten zu essen? Es gibt erste Versuche, den Verzehr von Insekten zu enttabuisieren. Es macht natürlich Sinn, über den Konsum alternativer Nahrungsmittel nachzudenken. Die Produktion von tierischem Protein ist extrem ressourcenintensiv. Für ein Kilo Fleisch brauche ich mindestens die zehnfache Menge an Energie, Wasser und anderen Ressourcen wie für ein Kilo pflanzliches Protein zum Beispiel in Form von Bohnen. Protein aus Insekten ist beim Ressourcenverbrauch irgendwo zwischen Fleisch und Pflanzenprotein angesiedelt. Traditionell werden in vielen Erdteilen Insekten in verschiedenen Formen gegessen. Pilze sind eine weitere gute Alternative, um Lebensmittel mit weniger Ressourcenaufwand zu produzieren. Noch besser als der Verzehr von Insekten ist natürlich Pflanzenprotein. Eine deutliche Reduktion unseres Fleischkonsums ist nicht nur gesund, sondern ermöglicht auch eine naturfreundlichere Landwirtschaft.
Können Sie sich das Herumgeeiere Österreichs beim Thema Glyphosatverbot in der Landwirtschaft erklären? Aus fachlicher Sicht gibt es dafür keine Erklärung. Leider ist in der österreichischen Landwirtschaftspolitik zu beobachten, dass diese nicht als Politik für die Gesellschaft begriffen wird, sondern oft als Lobbyarbeit für eine kleine Gruppe industrialisierter Landwirt*innen. Es scheitert am Selbstverständnis dieses Politikbereichs, der sich eigentlich in den Dienst der Gesellschaft stellen sollte. Es ist wichtig, Glyphosat nicht durch einen anderen Stoff zu ersetzen, sondern den Pestizideinsatz generell stark zu reduzieren.
Was kann man als Konsument mit der Kraft der Brieftasche dazu beitragen, die Situation zumindest nicht zu verschlechtern? Es wird oft übersehen, dass der beste Konsum der Nichtkonsum ist. Wir müssen dabei vom wirtschaftlichen Paradigma des ständigen Wachstums wegkommen, das in physikalisch begrenzten Systemen nicht aufrechtzuerhalten ist. Wir konsumieren über unsere Möglichkeiten hinaus. Bei den Lebensmitteln empfiehlt es sich, biologisch, lokal und saisonal zu konsumieren. Die Mutterkuhhaltung, die im Rahmen der extensiven Almwirtschaft betrieben wird, ist aus Biodiversitätsperspektive durchaus sinnvoll, die Kuh, die mit Kraftfutter gemästet wird und in erster Linie im Stall steht, nicht.
Sehen Sie die Raumordnung als mögliches Instrument, das verstärkt zum Erhalt von Biodiversität beitragen kann und diese nicht vernichtet? Die Raumordnung kann eine zentrale Möglichkeit werden, die grüne Infrastruktur zu planen. Planungen sollten überregional stattfinden. Es braucht einen strategischen Blick, um den Flächenverbrauch auf ein Zehntel des bisherigen Ausmaßes eindämmen zu können. Derzeit verbrauchen wir 13 Hektar pro Tag, wir sollten auf maximal einen Hektar kommen. Wir brauchen eine Verbesserung der Qualität und Erweiterung bestehender Schutzgebiete, Korridore und Trittsteinbiotope –die zuvor erwähnte grüne Infrastruktur. Diese kann aber nur überregional geplant werden. Die Raumordnung ist Gemeindesache, und Bürgermeister*innen stehen bei Widmungsangelegenheiten natürlich unter großem Druck, wenn es den Nachbarn oder potenziellen Wähler betrifft.
Gibt es bereits geeignete Widmungskategorien, die zum Erhalt der Biodiversität beitragen können? Es gibt Ansätze in diese Richtung, zum Beispiel die Ruhegebiete, die es spezifisch in Tirol gibt. Das ist eine defensive Maßnahme, weil Räume ausgewiesen werden, die nicht erschlossen werden dürfen. Wir bräuchten aber eigentlich eine proaktive Herangehensweise, um eine grüne Infrastruktur zu planen und zu erhalten. Dazu fehlen großteils noch die bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen.
Was kann man als (Klein)gartenbesitzer tun, um etwas zur Biodiversität beizutragen? Weniger tun. Weniger aufräumen, ein Stück vom Rasen ungemäht lassen. Man kann im Garten gute Ersatzlebensräume schaffen. Will ich Insekten fördern, braucht es ein Blühangebot. Gewürzkräuter – wie etwa Thymian, Lavendel, Oregano – eignen sich dafür sehr gut. Es können einmal Laub oder Totholz liegen bleiben, offene Bodenoder Sandstellen und insgesamt „Wildnisbereiche“ eingerichtet werden. All das fördert die Vielfalt. Außerdem sollte man natürlich konsequent auf Pestizide und Insektizide verzichten.
Wir haben viel über Krisen und Probleme gesprochen. Gibt es ein paar Good News zu dem Thema auch zu berichten? Es ist noch nicht zu spät. Wir können noch gegensteuern. Wir haben dafür das Wissen, die Möglichkeiten und die Ressourcen. Wir müssen es nur wollen und endlich tun. Es gibt bereits vereinzelt Projekte, die gute Ergebnisse bringen, etwa die Renaturierung von Mooren. Moore sind besonders wichtig, weil sie für die Biodiversität genauso wie gegen den Klimawandel gut sind. Die Renaturierung von Flüssen zeigt auch vielversprechende Ergebnisse. Die Wasserqualität unserer Fließgewässer ist in den letzten Jahrzehnten durch Kläranlagen und strengere Regeln viel besser geworden. Es hat sich bereits sehr viel in eine positive Richtung entwickelt. Ich habe zudem das Gefühl, dass es in den letzten Jahren zu einem Bewusstseinswandel gekommen ist und mittlerweile auch Wirtschaftszeitungen auf mich und meine Kollegen zukommen, um mehr zu erfahren. Zuletzt glaube ich, dass die Politik der Bevölkerung in diesem Bewusstsein noch hinterherhinkt. Aber es geht in einigen Bereichen in die richtige Richtung.
eco. titel 24
„Es ist als Wissenschaftler*innen einerseits unsere Aufgabe, zu warnen, aber auch darauf hinzuweisen, dass wir etwas tun können. Bei der Klimakrise hat es 30 Jahre gedauert, bis die Fakten im breiten Bewusstsein angekommen sind. Ins Handeln sind viele noch immer nicht gekommen. Bei der Biodiversitätskrise haben wir ganz sicher nicht mehr 30 Jahre lang Zeit, das Falsche zu tun.“
IM.ABO
7 AUSGABEN – DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN
7 AUSGABEN – ECO.NOVA SPEZIAL

ZUM VORZUGSPREIS VON 29 EURO


(AUSLAND: 49 EURO)

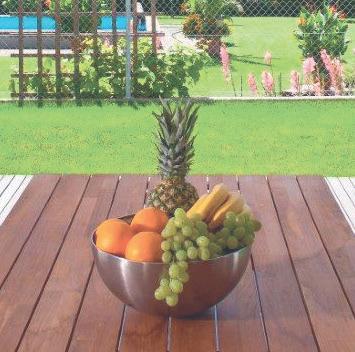

E-MAIL: REDAKTION@ECONOVA.AT | ABO-HOTLINE: 0512/29 00 88-10
WWW.ECONOVA.AT







SONNENSCHUTZ



b e i D o l e n z G oll ne r

Ihr Partner für Sonnenschutzlösungen in Tirol


promotion 25 Innsbruck, Grabenweg 12 (hinter Media Markt)
0512/2402, ww w.dolenzgollner-wagner at
Tel
!
des Sommers
aufrollbare Sonnensegel
für die I nnengestaltung
Auswahl
tenmöbel
I hr Wohnzimmer
Das
Alles
Alles für den Außenbereich Große
an G ar
N° DiefettenJahresindvorbei500 top SCHON IMMER ÜBER DIE BESTEN UNTERNEHMEN IN TIROL WOLLTEN. N° 02 lifestyle P.B.B. VERLAGSPOSTAMT 6020 INNSBRUCK ZNR. 02Z030672 EURO 3.00 N° 01 WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN
WIR MACHEN MAGAZIN.
ES IST KOMPLIZIERT
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Es wäre ein so simpler wie logischer Leitsatz für ein gelingendes Leben – und Wirtschaften –, den wir schon unseren Kindern beibringen. Ganz so einfach ist‘s dann allerdings doch nicht, wie es scheint. Es wäre jedoch wichtig, denn es geht um nichts Geringeres als die Vermeidung eines ökologischen Desasters, das folglich in alle anderen Lebensbereiche hineinspielt.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Kerstin Neumann ist Universitätsprofessorin für Corporate Sustainability am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck. Sie forscht an der Schnittstelle von Strategie, Organisation und unternehmerischer Nachhaltigkeit mit dem Ziel, zu verstehen, wie Unternehmen ihre ökonomische, soziale und ökologische Performance nachhaltig gestalten und dabei positive, langfristige Impulse für ihr sozioökonomisches System und ihre Stakeholder schaffen. Wir haben mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie sich Unternehmen nachhaltig entwickeln können.
ECO.NOVA: Nachhaltigkeit ist ein sehr breites Gebiet und heißt heute eigentlich alles und nichts. Wie definieren Sie Nachhaltigkeit in Ihrer Forschung und Lehre?
KERSTIN NEUMANN: In unserer Forschung zu Corporate Sustainability orientieren wir uns prinzipiell an den Definitionen der maßgeblichen Institutionen. Einfach gesprochen geht es darum, dass ein Unternehmen, ein System, eine Organisation im Bestreben, die heutigen Bedürfnisse der eigenen Stakeholder zu befriedigen, der nachfolgenden Generation nicht die Möglichkeit nimmt, ihre Bedürfnisse ähnlich gut zu befriedigen. Es geht also erstens darum, die Bedürfnisse nicht nur der Finanzgeber, sondern verschiedener Stakeholder zu beachten, und zweitens
um das Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit. Für Unternehmensmanager*innen und -eigentümer*innen erhöht dies im daily business die Komplexität. Es gilt, die langfristige Prosperität eines Unternehmens im Blick zu haben. Dafür muss man sich bewusst machen, dass das Unternehmen in ein System eingebettet ist, das es nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial beeinflusst, ob man will oder nicht. Die Akteure im System beeinflussen aber ebenso das Wohl (oder Wehe) des Unternehmens. All dies muss man in die strategischen Entscheidungen einbeziehen.
Wie lässt sich Nachhaltigkeit in einem Unternehmen tatsächlich strategisch implementieren? Was müssen die ersten Schritte sein? Es gibt zwar social oder green enterprizes, deren Unternehmenszweck per Definition die Nachhaltigkeit ist, die meisten Unternehmen müssen sich aber erst dahin entwickeln. Oft steht am Anfang externer Druck in Form von Regulierung des Gesetzgebers und ein Einfordern von Normen durch relevante Teile der Gesellschaft, so dass der Weg zu mehr Nachhaltigkeit durchaus Risikominimierung ist. Nämlich dahingehend, dass ein Unternehmen nicht an den Pranger gestellt werden will. Irgendwann merken Unternehmer*innen, dass es auch ökonomische Vorteile haben kann, wenn man seine Prozesse und Produk-
te zum Beispiel ökologisch effizient gestaltet oder sich damit vom Wettbewerb differenzieren kann. Kund*innen achten verstärkt auf Nachhaltigkeit, somit lässt sich durch nachhaltiges Handeln auch am Markt nutzbringend agieren. Im Idealfall setzt bei den Entscheidungsträger*innen irgendwann die Erkenntnis ein, dass man als Unternehmen nicht Teil des Problems, sondern vielmehr Teil der Lösung der großen gesellschaftlichen Probleme sein könnte, die im Übrigen durch unser Wirtschaften verursacht wurden. Enorm wichtig ist daher eine Änderung des Mindsets der Entscheidungsträger*innen, diese Zusammenhänge zu erkennen und Entscheidungsparameter nachhaltig zu ändern, Stakeholderorientierung, Langfris-

26 eco. wirtschaft
tigkeit und die bewusste Einpreisung ökologischer und sozialer Kosten. Ökologische und soziale Ressourcen kommen nämlich nicht umsonst. Also, ohne entsprechendes Leadership geht es nicht. Das Um und Auf ist, dass die Verantwortlichen in einem Unternehmen immer im Kopf haben, keinen unnötigen Schaden anzurichten, denn durch die wirtschaftliche Aktivität gibt es nun einmal auch immer negativen Impact, und der muss so gering wie möglich gehalten werden. Wenn sie das verinnerlicht haben, treffen sie in der Regel andere, bessere Entscheidungen. Dafür müssen auch alle Systeme und Prozesse im Unternehmen geändert werden. Den meisten Unternehmen fehlt schlichtweg immer noch die Struktur, um

Nachhaltigkeit wirksam zu implementieren, etwa im Reporting. You get what you mea sure. Momentan orientiert sich alles in vielen Unternehmen immer noch zu sehr auf die kurzfristige Befriedigung der Bedürfnisse einer Stakeholdergruppe, das kann auch die eigene Familie sein.
Es wird à la longue wirtschaftlich nicht mehr tragbar sein, nicht nachhaltig zu arbeiten, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Lässt sich dieses Umdenken erlernen oder anders gefragt, kann man nach außen glaubwürdig und authentisch sein, obwohl man Nachhaltigkeit vorrangig aus rein wirtschaftlich orientierter Sicht betrachtet und nicht intrinsische
eco. wirtschaft
„Der Mensch ist leider nicht dafür gemacht, langfristig zu denken und mit Unsicherheit gut umgehen zu können. Der Spatz in der Hand ist uns näher als die Taube auf dem Dach.“
KERSTIN NEUMANN
Motive im Vordergrund stehen? Zuerst einmal ist es mir egal, aus welchen Gründen Unternehmen jetzt substantiell nachhaltiger werden. Der gerade publizierte IPCC-Report macht ganz deutlich, dass wir in eine Katastrophe rasen, wenn wir unser Wirtschaftssystem nicht schnell und radikal umstellen. Langfristig wird eine rein ökonomisch motivierte Nachhaltigkeitsstrategie ohne moralisches Fundament aber nicht funktionieren, weil dann der Anreiz erhalten bleibt, bei Ausbleiben von äußerem Druck sofort wieder umzuschwenken und sich nur ein „grünes Mäntelchen umzuhängen“. Solches sogenanntes Greenwashing wird allerdings immer schwieriger, vor allem deshalb, weil (soziale) Medien dies immer schneller entdecken und publik machen. Dann folgen oft sehr schnell Abstrafungen, und die tun meist richtig weh. Aber es gibt auch große Diskrepanzen in Konsumentscheidungen. Selbst wenn man aus moralischen Gründen gegen das Vorgehen eines Unternehmens ist, kauft man trotzdem dessen Produkte. Hier müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Bei Unternehmen ist das ähnlich: Es geht nicht darum, zu wissen, dass es schon fünf nach zwölf ist, sondern es geht darum, diesem Wissen Taten folgen zu lassen.

Wie soll ein Unternehmen wissen, was die „richtigen“ Maßnahmen sind? Das ist tatsächlich sehr komplex, weil die nachhaltige
KERSTIN NEUMANN studierte Betriebswirtschaft unter anderem an der WU Wirtschaftsuniversität Wien. Am dortigen Department für Strategie und Innovation promovierte und habilitierte sie auch. Zahlreiche Aufenthalte als Gastwissenschaftlerin führten sie an viele renommierte internationale Universitäten, z.B. University of Illinois (US), ETH Zürich (CH), Tel Aviv U. (IL), Bocconi U. (IT) und Imperial College London (UK). Von Anfang 2013 bis 2016 forschte sie an der Bocconi University, insbesondere im dortigen Forschungsprogramm „Golden for Sustainability“. Zum 1. September 2016 nahm sie einen Ruf als Universitätsprofessorin für Corporate Sustainability an die Universität Innsbruck an. Das Jahr 2022 verbrachte sie zum Großteil als Visiting Scholar an der Tel Aviv University, Israel, und als Visiting Professor am Imperial College London, UK. Sie ist Mitglied der Academy of Management (AoM), Strategic Management Society (SMS), European Group for Organizational Studies (EGOS) und Alliance for Research on Corporate Sustainability (ARCS). Ihre Publikationen sind in renommierten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen.
Transformation mit einer starken Unsicherheit behaftet ist. Ich meine nicht das Wissen, dass sie notwendig ist, dies ist kristallklar, sondern die kausalen Zusammenhänge einzelner Transformationsschritte im Unternehmen sind, wie bei jeder komplexen Innovation, unklar. Wenn ich A tue, kommt dann wirklich B heraus oder etwas anderes? Es ist ein ständiges Ausprobieren. Und wo man probiert, passieren Fehler, deshalb fangen viele Unternehmen mit ihren Umstrukturierungsmaßnahmen zuerst bei kleineren Einheiten an, sie experimentieren. Da ist naturgemäß in größeren Unternehmen einfacher als in kleinen. Generell ist es in einer kleinteiligen Wirtschaft, wie wir sie in Tirol vorfinden, schwierig, entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen dafür freizumachen. Den meisten heimischen Klein- und Mittelbetrieben ist klar, dass sie etwas ändern müssen. Ihnen ist aber auch bewusst, dass ihnen die notwendigen Ressourcen und vor allem das relevante Wissen fehlen. Deshalb nehmen viele reflexartig eine Abwehrhaltung ein. Uns läuft allerdings die Zeit davon. Hier sind die unterschiedlichen Akteure gefragt, um Hilfestellung zu geben und Wissen und Ressourcen zu bündeln: der Bund und die EU, aber auch die Kommunen, regionale Initiativen, Branchenvereinigungen und wir als Universität.
Tirol ist stark geprägt von Klein- und Mittelbetrieben, Traditions- und Famili-
eco. wirtschaft 28
enunternehmen, die teils schon über Generationen bestehen. Wirtschaften diese nicht per se schon intuitiv nachhaltig, oder war der anhaltende Erfolg bislang schlicht Glück? Erfolge fußen meist auf vielen Säulen und es ist natürlich schwierig, einem Unternehmen, das über Jahrzehnte besteht, zu sagen, es hat in der Vergangenheit in mancherlei Hinsicht etwas falsch gemacht. Oft wusste man es einfach nicht besser. Vielen Familienunternehmen, die fest in einer Region verwurzelt sind, wohnt jedoch ein hoher Qualitätsanspruch inne. Sie denken anders als Konzerne, langfristiger, vielleicht auch sozialer. Viele dieser Unternehmen sind stark Stakeholder-orientiert, auch wenn sie es nie so nennen würden. Nur haben sie wirklich das langfristige Wohl des Unternehmens und der Region im Blick behalten? Das Problem ist ja, dass sich die Erfolgsfaktoren verändert haben, die ein Unternehmen langfristig überleben lassen. Vor 50 Jahren war es nicht das Thema, wie viel Energie ein Hotel verbraucht hat, auch Schnee war im Winter fast immer da. Jetzt gilt es, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu verstehen, dass sich Voraussetzungen dafür geändert haben, was Unternehmen resilient macht. Wenn man beim business as usual bleibt, ist es irgendwann vorbei. Das zeigt die Forschung sehr eindrücklich.
Glauben Sie, dass es langfristig mehr Sinn macht, Unternehmen zu fördern, die aus ihrem Unternehmenszweck heraus nachhaltig sind, oder eher jene zu unterstützen, die auf einem guten Weg sind, nachhaltig zu werden? Ich denke, man muss auf allen Ebenen ansetzen. Wichtig ist, dass man „gute“ Unternehmen ins Rampenlicht bringt, damit auch Mitbewerber sehen, was machbar ist, und dies als Anreiz nehmen, selbst besser zu werden. Auch Belohnungs- bzw. Sanktionssysteme können helfen. Für Unternehmen, die sich schon auf einem guten Weg befinden, könnten zum Beispiel Investitions- und Steuererleichterungen geschaffen werden, dies würde sie belohnen und weiterhin motivieren – zusätzlich zu eventuell bereits bestehenden Wettbewerbsvorteilen aus Nachhaltigkeit. Die beste Option zur Verhaltenslenkung sind tatsächlich Steuern. Eine CO2-Steuer, die diesen Namen auch verdient, das wissen wir aus der Forschung, würde emissionsstarken Unternehmen weh tun und den Anreiz setzen, in ökologisch optimierte Prozesse und Businessmodelle zu investieren. CO2-Steuern in einer lenkungs-
relevanten Höhe sind nur leider politisch schwer bis nicht durchsetzbar. Der Druck von außen steigt nun zwar endlich, und wir müssen auch jenen helfen, die noch nicht so weit sind, durch Kooperation und Wissenstransfer, wie bereits angesprochen, ganz pragmatisch. Wir brauchen jeden Schritt, um wenigstens unter dem Zwei-Grad-Klimaziel zu bleiben, die 1,5 Grad gehen sich nur noch ganz schwer aus.
Die Europäische Union hat mit ihrer Taxonomie-Verordnung im Rahmen des Green Deals ein Tool geschaffen, das Banken in die Pflicht nimmt, Investitionen und folglich die Kreditvergabe an ökologische Gesichtspunkte zu knüpfen. Klug? Ja, auch wenn die Verordnung noch einige Schlupflöcher enthält und sehr komplex in der Umsetzung ist, ist die Idee dahinter, nämlich Finanzinstitute dahin zu bringen, ihre eigenen Portfolios ökologisch in Ordnung zu bringen, schlau. Durch die Taxonomie wird zum einen bei der eigenen Veranlagung der Finanzinstitute das Thema Nachhaltigkeit nach vorn gebracht, das heißt, sie werden stärker in nachhaltige Unternehmen investieren, „schmutzige“ Unter-
nehmen werden sukzessive aus den Portfolios genommen. Zum anderen wird die Kreditvergabe verstärkt an „grünen“ Kriterien gemessen, was für problematische Unternehmen die Refinanzierungskosten erhöhen wird. Das ist gerade für die meisten europäischen und österreichischen Unternehmen relevant, die nicht an der Börse notiert sind. Mit der Taxonomie haben Finanzinstitute einen entscheidenden Hebel in die Hand bekommen, um Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren. Sie könnten nun einfach „schmutzige“ Unternehmen nicht mehr finanzieren, dies würde die eigene Kundenbasis aber auch sehr stark ausdünnen. Das Gute ist, dass Europa und Österreich geprägt sind von einem starken KMU-Sektor, wo Unternehmer*innen und Banken oft noch eine sehr persönliche Beziehung pflegen. Banken können damit zum Sparringpartner werden und Unternehmen hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften beraten und begleiten. Auch wir als Universität geben unser Know-how gerne weiter, doch auch staatliche Stellen sind gefordert, Wissen auf breiter Basis zur Verfügung zu stellen. Es bedarf der Anstrengung aller in der Gesellschaft.

eco. wirtschaft 29
„Es ist schwierig, sich als Unternehmen einzugestehen, dass man eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Das ist schon eine große Leistung, sich dann zu ändern, eine noch viel größere.“
© UNI INNSBRUCK
KERSTIN NEUMANN
SICH NACHHALTIG NACH VORNE ENTWICKELN
Seit der Gründung der CURA COSMETICS GROUP im Jahr 1999 steht verantwortungsbewusstes Handeln im Zentrum des Unternehmens. Es geht nicht um die reine Maximierung des Gewinnes, sondern vielmehr um einen respektvollen Umgang mit Mensch und Umwelt. Um das Thema weiter zu forcieren und zu strukturieren, wurde rund um einen internen Nachhaltigkeitsmanager eine interdisziplinäre Projektgruppe gegründet, die Bewusstsein schafft und konkrete Wege und Lösungen hin zu einem noch achtsameren Unternehmertum erarbeitet.
TEXT: MARINA BERNARDI
bildet. „In der Kosmetikbranche und speziell der Naturkosmetik geht es quasi naturbedingt stark um ökologische Gesichtspunkte in Bezug auf Nachhaltigkeit, bei den Inhaltsstoffen, aber auch bei der Verpackung und deren Recyclingfähigkeit. Dazu hat die Social Compliance einen großen Stellenwert in unserem Unternehmen“, so Kaiser.
Die CURA COSMETICS GROUP schafft es seit ihrer Gründung, den Spagat zwischen Kontinuität und zukunftsorientierter Weiterentwicklung hinzubekommen. Das dynamische Wachstum der Gruppe fußt dabei auf vielen unterschiedlichen Faktoren, ausschlaggebend war aber immer das frühe Erkennen von Trends gepaart mit langfristigem Denken. Was zählt, ist nicht der schnelle Erfolg, sondern beständiges, verantwortungsvolles Arbeiten unter Einbeziehung ökologischer und sozialer Aspekte. So ist Nachhaltigkeit innerhalb der CURA COSMETICS GROUP Teil der Unternehmensphilosophie und war bereits gelebter Alltag, als das Thema noch nicht die Aufmerksamkeit von heute hatte.
NACHHALTIG AUS PRINZIP, NICHT ALS MUSS
Seit einiger Zeit gibt es in der CURA COSMETICS GROUP eine eigene Projektgruppe, die sich ausschließlich mit den unterschiedlichen Facetten der Nachhaltigkeit beschäftigt. Sie wurde bewusst mit Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen zusammengesetzt, um einen ganzheitlichen Blick zu bekommen. „In der Projektgruppe arbeiten Leute aus dem Produktmanagement ebenso wie Vertreter*innen aus dem Einkauf, Mitarbeiter*innen aus Forschung und Entwicklung und natürlich der Kommunikation“, erklärt Gerhard Kaiser, der gemeinsam mit Manuel Rainalter und Hannes Kohl die Dreier-Geschäftsführung
Dass man sich bei der CURA COSMETICS GROUP schon länger mit der sozialen Seite der Nachhaltigkeit beschäftigt, hat nicht nur einen moralischen Aspekt, sondern kommt dem Unternehmen nun auch beim neuen und durchaus komplexen EU-Lieferkettengesetz zugute, das eine soziale, menschenrechtskonforme und nachhaltige Produktionsweise sicherstellen soll –und zwar bis ganz zurück zum Anfang. Die CURA COSMETICS GROUP ist dabei Mitglied des Verbandes Amfori, der die soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Supply-Chain sicherstellt, Vorlieferanten dabei unterstützt, unter anderem in Form fairer Bezahlung und Arbeitszeitregelung sozialverträglicheres Arbeiten zu gewährleisten. Zum ersten Mal veröffentlicht die Gruppe heuer bereits einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht, der im kommenden Jahr laut einer EU-Verordnung für viele große Unternehmen verpflichtend sein wird und diese dazu auffordert, so genannte nichtfinanzielle Informationen über das eigene Unternehmen offenzulegen. Dazu Anna Danzer, Corporate Communications Manager: „Wir starten in Kürze mit der konkreten Ausformulierung des Berichtes. Unsere Arbeitsgruppe hat dazu bereits wertvolle Vorarbeit geleistet und unter anderem entsprechende Guidelines und Bewertungssysteme entwickelt, die uns die Arbeit wesentlich erleichtern.“

CURA
Judith Williams, Schönheitsexpertin und Mehrheitsgesellschafterin der CURA COSMETICS GROUP, im neuen Labor
Angefangen hat man in der Projektgruppe damit, überhaupt erst zu definieren, was Nachhaltigkeit für die CURA COSMETICS GROUP bedeutet. „Jeder unserer Kunden hat seine eigenen Vorstellungen davon und interpretiert den Begriff auf seine Weise. Im TV-Shopping ist das anders als im Einzelhandel oder im Online-Geschäft. Das macht die Umsetzung nicht immer ganz einfach“, sagt Kaiser. Bei der CURA selbst orientiert man sich an den zehn Prinzipien des UN Global Compact, die wiederum aus den 17 allgemeinen globalen Nachhaltigkeitszielen der UN entstanden, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Mitglieder des Vereins, zu denen auch die CURA COSMETICS GROUP zählt, verpflichten sich zur Einhaltung dieser zehn unternehmensrelevanten so genannten Sustainable Development Goals/SDG, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption zugeteilt sind, und auch zur regelmäßigen Dokumentation der unternehmenseigenen Maßnahmen. Der Verein bietet zudem ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema, die die CURA-internen Angebote perfekt ergänzen. „Wir bieten unseren Mitarbeitern Onlinekurse zum Thema Nachhaltigkeit und informieren sie laufend über die Ergebnisse aus der Projektgruppe, um sie mit ins Boot zu holen, denn Nachhaltigkeit kann nur in der Gesamtheit eines Unternehmens funktionieren“, ist Dan-
zer überzeugt. Für einen Blick von außen holt man sich zudem regelmäßig externe Expertise ins Haus, um daraus für interne Prozesse zu lernen und diese laufend zu optimieren. „Wir haben uns im vergangenen Jahr in Sachen Nachhaltigkeit enorm weiterentwickelt und eine solide Struktur geschaffen, auf der wir künftig aufbauen können. Außerdem haben wir konkrete Ziele formuliert und das Thema fest in unserer Unternehmensstrategie verankert“, so der Geschäftsführer.
„Getrieben durch intensives Trendscouting und breite Marktforschung sind wir in der Lage, Trends früh zu erkennen und darauf zu reagieren. Deshalb war uns rasch klar, dass Nachhaltigkeit eines der großen Zukunftsthemen werden wird. In der CURA begleitet uns der achtsame Umgang mit unserer Umwelt aber schon seit der Firmengründung. Die Natur steht immer wieder im Mittelpunkt unserer Produkte. Auch daher liegt uns der Klimaschutz und der Erhalt unseres schönen Standortes besonders am Herzen. “
Mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichtes wird auch die CURA-Website entsprechend angepasst und darauf noch mehr Detailinformation für alle Interessierten zur Verfügung gestellt. Natürlich wird dort auch der Bericht zum Download bereitstehen. Schon jetzt finden sich auf der Homepage viele Informationen zum sozialen Engagement der Gruppe sowie zum nachhaltigen Passivhaus-Bürogebäude und zur generellen Philosophie der CURA COSMETICS GROUP, die sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Partnern, Kunden und Mitarbeitern mehr als bewusst ist. Und letztlich auch gegenüber unserem Planeten, der unser Zuhause ist. Und unsere Zukunft. PR
CURA COSMETICS GROUP wurde 1999 gegründet und ist ein internationales Unternehmen im Bereich Kosmetik und Nahrungsergänzung.
• Hauptgeschäftsfelder: Markenentwicklung und -vertrieb, Private Label, Start-up-Business, Forschung & Entwicklung

• Vertriebskanäle: Einzelhandel, Teleshopping, Online
• Mitarbeiter*innen: 200
• Frauenanteil: 80 %
• Gruppenumsatz: 70.000.000 Euro

• Geschäftsführung: Gerhard Kaiser, Hannes Kohl, Manuel Reinalter
CURA MARKETING GMBH
Doktor-Franz-Werner-Straße 19
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/262676
E-Mail: office@cura.co.at
www.curacosmeticsgroup.com
31
CURA
Im Rahmen einer internen Veranstaltung lud die CURA COSMETICS GROUP zu einem Vortrag zu den Tätigkeitsbereichen des Sustainability-Teams und lud im Anschluss zu einem Frühstück mit ausschließlich nachhaltigen Produkten. Die Lebensmittel wurden über die App „Too Good to Go“ vor dem Mülleimer gerettet oder lokal bei Hofläden eingekauft.
GERHARD KAISER
NACHHALTIGKEIT, ENERGIE UND REGIONALITÄT IN WORT UND BILD

KURZ & BÜNDIG
ÜBER DEN TELLERRAND
Aectual ist zwar kein heimisches Unternehmen, sondern aus Amsterdam, wir finden’s aber trotzdem gut! Die Niederländer stellen Raumteiler und (Büro-)Trennwände im 3-D-Druck her und verwenden dafür ausschließlich pflanzenbasierte Materialien. Das besonders vorteilhafte aber ist: Hat das Produkt ausgedient, schickt man es zurück und bekommt fünf Prozent des Kaufpreises zurück bzw. 25 Prozent Rabatt auf ein neues Produkt. Aectual macht aus dem zurückgesandten Produkt dann ein neues – shreddert dafür das alte und verarbeitet die Materialien weiter. Auch zu Pflanzengefäßen oder Kleiderbügeln.


ENERGETISCH WERTVOLL
Anfang des Jahres sind der Verein Energie Tirol und die landeseigene Wasser Tirol GmbH zur gemeinsamen Energieagentur Tirol verschmolzen. Sie ist ab sofort die zentrale Anlaufstelle für das Land, für Privatpersonen, Gemeinden, Regionen und Unternehmen in allen Energiefragen. Hauptgeschäftsfelder sind die unabhängige Beratung, Projektentwicklung, Kommunikation und Bewusstseinsbildung sowie Forschung und Innovation in den Bereichen Bau- und Gebäudetechnik, Energie- und Wasserressourcen, neue Technologien, Mobilität und die Gestaltung des Veränderungsprozesses der Energiewende. Die Fusion sei laut Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler der nächste organisatorische Schritt zur Beschleunigung dieser Energiewende. Bis 2050 will Tirol energieautonom sein, seinen Energiebedarf stark reduzieren und unterm Strich aus heimischen, erneuerbaren Energieträgern abdecken.
eco. wirtschaft 32
Table Screen (5 Farben, je ca. 750 Euro) und Raumteiler (ca. 7.600 Euro) aus Bio-Polyamid auf Basis pflanzlicher Öle. Produziert wird on demand, die Produkte sind zu 100 Prozent recyclingfähig.
ENERGIE IST ÜBERALL
Rowa Moser steht als stark regional verankertes Unternehmen seit jeher für Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Geschäftsführer und Inhaber Stefan Moser hat neben dem wirtschaftlichen Erfolg, den es braucht, um als Unternehmen dauerhaft – und damit nachhaltig – zu bestehen, auch den ökologischen und sozialen Aspekt im Blick.
Das Leistungs- und Produktfeld von Rowa Moser mit Firmensitz in Innsbruck ist breit, in vielen Bereichen lässt sich durch laufende Optimierung von Prozessen und Produkten sowie stete unternehmerische Weiterentwicklung ein aktiver Beitrag in Richtung mehr Nachhaltigkeit leisten. Auch kundenseitig – im Fall von Rowa Moser sind dies in erster Linie Professionisten wie (Industrie-)Elektriker*innen sowie Gewerbe- und Industriekund*innenen – wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. „Vor allem im Bereich der Elektrotechnik und bei Heizsystemen liegt enorm viel Potenzial, Elektro-Heizsysteme zum Beispiel werden immer effizienter und passgenauer, Photovoltaikanlagen erlauben es Nutzern, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen und sogar Kosten zu sparen. Im Energiebereich gilt es künftig, noch stärker anzusetzen, denn Energie ist quasi überall“, sagt RowaMoser-CEO und -Inhaber Stefan Moser.

ECO.NOVA: Kein Unternehmen kommt heute ohne „Nachhaltigkeit“ aus. Wie hält es Rowa Moser damit? STEFAN MOSER: Natürlich spielt das Thema auch in unserem Unternehmen quer durch alle Geschäftsbereiche eine Rolle und wir sind dabei, uns diesbezüglich laufend weiterzuentwickeln. Wir versuchen, die Wertschöpfung in der Region zu halten, und haben ein starkes Netzwerk an heimischen Partnern, die von Zulieferern im Optimalfall wieder zu Kunden werden, um den regionalen Kreislauf in Gang zu halten. Aber wir möchten auch ehrlich sein: Nachhaltig zu wirtschaften ist ein enormer Kraftaufwand und es ist noch viel zu tun. Wir sehen es als laufenden Prozess, hier immer besser zu werden, wie bei vielen anderen Themen.
In welchen Bereichen sehen Sie unternehmensseitig noch Potenzial? Wir setzen seit Jahren schon bei unseren eigenen Gebäuden auf PV-Anlagen und effiziente Heizsysteme. Auch im Bereich Beleuchtung und Print brauchen wir uns rund um Nachhaltigkeit absolut
„Wie bei allen Herausforderungen ist es wichtig, diese anzunehmen und sich nicht davor zu verstecken.“
Stefan Moser

nicht zu verstecken. Der Verpackungsbereich ist aber auch bei uns ein großes Thema. Wir haben viele empfindliche Produkte im Sortiment, die gut geschützt werden müssen, damit sie beim Transport nicht kaputt gehen. Unsere Tragsysteme aus Stahl und Alu sind vergleichsweise sehr robust, aber auch sie müssen makellos beim Kunden ankommen. So ist es eine ständige Gratwanderung zwischen Ökologie und Ökonomie, denn es ist niemandem geholfen, wenn wir beim Produktschutz sparen und die Kunden die Produkte wegen eines Mangels zurückschicken und wir diese folglich doppelt versenden müssen. Unterm Strich braucht es nicht nur von Unternehmens-, sondern auch von Lieferanten- als auch Kundenseite eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema.
Ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein Stück weit Bewusstseinsbildung? Definitiv! Wir sind auch nicht perfekt, möchten dem Thema aber bei uns im Haus und bei unseren Partnern mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir haben dafür zum Beispiel 1.000 kleine Büchlein mit dem Titel „Kleine Gase – große Wirkung. Der Klimawandel“ drucken lassen. „Das Klimawandelbuch“ ist ein Studentenprojekt, das Fakten von hunderten Wissenschaftlern kompakt zusammenfasst, aber auch mit Mythen aufräumt. Das Buch haben wir unter anderem bei der Eröffnung unseres jüngsten Standortes in Allhaming bei Linz an die Gäste verteilt und es hat mir selbst nochmals bewusst gemacht, dass nicht nur jeder für sich, sondern auch für sein Unternehmen einen Beitrag leisten muss. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, wichtig ist, dass man anfängt. Wir dürfen uns niemals auf dem bisher Erreichten ausruhen.
Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten spielt auch die soziale Komponente eine Rolle in der ganzheitlichen Betrachtung von Nachhaltigkeit … … deshalb unterstützen wir seit vielen Jahren zahlreiche Vereine, vor allem im Jugendbereich, um einen Teil unseres Erfolges zurückzugeben. Wir sind außerdem ein sehr sportliches Team, viele von uns in den Bergen und auf Sportplätzen unterwegs, was zu einer besonderen Beziehung zur Natur führt. Nachhaltigkeit betrifft bei uns also viele Bereiche, auch eine nachhaltige Unternehmensentwicklung mit langfristigen Mitarbeitern, Kunden- und Lieferantenbeziehungen. PR
ROWA MOSER
HANDELS - GMBH
Bernhard-Höfel-Straße 9 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/33770
office.ibk@rowa-moser.at www.rowa-moser.at
33 ROWA MOSER
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
© VIRTKREATIV
Josef Margreiter, Geschäftsführer von Lebensraum Tirol, AgrarmarketingGeschäftsführer Matthias Pöschl, Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, MPREISGeschäftsführer David Mölk, Projektverantwortliche Sabine Hofmann, Mathias

Mölk, Leiter der MPREIS Lebensmittelherstellung, sowie Peter Dornauer, Projektverantwortlicher der Zillertaler Tourismusschulen
BUCH.TIPP
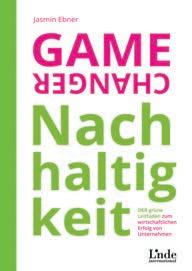
GAME CHANGER NACHHALTIGKEIT


Jasmin Ebner, Linde international, 208 Seiten, EUR 29,90
Unternehmen werden zukünftig nicht mehr gefragt werden, ob sie nachhaltig wirtschaften wollen oder nicht. Es wird alternativlos werden. Um als Unternehmen erfolgreich zu bleiben, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Corporate Social Responsibility daher unumgänglich. Gerade kleine und mittlere Unternehmen haben jedoch oft nicht die Ressourcen, sich durch das herrschende Begriffswirrwarr und komplexe Nachhaltigkeitsleitfäden zu arbeiten. Nachhaltigkeitsspezialistin

Jasmin Ebner bietet mit ihrem Buch einen eingängigen Wegweiser zu einer unkomplizierten Nachhaltigkeits- und Kommunikationsstrategie und liefert konkrete Werkzeuge, mit deren Hilfe Unternehmen sofort beginnen können, nachhaltige Schritte zu setzen und diese auch nach außen zu kommunizieren.
WE LIKE!
Kooperationen zwischen Wirtschaft und Schule sind prinzipiell immer eine gute Sache, vor allem, weil Schüler*innen dadurch bereits sehr früh und praxisnah in die Arbeitswelt hineinschnuppern können. Wenn es dann noch um ein regionales und nachhaltiges Projekt geht, ist das doppelt schön. Wie im Fall von MPREIS. Der heimische Lebensmittelhändler hat in Kooperation mit den Zillertaler Tourismusschulen zwei neue, nahrhafte Fertiggerichte auf den Markt gebracht. Der Startschuss für die Kooperation fiel bereits im Herbst 2021 durch ein erstes gemeinsames Brainstorming. Es folgten Produktvorschläge, produktionsseitige Machbarkeitsprüfungen sowie die Erstellung der Rezepturen seitens der Schule. Mehrere Musterproduktionen und Verkostungen später wurden die Gerichte im September 2022 endgültig abgenommen. Seit Anfang März sind die Spinatknödel in Käsesauce unter der Marke I LIKE sowie das Zwiebelfleisch vom Tiroler Jahrling mit Kräuterspätzle samt Gütesiegel „Qualität Tirol“ bei MPREIS erhältlich.
NACHHALTIGKEIT NACHHALTIG FÖRDERN
In den Jahren 2019 bis 2021 wurden seitens des Landes Tirol Wirtschafts- und Technologieförderungen mit einer Gesamtsumme von über 100 Millionen Euro genehmigt. Um auch künftig den Anforderungen und Bedürfnissen der Wirtschaft gerecht zu werden, wurde die bestehende Wirtschaftsförderung evaluiert und weiterentwickelt sowie Förderprogramme strukturell adaptiert und Themenschwerpunkte angepasst. Für 2023 liegen sohin 31 Millionen Euro im Fördertopf, wobei ein verstärkter Fokus auf Klima und Nachhaltigkeit liegen soll. Die Schwerpunkte bei der Förderung von Energiemaßnahmen und erneuerbaren Energieträgern liegen laut Wirtschaftslandesrat Mario Gerber dabei auf der Förderung von Solaranlagen, thermischer Gebäudesanierung, LED-Beleuchtung im Innenbereich sowie auf der Errichtung und Erweiterung von Biomasseanlagen. Darüber hinaus werde der Bezieher*innenkreis bei der Förderung von Energiesparmaßnahmen auf Großunternehmen ausgeweitet.
eco. wirtschaft 34
© MPREIS © AGRARMARKETING TIROL
BEWUSSTSEINSBILDUNG
Die Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (ATM) wurde 1992 von den Abfallverbänden der Bezirke Innsbruck-Land und Schwaz mit dem Ziel gegründet, die insgesamt 102 Mitgliedsgemeinden zu Umwelt- und Abfallthemen zu beraten und sie dahingehend mit entsprechenden Services zu unterstützen.
GEGEN LEBENSMITTELVERSCHWENUDNG
Seit Langem setzt sich die ATM für die Vermeidung von Lebensmittelabfall ein und hat dazu unter anderem mit der Agararmarketing Tirol die „Karakter Ernte“ ins Leben gerufen, die Gemüse vor der Entsorgung rettet, das nicht den striken Marktvorgaben entspricht – das also qualitativ völlig in Ordnung, nur eben ein wenig zu dick, zu klein/groß oder unförmig gewachsen ist. Weil aber natürlich nicht jedes Gramm Lebensmittelabfall vermieden werden kann, setzt man sich auch mit der Thematik der sinnvollen Verwertung unvermeidbarer biogener Abfälle auseinander, die als Biomasse zum Beispiel zu einem wertvollen alternativen Energielieferanten werden.
Ein weiterer Baustein in Sachen Lebensmittelabfallvermeidung ist die Genuss Box – ein Gemeinschaftsprojekt der ATM mit dem Land und der Wirtschaftkammer Tirol. In die Genuss Box kann man sich nicht verzehrte Speisen im Restaurant für zuhause einpacken lassen. Sie besteht aus recycelbarem Karton, ist wärme- und kälteisolierend und für die Mikrowelle sowie den Backofen geeignet –und zeigt gleichzeitig ein Stück Wertschätzung gegenüber der Küche. Win-win!
Die teilnehmenden Betriebe gibt's unter www.genussbox.at. Hier können interessierte Gastrobetriebe die Boxen auch bestellen.


TIPP: Im neu gestalteten Besucherzentrum im Recycling Zentrum Ahrental, das die ATM gemeinsam mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben/IKB betreibt, erfahren Interessierte spielerisch und spannend aufbereitet alles über Müll und Entsorgung.
PRODUKTEN EIN ZWEITES LEBEN GEBEN
In fast jedem Haushalt finden sich ungenutzte Dinge, die nur darauf warten, (von anderen) gebraucht zu werden. Die noamol-Box ist eine unkomplizierte Möglichkeit, all diesen Dingen eine zweite Chance zu geben. In die Re-use-Box darf Hausrat jeglicher Art, von Dekogegenständen, Geschirr über Bücher und Spielsachen bis hin zu Sportartikeln oder Werkzeug. Voraussetzung: Die Gegenstände dürfen nicht kaputt, schmutzig, unvollständig oder gefährlich sein. Durch soziale Projekte in Tirol werden die gesammelten Teile zum Wiederverkauf vorbereitet und zum Verkauf angeboten. Damit hat die Box dreierlei Nutzen: Sie hilft bei der Abfallvermeidung, gibt sozial-ökologischen Betrieben eine Verdienstmöglichkeit und schafft folglich Arbeitsplätze, und man ermöglicht es finanziell schlechtergestellten Menschen, zu gut erhaltenen Sachen für wenig Geld zu kommen. Seit dem Start sind über 1.500 Boxen im Umlauf, ingesamt konnten bereits über 10.000 Kilogramm an verwert- und wiederverkaufbaren Produkten gesammelt werden. Weitere Infos sowie Ausgabe-/ Rücknahmestellen finden Sie unter www.noamol.at.
FÜR GEMEINDEN
Im Rahmen des Check-Schecks bietet die ATM eine Art Betriebsberatung für Gemeinden, in denen unter anderem deren Abfallmaßnahmen analysiert werden, um daraus Handlungsempfehlungen für – gemeindeübergreifende – Verbesserungen abzuleiten und die Serviceleistungen entsprechend zu optimieren.
Auch die Flurreinigungsaktion „Tirol klaubt auf“ geht heuer in die nächste Runde. Aktuell beteiligen sich 53 Gemeinden in den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land, um wie alljährlich im April zur großen Flurreinigung auszuschwärmen . Viele Freiwillige aus Vereinen und Schulklassen, aber auch Einzelpersonen beteiligen sich daran, respektlos weggeworfene Abfälle einzusammeln und damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Die ATM unterstützt die Aktion mit entsprechenden Arbeitsmaterialien wie Müllsäcken, Zangen oder Handschuhen.
Infos zu den Aktionen und mehr unter www.atm-online.at
eco. wirtschaft 35
PILZFORSCHUNG RETTET LANDWIRTSCHAFT UND MENSCHENLEBEN
Pilze liefern wertvolle Medikamente wie das Penizillin, gleichzeitig befallen sie uns als Krankheitserreger. Manche sind eine wertvolle Nahrungsquelle, andere zerstören Ernten. Sie machen Häuser unbewohnbar und liefern Baumaterialien. Genauso vielfältig wie die Welt der Pilze ist auch ihre Wissenschaft, die Mykologie. Das zeigt allein das Beispiel der Siderophore. Diese Moleküle werden von Pilzen ausgeschieden, um sich mit lebensnotwendigem Eisen zu versorgen, und an der Universität Innsbruck sowie Medizinischen Universität Innsbruck intensiv erforscht. Sie finden unter anderem Anwendungen im Bio-Pflanzenschutz als auch in der Humanmedizin. Am Institut für Mikrobiologie erforscht etwa die Arbeitsgruppe von Prof. Susanne Zeilinger-Migsich den Schimmelpilz Trichoderma. Dieser kommt im Boden vor und ist ein sogenannter Mykoparasit: ein Pilz, der andere Pilze befällt und sich von ihnen ernährt. Das macht ihn für die Landwirtschaft interessant, denn als natürlicher Pflanzenschutz kann Trichoderma andere Pilze bekämpfen, die sonst Pflanzen infizieren würden. Am Institut für Molekularbiologie indes erforscht die Arbeitsgruppe von Prof. Hubertus Haas die Stoffe aus humanmedizinischer Sicht. „Jährlich sterben rund 1,5 Millionen Menschen an Pilzinfektionen“, sagt Haas. „Für Personen mit einem geschwächten Immunsystem besteht ein hohes Risiko für lebensbedrohliche Infektionen mit dem Schimmelpilz Aspergillus fumigatus, die sogenannte Aspergillose.“ Die Diagnose und Behandlung einer solchen Infektion ist nach wie vor eine Herausforderung, die Erforschung des Eisenstoffwechsels der Pilze aber verspricht neue Möglichkeiten, sodass uns die gewaltige Vielfalt der Mykologie künftig noch von großem Nutzen sein kann.

VERANSTALTUNGSHINWEIS
Unter dem Titel „Rauchzeichen“ haben Birgit Enk und Hannes Treichl (im Bild) ein Live-Talkevent initiiert, bei dem Unternehmer*innen aus der Region über ihre Erfahrungen und Erfolge sprechen, um damit zu inspirieren und zu motivieren. Das Publikum ist dabei herzlich eingeladen, mitzureden und sich natürlich auch untereinander möglichst rege auszutauschen. Auf der Agenda stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Purpose, Regionalität sowie Mitarbeiter- und Werteorientierung. Alle bisherigen Events waren ausverkauft, was „Rauchzeichen“ schon 2022 zu einem der meistbesuchten Jungunternehmer*innen-Events in Tirol machte. Den Start für die Eventreihe machte im heurigen Jahr der Talk in Hall, wo dieser erstmals im Salzlager stattfand, weitere Stationen der #glaubandichLivetour 2023 sind Kufstein, Mayrhofen, Reutte, Innsbruck und Gurgl. Infos und Tickets unter www.rauchzeichen.live, wer mag, schaut auf Instagram unter @rauchzeichen.live vorbei oder hört in den Podcast hinein: https.//anchor.fm/rauchzeichen


PRIORITÄT: HOCH!!!
Die weltwirtschaftliche Lage hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Angesichts dieser Entwicklung könnte man meinen, dass die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz nur mehr eine untergeordnete Rolle spielen. Eine aktuelle Deloitte-Studie belegt nun aber das Gegenteil: Klimaschutz steht auf der Prioritätenliste der Unternehmen weit oben, ein Großteil der Betriebe hat im vergangenen Jahr die Nachhaltigkeitsausgaben sogar erhöht. Im Fokus stehen vor allem außenwirksame Maßnahmen, interne Klimastrategien werden allerdings noch zu selten umgesetzt. Mit seinem aktuellen „CxO Sustainability Report“ beleuchtet das Beratungsunternehmen Einstellungen und Maßnahmen von mehr als 2.000 Führungskräften weltweit in Bezug auf Klimawandel und Nachhaltigkeit. Die im Rahmen des diesjährigen World Economic Forum in Davos veröffentlichte Studie liefert ein klares Ergebnis: Trotz massiver wirtschaftlicher Unsicherheiten stehen Investitionen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz weit oben auf der Unternehmensagenda. Den gesamten Bericht finden Sie (in englischer Sprache) unter dem QR-Code zum Download.
eco. wirtschaft 36
Der Schimmelpilz Trichoderma unter dem Lichtmikroskop
© ALEXANDER LICHIUS
© CHRISTIAN MEY
ECO.TIPP
ERSTES HOLZHAUS IN DER INNENSTADT
Bürogebäude in der Innsbrucker Innenstadt bestehen normalerweise aus Beton und Glas. Nicht so der Neubau der TIROLER VERSICHERUNG in der Wilhelm-Greil-Straße. Hier entsteht ein Holzbau mit begrünter Fassade – eine bis jetzt einzigartige Kombination in Tirol.
Die TIROLER VERSICHERUNG hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist gewachsen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten im Altbau schlichtweg nicht mehr genug Platz. Eine Aufstockung kam weder wirtschaftlich noch bautechnisch infrage. Deswegen haben wir uns für einen Neubau entschieden“, erklärt Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER, warum der Neubau im Innsbrucker Zentrum notwendig geworden ist.
LEITPROJEKT FÜR INNSBRUCK
Anstelle der drei Gebäude in der Wilhelm-Greil-Straße/Gilmstraße kommt ein innovativer Neubau aus Holz mit begrünter Fassade. Die Holzbauweise ist untypisch für das Innsbrucker Zentrum, die Kombination aus Holzbau mit begrünter Fassade ist einzigartig im Land. „Wir bauen hier ein Leitprojekt in Sachen nachhaltiger Bauweise. Mit Holz haben wir uns für einen nachwachsenden Rohstoff entschieden, die begrünte Fassade wird zur Abkühlung der Umgebung beitragen“, so Mair.

Im Architekturwettbewerb hat sich das Innsbrucker Architekturbüro DIN A4 gegen 19 weitere Einreichungen durchgesetzt. Für die Begrünung der Fassade und der Dachgärten kommt Unterstützung von Expert*innen des Unternehmens green4cities, ein Spin-
off der Universität für Bodenkultur in Wien. Nichts wird dem Zufall überlassen.
BAUARBEITEN PLANMÄSSIG
Bisher läuft alles nach Plan: Bis Anfang Februar 2022 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitlich gestaffelt ausgezogen. Das Kundenbüro hat in Gehweite, in der Wilhelm-Greil-Straße 15, ein Geschäftslokal für die Bauzeit bezogen, rund 200 Mitarbeiter*innen sind in der Anton-Melzer-Straße untergekommen.
Im Frühling 2022 startete dann auch schon der Rückbau des Altbestandes, beginnend mit dem Stöcklgebäude im Innenhof. „Der Abriss ist jene Bauphase, die für die Anrainerinnen und Anrainer besonders anstrengend ist. Doch sie ist auch die kürzeste Phase und war Ende August abgeschlossen. Nun ist die Belastung deutlich geringer. Die

Bauzeit beim Holzbau ist auch kürzer, weil wir mit vorgefertigten Elementen arbeiten. Dadurch sind auch die Arbeiten weniger lärm- und staubintensiv“, so Mair.
KLEINE GESCHÄFTE UND
CHANGING - PLACE - PREMIERE
Die geplante Fertigstellung: erstes Halbjahr 2024. Dann werden im Erdgeschoß auch wieder kleine Geschäfte einziehen. Eine besondere Einrichtung findet in der neuen Zentrale der TIROLER ebenfalls Platz: „Wir werden den ersten Changing Place Österreichs errichten. Dabei handelt es sich um Sanitäranlagen für Menschen mit Behinderungen. Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst und Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Tuns. Dazu gehören auch Maßnahmen für mehr Inklusion“, erklärt Mair. PR
37 TIROLER VERSICHERUNG
Mit der neuen Zentrale der TIROLER VERSICHERUNG entsteht gleichzeitig das erste Bürogebäude aus Holz im Zentrum Innsbrucks. Geplant wurde es vom Tiroler Architekturbüro DIN A4.
Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER VERSICHERUNG
© DIN A4 © TIROLER/BERGER
In der exklusiven Stadtvilla Rainer Maria in der Rilkestraße im Innsbrucker Stadtteil Pradl verbinden sich drei gute Argumente für echte Lebensqualität: begehrte, verkehrsberuhigte Lage, hochwertige Architektur sowie ökologische Bauweise und Energieversorgung mittels Grundwasserwärmepumpe. Vier individuell zugeschnittene Einheiten mit großzügigen Außenflächen bieten Raum für gehobene Ansprüche. Das Portfolio reicht von der flexiblen Familien-Gartenwohnung über zwei 2-Zimmer-Wohnungen im 1. Obergeschoss (die sich auf Wunsch auch vereinen lassen), bis zum Penthouse mit luxuriöser 360-Grad-Dachterrasse.

WOHNEN MIT WEITBLICK
In der Immobilienbranche steht Nachhaltigkeit oft als Synonym für ökologisches Bauen. Dabei geht es um weit mehr. Das Projekt Rainer Maria in der Rilkestraße der Innsbrucker Kairos Holding zeigt, wie ganzheitlich Nachhaltigkeit auch bei Immobilien gedacht werden kann. Die vier exklusiven Wohneinheiten des Projektes werden durch das Innsbrucker Maklerunternehmen InnReal verkauft.



INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Nachhaltigkeit ist nur ein Schlagwort, solange es nicht mit Leben gefüllt wird. Davon ist David Kranebitter, Chief Business Development Officer der Kairos Holding, überzeugt: „Gerade im Wohnbau finden sich oft dieselben trägen Prozesse und die stets gleichen Abläufe wie vor 20 oder 30 Jahren. Das Bauträgergeschäft muss sich weg vom Abschöpfen und hin zum Wertschöpfen entwickeln. Wir müssen weg davon, kurzfristig von Projekt zu Projekt zu denken und hin zu einem unternehmerischen, systemischen
und langfristigen Ansatz kommen.“ Mit der Kairos setze man genau dort an. „Wir möchten die Nonkonformisten der Branche sein und sind da, um das bestehende Bauträgergeschäft zu verändern.“ Die exklusive Stadtvilla Rainer Maria, die derzeit in der Rilkestraße entsteht, steht exemplarisch dafür, wie Immobilienwirtschaft ganzheitlich funktionieren kann.
Wir haben David Kranebitter und Immobilienmaklerin Beate Struggl, bei InnReal zuständig für den Verkauf der Einheiten, zum Gespräch getroffen.
ECO.NOVA: Nachhaltigkeit ist heute ein weitgedehnter Begriff und vielfach zum Marketingsprech verkommen. Wie definiert Kairos nachhaltiges Wirtschaften?
DAVID KRANEBITTER: Wird Nachhaltigkeit nur unter dem ökologischen Aspekt gesehen, bleibt es wohl tatsächlich beim Schlagwort. Wir bei der Kairos entwickeln unsere Projekte derart, dass sie unseren Ansprüchen sowohl in ökologischer als auch ökonomischer und sozialer Hinsicht gerecht werden. Es geht darum, Wohn- und Lebensräume ganzheitlich und über den gesamten Lebens-
38 INNREAL / KAIROS
© ARCHIVSU
zyklus zu denken. Sie sollen für den Käufer werthaltig bleiben und ihn möglichst lange begleiten. Genauso wichtig ist es uns, soziale Aspekte zu verfolgen. Das Projekt Rainer Maria in der Rilkestraße im Innsbrucker Stadtteil Pradl entstand zum Beispiel aus einem leerstehenden Gebäude, dessen Bestandsobjekt wir während der Entwicklungszeit den Tiroler Sozialen Diensten kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, um darin Frauen und Kinder in Notsituationen unterzubringen. Dieses Pilotprojekt war so erfolgreich, dass wir in Telfs im Tiroler Oberland bereits mit einem zweiten derartigen Projekt starten. Wir haben nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung.
Dennoch ist beim Bau der nachhaltigste Hebel jener der Ökologie. Worin sehen Sie den Baustoff der Zukunft? KRANEBITTER: Es gibt für uns nicht den einen, einzigen Baustoff der Zukunft. Dies gilt es je nach Projekt, der Zielgruppe und deren Bedürfnissen sowie der Umgebung abzustimmen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft setzen wir vermehrt auf nachwachsende und wiederverwertbare Baustoffe und versuchen Materialien aus der Umgebung mit einzubeziehen. Vielversprechende Ansätze sind außerdem klimaneutrale Ziegel oder zementfreier Beton, die in den kommenden Jahren hoffentlich zur Marktreife gelangen und kosteneffizient zur Verfügung gestellt werden können. Ein Trend, den wir innerhalb der Kairos aufgreifen, geht in Richtung Renovierung und Nutzung von Bestandsobjekten. Wir müssen hier unsere Verantwortung als Bauträger verstärkt wahrnehmen und Bestehendem neues Leben einhauchen, anstatt immer nur Neues zu schaffen. Im Wipptal setzen wir in Bälde ein derartiges Projekt um, bei Rainer Maria war es in der Tat sinnvoller, das bestehende Gebäude abzutragen und einen neuen Baukörper zu schaffen. Vor allem in Hinblick auf die Energieeffizienz, die ökologische Bilanz und die Lebensqualität war es in diesem konkreten Fall der bessere Zugang.
Wie kann oder muss effiziente Energieversorgung künftig aussehen? KRANEBITTER: Zum einen wird Energie immer öfter lokal
gedacht, also direkt am Eigenheim erzeugt. Zum anderen sehe ich für die kommenden Jahre verstärkt den Trend Richtung Energiegemeinschaften, die es ermöglichen, Strom, Wärme und Biogas gemeinsam zu nutzen. BEATE STRUGGL: Das Thema der Energie ist nicht nur vom ökologischen Standpunkt aus sinnvoll, sondern wird auch in Hinblick auf die Betriebskosten für unsere Kunden und Partner bei der InnReal immer wichtiger, hat also auch eine ökonomische Dimension. Wohnungskäufer werden sensibler. Beim Projekt Rainer Maria passiert die Energiegewinnung über eine Grundwasserwärmepumpe, in Hinblick auf zukünftige Kosten momentan eines der führenden Systeme. Hier sind die Initialkosten zwar höher, am Ende rechnet sich die Investition jedoch.
Was ist für Sie darüber hinaus das Besondere am Projekt Rainer Maria? STRUGGL: Neben den ökologischen Aspekten finde ich besonders schön, dass sich das Projekt optimal in das Landschaftsbild des Stadtteils Pradl einfügt: Der Neubau wurde in der Konzeption sowie der Kubatur bewusst an das ursprüngliche Bestandsgebäude angelehnt. Auch die Bäume und die Vegetation im Gartenbereich wurden so gut es ging trotz Baustelle erhalten. Richtig geflasht bin ich persönlich von der Dachterrasse, die einen atemberaubenden und einzigartigen 360-Grad-Rundumblick in die Berge bietet. Zudem bietet das Projekt mit seinen nur vier Einheiten viel Privatsphäre. Die zwei kleineren Wohnungen lassen sich je nach Lebensphase bei Bedarf auch zusammenlegen
und wieder teilen, was dem Trend des Mehrgenerationenwohnens entgegenkommt.
Wo sehen Sie die Zukunft des Wohnens generell hingehen? STRUGGL: Alle Wohnungen im Projekt Rainer Maria verfügen über großzügige Freiflächen, Balkone und Terrassen, was vor allem im urbanen Bereich heute essenziell ist und in Zukunft noch wichtiger werden wird. Wohnräume müssen ganzheitlicher und im Sinne eines Work-Life-Blendings flexibler gedacht werden. War die Lebenswelt zu Hause früher ein rein privater Bereich, so müssen heute mehrere Funktionen in einem Raumkonzept untergebracht werden – Stichwort Homeoffice. Man muss auf die Entgrenztheit von Wohnen und Arbeiten Rücksicht nehmen, dabei soll der Raum jedoch immer auch lebenswert bleiben. Die Einheiten werden teilweise kleiner, dafür feiner. Die Leute sind bereit, mehr Geld für Qualität auszugeben, wenn sie dafür genau das bekommen, was ihren Bedürfnissen entspricht. Zukunftsorientiertes Bauen braucht heute den Blick aufs Morgen, mit Wohnkonzepten, die daran angepasst werden können. Mit Rainer Maria ist uns das sehr gut gelungen, wie ich finde. PR
VERKAUF & BERATUNG
InnReal. Wohn- und Wirtschaftsimmobilien GmbH

Mag. Beate Struggl
Meraner Straße 9, 6020 Innsbruck Tel.: 0676/840 505 680
rainermaria@innreal.at www.innreal.at
39 INNREAL / KAIROS
„Die Zukunft zeigt sich uns, lange bevor sie eintritt.“
RAINER MARIA RILKE
© TOM BAUSE
Beate Struggl, InnReal, und David Kranebitter, Kairos, auf dem Dach der gerade in Bau befindlichen Stadtvilla Rainer Maria in der Rilkestraße in Innsbruck.
NACHHALTIGKEIT IM TOURISMUS – MEHR ALS NUR EIN TREND
Sanftes Reisen erfährt immer mehr Zuspruch. Gäste achten vermehrt auf ihren ökologischen Fußabdruck – eine Tendenz, der Hoteliers Rechnung tragen müssen, denn Nachhaltigkeit ist weitaus mehr als nur ein Trend. Womit wir in Zukunft zu rechnen haben werden, erläutert Tourismusexperte Michael Oberhofer im Interview.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
ECO.NOVA: Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wie wichtig ist sie der Tourismusbranche wirklich? MICHAEL OBERHOFER: Nachhaltigkeit gilt derzeit als einer der Hauptzukunftstrends der Branche. Sie ist aber keine reine Gegenwartserscheinung, die wieder verschwinden wird. Wir können davon ausgehen, dass uns dieses Thema ab jetzt nicht nur ständig begleiten, sondern sogar ausschlaggebend für die künftige Entwicklung des Reisens sein wird – zu drängend sind die Fragen des Klimawandels und der Verantwortung, die wir für spätere Generationen zu tragen haben. Trendforscher prognostizieren, dass nachhaltiges Reisen in den kommenden Jahren eine immens große Rolle spielen wird, und in der Tat ist es bereits jetzt für 21 Prozent der Reisenden ein entscheidender Faktor für die Wahl einer Destination oder einer Unterkunft. Entsprechend erwarten Gäste von den Hotels, dass sie sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt und entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Voraussichtlich wird jede Planung irgendwann grün sein. Kein Betrieb kann es sich heute leisten, Nachhaltigkeit zu ignorieren.

Nachhaltigkeit ist teuer, so der allgemeine Glaube. Kann sie sich dennoch – auch finanziell – lohnen? Nun ja, erst einmal ist Nachhaltigkeit natürlich mit Kosten verbunden, wenn man sozusagen die Hardware aufrüstet. Aber Nachhaltigkeit kann, strategisch klug umgesetzt, auch gleichbedeutend mit Wirtschaftlichkeit sein. Grundsätzlich sollten wir uns in erster Linie nicht fragen, was Nachhaltigkeit heute kostet, sondern wie viel
Ein Nachhaltigkeitsbericht kann der erste Schritt in die nachhaltige Zukunft eines Unternehmens sein.
wir künftig durch sie einsparen werden. Es geht also darum, nicht nur nachhaltig zu handeln, sondern nachhaltig zu denken und zu planen, sprich: generationenübergreifend, nicht nur für uns selbst. Wir haben bis jetzt oft viel zu kurzfristig agiert. Wir dürfen nicht vergessen: Nachhaltigkeit deckt bei weitem nicht nur den Bereich Ökologie ab. Mit der alleinigen Messung und Kompensation von CO2 oder der Implementierung erneuerbarer Energiequellen ist es nicht getan. Nachhaltigkeit umfasst auch die Bereiche Soziales und Ökonomie.
Können Sie diese Aspekte näher beleuchten? Die sozialen Aspekte von Nachhaltigkeit sind enorm wichtig und wirken sich selbstverständlich auf die ökonomischen aus. Dabei geht es um die Menschen und die soziale Entwicklung eines Orts, um den Schutz der Landschaft, die Wahrung des ökologischen Gleichgewichts und der Ressourcen, eben weil sie für das Wohlbefinden der lokalen Bevölkerung so bestimmend sind. Wir müssen auf die Gäste schauen, aber ebenso auf jene, für die eine touristische Destination ein Zuhause ist. Es geht um den Umgang mit
eco. wirtschaft 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die Schaffung von Bindung und Motivation; auch die Einbindung der ortsansässigen Menschen und Unternehmen in ökonomische Abläufe und die daraus resultierende Sicherung eines stabilen Arbeitsumfelds. Kurzum, den Erhalt einer lebenswerten Region für alle. In diesem Zuge schafft man Wirtschaftlichkeit, denn sie ist die Voraussetzung für umsetzbare Nachhaltigkeit. Ich gebe nur zu bedenken, was uns eine starke Mitarbeiterfluktuation ökonomisch abverlangt: 8.000 Euro kostet im Schnitt ein Personalwechsel. Da lohnt sich doch jede Investition in gute Arbeitsvoraussetzungen! Die langfristige Sicherung eines Unternehmensstandorts bedeutet eben auch die Vermeidung von finanzieller oder sozialer Instabilität, die für Nachhaltigkeit enorm kontraproduktiv sind. Menschen, die wirtschaftlich benachteiligt sind, sehen Nachhaltigkeit nicht als erste Priorität an.
Wie lassen sich diese Bereiche Ökologie, Soziales und Ökonomie konkret in einem Betrieb umsetzen? Neben der erwähnten Fürsorge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir bewusst lokale Unternehmen unterstützen, wenn wir etwa den Gästen hauptsächlich regionale und saisonale – vermehrt auch biologisch angebaute oder vegetarische bzw. vegane – Produkte und Speisen anbieten. Wenn wir Handwerker aus der näheren Umgebung anstellen, beim Bau lokale Materialien bevorzugen, Netzwerke bilden mit den Anbietern aus der Region. Wenn wir sanfte Mobilität fördern, indem wir die Anreise durch öffentliche Verkehrsmittel unterstützen, E-Ladestationen errichten usw. Mit all diesen Maßnahmen schaffen wir ideale Voraussetzungen für eine florierende Wirtschaft vor Ort. Die Bereitschaft der Gäste, für höhere Qualität mehr Geld auszugeben, liegt bei 80 Prozent. Hier nehmen meines Erachtens besonders kleine familiengeführte Häuser mit gelebten Hotelkonzepten eine Vorreiterrolle ein. Sie punkten meist mit weniger, dafür hervorragenden Leistungen, dem Einsatz moderner Technologien, einem umweltfreundlichen – übrigens auch ästhetischen – minimalistischen Design und oft bereits durch energetische Selbstversorgung. Für die Gäste sollten all diese Maßnahmen auch dort erkennbar gemacht werden, wo sie – wie etwa bei nachhaltigen Wellnesslösungen, alternativen Energiequellen und sozialen Bestrebungen – nicht unmittelbar ersichtlich sind. Schließlich sollen sie wie das Hotelteam selbst für gelebte Nachhaltigkeit sensibili-

siert und auf dem Weg zu einer nachhaltigen Infrastruktur mitgenommen werden. Die Veränderung in den Köpfen ist ebenso wichtig wie tatsächliche Maßnahmen.
Haben Sie weitere konkrete Tipps für Nachhaltigkeit in den einzelnen Hotelbereichen? Essenziell sind auch die kleinen Maßnahmen, denn sie machen in der Summe viel aus. Nachhaltige Ziele können sein, Energieverbrauch und Verpackungsmüll zu reduzieren; energetische Selbstversorgung anzustreben, gerade angesichts der stetig steigenden und unvorhersehbaren Energiekosten; effizient zu heizen, auf die richtige Raumtemperatur zu achten; wassersparende Duschköpfe zu nutzen. Oder in der Gastkommunikation auf einen klugen Mediamix zu setzen: zur Papiereinsparung vermehrt auf digitale Medien umzusteigen und Print dafür wirklich hochwertig und nachhaltig zu gestalten – auch hier sollte man unbedingt auf Qualität statt Masse setzen. Wie erwähnt haben auch ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln und deren Einkauf
oder Maßnahmen gegen Food Waste starke Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck. In diesem Bereich kann die Umwelt wirklich entlastet und gleichzeitig die soziale Nachhaltigkeit gestärkt werden. Im Bereich der Reinigung kann man umweltverträgliche Produkte und Technologien mit geringem Energie- und Wasserverbrauch einsetzen. Gut ist es, Checklisten über mögliche Maßnahmen zu führen. Wichtig ist, sich und dem Unternehmen Zeit zu geben, Prozesse zu verändern.
Es wird trotz allem immer auch um Verzicht gehen. Wie kann das den Gästen schmackhaft gemacht werden? Wir müssen realistisch sein: Menschen verzichten nicht gern. Aber es gibt Möglichkeiten, den Verzicht etwa auf bestimmte Angebote auszugleichen, sodass er nicht mehr ins Gewicht fällt. Wenn ich etwas Besseres erhalte als das, was ich gerade nicht haben kann, wird mir das, was ich nicht erhalte, nicht mehr so viel bedeuten. Wenn wir es als Gastgeber schaffen, unsere Gäste mit wenigen, dafür ausgezeichneten Produkten und Leistungen, vor allem aber mit Erlebnissen zu beeindrucken, die ihnen im Gedächtnis bleiben, dann werden wir eine Bindung zu ihnen herstellen, die durch nichts zu überbieten ist. Ich kann die Bedeutung von echter Gastfreundschaft gar nicht genug betonen. Aufmerksamkeit, Menschlichkeit, Interesse am anderen sind nichts Altmodisches, sondern ein Wert, der alle Zeiten überdauert und nachhaltig ist, weil er haften bleibt. Schöne Erinnerungen gehören für uns zum Wichtigsten überhaupt, sie sind wichtiger als Materielles. Auch das liegt in unserer Verantwortung als Touristiker, diese emotionale Bindung an einen Ort durch unser Verhalten zu fördern – denn wer eine Verbindung zu einem Ort und seinen Menschen aufbaut, will ihn automatisch auch bewahren. Genau das ist Nachhaltigkeit: das Gute für die Zukunft zu bewahren. Es lohnt sich, nicht immer reine Gewinnmaximierung zu betreiben, sondern auch ökologisch, ökonomisch und sozial zu handeln und langfristige Erfolge anzustreben, die allen dienen.
eco. wirtschaft 41
„Die sozialen Aspekte von Nachhaltigkeit sind enorm wichtig und wirken sich selbstverständlich auf die ökonomischen aus.“
MICHAEL OBERHOFER
MICHAEL OBERHOFER ist teilhabender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe für Tourismus HMM mit unter anderem den Agenturen Brandnamic und MTS Austria GmbH.
IN RICHTUNG ENERGIEUNABHÄNGIGKEIT
Die Gründe für den Ausstieg aus Öl und Gas sind eigentlich hinlänglich bekannt. Doch stellt sich für viele, die umrüsten wollen beziehungsweise müssen, die Frage, welche erneuerbare Wärme- oder Energielösung für den jeweiligen Anwendungsfall die beste ist. Die Komplexität bei Heizungsanlagen ist eindeutig gestiegen und so sind professionelle Beratung bei der Planung und maßgeschneiderte Umsetzungskonzepte von GUTMANN Energiesysteme gefragter denn je.
TEXT: DORIS HELWEG
In einer Zeit mit vielen negativen Nachrichten ist es umso schöner, wenn man über positive Unternehmenserfolge berichten kann. GUTMANN Energiesysteme GmbH ist ein leuchtendes Beispiel, wie ein Unternehmen mit einem Beitrag zur Energiewende gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein kann.
Als 100-Prozent-Tochter des Tiroler Familienunternehmens GUTMANN wurde die GUTMANN Energiesysteme GmbH 2019 gegründet und bietet Komplettlösungen im Bereich von Wärme-, Kälte- und Stromerzeugungsanlagen. „Hohe Energiepreise, entsprechende Vorgaben und Initiativen auf EU-/Bundes- und Bundesländerebene und die daraus resultierenden gut dotierten Förderprogramme sind die treibenden Kräfte, wodurch sich viele Kunden derzeit Gedanken über ihre Energieversorgung bzw. eine entsprechende Umrüstung auf erneuerbare Systeme machen. Eine möglichst große Unabhängigkeit steht dabei bei den meisten im Vordergrund“, erläutert Christian Schwaiger, Geschäftsführer GUTMANN Energiesysteme.
UMSTELLUNG AUF INNOVATIVE ENERGIESYSTEME
Die GUTMANN Energiesysteme GmbH bietet ihren Kunden eine umfassende Beratung bei der Planung einer Heizungsanlage inklusive maßgeschneiderter Umsetzungskonzepte, bei denen großer Wert auf die Zusammenarbeit mit Tiroler Handwerks- und Installati-
onsbetrieben gelegt wird. Was als alternative Energiequelle in Betracht kommt, hängt maßgeblich vom Bestand ab. „Es ist nicht in jedem Haus eine Pelletsanlage möglich und man kann auch nicht in jeder Wohnanlage eine Wärmepumpe errichten“, weiß Schwaiger. Welche Wärmeversorgung für das jeweilige Objekt die richtige Wahl ist, hängt von mehrerlei Faktoren ab – etwa Altbestand oder Neubau, Wärmeabgabesystem Hoch- oder Niedertemperatur, Lage und Größe des Gebäudes bzw. bestehender Räumlichkeiten. „Darum ist es wichtig, dass wir zum Kunden gehen und vor Ort die baulichen und technischen Gegebenheiten aufnehmen. Die Wünsche und Bedürfnisse der Interessenten wie auch die technologischen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte fließen in das Konzept ein, welches Verwalter oder Eigentümer als tragfähige Entscheidungsgrundlage von uns erhalten“, so der Energieexperte. „Ein Energiemix und
die Kombination von verschiedenen Heiztechniken und -systemen, um alle Bedürfnisse für jede Situation optimal abdecken zu können, wird die Lösung sein“, ist Schwaiger überzeugt, „denn pauschale Lösungen gibt es im Zusammenhang mit der Sanierung einer bestehenden Heizanlage nicht.“
Eine Pelletsheizung stellt eine saubere und CO2-neutrale Alternative zu Öl und Gas dar und ist somit eine zukunftsträchtige Heiztechnologie und oftmals der optimale Energieträger für einen nachhaltigen Heizungstausch. Im GUTMANN-Pelletsspeicher in Hall lagern rund 10.000 Tonnen Pellets. Ein beruhigender Aspekt für Pelletsheizungsbetreiber in Zeiten der Energieknappheit, denn somit kann die Versorgungssicherheit in bester Holzpelletsqualität garantiert werden. In ausgeklügelten Becherwerk- und Absaugtechniken der Anlage gelangen nahezu staubfreie Pellets in die LKWs. Wichtig ist, dass je geringer der Staubanteil der verpressten Holzspäne ist, desto höher ist der Wirkungsgrad. Neben der Direktbelieferung mit LKWs an die Kunden-Pelletslager wird bei GUTMANN auch Sackware in 10- oder 15-Kilogramm-Säcken an Tankstellen oder im Ab-Hof-Verkauf angeboten. Somit ergänzt sich das Angebot von Tochter- und Mutterunternehmen ideal.
HOLZVERGASERANLAGE
Erst Ende Februar ist die neu errichtete Holzvergaseranlage im Pelletsspeicher in
42
„Bei der Wahl der Energieversorgung steht eine möglichst große Unabhängigkeit bei den meisten im Vordergrund.“
GUTMANN
CHRISTIAN SCHWAIGER
Alles aus einer Hand – maßgeschneiderte Konzepte für Photovoltaikanlagen für private Haushalte, Unternehmen oder Organisationen
© © GUTMANN ENERGIESYSTEME GMBH


GUTMANN
Bei einer Heizungsinstallation gibt es keine pauschale Lösung. Somit wird bei Gutmann zu Beginn der Installation die Situation vor Ort objektiv analysiert. BERNHARD POSCHER
Betrieb gegangen. Der durch drei Holzvergaser erzeugte Strom wird zur Nutzung des Eigenbedarfs erzeugt, der Überschuss wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist, die erzeugte Wärme gelangt ins Fernwärmenetz der TIGAS. Mit den doch hohen Investitionen in diese Strom- und Wärmegewinnungsanlage setzt das Energieunternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit.
KOMFORTFAKTOR OUTSOURCING
Anhand ausgearbeiteter Konzepte erstellen Techniker eine detaillierte Ausführungsplanung inklusive aller Genehmigungsverfahren. „Wir kümmern uns auch um die Beantragung möglicher Fördermittel und überwachen die Errichtung der Anlage bis zur protokollierten Abnahme der Anlage“, verrät Schwaiger und ergänzt: „Aus unserer Erfahrung ist es für Kunden ein interessantes Thema, sich während der gesamten Sanierung um nichts kümmern zu müssen und die Umrüstung sozusagen komplett outzusour-
cen. Um den Kunden auch nach der Errichtung der Anlage jeglichen Komfort zu bieten, betreuen und warten wir auf Wunsch die Anlagen. Der Großteil unserer errichteten Anlagen ist auf unsere Fernüberwachungssystem aufgeschaltet. Damit werden Störungen zumeist schon im Frühstadium erkannt und können in den meisten Fällen auch aus der Ferne behoben werden. In den restlichen Fällen kommt der Techniker unverzüglich an Ort und Stelle, sodass der Kunde im Idealfall die Auswirkungen einer aufgetretenen Störung gar nicht bemerkt.“
Eine professionelle Betriebsführung und eine vorausschauende Wartungs- und Instandhaltungsstrategie sind die wesentlichen Stellhebel für einen optimalen Betrieb der Anlage und zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit sowie eines optimalen Anlagenwirkungsgrades. Schwaiger: „Im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Sanierung einer Wärmeerzeugungsanlage bieten wir unseren Kunden auch alternative Modelle in Form eines Anlagencontractings
an. In diesem Modell errichten und betreiben wir die für den jeweiligen Bedarf maßgeschneiderte Energieversorgungsanlage auf unser eigenes Risiko und Kosten. Die Vertragslaufzeiten können dabei variieren und werden auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Das gemeinsame Ziel besteht darin, durch eine nachhaltige und erneuerbare Energieerzeugung wirtschaftliche und ökologische Vorteile zu erreichen.“
PHOTOVOLTAIK
Neben Planung und Errichtung von Pellets- und Wärmepumpenanlagen für die Bereitstellung von Wärme und Kälte ist die GUTMANN Energiesysteme GmbH auch Spezialist für die Errichtung von Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen. „In den vergangenen Jahren haben sich Photovoltaikanlagen in der Stromerzeugung etabliert. Die Vorteile einer PV-Anlage vor allem für Gewerbetreibende liegen auf der Hand: nachhaltige Absicherung der Stromkosten und Unabhängigkeit, eine Stromkostenreduktion durch selbst erzeugten PV-Strom und attraktive Förderungen. Zudem gibt es derzeit zusätzliche Einnahmen durch hohe Einspeisevergütungen“, so Schwaiger.
Bei der Gutmann Energiesysteme GmbH erhalten Kunden eine maßgeschneiderte PV-Anlage von der Beratung über die Planung, Montage, Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Durchführung aller erforderlichen Genehmigungen und Abwicklung des Förderantrages. „Bei allen Photovoltaikanlagen stellt sich die Frage, was man mit seinem Erzeugungsüberschuss machen soll, da meist nicht die gesamte Menge an produziertem Sonnenstrom verwendet werden kann. Der Eigenverbrauch liegt beim privaten Haushalt bei ca. 25 bis 35 Prozent, bei Unternehmen entsprechend höher. Durch eine auf die unterschiedlichen Anforderungen abgestimmte Stromspeicherlösung können Erzeugung und Verbrauch von PV-Strom ideal miteinander kombiniert werden. Mit einem Sonnenspeicher (sonnenBatterie) kann überschüssiger Sonnenstrom, den die PV-Anlage tagsüber produziert hat, gespeichert werden, um ihn dann zu verbrauchen, wenn er benötigt wird, zum Beispiel in der Nacht. Damit kann die Eigenverbrauchsquote auf bis zu 80 Prozent erhöht und gleichzeitig der Zukauf von teurem Netzstrom reduziert werden. Durch den Einbau einer Netzumschaltbox kann der gespeicherte Strom auch im Falle eines Stromausfalls genutzt werden“, erläutert Christian Schwaiger. energiesysteme.gutmann.cc

44
GUTMANN © ANDREAS FRIEDLE
Christian Schwaiger, Geschäftsführer Gutmann Energiesysteme
VOLKSBANK TIROL WOHNBAU-FORUM

Mit über 350 Interessierten war das – nachhaltig als Onlineevent und im regionalen Digitalstudio in Mutters veranstaltete – Wohnbau-Forum der Volksbank Tirol am 22. März 2023 ein voller Erfolg.
Josef Tratter, Volksbank-Regionaldirektor für Schwaz und das Zillertal, eröffnete die Veranstaltung mit einer Darstellung der geänderten Rahmenbedingungen für Wohnbaufinanzierungen, geprägt durch den raschen Zinsanstieg über die letzten Monate, die deutlich verschärfte Regulatorik für die Vergabe von Wohnbaukrediten und das inflationsgeladene Umfeld als Treiber für die Baukosten.
NACHHALTIGES GESCHÄFTSMODELL
Dass sich Kund*innen seit über 150 Jahren auf die Volksbank Tirol als starke Partnerin verlassen können, liegt an ihrer Stabilität. Das Geschäftsmodell hat sich seit damals nicht verändert: „Wir stellen die uns anvertrauten Spareinlagen unseren Tiroler Kund*innen in Form von Wohnbaukrediten und Tiroler Wirtschaftsbetrieben in Form von Unternehmerkrediten zur Verfügung. Wir konzentrieren uns darauf, was wir gut können und wirtschaften dort, wo wir uns auskennen – in Tirol“, so Tratter. Neben der Regionalität sind auch Vertrauen und Kundennähe wichtige Bestandteile der Marke „Volksbank Tirol“ und wichtig für eine gute Beziehung zu den Kund*innen. Der Erfolg gibt der Volksbank Tirol recht: Mit einer Kernkapitalquote von über 20 Prozent zählt sie zu den kapitalstärksten Banken des Landes.

7 - PUNKTE - WOHNBAUPAKET
Förderexperte Gerhard Krug vom Amt der Tiroler Landesregierung ging in seinem interessanten Vortrag „Bauen mit Förderungen
des Landes Tirol“ zum einen auf die Themen Wohnbauförderung, die notwendigen Voraussetzungen und die verschiedenen Varianten ein. Zum anderen erhielten die Online-Teilnehmer*innen die neuesten Informationen zum wenige Tage vorher beschlossenen 56 Millionen Euro schweren 7-Punkte-Wohnbaupaket für mehr leistbares Wohnen.
SANIEREN IST NACHHALTIG
Willi Hörtnagl, ebenfalls vom Amt der Tiroler Landesregierung, lieferte in seinen Ausführungen spannende Details zum Thema Sanierung und klärte die Zuschauer*innen auf, welche Voraussetzungen für Sanierungsförderungen gelten, welche Möglichkeiten sich aus der einkommensunabhängigen Sanierungsoffensive ergeben und wie man Zuschüsse und den Ökobonus beantragen kann.
WOHNTRÄUME REALISIEREN
Antonia Egger, Wohnbauexpertin der Volksbank Tirol, zeigte in ihrer Präsentation un-
terschiedliche Finanzierungsformen auf und erläuterte, wie man den Weg zur Wunschimmobilie plant. Was sie den Online-Gästen besonders ans Herzen legt: „Nichts geht über eine gründliche Vorbereitung. Aber auch Absicherung ist wichtig, damit im Falle eines Schicksalsschlages die finanzielle Situation bestmöglich geregelt ist“, so die Expertin. Die Wohnbauberater*innen der Volksbank Tirol stehen für ein umfassendes, persönliches Beratungsgespräch sehr gerne zur Verfügung.
ENERGIEEFFIZIENTES
BAUEN UND SANIEREN
Im letzten Beitrag des Abends widmete sich Architekt DI Mag. (FH) Christian Melichar von der Energie Tirol dem Thema „Heute für morgen bauen und sanieren“. „Wir stehen in Bezug auf das Klima und den Umweltschutz mit dem Rücken zur Wand und müssen uns die Frage stellen, wie wir klimafit werden“, so Melichar. Dabei spielen für den Experten neben der thermischen Qualität der Gebäudehülle auch nachhaltige Heizsysteme, wie Wärmepumpen, erneuerbare Fernwärme, Pelletsheizungen, Photovolatikanlagen, etc. eine wichtige Rolle.
Während der Veranstaltung hatten die Zuschauer*innen die Möglichkeit, Fragen einzumelden, die am Ende von den Expert*innen beantwortet wurden. PR
TIPPS
Wer das Onlineevent verpasst hat, findet den Link zur Aufzeichnung mit den Tipps der Expert*innen unter www.wohn-bank.at
45
VOLKSBANK TIROL
V. l.: Josef Tratter, DI Christian Melichar, Antonia Egger, Willi Hörtnagl und Gerhard Krug kamen mit dem Elektro-Mini zum Studio
Antonia Egger und Josef Tratter
INNIO LEBT DIE ENERGIEWENDE VOR
INNIO entwickelt nicht nur innovative Lösungen und Services für eine saubere Energiezukunft, sondern setzt die Energiewende an seinem Hauptsitz in Jenbach mithilfe von grünem Wasserstoff (H2) auch selbst konsequent um. Jüngster Beweis für die vorbildliche Nachhaltigkeit von INNIO ist die erneute Auszeichnung durch Sustainalytics als weltweite Nummer 1 unter den Branchenunternehmen.

Mit seinen flexiblen, skalierbaren und resilienten Jenbacher Energiesystemen ermöglicht INNIO eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung – und zählt in diesem Bereich zu den Weltmarktführern. Damit versetzt INNIO Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage, Energie nachhaltiger zu gestalten und so eine sauberere Zukunft zu unterstützen.
MIT WASSERSTOFF ZUR
KLIMANEUTRALITÄT IN JENBACH
Bereits mehr als 9.000 Jenbacher Anlagen erzeugen heute grüne Energie aus erneuerbaren Energieträgern wie Biogas, Biomethan – und zunehmend auch Wasserstoff (H2), der als zentraler Bestandteil der Energiewende bereits fest im Portfolio von INNIO verankert ist. Dabei sind alle neuen Jenbacher Anlagen „Ready for H2“, also zukünftig auf einen Wasserstoffbetrieb umrüstbar. Bereits ab 2025 soll dann die gesamte Jenbacher Produktpalette für den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff ausgerollt werden.

Jüngster Meilenstein der innovativen Jenbacher Unternehmensgeschichte ist deshalb auch eine Wasserstoffkooperation mit TIWAG bzw. TINEXT. Ziel ist es, den Hauptsitz von INNIO in Jenbach bis 2025
mit grünem Wasserstoff zu versorgen, um daraus mithilfe der eigenen Technologien Strom und Wärme zu erzeugen. Überschüssige Strom- und Wärmemengen, die nicht am Standort selbst genutzt werden, sollen dabei in das lokale Strom- und Fernwärmenetz eingespeist werden. Und sobald ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff verfügbar sind, sind weitere Einsatzfelder geplant, so etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von INNIO oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler Logistikunternehmen. Damit lebt INNIO in Jenbach vor, wie der Übergang zur energieautonomen und klimaneutralen Energieversorgung von Industriebetrieben realisiert werden kann.
INTERNATIONAL AUSGEZEICHNETE NACHHALTIGKEIT
Das umfassende Commitment von INNIO zu Nachhaltigkeit wird international anerkennend wahrgenommen und als herausragend beurteilt. So hat Sustainalytics, ein global führender Anbieter von ESG-Research, -Ratings und -Daten, kürzlich das ESG-Risiko-Rating des Unternehmens von „gering“ auf „vernachlässigbar“ angehoben und INNIO erneut zur weltweiten Nummer 1 unter den Branchenunternehmen gekürt sowie als „ESG Industry Top Rated“ und
„ESG Regional Top Rated“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung durch Sustainalytics ist eine wichtige Anerkennung für INNIO und ein Indikator dafür, wie sehr sich das Unternehmen für nachhaltige Strategien und Programme einsetzt. Das international führende Rating signalisiert die positiven Ergebnisse der von INNIO gesetzten Initiativen und Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung, zur Förderung sozialer Gerechtigkeit und zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Zudem unterstreicht es auch die Bemühungen des Unternehmens um Transparenz und Verantwortung als wesentliche Faktoren für den Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei seinen Stakeholder*innen. „Jeder von uns hat eine gesellschaftliche Verpflichtung und kann einen Beitrag leisten. Wir bei INNIO tun das jeden Tag“, erklärt Dr. Olaf Berlien, President und CEO von INNIO, und ergänzt: „Sustainalytics hat unsere nachhaltigen Produkte und unser Unternehmen nochmals ausgezeichnet. Darauf sind wir alle extrem stolz.“ www.innio.com PR
46
Teamwork ist ein nachhaltiger Erfolgsfaktor von INNIO Sustainalytics kürt INNIO zur weltweiten Nr. 1 in seiner Branche
INNIO JENBACHER
Gemeinsam schaffen wir die Energiewende
Als Pionier im Bereich grüner Technologien unterstützt INNIO seine Kund:innen beim Übergang zur Klimaneutralität. Unsere dezentralen und flexiblen Energielösungen ermöglichen eine resiliente Energieversorgung und helfen gleichzeitig, CO2-Emissionen zu reduzieren. Profitieren auch Sie von unserer Expertise, während wir gemeinsam die Energiewende vorantreiben. innio.com

BEZIRK KUFSTEIN
Zahlen, Daten, Fakten.
970 km2
FLÄCHE BEZIRK KUFSTEIN
1.227 EURO
FINANZKRAFT PRO EINWOHNER
TIROLSCHNITT: 1.286 EURO
ÜBER DIE STÄRKSTE FINANZKRAFT VERFÜGT
KUNDL MIT 1.682 EURO PRO EINWOHNER.
111.999
EINWOHNER PER 1.1.2022
TIROL GESAMT: 764.102 / ANTEIL KUFSTEIN: 14,7 %
5.049 MIO. EURO
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG 2019
TIROL GESAMT: 32.411 MIO. EURO / ANTEIL KUFSTEIN: 16 %
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG PRO EINWOHNER 2019:
KUFSTEIN: 45.800 EURO / TIROL: 42.800 EURO PRO EINWOHNER
7.267
UNTERNEHMEN IM BEZIRK
TIROL GESAMT: 51.206 / ANTEIL KUFSTEIN: 14,2 %
DAVON FAST 40 % IN DER SPARTE GEWERBE & HANDWERK, GEFOLGT
VON HANDEL UND INFORMATION & CONSULTING. RUND 6 % DER
UNTERNEHMEN FINDEN SICH IN DER SPARTE TRANSPORT & VERKEHR, DAS ENTSPRICHT ZIEMLICH GENAU DEM TIROLSCHNITT.
3.244
DIENSTGEBERBETRIEBE
TIROL GESAMT: 51.206 / ANTEIL KUFSTEIN: 14,2 %
TIROL GESAMT: 12.648,4 km2 / ANTEIL KUFSTEIN: 7,7 %
Quellen: AMS/Arbeitsmarktkenndaten Februar 2023, TVB Kufsteinerland/Geschäftsbericht, Wirtschaftskammer Tirol/ Mitgliederstatistik bzw. Bezirksdaten Aktuell verfügbare Zahlen / Daten 2021, wenn nicht anders angegeben
KUNDL
48
717.272
NÄCHTIGUNGEN IM KUFSTEINERLAND VOM
1. NOVEMBER 2021 BIS 31. OKTOBER 2022
DAVON ÜBER 50 % AUS DEUTSCHLAND UND RUND 25 % AUS ÖSTERREICH. AUF DEN PLÄTZEN DREI BIS FÜNF LIEGEN DIE NIEDERLANDE, SCHWEIZ & LIECHTENSTEIN SOWIE POLEN.
DAVON FAST 65 % IM SOMMER. DAS ENTSPRICHT EINEM PLUS VON RUND 19 % GEGENÜBER DEM SOMMER 2021. IN DER WINTERSAISON 2021/22 KONNTE MAN MIT 240.590 NÄCHTIGUNGEN EIN PLUS VON 205 % IM VERGLEICH ZUR VORJAHRESSAISON ERZIELEN.
KUFSTEIN
326,1 EURO
DURCHSCHNITTSPREIS PRO M2 BAUGRUNDSTÜCK 2021
TEUERSTE GEMEINDE DES BEZIRKS: ELLMAU MIT 714,3 EURO/M2
ELLMAU
447
UNTERNEHMENSNEUGRÜNDUNGEN 2022
GESAMTTIROL: 3.164 / ANTEIL KUFSTEIN: 14,1 %
DAVON RUND DIE HÄLFTE IN DER SPARTE GEWERBE & HANDWERK.
5,2 %
ARBEITSLOSENQUOTE IM JÄNNER 2023
FRAUEN: 3,5 % / MÄNNER: 6,7 % / ÜBER 50
JAHRE: 5,3 % / TIROLSCHNITT: 4,5 %
2.267 VORGEMERKTE ARBEITSLOSE FÜR FEBER 2023. FRAUEN: 781 / MÄNNER: 1.486 / ÜBER 50 JAHRE: 718
1.552 BEIM AMS VORGEMERKTE, SOFORT VERFÜGBARE OFFENE STELLEN IM BEZIRK KUFSTEIN. TIROLWEIT SIND ES 7.851.
546
LEHRBETRIEBE
SIE BILDEN INSGESAMT RUND 1.620 LEHRLINGE AUS.
44 MENSCHEN SIND BEIM AMS IM FEBER 2023 ALS LEHRSTELLENSUCHENDE VORGEMERKT. 188 OFFENE LEHRSTELLEN WÄREN IM BEZIRK SOFORT VERFÜGBAR. TIROLWEIT TREFFEN 333 LEHRSTELLENSUCHENDE AUF
1.065 SOFORT VERFÜGBARE LEHRSTELLEN.
49.995
UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE IM JÄNNER 2023
TIROL GESAMT: 363.284 / ANTEIL KUFSTEIN: 13,8 %
49

50
STÜRMISCHE ZEITEN
Die Herausforderungen, vor denen der Bezirk Kufstein in wirtschaftlicher Hinsicht steht, sind teils dieselben wie andernorts und teilweise spezifisch. Während der Verkehr ein neuralgischer Punkt bleibt und die Wirtschaft dringend Arbeitskräfte braucht, ist das Stärkefeld Maschinenbau und Mechatronik gut bestellt. Vor allem Klein- und Mittelbetriebe sind gefordert, sich neben dem Tagesgeschäft vermehrt den Zukunftsfragen zu stellen, die erst längerfristig wirksam werden.
 TEXT: MARIAN KRÖLL
TEXT: MARIAN KRÖLL
51
Kennst du die Perle, die Perle Tirols?
Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl!

Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja das ist Kufstein dort am grünen Inn.
o beschaulich, wie es einem im aus den 1940er-Jahren stammenden Kufsteinlied vorgeschunkelt wird, geht es in und um die Perle Tirols heute freilich nicht (mehr) zu. Und das ist auch gut so. Der Bezirk Kufstein ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort, der ungebrochen großes Potenzial hat. Hier sucht man, wie andernorts auch, nach Antworten auf die großen Zukunftsfragen. Auf die Frage, wie eine Gesellschaft und eine Wirtschaft zu organisieren sein wird, die sich langsam von fossilen Brennstoffen verabschiedet, die in der Mobilität
den Verbrennungsmotor überwiegend oder ganz durch den Elektromotor zu ersetzen gedenkt und die endliche Ressourcen effizienter verwenden will, indem diese, wo es möglich ist, im Modus der Kreislaufwirtschaft im Kreis geschickt werden.
WIRTSCHAFT DER ZWEI
GESCHWINDIGKEITEN
Diesen und anderen Fragen stellt sich Peter Wachter von Berufs wegen. Er leitet seit zehn Jahren die Bezirksstelle
eco. wirtschaft
der Wirtschaftskammer Kufstein und kennt die hiesige Wirtschaft und die Verhältnisse. Im Hinblick auf die Befassung mit den drängenden ökonomischen Zukunftsfragen ortet er so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft bzw. -wirtschaft. Während die großen Unternehmen, die mitunter in internationale Konzernstrukturen eingebettet sind, sich schon heute intensiv mit diesen Zukunftsfragen auseinandersetzen, kommen längerfristig angelegte Überlegungen im Tagesgeschäft vieler Kleinund Mittelbetriebe zu kurz, weil ihnen schlicht die Ressourcen für einen strategischen Umgang damit fehlen. Wo für hochtrabende Visionen wenig Raum bleibt, ist Pragmatismus gefragt. „Für den typischen Handwerksbetrieb ist es wichtig, dass es entsprechende Fördermodelle gibt, welche zum Beispiel die Energiekosten auf einem konkurrenzfähigen Niveau halten“, meint Wachter. Zu großen strategischen Überlegungen würde die Zeit nicht reichen, mit dem chronischen Mitarbeiter*innenmangel bei guter Auftragslage gebe es zudem andere, unmittelbarere Themen, die im täglichen Wirtschaften Priorität genießen. Die Kammer, versichert Wachter, sei zwar bemüht, ihren Mitgliedern entsprechende Angebote zu machen, nur müssten diese auch angenommen werden, um Wirkung entfalten zu können.
HÄNDERINGEND
„Fast jeder Betrieb sucht Mitarbeiter, die er momentan nicht findet“, sagt Peter Wachter. Bei der demografischen Entwicklung ist nicht zu erwarten, dass sich das so rasch ändern wird, es sei denn, es kommt eine unerwartet kräftige Rezession mit all ihren negativen Begleiterscheinungen daher. Das wünscht sich niemand.
Aus dem jahrelangen Mangel an spezifischen Fachkräften, die fieberhaft und – wie es in diesem Zusammenhang gerne heißt – händeringend gesucht und nicht gefunden wurden, ist ein allgemeiner Arbeitskräftemangel geworden, von dem keine Branche verschont bleibt. „Die Situation ist mittlerweile dramatisch“, sagt Wachter, der schon seit Jahren keinen Betrieb mehr angetroffen hat, bei dem die personelle Lage nicht angespannt gewesen wäre. In Beherbergung und Gastronomie ist Personalmangel schon fast Tradition und besonders evident. „Man findet in vielen Orten kaum mehr ein Restaurant, das die ganze Woche offen hat“, beklagt Wachter. Das gastronomische Angebot ist ob der Situation am Jobmarkt längst eingeschränkt, und zunehmend müssen auch andere Branchen Federn lassen und können nicht in der Form wachsen, wie es die Auftragslage und wirtschaftliche Entwicklung zulassen würde. „Ob im klassischen Handwerk, im Handel, bei den LKW-Fahrern, bei Reinigungskräften, in der Pflege, wohin man auch schaut, es fehlt an allen Ecken und Enden“, weiß der Wirtschaftskämmerer.
Die Angst, dass die Digitalisierung und damit verbunden Automatisierung eine Jobvernichtungsmaschine sein könnte, hat sich gelegt. Ganz im Gegenteil könnte Automatisierung, wo sie sich anbietet, zur Entspannung der Situation beitragen. Doch nennenswerte Automatisierung sei, erklärt Wachter, auch wieder in erster Linie den grö-
ßeren Unternehmen vorbehalten. Dort gibt es Potenziale und die Ressourcen, sich eingehend mit dem Thema zu befassen und entsprechende Maschinen anzuschaffen, die menschliche Arbeitskraft teilweise ersetzen können. „Die größeren Produktionsbetriebe automatisieren, wo es möglich und zielführend ist, bei einem Zimmerer oder einem Dachdecker ist das Potenzial aber vergleichsweise doch sehr beschränkt, nennt Wachter ein Beispiel. Zudem sind hochqualifizierte Arbeitskräfte, die Maschinen bauen, warten, programmieren und bedienen können, äußerste Mangelware. Das hängt auch mit der Konkurrenz im Mechatroniksektor zusammen, die im benachbarten bayrischen Raum besonders groß ist.
Den Kufsteiner Betrieben fällt es nicht leicht, Arbeitnehmer*innen aus den Grenzregionen zu gewinnen. Es gibt natürlich Einpendler, aber mindestens ebenso viele Kufsteiner*innen arbeiten in Deutschland. Deswegen ist der Saldo zwischen Ein- und Auspendlern ungefähr null und trägt nicht dazu bei, die Situation in irgendeiner Weise zu entspannen. Dort, im angrenzenden Bayern, suche man auch nach Fachkräften, gibt Wachter zu bedenken. Ebenfalls „händeringend“, versteht sich. Wenn es hierzulande nicht mehr genügend Arbeitskräfte gibt, die man aktivieren könnte, müssen diese eben von woanders herkommen. Das gebietet die Logik. Deshalb müsste man es einfacher machen, qualifiziertes Personal ins Land holen zu können. „Das hören wir tagtäglich von unseren Unternehmen und das ist auch die Botschaft, die wir ständig an die Politik weitergeben“, sagt Wachter, dem diesbezüglich eine gewisse Resignation anzumerken ist.

eco. wirtschaft 53
FOTOS: © TIROL WERBUNG, ADOBE STOCK
„Im Industriebereich sind unsere Betriebe fast durchwegs gestärkt aus der Pandemie herausgekommen. Gastronomie und Beherbergung haben sich durch die öffentlichen Förderungen über Wasser halten können.“
PETER WACHTER, WIRTSCHAFTSKAMMER KUFSTEIN
Gerade erst um Weihnachten herum habe es einen Aufschrei aus dem Tourismus gegeben, weil die Kontingente für ausländische Arbeitskräfte viel zu knapp bemessen gewesen seien, moniert der Kämmerer, der Handlungsbedarf nicht nur unmittelbar sieht, sondern auch was die mittelfristige Planung entsprechender Maßnahmen betrifft. „Es fehlt an einer klaren Strategie des Bundes. Jeder weiß, dass wir ausländische Arbeitskräfte brauchen werden, aber es gibt keinerlei Strategie, wie man diese Menschen ins Land bringt. So ist es immer nur ein Stopfen von Löchern, das unkoordinierte Stolpern von einem Personalnotstand in den nächsten.“ Das ist keine schmeichelhafte Diagnose, aber eine doch sehr landestypische, urösterreichische. Ein zu Politik geronnenes „Schau ma mal“. Wachter hat auch dafür eine Erklärung, die über den Kufsteiner Raum hinaus Gültigkeit beanspruchen darf: „Die Diskussion über Arbeitsmigration ist rein von Ideologie geleitet, weil die Regierungsparteien aus wahltaktischen Überlegungen außerstande sind, eine schlüssige Strategie vorzulegen. Dabei bräuchten wir für unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ein System, das es nach genau vorgezeichneten Kriterien ermöglicht, planbar und rechtssicher qualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu holen.“ Nebenher muss ein solches System auch noch konkurrenzfähig sein, denn andere europäische Staaten stehen vor denselben demografischen Herausforderungen und zeigen schon bedeutend mehr Esprit, wenn es um die Hereinnahme von Arbeitskräften aus dem Ausland geht.
Mit dem Wort „Willkommenskultur“ wurde in der Vergangenheit Schindluder getrieben, doch hier wäre eine solche in der Tat angebracht. Qualifizierte Arbeitskräfte werden in ihrer Migrationsentscheidung zu berücksichtigen wissen, wo sie auch wirklich willkommen sind. In dieser Kategorie ist hierzulande deutlich Luft nach oben. „Machen wir hier unsere Hausaufgaben nicht, gehen diese Arbeitskräfte eben nach Deutschland und nicht nach Österreich. Wir in der Wirtschaftskammer haben nicht den Eindruck, dass die Politik hier ihre Hausaufgaben macht“, mahnt Wachter, der dem ineffizienten und bürokratischen Modell der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ die rote Karte zeigt. „Sie ist in der derzeitigen Ausgestaltung kein Instrument, mit dem man in der Fläche arbeiten kann“, so Wachter.
KEIN LONG - COVID IN DER WIRTSCHAFT
„Im Industriebereich sind unsere Betriebe fast durchwegs gestärkt aus der Pandemie herausgekommen“, weiß
Wachter Positives zu berichten. Das habe besonders für zwei Leitbetriebe, nämlich Medikamentenhersteller Sandoz und den Gartengeräteproduzenten STIHL Tirol, gegolten. „Gastronomie und Beherbergung haben sich durch die öffentlichen Förderungen über Wasser halten können, so dass wir nur vereinzelt Ausfälle gehabt haben“, resümiert Wachter. Es ist keineswegs gesagt, dass das dicke Ende nicht erst noch kommen wird, denn nun sind die staatlichen Zuschüsse, die in der Pandemie nachweislich durchaus üppig waren, versiegt. Die Energiekosten, obwohl subventioniert, sind in die Höhe geschossen, die Personalkosten, wesentlich inflations-, aber auch arbeitsmarktbedingt, ebenso. Eine Entwarnung könnte also noch verfrüht sein. In der Pandemie dürfte es durch die Lockdowns und den Stillstand in manchen Branchen zu einer Wanderungsbewegung von Arbeitskräften von Gastronomie und Hotellerie, oft handelt es sich dabei um Saisonarbeitsplätze, in Ganzjahresjobs in der Industrie gekommen sein. Das verschärft die ohnehin bereits unerfreuliche Personalsituation im Tourismus noch einmal zusätzlich, wenn Köche auf die Fertigungsstraßen der Industriebetriebe wechseln, wo viele Köche nicht den Brei verderben.

VOLATILE ZEITEN
Neben der prekären Personalsituation halten die hohen Energiepreise die Unternehmen im Bezirk auf Trab. Beides sind freilich keine Kufstein-spezifischen Probleme und folglich auch nur bedingt hausgemacht. Dennoch wäre es zu einfach, die Lösung dieser Herausforderungen nach außen, an nächsthöhere nationale, internationale, intergouvernementale Ebenen zu delegieren und selbst passiv zu bleiben. Trotz der kostenseitigen Herausforderungen – man könnte auch Zumutungen sagen – ist das Insolvenzgeschehen noch relativ ruhig und nicht höher als vor der Pandemie. Die Stunde der
eco. wirtschaft 54
Der Bezirk Kufstein ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort, der ungebrochen großes Potenzial hat. Hier sucht man, wie andernorts auch, nach Antworten auf die großen Zukunftsfragen.
Performance
Wissensgesellschaft.
Wahrheit kommt vielleicht in diesem Jahr, denn durch verschiedene Kostensteigerungen, vor allem bei Energie und Krediten, dürften besonders Geschäftsmodelle bedroht sein, deren Margen ohnehin niedrig sind und die ihre gestiegenen Kosten nicht auf ihr Produkt oder ihre Dienstleistung überwälzen können. Für besonders energieintensive Unternehmen ist staatliche Unterstützung mitunter überlebenswichtig. „Die staatlichen Unterstützungsleistungen haben auch dazu beigetragen, die Aufregung rund um die Energiepreise etwas zu dämpfen“, sagt Wachter. „Die Zeiten sind insgesamt sehr volatil. Unternehmen können dadurch nur schlecht planen“, so der Experte aus der Kammer, der auf absehbare Zeit keine Beruhigung erwartet.
Europa und die Welt driften auf unruhige Zeiten zu, in denen die rasche Abfolge wechselnder und sich über-
lappender Krisen zunehmend zur Normalität wird. Eine Normalität, auf die sich Unternehmen einstellen müssen und die neben höherer wirtschaftlicher Resilienz auch da und dort andere, bessere politische Rahmenbedingungen braucht. „Die Unternehmen haben gelernt, mit diesen krisenhaften Erscheinungen zu leben und sich rasch darauf einzustellen“, ist Peter Wachter überzeugt, der für den Bezirk keinesfalls schwarzmalen möchte. Kufstein hat Potenziale, besonders im Stärkefeld Maschinenbau und Mechatronik, den Leitbetriebe wie beispielsweise 3CON, Stihl und Lindner Traktoren technologisch anführen. Dort gibt es auch die größten Automatisierungspotenziale. Traditionell stark ist auch der Transportbereich, was naturgemäß mit der exponierten Lage des Bezirks zu tun hat. „Wir haben die höchste Speditionsdichte in ganz Tirol“, hält Wachter fest.
eco. wirtschaft 55
Als Fachhochschulstandort hat Kufstein insgesamt gute Voraussetzungen, um den ständigen Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu etablieren. Bildung und Ausbildung im Schul- genauso wie im Hochschulsektor sind mit ausschlaggebend für die wirtschaftliche
einer Region in der heutigen
#glaubandich
Unser Land braucht
Unternehmer:innen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt.
Erfreulich entwickelt sich auch der Tourismus, auch wenn dessen Intensität nicht so hoch ist wie andernorts in Tirol. Besonders die Sommersaison entwickelt sich zum Frequenzbringer, der sich zunehmender Beliebtheit bei Gästen aus dem In- und Ausland erfreut. Weniger Erfreuliches gibt es vom stationären Handel zu berichten, wo bereits in der Vergangenheit Betriebe überproportional weggebrochen sind und Leerstände in den Ortszentren erzeugt haben. Diese Leerstände können vor allem in Randlagen persistieren, wohingegen Toplagen mit hoher Frequenz meist rascher wieder besiedelt werden können.

GEMEINSAMES ARBEITEN
Wo New Work und die sinnvolle Nachnutzung leerstehender Gewerbeflächen zusammentreffen, kann Coworking stattfinden. „Wir haben ein großes gemeinsames Projekt am Start. Es entsteht mitten in der Stadt in einem ehemaligen Einkaufszentrum ein großer Coworking-Space, der im Sommer eröffnet werden soll“, sagt Wachter, der das Thema im ganzen Bezirk vorantreiben will. Federführend bei diesem Projekt ist die Innovationsplattform Kufstein i.ku, „ein Verein von Impulsgebern, die durch Austausch und gemeinsames Agieren einen Beitrag zum nachhaltigen Wohl der Region Tiroler Unterland leisten möchten“, wie es gemäß eigener Definition heißt.
Als Fachhochschulstandort hat Kufstein insgesamt gute Voraussetzungen, um den ständigen Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu etablieren. Bildung und Ausbildung im Schul- genauso wie im Hochschulsektor sind mit ausschlaggebend für die wirtschaftliche Performance einer Region in der heutigen Wissensgesellschaft. „Wir arbeiten mit der FH Kufstein bei Wirtschaftsthemen sehr gut zusammen“, zeigt sich Wachter zufrieden mit der Verschränkung von Wirtschaft und Wissenschaft. Bemerkenswert ist, dass es im Bezirk keine HTL gibt, obwohl die Wirtschaft durchaus technologielastig aufgestellt ist. Daher versucht man, vor allem über die Lehre die Jugend für den so wichtigen MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu sensibilisieren. „Es gibt in Kufstein eine Mechatronik-Berufsschule und den Wunsch, zu-
eco. wirtschaft
Kufstein hat Potenziale, besonders im Stärkefeld Maschinenbau und Mechatronik. Traditionell stark ist auch der Transportbereich, was naturgemäß mit der exponierten Lage des Bezirks zu tun hat.

Kontakt zu vermietbaren Flächen: immobilien@bodner-bau.at + 43 664 80699 1800 bodner-immobilien.at Jetzt Anfragen! 2023 2025 OFFICE · GEWERBEFLÄCHE · SCHAURAUM · STELLPLÄTZE · E-SCHNELLLADER ARGE ZECHNER – GRABHER / EXPRESSIV.AT EXCELLENT WORK SPACE 4.700 m2 ZUR MIETE.
künftig eine Abend-HTL für Mechatronik und Maschinenbau anbieten zu können“, verrät der Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter.
TEURE HEIMAT, KNAPPER BODEN
Während manche Branchen boomen, herrscht in anderen Ratlosigkeit. Der stationäre Handel hat Probleme. Das ist allerdings auch kein Phänomen, das sich auf Kufstein beschränken würde, sondern ein zumindest mitteleuropäischer Negativtrend. Besonders kleine, familiengeführte Betriebe tun sich schwer, sich gegen die übermächtige Online-Konkurrenz zu behaupten und geben auf. Oft geschieht das auch, weil keine geeigneten Nachfolger gefunden werden, wenn eine altersbedingte Betriebsübergabe ansteht. Der Ausdünnung des Handels und den damit verbundenen Konzentrationstendenzen, die sich im Lebensmittelhandel in Österreich in einem Oligopol verfestigt haben, wird noch zu wenig Beachtung geschenkt. Konkurrenz belebt das Geschäft und sorgt dafür, dass die Marktmacht weniger Player nicht übergroß wird und in einem Preisdiktat für Kunden wie Lieferanten gleichermaßen gipfelt. Die meisten Lebensmittel sind im benachbarten deutschen Raum teils deutlich billiger als in Österreich, selbst wenn man

die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze herausrechnet. Das Problem ist hausgemacht und hat steuerliche wie strukturelle Ursachen, für die der Endverbraucher täglich zur Kasse gebeten wird und die sich auch in der Inflationsberechnung niederschlagen.
Ein Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung in Kufstein ist nicht nur das knappe Arbeitskräfteangebot, auch bei Gewerbeflächen herrscht Knappheit. „Immobilien sind teuer, das betrifft den Wohnraum genauso wie Gewerbeimmobilien“, hält Wachter fest. Jungunternehmer hätten kaum Möglichkeiten, sich etwas zu schaffen, weil die Preise für Grund und Boden so hoch seien. „Wir brauchen hier unbedingt Entwicklungsflächen und sind mit diesem Anliegen auch mehrfach beim Land Tirol vorstellig geworden. Die Raumordnung bremst uns diesbezüglich sehr ein“, weiß Wachter. Das Thema ist höchst sensibel, nicht nur in Kufstein. In ganz Tirol fehlt es an gemeindeübergreifender, koordinierter Raumordnung. „Es gibt hier einige konkrete Fälle. Wir bemühen uns seit mehreren Jahren, dass ein Handwerksbetrieb in Münster 1.400 Quadratmeter Fläche erwerben kann, die für Erweiterungen dringend gebraucht würden, aber als landwirtschaftliche Vorsorgefläche gewidmet sind.“
Die Lage ist schwierig, sie offenbart fundamentale Interessengegensätze, die kaum zu überbrücken sind. Einerseits gilt es, mit den wertvollen landwirtschaftlichen Flächen im Land sorgsam umzugehen, andererseits braucht die Wirtschaft Raum zum Wachsen, weil es zum Paradigma des Wachstums bisher keine tragfähige Alternative zu geben scheint und eine Postwachstumsökonomie kaum mehr als graue Theorie ist. Sicher ist, dass der Bodenverbrauch und die -versiegelung in Österreich schon heute zu hoch sind, man bezeichnet die Entwicklung mitunter nicht zu Unrecht als Flächenfraß. Die Wirtschaftskammer hat naturgemäß die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und lobbyiert im Landhaus für die Schaffung einer neuen raumordnungsrechtlichen Kategorie – analog zu den bestehenden landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen – für „gewerbliche Vorsorgeflächen“, die der Wirtschaft vorbehalten sein sollen. „Das würde ein konkretes Entwicklungspotenzial aufzeigen und man müsste nicht um jeden Quadratmeter Fläche streiten“, argumentiert Wachter. Im Zusammenhang mit der Raumordnung ist auch der Hochwasserschutz – Stichwort Retentionsflächen – zu sehen, bei dem im Bezirk seit einigen Jahren zuverlässig die Wogen hochgehen. Besonders in Radfeld ist man nicht begeistert von den Hochwasserschutzplänen des Landes und befürchtet, dass die Gemeinde dadurch in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu stark limitiert wird. Die Natur, im konkreten Fall der Inn, braucht bei Hochwasser Möglichkeiten, kontrolliert über die Ufer treten und gewisse ausgewiesene Flächen überfluten zu können, ohne dabei den Siedlungsraum zu gefährden. Für jegliche andere Nutzung – als Gewerbe- oder Wohnflächen – abseits der Landwirtschaft sind diese Flächen klarerweise verloren. „Da kommt man nicht aus, aber in diesem Thema ist momentan wenig Bewegung
eco. wirtschaft 58
Aktuell behilft man sich in Kufstein mit Blockabfertigung und Dosierampeln gegen die Verkehrslawine. Eine schlechte Lösung für die transitgeplagte Region, aber eine bessere gibt es derzeit wohl nicht.
und ich sehe in näherer Zukunft keine alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung“, sagt Wachter zu den verhärteten Fronten rund um den Hochwasserschutz. Über die Aufteilung der zweifellos notwendigen Retentionsflächen im Bezirk werden möglicherweise letztlich die Höchstgerichte zu entscheiden haben.
ZÄHER VERKEHR
Kufstein leidet seit vielen Jahren unter dem Verkehr und in besonderem Ausmaß unter dem Schwerverkehr. Hieß es einst in Bezug auf die Inntalautobahn noch „Verkehr ist Leben!“, so hat sich dieser Leitspruch heute in sein Gegenteil verkehrt. „Leben statt Verkehr“ entspricht heute eher dem Zeitgeist. Die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene verläuft schleppend und wird von allen Beteiligten bestenfalls halbherzig verfolgt, auch wenn es auf der Tiroler Seite nachweislich besser aussieht als in Bayern. „Bayern kommt überhaupt nicht weiter. Dort wird noch über die Trassenführung gestritten. Bis es da eine Lösung gibt, wird der Brennerbasistunnel wohl wieder sanierungsbedürftig sein“, meint Wachter resigniert. Derweil behilft man sich mit Blockabfertigung und Dosierampeln gegen die Verkehrslawine. Eine schlechte Lösung für die transitgeplagte Region, aber eine bessere gibt es derzeit wohl nicht, zumal in der EU dem freien Warenverkehr Priorität gegenüber der Lebensqualität und
Gesundheit der Bevölkerung an den Hauptverkehrsadern eingeräumt wird. Peter Wachter hofft, dass mit der neuen Tiroler Landesregierung das zuletzt frostige Gesprächsklima mit der bayerischen Landesregierung wieder besser wird und für beide Seiten akzeptable Lösungen gefunden werden, die Wirtschaft und Bevölkerung gleichermaßen Luft zum Atmen lassen. „Die Blockabfertigung tut unserer regionalen Wirtschaft auch weh, weil dann auch für unsere LKW kein Weiterkommen ist“, sagt Wachter. Der Verkehr in und um Kufstein bleibt also eine zähe Angelegenheit.
Summa summarum ist die Gemengelage zwar herausfordernd, aber zugleich spannend und voller Möglichkeiten. Die Zeiten sind volatil, dementsprechend muss man der Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegenblicken. Mehr noch als früher wird es darauf ankommen, die Innovationskraft der Wirtschaft auch und besonders in den Klein- und Mittelbetrieben, die auch in Kufstein das Rückgrat der Wirtschaft darstellen, zu entfesseln. Dazu bedarf es auch entsprechender (Aus-) bildungsangebote und einer Bildungslandschaft, welche die ökonomischen und sozialen Herausforderungen adressiert. Die Zukunft ist kein Selbstläufer, es zahlt sich aus, diese aktiv mitgestalten zu wollen. So bleibt gewährleistet, dass die Perle Tirols auch in Zukunft noch glänzt und ein Ort bleibt, an dem Menschen gerne leben, arbeiten und urlauben.

eco. wirtschaft 59
„EIN BISSCHEN WENIGER GEMÜTLICH SEIN“
Jan Grigor Schubert hat im Jänner bei STIHL Tirol das Ruder übernommen. Inspiration für seine neue Tätigkeit bezieht er aus Asien, wo er die letzten Jahre als Manager gearbeitet und Erfahrung mit Transformationsprozessen gesammelt hat. Unter Schubert soll die Arbeitgebermarke gestärkt werden und von Langkampfen aus AkkuKnow-how in den STIHL-Konzern einfließen.

60 eco. wirtschaft
INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Sie waren lange Jahre als Geschäftsführer in Asien und dort vor allem in Hongkong bzw. China tätig. Was können wir hier in Mitteleuropa von der dortigen Mentalität lernen?
JAN GRIGOR
SCHUBERT: Das ist eine vielschichtige Frage, auf die es keine pauschalen Antworten gibt. Ich habe auf den Philippinen, in China und Hongkong sowie in Brasilien gearbeitet und dabei viele unterschiedliche Mentalitäten kennengelernt. Wir Kölner sagen „Jede Jeck is anders“, das gilt für Kulturen gleichermaßen wie für Individuen. Hier in Tirol ist mir aufgefallen, dass die Menschen sehr freundlich sind. Außerdem ist man schnell mit dem Gegenüber per Du und man spricht Dinge offen an. Ich mag diese Direktheit, weil man dadurch gerade in der Einarbeitungsphase schneller merkt, wo es gut läuft und wo weniger. Das macht das Arbeiten erfreulicherweise einfacher. Was man wiederum in Europa von der asiatischen Kultur lernen kann, ist die Geschwindigkeit. Manchmal könnte man hier in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen weniger gemütlich sein. In Hongkong, wo ich die letzten sieben Jahre überwiegend gelebt habe, war das ganz anders. Wenn man nicht gerade schläft, ist man busy. Geschwindigkeit und Effizienz stehen dort ganz oben.
China wurde lange Zeit als die verlängerte Werkbank der westlichen Industrienationen betrachtet. Durch die Pandemie, aber auch die weltpolitische Situation hat dieses Image als zuverlässiger Partner Risse bekommen. Muss man sich von der etwas naiven Vorstellung befreien, dass China unser Freund ist? Die Chinesen sind clevere Geschäftsleute und chinesische Arbeitnehmer*innen sind fleißige, arbeitsame Menschen. Daraus ergibt sich das Prinzip der verlängerten Werkbank. Das ist bis heute sehr attraktiv. Was sich geändert hat, ist der offensiv vorgetragene Führungsanspruch der chinesischen Regierung. Wir brauchen aber auch weiterhin die Globalisierung. Bei STIHL verfolgen wir zunehmend eine „Regional-für-Regional“-Strategie. Wir sind nach wie vor global unterwegs, passen jedoch unsere Wertschöpfungsketten so an, dass wir Europa aus Europa, die USA aus den USA und Asien aus Asien beliefern. Das hilft Transportkosten zu senken und ist auch für die Umwelt gut.
Leistet eine solche Strategie, die in der Wirtschaft generell en vogue zu werden scheint, der Deglobalisierung Vorschub? Deglobalisierung ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. STIHL
setzt daher auf Glokalisierung. Wir werden weiterhin unsere internationalen Produktions- und Vertriebsstandorte beibehalten und zum Teil sogar ausbauen. Auch China bleibt für uns wichtig. Man wird aber daran arbeiten müssen, die Warenströme so zu lenken, dass, wenn an einem Ort der Welt etwas Gravierendes passiert, andere Orte davon nicht so stark betroffen sind. So werden wir resilienter.
Können Sie Ihre Erfahrungen – sei es in der Personalführung oder in organisatorischer Hinsicht – hier in Langkampfen einbringen? Die seit einiger Zeit zunehmend knapper werdende Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf allen Ebenen erfordert neue, insbesondere für jüngere Mitarbeitende, attraktive Konzepte, mit denen wir uns aus dem Wettbewerbsumfeld positiv hervorheben. Flexiblere Arbeitszeiten, Projekt- und Fachkarrieren, durchlässige Hierarchieebenen und agiles Arbeiten sind wichtige Stichworte. Ich habe diesbezüglich im Laufe meiner Karriere vieles erfolgreich umsetzen können. Diese Erfahrung bringe ich bereits in Langkampfen ein, wo wir derzeit viele unbesetzte Stellen haben.
Hierzulande ist das arbeitsrechtliche Korsett viel enger als etwa in China, mit allen Vor-, aber auch Nachteilen, die das mit sich bringt. Nicht alles, was sich anderswo bewährt hat, lässt sich auf Österreich über-
tragen. Die sehr engmaschigen gesetzlichen Regelwerke stehen dem einen oder anderen in Asien erfolgreichen Konzept hier im Wege.
Wie wichtig ist Ihnen Flexibilität? Zeitlich und örtlich voll flexibel zu sein, kann man von den meisten Bewerber*innen heute nicht mehr erwarten. Tatsächlich erwarten Kandidat*innen im Gegenteil eine größere Flexibilität des Arbeitgebers bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort. Es gibt für offene Positionen heute oft so wenige potenzielle Bewerber*innen, dass man sich auf jede und jeden individuell einstellen muss. Wir müssen also als Unternehmen noch flexibler werden, um das beste Personal für uns zu gewinnen. Das ist aus Unternehmenssicht kein Nachteil und aus Sicht der Mitarbeitenden ein Vorteil. Aus Behörden- und Steuersicht sind flexible Arbeitszeitmodelle aber manchmal kompliziert.
Was tun Sie als Arbeitgeber, um Arbeitskräfte zu gewinnen, wenn der Arbeitsmarkt vermutlich längerfristig leergefegt ist und annähernd Vollbeschäftigung herrscht? STIHL Tirol ist im näheren Umfeld schon heute ein sehr attraktiver Arbeitgeber mit vielfältigen Jobmöglichkeiten, Entwicklungsperspektiven und hervorragenden Rahmenbedingungen. An all diesen Faktoren arbeiten wir laufend. Zusätzlich haben wir vor einigen Monaten außertariflich die Gehälter erhöht.

61
„Deglobalisierung ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. STIHL setzt daher auf Glokalisierung.“
JAN GRIGOR SCHUBERT
Marktgerechte Bezahlung ist gewissermaßen die Grundvoraussetzung. Was braucht es noch? Man muss interessante Aufgaben anbieten können. Wir haben hier den Vorteil, dass wir wachsen und viele neue, spannende Produkte einführen, die akkubetrieben sind und innovative Technologien bieten. Der Standort Langkampfen ist innerhalb der STIHL Gruppe diesbezüglich in einer Vorreiterrolle. Arbeit muss Spaß machen, dann macht man sie gerne und gut und bleibt auch da, wo es Spaß macht. Ich sehe es als unsere Aufgabe, ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten, wo man gerne hingeht. Lange Zeit haben wir viel Geld in neue Produkte, neue Maschinen und neue Gebäude investiert. Und wir werden weiter in diesen Standort investieren, um noch attraktiver zu werden. In den nächsten Jahren wollen wir noch einmal um 150 bis 200 Mitarbeiter*innen wachsen.
Wie groß ist derzeit die Stammbelegschaft? Derzeit stehen wir bei ca. 800 Mitarbeitenden, mit den Leasingarbeiter*innen sind es um einige mehr. Bauen wir weitere 200 Mitarbeiter*innen auf, werden wir an die Grenze dessen stoßen, was der regionale Arbeitsmarkt ermöglicht. Wir übernehmen auch immer wieder gerne Leasingarbeiter*innen in unsere Stammbelegschaft.
Sie haben vorhin das Bild von einem Unternehmen gezeichnet, in das mehr Spaß hineinkommen soll. Wie wird das in der Praxis aussehen? Unser Gebäude kommt, obwohl
ZUR PERSON
Der 56-jährige Jan Grigor Schubert ist seit Jänner 2023 Geschäftsführer von STIHL Tirol in Langkampfen. Zuvor war er mehr als zehn Jahre als Geschäftsführer von ZAMA – einer hundertprozentigen STIHL Tochtergesellschaft mit Standorten in Japan, den USA, auf den Philippinen und in China – tätig. Der in Gütersloh (Deutschland) geborene Manager lebt heute in Kufstein.

wir erst 2001 an den Standort Langkampfen übersiedelt sind, etwas in die Jahre. Unser etwas nüchternes Verwaltungsgebäude, das im Stil der 1960er-Jahre dekoriert ist, entspricht nicht mehr dem modernen Geschmack und Arbeitsmethoden. Arbeit ist für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute mehr denn je nicht mehr nur Broterwerb, sondern Lebenserfüllung. Wir müssen ohnehin nach und nach renovieren, und das ist eine gute Gelegenheit, nicht nur neue weiße Farbe aufzutragen, sondern mehr zu tun und moderne Arbeitswelten mit einer entsprechenden Unternehmenskultur zu schaffen.
Orientieren Sie sich dabei an den US-amerikanischen Tech-Branchenriesen, bei denen Spaß zumindest bisher großgeschrieben wurde, auch wenn der Spaß derzeit marktbedingt ein Loch hat? Darf man dennoch annehmen, dass es in Lang-
kampfen nicht zur Installation einer Rutsche oder eines Bällebads kommen wird? Grundsätzlich sollen sich Mitarbeiter*innen hier wohlfühlen, ein gutes Gehalt und interessante Aufgaben haben. In einem nächsten Schritt muss aber noch mehr passieren. Wir tun Sinnstiftendes –zum Beispiel im Bereich des Umweltschutzes. So erweitern wir kontinuierlich unsere Photovoltaikanlage am Dach und sind in Sachen Ökologie deutlich über dem Schnitt der Industrie unterwegs. Die Tech- bzw. IT-Industrie ist sicherlich in manchen Bereichen ein Vorbild. So ein Campus ist spannend, auch wenn Rutschen, Bällebad oder ein Tischkicker vielleicht nicht unbedingt zu STIHL passen. Die Grundidee, eine Kultur zu schaffen, in der sich die Menschen vor und nach der Arbeitszeit gerne bewegen, hat Vorbildcharakter. Wir werden mit unseren Mitteln hier mehr lebenswerte Atmosphäre in die weißen Wände bringen und ein gutes Gesamtpaket schnüren. Das ist unser Ziel.
Transformationsprozesse sind Ihnen aus Ihrer bisherigen Laufbahn nicht fremd. Was hat Sie daran gereizt? Wir haben aus einem japanischen Kleinunternehmen einen mittelgroßen internationalen Konzern gemacht. Aus dem reinen Vergaserproduzenten ZAMA haben wir ein Unternehmen geschaffen, das 2025 nur noch die Hälfte des Umsatzes mit Produkten für fossile Brennstoffe machen wird. Die Transformation hin zur Akkutechnologie, die wir in der STIHL Gruppe gerade durchlaufen und die bei STIHL Tirol schon weit fortgeschritten ist, ist mir also gut bekannt. Ich bin nie ins Ausland gegangen, um von zu Hause wegzukommen, sondern mich hat immer nur der Job gereizt. Mit meiner Familie hatte ich mich schon vor längerem darauf verständigt, dass ich mich bei Gelegenheit wieder in die Heimat – damit meine ich Europa – begeben werde. Ich war vor STIHL bei Bosch und Siemens an verschiedenen Orten, aber STIHL hat mir als Arbeitgeber – das Umfeld, die Gestaltungsfreiheiten, die Eigentümerfamilie – immer sehr gut gefallen. Die Gelegenheit, in der STIHL Unternehmensgruppe von Tirol aus die Transformation mitgestalten zu können, war ausschlaggebend für meine Entscheidung.
Sehen Sie den Standort als Akku-Kompetenzzentrum in einer potenziellen Vorreiterrolle im Konzern? Wir sind schon derzeit Vorreiter bei Akkugeräten. Diese Rolle können wir jetzt zum Wohl der Unternehmensgruppe nutzen und die anderen Standorte bei der Transformation tatkräftig unterstützen.
eco. wirtschaft 62
„In Tirol spricht man Dinge offen an. Ich mag diese Direktheit, weil man dadurch gerade in der Einarbeitungsphase schneller merkt, wo es gut läuft und wo weniger.“
JAN GRIGOR SCHUBERT
PERSONALSERVICE GEMEINSAM BRÜCKEN BAUEN
Der Tiroler Personalbereitsteller InterWork-Personalservice stellt inländische Facharbeiter für Bau-, Industrie- und Medizinbetriebe ein.
Die in Rum ansässige Firma InterWorkPersonalservice GmbH hat sich auf die Bereitstellung von top qualifizierten inländischen Fachkräften aus Ostösterreich für den Einsatz in Tirol, Salzburg und Vorarlberg spezialisiert.
Geschäftsführer Rainer Körber ist selbst schon seit über 10 Jahren auf dem Gebiet der Personalbereitstellung tätig und kann auf einen vielschichtigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, den er mit Geschick und Know-how mit seinem Team für seine Kunden einsetzt.
Tatkräftig unterstützt wird er dabei von Manuel Cammerlander, der seit der ersten Stunde Mitarbeiter der Firma InterWork ist und bereits seit mehr als 2 Jahren sehr erfolgreich als Gebietsleiter für Westöster-
reich fungiert. Der gelernte Elektroinstallationstechniker weiß dank seiner praxisnahen Ausbildung und umfangreichen Erfahrung sein Geschick gekonnt für seine Kunden und die Firma einzusetzen.
JETZT PERSONAL ANFRAGEN: m.cammerlander@interwork.co.at

Tel.: +43 (0)501 789 . M: +43 (0)699 / 188 888 20 interwork.co.at

#TEAMPOWER
Manuel Cammerlander, Gebietsleiter Westösterreich
KURZ & BÜNDIG
VORREITERROLLE
Riederbau aus Schwoich geht seit jeher immer wieder innovative Wege am Bau. Der Bauträger Riederimmo hat nun eine neue Strategie entwickelt, um den Bau von Immobilien und die Kaufabwicklung zu vereinfachen. Im Stadthaus KARG, dem ersten Projekt, das mit dem Variantenprinzip abgewickelt wird, ist in die Projektentwicklung und Planung bereits eine Extraportion Hirnschmalz gesteckt worden. Wohnungsinteressent*innen haben künftig die Möglichkeit, aus zwei Grundrissen auszuwählen, wobei diese bereits bis ins Detail geplant sind: Elektroplanung, Sanitär- und Küchenplanung werden von Beginn an mitgedacht, zusätzlich wählt man aus drei Ausstattungskategorien ein vordefiniertes Paket, das zum Beispiel Innentüren, Bodenbeläge und Armaturen enthält. Für einen ersten Eindruck kann man eine 3-D-Tour durch die Räume machen.
Mit dem Stadthaus KARG in Kufstein entstehen auf vier Etagen zehn hochwertige Wohnungen. Es ist das erste Projekt, das von Riederbau nach dem neuen Variantenprinzip abgewickelt wird.

LEUCHTTURMPROJEKT
Kürzlich fand der Spatenstich zum Kaiserreich-Kiefersfelden statt, auf dem bis Anfang 2024 rund 11.000 Quadratmeter entwickelte Gewerbefläche entstehen sollen. Zusätzlich stehen circa 7.500 Quadratmeter Freiflächen für Pacht und eigene Entwicklung zur Verfügung.
GEWERBEPARK NEU GEDACHT
Es ist ein prägnanter Standort an der A93, an dem bis Anfang 2024 mit dem Kaiserreich-Kiefersfelden ein neuer und ökologisch durchdachter Gewerbepark entsteht. „Über 16 Millionen Fahrzeuge passieren durchschnittlich pro Jahr diesen Standort. Hier ein attraktives Angebot sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für Durchreisende zu schaffen, ist Ziel unserer Projektentwicklung”, erklärt Bauherr Florian Unterberger, geschäftsführender Gesellschafter der Unterberger Immobiliengruppe. Auch das Thema Nachhaltigkeit hatte von Anbeginn der Planung einen hohen Stellenwert. Unter anderem wurde bei der Entwicklung des Grundstücks auf eine besonders geringe Flächenversiegelung geachtet. „Als Ausgleich haben wir eine Fläche ähnlicher Größe im Bezirk Rosenheim renaturiert und somit ein Naturschutzgebiet an anderer Stelle geschaffen”, so Unterberger.
Die Pletzer Resorts erweitern ihr Sportresort Das Walchsee und investieren dafür 15 Millionen Euro in einen Neubau, parallel dazu wird derzeit das Stammhaus um 1,5 Millionen Euro umgebaut. Insgesamt entstehen 22 weitere Hotelsuiten und ein exklusiver Gastronomie- und Badebereich direkt am See, dessen Herzstück das neue Seerestaurant „Das Lakeside“ werden wird. Dazu kommt ein offener Fitnessbereich in bester Seelage. „Unsere Move-&-Relax-Philosophie bekommt mit dem zusätzlichen Standort ein Upgrade. Weiters ist ein eigener Seminarbereich für Veranstaltungen und besondere Feierlichkeiten vorgesehen“, so Egon Kahr, Geschäftsführer der Pletzer Resorts. Am 13. Mai wird Das Walchsee nach den Adaptierungen wieder in Betrieb gehen, die Fertigstellung des Neubaus ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.


eco. wirtschaft 64
AKTUELLE PROJEKTE AUS DER REGION
© RENDERWERK
In Kufstein entsteht derzeit der BODNER CAMPUS, der auf mehrere Gebäudeeinheiten verteilt der wachsenden Baugruppe eine neue und moderne Heimat mit hoher Aufenthaltsqualität bieten wird.
Welche Gründe waren ausschlaggebend dafür, auf der grünen Wiese eine neue Konzernzentrale zu errichten?
SANDRA BODNER: Als Johann Bodner sen. 1913 in Osttirol seine Firma gründete, war nicht absehbar, dass 110 Jahr später aus einem kleinen Handwerksbetrieb eine Baugruppe entstehen würde, die mittlerweile mehr als 3750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Der Standort Kufstein, wo sich seit 1938 die Firmenzentrale befindet, spielt eine ganz besondere Rolle. Unser Slogan heißt „STARK GEBAUT“. In den letzten Jahren sind wir auf Grund einer weitsichtigen Wachstumsstrategie stark gewachsen. Dadurch wurde der momentane Standort in der Salurner Straße 57 zu klein und er entspricht auch nicht unseren Vorstellungen des modernen Arbeitens. Es war naheliegend, das im Firmenbesitz befindliche, über 16.000 m² große Grundstück am nördlichen Stadtrand von Kufstein für den Neubau der BODNER ZENTRALE heranzuziehen.

Was sind die architektonischen und sonstigen Besonderheiten des BODNER CAMPUS? Die Lage am nördlichen Stadtrand nahe der Autobahnausfahrt und -einfahrt Kufstein Nord ist ideal, um ohne
Stau zum BODNER CAMPUS zu gelangen. Das Grundstück bietet weit mehr Platz, als die neue BODNER ZENTRALE benötigt. Der BODNER CAMPUS wurde als Gesamtkonzept erdacht, das in der Endausbaustufe aus drei Gebäudeeinheiten bestehen wird. Planungsgrundlage war ein international ausgelobter Architekturwettbewerb mit der Aufgabenstellung, neben der neuen Konzernzentrale auch Platz für externe Unternehmen zu bieten. Zudem sollten Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen, die zum Verweilen einladen. Das renommierte Wiener Architekturbüro Zechner & Zechner gewann den Wettbewerb und ist für die Architektur verantwortlich. Das Grundstück wird durch ein halb unterirdisch befindliches Parkdeck, überbaut von übersichtlich angeordneten Baukörpern, organisiert und im Endausbau Platz für bis zu 1000 Personen bieten. Der BODNER CAMPUS wird zudem mit der Kufsteiner Innenstadt über eine eigene Bushaltestelle und einen Radweg verbunden sein.
Was wird der BODNER CAMPUS zukünftigen Mietern bieten? Bauteil II wird über dem Erdgeschoss, in dem es Platz für Gewerbeflächen oder Schauräume geben wird, auf vier weiteren Stockwerken ca. 4.700 m² für

Gewerbeflächen und Büros bieten. für Gewerbeflächen und Büros bieten. Auf den zum Teil unterirdischen Stellplätzen entstehen acht E-Schnellladestationen. Ein die Gebäude verbindender, teilweise begrünter Vorplatz, wird den Aufenthalt im Freien in Kommunikationszonen gestalterisch aufwerten.
Was macht den BODNER CAMPUS für die BODNER GRUPPE zum besonderen Projekt? Zum einen die Tatsache, dass erst das stetige, gesunde Wachstum der BODNER GRUPPE ermöglicht hat, dieses Projekt entwickeln zu können. Die Arbeitswelten und die Arbeitsweise in diesem Gebäude werden sich an den neuesten Trends aus der Wissenschaft orientieren, jedoch abgestimmt auf die Wünsche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eng in die Planung des Raum- und Funktionskonzeptes eingebunden sind. Besonders stolz sind wir als Familienunternehmen jedoch auf die Tatsache, dass die bislang namenlose Nebenfahrbahn den Namen Aloisia-Bodner-Straße erhalten wird. Aloisia war die Frau des Firmengründers Hans und hat nach dessen Tod die Firma als Witwenbetrieb weitergeführt und so die Entwicklung der Firma Bodner entscheidend mitbestimmt. PR
65
© ARGE ZECHNERGRABHER / EXPRESSIV.AT © ALEX GRETTER
Die BODNER ZENTRALE setzt mit ihren trapezblechverkleideten Containerboxen in „Bodner“-Blau ein funktionales wie architektonisches Ausrufezeichen und erinnert an die Wurzeln des Unternehmens.
Sandra Bodner, Leitung Marketing und Kommunikation BODNER GRUPPE
BODNER
STARK IN DIE ZUKUNFT GEBAUT
GUT FÜR KUNDEN UND UMWELT
Die Druckerei und Werbeagentur RWf – Frömelt Hechenleitner in Volders bietet Full Service auf höchstem Niveau und setzt Maßstäbe in Druckqualität und Umweltfreundlichkeit.

TEXT: SHIVA YOUSEFI
Die RWf – Frömelt Hechenleitner Werbegesellschaft bietet von der persönlichen Kundenberatung, der gemeinsamen Planung über professionelle Umsetzung bis hin zur Fertigstellung der Druckerzeugnisse alles aus einer Hand an. Auf Wunsch werden der Versand und das Datenmanagement übernommen. Dabei stehen die effiziente Umsetzung innovativer Ideen, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kunden sowie höchste Qualität des Produkts im Vordergrund.
Jahrzehntelange Erfahrung und das erforderliche Know-how ermöglichen es dem Team von RWf, den Vorstellungen des Kunden bestmöglich zu entsprechen und ein Media- und Marketingkonzept individuell
anzupassen. Durch neue hochmoderne Maschinen kann das erarbeitete Konzept schnell und effizient in die Tat umgesetzt werden. Die Freude an der Kreativität kommt dabei nicht zu kurz.
Die Produkte der Kunden von RWf werden sowohl national als auch international effizient und fachgerecht vermarktet und beworben. Die Kenntnis des globalen Marktes sowie zahlreiche internationale Kontakte kommen dem Kunden hierbei zugute.
NACHHALTIG AUS TRADITION
Der Philosophie des Betriebes entsprechend setzt die Druckerei und Medienagentur jedes Projekt engagiert, enthusiastisch und professionell um. Neben Aufträgen größerer
Unternehmen realisiert das Team von RWf gerne auch kleinere Projekte mit derselben Sorgfalt und Expertise.
Seit 50 Jahren zeichnen die persönliche Komponente in der Zusammenarbeit sowie Flexibilität RWf besonders aus. Anlässlich des Jubiläums ist das Unternehmen im vergangenen Jahr als Tiroler Traditionsbetrieb ausgezeichnet worden. Diese Anerkennung und Ehrung vonseiten des Landes Tirol hat das Team von RWf einmal mehr darin bestärkt, den hohen Qualitätsstandard und die durch langjährige Erfahrung geprägte Arbeitsweise zu wahren.
Darüber hinaus spielen gerade in der Druckbranche die Nachhaltigkeit sowie Regionalität der Produkte eine wichtige Rolle.
RWF
FOTOS: © MARIAN KRÖLL
RWf-Geschäftsführer Daniel Frömelt mit Außendienstleiterin Karin Mair
Den Kunden des Tiroler Traditionsunternehmens RWf kommt die Kenntnis des globalen Markts und jahrelanges Know-how zugute, um nachhaltige Druckergebnisse zu garantieren.
Aus diesem Grund hat es sich RWf zum Ziel gemacht, dies durch die Zusammenarbeit mit vielen Tiroler Unternehmen zu fördern. Derartige Zusammenarbeiten ermöglichen es, lange Transportwege der Produkte zu verringern. Im Übrigen erhält der Kunde am Ende des Tages ein regionales und qualitativ hochwertiges Produkt, dessen Ursprung nachvollziehbar ist.
MIT QUALITÄT ZUM ERFOLG
Unter der Devise „We print your success“ verhilft Ihnen RWf mit hochwertigen Printprodukten nachhaltig zum Erfolg und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen bei Ihren Kunden in Erinnerung bleibt. RWf ist es ein Anliegen, eine ressourcenschonende und klimaneutrale Produktion zu gewährleisten. Daher ist RWf besonders stolz auf seine Aus-




zeichnungen in diesem Bereich. Diese Zertifizierungen sind ein Zeichen der laufenden Optimierungsprozesse: Sämtliche Produkte erzielen damit stets einen einheitlichen hohen Qualitätsstandard, der für Kunden und Mitarbeiter jederzeit messtechnisch nachvollziehbar ist. Das reduziert Abstimmzeiten, sorgt für Flexibilität und schafft Freiräume, um rascher reagieren zu können. PR
Zum 50-jährigen Firmenjubiläum wurde RWf im vergangenen Jahr als Tiroler Traditionsbetrieb ausgezeichnet.
RWF – FRÖMELT HECHENLEITNER
WERBEGESELLSCHAFT MBH

Alpenstraße 2, 6111 Volders
Tel.: 05224/52 785, office@rwf.at www.rwf.at
67 RWF
© DIE FOTOGRAFEN
In guten Händen
Das Institut für klinische Epidemiologie des „Landesinstitut für integrierte Versorgung Tirol“ (LIV) gibt in regelmäßigen Abständen das „Klinische Tumorregister Österreich für Mammakarzinome und gynäkologische Tumoren“ heraus. Darin werden österreichweit die Überlebensraten für die verschiedensten gynäkologischen Krebserkrankungen verglichen. Aktuelle Auswertungen zeigen, dass die Überlebensrate für Patientinnen der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bei quasi allen Krebsarten signifikant höher ist als im Durchschnitt der anderen Zentren Österreichs. „Diese Zahlen, schwarz auf weiß und von unabhängiger Stelle erhoben, sind eine gute Nachricht für die Patientinnen“, sagt der Direktor der Innsbrucker Gynäkologie, Christian Marth. „Vor allem, da die Ergebnisse von Studien zum Überleben von Krebserkrankungen oft nicht sehr eindeutig sind – zu viele Faktoren spielen mit. Trotz all dieser Unschärfefaktoren sind die Ergebnisse diesmal klar und unmissverständlich.“ Im gesamtösterreichischen Durchschnitt leben zehn Jahre nach der Diagnose Brustkrebs sechs Prozent weniger Patientinnen als an der Innsbrucker Gynäkologie. Aber auch bei höheren Stadien und komplexen Diagnosen gynäkologischer Tumoren ist der Unterschied signifikant. So beträgt der Unterschied beim Langzeitüberleben von Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs etwa fünf Prozent. Zu verdanken sei dieses Ergebnis dem Zusammenspiel vieler Faktoren, so Marth: „Zum einen ist es natürlich die Erfahrung aufgrund der hohen Zahl von Betroffenen, aber auch das Zusammenspiel aller involvierten Berufsgruppen bei der Betreuung unserer Patientinnen. Dazu kommen die laufende Forschung und Teilnahme an internationalen Studien. Dadurch haben Patientinnen heute schon oftmals Zugang zur Medizin von morgen.“

68 bildung & innovation ZUKUNFT
GOOD NEWS
INNOVATIONEN SICHTBAR MACHEN
Die Agrarmarketing Tirol (AMTirol) und das Landesgremium des Tiroler Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Tirol zeichnen mit ihrem neuen Tiroler Lebensmittelinnovationspreis ideenreiche Projekte der heimischen Landwirtschaft aus. Bewerben können sich land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, Start-ups, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Institutionen. Die Einreichfrist läuft bis 30. Juni.

Infos unter www.liz.tirol/innovation/innovationspreis
STOSSWELLEN GEGEN CELLULITE


Zuerst die schlechte Nachricht: Cellulite betrifft 80 Prozent aller Frauen. Und nun zur guten: Es gibt eine sehr effiziente neue Therapiemethode!
SUPER RECHNER
Viele Bereiche der Wissenschaft sind beim Lösen mathematischer Aufgabenstellungen auf computerunterstützte Systeme angewiesen. Dafür stehen leistungsfähige Supercomputer zur Verfügung, die durch paralleles Rechnen auf tausenden Prozessoren aufwändigste Berechnungen durchführen können. Es gibt jedoch Probleme, die auch für Supercomputer nur schwer zu knacken sind oder exorbitant viel Rechenleistung benötigen. Genau hier können Quantencomputer ihre Stärken ausspielen. Deren Entwicklung steht zwar noch am Anfang, doch sie können bereits als Coprozessoren für klassische Computer eingesetzt werden. Ein Projektteam bestehend aus dem Forschungsschwerpunkt Scientific Computing, den Instituten für Informatik, Mathematik, Experimentalphysik und Theoretische Physik und dem Zentralen Informatikdienst der Uni Innsbruck wird in den nächsten Monaten mit der Unterstützung von externen Partnern in Linz und Wien einen solchen Supercomputer mit integriertem Quanten-Coprozessor in Innsbruck in Betrieb nehmen. Dafür stehen neun Millionen Euro aus Mitteln des Aufbau- und Resilienzplans NextGenerationEU zur Verfügung. Das System wird allen Wissenschaftler*innen in Österreich für Forschung und Lehre offenstehen.
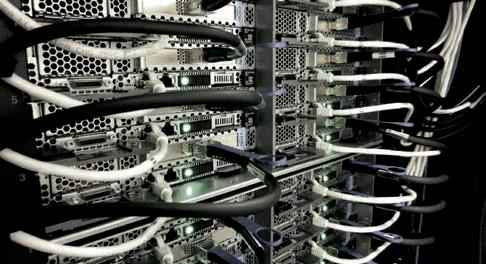
Bei Cellulite handelt es sich um ein multifaktorielles Geschehen, wobei der genaue Mechanismus bis dato nicht vollständig geklärt ist. Einerseits kommt es zu einer Zellschädigung, die bei Frauen möglicherweise hormonell begünstigt ist. Oxidativer Stress und ein lokales Ödem sind die Folge. Andererseits führt der Verlust von Bindegewebsstrukturen zu einer „Erschlaffung“ des Gewebes. Die oberste Hautschicht verdünnt sich und die typische Dellenbildung entsteht. Viele kosmetische Ansätze wurden und werden verfolgt, um das als unschön empfundene Erscheinungsbild zu verbessern. Allerdings konnte sich noch keine der Methoden nachhaltig durchsetzen.
In jüngerer Zeit wurde die Wirkung von Stoßwellentherapie auf Cellulite getestet. Durch Anregung von Zellregeneration kommt es zu einer Wiederherstellung der Bindegewebsstrukturen. Das Verfahren hat in zahlreichen Studien überzeugende Ergebnisse geliefert. Die Patientinnen sind hoch zufrieden. Auch im STOSSWELLENZENTRUM TIROL in Innsbruck gibt es beste Erfahrungen damit – siehe Beispielbilder aus dem Zentrum. PR
KONTAKT:
STOSSWELLENZENTRUM TIROL Innrain 98, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/531 663 www.stosswellenzentrum.tirol
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 9 bis 13 Uhr nach telfonischer Vereinbarung
eco. expertentipp
Dr. Eva Holfeld, MSc. (re.) und Dr. Sabine Kofler Zöhrer
vorher unmittelbar nach der Behandlung 69
SYMBOLBILD: © UNIVERSITÄT INNSBRUCK © AMTIROL
Stefan Mair (Obmann Sparte Handel der Wirtschaftkammer Tirol), Katharina Maizner (AMTirol), Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und AMTirol-Geschäftsführer Matthias Pöschl (AMTirol)
BUT FIRST COFFEE
Kaffee ist des Österreichers liebstes Heißgetränk. Gerne wird der auch to go genossen, was zwar praktisch ist, aber auch ziemlich viel (Plastik-)Becherabfall verursacht. Ein findiges junges Team aus Tirol hat eine Lösung.
Österreich ist eine Nation von Kaffeetrinker*innen und auch wenn laut Marktforschungsinstitut Integral rund ein Fünftel der Befragten wegen der Teuerung aktuell weniger Kaffee trinkt, so heißt das nicht, dass man gänzlich darauf verzichtet. Doch wo viel Konsum, da meist auch viel Abfall. Abgesehen von den umwelttechnisch fragwürdigen Kapsellösungen wird dieser vor allem von Coffee-to-go-Bechern verursacht. Das hat unter anderem auch Daniel Minatti-Krauhs beschäftigt. Er hat Industrial Design mit Ver-
tiefung Eco-Innovation in Graz studiert und sich im Zuge eines Uniprojektes Gedanken darüber gemacht, wie man die zahlreich anfallenden Kaffeeabfälle – sprich Kaffeesatz – sinnvoll verwerten könnte. Meist landen diese schlicht im Biomüll, im besten Fall dürfen sie daheim in kleinem Ausmaß zum Blumen- oder Tomatendünger werden. „Ich finde es extrem spannend, mich mit einem Thema so lange zu befassen, bis ich die größeren Zusammenhänge dahinter erkenne“, sagt Daniel Minatti-Krauhs und hat in diesem konkreten Fall den nicht un-
logischen Konnex vom Kaffee zum Plastik, aus dem die Mitnehmbecher gemacht sind, hergestellt. „Wir brauchen dringend Alternativen zum Einwegplastik und so hat sich unsere Idee wie ein Puzzle Teil für Teil zusammengefügt.“
Die Idee wurde schließlich dinghaft –in Form von seedcup, einem nachhaltigen Einwegbecher aus Kaffeesatz. Wie genau das funktioniert, darf aktuell noch verraten werden, derzeit bewegt man sich Richtung Patentanmeldung und will folglich kein Nachahmertisiko eingehen. Kurz und knapp

eco. zukunft
TEXT: MARINA BERNARDI
IDEE DER AUSGABE
Der Becher von seedcup besteht aus Kaffeesatz und natürlichen Verbundstoffen und ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar.
hat das Tiroler seedcup-Team – neben Managing Director Daniel Minatti-Krauhs sind das Marketing-Lead Agatha Sowinski und Product-Lead Florian Petter – eine Maschine entwickelt, die aus gepresstem Kaffeesatz und natürlichen Verbundstoffen robuste Becher für den Einmalgebrauch herstellt, die ob ihrer Zusammensetzung komplett biologisch abbaubar sind. Nach zahlreichen Materialexperimenten und Testungen war es so weit: „Wir geben einer Ressource ein zweites Leben“, beschreibt es der Gründer. Der Becher hält heiße Flüssigkeit bis zu 36 Stunden aus, für einen 15-Minuten-Coffee-to-go also mehr als ausreichend. Theoretisch könnte man ihn anschließend einfach in die Natur werfen, gern gesehen ist das vermutlich dennoch nicht. Aber: Der Becher ist tatsächlich heimkompostierbar. Das heißt, er kann problemlos in einem Hauskompostbehälter oder in den grünen Behältern entsorgt werden.

KAFFEE IM KAFFEE: WIN - WIN
Wichtig war den seedcup-Innovativen, die Ressourcen genau dort zu nutzen, wo sie anfallen. Minatti-Krauhs: „Wir wollten von Anfang nicht den Becher anbieten, sondern haben uns auf die Entwicklung der Maschine fokussiert, mit der die Becher im jeweiligen Café direkt vor Ort selbst hergestellt werden können. Damit kann das Café seinen eigenen Kaffeesatz verwerten und diesen als Einweg-Kaffeebecher ausgeben. Das führt einerseits zu weniger Abfall im Lokal und andererseits zu weniger Müll außerhalb.“ Theoretisch könnte man den Becher natürlich auch im Lokal anbieten, das sparte Geschirrspülkosten; den Biomüll wird man so allerdings nicht los.
Aktuell arbeitet man daran, den Pressvorgang so effizient wie möglich zu gestalten und die perfekte Kombination aus Druck und Temperatur zu finden, um den Becher im bestmöglichen Fall sofort einsatzbereit zu machen. „Im schlimmsten Fall dauert es ein paar Minuten“, so Daniel Minatti-Krauhs. Dass er aus dem Designbereich kommt, ist der Maschine übrigens anzusehen. Sie ist
Mit der innovativen seedcup-Maschine können Einweg-Kaffeebecher direkt im Café aus dem dort anfallenden Kaffeesatz hergestellt werden. Durch ihre kompakten Abmessungen und das reduzierte Design ist das Gerät quasi in jedes Interieur integrierbar. Weitergedacht, könnte dieses auch direkt an Siebträgermaschinen gekoppelt werden.
ebenso stylisch wie kompakt und passt dadurch in jedes Kaffeehaus-Interieur – im optimalen Fall wird sie gleich nebst der Kaffeemaschine platziert: „Es wäre natürlich cool, wenn wir das Gerät irgendwann direkt mit einer Siebträgermaschine kombinieren könnten.“ Generell hat das Team für sein Start-up eine fünfjährige Finanzplanung aufgestellt, im nächsten Jahr soll laut Plan die Zulassung für den Becher erfolgen, dann kommt der Schritt Richtung Industrialisierung des Verfahrens, um nicht nur kleine Mengen zu produzieren. „Die Masse macht das Produkt aus“, nennt es Minatti-Krauhs.
Wie das seed in den cup kommt, ist indes auch rasch erklärt. Kaffeesatz ist ein guter Dünger, dementsprechend war es ein fast folgerichtiger Gedanke, Samen in den Becher einzupressen, der aufgehen kann, sobald der Becher abgebaut ist. Das ist freilich noch mit ein paar Hürden verbunden, weil man im urbanen Bereich nicht einfach drauflosgärtnern darf, im eigenen Garten funktioniert’s aber schon. „Das ist eher eine langfristige Vision“, so die seedcups. „Doch wir finden es einen schönen Gedanken, die urbane Biodiversität zu fördern, indem man ein Produkt nicht als Abfall sieht, sondern als Basis für etwas Neues.“

eco. zukunft 71
David Minatti-Krauhs und Agatha Sowinski haben eine Vision: Gebrauchte Ressourcen aus der Kaffeeproduktion wiederzuverwenden, um nachhaltige Coffee-to-go-Becher herzustellen.
UM KOMMUNIKATIONSWELTEN BESSER
Es gibt eigentlich kaum eine Herausforderung, die das ambitionierte Team von AVsolutions nicht lösen kann. Mit dem klaren Fokus darauf, dass die Technik dem Menschen dienen soll und nicht umgekehrt, kreiert das Team rund um Firmengründer Matthias Heigl maßgeschneiderte audiovisuelle Kommunikationswelten höchster Ansprüche.

Gelungen ist eine Kommunikationswelt am besten dann, wenn man die Technik im Hintergrund gar nicht erst bemerkt“, lautet der Anspruch von Matthias Heigl an jegliche audiovisuellen Konzepte. Und tatsächlich verstecken sich beispielsweise in seinem Besprechungsraum technische Feinheiten, die man vordergründig gar nicht wahrnimmt, eine Videokonferenz jedoch fast hautnah anfühlen lassen.
Finessen wie ein TruVoicelift-Deckenmikrofon oder eine Kamera, die automatisch denjenigen näher heranzoomt, der gerade spricht, lassen ein Onlinemeeting nahezu real life erleben. „Videokonferenzen können sich nach dem neuesten Stand der Technik wie ein wirkliches Meeting anfühlen. Natürlich sind persönliche Treffen nicht gänzlich ersetzbar“, räumt Heigl ein, „jedoch muss nicht jedes Treffen persönlich stattfinden, insbesondere dann, wenn für ein zweistündiges Meeting eine längere Anreise verbunden ist. Das spart nicht nur den Teilnehmern Zeit und Geld, sondern schont auch die Umwelt.“ Dank ClickShare lassen sich frei nach dem Motto „byod“ – bring your own device – jedwede mobile Endgeräte unkompliziert und sicher verbinden.
TECHNIK SOLL
DEM MENSCHEN DIENEN
Mit dem Anspruch, dass die Technik dem Menschen dienen soll und nicht der User zum Sklaven der Technik avanciert, beschäftigt sich das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2004 intensiv mit Technologien zur Übertragung und Steuerung von Licht, Ton, Video und Informationen. „Unser Wissen über aktuelle und künftige Trends in diesem Bereich verbinden wir mit der Erfahrung aus den unterschiedlichsten Projekten. Dadurch können wir für jegliche individuelle Anforderung die optimale Lösung finden“, freut
72 AVSOLUTIONS
Matthias Heigl hat AVsolutions im Jahr 2004 gegründet.
© ANDREAS FRIEDLE
TEXT: DORIS HELWEG
Schaffen individuelle, sichere und bedienerfreundliche Kommunikationswelten: Dem Team rund um Firmengründer Matthias Heigl ist keine Herausforderung zu groß.
sich der Unternehmer vor allem über sein Team, das mit großer Leidenschaft an den bestmöglichen Lösungen für die Kund*innen arbeitet. Diese Höchstleistungen an individuell programmierten medientechnischen Konzepten suchen ihresgleichen und machen die hauseigenen Lösungen über die Landesgrenzen hinaus einzigartig.

DRAG AND DROP
So erfolgt nicht nur die Planung der Medientechnik maßgeschneidert am Standort Innsbruck, sondern auch die individuelle
MATTHIAS HEIGL
Programmierung der Steuerung. Gesteuert können die technischen Installationen entweder über ein Touchpanel oder auch per eigenem iPad oder sonstigem Device mit Display werden. Mittels „Drag and Drop“ sind die Touch-Displays einfach und intuitiv für jedermann bedienbar. So lassen sich die verschiedenen Medientechnik-Gesamtkonzepte mit qualitativ hochwertigen und langlebigen Hardwarekomponenten vertrauenswürdiger Produzenten ganz einfach mit einem Fingerwisch steuern, das Einstecken von irgendwelchen Kabeln kann in dem Fall der Vergangenheit angehören. „Denn am Ende des Tages soll die Technik für die Menschen da sein, deren Arbeit erleichtern, Präsentationen interessanter, die Zusammenarbeit ortsunabhängiger, interaktiver und Veranstaltungen einfach spannender machen“, betont Heigl.

Die Steuerung der technischen Installationen erfolgt ganz unkompliziert über ein Touchpanel oder per eigenem iPad oder sonstigem Device mit Display.
KOMMUNIKATIONSWELTEN
Die Anwendungsbereiche der medientechnischen Konzepte erstrecken sich über zahlreiche Gebiete, welche im gerade erfolgten Relaunch der Webseite „Kommunikationswelten“ getauft wurden. „Weil all diese Anwendungsszenarien letztlich Kommunikation – also den Austausch von Information in irgendeiner Form – ermöglichen, sehen wir uns als Kommunikationsweltverbesserer“, erklärt Marketingexpertin Gabriele Steiner.
MEETINGWELT – VIDEOKONFERENZEN
WAREN NOCH NIE SO EINFACH
Insbesondere seit der Pandemie hat die Bedeutung von Videokonferenzen einen neuen Hype erlangt und der neueste Stand der Technik seines dazu beigetragen, dass Online-Meetings heute genauso an der Tagesordnung stehen wie persönliche Besprechungen. Mittels „Drag and Drop“ wird mit dem Fingerwisch einfach das auf den Bildschirm gezogen, was man auf dem Board auch sehen will.
73 AVSOLUTIONS
„Gelungen ist eine Kommunikationswelt am besten dann, wenn man die Technik im Hintergrund gar nicht erst bemerkt.“
© PHILIPP HUBER –PHILIPP.PHOTO
© ANDREAS FRIEDLE
Kürzlich wurde die neu gestaltete Eventwelt in der Zugspitz-Arena in Ehrwald eröffnet. Der adaptierte Veranstaltungssaal wurde mit modernster Medientechnik inklusive Beschallung, Videotechnik, Audio und Bühnentechnik ausgestattet, ein Besprechungsraum zu einem flexibel nutzbaren Videokonferenzraum aufgewertet.


Sämtliche öffentliche Bereiche des Alpenhotel Kitzbühel wurden mit einer zentral steuerbaren Beschallungsanlage ausgestattet, der Seminarraum erhielt ein Upgrade mit modernster Medientechnik.


BILDUNGSWELT –DIGITALE LERNWERKZEUGE FÜR INTERAKTIVEN UNTERRICHT
Im Bereich der Bildungswelt punktet AVsolutions insbesondere mit sogenannten SMART Boards, also interaktiven Displays, die in Bildungseinrichtungen eingebaut werden. Im letzten Jahr wurden mehr als 500 solcher SMART Boards vorrangig in Schulen erfolgreich installiert. Das macht einen spannenden und interaktiven Unterricht möglich, ob in Präsenz oder Distance Learning. Auch in der Bildungswelt gilt das Motto: Digitale Lernwerkzeuge sollten intuitiv bedienbar sein – auch von den Lehrern.
EVENTWELT
Gute Veranstaltungsräumlichkeiten punkten neben einer angesagten Location vor allem mit ausgeklügelter Medientechnik. Beschallung, Video- und Bühnentechnik, Audio sowie Konferenztechniken greifen
dabei intuitiv steuer- und vernetzbar ineinander.
VERWALTUNGSWELT
Immer mehr Fokus vor allem bei Anwält*innen, Kanzleien und Ärzt*innen erlangen auch Diktiersysteme mit verlässlicher Sprachsteuerung und dahinterliegenden Workflow-Systemen. Dank ausgereifter Spracherkennung mit medizinischem oder juristischem Fachvokabular liegt hier noch ein großes Potenzial.
FREIZEITWELT –INTERAKTIVE KONZEPTE
Zentral steuerbare Beschallungsanlagen, die über ganze Skigebiete hinweg vernetzt sind zählen ebenso zur Freizeitwelt wie Medientechnik in Gebäuden wie Hotels, die von vielen unterschiedlichen Menschen genutzt werden. Hier ist die perfekt individuell abgestimmte Kombination audiovisueller Geräte der Schlüssel zu Sicherheit und Wohlbefinden.
SICHERHEITSWELT – IM NOTFALL VERSCHIEDENSTE ANLAGEN NUTZEN Im Bereich von Evakuierungsanlagen gibt es von Seiten der Technik wenig Einschränkungen, ob rein akustisch oder in Kombination mit Displays zum Beispiel in Funktion eines Wegweisers bauen die versierten Techniker genau das, was die Kund*innen haben wollen.
ZUKUNFTSTRÄCHTIG
Flexibilität zählt zu den weiteren Stärken der Medientechnik-Spezialisten. Um den steigenden Anfragen und Kundenaufträgen auch gerecht zu werden, wächst das Team von AVsolutions auch heuer weiter, was auch den Umzug in größere Räumlichkeiten einen Stock tiefer im Frühsommer 2023 mit sich bringt. „Dafür suchen wir Kommunikationsweltmeister in den Bereichen Technik und Vertrieb in Westösterreich und Deutschland zur Erweiterung unseres ambitionierten Teams“, ergänzt Matthias Heigl. av.solutions PR
74 AVSOLUTIONS
Die Bergstation Hochzillertal wurde medientechnisch mit einer Beschallungsanlage und IP-TV ausgestattet.
Beide Standorte von Holz Pfeifer in Imst und Kundl bekamen eine individuelle Meetingwelt, bestehend aus Räumen unterschiedlichster Größe auf modernstem technischen Niveau.
©
© AVSOLUTIONS © AVSOLUTIONS
AVSOLUTIONS
© ALPENHOTEL KITZBÜHEL
PERSONALSERVICE
InterWork freut sich über die Klimaschutz-Auszeichnung zum größten ÖBB-Businesskunden Westösterreichs - mit über 22.000 gebuchten Tickets im Jahr 2022 und eingesparten 712 Tonnen CO2Emissionen.
Zentrale Tirol Bundesstraße 25
6063 Rum
Niederlassung Salzburg
Teisenberggasse 29
5020 Salzburg
Niederlassung Wien
ICON Tower
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2 1100 Wien
InterWork erhält ÖBB-Auszeichnung für fleißiges Bahnfahren!

interwork.co.at let‘s work together Ihr Personalbereitsteller in Österreich
Rainer Körber Geschäftsführung
REPS-Gründer Alfons Huber kennt sich bestens aus mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und deren Nutzbarmachung.

76
VERKEHRSSTROM
Der junge Physiker und Start-up-Unternehmer Alfons Huber möchte mit REPS, einem „grüner“ Energiewandler, seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Das patentierte System greift Bewegungsenergie von Fahrzeugen und Fußgängern ab und soll bis 2024 Marktreife erlangen. Für sein Team sucht Huber noch technikaffine Menschen, die die Welt verändern wollen.
TEXT & FOTOS:
ber physikalische Gesetze kann man sich nicht hinwegsetzen. Das muss die Politik in der ideologisch aufgeladenen Diskussion rund um die Energiewende erst noch zur Kenntnis nehmen. Mit der Natur kann man nicht verhandeln und sie lässt sich auch nichts dekretieren. Einer, der sich mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten und deren Nutzbarmachung bestens auskennt, ist der Physiker und Jungunternehmer Alfons Huber, der das Start-up REPS – das Akronym steht für „Road Energy Production System“ – gegründet hat. „Ich baue hier ein Team aus derzeit insgesamt neun Leuten auf, um die Schlagzahl erhöhen zu können“, sagt Huber, der, wenn er nicht gerade komplexe Gleichungen in sein Notizbuch kritzelt, zum Abschalten gerne Handball spielt.
Die Teammitglieder, die Huber um sich geschart hat, arbeiten mit Begeisterung an der Umsetzung der Idee, die Expertisen der Mitglieder komplimentieren einander sowohl im technischen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Im Zuge der Entwicklung von REPS hat Alfons Huber überwiegend simuliert und berechnet, während sich das Technologieteam auf die Umsetzung eines praxis-, das heißt in diesem Fall straßentauglichen Endprodukts fokussiert hat. „Wir gehen hier ein großes Risiko ein“, sagt Huber, den man durchaus als treibende Kraft und Mastermind hinter der Technologie bezeichnen kann. Der junge Physiker wirkt so, wie man sich einen typischen Erfinder eben vorstellen mag. Huber gestikuliert ausladend und spricht schnell, zur Illustration des von ihm erdachten Road Energy Production System schreibt, zeichnet und rechnet er hastig auf einer weißen Tafel, die an der Wand hängt. Damit auch einem Laien klar werden soll, worum es ihm dabei geht.
Die Wissenschaft wurde Alfons Huber gewissermaßen in die Wiege gelegt, ist sein Vater doch internatio-
ALFONS HUBER
nal renommierter Krebsforscher an der Medizinischen Universität Innsbruck. Von diesem leiht sich der Filius die Expertise, vor allem was wissenschaftliches Arbeiten und Patentierung betrifft. Huber hat jahrelang an seiner Erfindung herumgerechnet und getüftelt. Anders als der Strom geht der junge Wissenschaftler, dessen Welt aus Zahlen besteht, nicht den Weg des geringsten Widerstands, wenn es um die Umsetzung seiner Vision geht. „Ich hatte zahllose schlaflose Nächte, weil mich das Thema nicht mehr losgelassen hat, und habe alle Ideen und Probleme systematisch in meinem Notizbuch erfasst.“ Und gelöst. Weil es für ihn nicht in Frage kam, sich irgendwo in der Hochschullandschaft anzudienen, hat Huber – vom Wissenschaftsbetrieb einigermaßen desillusioniert – kurzerhand selbst ein Unternehmen gegründet, um REPS zur Marktreife weiterzuentwickeln. Einen Business Angel möchte er einstweilen nicht an Bord holen. „Wenn man so früh ein Viertel seines Unternehmens hergibt, ist man nicht mehr zur Gänze handlungsfähig“, sagt Huber, der dennoch daran arbeitet, sein Start-up investmentwürdig aufzustellen. Dabei spielt es ihm in die Karten, dass es gelungen ist, die Erfindung sehr grundlegend und umfassend zu patentieren, was etwaiger zukünftiger Konkurrenz wenig Angriffsfläche bietet.
eco. zukunft 77
MARIAN KRÖLL
„Man bekommt viel positives Feedback, aber es gibt natürlich auch Kritiker. Die sind insofern wichtig, weil sie uns so geformt haben, dass wir mittlerweile auf jede Frage eine Antwort haben.“
PERMANENT MAGNETISCH
Entstanden ist die mittlerweile patentierte Erfindung für die Umwandlung verlorener Energie von Kraftfahrzeugen in Elektrizität aus Hubers Faible für Elektromagnetismus. „Wenn Strom zu einem knappen Gut wird, braucht es grüne Energiewandler, die sich rasch energetisch amortisieren“, sagt Huber, der mit gängigen Neodym-Magneten arbeitet, die sich problemlos immer wieder remagnetisieren lassen und damit nachhaltig sind. Das System sorgt dafür, dass prinzipiell jede Straße zur Energiequelle werden kann.
Damit das Ganze nicht nur eine theoretische Spielerei bleibt, haben Huber und sein Team den Mechanismus so konzipiert, dass er den täglichen Belastungen einer hochfrequentierten Straße widerstehen kann. „Der Mechanismus basiert auf einer permanentmagnetischen Lagerung und hält auf einer viel frequentierten Straße bis zu 35 Jahre lang“, hat Huber simuliert. Die Lebensdauer verdankt sich auch dem Umstand, dass es zu keiner mechanischen, sondern lediglich magnetischen Reibung kommt. „Mechanische Reibung macht jedes Bauteil ir-
gendwann kaputt“, weiß Huber. Bei Magneten, die einander abstoßen und nie direkt miteinander in Berührung kommen, ist das nicht der Fall. Der Teufel steckt aber wie immer im Detail, braucht es doch eine Platte, die Fahrzeuge überfahren können, die dabei den Mechanismus auslöst und lange haltbar ist. „Wir hatten als oberstes Entwicklungsziel immer die Langlebigkeit des Mechanismus vor Augen und haben erst in einem nächsten Schritt auf die Effizienz, auf den Wirkungsgrad, geschaut“, erzählt Huber. Der patentierte Mechanismus erzeugt umso mehr Strom, je schneller er betätigt wird. Ein schweres Fahrzeug setzt damit mehr Energie frei als ein leichtes.
REPS unterscheidet sich von anderen, auf Induktionsspannung basierenden Geräten dadurch, dass keine Umwandlung von einer Translations- in eine Rotationsbewegung stattfindet, bei der Energie verloren geht, sondern die Translation*) direkt genutzt wird, um einen Teil der kinetischen Energie eines Fahrzeugs abzugreifen. Den Beweis, dass das System auch in der Praxis funktioniert, konnte REPS im Dezember antreten. Alfons Huber ist damals ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Der erfolgreiche Praxistest hat ihn darin bestärkt, aufs Ganze zu gehen. Alfons Huber zeigt sich sowohl für seine Unterstützer als auch für die Kritiker dankbar: „Man bekommt viel positives Feedback, aber es gibt natürlich auch Kritiker. Die sind insofern wichtig, weil sie uns so geformt haben, dass wir mittlerweile auf jede Frage eine Antwort haben.“ Widerspruch motiviert den jungen Erfinder, die Grenzen des Machbaren auszuloten.

ENERGIE VON DER STRASSE HOLEN
Der ideale Einsatzort für REPS ist dort, wo Fahrzeuge ohnehin mechanisch abbremsen müssen: Vor Mautstellen, Grenzübergängen und generell überall dort, wo es Geschwindigkeitsbegrenzungen oder eine Gefällestrecke gibt, die Abbremsen erfordern. „Es wäre ineffizient und unethisch, das System auf einer normalen Strecke, die mit konstanter Geschwindigkeit befahren wird, zu installieren. Dabei würde man gewissermaßen nur aus dem Treibstoff der Autos elektrische Energie abgreifen“, erklärt der Forscher. „Das Anwendungsfeld ‚Straße‘ eröffnet uns eine enorm große Implementierungsfläche.“ Prinzipiell ließe sich REPS auch in hochfrequentierten Fußgängerbereichen installieren, etwa in Einkaufszentren, die damit einen Teil ihrer elektrischen Energie grün mit der Muskelkraft der Besucher*innen erzeugen könnten. „Das amortisiert sich bei Fußgängern aber nur in sehr hoch
eco. zukunft 78
Das Hauptanwendungsgebiet von REPS liegt definitiv im Straßenverkehr. An hochfrequentierten Straßen herrscht im transitgeplagten Tirol bekanntermaßen kein Mangel.
Der patentierte Mechanismus wandelt die Bewegungsenergie von Fahrzeugen und Fußgängern praktisch reibungsfrei in elektrischen Strom um.
ALFONS HUBER
frequentierten Bereichen“, räumt Huber ein, der das Hauptanwendungsgebiet seiner Erfindung definitiv im Straßenverkehr verortet. An hochfrequentierten Straßen herrscht im transitgeplagten Tirol bekanntermaßen kein Mangel. Bis Ende 2023 will Huber das REPS auf einer Teststrecke verbaut haben, Gespräche mit einem Straßenerhalter sind noch im Gang. Auf Grundlage öffentlich verfügbarer Daten hat er in Tirol 380 Straßenabschnitte identifiziert, an denen sich sein System binnen eines Jahrzehnts amortisieren würde und in den Jahren danach bis zum Ende der Lebensdauer kostenlos und wartungsarm Strom produzieren würde. „Dadurch könnte man jährlich allein durch den PKW-Verkehr 105 Millionen Kilowattstunden generieren.“ Huber schwebt vor, die mittels REPS erzeugte Energie nicht etwa ins Netz einzuspeisen, sondern nach Möglichkeit dort zu verbrauchen, wo sie erzeugt wird. „Mit diesem Strom könnte man zum Beispiel Stromtankstellen betreiben oder umliegende Häuser und Infrastruktur versorgen. Das würde auch das Stromnetz nicht weiter belasten“, erklärt der Physiker.

Alfons Huber sucht jedenfalls Verstärkung, um seine Erfindung 2024 endgültig auf die Straße bringen zu können. Das Stellenprofil beschreibt Huber so: „Ich suche Technical Engineers, die verrückt genug sind, mit mir diese Herausforderungen anzugehen und ein straßentaugliches REPS zu bauen.“ Allein schon im Sinne der Energiewende ist es nur zu wünschen, dass das ambitionierte Vorhaben gelingt.
Dr. Fabian Gerber ist Facharzt für Unfallchirurgie und ärztlicher Leiter medalp Zillertal

MENISKUS, DAS IST KEIN MUSS
Professionelle und modernste Diagnose, Therapie und Training bei der medalp.
Zu den häufigsten Knieverletzungen zählen Meniskusrisse, die sowohl durch eine akute Verletzung als auch verschleißbedingt auftreten können. Ein akuter Riss löst sofort starke Schmerzen aus, die häufig in eine Schwellung übergehen. Darüber hinaus können Symptome wie Schmerzen bei Belastung und Bewegung oder Blockaden mit Bewegungseinschränkung auftreten. „Bei Meniskusbeschwerden ist es wichtig, eine gründliche Diagnose zum Beispiel mittels MRT zu stellen und sofort mit der optimalen Behandlung zu beginnen“, führt Dr. Fabian Gerber, Facharzt für Unfallchirurgie und Ärztlicher Leiter der medalp Sportclinic Zillertal, aus. „Ein Meniskusriss kann sowohl konservativ (ohne Operation) mit Physio- und Schmerztherapie als auch operativ behandelt werden. Dabei wird im Rahmen einer Arthroskopie der verletzte Meniskus mittels Kamerabild genau untersucht und je nach Rissform teilweise entfernt oder mittels Naht versorgt“, erläutert Dr. Gerber.
Verschleißbedingten Meniskusverletzungen setzen meist schleichend mit Schmerzen beim Gehen oder Laufen ein und dies häufig in Kombination mit knackenden Geräuschen. Betroffene klagen häufig über Schmerzen, die nachts im Liegen oder bei längerem Sitzen auftreten. Von dem ersten Ordinationsbesuch und der Diagnose über den Klinikaufenthalt bis hin zum umfassenden Reha-und Trainingsprogramm sorgt das kompetente Fachpersonal der medalp für eine rasche Rekonstruktion des Knies. PR
MEDALP - FAKTENCHECK
• Hervorragende Expertise durch 3.300 OPs pro Jahr
• Modernste Technologie und topausgebildetes Personal
• Schnelle und professionelle Betreuung noch am selben Tag
• 5 Standorte in Tirol
• Diagnostik: MRT, CT, Röntgen
• Unfallchirurgie, Orthopädie, Sportmedizin
• Physiotherapie und spezielle Unterwasserbehandlungen
• Erfolgreiches back2sport-Programm und Trainingsbetreuung
KONTAKT:
medalp – Zentrum für ambulante Chirurgie Betriebs GmbH Medalp-Platz 1, A-6460 Imst, Tel.: +43 5418 51100
E-Mail: info@medalp.com, www.medalp.com
79
*Translation ist eine Bewegung, bei der sich alle Teile eines Körpers mit derselben Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen.
„Wenn Strom zu einem knappen Gut wird, braucht es grüne Energiewandler, die sich rasch energetisch amortisieren.“
eco. expertentipp
MIT MUT UND INNOVATION DEN KLIMAWANDEL GESTALTEN
Tirols Industrieunternehmen machen sich fit für die Zukunft und leisten mit ihren Innovationen und Investitionen einen zentralen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise.
Die Ökologisierung und Dekarbonisierung der Industrie und Wirtschaft schaffen wir nicht mit Angstmacherei und Verzicht, die Wohlstand und damit den sozialen Frieden gefährden können, sondern mit einer klaren Vorstellung, wie wir dank technologischer Entwicklungen und der Zusammenarbeit aller Beteiligten diese Jahrhundertherausforderung meistern. Die Tiroler Industrie bekennt sich dazu, die Transformation mit aller Kraft voranzutreiben, und arbeitet gemeinsam mit ihren Mitarbeitern jeden Tag daran, die Produktion nachhaltiger und ressourceneffizienter zu gestalten. Diese positive Einstellung zum notwendigen Wandel zeigen Umfragen der Industriellenvereinigung (IV) Tirol bei ihren
Mitgliedern ganz deutlich. „Der notwendige Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität gelingt nur gemeinsam mit der Wirtschaft. Die Lösungen liegen in neuen Technologien, in Forschung und Entwicklung und vor allem auch in der Nutzung der Energiequellen im eigenen Land“, bringt es Christoph Swarovski, Präsident der Industriellenvereinigung Tirol, auf den Punkt.
INDUSTRIE BEGRÜSST KLIMA - UND TRANSFORMATIONSOFFENSIVE
Die Verantwortung für diesen Wandel kann aber nicht nur bei den Unternehmen liegen. Sie müssen von Seiten der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Tirol durch die richtigen Maßnahmen und Förderungen
unterstützt werden, um Österreichs ambitionierte Klimaziele, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 zu erreichen, erfolgreich umzusetzen. Die Industriellenvereinigung Tirol begrüßt daher den Plan der Bundesregierung, der Industrie in der Ende 2022 präsentierten Klima- und Transformationsoffensive 5,7 Milliarden Euro für die Umrüstung auf moderne Produktionsanlagen, die Steigerung der Energieeffizienz und weitere Umweltförderungen zur Verfügung zu stellen.

UNABHÄNGIG DANK ERNEUERBARER ENERGIE
Obwohl sich die Lage am europäischen Energiemarkt entspannt, zahlen Tirols Unternehmen für ihre Energieversorgung immer
IV TIROL
© IV TIROL / CHRISTIAN VORHOFER
Industrie und Umwelt im Einklang: Die Tiroler Industrie geht mit gutem Beispiel voran und investiert Millionen in den Klimaschutz.
noch viel mehr als Unternehmen in anderen Wirtschaftsräumen – etwa die USA oder China –, mit denen sie in Konkurrenz stehen. Der schnelle und unbürokratische Ausbau erneuerbarer Energien bleibt also das Gebot der Stunde, um die Tiroler Industrie unabhängiger zu machen und die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 erreichen zu können. Neben dem Ausbau der Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft muss in Tirol auch die industrielle Verwendung von Wasserstoff als Energiespeicher und alternativer Kraftstoff weiter forciert werden.
KNOW - HOW FÜR ÖKOLOGISCHEN WANDEL GEFRAGT

Die erfolgreiche Transformation der Tiroler Industrie und Wirtschaft hin zu einer nach-


haltigen und emissionsfreien Produktionsweise steht und fällt mit der Expertise von Mitarbeitern, die wissen, wie dieser Wandel in konkreten Projekten in den Unternehmen umgesetzt werden kann. Das Angebot an spezialisierten Schultypen, Lehrberufen und Studiengängen, in denen das Wissen und das Handwerkszeug für die erfolgreiche Ökologisierung vermittelt wird, muss massiv ausgebaut und für so viele junge Menschen in Tirol wie möglich zugänglich gemacht werden. Dank der absoluten Bereitschaft der Unternehmen, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern der Klimakrise entschlossen entgegenzutreten, wird Tirols Industrie gestärkt und wettbewerbsfähiger aus diesem Transformationsprozess hervorgehen. PR
6 - PUNKTE- PLAN
Was brauchen Tirols Industrie und Wirtschaft für die erfolgreiche Ökologisierung?
SCHNELLE UND EINFACHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN
Die Industrie investiert Millionen Euro für die Transformation der Produktionsprozesse. Dafür müssen Verfahren beschleunigt und unbürokratischer gestaltet werden. Eine moderne Verwaltung muss Partner der digitalisierten Wirtschaft sein.
AUSBAU DER ERNEUERBAREN ENERGIE
Tirol muss seine Standortvorteile nutzen und das ist der entschlossene weitere Ausbau der Wasserkraft. Auch die Potenziale anderer alternativer Energieträger, wie der Photovoltaik und Windkraft, müssen gehoben werden.
FACHKRÄFTE MIT DEM RICHTIGEN KNOWHOW
Wie eine Umfrage der IV Tirol zeigt, ist das Fehlen von Fachkräften eines der größten Hindernisse bei der Ökologisierung. Hier müssen auf allen Ebenen mehr und passende Ausbildungsangebote geschaffen werden.
STÄRKUNG DER RESSOURCENEFFIZIENZ UND KREISLAUFWIRTSCHAFT
Einer der effektivsten Wege, um Emissionen einzusparen, ist die effizientere Nutzung von Rohstoffen. Hier braucht es eine tirolweite Strategie für den Aufbau der regionalen Kreislaufwirtschaft.
KLIMAFREUNDLICHE BETRIEBLICHE MOBILITÄT
Ein umweltfreundlicher betrieblicher Mobilitätsmix und angepasste Pendlerkonzepte sind Maßnahmen mit hohem Emissionseinsparungspotenzial. Innovative Projekte und Ideen müssen unterstützt, umgesetzt und für so viele Betriebe wie möglich zugänglich gemacht werden.
„TIROLER HAUS DES KLIMAS“
Damit Tirols Industrie und Wirtschaft nachhaltiger werden kann, braucht es genügend Fachkräfte, die diesen Wandel in den Unternehmen umsetzen.
Um die ökologische Transformation meistern zu können, braucht es eine zentrale Einrichtung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, die Beratung, Förderung und Behördenwege aus einer Hand anbietet und das Know-how für die Green Transition für alle zugänglich macht. Dafür steht das „Tiroler Haus des Klimas“.
81 IV TIROL
„Die Lösungen zur Gestaltung des Klimawandels liegen in neuen Technologien, in Forschung und Entwicklung und vor allem auch in der Nutzung der Energiequellen im eigenen Land.“
CHRISTOPH SWAROVSKI, PRÄSIDENT DER INDUSTRIELLENVEREINIGUNG TIROL
© ISTOCK / SKYNESHER
DIGITAL SOLUTIONS FOR DIGITAL THINKERS
Wie bedeutsam eine erfolgreiche und authentische digitale Performance für Unternehmen ist, darüber muss man eigentlich nicht mehr diskutieren. Wie sich diese jedoch von der ersten Codezeile bis zur letzten ausgestaltet und laufend gepflegt wird, ist für das Team von MOMENTUM Anspruch und Leidenschaft gleichermaßen.
Man mag persönlich zur Technologisierung stehen, wie man will, für Unternehmen ist eine authentische digitale Identität mittlerweile ein entscheidender Erfolgsfaktor geworden. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um eine Präsenz in Form irgendeiner Webseite, nein, es geht um einen Auftritt, eine Positionierung, eine Kommunikation mit Kund*innen und Zielgruppen. „Uns ist es ein großes Anliegen, dass Unternehmen den Wert erkennen, ihre digitale Performance als Sprachrohr zu nutzen, die schier unendlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Da gibt es noch so viele neue Geschäftsfelder, die erschlossen werden können und die wir gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten möchten“, kribbelt es MOMENTUM-Gründer Philip Farbmacher so richtig unter den Nägeln, mit seinen Kund*innen oder vielmehr Partner*innen zukunftsfähige digitale Performances zu gestalten. „Dazu braucht es aber weit mehr als lediglich einen Programmierer für eine Webseite. Dazu braucht es strategisches Denken, ein Gefühl für den Kunden und Markt, für die große, weite, digitale Welt, die eigentlich allen Unternehmen zu Füßen liegt und die man mit den richtigen Konzepten zum Leben erwecken muss.“
Dieses Digital Thinking und die bedeutsame Rolle der digitalen Performance für Unternehmen hat sich bei MOMENTUM auch im Laufe ihrer Tätigkeiten so entwickelt. Häufig ist die Website ein Einstieg für eine Zusammenarbeit, aber während der ersten Schritte des Entstehungsprozesses ergeben sich oft viel fundamentalere Fragen wie „Wie wollen wir bei wem wahrgenommen werden?“, „Versteht unsere Zielgruppe unser Angebot?“, „Was wollen wir in der digitalen Welt überhaupt bewirken oder erreichen?“
Kooperieren eng für erfolgreiche Brand Performance: Corinna Pfurtscheller und Christian Baumgartner, nio-Studio, Johannes Felder, awee GmbH, Philip Farbmacher und Wolfgang Farbmacher sowie Roman Fischer, MOMENTUM. „Wir sind ein Hub für Strategie, Design, Webentwicklung und E-Commerce.“

Fragen, die in ihrer inhaltlichen Konzeption weit über das einfache Programmieren einer Website hinausgehen.
DIGITALE KLAVIATUR
„Unsere Performance geht weit über den Rahmen einer üblichen Webagentur hinaus“, so Farbmacher und ergänzt: „Wir verschaffen und erleichtern mit unserer tiefgehenden strategischen Beratung und messbaren Kommunikationsmaßnahmen unseren Kunden einen Zugang zu digitalen Märkten unserer Zeit, die sonst eigentlich nur den Big Playern offen stehen.“ Für das
Team von MOMENTUM ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ihre digitale Klaviatur alle Noten spielt. „Ein sinnvoller, moderner Kommunikationspartner muss aus meiner Sicht alles beherrschen, von Web bis Social, von Growth Hacking bis Global Campaigning, und das natürlich immer auf Basis der Marke und gespickt mit hochwertigsten Inhalten.“
Mit dem Konzept „Website as a service“ agiert MOMENTUM in Österreich bislang einzigartig und bringt noch einen weiteren Aspekt mit. So treffen schon beim Gründerteam aus Vater und Sohn wertvolle Essenzen wie fundierte, gesammelte Erfahrung
82
TEXT: DORIS HELWEG
MOMENTUM
mit jungem, dynamischen Innovationsgeist aufeinander und ergänzen sich perfekt. „Natürlich ist es für mich schon eine Herausforderung, mit einem so jungen Team zusammenzuarbeiten, und so ist die Freude, meine Erfahrungen einbringen zu können, umso größer. Es macht mir vice versa auch wahnsinnigen Spaß, von den jungen Leuten zu lernen“, verrät Wolfgang Farbmacher und fungiert im dynamischen Unternehmen vorwiegend als Netzwerker, Berater und im Vertrieb. „Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, als Familie bzw. Vater und Sohn so eng zusammenzuarbeiten, überwiegen die Vorteile und die unschätzbare Effektivität bei weitem“, ergänzt Philip Farbmacher auf die Frage, ob es denn nicht auch manchmal zu Generationenkonflikten komme.
DESIGN THINKING
Was die Arbeit der Digitalisierungsspezialisten so besonders macht, ist die Herangehensweise nach der Design-Thinking-Methode. „Diese Methode, die ich bei meinem Studium am Imperial College in London, einer der besten Universitäten der Welt, kennenlernen durfte, erfolgt sehr kundenzentriert. Dabei werden Prozesse gemeinsam mit dem Kunden und dessen Kunden zielgerichtet erarbeitet. Das Ziel ist, Lösungen zu finden, die einerseits aus Anwender- oder Nutzersicht überzeugend, andererseits auch produkt- und natürlich markenorientiert sind“, erklärt Philip Farbmacher. „Dabei arbeiten wir uns in einem iterativen Prozess auf eine kundenzentrierte Lösung hin, arbeiten Pain Points heraus, versuchen diese mit unterschiedlichsten Ideen und Methoden zu lösen. Mit einfachen Worten: Wir probieren gemeinsam mit dem Kunden unterschiedliche Herangehensweisen aus, gehen im Fall auch noch mal einen Schritt zurück oder verwerfen eine Idee, so lange, bis wir die ideale und kundenzentrierte Lösung gefunden haben.“
DIGITAL MINDSET
Eine erfolgreiche digitale Identität ist völlig unabhängig von der Branche oder Größe eines Unternehmens, ein gewisses Mindset für Digitalisierung sollte jedoch vorhanden sein. „Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden verstehen, dass Digitalisierung wesentlich ist, ganz egal wie hoch der Digitalisierungsgrad im Unternehmen aktuell ist. Besteht im Unternehmen die Möglichkeit und das personelle Potential, den Content selbst zu liefern und den Webauftritt zu bespielen, ist das aus unserer Sicht der authentischs-
te Weg und wir begleiten und unterstützen sie dabei. Viele unserer Kunden nehmen auch unser Angebot der laufenden Weiterentwicklung der digitalen Performance in Anspruch, wir nennen diesen Ansatz ‚website as a service‘, der in Österreich einzigartig ist.“
So bunt gemischt das Kundenportfolio und die Ansprüche der Kunden sind, so mannigfaltig gestaltet sich das ambitionierte MOMENTUM-Team. Neben den Gründern Philip und Wolfgang Farbmacher bemühen sich derzeit weitere zehn Digital Natives wie Programmierer, Entwickler und Designer um erfolgreiche Lösungen für die Kunden. Basierend auf vier Leistungssäulen gliedert sich das MOMENTUM-Angebot in die Bereiche Strategie und Beratung, Design und Branding, Development und E-Commerce sowie Training und Change-Management. Um all diesen Ansprüchen auch in professioneller Expertise gerecht zu werden, kooperiert die Agentur mit Partnerbetrieben aus den Bereichen Markenentwicklung und Designstudios.
TREEHOUSE
Um der umfassenden Thematik einer erfolgreichen digitalen Performance mit professioneller Expertise gerecht zu werden,
arbeitet MOMENTUM sehr eng mit Markenentwickler und Kommunikationsstrategen Johannes Felder mit seinem Unternehmen awee GmbH sowie den Branding- und Grafikdesign-Experten nio-studio zusammen. Mit dieser TREEHOUSE-Kooperation fließen maßgebliche Bereiche wie Strategie, Design und Digital Performance ineinander. So deckt das Team als Full-Service-Anbieter von der Business Strategy über Markenentwicklung und Product Design bis hin zu Digital Performance und Experience Design sämtliche Kompetenzfelder ab, die es im Zusammenhang mit einer gelungenen und erfolgreichen digitalen Identität – online und offline – brauchen kann. Um die intensive Zusammenarbeit auch räumlich noch enger zusammenzuführen, wird das TREEHOUSE-Trio in Kürze eine Bürogemeinschaft in Innsbruck gründen. www.wearemomentum.at
Wollen Digitalisierung in Bewegung bringen: Philip und Wolfgang Farbmacher vereinen digitale Kompetenz mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung.

83
© ANDREAS FRIEDLE
www.wearetreehouse.group MOMENTUM
Ing. Mag. Thomas Stotter, Geschäftsbereichsleiter Telekommunikation der IKB
TOPMODERNES RECHENZENTRUM IN TIROL
Der Wunsch Tiroler Unternehmen, ihre Daten regional gesichert und geschützt zu wissen, ist groß. Mit der Errichtung des bereits dritten Rechenzentrums auf neuestem Stand der Technik wendet sich die IKB vor allem an Betriebe, denen Serverhousing mit höchster Verfügbarkeit, Unabhängigkeit und lokalem Service wichtig ist.
TEXT: DORIS HELWEG
Noch wird gewerkelt in den bunkerähnlichen Gemäuern eines stillgelegten Trinkwasserbehälters der IKB. Anfang Juni ist es dann so weit: Das dritte Rechenzentrum der IKB öffnet seine Tore für die lokale Datensicherung Tiroler
Unternehmen. „Wir investieren mit diesem in Tirol einzigartigen Rechenzentrum viele Millionen in ein Angebot für unsere Kund*innen, das ihnen ein sorgenfreies Betreiben ihrer Server ermöglicht, ohne jedoch die dafür notwendige Infrastruktur im eige-
nen Haus bereitstellen zu müssen“, zeigt sich Ing. Mag. Thomas Stotter, Geschäftsbereichsleiter Telekommunikation, erfreut über die bevorstehende Inbetriebnahme des bereits dritten lokalen Rechenzentrums der IKB. Die Nachfrage, Daten lokal zu sichern

IKB
und nicht in irgendwelchen Clouds, die ihre Server im Ausland betreiben, ist bei Tiroler Unternehmen durchaus groß. Das bestätigt allein die Tatsache, dass die beiden bisherigen IKB-Rechenzentren völlig ausgelastet und auch das nun in Fertigstellung befindliche dritte Rechenzentrum bereits sehr gut nachgefragt ist. „Mit diesem Rechenzentrum auf neuestem Stand der Technik schaffen wir auch für größere Industriekund*innen die Möglichkeit, ihre Daten lokal zu sichern und darüber hinaus eine Ansprech- und Servicepartnerin vor Ort zu haben“, betont Stotter. „Mit unserer mehrfach redundanten Anbindung zu Upstream-Providern in Wien, Frankfurt und Mailand sind wir bestens vernetzt und bieten höchste Sicherheitsstandards. Damit sind wir in Tirol bestens für Rechenzentrums-, Cloud- oder Hybridcloudlösungen aufgestellt.“
HÖCHSTE SICHERHEITSSTANDARDS
Allein schon die unterirdische Lage an sich bietet zuverlässigen Schutz vor Hochwasser, Starkregen, hohen Windgeschwindigkeiten, Explosionsgefahren oder Trümmerlasten. Zudem gewährleistet die direkte Stromversorgung aus dem Kraftwerk höchste Sicherheit, da dieses selbst bei einem Blackout unterbrechungsfrei Strom liefert. „Darüber hinaus gibt es noch weitere Batterieund Dieselaggregat-Stromsysteme, die im Worst-Case-Szenario die Stromversorgung übernehmen“, ergänzt Oliver Seiwald, M.Sc., zuständig für das Produkt- und Qualitätsmanagement. Sämtliche Räume sind rund um die Uhr videoüberwacht, der Zutritt ist mittels Zweifaktor-Authentifizierung gesichert. In sechs Serverräumen finden Firmen

modernste Racks für ihre Serverinfrastrukturen, die über redundante Strom- und Netzwerkanbindungen angebunden sind. Die

Klimatisierung in den Racks erfolgt energieeffizient und bedarfsgerecht direkt in den Racks, dadurch wird eine optimale Bereitstellung der benötigen Kühlleistung gewährleistet. Der Brandschutz erfolgt durch ein zweikreisiges Rauchansaugsystem für alle Server- und Technikräume, welches im Falle eines Brandes zuverlässig Brandvermeidungs-Vorkehrungen trifft. Durch diese mehrfach redundanten technischen Lösungen kann dieses Rechenzentrum höchsten Standards gerecht werden. Neben Alarmund Videosystemen ist das Rechenzentrum direkt an Leitstellen angebunden, wodurch neben der hohen Verfügbarkeit auch ein sehr hoher Sicherheitsstandard geboten wird. Als innovatives Unternehmen bietet die IKB mit ihren Serverhousing-Angeboten ihren Kund*innen Lösungen auf neuestem Stand der Technik. Den Unternehmen steht für ihre Hardware nicht nur höchstgesicherte Infrastruktur mit Rundum-Überwachung zur Verfügung, sondern auch höchste Verfügbarkeit und vor allem eine verlässliche Ansprechpartnerin vor Ort mit hoher Serviceorientierung – Vorteile, mit denen große Cloud-Anbieter*innen nicht aufwarten können. PR


85
IKB
Die unterirdische Lage an sich und die bunkerähnlichen Gemäuer bieten zuverlässigen Schutz vor Hochwasser, Starkregen, hohen Windgeschwindigkeiten, Explosionsgefahren oder Trümmerlasten.
„Mit diesem Rechenzentrum auf neuestem Stand der Technik schaffen wir auch für größere Industriekund*innen die Möglichkeit, ihre Daten lokal zu sichern und darüber hinaus eine Ansprech- und Servicepartnerin vor Ort zu haben.“
THOMAS STOTTER
Modernste und mehrfach redundante Verkabelungsinfrastrukturen bei Strom sowie ein Netzwerk auf dem aktuellen Stand der Technik sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Finanzwissen als Allgemeinbildung

Seit Langem werden Kämpfe darüber ausgefochten, was als bildungswirksamer Unterricht gilt. Es wird über Bildungsideale und -systeme verhandelt und darüber, ob Bildung per se zweckfrei sein muss oder auch nutzbringend sein darf, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Was die Allgemeinbildung betrifft, überwiegt erstere Ansicht. Wirtschafts- und Finanzwissen gelten allerdings gemeinhin als berufliches Wissen, das folglich zweckdienlich und deshalb qua definitionem nicht allgemeinbildend ist. In Pflicht- und allgemeinbildenden Schulen findet Wirtschafts- und Finanzbildung deshalb kaum statt. Das allerdings ist ein Problem, das unter anderem der Österreichische Verband Financial Planners zu lösen gedenkt. Und es bereits tut. Die gemeinnützige Organisation hat sich Finanzbildung als eines seiner Verbandsziele gesetzt und schon 2019 ein Konzept dafür erstellt sowie seine Mitglieder, die als European Financial Advisor/EFA® oder Certified Financial Planner/CFP® zertifiziert sind und sohin nachweislich über erstklassiges Fachwissen verfügen, zur Mitarbeit aufgerufen. Rund 60 Financial Advisors und Planners haben sich freiwillig gemeldet, um Wissen rund ums Thema Finanzen in die Schulen zu bringen. Das Institut für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien hat dafür neben einem didaktischen Konzept auch entsprechende altersgerechte Arbeitsmaterialien erarbeitet, die Finanzbildner*innen wurden unter anderem in speziellen Workshops vorbereitet. Sie alle arbeiten unentgeltlich, sodass das Angebot für alle Schultypen kostenfrei in Anspruch genommen werden kann.
Wenn auch Sie Interesse haben, senden Sie einfach ein E-Mail mit dem Betreff „Finanzbildung“ an office@afp.or.at. Sie werden dann gerne kontaktiert.
86 finanzieren & versichern GELD
SICHER IST SICHER
Wir sind keine Schwarzmaler und schon gar keine Weltverschwörer, aber die Empfehlung des Österreichischen Zivilschutzverbandes, für den Fall des Falles Wasser, haltbare Lebensmittel, eine Notbeleuchtung, ein Notfallradio (mit Batteriebetrieb) sowie eine kleine alternative Kochmöglichkeit daheim zu haben, macht durchaus Sinn. Laut Oesterreichischer Nationalbank sei es auch ratsam, im Krisenfall über etwas Bargeld zu verfügen. Die Empfehlung liegt bei 100 Euro in kleinen Stückelungen pro Familienmitglied. „Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel, das immer und überall funktioniert. Für einen Zahlvorgang mit Bargeld braucht man keine technischen Hilfsmittel. Damit das funktioniert, ist eine gewisse Vorsorge ratsam. Im Krisenfall – beispielweise bei einem Blackout oder einem großflächigen Hackerangriff – ist es wahrscheinlich zu spät und auch schwierig, sich noch Bargeld zu besorgen“, so Eduard Schock, Mitglied des Direktoriums der OeNB. Wobei im Falle eines tatsächlichen Blackouts Geschäfte wegen nicht mehr funktionierender Kassen- und Sicherheitssysteme vermutlich ohnehin geschlossen sein werden. Dennoch: Sicher ist sicher.

WIR FÖRDERN DIE GRÜNE TRANSFORMATION
Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol, darüber, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit lebt.

ECO.NOVA: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Wiener Städtischen? WALTER PEER: Die Wiener Städtische lebt Werte wie Solidarität, soziales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften in der Unternehmensführung. Diese Grundhaltung verfolgt eine klare Strategie des wertorientierten Wachstums, die den Unternehmenserfolg prägt. Nachhaltigkeit spielt für die Wiener Städtische seit jeher eine sehr wichtige Rolle.
BUCHTIPP
Monkee. Dem Geld auf der Spur EUR 19,95 Über Geld spricht man DOCH! Die Macher hinter dem Tiroler Start-up Monkee haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, finanziell gesünder zu leben. Dabei setzen sie schon bei den Kleinsten an – unter anderem in Form eines Wimmelbuches, mit dem sich Kinder und Eltern spielerisch und auf positive Art und Weise mit dem Thema Geld auseinandersetzen können. Somit sind die Kids gerüstet, wenn in weiterer Folge die Finanzbildner*innen von der Seite nebenan in die Schule kommen. Infos und Bestellmöglichkeit unter monkee.rocks/wimmelbuch

Welche Initiativen setzt das Unternehmen? Wir setzen auf ressourcenschonende Technologien, verwenden energieeffiziente Beleuchtungssysteme und umweltverträgliche Materialien bei Umbauten. Zudem wird verstärkt in nachhaltige Investments wie Solarparks oder Windkraftwerke investiert. In der Veranlagung werden grüne Anleihen bevorzugt.
Welche speziellen Angebote bietet die Wiener Städtische für umweltbewusste Kunden? Unsere Lebensversicherung Eco Select Invest wurde mit dem österreichischen Umweltzeichen prämiert und bietet die Möglichkeit, nachhaltig zu veranlagen. Nehmen wir alle fondsgebundenen Lebensversicherungen zusammen, fließt bereits jeder zweite Euro in nachhaltige Veranlagungen.
www.wienerstaedtische.at
eco. expertentipp
©
LUDWIG SCHEDL/WIENER STÄDTISCHE
„Souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wenig braucht.“
NICO PAECH, VOLKSWIRT
87
Betrachtet man die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz, sind teils stürmische Zuwächse zu erwarten, wofür auch die Innovationszyklen sprechen.
TECH-GELD: CHANCEN IM IT-SEKTOR
Technologieaktien werden derzeit zunehmend günstiger. Die infolge voraussichtlich weiterer Leitzinsanhebungen bevorstehenden erneuten Kurskorrekturen könnten bereits vereinzelt günstige Einstiegschancen bieten, doch erst wenn sich nach einer Talfahrt ein solider Boden bildet, sollte sich ein breiterer Einstieg lohnen.
TEXT: MICHAEL KORDOVSKY
eco. geld 88
emographische Überalterung und der starke Trend zu Teilzeitjobs führen zu einem Mangel an Arbeitskräften. Die Rettung der Betriebe liegt in der Automatisierung. Putzroboter, Servierroboter in der Gastronomie, in Tirol zunehmend mehr Verkaufsautomaten-Hütten für Nahrungsmittel vom Bauernhof und in der Industrie weltweit bereits vollautomatische Fertigungsstraßen – diese Zukunft hat begonnen. Auch Smart-Home-Produkte, wie mit dem Internet vernetzte Lichter, Kühlschränke und Waschmaschinen, aber auch autonom fahrende Fahrzeuge prägen den Trend zum Internet der Dinge (Internet of Things / IoT). Laut Statistica wird sich die Zahl der IoT-Geräte von 9,7 Milliarden im Jahr 2020 auf mehr als 29 Milliarden im Jahr 2030 fast verdreifachen.
Datenauswertungen und Überwachungstätigkeiten übernehmen außerdem zunehmend geeignete Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI), die in alle Bereiche moderner IT vordringen. Chatbots und Roboterhotlines sind erst der Anfang. Im Metaverse, der Weiterentwicklung des Internets durch die Schaffung virtueller Welten und eine 3-D-Abbildung unserer Welt, sollten KI-Tools über das Potenzial verfügen, ganze Welten und 3-D-Assets auf Grundlage von Textbeschreibungen zum Leben zu erwecken. Betrachtet man die Einsatzmöglichkeiten der KI von der Robotik, der Medizintechnik, dem Telekombereich, in Servicecentern bis hin quer durchs herkömmliche Internet und Metaverse, sind teils stürmische Zuwächse zu erwarten, wofür auch die Innovationszyklen sprechen.
INNOVATIONSTREIBER
Die vergangenen drei Jahre und auch die kommenden sind eine schwierige Zeit für die Weltwirtschaft. Pandemie, Ukrainekrieg, Inflationsschub, Zinsschock … gerade aus solchen Phasen gehen große Innovationen hervor, die häufig mehrere Dekaden prägen. Disruptive Industrien revolutionieren dann Wirtschaft und Technik.
Die frühen 1990er-Jahre zum Beispiel waren vor allem in Europa von einer Rezession geprägt. Am 6. August 1991 wurde die erste Webseite info.cern.ch veröffentlicht und am 30. April 1993 gab das Direktorium des europäischen Kernforschungszentrums CERN das World Wide Web kostenlos für die Öffentlichkeit frei. Mit verbesserten Browsern und Suchmaschinen stieg die Popularität. Es wurden immer mehr Firmen gegründet, deren Businessmodelle erst durch das Internet ermöglicht wurden. Der E-Commerce begann mit Amazon als Pionier, heute trotz jüngster Rückschläge an der Börse noch über eine Billion Dollar schwer. Die „Neuen Märkte“ entstanden ab Mitte der 1990er-Jahre und eine erste Generation
Internetaktien begann zu boomen. Nach dem Platzen der Technologieblase kamen die sozialen Medien, das Cloud-Computing und die 3-D-Drucker auf und aus der aktuellen Wirtschaftskrise gehen voraussichtlich weitere Innovationen in den Bereichen Metaverse, Virtual Reality und Raumfahrt hervor, deren wirtschaftlicher Nutzen sich erst in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zeigen wird. Letztlich sollen laut einer Schätzung von Precedence Research die weltweiten Umsätze von KI-Produkten und -Dienstleistungen bezogen auf den Enduser-Markt von 2022 bis 2030 von 119,78 auf 1.591,03 Milliarden Dollar bzw. um 38,1 Prozent per anno (CAGR) wachsen. Doch die ganze IT-Infrastruktur ist anfällig für Hackerattacken. Cybercrime kostet der Weltwirtschaft jährlich über eine Billion Dollar bzw. fast ein Prozent der globalen Wirtschaftsleistung (Quelle: McAfee and Center for Strategic and International Studies (CSIS), The hidden costs of cyber crime). Laut Daten von MarketsandMarkets soll von 2022 bis 2027 der globale Cyber Security-Markt von 173,5 Milliarden USD um 8,9 Prozent jährlich (CAGR) auf 266,2 Milliarden USD wachsen. Die Wertschöpfungskette des Healthcare-Bereichs verfügt dabei über das höchste Wachstum. An Bedeutung gewinnen werden dabei die cloudbasierende Cybersicherheit und die IoT-Security. Vor allem Produktionsanlagen, die am Internet hängen, bedürfen eines stärkeren Schutzes genauso wie staatliche Infrastruktur. Laut BlueWeave Consulting wächst der globale IoT-Security-Markt von 2021 bis 2028 von 15 auf 61,6 Milliarden USD.
AKTIENAUSWAHL UND EINSTIEGSZEITPUNKTE Technologieaktien stehen wegen steigender Zinsen und niedrigerer Barwerte von in Zukunft liegenden Gewinnen als Wachstumswerte stärker unter Druck. Daran kann auch die jüngste Tauwetterphase mit vereinzelt (noch) positiven Unternehmensnachrichten nichts ändern. Darüber hinaus kommen Start-ups derzeit immer schwerer an Investorengelder und eine Pleitewelle ist zu erwarten. Die wichtigste Bank für Neugründungen im Silicon Valley, die SVB mit über 200 Milliarden Dollar in Assets, geriet jüngst in eine Schieflage, da genau diese Start-ups massiv Einlagen abzogen. Dabei hat die Bank of Japan noch nicht einmal mit einer geldpolitischen Wende begonnen. Bis dato haben die Japaner dem globalen Finanzsystem
eco. geld 89
D
Gerade aus schwierigen Phasen gehen große Innovationen hervor, die häufig mehrere Dekaden prägen. Disruptive Industrien revolutionieren dann Wirtschaft und Technik.
tendenziell Geld zufließen lassen, das zukünftig fehlen könnte. Deshalb sollte primär in größere Unternehmen investiert werden, die rentabel sind oder zumindest die Verluste der vergangenen drei Bilanzjahre mit Cashreserven abdecken können. Von Vorteil wäre auch globale Marktführerschaft in bestimmten lukrativen Segmenten.
Bezüglich Einstiegszeitpunkte sollten noch ein bis zwei Quartale abgewartet werden. Es könnte infolge weiterer massiver Leitzinsanhebungen in den USA und Europa sowie einer geldpolitischen Wende in Japan und auch im Zuge einer Bankenpleitenwelle zu einer globalen Rezession kommen. Erst wenn sich nach einer längeren Talfahrt auf niedrigem Niveau ein solider Boden bildet, kann ein breiterer Einstieg erfolgen.
WICHTIG: Wer in Einzeltitel investiert, ist angehalten, eigene Recherchen auf der Webseite des Unternehmens und in diversen Presseberichten vorzunehmen. Auch die Fundamentaldaten sollten gecheckt werden. Einfach nur gutgläubig wegen eines einzigen Artikels mit der ISIN gleich beim Onlinebroker zu ordern, ist der falsche Zugang zur Materie. Wer keine Zeit hat, sollte somit besser in breit gestreute Fonds und/oder ETFs investieren. Aus genannten Gründen werden bei den Einzeltiteln keine ISINs angeführt.
ANLAGEPOTENZIAL
BEREICH IOT
Die üblichen Platzhirschen des Bereichs sind Amazon, Alphabet, Cisco, IBM und der kanadische IoT-Pionier Sierra Wireless. Letzterer verfügt über Mobilfunkmodule, Gateways und Konnektivitätsdienste, um komplette Device-to-Cloud-IoT-Lösungen mit Sicherheit bereitzustellen. Sierra-Wireless-Module und -Chips kommen vor allem in der Automobilindustrie, in der Logistik und dem Gesundheitswesen zum Einsatz. Sierra-Wireless wurde von Semtech übernommen. Das gemeinsame Unternehmen strebt langfristig bei 14 bis 18 Prozent Umsatzwachstum eine operative Marge von 32 bis 36 Prozent an. Als Softwareunternehmen des IoT stellt PTC die „ThingWorx“-Technologieplattform bereit, um schnell anwachsende Datenmengen von intelligenten, vernetzten Produkten und Systemen zu erfassen, zu analysieren und zu vermarkten. Breiter mit 58 Positionen kann man über den Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating in diesen Themenbereich investieren.
BEREICH KI UND ROBOTIK
KI erfordert ausreichende Rechenkapazitäten durch passende Prozessoren und hochleistungsfähige Chips. Hier kommt NVIDIA ins Spiel, die auf Grafikkarten und die Erschaffung virtueller Welten spezialisiert ist. Infolge einer steigenden Nachfrage nach KI müssen in Zukunft auch tausende von KI-Engines in einem Turm laufen, die einen großen und synchronisierten Datenfluss mit Geschwindigkeiten von 400 bis 800 Gigagyte ermöglichen. Bei der Unterstützung dieser massiven Prozessordichte ist das Netzwerk entscheidend, das skalierbar und verlustfrei sein soll und geringe Latenzzeiten haben sollte. Broadcom lieferte derartige KI-Netzwerke. Spekulativ interessant und aussichtsreich ist Duolingo, die weltweit führende E-Learning-Plattform, die durch ein Sprachlernprogramm bekannt wurde. Sie bietet interaktive Lernaktivitäten wie Sprachübungen, Spiele und Quizze an, die darauf abzielen, die Sprachkenntnisse des Nutzers in Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören zu verbessern. Dabei kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Aufgrund einer niedrigen Bewertung interessant erscheint auch der Hersteller von Computern und Rechenzentren Super Micro Computer, denn die Lösungen des Spezialisten für anwendungsoptimierte Serverund Speichersysteme umfassen künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing, Internet der Dinge sowie Hyperscale-Infrastruktur. Ebenfalls günstig bewertet ist mittlerweile Meta Platforms, Tendenz der Prognosen: starke Aufwärtsrevision!
Mit 295 Titeln gut abgedeckt werden kann diese Thematik über den Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF, der auf drei Jahre über 75 Prozent im Plus liegt. Der Xtrackers Intelligence and Big Data UCITS ETF 1 C bietet Zugang zu Unternehmen weltweit aus den Sektoren künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit, wobei die insgesamt 80 Titel vor allem Standardwerte wie NVIDIA, Meta Platforms, Amazon, Samsung, Apple und Alphabet abdecken. Die Dreijahres-Performance liegt bei ca. 78 Prozent. Auf drei Jahre sogar knapp 97 Prozent im Plus (Stichtag 17. 3.) liegt der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. Er bietet Zugang zu Firmen, die im Bereich KI tätig sind und von der Consumer Technology Association als Ermöglicher, Entwickler und Erweiterer eingestuft werden.
Im Robotikbereich ist der Platzhirsch die japanische FANUC. Das 1956 gegründete Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fabriksautomation, Industrierobotern, CNC-Systemen (elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen), Drahterodier- und Spritzgussmaschinen und vertikalen Bearbeitungszentren. FANUC ist Weltmarktführer bei größeren Industrierobotern, die beispielsweise in der Auto- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Das faktisch schuldenfreie Unternehmen überzeugt mit einer Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2022 von 85,9 Prozent und sollte in den kommenden Jahren einen Wachstumsschub bekommen.
Interessant ist auch Keyence, einer der weltweit größten Hersteller von Industriesensorik und Auto-
eco. geld 90
Technologieaktien stehen aktuell unter Druck. Daran kann auch die jüngste Tauwetterphase mit vereinzelt (noch) positiven Unternehmensnachrichten nichts ändern.
matisierungstechnik. Zum Produktangebot zählen Automatisierungssensoren, Barcode-Scanner, Bildverarbeitungssysteme sowie digitale Mikroskope und Messgeräte. Das Geschäftsmodell besteht darin, ohne eigene Fertigungsstätten zu arbeiten und mit einer engen Orientierung an die Bedürfnisse der Kunden trotzdem mit Innovationen zu punkten.
Mit einem für 2023 geschätzten KGV von 17,8 relativ günstig ist die Schweizer Komax, die Maschinen im Bereich der Kabelverarbeitung sowie Prüfung von Kabelsätzen anbietet. 2022 stieg der Bestelleingang um 40,6 Prozent, der Umsatz konnte um 44 Prozent auf 606,3 Millionen Schweizer Franken gesteigert werden, was einen Anstieg des betrieblichen Ergebnisses um 60,1 Prozent auf 71,7 Millionen Schweizer Franken ermöglichte. Das US-Unternehmen Intuitive Surgical ist Weltmarktführer bei Chirurgierobotern und durchaus eine Wachstumschance. Das Spezialgebiet sind roboterassistierte Systeme für minimalinvasive Chirurgie.
Zwei bewährte ETFs, mit denen das Robotik/Automatisierungs-Thema gut abgedeckt werden kann, sind der iShares Automation & Robotics UCITS ETF mit einem Dreijahres-Plus von knapp 77 Prozent per 17. März 2023 und der 80 Positionen enthaltende L&G ROBO Global Robotics und Automation UCITS ETF mit einem Plus von über 72 Prozent im gleichen Zeitraum.
BEREICH: CYBERSECURITY
In diesem Bereich liegt ein enormer Investitionsnachholbedarf. Und zwar weltweit. Folgende Aktien erscheinen dabei besonders aussichtsreich: Zum Urgestein der Branche zählen Check Point Software Technologies (7,1 Prozent p. a. Gewinnwachstum/Aktie in den Jahren 2017 bis 2021), Fortinet und Gen Digital (früher Symantec und NortonLifeLock). Crowdstrike Holdings verfügt indes
über die erste Cloud-native Endgerätschutzplattform zur Abwehr von Sicherheitsverletzungen, wobei auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. 37 der 100 weltweit führenden Unternehmen und sieben der zehn größten Energieunternehmen sind Crowdstrike-Kunden.
Ein weiteres Basisinvestment ist Palo Alto Networks, ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der ein Zacks-Ranking von „Strong Buy“ erhielt. Besonderheit: eine Sicherheitsplattform, die es Firmen und Behörden ermöglicht, alle Benutzer, Anwendungen, Daten, Netzwerke und Geräte übersichtlich und permanent an allen Standorten zu sichern. Stärken des Unternehmens sind auch Cloud- und Netzwerksicherheit. Eine Kaufempfehlung im Zacks-Ranking ist auch ZScaler, Entwickler der Zero-Trust-Exchange-Plattform und Betreiber der weltgrößten Security Cloud.
Als echter Geheimtipp gilt Splunk: Das Unternehmen betreibt eine Suchmaschine für Datacenter, die empfangene Informationen (Maschinendaten) gleichzeitig sammeln, speichern, verarbeiten, analysieren und visualisieren kann. Bereits in sehr frühen Stadien können durch Splunk Bedrohungen identifiziert werden. Zuletzt stellte das Unternehmen das Geschäftsmodell von Dauerlizenz zu einem Software-as-a-Service-Modell auf Abo-Basis um, das in den kommenden Quartalen höhere jährliche wiederkehrende Umsätze, eine höhere Rentabilität und einen verbesserten Cashflow bewirken sollte.
Breit gestreut kann die Cybersicherheitsthematik auch durch folgende ETFs abgedeckt werden: den L&G Cyber Security UCITS ETF mit 43 Positionen; den iShares Digital Security UCITS ETF, der den STOXX Global Digital Security Index abbildet und 110 Aktien enthält; sowie den First Trust NASDAQ Cybersecurity UCITS ETF, der den NASDAQ CTA Cybersecurity Index (37 Positionen) abbildet.
eco. geld 91
Bezüglich Einstiegszeitpunkte sollten noch ein bis zwei Quartale abgewartet werden.
VERTRAUENSSACHE IMMOBILIEN
Nach Zeiten stetiger Preissteigerungen am Immobilienmarkt scheint sich die Lage 2023 etwas zu stabilisieren. Für Gerhard Cramer, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien und Leiter des Raiffeisen Wohnteams, ist aktuell eine gute Zeit, ein Eigenheim zu erwerben. Schöne Versprechungen allein sind Raiffeisen Immobilien Innsbruck zu wenig, Verbindlichkeit und der Mensch mit seinen Bedürfnissen rücken bei den versierten Maklern in den Mittelpunkt.

ECO.NOVA: Immobilienangelegenheiten sind Vertrauenssache. Immerhin geht es in der Regel auch nicht gerade um wenig Geld für die Betroffenen. Wie begegnen Sie diesen Bedürfnissen? GERHARD
CRAMER: Die Beweggründe für einen Immobilienverkauf bzw. -kauf können mannigfaltig sein. Familiengründung, Scheidung oder Todesfälle können einen Wohnungswechsel notwendig machen, da können durchaus auch ergreifende Schicksale dahinterste-
hen. Aus diesem Grund ist es uns ein großes Anliegen, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten und ihnen sowohl beim An- oder Verkauf, der Bewertung wie auch bei Fragen die Finanzierung der Immobilie betreffend alles aus einer Hand bieten zu können. Als 100-Prozent-Tochter der Raiffeisen Landesbank haben wir den einzigartigen Vorteil, auch sämtliche Finanzdienstleistungen im Haus auf kürzestem Wege verfügbar zu haben.
Wie sieht die Situation am Immobilienmarkt derzeit aus? Der Markt hat sich im Verlauf des Jahres 2022 von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt gedreht. War es zu Beginn des Jahres 2022 auf Grund der großen Nachfrage noch schwierig, an Immobilien zu kommen, so hat sich der Markt in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres dahingehend entwickelt, dass es wieder schwieriger ist, Immobilien zu verkaufen. Durch die gestiegenen Zinsen,
eco. geld 92
INTERVIEW: DORIS HELWEG
die neue KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungs-Maßnahme), welche mindestens 20 Prozent an Eigenkapital für Kreditkunden vorsieht, sowie der maximalen Schuldendienstquote von 40 Prozent sind viele Menschen nicht mehr in der Lage, sich ein Eigenheim über einen Kredit zu finanzieren. Die Preise sind nach wie vor hoch, ein Preisrückgang ist nach wie vor nicht in Sicht. Wir rechnen eher mit einer Preisstagnation.
Wie wirken sich die gestiegenen Energiekosten auf den Wohnungsmarkt aus?
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind natürlich derzeit große Themen. Kunden schauen vermehrt auf erneuerbare Energiesysteme, vor allem im Neubau, aber auch bei gebrauchten Immobilien.
Würden Sie Wohnungssuchenden derzeit zur Anschaffung einer Immobilie raten?
Auf jeden Fall. Es ist künftig nämlich davon auszugehen, dass die Mietpreise weiter steigen werden. Deshalb und in Anbetracht einiger anderer Faktoren ist ein abbezahltes Eigenheim nach wie vor der beste Schutz vor Altersarmut und Inflation.
Was macht Raiffeisen Immobilien am Markt so erfolgreich? Ganz eindeutig die Kraft des WIR. Als starker Partner sind wir da, wo die Menschen sind, um mit ihnen gemeinsam Probleme dort zu lösen, wo sie entstehen. Für uns stehen die die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt. Meist stecken hinter Wohnungskäufen oder -verkäufen auch persönliche Veränderungen im Leben. So kommt es zum Beispiel nicht selten vor, dass Eltern nach dem Auszug der Kinder das Eigenheim zu groß geworden ist, die Erhaltung zu mühselig. Je nach den Bedürfnissen der Kunden gibt es auch in diesem Fall eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen wir begleitend zur Seite stehen – wie den Verkauf der größeren Immobilie und den Kauf einer kleineren oder den Verkauf des Objektes mit Wohnrecht – mit der Sicherheit, bis ans Lebensende in der verkauften Liegenschaft wohnen bleiben zu dürfen. Es gibt also für jedes Kundenbedürfnis auch eine individuelle Lösung. Bei all diesen Varianten würden wir als Makler es sehr begrüßen, wenn die Zwischenfinanzierung für die Kunden wieder leichter möglich wird.
Was versprechen Sie mit der Immobilien-Leistungsgarantie? Kundenzufriedenheit wird bei Raiffeisen Immobilien groß-
geschrieben. Dazu zählt vor allem auch Ehrlichkeit. Wir wollen nichts schönreden, was nicht schön ist. Wir wollen auch keine falschen Hoffnungen wecken. Wir möchten unsere Kunden ehrlich und verbindlich begleiten. Dazu zählt in unserem Fall auch eine Finanzierungsberatung bzw. -möglichkeit im Haus oder wie es so schön heißt: Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand. Die sogenannte Leistungsgarantie ist bei Raiffeisen Immobilien Tirol nicht nur eine leere Worthülse, sondern ein tatsächliches Blatt Papier, genauer gesagt ein dreiteiliger Folder, auf dem sämtliche relevanten Vereinbarungen vermerkt sind. Frei nach dem Motto „Schauen Sie uns ganz genau auf die Finger“ werden hier Versprechen als Leis-
tungspflichten für Raiffeisen Immobilien schriftlich festgehalten und für den Kunden anschaulich definiert. Insgesamt neun Rubriken mit über fünfzig Punkten umfasst die Leistungsgarantie, angefangen von der ersten Beratung über Energieausweise, Exposé-Erstellung, Marketing, Interessentenmanagement und Besichtigungsorganisation bis hin zu Kaufabschluss, Kaufvertragsvorbereitung und After-Sales-Service.
RAIFFEISEN IMMOBILIEN TIROL GMBH
Bozner Platz 2 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/5305-12300
www.raiffeisen-immobilien.at

eco. geld 93
„Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind natürlich derzeit große Themen.
Kunden schauen vermehrt auf erneuerbare Energiesysteme, vor allem im Neubau, aber auch bei gebrauchten Immobilien.“
GERHARD CRAMER
©
ANDREAS FRIEDLE
DAS NÄCHSTE LEVEL DES BUSINESS-BANKING
Mit INFINITY rollt der Raiffeisensektor derzeit ein neues OnlinePortal für Firmenkund*innen aus, das webbasiert, multibankfähig, personalisierbar und damit bereits heute für alle zukünftigen Anforderungen gerüstet ist. Zudem rücken Kund*innen mit INFINITY noch näher an ihre Berater*innen heran.

RAIFFEISEN INFINITY
Raiffeisen INFINITY entwickelt sich zwar ständig weiter, ist aber schon heute das geworden, was von vornherein beabsichtigt war: Eine ausgefeilte Onlinelösung, die von jedem Gerät aus komfortabel und intuitiv bedienbar ist und spürbaren Mehrwert bietet.
INFINITY hat Raiffeisen dieses neue Banking auf höchstem Niveau genannt. Die liegende Acht versinnbildlicht, was die Bank damit im Sinn hat: Das Korsett, das plattformabhängige Softwarelösungen darstellen, abzustreifen und durch eine webbasierte Anwendung zu ersetzen, die auf jeder gängigen Plattform ohne vorherige Installation lauffähig ist. „Durch unsere webbasierte Lösung haben Kund*innen von überall Zugriff auf ihre Finanzen und können in Echtzeit Überweisungen tätigen und prüfen. Durch die Plattformunabhängigkeit kann INFINITY auf jedem Betriebssystem und Gerät – ganz gleich ob am Desktop, Notebook, Tablet oder Smartphone – genutzt werden“, sagt Zahlungsverkehrsexperte Martin Danler von der Raiffeisen Landesbank Tirol AG.

NEUE MASSSTÄBE
Raiffeisens bisherige Elektronic-Banking-Lösung ELBA hat sich gerade auch in der Version für Firmenkund*innen (ELBA-business) über Jahre hindurch zweifellos bewährt. So wie bei Mein Elba für Privatkund*innen will Raiffeisen auch für Firmenkund*innen eine neue, auf einer Plattformtechnologie basierende, innovative Banking-Lösung realisieren, die das Online-Banking-Angebot auf das nächste Level hebt und mehr zu bieten hat: In technologischer Hinsicht ebenso wie was die Sicherheit, die direkte Kommunikation zwischen Bank und Kund*in sowie den Funktionsumfang betrifft.
Hervorgegangen ist INFINITY aus der akribischen, mehrjährigen Entwicklungsarbeit eines interdisziplinären Projektteams, angeführt von den beiden Landesbanken in Oberösterreich und in Niederösterreich-Wien als sogenannte Leadbanken, welche die Entwicklung von Raiffeisen INFINITY für die gesamte Raiffeisen-Bankengruppe vorangetrieben haben. Den Entwicklern war es dezidiert ein Anliegen, eine moderne Plattform zu schaffen, die Firmenkund*innen den Unternehmensalltag mit neuen, verständlichen und intuitiv nutzbaren Leistungen und Funktionen erleichtert. Und tatsächlich setzt INFINITY sowohl beim Funktionsumfang als auch in der Benutzerfreundlichkeit neue Maßstäbe. In der Umsetzung von INFINITY hat sich gezeigt, dass das Miteinander, mit dem sich mehr erreichen lässt, kein Lippenbekenntnis ist, sondern in Software überführte Wirklichkeit. Über ein eigenes Kommunikationsmodul bleiben Kund*innen via INFINITY im stetigen Austausch mit ihren Bankberater*innen. Die Interaktion mit Kund*innen spielte bereits in der Entwicklung des Portals eine gewichtige Rolle, wurden doch bereits im Vorfeld ausgiebige Tests und Befragungen von Nutzer*innen durchgeführt.

NEUE FUNKTIONEN
Der erweiterte Funktionsumfang sorgt zudem dafür, dass unkompliziert und direkt Bankgeschäfte abseits des reinen Zahlungsverkehrs, zum Beispiel Bankgarantien
95
RAIFFEISEN INFINITY
oder Barvorlagen, angefordert werden können. Über ein eigenes Benachrichtigungscenter erinnert INFINITY seine User*innen an noch nicht unterfertigte Aufträge, ablaufende Zertifikate und vieles mehr. Derart fungiert die Plattform gewissermaßen als Assistent, der wichtige geschäftliche Vorgänge in Erinnerung ruft. Das Potenzial, eine Plattform für alle unternehmensrelevanten Anforderungen zu sein, löst Raiffeisen INFINITY unter anderem dadurch ein, dass es durch Unterstützung des Multi-Bank-Standards „multibankfähig“ ist. „Dadurch können auch sektorfremde Konten eingebunden, beauskunftet und für den Zahlungsverkehr genutzt werden“, erklärt Danler. Zukünftig nimmt man auch die Integration von Konten ausländischer Kreditinstitute ins Visier. Das neue Business-Tool unterstützt sowohl den Export als auch den Import von Daten. Mit Raiffeisen INFINITY wird außerdem der unkomplizierte Abschluss von Geschäftsfällen möglich, die firmenmäßig gefertigt werden müssen. Das Portal ermöglicht das Anlegen unterschiedlicher Nutzer, die einfach verwaltet und mit individuellen Zugriffsrechten ausgestattet werden können. Durch die personalisierbare Nutzeroberfläche von Raiffeisen INFINITY bleibt beim Banking stets die Übersicht über eine Vielzahl an Mandanten und Möglichkeiten gewahrt.
NEUE SICHERHEIT
Im Zuge der Entwicklung von INFINITY wurde auch der Raiffeisen eSafe integriert. „Der eSafe verwahrt digitale Dokumente mit höchster Sicherheitsgarantie. Kund*innen können dort Verträge, Dokumente, Passwörter und vieles mehr ablegen. Auch der sichere Versand eines Dokuments an Dritte ist möglich. Über den sogenannten ‚Team-Safe’ lassen sich Daten einfach und unkompliziert mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern teilen. Der ‚Digitale Nachlass’ ist eine einzigartige Funktion des Raiffeisen
eSafes, um den Nachlassprozess von Daten – also die rechtmäßigen Erben der Daten – festzulegen“, erläutert Martin Danler das zukunftsweisende Mehrwert-Feature, das die höchsten gängigen Sicherheitsstandards erfüllt.
PRAXISTEST BESTANDEN
Die ersten Praxistests im Kund*innenalltag hat INFINITY in Tirol bereits bestanden. In der Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol hat Helmut Wopfner, Vertriebsassistent im Firmenkundenteam, mit seinem Team INFINITY bereits gemeinsam mit Kund*innen auf Herz und Nieren geprüft. Das Feedback sowohl von Kund*innenseite als auch vonseiten der Berater*innen war durchaus vielversprechend. Wopfner lobt Raiffeisen INFINITY als „übersichtlich, praktisch und vielseitig“. Ein Eindruck, der von den Kund*innen ohne Einschränkung geteilt wird. „Das Feedback unserer Kund*innen ist überragend, nicht nur was die operative Funktionstüchtigkeit betrifft. Die vielen praktischen Tools werden gut und gerne genutzt. Uns gelingt es außerdem, immer mehr Kunden, die schon seit vielen Jahren mit ELBA-business arbeiten, für unsere neue – bessere – Variante zu gewinnen“, ist Wopfner überzeugt vom neuen Produkt, das derzeit ausgerollt wird und mit Ende 2024 ELBA-business ablösen wird. „Die laufenden Kosten entsprechen in etwa jenen von ELBA-business, unsere Kund*innen sparen sich aber jedenfalls den Aufwand, diverse Softwareupdates durchführen zu müssen“, sagt Martin Danler. Dank der webbasierten Lösung ist INFINITY immer automatisch am neuesten Stand und damit völlig wartungsfrei.

DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN
Raiffeisen INFINITY ist ein ausgereiftes Produkt. Fertig ist es aber längst nicht. Es entwickelt sich nämlich ständig weiter – ad infinitum, könnte man im Hinblick auf den Namen meinen –, immer mit Blick auf die Anforderungen der Kund*innen und die Innovationen in der Banken- und Finanzwelt. Sicherheit, Komfort und Funktionsumfang werden laufend und bereits heute an die Anforderungen von morgen angepasst. „Raiffeisen INFINITY kann jederzeit beliebig um neue Funktionen, Bankgeschäfte und Schnittstellen erweitert werden“, erläutert Martin Danler. Dazu werden zukünftig voraussichtlich auch Fintech-Dienstleistungen gehören, die Raiffeisen zwar nicht selbst anbieten wird, die sich aber mit INFINITY verknüpfen und von dort aus komfortabel verwalten lassen werden. Offenheit für Neues ist eine Grundanforderung an die Business-Software gewesen.
Raiffeisen INFINITY entwickelt sich zwar ständig weiter, ist aber schon heute das geworden, was von vornherein beabsichtigt war: Eine ausgefeilte Onlinelösung, die von jedem Gerät aus komfortabel und intuitiv bedienbar ist und spürbaren Mehrwert bietet. Mit der neuen Business-Plattform ist Raiffeisen nicht etwa bloß nachgezogen, sondern hat mit der modernsten Business-Banking-Lösung Österreichs in vielen Bereichen sogar vorgelegt. Raiffeisen-Experte Martin Danler formuliert das so: „Die Zukunft hat für uns bereits begonnen.“
96
„Das Feedback unserer Kund*innen ist überragend, nicht nur was die operative Funktionstüchtigkeit betrifft. Die vielen praktischen Tools werden gut und gerne genutzt.“
RAIFFEISEN INFINITY
HELMUT WOPFNER
Freude am Fahren
INDIVIDUALITÄT 3 .
JETZT
€ 2.400,–*
PREISVORTEIL AUF
SONDERAUSSTATTUNGEN FÜR IHREN NEUEN
Unterberger Denzel Innsbruck
Griesauweg 32, 6020 Innsbruck
Telefon 0512/33435
info@unterberger-denzel.bmw.at
www.unterberger-denzel.bmw.at
Unterberger Kufstein
Endach 32, 6330 Kufstein
Telefon 05372/6945
info@unterberger.cc
www.unterberger.cc
Unterberger St.Johann
Anichweg 1, 6380 St. Johann/T.
Telefon 05352/62389
office.stj@unterberger.bmw.at
www.unterberger.bmw.at
BMW X3: von 110 kW (150 PS) bis 265 kW (360 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 2,0 l bis 9,5 l/100 km, CO 2-Emissionen von 45 g bis 216 g CO 2 /km, Stromverbrauch von 18,9 kWh bis 20,5 kWh/100 km. Angegebene Verbrauchs- und CO 2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.


* € 2.400,– Preisvorteil beim Kauf von frei wählbarer Sonderausstattung in der Höhe von mindestens € 8.400,–.
Die Aktion ist gültig für BMW X3 (G01) Neu- und Vorführwagen mit Kaufvertragsabschluss bis 31.06.2023 und Auslieferung bis 30.09.2023.
Symbolfoto
ES BLEIBT SPANNEND
Zählte der Aktienmarkt während der vergangenen Pandemiejahre noch zu den Krisengewinnern, sorgte der Ukrainekrieg für einen Stimmungsumschwung. Eine hohe Inflation und steigende Zinsen verstärken die (wirtschaftliche) Unruhe, letztere sorgen indes auch für neue Chancen. Bei den Anlegern scheint sich die Gemütslage langsam wieder zu verbessern.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man. Das scheint auch für Negativszenarien zu gelten. „Interessanterweise scheint sich die Stimmung unter unseren Kunden wieder zu heben. Wir haben im letzten Jahr teils signifikante Marktrückgänge erlebt, und es hat eine gewisse Zeit gedauert, doch nun scheinen sich die Kunden an diese neue Realität gewöhnt zu haben. Trotz Inflation und höherer Zinsen steigt die Investitionsbereitschaft wieder an. Auf der anderen Seite eröffnet die aktuelle Marktsituation im Bereich der festverzinslichen Anlage interessante Opportunitäten. Trotz überschaubarem Risiko sind wieder vier bis fünf Prozent Rendite möglich“, sagt MMag. Georg Frischmann, Leiter des Private Banking der Hypo Tirol. Wir haben mit ihm über Geld gesprochen.
ECO.NOVA: Festverzinsliche Wertpapiere werden wieder stärker nachgefragt. In erster Linie natürlich ob der steigenden Zinsen. Werden Anleger im Allgemeinen vorsichtiger? GEORG FRISCHMANN: Das würde ich generell nicht so sehen. Die letzten Jahre war ein festverzinsliches Anleihenportfolio schlichtweg uninteressant. Aufgrund der zu erwartenden Rendite ist die Tendenz stetig in Richtung einer höheren Aktienquote gegangen. Aktuell lassen sich im festverzinslichen Bereich Renditen von bis zu fünf Prozent erzielen und das bei relativ geringem Risiko, sodass sich viele Anleger fragen, ob eine minimal höhere Rendite das Aktienrisiko lohnt. Die langfristige Aktienrendite der letzten 100 Jahre lag bei rund acht Prozent, das entspricht einer Renditedifferenz von etwa drei Prozent. In Amerika zum Beispiel liegt die Aktien-Risikoprämie, bei der man die Gewinnrendite von Unternehmen mit zehnjährigen Staatsanleihen vergleicht, aktuell bei niedrigen 1,5 Prozent. Auch das spricht eher für den Anleihenmarkt.

98
HYPO TIROL BANK
Eine niedrige Aktien-Risikoprämie spricht in der Regel für eine gute Wirtschaftsprognose. Ist das Rezessionsszenario vom Tisch? Ehrlich gesagt bin ich auch ein wenig überrascht, weil die Wirtschaftsaussichten nicht sonderlich gut sind. Dass die Rezession vom Tisch ist, würde ich nicht sagen, im Gegenteil. Ich halte sie vor allem getrieben durch die hohen Zinsen sogar für sehr wahrscheinlich.
Die Europäische Zentralbank/EZB hat in Sachen Zinspolitik sehr spät reagiert, dann dafür sehr sprunghaft. Wie schätzen
Sie die weitere Entwicklung ein? Die Hoffnung, dass die Inflation schnell zurückgeht, ist mittlerweile wohl obsolet. Wir werden vermutlich weitere Zinsanhebungen sehen, das ist nicht ganz ungefährlich. Die amerikanische Federal Reserve zum Beispiel hat es historisch betrachtet nie geschafft, ein so genanntes Soft Landing hinzubekommen, und ich glaube, dass sie es auch dieses Mal nicht schafft. In Europa sind die Zinsen innerhalb eines Jahres um rund 3,5 Prozent gestiegen. Bis dies bei den Unternehmen auch im Privatbereich wirklich durschlägt, braucht es seine Zeit. Ich sehe also die Gefahr, dass die Zentralbanken diesen Verzögerungseffekt übersehen, das Zinsniveau zu spät beginnen zu stabilisieren und es zu einer Kettenreaktion kommt. Mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank haben wir ein erstes Ereignis der sehr restriktiven Geldpolitik gesehen. Die jüngsten Marktreaktionen gehen nun schon davon aus, dass die Fed ihren Zinsanhebungspfad beenden wird und wir zum Jahresende wieder einen tieferen Leitzins sehen. De facto preist der Markt weitere Kreditereignisse ein, sodass die Zentralbank schließlich gegensteuern muss, um das System zu stabilisieren. Es bleibt abzuwarten, ob wir ein solches Negativszenario sehen.
Wo würden Sie den Zinsplafond erreicht sehen? Das ist sehr schwer zu sagen, ich persönlich aber finde, dass die Zinsen mittlerweile hoch genug sind und es keine weiteren Zinsschritte benötigen würde. Auch manche Zentralbanker sind der Meinung, dass es seine Zeit braucht, bis die höhere Zinsbelastung bei den Unternehmen und Privaten ankommt und die Maßnahmen zu greifen beginnen.
Private Banking ist von Vertrauen getrieben und definiert sich stark über individuelle und ganzheitliche Beratung.
Ändert sich durch veränderte äußerliche Rahmenbedingungen auch der Beratungsbedarf? In schwierigen Marktphasen geht es vermehrt darum, die Kunden zu beruhigen und ihnen genau zu erklären, was die veränderten Bedingungen für sie bedeuten. Wir sprechen jedoch weitgehend von langfristigen Veranlagungshorizonten und in der Regel folgen auf negative Phasen wieder positive. Meist ist es so, und das zeigt sich auch aktuell, dass es nach ein paar Monaten zu einem Gewöhnungseffekt kommt, man sich mit der neuen Realität abfindet und wieder optimistisch(er) nach vorne blickt.
Die Hypo Tirol wird regelmäßig mit Auszeichnungen bedacht – unter anderem als „World’s Best Bank“ von Forbes oder dem Prädikat „summa cum laude“ vom Fachmagazin Elite Report. Sind solche Auszeichnungen reine Anerkennung für die nachhaltig-solide Arbeit oder haben diese tatsächlich Auswirkungen? Die Auszeichnung des Elite Reports ist tatsächlich eine große Ehre für uns. Dabei werden un-
ter anderem die Vermögensanalyse, das Research, die Anlagestrategie und die Rendite nach Kosten bewertet – anonym getestet von Mystery Shoppern. Von den heuer 53 empfehlenswerten Häusern im deutschsprachigen Raum haben nur sieben ihren Sitz in Österreich, wir sind die einzige Tiroler Bank, die in diesem Topsegment gelistet ist. Das ist ein echtes Qualitätssiegel.

99
„Vor zwei Jahren war der Anleihenmarkt kein interessantes Segment. Aktuell sind festverzinsliche Wertpapiere wieder stärker nachgefragt.“
GEORG FRISCHMANN
HYPO TIROL BANK AG Private Banking Meraner Straße 8 6020 Innsbruck Tel.: 050 700-7000 service@hypotirol.com www.hypotirol.com/privatebanking
HYPO TIROL BANK
Die Firma Immobilienmanagement Jenewein bietet ihren Kunden eine professionelle Rundumberatung von der Bewertung des Kaufpreises als Sachverständiger über eine sinnvolle und machbare Finanzierung bis hin zur treuhändigen Abwicklung an und steht für alle Fragen rund um die Immobilie jederzeit zur Verfügung.
ANGEBOT UND NACHFRAGE
Vom Verkäufer- zum Käufermarkt: Der Immobiliensektor erlebt turbulente Zeiten.
Wie nachhaltig die derzeitigen Veränderungen sein werden, wird sich zeigen.

INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Die Gemengelage aus anhaltend hoher Inflation, steigenden Zinsen und vor allem der neuen Verordnung der Finanzmarktaufsicht, die die Beschaffung von Wohnbaukrediten massiv erschwert, sorgt für eine schwierige Situation am Immobilienmarkt.
Um einen Kredit zu bekommen, braucht es nunmehr 20 Prozent Eigenmittel und die monatlichen Rückzahlungskosten dürfen 40 Prozent des Haushalts-Nettoeinkommens nicht übersteigen. Zudem wurde die Kreditlaufzeit auf 35 Jahre maximiert. „Kaufinteressenten, die sich bis vor einigen Monaten noch eine Immobilie leisten konnten, werden aufgrund dieser Verordnung nun nicht mehr finanziert. Zumindest bei älteren Menschen, deren Einkommenssituation zwar aufgrund des Pensionsantritts an Dynamik
verliert, die jedoch über Vermögen zur Absicherung verfügen, werden Aufweichungen vorgenommen“, erklärt Peter Jenewein. „Es sind herausfordernde Zeiten“, fügt er hinzu.
Peter Jenewein ist Gründer der Immobilienmanagement Jenewein mit Sitz in Innsbruck und verfügt über jahrzehntelanges, fundiertes Know-how am heimischen Immobilienmarkt. Mit Respekt vor dem starken Fundament des bisher Vollbrachten, dem Bekenntnis zur bisherigen Professionalität und dem ständigen Streben nach Verbesserung wird Tochter Anna, die bereits länger im Unternehmen tätig ist, in naher Zukunft die Geschicke des Immobilienbüros weiterführen. Mit der Übergabe geht der Relaunch des Logos sowie die Überarbeitung der Firmenbroschüre und Website einher. Auch einige innovative und kreative Ideen
sind bereit zur Umsetzung. Wir haben mit den beiden über die aktuelle Situation in der Branche gesprochen
ECO.NOVA: Lange Zeit folgten die Immobilienpreise einem steten, teils überdurchschnittlichen Aufwärtstrend. Wie ist die aktuelle Lage? PETER JENEWEIN: Wir standen lange vor der Problematik, dass aufgrund der Niedrigstzinsphase und der daraus resultierenden renditeschwachen Veranlagungssituation auf den Finanzmärkten vermehrt in Immobilien investiert wurde, auf der anderen Seite sind kaum Immobilien auf dem Markt zum Verkauf gekommen. Bei den meisten Immobilienbesitzern bestand keine Not zum Verkauf, was hätte man mit dem Verkaufserlös also alternativ Sinnvolles tun sollen? Nun beginnt
eco. geld 100
sich die Situation allmählich zu drehen. Das heißt, es kommen aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen immer mehr Immobilien auf den Markt, das Käuferpotenzial wird allerdings aufgrund der schwierigen Finanzierungssituation geringer. Was passiert ist, dass wir aktuell einen Käufer- und keinen Verkäufermarkt mehr vorfinden. Wir als Immobilienmanagement Jenewein haben aufgrund unserer langjährigen Marktpräsenz, unserer Netzwerke und qualitativ hochwertigen Arbeit ein breites Portfolio an gut verkaufbaren Immobilien. Für diese gilt es nun entsprechende Käufer zu finden, wohlwissend, dass die erzielbaren Preise nicht mehr so hoch sein werden wie noch vor einigen Monaten. Das müssen wir unseren Kunden auch deutlich sagen und erklären.
Findet am Immobilienmarkt aktuell damit auch eine Art Marktbereinigung und Preisregulierung statt? ANNA JENEWEIN: Wir haben in Tirol die besondere Situation, dass aufgrund der hiesigen Topografie nur sehr begrenzte Grundstücksressourcen zur Verfügung stehen. Das wird unserer Meinung nach die Grundstückspreise in Toplagen unabhängig von den aktuellen Entwicklungen steigen lassen. Die schlechteren Lagen werden stagnieren, am Sekundärmarkt, also bei gebrauchten Häusern und Wohnungen, werden die Preise nachgeben. Wir rechnen dabei mit Einbrüchen von zehn bis 20 Prozent, weil die Finanzierungsbedingungen derart verschärft wurden und gleichzeitig die Zinsbelastung steigt, sodass sich viele eine Finanzierung nicht mehr leisten können. Kurzum: Es kommen mehr Immobilien auf den Markt, die immer weniger Käufer finden, und der Preis gibt nach. Das ist das klassische Prinzip von Angebot und Nachfrage. PETER: Grundstücke werden immer rarer und auch wenn es hierzulande viele potente Bauträger gibt, die Grundstücke kaufen und bebauen, so wird es auch für sie immer schwerer, die Wohnungen zu verkaufen. Bauträger sind derzeit mit eklatant höheren Baukosten konfrontiert, was sich wiederum auf den Quadratmeterpreis der Wohnungen niederschlägt. Käufer, die solche Immobilien bislang gerne erworben haben, können sie sich nicht mehr leisten. Das ist schwierig. Ich sehe keine Immobilienblase auf uns zukommen wie seinerzeit in Amerika, weil die Voraussetzungen vor allem in Bezug auf die Besicherungen hierzulande ganz andere sind, aber es kann durchaus problematisch werden. Auch für die Banken. Nicht, weil Kredite nicht zurückge-
zahlt, sondern weil keine neuen mehr vergeben werden können. In manchen Instituten sind Wohnungsfinanzierungen um bis zu 75 Prozent zurückgegangen. Es drängt sich also die Frage auf, wie lange das auch die Banken noch aushalten können.
In Ihrem Portfolio finden sich auch durchaus luxuriöse Objekte. Schlagen die genannten Probleme auch hier durch? ANNA: Ehrlich gesagt weniger. Wir sehen, dass vor allem bei klassischen Drei- und Vierzimmerwohnungen die Käuferschicht dünner wird. Bei hochpreisigen Immobilien war die Käuferklientel schon immer recht überschaubar.
Mit welchem Gefühl schauen Sie in die Zukunft? PETER: Unsere Finanzierungsexperten sind der Meinung, dass uns die hohe Inflation noch die nächsten zwei, drei Jahre begleiten wird. Auch die Zinsen werden noch weiter steigen, ehe sie sich einzupendeln beginnen. Wir als Immobilienmakler sind gefordert, auf diese Schwankungen zu reagieren. Grundsätzlich ist die Investition in Sachwerte wie Immobilien jedoch immer noch eine gute Entscheidung. ANNA: Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden entsprechend zu beraten – auf Käuferseite vor allem in Finanzierungsfragen. Mein Vater und ich sind beide staatlich geprüfte Vermögensberater, das ist ein großer Vorteil. Wir verfügen zudem über ein breites Netzwerk an Banken und Finanzexperten, sodass wir vielfach Wege für eine solide, nachhaltige Finanzierung für unsere Kunden finden. Mit vielen dieser Experten arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten zusammen, sodass wir schon viele individuelle und maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte für unsere Kunden möglich machen konnten.
Außerdem arbeiten wir eng mit Rechtsanwälten und Notaren zusammen. Wir möchten unsere Kunden langfristig begleiten und sie auch nach dem Kauf oder Verkauf nicht alleine lassen. Ich sehe für die Immobilienbranche durchaus optimistisch in die Zukunft. Wie sich der Immobilienmarkt jedoch generell entwickelt, wird sich zeigen.

Nach einem regelrechten Boom der Vorsorgewohnungen nahm dieser in den letzten Jahren wegen niedriger Renditen etwas ab. Sind Vorsorgewohnungen bei Ihnen noch Thema? PETER: Natürlich. Vorsorgewohnungen sind nach wie vor ein sicheres Investment. In den vergangenen Jahren haben Immobilien eine enorme Wertsteigerung erfahren, auch wenn die Renditen selbst nicht wirklich hoch waren. Dennoch schafft man sich mit einer Vorsorgewohnung eine solide Basis für die Pension. Das wird auch so bleiben. ANNA: Selbst wenn man momentan vielleicht keine so hohe Rendite aus der Immobilie erwirtschaften kann, machen Vorsorgewohnungen absolut Sinn. Man bezahlt mit den Mieteinnahmen die Finanzierung zurück und kann in der Pension dann entweder ohne zusätzliche Wohnkosten selbst in der abbezahlten Immobilie leben oder man vermietet sie für ein zusätzliches Einkommen. Das Modell ist ein durchaus sinnvolles.
Eduard-Bodem-Gasse 8, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/26 82 82
office@immobilien-jenewein.at www.immobilien-jenewein.at
eco. geld 101
GMBH
IMMOBILIENMANAGEMENT JENEWEIN
Anna und Peter Jenewein
DIE STEUEROPTIMALE ANLEGERWOHNUNG
Hauptangelpunkt ist die Umsatzsteuer. Diese kommt immer dann ins Spiel, wenn der Kauf direkt von einem Bauträger erfolgt oder der Verkäufer seinerzeit bei der Herstellung oder Anschaffung der Immobilie einen Vorsteuerabzug geltend machen konnte. Ist dies der Fall, dann besteht die Wahlmöglichkeit zwischen einem umsatzsteuerfreien oder einem umsatzsteuerpflichtigen Erwerb. Letzteres hat zur Folge, dass auch die künftig erzielten Mieteinnahmen der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind. Das ist dann von Vorteil, wenn die daraus im Laufe der Zeit abzuführende Umsatzsteuer weniger ausmacht als die Ersparnis aus der beim Kauf geltend gemachten Vorsteuer.
Dies sei an folgendem Beispiel veranschaulicht: Eine Wohnung wird um 450.000 Euro angeboten. In diesem Preis stecken insgesamt 36.000 Euro an Umsatzsteuer, die der Bauträger für die Bauleistungen der Professionisten bezahlt hat. Dieser Betrag kann vom Finanzamt als Vorsteuer zurückgeholt werden, wenn der Bauträger seinerseits vom erzielten Verkaufspreis wiederum Umsatzsteuer an das Finanzamt bezahlt. In diesem Fall würde sich der Kaufpreis für den Anleger wie folgt darstellen: 450.000 Euro abzüglich darin enthaltene Umsatzsteuer aus Bauleistungen in Höhe von 36.000 Euro ergibt einen Nettokaufpreis von 414.000 Euro zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer in Höhe von 82.800 Euro. Letztere kann sich der Käufer wiederum vom Finanzamt als Vorsteuer zurückholen, womit er sich gegenüber dem gelisteten Preis von 450.000 Euro im Zeitpunkt des Kaufes 36.000 Euro spart. Im Gegenzug muss er von den Mieteinnahmen zehn Prozent Umsatzsteuer abführen. Bei einer Monatsmiete von durchschnittlich abgezinst 1.100 Euro kommt in 20 Jahren insgesamt ein Barwert von 24.000 Euro an Umsatzsteuern zusammen, womit die Gesamtersparnis 12.000 Euro beträgt. Zudem können die 36.000 Euro sofort lukriert werden und reduzieren somit die Finan-
zierungskosten, während die Gegenposition scheibchenweise über 20 Jahre verteilt anfällt. Weiters können von diesen laufend zu bezahlenden Umsatzsteuern auch Vorsteuern aus den laufenden Kosten (Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Steuerberaterkosten etc.) in Abzug gebracht werden. Neben diesen umsatzsteuerlichen Aspekten gilt es bei der Wahl der möglichen Kaufvarianten auch noch die Einkommensteuerbelastung zu optimieren. Dies gelingt durch Ansiedlung der Mieteinnahmen bei jemandem mit einem möglichst geringen Gesamteinkommen. Steuerideale Vermieter sind zum Beispiel studierende einkommenslose Kinder. Dies kann etwa mittels Fruchtgenusskonstruktion gelingen. Bei einem hohen Fremdkapitalanteil ist dies meist nicht notwendig, da sich die Steuerbemessungsgrundlage dann ohnehin stark reduziert.
WAS
BLEIBT NETTO VON DEN MIETEN?
Die gute Nachricht: Aufgrund der hohen Anschaffungskosten fällt die Steuerbelastung bei einem hohen Fremdkapitalanteil häufig wesentlich geringer aus, als man meinen möchte. Das funktioniert wie folgt:
ANLAGENABSCHREIBUNG (
AFA

) : Im 1. Jahr können 4,5 Prozent des auf den Gebäudeanteil entfallenden Investments steuermindernd angesetzt werden. Im zweiten Jahr sind es 3 Prozent und ab dem dritten Jahr 1,5 Prozent. Im angeführten Beispielfall bleiben so im ersten Jahr von den Einnahmen mehr als 10.000 Euro steuerfrei.
ZINSEN:
Rechnet man im angeführten Beispiel mit 80 Prozent Fremdkapital, so fallen nach Berücksichtigung von AfA und Zinsen überhaupt erst nach zehn bis 15 Jahren Steuern an. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren ergibt sich dann etwa im Jahr 15 bei einer Jahresmiete von angenommenen 17.000 Euro lediglich eine Steuer von 2.000 bis 3.000 Euro.
AUSBLICK:
Ist der Kredit nach 20 Jahren getilgt, kann mit Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen die Steuerbelastung weiterhin auch langfristig in Grenzen gehalten werden. Zudem kann nach Ablauf des Beobachtungszeitraumes von 20 Jahren bei Nettoumsätzen von maximal 35.000 Euro pro Jahr auf eine umsatzsteuerfreie Vermietung umgestellt werden.
102 eco. steuern
Die Ärztespezialisten vom Team Jünger: StB Mag. Dr. Verena Maria Erian und StB Raimund Eller
Bei der Anschaffung von Wohnraum als Geldanlage gibt es steuerlich einiges zu überlegen.
TEXT: VERENA MARIA ERIAN, RAIMUND ELLER
RISIKOVORSORGE
KUNDENSERVICE TIROL
T +43 512 5926 0, office.tirol.at@generali.com
UNS GEHT’S UM SIE
Dauer: 1 bis 2 Unterrichtseinheiten
FINANZBILDUNG
durch die Oesterreichische Nationalbank
Zielgruppe: 8. bis 13. Schulstufe sowie Berufsschulen


Themen: Bargeld & Zahlungsverkehr, Preisstabilität, Umgang mit Geld
Im kostenlosen Finanzbildungsprogramm Euro-Aktiv werden gemeinsam mit den Schüler:innen aktuelle Themen rund ums Geld erarbeitet. Bei allen Fragestellungen können die Jugendlichen ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen. Die Workshops finden in der OeNB WEST in Innsbruck in Kombination mit einer Führung durch die Ausstellung „Euro Cash“ statt. Sie können aber auch als Veranstaltung an der Schule gebucht werden.
Anmeldung unter regionwest@oenb.at. Weitere Informationen unter www.eurologisch.at
promotion 103
generali.at Anzeige
IM ERNSTFALL VERSORGT.
Entgeltliche Information
GRENZÜBERSCHREITENDES
HOMEOFFICE: STEUER- UND SV-RECHTLICHE ASPEKTE
Bedingt durch die Aufforderung zum „Social Distancing“ während der COVID-19Pandemie, haben sich Arbeits- und Organisationsstrukturen verändert. Homeoffice ist mittlerweile zum fixen Bestandteil der neuen Arbeitswelt geworden. Viele Unternehmen verfügen daher bereits über eine Homeoffice/Mobile Working Policy. Denn beim Thema Global Mobility geht es längst nicht mehr nur um die klassische Entsendung, sondern um die von Anglizismen geprägte „Remote-Welt“, in der hybride Arbeitsmodelle, „Work-from-Anywhere“ (auch bekannt als digitales Nomadentum), Workations und Jobbaticals in aller Munde sind.

104
TEXT: CAROLINE AMANN AICHNER, CLAUDIA RIECKH RUPP
Am derzeitigen Arbeitnehmermarkt erweitern flexible Arbeitsmodelle das Rekrutierungsspektrum und können als Instrument zur Mitarbeiterbindung eingesetzt werden. Viele Arbeitnehmer schätzen die örtliche Flexibilität – kombiniert mit der zeitlichen, führt die Reduktion von Arbeitsweg und Bürozeiten doch zu mehr Freizeit sowie Zeit für Familie und Freunde. Doch was bedeutet die Zunahme von Auslands-Tätigkeitssachverhalten für die Unternehmen? Worauf ist bei der Bezugsabrechnung hinsichtlich Lohnsteuer, Sozialversicherung und Lohnnebenkosten zu achten?
Leider halten die gesetzlichen Regelungen nicht Schritt mit den digitalen Möglichkeiten und der sich verändernden Arbeitswelt. Die coronabedingt eingeführten Sonderregelungen (Konsultationsvereinbarungen mit Österreichs Nachbarstaaten bzw.
Leider halten die gesetzlichen Regelungen nicht Schritt mit den digitalen Möglichkeiten und der sich verändernden Arbeitswelt. Daher ist es wichtig, vorab mit Ihrem Steuerberater zu klären, ob und wie das vertragliche Set-up bei Homeoffice-Lösungen gestaltet werden kann.
Ausnahmebestimmungen für die Sozialversicherung) sind mittlerweile ausgelaufen. Je nach Dauer und Destination können Betriebstätten- bzw. Lohnsteuerrisiken im Ausland begründet werden. Daher ist es wichtig, vorab mit Ihrem Steuerberater zu klären, ob und wie das vertragliche Set-up gestaltet werden kann. Je flexibler das Arbeitsmodell, desto schwieriger ist es, „compliant“ zu bleiben. Unreguliertes „Work-from-Anywhere“ ist aus Compliancesicht ein Albtraum. Das Arbeiten mit Onlinetools zur Aufzeichnung der Arbeitstage ist daher fast ein Muss. Die Frage der Sozialversicherungszuständigkeit ist ebenso nicht außer Acht zu lassen. Hat sie doch Auswirkungen über die medizinische Versorgung hinaus, sei es die Frage, welcher Staat für Familienleistungen zuständig ist bzw. nach welchem Recht später Pensionsleistungen gewährt werden.
STEUERRECHTLICHE ASPEKTE
Im grenzüberschreitenden Bereich führt Homeoffice zu steuerlichen Auswirkungen, welche Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen betreffen.
Seitens des Arbeitnehmers ist die steuerliche Ansässigkeit grundsätzlich ausschlaggebend für die Besteuerung des Welteinkommens. Eine kurzfristige Tätigkeit bis maximal 183 Tage pro Jahr im Ausland schadet im Regelfall nicht, solange das Entgelt weiterhin vom österreichischen Arbeitgeber bezahlt wird. Aber Achtung: Je nach Doppelbesteuerungsabkommen wird auf das Kalenderjahr, Steuerjahr bzw. einen Zwölfmonatszeitraum abgestellt. Ob das Besteuerungsrecht in Österreich verbleibt, ist daher immer anhand des konkreten Doppelbesteuerungsabkommens zu überprüfen. Liegt der Hauptwohnsitz des Arbeitnehmers im Ausland, führt die Homeoffice-Tätigkeit in diesem Staat allerdings zur dortigen Besteuerung; die 183-Tage-Regelung kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung.
Aus Sicht des Arbeitgebers ist zu beachten, dass abhängig von Art und Dauer der Tätigkeit des Arbeitnehmers das Risiko besteht, eine Betriebsstätte im Ausland zu begründen. In diesem Fall hat der Betriebsstättenstaat – der Staat, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird – das Recht, den Betriebsstättengewinn zu besteuern. Unternehmen sehen sich in diesem Zusammenhang der Herausforderung ausgesetzt, das Vorliegen steuerlicher Betriebsstätten prüfen zu müssen. Außerdem muss im Tätigkeitsstaat mit der Konsequenz der Verpflichtung zur Lohnsteuerabfuhr gerechnet werden.
Bei der Begründung einer Betriebsstätte ist zwischen Inbound-Fällen (Homeoffice in Österreich) und Outbound-Fällen (Homeoffice im Ausland) zu unterscheiden. Während für die Zeit der COVID-19-Pandemie („höhere Gewalt“) durch Homeoffice-Tätigkeiten eines in Österreich ansässigen Arbeitnehmers keine Betriebsstätte begründet wurde, da weder Beständigkeit noch Kontinuität vorhanden waren, gilt nun wieder eine niedrige Betriebsstätten-Schwelle, nach der die Privatwohnung eines Arbeitnehmers eine Betriebsstätte für dessen Arbeitgeber begründen kann (Einzelfallprüfung!). Beim Betriebsstätten-Risiko-Check im Ausland ist Fingerspitzengefühl gefragt. Zur Beantwortung der Frage, ob eine Homeoffice-Tätigkeit zu einer Betriebsstätte führt, sind die ausländischen nationalen Rechtsvorschriften heranzuziehen. Je nach Jurisdiktion wird dies sehr unterschiedlich ausgelegt. So wird etwa darauf abgestellt, ob die Initiative für die Homeoffice-Tätigkeit von Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ausgeht und welche Tätigkeiten im Homeoffice erledigt werden.
Bei Inbound-Fällen ist ein Lohnsteuerabzug für den ausländischen Arbeitgeber nur verpflichtend, wenn im Inland eine (Lohnsteuer-)Betriebsstätte besteht. Der Lohnsteuerabzug kann jedoch freiwillig erfolgen. Macht der ausländische Arbeitgeber

105 eco. steuern
vom freiwilligen Lohnsteuerabzug nicht Gebrauch, so hat er dem Finanzamt bis Ende Februar des Folgejahres eine Lohnbescheinigung zu übermitteln, wenn der Arbeitnehmer seinen Mittelpunkt der Tätigkeit für mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in Österreich hat und unbeschränkt steuerpflichtig ist. Bei Outbound-Fällen ist zu prüfen, ob lokal ein Lohnsteuerabzug vorgenommen werden muss.
Erfolgt eine parallele Tätigkeit im In- und Ausland, so sehen die Doppelbesteuerungsabkommen in der Regel eine Aufteilung des Besteuerungsrechts zwischen den beiden Staaten entsprechend der Anzahl der Arbeitstage vor. Diesbezüglich ist der Arbeitnehmer anzuleiten, die Arbeitstage schriftlich aufzuzeichnen. Im jeweiligen Ausland ist abzuklären, wie die Steuer für die Auslandstage abzuführen ist. Die Tätigkeitstage im Inland sind in der Lohnverrechnung zu erfassen. Fallen in einem Monat sowohl Tätigkeitstage in Österreich als auch Homeoffice-Tage im Ausland an, ist für die Besteuerung der in Österreich anteilig zu versteuernden Bezugsteile die Tageslohnsteuertabelle heranzuziehen. Gleichzeitig kann in der österreichischen Lohnverrechnung eine Lohnsteuerfreistellung für die Homeoffice-Arbeitstage vorgenommen werden.
SV - RECHTLICHE ASPEKTE
Gemäß den Grundprinzipien des EU-Sozialversicherungsrechts kann für eine Person zu jedem bestimmten Zeitpunkt nur das So-


zialversicherungsrecht eines Landes gelten. Grundsätzlich kommt das Territorialitätsprinzip zur Anwendung: Eine Person unterliegt dem Sozialversicherungsrecht jenes Landes, in dem sie ihre Beschäftigung ausübt. Aufgrund des Appells an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben, wurde Homeoffice für die Zeit der COVID-19-Pandemie jedoch vorübergehend zum Regelfall. Dementsprechend wurden kurzzeitig Sonderregelungen für grenzüberschreitende Telearbeit geschaffen, so dass sich die Zugehörigkeit zur Sozialversicherung eines Staates durch grenzüberschreitendes – pandemiebedingtes – Homeoffice nicht ändert. Diese COVID-Sonderregelungen sind bis zum 30. Juni 2023 unverändert anwendbar, jedoch nur insoweit, als im Homeoffice auf Grund oder durch Corona gearbeitet wurde.
Ab dem 1. Juli 2023 führt grenzüberschreitendes Arbeiten im Homeoffice jedenfalls wieder zu einer Änderung der Sozialversicherungs (SV)-Zuständigkeit, wenn ein wesentlicher Teil – dies sind gemessen an Arbeitszeit und/oder Einkom-
men mindestens 25 Prozent der Gesamttätigkeit – im Homeoffice erledigt wird. Um der geänderten Arbeitswelt Rechnung zu tragen, hat die EU-Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit einen Leitfaden zur Telearbeit veröffentlicht. Im Leitfaden definiert die Verwaltungskommission die grenzüberschreitende Telearbeit (Homeoffice) als Arbeitsleistung, die außerhalb der Arbeitsstätte bzw. des Betriebsgeländes, in einem anderen EU-Mitgliedstaat als jenem der üblichen Arbeitsstätte, sowie unter Einsatz von Informationstechnologie (um mit der Arbeitsumgebung des Unternehmens und anderer Beteiligter bzw. mit Kunden verbunden zu bleiben) erbracht wird. Die Telearbeit muss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden und darf ausschließlich Leistungen umfassen, die der Arbeitnehmer üblicherweise am Arbeitsplatz erbringt.
Im Hinblick auf die im Leitfaden zur Telearbeit angeführte Möglichkeit, bilaterale Ausnahmevereinbarungen für bestimmte Personengruppen zu schließen, hat das in Österreich für die Ausnahmevereinbarungen zuständige Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Sozialversicherungen Initiativen zum Abschluss derartiger Vereinbarungen ergriffen. Derzeit gibt es bereits eine solche Rahmenvereinbarung mit Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Diese Rahmenvereinbarungen ermöglichen in Fällen mit einer gewöhnlichen wiederkehrenden grenzüberschreitenden Telearbeit bis maximal 40 Prozent die Zuständigkeit des Mitgliedstaates, in dem der Arbeitgeber den Sitz hat, so dass der Wohnsitzstaat des Grenzgängers nicht zuständig wird. Ein Antrag auf Ausnahmevereinbarung ist bei der zuständigen Stelle des Staates zu stellen, dessen Rechtsvorschriften anwendbar sein sollen (in Österreich beim Dachverband der Sozialversicherungen). An weiteren Vereinbarungen mit anderen EU-Mitgliedsstaaten wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. www.deloitte.at/tirol
eco. steuern
Mag. Claudia Rieckh-Rupp, Steuerberaterin und Director, und MMag. Dr. Caroline Amann-Aichner, LL.M. (WU), Tax Consultant bei Deloitte Tirol
Je flexibler das Arbeitsmodell, desto schwieriger ist es, unternehmensund gesetzeskonform zu bleiben.
106
Unreguliertes „Work-from-Anywhere“ ist aus Compliancesicht ein Albtraum.
NACHHALTIGKEIT – WAS BEDEUTET DAS EIGENTLICH?
Seit dem Green Deal der Europäischen Union und dem wachsenden Bewusstsein der Menschen für Umweltschutz hat sich Nachhaltigkeit zum Modewort entwickelt und ist auch aus der Kommunikation der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken.
Nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Produktion und nachhaltige Produkte. Schlagworte sind des Marketings Freund und des Juristen Feind. Denn es kommt darauf an – so ist man es von Jurist*innen gewohnt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir uns auch nicht immer ganz sicher, was der positiv besetzte Begriff Nachhaltigkeit in einem konkreten Fall bedeutet oder bedeuten soll. Deshalb an dieser Stelle eine kurze juridische Spurensuche.
Im analogen Zeitalter hätte man noch zum Duden gegriffen und dort erfahren, dass Nachhaltigkeit das Prinzip ist, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf als jeweils nachwachsen, regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Nun werden Unternehmen durch EU-Richtlinien zu sogenannten Nachhaltigkeitsberichten verpflichtet, die deren Engagement für Umwelt-, Sozial- und Menschenrechte sowie die Rolle der Führungsorgane samt Unternehmensethik dabei auflisten sollen.
Auch in der sogenannten Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union ist die Nachhaltigkeit zentrales Thema. Ziel dieser Verordnung ist es, Investitionen in Richtung nachhaltiger Projekte und Aktivitäten zu lenken. Dazu werden Kriterien aufgestellt, wann eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Das läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass von Unternehmen Ziele wie Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und Ökosysteme sowie Übergang zur Kreislaufwirtschaft verfolgt und diese Umweltziele durch die Wirtschaftstätigkeit

nicht erheblich beeinträchtigt werden. Diese Vielschichtigkeit zeigt, dass es zwar im geschlossenen System der Taxonomie-Verordnung möglich ist, den Begriff „ökologisch nachhaltig“ für diese Zwecke zu definieren, darüber hinaus ist jedoch rechtlich Vorsicht geboten.
Das betrifft im Besonderen die Verwendung von Nachhaltigkeitsbehauptungen in der Unternehmenskommunikation, hier vor allem in der Werbung. Gemäß dem lauterkeitsrechtlichen Irreführungsverbot müssen Behauptungen zum Umweltschutz wahr sein, dürfen keine falschen Informationen enthalten und die Informationen müssen klar, spezifisch, genau und eindeutig formuliert werden. Die Gefahr, dass Behauptungen zum Umweltschutz irreführend sind, ist hoch, wenn sie auf ungenauen und allgemeinen Aussagen zum Umweltschutz beruhen, ohne dass ein Umweltnutzen angemessen belegt wird und ohne Angabe des einschlägigen Merkmals des Produkts, der Produktion
oder des Unternehmens. Damit sind Behauptungen wie „umweltfreundlich“, „grün“, aber eben auch „nachhaltig“ ohne weitere Information und Erklärung rechtlich problematisch. So hat auch ein Oberlandesgericht in Deutschland bereits zu der schlichten Aussage „nachhaltige Verpackung“ entschieden, dass derartige Aussagen in ihrer Allgemeinheit rechtswidrig sind, da sie vollkommen offenlassen, in welcher Hinsicht die Verpackung nachhaltig sein soll.
Wirtschaftsprozesse sind stark strukturiert und von einem hohen Komplexitätsgrad geprägt. Damit stellt sich die Frage nach den Bezugspunkten einer Nachhaltigkeitsbehauptung: Beginnt diese bei der Gewinnung der Rohstoffe und endet bei der Entsorgung eines Produkts? Ist damit die Abmilderung eines bestehenden Eingriffs in die Umwelt oder eine echte Kreislaufwirtschaft gemeint? Ist es also eine relative Verbesserung oder eine absolute Behauptung? Wird ein Effekt durch Ausgleichsmaßnahmen oder tatsächlich im Unternehmen gemachte Einsparungen und Verbesserungen erzielt? Was versteht die durchschnittliche Adressat*in davon?
Es kann viel hinter dem Wort Nachhaltigkeit stecken oder auch versteckt werden. Dadurch kann die Verwendung von Nachhaltigkeitsbehauptungen mit rechtlichen Risiken behaftet sein. Aber nicht nur die Wirtschaft, sondern wir alle tun gut daran, im Bereich des Umweltschutzes nicht mit Schlagworten zu operieren, die in Wahrheit die Umstände nicht ausreichend informativ benennen. Hinter der proklamierten Nachhaltigkeit können sich ernsthafte Bemühungen um umweltgerechtes Wirtschaften genauso verbergen wie ein grünes Mäntelchen für an sich nicht umweltgerechte Vorgänge, bekannt als Greenwashing.
107 eco. recht
TEXT: IVO RUNGG, BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE, INNSBRUCK
Dr. Ivo Rungg
DER SPAGAT ZWISCHEN FAMILIE UND ARBEIT
Elternteilzeit: Arbeitsstunden verkürzen und/oder die Lage der Arbeitszeit verschieben – so geht’s.

108
TEXT: DR. ESTHER PECHTL SCHATZ
Die Bewältigung von Arbeit und Kinderbetreuung gestaltet sich im Alltag häufig schwierig. Um Eltern hier zu entlasten, besteht die Möglichkeit, Elternteilzeit zu beantragen. Mit der Elternteilzeit kann ein Dienstnehmer/ eine Dienstnehmerin die Arbeitsstunden reduzieren bzw. die Lage der Arbeitszeit verändern. Es ist auch beides gleichzeitig möglich. Während der Elternteilzeit genießt der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin Kündigungs- und Entlassungsschutz bis längstens vier Wochen nach dem Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes.
GESETZLICHER ANSPRUCH
AUF ELTERNTEILZEIT
Diesen haben sowohl Mütter als auch Väter bis zum siebten Geburtstag ihres Kindes bzw.
bis zu einem allfällig späteren Schuleintritt. Dabei müssen die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
• Der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin lebt mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt oder ist obsorgeberechtigt.
• Im Betrieb, in dem er/sie beschäftigt ist, gibt es mehr als 20 Arbeitnehmer.
• Der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin ist bereits seit drei Jahren ununterbrochen im Betrieb beschäftigt.
• Die wöchentliche Normalarbeitszeit wird um mindestens 20 Prozent reduziert, wobei sie aber mindestens zwölf Stunden pro Woche beträgt (sogenannte „Bandbreite“).
Der Beginn und die Dauer der Teilzeitbeschäftigung sowie das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit sind mit dem Dienstgeber zu vereinbaren. Dabei sind sowohl die Interessen des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin als auch die betrieblichen Interessen zu berücksichtigen.
VEREINBARTE TEILZEITBESCHÄFTIGUNG
Erfüllt der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin eine der Voraussetzungen nicht, hat er/sie immer noch die Möglichkeit, eine entsprechende Vereinbarung mit dem Dienstgeber zu treffen, in der der Beginn, die Dauer, das Ausmaß und die Lage der Teilzeitbeschäftigung bis zum vierten Geburtstag des Kindes geregelt werden. Auch hier muss sich die normale wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 20 Prozent reduzieren, sie darf ebenfalls ein Ausmaß von zwölf Stunden pro Woche nicht unterschreiten. Auch in diesem Fall besteht ein Kündigungs- und Entlassungsschutz.
Die Elternteilzeit kann von beiden Elternteilen auch gleichzeitig in Anspruch genommen werden, dies jeweils aber nur einmal pro Kind. Der andere Elternteil darf sich während dieser Zeit nicht gleichzeitig für dasselbe Kind in Karenz befinden.
FRISTEN
Abhängig davon, wann der Dienstnehmer/ die Dienstnehmerin die Elternteilzeit in Anspruch nehmen möchte, gibt es unter-
schiedliche Fristen, die beachtet werden müssen:
Eine Dienstnehmerin, die unmittelbar nach der gesetzlichen Schutzfrist nach der Geburt des Kindes die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen möchte, muss dies innerhalb des Beschäftigungsschutzes bekanntgeben. Der Vater hat hierfür bis zu acht Wochen nach der Geburt Zeit. Wird die Elternteilzeit im Anschluss an die Karenz bevorzugt, muss die Bekanntgabe spätestens drei Monate vor dem Wiedereinstieg erfolgen. Soll die Teilzeitbeschäftigung erst zu einem späteren Zeitpunkt greifen, ist dies dem Dienstgeber spätestens drei Monate vor dem geplanten Beginn bekanntzugeben.
Kommt zwischen dem Dienstnehmer/ der Dienstnehmerin und dem Dienstgeber innerhalb von vier Wochen keine Einigung zustande, kann der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin die Elternteilzeit zu den von ihm/ihr vorgeschlagenen Bedingungen antreten, es sei denn, der Dienstgeber bringt innerhalb von zwei weiteren Wochen eine Klage bei Gericht ein.
DR. ESTHER PECHTL- SCHATZ Gerne stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite, um praktikable und schnelle Lösungen für Ihre Probleme zu finden. Wir unterstützen Sie umfassend und persönlich. Terminvereinbarung unter 05412/63 030 oder imst@anwaelte.cc www.anwaelte.cc


109 eco. recht
Der Beginn und die Dauer der Teilzeitbeschäftigung sowie das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit sind mit dem Dienstgeber zu vereinbaren.
MOBILITÄT
Jugend forscht
Eine Berufsausbildung bei Audi zu machen, heißt auch, bei spannenden Projekten mitmachen zu können. Im Zuge eines Azubiprojektes wurde unter anderem ein serienmäßiger RS6 von zwölf Auszubildenden im dritten Lehrjahr (aus den Berufen Karosseriebau, Kraftfahrzeugmechatronik, Fahrzeuglackiererei und Werkzeugmechanik) in mehreren Monaten zu ihrem ganz persönlichen RS6 GTO umgebaut. Viele der individuellen Bauteile kommen dabei aus dem 3-D-Drucker in Ingolstadt. Das Ergebnis ist ein Auto, das die legendäre Rennsportgeschichte des Audi 90 quattro IMSA-GTO mit modernem Vierringedesign verbindet. Mit seinem schmalen Körper und den breiten Backen zeichnet sich der Klassiker durch Athletik, Emotion und Progressivität aus. Was das Ganze mit Tirol zu tun hat? Der Sportler wurde für ein stilechtes Foto extra nach Innsbruck gefahren – konkret in die Dogana im Congress, wo er perfekt in Szene gesetzt wurde.

110
auto & motor
CHARAKTERLING
Schon in der Optik seines EV9 zeigt Kia Ecken und Kanten und selbst wenn das progressive Design nicht jedermanns Sache sein wird, finden wir den Schritt hin zu mehr eigenständigem Charakter gut. Keine Frage: Der neue Stromer soll zum neuen Kia-Flaggschiff werden. Zugleich ist er das erste dreireihige Elektro-SUV der Marke mit dem angenehmen Feature, dass die Sitze der ersten und zweiten Reihe im Stand umgelegt werden können, sodass man während des Ladevorgangs bequem im Auto entspannen kann. Und auch sonst präsentiert sich der Innenraum geräumig, hell und luftig. Seine Weltpremiere hat der EV9 Ende März gefeiert. Zu Redaktionsschluss gab's deshalb noch kaum Infos zu technischen Daten.

GIRLPOWER
Nebst dem Stelvio hat Alfa Romeo für das neue Modelljahr auch seiner Giulia ein Upgrade spendiert. Markantestes optisches Merkmal ist das neue Design der Scheinwerfer, die großteils dem Tonale angepasst wurden. Neuerungen gibt es auch in Sachen Technologie, die vor allem eine Steigerung in puncto Komfort und Konnektivität bringt, sowie beim Infotainment-System, das noch leistungsfähriger wurde. Die Fahrdynamik ist und bleibt Alfa-typisch vorbildlich, denn selbst wenn sich Stil und Technologie ständig weiterentwickeln, so bleibt man auch in der Neuauflage der Marken-DNA treu, die seit 1910 für italienische Sportlichkeit steht. Ab 46.900 Euro.

NA BUMM
TRÈS CHIC
2019 war der DS 3 Crossback (nach dem DS 7 Crossback) das zweite eigenständige Modell der Premiummarke aus dem Stellantis-Konzern. Vor wenigen Monaten stellte DS Automobiles den mit verschlanktem Namen auftretenden neuen DS 3 samt umfangreichen technischen und optischen Updates vor. Nun kommt der vom Pariser Luxus inspirierte Franzose angerollt. Der DS 3 profitiert vor allem in der elektrischen E-Tense-Version vom stärkeren E-Motor mit nunmehr 156 PS (vorher 135 PS) und einer Reichweite von bis zu 404 Kilometern laut WLTP. Eingestiegen wird bei rund 43.000 Euro.

Der neue M2 von BMW bietet M-typische Performance in besonders konzentrierter Form. Heißt in Daten: 460-PS-Reihensechszylinder (und damit satte 90 PS mehr als die Basismotorisierung des Vorgängers), maximales Drehmoment von 550 Nm, 4,1 Sekunden von null auf hundert und 250 km/h Höchstgeschwindigkeit. Dabei ist der Bayer in jeder Lebenslage souverän. Dem Untendrunter wird auch die Optik mit ihren athletischen Coupé-Proportionen vollumfänglich gerecht. Sehen lassen kann sich indes auch die Ausstattungsvielfalt, die in Sachen Komfort und Sicherheit bereits vieles in Serie mit an Bord hat. Produziert wird der Schönling gemeinsm mit dem neuen BMW-2er-Coupé im mexikanischen BMW-Werk in San Luis Potosí. Die weltweite Markteinführung beginnt im April, der Einstiegspreis wird bei rund 73.000 Euro vermutet.

eco. mobil 111 ©
MARKETING
SCHLOSS
„Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung.“
FOTOS (WENN NICHT ANDERS VERMERKT): HERSTELLER
PAOLO COELHO, SCHRIFTSTELLER
KULTIGE NEUAUFLAGE
Es gibt wohl kaum einen Wagen, der selbst Laien so aufschauen lässt wie der legendäre VW Bulli.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE

Der legendäre Bulli von VW wird elektrisch und heißt jetzt ID.Buzz. Angesichts der aktuellen Geschehnisse in Politik und Recht ist es nachvollziehbar, dass sich auch VW mit einem Elektro-Bus frühzeitig am Markt positionieren will, bevor auf EU-Ebene das Aus der Verbrennermodelle tatsächlich Wirklichkeit wird.

it seiner ikonischen Kastenwagenform, der klassischen Zweiton-Lackierung und dem geräumigen Innenraum hat der VW Bulli mittlerweile Kultstatus auf Österreichs Straßen. So ist es kaum verwunderlich, dass zwischenzeitlich dessen siebte Generation vom Band läuft. Doch nun erkennt auch VW den Trend und bringt den Bulli – zusätzlich zum aktuellen T7 – vollkommen neuinterpretiert auf den Markt. Wir dürfen vorstellen: der VW ID. Buzz – zwar ein Bulli, aber vollkommen elektrisch.
ELEKTRISCH ANGETRIEBEN
Angesichts der aktuellen Geschehnisse in Politik und Recht ist es nachvollziehbar, dass sich auch VW mit einem Elektrobus frühzeitig am Markt positionieren will, bevor laut aktueller Lage auf EU-Ebene das Aus der Verbrennermodelle 2035 tatsächlich Wirklichkeit wird.

Angetrieben wird der Pro folglich von einem Elektromotor mit einer Maximalleistung von 204 PS (150 kW), wodurch ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern generiert werden kann. Über ein 1-Gang-Automatikgetriebe gelangt die Leistung zu den beiden Hinterrädern, die es schaffen, das rund 2,5 Tonnen schwere Gefährt in knapp über zehn Sekunden auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen. Schluss ist bei 145 km/h. Wirklich mehr braucht es auch nicht, leidet daran doch ausschließlich die Reichweite und die fällt mit 417 Kilometern nach WLTP ohnehin nicht übermäßig hoch aus. Für den alltäglichen Stadtverkehr – in dem sich der 4,7 Meter lange ID. Buzz übrigens dank einem Wendekreis von gerade einmal 11,1 Metern ausgezeichnet schlägt – langt aber auch das allemal. Ist die 77-kWh-Batterie leer, lässt sie sich dank einer beacht-

lichen maximalen Ladeleistung von bis zu 170 kW in gerade einmal 30 Minuten von fünf auf 80 Prozent aufladen. Dafür gibt es mächtig Pluspunkte.
HOMMAGE AN EIN KULTMODELL
Während der Antrieb vielerorts Zustimmung findet, scheiden sich in Sachen Design die Geister. Der eine findet das Konzept super und erfreut sich an der dynamischen Linienführung, der andere sieht in dem Modell eher ein verwirklichtes Kinderspielzeug. Welcher Seite man sich auch immer zugehörig fühlt, einer Tatsache kann man sich kaum verschließen, nämlich der offensichtlichen Ähnlichkeit zum Kultmodell von 1950. Angefangen bei der klassischen Zweiton-Lackierung – hier in Weiß/Grün Metallic – über die stark abfallende Schnauze bis hin zur Karosserieform. Diese ergänzen in Kombination mit den auffälligen optionalen IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfern mit automatischer Fahrlichtschaltung, den 19-Zoll-Felgen und der durchgehenden LED-Rückleuchte das bekannte und doch vollkommen eigenständige Außendesign des neuen ID. Buzz. Vollendet wird es schließlich von zahlreichen aus der ID-Familie bekannten Zierelementen wie jenen am vorderen Stoßdämpfer.
VIEL PLATZ
Der Innenraum besticht bereits auf den ersten Blick mit geräumigen Platzverhältnissen, sowohl in der ersten und zweiten Sitzreihe als auch im Fond des Fünfsitzers. Varianten mit mehr Sitzen sollen folgen. Insgesamt 1.121 Liter fasst das Ladeabteil des ID. Buzz, bei umgeklappter Sitzreihe sind sogar 2.123 Liter füllbar. Sollte selbst das nicht reichen, ist das Dach des 1,95 Meter großen Wagens mit bis zu 100 Kilogramm zusätzlich belastbar.
Platz genommen werden kann im Cockpit auf stoffbezogenen, elektrisch verstellbaren Sitzen mit jeweils zwei Armlehnen und Sitzheizung. Passend zum schwarz gehaltenen Multifunktionslenkrad mit Touchbedienung sind auch das 10-Zoll-Infotainmentdisplay über der herausnehmbaren Mittelkonsole ID. Buzz-Box sowie die zentralen Bedienungselemente in Schwarz eingefasst. Das Infotainmentsystem besteht aus besagtem Display, neun gut verteilten Lautsprechern, Sprachbedienung sowie der Mobiltelefon-Ablage mit induktiver Ladefunktion. Dank App-Connect wireless bietet der ID. Buzz auch umfassende Möglichkeiten in Sachen Konnektivität.
ÄUSSERST KOMFORTABEL
Der Haupteinsatzort des ID. Buzz dürfte der städtische Bereich sein, ist die Reichweite für gediegene Ausflüge in die Ferne wohl noch ein wenig zu gering. Machbar sind sie dank der äußerst kurzen Ladedauer aber allemal und das auch durchaus komfortabel. Denn fahren lässt sich der ID. Buzz Pro wirklich ausgesprochen harmonisch. Dies ist nicht nur der agilen Lenkung, sondern vor allem dem ruhigen Fahrverhalten auch bei schneller Fahrt geschuldet. Im Ergebnis macht der ID. Buzz ausgesprochen Freude beim Fahren und dürfte in Zukunft häufiger auf Österreichs Straßen zu sehen sein. Einziges „Schlagloch“ könnte noch der Preis sein: Der fällt mit mindestens 70.863 Euro auffallend hoch aus. Das Testmodell bringt es sogar auf 83.990 Euro. Den ein oder anderen dürfte auch das nicht aufhalten, schließlich bekommt man auch was für sein Geld.
Gemacht für Großes
Ein völlig neues Raumkonzept, das Bedienkomfort, der alles ganz einfach
Stromverbrauch (kombiniert): 17,2
2-Emission: 0 g/km. Symbolfoto.
Antrieb: Heck
Leistung: 150 kW/204 PS
Drehmoment: 310 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 10,2 sec
Spitze: 145 km/h
Verbrauch: 21 kWh/100 km (lt. WLTP)
Spaßfaktor: 8,5 von 10
Preis Testwagen: 83.990 Euro
eco. mobil 114
VW ID. BUZZ PRO
Horizont erweitert –um bis zu 600 km.
Die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle.

ID.4 Pro Performance 150 kW
Bis zu 522 km Reichweite
Bis zu 125 kW Ladeleistung
Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden
Jetzt Probe fahren
Jetzt bei uns Probe fahren.
das Ihnen Freiheit schenkt. Elektrische Performance, die begeistert. Und intuitiver einfach macht. Der neue ID.4: stark wie ein SUV, nachhaltig wie ein ID.
17,2 – 18,5 kWh/100 km. Symbolfoto. Stand 01/2021.
Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 19,7 – 25,6 (WLTP); CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Symbolfoto. Stand 02/2023.
Porsche Innsbruck-Haller Strasse | Haller Straße 165, 6020 Innsbruck, www.porscheinnsbruck.at
Porsche Innsbruck-Mitterweg | Mitterweg 26-27, 6020 Innsbruck, www.porscheinnsbruck.at
Porsche Wörgl | 6300 Wörgl, Innsbrucker Straße 59, www.porschewoergl.at
Porsche Kufstein | 6330 Kufstein, Rosenheimer Straße 11, www.porschekufstein.at
Porsche St. Johann | 6380 St. Johann in Tirol, Birkenstraße 18, www.porschestjohann.at
CROSSOVER-FACELIFT
Rund dreieinhalb Jahre nach Vorstellung im Jahr 2019 erhält der XCeed, das Crossover von Kia, sein Facelift. Neu sind nicht nur das knackig aufgefrischte Design oder die akzentreichen Leuchten, sondern insbesondere die Einführung der athletischen GT-Line in die Modellpalette, die bei uns kürzlich zum Test antrat.

116
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Eines lässt sich schon zu Beginn festhalten: Kia scheint am Design seines Crossovers Gefallen gefunden zu haben, behält doch auch die Neuauflage die Formgebung im Wesentlichen bei. Änderungen werden ausschließlich am Kühlergrill, den Leuchten sowie am Diffusor vorgenommen, die vor allem bei der GT-Line-Variante extra hervorgehoben werden. So zeigt nicht nur der Tigernasen-Kühlergrill mitsamt zahlreichen Lufteinlässen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen ein leicht verändertes, sportlicheres Bild, sondern auch der in Wagenfarbe gehaltene Diffusor – in unserem Fall im knalligen Grün. Darüber hinaus erhält die GT-Line 18-Zoll-Leichtmetallräder in einem eigens angefertigten Design.
Angetrieben wird das schicke, farbenfrohe Crossover im konkreten Fall von einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodieselmotor, der von einem 48-Volt-Mildhybridsystem unterstützt wird und so eine Systemleistung von 136 PS (100 kW) sowie ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern ermöglicht. Zugegeben, angesichts der Tatsache, dass es sich um eine GT-Line-Variante handelt, wirkt das ein wenig mau – und das spiegelt sich auch bei der Beschleunigung wider. Über zehn Sekunden vergehen, bis der rund 4,4 Meter lange und 1.397 Kilogramm schwere XCeed die 100 Stundenkilometer knackt. Schluss ist schließlich bei 198 km/h. Ob das die GT-Line nun rechtfertigt oder nicht, wird jeder für sich selbst entscheiden müssen. Ausschlagend ist diesbezüglich auch der Preis. Schließlich ist die GT-Line erst ab 38.140 Euro zu haben, in der Testwagen-Motorisierung wird sogar erst ab 42.640 Euro eingestiegen. Dafür kann man sich durchaus ein wenig mehr Leistung erwarten. Pluspunkte gibt es indes für den Verbrauch. Der ordnet sich mit 5,1 bis 5,3 Liter auf 100 Kilometer im unteren Bereich ein und ist auch im Praxistext bei einigermaßen gediegener Fahrweise durchaus machbar.
AUSSTATTUNG? TOP!
In Sachen Ausstattung macht der GT-LineXCeed hingegen eine hervorragende Figur, insbesondere in der Fahrerkabine. Neben dem extra für das Modell konzipierten abgeflachten beheizbaren Lederlenkrad im GT-Line-Design mitsamt Lederschaltknauf erhält der XCeed beinahe die komplette Wunschpalette. Angefangen beim Super-

vision Cluster mit 12,3-Zoll-Voll-TFT-LCDFarbdisplay über das 10,25 Zoll große Navigationssystem bis hin zum JBL-Soundsystem für die musikalische Untermalung ist alles mit dabei. Auch eine kabellose Smartphone-Ladestation in der Mittelkonsole gehört zum Repertoire.

Platz genommen wird in der ersten Reihe stilecht auf beheiz-, belüft- und elektrisch verstellbaren Echtledersitzen, dazu lässt sich auch die zweite Sitzreihe beheizen.
Unmittelbar dahinter bietet das Ladeabteil ein Volumen von 380 Litern, das im Vergleich zu den reinen Verbrennermodellen aufgrund des 48-Volt-Systems etwas verkleinert ist. Bei umgeklappter Fondreihe sind schließlich bis zu 1.332 Liter möglich. Darüber hinaus sind beim XCeed auch alle gängigen Sicherheits- und Assistenzsysteme mit an Bord, beispielsweise ein adaptiver Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer samt Stop&Go-Funktion, das autonome Notbremssystem sowie das Smart-Parking-Assist-System inklusive Rückfahrkamera. In Sachen Fahrdynamik hält der XCeed, was er verspricht. So sind nicht nur schnellere
KIA
Antrieb: Front
Leistung: 100 kW/136 PS
Drehmoment: 320 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 10,1 sec
Spitze: 180 km/h
Verbrauch: 5,3 Liter/100 km
Spaßfaktor: 8 von 10
Preis: ab 38.140 Euro
Fahrten auf der Autobahn oder Landstraße einfach und komfortabel zu meistern, sondern ob des geringen Wendekreises von rund 10,6 Metern auch engere Stadtstraßen kein Problem.
Unterm Strich mangelt es dem XCeed ein wenig an der erhofften Sportlichkeit. Natürlich ist ein Crossover kein Supersportler, angesichts der Bezeichnung GT-Line und des überaus athletischen Designs könnte man aber durchaus einen Tick sportlicheres Fahrverhalten erwarten – auch angesichts des Preises. Ansonsten ist am Facelift des XCeed kaum etwas auszusetzen, im Gegenteil: Design und Ausstattungspalette sind wirklich top.
eco. mobil 117
GERNE ETWAS MEHR SPORTLICHKEIT
XCEED GT-LINE
TECHNIKAFFIN
Während die neuesten technologischen Errungenschaften meist den Aushängeschildern und Spitzenmodellen vorbehalten sind, macht BMW beim neuen 2er Active Tourer eine offensichtliche Ausnahme.
TEXT: FELIX KASSEROLER
einschließlich Curved Display sowie dem Intelligent Personal Assistant. Dazu verpasst BMW dem 2er eine annähernd schwebende Mittelkonsole mit integriertem Bedienfeld, Lautstärkeregler sowie Smartphone-Ablage unterhalb des Curved Displays. Beinahe sämtliche Einstellungen lassen sich entweder über jenes Bedienfeld, über das Display, die Tasten am optionalen M-Lederlenkrad oder die ausgezeichnet funktionierende Sprachsteuerung konfigurieren.

TOP - FAHRVERHALTEN
In Sachen Fahrdynamik lässt der BMW keine Wünsche offen. Ob gediegener Sprint von der Ampel, kurzfristige Beschleunigung auf der Autobahn oder gemütliches Cruisen: In beinahe jeder (Fahr-)Lebenslage ist man mit dem 230e xDrive Active Tourer bestens beraten – inklusive sämtlicher gängiger Fahr- und Assistenzsysteme. Hinsichtlich des Preises muss man dabei ein wenig einstecken, kostet das gegebene Fahrzeug doch 65.848 Euro. Generell liegt der Einstieg für den 230e bei 47.650 Euro.
Insbesondere im Innenraum erhielt der –hier bildlich festgehaltene – BMW 230e xDrive Active Tourer zahlreiche aus den Modellen iX und i4 bekannte Designelemente sowie diverse Technologiehighlights. Auch wenn sich das im Preis etwas widerspiegelt, wird der Active Tourer so auf eine komplett neue Stufe im Kompaktwagensegment gehoben.

Den Antrieb bildet im konkreten Fall eine Kombination aus Benzin- und Elektromotor mit einer Systemleistung von insgesamt 326 PS (240 kW) und einem maximalen Drehmoment von 477 Newtonmetern. Entsprechend rasant gelingt der Sprint auf 100 Stundenkilometer. Nicht einmal 5,5 Sekunden vergehen dank sportlich schaltendem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe aus dem Stand. Den kombinierten Verbrauch gibt man bei BMW mit rund 0,8 bis 0,6 Liter auf 100 Kilometer an, realistisch – wie meist bei einem Plug-inHybrid – sind knapp unter sechs Liter. Und
das nur dann, wenn der 2er nicht ausschließlich im (neben Personal- und Efficient- möglichen) Sportmodus gefahren wird.
KRAFTVOLLER AUFTRITT
Außenherum liegt das Hauptaugenmerk nicht unüblich bei BMW auf den einmal mehr größer gewordenen Nieren. In Kombination mit den adaptiven LED-Scheinwerfern verleihen diese der Front einen markanten Auftritt. Der ist nicht zuletzt auch der flacheren A-Säule geschuldet, die nicht nur einer besseren Übersichtlichkeit von innen dient, sondern insbesondere auch dem Außendesign einen sportlichen Touch verleiht. Das Heck besticht durch einprägsame LED-Heckleuchten sowie den markanten Diffusor.
Der Blick in den Innenraum offenbart die Ähnlichkeiten zu den Elektro-Vorreitern iX und i4. So erhält auch der 2er Active Tourer die Kombination aus dem innovativen Operating System 8 und dem BMW iDrive
Antrieb: Allrad
Leistung: 240 kW/326 PS
Drehmoment: 477 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 5,5 sec
Spitze: 140 km/h rein elektrisch
Verbrauch: ca. 6,0 Liter/100 km
Spaßfaktor: 9 von 10
Preis: ab 65.848 Euro
eco. mobil 118
BMW 230E XDRIVE ACTIVE TOURER
Eintauchen. In das leichte Leben.







Mediterranes Flair und ein Hauch von Süden. Unsere Landschaften erzählen von Dolce Vita, Genuss und Entspannung. Lauschen Sie ihnen in den 30 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. belvita.it








brandnamic.com Foto: Belvita-Hotel Alpin Panorama Hotel Hubertus (Archiv)
Safety first!
Wir sind ja schon lange Freunde der unkaputtbaren Brillen von Gloryfy, die uns vor allem beim Sport immer wieder gute Dienste erweisen. Dazu schauen die Teile auch noch echt gut aus – übrigens nicht nur als Sonnenbrillen, sondern auch in der optischen Version. Beide gibt’s ab sofort in einer limitierten Bernd-Mayländer-Edition. Der Deutsche ist seit über 24 Jahren (!) der offizielle Safety-Car-Fahrer der Formel 1 und schon zu aktiven Zeiten eine Legende. „Ich lebe fast das ganze Jahr aus dem Reisekoffer, weshalb meine Brillen all diese Strapazen und Alltagsbeanspruchungen mitmachen müssen“, sagt er und hat sich deshalb mit den Zillertaler Brillenspezialisten auf ein Packerl gehauen. Die Sonnenbrille Gi39 ist in drei Farbvarianten um je 169 Euro, die optische SPORT Drift in zwei verschiedenen Versionen um je 339 Euro erhältlich. Besonders praktisch: Die Bügelenden kann man ganz einfach selbst verbiegen, so lässt sich der Halt individuell anpassen. www.gloryfy.com

120 kultur & trends
LIFESTYLE
JUNG UND KREATIV

Zum vierten Mal haben die Landesinnung der Tischler und Holzgestalter sowie proHolz Tirol heuer ihren Gestaltungspreis für junge Tischler*innen und Tischlereitechniker*innen ausgelobt. Die vielfältigen Einreichungen zum Thema Gestaltung und Design zeigen einmal mehr, wie viel kreatives und handwerkliches Potenzial im heimischen Tischler-Nachwuchs steckt. Aus insgesamt 43 eingereichten Werkstücken nominierte eine fünfköpfige Jury 22 Projekte, von denen drei ausgezeichnet wurden und vier eine Anerkennung erhielten. Alle Möbel sind bis ins Detail durchdacht und geplant und in höchster Handwerkskunst ausgeführt. Chapeau! www.proholz-tirol.at
HOME IS WHERE THE BLAUFRÄNKISCH IS
Blaufränkisch bedeutet für das Weingut Strehn aus Deutschkreutz mehr als eine Rebsorte, ein Wein, ein Duft, ein Geschmack, eine Farbe – er ist ein Bekenntnis und eine positive Lebenseinstellung. Der trockene und feine Rosé des Hauses verströmt lebendige, animierende Frische. Aromen von Pfirsich, Erdbeere und reifer Feige verneigen sich vor seiner wohligen Finesse. Nicht umsonst hat Pia Strehn den Beinamen „Rosékönigin“ bekommen. Ihr Blaufränkisch Rosé ist der perfekte Begleiter zu Garnelen, gegrilltem Lachs, Ziegenkäse und Tatar. Entdeckt in der Vinothek Gottardi in Innsbruck um 8,50 Euro. www.gottardi.at

KREISFÖRMIGE LÄSSIGKEIT

Sobald's draußen wärmer wird (obwohl es heuer in Wahrheit nie richtig kalt war), sind wir unter den Ersten, die es sich in ihrem Draußen-Zuhause gemütlich machen. Unseren Unter-freiem-Himmel-Lieblingsbuddy dafür haben wir schon gefunden. Die preisgekrönte Dala-Kollektion von Stephen Burks für Dedon zeichnet sich durch den Flechtstil der kreisförmigen Loungeelemente aus und ist in fünf Farbvarianten erhältlich. Insgesamt besteht die Serie aus Sesseln, Beistelltischen, einem Daybed sowie Laternen und Übertöpfen. Sie ist flexibel einsetzbar und überall ein echtes Highlight. Ab 3.030 Euro erhältlich bei reiter design in Innsbruck.
EINMAL MIT ALLES
Die Diamond-Kapseln von Biogena sind neu und wahre Wunderdinger, erfüllen sich doch quasi alle Top-Healthy-LifeBedürfnisse: Sie unterstützen die Gesundheit mit Vitaminen und Mineralstoffen, geben Energie, fördern die Konzentration, stärken Ihre innere Balance und lassen Sie rundum strahlen. Die EinMonats-Kur kostet 169,90 Euro. www.biogena.com

eco. life 121
TIPP DER AUSGABE:
Wenn dich dein Leben nervt, streu Glitzer drauf.
TIPP DER REDAKTION
© RENE MARSHALL
Auszeichnung Tischlereitechnik: Julian Weitlaner, Franz Walder Ges.m.b.H.
Als einziger Hersteller der Branche testet Miele seine Waschmaschinen auf eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren, was diese besonders langlebig – und damit nachhaltig – macht. Mit dem integrierten Dosiersystem TwinDos lassen sich außerdem bis zu 30 Prozent Waschmittel gegenüber manueller Dosierung sparen, in Kombination mit dem extra SingleWash können bis zu 40 Prozent Waschmittel und bis zu 60 Prozent Energie und Zeit eingespart werden.

KLEINE WELTVERBESSERER-TIPPS
Energie, die nicht verbraucht wird, muss nicht erzeugt werden. Manchmal ist es tatsächlich so einfach. Wir haben ein paar Tipps für Sie, wie sich im Haushalt mit einfachen Kniffen Energie sparen lässt.
Beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz rückt immer wieder ein Aspekt in den Fokus: die Energie. Einerseits geht es natürlich darum, aus welchen Ressourcen wir diese gewinnen, und auf der anderen Seite, wofür sie verwendet wird. Das wiederum nimmt unter anderem (Haushalts-)Gerätehersteller in die Pflicht.
Ende 2019 hat die Europäische Union ihren Green Deal präsentiert, mit dem das Leben und Wirtschaften in der EU in vielen Bereichen ökologischer und nachhaltiger werden soll. Das Paket beinhaltet eine Reihe an Maßnahmen, mit deren Hilfe die Klimaziele bei gleichzeitiger Neuausrichtung der Wirtschaft und Gesellschaft für eine gerechte und flo-
rierende Zukunft erreicht werden sollen. Die Richtlinien und Verordnungen dazu werden stetig erweitert und angepasst. Eine davon befasst sich mit der „Förderung des Rechts auf Reparatur und Wiederverwendung“*)
Das klingt im ersten Moment vor allem recht sperrig und auf den zweiten Blick ein wenig eigenartig, hat aber unterm Strich ein ganz konkretes, langfristiges Ziel: nämlich, dass die Hersteller ihre Produkte künftig langlebiger, stabiler und robuster bauen und damit die Lebensdauer deutlich verlängert wird. Miele zum Beispiel setzt schon lange darauf, Nachhaltigkeit zu einem essenziellen Bestandteil in jeder Phase des Produktlebenszyklus zu machen – in der gesamten Wertschöpfungskette und insbesondere in der Nutzungsphase.
Kürzlich lud der Gerätehersteller zu seinen „Green Experience Days“, bei denen gezeigt wurde, wie jeder sein eigenes Leben ein kleines bisschen besser gestalten kann. Im Zuge dessen hat Miele auch ein eigenes Booklet zum Thema Energiesparen und nachhaltigem Lebensstil erstellt. Ein paar Alltagstipps haben wir daraus für Sie herausgepickt.
WASCHMASCHINE
MAXIMALE BELADUNG
Nutzen Sie die volle Beladungskapazität für das jeweils gewählte Waschprogramm. Der Energie- und Wasserverbrauch sind je nach Waschprogramm und Beladungsmenge bei maximaler Beladung am niedrigsten.
eco. life 122
HOHE DREHZAHL
Die gewählte Schleuderdrehzahl beeinflusst die Restfeuchte der Wäsche und die Schallemission der Waschmaschine. Je höher die Schleuderzahl, desto geringer ist die Restfeuchte. Zu beachten ist, dass dabei die Schallemission der Waschmaschine steigt. Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des jeweiligen Waschprogramms.
GESCHIRRSPÜLER
DIE RICHTIGE SPÜLVORBEREITUNG
Es ist empfehlenswert, grobe Speisereste vorm Einladen zu entfernen. Ein langes Vorspülen unter fließendem Wasser ist aber in der Regel nicht erforderlich und erhöht nur unnötig den Wasser- und Energieverbrauch. Für noch höhere Effizienz lohnt es sich, das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll auszunutzen, ohne den Geschirrspüler zu überladen.
ECO - PROGRAMM
Für normal verschmutztes Geschirr kann das ECO-Programm für energiesparendes Spülen verwendet werden. Wichtig ist, dass Sie nach mehrfacher Nutzung von Programmen mit niedrigen Temperaturen einmal im Monat ein Intensivprogramm mit 75 °C wählen. Dadurch wird der Spülraum gereinigt und Geruchsbildung vermieden.
GERÄTEPFLEGE
Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle vier bis sechs Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden. Zusätzlich sollten die Tür und ihre Dichtungen regelmäßig mit einem feuchten
Die neuen Miele-Backöfen mit obsidianschwarzem Glas sind nicht nur elegant-chic, sondern auch maximal vernetzungsfähig und haben die Energieeffizienzklasse A+.


Tuch gereinigt werden, um Speisereste zu entfernen. Reinigen Sie ebenfalls regelmäßig die Siebe im Spülraum. Die Sprüharme sollten regelmäßig (alle zwei bis vier Monate) kontrolliert werden.
KÜHLSCHRANK
TÜR SELTENER ÖFFNEN
Durch jedes Öffnen der Tür gelangt warme Luft von außen in den Kühlschrank. Dieser muss in der Folge durch zusätzliche Nutzung von Energie wieder vom Kompressor abgekühlt werden. Um Energie zu sparen, öffnen Sie Ihren Kühlschrank also am besten nur dann, wenn Sie wissen, was Sie benötigen.
WARMES ESSEN VS. GEFRIERGUT
Lassen Sie warme Speisen und Getränke abkühlen, bevor Sie sie im Kältegerät verstauen, und legen Sie Gefriergut zum Auftauen in die Kühlzone.
RICHTIGER EINBAU & PFLEGE
Das Kältegerät muss bei erhöhten Umgebungstemperaturen öfters kühlen und verbraucht dabei mehr Energie. Deshalb soll das Kältegerät in einem gut belüfteten Raum stehen. Ebenso sollte das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sowie Beund Entlüftungsquerschnitte freigehalten und von Staub befreit werden.
KOCHFELD & BACKOFEN
PASSENDES KOCHGESCHIRR
Wählen Sie für kleine Mengen einen kleinen Topf. Ein kleiner Topf benötigt weniger Energie als ein großer, nur wenig befüllter Topf.
DECKEL VERWENDEN
Garen Sie nach Möglichkeit in geschlossenen Töpfen oder Pfannen. So wird verhindert, dass Wärme unnötig entweicht.
RECHTZEITIG ZURÜCKSCHALTEN
Schalten Sie nach dem Ankochen oder Anbraten rechtzeitig auf eine niedrigere Leistungsstufe zurück.
BACKROHR VORHEIZEN
Heizen Sie den Garraum nur dann vor, wenn es laut Rezept oder Gartabelle erforderlich ist.
RESTWÄRME NUTZEN
Garen Sie Gerichte, die Sie nicht gleichzeitig zubereiten können, möglichst direkt nacheinander, um die bereits vorhandene Wärme zu nutzen. Öffnen Sie die Tür möglichst nicht während eines Garvorgangs. Wenn möglich, bereiten Sie mehrere Gerichte gleichzeitig zu. Stellen Sie diese nebeneinander oder auf verschiedene Ebenen.
*) TIPP
Im vergangenen Jahr wurde der so genannte Reparaturbonus eingeführt – eine Förderaktion des Klimaschutzministeriums für die Reparatur von elektrischen und elektronischen Geräten in Privathaushalten. Wer seine Elektrogeräte reparieren lässt, anstatt sie zu entsorgen, bekommt 50 Prozent (oder maximal 200 Euro pro Reparatur) der Rechnungssumme zurück. Bis 2026 stehen dafür Mittel in Höhe von 130 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere Infos unter www.reparaturbonus.at
eco. life
123
Induktionskochfelder benötigen bis zu 30 Prozent weniger Energie gegenüber herkömmlichen Kochfeldern. Bei den neuen Vollflächen-Induktionskochfeldern von Miele sorgt die DiamondFinish-Oberfläche für möglichst weniger Kratzer.
Die Mannigfaltigkeit der Kunst
In der Galerie Nothburga am Innsbrucker Innrain werden Künstler*innen und Kunstrichtungen gekonnt gemischt. Aus zwei Namen und artverwandten Arbeiten oder der symbiotischen Kombination unterschiedlicher Genres entstehen spannende Begegnungen – für die Kunst an sich wie für deren Betrachter*innen.
Unter dem Titel „Granatapfel und Weiblichkeit“ zeigt die Galerie Nothburga noch bis 15. April die beiden Künstlerinnen Anna Maria Achatz und Katharina Schmidinger. Die Bilder von Anna Maria Achatz sind bei einem Artist-in-Residence-Aufenthalt in Portugal entstanden. Der Dialog der Künstlerin mit der Landschaft, der Natur und dem südlichen Himmel war der Impuls für zahlreiche Arbeiten auf feinem chinesischem Papier mit hochpigmentierter, farbiger Tusche. Es sind
rhythmische Erzählungen, farbige Beschreibungen der Formen, die sich tänzerisch im Raum bewegen. Neben dem Organischen sind auch die „Strukturen“ – besondere räumliche Anordnungen – in Achatz‘ Bildern sicht- und spürbar. Scheinbar spielerisch bewegt sich die Künstlerin malend in der Fläche. Da gibt es ein Dahinter und Darüber, gitterförmige Durchdringungen von Farbstrukturen, die wiederum neue Farbschöpfungen generieren und optisch von der Bildfläche in die dritte Dimension führen. Es ist ein Blick in die Tiefe
des Bildraumes einerseits, aber wohl auch ein Blick in die Tiefe der Emotionen der Malerin.
Für Katharina Schmidinger indes eröffnet Ton in den unterschiedlichsten Farben und Körnungen vielfältigste Möglichkeiten schöpferischen Tuns. Ihr Schwerpunkt in der Ausstellung ist vor allem die weibliche Figur. Durch Haltungen, Bewegungen und Gesten verleiht die Künstlerin den Körpern den besonderen Ausdruck. Diese Weiblichkeiten, teils gegenständlich, teils sehr reduziert und abstrakt, bewegen sich heiter im Miteinander



eco. life 124 © ANNA MARIA ACHATZ
In der aktuellen Ausstellung in der Galerie Nothburga trifft Malerin Anna Maria Achatz (Bilder links: magenta – green / turquiose) auf Keramikkünstlerin Katharina Schmidinger. In ihren Arbeiten zeigen die beiden das Wechselspiel von Rhythmus und Struktur, Erdverbundenheit und Abstraktion, Filigranem und Farbigem, immer ausgehend von der Natur.
OBEN: Heike Kleinlein: Austria-Reihe mit Kremser Ascheglasur „Grüner Veltliner“ / Steinzeug, ungebrannt
UNTEN: Norbert Kleinlein: „Yves und ich fliegen zum Mond“, Papier, Stroh, Acryl / Nocturne, Pigment auf Leinwand
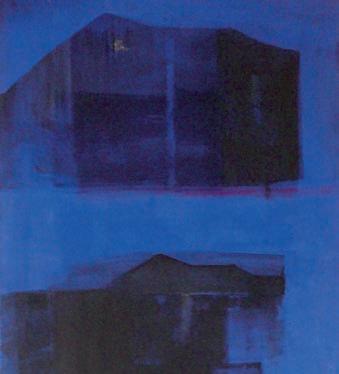
RECHTS: „Die Prächtige“, Vase von Heike Kleinlein, Bronzeabguss von Norbert Kleinlein


und Beieinander. Das Farbspektrum erzeugt die Keramikerin nicht nur mit sparsam eingesetztem Glasurauftrag, vielfach lässt sie die Farbwelt des Materials Ton sichtbar zur Wirkung kommen. Je nach Brandverfahren, Raucheinwirkung oder der Bearbeitung der Oberfläche bleiben ihre Figuren stets im Spektrum des erdig Ausgerichteten. Katharina Schmidinger verwendet und integriert gerne Eisenteile alter Handwerkskunst, die von vergangenem Gebrauch erzählen und in der Kombination mit der gebrannten Keramik eine neue Aussage bekommen.

FORMENSPIEL
Die daran anschließende Schau der Eheleute Kleinklein aus dem deutschen Schweinfurt schließt in Material und Ausdrucksform teilweise daran an und steht dabei dennoch ganz für sich. Im „Pas de deux“ von Heike und Norbert Kleinlein trifft Keramik auf Objektkunst und Malerei. „Norbert Kleinlein nimmt die äußere Wirklichkeit auf und verarbeitet diese als seine Essenz, in der natürliche und artifizielle Welt ineinandergreifen. Seine Sprache ist die im Sehen gegründete Erinnerung, verbunden mit seinen Erfahrungen
und all den subjektiven Einflüssen, die die Identität eines Künstlers ausmachen. Seine Arbeiten leben aus der Spannung zwischen Außen- und Innenwelt. Verborgenes wird sichtbar und Unverborgenes wird durch seine eigene Sicht der Dinge verborgen. Nicht um Überblick geht es, sondern um Einblick“, beschrieb es dereinst Wolfgang Köster, ehemaliges Mitglied der Dr.-Georg-Schäfer-Stiftung in Schweinfurt.
Norbert Kleinlein ist Bildhauer und Maler, seine Frau ergänzt das gestalterische Œuvre um formenreduzierte Keramikkunst. Die Gestalt der von Hand aufgebauten Objekte entstammt vorrangig den schlichten Gefäßen des Alltags, abstrahiert auf ihre Grundform. Die klare Formensprache erhält ihr Spannungsmoment durch die verwendeten Materialien und die außergewöhnliche Glasur, die von Heike Kleinlein im Zuge eines Aufenthalts als Artist in Residence in Krems entstand. Dafür hat sie von verschiedenen Winzern der Kremser Region Rebholzabschnitte gesammelt, diese getrocknet und verbrannt. Aus der daraus gewonnenen Asche hat sie folglich die „Kremser Asche Glasur“ entwickelt, deren Farbgebung vor
allem den Boden der Region in all seiner Unterschiedlichkeit widerspiegelt. „Sowohl in die Gefäße als auch in die Glasur ist die schöne Landschaft, in der ich leben durfte, mit hineingeflossen. Es sind nicht wiederholbare Vorgänge und das Ergebnis ist ein einzigartiges“, so die Künstlerin.
GALERIE NOTHBURGA
Innrain 41, 6020 Innsbruck info@galerienothburga.at www.galerienothburga.at
Mi. bis Fr. von 16 bis 19 Uhr, Sa. von 11 bis 13 Uhr
AKTUELLE AUSSTELLUNG
Anna Maria Achatz
Katharina Schmidinger
„Granatapfel und Weiblichkeit“
Malerei und Keramik
noch bis 15. April 2023
KOMMENDE AUSSTELLUNG
Heike und Norbert Kleinlein
„Pas de deux“
Keramik, Malerei, Objekt
26. April bis 20. Mai 2023
Vernissage: 25. April 2023, 19 Uhr

eco. life 125
AUSBLICK
IM
FÜREINANDER DA SEIN
Der Verein „Miteinander im Mittelgebirge“ (MiM) setzt sich für ein gutes Leben aller ein – unabhängig von Herkunft oder Lebenssituation. Um dies zu erreichen, hilft MiM Geflüchteten zum Beispiel beim Spracherwerb, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, bei der Integration von Kindern in Kindergarten und Schule und allgemein beim Aufbau eines geregelten und sicheren Lebens in Österreich. Der ZONTA Club Innsbruck 1 unterstützte die Einrichtung kürzlich mit einer Spende von 3.500 Euro. Infos zum Verein finden Sie unter www.miteinander.tirol
GENUSSVOLL GEFASTET
AUSGEZEICHNETES BRANDING

Warum ist Kitzbühel so besonders? Um diese Frage zu beantworten, initiierte Kitzbühel Tourismus in der Wintersaison 2021/22 ein eigenes Magazin. Der eigens kreierte Concierge „Jo Hahn“ führt dabei durch das abwechslungsreiche Kitzbühel – Insidertipps inklusive. Eine besondere Rubrik sind die ganze persönlichen Geschichten aus Kitzbühel – von den Röcklgwand-Frauen bis hin zu den #LocalHeroes aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die mittlerweile dritte Ausgabe wurde nun gleich zweimal prämiert – sowohl mit dem German Brand Award als auch dem German Design Award. Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser freut sich gemeinsam mit Chefredakteurin Sascha Reitsma über die doppelte Auszeichnung: „Gerade weil sich unser Kommunikationsfokus vermehrt ins Digitale verlagert, gewinnt Gedrucktes noch mehr an Wert.“


Am Aschermittwoch und damit zum Start der Fastenzeit verköstigten die Schüler*innen der Ferrarischule die Besucher*innen des Sillparks wieder mit hausgemachten Suppen, die erstmals auch to go erhältlich waren. Der Erlös für die Suppen wurde dem Verein Netzwerk Tirol hilft gespendet. Die von der Ferrarischule eingenommenen 890,83 Euro wurden dabei vom Sillpark auf 1.500 Euro aufgestockt und kürzlich an NetzwerkTirol-Chef Herbert Peer übergeben.
Im Bild: Sillpark-Centermanager Markus Siedl, Ferrari-Fachvorständin
ÜBERGABE
Trotz eines herausfordernden Jahres konnte die Tiroler Krebshilfe im vergangenen Jahr positive Ergebnisse erzielen. Mit Beginn des neuen Jahres stand nun eine erste Veränderung in der Organisation an. Christian Marth (li.), der sich seit über neun Jahren als ehrenamtlicher Präsident für die Krebshilfe engagiert hat, übergab seine Stelle an Dominik Wolf. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin V, Hämatologie und Onkologie sowie Sprecher des Comprehensive Cancer Centers Innsbruck/CCCI. Florian Klotz bleibt für die Geschäftsführung der Tiroler Krebshilfe zuständig. www.krebshilfe-tirol.at

126
news & events
GESPRÄCH
© KREBSHILFE TIROL
Regina Haslwanter, Herbert Peer vom Netzwerk Tirol hilft und Ferrari-Schuldirektor Manfred Jordan
© KITZBÜHEL TOURISMUS
Barbara Fritz (li.) und Christl Bernhart (3. v. li.) vom Zonta Club Innsbruck 1 mit Susanne Marini und Martina Seiwald, beide MiM
NEUER INVESTOR

Christian Jäger ist einer, den man wohl getrost als bunten Hund bezeichnen kann. Der Multiunternehmer hat 2021 unter anderem seinen EasyMotionSkin DOME in Reith bei Seefeld eröffnet, sein EMS-System ist im vergangenen Jahr sogar ins All geflogen. Nun wird der Tiroler Selfmade-Millionär neuer Investor der Start-up-Show #2min2mio auf PULS4 „Ein Start-up ist wie ein Blind Date: Immer für eine Überraschung gut, es kann sehr teuer werden, kann aber auch das Leben verändern“, so der Neoinvestor.
GERÜSTET FÜR DRAUSSEN

Die Draußen-Saison steht vor der Tür – das gilt nicht nur für die Terrasse, die wir mit neuen Möbeln (gekauft gerne bei reiter design von Seite 130) behübschen, sondern auch für jegliche Outdooraktivitäten. Dafür brauchts quasi naturgemäß die richtige Kleidung, deshalb freuen wir uns über den Neuzugang im zweiten Stock des Kaufhaus Tyrol in der Innsbrucker Innenstadt. Kürzlich ist dort mit der schwedischen Brand PeakPerformance ein echter Outdoorspezialist eingezogen und hat auf 180 Quadratmetern alles mit, was man in der Natur und in den Bergen so braucht. Golfbekleidung inklusive. Die Teile sind an sich schon funktional, qualitativ hochwertig und langlebig, für noch mehr Nachhaltigkeit bietet PeakPerformance auch einen Pflege- und Reparaturservice an.
BESCHWINGTER ABEND
FÜR DEN GUTEN ZWECK
150 gut gelaunte Gäste folgten der Einladung des Rotary Clubs Innsbruck Bergisel zur „Boogie, Blues & More Charity Party“ zugunsten des Vereins „Arche Herzensbrücke“ ins Restaurant 1809 am Bergisel. Katharina Alber – besser bekannt als „Boogie-Kathie“ – sorgte mit Peter Müller und Karol Hodas für ausgelassene Stimmung. Die zahlreichen Sponsoren (RLB Tirol, Geb on Stage, Dr. Czech – Praxis für Frauengesundheit, ecodata, eco.nova, Dermatologe Dr. Alfred Grassegger, Autohaus Moriggl, Trigonos ZT, Zimmermann Ganahl, Stoffwechselinstitut Innsbruck, magped, IBPA Ziviltechniker, Rowa-Moser, Moser Wohnbau, Boogie Kathi) und Gäste sorgten für einen Reingewinn von über 10.000 Euro.




FRAUEN VOR DEN VORHANG
Der „Meisterinnen-Förderpreis“ des Soroptimist International Club Innsbruck und der Wirtschaftskammer Tirol holt Frauen in typisch männerdominierten Berufen auf die Bühne und soll Mädchen für technische und handwerkliche Berufe begeistern. Die mit 1.500 Euro dotierte Auszeichnung ging heuer an die 27-jährige Elektromaschinenbau- und Automatisierungstechnikerin Stefanie Hoffmann aus Hochfilzen. „Stefanie Hoffmann wurde von der Jury einstimmig als preiswürdig bewertet. Die Meisterin ist ein Role Model dafür, welche Vielfalt und Zukunftsorientiertheit es im Berufsleben gibt“, so Elisabeth De Felip-Jaud.

Im Bild: Elisabeth De Felip-Jaud, Past-Präsidentin des Soroptimist Club Innsbruck, Stefanie Hoffmann und Wirtschaftskammerdirektorin Evelyn Geiger-Anker

im. gespräch 127
Li.: Doris und Horst Szeli freuten sich über das Engagement für ihr Projekt „Arche Herzensbrücke"
Re.: „Boogie Kathi & Friends“ sorgten mit Peter Salinger vom Lions Club Kitzbühel (li.) für Stimmung
© VICTOR MALYSHEV © PULS4/GERRY FRANK
Klaus Schredelseker, Rotary Club/RC, Herbert Bauer, RC Goldenes Dachl, Alfred Grassegger, RC Innsbruck Bergisel, und Herbert Weissenböck
TEAM DER TISCHLEREI FALGSCHLUNGER


Gelebtes Miteinander

Mitte März luden Daniel und Mario Falgschlunger samt ihrem Tischlereiteam zum Architektenabend „Wood and Architecture 2.0“, zu dem sich neben den namensgebenden Architekt*innen dieses Mal auch die wichtigsten Geschäftspartner*innen zu einem gemütlich-geselligen Abend im Congresspark Igls trafen. In launiger Atmosphäre wurde geplaudert und genetzwerkt, Hafele Catering aus Lans sorgte für die perfekte kulinarische Begleitung. „Kooperation und ein gelebtes Miteinander sind mir wichtig, weil man letztlich nur gemeinsam vorankommt“, ist Daniel Falgschlunger überzeugt und sieht die Veranstaltung deshalb auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber seinen Geschäftspartner*innen. Seit jeher arbeitet die Tischlerei Falgschlunger mit Unternehmen aus der Region zusammen und sagt mit dieser Veranstaltung auf schöne Weise „Danke“. Dem „Wood“ im Veranstaltungsnamen wurde man unter anderem mit einem eigenen Holzquiz gerecht, das mit Sicherheit nicht nur dem anwesenden proHolz-Geschäftsführer Rüdiger Lex sowie Georg Steixner, ehemaliger Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Tirol, gefallen hat. Gewonnen hat das Quiz übrigens eine junge Architekt*innengruppe. Falgschlunger: „Es ist schön, zu sehen, dass auch der Architektennachwuchs schon in den Startlöchern steht.“ www.tischlerei-falgschlunger.com








im. gespräch 128
QUIZSIEGER
RUNDUM BETREUT
Das Modell der 24-Stunden-Betreuung bietet Betreuung in den eigenen vier Wänden – für viele Menschen ein zentraler Wunsch im Alter.
Das Modell der 24-Stunden-Betreuung bietet individuelle Lösungen: Die Angebote reichen von wenigen Stunden bis rund um die Uhr, 365 Tage lang. So wird die 24-Stunden-Betreuung zum Beispiel für einige Tage als Urlaubsvertretung gerufen oder für einen Wechselmodus mit Angehörigen, indem die Versorgung einen Monat lang von der 24-Stunden-Betreuung und im nächsten Monat durch die Angehörigen übernommen wird.
UNVERZICHTBARE STÜTZE
Gerade in schwierigen Zeiten wie der Coronapandemie tritt der unbezahlbar hohe Wert einer 24-Stunden-Betreuung noch deutlicher zutage: „Die rund 3.000 Betreuer*innen in Tirol haben Großartiges geleistet: Mehr als 2.000 Klient*innen haben nicht nur Betreuung, sondern auch Sicherheit vor dem Virus erfahren. Dies konnten die Betreuer*innen dank strenger Hygiene- und Schutzvorkehrungen gewährleisten. Zudem war die 24-Stunden-Betreuung für Familien und Angehörige, die durch die Pandemie zusätzlich familiäre Herausforderungen wie Homeschooling meistern mussten, eine wichtige Stütze“, erklärt Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol.
AUFGABENGEBIETE
Die 24-Stunden-Betreuung übernimmt vielfältige Arbeiten. Im Zentrum steht die durchgängige Anwesenheit des Betreuers und Unterstützung in alltäglichen Dingen wie Einkaufen, Wäscheversorgung und Spaziergängen. Auch unterstützen Personenbetreuer*innen bei der Körperpflege oder dem An- und Auskleiden.
Die Personenbetreuung endet dort, wo die medizinische Pflege beginnt – Personenbetreuung ersetzt also keine Pflegedienste. Vielfach werden in solchen Fällen die Leistungen der 24-Stunden-Betreuung mit mobiler Hauskrankenpflege kombiniert. Manche Organisationen haben selbst diplomiertes Pflegepersonal, aber auch die Gesundheitsund Sozialsprengel sind in Tirol eine wichtige Struktur. „Die Personenbetreuung ist

kein stationärer Pflegedienst, sondern neben Hauskrankenpflege und medizinischer Betreuung durch den Hausarzt ein zusätzliches Tool, damit Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können“, klärt Moritz über Missverständnisse auf. „Wichtig ist, dass man sich nicht erst im Krisenfall mit dem Thema Personenbetreuung beschäftigt, sondern sich schon früh genug über die Möglichkeiten und die Dienstleistung der häuslichen Betreuung informiert und das mit der Familie und den Betroffenen bespricht“, rät Moritz, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.
DIE RICHTIGE WAHL
Wie kommt man zu einer Personenbetreuung? Der einfachste und verlässlichste Weg ist über eine Vermittlungsagentur, vorzugsweise eine einheimische. Bei österreichweit tätigen Agenturen sollte man darauf achten, dass regionale Ansprechpartner vor Ort sind.
Worauf sollte man bei der Agentur achten? Seriöse Agenturen setzen sich unter anderem vor Auftragsabschluss intensiv mit Angehörigen und Klienten auseinander. Sie bieten eine transparente und umfassende Leistungs- und Kostenstruktur und führen laufend eine exakte Dokumentation über die erbrachten Leistungen der Betreuung, die auch für Angehörige einsehbar ist.
Mit welchen Kosten ist für eine 24-Stunden-Betreuung zu rechnen? Die Betreuungskosten liegen mit ca. 2.000 bis 2.500 Euro im Monat deutlich unter einem Heimplatz. Durch das gesetzliche Pflegegeld und Unterstützung des Bundes liegen die tatsächlichen Kosten zwischen 800 und 1.300 Euro. Zusätzlich gibt es weitere kleinere Kostenbefreiungen. PR
WEITERE INFOS
Die Wirtschaftskammer Tirol fungiert als Servicestelle und Ansprechpartner der Personenbetreuer*innen und Agenturen. „Qualität steht im Mittelpunkt: Wir haben uns bei der Entwicklung von Qualitätsmanagement-Standards für Agenturen des Gesundheits- und Sozialministeriums eingebracht. Unter www.oeqz.at können sich Angehörige erkundigen, welche Agenturen sich einer freiwilligen Qualitätszertifizierung unterworfen haben. Auch die Fachgruppe Tirol hat an der Entwicklung einer mehrsprachigen Dokumentationsplattform für Personenbetreuer*innen inklusive Online-Lernsoftware mitgearbeitet und diese auch finanziell unterstützt“, so Fachgruppenobmann Bernhard Moritz. Infos unter www.daheimbetreut.at
Zu Pflege und 24-Stunden-Betreuung können Sie sich auch auf der neuen Plattform des Gesundheitsministeriums informieren: https:// pflege.gv.at

129
Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann Personenberatung/Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol
WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL
WENN DER GARTEN ZUM WOHNZIMMER WIRD
Endlich wieder warme Sonnenstrahlen, blühender Krokus und gute Laune: Die reiter design gmbh sorgt mit ihren Möbeln für Schmetterlinge im Bauch und bringt den Sommer in Ihren Garten, auf Ihre Terrasse oder Balkon.
Seit mehr als 38 Jahren setzt reiter design Standards für Designermöbel, Licht und Accessoires. Das Vorarlberger Unternehmen eröffnete vor 13 Jahren einen zweiten Standort in Tirol und ist erst im vergangenen Jahr von der Haller Straße in die Südbahnstraße in Innsbruck übersiedelt. Auf 450 Quadratmetern präsentiert reiter design dort eine große Auswahl an führenden internationalen Premiummarken. „Wir lieben und leben Design. Deshalb beraten wir unsere Kunden bei ihren Projekten von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung und liefern Topmarken sowie besten Service, egal ob in- oder outdoor“, so Geschäftsführer Harald F. Künzle.
HALLO SOMMER. BITTE KOMM!
Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen und die Vorfreude auf den Sommer und die Zeit im eigenen Garten wächst. reiter design bietet seinen Kunden mit Outdoormarken wie Cane-Line, DEDON, Fermob, Gloster, Paola Lenti und Weishäupl eine große Auswahl an trendigen Gartenmöbeln zum Entspannen und Genießen. „Der Garten ist für viele ein wichtiger Bestandteil und vor allem auch Wohn- und Rückzugsort in der warmen Jahreszeit. Ein gemütliches Outdoorsofa, genügend Platz für ein Dinner im Freien mit Familie und Freunden und ein stimmungsvolles Licht für laue Sommerabende sind nicht mehr wegzudenken“, betont Art-Direction Sarah Ertl.
Neben den bewährten Klassikern wie großzügige Loungegarnituren und Essplätze sind auch Möbel aus Metall in den buntesten Sommerfarben angesagt. Genauso wie Rattan oder Teak. Unkompliziert gemütlich wird es mit Liegen oder den diversen Club- oder Loungechairs. Bei den Farben haben Erdund Pastelltöne sowie kühles Weiß Saison.
DER SPIRIT VON DEDON
Es begann mit der Schaffung einer revolutionären Faser, die sich angenehm anfühlt und dennoch robust genug ist, um selbst
den härtesten Bedingungen standzuhalten.
DEDON war von Natur aus Entdecker und suchte nach Handwerkern, die geschickt genug waren, um diese Faser in Outdoormöbel zu weben, die von weltweit führenden Talenten entworfen wurden. Seit mehr als 30 Jahren reist DEDON kreuz und quer über den Globus auf der Suche nach den Menschen, Orten und Geschichten, die sie inspirieren.
DEDON wählt nur die besten Materialien für seine ikonischen Möbel aus und arbeitet ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die seine Leidenschaft für Qualität teilen. Von hochwertigem Teakholz über industrietaugliche Keramik bis hin zu fortschrittlichen Stoffen aus den USA und Europa passt
jedes Material zu den individuellen Bedürfnissen seiner Kollektion. Ebenso wird die DEDON-Faser in umweltfreundlichen Anlagen in Norddeutschland produziert, ist zu 100 Prozent recycelbar und frei von Schadstoffen und Schwermetallen. Im Streben nach höchstem Qualitätsstandard strebt der Hersteller danach, Möbel und Accessoires herzustellen, die niemals weggeworfen werden müssen. Das Ergebnis: Nutzer können das Leben drinnen und draußen von seiner besten Seite genießen.
Besuchen Sie den Showroom von reiter design in Innsbruck, lassen Sie sich inspirieren und holen Sie sich den Sommer und den Spirit nach Hause. www.reiter.design PR



130
REITER DESIGN

office@reiter.design Spirit of Place
T
1
512 560606 dedon.de
www.reiter.design
Herzogried 2 · A-6837 Weiler
+43 5523 58580 Südbahnstraße
· A-6020 Innsbruck T +43
Jetzt TechnologieFörderung beantragen
und Innovations- bzw. Digitalisierungsmaßnahmen umsetzen!
□ bis zu 10 Prozent höhere Förderquoten
□ Erweiterung des Programms „InnovationsassistentIn“ in Richtung „NachhaltigkeitsassistentIn“

□ Digitalisierungsförderung: Vereinfachte Beantragung durch Zusammenlegung der Programme
□ neue Schwerpunktsetzungen bei förderbaren Inhalten
□ Start-up Förderung für JungunternehmerInnen in der frühen Projektphase
www.tirol.gv.at/technologiefoerderung
Bezahlte Anzeige | Bildnachweis: shutterstock.com Neu!

















































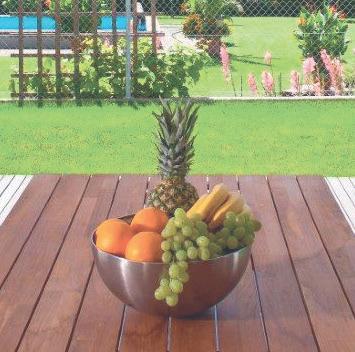























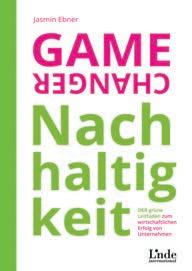


























 TEXT: MARIAN KRÖLL
TEXT: MARIAN KRÖLL