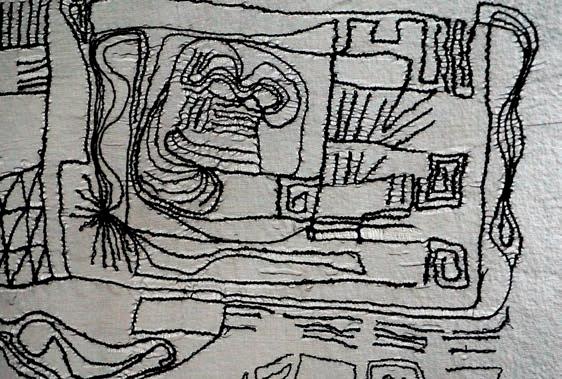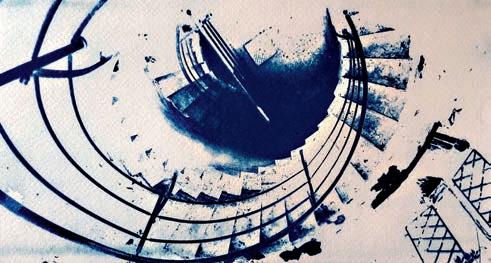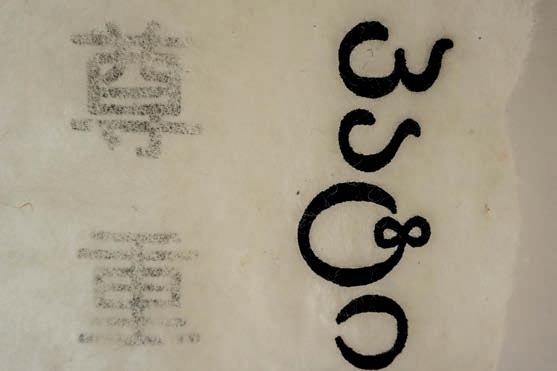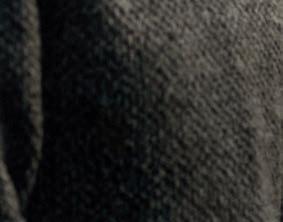WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN
BEWUSSTSEINSBILDUNG: Die Grenzen des Wachstums
ENERGIEWENDE: Warum wir Zeit gewinnen müssen
FREUD UND LEID: Die Zukunft der Zinsen
CYBERSECURITY: The good, the bad and the ugly
N° 01
FEBRUAR 2023 | P.B.B. VERLAGSPOSTAMT 6020 INNSBRUCK | ZNR. GZ 02Z030672 M | EURO 3.00
MEHR ENERGIE , LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND

EINEN DEFINIERTEN KÖRPER ?
HOL DIR DEINEN KÄLTEKICK
FÜR MEHR GESUNDHEIT UND
WOHLBEFINDEN!


STOFFWECHSELINSTITUT INNSBRUCK Amraser-See-Straße 56, Menardicenter II, 4. OG 6020 Innsbruck Tel. +43 (0) 512 346437 termin@stoffwechsel-innsbruck.at www.stoffwechsel-innsbruck.at „FREEZING TO GO“ FÜR JUGENDLICHES, DYNAMISCHES AUSSEHEN, EINE FUNKTIONIERENDE FETTVERBRENNUNG UND GEWEBESTRAFFUNG! FÜHRENDE EXPERTEN BESTÄTIGEN DIE ERFOLGE DER GANZKÖRPER KÄLTEMEDIZIN Leistungssteigerung Anti-Aging Schmerzlinderung Energiebooster Stärkung des Immunsystems bei Müdigkeit und Schlafstörungen Stressabbau Verschönerung des Hautbildes Steigerung von Stimmung und Vitalität Vereinbare jetzt einen Termin für deinen Kryo-Energie-Booster!
KLAR ZUR WENDE
Bis der Mensch tatsächlich etwas an (s)einer Situation ändert, muss der Leidensdruck in der Regel richtig hoch sein. Zu verlockend-bequem ist es, sich mit dem abzufinden, was ist. Eigentlich ist‘s so eh ganz ok und wer weiß schon, ob es anders wirklich besser wird?! Das mag im Kleinen funktionieren, bei den großen Themen geht das nicht mehr.
Wir leben in einer Welt, die – selbst wenn man im Sinne der viel zitierten Achtsamkeit das Gegenteil behauptet – großteils nach wie vor getrieben ist von Leistung und einem Höher, Schneller, Weiter. Die Karriereleiter kennt nur einen Weg und der geht hinauf. Erfolg ist noch immer mit einem Mehr und Größer verbunden. Dem größeren Auto, dem größeren Haus, dem Essen im Sternerestaurant und dem Urlaub am besten ganz weit weg und geteilt auf sämtlichen sozialen Medien dieser Welt. Der Drang, sich weiterzuentwickeln, ist wichtig, um als Individuum und Gesellschaft bestehen zu können. Fortschritt kann aber tatsächlich auch heißen, einmal einen Schritt zurückzugehen, zumindest aber kurz anzuhalten, um zu schauen, ob der Weg noch der richtige ist.
Viele Jahre lang wurden wir von Aufschwüngen, Wachstum und gedeihlicher Konjunktur verwöhnt. Alles war schön und gut, sodass man vergaß, darauf zu schauen, auf wessen Kosten der eigene Wohlstand ging. Denn Verlierer*innen gibt es immer. Wo Licht ist, ist Schatten. Keine Rose ohne Dornen. Jedes Ding hat zwei Seiten. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ist man selbst Teil der positiven Entwicklung – unabhängig davon, ob man aktiv dazu beiträgt oder passiver Nutznießer ist –, ist einem die andere Seite, die negative und unschöne, im besten Fall nicht bewusst und im Worst Case egal. Werden schließlich negative Entwicklungen gewahr und unmittelbar, kommen diese oft vermeintlich überraschend. Doch nur weil man Probleme in der Vergangenheit nicht sehen wollte, heißt es nicht, dass sie nicht da waren. Aktuell wird einer Generation, die in Zeiten von Prosperität sozialisiert und geprägt wurde, von der nachkommenden ein Spiegel vorgehalten. Arbeit, Status und Geld stehen nicht mehr über allem. Die aktuelle Jugend- und Junge-Erwachsene-Generation ist mit Krisen groß geworden: Flüchtlingskrise, Klimakrise, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation. Sie erlebt die Auswüchse des verschwenderischen Lebens der Vergangenheit viel direkter und sie sieht – in vielen Belangen zu Recht – ihre Zukunft gefährdet. Über diese ihre Zukunft entscheiden jedoch (noch) andere, jene nämlich, die vom Ergebnis dieser Entscheidung selbst wahrscheinlich nichts mehr mitbekommen werden. Das macht den (Generationen-)Konflikt nicht einfacher. Gegeben hat‘s das immer schon, nur jetzt wird der Zustand tatsächlich richtig prekär. „Der Nächste wird‘s schon richten“, haut nicht nicht mehr hin, weil wir längst schon „die Nächsten“ sind. Es gilt also, in vielerlei Hinsicht eine Wende einzuläuten. Spaziergang wird das keiner, das wär auch zu wenig. Es braucht einen Sprint.
Spurten Sie los! Ihre Redaktion der eco.nova
MAHATMA GANDHI, KLUG WIE IMMER

eco. edit 4
eco.nova-Herausgeber Sandra Nardin (re.) und Christoph Loreck mit Chefredakteurin Marina Bernardi
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE
„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“
„Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Empathie sind in der ästhetischen Chirurgie für mich die Grundvoraussetzung für ein gutes Ergebnis.“
Fachärztin für Plastische Chirurgie • Ästhetische Chirurgie Ästhetische Medizin • Wiederherstellungschirurgie
Leistungen: Ästhetische Medizin mit Botox, Hyaluronsäure, PRP, Mesotherapie, Lipofilling, Ästhetische Chirurgie: Brustvergrösserung, -verkleinerung oder -straffung, Bauchstraffung, Oberarm-, Oberschenkelstraffung

Gesichtschirurgie: Lidkorrekturen, Facelift, Lippenoder Kinnkorrekturen, Ohranlegeplastik uvm.

Dr. med. univ. Elisabeth Zanon | Sanatorium Kettenbrücke | Sennstraße 1 | 7. Stock | 6020 Innsbruck Jetzt Termin vereinbaren unter: +43 512 211 275 12 | zanon@sanatorium-kettenbruecke.at | www.elisabeth-zanon.at
DR. MED. UNIV. ELISABETH ZANON
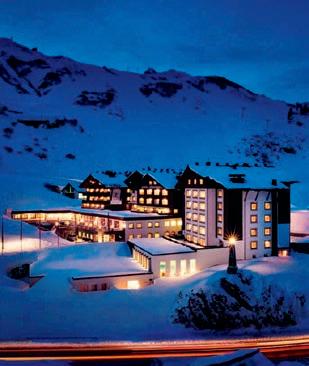






eco. inhalt 6 36 52 22 74 18 44 84
FOTOS: MARIAN KRÖLL, BIRGIT KOELL, ANDREAS FRIEDLE, FININ, TOM BAUSE, MARCEL A. MAYER
ECO.TITEL
18 BITTE WENDEN!
Unser Umgang mit den endlichen Ressourcen der Erde zeugt positiv betrachtet von menschlichem Tatendrang und ökonomischem Vorwärtsstreben, kritisch besehen aber auch von hartnäckiger Zukunftsvergessenheit und globaler Gerechtigkeitsblindheit.
22 ACHTSAM ( ER ) SEIN
Umweltökonom Markus Ohndorf über Ressourcenübernutzung, Wohlstandsmaßstäbe und Finanzarchitekturen.
28 DIE ZEIT DRÄNGT
Georg Brasseur will auf das zurückgreifen, was es in der Natur bereits gibt. Ein Gespräch zur Energiewende.
34 ANGST UND ANGSTMACHEREI
Ein Plädoyer für eine hoffnungsvolle Wirtschaftspolitik in Buchform.
ECO.WIRTSCHAFT
36 DIE LIEBE FAMILIE
Häufig wird der Erfolg von Familienunternehmen auf die Familie zurückgeführt und auf all das, was mit ihr assoziiert wird. Aber nicht immer sind Unternehmen erfolgreich „wegen“, manchmal sind sie es „trotz“ Familie. Family-BusinessExperte Markus Weishaupt im Interview.
ECO.ZUKUNFT
44 THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY Mit Problemen beschäftigt man sich oft erst dann, wenn sie da sind. In vielen Fällen ist das zu spät und nur weil man sie nicht auf den ersten Blick sieht, heißt es nicht, dass sie nicht schon vorhanden wären. Vorsorge kommt vor der Sorge – auch und vor allem bei der Cybersecurity.
52 DAS MUSS DOCH BESSER GEHEN
Innovationen ist inhärent, dass sie nicht ein Bedürfnis schaffen, sondern ein Problem lösen. Die zwei HTL-Schüler Patrick Jenewein und Marcel Maffey haben das mit ihrer Lawinensonde Avalano getan.
ECO.GELD
58 ERSTENS KOMMT ES ANDERS, ZWEITENS ALS MAN DENKT
Derzeit stehen die Zeichen zunehmend auf eine mögliche Zinsanhebungspause oder gar Lockerung der Geldpolitik. Doch es gibt Faktoren, die eine zweite Inflationswelle einleiten könnten.
64 LIEBER KONSERVATIV
„Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft“, sagte dereinst der Dramatiker Ludwig Anzengruber. Geht es nach Anlageberater Florian Weihs, so ist das Zitat derzeit aktuell wie selten.
ECO.MOBIL
74 OFFROAD - LUXUS
Kaum einem Autohersteller gelingt es, eine bessere Kombination aus komfortablem Luxus und perfekten Offroad-Eigenschaften zu kreieren, als Land Rover. Der Range Rover Sport First Edition D359 im Praxistest.
78 KERNUPDATE
BWM kommt kommt mit seinem neuen 330e xDrive Touring angerollt. Außen sind sich die Bayern treu geblieben, innen gibt‘s viel Neues.
80 ELEKTRO - RS
Nachdem bereits die SUV-Variante mächtig Eindruck gemacht hat, brachte Skoda in logischer Konsequenz auch eine SUV-Coupé-Variante seines elektrifizierten Enyaq iV auf den Markt.
ECO.LIFE
88 START INS KUNSTJAHR
In der Innsbrucker Galerie Nothburga ist aktuell die Nominiertenausstellung des Fritzi-GerberPreises zu sehen, Mitte Feber folgt mit Monika Köck und Holger Rudnick die erste – galeriegewohnte – Doppelausstellung. 04
HERAUSGEBER & MEDIENINHABER: eco.nova Verlags GmbH, Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, 0512/290088, redaktion@econova.at, www.econova.at
GESCHÄFTSLEITUNG: Christoph Loreck, Mag. Sandra Nardin ASSISTENZ: Martin Weissenbrunner CHEFREDAKTION: Marina Bernardi REDAKTION: eco.wirtschaft: Marian Kröll, Alexandra Keller, MMag. Klaus Schebesta, Stefanie Kozubek // eco.zukunft: Doris Helweg // eco.geld: Michael Kordovsky // eco.mobil: Felix Kasseroler // steuer.berater: Dr. Verena Maria Erian // recht.aktuell: RA Mag. Dr. Ivo Rungg // eco.life: Shiva Yousefi ANZEIGENVERKAUF: Ing. Christian Senn, Matteo Loreck, Daniel Christleth LAYOUT: Tom Binder LEKTORAT: Mag. Christoph Slezak DRUCK: Radin-Berger-Print GmbH
UNTERNEHMENSGEGENSTAND: Die Herstellung, der Verlag und der Vertrieb von Drucksorten aller Art, insbesondere der Zeitschrift eco.nova. GRUNDLEGENDE RICHTUNG: Unabhängiges österreichweites Magazin, das sich mit der Berichterstattung über Trends in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Gesundheit & Wellness, Steuern, Recht, Kulinarium und Life style beschäftigt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, sowie anderwertige Vervielfältigung sind nur mit vorheriger Zustimmung des Herausgebers gestattet. Für die Rücksendung von unverlangt eingesandten Manuskripten und Bildmaterial wird keine Gewähr übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar.
JAHRESABO: EUR 29,00 (13 Ausgaben). // Sind Beiträge in dieser Ausgabe in der Kopfzeile mit dem FIRMENNAMEN gekennzeichnet, handelt es sich um BEZAHLTE ANZEIGEN bzw. KOOPERATIONEN!
eco. inhalt
08
12
66
70
84 URLAUBS.TIPP 90 IM.GESPRÄCH
EDITORIAL
ECO.MMENTAR 10 11 ¾ FRAGEN
ECO.GRAFIK
ECO.STEUERN
ECO.RECHT
WARUM?
Nachrichten zu verfolgen, sollte eigentlich Antworten bringen. Immer öfter bleiben jedoch nur Fragezeichen übrig. Wir werden zwar mit jeder Menge Infos zu unwichtigen Details zugeschüttet, doch beim Warum großer Fragen bleibt es stockfinster.
arum ist Christine Lagarde noch im Amt? Sie leitet schließlich nicht irgendeine unbedeutende Zweigstelle einer Regionalbank, sondern ist die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB. Jahrelang wurde über die Notwendigkeit der Anhebung von Zinsen debattiert, um die Währung stabil zu halten. Jahrelang hat die EZB regelmäßig Prognosen als Basis ihrer ultralockeren Geldpolitik veröffentlicht, die sich im Nachhinein als grundfalsch herausgestellt haben. Natürlich sind höhere Zinsen speziell für südeuropäische Länder ein Problem, aber die erste Aufgabe der EZB ist nun einmal die Bekämpfung der Inflation. Nach jahrelangem Versagen brauchte es nicht mehr viel. Die Corona- und Ukraine-Krise haben den Funken geliefert, der unsere Währung nun schmelzen lässt wie Butter in der Sonne. Zur Kühlung wurden jetzt die Zinsen erhöht – viel zu spät.
Warum kann der Finanzminister noch ruhig schlafen? Die Coronahilfen haben 47 Milliarden Euro verschlungen. Das ist Platz 1 in der EU im Geldvernichten. Und jetzt fehlt bei jedem Kindergarten, bei jeder Kulturförderung, bei jedem Infrastrukturprojekt vorne und hinten das Geld. Und der Rucksack, den wir unserer jüngeren Generation umhängen, wird immer schwerer. Weil: Irgendjemand muss das alles zurückzahlen.
Bleiben wir bei der Jugend: Warum kann die Jugendministerin noch in den Spiegel schauen? Seit Jahren, nein Jahrzehnten, ist klar, dass die demografische Entwicklung auseinanderdriftet wie die Kontinentalplatten im Atlantik. Die Jüngeren werden immer weniger, die Älteren immer mehr. Das ist Gift für das Umlagesystem bei den Pensionen. Heuer müssen 25 Milliarden Euro jährlich aus dem Staatsbudget zugeschossen werden, vor zehn Jahren waren es noch 18 Milliarden. Dieses Geld fehlt bei … siehe oben.
Hätten wir den Experten zugehört und mit ernsthaften Reformen vor 20 Jahren begonnen, dann würden die Jungen noch eine Pensionsperspektive vorfinden.

WWarum verzeichnen wir auf der einen Seite den größten Arbeits- und Fachkräftemangel seit 50 Jahren – und kriegen auf der anderen Seite mehr als 300.000 Arbeitslose nicht in Beschäftigung? Die Politik überlegt sich alles Mögliche: Kinder zu betreuen, damit mehr Frauen arbeiten können. Die Bedingungen für angehende Pensionisten zu verbessern, damit Ältere länger im Job bleiben. Die Voraussetzungen für die Zuwanderung zu lockern, damit andere die Arbeit für uns erledigen. Kaum gedreht wird an der großen Schraube, die eigentlich nahe liegt: Die Rahmenbedingungen für Arbeitslose so zu gestalten, dass diejenigen, die bloß nicht wollen, auch einen Job annehmen. Das wäre übrigens ein Teil der Arbeitsmarktreform gewesen, die Schwarz und Grün lapidar für gescheitert erklärt haben. Warum bauen wir einen Tunnel, in dem kaum einer fahren wird? Kluge Projektbetreiber haben es von Anfang an gesagt: Der Bau des Brenner-Basistunnels ist die eine Sache. Wenn es jedoch weder eine Pflicht zur Verlagerung von der Straße auf die Schiene noch die nötigen Zulaufstrecken gibt, dann wird daraus nichts als ein großes, sündteures schwarzes Loch. Es sieht leider so aus, als ob die Mahner recht behalten würden. In zehn Jahren soll der Tunnel eröffnet werden und in Bayern ist noch nicht einmal die Trassenführung für die Zulaufstrecke klar.
Warum ist ein Zaun die schlechteste Lösung? Es ist eine Tatsache: Die EU–Außengrenze ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Nun schlagen manche Politiker vor, eine Grenze, wenn man sie schon hat, auch ernsthaft zu überwachen. Das wird heftig kritisiert. Es ist schon klar: Grenzsicherung allein ist nicht alles. Es braucht zusätzlich dringend Asylannahmestellen im Ausland und eine drastische Erhöhung der Entwicklungshilfe, um die Lebenssituation der Menschen außerhalb der EU zu verbessern. Was aber ist falsch daran, wenn eine Staatengemeinschaft ihre Grenzen auch sichert und kontrolliert?
Die Liste ist willkürlich, unvollständig und subjektiv. Aber es würde schon reichen, auf diese Fragen befriedigende Antworten zu bekommen. Sieht allerdings nicht so aus, als ob „da oben“ irgendjemand zuhören würde.
eco. mmentar 8
VON KLAUS SCHEBESTA
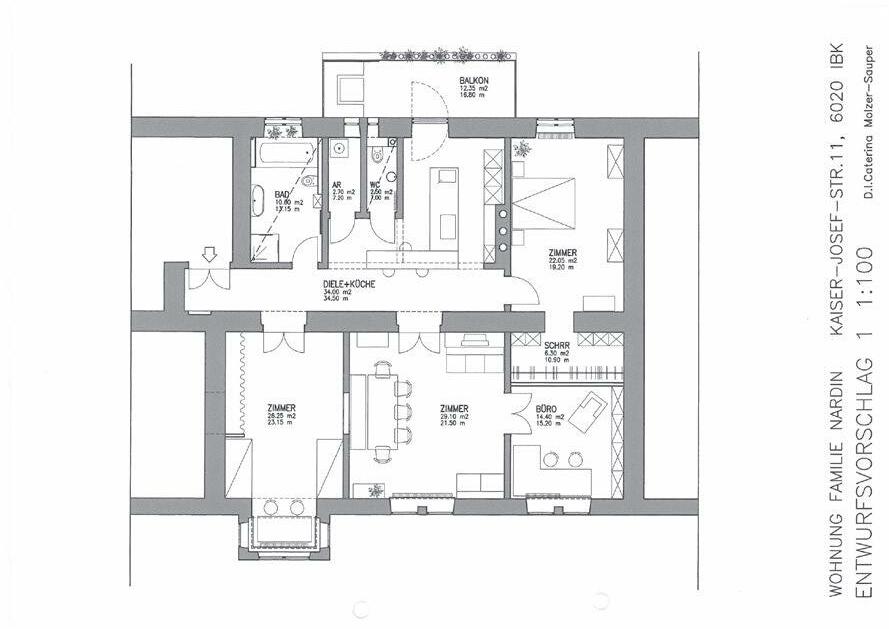






NÄHERE INFOS UNTER NARDIN@ECONOVA.AT ODER 0676/3344422 EXKLUSIVE
( 147 m 2 )
Kaiser-Josef-Straße, Innsbruck | 1. Stock | gegenüber Klinik | verkehrsberuhigte Lage | inklusive Kellerabteil | ab Mai 2023 | Miete € 2.300,– exkl. Betriebskosten | keine Maklergebühr
ALTBAUWOHNUNG

eco. porträt 10 © ANDREAS FRIEDLE
11¾ FRAGEN AN URSULA MUIGG
1. Wer sind Sie? Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Innsbruck und dem Gerichtspraktikum habe ich 2006 beim ÖAMTC Tirol in der Rechtsabteilung begonnen. Mobilität, Reisen und Fortbewegungsmittel aller Art haben mich schon immer interessiert und begeistert, daher bin ich sehr stolz darauf, dass ich seit Anfang dieses Jahres den ÖAMTC Tirol als Direktorin leiten darf.
2. Warum, glauben Sie, haben wir Ihnen geschrieben? Weil der größte Verein Tirols eine neue Landesdirektorin hat.
3. Wie lautet Ihr Lebensmotto? Bleibe neugierig und optimistisch und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
4. Was macht Sie stolz? Vor allem meine Familie und dass ich den außergewöhnlichen Verein ÖAMTC Tirol leiten darf.
5. Was bedeutet für Sie Luxus? Ein entspanntes Wochenende mit meiner Familie, ein gutes Buch und die Aussicht auf die Berge Tirols, die ich sowohl aus meinem Bürofenster als auch von zu Hause genießen und daraus Kraft tanken kann.
6. Mit welcher bereits verstorbenen Persönlichkeit würden Sie gerne einen Abend verbringen? Mit Maria Theresia von Österreich, weil sie eine außergewöhnliche Frau mit Visionen und Weitblick war. Bei einem Glas Wein würde ich mich gerne mit ihr über ihr Leben und ihre Politik unterhalten.
7. Was ist das ungewöhnlichste Thema, über das Sie richtig viel wissen? Ich probiere immer mal wieder etwas Neues aus – vor einiger Zeit habe ich begonnen, mich mit dem Brotbacken zu beschäftigen und weiß ziemlich viel über Sauerteig und optimale Gehzeiten.
8. Ihr Leben in Fahrzeugen: Wenn Sie den größten Meilensteinen in Ihrem Leben je ein Fahrzeug zuordnen müssten, welche wären das? Warum? • MATURA: VW Käfer, als Zeichen für Aufbruch und Veränderung der Mobilität. • ABSCHLUSS STUDIUM: Aston Martin, weil spritzig und als James-Bond-Auto gefinkelt. • HEIRAT UND GEBURT MEINER KINDER: Ein Volvo oder Volkswagen als Sinnbild für Verlässlichkeit. • GESCHÄFTSFÜHRUNG ÖAMTC TIROL: Ein Schiff mit einer großen Mannschaft und einer wichtigen Ladung für unsere Mitglieder.
9. Was macht für Sie gute Führung aus? Ein respektvoller und offener Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine klare Linie.
10. Welche (Charakter-)Eigenschaften sind Ihnen bei Mitarbeitern wichtig? ÖAMTC-Mitarbeiter*innen müssen Menschen mögen und ihnen helfen wollen. Die exzellente, fachkundige und freundliche Betreuung unserer Mitglieder sowie Teamfähigkeit sind oberstes Gebot.
11. Mit welchem Gefühl blicken Sie ins heurige Jahr? Mit einem sehr positiven. Die jüngsten Zeiten waren und sind schwierig genug, aber die positiven Gedanken und Gefühle kann mir niemand wegnehmen.
11¾ : WELCHE FRAGE WOLLTEN SIE SCHON IMMER BEANTWORTEN, NUR HAT SIE NOCH NIE JEMAND GESTELLT?
MUIGG: Es ist zwar zum Glück nicht so, dass mir diese Frage noch nie gestellt wurde, aber am liebsten wären mir im Moment Anfragen von guten KFZ-Techniker*innen, die gerne beim ÖAMTC Tirol arbeiten wollen.
eco. porträt 11
EINE FRAGE DER ZEIT
In der heutigen Schnelllebigkeit scheint die kostbare Ressource Zeit stetig knapper zu werden. Und manchmal würde man sie einfach gerne anhalten. Das Online Research Institut Marketagent hat rund 105.500 Menschen quer über den Globus zu ihrem Verhältnis zur Zeit befragt.
Unser Tipp für 2023: Probier’s mal mit Gemütlichkeit!
70 %
43 %
70 %
HALTEN PÜNKTLICHKEIT FÜR WICHTIG, UM DEN TAG PLANEN ZU KÖNNEN. 72 % DER BEFRAGTEN – VOR ALLEM MÄNNER – BESITZEN EINE ARMBANDUHR.
DER BEFRAGTEN FINDEN, DIE ZEIT RENNT IHNEN ZU SCHNELL DAVON.
FÜHLEN SICH EINMAL ODER MEHRMALS TÄGLICH GESTRESST. ÖSTERREICH LIEGT MIT 38 % IM GROBEN WELTWEITEN SCHNITT.
„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.“
GEORGE ORWELL, SCHRIFTSTELLER
40 %
GEBEN AN, DASS SIE DURCH DIE CORONAPANDEMIE MIT ALL IHREN BEGLEITERSCHEINUNGEN ZEIT VERLOREN HABEN.
90 %
VERSPÜREN ZUMINDEST HIN UND WIEDER DEN WUNSCH, DIE ZEIT ANHALTEN ZU KÖNNEN, UM EINE VERSCHNAUFPAUSE ZU HABEN.
ASTRID LINDGREN, SCHRIFTSTELLERIN
38 STUNDEN
ARBEITEN DIE ÖSTERREICHER*INNEN IM SCHNITT PRO WOCHE UND LIEGEN DAMIT IM WELTWEITEN MITTELFELD. ÜBER DIE HÄLFTE WÜRDEN GERNE WENIGER STUNDEN MIT ARBEIT VERBRINGEN
12 STUNDEN
WERDEN HIERZULANDE PRO WOCHE DURCHSCHNITTLICH FÜR DIE ARBEIT IM HAUSHALT AUFGEWENDET. RUND EIN DRITTEL DER ÖSTERREICHER*INNEN WÜRDE GERN WENIGER ZEIT DAFÜR BENÖTIGEN.
DIE LIEBSTE TAGESZEIT
26 % DER BEFRAGTEN WELTWEIT HALTEN DEN ABEND FÜR DIE SCHÖNSTE TAGESZEIT, GEFOLGT VOM MORGEN MIT 23 %.
Unterschiede gibt es vor allem zwischen den Generationen: Während die jüngeren Befragten eher Morgenmuffel und dafür lieber Nachtschwärmer sind, wird mit steigendem Alter der Morgen wichtiger als die späten Stunden des Tages. Auch zwischen den Kontinenten gehen die Geschmäcker auseinander. In Afrika und Lateinamerika wird die Nacht wesentlich öfter als Lieblingszeit genannt als von den Europäer*innen.
Quelle: Marketagent.com
„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen.“
5 % MITTAG 11 % VORMITTAG 23 % MORGEN
NACHMITTAG ABEND NACHT
26 % 18 % 17 %
Yey ... Flaute!
Bei seinem Wirtschaftsausblick Mitte Jänner startet Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser optimistisch ins neue Jahr. Mit der Ankündigung einer Wirtschaftsflaute nämlich. In Anbetracht dessen, dass man eine Rezession erwartet hat, ist das tatsächlich eine gute Nachricht, und wenn man weiß, welche Rolle die Psychologie in Sachen wirtschaftliche Stimmungslage spielt, ist es wohl nicht verkehrt, ein wenig Optimismus zu verbreiten. So wird die Tiroler Wirtschaft 2023 voraussichtlich zwar nur moderat wachsen, aber immerhin WIRD sie wachsen. „Nach einem insgesamt kräftigen Wachstum von real rund sechs bis sieben Prozent der Bruttowertschöpfung im Jahr 2022 gehen wir davon aus, dass Tirol im Jahr 2023 – trotz Schwächephase im ersten Quartal – ein reales Wirtschaftswachstum von bis zu zwei Prozent erreichen kann, was über dem Österreichschnitt liegt“, glaubt Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit der Wirtschaftskammer Tirol. In Summe habe der Wirtschaftsstandort Tirol die Krisen schneller verkraftet als erwartet, Ende 2023 soll das Vor-Coronaniveau erreicht sein. Auffallend ist, dass sich die wirtschaftliche Lage vor allem bei den Produktionsbetrieben im Vergleich zur Situation von vor einem Jahr deutlich eingetrübt hat, während sich der Tourismus wieder äußerst zufrieden zeigt. Über die Branchen hinweig zeichnet sich sohin ein ausgeglichenes Bild, was zeigt, dass der Branchenmix Tirols Wirtschaft durchaus austariert. Während in der Pandemiezeit die Industrie und Bauwirtschaft die Konjuktur stützten, ist es 2023 der Tourismus. Die größten Herausforderungen sehen die Leitbetriebe wenig überraschend in den hohen Energie- und Rohstoffpreisen, dem Arbeitskräftemangel sowie den Arbeitskosten, auch die Zinswende macht sich bemerkbar. Prognosen waren schon immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen (vermeintlich gesagt von Karl Valentin). Leichter ist es ob der derzeitigen Gemengelage nicht geworden. In diesem Sinne: Schau ma mal.

wirtschaft & unternehmen WIRTSCHAFT 14
NACHHALTIGE LÖSUNGEN

Das Thema Auto ist in vielen Bereichen schon lange zum Politikum geworden. Das Thema Parken ist es nicht minder. Vor allem im städtischen Bereich braucht es verkehrstechnisch sinnvolle und nachhaltige Lösungen – das schließt kluge Parkkonzepte mit ein. Die BOE Parking & Real Estate betreibt zwölf Garagenobjekte in Innsbruck und hat kürzlich zu einem Arbeitsgespräch mit der Stadt Innsbruck geladen. „Für uns sind die Herausforderungen vielfältig: Es gilt, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit Handel und Tourismus mit entsprechend dynamischen Verkehrsleitsystemen auszustatten und damit auch die Bewohner*innen der Stadt zu entlasten. Um möglichst viele neue Nutzungsmöglichkeiten an der Oberfläche zu erhalten, müssen wir zusätzlich notwendige Parkmöglichkeiten – wenn möglich durch unterirdische Garagen – schaffen“, so Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Aus den Umlandgemeinden, touristischen Regionen und Plateaus kämen täglich tausende Menschen in die Stadt. Es gelte daher sowohl dem Lebensraum als auch dem Wirtschaftsraum Qualität zu erhalten und aktuelle wie künftige Verkehrsströme zu planen. „Gerade im städtischen Raum ist uns die Planung und Umsetzung möglichst effizienter und nachhaltiger Projekte ein großes Anliegen“, sagt Mario Delmarco, BOE Parking & Real Estate. Allein in der Maria-Theresien-Straße bewegen sich täglich rund 40.000 Menschen. „Hier betreiben wir als BOE auch mehrere Garagen mit direktem Zugang. Aber auch hier benötigt es in Zukunft grundlegend neue Konzeptionen, Stichwort E-Mobility, die nicht nur Autos, sondern auch Mopeds und Fahrräder betrifft, was wiederum den Ausbau einer notwendigen Infrastruktur wie der Errichtung von E-Ladestationen mit sich bringt“, meint Delmarco. Der Arbeitsauftrag ist also klar, wir freuen uns auf Lösungen.
Marina Bernardi, Chefredaktion

UmkehrSchluss
Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wären Sie an irgendeiner Stelle anders abgebogen?
Wir treffen täglich ziemlich viele Entscheidungen, viele davon unbewusst und die meisten sind nicht unbedingt wichtig. Ob man ein Marillen- oder Pfirsichjoghurt kauft, wird vermutlich wenig Einfluss auf Ihr weiteres Leben haben (es sei denn, Sie sind eventuell gegen eins der beiden allergisch). Und dann gibt es Entschlüsse, die prägen das Leben entscheidend mit. Nach einigen Jahren des Mit-dieser-Entscheidung-vor-sich-hin-Lebens kann es passieren, dass man sich rückblickend vielleicht besser anders entschieden hätte. Wissen kann man es natürlich nie. Meist kommen solchen Gedanken, wenn man ohnehin mit dem Status quo hadert, dann erscheint jede andere Option per se schon als die bessere. Das Gute ist: Wir können viele Entscheidungen in unserem Leben revidieren – weil wir klüger geworden sind oder sich gänzlich neue Möglichkeiten auftun – und mitunter auch dorthin zurückkehren, wo wir das letzte Mal vermeintlich falsch abgebogen sind. Zumindest aber können wir den eingeschlagenen Weg verlassen und nach einem anderen suchen. Das wird nicht immer ohne Kollateralschäden funktionieren, manche Themen aber sind zu wichtig, um die Kehrtwende nicht wenigstens zu versuchen. Im Kleinen mag es nur das einzelne Individuum betreffen (was für denjenigen natürlich unschön, aber zumindest gesamtheitlich nicht wirklich relevant ist), bei den richtig großen Themen geht es aber um uns alle als Kollektiv. Und in manchen Bereichen um nichts weniger als die Menschheit. Beim Klima zum Beispiel, beim Thema Gerechtigkeit, der globalen Ernährung oder Armut. Während man sich im Privaten noch um die ein oder andere Wende-Entscheidung herumbequemen kann, braucht‘s bei den wirklich großen Problemen rasches Handeln. Bevor ganz Schluss ist mit Umkehr.
Anregungen und Kommentare bitte an bernardi@econova.at
eco. wirtschaft 15
Die Geschäftsführer von City-Parking (Deutschland) Josef Solnier und Tobias Schwinger suchen mit dem Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber und Mario Delmarco, BOE Österreich, nach sinnvollen, nachhaltigen Parklösungen für die Stadt.
eco. mmentar
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE © TANJA CAMMERLANDER
„Es ist ein verbreiteter menschlicher Fehler, bei schönem Wetter nicht mit Stürmen zu rechnen.“ NICCOLÒ MACHIAVELLI
KEIN SPIEL MEHR
Wenn wir 2023 vom Internet einer neuen Generation, dem Web 3.0, Metaversum, NFT, Blockchain, Crypto und Avataren sprechen, sprechen wir von der Technologie – nicht von ihrer Anwendung. Dieses Narrativ wird sich in den kommenden Monaten ändern. Der Hype kommt zur Ruhe. Es folgt das Erwachen in virtuellen Realitäten.
Am 5. Oktober 2023 startet in Kitzbühel die dreitägige internationale Metaverse-Konferenz Metagonia. Als erste disruptive Alternative zu etablierten Formaten entmystifiziert sie die Technologie der Zukunft und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sie öffnet das Tor in neue digitale Welten für 99 Prozent unserer Gesellschaft. Tiroler Unternehmer*innen ermöglicht die Metagonia eine neue, ungeahnte Beziehung mit der neuen Technologie einzugehen. Sie befähigt die Teilnehmer*innen, das Internet einer neuen Generation – genannt Web3 – zu entdecken und zu verstehen, um neue Erlösquellen zu schaffen. Angetrieben von Kreativität, Vorstellungskraft und Visionen schafft die Konferenz einen lebensnahen Zugang zu neuen digitalen Welten. Eingebettet in die wundervolle Bergwelt der Kitzbüheler Alpen, zwischen Avataren und Avantgarde, Blockchain und Bergwelt, Crypto und Cocktails bietet sich ein vielfältiges und komplexes Themenspektrum, das internationale Top-Speaker*innen lebensnah, einfach und verständlich vermitteln und anwendbar machen. Beruflich oder privat.

Tiroler Unternehmer*innen profitieren von der Teilnahme an der Metagonia, da sie die neuesten Entwicklungen einfach und verständlich vermittelt bekommen, Netzwerke aufbauen und neue Kunden und Partner finden können. Sie treffen auf internationale Gäste und auf Tatendränger*innen der Ge-
neration Z, auf der Suche nach realen beruflichen Herausforderungen in digitalen Welten.
Die intime Atmosphäre ermöglicht es, mit führenden Experten aus der Branche zu sprechen und Einblicke in lebensnahe Beispiele zu erhalten: Welche digitalen Welten entstehen gerade, wie betritt man sie und wie erscheinen digitale Identitäten?
Wie nutzt man digitale Güter? Was gilt es zu beachten? Eine einzigartige Gelegenheit, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die neuesten Entwicklungen zu verfolgen, um sachliche und fachlich fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Potenzial der Metagonia sorgt auch im Bezirk Kitzbühel für wirtschaftliches Momentum. Bisher unerreichte Gästegruppen, hohes internationales Interesse und nicht zuletzt das positive Image, Zukunftsthemen zu belegen, heizen die Fantasie der Stadt Kitzbühel, des Kitzbüheler Tourismusverbandes und der Bergbahn AG Kitzbühel an, die als Partner die Veranstaltungsplattform Metagonia unterstützen. Mehr dazu auf Seite 48.
eco. mmentar 16
VON PETER BECKE
„Beim Thema Web3 hat man das Gefühl, jeder versucht einem den Backofen zu erklären, statt Kuchen zu backen.“
WEST PARK INNSBRUCK
WIR BIETEN
- ein attraktives Büro-, Labor- bzw. Gewerbeobjekt in zentrumsnaher TOPLAGE
- Mietflächen ab 100m² zu ATTRAKTIVEN MIETZINSEN
- zukunftssichere Bürostandards durch räumliche und digitale FLEXIBILITÄT
- multifunktionale Arbeitswelten mit gewinnbringenden SYNERGIEN
- alternative Energiekonzepte mit Grundwasserwärmepumpe, Baukernaktivierung sowie großflächiger PV-Anlagen zur SENKUNG DER LAUFENDEN BETRIEBSKOSTEN
- eine gesamtheitliche Betrachtungsweise von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Erreichung der KLIMAAKTIV- oder ÖGNI-ZERTIFIKATE
- einen barrierefreien Arbeitsort für Menschen mit hohen Ansprüchen an SOZIOKULTURELLE UND FUNKTIONALE QUALITÄT
- naturnahe Grünanlagen als Erholungszonen und als wichtige ÖKOLOGISCHE AUSGLEICHSFLÄCHEN
- eine 2-geschossige Tiefgarage für ausreichend PARK- UND LAGERMÖGLICHKEITEN
Projektentwickler: WEST PARK Immobilien GmbH & Co KG



Stadtteil:
Innsbruck - Höttinger Au
Adresse: Exlgasse
Baubeginn: bereits erfolgt im Q IV/2022
Fertigstellung: geplant Q I/2025
MIETANFRAGEN AN:
bauwerk Immobilien GmbH I Hr. Michael Scheidle I T. +43.512.284338 I info@bauwerk.tirol I www.bauwerk.tirol
eine Kooperation der bauwerk Gruppe & Seidemann Holding
Immobilien und

bauwerk

BITTE WENDEN!
Unser kollektiver Umgang mit den endlichen Ressourcen der Erde zeugt positiv betrachtet sowohl von menschlichem Tatendrang und ökonomischem Vorwärtsstreben, kritisch besehen aber auch von hartnäckiger Zukunftsvergessenheit, Hybris – gestern galt sie der Produktion, heute dem Konsum – und globaler Gerechtigkeitsblindheit. Letztere Aspekte treten in den vergangenen Jahrzehnten immer nachdrücklicher in den Vordergrund.
 TEXT: MARIAN KRÖLL
TEXT: MARIAN KRÖLL
eit mindestens 50 Jahren, wahrscheinlich aber noch viel länger, ist allgemein bekannt, dass sich endliche planetare Ressourcen nicht beliebig lange mit unendlichem, teils exponentiellem Wachstum vertragen. Mit seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ hat der einflussreiche Thinktank – nicht für seinen Mangel an Visionen bekannt – bereits 1972 darauf hingewiesen, dass exponentielles Wachstum binnen hundert Jahren an die absoluten Wachstumsgrenzen des Planeten führen könnte. Die Hälfte dieser Zeit ist verstrichen, die Szenarien, die der Club of Rome aufgezeigt hat, sind teilweise bereits eingetroffen.
Schon in den 1970er-Jahren formulierte man im Bericht, dass es mit dem sanften Drehen an ein paar Stellschrauben nicht getan sein würde: „Unsere gegenwärtige Situation ist so verwickelt und so sehr Ergebnis vielfältiger menschlicher Bestrebungen, daß keine Kombination rein technischer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Besserung bewirken kann. Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleichgewichtszustände führen.“ Der Bericht war indes weniger als Weissagung gedacht denn als Denkanstoß, der sensibilisieren sollte für das Verhalten komplexer Systeme, die Dynamiken exponentiellen Wachstums und die Risiken, die erst mit Verzögerung schlagend werden.
Eine Analogie aus der Klimaforschung sind die ebenso vielzitierten wie oft missverstandenen Kipppunkte. Das Klimasystem kann nämlich höchst nichtlinear reagieren, und steht dieses System nahe an der Kippe, können bereits kleine Änderungen – etwa in der Temperatur – für weitreichende, irreversible Folgen sorgen. Die Wissenschaft hat zwischenzeitlich 16 dieser Kippelemente identifiziert, eine Begrenzung des globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf zwei Grad – das ohnehin bereits ambitionierte Zwei-Grad-Ziel –dürfte nach dem Stand der Forschung nicht ausreichen, um alle diese zu stabilisieren.
SCHUBUMKEHR
Heute ist evident, dass zahlreiche Ressourcen der Erde chronisch übernutzt werden und das mögliche Gegenmittel, das dieses Problem zwar nicht beheben, aber doch signifikant lindern kann, die Kreislaufwirtschaft, noch in den Kinderschuhen steckt. Folgt man dem neuen Club-of-Rome-Bericht „Earth for All“, er trägt den vielsagenden Untertitel „Ein Survivalguide für unseren
Planeten”, dann braucht es nicht bloß eine Kehrtwende, sondern derer gleich fünf, allesamt außerordentlich, um das Ruder noch herumzureißen.
Nun könnte man berechtigterweise fragen, ob es nicht auch eine Nummer kleiner ginge. Den potenziell monströsen Folgen eines More-of-the-Same kann man aber auch mit steilen Ansagen begegnen, um die Dimension der Herausforderung zu verdeutlichen. Die Szenarien des Club of Rome sind allesamt nicht aus der Luft gegriffen, sondern Ausfluss eines komplexen Rechenmodells, dem eine große Menge an Variablen und damit Daten zugrunde liegen. Das Earth4All-Modell berücksichtigt dabei kausale Rückkopplungen, die komplexe Systeme kennzeichnen. Die Marschrichtung ist klar: Es geht um die Wurst, um nichts Geringeres als die Zukunft der Menschheit. Der eingeschlagene Pfad soll verlassen werden, was die Armut, die Ungleichheit, die Geschlechterverhältnisse, die Ernährung und nicht zuletzt das Energiesystem betrifft. All das soll im globalen Maßstab geschehen, und zwar am besten gestern. Geht alles seinen gewohnten Gang, wird den Menschen die Entscheidung über die Gestaltung der Zukunft abgenommen, sind wir doch auf dem besten Weg, die Grenzen des Wachstums aufgezeigt zu bekommen, anstatt uns bewusst für unsere eigenen entscheiden zu können. Das Selbstbeschwichtigungsmantra „Alles wird gut!“ verfängt nicht mehr. Heute sind wir noch einen Schritt vom Abgrund entfernt, morgen sind wir, wenn alles so weitergeht, vielleicht schon einen Schritt weiter.
Man muss kein allzu großer Pessimist sein, um anzuzweifeln, dass sich das alles ausgehen wird. Die möglichen Konsequenzen, die weiteres Zögern und ein Weitermachen wie bisher zeitigen könnten, sind allerdings zu schwerwiegend, um nicht die Kehrtwende zumindest zu versuchen. Das internationale politische System ist nicht dazu angelegt, vorbehaltlos zu kooperieren. Supranationale Instanzen sind häufig zahnlos oder aber gelähmt. Das gilt vor allem in instabilen Wendezeiten, in denen einzelne Staaten anscheinend die Weltordnung neu ausverhandeln wollen und dafür das Schlachtfeld als ebenso legitime wie geeignete Arena betrachten. Eigentlich bräuchte es so etwas wie eine Weltinnenpolitik, um die Herausforderungen koordiniert in Angriff nehmen zu können und Trittbrettfahrer abzuschrecken.
eco. titel 20
Geht alles seinen gewohnten Gang, wird den Menschen die Entscheidung über die Gestaltung der Zukunft abgenommen, sind wir doch auf dem besten Weg, die Grenzen des Wachstums aufgezeigt zu bekommen, anstatt uns bewusst für unsere eigenen entscheiden zu können.
UNGLEICHGEWICHTSZUSTÄNDE
Von einem Gleichgewichtszustand ist die Menschheit global weit entfernt, die Ungleichheit nimmt punktuell sogar zu. Die globalen Vermögensungleichheiten sind noch ausgeprägter als die Einkommensungleichheiten. „Die globalen Ungleichheiten scheinen heute ungefähr so groß zu sein wie auf dem Höhepunkt des westlichen Imperialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts“, heißt es im Bericht zur weltweiten Ungleichheit 2022. Mit dieser Einkommens- und Vermögensschieflage geht zwangsläufig auch eine ökologische Unwucht einher. Eine durchschnittliche Person emittiert gemäß Ungleichheitsbericht 6,6 Tonnen Kohlendioxidäquivalent (CO2) pro Kopf und Jahr. „Die obersten zehn Prozent der Emittierenden sind für fast 50 Prozent aller Emissionen verantwortlich, während die unteren 50 Prozent nur zwölf Prozent der Gesamtemissionen produzieren“, heißt es dort. Dass sich besonders idealistische und besorgte Menschen irgendwo festkleben, weil sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und ihre jeweiligen Regierungen zum Handeln bewegen oder vielmehr zwingen wollen, ist weniger schlimm als der Umstand, dass sich allzu viele Länder politisch festgeklebt haben an Positionen, die um der Vernunft willen längst hätten aufgegeben werden müssen. Vieles, was bereits in der Vergangenheit hätte getan werden können, wurde bestenfalls verschlafen, schlimmerenfalls boykottiert oder gar sabotiert. Klimakleben ist sicher nicht besonders klug, es ist ein Akt der Verzweiflung und des zivilen Ungehorsams gegen eine Politik, die sich selbst einzementiert hat und nur sehr träge auf Notwendigkeiten für Veränderungen reagiert, für welche die Gesellschaft vielleicht schon eher bereit ist. Trägheit und Defätismus können gerade in der Klimapolitik zu Self-Fulfilling-Prophecies werden. Es sind in erster Linie die Bürger*innen, die es in der Hand haben, in und außerhalb der Wahlzelle mehr Druck auf ihre Regierungen auszuüben, aktiv zu werden. Es versteht sich von selbst, dass die angeregten Kehrtwenden auf der globalen Bühne vollzogen werden müssen. Das heißt freilich nicht, dass nicht auch auf den darunterliegenden Ebenen – vom Individuum über die Familie und innerhalb jeder Gebietskörperschaft – der Boden für einen „Giant Leap“, wie das positivste Szenario im Bericht heißt, bereitet werden kann.
DIE IDEE IST GUT, DOCH DIE WELT NOCH NICHT BEREIT
Im Gegensatz zu den Dinosauriern ist es kein unvorhersehbarer, plötzlicher Asteroideneinschlag, der der Menschheit die Lebensgrundlagen entzieht. Das besorgt sie offenbar selbst, (Fort)schritt für (Fort)schritt. Es könnte als besonders zynische Form der Gerechtigkeit gelesen werden, dass ausgerechnet das, was der Mensch unablässig zerstört, ihn letztlich selbst zerstört. Die zukünftigen Herausforderungen werden nicht kleiner, ganz unabhängig davon, welcher Weg eingeschlagen wird.
Es ist nicht alles verloren. Der Mensch ist, wenn er sich darauf besinnt, doch auch ein vernunftbegabtes Wesen, das durchaus imstande ist, mit widrigen Bedingungen zurande zu kommen. Eine Spezies, die vielleicht sogar fähig ist, Wirtschaft und Zusammenarbeit für ein gedeihliches Zusammenleben auf dieser Erde – eine andere haben wir nicht – anders zu denken. Resilient zu sein, wie es heute heißt, und ein wirklich weltumspannendes Projekt anzugehen, das im Wortsinn TOO BIG TO FAIL ist.
Im Anthropozän hat der Mensch das Fliegen gelernt und sich „über die vom Holozän gesetzten Grenzen hinauskatapultiert“, steht im Bericht. Nun ist es Zeit, zur Landung anzusetzen, die wir noch selbst gestalten können. Eine sanfte Landung, welche die Erde für alle zu einem Ort macht, um in Würde und relativer Stabilität leben zu können.
CLUB
OF ROME
Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Experten unterschiedlicher Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein.
Das Buch „Earth for All“ ist der neue Bericht des Club of Rome, erschienen im September 2022 und damit 50 Jahre nach „Die Grenzen des Wachstums“. Oekom Verlag, 256 Seiten, EUR 25,–

21 eco. titel
Dass sich besonders idealistische Menschen irgendwo festkleben, weil sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen wollen, ist weniger schlimm als der Umstand, dass sich allzu viele Länder politisch festgeklebt haben an Positionen, die um der Vernunft willen längst hätten aufgegeben werden müssen.

22
Anders als im Film „Don’t look up“ ist Markus Ohndorf einer, der sich gern den Tatsachen stellt. Schon von Berufs wegen.
„WIRD DIE NATUR CHRONISCH ÜBERNUTZT, IST IRGENDWANN NICHTS MEHR ÜBRIG“
Mit dem Umweltökonomen Markus Ohndorf von der Universität Innsbruck haben wir den neuen Bericht des Club of Rome seziert, über Ressourcenübernutzung, Wohlstandsmaßstäbe, Finanzarchitekturen und die Pflicht des Wissenschaftlers gesprochen, bei existenziellen Fragen seinen Elfenbeinturm zu verlassen.
INTERVIEW & FOTOS: MARIAN KRÖLL
ECO.NOVA: Geht es nach dem Club of Rome, soll es nicht nur eine, sondern gleich fünf Kehrtwenden für zukünftige Generationen richten. Die Armut soll beendet werden, die eklatante globale Ungleichheit beseitigt, Frauen sollen ermächtigt werden, ein für Menschen und Ökosysteme gesundes Nahrungsmittelsystem aufgebaut sowie der Übergang zu sauberer Energie vollzogen werden. Das sind gleich mehrere Paradigmenwechsel. Glauben Sie an diesen „Giant Leap“ oder wird es eher ein ebenfalls beschriebenes „Too Little too Late“-Szenario werden?
MARKUS OHNDORF: In diesen Szenarien findet sich eine optimistische und eine pessimistische Weltsicht wieder. Das, was bisher in Bezug auf den Klimawandel getan wurde, ähnelt sehr stark dem „Too Little too Late“-Szenario. Wir hinken hinten nach und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es so weitergeht. Mittlerweile gilt das 1,5-GradZiel als verfehlt. Das Pariser Klimaschutzübereinkommen wurde als Nachfolger des Kyoto-Protokolls gefeiert, es muss sich aber erst noch bewähren. In Europa hat die Klimaschutzpolitik zwar eine starke Tradition, es ist allerdings fraglich, ob sich das auf die Welt überträgt.
Selbst das, was die EU tut, würde umgelegt auf die Welt nicht reichen, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. Das würde nicht reichen, aber ge-
rade in meinem Berufsfeld hofft man noch, dass noch der große Durchbruch kommt.
Die Wirtschaft scheint in einer Abhängigkeit vom Wachstum gefangen. Wie könnte aus Ihrer Sicht eine Postwachstumsökonomie aussehen? Kann eine solche im doppelten Sinn nachhaltig funktionieren? Mit dem Club-of-Rome-Bericht ist etwas klarer geworden, was Wachstumskritik eigentlich bedeutet. Es ist keine Kritik am Wachstum, an der kontinuierlichen Schaffung eines Mehr an Werten. Das ist moralisch nicht fragwürdig. Die Frage ist, wie man zu diesem Mehrwert kommt.
Durch eine fortwährende Übernutzung natürlicher und endlicher Ressourcen. Es ist tatsächlich diese Übernutzung, die moralisch fragwürdig ist, nicht das Wachstum an sich. Könnte man dieses Wachstum erzeugen, ohne die Ressourcen zu übernutzen, und es fair verteilen, würde sich niemand daran stoßen.
Ist die globale Ungleichheit die Mutter aller Probleme? Das könnte man so sehen. Ich bin nicht sicher, ob die Ungleichheit Ursache oder Wirkung ist. Man muss dem Club of Rome zugutehalten, dass sich mittlerweile die Ansicht durchgesetzt hat, dass arme Länder in jedem Fall wachsen dürfen. Es wäre unmoralisch, da nicht zu differenzieren.
Ist der Wohlstand auf der Erde ein Nullsummenspiel? Wenn Wohlstand ohne die negativen Begleiterscheinungen – wie die Übernutzung der Ressourcen – geschaffen werden kann, dann ist das kein Nullsummenspiel. Als Ökonomen gehen wir davon aus, dass Dinge in zusätzliche Werte transformiert werden können.
Ist das BIP noch die geeignete Messgröße, um wirtschaftliche und soziale Prosperität zu messen? Was halten Sie vom im Bericht vorgeschlagenen Wohlergehensindex? Das BIP ist kein gutes Wohlstandsmaß. Das weiß jeder, der sich damit
eco. titel 23
„Aus umweltökonomischer Sicht ist die Besteuerung der Ressourcennutzung statt Arbeit oder Kapital oder irgendwelche Märkte immer vorteilhaft.“
MARKUS OHNDORF
beschäftigt. Die Frage ist aber immer, ob alternative Vorschläge besser sind.
Dennoch gibt es eine Fixierung auf das BIP als Maß der Dinge. Weil es eine so schön einfache Zahl ist, die einfach zu vergleichen ist. Daran krankt auch der Wohlergehensindex. Die Grenzen der Aussagekraft des BIP sind inzwischen wissenschaftlich so viel diskutiert worden, dass man sie kennt und bei Vergleichen mitdenkt. Bei diesem Wohlergehensindex, den der Club of Rome als Alternative vorgeschlagen hat, lässt sich jede einzelne Komponente kritisieren. Für das Kriterium „Verbundenheit“ werden in den Modellrechnungen dort die Staatsausgaben pro Kopf als Maß herangezogen werden. Das heißt, dass ich auch ein hohes Maß an Verbundenheit erreichen kann, wenn die Staatsausgaben sehr ineffizient sind oder das Geld verschleudert wird.
Ist es dennoch sinnvoll, die Aufmerksamkeit vom BIP wegzulenken und den Sinn dafür zu schärfen, dass es auch noch andere wichtige Dinge gibt, an denen man sich orientieren könnte? Da bin ich ganz dafür. Allerdings sollte es nicht zu simpel sein. Für das Kriterium „Natur“ verwenden die Modellrechnungen des Club of Rome etwa ausschließlich die Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur. Der Klimawandel ist sicher global betrachtet das dringendste Problem unserer Zeit, es gibt aber eine ganze Menge regionaler Umweltprobleme, die unberücksichtigt bleiben. Die Idee ist gut,
aber die herangezogenen Maßzahlen greifen häufig zu kurz. Beim BIP wissen wir, was wir daraus herauslesen können und was nicht.
Der Club of Rome schlägt auch eine Transformation der globalen Finanzarchitektur und neue Wirtschaftslogik vor. Kritisiert wird vor allem der Rentierkapitalismus, in dem Geld mit Geld und dem schwankenden Wert bestimmter Vermögenswerte verdient werde, unter anderem als „nicht nachhaltiges Monopolyspiel“. Können Sie diese Kritik nachvollziehen oder woran krankt die bestehende Ordnung tatsächlich? Beim Zusammenbruch der Kryptowährungsmärkte hat man diese Kritik nachvollziehen können. Kryptowährungen sind nur so viel wert, wie ihre Käufer bereit sind, dafür zu bezahlen. Das, was als Rentierkapitalismus kritisiert wird, lässt sich anhand von Kryptowährungen gut illustrieren. Allgemein kann Spekulation sowohl stabilisierend als auch destabilisierend wirken. Nobelpreisträger James Tobin hat die Tobin-Tax vorgeschlagen, die als Finanztransaktions-
steuer auf Devisengeschäfte konzipiert ist. Damit ließe sich die Spekulation durchaus in den Griff bekommen. Ob das auf Aktienoder Derivatmärkte sinnvoll übertragbar wäre, müsste man sich im Detail ansehen. Für Derivate könnte ich mir so etwas vorstellen. Finanzmärkte haben aber ganz allgemein eine wichtige ökonomische Funktion. In ihnen sollen Ressourcen einer Nutzung zugeordnet werden, die letztlich allen ein besseres Leben ermöglichen soll. Der Markt sorgt mit seinen Preisen dafür, dass Werte dorthin fließen, wo die höchste Bewertung durch den Käufer stattfindet.
Das gilt für einen funktionierenden Markt, aber den letzten großen Finanzkrisen lag Marktversagen zugrunde. Ich glaube nicht, dass Marktversagen und -blasen langfristig das größte Problem sind. Diese Blasen bringen das Finanzsystem immer wieder einmal in Schwierigkeiten. Es korrigiert sich dann aber mehr oder weniger von selbst. Es ist tatsächlich die Ressourcenübernutzung. Die Natur ist endlich, wird sie chronisch übernutzt, ist irgendwann nichts mehr übrig.
Der Markt hat sich 2008 eher weniger als mehr selbst korrigiert, sondern musste vom Steuerzahler gerettet werden. Gewinne wurden privatisiert, Verluste sozialisiert. Lässt man den Marktmechanismen ihren Lauf, sollte es keine Bail-outs um jeden Preis geben dürfen. Das ist richtig. Es gibt aber auch eine Interaktion zwischen Wirtschaft und Politik. Es ist politisch nicht durchsetzbar, gewisse Unternehmen nicht zu retten, weil sie im System eine große Rolle spielen und einfach zu viele Arbeitsplätze dranhängen.
Dieses Treiben firmiert dann unter dem Titel „Too big to fail“. Genau. Derartiges gibt es aber auch bei großen Unternehmen, die nicht der Finanzwirtschaft zuzurechnen sind. Da werden dann plötzlich die marktgläubigsten Leute über Nacht zu Protektionisten.

24
„Die Frage, wie viel Einkommen aus Arbeit und wie viel Kapitaleinkommen ein einzelner Mensch haben sollte, müssen wir früher oder später als Gesellschaft beantworten.“
MARKUS OHNDORF
Braucht es eine Neuordnung im Umgang mit den und für die Bewirtschaftung von Gemeingütern, den sogenannten Commons? Begreift man die Atmosphäre als öffentliches Gut, was sie tatsächlich ist, ergibt sich daraus, dass einzelne Staaten davon profitieren können, wenn andere Klimaschutz betreiben und sie selbst nicht. Das ist ein „Öffentliches Güter“-Problem. Um dieses Freifahrerverhalten zu überwinden, gibt es internationale Verträge wie das Pariser Klimaschutzübereinkommen. Ich glaube, dass Paris nicht besonders gut dafür geeignet ist, die Maßnahmen zu ergreifen, die benötigt werden würden, um das 2-Grad-Ziel zu erfüllen. Man wünscht sich gerade in Bezug auf globale Umweltprobleme etwas Besseres.
Mit der CO2-Bepreisung hat man erste Schritte unternommen. Kann das in globalem Maßstab ein Mittel sein, die Erderwärmung in den Griff zu bekommen? In den Modellen, mit denen wir globale Kosten-Nutzen-Analysen durchführen, gehen wir davon aus, dass es einen international harmonisierten CO2-Preis geben sollte. Das ist das optimale Instrument, das wir als Ökono-
MARKUS OHNDORF
ist seit Juli 2016 Professor für Volkswirtschaft an der Universität Innsbruck. Zuvor war er an der ETH Zürich tätig, wo er 2009 promovierte. In den 1990er-Jahren war Ohndorf als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation bei verschiedenen UN-Gipfeln aktiv. Heute beforscht er unter anderem die Tendenz, dass Konsumenten wie Wähler gar nicht alle Informationen haben wollen, die ihnen zur Unterstützung bei Konsum- und Wahlentscheidungen kostenfrei zur Verfügung stehen.
men zur Steuerung von Emissionen verwenden können. Wäre ein international gültiger CO2-Preis durchsetzbar, würden wir uns das wünschen. Das ist aber noch nicht realistisch. Versieht man nur Teile des CO2-Systems mit einem Preis, ist das nicht optimal, aber immer noch besser als nichts. Europa ist diesbezüglich tatsächlich Vorreiter gewesen.
Was halten Sie von der Einrichtung eines Bürgerfonds, der ein gerechteres Trickle-down von Reichtum zu allen Bürgern gewährleisten und von denjenigen befüllt werden soll, die den gemeinsamen Ressourcen (produktiven, natürlichen, geistigen und sozialen Gemeingütern) Reichtum entnehmen? Inwiefern würde sich ein solcher Ansatz vom bestehenden Steuersystem unterscheiden? Thinktanks machen in der Regel derartige Vorschläge nicht in der Erwartung, dass diese eins zu eins umgesetzt werden können. Es geht vor allem darum, einen Finanzierenden mit einer zu finanzierenden Aktivität zu matchen. Konkret wird das letztlich immer im jeweiligen Steuersystem umgesetzt. Wenn man die Forderung nach einem Bürgerfonds als Forderung nach einer ökologischen Steuerreform, die stärkere Umverteilungselemente enthält, bezeichnet, klingt das längst nicht mehr so fancy wie der von den Ressourcennutzern finanzierte Bürgerfonds. Darauf läuft dieser Vorschlag – übersetzt in reale Politik – am Ende hinaus. Aus umweltökonomischer Sicht ist die Besteuerung der Ressourcennutzung statt Arbeit oder
Dauer: 1 bis 2 Unterrichtseinheiten
FINANZBILDUNG
durch die Oesterreichische Nationalbank
Zielgruppe: 8. bis 13. Schulstufe sowie Berufsschulen

Themen: Bargeld & Zahlungsverkehr, Preisstabilität, Umgang mit Geld
Im kostenlosen Finanzbildungsprogramm Euro-Aktiv werden gemeinsam mit den Schüler:innen aktuelle Themen rund ums Geld erarbeitet. Bei allen Fragestellungen können die Jugendlichen ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen. Die Workshops finden in der OeNB WEST in Innsbruck in Kombination mit einer Führung durch die Ausstellung „Euro Cash“ statt. Sie können aber auch als Veranstaltung an der Schule gebucht werden.
Anmeldung unter regionwest@oenb.at. Weitere Informationen unter www.eurologisch.at
eco. titel 25
Entgeltliche Information
MARKUS OHNDORF

Kapital oder irgendwelche Märkte immer vorteilhaft. Letztere verzerren das System, die Einbeziehung von externen Kosten entzerrt es. Grundsätzlich wäre jeder Finanzwissenschaftler für eine Besteuerung der Ressourcennutzung in der Höhe der externen Kosten. In Österreich haben wir mit der Ungleichverteilung des Einkommens kein großes Problem, sehr wohl aber mit der Vermögensverteilung. Das Vermögen ist sehr, sehr, sehr ungleich verteilt.
Österreich ist sehr konservativ, was die Einführung von Vermögenssteuern – in welcher Form auch immer – betrifft. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Frage interessant, ob die Vermögenden abwandern würden, wenn man sie besteuert. Kapital ist bekanntermaßen weit mobiler als Arbeit. Es kann gute Gründe haben, die Superreichen nicht stärker zu besteuern.
Ich bitte Sie jetzt um eine moralische Wertung. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas wie Überreichtum? Die Ökonomie als wissenschaftliche Disziplin gibt mir keinerlei Instrumente an die Hand, das zu beurteilen. Da müsste man auf die Ethik oder einen anderen Referenzrahmen ausweichen. Sobald jemand Milliardär ist, konsumiert er nicht nur, sondern überlegt, wie Geld sinnvoll reinvestiert werden könnte. Warren Buffett oder Elon Musk, auch wenn er derzeit sehr in der Kritik steht, tun das. Solange dieses Geld produktiv eingesetzt ist, wird es zumindest nicht verschwendet, sondern fließt dorthin, wo es potenziell den größten Nutzen bringt. Die Frage ist, warum diese Entscheidungen von einem Individuum getroffen werden sollten und nicht von einem Fonds, der die ganze Gesellschaft repräsentiert. Das ist letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. Die Frage, wie viel Einkommen aus Arbeit und wie viel Kapitaleinkommen ein einzelner Mensch haben sollte, müssen wir früher oder später als Gesellschaft beantworten. Vor dem Hinter-
grund, dass die Automatisierung zunehmen und die Arbeit damit knapper werden wird.
Wie könnte man darauf angemessen reagieren? Es gibt zwei Möglichkeiten: Man könnte fordern, dass die Menschen Kapitaleinkommen generieren, anstatt zu konsumieren – in Fonds und dergleichen zu investieren – oder der Staat muss das in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens organisieren. Das ist nichts, was politisch als links oder rechts punziert werden sollte, sondern eine Frage, wie man sich als Gesellschaft neuen Notwendigkeiten anpasst.
Gewinnt diese Frage an Dringlichkeit durch den Umstand, dass sich der Mensch zunehmend vermittels seiner Technolo-
gien selbst wegzurationalisieren scheint? Man könnte auch sagen, der Mensch lebt sein Recht auf Faulheit.
Das wäre die positive Lesart. Dann muss dafür gesorgt sein, dass alle überleben können, weil es keinen signifikanten Bevölkerungsanteil geben kann, der einkommensund arbeitslos ist.
Anlässlich der polarisierenden Aktivisten, die es als Klimakleber zu einiger Bekanntheit gebracht haben: Ist es für den Wissenschaftsbetrieb statthaft, auch „aktivistisch“ tätig zu werden, oder reicht es aus, die Welt lediglich zu beschreiben? Es gibt Argumente dafür und dagegen. Gerade im Klimabereich gibt es eine ganze Menge an Wissenschaftlern, die zukünftig Schlimmes erwarten. Das sind meistens diejenigen, die öffentlich auftreten und wachrütteln wollen. Das halte ich nicht für moralisch problematisch. Allerdings besteht die Gefahr, als Wissenschaftler politisch instrumentalisiert und in eine Ecke gestellt zu werden. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit, die eigentliche Message leidet darunter.
Das heißt im Umkehrschluss, dass die sichere Variante ist, ruhig zu bleiben und sich auf dem Objektivitätsgebot auszu-
eco. titel
„Gemäß Paris-Agreement kann jedes Land zum Klimaschutz beitragen, was es will. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit der Durchsetzung über Moral führt, über den Wähler, der an der Urne auch über Klimapolitik abstimmt.“
ruhen? Als Wissenschaftler formulieren wir immer bewusst vorsichtig, zeigen Tendenzen auf, betonen aber auch die Unsicherheiten von Prognosen. Das hat dazu geführt, dass gewisse Lobbys wissenschaftliche Erkenntnisse immer wieder relativiert haben. „Die Wissenschaftler sind sich selbst nicht sicher, die wissen das gar nicht“ und so weiter heißt es dann. Da wird dem Wissenschaftler gewissermaßen seine Wissenschaftlichkeit zum Verhängnis. Man will eigentlich einen klaren Punkt machen, relativiert ihn aber zugleich, weil man gewisse wissenschaftliche Unsicherheiten hat. Man darf sich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen, bloß weil es keine hundertprozentigen Gewissheiten gibt. Zieht sich die Wissenschaft zurück, trifft die Gesellschaft uninformierte Entscheidungen. Damit ist nichts gewonnen.
Ist der Klimawandel eine Angelegenheit, für die es sich lohnt, sich aus der Deckung zu wagen? Solange man das formuliert wie „gegeben der Expertise, die ich habe, bin ich der Meinung…“, würde ich das sogar als eine Aufgabe des Wissenschaftlers begreifen, für die man von der Gesellschaft, vom Steuer-
zahler bezahlt wird. Der Universitätsforscher soll der Gesellschaft schließlich einen Nutzen bringen.
Braucht es mehr Druck aus der Zivilgesellschaft, um eine träge und teils mutlose Politik zum Handeln zu bewegen? Gemäß Paris-Agreement kann jedes Land zum Klimaschutz beitragen, was es will. Es gibt keine effektiven Sanktionsmechanismen. Das bedeutet, dass die einzige Möglichkeit der Durchsetzung über Moral führt, über den Wähler, der an der Urne auch über Klimapolitik abstimmt.
Moral ist bekanntermaßen keine politische Kategorie. Es ist der Souverän, der Moral zeigen muss. Die Bewegungen Fri-
days for Future und in geringerem Maße auch Scientists for Future hatten in den Demokratien relativ großen Einfluss auf die Klimapolitik und eine spezifische gesellschaftliche Funktion als Umweltgewissen der Bürger. Genau wie die Wissenschaftler muss diese Bewegung darauf achten, nicht als Bremse des Fortschritts wahrgenommen zu werden. Mediale Vergleiche mit Linksterroristen aus den 1970er-Jahren schaden der Glaubwürdigkeit dieser Gruppe, die damit in die Illegalität abgeschoben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bewerfen von Kunstwerken und dergleichen Aktivitäten nicht die falsche Richtung sind. Man kann auch für Bewusstsein sorgen, ohne Dinge zu tun, die es Gegnern nicht so einfach machen, die berechtigten Anliegen der Aktivisten zu diskreditieren.
HERZLICH WILLKOMMEN BEI TIROLS GRÖSSTEN EVENTS ALLE EVENTS AUF WWW.OLYMPIAWORLD.AT

10.02.23
EHRLICH BROTHERS
OLYMPIAHALLE
Die spektakuläre aktuelle Show der Ehrlich Brothers. „Dream & Fly“ ist das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde. Andreas und Chris Ehrlich werden mit noch nie dagewesenen Illusionen die Olympiahalle rocken. Zwischendurch gibt es die Ehrlich Brothers sogar mitten im Publikum zu erleben.

10.
– 12.02.23
WELTCUP BOB & SKELETON
OLYMPIA EISKANAL
Die Weltelite des Kufensports macht beim BMW IBSF Bob & Skeleton Weltcup 2023 in Innsbruck Station. Neben dem Skeleton-Rennen am Freitag werden bei den Herren gleich zwei Bewerbe im 4er-Bob ausgefahren. Bei den Damen steht neben dem Skeletonbewerb noch jeweils ein Rennen im Monobob sowie im 2er-Bob auf dem Programm.
05.03.23 RIVER DANCE
OLYMPIAHALLE
Die erfolgreichste Tanzshow der Welt ist zurück! Die Begeisterung über die atemberaubende Darbietung irischen Stepptanzes ist auch nach 25 Jahren weiterhin ungebrochen. Die Show zum 25-jährigen Jubiläum katapultiert Riverdance ins 21. Jahrhundert und lässt das Publikum die elementare Kraft ihrer Musik und Choreografie hautnah spüren.
ALLE EVENTS

eco. titel 27
„Zieht sich die Wissenschaft zurück, trifft die Gesellschaft uninformierte Entscheidungen. Damit ist nichts gewonnen.“
MARKUS OHNDORF
oly-inserat econova 180 x 120.indd 1 31.01.23 09:36
„WIR MÜSSEN UNBEDINGT ZEIT GEWINNEN“
„Europa“, will Georg Brasseur, emeritierter Universitätsprofessor für elektrische Messtechnik und Sensorik an der TU Graz, gleich eingangs festgehalten wissen, „ist nicht energieautonom, war es nie und wird es auch niemals sein.“ Das macht die Energiewende freilich nicht einfacher.
INTERVIEW: MARIAN KRÖLL

eco. titel
eorg Brasseur will in der Energiewende auf das zurückgreifen, was es in der Natur bereits gibt, und das synthetisch herstellen. Effizient funktioniert das allerdings nur in Weltgegenden, in denen es mehr Wind und stärkere Sonneneinstrahlung als in Europa gibt.
ECO.NOVA: Kann man tatsächlich so apodiktisch sagen, dass Europa auch zukünftig nicht energieautonom sein wird? GEORG BRASSEUR: Stellt man die Förderung und den Import fossiler Energie in Europa ein, müsste die Energie vorwiegend aus Wind und Sonne stammen. Das geht schon einmal gar nicht. Wir haben gar nicht die Fläche für Windkraft und Photovoltaik im nötigen Ausmaß, außerdem ist in unseren Breiten die „Ernte“ schlecht. Bei Photovoltaik liegt die Ausnützungsrate* bei nur zwölf Prozent, bei der Windkraft sind es gerade einmal 26 Prozent. Das hat weitreichende Auswirkungen. Energie ist Leistung mal Zeit.* Ist die Zeitspanne kürzer, in der Energie übertragen werden kann – weil sie bei Photovoltaik und Windkraft nicht immer zu bekommen ist –, heißt das, dass die Verluste steigen, und zwar quadratisch mit der Leistung. Über unser Stromnetz kann zukünftig nicht die Energie übertragen werden, die wir heute gewohnt sind, weil diese in kürzerer Zeit übertragen werden muss. Nämlich dann, wenn sie gerade verfügbar ist. Fakt ist: Wir sind in Europa nicht energieautonom, folglich müssen wir Energie einführen.
Der Club of Rome schlägt in seinem neuen Bericht „Earth for All“ die Energiekehrtwende vor, die einer vollständigen Elektrifizierung und Dekarbonisierung gleichkommt. Halten Sie das für machbar und sinnvoll? Eine Dekarbonisierung ist ein grundlegender Denkfehler. Kohlenstoff ist für den Menschen eines der wichtigsten Elemente, neben Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Kalzium. Mit dem Kohlenstoff würden wir uns den Teil des gasförmigen Energieträgers Wasserstoff schlechthin wegnehmen, der durch atomare Bindung dem Wasserstoff eine viel höhere volumetrische Energiedichte verleiht. Dieser Energieträger ist im Großen und Ganzen Glukose bzw. Zucker, ein Kohlenwasserstoff mit der Summenformel C6H12O6. Letztlich ist es egal, ob dieser Kohlenwasserstoff nun als Glukose, als Treibstoff an der Tankstelle oder als Kornweckerl vorliegt. Das hat die Natur durch die Kohlenwasserstoffe genial gelöst. Der Wasserstoff mit seiner hohen gravimetrischen, aber sehr schlechten volumetrischen Energiedichte hat sich evolutionär als hervorragender Energieträger herauskristallisiert, und zwar in atomar gebundener Form. Kohlenstoff ist
GEORG BRASSEUR

ist emeritierter Ordinarius an der TU Graz am Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik und war von 2013 bis 2022 Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Neben industrieller Elektronik und elektrischer Messtechnik umfassen seine Forschungsinteressen Sensorik und Aktuatorik, kapazitive Mess- und Schaltungstechnik sowie nachhaltige Mobilität. Letzteres ist auch eine der zentralen Herausforderungen des von ihm mitgegründeten Vereins netER – new energy transition Europe Researchassociation, zu dessen Gründungsmitgliedern auch der Tiroler Industrielle Arthur Thöni gehört.
der „Klebstoff“, der dem Wasserstoff eine höhere volumetrische Energiedichte gibt. Ob in Form von Alkohol, Zucker oder Methan, ist egal. Das hat die Natur erfunden und wir Menschen wären schlecht beraten, klüger als die Natur sein zu wollen, die zu dieser Erkenntnis Milliarden Experimente zur Optimierung des Energieträgers für Lebewesen gebraucht hat.
Das ist nicht trivial. Was können wir also für die Energiewende aus der Evolution lernen? Wir können lernen, dass die großen Energieträger, die wir in Zukunft brauchen werden, genau die sind, die wir schon haben. Wir brauchen keine neuen erfinden. Wir brauchen keinen Wasserstoff in gasförmiger Form. Wenn das evolutionär ein Vorteil gewesen wäre, hätten wir vermutlich irgendwo einen Körperteil, der diesen speichern könnte. Die Natur hätte sich theoretisch auch eine Art Batterie für Tiere und Pflanzen einfallen lassen können, hat sie aber nicht. Elektrizität ist in der Natur zwar auch sehr wichtig, aber nicht als Energieträger, sondern in der Nervenreizleitung. Strom hat selbst keine Energie, er transportiert diese nur von A nach B. Bei der Energiewende sollten wir auf das zurückgreifen, was uns die Natur vorgegeben hat. Das ergibt dann automatisch Drop-in-Fuels*, mit denen über Jahrzehnte die fossilen Kraftstoffe dank gleicher Chemie quasi „verdünnt“
29 eco. titel
© DORIS KUCERA
werden können. So kann nach und nach Fossiles durch Grünes ersetzt werden, ohne dass wir dadurch viel fossiles CO2 – ich sage bewusst nicht Geld – in die Hand nehmen müssen, um neue Anlagen zu errichten. Die Größenordnung, die wir an fossiler Energie ersetzen müssen, ist gigantisch. Die nötigen Anlagen brauchen sehr viele Rohstoffe – Stahl, Aluminium, Kupfer, Zement, etc. –, die zusätzlich gewonnen werden müssen. Für die Energiewende brauchen wir ganze Weltjahresproduktionen dieser Rohstoffe – zusätzlich!

Die Energiewende ist damit wohl keine schnelle Nummer. Ist der Zeithorizont, der für die Energiewende öffentlich suggeriert wird, zu kurz bemessen? Viel zu kurz. Wenn der Club of Rome nun fast alles auf Elektrizität umstellen will, ist das nicht ein Feature, sondern ein Bug. Wir sind salopp gesagt immer noch zu dumm, aus Sonne, Wasser und Luft Glukose – C6H12O6 –erzeugen zu können. Wir müssen Strom machen, etwas anderes können wir großtechnisch zurzeit nicht aus Wind und Sonnenenergie generieren. In einem nächsten Schritt kann dann mittels Elektrolyse aus diesem Strom Wasserstoff erzeugt werden. Wasserstoff ist aber flüchtig und schlecht speicherbar. Also braucht es für viele Anwendungen noch eine weitere Konversion –etwa in Methan, Methanol oder andere flüssige grüne Energieträger –, die wieder verlustbehaftet ist.
Die Sonne schickt keine Rechnung, heißt es doch oft so schön. Es mag sein, dass diese Energie geschenkt ist, der Bau der notwendigen Anlagen benötigt aber gewaltige Rohstoffmengen und setzt Unmengen an fossilem CO2 frei, dessen Ausstoß wir eigentlich verringern müssten. Deshalb müssen wir vor allem sparen. Das heißt zunächst einmal das, was wir bereits haben, weniger und möglichst lange zu verwenden.
Das heißt wohl auch, dass bestehende Kraftwerke so lange wie möglich betrieben werden sollten. Der überhastete Atomausstieg und der teure Rückbau prinzipiell betriebsbereiter Kraftwerke bei unseren deutschen Nachbarn dürfte vor diesem Hintergrund nicht besonders klug gewesen sein? Dumm darf man ja in einer Zeitung nicht sagen. Man hat die Situation völlig verkannt. Wir leben bisher in einem verbraucherorientierten System, das Energie grundsätzlich dann zur Verfügung stellt, wenn diese gebraucht wird. Mit Wind- und Sonnenenergie haben wir zukünftig ein angebotsgetriebenes Energiesystem. Damit können wir nicht umgehen. Was heißt das? Nur wenn morgens die
Sonne scheint und der Wind weht, können wir warm duschen. Das ist unsinnig. Man kann versuchen, Verbrauchsspitzen auf den Zeitpunkt zu schieben, an dem das größte Stromangebot da ist. Das Pumpspeicherkraftwerk funktioniert nach dieser Logik, die Energie aus Wind und Sonne wird in Form von Wasser zwischengespeichert. Das Pumpspeicherkraftwerk hat die höchste Effizienz. Etwas Besseres ist uns bisher noch nicht eingefallen. Es gibt aber Dunkelflauten – Tage bis Wochen, in denen kaum Wind weht und keine Sonne scheint –, für die wir ein ganzes Parallelsystem aus kalorischen Kraftwerken zur Stromerzeugung brauchen werden.
Wie viel Leistung muss an kalorischen Kraftwerken im Verhältnis zur installierten Leistung aus Windund Sonnenenergie vorgehalten werden? Kalorische Kraftwerke müssen dieselbe Menge an Energie liefern können, die beim Wegfall der Wind- und Sonnenenergie gebraucht wird. Das heißt, dass in diesen Kraftwerken die meiste Zeit Däumchen gedreht wird. Diese Infrastrukturen und das Personal, die eigentlich nur für Notfälle da sind, kosten Unmengen an Geld. Es wird immer Gaskraftwerke zur Sicherstellung der Netzstabilität brauchen, die vielleicht in ferner Zukunft irgendwann mit grüner Energie betrieben werden.
GEORG BRASSEUR
Ein derartiges Parallelsystem aus regenerativen und kalorischen Kraftwerken bedeutet wohl auch automatisch, dass die Zeiten billiger Energie in Europa endgültig vorbei sind? Diese Zeiten sind vorbei. Wir finanzieren seit 150 Jahren unseren Wohlstand über fossile Energie, die nahezu nichts kostet. Das zeigt sich gerade wieder am eindrücklichsten in Deutschland mit der Braunkohle. Der Bagger schaufelt diese Kohle auf ein riesiges Förderband, das direkt ins Kraftwerk hineinführt. Billiger geht es nicht. Das wird es in Zukunft
eco. titel 30
„Wir können lernen, dass die großen Energieträger, die wir in Zukunft brauchen werden, genau die sind, die wir schon haben.“
GEORG BRASSEUR
in dieser Form zur Überbrückung kalter Dunkelflauten nicht mehr geben, außer man sammelt und injiziert das bei der Verbrennung im Kraftwerk entstehende CO2 beispielsweise in Basalt, der CO2 binnen zwei Jahren in Karbonatgestein umwandelt.
Warum haben fossile Energieträger eine derart hohe Energiedichte? Weil fossile Energieträger kaum Sauerstoff enthalten, sondern diesen bei der Verbrennung aus der umgebenden Luft entnehmen.1 Die fossilen und auch die chemisch identen synthetischen Kraftstoffe haben deshalb eine um gut den Faktor 50 höhere Energiedichte als Batterien.
Die Batterie gilt aber gewissermaßen als einer der Hoffnungsträger der Energiewende. Wiederaufladbare Batterien haben das Oxidationsmittel integriert, sie führen quasi den Sauerstoff mit. Das ist keine gute Idee, denn das Oxidationsmittel ist in der Umgebungsluft frei verfügbar. Nur ist die Chemie bisher nicht in der Lage, dieses Manko zu überwinden. Ebenso wenig gelingt der Nachbau der Fotosynthese, also aus CO2 aus der Luft und Wasser mittels Sonnenstrahlung Glukose, einen festen grünen Energieträger, großtechnisch herzustellen. Batterien funktionieren unter Wasser oder im Vakuum und haben durch diese in der Regel nicht benötigte Eigenschaft eine sehr schlechte Energiedichte. Für großtechnische Anwendungen ist die heutige Lithiumionen-Batterietechnologie ungeeignet, zumal sie nicht wirklich gut skalierbar ist, ohne das Brandrisiko mehr und mehr zu erhöhen und ohne dass die Batterieherstellung große Mengen an fossilem CO2 freisetzt. Um das zu ändern, braucht man völlig neue Technologien, die es leider noch nicht gibt.
Warum wird dann derzeit die Elektromobilität so massiv gepusht? Ich kann Ihnen zwei Gründe nennen: Die Politiker finden Strom cool, da man fast alles mit Strom machen kann, weil der neue Strom aus Wind- und Solarkraftwerken kommt und damit grün ist, obwohl die meisten Proponenten den Unterschied zwischen Watt und Wattstunden – also zwischen Leistung und Energie – nicht präsent haben. Die Logik könnte folgendermaßen lauten: Strom ist cool, weil Strom so viel kann und grüner Strom der Energiewende nutzt. Wenn ich Strom fördere, fördere ich eine coole, grüne Sache. Damit bin ich auch cool und werde wiedergewählt.
Der zweite Grund ist, dass der Verbrauch bei Fahrzeugen mit Liter pro hundert Kilometer gemessen wird. Und zwar von der Zapf- bzw. Ladesäule weg. Deshalb
IMMO
TIONEN
proudly presented by Who else?
Praxis/Kanzlei, Klinik- bzw. Landesgerichtsnähe für Ärzte/Rechtsanwälte/Steuerberater INNSBRUCK, NFL ca. 250 m², 8 Zimmer, 57 m² Terrasse, 2 WCs, Keller, 1. OG, barrierefrei, Baujahr 1976, HWB 111 kWh/m2a, Kaufpreis 1.500.000 Euro


m², EG/1. OG/2. OG/DG, Sauna, Lager, Keller, Doppelgarage, 10 AAP im Freien, Baujahr 2008, erweitert 2020, HWB 77,2 kWh/m2a, Kaufpreis 5.300.000 Euro
Rarität Landhausvilla INNSBRUCK, GFL ca. 502 m², WNFL ca. 170 m², UG/EG/OG, 7 Zimmer, 2 Bäder, Keller, ca. 109 m² Garten, DG ausbaubar, große Garage, AAP im Freien, Baujahr 1981, HWB in Arbeit, Kaufpreis 2.250.000 Euro

IMMOBILIENMANAGEMENT JENEWEIN GmbH

Eduard-Bodem-Gasse 8, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512-26 82 82
E-Mail: office@immobilien-jenewein.at www.immobilien-jenewein.at
eco. titel 31
„Bei der Energiewende sollten wir auf das zurückgreifen, was uns die Natur vorgegeben hat.“
Apartmentchalet im Top-Skigebiet FISS, 6 Wohneinheiten, GFL ca. 848 m², NFL ca. 1.048
ist festgelegt, dass der Strom aus der Steckdose in Analogie zur Zapfsäule CO2-frei ist, denn Elektronen emittieren kein CO2. Dass der zum Laden notwendige Strom vorwiegend in kalorischen Kraftwerken erzeugt werden muss, wird ignoriert. Die Automobilindustrie kann sich deshalb für jedes verkaufte Elektroauto negative CO2-Emissionen für den Flottenverbrauch anrechnen lassen. Das macht es möglich, weiterhin Autos mit Verbrennungsmotoren zu verkaufen, obwohl der Flottengrenzwert sehr streng ist. Der Großteil der verkauften Elektrofahrzeuge sind Firmenfahrzeuge.

Das dürfte mit den hohen Förderungen zusammenhängen. Ja. Elektroautos werden über den Lebenszyklus in Summe mit ca. 20.000 Euro gefördert, statt diese Mittel für Aktivitäten einzusetzen, die faktenbasiert der Energiewende nutzen, wie beispielsweise Wärmepumpen. Die Energiewende fördert man durch Elektroautos nicht, man verzögert sie sogar.
Wie kommt das? Weil dadurch ständig neue Verbraucher ans Netz gebracht werden. Und zwar schneller, als grüne Kraftwerke gebaut werden können. Damit wird der Strom insgesamt nicht grüner, sondern immer brauner. Zuerst sollten neue grüne Kraftwerke errichtet werden, bevor durch Förderungen neue Verbraucher motiviert werden, zusätzlichen Strom zu beziehen.
Könnte nicht auch eine Vielzahl an Elektroautos, die bidirektionales Laden unterstützen und intelligent
angesteuert werden, dem Stromnetz als Speicher dienen? In Österreich gibt es fünf Millionen Autos. Nehmen wir an, es handelt sich dabei ausschließlich um Elektroautos und eine Autobatterie stellt 50 kWh Energie bereit. Das ergibt in Summe 0,25 Terawattstunden. Unser durchschnittlicher Verbrauch beträgt sieben Gigawatt, das heißt, dass nach 35 Stunden alle Batterien leer wären. Zum Vergleich: Aus Pumpspeichern bekommen wir in Österreich circa drei Terawattstunden. Ideen wie diese sind in großtechnischem Maßstab unsinnig. Die Leute hören es nicht gerne, dass sie mit Elektroautos der Energiewende schaden. Die Erfindung neuer Verbraucher macht keinen Sinn, es sei denn, es handelt sich um Wärmepumpen. Damit hat man einen großen Hebel, der auch beim derzeitigen Strommix Sinn ergibt. Wärmepumpen müssten dementsprechend stärker gefördert werden, nicht Elektroautos.
eco. titel 32
„Die Energiewende fördert man durch Elektroautos nicht, man verzögert sie sogar. Denn dadurch werden ständig neue Verbraucher ans Netz gebracht werden. Und zwar schneller, als grüne Kraftwerke gebaut werden können.“
GEORG BRASSEUR
Ist die Energiewende ohne Verhaltensänderung –sprich Verzicht – zu bekommen? Ich glaube nicht, dass man Menschen bewusst zum Verzicht bewegen kann. Man muss die Energiewende so gestalten, dass die Leute nicht das Gefühl bekommen, ihnen entgeht etwas.
Ist es leichter und damit günstiger, die bestehenden Energiesparpotenziale zu heben oder neue bzw. weitere – am besten nachhaltige – Energiequellen zu erschließen? Es braucht beides. Energiesparen wirkt sofort. Wir müssen unbedingt Zeit gewinnen. Zeit, um von der Industrie die Rohstoffe zu bekommen und auch die personellen Ressourcen aufzubauen, die wir für die Energiewende brauchen. Wir brauchen Geräte, Anlagen und Fachkräfte, und das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb müssen wir Zeit gewinnen, das Bestehende möglichst lange weiter nutzen und gegebenenfalls reparieren und nicht wegwerfen. Ich fahre meine Autos immer so lange, bis dass der Rost uns scheidet. Das ist Energie sparen.
Könnte ein Fazit für den weiteren Umgang mit der Energiewende lauten, dass mehr Pragmatismus und weniger das Bauen von Luftschlössern gefragt sein wird? Die Politiker sollten sich aus Energiefragen völlig heraushalten. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich zu wenig auskennen, sehr wohl aber, dass sie zu ignorant sind, sich das einzugestehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Die Politik sollte Experten aus der Industrie und Wissenschaft stärker einbinden. Wahrheit hat auch die Wissenschaft nicht, sie zeigt aber unverblümt die Fakten mit allen Vor- und Nachteilen auf. Und sie ist durch die der Wissenschaft innewohnende Skepsis lernbereit und lernfähig. Diese Grundhaltung muss man der Politik nahebringen. Experten sollen die

In medias res:
Fakten darlegen, deren Bewertung die Politik vornehmen muss. Dafür wurden die Politiker gewählt. Es gilt außerdem, Verträge mit jenen Ländern zu schaffen, aus denen diese grüne Energie nach Europa importiert werden könnte. Auf die Errichtung derartiger Verträge und Abkommen sollte sich die Politik fokussieren. Diese müssen Investoren auf Jahrzehnte Rechts- und Planungssicherheit garantieren, sonst werden diese nicht den Großteil der Energiewende finanzieren. Das ist die Voraussetzung, damit alles andere getan werden kann.
Woher soll unsere grüne Energie kommen? Aus Gegenden rund um den Äquator, wo die Sonneneinstrahlung ganzjährig stark ist. Für Windkraft kommen viele um den Globus verteilte Regionen in Frage.
Das gesamte Gespräch mit Georg Brasseur hat rund zweieinhalb Stunden gedauert und ist folglich um einiges länger ausgefallen, als hier zu lesen ist. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt’s unter dem QR-Code die Langfassung.
1. Sauerstoff ist mit einem Atomgewicht von 16 16-mal schwerer als Wasserstoff. Zwei Wasserstoffatome verbrennen zu H2O und haben mit 33 kWh pro Kilogramm die höchste massebezogene Energiedichte überhaupt. Für ein leichtes Gas wie Wasserstoff ist aber nicht die hohe gravimetrische, sondern die leider schlechte volumetrische Energiedichte von 3 kWh pro Kubikmeter relevant. Bei Methan sinkt durch die atomare Bindung von vier Wasserstoffatomen an Kohlenstoff das Volumen des Moleküls und die volumetrische Energiedichte steigt signifikant an. So liefert die vollständige Verbrennung eines Kubikmeters Methan (CH4) mit 13 Kubikmetern Luft ungefähr 10 kWh Wärmeenergie und bei einem Kilogramm Diesel oder Benzin sind für die vollständige Verbrennung 14,7 Kilogramm Luft notwendig.
* Ausnützungsrate: Ist ein Prozentsatz P, der angibt, wie viele Stunden bezogen auf die Stunden eines Jahres (8.760 Stunden) ein volatiles Kraftwerk mit der installierten Leistung L betrieben werden müsste, um die vom Kraftwerk tatsächlich generierte Energie W zu erhalten: P = W/(8760*L).
* Energie wird in Joule (J) oder Kilowattstunden (kWh) gemessen und ist dasselbe wie mechanische Arbeit, die in Newtonmeter (Nm) gemessen wird. Leistung dagegen ist Energie pro Zeit und wird in Watt (W) gemessen.
* Drop-in-Kraftstoff ist ein Kraftstoff, der aufgrund der (nahezu) gleichen chemischen Strukturformel konventionelle Kraftstoffe direkt ersetzen kann.
eco. titel 33
MEHR DAVON?
ANGST ESSEN SOLIDARITÄT AUF
Die Autoren Markus Marterbauer und Martin Schürz haben unter dem Titel „Angst und Angstmacherei – Für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht“ ein lesenswertes Buch vorgelegt, das als Plädoyer für einen besseren Sozialstaat zu lesen ist.
unächst nehmen Markus Marterbauer und Martin Schürz in ihrem Buch so etwas wie eine Bestandsaufnahme vor, in deren Zentrum die Prämisse steht, dass Angst im Neoliberalismus nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern mobilisierender Faktor sei und Methode habe. Die neoliberale Wirtschaftspolitik schüre gezielt Angst – Angst vor Altersarmut, sozialem Abstieg oder einem zu starken Staat, der seine Bürger gängelt. Die Autoren kritisieren ein unheilbringendes Nebeneinander von Viel-zu-Wenig und Viel-zu-Viel, von Armut da und Überreichtum dort. Das ist kein dumpfes „Eat the Rich“, sondern lediglich das Benennen des auch zahlenmäßig gut nachzuvollziehenden Umstands, dass vor allem im globalen Maßstab „die einen viel zu wenig haben, um halbwegs gut leben zu können“, während „die anderen viel zu viel“ hätten. Damit rücken nicht nur Übergewinne in den Fokus der Aufmerksamkeit, sondern auch Überreichtum, mit dem ein Übermaß an Macht einhergeht, die in Wirtschaft, Medien und Politik zum eigenen Vorteil und zum Nachteil der großen Mehrheit eingesetzt wird. Den größten Hebel, diese ungerechte Welt aus den Angeln zu heben, sehen die Autoren wie weiland auch der österreichische Ökonom Kurt Rothschild in der Wirtschaft.
Der Wirtschaftswissenschaft begegnen Marterbauer und Schürz mit kritischem Blick, fehle ihr doch „allzu oft die kritische Reflexion der Grenzen des eigenen Fachwissens und der implizit vorhandenen persönlichen Werturteile“. Ökonomen, die sich in eine vermeintlich unpolitische Modellwelt zurückzögen, trügen zur Verteidigung eines fragwürdigen gesellschaftlichen Status quo bei, „weil die eminenten Fragen nach Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit, sinnerfüllter Arbeit und Freiheit keine Rolle spielen“. Kritisch sehen die Autoren auch das sogenannte Nudging, jene kleinen, als Verhaltensanreize zu interpretierenden Stupser, welche die Menschen in die richtige Richtung lenken sollen. Genauso wie schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, Kinderarmut, mangelnde Gesundheitsvorsorge oder die Pflegemisere im Alter nicht unvermeidlich seien, seien auch exzessiver Reichtum und exzessive Privilegien keine unumstößliche Tatsache. „In einer funktionierenden Demokratie ist die Einigung auf eine Begrenzung des Reichtums
Zdenkmöglich. Ein die Ängste mildernder Sozialstaat für alle kann geschaffen und weiterentwickelt werden“, hoffen die Autoren. Nun ist Österreich fast zweifellos eine funktionierende Demokratie, von ernsthaften politischen Anstrengungen, die evidente Schieflage in der Besteuerung zwischen Arbeitseinkommen und Vermögen zu beheben, ließe sich bis dato aber noch nichts Nennenswertes berichten.
LIBERALISMUS DER FURCHT
Angst verstehen Marterbauer und Schürz auch als Herrschaftsinstrument. Deshalb sei es eine wirtschaftspolitische Aufgabe, deren Ursachen zu bekämpfen und die Menschen in die Lage zu versetzen, wichtige Entscheidungen ohne Furcht zu treffen. Angst ist aber nicht nur diffus, sondern auch ein konkreter Motivationsfaktor für Menschen. Angstsparen wirkt sich zum Beispiel negativ auf die Nachfrage und damit auch Produktion und letztlich Beschäftigung aus. „Angst vor Arbeitslosigkeit kann auf diese Weise selbst Arbeitslosigkeit schaffen“, heißt es im Buch. Angst lähmt und nagt an der gesellschaftlichen Solidarität. Längst sind in den Industrieländern Angststörungen und Depressionen zu einer Art Epidemie geworden. Die Covid-19-Pandemie hat sie rasant weiter ansteigen lassen. Angst verringert die Lebensqualität.
Als Gegenmittel schwebt den Autoren der Grundsatz inklusiver Prosperität vor, der besagt, dass „im Streben nach Wohlstand und bei der Suche nach Wohlbefinden die Interessen aller Menschen Berücksichtigung finden müssen.“ Das sollte eigentlich in die Kategorie Na-no-na-ned fallen. Tut es aber nicht. Die Interessen der Ärmsten sind unterrepräsentiert, sie haben üblicherweise keine Lobbyisten, die im vorparlamentarischen Raum herumwuseln. „Wer das Gold hat, macht die Regeln“, wusste Frank Stronach einmal unverblümt zu sagen.
Die Politologin Judith Shklar hat einen theoretischen Ansatz geprägt, den sie als Liberalismus der Furcht bezeichnet und der den Autoren merklich sympathisch ist. Dieser besagt, dass jeder Mensch Anspruch auf ein Leben ohne Furcht haben sollte. Dieser Ansatz sieht es als Aufgabe der Politik, mit ihren Entscheidungen soziale und politische Quellen der Furcht zu mindern. Ein Liberalismus der Furcht wäre, mit dem deutschen Sozialphilosophen Axel Honneth
eco. mmentar 34
VON MARIAN KRÖLL
gesprochen, ein Liberalismus von unten, der zu einer Gesellschaft führen kann, in der „niemand so arm wäre, sich verkaufen zu müssen und niemand so reich, andere kaufen zu können“. Die Politik braucht ein feineres Sensorium für die Ängste der Menschen. Nicht, um diese populistisch zu bewirtschaften und die Schlechtergestellten in einer Gesellschaft gegeneinander auszuspielen, wie es so häufig geschieht. Die Angst der Armen, erinnern die Autoren, sei untrennbar mit Scham verbunden. Das geht so weit, dass Menschen Sozialleistungen nicht in Anspruch nehmen, die ihnen von Rechts wegen zustünden. Eine Sozialleistung, die als Almosen und nicht als Recht konzipiert ist, beschäme die Betroffenen, wissen Marterbauer und Schürz. Ums Geld geht es dabei nicht, folgt man der Rechnung der Autoren, die argumentieren, dass sich die Anhebung von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialhilfe über die Grenze der Armutsgefährdung mit Mehrkosten von zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen würde. Das entspricht gerade einmal zwei Prozent aller Sozialausgaben.
VERMÖGEN BESTEUERN UND BEGRENZEN
Zur Finanzierung eines besseren Sozialstaats für alle schlagen die Autoren Vermögenssteuern vor, deren Einnahmen zweckgebunden sein sollen. Konkret wird eine progressive Vermögenssteuer auf das gesamte Nettovermögen ab einer Million Euro sowie eine progressive Erbschaftssteuer genannt. Wer von seiner Arbeit lebt, soll überdies künftig zumindest keine höheren Abgaben mehr leisten als jene, die von ihrem Vermögen ohne Arbeit leben können. Das Vermögen der Armen und der Mitte, schreiben die Autoren, sei der Sozialstaat. „Wenn Aktienbesitz oder Immobilienvermögen mehr abwerfen als die Lohnarbeit, muss die Finanzierung des Sozialstaats umgestellt werden“, heißt es im Buch. Ein gut ausgebauter Sozialstaat, der gewisse Mindeststandards bietet, kann ein wirksames Antidot gegen zunehmende gesellschaftliche Zentrifugalkräfte sein, weil man kein Vermögen braucht, um gut und frei leben zu können.
Die Autoren schlagen nebst sozialen Mindeststandards auch so etwas vor wie ein Maximalvermögen, das gesellschaftlich auszuverhandeln sei. Exemplarisch schwebt ihnen hier eine Grenze von einer Milliarde Euro vor. Ein Maximalvermögen soll dazu beitragen, die Macht der Superreichen zu beschränken und die Demokratie zu verteidigen, argumentieren Marterbauer und Schürz. Sie stützen sich dabei auf die herrschenden Verhältnisse und Rahmenbedingungen, sehen „enorme reichtumsunterstützende Dienste des Staates“ und verweisen darauf, dass es so etwas wie eine „natürliche Vermögensverteilung, die nachträglich durch den Staat verändert wird“, nicht gebe. Die Rahmenbedingungen machen es möglich, dass Reiche fast zwangsläufig reicher werden, während der soziale Aufstieg nicht einfacher geworden ist.
Die unaufgeregt vorgetragenen und gut mit Zahlen unterfütterten Vorschläge der Autoren sind weder – wie der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz einmal in einer TV-Sendung monierte – „Hetze gegen Reiche“ noch dem „Klassenkampf“, der „Neiddebatte“ oder einer „notorischen Eigentumsfeindlichkeit der Linken“ zuzurechnen. Vielmehr handelt es sich um die unmissverständliche Benennung einiger Umstände, die sich viele Bürger erst einmal bewusst machen sollten. Erst dann kann – wie es in Demokratien üblich ist an der Wahlurne – darüber abgestimmt werden, ob der Status quo beibehalten werden soll oder sich einige Dinge ändern sollten. Marterbauer und Schürz analysieren, hoffen und zeigen das möglicherweise Veränderbare im Bestehenden auf. Geworden ist aus dem Buch eine lesenswerte Sammlung von Diagnosen und Ideen, geleitet gleichermaßen von – wie es die Autoren selbst treffend beschreiben – paradoxer Hoffnung und konzisem Realitätssinn.
ANGST UND ANGSTMACHEREI
Markus Marterbauer, Martin Schürz Zsolnay Verlag, 384 Seiten, EUR 26,80

ZU DEN AUTOREN:
Markus Marterbauer studierte in Wien Volkswirtschaft, war von 1988 bis 1994 Assistent am Institut für Volkswirtschaft der WU Wien und arbeitete bis 2011 als Verantwortlicher für Konjunkturprognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Seit 2011 leitet er die Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik der Arbeiterkammer Wien.
Martin Schürz arbeitet als Psychotherapeut in Wien und forscht seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Vermögensverteilung in Europa. 2015 erhielt er den Progressive Economy Award des Europäischen Parlaments. Schürz’ Buch Überreichtum (2019) wurde mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch ausgezeichnet.
35 eco. mmentar
Angst ist im Neoliberalismus nicht etwa ein Betriebsunfall, sondern hat Methode.
DIE LIEBE FAMILIE
Der Großteil der Betriebe Tirols sind in Familienhand. Tradition hat durchaus ihre schönen Seiten. Und ihre Tücken.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Was ist anders, wenn die Eltern einen Betrieb führen, der in der Kindheit zum zweiten Wohnzimmer wurde? Was ist die Triebfeder, wenn ein Unternehmen nicht gegründet, sondern übernommen wurde? Wie lebt es sich mit der geerbten Verantwortung und wie funktioniert das Neben- und Miteinander, wenn die Vorsicht der Alten auf den Mut der Jungen prallt, die Gewohnheiten aus Jahrzehnten auf

den Wunsch nach Veränderung? Letzteres wird vor allem in der Phase der Übergabe gewahr. Genau mit dieser beschäftigt sich Markus Weishaupt. Die initiale Begeisterung für die komplexe Welt der familiengeführten Unternehmen hat er von seinem Vater übernommen, dessen Leidenschaft für die Arbeit ihn seit Kindeszeiten prägte. Nach unterschiedlichen beruflichen Stationen ist Markus Weishaupt 2008 als Partner in das auf Familienunternehmen speziali-
sierte Südtiroler Beratungsunternehmen Weissmann eingestiegen und ist seither als Berater für meist international agierende Unternehmerfamilien vorrangig in Österreich, Italien und der Schweiz tätig. In seinem Buch „Radikal anders“ hat er die DNA erfolgreicher Familienunternehmen entschlüsselt, im Zuge dessen auch ein geordneter Nachfolgeprozess eine entscheidende Rolle spielt. Fast folgerichtig zeigen sich in der Begleitung so vieler Unternehmen auch
eco. wirtschaft
© BIRGIT KOELL
die Fallstricke der Übergabe innerhalb der Familie. So unterschiedlich und individuell jedes Unternehmen zu betrachten ist, so tun sich doch einige erkennbare Muster hervor, die allen gemein sind. Das hat Weishaupt dazu veranlasst, auch diese in Buchform zu verpacken. Er hat dafür nicht das Format eines klassischen Sachbuches gewählt, sondern nimmt wahre Begebenheiten aus seiner beruflichen Praxis, aus denen er 36 immer wiederkehrende Fehler ableitet, mit dem Ziel, sich deren bewusst zu werden und sie folglich in der eigenen Geschichte zu vermeiden. Dietmar Gamper hat jedes Kapitel mit passenden Illustrationen bereichert. Ein Gespräch über Fehler und wie man sie vermeiden kann.
ECO.NOVA: Oft machen Familienunternehmen in der Übergabe aus dem Bauch heraus das Richtige, manche lassen sich von Externen begleiten. Ab und an geht’s aber auch schief. Vor allem, wenn in einem Unternehmen noch stark patriarchalische Systeme herrschen, wird es schwierig. Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Stolpersteine bei der Übergabe innerhalb der Familie? MARKUS
WEISHAUPT: Ein Muster, das sich immer wieder als Problem für die Entwicklung von Familienunternehmen identifizieren lässt, ist die vermeintliche Unsterblichkeit. Das Gefühl der Seniorchef*innen, unersetzlich zu sein, schadet dem Unternehmen ab einem gewissen Zeitpunkt. Wenn die Nachfolge nicht rechtzeitig in die Wege geleitet wird, hat die folgende Generation Probleme bei der Übernahme. Was auffällt, ist: Je länger Unternehmen existieren und je häufiger diese schon mit Nachfolgeprozessen konfrontiert waren, desto einfacher wird im Normalfall auch die Übergabe. Zu den weiteren augenscheinlichen Unterschieden zählt die reduzierte Schriftlichkeit in Familienunternehmen. Das bedeutet, dass unternehmensinterne Rollen, Entscheidungsbefugnisse und Nachfolgeregelungen selten schriftlich festgehalten werden. Aus reiner Mündlichkeit entsteht mannigfaltiger Interpretationsspielraum und erschwert dadurch das Schaffen von Verbindlichkeit. Fehlinterpretationen können die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Unternehmen lähmen. Und wenn familieninterne Entscheidungsprozesse als sehr intime Familienphänomene wahrgenommen werden, wird die Hürde, sich externe Hilfe in Form einer Beratung zu suchen, groß.
Unternehmensführung und -übergabe ist ein Balanceakt. In Kapitel 23 von „Erfolgreich trotz Familie“ beschäftigt sich Markus Weishaupt mit den Tücken des Kompromisses.
MARKUS WEISHAUPT

ist Family-Business-Experte und geschäftsführender Gesellschafter bei Weissman International. Er begleitet als Unternehmensberater international ausgerichtete Familienunternehmen in den Bereichen Strategie, Führung, Organisationsentwicklung, Corporate und Family Governance sowie in der Nachfolge. Als Autor zahlreicher Fachartikel und mehrerer Fachbücher hat er sich als Experte im Bereich familiengeführter Unternehmen einen Namen gemacht. An der FH Kufstein, University of Applied Sciences, lehrt er als Professor „Strategy Development and Execution“, „Führung von Familienunternehmen“ und „Unternehmensübernahme und Nachfolge in Familienunternehmen“. www.familybusinessmodel.com
Sie fordern unter anderem auch mehr Gerechtigkeit innerhalb der nachfolgenden Generation ein. Was meinen Sie damit? Gerade Nachfolgeprozesse müssen meiner Erfahrung nach zwei Kriterien entsprechen, um langfristig akzeptiert zu werden: Einerseits sollen sie für jeden Beteiligten subjektiv gerecht sein, andererseits darf die Nachfolge auch objektiv „nicht ungerecht“ sein. Damit ist gemeint, dass die Erbschaftswerte, die aus dem Unternehmen und anderen Werten bestehen, gerecht unter den Nachfolger*innen aufgeteilt und bestimmte Personen nicht überzogen überproportional bedacht werden. Ungerechte Entscheidungen rächen sich früher oder später.
Was unterscheidet Familienunternehmen von Unternehmen, die in keinerlei Verwandtschaftsbeziehungen verstrickt sind? Ganz einfach ausgedrückt: „Die Familie“. Schon bei der längerfristigen Ausrich-
37 eco. wirtschaft
©DIETMARGAMPER
MARKUS WEISHAUPT
tung des Betriebs zeigen sich grobe Unterschiede. Familienunternehmen orientieren sich selten an einer expliziten Profitmaximierung. Stattdessen geht es häufiger um gesellschaftsrelevante Aspekte und Wertehaltungen sowie risikoangepasste, konstante Rendite. Der Anspruch nach einem guten Ruf und gesellschaftlicher Reputation rückt mehr in den Mittelpunkt, als es in anderen Unternehmen der Fall wäre.
Die manchmal große Anzahl an potenziellen Entscheidungsträger*innen sowie die unklare Aufteilung von Entscheidungsbefugnissen führen häufig zu Stagnation in familiengeführten Unternehmen. Wie können derartige Pattsituationen aufgelöst beziehungsweise von vornherein verhindert werden? Einerseits stellen Familienverfassungen ein sinnvolles Tool für die Festlegung künftiger Entwicklungsprozesse in Familienunternehmen dar, vor allem dann, wenn viele Familienmitglieder im Betrieb involviert sind oder das Unternehmen eine bestimmte Größe hat. Um Konflikten in Nachfolgeprozessen vorzubeugen, eignen sich schriftlich definierte Abmachungen, die nach Möglichkeit in die
Satzung der Unternehmen und in Gesellschafterverträgen übernommen werden. Damit schafft man neben der moralischen auch eine rechtliche Verbindlichkeit. Je demokratischer Entscheidungsprozesse konzipiert sind, desto mehr Ebenen der Unternehmenshierarchie müssen miteinbezogen werden. Es braucht also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Inklusion und Exklusion in Entscheidungsprozessen. Allerdings lässt sich kein generelles Erfolgsrezept für die Aufteilung der Entscheidungshoheit in Familienunternehmen ableiten, jedes Unternehmen ist auf individuelle Lösungen angewiesen.
Macht es Ihrer Erfahrung nach Sinn, die Themen Eigentum und Führung voneinander zu trennen und zum Beispiel einen externen Geschäftsführer zu etablieren?
Es bietet sich an, die beiden Bereiche zumindest konzeptionell voneinander zu trennen. Das schafft interessante Möglichkeiten in der Nachfolge-Governance. So wird auch eine externe Geschäftsführung durchaus zu einer denkbaren Option. In vielen Fällen erfolgreicher Familienunternehmen werden operative Entscheidungen einer externen
Geschäftsführung überlassen, die auch mit der Entwicklung der Unternehmensstrategie beauftragt wird.
Gibt es in Bezug auf die Eigenheiten und Probleme von Familienunternehmen kulturelle Unterschiede? Im Grunde zeigen sich viele Parallelen und es lassen sich zumindest für die westliche Welt allgemeine Muster erkennen, wenn es um häufig auftretende Schwierigkeiten geht, mit denen Familienbetriebe konfrontiert sind. Trotz aller Gemeinsamkeiten, die ich in meinem Buch herauszufiltern versuche, gibt es länderspezifische Unterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie eine Art Nord-Süd-Gefälle, wenn es um die Altersstruktur der Unternehmenslenker*innen geht. Während in den meisten westlichen Ländern ab einem gewissen Alter von Seniorchef*innen erwartet wird, dass sich diese aus dem Unternehmen zurückziehen und eine geordnete Übergabe in die Wege leiten, gibt es in so genannten Emerging Markets und in südlicheren Ländern kaum Restriktionen in Bezug auf das Alter. Selbst im greisen Alter halten Unternehmer*innen dort nicht selten höchst strategische Entscheidungsbefugnisse.
ERFOLGREICH TROTZ FAMILIE
Markus Weishaupt

196 Seiten, EUR 49,–
Häufig wird der Erfolg von Familienunternehmen auf die Familie zurückgeführt und auf all das, was mit Familie assoziiert wird. Aber nicht immer sind Unternehmen erfolgreich „wegen“, manchmal sind sie es „trotz“ Familie. Einige Fehler in der Welt der Familienunternehmen sind so häufig, dass sie eine Art Muster von zu vermeidenden Stolpersteinen auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft bilden. Diese beschreibt Markus Weishaupt anhand 36 kurzweiliger Geschichten zu wahren Begebenheiten, Dietmar Gamper hat dieses pointiert illustriert. Infos und Bestellung unter www.weissmann-international.com
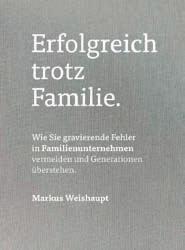
eco. wirtschaft 38
„Viele Unternehmerfamilien tun sich allerdings schwer, die Logik des Unternehmens und die Logik der Familien in einem System zu vereinen und daraus ein harmonisches und profitables Modell zu schaffen. Und so überleben Unternehmen oftmals nicht wegen, sondern trotz ihrer familiären Verstrickungen.“
©
BIRGIT KOELL
NEUES JAHR, NEUES GLÜCK
Was bringt das Jahr 2023? Für alle, denen ein Jobwechsel vorschwebt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Dass es sich lohnt, aus der Komfortzone herauszutreten, zeigen drei Erfolgsgeschichten aus der TIROLER VERSICHERUNG.
Gerade zu Jahresbeginn sehnen sich viele Menschen nach einer neuen Herausforderung und nach Veränderung. Alexandra Achner, Martin Mayr und Cornelia Habinger haben den Schritt bereits gewagt – und nicht bereut. „Ich war zehn Jahre bei einem Versicherungsmakler angestellt. Irgendwann regte sich die Sehnsucht nach Veränderung“, erzählt Achner. Durch ihre Zusammenarbeit mit der TIROLER erfuhr sie von der offenen Position im Vertriebsservice und hat die Chance genutzt. „Ausschlaggebend war, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TIROLER so geschwärmt haben. Sie haben mich quasi abgeworben“, lacht die 29-Jährige. Seit September ist sie im Unternehmen und hat diesen Schritt keine Sekunde bereut: „Ich wurde sehr herzlich empfangen und die Arbeitsbedingungen sind top. Ich mag es auch sehr, dass wir ein zu 100 Prozent Tiroler Unternehmen sind und alle Entscheidungen im Haus getroffen werden.“
EIN GUTER START
Im Oktober kam auch Martin Mayr zur TIROLER. Er ist Quereinsteiger, hat viele
Jahre in der Gastronomie gearbeitet und ist jetzt als Berater für die TIROLER in Fritzens, Gnadenwald, Terfens und Weer unterwegs. „Eine Stellenanzeige hat mich neugierig gemacht. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und Neues zu lernen. Dass ich noch kein Versicherungsfachwissen hatte, spielte keine Rolle. Wir werden intern sehr gut ausgebildet“, erzählt er. Gerade in Zeiten wie diesen hätte Versicherung einen besonders hohen Stellenwert und müsste perfekt zu den Kundenbedürfnissen passen, meint der Osttiroler. „Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst und ich tüftle gerne an individuellen Lösungen“, so Mayr.
Ähnlich sieht das Cornelia Habinger, die 2021 den Sprung gewagt hat und nun als Beraterin im Ötztal unterwegs ist. „Ich komme aus dem Handel und habe mir eine Veränderung gewünscht“, erzählt sie von ihren Anfängen. „Ja, ich musste und muss immer noch viel lernen. Aber das macht mir auch großen Spaß! Wenn es mal schwierig ist, dann helfen mir meine Kolleginnen und Kollegen oder mein Vertriebscoach weiter. Zu wissen, dass ich nicht immer alles allein
Mit Freude bei der Arbeit: Cornelia Habinger (TIROLER-Beraterin im Ötztal), Martin Mayr (TIROLER-Berater in Fritzens, Gnadenwald, Terfens, Weer) und Alexandra Achner (Vertriebsservice)

machen muss, hat viel Druck weggenommen“, sagt Habinger.
WECHSEL MAL DREI
Für die drei war der Start bei der TIROLER ein sehr guter: „Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Die Atmosphäre ist sehr familiär und alle begegnen den Neuen offen und freundlich. Ich gehörte von Anfang an dazu“, schwärmt Mayr. Habinger ergänzt: „Alle starten gemeinsam mit einer Grundschulung, unabhängig zu welcher Abteilung sie gehören. Damit hatte ich von Anfang ein tolles Netzwerk im Haus!“ Alle drei sind froh, den Schritt gewagt zu haben. „Alle Sorgen, die ich mir über den Jobwechsel gemacht habe, waren unbegründet. Ich habe mich sehr schnell eingewöhnt und bin froh, bei der TIROLER zu sein“, spricht Achner aus, was alle drei denken.
Das zeigt deutlich: Neues zu wagen, erfordert Mut. Doch dieser Mut schreibt meist die besten (Erfolgs-)Geschichten. PR
39 TIROLER VERSICHERUNG
© TIROLER/ILLMER
DIE HERAUSFORDERER AUS KUNDL
Wer hätte gedacht, dass sich im großen Gebäude direkt an der Autobahnausfahrt Wörgl
West mit Aqipa ein derart innovatives, in ganz Europa vertretenes und spannendes Unternehmen befindet? Beim nächsten Kopfhörer- oder Kamerakauf denken Sie vielleicht daran, dass das Produkt direkt aus dem Lager in Kundl kommt.


Als Jimmy lovine und Dr. Dre im Jahr 2008 die Firma Beats gegründet hatten, war der Markt für Kopfhörer dominiert von schlecht klingenden kleinen Ohrstöpseln, die man für weniger als 20 Euro im Laden kaufen konnte. Dr. Dre soll damals gesagt haben: Es ist eine Sache, dass Leute meine Musik online klauen, aber viel schlimmer ist es, dass ich sie in einer Qualität anhören muss, die meinem künstlerischen Schaffen einfach nicht gerecht wird. (“Man, it’s one thing that people steal my music. It’s another thing to destroy the feeling of what I’ve worked on.”)
Heute ist Beats ein allseits bekannter Name und hat über viele Jahre lang den Markt für Kopfhörer dominiert. Als die Marke

nach Europa kam, war der Erfolg keineswegs vorgezeichnet: zu teuer, zu bunt, zu anders, nicht in den GfK-Zahlen. Das waren die Aussagen, die ein junger Unternehmer von seinen Vertriebspartnern hörte. Durch Hartnäckigkeit, ein letztlich sehr gutes Produkt aber auch durch viele neue innovative Ideen, wie die Produkte am Markt präsentiert werden müssen und wie deren Story erzählt werden kann, ist es dem Unternehmer Christian Trapl und seinem Team damals mit Aqipa gelungen, die Vertriebsrechte unter anderem in Deutschland, Österreich und Spanien zu bekommen und die Marke erfolgreich aufzubauen.
Die Erfolgsgeschichte von Beats ist symptomatisch für die Erfolgsgeschichte des
Unterländer Distributionsunternehmens. Aqipa versteht sich als Wachstumsbeschleuniger, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, nach Teams, die den Status quo in Frage stellen, nach Produkten, die den Markt anders angreifen. „Viele Einkäufer bei Handelsunternehmen gehen heute nach den Verkaufszahlen der GfK, das heißt, man verlässt sich auf das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, und projiziert es in die Zukunft“, sagt Klaus Trapl, Bruder des Gründers Christian Trapl und Vertriebsleiter bei Aqipa. Dass die Fortschreibung der Vergangenheit aber ein schlechtes Modell für die Zukunft ist, hat uns die Geschichte immer wieder und vor allem in den vergangenen Jahren gelehrt. Darum verlässt
40
AQIPA
Aqipa-Gebäude Kundl Auszug des Aqipa Markenportfolios
Das robotische Autostore-Lager bietet hohe Kapazitäten.
man sich bei der Aqipa nicht allein auf die Marken, die jeder kennt, sondern versucht immer wieder neue Brands zu finden und aufzubauen.
KLARE POSITIONIERUNG
Neben der Erfolgsgeschichte Beats ist das zum Beispiel bei der Marke Marshall Headphones gelungen, im Moment sind die Unterländer drauf und dran, den Markt für Smart Beamer mit XGIMI, dem Marktführer aus China, erfolgreich zu erobern und so dem gesättigten Fernsehmarkt Anteile abzujagen. Aqipa hat sich dabei in einer sehr attraktiven Nische positioniert: Andere Distributionsunternehmen sind oft nur in einem oder zwei Märkten vertreten oder es sind Global Player, die Milliarden umsetzen und im Zweifel keine Ressourcen für kleinere, innovative Marken einsetzen. Aqipa hat einen paneuropäischen Ansatz mit Niederlassungen in ganz Europa von England über Spanien, Frankreich oder Nordics sowie Benelux und Polen oder auch Italien und natürlich die Heimmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit einem Umsatz im Bereich von 200 Millionen Euro ist das Unternehmen groß genug, um die logistischen und marketingtechnischen Anforderungen der großen Handelskonzerne zu erfüllen, und doch noch agil, flexibel und innovativ, mit kurzen Entscheidungswegen und Mut immer wieder auch neue Wege zu gehen.
Die letzten großen Kunden, die das Konzept von Aqipa überzeugt hat, sind Oakley Gaming-Brillen und der neue Action-Communicator von Milo, der die Kommunikation
im Outdoorsport ebenso revolutionieren kann, wie das GoPro beim Bewegtbild gemacht hat. Neben Audio, Gaming und dem Action/Imaging-Bereich ist die Kategorie Home-Appliances stark im Wachsen. Hier konnten die Gear-Gurus mit der Marke Mill auch im Bereich der intelligenten und designprämierten Heizsysteme einen ganz spannenden Partner gewinnen.



VIER GEWINNT
Das Geschäftsmodell von Aqipa baut dabei auf vier Säulen auf und geht viel weiter als das eines klassischen Distributionsunternehmens.

DISTRIBUTION:
Neben dem Ein- und Verkauf von Waren punktet Aqipa vor allem mit umfangreichen Services im Bereich der Markenführung, des Markenaufbaus der Distributionssteuerung, des Channel Marketings und im Handling sämtlicher Vertriebskanäle von Amazon bis zum Lebensmitteleinzelhandel, vom Fotofachmarkt bis hin eben zum Elektronikhändler.
LOGISTIK:
Als Grundlage für die effiziente Abwicklung dieser Geschäfte wird bereits seit vielen Jahren in den Aus- und Aufbau von digitalisierten Logistik- und Lagerabläufen investiert. Das automatische robotische Autostorelager bietet sehr viel Kapazität und Möglichkeiten, Produkte schnell und effizient zu versenden. Auch Fremdmarken, die vertrieblich nicht

durch Aqipa vertreten werden und gerne auch in ganz anderen Branchen tätig sein können (Kosmetik, Mode etc.), können allein die Logistik- und Lagerleistung beziehen. Dann kümmert sich Aqipa rein um die Einlagerung und den Transport zum Beispiel vom Onlineshop zum Kunden.
EIGENMARKEN:
Um sich weniger abhängig vom Distributionsgeschäft zu machen, haben die Unterländer auch in ein Eigenmarktgeschäft investiert. So konnte man mit Braun eine prestigeträchtige Lizenz von Procter & Gamble gewinnen und stellt hochwertige Designlautsprecher her, mit dem Kauf der Marke Pure ist man im Segment der digitalen Musiksysteme unterwegs.
ONLINESHOPS:
Last, but not least ist natürlich die Digitalisierung des Einzelhandels nicht spurlos an Aqipa vorübergegangen. Auch hier hat das Kundler Unternehmen Weitsicht gezeigt und in den Ausbau der eigenen Webshops investiert. So betreibt man heute sieben eigene Onlineshops für die Marken Pure, Braun-Audio, Milo, Pioneer, Onkyo, TEAC und einen großen Multimarken-Store mit Namen eleonto.com (übrigens abgeleitet vom lateinischen Wort für Edelweiß). Wer also online lokal einkaufen möchte, der findet bei eleonto.com von Kopfhörern und GoPro-Action-Cams bis hin zu hochwertigen Küchengeräten eine riesige Auswahl zu unschlagbaren Preisen. PR
41
AQIPA
Intelligente E-Heizung von Mill
Milo – Action Communicator
Audio-Design-Speaker von Braun
Online Shop für Endkonsumenten
Vom Labor auf die Piste
Der alpine Skisport ist für viele Menschen attraktiv, wird allerdings oft nur an wenigen Tagen im Jahr, dann aber für mehrere Stunden ausgeübt. Die Kombination aus hoher Motivation, vergleichsweise wenig spezifischem Training und einer intensiven körperlichen und mentalen Belastung kann dazu führen, dass Ermüdung nicht rechtzeitig erkannt wird. Ermüdungserscheinungen sind jedoch der Grund für Handlungsfehler, deren Folge Stürze und Verletzungen sein können. Im Rahmen des COMET-Kompetenzzentrums „Digital Motion“ erarbeiten Industriebetriebe gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Salzburg Research, der Universität Salzburg und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) smarte Lauf- und Skiausrüstung. Mit Hilfe von smarten Textilien und integrierter Sensorik soll die Ausrüstung gezielte Rückmeldungen an die Nutzer*innen geben, um einerseits das Sporterlebnis zu optimieren und andererseits das Verletzungsrisiko zu senken. „Wir arbeiten gemeinsam mit Atomic an intelligenter Skiausrüstung, um bei Ermüdung rechtzeitig zu warnen. Weil Ermüdung sehr individuell ist und aus sehr unterschiedlichen Gründen auftritt, wurden trainingswissenschaftliche, biomechanische sowie sportpsychologische Faktoren seitens der Universität Salzburg untersucht. Gemeinsam mit dem Know-how zu Sensorik, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz von Salzburg Research kann daraus automatisiertes Feedback generiert und die Skiausrüstung ‚intelligent‘ werden“, sagt Stefan Kranzinger, Data Scientist bei Salzburg Research und Co-Autor der Studie. Wir bleiben gespannt ...

42 bildung & innovation ZUKUNFT
© ATOMIC
VON DER UNI IN DIE WIRTSCHAFT
Das Wissen, das an Tiroler Hochschulen und Universitäten generiert wird, ist enorm. Schon seit Langem ist man bemüht, dieses (Forschungs-)Know-how auch in die heimische Wirtschaft zu transferieren. Mit Erfolg, der in schöner Regelmäßigkeit auch ausgezeichnet wird – von der Tiroler Wirtschaftskammer zum Beispiel. Seit 25 Jahren prämiert diese herausragende Dissertationen sowie Diplomund Masterarbeiten, die von Studierenden der Uni Innsbruck, des Management Center Innsbruck/MCI und der Fachhochschule Kufstein verfasst wurden. Die Jury bewertet die eingereichten Arbeiten nach einem Kriterienkatalog, in dem die Verwertung der Forschungsergebnisse sowie die Bedeutung der Arbeiten für die Tiroler Wirtschaft eine vorrangige Rolle spielen. Die Unternehmerjury wurde heuer um Vertreter aus den Hochschulen ergänzt. Der Preis ist mit je 2.000 Euro dotiert und ging heuer an Dr. Freia Ruegenberg (Uni Innsbruck), Dr. Nikolaus Weinberger (Uni Innsbruck), Jonas Lehman, MA (MCI), und Anna Thaler, MA (FH Kufstein).
HANDLUNGSFÄHIG BLEIBEN
Wie kann ich mein Unternehmen rechtlich absichern? Ein Praxistipp.
In Tirol gab es 2021 laut Wirtschaftskammer Tirol fast 36.000 Einzelunternehmen und rund 10.000 GmbHs, viele davon mit nur einem Gesellschafter/ Geschäftsführer in Personalunion. Fällt diese eine unternehmenstragende Person krankheitsbedingt oder durch Tod aus, wird das Unternehmen von einem Moment auf den anderen handlungsunfähig. Doch wie kann ein Unternehmen gegen solche Risiken abgesichert werden?
Zunächst könnte man dafür sorgen, dass es noch weitere einzelvertretungsbefugte Personen im Unternehmen gibt, beispielsweise als Prokurist*in. Gegen den gesundheitsbedingten Verlust der Handlungsfähigkeit sichert eine Vorsorgevollmacht ab. Hier wird festgelegt, wer das Einzelunternehmen im Ernstfall weiterführt, Gesellschafterrechte ausübt, neue Organe bestellt und auf geschäftliche und private Konten Zugriff hat.

VON TIROL IN DIE SCHWEIZ
Der Technologiespezialist Westcam aus Mils bleibt auch 2023 auf Expansionskurs. Gerade erst erweiterte das Unternehmen mit der Übernahme der Mehrheit des steirischen Messtechnikprofis ITM seine Kompetenz um taktile Vermessung und Lasertracker-Messung und baute damit seine Präsenz in Südösterreich aus; im heurigen Jänner kam im Zuge der Gründung der Westcam AG ein eigener Standort in Baden nahe Zürich hinzu. Von seinem neuen Basecamp aus fokussiert Westcam in einem ersten Schritt auf die Kernkompetenz Industrielle 3-D-Messtechnik und Engineering. Bereits jetzt wurden namhafte Schweizer Kunden ausgehend von der Westcam-Filiale im vorarlbergerischen Götzis betreut, der Schritt zu den Eidgenossen war also so konsequent wie folgerichtig. www.westcam.at


Ist man als Unternehmer*in schon älter, stellt sich die Frage nach einer geeigneten Nachfolge und dem idealen Zeitpunkt dafür. Bei der Unternehmensübergabe sind neben den steuerlichen Aspekten auch unternehmensrechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Hier ist neben dem Steuerberater auch der Rechtsberater wie der Notar gefragt, um die ideale Rechtsform zu finden und gegebenenfalls vor Übergabe eine Umgründung vorzunehmen. Im Idealfall kann auch eine Gesamtlösung mit Pflichtteilsberechtigten gefunden werden. Dies verhindert streitige und teure Auseinandersetzungen. Wer zu Lebzeiten noch kein Vermögen übertragen möchte, ist mit einem Testament gut beraten, auch das ist eine gute Vorsorgeform. PR
Erlerstraße 4/2. OG, 6020 Innsbruck Tel.: 0512/58 70 10, www.ak-notariat.at
43 eco. expertentipp
Notar Dr. Lukas König und Notarpartnerin Dr. Daniela Almer
AK NOTARIAT
„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, an dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde.“
WOODY ALLEN
© WESTCAM
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
Mit Problemen beschäftigt man sich oft erst dann, wenn sie da sind. In vielen Fällen ist das zu spät und nur weil man sie nicht auf den ersten Blick sieht, heißt es nicht, dass sie nicht schon vorhanden wären. Oder bereits Ungemach droht. Vorsorge kommt vor der Sorge – auch und vor allem bei der Cybersecurity.
 TEXT: MARINA BERNARDI
TEXT: MARINA BERNARDI
eco. zukunft
as Internet und die Digitalisierung haben uns zweifelsohne viele Vorteile gebracht. Dazu aber auch jede Menge Tücken. Vor allem deshalb, weil wir als Menschen mit den rasanten Entwicklungen oft nicht mehr mitkommen oder mitkommen wollen und uns vielfach das Bewusstsein dafür fehlt, was dort in diesem Netz überhaupt passiert. In der Regel nehmen wir technische oder digitale Prozesse überhaupt erst bewusst wahr, wenn sie nicht mehr funktionieren. Die Vorgänge in und hinter der digitalen Welt sind den meisten von uns verborgen, sie sind nicht sicht- und fassbar und deshalb irgendwie zu einem Schwarzen Loch geworden, in das wir unbedacht alles hineinwerfen, das uns in der „realen“ Welt wichtig und schützenswert scheint. Unser digitaler Fußabdruck ist enorm und was viele nicht wissen: Die meisten unserer Daten sind öffentlich zugänglich. Das Sammeln und Auswerten ist zwar mit einem ziemlichen Aufwand verbunden, lohnt aber vor allem dann, wenn man damit nichts Gutes im Schilde führt. Eine Firewall hilft dabei nur bedingt, auch wenn uns vielfach suggeriert wird, mit ihrer Hilfe wären wir vor allem Bösen gefeit. In den allermeisten Fällen sitzt das Problem nämlich vor dem Bildschirm. Fehlende Awareness ist das größte Einfallstor für digitale Missbrauchstätigkeiten.
Thomas Unterleitner hat sich mit seiner Finin GmbH dem Thema der Cybersecurity angenommen und setzt mit seinen Services noch weit vor besagter Firewall an. „Unsere Mission ist es, einen umfassenden Internet-Schutzschirm bereitzustellen, der Unternehmen hilft, ihre digitalen Rechte zu kennen, zu verstehen, zu wahren und durchzusetzen.“ Finin arbeitet unter anderem mit dem Europol Cybercrime Centre zusammen und hat darüber exklusiven Zugriff auf das EC3 Cyber Intelligence OSINT Dashboard, das es vereinfacht gesagt erlaubt, quasi in Echtzeit zu verfolgen, was sich in der Welt der Daten – nicht nur aber vorrangig Verbotenes – tut. OSINT steht für Open Source Intelligence und ist eine Methode zur Sammlung von sämtlichen Informationen, die über ein Unternehmen im Internet öffentlich zugänglich sind (also die meisten). Infos zu sammeln ist per se nichts Unerlaubtes, im Gegenteil. Spamfilter etwa nutzen diese, um eben verdächtige Mailadressen auszusortieren. Das Problem ist nicht das Sammeln an sich, sondern was man mit seinen Erkenntnissen anstellt.

„Was viele nicht verstehen, ist, dass wir durch jede Tätigkeit, die wir im digitalen Austausch mit anderen ausführen, permanent Informationen nach außen geben. Allein dadurch, dass wir arbeiten, hinterlassen wir in den meisten Fällen Abdrücke. Und die kann man sehen, wenn man es möchte. Der Zugriff auf diese Informati-
onen ist offen, wenngleich nicht zwangsläufig gratis, aber dennoch öffentlich verfügbar. Durch die digitale Kommunikation schaffen wir Angriffsflächen, deren Analyse es ermöglicht, über jeden von uns ein digitales Profil zu erstellen und Schwachstellen zu finden. Völlig legal. Auch wir tun das im Auftrag unserer Kunden, um herauszufinden, ob etwa E-Mail-Adressen oder Domains bereits gehackt wurden oder auf so genannten Blacklists gelandet sind. Wir schauen also von außen aufs Unternehmen, schauen uns die digitale Welt an und was diese über ein Unternehmen oder eine Organisation weiß, gänzlich ohne dass wir dafür direkt ins Unternehmen eindringen müssen, um schlussendlich zu erkennen, ob die nach außen gegebenen Informationen bereits negative Auswirkungen haben können“, so Unterleitner. All diese Informationen trägt Finin zusammen, um durch so genanntes externes Angriffsflächenmanagement potenzielle Eintrittspunkte in das Netzwerk eines Unternehmens zu finden. Finin macht also im Guten, was viele andere im potenziell Bösen machen.
Werden verdächtige Vorgänge geortet, poppen also dubiose Domains oder Websites auf oder gelangen bereits gefälschte E-Mails in Umlauf, braucht es eine rasche Reaktion. Vielen ist nicht klar, welchen Schaden derartige Missbräuche anrichten können. Nicht immer sind diese unmittelbarer finanzieller Natur, oft geht es darum, einer Marke zu schaden, um sie langfristig zu schwächen. Damit beschäftigt sich der digitale Markenschutz, zu Englisch: digital brand protection/DBP. Finin arbeitet dabei mit dem auf Markenrecht spezialisierten Innsbrucker Anwalt Stefan Warbek zusammen, der sich darum kümmert, dass etwa Websites, die einer

eco. zukunft
„Die Daten unserer betreuten Unternehmen liegen auf unseren eigenen Servern in Sistrans. Es ist uns wichtig, dafür nicht auf – internationale – Cloudlösungen zurückzugreifen.“
THOMAS UNTERLEITNER
THOMAS UNTERLEITNER
Marke nachweislich schädigen, vom Host so schnell wie möglich vom Netz genommen werden. „Wir können die Probleme unserer Kunden nicht wegzaubern, aber wir können ihren digitalen Fußabdruck zu ihrem Schutz überwachen. Unser Service kann Angriffe nicht gänzlich verhindern, das ist unmöglich, aber wir können den Schaden minimieren und so früh eingreifen, dass die Situation nicht eskaliert“, sagt Thomas Unterleitner. Dafür beobachtet er das digitale Umfeld quasi aus einer Späherposition, im militärischen Umfeld – aus dem Unterleitner eigentlich kommt – würde man von Feindaufklärung sprechen. Auch im Darkweb schaut er sich um, um proaktiv Cyberangreifer zu identifizieren. Wichtig sei, sagt Unterleitner, nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn verdächtige Vorgänge geortet werden, sondern diese zu beobachten und sich dessen bewusst zu sein, dass sie zu einem Problem werden können. Nur weil es heute noch keines ist, kann es morgen zu einem werden. Muss es aber nicht.
HINTER DEN BERG SCHAUEN
Gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie gerade erleben, nehmen kriminelle Aktivitäten zu. Früher waren diese unmittelbarer, heute sind sie durch das Abwandern ins Digitale subtiler. Hinzu kommt die Gefahr unzufriedener und teils wütender, weil vielleicht gekündigter Mitarbeiter, die oft auch fachspezifisch gut ausgebildet sind und Angriffe nicht zwingend aber auch auf das eigene (Ex-)Unternehmen starten. OSINT ist eine Methode, um solche Angriffe zu orten, dabei aber nur ein Teil des Ganzen. Unterleitner: „Seine Security-Hausaufgaben muss man trotzdem machen. Es braucht eine aktuelle Firewall und einen aktiven Virenschutz und vor allem ein Awarenesstraining für Mitarbeiter, damit nicht jeder auf jedes daherkommende Katzenvideo klickt. Unser Service ist ein erweitertes Tool für einen umfassenden Schutz.“
Stellen Sie sich ihr Unternehmen als schöne, heroische Burg vor, mit einem tiefen Burggraben (Virenschutz) und einer hohen Burgmauer (Firewall). Eines Tages kommt ein Angreifer mit einem Schlachtgerät, das dummerweise höher als die Burgmauer und richtig schlagkräftig ist. Kurzum: Die Burg geht kaputt und man fragt sich, wie das bei all den getroffenen Schutzmaßnahmen passieren konnte. Deshalb macht es Sinn, einen Aufklärer loszuschicken, der sich nicht nur im näheren Umfeld der Burg umsieht, sondern sich an-
schaut, was sich hinter der Bergkuppe abspielt. Baut dort jemand einen Angriffsturm, der größer ist als meine Mauer? Oder hat er vielleicht sogar Kanonen? Gewinnt man diese Erkenntnisse früh genug, kann man einen Angriff vermutlich nicht verhindern, sich aber besser darauf vorbereiten. Das passiert bei Finin in Form von Angriffsflächen-Management, digitalem Markenschutz und Darknet-Angreiferaufklärung. Das Beispiel der Burg gibt der Thematik ein reales Gesicht, das wichtig ist, weil uns für Cyberkriminalität vielfach das Bewusstsein fehlt, schlicht weil sie nicht haptisch ist, nicht fassbar. „Wir haben uns als Menschen in unseren Fähigkeiten in Sachen Internetisierung und Digitalisierung kaum weiterentwickelt, um die dort vorhandene Abstraktion zu verstehen. Doch auch wenn ich die Gefahr nicht sehe, so ist sie trotzdem da und sie geht auch nicht weg, wenn man sie einfach ignoriert“, gibt Thomas Unterleitner zu bedenken. Fast kein Unternehmen ist zu klein, um zum Angriffsobjekt zu werden. Besondere Vorsicht ist bei all jenen geboten, die mit sensiblen Daten hantieren. Steuerberater oder Anwälte zum Beispiel. Auch wenn diese oft über einen relativ überschaubaren Internetauftritt verfügen, so kommunizieren sie in der Regel digital. Und wer online kommuniziert, ist in irgendeiner Weise gefährdet. Finin bietet dafür individuelle Unternehmenslösungen, wir können Ihnen an dieser Stelle mitgeben: Passen Sie auf, bleiben Sie aufmerksam und werden Sie sich dessen bewusst, dass Cybercrime keine Frage der Unternehmensgröße oder -art ist.
eco. zukunft 46
„Die Cyber-Bedrohungslandschaft hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, wobei die Zahl der ausgeklügelten Angriffe und die Zahl der böswilligen Akteure zugenommen hat. Unternehmen müssen deshalb sicherstellen, dass sie jederzeit über die richtigen Tools verfügen, um ihr Netzwerk vor Angreifern zu schützen.“
INTERNATIONALITÄT, UNTERNEHMERTUM & DYNAMIK
Die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und lässt Studierende vom einzigartigen Konzept der Verbindung aus Wissenschaft und Wirtschaft, internationalen Lehrenden und Experten und einem weltweiten Netzwerk profitieren.
BEWERBUNGSFRIST
26. März 2023
Jetzt informieren!
BACHELOR
Betriebswirtschaft Online
Bio- & Lebensmitteltechnologie
Business & Management
Digital Business & Software Engineering
Management, Communication & IT
Management & Recht
Mechatronik, Design & Innovation
Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie
Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement
Smart Building Technologies
Soziale Arbeit
Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik
Unternehmensführung, Tourismus- & Freizeitwirtschaft
Wirtschaft & Management
Wirtschaftsingenieurwesen
MASTER
Biotechnology

Corporate Governance & Finance
T OPMODERNES, INTERNATIONALES STUDIENANGEBOT
29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences vermitteln hochwertiges Know-how und bereiten die Studierenden auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot
N ÄCHSTE KARRIERESCHRITTE: MCI - WEITERBILDUNG
Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bietet das MCI spannende akademische Upgrades mit international anerkannten Mastergraden und dynamische Karriereoptionen durch maßgeschneiderte modulare Weiterbildungen.
• PhD Program for Executives
• MSc | DBA Double Degree Program
• Executive MBA General Management
• Executive MBA Digital Business & Entrepreneurship
• Executive MBA Management & Leadership
• LL.M. Digital Business & Tech Law
• Management & Leadership MSc (Einstieg nur bis Mai möglich)
• MCI eStudy: Bachelor (CE) General Management
• Zertifikatslehrgänge & Management-Seminare
• Technische Weiterbildung & Inhouse-Trainings
Jetzt informieren: mci.edu/weiterbildung
Bei Bewerbung bis 26. März 2023 – Early Bird Offer: 2.000 Euro auf jeden MBA | MSc | LL.M.
M ENTORING THE MOTIVATED
Mit seinem dynamischen Start-up-Spirit begleitet das MCI Studierende, Alumni und Partner in ihrer Karriere und unternehmerischen Aktivitäten und fördert jene Kompetenzen, welche erfolgreiche Führungskräfte und Entrepreneure benötigen.

Infos: mci.edu/entrepreneurship
Entrepreneurship & Tourismus
European Health Economics & Management
International Business & Law
International Business & Management
International Health & Social Management
Lebensmitteltechnologie & Ernährung
Management, Communication & IT
Mechatronik & Smart Technologies
Medical Technologies
Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management
Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik
Wirtschaftsingenieurwesen
EXECUTIVE EDUCATION
PhD Program for Executives
MSc | DBA Double Degree Program
Executive MBA
Management & Leadership Executive MBA
Digital Business & Entrepreneurship MBA
Digital Business & Tech Law LL.M.
Management & Leadership MSc
eStudy Bachelor General Management
Zertifikatslehrgänge & Management-Seminare Member of

MCI
© Stubaier Gletscher
© MCI/KASPER
Premium accredited Member of TRT G G ME AT NO PRE UM Vollzeit Berufsbegleitend Online Dual Deutsch Englisch
DIE ZUKUNFT IST DA
Die Frühphase des Internets startete tatsächlich schon Mitte der 1960er-Jahre, dessen kommerzielle Phase beginnt Anfang der 1990er. Mittlerweile beginnen sich reale und virtuelle Welten zu vermischen.
Wie bei den industriellen Revolutionen – mittlerweile sind wir bei Industrie 4.0 angelangt – durchläuft auch das World Wide Web verschiedene Etappen. Waren zu Beginn die meisten Websites sehr statisch und die Mehrheit der Nutzer*innen noch Verbraucher und nicht Produzenten von Inhalten, basiert die Idee des Web 2.0 auf der Idee des „Web als Plattform“, in dem Nutzer*innen etwa in Form von Social-Media-Beiträgen, Blogs oder Wikis selbst Inhalte bereitstellen. Mit der neuen Generation des Web 3.0 beginnen indes die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt zusehends zu verschwimmen. Was das bedeutet und wie man diese neuen Technologien für sich nutzen kann, damit beschäftigt sich die internationale Metaverse-Konferenz „Metagonia“, die im Oktober erstmals in Kitzbühel stattfindet – konsequenterweise als Vor-Ort-Variante als auch virtuell.
„Beim Thema Web3 hat man das Gefühl, jeder versucht einem den Backofen zu erklären, statt Kuchen zu backen. Dabei verhält es sich mit der neuen Technologie doch wie mit einem guten Song: Ich muss den Text nicht verstehen, um zu tanzen”, so Peter Becke, Chief Creative Officer der Tiroler Kommunikationsagentur ComSat Media GmbH aus Kitzbühel und Allianz-Partner der Metagonia. Mit seinem Team unterstützt er schon heute Unternehmen dabei, in digitalen Welten zu kommunizieren.
Bei der Metagonia vermitteln internatiole Topspeaker*innen Themen wie NFT, Blockchain oder Crypto lebensnah und verständlich. Ida Kymmer, Woman Director of Global Affairs bei Journee, einem weltweit führenden Unternehmen für virtuelle Welten, spricht über Parallelwelten im digitalen Raum und wie sie mehr und mehr klassische Webseiten ersetzen können. Top 100 Women of the Future Caroline Johnová referiert darüber, wie Unternehmer*innen die Technologie nutzen, um unseren Alltag zu verbessern. Digital Artist Yves Peitzner zeigt während einer Live-Performance, wie digitale Kunst entsteht und sich der Kunstmarkt unter Anwendung der NFC-Technologie in digitalen Welten monetarisiert. Beispiele, die sich auf zahlreiche Branchen übertragen lassen.
Bei festivalähnlicher Atmosphäre darf auch der Genuss in Kitzbühel nicht ausbleiben. Henris-Edition-Verlagschef Hans Fink präsentiert beim Gault&Millau-Wine-Tasting, wie er mit dem traditionsreichen Gourmetführer in der realen Welt Feinschmecker*innen zu zahlenden Sammler*innen virtueller Produkte macht und was passiert, wenn die Flasche leer ist und dennoch an Wert gewinnt. Mit einer digitalen Kopie der Stadt Kitzbühel im Metaversum stellen die Veranstalter*innen der Metagonia ihren Anspruch unter Beweis, digitale Welten für Konsument*innen zugänglich zu machen. Thorsten Peisl, Initiator der Metagonia und des einzigartigen Kitzbühel-Zwillings: „Das Tor in neue digitale Welten steht offen – wer mittanzen möchte, ist herzlich eingeladen.“
METAGONIA
Internationale Metaverse-Konferenz 5. bis 8. Oktober 2023 in Kitzbühel www.metagonia.at / LinkedIn, Twitter: @metagonia Instagram: @metagonia_at
TICKETS
• love – 3 Tage: Konferenz in Kitzbühel inkl. Sideevents, Dinner, Party, Speakersnight, 1.450 Euro

• local – 1 Tag : Konferenz in Kitzbühel, 950 Euro
• live: Zugang zu Konferenz im Kitzbühel Metaversum, 250 Euro
• learn: Zugang zu Konferenz im Kitzbühel Metaversum für Student*innen, 25 Euro
COMMUNITY
Sie sind als Tiroler Unternehmen bereits im Bereich Web 3.0, Metaversum, NFT, Blockchain, Crypto, DAO, Avataren, AR oder VR aktiv? Schließen Sie sich der Metagonia an und profitieren Sie von einer Trust Brand mit hoher Aufmerksamkeit und einem inspirierenden Netzwerk. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt: gate@metagonia.at
eco. zukunft 48

Jungtalent trifft Adler! Deine Lehre. Dein Erfolg. Bewirb dich jetzt auf eine Lehrstelle beim Land Tirol. www.tirol.gv.at/lehrlinge Bezahlte Anzeige | Foto: Land Tirol/Charly Schwarz Komm zum BewerberInnentag!
ACCENTURE GIBT KRÄFTIGEN IMPULS FÜR DEN STANDORT TIROL
Die Entwicklung eines Technologie-Kompetenzzentrums mitten in Innsbruck stärkt den Wirtschaftsstandort Tirol und bietet Marktchancen in ganz Europa. Basis dafür ist die ARZ-Übernahme durch Accenture, die Ende 2022 abgeschlossen wurde.
Die ARZ-Akquisition von Accenture ist die Basis für die Entwicklung eines Tech-Hubs in Tirol und eines Kompetenzzentrums für das Banking der Zukunft. Im Fokus der Wachstums- und Entwicklungsstrategie steht der Ausbau und Aufbau zu einem Cloud-basierten Platform-as-a-service-Angebot für Banken, das von Kern-Bankdienstleistungen über Online-Banking bis hin zu regulatorischen Dienstleistungen für Bankkunden in ganz Europa reicht. Michael Zettel, Country Managing Director von Accenture Österreich, gibt Einblicke in die Pläne von Accenture am Standort Tirol.

ECO.NOVA: Warum kommt Accenture nach Tirol? MICHAEL ZETTEL: Accenture ist ein führendes internationales Unternehmen mit bereits starken Wurzeln in Österreich. Accenture wird nun aber auch zu einem Tiroler Unternehmen, das voller Tatendrang mit weiteren Partnern am Standort anpackt. Die ARZ-Übernahme mit seinen 400 top-

qualifizierten Mitarbeitern am Standort in Innsbruck bietet große Möglichkeiten und neue Perspektiven – für Accenture, für den Wirtschaftsstandort Tirol und letztendlich für die Menschen im Land. Das ARZ-Team verfügt über die Erfahrung und das Knowhow, um gemeinsam zu wachsen und die Bedürfnisse von Bankkunden jetzt und in Zukunft perfekt zu erfüllen.
Was ist demnach die gemeinsame Vision? Gemeinsam kräftig in die digitale Transformation investieren, um die Banken der Zukunft zu gestalten. Diese verlagern ihre Kernfunktionen verstärkt in die Cloud, um neue Businessmodelle zu ermöglichen. Daher bauen wir ein umfassendes Kompetenzzentrum auf. Unser klarer Auftrag ist es, ein innovatives, cloudbasiertes Banking-Platform-as-a-service-Angebot für neue und bestehende Kunden in ganz Europa zu entwickeln.
Was bedeutet dies im Detail? Die bestehenden ARZ-Kunden wie die Hypo Tirol oder die Volksbanken werden von der Accenture TiGital GmbH übernommen. Dies gilt auch für das umfassende Serviceangebot, das sukzessive ausgebaut wird. Mit der Übernahme des ARZ investieren wir in die digitale Transformation und entwickeln das Banking der Zukunft „Made in Austria“. Der Standort in
Innsbruck wird daher federführend bei der digitalen Transformation mitgestalten und sich damit zu einem richtigen Kompetenzzentrum entwickeln.
In welcher Größenordnung sind Investitionen geplant? Nach der ARZ-Übernahme werden wir 50 Millionen Euro am Standort investieren. Mit dem Set-up der bestehenden Expertise in Verbindung mit dem internationalen Bankennetzwerk und Know-how von Accenture wollen wir ein neues, zukunftsweisendes Angebot für die bestehenden Kunden schaffen und neue Märkte erschließen PR
ACCENTURE: GLOBAL UND REGIONAL VERANKERT Vor 35 Jahren hat das internationale Beratungsunternehmen Accenture sein erstes Büro in Wien eröffnet. Das globale Unternehmen ist seitdem stark in Österreich verankert – mit vielen österreichischen Projekten, bei heimischen Organisationen und Unternehmen im gesamten Bundesgebiet und mit mittlerweile 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Wien, Linz und nun auch Innsbruck. www.accenture.at

50 ACCENTURE
„Das Banking der Zukunft wird in absehbarer Zeit das Prädikat ‚Made in Austria‘ bzw. ‚Made in Tirol‘ tragen.“
MICHAEL ZETTEL
NACHHALTIGE INVESTITION IN DEN STANDORT TIROL

Der internationale Partner Accenture stärkt nachhaltig das IT-Know-how und bringt große Expertise für die Cybersecurity am Standort.
Das ARZ, das der Hypo Tirol wie anderen Banken IT-Dienstleistungen bereitstellt, hat sich in Abstimmung mit seinen Gesellschaftern für eine Übernahme durch Accenture entschieden. Die Entscheidung, seit Ende 2022 unter dem Dach von Accenture zu agieren, wurde gemeinschaftlich unter allen Gesellschaftern getroffen und positiv angenommen. Der neue internationale Partner bringt sein geballtes IT-Know-how nach Tirol. Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol, erläutert die Hintergründe für die strategische Partnerschaft.
ECO.NOVA: Warum ist die ARZ-Übernahme eine nachhaltige Entscheidung? WILFRIED
STAUDER: Manchmal muss man loslassen, damit mehr entstehen kann. Als Tiroler Landesbank stellen wir sicher, dass das bestehende Know-how auch künftig in Tirol bleibt und darüber hinaus noch kräftig mit dem internationalen Know-how von Accenture wächst. Es ist daher strategisch richtig, den Schritt zu Accenture zu machen – alle Bankkunden sowie deren Kunden werden künftig von der Bereitstellung bester IT-Services des ARZ unter dem Dach von Accenture profitieren.

Was macht Sie dabei so sicher? Mit der klaren Vision von Accenture zum Aufbau
eines Tech-Hubs entstehen einzigartige Perspektiven für Wirtschaft und Wissenschaft im ganzen Land. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn ein führendes IT-Unternehmen mit über 700.000 Mitarbeitenden beschließt, nach Tirol zu kommen und kräftig in den Standort zu investieren. Das macht uns stolz und ist zugleich auch Auftrag für uns, mit allen Partnern an einem Strang zu ziehen. Tirol bietet gute Rahmenbedingungen – durch gut ausgebildete Menschen und ein starkes Netzwerk von Wirtschaft und Wissenschaft.
Welcher Mehrwert ergibt sich für den Standort Tirol? Als internationaler Player bringt Accenture nachhaltig starkes ITKnow-how an den Standort Tirol. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten ist Accenture führend in Digitalisierung und Security – gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations. Besonders im Hinblick auf das komplexe Thema Cybersecurity bringt Accenture durch seine internationale Ausrichtung eine große Expertise mit – diese kommt in hohem Maße Finanzdienstleistern wie der Hypo Tirol zugute. Aber nicht nur das, Accenture investiert in moderne Technik und natürlich in Mitarbeiter. Der Zusammenschluss eröffnet daher spannende Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Technologiebereich.
Ist diese Perspektive zugleich auch als Auftrag zu verstehen? Ja – wir haben den Auftrag, diese einzigartige Chance zu nutzen. Durch unsere Landesuniversität und Fachhochschulen haben wir gut ausgebildete Menschen im Land. Klar ist, dass wir dort die bereits gesetzten digitale Schwerpunkte weiter voranbringen müssen, damit Tirol auch wie geplant europaweit führend als Tech-Hub agieren kann. Das sind Perspektiven, um mehr als positiv in die Zukunft zu blicken PR
51
Accenture kommt gemeinsam mit seiner Tochter Avanade, einem IT-Implementierer, der auf Microsoft spezialisiert ist, nach Tirol, um langfristig ein Technologiezentrum aufzubauen. Von Tirol aus wird künftig die digitale Transformation in Europa vorangetrieben.
ACCENTURE
Wilfried Stauder, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo Tirol

52
DAS MUSS DOCH BESSER GEHEN
Innovationen ist inhärent, dass sie nicht ein Bedürfnis schaffen, sondern ein Problem lösen. Die zwei HTL-Schüler Patrick Jenewein und Marcel Maffey haben das getan.
a sage noch einer, die Generation Z wäre verwöhnt, faul, empfindlich und kriege nichts gewuppt. Patrick Jenewein und Marcel Maffey, Jahrgang 2004 und Schüler der HTL Anichstraße, beweisen mit ihrer Diplomarbeit das Gegenteil. Sie haben mit ihrer Lawinensonde Avalano ein fast marktreifes Produkt entwickelt und nicht nur uns mit ihrer professionellen Präsentation und Eloquenz überzeugt.
Geboren wurde die Idee wie so oft aus einem persönlichen Ärgernis, wie Patrick Jenewein erzählt und dafür ein bisschen ausholt: „Um Schneeprofile zu erstellen, braucht es bestimmte Parameter – einer davon ist die Schneetemperatur. Mein Bruder ist Lawinenbeobachter, ich habe ihn bei Messungen regelmäßig begleitet und wurde dafür abgestellt, eben diese Temperaturen zu messen. Das war relativ mühsam und verhältnismäßig zeitaufwändig und ich dach-

Patrick Jenewein und Marcel Maffey sicherten sich mit ihrer Lawinensonde Avalano samt zugehöriger App Ende letzten Jahres den Sonderpreis in der Kategorie „Positive Impact“ beim 120-Sekunden-Ideencasting der Standortagentur Tirol. Dieser Award wird für Produkte und Dienstleistungen vergeben, die zur Lösung eines gesellschaftlichen oder ökologisch relevanten Problems beitragen. Im konkreten Fall erkennt ihre Lawinensonde autonom den Verlauf von Temperaturveränderungen in der Schneedecke, wodurch deren Aufbau präziser analysiert werden kann, um damit die Qualität von Lawinenprofilen zu steigern.
te mir: Das muss doch besser gehen.“ Also hat er sich gemeinsam mit Marcel Maffey daran gemacht, diese Prozesse zu automatisieren. Zusammen haben die beiden eine Sonde entwickelt, die den Verlauf von Temperaturveränderungen in der Schneedecke autonom erkennt und daraus Daten zur besseren Analyse liefert. Der Name: Avalano.
Der erste Weg führte Jenewein und Maffey fast folgerichtig zum Lawinenwarndienst Tirol, bei dem sie mit ihrer Idee vorstellig wurden und die zu Beginn wohl wichtigste Frage stellten: Kann man so etwas in der Praxis brauchen? Man kann, denn tatsächlich hadern auch Experten mit der aufwändigen Temperaturaufnahme. Da diese allerdings ein wesentliches Element eines Schneeprofiles ist, weil sich darüber unter anderem
Rückschlüsse auf die einzelnen Schneeschichten und folglich auch über die Lawinensituation ziehen lassen, kommt man nicht drumherum. Die weitere Entwicklung der Sonde erfolgte infolgedessen in enger Abstimmung mit dem Lawinenwarndienst, der dazu wertvollen Input liefert und – geht es nach den beiden Jungs – das Gerät à la longue selbst im Einsatz haben soll, um Temperaturmessungen rascher und damit häufiger durchführen zu können. Weil der langfristige Plan ist, Avalano auch privaten Tourengehern zu Verfügung zu stellen, haben sich Patrick Jenewein und Marcel Maffey dazu entschlossen, kein neues, eigenständiges Gerät dafür zu kreieren, sondern Bestehendes zu adaptieren, um die Anwendung so unkompliziert wie möglich zu gestalten. „Wir
eco. zukunft 53
TEXT: MARINA BERNARDI
„Wir möchten nicht, dass zukünftige Anwender ein weiteres Gerät mit auf den Berg nehmen müssen, deshalb haben wir Avalano an eine Lawinensonde gekoppelt, die viele Tourengeher ohnehin mithaben.“
PATRICK JENEWEIN
IDEE DER AUSGABE
FOTOS: © ANDREAS FRIEDLE
haben bewusst ein Gerät verwendet, das die meisten Tourengeher ohnehin dabeihaben: eine Lawinensonde. Diese wird entsprechend aufgerüstet, man steckt sie ganz unkompliziert in den Schnee, schaltet ein und lässt sie messen.“
Der Prototyp hat vorerst drei Tempertaurentnahmestellen in Form eines Aluminiumrings mit Temperatursensor bekommen, der die Daten an den Header, also die Elektronik am oberen Ende der Sonde, sendet, der diese wiederum an eine eigens programmierte App weiterleitet, die sie einfach und auch für Laien verständlich aufbereitet. Im Endprodukt sollen die Messstellen auf zehn ausgeweitet werden, um noch präzisere Daten zu erhalten. „Wir möchten mit Avalano zwei Dinge erreichen: Wir wollen die Temperaturmessung automatisieren, um sie schneller und einfacher zu machen, und es dadurch ermöglichen, dass Messungen öfter durchgeführt werden können, um punktuell bessere Ergebnisse zu erzielen. Auf der anderen Seite sollen über die Zeit Daten gesammelt werden, um in Zukunft anhand der Temperaturverläufe Vorhersagen zur Lawinensituation treffen zu können“, erklären die beiden Schüler. Dem Tourengeher soll sohin ein Tool an die Hand gegeben werden, mit dem er selbst vor Ort die potenzielle Lawinengefahr überprüfen und sich folglich überlegen kann, weiterzugehen oder umzukehren. 100-prozentige Sicherheit gibt es selbstverständlich auch dann nicht, der Berg hat seine ganz eigenen Gesetze, Avalano aber ermöglicht

LAWINEN -APP
Noch ist Avalano nicht offiziell am Markt, die App von „Lawine Tirol“ gibt’s indes schon seit zehn Jahren und auch sie ist ein Präventionstool für alle, die winters aktiv am Berg unterwegs sind. Die App bietet nebst einem täglichen Lawinenbericht gesammelt aus Daten von über 200 Tiroler Wetterstationen auch Praktisches wie einen Kompass oder einen Höhen- und Hangneigungsmesser. Die App gibt’s zum kostenlosen Download für Apple und Android.
es, einen Einblick in die Schneeschichten unter einem zu haben, die bis dahin einfach nur weiß waren. „Uns war es vor allem wichtig, dass das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen ist. Wenn wir Avalano einem Tourengeher in die Hand drücken und er weiß nichts damit anzufangen, geht der Sinn dahinter verloren. Wir finden, Avalano ist sehr anwenderfreundlich geworden und in Kombination mit der Lawinensonde macht es vielmehr Sinn als ein zusätzliches externes Gerät“, sagt Maffey. Denkbar wäre auch, Avalano künftig stationär an Wetterstationen zu koppeln, um somit regelmäßig Daten zu senden.
VON DER SCHULE IN DIE PRAXIS
Entstanden ist Avalano im Zuge der Diplomarbeit. „Wir können uns dabei in einem geschützten Rahmen bewegen und uns ausprobieren. Es ist ja nicht gesagt, dass aus unserer Ursprungsidee tatsächlich ein Produkt wird“, sagen die beiden. Der Zuspruch seitens des Lawinenwarndienstes jedenfalls ist groß. Es kommt nicht von ungefähr, dass man schon seit rund eineinhalb Jahren zusammenarbeitet. „Der Austausch mit dem Lawinenwarndienst ist uns wichtig, wir möchten Avalano so kundenorientiert wie möglich entwickeln. Wir wollen wissen, was potenzielle Nutzer brauchen, und passen uns laufend an, damit wir nicht am Ziel vorbeiarbeiten“, sagen die beiden reflektiert: „Avalano ist ein ständiger Entwicklungsprozess und es wird noch eine Weile dauern, bis es getestet und anhand repräsentativer Daten erprobt ist. Zuerst geht es uns darum, dass das Gerät technisch funktioniert, dann schauen wir weiter.“ Das Ziel indes ist klar: Das Ding soll auf den Markt kommen. „Wir haben beide vor zu studieren und würden gerne nebenher ein Unternehmen gründen“, steckt Maffey die Marschrichtung ab. Mit dem Sieg beim 120-Sekunden-Ideencasting der Standortagentur, zu dessen Teilnahme übrigens ein Lehrer geraten hat, geht auch eine Mitgliedschaft beim Impact Hub einher, der unter anderem dabei hilft, Struktur zu finden und Menschen, die einen auf dem Weg begleiten und unterstützen. Auch die Suche nach potenziellen Produktionspartnern hat bereits begonnen. „Im Moment arbeiten wir noch mit dem Equipment aus der Schule, für die Massenfertigung brauchen wir natürlich entsprechende Partner“, so Jenewein.
Das 120-Sekunden-Casting hat den beiden übrigens vor allem bei ihren Präsentationsfertigkeiten geholfen. Erfolgreich, wie wir finden. Maffey: „Es war echt lässig, weil wir viel gelernt haben – auch, was die potenziellen Fragen zu dem Produkt sind und wie wir Avalano auch jenen verständlich erklären können, die damit bis dato nichts am Hut hatten. Wir konnten auch spannende Kontakte knüpfen, die uns künftig hoffentlich weiterbringen werden.“ Der Lawinenwarndienst Tirol hat den beiden außerdem geraten, sich mit der ÖGSL, der Österreichischen Gesellschaft für Lawinen und Schneekunde, in Verbindung zu setzen, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Wäre der Lawinenwarndienst selbst nicht vom Produkt überzeugt, wäre das wohl kaum passiert. So gesehen bestehen gute Chancen, dass Avalano tatsächlich am Markt reüssiert.
eco. zukunft 54
„Wir haben beide vor, zu studieren, und würden gerne nebenher ein Unternehmen gründen, um Avalano marktreif zu machen.“
MARCEL MAFFEY

Member of the Radin Print Group www.radin-berger-print.at office@radin.at Tel. +43 512 302412 Radin Berger Print GmbH Innsbrucker Straße 59 6176 Innsbruck-Völs individuelle Offsetdruck-Lösungen die EINDRUCK MACHEN ❱ MAGAZINE ❱ KATALOGE ❱ BROSCHÜREN ❱ KUPONHEFTE ❱ BEILEGER ❱ BOOKLETS ❱ HARD- UND SOFTCOVER
Tirol bleibt teuer
Die Zinswende und verschärfte Regularien stoppen zwar den steilen Anstieg der Immobilienpreise, sodass für 2023 und 2024 kleine Preiskorrekturen nach unten zu erwarten sind, das Preisniveau vor allem in Tirol bleibt dennoch hoch. „Wir erwarten 2023 und 2024 österreichweit nominale Preisrückgänge von jährlich fünf Prozent. Wohneigentum würde sich damit auf Gesamtjahressicht erstmals seit 2004 wieder etwas verbilligen. Allerdings dürfte die erwartete Preiskorrektur nur moderat ausfallen, verglichen mit dem Gipfelsturm der Immopreise in den letzten Jahren“, so Ökonom Matthias Reith von Raiffeisen Research. Das Einfamilienhaus hat sich in Tirol in den beiden Pandemiejahren ausgehend von einem ohnehin schon hohen Niveau um jeweils 16 Prozent verteuert – insgesamt sind hier die Zuwächse bereits seit 2015 zweistellig. Und auch die Wohnungen verteuerten sich in Tirol mit durchschnittlich 8,2 Prozent pro Jahr zwischen 2016 und 2021 deutlich über dem Österreichschnitt. Dass dieses hohe Tiroler Preisniveau trotz der besonders angespannten Leistbarkeitssituation in den drei westlichsten Bundesländern gut abgesichert ist, liegt an Faktoren wie dem Bevölkerungswachstum, aber vor allem an dem in Tirol besonders knappen Gut Baugrund. Das Fazit von Raiffeisen Research aus der zugrunde liegenden Immobilienstudie: Der Partystimmung auf dem österreichischen Immobilienmarkt taten die diversen Krisen der gar nicht mehr so jungen Geschichte der Eurozone keinen Abbruch, auch wenn die – mancherorts sorglose – Schönwetterperiode langsam zu Ende gehen scheint.

56 finanzieren & versichern GELD
AM RICHTIGEN ENDE ( NICHT ) GESPART
Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, eine explodierende Inflation und der Klimawandel sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Umstände, die sich nicht nur finanziell bemerkbar machen, sondern mittlerweile Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche der Österreicher*innen haben. Das ergab – wenig überraschend – eine Umfrage von IMAS Austria, im Auftrag von Erste Bank, Sparkassen und Wiener Städtische. Über 70 Prozent der Befragten gehen von einer Verschlechterung der eigenen Lebensqualität in den kommenden Monaten aus. Doch obwohl die finanziellen Belastungen zunehmen, an einer Stelle wird nicht gespart: der persönlichen Vorsorge. Die Bedeutung der privaten Vorsorge hat mit 90 Prozent ein Allzeithoch im Land erreicht. Die Aufwendungen für die Pensions- und Gesundheitsvorsorge liegen mit durchschnittlich 247 Euro im Monat so hoch wie nie. Bei den Vorsorgegründen liegt die finanzielle Reserve für Krisenfälle mittlerweile ganz weit vorne. Nicht geändert haben sich die Top-drei-Vorsorgeprodukte: Sparbuch, Lebensversicherung, Bausparer.
ES BLEIBT SPANNEND
Was können wir vom Jahr 2023 erwarten?
Aus Sicht der Steuerberater*innen wird das begonnene Jahr 2023 besonders interessant. Die Ausschüttung von Wirtschaftshilfen mit der Gießkanne dürfte nicht mehr so massiv ausfallen wie in den letzten Jahren. Der Zuschuss zu den Energiekosten wollte in einem ersten Schwung nicht so richtig gelingen, nur wenige Klein- und Mittelbetriebe haben wegen der hohen Hürden einen Zuschuss beantragen können. So warten wir gespannt auf den nächsten „großen Wurf“ des Gesetzgebers für einen zweiten Energiekostenzuschuss.

Hoffentlich werden die zahlreichen noch ausstehenden Anträge zu den Coronaförderungen, die wir seit dem Frühjahr 2020 gestellt haben, seitens der Förderstellen endlich abgearbeitet, damit wir alle Klarheit erhalten, welche Fördermittel genehmigt werden und welche nicht. Wir wollen das leidige Kapitel „Coronaförderungen“ endlich vom Tisch haben, aber dazu müssen auch die zahlreichen (schon längst angekündigten) Prüfungen endlich stattfinden.
GEWECHSELT
Finanzexperte Mario Bernardi hat den Arbeitgeber gewechselt und leitet seit Anfang des Jahres nunmehr das Private Banking der Innsbrucker Niederlassung des Bankhaus Spängler. Der neunte Standort der ältesten Privatbank Österreichs, die sich seit der Gründung 1828 in Familieneigentum befindet, wurde vor zwei Jahren in der Tiroler Landeshauptstadt eröffnet, insgesamt liegt das betreute Kundenvolumen des Bankhauses bei rund 9,7 Milliarden Euro. Der Hauptfokus liegt auf vermögenden Privatkunden und Familienunternehmen.

Das seit Monaten gestiegene Zinsniveau wird zahlreiche Betriebe und auch Vermieter von Immobilienbesitz in Bedrängnis bringen. Verschärft wird die Situation durch höhere Betriebskosten für die Gebäude, die in manchen Lagen nicht zur Gänze an die Mieter weiterverrechnet werden können. Das bringt Zündstoff in steuerlicher Hinsicht, wenn Verluste aus Vermietungen entstehen.
Ich erwarte mir ein sehr „spannendes“ Jahr, das wir gemeinsam mit unseren Klient*innen hoffentlich gemeinsam zufriedenstellend meistern können. PR

eco. expertentipp
Prof. StB MMag. Dr. Klaus Hilber ist Präsident der Kammer der Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen in Tirol
© BLICKFANG PHOTOGRAPHIE 57
„Es gibt Menschen, die Geld haben, und Menschen, die reich sind.“
COCO CHANEL
© BANKHAUS SPÄNGLER
ERSTENS KOMMT
ES ANDERS, ZWEITENS ALS MAN DENKT.

eco. geld
Derzeit stehen die Zeichen zunehmend auf eine mögliche Zinsanhebungspause oder gar Lockerung der Geldpolitik. Rückläufige Energie- und Rohstoffpreise dämpften die Headline-Inflation, in den USA mäßige Lohnsteigerungen im Dezember lassen dort die Leitzinserwartungen zurückgehen. Damit einhergehend ist auch der jüngste Renditerückgang am langen Ende. Doch es gibt Faktoren, die eine zweite Inflationswelle einleiten könnten.
TEXT: MICHAEL KORDOVSKY
Vor steigenden Zinsen ungeschützte Häuselbauer und Wohnungskäufer bekamen den Zinsschock in voller Härte zu spüren. Viele hat diese Entwicklung wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.
fänglich pro Jahr hochgerechnet rund 9.000 Euro mehr an Zinsen bezahlen. Viele hat diese Entwicklung wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.
FREUD UND LEID
Die aktuelle Kombination aus hohen Inflationsraten, der jüngsten Zinsexplosion und seit August strengeren Immobilienkreditvergaberichtlinien führt in Österreich in puncto Leistbarkeit von Wohnraum immer mehr zu einer Auflösung der Mittelschicht. Die Teuerung ist da und die Zinsen am langen Ende haben in Erwartung einer baldigen Entspannung an der Zinsfront noch nicht sonderlich stark reagiert. Doch die Schwankungsbreite der Zinsen ist hoch und im Fall von Neuabschlüssen langjähriger Fixzinsbindungen reagieren Banken immer seltener auf kurzfriste Zinsrückgänge. Vielmehr sichern sie sich einen „Polster“ für weitere Zinsschübe am langen Ende. Die aus einer Marktstichprobe von zwölf Kreditinstituten gewonnenen Durchschnittskonditionen 20-jähriger Fixzinsbindungen bei Neuabschluss fassen die Wohnbau-Finanz-Experten von Infina in ihrer jüngsten Aussendung zum IKI (Infina Kredit Index) vereinfacht formuliert so zusammen: „Pro 100.000 Euro Kredit mit 25 Jahren Gesamtlaufzeit verteuerte sich für eine 20-jährige Fixzinsbindung der Kredit um 1.585,80 Euro pro Jahr. Im Fall eines Kreditbetrags von 300.000 Euro wäre es bereits eine jährliche Verteuerung um 4.757,40 Euro.“ Die Folge: Immer weniger Einwohner können sich Wohneigentum leisten und wohnen deshalb in Miete.
or steigenden Zinsen ungeschützte Häuselbauer und Wohnungskäufer, die weiter in variabel verzinsten Krediten verharrten, bekamen den Zinsschock in voller Härte zu spüren. Der 3-Monats-Euribor als geläufiger Referenzzinssatz für variabel verzinste Wohnbaukredite stieg von minus 0,57 Prozent am 3. Jänner 2022 bis 20. Jänner 2023 auf 2,417 Prozent, also um 2,987 Prozentpunkte. Wer also 300.000 Euro an variabel verzinsten Immobilienkrediten offen hat, würde in diesem Fall an-
VErste Lichtblicke hingegen gibt es für Sparer. Während die klassischen Banken sich mit Sparbuchzinsen tendenziell noch etwas zurückhalten, gibt es bei den auf Sparkonten spezialisierten Instituten bereits erste interessante Angebote. Gleichzeitig werfen langjährige heimische Bundesanleihen wieder Renditen von knapp drei Prozent per anno ab und es ist in puncto Renditen noch Luft nach oben (bedeutet fallende Anleihenkurse). Sparer, die von baldigen Nachbesserungen der Angebote überzeugt sind, sollten ihr Geld deshalb vorerst jederzeit verfügbar parken oder maximal auf zwölf Monate binden, um dann auf möglicherweise lukrativere Angebote umzusteigen oder gar in langlaufende Bonds mit höherer Rendite zu investieren.

eco. geld 59
SCHWÄCHETENDENZ AM IMMOBILIENMARKT
Immobilien treten bei wohlhabenden Anlegern in Konkurrenz zu Sparguthaben und Anleihen. Denn sowohl Zinsen als auch Monatsmieten sind regelmäßige fixe Einnahmen. Derzeit stehen Mietrenditen zwischen einem Prozent (und sogar weniger) und drei Prozent in bedeutenden Großstädten langfristige Anleihenrenditen um 2,7 bis knapp unter drei Prozent gegenüber. Denkt man an den Vermietungsaufwand und daran, dass Mieterträge der Einkommenssteuer unterliegen, während auf Anleihekupons auf einem Inlandsdepot lediglich 27,5 Prozent KESt (endbesteuert) einbehalten werden, dämpft dies den Druck, unbedingt Wohnungskäufe durchführen zu müssen. In Kombination mit einer sinkenden Immobilienkreditnachfrage wirkt sich dies laut Wohnimmobilienpreisindex der Oesterreichischen Nationalbank für Gesamtösterreich bereits aus. Lag die jährliche Preissteigerung im zweiten Quartal noch bei 13,1 Prozent, folgte im dritten Quartal bereits eine Ver-
langsamung auf 10,8 Prozent, ehe die Preisdynamik im vierten Quartal 2022 auf 5,2 Prozent abgebremst wurde. Generell blicken Experten im laufenden Jahr dem Immobilienmarkt skeptisch entgegen: Der kürzlich präsentierte „Remax Real Estate Future Index“ (PREFIX), ein Konsens von rund 600 Immobilienexperten-Meinungen in ganz Österreich, geht davon aus, dass die Immobilienpreise (alle Kategorien des PREFIX) in Österreich dieses Jahr im Schnitt um 6,8 Prozent sinken werden.
GLOBALE SIGNALE KURZFRISTIG
AUF ENTSPANNUNG
Viele wünschen sich wieder eine unabhängige heimische Notenbank, die ihre eigenen Zinsen festsetzt und sich dabei auf die heimischen Wirtschaftsdaten konzentriert. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage trifft die Europäische Zentralbank/EZB in Frankfurt am Main die Entscheidung über ein über den gesamten Euroraum (20 EU-Staaten) einheitliches Leitzinsniveau. Während die EZB ein mittelfristiges Inflationsziel von zwei Prozent verfolgt, behält sie auch die Klimafreundlichkeit kreditfinanzierter Investitionen und die Stabilität des Finanzmarktes im Auge.
Die Inflationsrate im Euroraum liegt beispielsweise noch 6,7 Prozentpunkte über dem EZB-Leitzins, während in früheren Zeiten Notenbanker zur Inflationsbekämpfung sogar zweistellige Leitzinsen in Kauf nahmen. Anfang der 1980er-Jahre lag beispielsweise in den USA der

eco. geld 60
Viele wünschen sich wieder eine unabhängige heimische Notenbank, die ihre eigenen Zinsen festsetzt und sich dabei auf die heimischen Wirtschaftsdaten konzentriert.
Rekord-Leitzins bei 20 Prozent. Damals betrug allerdings die Staatsverschuldung nur einen Bruchteil von heute. Vor allem im Euroraum haben eine Reihe von Ländern kritische Werte erreicht. Die höchsten Verschuldungsquoten im Verhältnis zum BIP weisen dabei Ende des zweiten Quartals 2022 Griechenland (182,1 %), Italien (150,2 %), Portugal (123,4 %), Spanien (116,1 %), Frankreich (113,1%) und Belgien (108,3 %) auf.
In den USA hat die Inflationsrate infolge einer zwischenzeitlichen Konsolidierung der Energie- und Industrierohstoffpreise bereits im Juni mit 9,1 Prozent ihren Scheitelpunkt gebildet. Seither ging es sechs Monate in Folge abwärts, zuletzt von November auf Dezember von 7,1 auf 6,5 Prozent. Im Euroraum war im Oktober mit 10,6 Prozent der Höhepunkt erreicht worden, ehe es im November auf 10,1 Prozent und im Dezember um 0,9 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent rückwärts ging. Auffällig zu beobachten ist, dass die amerikanische Federal Reserve/Fed bereits Mitte März 2022 mit den Leitzinsanhebungen begann, während die EZB damit noch bis 21. Juli 2022 wartete. Das ist ein Zeitabstand von vier Monaten – genauso wie beim Inflationspeak. Zwar gab es im Euroraum Sonderfaktoren wie besonders hohe Erdgaspreise in den Sommermonaten, kriegsbedingte Lieferkettenunterbrechungen und einen hohen US-Dollarkurs, doch die geldpolitisch zögernde Haltung der EZB könnte durchaus einen Beitrag zum späteren Inflationspeak im Vergleich zu den USA geleistet haben. Die Entwicklung der Preise für Industrierohstoffe und Erdölprodukte („Energie-Rohstoffe“) bleibt genauso wie eine volatile Nahrungsmittelkomponente in der Headline-Inflation sowohl in den USA als auch in Europa ein wesentlicher Faktor, der aber weitgehend vom Industrieproduktionsland China aus gesteuert wird: Die jüngste Entspannung war dabei auf verschiedene
Es geht um mehr als Steuern.
Öffnet
Rohstoffnachfrage.
Preisschübe einen erneuten Inflationsschub entfachen.
Entwicklungen zurückzuführen: Chinas strenge Coronamaßnahmen und die Abriegelung von Industrie und Häfen führten dort zu einem Konjunkturabschwung und somit einer rückläufigen Energie-/Rohstoffnachfrage. In der Folge waren die Preise für Erdöl, diverse Raffinerieprodukte und Industriemetalle rückläufig. Welche Wirkung rückläufige Erdölpreise im Euroraum entfalten, kann anhand der im HVPI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex) mit 10,93 Prozent gewichteten Energiepreiskomponente anschaulich illustriert werden. Ihr Anstieg lag im Oktober noch bei 41,5 Prozent, ehe sich die Teuerungsdynamik bis Dezember auf 25,7 Prozent verlangsamte. Dämpfend wirkte auch der bereits eingesetzte konjunkturelle Abschwung, in dem sich die Rezessionssignale in diversen Einkaufsmanager-Indizes (Unternehmensumfrage-Auswertungen) zeigen.
Es geht um mehr als Steuern.
Es geht um mehr als Steuern.
DIE FOLGEN AN DEN ZINSFRONTEN
Am Futuresmarkt gingen in den USA vom 23. Oktober 2022 bis 20. Jänner 2023 die Renditen zehnjähriger US-Treasuries von 4,23 auf 3,48 Prozent zurück. Auch die Erwartungen der Zinserhöhungsdynamik sind rückläufig. Laut dem FedWatch-Tool preisen nun die Fed Fund
Als verlässlicher Partner beraten Steuerberater ihre Klienten oft nicht nur in Fragen rund um Buchhaltung, Bilanzierung, Kalkulationen sowie Steuern und erledigen alle dafür nötigen Tätigkeiten. Sie sind auch erster Ansprechpartner bei Sanierungen, Investitionsund Finanzierungsentscheidungen, Förderungen, bei gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie im Arbeits- und Sozialversicherungsoder Insolvenzrecht.
Als verlässlicher Partner beraten Steuerberater ihre Klienten oft nicht nur in Fragen rund um Buchhaltung, Bilanzierung, Kalkulationen sowie Steuern und erledigen alle dafür nötigen Tätigkeiten. Sie sind auch erster Ansprechpartner bei Sanierungen, Investitionsund Finanzierungsentscheidungen, Förderungen, bei gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie im Arbeits- und Sozialversicherungsoder Insolvenzrecht.
Stresstest für Unternehmen.
Als verlässlicher Partner beraten Steuerberater ihre Klienten oft nicht nur in Fragen rund um Buchhaltung, Bilanzierung, Kalkulationen sowie Steuern und erledigen alle dafür nötigen Tätigkeiten. Sie sind auch erster Ansprechpartner bei Sanierungen, Investitionsund Finanzierungsentscheidungen, Förderungen, bei gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie im Arbeits- und Sozialversicherungsoder Insolvenzrecht.
Viele Unternehmen stehen durch unerwartete Zahlungen für Steuern, SVA-Beiträge und sonstige Abgaben plötzlich unter großem finanziellen Druck.
Finden Sie Ihren
Steuerberater:
Finden Sie Ihren
Finden Sie Ihren
Steuerberater:
Steuerberater:
Finden Sie Ihren
Steuerberater:
Mit uns wachsen.
Sparen Sie sich diesen Stress! Ihr Steuerberater kann mit Ihnen regelmäßig eine steueroptimierte Planung der Abgabenzahlungen erstellen: damit sind Sie auf alles vorbereitet und können sich auf Ihr Business konzentrieren!
Mit uns wachsen.
Mit uns wachsen.
eco. geld 61
sich China wieder den herkömmlichen Handelsströmen, dann explodiert die
Vorratseinkäufe bei Industriemetallen und Erdöl könnten durch ausgelöste
www.facebook.com/IhreSteuerberater www.ksw.or.at www.facebook.com/IhreSteuerberater www.ksw.or.at
www.facebook.com/IhreSteuerberater www.ksw.or.at
www.facebook.com/IhreSteuerberater www.ksw.or.at
Futures zwischen der Fed-Entscheidung am 22. März und jener am 26. Juli 2023 ein voraussichtliches Leitzins-Hoch von 4,75 bis 5,00 Prozent ein, was nur noch Luft für weitere Anhebungen um 0,5 Prozentpunkte bedeuten würde. Bis Jahresende wird eine minimale Zinssenkung nicht mehr ausgeschlossen. Im Euroraum sind die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen auf Monatsbasis bereits wieder um 18 Basispunkte auf 2,17 Prozent rückläufig. Und auch weitere Indikatoren lassen einen Leitzinspeak von 3,0 Prozent ableiten. Doch Vorsicht, denn ab einem gewissen Niveau könnte zumindest eine hartnäckigere Kerninflation weitere Zinsschritte erfordern, denn die Zielinflation der EZB liegt bei zwei Prozent. Somit gilt es, einige Entwicklungen kritisch zu bewerten – Lohninflationsrisiken zum Beispiel.

Im Euroraum stieg der HVPI ex Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak von November auf Dezember 2022 von 5,0 Prozent weiter auf ein neues Hoch von 5,2 Prozent. Wegen höherer Tarife nahmen die Preissteigerungen bei den Dienstleistungen zu und auch der Preisaufschwung bei Industriegütern ohne Energie beschleunigte sich kontinuierlich. Für europäische Verhältnisse ist zudem der Arbeitsmarkt relativ leergefegt. Vor allem in Deutschland und Österreich mangelt es an Fachkräften. Darüber hinaus fordern quer durch Europa starke Gewerkschaften vehement einen Inflationsausgleich bei den Lohnrunden. In den USA hingegen sind die Gewerkschaften schwächer und der Arbeitsmarkt ist flexibler. Doch der Marktmechanismus (Angebot und Nachfrage) ist intakt und könnte angesichts eines bei einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent völlig leergefegten Arbeitsmarktes im Falle einer konjunkturellen Erholung eine Lohn-Preis-Spirale auslösen.
ROHSTOFFNACHFRAGEFAKTOR CHINA
China hat seine Coronamaßnahmen aufgegeben. Derzeit versinkt zwar das Reich der Mitte im Pandemiechaos, doch nach Erreichung der Herdenimmunität könnte dort die Konjunktur plötzlich hochlaufen. Öffnet sich das Land wieder den herkömmlichen Handelsströmen, dann explodiert die Rohstoffnachfrage. Vorratseinkäufe bei Industriemetallen und Erdöl könnten durch ausgelöste Preisschübe einen erneuten Inflationsschub entfachen und auch die Historie deutet darauf hin, dass mit
einer langwierigeren Inflationsphase und somit noch weiteren Leitzinserhöhungen zu rechnen ist.
Definiert man dabei nachhaltige Hochinflationsphasen als Phasen, in denen die Inflationsrate mindestens zwölf Monate in Folge um mindestens fünf Prozent anstieg, so gab es seit 1916 in den USA sieben nachhaltige Hochinflationsphasen, die zwischen 13 Monate (Dezember 1950 bis Dezember 1951) und 70 Monate (Jänner 1977 bis Oktober 1982; Zweiter Ölschock) anhielten. Im Schnitt dauerte eine solche Phase 37 Monate. Auch Analysen der Zinserhöhungszyklen schlagen in die gleiche Kerbe. Beispielsweise haben die Analysten von HedgeGo in der Research-Publikation „Treasury Scout“ vom 10. November 2022 unter Leitung ihres Chefanalysten Gerhard Massenbauer die letzten acht Zinserhöhungszyklen in den USA (seit 1971) untersucht und kamen zu folgender Erkenntnis: Die durchschnittliche Anzahl an Zinserhöhungen lag bei 15 (per 20. Jänner 2023 erst 7) und die durchschnittliche Gesamt-Leitzinserhöhung über den Zyklus hindurchgehend bei 5,64 Prozentpunkten (aktuell: 4,25 Prozentpunkte). Allerdings dauerte ein Zinserhöhungszyklus im Schnitt 32 Monate (derzeit sind erst zehn Monate vergangen). Doch hier schreiben die Analysten von durchschnittlichen Szenarien. In den hochinflationären 1970er-Jahren benötigte die Fed 20 bzw. 34 Zinsschritte zur Erreichung ihres Zieles.
FAZIT
Es kann heuer an der Zinsfront völlig anders verlaufen, als die Basisszenarien zahlreicher Analysten zeigen. Lohninflation und vor allem die konjunkturelle Entwicklung Chinas sollten im Auge behalten werden. Springt in China die Konjunktur an, werden von dort aus mehr Erdölprodukte und weitere Rohstoffe konsumiert und das treibt Preise, Inflationsraten und Zinsen erneut nach oben.
eco. geld 62
Es kann heuer an der Zinsfront völlig anders verlaufen, als die Basisszenarien zahlreicher Analysten zeigen.
Wir sehen die Welt heute
mit anderen Augen. Zeit für einen Blick auf Ihre Geldanlage
Jetzt Geldanlage checken
Die Welt ist stetig im Wandel und im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert. Bestimmt auch der Blick auf Ihre Geldanlage. Deshalb ist es gut, die eigene finanzielle Situation einmal auf den Prüfstand zu stellen. Schließlich möchten Sie auch aktuelle Möglichkeiten nutzen und vor unnötigen Risiken sicher sein.
Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin, um neue Perspektiven für Ihr Geld zu entdecken – mit Fonds von Union Investment.
Aus Geld Zukunft machen
Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot beziehungsweise eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung beziehungsweise individuelle, fachgerechte Beratung. Union Investment Austria GmbH und die Volksbank Tirol AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Verkaufsunterlagen zu den Fonds [(Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinfor m a t ionen/KID (bis zum 31.12.2022) / Basisinformationsblatt (ab dem 01.01.20223)] finden Sie in deutscher Sprache auf: www.union-investment.at. Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH; Verlags- und Herstellungsort: Wien. Werbung I Stand: Dezember 2022

20221219_J-DTP2022-0257_JR_Anz-ANP2023-UIA_Tirol.indd 1 19.12.22 17:41 Die Anlage-Bank für Tirol. Tel.
566 www.volksbank.tirol
050
DIE TUGENDEN DER VERANLAGUNG
„Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft“, sagte dereinst der österreichische Dramatiker Ludwig Anzengruber. Geht es nach Anlageberater Florian Weihs, so ist das Zitat derzeit vollumfänglich aktuell.
INTERVIEW: MARINA BERNARDI
Florian Weihs bietet mit seiner PlanWise Invest in Reith bei Seefeld unabhängige Anlageberatung auf Honorarbasis. Warum er aktuell zu festverzinslichen Wertpapieren rät, Aktien aber dennoch für unabdingbar hält, unter anderem darüber haben wir mit ihm gesprochen.
ECO.NOVA: Die derzeitige (wirtschaftliche) Gemengelage ist herausfordernd – regional, national, international. Auf welche Indikatoren schauen Sie in der Anlageberatung aktuell besonders und wo sehen Sie Potenzial für eine erfolgreiche Veranlagung? FLORIAN WEIHS: Generell habe ich immer die Entwicklung des Zinsniveaus im Blick, weil sich daraus vieles ablesen lässt. In der Vergangenheit etwa kam es öfter vor, dass die Zinsen gestiegen sind und sich die Aktienkurse eine Zeitlang noch sehr gut gehalten haben. Bis es zum Crash kam. Das möchte ich für meine Kunden natürlich weitestgehend verhindern, deshalb rate ich aktuell eher zu Investments in festverzinsliche Wertpapiere.
Sie sind kein Freund von Aktien? Doch, sehr! Ich denke, dass ohne eine Veranlagung in Aktien gar nichts geht. Will man langfristig erfolgreich sein, kommt man nicht umhin, dort zu investieren, wo Menschen ehrliche Arbeit leisten. Man darf allerdings die Zinsentwicklung nicht aus den Augen lassen, vor allem dann, wenn sich das Zinsniveau – drastisch – verändert. Eine Anhebung der Zinsen wirkt oft marktbereinigend, weil Unternehmen, deren Basis ohnehin nicht (mehr) sonderlich solide ist, nicht überleben werden. Gerät ein Unternehmen finanziell und wirtschaftlich in Schieflage, fällt das in Zeiten billigen Geldes weniger auf, weil es
sich relativ günstig weiter verschulden kann. Steigen die Zinsen, wird das folglich zum Problem. Die Niedrigzinsphase hat relativ lange angedauert und das Kreditwachstum angeheizt, sodass der Hebel der EZB, über Zinsanhebungen einzugreifen, heute viel stärker wirkt als früher. Ich würde derzeit deshalb eher in Richtung festverzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren tendieren und Aktien als Beimischung sehen.
Wie bewerten Sie die derzeitigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank/EZB? Der Zinssprung schaut in absoluten Zahlen vielleicht wenig aus, ist jedoch
gewaltig. Wir sehen bereits Auswirkungen auf die Kreditvergabe – im privaten, aber auch im unternehmerischen Bereich. Letzteres wiederum wirkt sich unmittelbar auf die Investitionstätigkeiten aus. Werden diese zurückgefahren, hat das in der Konsequenz fast immer negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Daher rührt auch meine Vorsicht. Es mag den Ansatz geben, gerade jetzt vermehrt auf Aktien zu setzen, meiner ist das nicht. Ich gehe davon aus, dass die Zinserhöhungen einige Unternehmen ins Straucheln bringen werden, in der Folge steigt die Anzahl der Arbeitslosen, es fehlt Geld im Konsum und der Wirtschaftskreislauf wird langsamer.
eco. geld 64
„Aktuell würde ich ein Veranlagungsportfolio so konservativ wie möglich ausrichten.“
FLORIAN WEIHS
Wie schätzen Sie die weitere Zinsentwicklung ein? Die Rhetorik der EZB ist nach wie vor scharf. Die Notenbank hat früher dazu geneigt, es ab und an zu übertreiben, und auch dieses Mal hat sie zwar reagiert, aber zunächst sehr zögerlich und dann sprunghaft. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Verantwortlichen erkannt haben, dass die Wirtschaft, aber auch – hoch verschuldete –Staaten ein veritables Problem bekommen, wenn die Zinserhöhungen in diesem Tempo weitergingen. Viele Unternehmen sind getrieben durch die vergangene Niedrig(st) zinsphase stark kreditfinanziert. Wenn man die Stellschrauben noch weiter anzieht, wird es für viele in einem ohnehin schon herausfordernden Umfeld hoher Energiekosten noch schwerer. Ich hoffe also, dass die EZB in ihren weiteren Schritten besonnen vorgeht, und rechne mit drei bis 3,25 Prozent bis Ende des Jahres.
In der Veranlagung gilt es gerne, „die Inflation zu schlagen“ und damit sein Vermögen wertemäßig zumindest nicht kleiner werden zu lassen. Die Inflationsrate lag im vergangenen Jahr bei 8,6 Prozent, zu Spitzenzeiten sogar bei elf. Solche Renditen zu erzielen, wird wohl schwierig. Ja, derzeit wird es tatsächlich unmöglich sein, die Inflation zu schlagen, wobei man dazusagen muss, dass man in den vergangenen Jahren bei kluger Veranlagung überdurchschnittlich erfolgreich sein konnte, ohne dafür ins absolute Risiko zu gehen. Es braucht also auch ein bisschen Bescheidenheit. Mit festverzinslichen Wertpapieren bewegt man sich in etwa bei 3,5 Prozent Rendite, mit viel Anstrengung bei vier. Das sage ich meinen Kunden auch deutlich, dafür werden wieder Zeiten kommen, bei denen man die Inflation deutlich übertrifft. Im Moment würde ich jedoch die zahlreichen völlig offenen Entwicklungen abwarten und nicht ungeduldig werden. Hat sich die Gemengelage weitestgehend stabilisiert, kann man auch wieder vermehrt auf Aktien setzen.
Wie würden Sie Ihr Portfolio aktuell zusammenstellen? Sehr defensiv mit gut 75 Prozent Anleihen und dem Rest Aktien, vielleicht noch Gold als Beimischung in Form von Fonds. Es kann gut sein, dass die Aktien noch eine Weile steigen, es kann aber rasch wieder in die andere Richtung gehen und dann den optimalen Ausstiegszeitpunkt zu erwischen, ist ein Glücksspiel. Ich würde mich jetzt frühzeitig in etwas ruhigere Fahr-
wasser begeben und den Aktienmarkt aus entspannter Position beobachten.
Mit welchem Ergebnis würden Sie das heurige Jahr als ein erfolgreiches betrachten? Ein erfolgreiches Jahr wäre für mich, mit der Veranlagung eine Rendite in Höhe der halben Inflation zu schaffen. Das heurige Jahr wird in vielerlei Hinsicht herausfordernd werden, deshalb sind Prognosen, die ohnehin immer schwierig sind, noch unsicherer. Heuer kann alles passieren. Ich gehe davon aus, dass die Notenbankmaßnahmen greifen und die Inflation wieder sinken und sich normalisieren wird, denn man darf nicht vergessen, dass wir uns die hohe Inflation ein Stück weit auch mit früherem Konsum erkauft haben. Ich würde es der Wirtschaft durchaus wünschen, dass es mit rasantem Wachstum weiterginge und die Aktienkurse weiter steigen, aber ich kann es mir ob der allgemeinen Umstände schwer vorstellen.
In welche Unternehmen lohnt es sich Ihrer Meinung nach künftig zu investieren?
In solche mit einem guten, soliden und zukunftsträchtigen Geschäftsmodell und Un-
ternehmen mit Substanz. Unser Blick ist in die Zukunft gerichtet, deshalb investieren wir in Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie auch übermorgen noch funktionieren. Aktien sind entgegen oft landläufiger Meinung nicht zwingend Spekulationsobjekte, sondern vorrangig langfristige Investments, weshalb die vergangene Entwicklung zwar wichtig ist, aber der Blick eindeutig nach vorne gehen sollte – beim Autofahren braucht es zwar auch den Blick in den Rückspiegel, damit man sicher im Verkehr navigiert, der Blick durch die Windschutzscheibe nach vorn ist aber wichtiger. Deshalb investieren wir in Unternehmen, die nachhaltige Werte schaffen. Das können durchaus Digitalunternehmen sein, aber es braucht Substanz und ein Zukunftsmodell, kein kurzfristiges Gewinnmaximierungsdenken. Dafür bewerten wir zahlreiche Einzeltitel sehr genau und schauen, ob und wie sie sinnvoll zu uns passen können.
PlanWise e.U. (FN 515972h) wurde am 01.07.2022 die Konzession als Wertpapierdienstleistungsunternehmen gem. § 4 WAG 2018 erteilt. PlanWise e.U. ist zur gewerblichen Erbringung der Anlageberatung sowie der Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 lit. a und c WAG 2018 berechtigt. Meinungen wie auch die Aussagen in diesem Artikel sind Marketingaktivitäten und/oder allgemeine Analysen und haben keinerlei Beratungs- oder Empfehlungscharakter

eco. geld 65
„Ich denke, bei einem Zinsniveau von 3,25 Prozent ist der Zenit erreicht – das ist halb Prognose, halb Hoffnung.“
FLORIAN WEIHS
INVESTITIONSFREIBETRAG –NEUER ZUSÄTZLICHER STEUERABSETZPOSTEN
AB 2023
Mit der Neugestaltung des Investitionsfreibetrags kann für die Anschaffung und Herstellung ungebrauchter abnutzbarer Wirtschaftsgüter ab sofort ein zusätzlicher Steuerfreibetrag in Höhe von zehn Prozent des Investitionsvolumens geltend gemacht werden. Im Bereich Ökologisierung sind es sogar 15 Prozent.
Dieser Freibetrag ist ein fiktiver Posten, der für bestimmte Investitionen zusätzlich zur herkömmlichen Anlagenabschreibung von der Steuerbemessungsgrundlage in Abzug gebracht werden darf. Insgesamt können hier jährlich Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von bis zu 1.000.000 Euro zu Grunde gelegt werden. Im besten Fall ergibt sich daraus ein Steuerfreibetrag von 150.000 Euro, was bei einem Grenzsteuersatz von zum Beispiel 50 Prozent zu einer Steuerersparnis von bis zu 75.000 Euro führen kann.
Ausgenommen sind geringwertige Wirtschaftsgüter, Gebäude, KFZ (außer Elektroautos), unkörperliche Wirtschaftsgüter (außer für Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit, Life-Sciences) und Anlagen in Verbindung mit fossilen Energieträgern. Ebenso ausgeschlossen ist die Doppelbelegung eines Wirtschaftsgutes mit dem Gewinnfreibetrag und dem Investitionsfreibetrag. Ersteren gibt es bereits seit vielen Jahren. Er ist gestaffelt, kann für Gewinne bis zu 580.000 Euro geltend gemacht werden
und nimmt mit zunehmender Gewinnhöhe von 15 Prozent auf 4,5 Prozent ab. Voraussetzung ist auch hier eine bestimmte Investitionstätigkeit. Anders als beim neuen Investitionsfreibetrag gelten für den Gewinnfreibetrag auch bestimmte Wertpapiere als begünstigungsfähig.

Um von beiden Freibeträgen maximal zu profitieren, empfiehlt es sich, für alle zugelassenen Wirtschaftsgüter den Investitionsfreibetrag zu nutzen. Der Gewinnfreibetrag sollte somit ab 2023 ausschließlich durch die Anschaffung von Wertpapieren abgedeckt werden. Im Zuge der mittel- und langfristigen Investitionsplanung sollten Großinvestitionen vor allem für besonders gewinnstarke Jahre vorgesehen werden.
Die Ärztespezialisten vom Team Jünger: StB Mag. Dr. Verena Maria Erian und StB Raimund Eller
In Hinblick auf die Planung ist es in diesem Zusammenhang auch gut, die Spielregeln hinsichtlich des Timings genau zu kennen: Als Anschaffungsdatum gilt die Lieferung (Verschaffung der Verfügungsmacht, Betriebsbereitschaft). Der Zeitpunkt der Bestellung und Zahlung ist für die Inanspruchnahme des Investitionsfreibetrags sowie auch des Gewinnfreibetrages nicht maßgeblich.

66 eco. steuern
TIPP
TEXT: VERENA MARIA ERIAN, RAIMUND ELLER
KINDER BRAUCHEN

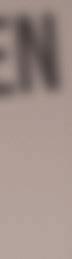


BEWIRB DICH: PROJUVENTUTE.BEWERBERPORTAL.AT SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600
DICH!
EIN ZUHAUSE! UND DAFÜR BRAUCHEN WIR
VERLÄNGERUNG ENERGIEKOSTENZUSCHUSS
In Reaktion auf die anhaltend stark gestiegenen Energiepreise hat die Bundesregierung am 22. Dezember 2022 im Rahmen einer Pressekonferenz die Verlängerung des Energiekostenzuschusses und die deutliche Ausweitung der maßgeblichen Förderkriterien verkündet.

Demnach wird der Energiekostenzuschuss 1 bis Ende 2022 verlängert, wofür eine separate Antragsphase vorgesehen ist. Zusätzlich dazu wird ein neuer Energiekostenzuschuss 2 geschaffen, der den Zeitraum des gesamten Jahres 2023 umfasst und für den erweiterte Förderkriterien geschaffen werden. Pro Unternehmen können dabei Zuschüsse von 3.000 bis 150 Millionen Euro gewährt werden. Ob für den Energiekostenzuschuss 2 wiederum eine Budgetobergrenze der zur Verfügung stehenden Mittel ähnlich dem Energiekostenzuschuss 1 besteht, wurde seitens der Bundesregierung bisher noch nicht kommuniziert und bleibt entsprechend abzuwarten.
WER WIRD GEFÖRDERT?
Äquivalent zum Energiekostenzuschuss 1 werden bei dessen Verlängerung als auch im Energiekostenzuschuss 2 gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen sowie unternehmerische Bereiche von gemeinnützigen Vereinen mit Sitz oder Betriebsstätte in Österreich gefördert. Entgegen dem Energiekostenzuschuss 1 basiert der Energiekostenzuschuss 2 für das Jahr 2023 jedoch auf einem fünfstufigen Modell, bei dem lediglich noch in zwei Stufen (Stufe 3 und 4) das Kriterium der Energieintensität vorgesehen ist, während dieses in den Stufen 1, 2 und 5 entfällt. Als energieintensives Unternehmen gelten im Rahmen des Energiekostenzuschusses 2 Unternehmen, bei denen sich auf Basis des Jahres 2021 die Energiekosten auf mindestens drei Prozent des Produktionswertes bzw. auf Basis des ersten Halbjahres 2022 auf mindestens sechs Prozent belaufen.
Ausgenommen von der Förderung sind wiederum Unternehmen, die gemäß volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung als staatliche Einheit geführt werden, Gebietskörperschaften, energieproduzierende oder
mineralölverarbeitende Unternehmen, land- und forstwirtschaftliche Urproduktion, Unternehmen aus dem Banken- und Versicherungswesen, freie Berufe sowie politische Parteien.
GEGENSTAND DER FÖRDERUNG
Mit dem Energiekostenzuschuss 2 werden Mehraufwendungen für den Bezug von Energie zum betriebseigenen Verbrauch im Förderungszeitraum vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gefördert. Nicht förderungsfähig ist, wie bereits im Rahmen des Energiekostenzuschusses 1, die Lagerung von Energie. Der Energiekostenzuschuss 2 sieht fünf unterschiedliche Förderstufen vor:
In Stufe 1 sollen Energiemehrkosten (verglichen mit dem Jahr 2021) mit einer
Förderintensität von 60 Prozent gefördert werden, wobei die maximal förderfähige Verbrauchsmenge mit dem Verbrauch von 2021 begrenzt sein soll. Förderfähig sind dabei unter anderem Kosten für Strom, Erdgas, Treibstoffe, Wärme/Kälte (inkl. Fernwärme), Dampf und Heizöl. Die Zuschussuntergrenze liegt in dieser Stufe bei 3.000 Euro und ist begrenzt bis zwei Millionen Euro.
Stufe 2 sieht Zuschüsse zwischen zwei und vier Millionen Euro vor, wobei in dieser Stufe Energiemehrkosten, die über einer 1,5-fachen Preissteigerung liegen, mit 50 Prozent gefördert werden sollen. Die förderfähige Verbrauchsmenge soll mit maximal 70 Prozent der Verbrauchsmenge von 2021 begrenzt sein. In dieser Stufe sollen Strom, Erdgas und direkt aus Erdgas und Strom erzeugte Wärme/Kälte (inkl. Fernwärme) begünstigt sein.
68 eco. steuern
TEXT: MARTIN WOLF
In Stufe 3 werden ebenfalls Energiemehrkosten für den Verbrauch von Strom, Erdgas und direkt aus Erdgas und Strom erzeugte Wärme/Kälte (inkl. Fernwärme), welche über einer 1,5-fachen Preissteigerung liegen, gefördert, allerdings mit einer Förderquote von 65 Prozent. Die Höhe der Zuschüsse in dieser Stufe soll zwischen vier und 50 Millionen Euro liegen. Die förderfähige Verbrauchsmenge soll wiederum mit maximal 70 Prozent der Verbrauchsmenge von 2021 begrenzt sein. Darüber hinaus muss in dieser Stufe das Kriterium der Energieintensität erfüllt sein, um anspruchsberechtigt zu sein.
In Stufe 4 werden Energiemehrkosten für den Verbrauch vonStrom, Erdgas und direkt aus Erdgas und Strom erzeugte Wärme/ Kälte (inkl. Fernwärme), welche über einer 1,5-fachen Preissteigerung liegen, gefördert, in dieser Stufe jedoch mit einer 80-prozentigen Förderquote. Die Zuschusshöhe soll zwischen 50 und 150 Millionen Euro betragen. Auch für diese Stufe soll die förderfähige Verbrauchsmenge wiederum mit maximal 70 Prozent der Verbrauchsmenge von 2021 begrenzt sein. Zusätzlich ist auch in dieser Stufe das Kriterium der Energieintensität zu erfüllen, um anspruchsberechtigt zu sein.
Die Stufe 5 wurde für den Energiekostenzuschuss 2 gegenüber dem Energiekostenzuschuss 1 neu eingeführt. Ähnlich zu den Stufen 2 bis 4 werden Energiemehrkosten aus Strom, Erdgas und direkt aus Erdgas und Strom erzeugte Wärme/Kälte (inkl. Fernwärme), welche über einer 1,5-fachen Preissteigerung liegen, gefördert, wobei die förderfähige Verbrauchsmenge wiederum mit maximal 70 Prozent der Verbrauchsmenge von 2021 begrenzt sein soll. Die Förderintensität beträgt dabei 40 Prozent, die daraus resultierenden Zuschusshöhen liegen zwischen vier und 100 Millionen Euro.
Äquivalent zum Energiekostenzuschuss 1 sind für den Bezug des Energiekostenzuschusses 2 einige Auflagen vorgesehen, wie beispielsweise steuerliches Wohlverhalten und die Beschränkung von Bonuszahlungen, allerdings laut Ankündigung auch erweitert um die Einschränkung von Dividendenausschüttungen, wobei diesbezüglich nähere Konkretisierungen abzuwarten bleiben. Neu hinzugekommen ist nach deutschem Vorbild außerdem, dass vom förderwerbenden Unternehmen als Förderbedingung eine Beschäftigungsgarantie abzugeben ist, wonach sich das Unternehmen zu verpflichten hat, bis zum Ende des Jahres 2024 mindestens 90 Prozent der Arbeitsplätze zu erhalten.
WESENTLICHE NEUERUNGEN BEIM ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Im Vergleich zum Energiekostenzuschuss 1 wurde die Förderintensität erhöht, sodass voraussichtlich mehr Unternehmen antragsberechtigt sind und auch durch höhere Fördersummen profitieren können. Einerseits wurde mit der Stufe 5 eine vollkommen neue Förderstufe eingeführt, in welcher Fördersummen von bis zu 100 Millionen Euro möglich sein sollen. Darüber hinaus ist der Nachweis, dass es sich beim antragstellenden Unternehmen um ein energieintensives Unternehmen handelt, nur noch im Rahmen der Stufen 3 und 4 erforderlich.
Ebenso wurden für alle Förderstufen die für den Zuschuss in Frage kommenden und begünstigten Energiearten erweitert. Waren in Stufe 1 des Energiekostenzuschusses 1 nur Strom, Erdgas und Treibstoffe förderfähig, wurden diese nunmehr um Wärme/ Kälte, Dampf und Heizöl erweitert. Auch in den weiteren Förderstufen sind entgegen dem Energiekostenzuschuss 1 nunmehr direkt aus Erdgas und Strom erzeugte Wärme/ Kälte (bspw. Fernwärme) förderungsfähig.
Ebenso wurden die Förderquoten entsprechend erhöht, sodass der Prozentsatz des Zuschusses in Stufe 1 von 30 auf 60 Prozent und in Stufe 2 von 30 auf 50 Prozent angehoben wurde. Gleichzeitig wurden jedoch für den Energiekostenzuschuss die Auflagen und zu erfüllenden Förderkriterien entsprechend ausgeweitet.
FAZIT
Der kürzlich veröffentlichte Energiekostenzuschuss 2 und die Verlängerung des Energiekostenzuschusses 1 sollen die Antwort
der Bundesregierung auf die weiterhin anhaltenden hohen Energiekosten darstellen. Durch die Ausweitung der begünstigten Energiearten und die Erhöhung der Förderquoten sowie den Wegfall des Energieintensitätskriteriums bei mehreren Zuschussstufen ist mit höheren Zuschüssen für eine größere Anzahl an Unternehmen zu rechnen. Problematisch ist jedoch, dass die maximal förderfähige Verbrauchsmenge mit dem Verbrauch von 2021 begrenzt sein soll. In diesem Jahr waren zahlreiche Betriebe massiv von Lockdowns betroffen und der Energieverbrauch dadurch stark reduziert. Dies betrifft insbesondere Tourismusbetriebe. Es bleibt zu hoffen, dass in diesem Punkt noch eine Nachjustierung für den Energiekostenzuschuss 2 erfolgt. Weitere Details bleiben abzuwarten, da von der Bundesregierung im Rahmen der Pressekonferenz lediglich die Rahmenbedingungen und erste Details zur Verlängerung des Energiekostenzuschusses verkündet wurden und da die Ausgestaltung naturgemäß auch den vom europäischen Beihilfenrecht definierten Grenzen entsprechen muss. www.deloitte.at/tirol
ABWICKLUNG DER FÖRDERUNG
Die Abwicklung des Energiekostenzuschusses 2 wird, wie der Energiekostenzuschuss 1, über die Austria Wirtschaftsservice (aws) abgewickelt. Die Antragstellung erfolgt ebenfalls online über den aws-Fördermanager. Der genaue Ablauf der Antragstellung und ob wie beim Energiekostenzuschuss 1 ein mehrstufiger Antragsprozess vorgesehen ist, wurde bisher noch nicht veröffentlicht und bleibt entsprechend abzuwarten.
69 eco. steuern
© DIE FOTOGRAFEN
Martin Wolf, B.A., ist Senior Manager Financial Advisory bei Deloitte Tirol
ES WIRD KONKRET
Ein EuGH-Urteil schafft mehr Klarheit: Was Unternehmen künftig bei einer Datenauskunft berücksichtigen müssen.
Eine kürzlich ergangene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes/EuGH konkretisiert den Inhalt des Auskunftsrechts. Danach hat jede betroffene Person das Recht zu erfahren, an wen ihre oder seine personenbezogenen Daten weitergegeben wurden. Die Entscheidung bedeutet für Unternehmer*innen (datenschutzrechtlich Verantwortliche) allenfalls einen höheren Aufwand bei der Beantwortung von Auskunftsersuchen, etwa auch durch entsprechende Dokumentation und Organisation.

Im Zusammenhang mit dem in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verankerten Recht auf Auskunft von Betroffenen war bislang fraglich, ob es genügt, der oder dem Betroffenen die Kategorien von Empfänger*innen mitzuteilen, also etwa IT-Dienstleister*innen oder Vertriebspartner*innen. Der EuGH hat diese Frage nun in seinem Urteil vom 12. Januar 2023 im Zuge eines Vorlagebeschlusses des Obersten Gerichtshofs in Österreich beantwortet und im Ergebnis die Rechte der Betroffenen gestärkt. Das Auskunftsrecht ist ein zentraler Bestandteil des Selbstdatenschutzes, das einer Person die Möglichkeit gibt, grundlegende Informationen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch Verantwortliche zu erhalten. Nicht selten wird eine Person erst durch das Auskunftsrecht in die Lage versetzt, weitere Betroffenenrechte geltend zu machen. Werden die eigenen personenbezogenen Daten von Verantwortlichen verarbeitet, so steht der oder dem Betroffenen unter anderem das Recht zu, Informationen über den Zweck der Verarbeitung, die geplante Dauer der Speicherung der Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch und das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichts-
behörde zu erhalten. Nach dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 lit. c DSGVO hat jede Person auch das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten der oder die Verantwortliche gegenüber welchen Empfänger*innen oder Kategorien von Empfänger*innen offengelegt hat oder offenlegen wird. Diese Formulierung lässt einen Interpretationsspielraum zu und führte zu einer Kontroverse darüber, ob es ausreicht, die betroffene Person „nur“ über die Kategorien von Empfänger*innen, wie IT-Dienstleister*innen oder Vertriebspartner*innen, zu informieren, ob die Empfänger*innen konkret anzugeben sind oder die Verantwortlichen sogar ein Wahlrecht darüber haben könnten, wie umfassend eine Auskunftserteilung erfolgen soll.
Nach dem EuGH macht es für Personen bei der Wahrnehmung ihrer Betroffenenrechte einen erheblichen Unterschied, ob sie wissen, an wen konkret ihre personenbezogenen Daten weitergegeben wurden, oder ob sie lediglich von einer Kategorie von
Empfänger*innen Kenntnis bekommen. Andererseits ist es für Verantwortliche einfacher, die Kategorien von Empfänger*innen bekannt zu geben als alle Empfänger*innen konkret zu nennen. Um bei Auskunftsersuchen die konkreten Empfänger*innen benennen zu können und der Rechenschaftspflicht als Verantwortlicher nachzukommen, müssen die jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert und organisiert sein. Die unterschiedliche Beantwortung dieser Fragestellung in der Literatur zusammen mit den empfindlichen Sanktionen bei Verstößen gegen die DSGVO führten bislang zu Unsicherheiten in der Praxis.
Mit seinem aktuellen Urteil hat der EuGH nun entschieden, dass betroffene Personen das Recht haben, zu erfahren, an welche konkreten Empfänger*innen ihre oder seine personenbezogenen Daten offengelegt sind oder offengelegt werden. Verantwortliche sind lediglich dann nicht dazu verpflichtet, die konkreten Empfänger*innen von personenbezogenen Daten zu nennen, wenn die Bekanntgabe nicht möglich ist. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Empfänger*innen noch nicht bekannt sind.
Die ergangene Entscheidung des EuGH spricht sich für eine zunehmende Kontrolle für betroffene Personen aus und schafft Rechtssicherheit. Unternehmen als Verantwortliche sind gut beraten, auch aus diesem Grund ihre Verarbeitungsprozesse entsprechend zu dokumentieren und zu organisieren, damit alle Empfänger*innen von personenbezogenen Daten im Fall eines Auskunftsersuchens konkret benannt werden können. Unabhängig davon bleibt das Recht unangetastet, Anträgen von Betroffenen nicht zu entsprechen, wenn diese von ihrem Auskunftsrecht offenkundig unbegründet oder exzessiv Gebrauch machen.
70 eco. recht
TEXT: IVO RUNGG, BINDER GRÖSSWANG RECHTSANWÄLTE, INNSBRUCK
Dr. Ivo Rungg
DIGITALE PIONIERINNEN FÜR TIROL
Um noch mehr jungen Frauen technische Berufe schmackhaft zu machen, startet im Herbst 2023 die zweite Auflage des Projekts Digital Pioneers, bei dem Theorie und Praxis auf einzigartige Weise miteinander kombiniert werden. Das BFI Tirol steht auch dieses Mal wieder als Bildungspartner zur Verfügung.

Beim Projekt Digital Pioneers handelt es sich um ein digitales Jahr für Frauen zwischen 17 und 27 Jahren. Dort haben sie die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren und die Technik und Berufe von morgen kennenzulernen. Zunächst gibt es für die Teilnehmerinnen eine zehnwöchige Grundausbildung am BFI Tirol, die nicht nur kostenlos ist, sondern sogar mit einem geringfügigen Gehalt vergütet wird. Hier werden unter anderem erste Kenntnisse in Programmieren, Webdesign, IT-Projektmanagement sowie Design- und Innovationsprozessen vermittelt. Darüber hinaus können Erfahrungen im Umgang mit modernen Technologien wie 3-D-Druckern, Lasercuttern und Mikrocontrollern gesammelt werden. Aufbauend auf die Grundausbildung folgt eine bezahlte, achtmonatige Praxisphase in einem Tiroler Unternehmen, wo die erlernten Fähigkeiten angewendet und vertieft werden.
DATENANALYSE FÜR EINSTEIGER*INNEN
Eine andere Zielgruppe im digitalen Bereich bedient der Lehrgang Data Science und Business Analytics. Durch die Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, den hohen Praxisbezug sowie die individuelle Begleitung und Unterstützung durch die Kursleitung gelingt der Einstieg in die spannende Welt der Datenanalyse garantiert. Somit ist der Kurs ideal für alle Unternehmen, die hier Kompetenzen aufbauen möchten.

MASSGESCHNEIDERTE
SCHULUNGEN NACH WUNSCH
Nach Bedarf konzipieren wir maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind. Das BFI Tirol ist mit seiner mehr als 50-jährigen Erfahrung ein verlässlicher Partner für professionelle Firmentrainings. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. PR
PROJEKT DIGITAL PIONEERS
Interessierte Frauen und Firmen für die Praxisphase können sich gerne schon jetzt unter firmenservice@bfi-tirol.at mit uns in Verbindung setzen.
AKTUELLE SEMINARE
• How to Instagram Marketing
Start am 28. Februar 2023
• Ausbildung zum/zur Visagist*in
Start am 6. März 2023
• Ausbildung zum/zur Abfallbeauftragten
Start am 6. März 2023
• Data Science und Business Analytics
Start am 13. März 2023
• Ausbildung zum/zur Dampfkesselwärter*in
Start am 13. März 2023
• Ausbildung zum/zur Buchhalter*in
Start am 23. März 2023
• Sicherheitsfachkrafttag
30. März 2023
• Berufsbegleitend studieren an der HFH
Start am 1. April 2023
• Sprengbefugten-Grundlehrgang
Start am 17. April 2023
• Baurechtstag
27. April 2023
• Ausbildung zum/zur Systemischen Coach*in
Start am 4. Mai 2023
BFI TIROL

Ing.-Etzel-Straße 7, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/59 660
info@bfi-tirol.at www.bfi.tirol
BFI TIROL
71
„Unsere Aufgabe als Bildungsinstitut ist es, die Tirolerinnen und Tiroler auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten.“ GESCHÄFTSFÜHRER OTHMAR TAMERL, MBA
Alles wird besser
Mit dem e-tron startete Audi 2018 ins Zeitalter der E-Mobilität und markierte damit den Auftakt für die elektrische Zukunft der vier Ringe. Seither setzt das Modell Maßstäbe im Segement der elektrischen Oberklasse-SUV. Der Audi Q8 e-tron soll an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen und rollt bullig, markant und optisch beeindruckend an den Start. Mit seiner Modellbezeichnung Q8 reiht sich das Modell an der Spitze der Audi-Nomenklatur ein und stellt damit von Anfang an klar, dass es sich dabei um das Topmodell der elektrischen SUV und Crossover handelt. In seiner neuesten Form besticht es durch sein optimiertes Antriebskonzept, bessere Aerodynamik, höhere Ladeperformance und Batteriekapazität sowie optische Auffrischung vor allem im Frontbereich. Kurzum: Der Q8 e-tron soll länger stromern, flotter laden und sich schlichtweg besser fahren. Und das im Topmodell bis zu 580 Kilometer weit, in etwa einer halben Stunde ist er von zehn auf 80 Prozent (schnell)geladen. Die Preisliste beginnt bei rund 75.000 Euro, Audi-gewohnt ist der Spielraum nach oben recht weit offen.

72
auto & motor
MOBILITÄT
REVOLUZZER
„Es ist Zeit für so ein schönes, so nachhaltiges, so innovatives und so funktionales Elektrofahrzeug, und all das zu diesem Preis“, sagt Henrik Fisker. Bescheidenheit klingt anders, tatsächlich aber ist der vollelekrische Fisker Ocean ein echtes Prachtstück. Das Exterieur ist betont schlank und präsentiert sich dennoch kraftvoll und robust, innen setzt man auf Minimalismus und Luxus sowie spannende Technikfeatures. In der Top-Ausstattungsvariante Extreme soll man bis zu 630 Kilometer weit kommen, zu den aktuellen Fahrmodi Earth, Fun und Hyper sollen im nächsten Jahr noch Offroad und Snow/Ice hinzukommen – für Tirol wohl nicht ganz verkehrt. Mitte November 2022 ist die Serienfertigung bei Magna in Graz gestartet, der Einstiegspreis liegt bei rund 42.000 Euro.

SCHON SCHÖN
Alfa Romeo hat für das neue Jahr seine Modelle Giulia und Stelvio (Bild) neu gewandet und passt die Optik damit ein Stück mehr an den neuen Tonale an. Dazu wurde die Konnektivität verbessert und eine volldigitale Instrumentenanzeige eingebaut. Ansonsten präsentieren sich die Italiener gewohnt sportlich und chic und auch in Sachen Fahrdynamik gibt‘s nichts zu bemängeln. Angerollt kommt der Stelvio ausschließlich mit Allradantrieb samt innovativer Alfa-Q4-Technologie, die für optimale Fahrleistung und Traktion sorgt. Erhältlich als 2.0-Turbo mit 280 PS und 2.2-Diesel mit 210 PS in verschiedenen Ausstattungsvarianten ab rund 58.000 Euro.

erfolgs. geschichten
Stark vernetzt
1989 von Ewald Stark mit gerade mal einem LKW gegründet, ist LKW Stark über die Jahre zu einem großen und namhaften Speditionsunternehmen herangewachsen.
Zuverlässig, kompetent und hilfsbereit war seit jeher die Prämisse des erfolgreichen Speditionsunternehmens. Nach der Gründung 1989 wuchs das Unternehmen stetig, 2019 fand die Erfolgsgeschichte mit der Übernahme durch die Familie Höllwarth eine geglückte Fortsetzung.
Mit 240 Fahrzeugen und 26.700 Transporten im Jahr ist ein kompetentes Team von rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den bestmöglichen Service für die zahlreichen Kunden bemüht. Zufriedene Mitarbeiter – zufriedene Kunden, mit dieser Devise brilliert LKW Stark auch als Arbeitgeber in der Region. „Das Mitarbeiterwohl ist ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie, ebenso wie eine effiziente, ressourcenschonende und umweltbewusste Streckenplanung. „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht – genau aus diesem Grund legt LKW Stark besonderen Wert darauf, einen Beitrag zur Umwelt zu leisten und auf nachhaltige Maßnahmen zu setzen“, betont Eigentümer Christian Höllwarth. Faire Entlohnung und Kommunikation auf Augenhöhe sorgen für ein herzliches Miteinander, denn wo Gemeinschaft herrscht, da herrscht auch Erfolg.
Eine starke Verbindung pflegt das Speditionsunternehmen auch zur Hypo Tirol Bank. „Seit vielen Jahren ist die Hypo Tirol Bank für LKW Stark ein verlässlicher und starker Finanzpartner und trägt zu unserer erfolgreichen Entwicklung bei. Denn zu einem erfolgreichen Unternehmenswachstum gehört auch ein fairer und lösungsorientierter Partner, der weitsichtig strategische Investitionen in die Zukunft unterstützt. Bei unserem persönlichen Berater Matthias Lehmann fühlen wir uns bestens verstanden und betreut“, betont Christian Höllwarth. PR

eco. mobil 73
Vinzent Höllwarth – LKW Stark, mit Matthias Lehmann – Kundenbetreuer Hypo Tirol Bank und Christian Höllwarth – LKW Stark
FOTOS (WENN NICHT ANDERS VERMERKT): HERSTELLER
„Man erfand das Auto, um bequem im Stau zu sitzen.“
ANDRZEJ MAJEWSKI, POLNISCHER SCHRIFTSTELLER

OFFROADLUXUS
Kaum einem Autohersteller gelingt es, eine bessere Kombination aus komfortablem Luxus und perfekten
Offroad-Eigenschaften zu kreieren, als Land Rover.
 TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
Es kommt nicht von ungefähr, dass die Modelle des britischen Automobilproduzenten seit Langem beliebt sind. Ob rustikaler Defender, eleganter Range Rover oder der neue Range Rover Sport: Sie alle sehen nicht nur auf festem Untergrund wahnsinnig fesch aus, sondern machen auch abseits von asphaltierten Straßen eine ausgezeichnete Figur. Wir durften kürzlich den Ranger Rover Sport First Edition D359 fahren.
ECHT CHIC
Während der ursprüngliche Range Rover Sport bereits optisch seinem Namen alle Ehre machte, setzt die aktuelle Generation ein wenig mehr auf Understatement. Zwar erinnern vereinzelte Elemente wie die leicht schräg abfallende Dachlinie, die angetäuschten Einlässe auf den Kotflügeln und nicht zuletzt die 23 Zoll großen Räder an den eigentlichen Grundgedanken – nämlich die Sportlichkeit –, im Großen und Ganzen ist die Linienführung allerdings sanft und rundlich, eben ein Stück weit luxuriöser angelegt. Herausgekommen ist ein cleanes, edel anmutendes Design ohne Ecken und Kanten, fast so als bestünde die Karosserie aus nur einem einzigen Teil. Während die Frontansicht mit dem klassischen Kühlergrilldesign zwischen den digitalen LED-Scheinwerfern mit LED-Signatur und Bildprojektion durchaus bekannte Züge aufweist, zeigt sich das Heck des Range Rover Sport eigenständiger. So fällt der Blick insbesondere auf die beiden LED-Heckleuchten, die sich geschmeidig in die Profileinsicht einschmiegen und zwischen sich in einem fließenden Übergang den Markenschriftzug einschließen. Hierbei setzt man bewusst auf Ähnlichkeiten zum
markanten Design des luxuriösen großen Bruders, kommt die dunkel gehaltene Heckleiste doch vielerorts hervorragend an.
LUXUS PUR
Auch im Innenraum finden sich zahlreiche Similaritäten zum herkömmlichen Range Rover wie hochwertige Materialien, penible Verarbeitung und ein wunderbar aufgeräumtes Interieur. Unterschiede lassen sich insbesondere im Hinblick auf den Namenszusatz „Sport“ feststellen, wirkt die Fahrerkabine des Range Rover Sport doch im Vergleich etwas fahrerorientierter und schnittiger. Nichtsdestotrotz stehen auch hier Komfort und Luxus im Vordergrund –angefangen bei den opulenten beheiz- sowie kühlbaren elektrischen Vordersitzen in perforiertem Semi-Alinin-Leder über das Panoramaglasschiebedach bis hin zu den Edelstahlpedalen. Auch in technischer Sicht hat das Cockpit allerhand zu bieten. Sowohl der 13,1 Zoll große, leicht gebogene Touchscreen mit dem intuitiv zu bedienenden Pivi-Pro-Betriebssystem als auch das 12,3 Zoll große TFT-Instrumentendisplay funktionieren einwandfrei. Und sogar ein Head-up-Display gehört zur Serienausstattung. Natürlich hat der Range Rover Sport auch sämtliche Fahr- und Assistenzsysteme wie ein 3-D-Surround-Kamerasystem und eine adaptive Offroad-Geschwindigkeitsregelung mit an Bord. Dennoch bleibt der Fahrgenuss erhalten, denn die Systeme greifen ausschließlich auf Wunsch oder im äußersten Notfall unterstützend ein.

KOMFORT IM VORDERGRUND
Angetrieben wird unser First Edition
D350 von einem Dreiliter-6-Zylinder-Bi-
turbo-Dieselmotor mitsamt Mildhybridsystem, wodurch eine Systemleistung von 258 kW (350 PS) und ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmeter freigesetzt werden können. Umgelegt auf Leistungswerte bedeutet das eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,9 Sekunden trotz eines Leergewichts von 2.435 Kilogramm sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 234 km/h – inklusive attraktivem Sound im Dynamic-Modus. Insoweit ist er ein recht rasanter Zeitgenosse, der gerne auch flott um die Kurve gefahren werden darf. Die straffe Lenkung sowie das sportlich ausgerichtete adaptive Fahrwerk unterstützen die eigene Fahrweise zusätzlich.
Letzten Endes ist und bleibt der rund fünf Meter lange Wagen allerdings ein auf Komfort ausgerichtetes SUV, heißt: Der erwähnte äußerste Notfall tritt im sportlichen Kurvenfahren etwas schneller ein … und das ist auch völlig in Ordnung. Denn als Ausgleich bietet der Engländer nicht nur im Fondbereich, sondern insbesondere im Ladeabteil reichlich Platz. Stolze 647 Liter fasst das Kofferraumvolumen des Range Rover Sport, nach Umklappen der Sitzreihe erhöht sich das Volumen sogar auf geräumige 1.491 Liter. Damit lässt es sich also bequem als Familie in den Urlaub fahren – gerne auch über Stock und Stein. Denn auch der Range Rover Sport überzeugt mit hervorragenden Offroad-Eigenschaften. Sowohl mit der maximalen Bodenfreiheit von 281 Millimetern als auch mit der maximalen Wattiefe von 900 Millimetern lässt es sich ausgezeichnet arbeiten.
Letztlich handelt es sich beim aktuellen Range Rover Sport First Edition D350 in Santorini-Black nicht nur um ein unglaublich attraktives Modell, sondern auch um eines mit idealen Fahreigenschaften – on- als auch offroad. Ob man mit einem Auto, das ab rund 150.000 Euro zu haben ist, tatsächlich offroad unterwegs sein möchte, darf jeder für sich selbst entscheiden. Können würde er es allemal.
RANGE ROVER SPORT FE D350
Antrieb: Allrad
Leistung: 258 kW/350 PS
Drehmoment: 700 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 5,9 sec
Spitze: 234 km/h
Verbrauch: 7,8 l/100 km (lt. WLTP)
Spaßfaktor: 9,5 von 10
Preis Testwagen: 155.783 Euro
eco. mobil 76
DAS REZEPT FÜR IHRE FINANZIELLE GESUNDHEIT!
UNTERSTÜTZUNG BEI IHRER PRAXISGRÜNDUNG
UNTERSTÜTZUNG BEI IHRER PRAXISGRÜNDUNG
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzteund das seit 40 Jahren. Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vorteil!
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet.
Wir beraten ausschließlich Ärztinnen und Ärzte - und das seit über 40 Jahren. Mit uns sind Sie für alle Fragen rund um Ihre Praxisgründung bestens gewappnet.
und das seit über 40 Jahren. Das schafft Vorsprung durch Wissen - und das zu Ihrem Vorteil!
Unser ressourcenreiches Team steht für bestes Service und maximalen Klientennutzen.


Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.
Ergebnis ist ein ausgefeilter Praxisgründungsplan, auf den Sie sich verlassen können.
Erwarten Sie von uns ruhig mehr, denn wir sind die Spezialisten!
v. li. Raimund Eller, Karin Fankhauser, Dr. Verena Maria Erian, Mag. Johannes Nikolaus Erian

v. li. Mag. Johannes Nikolaus Erian, Raimund Eller, Mag. Dr. Verena Maria Erian, Karin Fankhauser

Wir haben neue Räumlichkeiten mit mehr Platz für Sie und für uns. Kostenlose Parkplätze direkt vor unserer Haustüre. Unser Team freut sich auf Sie.
Wer kommt, will bleiben.

TEAM JÜNGER STEUERBERATER OG Die Ärztespezialisten Kaiserjägerstraße 24 · 6020 Innsbruck Tel.: +43 512 59 8 59-0 · Fax: DW-25 info@aerztekanzlei.at www.aerztekanzlei.at Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
www.aerztekanzlei.at
KERNUPDATE
Was man bisher – abgesehen von ein paar Ausnahmen – nur aus den elektrischen Vorreiterwägen iX und i4 der BMW i GmbH kennt, schmiegt sich nun langsam auch in die herkömmlichen (Verbrenner-)Modellpaletten ein. Dabei ist nicht das gewohnt sportliche Design oder der hohe Standard an Komfort, sondern vielmehr das moderne Betriebssystem OS 8 gemeint. Was genau dahinter steckt und wie es sich im Alltag bewährt, durften wir im neuen 330e xDrive Touring testen.
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE

eco. mobil
Beim Design ihres Neuen bleiben die Bayern gewohnt sportlich, hier und da wurde das Exterieur ein wenig an die aktuellen Kundenwünsche angepasst – athletisch, kantig und ins Auge fallend. So verbaut BMW an der Front hochglänzend schwarze Lufteinlässe, schräg darüber liegen die mit blauen Akzenten versehenen optionalen adaptiven LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Matrix-Fernlicht. Auch die Heckschürze erhält ein kleines Facelift, viel verändert hat sich allerdings nicht.
Umso spannender sind die Neuerungen im vorderen Bereich der Fahrerkabine. Besonders elegant zeigt sich das Cockpit nach dem iDrive-Update mit dem eindrucksvollen Curved-Display bestehend aus einem 12,3 Zoll großen Instrumentendisplay hinter dem optionalen M-Lederlenkrad sowie dem 14,9 Zoll großen Control-Display. Sinn und Zweck des neuen OS 8 ist die systematische Verdrängung von haptischen Steuerungsmodulen wie Tasten und Knöpfen. Vielmehr sieht BMW die Zukunft in der Touch- und Sprachsteuerung.
Neu indes ist das nicht. Zahlreiche Autohersteller verbannten in den letzten Jahren Tasten, Schalter und Knöpfe regelrecht aus ihrem Repertoire. Während der Grundgedanke dahinter unschwer nachzuvollziehen ist – der Fahrer kann sich besser auf das Fahren konzentrieren –, mangelte es in einigen Fällen schlichtweg an einer adäquaten Umsetzung. Oft waren wichtige Einstellungen in etlichen Untermenüs versteckt, sodass der geplante Zweck verloren ging, musste der Fahrer die gewünschte Einstellung doch erst in den Tiefen der teils unruhig funktionierenden Betriebssysteme suchen.
TOUCH STATT TASTEN
Anders beim neuen Betriebssystem von BMW. Gleich in zweierlei Hinsicht versucht man sämtliche Bedenken in Hinblick auf erschwerte Bedienmöglichkeiten im Keim zu ersticken. Zum einen funktioniert die Sprachsteuerung nahezu fehlerfrei und erlaubt ein kinderleichtes Einstellen zahlreicher Funktionen. Zum anderen lässt sich das Control-Display individuell konfigurieren, sodass die wichtigsten Standardeinstellungen bequem und einfach als Widget auf den Home-Bildschirm gezogen werden können. Auch sämtliche Untereinstellungen sind intuitiv mit nur wenigen Berührungen schnell zu finden. Einzig der altbewährte iDrive-Controller auf der Mittelkonsole ist geblieben, abgesehen natürlich von der ein oder an-
Zahlreiche Autohersteller verbannten in den letzten Jahren Tasten, Schalter und Knöpfe regelrecht aus dem Cockpit. Doch
deren obligatorischen Taste. Ansonsten zeigt sich das Cockpit nahezu unverändert, Platz nehmen darf man unter dem Panorama-Glasdach auf den optionalen Sportsitzen in toscarotem Vernasca-Leder mit schwarzer Dekorsteppung. Der Fondbereich bietet gewohnt angemessene Platzverhältnisse, unmittelbar dahinter eröffnet das Ladeabteil des 4,7 Meter langen Kombis ein Laderaumvolumen von 410 bis zu 1.420 Litern.
SOLIDE POWER
Angetrieben wird der schicke Mittelklassewagen von einer Kombination aus einem Dreiliter-Vierzylinder-Benzinmotor und einem Elektromotor. Diese ermöglicht eine Systemleistung von 215 kW (292 PS) und ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern. Dementsprechend gelingt ein gediegener Sprint von null auf 100 km/h in gerade einmal 5,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Plug-inHybrid-typisch fährt dieser auch rein elektrisch. Insgesamt ermöglicht der Elektromotor eine realistische rein elektrische Reichweite von knapp über 40 Kilometern.
Im Ergebnis überzeugt nicht nur das gewohnt moderne Design sowie der in jeder Situation bravouröse Antrieb, sondern vor allem die Technik, die der Bayer mitbringt. Dank des neuen Betriebssystems in Verbin-
dung mit einwandfreier Smartphone-Konnektivität wird der Wagen schlicht zum persönlichen Assistenten. Dabei behält BMW beim Betriebssystem ein Kernelement besonders im Fokus: Intuition. Das Handling des Betriebssystems funktioniert im Großen und Ganzen wie ein Smartphone. Das ist auch gut so, denn mal ehrlich: Wer studiert denn schon gerne eine Betriebsanleitung.

BMW 330E XDRIVE TOURING
Antrieb: Allrad
Leistung: 215 kW/292 PS

Drehmoment: 420 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 5,9 sec
Spitze: 225 km/h
Verbrauch: 1,5 Liter/100 km (lt. WLTP)
Spaßfaktor: 8,5 von 10
Preis: ab 82.528 Euro
eco. mobil 79
kaum einer macht’s so gut wie BMW.
ELEKTRO-RS
Nachdem bereits die SUV-Variante mächtig Eindruck gemacht hat, brachte Škoda in logischer Konsequenz auch eine SUV-CoupéVersion seines elektrifizierten Enyaq iV auf den Markt.
Eines steht fest: Ein Hingucker ist das Škoda Enyaq Coupé RS iV allemal, sowohl innen als auch außen.

80
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
So weit, so folgerichtig. Etwas unkonventionell hingegen ist die Herangehensweise, begann Škoda doch mit der Veröffentlichung der stärksten RS-Variante, die im Übrigen das erste rein elektrische Mitglied der RS-Familie ist. Einen Enyaq SUV RS gibt es bis dato nicht.
DYNAMISCHES DUO
Den Antrieb des RS-Coupé bildet ein Gespann aus zwei Elektromotoren – einer an jeder Achse. Generell fährt der Enyaq Coupé RS mit Hinterradantrieb, sofern benötigt, schaltet sich der vordere Motor dazu. Gesamt bringt es das Duo dadurch auf eine Systemleistung von 220 kW (299 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 460 Newtonmetern. Dank einer Batteriekapazität von 82 kWh ist mit der Coupé-Variante eine maximale Reichweite von über 500 Kilometern machbar. Theoretisch, denn bekanntlich hängt die größtmögliche Distanz zwischen zwei Ladepausen von zahlreichen Faktoren ab. Geschwindigkeit, Temperatur oder Fahrweise sind nur ein paar davon. Wem die rasant purzelnden Kilometer auf dem 5,3-Zoll-Instrumentendisplay allerdings kein Dorn im Auge sind, der wird gelegentlich auch die sportliche Seite des Coupés kennenlernen wollen. Und können. Trotz einer – verglichen mit anderen Elektromodellen – eher mäßigen Beschleunigung von 6,5 Sekunden von null auf 100 km/h gelingt jedes Überholmanöver flott.
GANZ VORNE MIT DABEI
Designtechnisch übernimmt das Coupé in typischer Automobilherstellermanier insbesondere die Front mehr oder weniger ident von seinem SUV-Bruder. Optisch auffallend ist das bei den RS-Varianten verbaute Crystal-Face, wobei der Frontgrill im LED-Crystal-Design beleuchtet wird und so der Vorderansicht einen wunderbaren, bleibenden ersten Eindruck verleiht. Erst hinter der B-Säule offenbart sich der wahre Kern eines SUV-Coupés: die schräg abfallende Dachlinie mitsamt scharfer Abrisskante am Heck. Dass diese Karosserievariante im Privatkundensegment hervorragend ankommt, ist längst kein Geheimnis mehr. So ist es kein Wunder, dass auch Škoda –ähnlich wie seine Konzerngeschwister – auf diesen Zug aufspringt. Das Ergebnis? Sieht nicht nur gut aus, sondern gehört auch zur absoluten Aerodynamik-Elite.
Das Heck des Enyaq Coupé besticht indes durch seine LED-Leuchten mit dynamischen
Blinkern sowie der athletisch ausgeführten Heckschürze. Um dem Design den letzten Schliff zu verpassen, setzen die Ingenieure vorwiegend auf hochglänzend schwarze Akzente, auffallend insbesondere bei der Frontgrillumrandung, den Außenspiegelgehäusen sowie dem Diffusor. Abgerundet wird das sportliche Design durch die auffälligen RS-Logos auf den vorderen Kotflügeln. Schließlich soll man ja auch sehen können, dass es sich hierbei um einen RS handelt –hören kann man es letztendlich nicht.
Dass auch der Innenraum auf RS-DNA beruht, ist schon beim Einsteigen an dem perforierten Multifunktions-Sportlenkrad oder den hochwertigen Sportsitzen unschwer zu erkennen. Im Vergleich zum herkömmlichen SUV hat sich allerdings kaum etwas verändert. So bleibt das Herzstück des Cockpits auch weiterhin der 13 Zoll große Multitouch-Screen, im Coupé erhält das Betriebssystem allerdings ein Update, wodurch die Benutzerfreundlichkeit ordentlich gesteigert wird. Ebenfalls unverändert – allerdings zum Nachteil – bleibt das nur 5,3 Zoll große Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad. Auch wenn dies im gesamten Konzern immer wieder gern gesehen ist, optisch ginge da etwas mehr.
Besonders erfreulich hingegen: In Sachen Raumangebot steht das Coupé der SUV-Variante um fast nichts nach. So wird nicht nur im Fondbereich unter dem serienmäßigen Panoramaglasdach ausreichend Platz auch für größer gewachsene Personen geboten, sondern vor allem im Ladeabteil. Mit 570 Litern fasst das Kofferraumabteil des SUV-Coupé gerade einmal 15 Liter weniger als das des SUV – trotz des schnittigen De-
ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS IV
Antrieb: Allrad
Leistung: 220 kW/299 PS
Drehmoment: 460 Nm
Beschleunigung: 0–100 km/h: 6,5 sec
Spitze: 180 km/h
Verbrauch: 16,7 kWh/100 km
Spaßfaktor: 8 von 10
Preis Testwagen: 71.181 Euro
signs. Auch vergleichbare Modelle wie der Q4 Sportback e-tron mit 535 Litern können mit dem Coupé nicht mithalten. Zusätzlich zum großzügigen Platzvolumen kommt ein variabler Ladeboden mit Stauraum für Ladekabel.

GERNE ( NOCH ) ETWAS MEHR SPORTLICHKEIT
Trotz seiner vielversprechenden Bezeichnung mangelt es dem Coupé RS iV leider ein wenig an Sportlichkeit. Auch wenn die im Unterboden verbaute Batterie den Schwerpunkt stark nach unten verlagert, gerät der rund 2,3 Tonnen schwere Koloss bei sportlicher Fahrweise etwas ins Wanken. Zugegeben, das tun die meisten größer gewachsenen Modelle, in diesem speziellen Fall jedoch etwas auffälliger. Insoweit sind die rund 9.000 Euro Unterschied zwischen den Grundpreisen der beiden Varianten RS und bald auch dem „normalen“ Coupé durchaus ein Faktor, den es bei der Entscheidung miteinzubeziehen gilt – denn die Leistungsunterschiede dürften sich in Grenzen halten. Der Preis für die RS-Variante des sportlichen SUV-Coupé beginnt jedenfalls bei 66.430 Euro.
eco. mobil 81
LIFESTYLE
Rad, ich, passt!
Im vergangenen Jahr hat sich Lukas Schindl seinen Traum erfüllt und mit dem Radgut einen wunderbaren Ort rund ums Bike geschaffen. Der Standort im Stublerfeld in Terfens/Vomperbach mag anfangs etwas gewagt anmuten, doch das Radgut ist kein Laden, in den man zufällig kommt. Man kommt ganz bewusst, geht es doch nicht darum, schnell ein Bike von der Stange zu (ver)kaufen. Hier bekommt jeder, was er braucht und was seinen Bedürfnissen entspricht. Dafür nimmt sich Lukas Schindl ordentlich Zeit für die Beratung. Weil Rad eben nicht gleich Rad ist, sondern 100-prozentig zu demjenigen passen muss, der es nutzt, um sicher und langfristig mit Freude unterwegs zu sein. Die Körpergröße allein hilft dabei nur mäßig weiter, deshalb nimmt man bei Radgut anhand eines speziellen Bikefittings den gesamten Körper und Menschen unter die Lupe. Anhand dieser Parameter wird das Bike individuell zusammengebaut. Bei den Marken – sowohl bei den Bikes selber als auch bei der Bekleidung – setzt man auf Hersteller, die den Radsport definieren und die sich in Sachen Innovation und Qualität im Spitzenfeld bewegen. Service wird indes auch nach dem Kauf großgeschrieben, denn im Radgut wird auch professionell repariert und serviciert – um frühjahrsfit zu sein, lohnt es sich, bereits jetzt einen Termin zu vereinbaren. www.radgut.at




82 kultur & trends
© MARIKA UNTERLADSTÄTTER
SCHENKEN MACHT FREU ( N ) DE

Wir alle haben ziemlich viel Zeugs zuhause liegen, das wir in Wahrheit weder brauchen noch nutzen, das aber wiederum andere gut brauchen und nutzen könnten. Die noamolBox ist eine unkomplizierte Möglichkeit, all diesen Dingen eine zweite Chance zu geben. In die Re-use-Box darf Hausrat jeglicher Art von Dekogegenständen, Geschirr über Bücher und Spielsachen bis hin zu Sportartikeln oder Werkzeug. Voraussetzung: Die Gegenstände dürfen nicht kaputt, schmutzig, unvollständig oder gefährlich sein. Durch soziale Projekte in Tirol werden die gesammelten Teile zum Wiederverkauf vorbereitet und zum Verkauf angeboten. Die Boxen können kostenlos an den Recyclinghöfen der teilnehmenden Gemeinden mitgenommen und abgegeben werden. Bei der Pilotphase sind vorerst Innsbruck, Telfs, Schwaz, Hall, Zirl, Völs und Fulpmes dabei. www.noamol.at

TREUER WEGBEGLEITER
Ein Wein, der jederzeit wie ein guter Freund zur Seite steht und jeden Augenblick verschönert: Der „Alano“ (Die Dogge) vom Weingut Poggio Rozzi – Conti Toggenburg ist zuverlässig, unkompliziert, sanft und Sinnbild für einen klassischen toskanischen Rotwein. Der jugendliche, frische Charme unterstreicht den runden und angenehmen Wein. Er besticht mit seinen Beerenaromen, der leichten Würzigkeit im Abgang und dem typischen Chianti-Charakter. Entdeckt in der Vinothek Gottardi in Innsbruck um faire 11,50 Euro. www.gottardi.at

AUSSTELLUNGSTIPP

Im Jahr 1420 kaufte Herzog Friedrich IV. zwei Bürgerhäuser in der Altstadt und verlegte die Residenz nach Innsbruck. Der landesfürstliche Hof und die Landesverwaltung hielten Einzug und wandelten und prägten die Stadt damit maßgeblich. Viele Spuren sind bis heute sichtbar. Die aktuelle Ausstellung „Im Aufbruch. Innsbruck wird Residenzstadt“ im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck spürt der Entwicklung noch bis 21. April 2022 nach und ist in einer Kooperation mit dem Tiroler Landesarchiv entstanden. Am 18. Feber und 15. April sind außerdem Stadtführungen zum Thema geplant.
FILMLAND IM GEBIRG
91 Kino-, TV- und Streamingproduktionen, 66 Werbefilme, 44 Fotoshootings, drei Musikvideos, 807 Drehtage, über fünf Millionen Euro produktionsbedingte Ausgaben und rund 351 Millionen Kinobesucher*innen, TV-Zuseher*innen und YouTubeUser*innen – das Filmland Tirol blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Der Ausblick ist nicht minder gut, werden doch schon wieder zahlreiche Anfragen aus dem In- und Ausland registriert. Tja, ist aber auch echt schön bei uns!
eco. life 83
© TOBIS/EPOFILM/HEINZ LAAB TIPP DER REDAKTION
TIPP DER AUSGABE:
Fantasie hilft gegen Realität. Ein ganzes Leben
Von der Piste ins Spa
Der Zürserhof und der Arlberg verbinden gelebte Gastfreundschaft und Winterfeeling par excellence.


In einer Zeit, in der Entspannung und Ruhe zu Luxusgütern geworden sind, bietet die Familie Skardarasy in ihrem Ski- und Spa-Resort Zürserhof eine gemütliche Atmosphäre, herausragenden Service auf höchstem Niveau und einen feinen Sinn für Stil und Eleganz. Dass in einem Hotel, das mit fünf Sternen superior ausgezeichnet ist, alles geboten wird, was das Herz begehrt, davon kann der Gast ausgehen. Dies beweist nicht zuletzt das Aureus SPA auf 3.200 Quadratmetern.

WEIT UND BREIT
Mehr als 300 Skiabfahrtskilometer liegen den Skifahrern hier im größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs zu Füßen. Die Pisten breiten sich zwischen 1.300 und 2.800 Metern Höhe aus und sind bis weit in den Frühling hinein schneesicher. Die Sonnenterrasse des Zürserhofs schmiegt sich an die Piste und ist eine der schönsten am Arlberg. Kenner von Haus und Arlberg timen ihre Skitage längst so, dass sie ihre Schwünge zur Lunchtime in der Nähe der Zürserhof-Terrasse ziehen.
Wo allerhöchstes Niveau für ein internationales Publikum geboten wird, stehen auch umweltverantwortliches Handeln und Energiesicherheit im Mittelpunkt. „Wir sind autark“, das kann Familie Skardarasy mit gutem Gewissen behaupten. Die Wärme kommt im Zürserhof zu 100 Prozent aus dem Biomasseheizwerk Lech, der Ökostrom aus Vorarlberg und das Wasser aus der eigenen Quelle. Dank der Symbioceuticals-Harmonizer-Technologie im Haus ist das Ski- und Spa-Resort frei von negativen Umwelteinflüssen, denn Elektrosmog, Feinstaub und andere Belastungen werden damit flugs neutralisiert. Mehr Wohlbefinden, weniger Stress und ein gesünderes Leben sind das Ergebnis. Das Aureus SPA ist wohl eines der exklusivsten und beeindruckendsten SPAs des Landes. Nicht nur, dass der Platz, an dem das Aureus SPA gebaut wurde, ein besonderer ist, auch das SPA-Konzept ist durchdacht bis ins letzte Detail und im SPA-Bereich sprudelt das frische Wasser aus der hauseigenen Quelle. Im eigenen Family SPA werden Kinder und Jugendliche wie die Großen verwöhnt.
Das kulinarische Wochenprogramm des Zürserhofs kommt einer Genussreise gleich. Sitzt man einmal bei Tisch, will man gar nicht mehr aufhören, die Köstlichkeiten der exzellenten Küche zu genießen. Anschließend locken die gemütliche Hotelbar, die Zigarrenlounge oder der Hauspianist, um einen wunderschönen Tag genussvoll ausklingen zu lassen.
HOTEL ZÜRSERHOF
Zürs 75, 6763 Zürs am Arlberg Tel.: 05583/2513-0
hotel@zuerserhof.at www.zuerserhof.at

eco. life 84
FOTOS: © DOMINIK CINI, DOMINIK ZIMMERMANN, RAINER HOFMANN PHOTODESIGN
EINE ARBEIT MIT SINN
Es ist eine revolutionäre Mission, die das weltweite Cropster-Team mit Hauptsitz in Innsbruck zusammenschweißt und gemeinsam für eine gute Sache arbeiten lässt: einen besseren und nachhaltigeren Kaffee.

 TEXT: DORIS HELWEG
TEXT: DORIS HELWEG
Eine Vision verbindet. Vor rund 15 Jahren nahm die Geschäftsidee von Cropster in einer Wohnung in Cali in Kolumbien ihren Anfang. Mit einem Traum. Nämlich dem Traum, mit einer erschwinglichen Technologie Kaffeeprofis weltweit zu verbinden – von Farmen am Ursprungsort über Röstereien bis hin zu Cafés. Die Technologie soll das Zusammentragen, Nutzen und Analysieren von Geschäftsinformationen leichter machen und den verschiedenen Unternehmen der Kaffeebranche dabei helfen, sich in jeder Produktionsphase auf die Kernprozesse zu konzentrieren – sei es in puncto Qualität, Beständigkeit, Planung, Nachverfolgbarkeit oder Ressourcenmanagement. Dabei spielt Fairness allen Stakeholdern gegenüber eine elementare Rolle, denn die Mission lautet: ein besserer und nachhaltigerer Kaffee für alle. „Mit unserer Arbeit möchten wir alle Seiten der Wertschöpfungskette durch geteiltes Fachwissen und Informationen befähigen“, verrät Sarah Nobis, zuständig für Employee Experience bei Cropster. Cropster unterstützt mit den verschiedenen Softwarelösungen und Apps Kaffeeprofis weltweit. „Auch intern leben wir dieses hohe Engagement, um unsere revolutionäre Mission einer nachhaltigen Kaffeeindustrie zu verfolgen. Mit unseren weiteren Standorten weltweit zählen wir heute bereits 75 Mitarbeitende und sind
immer auf der Suche nach Gleichgesinnten, die mit uns an unserer Mission arbeiten möchten“, erklärt Nobis. Hauptsitz von Cropster ist im Gebäude des Hotel Ibis am Innsbrucker Bahnhof, wo aktuell an die 40 emsige Köpfe ihren Spirit einbringen. „Als Softwareunternehmen arbeiten wir mit moderner Ausstattung im Büro sowie im Homeoffice. Zudem sind wir als Arbeitgeber überzeugt, dass eine gute Work-LifeBalance mehr als nur ein Schlagwort ist – sie
ist vielmehr Teil unseres Erfolgs. Daher bieten wir flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sowie bezahlte Zeit für ehrenamtliches Engagement und Remote-Work an.“
Beim aufstrebenden Softwareunternehmen gehört neben fairer und wettbewerbsfähiger Entlohnung ein Bildungs- und Wellnessbudget zu den Benefits, das Mitarbeitende für ihre Weiterbildung oder ihre mentale und körperliche Gesundheit einsetzen können. „Bei Cropster können sich Mitarbeitende frei entwickeln. Wir unterstützen Entwicklungsmöglichkeiten und übernehmen die Kosten für Trainings und Kurse. Außerdem geben wir unseren Teammitgliedern auch genügend Raum, um innerhalb unserer Organisation zu wachsen und ihre beruflichen Interessen und ihr Fachwissen unabhängig vom aktuellen Erfahrungslevel zu entwickeln“, betont Nobis.
Als Marktführer von Softwarelösungen für die Spezialitätenkaffeeindustrie zeigt sich Cropster als ein stabiles und solides Unternehmen mit einem Netzwerk aus Partnern und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wer also einen bedeutenden Beitrag leisten und mit anderen engagierten Menschen zusammenarbeiten möchte, ist bei Cropster genau richtig. www.cropster.com PR
85 CROPSTER
Mit der Vision eines besseren und nachhaltigeren Kaffees für alle bringt Cropster Profis aus aller Welt zusammen.
Die Cropster-Gründer Norbert Niederhauser, Martin Wiesinger und Andreas Idl
QUALITÄT AUS ÖSTERREICH. UND AUS TRADITION.
Das österreichische Textilunternehmen David Fussenegger produziert seine hochwertigen Heimtextilien in Altach in Vorarlberg nach höchsten ökologischen und sozialen Standards. Gegründet 1832 fußt es auf einer starken Vergangenheit und blickt heute jeden Tag in eine tolle Zukunft.
Bereits mit 24 Jahren gründete David Fussenegger im Jahr 1832 seinen Betrieb in der damaligen Textilhochburg Dornbirn. In nur drei Jahren entwickelte sich das Unternehmen zum drittgrößten Arbeitgeber Vorarlbergs. Schon damals bildete die Verarbeitung von Baumwolle und Baumwollmischgarnen den Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten.
Das Unternehmen blieb beinahe 180 Jahre im Familienbesitz, bis es im Jahr 2011 von den langjährigen Mitarbeitern Jürgen Spiegel und Gottfried Wohlgenannt übernommen wurde. Seit diesem Zeitpunkt setzen die beiden Geschäftsführer die langjährige Tradition des Familienunternehmens fort und führen den heute mittelständischen Betrieb mit rund 50 Mitarbeiter*innen mit Umsicht und Erfolg. Mit einer Exportquote von 75 Prozent sind die Produkte nicht nur in Österreich sehr beliebt, sondern finden mittlerweile auch in den USA, Kanada, Südkorea oder Australien Anklang als dekoratives Element.
HOCHWERTIGE HEIMTEXTILIEN
Nicht nur die Produkte, sondern auch die Designs entstehen in Vorarlberg aus eigener Hand. So entwickelt das dreiköpfige Designteam jährlich sechs neue Kollektionen, die insgesamt mehr als 600 Produkte umfassen. Großteils produziert das Unternehmen hochwertige Kuscheldecken für Erwachsene, Kinder und auch Haustiere. Zusätzlich zur Kernkompetenz der Deckenherstellung hat das Unternehmen begonnen, sein Produktportfolio mit diversen Accessoires zu erweitern. So werden beispielsweise zu den Kuscheldecken passende Kissenhüllen oder Teppiche und Taschen angeboten. Damit will David Fussenegger seiner Mission, Endverbraucher*innen bei der individuellen Gestaltung ihres Zuhauses zu unterstützen, gerecht werden – ganz im Sinne des Leitgedankens „Dein besonderes Zuhause“.


Nachhaltigkeit und Recycling sind beim Hersteller von Interiortextilien dabei seit
Die Produkte von David Fussenegger sind nicht nur in vielen großen österreichischen Möbelhäusern, sondern auch in zahlreichen kleineren Möbel-, Deko- und Geschenkläden erhältlich.
vielen Jahren prägende Themen, zuletzt wurde man für dieses Engagement mit dem European Green Award 2021 in der Kategorie „Interior“ ausgezeichnet. Bereits seit 2011 werden sämtliche neu eingeführten Produkte aus Recyclinggarnen hergestellt. Ab 2023 geht das Unternehmen einen Schritt weiter, sodass künftig das gesamte Produktportfolio auf Recyclingmaterialien basieren wird.
ZEIGEN, WER MAN IST
Mit kundenspezifischen Designs hat sich für das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein neues Geschäftsfeld eröffnet. David Fussenegger wickelt so jährlich rund 300 Sonderprojekte entsprechend der individuellen Vorstellungen seiner Kunden ab. Ab einer geringen Stückzahl von etwa 120 Stück entwickelt und produziert das Unternehmen Decken und Accessoires für einzigartige Kunden- und Mitarbeitergeschenke, die Hotellerie oder zur Ergänzung des eigenen Produktportfolios. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Automobilindustrie, Banken, Versicherungen, Gemeinden und Hotels. Als Paradebeispiel für Westösterreich zählt die Kooperation mit dem Tirol Shop. Seit vielen Jahren zählt man hier auf die hochwertige Vorarlberger
Jürgen Spiegel und Gottfried Wohlgenannt haben das Unternehmen als langjährige Mitarbeiter 2011 von der Gründerfamilie übernommen.
Qualität, „veredelt“ mit dem Tirol-Logo. Darüber hinaus tritt der Tirol Shop auch als erfolgreicher Vertriebspartner für David Fussenegger in Tirol auf, wobei bereits viele schöne Ideen für verschiedenste Betriebe in Co-Produktion umgesetzt worden sind. Einweben kann man dabei fast alles, ganz egal, ob ein Design, Logo, Schriftzug oder sogar Fotos. Bei Interesse können sich Firmenkunden aus Tirol gerne direkt an Frau Martina Rohrmoser vom Tirol Shop wenden (martina.rohrmoser@tirolshop.com). PR
DAVID FUSSENEGGER
TEXTIL GMBH

Unterhub 33, 6844 Altach Tel.: 05576/73 400
www.davidfussenegger.com
Anfragen zu individuellen Sonderprojekten außerhalb Tirols über privatelabel@davidfussenegger.com.
86
DAVID FUSSENEGGER


 Stylisch und zeitlos: der Tiroler Adler eingewoben mittels Jacquard-Technik
Stylisch und zeitlos: der Tiroler Adler eingewoben mittels Jacquard-Technik
VIELFÄLTIGER START INS KUNSTJAHR
In der Innsbrucker Galerie Nothburga ist aktuell die Nominiertenausstellung des Fritzi-Gerber-Preises zu sehen, Mitte Feber folgt mit Monika Köck und Holger Rudnick die erste – galeriegewohnte – Doppelausstellung.


In Gedenken an ihre Gründerin Prof. Elfriede Gerber hat die Galerie Nothburga im Jahr 2016 erstmals den mit 1.000 Euro dotierten Fritzi-Gerber-Preis ausgerufen, der als anonymisierter Wettbewerb mit Unterstützung der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol durchgeführt wird. Seither findet dieser alle drei
Jahre statt und stand nach den Themenbereichen Malerei sowie Zeichnung dieses Mal unter der Kategorie Kleinplastik. Einreichen konnten Künstler*innen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, eine hochkarätige sechsköpfige Fachjury (siehe unten) nominierte daraus 35 Kreative, deren Arbeiten noch bis 4. Feber in der Galerie Nothburga

eco. life 88
Elke Krismers „Metamorphosis for ever and ever AND EVER ...“ (Kupferdraht/Glas, ca. 10 x 10 x 19 cm, 1 kg, 2022) wurde von der sechsköpfigen externen Fachjury zum Siegerprojekt des Fritzi-Gerber-Preises 2022 gekürt.
Martina Geroldinger, Tochter von Prof. Fritzi Gerber, Vorsitzende Dr. Sibylle Saßmann-Hörmann, Dr. Melanie Wiener, Kulturabteilung der Tiroler Landesregierung, und Preisträgerin Dipl.-Ing. Elke Krismer
Die externe Fachjury: Mag. Veronika Gerber, Dr. Maria Mayrl, Mag. Georg Loewit, MMag. Dr. Melanie Wiener, Univ.-Prof. Mag. Lukas Madersbacher und Mag. Michael Defner.
© NIKO HOFINGER
zu sehen sind. Aus allen Nominierten wiederum ging Elke Krismer mit ihrem Objekt „Metamorphosis for ever and ever AND EVER…” als Preisträgerin hervor. Die Galerie widmet ihr im kommenden Jahr eine Einzelausstellung, die wie die Nominiertenausstellung unter der Kuratierung der Künstlerin Barbara Fuchs erfolgen wird
Bis dahin werden – dem Konzept der Galerie entsprechend – vorrangig wieder Doppelausstellungen zu sehen sein, deren Protagonist*innen auf den ersten Blick oft unterschiedlich sein mögen, sich jedoch auf verschiedensten Wegen treffen und (künstlerisch) ergänzen. Den Anfang machen Monika Köck und Holger Rudnik, die unter dem Titel „Lichtspiele und Fadenläufe“ ab 15. Feber zueinanderfinden. Die Vernissage findet am 14. Feber um 19 Uhr in der Galerie Nothburga statt.

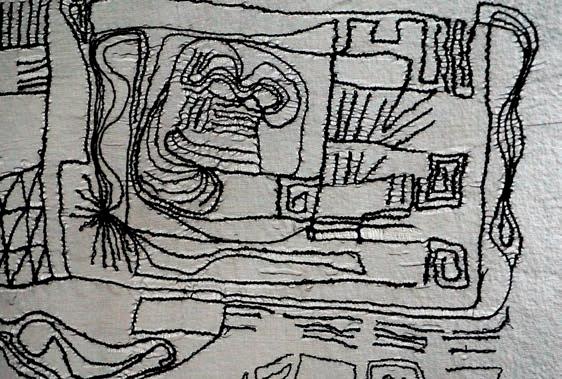
AUSEINANDERSETZUNG
MIT DEM MATERIAL
Monika Köck fertigt textile Arbeiten, wobei es ihr dabei vor allem um die Auseinan-
dersetzung mit dem Material und dessen Tücken geht, um das Ringen mit einer Idee und die daraus entstehende Freude, wenn eine Umsetzung gelingt. Seit 2004 ist Köck Mitglied der Gruppe co.opStoFF, arbeitet im Zuge dessen mit Irmgard Hofer-Wolf zusammen und stellt gemeinsam aus. Ursprünglich gehörte auch die Textilkünstlerin Christine Siess zur Kooperative. Sie verstarb jedoch leider im Sommer 2020 durch einen Unfall. Köck lebt und arbeitet in Rum.
In der Galerie Nothburga bekommt Monika Köck mit Holger Rudnick einen künstlerischen Partner zur Seite, der in der Ausstellung hauptsächlich Cyanotypien zeigt – eine besondere Form des Blaudrucks. Das auch als Eisenblaudruck bekannte Verfahren ist ein altes fotografisches Edeldruckverfahren mit blauen Farbtönen. Bis 1870 war die Cyanotypie zur Vervielfältigung von Plänen, also das Anfertigen von Blaupausen, weit verbreitet. Die Belichtung erfolgt mittels Sonnenlicht. Nach vielen Jahren der Beschäftigung mit Keramik wandte
sich Rudnick vermehrt den Glasarbeiten zu und hat das Verfahren der Cyanotypie als auch anderer Drucktechniken für sich (wieder)entdeckt. Rudnick ist in Norddeutschland geboren und lebt seit 1978 in Tirol. Als gelerntem Maschinenbauer sind ihm technische Vorgänge durchaus nicht fremd.
GALERIE NOTHBURGA
Innrain 41, 6020 Innsbruck info@galerienothburga.at www.galerienothburga.at
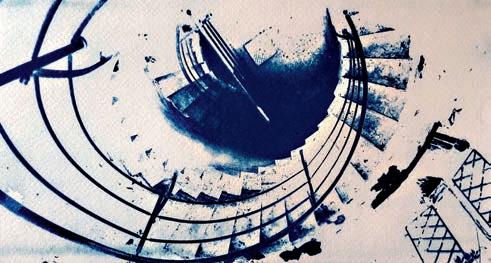
Mi. bis Fr. von 16 bis 19 Uhr, Sa. von 11 bis 13 Uhr
AKTUELLE AUSSTELLUNG
Nominiertenausstellung
Fritzi-Gerber-Preis 2022 Kleinplastik
noch bis 4. Feber 2023
KOMMENDE AUSSTELLUNG
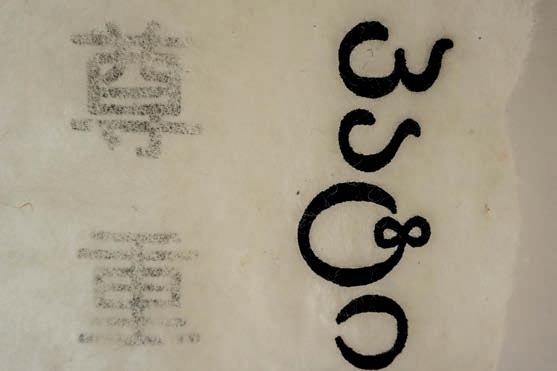
Lichtspiele und Fadenläufe
Monika Köck & Holger Rudnick
15. Feber bis 11. März 2023
eco. life 89
Holger Rudnick
Monika Köck
IM GESPRÄCH
SAVE THE DATE
Nach dreijähriger Pause ist es am 11. November 2023 wieder so weit: Dann nämlich findet der beliebte Brautkleiderball in der SichtBAR in Fügen statt. Neben unterhaltsamer Partymusik stehen auch der traditionelle Brautwalzer sowie der obligatorische Hochzeitstortenanschnitt auf dem Programm, die in Form einer Tombola zugunsten der Kinderhilfe Bezirk Schwaz verlost werden. Das Team der SichtBAR rundet den Ballabend kulinarisch mit einem festlichen „Hochzeitsmenü“ ab. Kartenreservierungen unter 0664/612 33 39. Infos unter www.binderholz-feuerwerk.com

NEUE FÜHRUNG
STIHL Tirol hat unter der Führung von Clemens Schaller in fünf Jahren eine positive Entwicklung genommen. Die Belegschaft stieg von 480 Mitarbeiter*innen im Jahr 2017 auf aktuell rund 800. Auch der Umsatz hat sich von 381 Millionen Euro (2017) auf 715,8 Millionen Euro (2021) fast verdoppelt. 2019 und 2022 wurden mit zwei großen Erweiterungsbauten am Standort Langkampfen außerdem große Meilensteine gesetzt. Mit 1. Jänner 2023 übernahm nun Jan Grigor Schubert die Geschäftsführung des Gartengeräte-Herstellers aus Langkampfen, Clemens Schaller trat Ende des vergangenen Jahres 2022 in den Ruhestand. Schubert war zuvor über zehn Jahre Geschäftsführer von ZAMA, einer hundertprozentigen STIHL-Tochtergesellschaft.

EINGEKOCHT
14 Spitzenköch*innen von Osttiroler Haubenrestaurants haben für ein Charityprojekt des Rotary Club Lienz das Buch „Koch mit uns“ verlegt und darin insgesamt 50 Rezepte zusammengestellt, die pro Gericht für zwei bis vier Personen maximal zehn Euro kosten. Auch der Rotary Club Innsbruck Bergisel unterstützte das Projekt, sodass am Ende eine Spendensumme von 2.500 Euro zusammengekommen ist, die kürzlich an die Innsbrucker Tafel übergeben werden konnte.

CHARITY IN KUFSTEIN
Die Damen des Lions Club Kufstein organisierten in der Vorweihnachtszeit in den Kufstein Galerien zum bereits zehnten Mal einen Geschenke-Einpackservice. Während die Männer am Kufsteiner Weihnachtsmarkt für den karitativen Zweck Glühwein verkauften, packten ihre Damen fleißig Geschenke ein. Kürzlich konnten Sandra Bodner, Reinhilde Wildinger, Evi Lüthi, Heidi Mauracher (im Bild von links) stellvertretend für alle Kufsteiner Lions-Damen mehr als 2.300 Euro an den neuen Präsidenten des Lions Club Kufstein, Jörg Kickenweitz, übergeben. Das Geld kommt Bedürftigen in der Region zugute.

90
news & events
© STIHL TIROL
© KUFSTEIN GALERIEN
Katarina Kröll, Susi Lengauer, Caroline Bernardi, Katharina Hotter und Martina Geisler
Alfred Grassegger, Präsident des RC Innsbruck Bergisel, bei der Scheckübergabe an Jasmin Carli von der Tafel Innsbruck
© BINDERHOLZ GMBH
Jan Grigor Schubert hat mit Anfang des Jahres die Geschäftsführung der STIHL Tirol GmbH übernommen.
um kommunikations welten besser
WEIL TECHNIK NICHT MEINS IST *
Abteilungsleiterin Helene S.: Würde gerne endlich pünktlich mit Videokonferenzen starten
* Muss sie auch nicht, liebe Helene! Unsere VideokonferenzSysteme sind für jeden einfach zu bedienen und funktionieren beim ersten Log-in. So können alle Meetings direkt starten und die Zusammenarbeit wird um Kommunikationswelten besser. Versprochen!
Wir freuen uns darauf, auch mit Ihnen über die für Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen maßgeschneiderte, funktionierende Medientechnik zu sprechen.

#weiltechniknichtmeinsist www.av.solutions
Schauen wir nach vorne.

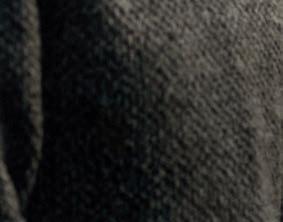
Reden wir darüber, wie Sie jetzt sich und Ihre Finanzen absichern.



sparkasse.at







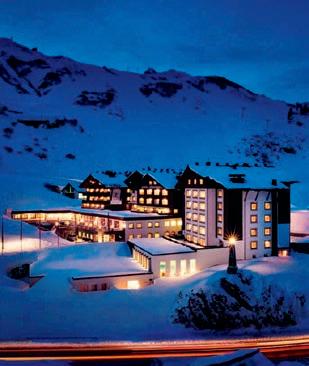







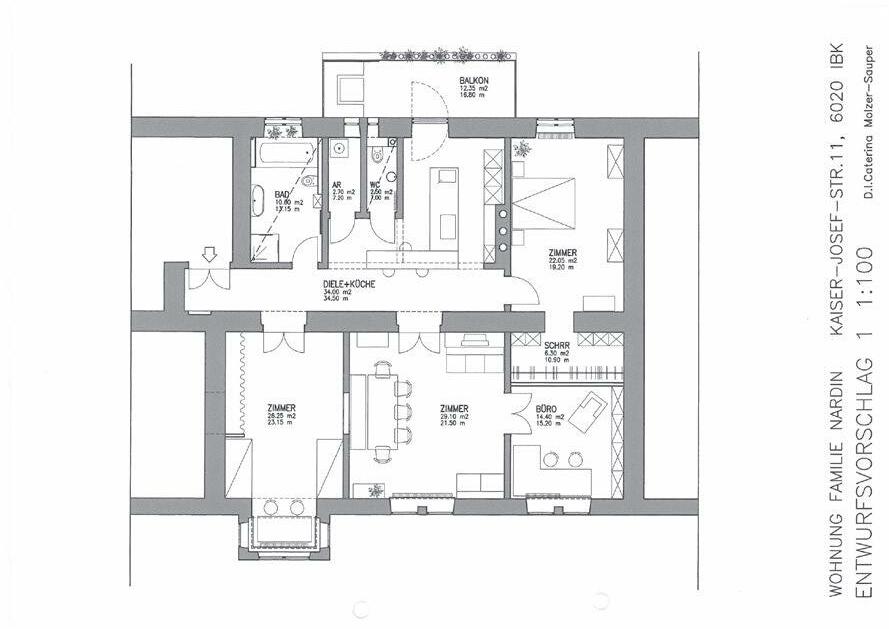
















 TEXT: MARIAN KRÖLL
TEXT: MARIAN KRÖLL





















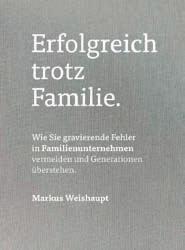












 TEXT: MARINA BERNARDI
TEXT: MARINA BERNARDI





























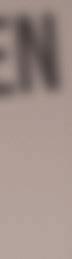













 TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
TEXT: FELIX KASSEROLER // FOTOS: TOM BAUSE
























 TEXT: DORIS HELWEG
TEXT: DORIS HELWEG





 Stylisch und zeitlos: der Tiroler Adler eingewoben mittels Jacquard-Technik
Stylisch und zeitlos: der Tiroler Adler eingewoben mittels Jacquard-Technik