Ausgabe 4 / 2024


Ausgabe 4 / 2024

Geschützt im Stadion: Die Wohntürme- und Swissporarena-Haustechniker René Limacher und Alfred «Tschuni» Köhler zählen auf die Brandmeldeanlage von CKW.

Der sportbegeisterte Elektroplaner Fabian Blum von CKW (in der Mitte) nahm sich eine berufliche Auszeit, um sich auf Paris vorzubereiten. Jan Moor (rechts) schloss im Sommer sein BachelorStudium im Bereich Energie- und Umwelttechnik ab, während er in einem 60-Prozent-Pensum als Solar-Spezialist arbeitete. CKW unterstützt individuelle Wege – mit Flexibilität und Weitsicht. Ab Seite 6 erfahren Sie mehr, auch über Thomas Baumann und Celine Müller (links im Bild), die ihren Beruf und ihr Leben bei CKW vereinbaren.


Sparsam im Winter Unsere Infografik gibt Tipps, wie Sie in der kalten Jahreszeit Energie sparen.
Impressum
2025 sinken die schweizerischen Strompreise um rund 10 Prozent. CKW senkt ihre Stromtarife um 30 Prozent – und belegt damit schweizweit erneut einen Spitzenplatz. In kaum einem anderen Versorgungsgebiet sind die Tarife günstiger als im CKWGebiet. Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt spart somit gegenüber dem Vorjahr rund 400 Franken pro Jahr. Das freut mich persönlich riesig!
Zusammen mit den tieferen Stromtarifen führt CKW einen neuen Leistungstarif ein. Der bekannte Hoch- und Niedertarif fällt weg. Der Leistungstarif belohnt alle Kundinnen und Kunden, die hohe Leistungsspitzen vermeiden und dadurch das Stromnetz nicht unnötig belasten. Wie das geht, erfahren Sie ab Seite 18.
Apropos Leistung: Höchstleistungen erbrachte die Hoteliersfamilie Pampel in Pontresina. Sie realisierte mit Unterstützung von CKW eine innovative PV-Anlage, die auch im verschneiten Winter des Engadins zuverlässig Strom produziert.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Martin Schwab, CEO CKW

Energieschub für das Sporthotel Mehr Nachhaltigkeit. Mit Unterstützung von CKW hat das Sporthotel Pontresina eine neue PV-Anlage in Betrieb genommen.
10. Jahrgang, November 2024, erscheint vierteljährlich
Herausgeber: CKW, Täschmattstrasse 4, Postfach, 6002 Luzern; Telefon 041 249 51 11, meine-energie@ckw.ch, ckw.ch
Redaktionsadresse: Redact Kommunikation AG, 8152 Glattbrugg; redaktion@redact.ch
Chefredaktion «Smart»-Verbund und Projektleitung: Simon Eberhard | Gestaltung: Nicole Senn
Druck: CH Media Print AG, 5000 Aarau

Neues Tarifmodell Leistungstarif statt Hoch- und Niedertarif. Wir erklären Ihnen, wie das neue CKW-Tarifmodell funktioniert.

Am 9. Juni 2024 stimmte die Schweizer Bevölkerung dem neuen Stromgesetz zu. Dieses will die Stromversorgung der Schweiz mit erneuerbaren Energien sichern. Was ändert sich für die Kundinnen und Kunden von CKW ab 2025? Unter anderem dies:
– Solarstrom kann besser lokal verbraucht werden. Einerseits mit virtuellen Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (voraussichtlich ab 2025) und andererseits mit lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (voraussichtlich ab 2026). Letztere machen es möglich, selbst produzierten Strom innerhalb eines Quartiers oder einer Gemeinde zu vermarkten.
– Die Kosten, um eine grössere PV-Anlage (ab 50 Kilowatt-Peak) ans Netz anzuschliessen, müssen nicht mehr allein von den Produzenten bezahlt werden. Ein Teil der Kosten für Anschlussverstärkungen wird künftig über die Netztarife von Swissgrid von der Allgemeinheit finanziert.
Weitere Neuerungen und mehr Informationen zum Stromgesetz finden Sie laufend aktualisiert auf unserer Website.
ckw.ch/stromgesetz

Vom 9. bis 19. Januar 2025 verwandelt sich Luzern erneut zum leuchtenden Treffpunkt –das Lilu Lichtfestival Luzern feiert seine 6. Ausgabe. Als Sponsorin trägt CKW nicht nur dazu bei, während der kalten Wintertage Licht und Wärme nach Luzern zu bringen, sondern unterstützt auch einen Verein, der sich ebenso wie CKW für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie einsetzt.
Gewinnen Sie für sich und Ihre Begleitperson zwei Tickets für die Lichtshow in der Jesuitenkirche und lassen Sie sich vom einzigartigen Zusammenspiel aus Licht und Musik verzaubern.
Jetzt mitmachen: ckw.ch/lilu
NACHGEFRAGT
Wie stelle ich die Heizkurve meiner Wärmepumpe richtig ein?
Beantwortet von:
Giuseppe Perrino, Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS

Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe an die Aussentemperatur angepasst wird. Eine zu steile Heizkurve kann den Energieverbrauch und das Takten der Wärmepumpen erhöhen, während eine flachere Kurve beide Kriterien verbessert. Gut gedämmte Gebäude mit grossen Heizflächen benötigen in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur. Wichtig ist, die Heizkurvensteilheit und die Heizgrenze auf die Dämmung des Hauses und die Heizflächen abzustimmen. Ein Fachmann kann die Heizkurvensteilheit berechnen und bei der optimalen Einstellung helfen. Mehr Informationen erhalten Sie im Dokument «Heizkurve richtig einstellen» von EnergieSchweiz. Das Dokument können Sie über den nebenstehenden QRCode herunterladen.

Seilwinden sind seit dem Altertum bekannt. Doch bis ins 19. Jahrhundert galten sie als zu gefährlich, um Menschen hochzuziehen. Der Siegeszug des Lifts begann mit Elisha Graves Otis aus New York, der eine Lösung entwickelte, um den Absturz eines Lastenzugs zu verhindern. Seine Fangbremse stoppte die Kabine bei einem Riss des Zugseils sofort. Eine spektakuläre Demonstration 1853 überschwemmte ihn mit Aufträgen. Otis’ Lifte veränderten die Stadt und ihre Architektur komplett. Sie liessen Wolkenkratzer erst in den Himmel wachsen, und das «Pent House» löste die «Bel Étage» als repräsentativsten Ort im Haus ab. Die Antriebe waren zuerst hydraulisch und ab 1891 elektrisch. In der Schweiz stieg der Luzerner Landmaschinenhersteller Schindler 1892 dank den Hotelpalästen der Belle Époque ins Liftgeschäft ein und ist heute nach Otis der zweitgrösste Lifthersteller der Welt. Lange konnten Lifte nur von Liftboys und Liftgirls sicher betrieben werden. Diese reizten ihre Machtposition mit Streiks in New York und Chicago bis in die 1940erJahre derart aus, dass automatische Lifte mit Nothalt- und Notrufsystemen entwickelt wurden. So sind Lifte heute das am konsequentesten automatisierte und auch das am meisten benutzte öffentliche Verkehrsmittel.
Bachelor-Student und Solar-Fachspezialist in einem? Bei CKW ist das möglich. Jan Moor schloss Anfang Sommer sein Bachelor-Studium im Bereich Energieund Umwelttechnik erfolgreich ab, während er in einem 60-Prozent-Pensum bei CKW arbeitete.
TEXT NICOLE MEYER FOTO CELINE MÜLLER
Der 26-Jährige begann seine berufliche Laufbahn mit einer kaufmännischen Lehre bei einem grossen Player in der Automobilbranche. «Schon während meiner Lehrzeit war Elektromobilität ein Thema. Obwohl die Technologie damals noch nicht so verbreitet war, wusste ich, dass dieses Thema Zukunft haben wird», erinnert sich Jan Moor. Seine Leidenschaft für Umwelt und Nachhaltigkeit wuchs, und er traf den Entscheid, dass er beruflich in einem Tätigkeitsfeld arbeiten möchte, in dem er der Umwelt etwas zurückgeben kann.
Von der Automobil- in die Energiebranche
Mit der Entscheidung für ein Bachelor-Studium in Energie- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Nordwestschweiz legte Jan den Grundstein für seine neue Karriere. «Für mich war der Übergang sehr spannend. Ich habe schnell bemerkt, dass in der Energiebranche die Gesellschaft als Ganzes im Vordergrund steht. In der Automobilbranche geht es viel mehr um das Individuum. Weiter fasziniert mich, wie fortschrittlich die Schweiz im Hinblick auf die Energiewende agiert. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und mithelfen, das gesamte SolarPotenzial auszuschöpfen.»
Mit flexiblen Arbeitszeiten zum Erfolg
Während seines letzten Studienjahres arbeitete der gebürtige Aargauer in einem 60-Prozent-Pensum bei CKW in der Solar-Abteilung Gross- und Spezialprojekte, in der er grosse Flexibilität genoss. «Am meisten geschätzt habe ich, dass ich meine Arbeitszeiten und -tage flexibel anpassen konnte. Wenn ich mal einen Tag zum Lernen brauchte, konnte ich das ganz
einfach einrichten.» Wertvoll war zudem, dass Jan das theoretische Wissen aus dem Studium direkt in der Praxis anwenden konnte.
Innovative Bachelor-Arbeit
Ein Höhepunkt seines Studiums war seine BachelorArbeit, die sich mit dem Potenzial von Solaranlagen auf Parkplatzflächen beschäftigte. «Die Ergebnisse sind vielversprechend», freut sich Jan Moor. «SolarCarports bieten enormes Potenzial zur Erzeugung erneuerbarer Energie, besonders in Kombination mit Elektromobilität.» Trotz der langen Amortisationszeit sieht Jan grosses Potenzial für diese Technologie, besonders bei grossen Fabriken und Einkaufszentren. Bereits heute bearbeitet CKW einige Kundenanfragen zu diesem Thema. Die Galliker Transport AG hat beispielsweise mit CKW die bislang grösste Carport-Solaranlage der Zentralschweiz umgesetzt; und das CKW-Mutterhaus Axpo realisierte gemeinsam mit Disneyland Paris die grösste SolarParkplatzüberdachung in Europa. Den 26-Jährigen freut’s: «Es ist grossartig zu sehen, dass ein effektives Bedürfnis für diese Lösungen am Markt vorhanden ist.»
Zeit, beruflich durchzustarten
Nun, da er seinen Bachelor abgeschlossen hat und in einem Vollzeitpensum bei CKW arbeitet, hat der frischgebackene Absolvent klare Ziele vor Augen. «Ich fühle mich sehr wohl bei CKW und im gesamten Axpo-Konzern. Hier möchte ich mich weiterentwickeln – vorerst vor allem im Bereich Solar-Grossprojekte. Mittelfristig strebe ich an, mehr Verantwortung zu übernehmen und eigene Projekte umzusetzen.»

« Am meisten geschätzt habe ich, dass ich meine Arbeitszeiten und -tage flexibel anpassen konnte.»
Die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben ist der Schlüssel zu langfristiger Zufriedenheit. Genau da setzt CKW an: Flexibilität, Eigenverantwortung und Unterstützung sind keine Schlagworte, sondern Teil der DNA. Drei Mitarbeitende erzählen.

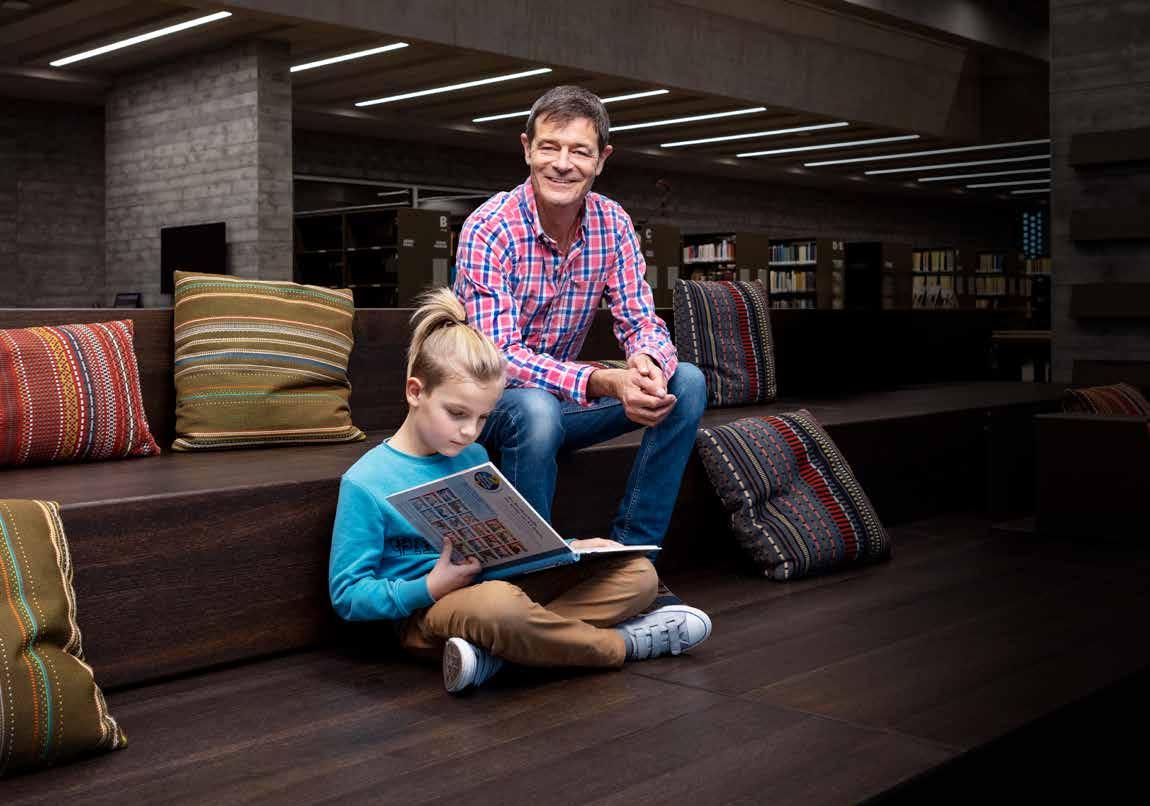
« Ich arbeite, wo die Work-PapiBalance stimmt.»
Wärmeprojekte realisieren und zwischendurch das Znüni für seinen Sohn vorbereiten: Das Teilzeitpensum mit flexiblen Arbeitszeiten ermöglicht es Thomas Baumann, Arbeit und Familie zu vereinbaren. ckw.ch/thomas-baumann

ckw.ch/traum
« Die längere berufliche Auszeit war für mich als Sportler Gold wert.»
Ein Sportunfall brachte Fabian Blum in den Rollstuhl. Sein Weg bei CKW ging trotzdem weiter, und er entdeckte eine neue Leidenschaft –den Rollstuhlsport. Der Elektroplaner nahm sich 2024 eine längere berufliche Auszeit, um sich für Paris vorzubereiten.

« Berufserfahrung sammeln und mich weiterbilden – das schätze ich sehr.»
Celine Müller schliesst im Sommer 2025 ihre vierjährige Lehre als Mediamatikerin EFZ ab – und der Weg geht weiter: In einem 50-Prozent-Pensum wird sie weiterhin bei CKW tätig sein und plant, die Berufsmatura Gestaltung, Kunst & Kultur berufsbegleitend zu absolvieren. Die Flexibilität, die CKW ihr bietet, schätzt sie sehr: «Ich kann mich auf meine Weiterbildung fokussieren und gleichzeitig Berufserfahrung sammeln –das ist für mich ideal.»
Im Fussballstadion des FC Luzern und in den Wohntürmen Allmend sorgen CKW-Brandmeldeanlagen für den optimalen Schutz Tausender Menschen. Die beiden Haustechniker Alfred «Tschuni» Köhler und René Limacher nehmen uns auf einen Rundgang mit.
TEXT NICOLE MEYER FOTOS CHRISTIAN BETSCHART
Die Sonne bricht nur zögerlich durch die Wolken, als wir an diesem Herbstnachmittag das Stadion des FC Luzern betreten. Es ist ruhig, die Tribünen sind leer – doch auch ohne die Spielerinnen und Spieler und die zahlreichen Fussballfans steht die Sicherheit stets im Vordergrund. Alfred Köhler, besser bekannt als «Tschuni», begrüsst uns mit einem Lächeln. Seit acht Jahren sorgt er als technischer Verantwortlicher dafür, dass im Stadion des FCL alles reibungslos funktioniert. «An den Matchtagen, wenn bis zu 15 000 Menschen hier sind, müssen wir uns auf jedes System verlassen können», erklärt er. «Die Brandmeldeanlage von CKW gibt uns die nötige Sicherheit, weil sie alles im Blick hat – ich kann ja nicht an allen Ecken gleichzeitig sein.»
Vielfältige Herausforderungen im Stadion
Sicherheit steht im Stadion des FC Luzern an oberster Stelle. Die Brandmeldeanlage im Stadion ist speziell darauf ausgelegt,
Fehlalarme zu vermeiden – eine besondere Herausforderung bei Fussballspielen, bei denen Rauchpetarden keine Seltenheit sind. «Es kommt immer wieder vor, dass Rauchpetarden gezündet werden. An Matchtagen habe ich jeweils Helferinnen und Helfer in verschiedenen Bereichen des Stadions, die mir dann bestätigen, ob es sich ‹nur› um eine Rauchpetarde oder um einen tatsächlichen Brandvorfall handelt», erklärt Tschuni Köhler.
Was passiert, wenn der Alarm losgeht?
Doch was läuft im Hintergrund ab, wenn die Brandmeldeanlage einen Alarm auslöst? «Sobald ich eine Brandmeldung erhalte, gehe ich zum Tableau, das mir zeigt, wo der Vorfall gemeldet worden ist», so Tschuni Köhler. «Dann überprüfe ich, ob es tatsächlich brennt. Wenn nicht, quittiere ich den Alarm. Wenn es aber Brandanzeichen gibt, wird die Feuerwehr automatisch alarmiert. Zum Glück gab es bisher noch keinen echten Brand, der einen Einsatz erfordert hätte.»

« Wir haben ein System, auf das wir uns verlassen können.»
Tschuni Köhler

« Es gibt uns ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Technik funktioniert und wir auf alles vorbereitet sind.»
René Limacher
Das Tableau zeigt, wo ein Brand gemeldet worden ist. Wenn es Brandanzeichen gibt, wird automatisch die Feuerwehr alarmiert.


Die Brandmeldeanlagen im Stadion sind speziell darauf ausgelegt, Fehlalarme zu vermeiden.
Sicherheit in den höchsten Türmen Luzerns
Vom Stadion schweift der Blick zu den höchsten Gebäuden von Luzern – den Wohntürmen Allmend. Hier ist René Limacher als Haustechniker im Einsatz.
Seit sechs Jahren betreut er die technischen Anlagen der Wohntürme im Auftrag von Enzler Reinigungen. «Die Brandmeldeanlage ist hier eine zentrale Komponente. Wir haben Feuerwehrlifte und spezielle Steuerungen im Brandfall –das Zusammenspiel ist enorm wichtig», sagt Limacher. Eine Situation, die zeigte, wie wertvoll die Anlage ist, ereignete sich vor etwa einem Jahr. «Kinder haben in einem Kellerraum gezündelt. Die
Brandmeldeanlage erkannte den Brand sofort und löste die Sprinkleranlage aus. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, sodass der Brand früh gestoppt werden konnte und kaum Schaden entstand.»
Sicherheit im Fokus
Egal ob Stadion oder Wohntürme – die Sicherheit steht an oberster Stelle. Dafür sorgen auch regelmässige integrale Tests, bei denen alle Systeme überprüft werden – von den Liftsystemen über die Rauch-Druck-Anlagen bis hin zu den Brandabschnittstüren. «Im Jahr 2023 haben wir die Wohntürme getestet, 2024 ist das Sportgebäude dran», erklärt René Limacher. «Die Zusammenarbeit mit CKW läuft immer sehr unkompliziert. Bei Problemen oder Wartungen sind die Technikerinnen und Techniker schnell zur Stelle.»
René Limacher und Tschuni Köhler sind sich einig, wie wichtig die zuverlässige Funktion der Brandmeldeanlagen ist. «Es gibt uns ein gutes Gefühl, zu wissen, dass die Technik funktioniert und wir auf alles vorbereitet sind», sagt René Limacher abschliessend. Tschuni Köhler stimmt zu: «Wir haben hier ein System, auf das wir uns verlassen können – und das ist das Wichtigste.»
Hand aufs «Hertz»:
Wie gut kennen Sie das Schweizer Stromnetz?
Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!
TEXT SIMON EBERHARD
a) Zwei
b) Fünf
c) Sieben
d) Zwölf Wie viele Netzebenen gibt es?
Die in Hertz (Hz) gemessene Netzfrequenz beschreibt die Anzahl Impulse im Netz pro Sekunde. Wie hoch ist die Netzfrequenz im Schweizer Netz?
a) 50 Hz
b) 180 Hz
c) 230 Hz
d) 870 Hz
Wie lang ist das gesamte Schweizer Stromnetz über alle Netzebenen hinweg? 3.
a) 6700 km
b) 88 000 km
c) 250 000 km
d) 1 Million km 4.
Wie viele Strommasten hat das Schweizer Höchstspannungsnetz?
a) 500
b) 1800
c) 8600
d) 12 000
Lösung 1: c) Das Schweizer Stromnetz umfasst vier Ebenen unterschiedlicher Spannung (Höchst-, Hoch-, Mittelund Niederspannung) sowie drei Ebenen, in denen die Spannung von einer Ebene zur nächsten umgewandelt wird (zum Beispiel in Trafostationen). Das ergibt insgesamt sieben Netzebenen.
Lösung 2: a) Die in Europa einheitliche Netzfrequenz von 50 Hz bedeutet, dass der Strom seine Richtung 50-mal pro Sekunde ändert. Ausnahme ist die SBB, die ihr Bahnstromnetz auf einer Frequenz von 16,7 Hz betreibt.
Lösung 3: c) Mit 250 000 km würde das Schweizer Stromnetz rund sechsmal um die gesamte Erde reichen. Antwort a) ist auch nicht ganz falsch: 6700 km beträgt die Länge des Schweizer Höchstspannungsnetzes.
Lösung 4: d) Das Schweizer Höchstspannungsnetz hat aktuell insgesamt rund 12 000 Strommasten.
Energie sparen ist auch in den Wintermonaten auf verschiedene Weise möglich. Diese Infografik gibt einen Überblick, wo verstecktes Sparpotenzial liegt.
TEXT UND RECHERCHE CELESTE BLANC INFOGRAFIK JACQUELINE MÜLLER

Im Glanz der Lichter
Während der Weihnachtszeit steigt in der Schweiz der Stromverbrauch wegen der Beleuchtung stark an. Studien sprechen von einem Verbrauch von rund 50 Millionen Kilowattstunden pro Jahr – das entspricht einer kleinen Stadt mit 15 000 Haushalten.
Grosses Sparpotenzial liegt bei der Weihnachtsbeleuchtung: Die Glühbirnen der Lichterketten mit LED-Lämpchen austauschen sowie eine getimte Beleuchtungszeit mit Zeitschaltuhr spart viel Energie – und auch Kosten.
Mit 1 Kilowattstunde Strom kann man ... 100 ×
56 l
Um die Hälfte gesenkt
160 l
Ein Vollbad benötigt im Durchschnitt 160 Liter Wasser und 5,7 Kilowattstunden. Bei einer 7-minütigen Dusche mit Sparduschkopf hingegen verbraucht man lediglich rund 56 Liter und 3 Kilowattstunden.
Clever trocknen
Ein Tumbler, je nach Modell, braucht zwischen 2 und 4 Kilowattstunden Strom pro Trockengang. Sparsamer ist das Trocknen im Freien. Das funktioniert bei Sonne und Wind sogar bei Minustemperaturen: Die Wäsche gefriert, danach verdampft das Eis. Wenn die Kleider nicht mehr steif sind, sind sie trocken. Die Wäsche drinnen aufzuhängen, hat wiederum den Nebeneffekt, dass die im Winter meist trockene Luft befeuchtet wird.
Wintersonne nicht unterschätzen
Auch im Winterhalbjahr (Oktober bis März) generiert eine PV-Anlage Strom. Für den Maximalertrag müssen die Panels frei von Laub und Schnee sein.


Backe, backe Kuchen
Anstatt mit Ober- und Unterhitze zu heizen, kann der Ofen mit Umluft 30 Grad tiefer eingestellt werden. Das spart 15 Prozent Energie. Zudem auf Vorheizen verzichten und mehrere Bleche gleichzeitig backen.
Mehr Strom in den Bergen
Alle in der Schweiz installierten PV-Anlagen produzierten 2022 rund 3,8 TWh Solarstrom, 27 Prozent davon im Winterhalbjahr. Wie hoch der Ertrag einer PV-Anlage ist, hängt stark von ihrem Standort ab. Im Winter erreichen Solaranlagen im Mittelland zwischen 10 und 20 Prozent, hochalpine Anlagen hingegen bis zu 50 Prozent ihrer Jahresproduktion
Jährlicher Stromverbrauch
Durchschnittlich verbraucht ein Schweizer 4-PersonenHaushalt pro Jahr rund 5000 kWh (ohne Elektroheizung und elektrische Wassererwärmung).
10 % diverse Kleingeräte
10 % Beleuchtung
13 % Allgemeinstrom (Gebäudetechnik)
16 % Waschen und Trocknen
19 % Elektronik
32 % Kochen, Kühlen, Spülen
Gamen an kalten Winterabenden
Ein Gaming-Computer braucht mehr Energie als ein normaler Computer. So liegt der stündliche Verbrauch eines herkömmlichen Computers zwischen 130 und 150 Wattstunden, bei einem Gaming-PC bei etwa 350 Wattstunden. Sparpotenzial gibt es nach der Gaming-Session: Nach dem Spiel den Netzstecker ziehen, denn im Standby-Modus verbraucht der Gaming-PC nur noch 15 Wattstunden. Noch sparsamer sind klassische Brettspiele.
Stromverbrauch pro Stunde
Die richtige Raumtemperatur
Senkt man die Raumtemperatur um 1 Grad, ergibt das eine Energieeinsparung von 5 bis 6 Prozent. Zwar gibt es die «richtige» Raumtemperatur nicht, aber für jeden Aufenthaltsbereich im Haus gibt es bestimmte Richtwerte.
Das Sporthotel Pontresina macht einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Mit Unterstützung von CKW hat die Besitzerfamilie auf dem erhaltenswerten Haus eine Photovoltaikanlage installiert –mit einer technischen Besonderheit.
TEXT SIMON EBERHARD FOTOS ANDREA FURGER

Grand Old Lady: So nennt die Besitzerfamilie des Sporthotels Pontresina ihr 155-jähriges Haus liebevoll. «Sie benötigt ziemlich viel Pflege», sagt Alexander Pampel. Zusammen
mit seiner Frau Nicole führt er das auf sportliche Aktivitäten spezialisierte Hotel in zweiter Generation, nachdem seine Eltern im Jahr 1982 die Geschicke des altehrwürdigen Hauses übernommen hatten.

Alexander Pampel präsentiert stolz die neuen PV-Module auf dem Dach des Sporthotels. Er führt das traditionsreiche Haus seit rund 25 Jahren.
Der aktuellste «Pflegefall» im Sporthotel betrifft die Sanierung der Fassade und des Dachs. Und im Zuge der Dachsanierung hat sich die Familie Pampel dafür entschieden, eine Photovoltaikanlage zu installieren. «Wir haben drei Kinder und das Glück, eine intakte Natur um uns zu haben», sagt Alexander Pampel. «Wir sehen es deshalb als unsere Pflicht, wirtschaftliche Ziele mit nachhaltigem Handeln zu vereinbaren.»
Administrative und technische Herausforderungen
Dafür nahm die Besitzerfamilie auch einige Hürden in Kauf. Die erste Hürde war bürokratischer Natur. «Das Gebäude ist vom Denkmalschutz als erhaltenswertes Gebäude eingestuft», erklärt Alexander Pampel. «Wir waren die Ersten im Dorf, die auf ein erhaltenswertes Gebäude eine Photovoltaikanlage installieren wollten –also sozusagen ein Präzedenzfall.» Dies hatte einen langwierigen Prüfungs- und Bewilligungsprozess zur Folge.
Altehrwürdiges Gebäude: Die unebene Dachfläche des Sporthotels Pontresina stellte das Projektteam vor einige technische Herausforderungen.

Die zweite Hürde schliesslich war technischer Natur. «Das Hoteldach hat eine ‹ interessante› Gestaltung – es ist sehr uneben», erläutert Alexander Pampel und ergänzt mit einem Schmunzeln: «Den Verantwortlichen für die Installation sind da einige graue Haare gewachsen.»
Senkrechte Module produzieren mehr Strom
Bei diesen Verantwortlichen handelt es sich unter anderem um die Soller Partner AG, eine Tochterfirma von CKW. «Der spezielle Untergrund mit den vielen Unebenheiten erforderte eine spezielle Unterkonstruktion», erinnert sich der Projektleiter Robert Cavegn.
Eine weitere technische Eigenheit besteht darin, dass die Module nicht wie bei den meisten anderen Solaranlagen im 15-Grad-Winkel, sondern senkrecht auf dem Dach zu stehen kommen. «Dies ermöglicht eine höhere Stromproduktion im Winter», erläutert Robert Cavegn. So sind die Module einerseits schneller
schneefrei. Andererseits ist dies auch ein Vorteil, weil sie bifazial sind, also auf beiden Seiten Licht in Strom umwandeln. «Auf diese Weise ist der Stromertrag deutlich höher als bei einer 15-Grad-Aufstellung.»
«Um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen, braucht es immer alle.»
Alexander Pampel
15 Prozent des Strombedarfs gedeckt
Die Photovoltaikanlage ist für das Sporthotel ein weiterer grosser Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Bereits zuvor
hat es unter anderem dank einem Heizungsersatz 100 000 Liter Öl jährlich eingespart. Mit der neuen Anlage auf dem Dach wird das Hotel dereinst 15 bis 18 Prozent seines Strombedarfs selbst decken. Die zweite Etappe der Installation wird nächstes Jahr fertiggestellt. «Zuvor sanieren wir noch die Elektroinstallationen», sagt Alexander Pampel. «Auch diese sind bereits ein wenig in die Jahre gekommen.» Damit wird es auch möglich sein, die künftige Kapazität der neuen Anlage von insgesamt 75 kWp vollständig auszuschöpfen.
Die Zusammenarbeit mit dem Projektteam hat Pampel dabei sehr positiv erlebt. «Um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen, braucht es immer alle», sagt der Direktor. «Ich kann den Handwerkern, den Planern sowie der Bauleitung nur ein Kränzchen winden – alle haben ihren Beitrag geleistet, dass es so speditiv geklappt hat.» Und die Grand Old Lady erhält so einen gehörigen Schub neuer Energie.
CKW spurt vor für die Energiezukunft und schafft 2025 den Hoch- und Niedertarif ab. Ein neuer Leistungstarif belohnt Kunden, die ihre Leistungsspitzen reduzieren. Erfahren Sie, wie das Tarifmodell funktioniert.
TEXT DOMINIQUE MOCCAND FOTOS CHRISTIAN BETSCHART / PHILIPP SCHMIDLI

In der Nacht kostet der Strom wenig, am Tag mehr. Dieses Tarifmodell hat sich über Jahre hinweg bewährt. Es stammt aus Zeiten, in denen nachts überschüssige Kernenergie vorhanden war und mittags am meisten Strom verbraucht wurde. Das ist heute anders. Zukunftstechnologien wie PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität produzieren oder verbrauchen unregelmässig und über den ganzen Tag verteilt Strom. Um diesen effizient zu nutzen, muss das Stromnetz stark und kostspielig ausgebaut werden.

Gleichzeitig wird der Stromverbrauch der Schweizer Bevölkerung in den kommenden Jahren zunehmen. Im Winter verschärfen der Ausbau von Wärmepumpen und die Elektromobilität den Strommangel zusätzlich.
Mit einem neuen Leistungstarif spurt CKW deshalb für das Energiesystem der Zukunft vor. Der Leistungstarif belohnt ab 2025 jene Kundinnen und Kunden, die ihre Leistungsspitzen reduzieren, Strom gezielter nutzen und dadurch das Netz nicht unnötig belasten. Wir zeigen, wie das funktioniert.
Leistung reduzieren oder Bezug staffeln
Mit dem Leistungstarif wird die höchste während 15 Minuten beanspruchte mittlere Leistung (kW) im Monat gemessen und mit 1.50 Franken/kW in Rechnung gestellt. Das heisst, je gleichmässiger der Strombezug ist, desto geringer fallen die Leistungskosten aus.
Der neue Leistungstarif von CKW bietet also einen Anreiz, Verbraucher mit hohem Stromkonsum – zum Beispiel Backofen, Tumbler, Wärmepumpe oder das Laden des Elektroautos – zeitlich gestaffelt oder mit reduzierter Leistung zu nutzen.

Das neue Tarifmodell belohnt Kundinnen und Kunden, die Geräte mit hohem Stromkonsum zeitlich gestaffelt oder mit reduzierter Leistung nutzen, also zum Beispiel das Auto langsamer laden.
CKW lädt alle interessierten Kundinnen und Kunden zu einer Informationsveranstaltung zum neuen Leistungstarif ein. CKW-CEO Martin Schwab gibt einen Einblick in die Herausforderungen der Energiezukunft und erklärt das neue Tarifmodell. Im Anschluss laden wir Sie herzlich zum Apéro und zum Austausch mit Expertinnen und Experten von CKW ein.
Termine
– Montag, 10. Februar 2025, 17.30 Uhr – Donnerstag, 13. Februar 2025, 17.30 Uhr
Die Veranstaltung findet am CKW-Sitz in Rathausen und virtuell per Videostream statt.
Jetzt anmelden ckw.ch/event-tarifmodell
Zwei Beispiele:
– Waschmaschine, Backofen und Staubsauger erzeugen, wenn sie zeitgleich genutzt werden, eine Leistungsspitze von rund 6 kW Strom. Diese Leistungsspitze kostet Sie 9 Franken pro Monat (6 kW × 1.50 Franken). Backen Sie Ihren Kuchen nun zu einem anderen Zeitpunkt, als Sie waschen und staubsaugen, reduziert sich Ihr Stromverbrauch um 2 kW. Sie sparen somit 3 Franken (2 kW × 1.50 Franken).
– Sie laden Ihr Elektroauto normalerweise mit einer Leistung von 22 kW. Reduzieren Sie die Ladeleistung auf 11 kW, verlängert sich zwar die Ladezeit, dafür reduziert sich Ihre Leistungsspitze. So sparen Sie 16.50 Franken pro Monat (11 kW × 1.50 Franken).
Nebst Geräten, die Wärme erzeugen, sind auch Geräte, die viel Kraft benötigen, stromintensiv. Im Gewerbe und in der Landwirtschaft sind das zum Beispiel elektrische Sägen, Hobel- und Schleifmaschinen, Fräsen, Jauchepumpen oder Heugebläse. Auch diese Geräte sollten idealerweise zeitlich versetzt oder nicht auf voller Leistung eingesetzt werden.
Solarstrom: Eigenverbrauch lohnt sich Für Betreiberinnen und Betreiber von PV-Anlagen lohnt sich mit dem neuen Leistungstarif ein möglichst hoher Eigenverbrauch gleich doppelt: Der eigene Solarstrom ist der günstigste, und innerhalb der eigenen Produktion entstehen keine Lastspitzen. Zudem bezahlen PV-Produzentinnen und -Produzenten fürs Einspeisen ihres überschüssigen Stroms keinen Leistungstarif – lediglich für den Bezug von Strom aus dem Netz. Nach wie vor gilt: Die wirksamste Massnahme, um Strom zu sparen, ist, weniger Strom zu verbrauchen. Unabhängig davon, wie das Tarifmodell aussieht.
Mehr erfahren
ckw.ch/video-leistungstarif
CKW senkt die Strompreise per 2025 deutlich und präsentiert ein neuartiges Tarifmodell für das Energiesystem der Zukunft.
CKW kann ihre Tarife per 2025 stark senken. Für Privatkunden wird Strom rund 30 Prozent günstiger, für Geschäftskunden rund 26 Prozent. Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt spart 2025 gegenüber dem Vorjahr rund 400 Franken pro Jahr, ein KMU in der Grundversorgung mit mittlerem Stromverbrauch knapp 12 000 Franken pro Jahr.
Um die Strompreise für die grundversorgten Kundinnen und Kunden festzulegen, hält sich CKW an die regulatorischen Vorgaben des Stromversorgungsgesetzes (StromVG), der Stromversorgungsverordnung (StromVV) und der Regulierungsbehörde ElCom. Dabei werden drei Komponenten berücksichtigt: – Preis für die Energielieferung – Preis für die Netznutzung und die Winterreserve – Preis für allgemeine Abgaben
In die Preisberechnung für die Energielieferung fliessen sowohl die Gestehungskosten der eigenen Produktion und der langfristigen Bezugsverträge als auch sämtliche von CKW getätigte Energiekäufe zu Marktpreisen mit ein.
Die internationalen Marktpreise für Energie haben sich seit dem Höchststand von 2022 / 2023 deutlich erholt, womit auch die Beschaffungskosten von CKW spürbar gesunken sind. Im Tarifjahr 2024 wird voraussichtlich ein grösserer Abbau der bestehenden Unterdeckung resultieren, als dies bei der Festlegung der Tarife 2024 erwartet wurde. So werden die Deckungsdifferenzen aus 2021 / 2022 voraussichtlich per Ende Tarifjahr 2024 zum überwiegenden Teil
abgebaut sein. Die Kosten der eigenen erneuerbaren Produktion (hauptsächlich Wasserkraft) werden im Tarifjahr 2025 voraussichtlich leicht ansteigen, während die Produktionskosten aus Kernkraft voraussichtlich tiefer liegen werden als im Rahmen der Tarifierung 2024 prognostiziert.
Nebst den deutlich tieferen internationalen Marktpreisen für Energie ermöglichen weitere positive Effekte eine starke Tarifsenkung: Sowohl die Netzkosten von CKW wie auch jene der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid fallen tiefer aus. So weist der Netzbereich von CKW tiefere Kapitalkosten und geringere Kosten für die Wirkverluste auf. Auch fallen aufgrund des Abschlusses des Smart-Meter-Rollouts entsprechende Installationskosten weg. Zudem sinken die Kosten für die Winterreserve des Bundes von bisher 1,20 Rp. / kWh auf neu 0,23 Rp. / kWh wegen vornehmlich deutlich tiefer erwarteter Kosten für die Wasserkraftreserve über die Wintermonate. Diese und weitere Massnahmen hatte der Bund für den Fall einer Strommangellage eingeführt.
Neues, innovatives Tarifmodell Je nach Verbrauchstyp sind die Einsparungen sogar noch grösser. Denn CKW passt das veraltete Tarifmodell an, um die Energiewende zu ermöglichen. Der Hoch- und der Niedertarif zu Tages- und Nachtzeiten fallen weg. Weiter schafft CKW mit einem neuen Leistungstarif Anreize, das Netz nicht mit hohen Leistungsspitzen zu belasten. Denn diese verursachen einen aufwendigen, teuren Netzausbau, der von allen Kundinnen und Kunden bezahlt werden muss.
Standard <50 000 kWh / a
Einheit
Tarife 2024
Energie: CKW
ClassicStrom D Netz: CKW Netz D
Tarife 2025
Energie: CKW
ClassicStrom Netz: CKW Netz E
zur Förderung erneuerbarer Energien
Abgabe an Gemeinde 10 % auf Netznutzung, individuell Rp. / kWh bei einzelnen Gemeinden
Business Standard
>50 000 kWh / a
Abgabe zur Förderung erneuerbarer Energien
Abgabe an Gemeinde 10 % auf Netznutzung, individuell Rp. / kWh bei einzelnen Gemeinden
Alle Preise exkl. MWST
Der Sicherungskasten beherbergt alle wichtigen Schutzeinrichtungen für Personen und Installationen im Gebäude. Damit die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist, gibt es im Alltag einiges zu beachten, wie unsere fünf Tipps zeigen.
Kunststoffe verbannen
Man kennt es von Polyester-Pullovern: Einige Kunststoffe können statische Elektrizität erzeugen, beispielsweise durch Reibung. Lagern Sie deshalb keinen Kunststoff in der Nähe Ihres Sicherungskastens. Denn bei der Entladung können elektrische Bauteile beschädigt werden.
Trocken bleiben
Feuchte Materialien beeinträchtigen die Isolierung der elektrischen Leitungen. Das kann zu Kurzschlüssen und elektrischen Schlägen führen. Achten Sie deshalb darauf, dass die Räume, in denen sich Sicherungs- oder Anschlusskästen befinden, trocken bleiben.
Ordnung halten
Der Sicherungskasten muss frei zugänglich sein. Ist der Raum mit anderen Objekten überfüllt, steigt gerade bei einem Stromausfall die Stolpergefahr, was zu Unfällen führen kann. Halten Sie deshalb Ordnung im und auf dem Weg zum Sicherungsraum.
Gründlich putzen
Das Gemisch von Luft und Staub ist explosionsfähig. Geben Sie aus diesem Grund dem Staub im Umfeld des Sicherungs- oder Anschlusskastens keine Chance und halten Sie dieses genauso sauber wie den Rest Ihrer Wohnung.
Sicher lagern Brennbare Materialien in der Nähe elektrischer Anlagen bergen die Gefahr einer Funkenbildung oder Überhitzung. Lagern Sie solche Materialien darum niemals in der Nähe von elektrischen Installationen.
Einfach mitmachen
Füllen Sie das Online-Formular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der untenstehenden Preise. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2025.
ckw.ch/meine-energie
Alternativ können Sie uns auch eine Postkarte schicken an: Redact Kommunikation AG, Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Rätseln!
Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Lösungswort der letzten Ausgabe war «Bohrloch».

Geniessen Sie mit einer Begleitperson eine Übernachtung im stilvollen Arvenholzzimmer mit Balkon in Zermatt. Beginnen Sie mit einem tollen Walliser Frühstücksbuffet im zentral gelegenen *** Hotel Derby einen erlebnisreichen Tag am Fusse des Matterhorns.
Gesamtwert des Preises: 348 Franken Hotel Derby, 3920 Zermatt, derbyzermatt.ch
Über den Wolken
Erleben Sie zu zweit einen erlebnisreichen Ausflug auf den 3089 Meter hohen Gornergrat. Von dort haben Sie den schönsten Blick aufs Matterhorn und auf weitere 28 Viertausender.
Gesamtwert des Preises: 192 Franken
Gornergrat Bahn, 3920 Zermatt, gornergrat.ch



Schön mit Kafi
Lassen Sie sich verwöhnen mit der Facial Box bestehend aus Gesichtspeeling/-maske, Gesichtsserum und -creme – alle Produkte enthalten recycelten Kaffeesatz. Natur pur und erst noch nachhaltig hergestellt.
Gesamtwert des Preises: 75 Franken
RRREVOLVE Fair Fashion & Eco Design, Zürich und Bern, rrrevolve.ch

ckw.ch/elektroprofis