









Gruppe, wie den Digitalen Staat, den Europäischen Polizeikongress, die PITS und die Berliner Sicherheitskonferenz. Zahlreiche Expertinnen und Experten haben Fortbildungen der Führungskräfteakademie besucht und Zertifikate erhalten.
Druckreife
dem er Wissen weitergibt. Er prüft Informationen, falsifiziert, stellt Zusammenhänge her und bewertet diese.
„40
Macht der Wahrheit. Denn nicht jeder differenziert nach Wirklichkeiten und der Gesetzgeber unternimmt zu wenig, um dem entgegenzuwirken.
Analog im Digitalen
Frisch gedruckt – Vorsicht Tinte (BS/Dr. Eva-Charlotte Proll) Der Behörden Spiegel ist gewachsen an und mit seinen Leserinnen und Lesern. Die Zeitung verdankt ihre Existenz den Bediensteten und Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und ihren Gründern, zwei Menschen mit Vision. Die erste gedruckte Auflage des Behörden Spiegel erschien am 15. April 1985. Damals händisch und in kleiner Auflage in Bonn vor den Regierungsbehörden verteilt, lauteten Vision und Auftrag der Gründer gleichermaßen, Leitmedium für den Öffentlichen Dienst zu werden. Vier Dekaden später ist die Marke Behörden Spiegel nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag vieler Behörden.
Die Zeitung ist mit einer Druckauflage von 101.000 Exemplaren monatlich die auflagenstärkste unabhängige Zeitung für den Öffentlichen Dienst in Deutschland. Allein 10.000 Teilnehmende besuchen jährlich die großen in Berlin stattfindenden Veranstaltungen der
Auf das beste Alter im Leben blickt der Mensch selbst meistens nur im Rückblick und schwelgt in Erinnerungen. Nur der Lebenskünstler vermag es, das beste Alter als jenes anzusehen, in dem er sich grade befindet. Und beim Behörden Spiegel? Sind 40 Jahre Existenz eines Printmediums jene, wo es seine Reife erreicht hat?
Adressfeld
Es sind bewegte Zeiten, in denen durch digitale Großkonzerne individuelle Geschichten und Bilder via Social Media um die Welt gehen, ohne einem Faktencheck unterlaufen zu sein. Es gab Zeiten, in denen der gedruckte Journalismus vor der Herausforderung der Bewegtbilder stand, es gab die scheinbare Bedrohung durch den Online-Journalismus, der plötzlich nur noch Überschriften nach potenziellen Klicks hervorbrachte. Der Journalist hat heute, wie früher Macht, in-
Jahre Behörden Spiegel bedeuten auch, weiter in die Kraft des gedruckten Wortes zu investieren.“
Einem Thema oder einem Artikel die entsprechende Druckreife zu verleihen, verstehen Journalistinnen und Journalisten aber als Aufgabe oder Kunst, nicht als Macht. Die beim Posten in Sozialen Medien hingegen individualistisch geschaffenen Momentaufnahmen, werden durch Algorithmen in ihrer Informationsweitergabe gesteuert und sind damit eine Herausforderung um die
Hier können Sie die App direkt herunterladen!




Der Fokus liegt beim Behörden Spiegel gleichermaßen seit mehreren Jahren – und nicht erst seit der Corona-Pandemie – auf der Weiterentwicklung digitaler Produkte und Möglichkeiten.
Dem Jubiläum entsprechend hat die Zeitung ihre App relaunched, in der Sie – liebe Leserinnen und Leser – ab sofort auf alle unsere Publikationen, Veranstaltungen und Communities zurückgreifen können. 40 Jahre Behörden Spiegel bedeuten auch, weiter in die Kraft des gedruckten Wortes zu investieren. Denn so wie damals erste Zeitungen verteilt und später verschickt wurden – mit persönlicher Einsatzkraft –so soll die Marke weiter fortgeführt werden: als Familienunternehmen.
Dank
Mein herzlicher Dank geht an die vielen Partner, die den Behörden Spiegel in den vergangenen Jahren begleitet haben! Das betrifft sowohl die langjährigen Weggefährten, die zu Freunden geworden sind und die zahlreichen Behörden, die wir gemeinsam mit Publikationen und Fortbildungen begleiten durften, sowie die zahlreichen Partner und Unternehmen, die Teil unserer Veranstaltungen sind und waren! Auf die nächsten 40 Jahre!

Bündeln statt streuen Knappe Kassen, Personalmangel, Digitalisierung: Wie bleiben Kommunen in Zukunft handlungsfähig und wie gelingt Bürokratieabbau? Seite 13

Regeln im Cyberspace Cyberbotschafterin Maria Adebahr spricht über Cyber-Diplomatie und warum Debunking Desinformation verstärken kann. Seite 31

Im Dienst der Sicherheit Sie engagieren sich als Soldatinnen für die Verteidigung, löschen Brände und leiten polizeiliche Ermittlungen: Warum Frauen in Uniformen trotzdem noch Irritationen auslösen. Seite 35
„Einepositive Fehlerkultur fördert offene Kommunikation und Lernorientierung, indem sie Fehler als Chancen zur Verbesserung betrachtet“, betont Alexander Schweitzer, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz. Der richtige Umgang mit Fehlern unterstütze Mitarbeitende durch Verständnis, implementiere proaktive Maßnahmen zur Fehlervermeidung und ermutige zu Innovation. All das erzeuge ein positives Arbeitsumfeld. In Rheinland-Pfalz wird positive Fehlerkultur in der öffentlichen Verwaltung daher aktiv und mit verschiedenen Instrumenten gefördert. Das beginnt schon beim Onboarding neuer Mitarbeitender. In einem Patenmodell werden Wissen und Erfahrung transparent geteilt. Das sorge dafür, dass Fragen gezielt adressiert und Fehlerquellen vermieden werden könnten, heißt es aus der Staatskanzlei RheinlandPfalz. Zudem bieten strukturierte Kooperations- und Fortbildungsgespräche Raum für offenen und vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe sowie für Gespräche über Verbesserungen und die dazu erforderlichen Werkzeuge.
Wenn der falsche Weg der richtige ist
(BS/Ann Kathrin Herweg) Fehler sind keine Schwäche, sie bieten Entwicklungspotenzial. Das zu verstehen, scheint leicht, es zu leben und Fehler offen zuzugeben, fällt häufig deutlich schwerer. Doch es gibt hilfreiche Ansätze, um eine gute Fehlerkultur zu etablieren – sogar in der hierarchieliebenden öffentlichen Verwaltung.
Auch die internen Führungsgrundsätze sollen helfen: Führungskräfte agieren durch ihren offenen Umgang mit eigenen Fehlern als Vorbilder für ihre Kolleginnen und Kollegen. Regelmäßige Teamreflexionen und Feedback-Runden fördern die Kommunikation untereinander.
„Wir setzen auf ein gutes System des Miteinanders“, so Schweitzer Die genannten Maßnahmen seien dafür grundlegend.
Win-Win-Situation
Eine gute Fehlerkultur in der öffentlichen Verwaltung erkennt man laut Prof. Dr. Michael Leyer an drei Faktoren. Zum einen müssen die Erfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern mit Verwaltungsleistungen aktiv und systematisch erfasst und für die Verbesserung der Pro-

im Idealfall, diesen nicht noch einmal zu machen. Foto: BS/Unitas Photography, stock.adobe.com
zesse genutzt werden – schließlich bestimmen diese, was ein Fehler ist. Zum anderen braucht es eine Arbeitsatmosphäre, in der alles konstruktiv kritisiert und hinterfragt werden darf. Der dritte Faktor
Im Dienst für gesellschaftlichen Zusammenhalt
lautet schlicht: Fehler müssen erlaubt sein.
Organisationen ist, das mit anderen Themen interagiert und z. B. von etablierten Denkweisen beeinflusst wird, so Leyer. Darüber hinaus ist sie meist auf inkrementelle Verbesserungen in Prozessen bezogen und hindert damit den Blick auf größere Veränderungen, die meist mit Technologien zu ganz anderen Prozessen führen.
Die Tatsache, dass Verwaltungsprozesse an den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern vorbeigehen, wird ebenfalls nicht berücksichtigt. „In jedem Fall sollte es eine übergeordnete Strategie geben, in deren Rahmen Fehler adressiert werden“, fordert er.
Kleine Schritte
Die drei entscheidenden Fragen, die für die Zukunft beantwortet werden müssen, sind also: Welche Aufgaben soll der Öffentliche Dienst zukünftig noch erfüllen? Wie können diese Aufgaben effizient erledigt werden? Und: Wie kann die Verwaltung das dafür notwendige Personal gewinnen und halten?
KI kann echte Entlastung bringen Der öffentliche Sektor erlebt in den letzten Jahren einen enormen Aufgabenzuwachs. Die Beschäftigten müssen mehr Aufträge erfüllen, mehr Verordnungen berücksichtigen und mehr protokollieren. Das lähmt und sorgt für Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die Politik muss effektiv Bürokratie durch Überregulierung abbauen und den Beschäftigten mehr Spielraum bei den Entscheidungen lassen. Aufgabenkritik, Praxistests für neue Gesetze und die Evaluierung alter Gesetze müssen die neuen Mantras werden. Digitalisierung und KI werden den Öffentlichen Dienst der Zukunft prägen. Diese Technologien können auch dazu beitragen, den Arbeitskräftemangel zu lindern. Gewarnt sei an dieser Stelle allerdings vor überzogenen Erwartungen – Digitalisierung und KI sind kein Allheilmittel. Für den Deutschen Beamtenbund und Tarifunion (DBB) liegt das größte Potenzial dieser Technologien in der Entlastung von Mitarbeitenden im Öffentlichen Dienst, die überall dort greifen kann, wo kleinteilige Routineprozesse anfallen. Dadurch haben die Beschäftigten mehr Zeit für andere Aufgaben. Die Mitarbeitenden in der öffentlichen Verwaltung müssen auch auf
die Veränderungen, Unsicherheiten und Komplexitäten der Arbeit unter den Bedingungen der Digitalisierung vorbereitet werden. Die Anforderungen an Erreichbarkeit, Schnelligkeit, Transparenz und Servicequalität sind gerade durch die Möglichkeiten der Digitalisierung erheblich gestiegen. Zugleich muss Verwaltungshandeln weiter rechtssicher, verlässlich, nachvollziehbar und am Gemeinwohl orientiert sein.
Neue Kompetenzen fallen nicht vom Himmel
Die Digitalisierung der Verwaltung wird nur erfolgreich sein, wenn alle Mitarbeitenden über entsprechende Kompetenzen und Qualifikationen verfügen. Das erfordert neben der Beherrschung grundlegender ITund Medienkompetenzen zusätzlich die Ausbildung neuer bzw. veränderter Kompetenzen. Diese fallen aber nicht vom Himmel, sondern müssen in grundständigen Studiengängen und Berufsausbildungen erlernt und vor allem im Berufsleben ständig weiterentwickelt werden.
Bei der Arbeit mit KI muss das Ziel sein, dass alle Mitarbeitenden zumindest über ein Grundverständnis über die Funktionsweise, Vorteile und Risiken von KI-Systemen verfügen. Daher brauchen wir weitere Investitionen in die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Für die digitale Transformation sind Fort- und Weiterbildung genauso wichtig wie eine angemessene sachliche Ausstattung.
Woher kommt das Personal für die neue Technik?
Die Verwaltung muss im Blick behalten, dass sich auch der Arbeitsmarkt stark wandelt. Mittlerweile sind es nicht mehr die Arbeitnehmer, die um einen Arbeitsplatz buhlen müssen. Es sind die Arbeitgeber, die im harten Wettbewerb um den Nachwuchs stehen. Der Öffentliche Dienst muss dringend attraktiver werden, um Nachwuchskräfte zu finden und das bestehende Personal zu halten. Nur dann kann er
auch von den neuen Technologien profitieren.
Im Kampf um die besten Fachkräfte hat der Öffentliche Dienst seit jeher schlagkräftige Argumente, wie die Sinnhaftigkeit und Sicherheit der Tätigkeit auf seiner Seite. Die Kolleginnen und Kollegen sind Menschen im Dienst der Menschen und setzen sich mit ihrer Arbeit für das Gemeinwohl ein.
(BS/Ulrich Silberbach) Der Öffentliche Dienst steht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor zahlreichen großen Veränderungen: Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Digitalisierung und KI – um nur ein paar zu nennen. Der Schlüssel, diese multiplen Transformationen zu bewältigen, ist die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten. Dazu müssen schon jetzt die nötigen Schritte in Richtung Zukunft gemacht werden. Grundsätzlich gilt: Der Öffentliche Dienst braucht engagierte Menschen, um zu funktionieren – heute wie in 40 Jahren. Er leidet unter einem eklatanten Arbeitskräftemangel. Schon jetzt fehlen 570.000 Beschäftigte. In den kommenden 20 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Das bedeutet einen Verlust der Hälfte der aktuell Beschäftigten.
Der große Knackpunkt betrifft die Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen. Ein auskömmliches Gehalt im Öffentlichen Dienst muss sichergestellt werden, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig bleiben zu können. Aber auch die Arbeitszeitgestaltung muss mit der jeweiligen Lebenssituation der Beschäftigten vereinbar sein. Sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigte profitieren von guten Arbeitszeitmodellen. Überzeugt von diesem Mehrwert ist der DBB in der Einkommensrunde Anfang des Jahres für die dringend benötigte Flexibilität eingetreten. Der DBB erwartet, dass in der nun beginnenden neuen Legislaturperiode die Politik ein klares Bekenntnis zu einem verlässlichen und modernen Staat abgibt. Es wird entscheidend darum gehen, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Öffentlichen Dienstes dauerhaft zu sichern.
Ob im Jahr 2025, 2050 oder 2100: Der Öffentliche Dienst ist und bleibt ein Garant für rechtsstaatliche und sichere Verhältnisse in Deutschland. Der Staat der Zukunft erledigt seine Aufgaben schnell und effektiv und verfügt über eine gut ausgestattete Infrastruktur. Er wird auch in Zukunft Dienstleister und Multiplikator für gesellschaftlichen Zusammenhalt zugleich bleiben. Das ist sicher.

Ulrich Silberbach ist Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbund und Tarifunion.
Foto: BS/Andreas Pein
„Durch eine gute Fehlerkultur kann eine entspanntere Arbeitsumgebung geschaffen werden“, so der Professor für Digitalisierung und Prozessmanagement an der Philipps-Universität Marburg. Dann sind Mitarbeitende zufriedener und in der Folge auch die Bürger, weil ihre Anliegen besser und schneller bearbeitet werden. Wo Fehlerkultur gelebt wird, wird die Grundlage für weitreichendere Veränderungen z. B. in Richtung Digitalisierung gelegt.
Fehlerkultur hat jedoch auch ihre Grenzen – insbesondere dadurch, dass Fehlerkultur nur ein Thema in
Leyers Tipp für Beschäftigte, die eine gute Fehlerkultur in ihrer Behörde etablieren wollen: einen langen Atem haben. Das System der öffentlichen Verwaltung basiert auf einer langen Tradition der Bürokratie, die sich eher an Hierarchie und der korrekten Abarbeitung von Vorgängen nach Vorgaben orientiert. „Das Umdenken dauert, kann aber durch einige Maßnahmen gefördert werden.“ Es braucht zunächst Personen, die das Thema mittragen. Diese müssen vorab mit den nötigen Konzepten und Methoden dafür ausgestattet werden. Leyer rät dazu, mit kleinen Maßnahmen zu beginnen, die bei den Prozessverantwortlichen liegen. Die positiven Effekte können dann anderen Mitarbeitenden transparent gemacht werden, bei diesen auf Interesse stoßen und anschließend größere Themen angegangen werden.

–Tägliche News rund um den Public Sector – Vernetzen Sie sich zu aktuellen Themen und erstellen Sie Ihren individuellen Newsfeed – Direkter Zugriff auf Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts und vieles mehr







Ist Reisezeit Arbeitszeit? Eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie mit einer Dienstreise umzugehen ist. Die Wahl des Verkehrsmittels ist eine Weitere. Die entscheidendste Frage aber ist, ob eine Dienstreise notwendig ist?
Getrennte Dienstsitze Von Außeneinsätzen und Fortbildungsreisen einmal abgesehen, häufen sich jene Dienstreisen, die zwischen den Standorten der eigenen Behörde oder zu anderen Behörden getätigt werden. Dies betrifft die nach wie vor bestehende Trennung der Erst- und Zweitdienstsitze der Bundesministerien durch das Berlin-/Bonn-Gesetz. Schließlich waren 1991 nach Beschluss zur Verlegung der Hauptstadt viele Bundesministerien plötzlich an zwei Standorten gleichzeitig anzufinden und etwaiger Besprechungsbedarf zwischen den Beschäftigten blieb bestehen. Das viel diskutierte und kritisierte Hin- und Herreisen von Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wird dabei fast genauso lange diskutiert. Doch mit Technologien wie Videokonferenzen werden die trennungsbasierten Dienstreisen zwischen Berlin und Bonn zunehmend weniger. Zusätzlich sind Dienstreisen nur insoweit genehmigungsfähig, als sie unmittelbar mit der Ausübung einer konkreten dienstlichen Tätigkeit verbunden sind, erklärt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auf Nachfrage.
Trotz moderner Technologien bleiben Reisen zwischen Standorten bisweilen nötig und sinnvoll. Das betrifft nicht nur die Standorte der geteilten Ministerien in Bonn und Berlin, sondern weitere Zweigstel-
Während Tagungen und Kongresse früher oft als reine Pflichtveranstaltungen galten, sind sie heute interaktive Plattformen für Innovation, Wissenstransfer und politische Gestaltung. Berlin hat sich dabei als bedeutender St andort für Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) etabliert – eine Entwicklung, die das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin aktiv mitgestaltet.
Die Rolle Berlins als MICEDestination
Der MICE-Report 2024 der Event Inc Group zeigt, dass über 90 Prozent der Unternehmen im kommenden Jahr mehr oder gleich viele Events planen. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Relevanz von Konferenzen und Fachveranstaltungen – auch im behördlichen Umfeld. Ein Beispiel ist der Berlin Tourism & MICE Summit, der am 15. November 2024 im Gasometer auf dem EUREF-Campus stattfand. Er verdeutlichte, wie Nachhaltigkeit und Innovation zentrale Aspekte der Eventplanung sind. Als etablierter Veranstaltungsort für Behördenund Verwaltungsveranstaltungen verbindet das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin moderne Infrastruktur mit nachhaltigen Konzepten und einem erfahrenen Event-Team, wodurch es eine bevorzugte Adresse für Fachveranstaltungen in Berlin ist.
Flexibilität und Raum für Ideen
Moderne Veranstaltungen erfordern eine vielseitige Raumgestaltung und technische Ausstattung. Das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin bietet 37 flexibel kombinierbare Konferenzräume auf 4.400 Quadratmetern, einen
Dienstliche Außeneinsätze besser managen
(BS/Sven Rudolf) Mit voranschreitender Digitalisierung nimmt die Bedeutung von Dienstreisen ab, vollständig vermeiden lassen sie sich nicht, auch nicht im Öffentlichen Dienst. Während es bei Dienstreisen früher um die Wirtschaftlichkeit ging, spielt Nachhaltigkeit mittlerweile ebenfalls eine wichtige Rolle, wird doch anhand derselben entschieden, welche Reisemittel genutzt werden.

Mit der geplanten Verbesserung des Bahnnetzes kann die umweltfreundliche Dienstreise in Zukunft hoffentlich auch sehr viel entspannter gestaltet werden. Foto: BS/pattilabelle, stock.adobe.de
len, die unter anderem in den neuen Bundesländern eröffnet wurden.
Travel-Management Jede Dienstreise bringt dabei einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich. Um diesen möglichst gering zu halten, hat der Bund das freiwillige Einkaufsmanagement (Travel-Management) etabliert. Das Travel-Management-System verfolgt dabei vier konkrete Ziele: erstens die Bündelung der Nachfrage und Optimierung des Reise-
einkaufs, zweitens eine Prozessoptimierung der Reiseplanung und Buchung, drittens Sicherung von Qualität und Kundenservice und viertens Kundenzufriedenheit. Der modulare Aufbau des Systems soll Flexibilität für teilnehmende Institutionen herstellen, so können sie beispielsweise auch eigene Buchungen vornehmen.
Die operative Abwicklung der Reisebuchung und Reisekostenabrechnung wird überwiegend entweder über zentrale Reisestel-
len in den jeweiligen Institutionen umgesetzt oder von spezialisierten Dienstleistungszentren übernommen. Die Aufgabenbündelung bei diesen zentralen Dienstleistenden führt zu geringeren Aufwänden, erhöhter Serviceorientierung und Synergieeffekten. Damit verbunden ist zudem eine Bearbeitung durch Spezialistinnen und Spezialisten, auch sollen bestehende Prozesse optimiert werden. Somit fördere das System aus Sicht des Bundesinnenministerium ebenfalls den Bürokratieabbau in den Institutionen.
Ständige Optimierung
Die drei in das Travel-Management integrierten externen Dienstleistungen (Reisebürovertrag, Kreditkartenvertrag und Workflow) werden bei Neuausschreibungen immer auf ihre Digitalisierungspotenziale geprüft. Entsprechende Punkte fließen dann in die Verhandlungen ein, wie etwa die Prüfung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. Zurzeit befinden sich der Kreditkartenvertrag des Bundes und der Vertrag für einen neuen Workflow in einem Vergabeverfahren. Der Reisebürovertrag wurde gerade erst neu verhandelt. Im Sinne der weiteren Prozessoptimierung läuft aktuell ein Pilotprojekt für bürokratiearme neue Buchungs- und
Wandel, Innovation, erfolgreiche Veranstaltungen
(BS) Gemeinsam gewachsen: Behörden, Veranstaltungen und das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin als führende Adresse für Kongresse und Tagungen. Seit vier Jahrzehnten begleitet der Behörden Spiegel die Entwicklungen in Verwaltung und Politik – eine Zeit großer Veränderungen im Veranstaltungswesen.

Ballsaal für bis zu 1.200 Gäste sowie zwei LKW-Lastenaufzüge mit einer Tragkraft von jeweils 30 Tonnen, die vielfältige Veranstaltungsformate ermöglichen.
„Wir möchten Veranstaltern und Gästen eine Umgebung bieten, die produktive Meetings und einen gelungenen Austausch optimal fördert“, sagt Yavuz Yetgin, Cluster General Manager des Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin. „Unsere Räumlichkeiten sind vielseitig nutzbar und mit modernster Technik ausgestattet.“
Ein Standort mit Bedeutung
Berlin ist ein bedeutender Standort zahlreicher Fachkonferenzen, politischer Events und hochkarätiger Fachtagungen. Dazu zählt
der Kongress Digitaler Staat, der regelmäßig hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung zusammenbringt. Eine weitere bedeutende Veranstaltung ist die Berlin Security Conference (BSC), die am 18. und 19. November 2025 bei uns stattfinden wird. Diese Konferenz, gemeinsam organisiert von Behörden Spiegel und dem Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin, vereint führende Experten aus Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie internationalen Institutionen und trägt maßgeblich zum politischen Diskurs bei. „Die steigende Zahl hochkarätiger Veranstaltungen in unserem Haus zeigt, wie sehr Berlin als MICE-Destination geschätzt wird“, ergänzt
Beschaffungswege. Zur Messung der Zielerreichung werden mithilfe von anonymisierten Daten Kennzahlen zu verschiedenen Aspekten entwickelt und auf ihre Einhaltung überprüft.
CO2-Bilanz
Eine wichtige Kennzahl, die dabei geprüft wird, ist die Frage der Nachhaltigkeit von Dienstreisen. Immerhin sind Dienstreisen ein wichtiger Aspekt für die Bundesverwaltung bei der Reduzierung der CO2-Eigenbilanz. Ein Ziel, das im Rahmen der mit dem Bundesklimaschutzgesetz beschlossenen Klimaneutralität bis 2030, von Bedeutung ist. So hat man schon vor Jahren bei der Bahn die sogenannten grünen Fahrkarten durchgesetzt. Eben diese garantieren eine emissionsfreie Fahrt, da der Strom für die Fahrten ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Damit greift das Travel-Management des Bundes auf die Möglichkeiten des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) zurück. Das BRKG ist aktuell auch die einzige rechtliche Möglichkeit, bundesweite Vorgaben zur Nachhaltigkeit von Dienstreisen festzulegen. Kriterien der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit sind dabei bereits seit 2021 in dem Gesetz verankert. So können Mehrkosten, die durch ein umweltverträgliches Reisen entstehen, in einem verhältnismäßigen Rahmen erstattet werden. Auch wenn in diesem Zusammenhang Bahnfahrten priorisiert wurden, soll die Nutzung von Elektro-Mietfahrzeugen möglich werden. Schließlich ist die Bundesverwaltung aktuell auch damit beschäftigt, ihre Fuhrparks für eine neutrale Klimabilanz umzusetzen.
ADVERTORIAL
Janka Altmann, Director of Convention & Event Sales des Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin. „Wir freuen uns darauf, Veranstaltern aus dem behördlichen Umfeld ein professionelles Umfeld mit maßgeschneiderten Lösungen zu bieten.“ Diese Kongresse zeigen die Bedeutung des Hotels für öffentliche Institutionen. Zudem setzt unser Haus auf ressourcenschonende Konzepte und ist zertifizierter Partner nachhaltiger Eventformate.
Besondere Atmosphäre Neben den offiziellen Programmpunkten spielen informelle Gespräche eine entscheidende Rolle. Das Hotel bietet dafür verschiedene gastronomische Angebote, darunter die mit einem MichelinStern ausgezeichnete Skykitchen und die Loft14 Bar mit Blick über Berlin – ideale Orte für Networking und Austausch.
Moderne meets Komfort Mit 557 Zimmern, Spa-Bereich und guter Anbindung ans Zentrum bieten wir optimale Veranstaltungsbedingungen und Komfort. Die K ombination aus moderner Ausstattung, guter Erreichbarkeit und nachhaltigem Konzept macht das Hotel zu einem verlässlichen Partner für Kongresse und Tagungen.
Eine verlässliche Adresse Ob Fachkonferenz, Behördentagung oder Branchenevent –
das Vienna House by Wyndham Andel’s Berlin bietet passende Räumlichkeiten und professionelle Unterstützung für vielfältige Veranstaltungsformate. Mit flexiblen Raumkonzepten, moderner Technik und einem erfahrenen Team bietet das Hotel Veranstaltern optimale Bedingungen für erfolgreiche Veranstaltungen. Eine bewährte Zusammenarbeit für die Zukunft
Als langjähriger Partner gratulieren wir dem Behörden Spiegel herzlich zum 40. Jubiläum und blicken gemeinsam auf eine bewegte Geschichte zurück. Die Jahrzehnte zeigen die enge Verbindung zwischen Behörden und Veranstaltungsbranche – eine Partnerschaft, die sich stetig an neue Herausforderungen anpasst und auch in Zukunft entscheidend dazu beiträgt, Wissen, Innovationen und politische Impulse zu fördern.

Das BAMF ist mit seiner Zentrale in Nürnberg und rund 50 Außenstellen das bundesdeutsche Kompetenzzentrum für Asyl, Migration und Integration. Im Jahr 2016 wurde bei den Asylverfahren der historisch höchste Wert mit knapp 746.000 Anträgen erreicht. Insgesamt bewegen sich die Asylantragszahlen seit 2014 auch im europäischen Vergleich auf einem hohen Niveau. Dazu kommt ein wachsendes Aufgabenspektrum unseres Amtes im Bereich der Integration, Rückkehr und Sicherheit. Um diesen Entwicklungen und der hohen politischen Bedeutung des Themas Migration Rechnung zu tragen, musste die Anzahl der Mitarbeitenden insbesondere im Asylbereich schnellstmöglich mitwachsen. Bemerkenswert ist dabei die Aufpersonalisierung bei den dauerhaft beschäftigten Mitarbeitenden seit 2017: Diese Zahl hat sich bis heute mehr als verdoppelt. Zum 1. März 2025 zählten zu unserem Dauerpersonal 8.751 Beschäftigte. Darüber hinaus sind aktuell weitere 581 befristet Beschäftigte sowie 615 Leiharbeitnehmende bundesweit für das BAMF tätig.
Das BAMF ist eine flexible Behörde Um die vorhandenen Personalressourcen effizient zu nutzen und
Wie das BAMF die Asylanfragen stemmt
(BS/Dr. Hans-Eckhard Sommer) Zu einem erweiterten Aufgabenspektrum kam seit 2014 ein massiver Anstieg der Asylantragszahlen hinzu: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat auf diese Herausforderungen in kürzester Zeit mit einer Personalerweiterung reagiert, wie sie wahrscheinlich einzigartig im deutschen Behördenumfeld ist. BAMFPräsident Dr. Hans-Eckhard Sommer beschreibt, welche Strategien die flexible Behörde beim Recruiting und der Personalentwicklung bis heute verfolgt, um auch in Zukunft dem Fachkräftemangel vorzubeugen.
auf kurzfristig eintretende Herausforderungen zeitnah reagieren zu können, wurde das Konzept der flexiblen Behörde eingeführt. Dieses soll einen effizienten Einsatz vieler Beschäftigter, etwa im Asylbereich, ermöglichen, um die optimale gegenseitige Unterstützung der Organisationseinheiten zu schaffen. Zudem bietet die flexible Behörde unseren Mitarbeitenden die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln und Expertise in mehreren Bereichen zu gewinnen.
Qualifizierung und Personalentwicklung
In drei eigenen Qualifizierungszentren des Bundesamtes erhalten die Mitarbeitenden aller Laufbahnen seit 2015 Schulungen zu verwaltungstypischen Kompetenzen, aber auch zu den Kernthemen
Asyl und Integration. Allein im
Jahr 2024 profitierten fast 11.000 Teilnehmende vom Wissensaufbau und der Vernetzung durch das QZ. Einen wesentlichen Erfolgsfaktor stellen dabei die mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aller Fachbereiche dar, die als nebenamtlich Dozierende ihre Expertise und Praxis-Erfahrungen mit anderen teilen.
Die Personalentwicklung in unserem Bundesamt soll die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken und das lebenslange Lernen fördern. Dabei werden nicht nur die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeitenden gestärkt, sondern auch ihre Weiterentwicklung und berufl ichen Aufstiegsmöglichkeiten unterstützt. Dafür stehen unter anderem ein Mentoring-Programm und verschiedene Aufstiegsverfahren bereit. Daneben werden berufsbe-
Braucht es ein Beamtentum 2.1?
(BS/sr) Die jüngsten Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst mit der schließlich per Schlichterspruch erzielen Lösung, haben abermals die Bedeutung des Streikrechts für die Beschäftigten bei soclhen Auseinandersetzungen hervorgehoben und vielerorts spürbar gemacht. Davon unberührt blieben die Beamten, die nicht streiken dürfen, aber dafür andere Privilegien genießen. Ist das aktuelle Beamtenrecht noch zeitgemäß oder braucht es einen Neustart, um Updates zu installieren?

Anders als bei Softewareupdates aktualisiert sich das Beamtenrecht nicht automatisch. Foto: BS/Cagkan, stock.adobe.com
Als Herz und Motor des Öffentlichen Dienstes sind die Beamtinnen und Beamten eines der ältesten Standbeine eines funktionierenden Staates. Im Laufe der Zeit haben sich Vorgaben, Privilegien und Stellung des Beamtentums verändert. So ist zum Beispiel vom Staat gestelltes Wohneigentum, früher üblich, heute eher die Ausnahme als die Norm. Doch es besteht wieder erhöhtes Interesse an bezahlbarem Wohnraum, der für Bundesbedienstete vorgehalten wird.
Anpassungen gefordert Im Zeitalter der Digitalisierung und einer sich ändernden Weltlage tauchen aber Rufe nach einer Aktualisierung oder Anpassung des Beamtentums auf. Auch werden immer wieder Stimmen laut, die eine Abschaffung des Beamtentums als Ganzes fordern oder zumindest eine weitere Angleichung an Tarifbeschäftigte fordern. Ob es nun um Besserstellung, Kosten für den Staat oder andere Regelungen geht, ist dabei nebensächlich. Denn die vermehrten Krisen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass es Beamte und das Treueverhältnis, welches sie zum Staat haben,
gebraucht werden. Wie in vielen Fällen führen Beschwerden und veränderte Wahrnehmungen und Werte aber zu Veränderungen. Das kann systemische, gesellschaftliche oder mit anderen Strukturen des Öffentlichen Dienstes zu tun haben. Überspitzt dargestellt, hat der Beamte von heute mit dem aus der Kaiserzeit nicht mehr viel zu tun.
Gesetzlich vs. privat versichert Bereits seit einigen Jahren wird immer wieder die Wahlfreiheit bei Krankenversicherungen als wichtiges Thema genannt. Zwar steht es Beamten frei, in eine gesetzliche Krankenkasse einzutreten, jedoch ist es mit den finanziellen Zuwendungen für die private Krankenversicherung nur in den wenigsten Fällen günstiger und attraktiv für die Beschäftigten. Ob eine pauschale Beihilfe, wie in Hamburg und andere Bundesländer bereits eingeführt, tatsächlich eine Verbesserung der Situation herbeiführen würde, ist allerdings umstritten. Nach Aussage von Kritikern, würde einer pauschale Beihilfe auf kurz oder lang Menschen mit zusätzlichen Kosten in die Gesetzliche Krankenkasse
treiben. Zu solchen Kosten zählen zum Beispiel die Versicherung für Kinder in der privaten Kasse oder Vorerkrankungen. Dennoch sollte die bisherige Wahlfreiheit auf ihre Zeitmäßigkeit überprüft werden.
Arbeitszeit
Ein weiterer Aspekt des Beamtentums, der unter anderem vom dbb kritisiert wird, ist die Arbeitszeit. Besonders die erhöhte wöchentliche Stundenzahl ,die im Jahr 2006 zu Sparzwecken beschlossen wurde, wird seit langem kritisiert. Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels ist eine baldige Abschaffung der 41-Stundenwoche für Beamte aber eher unwahrscheinlich.
Zu anderen Forderungen rund um das Thema Arbeitszeit hat der Schlichtungsvorschlag der jüngsten Tarifrunde von Bund und Kommunen einige Vorschläge unterbreitet, etwa die Schaffung eines Langzeitkontos auf Betriebsebene. Das eingebrachte Wertguthaben soll für Sabbaticals, eine Verringerung der Arbeitszeit, Freistellungen für Kinderbetreuungen und Pflege verwendet werden können. Beschäftigte und Arbeitgeber können zukünftig auf freiwilliger Basis vereinbaren, dass ab dem Jahr 2026 die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden erhöht wird, maximal für einen Zeitraum von 18 Monaten. Die Beschäftigten erhalten dann das entsprechend erhöhte Entgelt. Auch wenn beide Seiten dem Ergebnis zustimmen, bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen auch auf Beamtinnen und Beamte übertragen werden. Es zeigt sich also, dass ein gewisser Anpassungsbedarf bei Bestimmungen und Rahmenbedingungen immer bestehen wird. Regelmäßige Modernisierungen sind zudem wichtig, um auch für junge Menschen ein interessanter Arbeitgeber zu sein und langjährig Beschäftigte zu halten.
gleitende Studiengänge finanziell gefördert, damit unsere Mitarbeitenden ihre Kompetenzen vertiefen oder neue Qualifikationen erwerben können.
Recruiting – digital und vor Ort Das Bundesamt hat sein Personalmarketingkonzept strategisch auf bewährte und digitale Ansätze ausgerichtet. Den Herausforderungen des Arbeitsmarktes wollen wir als moderner Arbeitgeber begegnen und langfristig ein positives, einheitliches Arbeitgeber-Image aufbauen. Unser Ziel ist es dabei, Fach- und Führungskräfte, Berufseinsteigende und Quereinsteigende anzusprechen. Ein zentraler Baustein sind Messeauftritte und Veranstaltungen, auf denen wir uns mit allen Aufgabenbereichen präsentieren.
Digitale Recruiting-Maßnahmen finden vor allem auf den Plattformen Indeed und LinkedIn statt. Auch Social Media spielt eine wichtige Rolle: Auf Instagram gewähren Mitarbeitende Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Dazu kommen klassische Maßnahmen wie Plakatkampagnen in Metropolregionen und eine Karriereseite auf unserer Homepage. Die kontinuierliche Evaluation der Maßnahmen – etwa über Klickzahlen, QR-Codes und Feedbackbögen – sichert den messbaren Erfolg der Strategien.
Personalisierung im IT-Bereich Wie überall ist der Mangel an ITFachkräften auch in der öffentlichen Verwaltung besonders hoch. Um die digitale Transformation unserer Behörde zu unterstützen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurde im BAMF
2019 der Bereich IT-Research gegründet. Dessen primäres Ziel ist es, die BAMF-IT für die Vernetzung mit Lehre, Wissenschaft und Forschung zu öffnen und damit das Bundesamt als attraktiven Arbeitgeber im IT-Bereich sichtbar zu machen; dazu zählen Forschungskooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen oder die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, z. B. zum Thema Blockchain, darüber hinaus Vorträge in Lehrveranstaltungen zu den zahlreichen IT-Projekten. Über akademische Abschlussarbeiten bietet IT-Research Studierenden die Chance, BAMF-eigene IT-Themen zu bearbeiten, die durch betreuende Professorinnen und Professoren wissenschaftlich begleitet werden. Über Netzwerke mit mehr als 30 Hochschulen und Forschungseinrichtungen können Studierende vermittelt werden. Dieser Weg fördert eine frühe Identifikation mit unserer Behörde - auch als Arbeitgeber. Zudem unterstützen Werkstudierende ausgewählte IT-Projekte. Interessenten für ein duales Studium im IT-Bereich bieten wir die Studiengänge „Verwaltungsinformatik“ und „Digital Administration and Cyber Security“ an, die an der Hochschule des Bundes gelehrt werden. Bestandteil beider Studiengänge sind Praktika, die im BAMF absolviert werden können. 2019 entstand das „Creative Information Technology Center“ (CIC) des Bundesamtes und seine Veranstaltungsreihe, die CIC-Thementage. An bis dato 45 Thementagen wurden dabei verschiedenste ITThemen diskutiert – und regelmäßig rund 800 Kontakte aus Wissenschaft, Behörden und Wirtschaft erreicht.

Dr. Hans-Eckhard Sommer ist Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Foto: BS/BAMF/Lopez



Wir freuen uns, in den vergangenen Jahren den erfolgreichen Weg des Behörden Spiegel begleitet zu haben. Die besten Wünsche zum 40. Geburtstag und weiterhin viel Erfolg!


Weiss-Druck GmbH & Co.KG Hans-Georg-Weiss-Straße 7 · 52156 Monschau

Ins Ziel kommen die Meisten. Es geht aber darum, der Schnellere zu sein. Wenn Ihr nächster großer Druckauftrag mit mehr Dynamik abgewickelt werden muss, sollten Sie vorher mit einer der faszinierendsten Druckereien Deutschlands sprechen. Damit Sie die Zielfahne früher sehen.
www.dynamikistweiss.de Tel. +49 2472 982-0
Behörden Spiegel: Warum ist Zugang zu Sportangeboten so wichtig für die Gesellschaft?
Sandra Kiriasis: Sport verbindet Menschen. Das beginnt schon bei den Kindern im örtlichen Sportverein. Wenn alle Kinder die gleichen Trikots tragen, sorgt das für ein Zugehörigkeitsgefühl. Schon für die Jüngsten ist das etwas Besonderes und Motivation, sich sportlich anzustrengen, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden.
Außerdem hat Sport etwas mit Lebensqualität zu tun. Es ist erschreckend, dass viele Kinder heute keinen Purzelbaum mehr machen können. Wenn Bewegung nicht in jungen Jahren erlernt wird, führt das später zu körperlichen Problemen und zuletzt zu einem hohen Krankenstand.
Sport hat viele positive Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes und auf jede und jeden persönlich – mehr, als man in ein paar Sätzen erklären könnte.
Behörden Spiegel: Warum muss der Staat Sportförderung als wichtige Aufgabe für sich verstehen?
Dr. Tamara Zieschang: Sport hält uns alle gesund, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und trägt dazu bei, Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und aus allen sozialen Lebensbereichen zusammen zu bringen. Sport verbindet die Menschen. Vor allem junge Menschen erleben im Sportverein und bei sportlichen Wettbewerben sehr früh Werte wie Fairness, Toleranz und Verantwortung. Und Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die Deutschland auf internationalen Wettbewerben vertreten, begeistern nicht nur die Menschen landauf und landab. Sie sind zugleich beeindruckende Botschafter für unser Land.
Kiriasis: Das Problem ist, egal ob Hobby oder Profikarriere: Sport ist teuer. Das gilt besonders für technische Sportarten wie Bob, Rodeln oder Skeleton, für die man mehr Ausrüstung benötigt als nur ein paar Turnschuhe. Damit Kinder eine Sportart ausprobieren, ausüben und vielleicht sogar Profis werden können, braucht es daher oft finanzielle Unterstützung – insbesondere dann, wenn die Eltern finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Die Eltern sind die ersten Förderer ihrer Kinder. Die nächsten Förderer sind dann meist die Vereine. Damit sie die Nachwuchsathletinnen und -athleten trainieren und bei der Ausstattung unterstützen können, sind sie oft auf Sponsoren angewiesen. Zu Sportförderung gehört auch, diese Vereine so aufzustellen, dass sie Nachwuchstalente an einen Sport heranführen, trainieren und z. B. die schon erwähnten Trikots finanzieren können. Wenn das gelingt, kann es eine echte Veränderung bewirken – für die Kinder und für den Sport.
Natürlich muss auch die nötige Infrastruktur errichtet und in Stand gehalten werden. Wo es keine intakten Schwimmbäder gibt,
Ausprobieren, dranbleiben, gewinnen
(BS) Eine Medaille für eine deutsche Athletin oder einen deutschen Athleten ist immer auch eine Medaille für Deutschland. Profisportlerinnen und -sportler repräsentieren das Land, dafür werden sie mit staatlichen Mitteln gefördert. Die Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Tamara Zieschang, und die ehemalige Bobpilotin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sandra Kiriasis erläutern, warum Sportförderung lange vor der Profikarriere beginnt, welche Unterstützungsangebote es für Athletinnen und Athleten gibt und wieso staatliche Investitionen in diesem Bereich wichtig sind. Die Fragen stellte Ann Kathrin Herweg.

bekommen Kinder keine Möglichkeit schwimmen zu lernen und am Ende haben wir dort Erwachsene, die immer noch nicht schwimmen können.
Viele ehemalige Athletinnen und Athleten unterstützen mit eigenen Initiativen junge Sportlerinnen und Sportler und es gibt Hilfe von Stiftungen, wie der Deutschen Sporthilfe. Aber auch der Staat ist hier gefordert. Ohne die Förderung von Bund und Ländern könne viele Kinder gar nicht erst mit einer Sportart beginnen, geschweige denn eine Profikarriere starten.
Behörden Spiegel: Was leistet die Sportförderung in Sachsen-Anhalt?
Zieschang: Mit der Sportförderung können gute Rahmenbedingungen geschaffen werden – und zwar sowohl durch die Unterstützung der Organisationsstrukturen im Sport als auch durch gute Sport- und Trainingsstätten. Sachsen-Anhalt fördert die Strukturen im Sport, also den Landessportbund, die Kreis- und Stadtsportbünde, die Landesfachverbände sowie die Vereine. So erhalten zum Beispiel die Sportvereine und -verbände mit jährlichen Pauschalen eine unbürokratische Unterstützung für ihre Arbeit. Dadurch stärken wir die Autonomie des Sports und das Sportland Sachsen-Anhalt in der Breite. Darüber hinaus können Kommunen und Sportvereine Förderungen für die Sanierung, Modernisierung, den Umbau oder Neubau von Sportstätten erhalten – vorausgesetzt, diese sind nach der Bauordnung des Landes barrierefrei. Zudem werden Projekte oder Veranstaltungen im sportlichen
Bereich gefördert, wobei auch inklusive Sportangebote berücksichtigt werden. Hinzu kommt die Förderung des Spitzensports.
Behörden Spiegel: Frau Kiriasis, wie hat die Sportförderung Ihre Karriere beeinflusst?
Kiriasis: Ich habe in der DDR mit dem Sport angefangen, wo Sport und dessen Förderung sehr großgeschrieben wurden. Das war eine harte Zeit, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Förderung bekommen habe. Nach der Wende, als ich 16 Jahre alt war, kam ich in den Nachwuchskader und habe das erste Mal Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe bekommen. Mit dem Erfolg kamen später auch leistungsbezogene Prämien hinzu. 1993 bin ich in die Bundeswehr eingetreten. Dort habe ich eine Grundausbildung absolviert und konnte mich dann ganz meinem Sport widmen. Dafür habe ich ein normales Grundgehalt bekommen. Solch ein regelmäßiges Gehalt war wichtig, um meinen Lebensunterhalt zu sichern und mich ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Nebenbei habe ich weiterhin die Unterstützung der Deutschen Sportförderung genutzt, um weitere anfallende Kosten zu decken. Ich weiß nicht, wie mein Sportlerleben sich ohne die Förderung der Bundeswehr entwickelt hätte. Anfang der 90er-Jahre war die Bundeswehr die einzige Möglichkeit für Frauen, eine solche Sportförderung zu erhalten. Heute gibt es mehr Dienstherren, die eine solche Unterstützung anbieten: die Bundes- und Landespolizei, der Zoll
und seit einiger Zeit auch die Feuerwehr. Das ist eine tolle Möglichkeit für die Beschäftigten, am Leistungssport dran bleiben zu können. Jüngere Athletinnen und Athleten, die nicht arbeiten, sondern noch zur Schule gehen, können von der Förderung der Länder profitieren.
Behörden Spiegel: Im Nachwuchsbereich und den Vereinen engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Wie kann und wird Ehrenamt unterstützt?
Zieschang: Der Großteil der Sportvereine in Sachsen-Anhalt wird ehrenamtlich organisiert. Sie erhalten Pauschalen nach dem Sportfördergesetz, die eine wichtige finanzielle Unterstützung für das Ehrenamt darstellen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ehrenamtliches Engagement öffentlich zu würdigen. Besonders zu erwähnen ist die Ehrungsveranstaltung im sportlichen Bereich, die jährlich vom Ministerium für Inneres und Sport ausgerichtet wird oder auch die Ehrung beim Tag des Ehrenamtes, zu dem der Ministerpräsident des Landes einlädt. Auch auf kommunaler Ebene werden regelmäßig ehrenamtlich tätige Menschen im Sport gewürdigt.
Behörden Spiegel: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Sportförderung?
Kiriasis: Zum einen muss eine solche Unterstützung des Ehrenamtes weitergeführt werden. Ohne Ehrenamtliche würde die Vereinsarbeit nicht funktionieren. Ihre Arbeit muss gewürdigt werden und ich denke, was Bürokratie angeht, könnte für sie einiges vereinfacht werden. Außerdem ist es enorm wichtig, dass sichergestellt wird, dass an
allen Schulen Spotunterricht stattfinden kann. Allein schon aus gesundheitlichen Gründen. Auch Aktionen wie die Bundesjugendspiele müssen beibehalten werden. Kinder wollen und müssen sich miteinander messen. Natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die nicht so sportlich sind – aber das sind dann vielleicht Mathe- oder Schachexperten. Insgesamt sollten Kinder die Möglichkeit haben, verschiedene Sportarten kennen zu lernen und vielleicht eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Das muss der Staat fördern.
Und ich würde mir wünschen, dass Gelder, die z. B. von der Deutschen Sportförderung, also aus Spenden, an die Athletinnen und Athleten gezahlt werden, in vollem Umfang bei diesen ankommen – ohne komplizierte Prozesse und ohne dass z. B. Abgaben an das Finanzamt gezahlt werden müssen.
Behörden Spiegel: Was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung in Punkto Sportförderung?
Zieschang: Die Förderung des Spitzensports ist eine zentrale Aufgabe des Bundes. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat unterstützt sowohl die Bundessportfachverbände als auch den Betrieb und den Bau von Trainingsstätten, um Athletinnen und Athleten optimale Bedingungen für Training und Wettkampf zu bieten. Ziel ist es, der Bundesrepublik Deutschland eine Spitzenposition im internationalen Sport zu sichern. Eine erfolgreiche Förderung setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Sportorganisationen und den öffentlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene voraus. Insofern erwarte ich von der neuen Bundesregierung wieder ein klares Signal für die Fortführung der Spitzensportförderung. In Magdeburg wollen wir ein Schwimmzentrum für Deutschland neu bauen. Magdeburg ist derzeit der Erfolgsgarant im deutschen Schwimmsport und der erfolgreichste Bundesstützpunkt bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, können auch weiter Spitzenleistungen erzielt werden.








Bereits 2019 kam der Nationalen Normenkontrollrat (NKR) in seinem Jahresbericht zu dem Schluss: „Seit Gründung der Bundesrepublik hat sich viel verändert; jedoch unverändert geblieben ist die Art und Weise, wie Gesetze gemacht werden.“ Das ist auch heute noch so. Die technische Basis des Gesetzgebungsprozesses ist noch immer von etlichen Medienbrüchen geprägt. Die Vorphase des Gesetzgebungsprozesses, in der es wichtig wäre, unterschiedliche Alternativen zu erproben, ihre Praxis- und Digitaltauglichkeit sicherzustellen und Kosten-Nutzen-Analysen sowie Prozessdarstellungen aufzuzeigen, bleibt ein Desiderat. Stattdessen werden frühe Festlegungen getroffen, Textentwürfe erarbeitet und im Ressortkreis abgestimmt. Der Katalog der Qualitätskriterien guter Rechtsetzung wird lediglich als Checkliste abgehakt. So entstehen Regelungen, die unvorhersehbare Bürokratielasten hervorrufen. Deshalb muss der Prozess der Gesetzesvorbereitung grundlegend reformiert werden.
Zentrum für Legistik Es braucht prozessuale Veränderungen, eine fachliche Weiterentwicklung in der Ausrichtung der Gesetzesfolgenabschätzung und eine solide technische Basis für die Abbildung der Prozesse. Für die Umsetzung und Implementierung wäre die Einrichtung eines Zentrums für Legistik (ZfL) im Bundeskanzleramt der richtige Weg. Der NKR fordert, das ZfL zukünftig als Prozesseigner für Gesetzgebung agieren zu lassen. Das ist notwendig, um Praxis- und Vollzugstauglichkeit in den Mittelpunkt aller Gesetzgebungsprojekte zu stellen. Das ZfL sollte interdisziplinär aufgestellte Teams für Gesetzgebungsprojekte bilden, um die bisher juristisch geprägte Sichtweise durch technisches Know-how, praktische Vollzugserfahrungen und analytische Kompetenzen zu ergänzen. Mit dem ZfL könnte so die Voroder Frühphase im Gesetzesvorbereitungsprozess gestärkt werden. Denn hier spielt im Sinne des Bürokratieabbaus die meiste Musik – vor allem, wenn noch keine konkreten Textentwürfe, sondern erst Lö-
W enn man von Gleichstellung zwischen Mann und Frau spricht, ist auch immer eine paritätische Beteiligung an der Erziehung der gemeinsamen Kinder gemeint. Natürlich hängt es immer von der jeweiligen familiären Situation ab, wie die tatsächliche Aufgabenteilung ausfällt. Tatsächlich lag der Anteil der Väter, die 2023 Elterngeld bezogen, bei ungefähr 25 Prozent.
Reduzierte Stundenzahl für die Familie Frauen sind allerdings nach wie vor länger in Elternzeit als Männer. So haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts Frauen im Jahr 2023 im Schnitt für 14,8 Monate Elterngeld beantragt, während es bei Männern durchschnittlich 3,7 Monate waren.
Schon früh im Prozess ansetzen
(BS/Lutz Goebel) Die Vorbereitung von Gesetzen ist der wichtigste Prozess in den Bundesministerien. Das Problem ist, dass er noch nie wirklich modernisiert wurde. Aufgrund veralteter Strukturen entstehen bürokratische Lasten, die vermeidbar wären. Es ist an der Zeit, die Gesetzesvorbereitung einem Update zu unterziehen und fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Ein Plädoyer für ein fundamentales Umdenken.

Die deutsche Gesetzgebung muss modernisiert und angepasst werden. Medienbrüche sollten der Vergangenheit angehören. Qualität gehört gelebt nicht abgehakt. Foto: BS/vegefox.com, stock.adobe.com
sungsansätze beleuchtet werden. In der Frühphase könnte das ZfL den Gesetzgebungsprojekten einen geschützten Raum zur Abwägung von Alternativen und Umsetzungswegen bieten. In dieser Phase müssten Betroffene aus Vollzugsbehörden und Unternehmen eine wichtige Rolle spielen, um die Praxis- und Vollzugstauglichkeit von Gesetzen zu erhöhen. Am Ende der Vorphase stünden mehrere Alternativen – alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen und einem ungefähren „Preisschild“ für die Umsetzung. Darüber hinaus könnten grafische Visualisierungen von Vollzugsmodellen als gemeinsame Sprache zwi-
schen den Bereichen Recht, Technologie und Vollzug für mehr Klarheit sorgen. Und nicht zuletzt ist die Vorphase gut geeignet, um mittels Gesetzgebungs- und Reallaboren Chancen und Risiken innovativer Regulierungsansätze zu verproben. Erst ganz am Ende sollte dann die politische Entscheidung getroffen werden, welche Gesetzesalternative gewählt wird und erst danach können konkrete Regelungstexte entstehen.
Zu viele Guidelines
Für die effektivste Ausgestaltung dieser Vorphase sollte auch die Methodik bzw. der Instrumenten-
kasten der besseren Rechtsetzung überarbeitet werden. Denn es existieren über 50 Leitfäden und Handreichungen, die bei der Entwicklung von Gesetzentwürfen zu beachten sind. Sie alle haben das Ziel, Gesetze zu verbessern. In ihrer Summe sind sie aber zu wenig aufeinander abgestimmt, nicht trennscharf und wirken vor allem überfordernd. Bei der Weiterentwicklung der Methodik sollte auf quantitative Faktoren (z. B. Darstellung von Kosten und Nutzen) und qualitative Ziele (Digital-, Praxis- und Vollzugstauglichkeit) gesetzt werden. Auch hierbei kann das ZfL eine zentrale Rolle spielen: es sollte den Neuordnungs-
Geschlechterrollen bei Arbeitszeit und Beurlaubungen
(BS/sr) Es ist das typische Klischee: Der Mann arbeitet in Vollzeit und die Frau in Teilzeit oder sie bleibt ganz zu Hause. Im Sinne einer Gleichstellung ist das wenig sinnstiftend. Aber es bleibt auch das Bild in der öffentlichen Verwaltung des Bundes – laut Gleichstellungsindex.
Deutliche Unterschiede werden auch bei einem Blick auf die Gründe für Teilzeit deutlich. Frauen reduzieren ihre Stundenzahl häufig wegen der Familie. Männer nutzen Teilzeit hingegen oft, um sich fortzubilden oder zu studieren. Wie in der Wirtschaft, konzentriert sich die Teilzeitbeschäftigung in der Bundesverwaltung eher auf die Frauen, zeigt der Gleichstellungsindex. In den einzelnen Bundesinstitutionen fällt der Teilzeitumfang unterschiedlich aus. Fast 80 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit sind

in der Bundesverwaltung Frauen. Am ausgewogensten ist noch die Verteilung im Bundesrechnungshof und in der Bundestagsverwaltung. Hier sind zumindest über 30 Prozent der in Teilzeit Beschäftigten männlich. Zu berücksichtigen bleibt aber, dass der Frauenanteil in den einzelnen Behörden unterschiedlich ausfällt.
Dieser Trend setzt sich auch im höheren Dienst fort. Dort waren im Jahr 2023 insgesamt 33 Prozent aller Frauen in Teilzeit tätig, aber nur elf Prozent der Männer.

prozess der Methodik koordinieren, mit dem klaren Ziel, die Gesetzgebungsreferate von formalistischen Anforderungen zu entlasten. Nach Abschluss dieses Prozesses, der bis Ende 2025 umgesetzt werden kann, sollte das ZfL ein Curriculum für gute Rechtsetzung aufsetzen und das gesamte juristische Personal bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2029 schulen.
Keine effiziente Zusammenarbeit Abschließend ist auch die technische Modernisierung des Gesetzgebungsprozesses dringend notwendig. Denn aktuell werden Regelungsentwürfe mit Microsoft Word geschrieben – ohne die Möglichkeit, effizient mit den anderen Ressorts zusammenzuarbeiten. Das führt dazu, dass erhebliche Ressourcen in die Konsolidierung der Regelungsentwürfe fließen, ohne dass auch nur eine Sekunde an den Inhalt gedacht wurde. Die wichtigsten Projekte zur Digitalisierung des Rechtsetzungskreislaufs (E-Gesetzgebung, E-Verkündung, das Neue Rechtsinformationssystem NeuRIS sowie das Gesetzgebungs-portal des Bundes) werden von unterschiedlichen Stellen der Bundesregierung verantwortet und die Notwendigkeit ihrer fachlichen Weiterentwicklung nirgendwo mitgedacht. Auch hier kann ein ZfL im Bundeskanzleramt Abhilfe schaffen – indem es die Steuerung der oben genannten Projekte übernimmt und so sicherstellt, dass die fachliche Weiterentwicklung der Rechtsetzung auch in technischer Hinsicht endlich voranschreitet. Die nächste Bundesregierung wird sich dazu bekennen, nachhaltig Bürokratie abzubauen und den Staat wieder leistungsfähig zu machen. Eine notwendige Bedingung dafür ist ein Update für die Gesetzgebung – lassen Sie Worten endlich Taten folgen!

Lutz Goebel ist Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats. Foto: BS/NKR
sind es nach dem aktuellen Gleichstellungsindex sogar 47 Prozent. Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, erklärte vor dem Hintergrund, dass das gesetzte Ziel von Gleichstellung in Führungspositionen bis Ende 2025 zu erreichen sei.
Genau so wie im höheren Dienst gehen auch dreimal so viele Frauen wie Männer in Führungspositionen in Teilzeit. Ein Fakt, der sich auch auf den Frauenanteil in Führungspositionen bezieht.
Gleichstellung greifbar
Das Gesamtziel der Gleichberechtigung befindet sich aber trotzdem auf einem guten Weg. In den obersten Bundesbehörden belief sich der Frauenanteil zum Stichtag des 30.06.2024 auf 44 Prozent, mit den nachgeordneten Behörden
Der Bund müsse an dieser Stelle seine Vorbildrolle wahrnehmen: „Wenn wir von der Privatwirtschaft mehr Gleichstellung fordern, müssen wir als großer Arbeitgeber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir nehmen unsere gesetzliche Verpflichtung sehr ernst“, erklärte Paus weiter.
Weiterhin ergänzte sie, dass ein guter Mix an Führungskräften auch bessere Ergebnisse hervorbringe. Dieser Fakt sei auch vielen Entscheidern in der Wirtschaft bewusst.

Wenn wir bei zehn Prozent Besteuerung 25.000 Euro einnehmen, dann müssten wir bei einer Besteuerung von 20 Prozent doch 50.000 Euro einnehmen.
Soweit mathematisch korrekt gerechnet, aber wie einige Kämmerer aus Erfahrung wissen, ist es nicht immer so leicht. Denn wenn durch eine Steuererhöhung ein, zwei Spielhallen schließen oder abwandern, generieren sie keine Steuereinnahmen mehr. Dabei ist der legale und gesteuerte Markt wichtig, damit Spielende nicht in den unregulierten Markt abwandern, wo keinerlei Schutzmaßnahmen mehr für sie bestehen.
(BS/sr) Abstandsregeln, Maximalanzahl an Geräten, Einzahlungslimits: Die Glücksspielbranche ist stark reguliert und besteuert. Die Unterschiede zwischen Kreisen oder zwischen Bundesländern können dabei immens sein. Ein Grund dafür ist die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Politik, die sich je nach der persönlichen Haltung zum Thema Glücksspiel differenziert. Wie kann eine Zusammenarbeit im Sinne eines sicheren Spiels gelingen?

Dahms, Präsident Deutscher Sportwettenverband. Er ist der Meinung, dass zu einer Verbesserung der Situation zunächst einmal eine Akzeptanz des Schwarzmarktvolumens in den Behörden geschaffen werden müsse. Dann könnte die für viele Anbieter aktuell zu scharf ausgestaltete Regulierung angegangen werden.
Geregelt sind die Ziele und Vorgaben für eine nachhaltige Ausrichtung in der Beschaffung dabei im Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, welches die Normen, mit denen neue Fahrzeuge ausgeschrieben werden müssen, festlegt. Dabei handelt es sich um die Umsetzung der europäischen Richtlinie (EU) 2019/1161 zur Änderung der Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive). Betroffen sind alle öffentlichen Stellen, egal ob es sich um Pkw-Dienstfahrzeuge oder Personen- oder andere Verkehrsdienste handelt. Ausgenommen sind hingegen Einsatzfahrzeuge, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gebaut oder dafür angepasst wurden, wie Polizei und Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz sowie land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge und reine Reisebusse. Während die Clean Vehicle Directive konkrete Vorgaben schafft, ist sie nicht der Beginn einer nachhaltigen Umstellung der Fahrzeuge.
Elektrifizierte Bundeswehr So macht unter anderem auch die Bundeswehr in ihrem Fuhrpark mit handelsüblichen Fahrzeugen große Fortschritte. Die BwFuhrparkServi-
Auch Marc Elxnat, Beigeordneter Arbeitsmarktpolitik Kultur, Bildung, Sport, Gesundheitswesen, Deutscher Städte und Gemeindebund, hält einen gemeinsamen Runden Tisch für wichtig, egal welche Überzeugung man bei diesem Thema inne hat.
Denn Redebedarf besteht. So ist zum Beispiel im Rahmen einer Revitalisierung der Innenstädte auch darüber zu sprechen, wie Glücksspiel in die neuen Konzepte passt.
Ins Gespräch kommen Eine gemeinsame Abstimmung könnte helfen, allerdings gestaltet sich diese nicht immer ganz einfach. Wie eine gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung gelingen kann, war eine der großen Fragen des Kongresses der Deutschen Automatenwirtschaft. Eine Formel für Erfolg gibt es dabei nicht, wie Horst Burghardt, Bürgermeister a. D. Friedrichsdorf, Hessen (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt. Der Faktor Mensch ist dabei einfach zu variabel. Dr. Daniel Henzgen erklärt, dass gerade unterschiedliche Wertevorstellungen hier eine Rolle spielen. So herrsche zum Beispiel in den Stadtstaaten ein negatives Bild von Unternehmern und Unternehmerinnen der Glücksspielbranche vor, weswegen die Regelungen hier besonders hart ausgefallen. Dennoch ist es wichtig, regelmäßig das Gespräch zu suchen. Oliver Kumbartzky, hauptamtlicher Bürgermeister im Nordseeheilbad Büsum, schätzt, dass ein jährlicher Gesprächstermin eine Option sei, die wahrgenommen werden sollte, um über das Miteinander zu sprechen. Er empfiehlt, die Kämmerer bei Gesprächen nicht zu vergessen.
Johanna Bergstein, Vizepräsidentin Bundesverband Automatenunternehmer, spricht zudem die Optik von Spielhallen an und gibt zu bedenken, dass diese mehr an die Gemeinden angepasst werden könnte.
Verwaltungslast ist groß Mit verdunkelten Fenstern und wenig Außenwirkung aufgrund der Werbebestimmungen sind Spielhallen nicht immer gut in das städtische Gesamtbild integriert. Welche Vorgaben dabei genau gelten, ist von Kreis zu Kreis und Land zu Land unterschiedlich. Dabei sind
gerade kleinere Kommunen mit der umfangreichen Regulierung ebenso belastet, wie es die Unternehmen sind. Burghardt erklärte, dass bei kleineren Kommunen bisweilen nur ein bis eineinhalb Personen für das gesamte Gewerbe zuständig sind. Auch Elxnat weiß aus der hohen Nachfrage an Schulungen, dass bei Kommunen auch Unsicherheiten bzgl. der Verfahren bestehen. Eine optimierte Zusammenarbeit könnte daher für beide Seiten Verbesserungen bringen. Kurzfristig kann hier allerdings nur wenig helfen, sagt Mathias
Grün auch ohne Tarnfleck
Beschaffung sauberer Fahrzeuge für den Bund
(BS/sr) Ende 2025 ist es so weit, dann ist die erste Etappe zur Umstellung des öffentlichen Fuhrparks beendet: Öffentliche Vergabestellen sollen verstärkt umweltfreundliche Fahrzeuge ausschreiben und ihre Flotten nachhaltiger gestalten. Das betrifft natürlich auch die Bundeswehr, auch wenn schweres Gerät wie Panzer oder Artillerie von den Vorgaben ausgeschlossen bleibt.

Zum Erreichen der Klimaziele muss auch der Fahrbereitschaftsdienst der Abgeordneten und der Ministerinnen und Minister klimafreundlicher werden. Foto: BS/Comofoto, stock.adobe.com
ce GmbH ist bereits seit 2016 damit beschäftigt, nach Vorgaben des Bundesministeriums der Verteidigung eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotte vorzunehmen und auf
Bundeswehr-Liegenschaften eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu schaffen. So konnten bisher bereits 2.000 elektrifizierte Fahrzeuge an die Bundeswehr übergeben und
500 smarte Ladepunkte in den Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden. Diesen sollen bis zum Ende des Jahres 2025 600 weitere Ladesäulen hinzugefügt werden. Zu-


Dass die aktuelle Regulierung zu scharf sei, sieht auch Michael Hüttner, Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz (SPD), so. Es sei überbremst worden, erklärte er bei der Frage, wie eine gute Regulierung gelingen kann. Er erkannte an, dass die Bedürfnisse der Normalspieler respektiert und gewahrt werden müssten, wies aber auch darauf hin, dass gefährdete Spieler weiterhin geschützt werden müssten. Eine schwierige Aufgabe, der man sich jedoch stellen muss. Schließlich sei es die Aufgabe der Politik, Kompromisse zu finden. Ein gegenseitiges Entgegenkommen von beiden Seiten ist für zukünftige Gespräche ebenfalls wichtig. Es bleibt festzuhalten, dass weiterhin einiges zu tun und zu prüfen bleibt, wenn es um die Regulierung von Glücksspiel geht. Allerdings nimmt die allgemeine Gesprächsbereitschaft weiterhin zu. Georg Stecker, Präsident der Deutschen Automatenwirtschaft e. V., erklärt dabei, dass besonders erfreulich sei, dass mittlerweile viele verschiedene Anbieter bereit seien, gemeinsam für Interessen der Glücksspielbranche einzustehen. Selbst wenn es zu einer schnellen Anpassung des Glücksspielstaatsvertrages oder der Spielverordnung kommt, wird der Gesprächsbedarf weiterhin wichtig bleiben. Nach der Glücksspielregulierung ist vor der Glücksspielregulierung.
sätzlich gibt es die Möglichkeit, das öffentliche europäische Ladenetz zu nutzen, wofür entsprechende Ladekarten zur einheitlichen Authentifizierung des Ladevorgangs bereitgestellt werden. Zur Steuerung der Ladeeinrichtungen hat die BwFuhrparkService GmbH ein Ladebackend entwickelt. Für die Zukunft ist neben einem Ausbau des Netzes an Ladepunkten und Fahrzeugen auch eine LadeApplikation geplant, mit der Status und Authentifizierung im Ladenetz erleichtert abgefragt werden können.
Höhere Ziele bei der Bundesverwaltung
Mit dem Beginn der nächsten Phase werden auch die Ziele bei der nachhaltigen Beschaffung weiter angehoben. So werden unter anderem bei Bussen, von denen die Hälfte nicht nur emissionsarm, sondern emissionsfrei sein müssen, die Quoten von 45 Prozent auf 65 Prozent angehoben. Für Lkw steigt die Quote von zehn auf 15 Prozent. In der Bundesverwaltung steigen zudem die Quoten für Pkw weiter an. Diese dienen neben einer Vorbildfunktion auch dazu, dass für die Bundesverwaltung gesetzte Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen.

Behörden Spiegel: Nach Anschlägen wie in Magdeburg wurde in der Vergangenheit immer wieder der Vorwurf laut, die Ausländerbehörden kämen nicht hinterher. Stimmt das?
Engelhard Mazanke: Die Bundesrepublik Deutschland hat fast 600 Ausländerbehörden mit ganz unterschiedlichen Strukturen und Größen. Seit dem Jahre 2015 sind sie in einer Art Dauerbelastung – manche sagen Krisenmodus. Das führt zu einer hohen Belastung der Mitarbeitenden, aber auch dazu, dass wir unseren eigenen Ansprüchen gegenüber den Kunden und vielleicht auch den vorgesetzten Stellen nicht mehr in der Form gerecht werden, wie wir uns das selbst wünschen. Die Ausländerbehörden sind z. B. durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, aber auch durch die alltägliche Erfüllung der anderen gesetzlichen Aufgaben, die sich permanent ändern und komplexer werden, stark gefordert. Wartezeiten sind zu lang. Insofern stimmt das: Wir kommen nicht wirklich hinterher.
Behörden Spiegel: Warum gelingen Integration aber auch Abschiebungen oft nicht?
Mazanke: In unseren gesetzlichen Vorgaben sind zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten vorgesehen und es gibt an vielen Stellen Doppelprüfungen. Ein Beispiel ist das Visumsverfahren. Die Auslandsvertretungen und die Inlands-Ausländerbehörde prüfen beim Familiennachzug beide dasselbe, müssen beide zustimmen und zu einem positiven Ergebnis kommen. Tut eine das nicht, gibt es kein Visum. Das können wir uns nicht mehr leisten: eine Doppelprüfung von zwei Sachbearbeitern in zwei Behörden auf der Basis derselben Unterlagen.

Engelhard Mazanke ist seit 14 Jahren Direktor des Berliner Landesamtes für Einwanderung (LEA). Foto: BS/jamilfilm@yahoo.de
Hinzu kommt, dass Menschen, die für mindestens drei Jahre einwandern, weil sie z. B. einen deutschen Ehepartner gefunden haben, häufig nur ein Visum für drei Monate bekommen. Dann geht genau dasselbe Verfahren wieder von vorne los. Viel einfacher wäre es, wie in anderen Ländern, gleich ein Visum für ein Jahr auszustellen. Ähnlich ist das auch im Rückführungsverfahren. Vom Anstoß des Abschiebeprozesses bis zur Organisation eines Fluges sind an einem Regel-Rückführungsverfahren bis zu sechs oder sieben Stellen – Ausländerbehörden, Polizei und ggf. Justiz und Staatsanwaltschaft –beteiligt. Wenn eines dieser sieben
Eine Ausländerbehörde auf beiden Seiten des Tresens
(BS) Sie arbeiten auf Hochtouren, meistern eine Ausnahmesituation nach der anderen und doch ernten Ausländerbehörden dafür vor allem eines: Kritik. Die größte Einwanderungsbehörde Deutschlands ist das Landesamt für Einwanderung (LEA) in Berlin. Ihr Direktor Engelhard Mazanke spricht im Interview mit Dr. Eva-Charlotte Proll über veraltete Verfahren, Einsparungspotenziale und einen ganzheitlichen Denkansatz im Umgang mit Ausländerangelegenheiten.
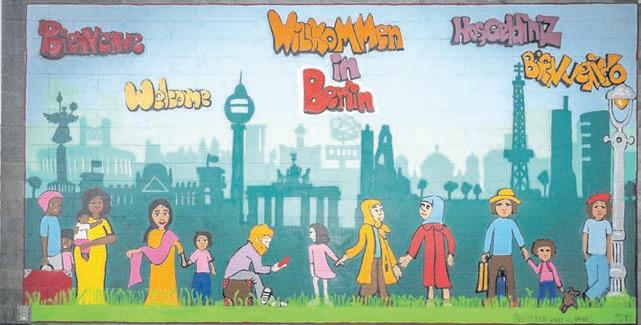
Schülerinnen und Schüler der Beethoven-Schule haben 2015 ein Wandbild am Haupteingang des LEA-Hauptstandorts angefertigt. Foto: BS/LEA Berlin
Rädchen nicht richtig in das andere Rädchen greift, weil es z. B. nicht genug Flugbegleiter Luft bei der Bundespolizei gibt, dann funktioniert das ganze Verfahren nicht. Kurzum: Wir haben zu viele Behörden, wir haben Behörden, die Vorgänge doppelt prüfen und dann haben wir im Gesetz viele Vorschriften, die aus meiner Sicht veraltet, zu komplex oder überflüssig sind.
Behörden Spiegel: Wie können veraltete Prozesse effizienter gestaltet werden?
Mazanke: Die Ausländerbehörden haben ganz viele Ideen, um Verfahren zur Fachkräfteeinwanderung zu verschlanken. Auf die Einbindung der Bundesagentur in Entscheidungsprozesse bei Fachkräften kann z. B. in vielen Fällen verzichtet werden, da die Einwanderungsbehörden Überprüfungen, wie sie die Bundesagentur durchführt, häufig selbst schneller und effizienter durchführen könnten. Eine weitere Möglichkeit ist die Anpassung der Geltungsdauer von Aufenthaltstiteln, wenn eine Person sich straffrei verhält und einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat oder eine Ehe mit einem Deutschen lebt. Wenn es dem Gesetzgeber – der neuen Bundesregierung – gelingt, an dieser Stelle wirklich Effizienzgewinne zu erzielen, könnten die Arbeitsbelastung in den Einwanderungsbehörden um bis zu 20 Prozent gesenkt werden. Mit vollständiger Digitalisierung und echter Entbürokratisierung ließen sich aus unserer Sicht sogar bis zu 50 Prozent der Arbeitsaufwände in Einwanderungsbehörden bei der Fachkräfteeinwanderung einsparen. Dann werden Kapazitäten frei, um sich mit Themen wie Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine oder Syrien und Rückführung von Straftätern auseinanderzusetzen. Das Ersparnis-Potenzial liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben.

Behörden Spiegel: Was macht das LEA anders als die Einwanderungsbehörden in anderen Ländern?
Mazanke: Das zeigt sich schon an unserem Namen. Wir sind das Landesamt für Einwanderung – nur Einwanderung, nicht Einwanderung und Ausländerangelegenheiten oder ähnliches. Der Begriff Einwanderung wird bei uns breit gefasst, wir verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, bei uns prüfen die Sachbearbeiter aus dem Bereich Einbürgerungen auch das Aufenthaltsrecht und umgekehrt prüfen auch die Sachbearbeiter aus dem Bereich Aufenthaltsrecht zum Teil die Einbürgerung mit. Entsprechend ganzheitlich versuchen wir auch zu beraten. Der Gesetzgeber differenziert in Kästchen: Es gibt das Asylverfahren, es gibt das Fachkräfteverfahren, es gibt das Einbürgerungsverfahren, es gibt das Visaverfahren. Wir unterscheiden nicht mehr so. Für uns ist das ein Einwanderungsprozess mit einem Verfahren in einer ausgesprochen diversen Gesetzgebung. Aktuell sind wir die einzigen, die so mit diesem ganzheitlichen Ansatz arbeiten. Alle anderen machen ihre Kästchen. Frankfurt, München und andere haben ähnliche Ideen wie wir, aber sie werden immer wieder durch Problematiken wie unterschiedliche IT-Fachverfahren, Personalkürzungen o. Ä. ausgebremst.
Behörden Spiegel: Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem ganzheitlichen Ansatz gemacht?
Mazanke: Stellen wir uns vor, eine Person hat eine Aufenthaltserlaubnis, sie ist Ausländerin und mit einem Deutschen verheiratet. Nach drei Jahren Aufenthalt kann die Person eine Niederlassungserlaubnis bekommen. Sie macht digital den Quick-Check für eine solche Niederlassungserlaubnis und muss angeben, ob sie noch mit ihrem Mann zusammenlebt, wie hoch

keit hat uns vorher schlicht nicht interessiert, der Vorgang lag nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Der Kunde sieht den Prozess aber natürlich ganzheitlich. Hochqualifizierte Fachkräfte, die nach Deutschland einwandern möchten, erkundigen sich schon im Visumsverfahren nach Möglichkeiten, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen oder ihre Familien nachzuholen. Visastellen müssen in der Lage sein, darüber informieren zu können. Schließlich entscheiden diese Fachkräfte bewusst, in welches Land sie ziehen möchten. Die Information, dass sie einen deutschen Pass schon nach drei oder vier Jahren bekommen können, die Greencard in den USA aber erst nach fünf Jahren, kann für sie ein Kriterium sein, sich für Deutschland zu entscheiden. Darum ist ganzheitliches Denken der Prozesse wichtig.
Behörden Spiegel: Viele Beschäftigte im LEA haben einen Migrationshintergrund. Ist das ein Vorteil im Arbeitsalltag und im Umgang mit den Kunden?
ihr Einkommen ist, ob sie Deutsch spricht etc. Der Quick-Check ergibt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind und eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden könnte.
Hier kommt der ganzheitliche Ansatz ins Spiel: Viel sinnvoller ist es für sie in diesem Fall, einen Einbürgerungsantrag zu stellen. Nach § 9 Staatsangehörigkeitsgesetz kann eine Person, die mit einem Deutschen verheiratet ist, nach drei Jahren den deutschen Pass bekommen und braucht zuvor keine Niederlassungserlaubnis mehr. Die Behörde muss weniger prüfen und die Betroffene zahlt zwar etwa hundert Euro mehr, ist dann aber Deutsche, kann ihren alten Pass behalten und muss nie wieder in eine Ausländerbehörde. Wir bemerken aber immer wieder, dass diese Option den Leuten gar nicht bekannt ist. Hier beraten wir dann in das Einbürgerungsverfahren, obwohl
Mazanke: Diversität ist ein Vorteil – nicht nur in Einwanderungsbehörden, sondern überall dort, wo Teams zusammenarbeiten. Je diverser ein Team bei Alter, Geschlecht, Einstellungen etc. ist, desto resilienter und effizienter ist es. Wir als Einwanderungsbehörde des Landes Berlin bilden auch auf der Beschäftigtenseite die Stadtgesellschaft Berlin ab. Insgesamt liegt der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei 34 Prozent. Von den Mitarbeitenden unter 29 Jahren haben 69 Prozent einen Migrationshintergrund, das sind elf Prozent über dem Durchschnitt der Berliner Stadtbevölkerung. Ein junger Sachbearbeiter mit Migrationshintergrund kann sich oft noch gut daran erinnern, wie es sich anfühlt, als dolmetschendes Kind mit den Eltern in einer Behörde zu sein – vor einem angstbehafteten Termin. Das birgt viele Chancen. Die Beschäftigten bringen häufig interkulturelle Kompetenzen mit in die Behörde, genau wie Sprachkenntnisse, die sonst mit Dolmetscherleistungen teuer eingekauft werden müs-

Der Hauptstandort des Landesamtes für Einwanderung befindet sich am Friedrich-Krause-Ufer in Berlin-Mitte, Ortsteil Tiergarten. Foto: BS/LEA Berlin
die Kundin diesen Antrag noch gar nicht gestellt hat. An solchen Stellen zeigen sich Brüche im System und damit das Problem beim Kästchen-Denken. Erst als wir für Einbürgerung zuständig geworden sind, ist uns diese Situation bewusst geworden. Die Möglich-
sen. Außerdem verfügen sie über ein hohes Maß an Flexibilität, um sich auch auf neue rechtliche Dinge einzustellen. Wenn man uns also Ausländerbehörde nennen möchte, dann lege ich Wert darauf, zu sagen: Wir sind Ausländerbehörde auf beiden Seiten des Tresens.

Die Finanzierung einer unabhängigen Zeitung für den Öffentlichen Dienst erfolgte ausschließlich aus den privaten Finanzmitteln der Gründer. In vier Jahrzehnten hat sich aus dieser kleinen Unternehmensgründung die Behörden Spiegel Gruppe entwickelt, die als Kernmarke weiterhin die Zeitschrift Behörden Spiegel und den Berliner Behörden Spiegel herausgibt. Heute hat die Zeitschrift eine geprüfte Auflage von 101.000 Exemplaren. Neben dem Behörden Spiegel erscheinen fünf digitale Newsletter, die das Print-Produkt flankieren. Über die zahlreichen Seminare und Webinare, eine Vielzahl von europäischen, nationalen und regionalen Kongressen – über die an anderer Stelle in dieser Sonderausgabe berichtet wird – ist der Behörden Spiegel heute ein fester Bestandteil der deutschen Presselandschaft.
Warum der Öffentliche Dienst?
Warum ergab es Sinn, eine unabhängige Zeitschrift für den Öffentlichen Dienst ins Leben zu rufen?
Die Gründer waren der Ansicht, es fehle eine unabhängige Stimme, die die Notwendigkeit und Attraktivität des Dienstes im Staat und für den Staat in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt – genauer gesagt für Staat und Kommunen. Es gab und es gibt nach wie vor zahlreiche Magazine und Zeitschriften, die sich mit dem Öffentlichen Dienst beschäftigen, doch immer aus einer interessensgeleiteten Sicht auf die Dinge, seien es Gewerkschaften, Behörden oder Ministerien selbst – dazugekommen sind noch Publikationen von NGOs. In fast 500 Ausgaben hat der Behörden Spiegel immer das Gesamtinteresse der staatlichen Verwaltung, wie auch ihrer Beschäftigten im Blickfeld behalten. Warum es gut ist, Sinn ergibt und eine hohe Verpflichtung für das Allgemeingut erfordert, Finanzbeamtin und Finanzbeamte, Soldatin und Soldat, Försterin und Förster, Diplomatin und Diplomat, Justizvollzugsangestellte oder Rechnungsprüferin und Rechnungsprüfer zu sein – auf diese Fragen fand die Leserschaft im Behörden Spiegel immer positive und bestätigende Antworten. Doch neben dieser Bejahung gab es auch positive Kritik, vor allem dann, wenn Leitungen von Behörden und Ministerien parteiliche Fehlentwicklungen zu verantworten
(BS/Uwe Proll) Am 15. April 1985 erfolgte der Eintrag der ProPress Verlagsgesellschaft im Handelsregister des Amtsgerichtes Bonn, bereits am 16. April – also einen Tag später – stand ein LKW mit 20.000 Exemplaren des Bonner Behörden Spiegel bereit zur Verteilung. Heute würde dies sicherlich als Start Up bezeichnet werden, zumindest war das Risiko für die Beteiligten groß.

Jeden Monat rollen tausende Ausgaben des Behörden Spiegel über die Druckerpresse und finden ihren Weg zu den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Foto: BS/Rudolf
hatten oder das Gesamtinteresse der Beschäftigten unberücksichtigt ließen. Der Behörden Spiegel als Zeitschrift und seine begleitenden Veranstaltungen entwickelten sich daneben zu einer fachlichen Plattform, die in zahlreichen Fachgebieten zur unentbehrlichen Quelle wurde.
Ein gesamtdeutsches Produkt Der Behörden Spiegel – nun im 41. Jahrgang – ist selbst ein Stück Zeitgeschichte geworden. Nur zwei geschichtliche Zeitmarken seien hier kurz erwähnt. Da ist zum einen die deutsche Wiedervereinigung, der Fall der Mauer und in Folge der Parlaments- und Regierungsumzug. Der damalige Postminister der DDR, Klaus Wolf (CDU), erteilte dem ProPress Verlag die Lizenz für eine eigene Ausgabe im Bezirk Berl-
lin und eine zweite Lizenz für alle anderen Bezirke der DDR. In diesen Ausgaben beschäftigte sich der Behörden Spiegel mit zentralen Fragen des Öffentlichen Dienstes. Welche Rechte hat ein öffentlich Bediensteter? Wie werde ich verbeamtet? Wie ist ein Soldat versichert? Was ist Beihilfe? Der Informationsbedarf in den fünf neuen Bundesländern war unerschöpflich. Schon 1987 erhielt der Behörden Spiegel in West-Berlin ein eigenes Büro, das später der Nukleus für den zweiten, parallelen Verlagssitz in der neuen Bundeshauptstadt wurde. Der Behörden Spiegel organisierte sechs Berliner Immobilienbörsen in Bonn und drei Bonner Immobilienbörsen in Berlin für die Beschäftigten, die von der Spree an den Rhein oder umgekehrt mit ihrer Dienststelle umziehen mussten. Neben Immobi-
lienangeboten gab es Informationen der Schul- und Kulturverwaltung, der Polizei und zum Nahverkehr in der neuen Heimat.
Ein Sprung ins Digitale Neben vielen weiteren krisenhaften und ökonomischen Phasen, die den Behörden Spiegel nicht nur redaktionell beschäftigten, sondern auch organisatorisch selbst herausforderten, ist unzweifelhaft die Pandemie zu nennen. Corona änderte alles. Zum einen wurde die gesamte Zeitungserstellung in Küche und Wohnzimmer der Beschäftigten verlegt. Zum anderen konnten mit dem nationalen Lockdown 2020 von einem auf den anderen Tag keine Seminare und keine Kongresse mehr stattfinden. Aufgrund der stabilen finanziellen Lage des Verlages konnte sich die-
ser auf eine bis dahin nicht geahnte Reise in die digitale Transformation begeben. Aus Seminaren wurden Webinare und aus Kongressen Online–Veranstaltungen. Der Behörden Spiegel richtete an seinen beiden Standorten Berlin und Bonn jeweils ein virtuelles TV-Studio ein und transformierte seine Inhalte in digitale Angebote. Hinzu kamen neue Formate wie Podcasts und ein E-Journal. Aber auch neue Kolleginnen und Kollegen, Kamera, Ton und Videobearbeitung.
Auch in dieser Phase galt es nicht nur, die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in der Wichtigkeit und Richtigkeit ihres Tuns zu bestätigen, sondern auch frühzeitig kritisch, die sich allzu häufig widersprechenden Allgemeinverfügungen zu hinterfragen. Es war eine Zeit, in welcher der Öffentliche Dienst vieles gut und schnell geregelt hat, doch an vielen Stellen auch zu Übertreibungen neigte, die bis dato noch nicht aufgearbeitet sind und auch im Öffentlichen Dienst selbst Zweifel am eigenen Tun hinterlassen haben.
Die Herausforderungen nehmen nicht ab
Die Zeit dreht sich heutzutage schneller als den meisten lieb ist. Immer ist der Öffentliche Dienst unmittelbar betroffen. Das hat zur Folge, dass Beamte und Angestellte bei Staat und Kommune häufig Vorgaben des Gesetzgebers und der Regierenden exekutieren müssen, die wenig Freude bei Bürgerinnen und Bürgern auslösen. Die Verteidigungsfähigkeit und damit die Wehrpflicht, Tariferhöhungen bei Bund und Kommunen, die zu höheren Gebühren für die Bürgerschaft führen werden, eine seit 2015 bis heute inkonsistente Migrationspolitik und nun ein Handelskrieg –alles beschäftigt den Öffentlichen Dienst in vielfältigster Weise. Wenn auch an der Spitze des Behörden Spiegel, in den Redaktionen und in der Kongress- und Seminarabteilung eine neue junge Generation Verantwortung trägt, bleibt es, wie es war – der Behörden Spiegel ist die notwendige, unabhängige und unparteiliche Stimme der Gesamtheit des Öffentlichen Dienstes. Er muss dies sein und tut es aus Überzeugung, wenn nicht schierer Notwendigkeit ohne externe finanzielle Unterstützung durch Regierungen, Parteien oder Stiftungen.

Exklusive dreiteilige Reihe „25 Jahre Verwaltungsdigitalisierung –Lernen aus der Vergangenheit?!“
Teil 17. MaiSubstanz statt Schaufensterdigitalisierung

Teil 222. MaiEntscheidungen und Steuerung zwischen Fragmentierung und Föderalismus
Teil 36. JuniAus Fehlern lernen, statt diese zu wiederholen
Weitere Informationen unter: www.digitaler-staat.online
In Kooperation mit:










Die thematischen Schwerpunkte der Botschaften variieren stark – und bieten interessante Einblicke. Denn in vielen Bereichen, etwa der Digitalisierung oder Kulturpolitik, können deutsche Diplomaten von ihren Gastländern einiges lernen.
Vielseitigkeit im Botschafteralltag
Der Botschafter Stephan Steinlein in Paris hat ein breites Aufgabenspektrum: Ein informelles Telefongespräch mit dem Élysée-Palast, ein offizieller Termin im Außenministerium oder eine Diskussionsrunde mit Wirtschaftsvertretern beider Länder – all das gehört zu seinem Alltag. Auch andernorts ist die Agenda vielseitig. In der Schweiz spricht man mit Botschafter Michael Flügger über Politik, Wirtschaft, Kultur und Militär. In Estland hingegen dominieren Themen rund um Digitalisierung den Austausch mit dem ständigen Vertreter Mario Sauder Smart-City-Konzepte, E-Government, Cyber-Sicherheit und hybride Bedrohungen stehen dort im Fokus – nicht zuletzt wegen der geografischen Nähe zu Russland.
„Von
Faxgeräten gibt es in Estland weit und breit keine Spur!“
Mario Sauder, Ständiger Vertreter der deutschen Botschaft in Estland
Die deutsche Botschaft in Bern ist durch die Präsenz vieler internationaler Organisationen auch in multilaterale Verhandlungen, etwa bei den Vereinten Nationen, eingebunden. Zudem betreut sie über ihre Rechts- und Konsularabteilung sowie mehrere Honorarkonsulate mehr als 450.000 Deutsche und Doppelstaatler in der Schweiz und in Liechtenstein.
Digitale Vorreiter – Deutschland im Rückspiegel
Mit der Passstelle in Bern betreibt Deutschland hier die weltweit größte Auslandsvertretung dieser Art. Beim Thema Digitalisierung geraten deutsche Botschaften oft ins
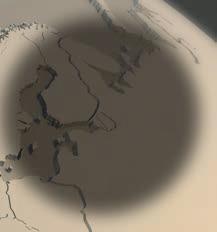
Europäische Partnerländer wünschen sich stärkere deutsche Rolle in der Sicherheitspolitik


Staunen – und nicht selten in Erklärungsnot. So bezeichnet Mario Sauder die Digitalisierung in Estland als „legendär“. Alles laufe digital und mit Signatur – von Faxgeräten sei „weit und breit keine Spur“. Auch in der Botschaft in Den Haag wird beobachtet, dass die niederländische Verwaltung in Sachen Digitalisierung weiter ist als Deutschland, wie Botschafter Dr. Nikolaus Meyer-Landrut anmerkt.
Allerdings bringen vollständig digitalisierte Prozesse auch Herausforderungen mit sich: „Manchmal fällt es schwer, Ansprechpartner zu finden, wenn sich Anliegen nicht digital klären lassen – wie etwa bei der Eröffnung eines Bankkontos“, so Meyer-Landrut
In Frankreich geht die Pflege der bilateralen Beziehungen sogar noch darüber hinaus. Kein anderes Land sei so eng mit der Bundesrepublik verbunden wie Frankreich, betont Botschafter Steinlein. Besonders beeindruckt ist er vom zivilgesellschaftlichen Engagement: „Im Wochenrhythmus stoße ich auf neue, spannende Initiativen.“
Baden in der Seine
Eine Anekdote, die Steinlein mit einem Augenzwinkern erzählt, hat mit den Olympischen Spielen 2024 zu tun. Die Stadt Paris hatte die Seine so weit gereinigt, dass dort die Triathlon-Wettbewerbe stattfinden konnten. Um diese Leistung zu feiern, lud die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo unter anderem den deutschen Botschafter ein, mit ihr in der Seine zu schwimmen.
An einem sonnigen Tag im Juli 2023 stand Steinlein in Badehose am Ufer – und stellte fest, dass das Wasser nicht nur recht kühl war, sondern alle anderen Teilnehmenden in Neoprenanzügen erschienen. Dank seiner Erfahrung aus den Berliner Seen konnte er sich aber auch ohne Neopren wohlfühlen.
Kulinarische Heimat fern der Heimat
Auch kulinarisch müssen deutsche Diplomaten nicht auf Vertrautes verzichten. In der deutschen Botschaft in Den Haag werden deutsche Weine und Biere ausgeschenkt. In der Schweiz hat sich der Küchenchef auf die Wünsche der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.
Bei Veranstaltungen wie dem Tag der Deutschen Einheit, dem Sommerfest oder dem Adventsmarkt


(BS/Paul Schubert) Deutschland unterhält diplomatische Beziehungen zu 193 Staaten und in Berlin sind 157 mit einer Botschaft vertreten. In den vergangenen vier Jahrzehnten wurden im Behörden Spiegel zahlreiche Botschafterinnen und Botschafter anderer Länder porträtiert. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Welche Geschichten erzählen die deutschen Repräsentanten im Ausland? Immerhin vertreten 154 hauptberufliche Botschafterinnen und Botschafter die Bundesrepublik weltweit. Manche von ihnen, wie etwa die deutsche Botschaft in Trinidad und Tobago, sind zusätzlich für bis zu neun weitere Karibikstaaten zuständig. Auch in Paris übernimmt Botschafter Stephan Steinlein eine Doppelfunktion und ist gleichzeitig für das Fürstentum Monaco verantwortlich.

werden Klassiker wie Currywurst, Bulette mit Schrippe oder Grünkohl mit Pinkel serviert – „Das kommt bei den Schweizern total gut an!“, erzählt Flügger
In Tallinn stehen Thüringer Bratwurst, Brezeln und Lübecker Marzipan auf dem Menü. Sowohl in Estland als auch in der Schweiz gilt: Die Kartoffel verbindet. „Da fällt es leicht, sich kulinarisch zu einigen“, so Sauder
Auch in Paris ist man Fan der Currywurst – insbesondere bei Events ,wie der Wahlnacht am 23. Februar. „Das kam hervorragend an!“, berichtet der Botschafter.
Die Forderung nach mehr deutscher Führungsrolle
In sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen zeigen viele Partnerländer klare Erwartungen an Deutschland. Besonders Estland schätzt Deutschland als „verlässlichen Partner und großen Unterstützer der Ukraine“, so Sauder. Von Berlin erhofft man sich eine aktive Rolle bei der Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur – in der NATO, der EU und bilateral. Ähnliches hört man aus Paris. „Die Rede des deutschen Bundeskanzlers zur Zeitenwende 2022 wurde aufmerksam registriert“, berichtet Steinlein. Eine Umfrage der deutschen Botschaft in Frankreich ergab, dass sich insbesondere die jungen Franzosen (19–24 Jahre) eine aktivere deutsche Rolle auf internationaler Bühne wünschen.
In der Schweiz würdigt man die engen persönlichen Kontakte zwischen Bundeswehr und Schweizer Armee. Flügger verweist besonders auf die Zusammenarbeit bei der Ausbildung.
modernes und zukunftsgerichtetes Bild von Deutschland zu vermitteln“.
Für Mario Sauder in Estland ist dieser Tag ein Höhepunkt des Jahres: „Ich nutze die Gelegenheit, um
„Die Rede des deutschen Bundeskanzlers zur Zeitenwende 2022 wurde aufmerksam registriert.“
Stephan Steinlein, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich und Monaco
Auch in den Niederlanden ist die sicherheitspolitische Partnerschaft eng. Meyer-Landrut hebt das seit über 30 Jahren bestehende Deutsch-Niederländische Corps hervor, das die Landstreitkräfte beider Länder auf „einzigartige Weise zusammenbringt“. Beide Staaten seien heute sicherheitspolitisch „untrennbar miteinander verbunden“.
Gemeinsam feiern am Nationalfeiertag Ein verbindendes Element in den deutschen Auslandsvertretungen ist der Tag der Deutschen Einheit. Weltweit richten die Botschaften an diesem Datum Empfänge aus. In den Niederlanden etwa lädt MeyerLandrut Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um „ein
auf die bilateralen Fixpunkte des vergangenen Jahres zu blicken und gemeinsam zu feiern.“ In Bern trifft man sich bei gutem Wetter auch im Garten – mit Live-Musik und traditionellen deutschen Klängen. Steinlein erinnert sich an einen besonderen Moment: 1990 war er als letzter Botschafter der DDR beim Empfang im Palais Beauharnais zu Gast – der heutigen Residenz des deutschen Botschafters in Paris. Seitdem wird der Feiertag dort jedes Jahr gemeinsam mit einem anderen deutschen Bundesland begangen. 2023 war der Freistaat Sachsen Partnerregion – eine bislang eher unbekannte Region in Frankreich. Doch der sächsische Wein, das traditionelle Handwerk und die innovative Tech-Szene stießen auf großes Interesse.

40 Jahre
(BS/Anne Mareile Moschinski) Knappe Kassen, Personalmangel – und die von allen Seiten geforderte Digitalisierung: Wie bleiben Kommunen in Zukunft handlungsfähig und wie gelingt Bürokratieabbau? Die Theorie zeichnet einen Weg vor.
www.behoerdenspiegel.de

„Derbeste Bürokratieabbau ist, unnötige Vorschriften gar nicht erst zu schaffen.“ Ein großes Ziel, das Dr. Uda Bastians in einem Statement für den Behörden Siegel formulierte – von dessen Umsetzung die Verwaltung aktuell aber noch ein ganzes Stück entfernt ist. Das ist mit ein Grund, weshalb die Beigeordnete der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetags (DST) 2021 die „Dresdner Forderungen“ mitverfasste.
Auf dem damaligen Fachkongress des IT-Planungsrats formulierte sie die Appelle für einen zukunftsfähigen, effizienten Öffentlichen Dienst gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Städten Leipzig, Freiburg, München, Köln und Essen.
Doch was braucht es, damit Städte und Gemeinden auch in Zukunft handlungsfähig bleiben?
Komplexe Zuständigkeiten reduzieren
Bastians vertritt dazu eine eindeutige Position: Neben einer vollumfänglichen Digitalisierung und einer gesicherten Finanzierung seien klare Zuständigkeiten die Grundpfeiler einer zukunftsfähigen Verwaltung. Die Inhalte der „Dresdner Forderungen“:
• Die Komplexität der Verantwortlichkeiten in der Verwaltung verringern und die digitale Daseinsvorsorge stärken
• Zentrale IT-Verfahren für zentrale Aufgaben
• Das OZG fungiert als Treiber für die Verwaltungsdigitalisierung und die Nutzerinnen und Nutzer stehen durch einen zentralen Support im Mittelpunkt der Verwaltungsarbeit
„Die Dresdner Forderungen zeigen den Weg – jetzt sind politische Ent-
scheidungen gefragt, um die Weichen für eine moderne, effiziente und bürgerfreundliche Verwaltung zu stellen“, sagt Bastians. Auch der Nationale Normenkontrollrat (NKR) befasst sich naturgemäß mit den Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Verwaltung. Er unterstreicht in dem Zusammenhang, dass die Belastungs- und Leistungsgrenze in vielen Kommunen bereits überschritten sei. Wie der Vorsitzende des NKR, Lutz Goebel, auf Anfrage des Behörden Spiegel mitteilte, sei vor allem die zersplitterte Aufgabenorganisation des Föderalismus ein Hemmschuh für die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. „Die Modernisierung der Verwaltung scheitert an strukturellen
„Deutschland muss aus der Phase der Problembeschreibung ins Handeln kommen.“
Lutz Goebel, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats
Grenzen“, sagt Goebel Anfang Februar veröffentlichte der NKR unter dem Titel „Bündelung im Föderalstaat“ ein neues Gutachten, das sich ebendiesem Thema widmet. Die zentrale Idee: Nur durch eine Bündelung von Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung gelingt der Neuanfang. Damit ließen sich die Leistungsfähigkeit des Staates und die Resilienz einer serviceorientierten Verwaltung stärken. Die in dem Gutachten formulierten Vorschläge für eine Bündelung
seien sofort umsetzbar, so der NKR. Dessen stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Sabine Kuhlmann machte bei der Vorstellung des Gutachtens deutlich: „Die Vorschläge können schrittweise angegangen werden, wir fordern nicht gleich die große Staatsreform.“
Die Dringlichkeit der Umsetzung unterstreicht auch Lutz Goebel „Deutschland muss aus der Phase der Problembeschreibung ins Handeln kommen“, sagt er. Dafür sei aber ein gemeinsames Bekenntnis von Bundes-, Landes- und Kommunalebenen zur Bündelung von Aufgaben nötig. Zwar sei schon länger zu beobachten, dass alle Ebenen Aufgaben zusammenziehen wollen – trotzdem stehe eine Einigung zwischen Bund und Ländern aus.
Fahrerlaubnisse zentral vom Bund ausstellen lassen
Wie sich Aufgaben in der Verwaltung konkret bündeln lassen, zeigt das NKR-Gutachten anhand dreier Beispielen auf: des Antrags und der Erteilung einer Fahrerlaubnis, der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und der Einkommensprüfung.
Hierzu führte Hannes Kühn, Leiter des Sekretariats des NKR, in einer Diskussionsrunde aus: Führerscheine sollten in Zukunft zentral gebündelt vom Kraftfahrtbundesamt ausgestellt werden. „Die Kommunen wären dann ganz raus“, erklärt Kühn. Der Bund könne das so regeln, ohne Änderung der bestehenden Gesetze. Einzige Voraussetzung sei, dass die Zentralität der Aufgaben gewährleistet ist und der Bund tatsächlich ohne Rückgriff auf die Vor-Ort-Infrastruktur der Kommunen auskommt. „Damit würden Personal-, Mitwirkungs- und Rechercheaufwand bei den Kommunen
sinken“, sagte Kühn. Rechtlich wäre die Bündelung im Falle der Fahrerlaubnis möglich, da der Bund die Gesetzgebungskompetenz für den Straßenverkehr und das Kraftfahrwesen besitzt. Somit könnte eine eigene Bundesbehörde mit der Ausstellung betraut werden. Im Detail solle die Beantragung über einen gemeinsamen digitalen Zugangskanal (Self-Service) auf einer zentralen Informations- und Antragsplattform
„Kommunen brauchen langfristige Finanzierungsmodelle, statt von kurzfristigen Förderprogrammen abhängig zu sein.“
Dr. Uda Bastians, Beigeordnete, Hauptgeschäftsstelle Deutscher Städtetag
erfolgen. Transfer- und Wartezeit würden damit reduziert. Grundsätzlich sollte aber nicht nur auf der Bundesebene gebündelt werden, sondern auch auf den Ebenen darunter, zwischen den Ländern oder auch innerhalb eines Landes. „Auch jetzt ist schon viel mehr möglich“, machte Kühn deutlich. Man müsse nicht warten, bis sich der Bund bewegt. Viele Formen der Bündelung seien auch auf den unteren Ebenen ohne Änderung des geltenden Rechts möglich.
Dr. Christian Ege, Staatssekretär
a.D. und Gründer der Anti-Bürokratisierungsinitiative „BürokratEASY“ macht in dem Zusammhang deutlich: „Zukunftsfähige Kommu-
nen brauchen Mut, Macht, Mittel – und Mitarbeiter, die sagen, welche 25 Prozent der Verwaltungsvorschriften verzichtbar sind, damit der Staat handlungsfähig bleibt." Bund und Länder müssten der kommunalen Ebene in Zukunft mehr zuhören, fordert er.
Gemeinschaftssteuern müssen neu aufgeteilt werden
Uda Bastians vom Deutschen Städtetag weist derweil darauf hin, dass auch bei einer Bündelung von Aufgaben ein Update des Grundgesetzes vorgenommen werden müsse. Denn dieses stamme aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und sei damit „weit vor jeder Digitalisierung“ aufgesetzt worden. Sie unterstreicht in dem Zusammenhang die Bedeutung einer „Digital-Ready-Gesetzgebung“ sowie eine nachhaltige Reformen der Finanzverteilung. „Kommunen brauchen langfristige Finanzierungsmodelle, statt von kurzfristigen Förderprogrammen abhängig zu sein“, macht Bastians deutlich. Damit Städte und Gemeinden in Zukunft bestehende Förderprogramme häufiger in Anspruch nehmen, müssten zentrale, standardisierte Antragsplattformen etabliert sowie der Abbau von bürokratischen Nachweispflichten vorangetrieben werden.
Nötig sei aber auch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. „Die neue Bundesregierung wird große Räder drehen müssen, damit die Kommunalfinanzen nicht komplett zusammenbrechen und die Städte endlich wieder vor Ort gestalten können“, prognostiziert Bastians und formuliert dabei einen weiteren Appell: Als erstes müssten die Gemeinschaftssteuern neu aufgeteilt werden.
Ob Klimaanpassung, Energiewende, soziale Gerechtigkeit oder nachhaltige Mobilitätskonzepte oder Digitalisierung – kaum ein Bereich kommunaler Verantwortung bleibt unberührt. Die gute Nachricht: Viele Kommunen handeln längst. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob, sondern wie wir nachhaltige Entwicklung wirksam und dauerhaft in der kommunalen Praxis verankern.
Vom Umweltgedanken zur integrierten Nachhaltigkeit
Ein Blick zurück zeigt, wie weit der Weg bereits gegangen ist. In den 1980er Jahren waren es klassische Umweltfragen wie Luftreinhaltung, Müllvermeidung und Gewässerschutz, die die ersten nachhaltigen Impulse in der Kommunalpolitik setzten. Mit der Agenda 21 nach dem Erdgipfel von Rio 1992 begannen viele Kommunen, Nachhaltigkeit strategisch zu denken – zunächst meist ökologisch fokussiert. Seit den 2000er Jahren hat sich das Verständnis verbreitert: Nachhaltigkeit wurde zur Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche kommunalen Handelns umfasst – von Stadtentwicklung über Bildung, Mobilität und Soziales bis hin zur Finanzpolitik. Netzwerke wie das Klima-Bündnis oder die Allianz nachhaltiger Kommunen trugen dazu bei, Wissen zu teilen und konkrete Umsetzungsstrategien zu entwickeln.
Nachhaltigkeit heute – strategisch, messbar, verbindlich Heute ist Nachhaltigkeit vielerorts fest in den Steuerungsstrukturen verankert. Immer mehr Kommunen setzen sich ambitionierte Ziele, richten Haushalte an Nachhaltigkeitskriterien aus, arbeiten mit Indikatorensystemen und entwickeln ressortübergreifende Strategien. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen für nach-
Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt und will bis zum Jahr 2030 80 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken und die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent senken. Dies bedeutet, dass die Energieeffizienz gesteigert und die sogenannte Sektorenkopplung vorangetrieben werden muss. Die selbst gesteckten Ausbauziele der erneuerbaren Energien werden bisher so gut wie nicht erfüllt, auch wenn sich jüngst das Ausbautempo vor allem der Solarenergie deutlich erhöht hat. Eine große Lücke ist nach wie vor beim Ausbau der Windenergie zu beobachten. Das Ausbautempo sowohl bei Windenergie an Land als auch auf See müsste verdreifacht werden, um die Ziele noch erreichen zu können.
Große Chancen für Kommunen
Enorme Investitionen sind nötig, um den Ausbau der erneuerbaren Energien, Wasserstoff, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge samt Infrastrukturen voranzutreiben. Die genaue Höhe dieser Investitionen ist aufgrund unterschiedlicher Annahmen schwierig abzuschätzen. Der so genannte Fortschrittsmonitor Energiewende von EY und Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geht davon aus, dass dazu 721 Milliarden Euro allein bis 2030, also mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr benötigt werden. Knapp die Hälfte dieser Investitionen werden laut dieser Studie allein in die Energieerzeugung investiert werden müssen. Die Höhe der Investitionen ist zwar beträchtlich, sie können aber auch
(BS/Dr. Kirsten Witte) Nachhaltigkeit ist längst kein abstrakter Zukunftsbegriff mehr – sie ist zur bedeutenden Herausforderung und Gestaltungsperspektive für Kommunen geworden. Städte, Landkreise und Gemeinden stehen heute an zentraler Stelle der gesellschaftlichen Transformation.

Kommunen im Wandel: Ob Energie, Mobilität oder Beteiligung – nachhaltige Entwicklung beginnt vor Ort. Foto: BS/slavun, stock.adobe.com
haltige Entwicklung (SDGs) dient dabei als globaler Rahmen – lokal konkret umgesetzt. Für die strategische Steuerung gewinnen datenbasierte Ansätze zunehmend an Bedeutung. Das SDG-Portal der Bertelsmann Stiftung (sdg-portal.de) stellt dafür ein wichtiges Instrument dar: Es ermöglicht Kommunen, ihre Entwicklung anhand relevanter Nachhaltigkeitsindikatoren zu analysieren und zu vergleichen. So wird Nachhaltigkeit nicht nur politisch formuliert, sondern auch messbar gemacht – eine zentrale Voraussetzung für wirkungsvolles Handeln. Zugleich verändert sich die Verwaltungskultur: Weg vom Silo, hin zu vernetztem Arbeiten. Nachhaltigkeit wird nicht mehr als Zusatz-
aufgabe gesehen, sondern als Gestaltungsprinzip. Im KGSt-Bericht 02/24 zum Kommunalen Nachhaltigkeitsmanagement haben die KGSt, die Bertelsmann Stiftung und zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Kommunen ein Steuerungsmodell erarbeitet, das Kommunen den Einstieg deutlich erleichtert.
Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken
Ein zentrales Thema der Gegenwart ist die Verknüpfung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Potenziale sind groß: Digitale Tools können Energienetze steuern, Verkehrsflüsse optimieren oder Bürgerbeteiligung stärken. Doch Digitalisierung darf kein Selbstzweck
sein – sie muss auf soziale Gerechtigkeit, ökologische Tragfähigkeit und wirtschaftliche Resilienz ausgerichtet sein. Eine wirklich nachhaltige Kommune denkt daher digital und gemeinwohlorientiert: mit transparenten Beteiligungsformaten, nachhaltiger IT-Infrastruktur und datenbasierter Entscheidungsfindung. Viele Städte gehen hier bereits voran – doch der flächendeckende Kulturwandel steht erst am Anfang.
Die nächste Etappe: Nachhaltigkeit systemisch denken Nachhaltigkeit darf nicht projektbezogen bleiben – sie muss institutionalisiert werden. Dazu gehört eine strategische Zielsteuerung ebenso wie ein Umdenken in Haushaltslogiken, Personalentwicklung und Organisationskultur. Nachhaltigkeit in Kommunen braucht Kompetenzen, Kooperationen und politische Rückendeckung. Gleichzeitig werden neue Partnerschaften entscheidend: Viele Kommunen öffnen sich verstärkt für Kooperationen mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. Reallabore, Nachhaltigkeitsbeiräte oder Allianzen auf regionaler Ebene zeigen, dass Nachhaltigkeit in der Kommune heute auch ein Prozess gesellschaftlicher Co-Produktion ist.
Gemeinsam mit Partnern arbeitet die Bertelsmann Stiftung gerade daran, ihr SDG-Portal zu einer Digitalen Plattform für Nachhaltige Kommunen weiterzuentwickeln. Neben Indikatoren und Daten sollen hier
Die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende (BS/Prof. Dr. Claudia Kemfert) Die Energiewende ist nicht nur ein nationales Großprojekt, sondern entfaltet ihre Wirkung vor allem lokal: In den Kommunen werden Windräder gebaut, Gebäude saniert und Mobilitätswende gestaltet – dort entscheidet sich, ob die Energiewende gelingt. Eine Bestandsaufnahme – und ein Blick in die Zukunft.
erheblich zum Wachstum und zur Wertschöpfung beitragen – insbesondere regional. Die wirtschaftlichen Chancen sind gerade für Kommunen groß, denn in vielen Fällen sind die Kommunen die zentralen Akteure bei der Umsetzung der Energiewende: Neben einer direkten Wertschöpfung und der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die beispielsweise durch neue Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien entstehen, können indirekte Wertschöpfungseffekte generiert werden. Mittlerweile gibt es immer mehr Kommunen, die die Energiewende aktiv und dezentral umsetzen und die von der Energiewende profitieren. Vor allem können enorme Energiemengen, -kosten und Treibhausgase durch eine verbesserte Energieeffizienz im Gebäudebereich erzielt werden. So sind viele Kommunen aktiv, wenn es darum geht, Energie in öffentlichen Gebäuden einzusparen oder auch den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern und die Innenstädte emissionsfrei zu bekommen.
Auf die Menschen kommt es an Dem verstärkten Einsatz der Elektromobilität auf der Straße und der Schiene kommt neben der Einführung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung eine zentrale Rolle zu. Die Energiewende ist also

Die Energiewende ist ein Fortschrittsmotor, von dem alle profitieren können. Foto: BS/peterschreiber.media, stock.adobe.com
nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch der Wirtschaftsmotor der Zukunft. Laut der oben erwähnten Studie von EY und BDEW können die bis 2030 erforderlichen Investitionen eine Bruttowertschöpfung von über 52 Milliarden Euro pro Jahr anstoßen. Dies entspricht 1,5 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. Für das vergangene Jahr wird die durch die Energiewende tatsächlich ausgelöste Bruttowertschöpfung auf über 28 Milliarden Euro geschätzt. Damit konnte gut die Hälfte des jährlichen Potenzials realisiert werden. Dies liegt vor allem an dem im Jahr 2023 erfolgten Ausbau der Stromerzeugung und der Stromnetze. Doch hängt das Gelingen der Energiewende auch von vielen aktiven Bürgerinnen und Bürgern ab. Ca.
auch Instrumente für Nachhaltigkeitssteuerung und gebündelte Informationen zahlreicher Partner zur Verfügung gestellt werden. Neben den Kommunalen Spitzenverbänden sind der Rat für Nachhaltige Entwicklung, das Deutsche Institut für Urbanistik, die KGSt, ICLEI, Engagement Global und der RGRE in das Projekt eingebunden.
Zukunft ist kommunal – und sie beginnt jetzt
Klimakrise, soziale Ungleichheit, Energie- und Ressourcenfragen machen deutlich: Die nächsten Jahre werden entscheidend. Kommunen haben dabei eine doppelte Verantwortung – als Gestalterinnen und als Vorbilder. Sie können zeigen, dass nachhaltige Entwicklung nicht Verzicht bedeutet, sondern Lebensqualität, Zukunftsfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Dieser Wandel ist anspruchsvoll, aber machbar – wenn er denn politisch gewollt, strategisch gedacht und konsequent umgesetzt wird. Kommunen haben das Potenzial, zum Rückgrat einer nachhaltigen Gesellschaft zu werden. Dafür braucht es Mut, klare Leitbilder –und den festen Willen, aus guten Ansätzen strukturelle Wirklichkeit zu machen.
Auch in den kommenden Jahrzehnten wird der Behörden Spiegel diesen Weg begleiten – als Plattform für Austausch, Impulse und Inspiration. Die Zukunft ist kommunal –und sie beginnt nicht irgendwann, sondern jetzt!

Dr. Kirsten Witte ist Leiterin des Zentrums für nachhaltige Kommunen bei der Bertelsmann Stiftung. Foto: BS/privat
ordnung her ein noch immer wesentlicher Bestandteil der Energiewende, auch wenn sich der Anteil nach einem deutlichen Anstieg bis zum Jahr 2014 aufgrund erschwerter Rahmenbedingungen nicht weiter erhöht hat. Bürgerenergieanlagen bringen vor allem den Zubau von Windenergie an Land beständig voran. Aufgrund der jüngst deutlich verbesserten Rahmenbedingungen dürfte auch die Beteiligung an Photovoltaikanlagen wieder zunehmen. Die Bürgerbeteiligung treibt nicht nur die Energiewende voran, sondern stärkt auch die Akzeptanz für die notwendigen Maßnahmen und damit die Demokratie.
1,5 Millionen Menschen generieren aktuell ihre eigene Energie. Die Energiewende wird zu großen Anteilen noch immer von Privatpersonen vorangetrieben, aktuell gehen etwa 30 Prozent der gesamten Investitionen in erneuerbaren Energien auf Privatpersonen zurück.
Energiewende schafft
Bürgerenergie Gerade zu Beginn der Energiewende stieg die Anzahl der Energiegenossenschaften rasant an, die eine wichtige Form von Bürgerenergie sind. Als Bürgerenergie werden Projekte bezeichnet, in denen Bürger oder lokale Unternehmen Eigenkapital in erneuerbare Energieanlagen investieren.
Bürgerenergieprojekte sind somit in Deutschland von ihrer Größen-
Die Energiewende samt Ausbau erneuerbarer Energien, Installation von Speichern und Netzen erfordert große Mengen an Investitionen, die wiederum enorme wirtschaftliche und Chancen wie regionale Wertschöpfungen samt zukunftsfähigen Arbeitsplätzen schaffen. Doch auch überregional ist der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht nur in puncto Klimaschutz von enormer strategischer Bedeutung. In Kombination mit dadurch angestoßenen technologischen Neuerungen schafft er auch bei Einhaltung der Klimaschutzziele Spielräume für Wohlstandswachstum.

Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Foto: BS/Oliver Betke
Sperrmüll, Bioabfälle, Altbatterien und Papier – die Siedlungsabfälle der privaten Haushalte sollen bis 2035 drastisch reduziert werden. Der Plan der Landeshauptstadt: Pro Kopf und Jahr 15 Prozent weniger Müll. Auch in puncto Restmüll strebt Kiel eine radikale Kehrtwende an: Pro Kopf und Jahr ist hier eine Reduktion um 50 Prozent avisiert.
„Wir alle werfen zu viel weg“, erklärt die Kieler Stadträtin Alke Voß
„Dagegen wollen wir das tun, was wir auf lokaler Ebene tun können.“ 2020 hat die Stadt aus diesem Grund neues Terrain beschritten: Als erste Kommune Deutschlands entwickelte sie unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein Zero Waste-Konzept. Im Februar 2023 wird sie damit zur ersten zertifizierten „Zero Waste City“ der Republik. Die 100 erarbeiteten Maßnahmen zur Abfallvermeidung überzeugen das internationale Netzwerk Zero Waste Europe, das für die Vergabe der Zertifikate zuständig ist.
Begrenzte Ressourcen minimal nutzen
„Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung stehen wir vor der dringenden Herausforderung, die begrenzten Ressourcen unseres Planeten möglichst umweltfreund-
Wer die Frage mit „Ja“ beantwortet, hat vollkommen recht. Denn gerade in den Filtern der Zigaretten, die die schlimmsten Schadstoffe von unserem Körper fernhalten sollen, sammeln sich eben besagte Schadstoffe hochkonzentriert. Wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erklärt, seien darunter Stoffe wie Arsen, Blausäure und Schwermetalle (z. B. Blei und Kupfer). Und nicht zu vergessen das Nervengift Nikotin. Da diese Stoffe wasserlöslich sind, bedarf es nur eines ca. 30-minütigen Regenschauers, damit die Hälfte der gut 7000 Substanzen in die Umwelt (und ins Grundwasser) gelangen. Und damit nicht genug. Auch der Filter selbst gibt bei der langjährigen Zersetzung Mikroplastik an seine Umwelt ab, da er aus Kunststoff besteht. All diese Stoffe schaden Fischen, Vögeln und Kleinsttieren und schädigen somit auch das Ökosystem. Zusätzlich zu diesen unschönen Folgen, bringen sie außer-

Zero Waste-Strategien für Kommunen
(BS/Anne Mareile Moschinski) Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft gehören zu den entscheidenden Zukunftsthemen für die kommunale Verwaltung. Was es auf dem Weg dahin braucht, zeigt die Stadt Kiel als erste Zero Waste-City Deutschlands.

Die begrenzten Ressourcen des Planeten möglichst umweltfreundlich nutzen: Immer mehr Kommunen wollen durch Zero Waste-Strategien dieses Ziel umsetzen. Foto: BS/Imagecreator, stock.adobe.com
lich und minimal zu nutzen.“ Mit diesem Satz umreißt Zero Waste Germany das Ziel, das es für die Kommunen umzusetzen gilt. Wie erstrebenswert eine solch effektive Kreislaufwirtschaft für die Städte und Gemeinden tatsächlich ist, er-
läutert Maic Verbücheln, Projektleiter des Forschungsbereichs Umwelt am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu). „Die Zukunft für eine Zero Waste-Abfallwirtschaft auf der lokalen Ebene ist vielversprechend“, sagt er. Bereits jetzt würden immer
mehr Kommunen Zero Waste-Maßnahmen nutzen, um „eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft einzuführen, Ressourcen zu schonen und den CO2-Ausstoß zu senken“. Grundlegend für die Umsetzung sei allerdings der Faktor Bürgerbeteiligung. Abfallvermeidung, Reparatur und Recycling funktionieren nur, wenn auch die Einwohnenden vor Ort mit am Strang ziehen. Ohne Mülltrennung und Mehrwegnutzung rückt das Ziel einer „abfallarmen Gesellschaft“ in weite Ferne. In Kiel war die Integration der Bürgerinnen und Bürger von Anfang an Teil des Erfolgsrezeptes: Rund 450 Einwohnende beteiligten sich an der Erstellung des Zero WasteKonzepts. Daraus entstanden 600 Beiträge, die zu 107 Maßnahmen zusammengefasst wurden. Den Weg hin zu einer abfallfreien Kommune haben mittlerweile auch andere Städte eingeschlagen. So sind unter anderem Regensburg
Kommunale Lösungsansätze gegen Zigarettenstummel und Einweg-Vapes (BS/Scarlett Lüsser) Dass Zigarettenstummel gerne mal auf dem Boden landen, ist in vielen Ländern normal. So normal, dass es laut der World Health Organisation (WHO) zwei Drittel aller gerauchten Zigaretten betrifft. Und wo Zigaretten schon für den menschlichen Körper hochgradig schädlich sind, kann das für die Umwelt auch nicht gut sein, oder?
dem noch schlechte Nebeneffekte mit sich: Sie begünstigen z. B. das Wachstum von giftigen Blaualgen in Gewässern, wie das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin herausfand.
Gespaltene Meinungen
Wie man damit umgehen soll, dafür gibt es noch keine Gesamtlösung. Der Leiter der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz in Tübingen, Bernd Schott, zeigt sich pessimistisch. Zwar gäbe es in den Bundesländern bereits verwendbare Bußgelder für das achtlose Wegwerfen von Zigaretten, jedoch sei der damit verbundene Aufwand für die Ordnungsämter kaum zu stemmen. Denn da die Ordnungs-
hüter – anders als die Polizei – niemanden festhalten dürften, sei es für die Übeltäter sehr einfach, dem Bußgeld zu entgehen. Für ihn wäre eine flächendeckende Aufklärung zum Thema ein möglicher Schlüssel, um die schiere Menge an weggeworfenen Zigarettenstummel zu reduzieren.
Der Umweltaktivist Arno Meyer von cleanup.saarland e. V. ist dagegen der Ansicht, dass Aufklärung schon zur Genüge versucht wurde und nicht wirklich weiterhilft. „Eine Zigarettenkippe ist etwas sehr Giftiges, potenziell tödlich und da wäre es nicht zu viel verlangt, dass ein Raucher jederzeit diesen Sondermüll sicher aufbewahren kann“, ist Meyer der Ansicht. Daher plädiert



und München dem Kieler Vorbild gefolgt und befinden sich aktuell im Zertifizierungsprozess für den Status „Zero Waste City“. In der Koalitionsvereinbarung des Regensburger Stadtrats ist beispielsweise zu lesen: „Wir vollziehen langfristig einen Wandel vom Abfall- hin zum Ressourcenmanagement“. Dabei solle Abfallvermeidung kein Selbstzweck sein, stattdessen werde ein aktiver Beitrag für den gesellschaftlichen Wandel zu einem nachhaltigeren Stadtleben angestrebt.
Zero Waste-Picknicks und Reparatur-Events
„Abfall zu vermeiden, muss den Menschen Freude machen“, sagt die Kieler Stadträtin Alke Voß. Die Stadt habe deshalb verschiedene Aktionen gestartet: „Schnippel-Partys“ zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Reparatur-Events und Zero Waste-Picknicks. „Wir sind in Kiel jetzt schon sehr weit bei der Abfallvermeidung. Auch in Zukunft wollen wir zu den Zero Waste-Pionieren gehören“, formuliert Voß das Credo. Den ersten Grundstein dazu legte die Stadt bereits: Für ihr Abfallvermeidungskonzept wurde sie vom Netzwerk Zero Waste Germany mit einem von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet.
er für die Einführung einer Pflicht zum Mitführen eines Taschenaschenbechers, denn diese könne man leichter stichprobenartig überprüfen und für Verstöße Bußgelder verhängen. Doch egal, welcher Ansatz gewählt wird, die Zigaretten sind längst nicht mehr das einzige Tabak-Abfallproblem in Deutschland. Seit ein paar Jahren gibt es noch eine zusätzliche Umweltbelastung in Form von Einweg-Vapes. Diese elektronischen Produkte werden ebenfalls häufig ins Gebüsch geworfen und selbst wenn sie ihren Weg in den Mülleimer finden, gehören sie dort nicht hin. Denn als Elektroartikel mit einer Batterie müssen sie gesondert entsorgt werden.

Um die hohe Abfallquote von Einweg-Vapes zu senken, sieht Schott nur einen Weg: „Also sowas geht, glaube ich, nur mit hohen Pfandsätzen, die die Rücknahme und dann die sachgerechte Entsorgung gewährleisten.“ Doch auch für eine bundesweite Pfandpflicht sieht er schwarz. Denn in der Politik sehe es nicht so aus, als würde sich hier bald etwas tun. Und für kommunale oder kreisangehörige Kommune sei das gar nicht lösbar, denn man könne die Vape in einen Ort kaufen und im Nachbarort verwenden, sodass eine kommunale Lösung wenig helfen würde.
Ob Zigarettenstummel oder Einweg-Vape – am Ende des Tages hilft es schon, wenn sich jeder an die eigene Nase fasst oder vielleicht auch im Freundeskreis daran erinnert, dass solche Erzeugnisse nicht in unsere Umwelt gehören. Denn wenn jeder von uns vor der sprichwörtlichen eigenen Haustür kehrt, ist das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.


Mit großem Dank blicken wir auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Behörden Spiegel zurück und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zukunft.
Für die kommenden Jahre wünschen wir weiterhin viel Erfolg und alles Gute!
Ihre SVA System Vertrieb Alexander GmbH




Dafür existieren viele Konzepte, von unterschiedlichen Arten der Vereinsförderung und -bezuschussung, über Vereinslotsen, bis hin zur Unterstützung bei der Organisation von Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen und ähnlichem. So sind, gerade bei den bürokratischen Hürden, die beispielsweise ein neuer Verein nehmen muss, Vereinslotsen gefragt. Ein Beispiel dafür liefert der Landkreis Sankt Wendel, der zu den 18 Landkreisen gehört, die im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) das Verbundprojekt Hauptamt stärkt Ehrenamt (HasE) durchführen. Dabei dienen die Vereinslotsen als Bindeglied zwischen Vereinen und dem HasE-Team, erklärt Tina Noack von der Stabsstelle Ehrenamt des Landkreises.
Bürokratische Hürden überwinden Sie seien die Ansprechpartner vor Ort und könnten die Anliegen der Vereine entweder direkt lösen, oder an das HasE-Team weiterleiten. Zusätzlich informierten die Lotsen auch über wichtige aktuelle Themen wie Fördermittel und Finanzierungsmöglichkeiten und nähmen regelmäßig an Austauschtreffen teil, so Noak. Um die konkreten Bedürfnisse der Kommunen vor Ort zu berücksichtigen, stünden diese in engem Austausch mit dem Landkreis, um Dopplungen zu vermeiden und Ressourcen effektiv zu nutzen. Durch eine enge Vernetzung können so „Schulungsangebote, Vereinsberatungen und sonstige Hilfestellungen“ dezentral angeboten werden.
Unterstützt werden sie dabei auch durch das HasE-Team: „Neben Informationen, Beratung, Qualifizierung und Vernetzung werden Vereine und Organisationen bei der alltäglichen Vereinsarbeit unterstützt und begleitet“, so Noack Durch Workshops und Seminare, einer Ehrenamtbörse für die Suche nach Helferinnen und Helfern und einer Wissensdatenbank werde das
Sie erbringen den Großteil der Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen und sind in der Regel der erste Ansprechpartner vor Ort. Sie müssen sich also fragen, wie sie ihre Verwaltungsorganisation für die Zukunft aufstellen möchten, um ihre Leistungsfähigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Eine Lösung für alle wird es dabei nicht geben –denn jede Kommune ist anders, mit unterschiedlicher geographischer Lage, Bevölkerungsstruktur oder Ressourcenausstattung. Welche Verwaltungsstrukturen kann sich eine Kommune personell und finanziell leisten, was erwarten Bürger und Unternehmen? Welche weiteren Faktoren beeinflussen das Verwaltungshandeln? Für unterschiedliche Ausgangslagen sind ganz unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten denkbar. Wie diese aussehen könnten, lässt sich mit Zukunftsszenarien beschreiben. Wir haben mithilfe der Szenarioachsen-Methode vier mögliche Szenarien für das Jahr 2040 gezeichnet. Entwickelt wurden diese Zukunftswelten erstmals im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts für den öffentlichen Sektor im Jahr 2016. Zwei Aspekte wurden dafür unabhängig voneinander simuliert und auf zwei Szenarioachsen miteinander kombiniert: Der Aktivitätsgrad der Menschen – die Frage also, ob eher aktivistische „Tu-Bürger“ oder bequeme Leute, die möglichst wenig mit dem Staat zu tun
Kommunale Förderung für Vereine und Ehrenamt
(BS/Scarlett Lüsser) Das Sportcamp, zu dem das Kind am Wochenende gefahren ist, kann nur stattfinden, weil sich viele Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren und weitere Angebote wie Gesangs- oder Orchestervereine überhaupt erst ermöglichen. Damit diese kulturschaffende Vielfalt erhalten bleibt, müssen Kommunen unterstützen.

Vereine und ehrenamtliche Organisationen schaffen einen sozialen Mehrwert für ihre Gemeinden und sollten dafür nach besten Kräften von der Gemeinde unterstützt werden. Foto: BS/Coloures-Pic, stock.adobe.com
Angebot abgerundet. Ein Beispiel, wie es auch ohne Unterstützung vom Bund funktionieren kann, liefert Mannheim. Die Stadt habe seit Mitte 2024 eine neue Förderrichtlinie für Vereine eingeführt, „um identitätsstiftende Veranstaltungen in der Stadt und den Stadtteilen langfristig zu sichern“. Diese finanzielle Unterstützung richte sich gezielt an Vereine, die größere Veranstaltungen wie Stadtteilfeste, Fastnachtsumzüge oder Weihnachtsmärkte organisieren. „Gefördert werden dabei unter anderem Mieten für Technik, Straßensperrungen, Toiletten oder
Sicherheitskonzepte. Die Richtlinie regelt zudem das Antragsverfahren, förderfähige Kosten sowie die maximale Fördersumme“, erläutert eine Sprecherin der Stadt. Die Nachfrage sei dabei recht hoch, bereits 2024 habe man aus dem Vereinsfonds 13 Veranstaltungen unterstützt, für dieses Jahr liegen bereits über 20 Anträge vor. Dazu äußert sich auch Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht: „Der Veranstaltungsfonds trägt dazu bei, dass Vereine ihre öffentlichen Veranstaltungen trotz knapper Ressourcen, steigender Preise und zunehmender Auflagen
von Bund und Land auch künftig auf einer wirtschaftlich sicheren Basis durchführen können.“ Zusätzlich habe die Stadt auch einen Vereinsbeauftragten berufen, der ähnliche Aufgaben erfüllt, wie die Sankt Wendeler Vereinslotsen und das HasE-Team.
Dankbarkeit auch zeigen Für Specht ist die Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit von Vereinen und ähnlichem gleichzeitig auch der Stadt zuträglich: „Vereine und Interessengemeinschaften sind eine zentrale Säule unserer Stadtgesellschaft, fördern den Ge-
Vier Szenarien für die Kommunalverwaltung
(BS/Dr. Ferdinand Schuster/Franziska Holler) Die öffentliche Verwaltung in Deutschland befindet sich im Umbruch: fehlende Fachkräfte, leere Kassen und rasanter technologischer Wandel üben zunehmend Veränderungsdruck aus. Vor allem trifft es die Kommunen.
haben wollen, dominieren – und ob sie voll digital unterwegs sind oder doch lieber analog bedient werden möchten.
Vier mögliche Verwaltungsarten
Die Online-Discounter-Verwaltung ist vollständig auf zentral vorgehaltene Online-Verfahren umgestellt. Die Verwaltung hat sich aus der Fläche komplett zurückgezogen, Bürgerämter vor Ort werden nicht mehr benötigt. Die persönliche Identifikation erfolgt durch die digitale Ausweisfunktion, biometrische Daten und elektronische Konten. Fragen beantworten Chatbots, sie leisten auch Hilfestellung bei der Formularbearbeitung. Automatisierte Verfahren reduzieren den Personaleinsatz für die Verwaltung, durch vernetzte Register und das Once-Only-Prinzip ist auch der Aufwand für Antragstellerinnen und Antragsteller sehr gering. Mit der kollaborativen Online-Verwaltung entsteht eine Verwaltung zum Mitmachen. Sie ermöglicht ebenfalls die digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen, bietet aber auch eine Online-Plattform zum partizipativen Austausch der Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern. Mit einem eigenen Avatar kann man sich durch die digitale
meinschaftssinn und stiften Identität.“
Auch Jan Holze, der Gründungsvorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), ist der Ansicht, dass konkrete Ansprechpersonen in der Kommunalverwaltung viel wert sein können. Gerade „um Hilfe bei der Orientierung im Behördenoder Förderdschungel zu erhalten“, seien diese Beratungen immer sehr gefragt. Doch auch um die Ehrenamtlichen zu würdigen, könnten Kommunen viel tun: „Ob ein Dankeschönabend für Ehrenamtliche oder regelmäßige Berichterstattung im Amtsblatt.“ Um Kommunen dabei zu unterstützen, hält auch das DSEE vielfältige kostenfreie Angebote bereit, meint Holze Aber das ist nicht alles, was die DSEE für das deutsche Ehrenamt und Vereine tut.
Selbst kleine Beträge helfen Laut Holze können auch kleine Förderbeträge einen großen Unterschied machen, weshalb auch 2025 das Mikroförderprogramm zur Ehrenamtsförderung für strukturschwache und ländliche Räume des DSEE angeboten wird. Damit können „verschiedenste Vorhaben von gemeinnützigen Organisationen mit bis zu 1.500 Euro“ bezuschusst werden. „Gefördert werden zum Beispiel Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche, Anschaffungen für die Vereinsarbeit oder auch Veranstaltungen zur Wertschätzung der Engagierten“, so Holze. Dieses Programm habe schon tausende Vorhaben von Vereinen und Ehrenamtlichen in ganz Deutschland einfach und unbürokratisch ermöglicht.
Apropos unbürokratisch: Bei all diesen Maßnahmen, Lotsen und Beauftragten liegt eine Überlegung nahe: Vielleicht wären diese konkreten Ansprechpersonen in Behörden gar nicht nötig, wenn die bürokratischen Hürden für Vereine und Ehrenamtliche nicht so hoch angesetzt wären.
Offenbar gibt es doch noch viele „analoge Leute“, die digitale Angebote nicht wahrnehmen. Selbst dort, wo digitale Leistungen inzwischen verfügbar sind, werden sie nicht vollumfänglich genutzt, auch im scheinbar digital-affinen Berlin – der Heimat vieler Tech-Start-ups - sind sie kein Selbstläufer: So ist dort zum Beispiel seit Oktober 2024 die digitale Wohnsitzanmeldung möglich, doch laut Presseinformation wird sie in den ersten Monaten noch nicht einmal zu zehn Prozent genutzt. Ob die analoge Verwaltung jemals ihre Relevanz verlieren wird, ist also noch nicht abzusehen. Eine Blitzumfrage des Instituts für den öffentlichen Sektor hat ergeben: Unter rund 160 Befragten aus dem öffentlichen Sektor meint immerhin ein Drittel, dass es auch in mehr als zwei Jahren noch einen Bedarf für Faxgeräte geben wird.

Viele Elemente der vor rund zehn Jahren entwickelten Szenarien liegen auch heute noch in der Zukunft. Veränderungen hat es vor allem im digitalen Verwaltungsangebot gegeben – doch zum Standard ist dies noch immer nicht geworden.
Verwaltungswelt bewegen. Je nach Angabe der Lebenslagen bzw. Präferenzen werden im persönlichen Profilbereich der Bürgerinnen und Bürger bzw. Unternehmen relevante Verwaltungsvorgänge und die nötigen digitalen Formulare bereitgestellt. Parallel können über die Plattform Anliegen kommuniziert werden, außerdem ist eine Beteiligung bei öffentlichen Entscheidungsprozessen oder Bürgerinitiativen möglich. Eine andere Möglichkeit bietet die Tante-Emma-Verwaltung. Diese ist noch in der Fläche präsent, allerdings in veränderter Form. Um keinen zeitlichen oder organisatorischen Mehraufwand zu erzeugen, können Verwaltungsgänge bequem im Zusammenhang mit anderen Dienstleistungen etwa in Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten oder Banken erledigt werden. Die öffentliche Hand hat ihre eigene Verwaltungsinfrastruktur weitestgehend aufgegeben und vergibt stattdessen Konzessionen an Private. Die jeweiligen Leistungserbringer vor Ort kennen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und bieten bei Nachfrage individuelle Lösungen an. Der Servicegedanke steht bei der Boutique-Verwaltung im Vordergrund. Es gibt zahlreiche Spezialbehörden, die auf bestimmte Lebenslagen fokussiert sind. In personalintensiven persönlichen Gesprächen wird jeweils nach maßgeschneiderten Lösungen für die individuellen Bedürfnisse gesucht. Im Übrigen agiert die Verwaltung wo möglich antragslos und versteht sich als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger. Verwaltungsangestellte bezeichnen sich als „Bürgerberater“. Ein Premium-Pay-Modell ermöglicht noch mehr Serviceleistung für zahlungswillige Nutzerinnen und Nutzer. Durch zusätzliche Gebühren können auch die hohen Personalkosten für individuelle Beratung abgedeckt werden. Zukunft der Kommunen Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eines dieser vier Szenarien in Reinform eintreten wird – realistischer werden vielmehr Kombinationen aus diesen vier möglichen Verwaltungstypen sein, je nach individueller Lage der Kommune.

Franziska Holler ist Projektleiterin im Institut für den öffentlichen Sektor und leitet eine Initiative zur Vernetzung von Start-ups. Foto: BS/privat Dr. Ferdinand Schuster ist Geschäftsführer des Instituts für den öffentlicher Sektor und verantwortlich für die Studienvorhaben. Foto: BS/privat
Durch das vorzeitige AmpelAus wurden viele wichtige Vorhaben nicht umgesetzt. Auch wurde der Bundeshaushalt 2025 nicht beschlossen, weshalb nun die vorläufige Haushaltsführung greift. Somit sind nur gesetzlich verpflichtende Ausgaben möglich. Freiwillige Leistungen wie der Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) stehen dagegen auf der Kippe. Dabei hatte der KJP noch Ende letzten Jahres in einer Pressemitteilung darauf gedrängt, dass eine „bedarfsgerechte Ausstattung des KJP dringend notwendig“ sei, „um steigenden Personal- und Maßnahmenkosten gerecht zu werden“. Bereits vor Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung seien Kinderund Jugendangebote chronisch unterfinanziert gewesen. Was passiert, wenn Kommunen die fehlenden Mittel nicht kompensieren können, zeigt sich in Köln und Berlin.
Kölner Kürzungswende
Eklatante Finanzierungslücken sind in der Domstadt beinah zur Gewohnheit geworden. So preist der Kölner Doppelhaushalt 2025/26 ein Defizit von fast 400 Millionen Euro ein. Einsparungen sind unumgänglich – und treffen vor allem Kinderund Jugendangebote: Geplant sind unter anderem eine Erhöhung der Kitabeiträge, Kürzungen bei offenen Ganztagsschulen sowie bei der Jugendverbandsarbeit, bei letzterer beträgt die Kürzung 32 Prozent. „Ferienfreizeiten können sich dann nur noch reiche Familien leisten“, kritisierte der Geschäftsführer des Kölner Kinder- und Jugendrings Thorsten Buff. Auch die Kölner Sportjugend schlug auf Nachfrage Alarm: „Sport ist Bildung. Wo sollen sich Kinder bewegen, wenn Hallen geschlossen werden?“, fragt die Vorsitzende Antje Hogrefe
Bundestag und Bundesrat haben mit einem Sondervermögen den Weg frei gemacht für dreistellige Milliardenbeträge für Infrastruktur. Die Bundespolitik hat endlich den Ernst der Lage vor Ort erkannt. Der Investitionsstau ist riesig. Das Sondervermögen ist also absolut richtig. Richtig ist aber auch: Es wird nicht alle Probleme von heute auf morgen lösen. Es braucht zusätzlich nachhaltige strukturelle Veränderungen, die die Kernhaushalte spürbar entlasten. Werfen wir deshalb einen Blick auf den Status Quo, der zeigt: In der Finanz- und Haushaltspolitik muss ein Umdenken stattfinden.
In der dramatischen Situation der öffentlichen Haushalte zeigt sich besonders deutlich, vor welchen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungszwängen unser Land steht: Unsere verfügbaren Mittel reichen kaum aus, um die gesetzlich fixierten Aufgaben des Staates abzudecken, ganz zu schweigen von der Finanzierung unabweisbarer Herausforderungen wie den großen Transformationsaufgaben. Zugleich mussten zunehmend Abstriche bei der Erfüllung der Kernaufgaben gemacht werden, wie man am Zustand der sozialen und der technischen Infrastruktur sieht.
Die drei Ebenen Bund, Länder und Gemeinden haben nicht immer gut zusammengearbeitet: Bund und Länder verlagern oftmals nur ihre Probleme in die kommunale Ebene hinein, anstatt sie selbst zu lösen. Dabei haben Bund und Länder lange die Brisanz der Lage in den Städten nicht erkannt. Die kommunalen Haushalte stecken in einem Rekorddefizit, das nicht von alleine verschwinden wird.
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Das Verhältnis zwischen
Kommunale Sparzwänge treffen Jugend hart
(BS/Julian Faber) Die prekäre Finanzlage vieler Städte und Gemeinden spitzt sich durch die fehlende Haushaltsklarheit im Bund weiter zu. Kommunale Kürzungsspiralen drohen sich in den nächsten Jahren auszuweiten – und gefährden die soziale Infrastruktur zunehmend. Köln und Berlin stehen exemplarisch für einen Trend, der zuerst bei den Kleinsten kürzt.
Der Widerstand gegen die Sparpläne war erheblich. Jugendverbände, soziale Einrichtungen und Familien organisierten Demonstrationen und Protestaktionen. Der Kölner Kinder- und Jugendring gab den städtischen Ehrenamtspreis zurück. „Es fühlt sich nicht richtig an, einen Preis für Engagement zu behalten, während ehrenamtliche Strukturen zerstört werden“, so der Vorsitzende Konrad Schmitz Dass die Sparpläne derart hohe Wellen schlagen, hatte man im Rathaus offenbar nicht erwartet. Nachdem Oberbürgermeisterin Reker die Pläne noch Anfang Januar verteidigt hatte, nahm der Stadtrat sie nur zwei Wochen später zurück. „Wir sind erleichtert und danken allen, die sich für eine soziale Stadt stark gemacht haben“, so Buff Statt der Jugend soll es nun die Kultur treffen: Die Mittel werden um rund 20 Prozent gekürzt. Stadtkämmerin Dörte Diemert gab sich zurückhaltend: „Der Haushaltsbeschluss ist ein wichtiger Meilenstein, aber ohne Genehmigung durch die Bezirksregierung bleibt die Lage angespannt.“ Diese steht bislang noch aus.
Berlin bleibt hart Im Gegensatz zum Kölner Stadtrat ließ sich das Berliner Abgeordnetenhaus nicht erweichen. Für den Nachtragshaushalt 2025 wurden im Dezember Kürzungen von insgesamt drei Milliarden Eu-

ro, davon sieben Millionen für die Freie Jugendarbeit beschlossen. Gespart wird außerdem bei der Schulsozialarbeit, bei Familienbildungsmaßnahmen, Prävention für Kinder- und Familienarmut sowie der kulturellen Bildung. Dabei diskutiere man auch hier seit Jahren über wachsende Bedarfe, sagt Gloria Amoruso von der Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendförderung. Allein in Reinickendorf gebe es Wohngebiete, in denen bis zu 60 Prozent der Kinder von Armut betroffen und besonders auf die Angebote angewiesen seien. „Seit Jahren diskutieren wir über die wachsende Bedarfslage. Jetzt
Weil Geld allein nicht reicht
müssen wir so viele Rückschritte hinnehmen“, so Amoruso Prominentestes Opfer der Sparpläne ist die Nummer gegen Kummer. Das Sorgentelefon der Diakonie wurde von der Bildungsverwaltung bislang mit 100.000 Euro im Jahr gefördert. Diese soll nun ersatzlos entfallen, gab der Senat Mitte März bekannt. Im vergangenen Jahr wurden rund 10.000 Anrufe von etwa 100 ehrenamtlichen Mitarbeitenden bearbeitet. Die Gesprächsthemen reichen von alltäglichen Sorgen bis zu Suizidgedanken. Psychische Erkrankungen zählen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes heute zu den häufigsten Gründen
für stationäre Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen. 2023 waren rund 111.000 der Zehn- bis 19-Jährigen aufgrund von psychischer Leiden in stationärer Behandlung. Auch abseits stationärer Angebote ist das Behandlungsangebot vor allem aufgrund unzureichender Kassensitze für die Psychotherapie limitiert. Die Folge sind endlose Wartelisten für Kassenpatienten. Dieser Mangel bestehe bereits lange vor 2020, sagt Jörg Ciszewski vom Sozialverband VdK. Der Bedarf sei seitdem aber nochmal deutlich gewachsen: „Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die gesellschaftlichen Krisen der vergangenen Jahre haben die psychische Gesundheit zusätzlich stark belastet.“ Ob und wie psychologische Hilfsangebote für Kinder- und Jugendliche künftig kompensiert werden sollen, ließ der Berliner Senat auf Nachfrage unbeantwortet.
Zwischen Spardruck und Verantwortung
Die Entwicklungen in Köln und Berlin verdeutlichen das Dilemma zahlreicher Kommunen: Ohne eine verlässliche Finanzierungsgrundlage drohen Städte und Gemeinden immer wieder in die gleiche Kürzungsspirale zu geraten.
Die Haushaltslage auf Bundesebene wird auch darüber entscheiden, wie handlungsfähig Kommunen mit Blick auf die Versorgung der Kleinsten sind. Werden benötigte Mittel nicht bewilligt, droht sich die soziale Schieflage zu verschärfen. Die Frage, wie es Städten und Gemeinden gelingt, Kinder- und Jugendangebote auch in schwierigen Haushaltslagen zu sichern, wird in den kommenden Jahren zu einem Gradmesser für sozialen Zusammenhalt und politische Prioritätensetzung werden.
(BS/Dr. Dominique Köppen) Milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur sind ein wichtiges Signal – sie allein werden die strukturellen Herausforderungen in der Finanz- und Haushaltspolitik jedoch nicht lösen. Es braucht klare Reformen und ein neues Verständnis der Aufgabenverteilung im föderalen System. Wie sich Städte und Gemeinden nachhaltig stärken lassen.

Bund, Ländern und Gemeinden muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Was das bedeutet, erläutere ich nachfolgend mit Blick auf die drei Schwerpunkte Verteilung und Finanzierung der Aufgaben, Finanzverteilung sowie Formen der Zusammenarbeit (Förderprogramme).
Verteilung von Finanzierung und Aufgaben
In einem geordneten Staatswesen sollte zuerst die Aufgabenverteilung zwischen den Ebenen festgelegt werden, die entsprechende Finanzierung der einzelnen Ebenen folgt dann aus der Aufgabenverteilung. Bei Aufgaben, die regional stark streuen oder über die Landes- beziehungsweise Gemeindegrenzen wirken, ist dies bei der Aufgabenund Mittelzuordnung zu beachten.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, deren Sinn und Zweck sich jedem und jeder sofort erschließt. Dieses Verfahren funktioniert in der Bundesrepublik seit langem nicht. In der Theorie haben Bund und Länder viele Probleme erkannt, die Debatten um das Konnexitätsprinzip (wer bestellt, bezahlt) sind ein gutes Beispiel. Aber all zu oft wird nach der Devise gehandelt „Grundsätzlich ja, im konkreten Fall nein!“: Es werden Schlupflöcher gesucht und gefunden.
Finanzverteilung an Realität anpassen Wir brauchen eine neue Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die Kommunen tragen circa ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, haben al-
lerdings nur ein gutes Siebtel der Steuereinnahmen. Allein dieser Zahlenvergleich macht die Unwucht im System deutlich. Ein Weg zur Verbesserung der Situation ist ein größerer Anteil der Städte an den Gemeinschaftssteuern, zum Beispiel an der Umsatzsteuer. Eine Erhöhung unseres Anteils an den Gemeinschaftssteuern bedeutet nicht nur, dass insgesamt mehr Geld in kommunalen Kassen ist und die Defizite sinken. Das zusätzliche Geld kommt dann auch noch auf dem richtigen Weg, frei von realitätsfremden, unnötig einschränkenden Auflagen, bei den Kommunen an.
Kooperativ zusammenarbeiten
Viele Mittel stellen Bund und Länder den Kommunen in der Form von
Förderprogrammen bereit. Gegen diesen Transferweg ist nur dann nichts einzuwenden, wenn spezielle Gründe dafürsprechen. Zusätzlich sind die Förderprogramme von einem ausgeprägten Misstrauen gegenüber der sachgerechten Mittelverwendung durch die Kommunen geprägt.
Das schlägt sich dann in der Form unnötiger, kleinteiliger, lebensfremder und im Ergebnis schlichtweg teurer und unnützer Vorgaben und Nachweispflichten nieder. Dort, wo es Förderprogramme braucht, muss deren Ausgestaltung von gegenseitigem Vertrauen und dementsprechend schlanken Vorschriften geprägt sein.
Ein Wort zum Schluss
Die vor uns liegenden Herausforderungen sind immens. Zwei Reaktionen hierauf sind ebenso verständlich wie falsch: Es ist falsch, den Kopf in den Sand zu stecken und die Probleme zu leugnen. Dies führt nur dazu, dass die Probleme größer werden. Ebenso falsch ist es aber, den Untergang Europas herbeizubeschwören und sich der Verzweiflung hinzugeben. Die vor uns liegenden Herausforderungen sind groß, vermutlich die größten seit mehreren Jahrzehnten, aber sie sind lösbar. Das Sondervermögen Infrastruktur ist ein wichtiger Schritt, weitere strukturelle Veränderungen müssen folgen.

Dr. Dominique Köppen ist Beigeordneter und Leiter des Dezernats Finanzen beim Deutschen Städtetag. Foto: BS/privat
(BS/amm) Aufgaben effizienter verteilen, Kosten einsparen und die Verwaltung verschlanken: Die Beweggründe für den Vollzug von Gemeindegebietstreformen sind vielfältig. Seit Beginn der Reformen 1993 hat sich die Zahl der Landkreise kontinuierlich verringert: von 543 auf aktuell 294. Auch die Zahl der Gemeinden ist in den vergangenen Jahrzehnten gesunken: von knapp 12.300 im Jahr 2008 auf rund 11.000 im Jahr 2023.
Dabei sind es nicht nur die Gemeinden im Osten der Republik, die infolge von Demografie und Abwanderung Ämter auflösen und Zwangsfusionen vollziehen. Auch auf Sylt oder in Niedersachsen wurden die Gemeindegrenzen neu gezogen.
Anzahl der Gemeinden in Deutschland 2008–2023
Zu- und Abwanderungen in und aus Gemeinden Differenz zwischen 2008 und 2023









Behörden Spiegel: Wie bewertet der VRR den aktuellen Stand der Verkehrswende in NRW, insbesondere im Hinblick auf die dichte Ballung der Großstädte?
Oliver Wittke: Die Verkehrswende gelingt nicht von heute auf morgen. Unser Ziel ist es, den Anteil des ÖPNV am Modal Split deutlich auszuweiten. Hierzu müssen wir Leistungen im Regionalverkehr und im kommunalen Nahverkehr nahezu verdoppeln. Das ist eine Mammutaufgabe, der wir uns gemeinsam mit allen Nahverkehrsakteuren in unserem Verkehrsgebiet widmen. Denn in einem polyzentrischen Ballungsraum wie dem VRR endet die Mobilität der Menschen nicht an der Grenze zur Nachbarstadt, sie muss immer als Ganzes betrachtet werden.
Behörden Spiegel: Welche konkreten Maßnahmen hat der VRR bereits umgesetzt, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver und effizienter zu gestalten?
Wittke: Am 1. März haben wir eine Tarifreform auf den Weg gebracht und 75 Prozent der Ticketprodukte abgeschafft. Mit dem Deutschlandticket, dem elektronischen Tarif eezy.nrw und dem reduzierten VRR-Tarif wird es für unsere Fahrgäste wesentlich einfacher. Verkehrsunternehmen sparen dadurch Vertriebskosten ein, das trägt zur Effizienz des ÖPNVGesamtsystems bei.
Behörden Spiegel: Wie plant der VRR, das Streckennetz und die Taktung zu verbessern, um den ÖPNV als echte Alternative zum Individualverkehr zu stärken? Und welche Strategien verfolgt der VRR, um die Menschen zum Umstieg zu bewegen?
Wittke: Mit unserem Zielnetz 2040 möchten wir in den nächsten Jahren das SPNV-Angebot verbessern. Geplant sind neue Direktverbindungen, dichtere Takte, ausgeweitete Betriebszeiten und eine bessere
Energie aus dem Gully – für viele Städte und Gemeinden eine kontinuierliche und erneuerbare Wärmequelle, die das ganze Jahr über bei weitgehend konstanter Temperatur zur Verfügung steht. Nach aktueller Studienlage können damit bis zu 15 Prozent des Wärmebedarfs im kommunalen Gebäudesektor abgedeckt werden. Angesichts der Energiewende dürfte Wärmegewinnung aus Abwasser auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Doch wie können Kommunen die Technik nutzen, welche Voraussetzungen braucht es und wie müssen die finanziellen Bedingungen ausgestaltet sein? In einer Diskussionsrunde des Deutschen Instituts für Urbanistik gaben Experten Antworten. „Abwasserwärme ist eine sehr sichere Energiequelle, denn Abwasser wird es immer geben“, betont Dr. Simon Ambühl, Projektleiter Energie bei der Holinger Gmbh, einem Schweizer Unternehmen, das Verfahrenstechnik für Kläranlagen konzipiert. Die Möglichkeiten der Nutzung, aber auch der technischen Nutzbarmachung seien vielfältig.
Nachträglicher Einbau von Wärmetauschern problematisch
So lässt sich in einer simplen Version „inhouse“ über den Einbau eines Wärmetauschers die anfallende Abwassermenge nutzen. In einem nächsten Schritt kann der Wärmetauscher an Gebäudeausgängen installiert werden – mit diesem Verfahren können größere Anlagen wie Pflegeheime oder Kran-
Zukunftsfähiger ÖPNV in NRW
(BS) Wer schon einmal eine Sightseeing Tour durch das Ruhrgebiet unternommen und sich dabei für die öffentlichen Verkehrsmittel entschieden hat, der ist an der Tarifstruktur von vier verschiedenen Verkehrsverbünden verzweifelt. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) plant, den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen fahrgastfreundlicher zu gestalten und in die Zukunft zu führen, hat der Vorstandssprecher Oliver Wittke im Interview erklärt. Die Fragen stellte Scarlett Lüsser.

Oliver Wittke ist Vorstandssprecher beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und ehemaliger CDU-Politiker (sowohl auf kommunaler als auch auf Landes- und Bundesebene).
Einbindung der Regionen außerhalb der zentralen Verkehrsachsen in den Regionalverkehr. Nur wenn wir das Leistungsangebot ausweiten und gezielt dort stärken, wo es heute Lücken gibt, können wir mehr Menschen für eine klimafreundliche Mobilität gewinnen. Voraussetzungen dafür sind eine verlässliche Finanzierung der zusätzlichen Verkehrsleistungen und ein massiver Infrastrukturausbau.
Behörden Spiegel: Welche Rolle spielen neue Mobilitätskonzepte wie On-Demand-Verkehr, Carsharing oder Fahrradverleihsysteme im Gesamtkonzept des VRR?
Foto: BS/VRR
Wittke: Wir verfolgen schon seit vielen Jahren das Ziel, nachhaltige Verkehrsmittel wie den Radverkehr mit dem ÖPNV zu vernetzen, vor allem an Mobilitätsdrehscheiben wie Bahnhöfen oder Bus- und Bahnhaltestellen. Genau dort sind beispielsweise unsere DeinRadschlossAnlagen zu finden, die verbundweit über ein zentrales Buchungssystem zu einheitlichen Tarifen mit nur einer Anmeldung genutzt werden können. Auch On-Demand-Verkehre sind bereits in vielen Regionen von NRW eine sinnvolle Ergänzung des regulären ÖPNV in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage.
Behörden Spiegel: Welche Maßnahmen werden getroffen, um die Anbindung ländlicher Räume im VRR-Gebiet zu verbessern?
Wittke: Eine klimaneutrale und nachfrageorientierte Mobilität in ländlichen Regionen braucht vor allem leistungsstarke öffentliche Zubringer-Verkehre zum nächsten Bahnhof. Genau hier setzen wir mit unseren XBus-Linien an. Sie verknüpfen Kommunen ohne eigenen Schienenanschluss mit dem Regionalverkehr und schließen Lücken zwischen Städten. Für die ländlich geprägten Gebiete im VRR sind sie ein enormer Gewinn: Fahrgäste schätzen die XBusse als lohnende Alternative zum eigenen Auto und nutzen das Angebot für die täglichen Wege. Ob die Verkehrswende gelingt, entscheidet sich letztlich im ländlichen Raum.
Behörden Spiegel: Was sind aktuell die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Verkehrswende im VRR-Gebiet?
Wittke: Die infrastrukturellen Engpässe, die Verfügbarkeit moderner und klimafreundlicher Fahrzeuge, die insgesamt unklare Finanzsituation im ÖPNV sowie wirtschaftliche Unsicherheiten haben Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Verkehrssektors. Vor allem aber ist der Fachkräftemangel eine enorme Herausforderung für die Branche und damit auch für eine erfolgreiche Verkehrswende. Bereits heute haben die Verkehrsunternehmen Probleme,
Heizen mit Abwasserwärme
(BS/Anne Mareile Moschinski) Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Eine Etappe auf dem Weg dahin ist die Nutzung von Abwasserwärme zum Beheizen des kommunalen Gebäudesektors. In vielen europäischen Ländern werden die Wärmequellen bereits eingesetzt, auch in Deutschland ist die Thermietechnik auf dem Vormarsch.
kenhäuser beheizt werden. Ganze Gebäudesektoren lassen sich hingegen mit einem Wärmetauscher, der im Kanalnetz eingesetzt wird, mit Energie versorgen.
Das Prozedere bei letzterer Option erklärt Ambühl so: „Bevor das in der Kläranlage gereinigte Abwasser in den Fluss weitergeleitet wird, entziehen wir Wärme.“ Die nachfolgend heruntergekühlte Wassertemperatur habe einen „positiven Einfluss“ auf das Gewässer.
Mangelnde Verfügbarkeit von digitalen Karten
Wie groß das Potenzial von Abwasserwärme für das Beheizen von großflächigen Wohnquartieren ist, demonstriert Tobias Meyer, der bei den STWB Stadtwerken Bamberg Ingenieur für die Quartiersentwicklung des Lagarde-Campus in Bamberg ist. Für das 22 Hektar große Areal erzeugen Wärmepumpen mithilfe der Restwärme aus dem Abwasser heißes Wasser für Küche, Bad und Heizung in den Wohnungen. Parallel werden die Erdwärmespeicher auf dem Areal durch die Abwasserwärme wieder aufgeladen. Damit verbunden ist eine Heizöl-Einsparung von 230.000 Litern pro Jahr. Insgesamt 1.200 Familien werden so mit Wärme versorgt, die zu 70 Prozent CO2-neutral

Für viele Kommunen kann die Nutzung von Wärme aus Abwasser ein sinnvoller Beitrag zur Klimaneutralität sein. Foto: BS/PhotographyByMK, stock.adobe.com
offene Stellen zu besetzen. Immer öfter fallen Nahverkehrsverbindungen aus, weil nicht genug Fahrerinnen und Fahrer verfügbar sind. Es wird schwieriger, genug Fahrpersonal für den Leistungsaufwuchs der Zukunft zu gewinnen. Dies wird eine der wichtigsten Aufgaben im ÖPNV der nächsten 20 Jahre sein.
Behörden Spiegel: Wie bewertet der VRR die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Städten und Kommunen – gibt es hier manchmal Zielkonflikte oder bürokratische Hürden, die Projekte verzögern?
Wittke: Die öffentliche Mobilität der Zukunft und eine erfolgreiche Verkehrswende sind eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir nur im Schulterschluss mit allen Nahverkehrsakteuren realisieren können. Deshalb arbeiten wir eng und auf Augenhöhe mit den Kommunen als ÖPNV-Aufgabenträger und auch mit den kommunalen Verkehrsunternehmen zusammen.
Behörden Spiegel: Stichwort Nachhaltigkeit: Gibt es Pilotprojekte oder innovative Ansätze, die besonders erfolgversprechend für die Verkehrswende in NRW sind?
Wittke: Aktuell beschaffen wir klimafreundliche batterieelektrische Züge für das Niederrhein-Münsterland-Netz, in dem heute noch Dieselzüge verkehren. Wenn in einigen Jahren alle Fahrzeuge ihren Betrieb aufgenommen haben, sinkt der Anteil an Zugkilometern, die im VRR-Gebiet mit Dieselfahrzeugen gefahren werden, auf unter zehn Prozent. Eine Entwicklung, die uns sehr wichtig ist. Denn hiervon profitieren Menschen, Umwelt und Klima. Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit Unternehmen individuelle Mobilitätskonzepte, die die unterschiedlichen Verkehrsträger miteinander verknüpfen, statt sie gegeneinander auszuspielen.
gewonnen wird. Meyer erläutert die Details: Vor dem Bau der Häuser würden hier Erdwärmekollektoren wie eine Fußbodenheizung unter der Bodenplatte verlegt. 117 Erdsonden seien hier auf drei Plätze verteilt und die Wärmetauscher insgesamt auf einer Länge von 225 Metern verlegt worden. Eine Hürde für die Nutzung von Abwasser-Wärmequellen ist allerdings die mangelnde digitale Verfügbarkeit von Karteninformationen zu Kanalnetzen. Privaten Bauherren und Energiedienstleistern fehlt dadurch oft die Planungsgrundlage. Ein weiteres Hindernis seien Genehmigungsverfahren, die sich in die Länge zögen, so Ambühl. Wenn Kommunen Gebäude mit Abwasserwärme versorgen wollten, werde die Energie in der Regel über den Kanal bereitgestellt. „Wenn Kommunen aber das Maximum an Wärme aus dem Abwasser ziehen wollen, dann erreicht man den Energiebedarf nur unter Einbeziehung der Kläranlage“, ergänzt der Projektleiter. Dabei müssen Kommunen auch die Frage beantworten, ab welcher Kilowattmenge sich die Nutzung von Abwasserwärme grundsätzlich lohnt. Aus Sicht von Ambühl gibt es darauf keine eindeutige Antwort. „Entscheidend ist hier nicht die Leistung, sondern der Energieabsatz, also die Zahl der Megawattstunden, die ich pro Jahr absetzen kann“, führt er aus. Beziehe beispielsweise eine Wäscherei Abwasserwärme, dann brauche diese zwar tagtäglich Energie, aber nicht das Maximum an Leistung. In einem solchen Fall lasse sich ohne Weiteres auch eine kleine Wärmepumpe installieren.
Bei der Abwägung, ob der Bezug von Abwasserwärme für eine Gemeinde wirtschaftlich sei oder nicht, sei stattdessen folgende Faustformel zu beachten: Pro Kilometer Leitungslänge müsse ein Megawatt Leistung erwirtschaftet werden. „Man muss also schauen: Wo ist das Zentrum? Wo ist die Kläranlage und wie viel Leistung kann ich rausziehen? Dann kann man grob abschätzen, ob es wirtschaftlich ist oder nicht“, so Ambühl In den meisten Fällen erhalten die Kanalbetreiber nach geschlossener Vereinbarung von der Kommune eine Einmalzahlung für den Aufwand, den sie für die Installation der technischen Voraussetzungen benötigen. Hinzu kommen jährliche Pauschalen, die sich an dem erhöhten Betriebsaufwand der Kanalbetreiber orientieren. „Wir verkaufen keine Wärme, sondern wir lassen uns den Mehraufwand bezahlen“, sagt Ingo Schwerdorf, Abteilungsleiter Wasserwirtschaftliche Planungen bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln. Denn: Gewinne zu erwirtschaften, ist Entwässerungsbetrieben als Anstalten des öffentlichen Rechts untersagt.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, haben wir in Berlin in dem zweijährigen verwaltungsübergreifenden Projekt „Zukunftsfähige Ordnungsämter“ die bestehenden Strukturen und Geschäftsprozesse der zwölf bezirklichen Ordnungsämter untersucht und Handlungsempfehlungen für eine Optimierung erarbeitet, die jetzt sukzessive umgesetzt werden. KOD als Ausbildungsberuf Eine wesentliche Säule für die Zukunftsfähigkeit der Ordnungsämter ist die Stärkung der Dienstkräfteausbildung. Die bisher mehrwöchige berufsbegleitende Qualifizierung soll durch einen Ausbildungsberuf abgelöst werden. Deshalb streben wir gemeinsam mit anderen Kommunen in Deutschland die Integration des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) als neue, sechste Fachrichtung der Ausbildung der Verwaltungsfachangestellten während des aktuellen Novellierungsverfahrens des Bundesinnenministeriums an. Die stetig wachsende Zahl an Aufgaben in den kommunalen Ordnungsämtern und die zunehmende Gefährdung der Außendienstkräfte durch Übergriffe erfordert eine viel umfangreichere Qualifizierung als bisher, um die Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes (AOD) besser zu schützen, sie mit weitreichenderen Hilfsmitteln ausstatten zu können und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Ordnungsämter zu erhöhen.
Engere Zusammenarbeit
Die Ordnungsämter werden ein immer wichtigerer Partner im Rahmen der Sicherheitsarchitektur. Deshalb statten wir in diesem Jahr die in Schwerpunkt- und Verbundeinsätzen mit der Polizei eingebundenen Außendienstkräfte mit BOS-Digitalfunkgeräten aus, damit die interne Kommunikation verbessert werden kann. In den nachfolgenden Jahren ist die Qualifizierung weiterer AODKräfte geplant, damit sich künftig
München, Gelsenkirchen und Kaiserslautern klagen über die Respektlosigkeit gegenüber den Beschäftigten des KOD. Ordnungskräfte werden zunehmend weniger ernst genommen und erleben immer häufiger Konfrontationen mit Bürgerinnen und Bürgern. „Anweisungen der Ordnungsbehörden scheinen lediglich eine Diskussionsgrundlage zu sein“, klagt beispielsweise die Stadtverwaltung Kaiserslautern über die derzeitige Situation. Auch Gelsenkirchen vermeldet verbale „Unmutsbekundungen bis hin zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen“ und führt diese vor allem auf die allgemeine gesellschaftliche Verrohung und die Ablehnung staatlichen Handelns zurück.
Mitarbeiterschutz an erster Stelle Die Behörden versuchen dem gestiegenen Konfliktpotenzial in erster Linie mit Anpassungen und Änderungen im eigenen Hause entgegenzutreten. So führt die Stadt München regelmäßig Deeskalations- und Kommunikations- sowie Selbstverteidigungsschulungen durch. Zudem bereite man belastende Einsätze nach. Kaiserslautern weist in Pressemitteilungen regelmäßig auf die Zuständigkeiten und Eingriffsrechte des Ordnungsdienstes hin, um in der Bevölkerung ein größeres Bewusstsein für diese zu schaffen. Weiterhin fordert die Stadtverwaltung vom Gesetzgeber die Übertragung des Rechts der sofortigen Vollziehung gemäß Paragraf 80 Absatz 2 VwGO, das derzeit ausdrücklich nur Polizeivollzugskräften zusteht. In Gelsenkirchen fahren die Be-
Wie Berlin seine Ordnungsämter neu aufstellt
(BS/Martina Klement) Die Verwaltung steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen: Sie muss sowohl auf den Personalrückgang infolge der demografischen Entwicklung reagieren als auch den veränderten Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft an eine funktionierende Verwaltung entsprechen. Deshalb gilt es, die eigene Attraktivität am Arbeitsmarkt zu steigern, die Verwaltung strukturell zu verändern und die Digitalisierung auszubauen.

Auch die Berliner Ordnungsämter sollen sich in wandelnden Zeiten der Entwicklung anpassen. Dies drückt sich neben den Feldern Ausbildung und Personal auch bei den Aufgaben und Zuständigkeiten aus. Foto: BS/Mummert-und-Ibold, stock.adobe.com
alle in Sicherheitsfragen zuständigen Dienstkräfte im Land Berlin über den geschützten BOS-Digitalfunk bei ihren Einsätzen abstimmen können.
Zur effektiveren Einsatzplanung und -steuerung wird die Einbindung der Ordnungsämter in die Kooperative Leitstelle von Polizei und Feuerwehr vorbereitet, um die bezirklichen Ordnungsämter als Partner vollumfänglich in den Vorgangsprozess einzubinden. Mit der Umsetzung des im Projekt entwickelten Musterordnungsamtes wurde ein wesentlicher Grundstein gelegt, um die Geschäftsprozesse und die digitale Infrastruktur der zwölf bezirklichen Ordnungsämter zu vereinheitlichen und dann die Einbindung realisieren zu können. Ebenso wird die Schaffung von Schnittstellen bei
den in den Ordnungsämtern eingesetzten IT-Fachverfahren zu anderen im Land Berlin genutzten Fachverfahren zukünftig die Arbeit in den Ordnungsämtern optimieren und in Teilen auch automatisieren. Damit werden vor allem die in der Bußgeldsachbearbeitung eingesetzten Dienstkräfte perspektivisch von Routineaufgaben entlastet, die Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Behörden wird effektiviert und die Einnahmen aus Bußgeldverfahren können erhöht werden, weil die Zahl der Verfristungen sinken wird.
Reformen im Bereich Personal Zudem wurde ein Prognosemodell zur Personalbedarfsermittlung für die unterschiedlichen Aufgaben der Ordnungsämter entwickelt. In Ab-
hängigkeit von variablen, an der Fachlichkeit orientierten Parametern kann für jedes Tätigkeitsfeld in den Ordnungsämtern der jeweilige Personalbedarf ermittelt und fortgeschrieben werden; auch regionale Unterschiede der Bezirke hinsichtlich ihrer sozialen Struktur und ihrer Infrastruktur finden bei einer bezirksscharfen Personalbedarfsermittlung ausreichend Berücksichtigung. Die für die jeweiligen Politikfelder zuständigen Senatsverwaltungen sind nun gehalten, auf dieser Grundlage themenfeldbezogene Leitfäden zu erstellen und in Umsetzung der Konnexität die bezirklichen Ordnungsämter mit aufgabenadäquatem Personal auszustatten. Ein erstes Tätigkeitsfeld könnte hierfür der Verkehrsüberwachungsdienst sein, der nach einer
Der Umgang mit Anfeindungen aus der Bevölkerung
(BS/Lars Mahnke) Die Kommunalen Ordnungsdienste (KOD) sehen sich durch den gesellschaftlichen Wandel zunehmend neuen Herausforderungen ausgesetzt, auf die es sich einzustellen gilt. Auf Nachfrage des Behörden Spiegel berichten drei Kommunen von den Herausforderungen, die das gestiegene Konfliktpotenzial im Arbeitsalltag und die Erweiterung des Aufgabenspektrums des KOD mit sich bringen.

Die Anforderungen an Beschäftigte des Kommunalen Ordnungsdienstes haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Foto: BS/redaktion93, stock.adobe.com
hörden eine Null-Toleranz-Strategie: Angriffe – egal ob physischer oder verbaler Natur – werden konsequent zur Anzeige gebracht und von der Erteilung von Hausverboten flankiert. Die Stadt versteht sich zudem als Impulsgeber für die Landes- und Bundesgesetzgebung. So spiegele man Problemfelder wiederholt an übergeordnete Stellen, um neue Gesetzesvorhaben anzuregen und auszugestalten. Des Weiteren versucht die Stadt, die Einsatzkräfte „bestmöglich auf herausfordernde
Situationen vorzubereiten und ihre Sicherheit im Dienst zu erhöhen“. Neben entsprechender Schutzausrüstung wie stich- und schusssicheren Westen bietet auch Gelsenkirchen seinen Ordnungskräften verstärkt Schulungen im Bereich von Deeskalation und Selbstverteidigung an. Derzeit läuft die Prüfung, ob die Ausrüstung um einen Einsatzmehrzweckstock ergänzt werden kann. Weitere Einsatzmittel werden fortlaufend evaluiert. Kaiserslautern hat seine Bediensteten im vergangenen Jahr zum Selbstschutz mit Reiz-
Verschmelzung mit dem AOD im Jahr 2006 wieder ein eigenständiges Tätigkeitsfeld werden soll, um die Dienstkräfte zielgerichteter einsetzen zu können und die Verkehrssicherheit in Berlin zu stärken.
Die Handlungsempfehlungen des Projekts sehen weiterhin ein teilzentralisiertes Auswahlverfahren für die Tätigkeitsfelder der Ordnungsämter vor, die im uniformierten Außendienst aller Bezirke in großem Umfang mit Dauerausschreibungen befasst sind. Einige Auswahlschritte können gerade bei Parallelbewerbungen in mehreren Bezirken zu einer Effektivierung und Beschleunigung der Auswahlverfahren führen, ohne die Personalentscheidung der Einstellungsbehörde zu beschneiden.
Die zunehmenden Übergriffe auf die Dienstkräfte der Ordnungsämter erfordern ein gezieltes Handeln seitens der Behörden. Deshalb ist der Aufbau einer Datenbank zur Erfassung der Gewaltvorfälle geplant, um die Schutzmaßnahmen verbessern zu können.
Viele Herausforderungen – allen voran die Absicherung der Finanzierung – werden den Weg zur Umsetzung all dieser Handlungsempfehlungen prägen. Auch wenn sich alle Beteiligten wünschen, dass diese Maßnahmen schnell realisiert werden, wird dieser Umsetzungsprozess von uns allen große Anstrengungen erfordern und leider auch einige Jahre dauern. Aber am Ende schaffen wir damit, was die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von uns erwarten: zukunftsfähige Ordnungsämter.

Martina Klement ist seit Mai 2023 Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in der Berliner Senatskanzlei sowie Chief Digital Officer (CDO) des Landes Berlin. Foto: BS/privat
gas-Sprühpistolen ausgestattet und plant für dieses Jahr die Anschaffung von Bodycams. Zudem hat die Kommune, die in Rheinland-Pfalz originär für Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) zuständig ist, die Teilnahme am BOS-Funk und eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung von Sondersignal und Einsatzhorn beantragt. Die Stadt München verweist in Bezug auf die Erweiterung rechtlicher Kompetenzen des Kommunalen Außendienstes (KAD) auf klare gesetzliche Grenzen. Die Behörde sei diesbezüglich von Stadtratsbeschlüssen abhängig. Erweitertes Aufgabenspektrum Für die Zunahme der Zuständigkeiten in den letzten Jahren sieht die Stadt Gelsenkirchen einen entscheiden Grund in der „Fokussierung der Polizei auf die Strafverfolgung und Gefahrenabwehr im engeren Sinne“. Der KOD wachse dadurch zunehmend in die Rolle eines wichtigen Akteurs zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Verwaltung erwarte daher einen Zuwachs an Aufgabengebieten vor allem in den Bereichen ordnungsrechtlicher Vollzugsaufgaben, bezüglich der Präsenz im öffentlichen Raum und der Zusammenar-
beit mit anderen Sicherheitsbehörden. Kaiserslautern nennt vor allem die Zuständigkeit für die Umsetzung des Konsumcannabisgesetzes und die Änderung des Waffengesetzes, wenn es um den Zuwachs neuer Aufgabengebiete geht. Zudem seien in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Ländern die Kreisordnungsbehörden für die Umsetzung des Waffenverbotes bei öffentlichen Veranstaltungen zuständig. Kritik äußert die Stadtverwaltung an der mangelnden Umsetzung des Konnexitätsprinzips („wer bestellt, bezahlt“). Die Einrichtung weiterer Stellen zur Umsetzung neuer Zuständigkeiten sei ohne finanziellen Ausgleich „kaum leistbar“. Allerdings äußerte sich die Stadt diesbezüglich skeptisch: Man erwarte „einen steten Anstieg der Aufgaben ohne zusätzliche finanzielle Ausstattung“.
In München sieht man sich dagegen grundsätzlich sehr gut aufgestellt, was die nähere Zukunft des KAD betrifft. Allerdings sei es im Hinblick auf die Personal- und Haushaltssituation wichtig, die Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Man wolle dies durch „Schwerpunktsetzung, Aufgabenkritik, verbesserte Prozesse und Motivation der Kolleginnen und Kollegen“ erreichen. Es werde angestrebt freie Stellen nachzubesetzen, wobei man sich mit Verweis auf die positive Führungskultur, Wertschätzung und gute Bezahlung sowie die interne Aus- und Weiterbildung optimistisch zeigt, dies angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels gewährleisten zu können.
40 Jahre Behörden Spiegel Berlin und Bonn
(BS/Anna Ströbele) Skalierbarkeit, Ressourcen sparen, Resilienz –viele Gründe sprechen für die Cloud-Transformation der öffentlichen Verwaltung. Doch wie gehen Behörden dabei am besten vor? Welche Rolle Kooperationen spielen und wie die Souveränität bei der Cloud-Nutzung gestärkt werden kann, erklären Vertreter des ITZBund, der Bundesagentur für Arbeit (BA), von govdigital und SUSE.



www.behoerdenspiegel.de

Clemens Wunder , Leiter des Cloud Centers of Excellence (CCoE) der BA, beschreibt die Entwicklung der Cloud-Strategie der Behörde. Seit Langem betreibe die BA eine private Cloud, habe aber festgestellt, dass dies mit erheblichem Aufwand verbunden sei. Am Markt könnten die Produkte womöglich „besser oder billiger“ eingekauft werden. Nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels sollen Mitarbeitende gezielt in jenen Bereichen eingesetzt werden, die nicht extern beschaffbar sind. Eine Software für die Vermittlung von Arbeitslosen gebe es beispielsweise auf dem Markt nicht – „die müssen wir selbst bauen und auch selbst pflegen“, veranschaulicht Wunder Um einen geeigneten Cloud Provider zu wählen, betrachte die BA jeden Anwendungsfall. Der Leiter des Cloud-Zentrums vergleicht das Vorgehen mit einer Murmelbahn: Oben steige die Murmel ein, dann folgten mehrere Entscheidungspunkte und Abzweigungen, bis die Murmel schließlich bei einem der Provider herauskomme. Die Wahl Trumps zum US-Präsidenten habe „natürlich“ Auswirkungen auf die „Murmelbahn“, bestätigt Wunder auf Nachfrage. Ihm zufolge werden Fälle, die nur bei einem der Hyperscaler realisiert werden können, über zusätzliche Infrastrukturen abgesichert. Trotzdem tendiere man zu europäischen Anbietern bei Produkten, bei denen es „um Vertrauen und Daten geht“. Das ITZBund, der zentrale ITDienstleister des Bundes, verfolgt eine ähnliche Strategie. Manche Dienste, etwa die E-Akte, würden weiterhin in der Bundescloud laufen, versichert Marco Gräf, Abteilungsleiter Applikationsbetrieb und Cloud. Gleichzeitig betont er:
„Wir möchten uns frei machen von dem Brot- und Buttergeschäft. Das wollen wir einkaufen.“ Hierfür setze die Behörde auf Dienste der IONOS und der AWS, einem der drei USamerikanischen Hyperscaler. Auch hier werden die Cloud-Produkte vor ihrer Nutzung veredelt, um Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Darüber hinaus nutzt das ITZBund für mehr Resilienz einen ContainerService, der den Wechsel zwischen verschiedenen Cloud-Stacks ermöglicht. So geht auch das Unternehmen SUSE vor: „Wir sorgen immer dafür, dass wir eine Plattform darunter haben, die eine Wechselfähigkeit ermöglicht – und das auf Basis von Open Source“, berichtet Holger Pfister, General Manager bei SUSE für den deutschsprachigen Raum. Aus seiner Sicht gibt es „nicht wirklich eine Cloud“, sondern nur „einen Rechner, der jemand anderem gehört“. Und „wenn der Rechner jemand anderem gehört, dann muss ich mir überlegen, was ich mache, wenn ich in den Rechner einziehe und was es für Implikationen hat“, hält Pfister fest.
Schallbruch die ekom21 aus Hessen. Der IT-Dienstleister greife dafür wiederum auf Angebote der govdigital zurück. Auch aufgrund der zunehmenden Cyber-Angriffe auf Kommunen sei deren Bereitschaft höher, ein „Stück zurückzutreten“ und das IT-Management „in die Hände von Profis“ zu geben, bekräftigt der CEO.
„Wir haben uns Verbündete gesucht.“
Clemens Wunder, Bundesagentur für Arbeit
Kommunen sollen Betrieb abgeben Martin Schallbruch, CEO der Genossenschaft govdigital, stellt die Vorteile von Cloud-Technologien für die IT-Sicherheit heraus: Nach wie vor existierten in Deutschland viele kleine, „kaum abzusichernde“ Betriebsstätten. Diese Struktur sei schlicht „nicht zu verteidigen“, sagt Schallbruch. Stattdessen müssten größere Strukturen aufgebaut werden, die „überhaupt professionell managebar“ seien. Manche Mitglieder der govdigital machten ihren kommunalen Kunden ein solches Angebot, also den Betrieb für sie zu übernehmen. Als Beispiel nennt
Das langfristige Ziel der Genossenschaft ist der Aufbau einer gemeinsamen Betriebsplattform. Eine „gemeinschaftlich zu betreibende, zu verwaltende und zu steuernde Infrastruktur“ erlaube es, Applikationen in Zukunft sicherer zu betreiben und schneller in die Fläche zu bringen. So könne der Staat zudem „agiler reagieren, wenn es darauf ankommt, beispielsweise in Krisensituationen“, ist Schallbruch überzeugt. Besonders wichtig seien dabei gemeinsame rechtliche Rahmenbedingungen und eine einheitliche Organisation. Marco Gräf sieht dies ähnlich: „Wir reden immer von Cloud-Produkten, aber eigentlich geht es darum, Services zu zentralisieren und anderen zur Verfügung stellen“, macht er deutlich. Lösungen wie die BundID, die vom Bund betrieben, aber für die Länder bereitgestellt wird, haben aus Gräfs Sicht Modellcharakter. Wie Schallbruch wünscht er sich, dass die Grenzen zwischen Kommunen, Ländern und
Bund aufgehoben werden und man sich gegenseitig unterstützen kann, denn: „Wir haben alle die gleichen Probleme.“ Mit der Deutschen Verwaltungscloud (DVC), die am 1. April in den produktiven Betrieb startete, wird ein Schritt in diese Richtung gemacht. Fortan können öffentliche IT-Dienstleister Cloud Services über das Portal anbieten – und auch buchen. Das ITZBund darf jedoch aktuell „aufgrund eines Regulariums“ selbst keine Angebote in der DVC einstellen. Diese Hürde müsse die nächste Bundesregierung beseitigen, meint Gräf. Auch für Clemens Wunder ist die DVC derzeit keine Option: „Wir betreiben die IT für 117.000 Mitarbeitende. Wenn wir jetzt reingingen, würden wir das Projekt überfordern.“ Trotzdem sei die BA in den Gremien der DVC vertreten und unterstütze, wo es gehe. Wenn in „zwei oder drei Jahren“ die Basis stabil genug sei, damit die BA mit allen Jobcentern Services in der Deutschen Verwaltungscloud laufen lassen könne, „sind wir gerne dazu bereit“, erklärt Wunder. In der Zwischenzeit hat die BA einen anderen Weg eingeschlagen – und ist dabei nicht allein. Ohne gesetzlichen Auftrag Gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) veröffentlichte die BA im Januar 2024 eine Ausschreibung für einen Multicloud Broker, die im Dezember 2024 an das Unternehmen Computacenter vergeben wurde. „Wir haben uns Verbündete gesucht und nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner geguckt“, erinnert sich Wunder. Zu dritt hätten die Behörden eine „nennenswerte Größe“
erreicht, mit welcher sie auf dem Markt wahrgenommen worden seien. Das sei nicht selbstverständlich: „Die Anforderungen, die wir definieren, werden teilweise von den Providern, gerade von den großen, einfach ignoriert. Die ändern ihre Systeme nicht“, erläutert der Leiter des Cloud Centers. Durch den Zusammenschluss der Sozialversicherer hätten sie mehr erreichen können. Doch die Idee sei nicht von allen positiv aufgenommen worden: Immer wieder habe Wunder erklären müssen, warum die BA als Federführerin eine Ausschreibung für die Rente und die DGUV mache. „Wo ist der gesetzliche Auftrag dafür?“, sei er gefragt worden. Doch seine Kollegen und er seien standfest geblieben. „Es bringt nichts, wenn es jeder allein macht. Wir müssen diese Allianzen gründen, wir müssen gucken, wo es zusammenpasst und nach vorne gehen“, bekräftigt er.
Nicht einschüchtern lassen Menschen in ähnlichen Situationen rät Wunder: „Machen, sich den Herausforderungen stellen, anstatt unten am Berg zu stehen und hochzuschauen. Einfach mal losrennen und gucken, wie weit man kommt.“ Schallbruch empfiehlt, sich nicht von Juristinnen und Juristen „einschüchtern zu lassen“. Wunder ergänzt: „Und von den Datenschützern.“
Holger Pfister weiß, dass Widerstand gegen Veränderungen eine normale menschliche Reaktion ist: „Jeder findet Cloud super, bis er seine Arbeitsweise ändern muss.“ Er appelliert an Führungskräfte, mit solchen Bedenken ernst umzugehen. Die Transformation ist „einfach ein langer Prozess“, gibt er zu. Titel: BS/Hoffmann unter Verwendung von ImagineWorld, stock.adobe.com; Thitichaya, stock.adobe.com

IT: Kinder lernen spielend
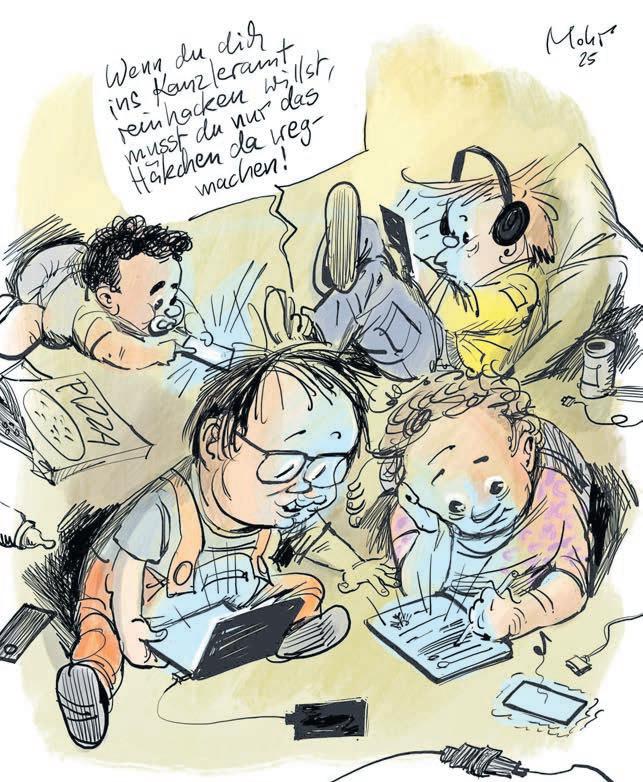
Kommentar
Das BMI gründete das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS), um die öffentliche Verwaltung souveräner aufzustellen – eine Mission, die aktueller und notwendiger ist denn je. Trotzdem sind die Finanzierung und das Beteiligungskonzept des ZenDiS nach wie vor unsicher. Die Länder können der bundeseigenen GmbHwegen laufender rechtlicher Prüfungen, noch immer nicht beitreten. Und eine Grundsicherung ist nicht vorgesehen. Das ZenDiS soll sich nur durch Aufträge finanzieren, erklärte die Bundesregierung kürzlich als Antwort auf eine Anfrage der Linken. Ende letzten Jahres beschloss der Haushaltsausschuss, einen Restbetrag von 34 Millionen Euro an das Zentrum auszuzahlen – geschehen ist dies nicht. Ist das ZenDiS seinen Gründern also doch nicht so wichtig? Und wenn dem so ist, woran liegt es?
Dem ZenDiS mangelt es weder an Beliebtheit noch an Nachfrage zu seinen Produkten openDesk und openCode, die mittlerweile beide
produktiv im Einsatz sind und steigende Nutzungszahlen verzeichnen.
Auch international gibt es großes Interesse: Letzten Sommer reisten Vertreter des ZenDiS und der Sovereign Tech Agency nach New York, um bei den Vereinten Nationen den „erfolgreichen deutschen Weg“ vorzustellen. Mit dabei war Dr. Markus Richter, Staatssekretär im BMI, Bundes-CIO und Vorsitzender des ZenDiS-Aufsichtsrats.
Im Wolkenkratzer der UN diskutierten die Expertinnen und Experten Deutschlands Rolle im globalen Open-Source-Ökosystem der Zukunft. Doch was können wir beitragen, wenn das eigene Vorzeigeprojekt seinen Auftrag nicht erfüllen kann – sei es aufgrund von rechtlichen Hürden oder einem mangelnden politischen Willen? Wenn Deutschland die digitale Souveränität seiner Verwaltung ernsthaft unterstützen will, muss
Unzeitgemäße Gedanken
Die Verwaltung im Jahr 2065
Grünes Licht – Rotes Licht
Digitalisierung in Dänemark
Adrenalin für Mathematiker
es das ZenDiS konsequent fördern. Lippenbekenntnisse reichen nicht aus. Es braucht eine solide Finanzierung, die langfristig Planungssicherheit schafft und dem Zentrum eine kontinuierliche Weiterentwicklung abseits konkreter Aufträge für seine existierenden Lösungen ermöglicht. Ansonsten droht das ZenDiS ein – weiteres – gut gemeintes Experiment zu bleiben. Und auch darüber hinaus muss die neue Bundesregierung entscheiden, welche Priorität sie der digitalen Souveränität geben wird. Dabei geht es neben der Förderung von Open Source auch um eine eigene und unabhängige IT-Infrastruktur. Laut den Ergebnissen der Arbeitsgruppe Digitales sind sich die Parteien ausgerechnet in einem Punkt uneinig: Ob das ZenDiS hier zusammen mit weiteren Akteuren genannt werden soll oder ob stattdessen eine allgemeine Formulierung Platz findet und die Frage der GmbH damit – wie könnte es anders sein – weiterhin offen bleibt.
Rückblick: 1994

Kommentar Fast ganz unkompliziert
Wer Urlaub in Dänemark macht, könnte glatt vergessen, dass Bargeld überhaupt existiert. Vom Cappuccino bis zum Museumsticket läuft die Bezahlung per Bankkarte oder Smartphone. Auch, wer bei unseren skandinavischen Nachbarn ein Auto parkt, erlebt einen volldigitalen Prozess: per QR-Code auf der Website zur Parkraumbewirtschaftung landen, Kfz-Kennzeichen und Parkdauer eingeben, online bezahlen. Wer auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in Lübeck einlegt, hat ebenfalls die digitale Parkoption. Genauer gesagt: Optionen. Zunächst muss man sich nämlich für einen von mehreren unterschiedlichen Park-App-Anbietern entscheiden, die entsprechende App herunterladen, sich mit den üblichen Kontaktdaten registrieren und die Registrierung per E-Mail bestätigen – dann können auch hier Kennzeichen, Parkdauer und Bezahlmethode ausgewählt werden. Am Ende des Prozesses folgt je-
von Christian Brecht
doch noch ein überraschender letzter Schritt: die Aufforderung, für die Mitarbeitenden des Ordnungsamts, einen Hinweis hinter der Windschutzscheibe zu platzieren, dass ein digitales Parkticket erworben wurde. Dies kann entweder eine offizielle Vignette des Park-App-Anbieters sein – was bei erstmaligem Parken keine Option ist, da diese per Post zugeschickt wird – oder
eine handgeschriebene Notiz. Wohl denen, die noch Papier und Stift im Handschuhfach haben. Laut derzeitiger Verordnung sei der schriftliche Hinweis Pflicht, erklärt eine Pressesprecherin der Stadt Lübeck. Durch die Notiz wüssten die Kontrollierenden, dass sie prüfen müssen, ob ein digitaler Parkvorgang aktiv ist. Warum dies nicht ohne einen Hinweis und nur mit einem kurzen Blick ins System geschehen kann, weiß nur der Verwaltungsgott. Im Herbst 2024 war die Stadtverwaltung dabei, mit der Stadtplanungsgesellschaft KWL eine neue Parkgebührenverordnung auszuarbeiten. Im Februar 2025 wurde die Vorlage jedoch noch einmal zurückgestellt – es gibt noch rechtliche Belange zu klären. Die politische Beratung werde beizeiten wieder aufgenommen, heißt es aus der Lübecker Stadtverwaltung. Den analogen Wurmfortsatz des digitalen Parkprozesses hält man bis dahin „für zumutbar“. Das ist er wohl, größere physische oder seelische Leiden während des Zettelschreibens wurden bislang nicht erfasst. Er ist aber vor allem eins: ein exemplarischer, kleiner, feiner Unterschied zwischen einem konsequent digitalisierten Staat wie Dänemark und dem unseren, in dem die kulturimmanente Ehrfurcht vor der Vorschrift und die rätselhaft langen Prozesse, diese anzupassen, eine schnellere Digitalisierung immer wieder verschleppen.
Die digitalen Anwendungen in den Behörden existieren in großen Teilen nebeneinander. Die Antragstellung wird seit dem OZG kontinuierlich auf digital umgestellt, von Flächendeckung sind wir bei den Onlineanträgen jedoch in vielen Fällen entfernt. Und die Chancen, die eine Digitalisierung ermöglichen, werden noch nicht hinreichend genutzt. Wir bilden in vielen Fällen lediglich die analogen Prozesse in digitaler Form ab. Die Transformation der Verwaltung muss weiter gehen. Dafür braucht es neben der Digitalisierung ein stärkeres und strukturiertes Zusammenwirken in der gesamten Verwaltung.
Digitalisierung steuern
Das gemeinsam wirksame Vorgehen ist Anlass für uns, für den IT-Planungsrat, die Föderale Digitalstrategie für die Verwaltung zu erarbeiten, sichtbar zu machen und auf deren Grundlage die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland zu steuern.
Die Ausgangsfrage ist dabei: Was wollen wir mit der Digitalisierung der Verwaltung erreichen? Diese Frage beantworten wir im ersten Teil unserer Strategie mit dem Zukunftsbild für die Verwaltung, abgeleitet aus den Anforderungen an die Verwaltung aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und Organisationen, der
Gemeinsame Verantwortung für die Zukunft der Verwaltung
(BS/Ina-Maria Ulbrich) Die Verwaltung in Deutschland arbeitet digital. Fachverfahren werden in den allermeisten Behörden seit Jahren genutzt, um Anträge und Vorgänge zu bearbeiten. Auch KI wird zur Unterstützung der Bearbeitung bereits eingesetzt. Und doch haben viele Menschen den Eindruck, die Verwaltung in Deutschland ist nicht gut aufgestellt, was digitales Arbeiten betrifft. Woran liegt das?

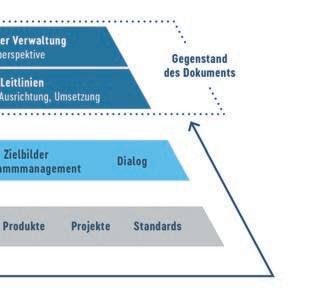
Das Zukunftsbild besteht aus drei Bausteinen mit jeweils eigenen Maßnahmen: Dachstrategie, Schwerpunktthemen und Umsetzungsvorhaben. Foto: BS/IT-Planungsrat
eigenen Mitarbeitenden sowie der politischen Entscheidungsträger, und unter Berücksichtigung der Herausforderungen, mit denen Verwaltung konfrontiert ist: Verwaltung der Zukunft ist auch unter

Die Roadshow für eine zukunftssichere Verwaltungsdigitalisierung

dem Druck knapper Ressourcen effizient durch Arbeitsteilung in einem zukunftsfähigen Föderalismus. Verwaltung ist in einer sich wandelnden Welt krisenfest und anpassungsfähig. Das Vertrauen in


gänglich ist, unter anderem durch die Deutsche Verwaltungscloud. Dafür ist die Informationssicherheit Grundvoraussetzung. Die Ziele in diesem Themenfeld sind automatisierte, innovationsorientierte, risikobasierte und krisenresiliente Sicherheit. Ein weiteres Ziel ist die Verankerung von Informationssicherheit in Leadership. Im Schwerpunktthema „Datennutzung“ soll eine effektive Data Governance erarbeitet werden, die Standards für den Umgang mit Daten definiert und verbreitet. Ziel ist Datenschutz, der bei der Entwicklung föderaler und digitaler Lösungen von Anfang an mitgedacht wird. Die Datennutzung soll durch eine moderne Registerlandschaft ermöglicht werden. Schließlich ist ein weiteres Ziel, die Nutzung von KI für die Verwaltung menschzentriert, chancen- und gemeinwohlorientiert entsprechend einer gemeinsamen Governance zu gestalten.
Dritter Strategieteil im November 2025
Der erste und der zweite Teil unserer Strategie sind beschlossen. Diese Zielbilder werden nun weiter untersetzt mit konkreten Maßnahmen. Daraus entsteht der letzte Teil der Strategie, das Umsetzungsportfolio, das im November 2025 verabschiedet werden soll.

JETZT ANMELDEN!







den Staat ist durch nachvollziehbares Handeln der Verwaltung auf Augenhöhe gegeben. Zur Erreichung dieser zukunftsfähigen Verwaltung leistet der IT-Planungsrat seinen Beitrag. Wie? Das beschreiben wir mit den Leitlinien, die wir uns für unser gemeinsames Vorgehen gegeben haben. Diese Leitlinien beziehen sich auf die Governance, die Fachlichkeit und die Umsetzungsprinzipien. Beispiele für die Governance sind die Weiterentwicklung des EfA-Ansatzes (Einer entwickelt für Alle) hin zu Einer prüft für Alle, Einer betreibt für Alle und Einheitlich für Alle, oder die gemeinsame Finanzierung. Fachlich haben wir uns unter anderem auf konsequente Automatisierung, Datensparsamkeit, Datennutzung, Souveränität und Interoperabilität verständigt und in den Leitlinien festgeschrieben, was wir gemeinsam darunter verstehen. Die Umsetzungsprinzipien fokussieren auf Wirksamkeit und Verbindlichkeit.
Unsere Strategie ist die Grundlage für unser Handeln, für unsere Beschlüsse, Projekte, Produkte, Maßnahmen. Wir arbeiten bereits jetzt an der Umsetzung, unter anderem mit den Beschlüssen zur Deutschen Verwaltungscloud in der Frühjahrssitzung des IT-Planungsrates oder mit der Etablierung des Standardisierungsboards, erstmals mit Beteiligung der Wirtschaft.

























Verbindliche Standards Mit den Zielbildern für die Schwerpunktthemen des IT-Planungsrates konkretisieren wir im zweiten Teil unserer Strategie die Leitlinien und legen fest, was wir erreichen wollen. Im Schwerpunktthema „Digitale Transformation“ ist das Ziel, Methoden bereitzustellen, um wichtige Verfahren vollständig zu modellieren und zu analysieren und dadurch Digitalisierungshemmnisse abzubauen. Verbindliche Standards sollen skalierbare Lösungen ermöglichen und interföderale Zusammenarbeit erleichtern. Digitale Fähigkeiten der Mitarbeitenden in den Verwaltungen sollen ausgebaut werden, um Verwaltung zukunftsfähig zu gestalten.
Start der VOIS-STADION-TOUR 2025 am 29. und 30. April in der Red-Bull-Arena Leipzig


Anmeldung, Programm und weitere Termine: www.vois.org/voisstadiontour2025



Im Schwerpunktthema „Digitale Anwendungen“ ist das Ziel, mit Ende-zu-Ende digitalisierten Prozessen und der Nutzung der Daten im Sinne des Once-Only-Prinzips Verwaltung zu entlasten und besser zu machen. Die Leistungen der Verwaltung sollen flächendeckend online zur Verfügung stehen und Kooperation und EfA gestärkt werden. Die Digitalen Anwendungen sollen nutzerfreundlich sein, unter anderem durch Basisdienste wie eine digitale Identität und ein digitales Postfach für sämtliche Verwaltungskommunikation. Dazu bedarf es einer Digitalen Infrastruktur, die nach den Zielen in diesem dritten Schwerpunktthema skalierbar, souverän, resilient und für die Verwaltungen einfach zu-












In Zusammenarbeit entstanden
Wie die Umsetzung, ist auch die Strategie selbst durch ein gemeinsames Wirken vieler entstanden. Nicht nur die Mitglieder des IT-Planungsrates, die IT-Verantwortlichen von Bund und Ländern, sondern auch die beratenden Mitglieder, die kommunalen Spitzenverbände, die Repräsentanten für den Datenschutz und die FITKO haben diese Strategie erarbeitet. Unterstützt wurden wir von der Agora Digitale Transformation und der PD Partnerschaften Deutschland sowie von vielen Vertreterinnen und Vertretern aus Bund, Ländern, Kommunen, aus Wissenschaft und Wirtschaft und aus Netzwerken, die sich für die Verwaltung der Zukunft engagieren. Nur so wird die Strategie eine gemeinsam getragene Strategie und nur so werden wir erfolgreich bei der Umsetzung sein.

Ina-Maria Ulbrich ist Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern, CIO des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzende des IT-Planungsrats im Jahr 2025. Foto: BS/Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung
Große Digitalisierungsvorhaben kranken meist an mangelnder Umsetzungsgeschwindigkeit, geraten dafür aber umso schneller in Vergessenheit. Dabei hätte viel aus diesen gelernt werden können. Dieses Versäumnis haben das SHI Stein-Hardenberg Institut – u.a. bekannt für das Grundlagenwerk „Stein-Hardenberg 2.0“ – und Agora Digitale Transformation in einer gemeinsamen empirischen Studie nachgeholt. Dazu wurden Entscheiderinnen und Entscheider interviewt, die Verwaltungsdigitalisierung in den vergangenen 25 Jahren mitgestaltet haben. Der reflektierte Blick zurück ist mehr denn je notwendig, denn die heutige Ausgangslage ist das Resultat der Vergangenheit. Statt hastig Empfehlungen und Punktepläne zu schreiben, die zwar politische Aufmerksamkeit bekommen, aber kaum Substanz haben, sollten wir einen Moment innehalten, um aus zurückliegenden Erfahrungen zu lernen und die notwendigen Schritte für die Transformation von Staat und Verwaltung mit Bedacht abzuleiten.
Rückblick
Werfen wir zunächst einen Blick zurück: Im Jahr 1997 verabschiedete die Bundesregierung das weltweit erste (Digitale) Signaturgesetz. Der Förderwettbewerb MEDIA@ Komm zur Jahrtausendwende sollte für Anwendungsfälle für die digitale Signatur in den Kommunen sorgen. Aus den Gewinnerprojekten gingen u. a. Governikus und die XÖV-Standards hervor, die wir bis heute nutzen. Anfang der 2000er Jahre bemühte sich auch der Bund um eine Digitalisierung seiner Leistungen mit BundOnline 2005. Doch bereits dieses Vorhaben war für seine Front-End-Fokussierung kritisiert worden. DeutschlandOnline als erster ebenenübergreifender Ansatz scheiterte kläglich. Steuerungsstrukturen für solch komplexe Vorhaben mussten erst noch entwickelt werden. Es dauerte weitere zehn Jahre, bis die ersten heute wichtigsten Akteure wie z.B. der IT-Planungsrat entstanden. Trotz E-Government-Gesetzen be-
Der Behörden Spiegel ist in diesen Umbrüchen mehr als nur ein Beobachter – er ist Impulsgeber und Sprachrohr. In einer Zeit, in der technologische Souveränität für Deutschland und Europa wichtiger denn je wird, ermöglicht er die dringend notwendige Debatte über Unabhängigkeit und Innovation. Denn eines steht aus meiner Perspektive fest: Die digitale Verwaltung darf nicht von wenigen außereuropäischen Anbietern abhängig sein.
Wandel in den Köpfen
Dass dieser Wandel bereits begonnen hat, zeigte sich zuletzt beim Digitalen Staat 2025, einer der wichtigsten Veranstaltungen für die digitale Verwaltung – organisiert durch den Behörden Spiegel. Hier kamen Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und machten deutlich, dass das Bewusstsein für digitale Souveränität rasant wächst. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen sollten nicht nur als Herausforderung verstanden werden, sondern auch als Chance: Europa kann unabhängiger werden – nicht nur in der Verteidigung, sondern auch in der Technologie. Der Aufbau eigener digitaler Strukturen, die sichere Kommunikation und Zusammenarbeit ermöglichen, ist längst eine Notwendigkeit.
Ein Blick auf die letzten 25 Jahre Verwaltungsdigitalisierung
(BS/Ayleen Siegemund/Stefanie Köhl) Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland erscheint mitunter als Hamsterrad: Viele Konzepte und Strategien wiederholen sich oder es werden Umsetzungswege eingeschlagen, die sich bereits früher als ineffektiv erwiesen haben. Daher stellt sich die Frage: Wurde aus vergangenen Erfahrungen (nicht) gelernt?

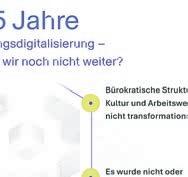


Auf institutioneller Ebene wurde bis heute nicht systematisch aus den Erfahrungen vergangener Digitalisierungsvorhaben gelernt – weder aus Fehlern noch aus Erfolgen.
stehen auch weiterhin hinderliche Schriftformerfordernisse und andere bürokratische Hürden, wie man im Grunde in allen NKR-Berichten seit seiner Gründung im Jahr 2006 nachlesen kann. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) folgt eine Art Renaissance – und scheiterte an den gleichen ungeklärten Fragen wie zuvor viele andere Großvorhaben. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung mit nahezu unveränderten Rahmenbedingungen ist es eher überraschend, dass sich noch immer Akteure wundern, warum wir seit Jahren nicht zu anderen Ergebnissen kommen. Wer beschafft wie Mehrheiten bspw. für eine Standardisierung im Back-Office? Wer steuert die Umsetzung und welche „echten“ Steuerungsmöglichkeiten gibt es? An den Steuerungsproblemen vermochte auch die FITKO als neuer Umsetzungsarm des IT-Planungsrats bisher nichts zu ändern. In Summe sind nur wenige Projekte in Betrieb gegangen, wie bspw.
Digitale Transformation
die Einheitliche Behördenrufnummer 115. Während einige Einzelprojekte über mehrere Regierungsprogramme und Umsetzungsstrategien ‚mitgezogen‘ wurden – z. B. die von Anfang an tot gesagte De-Mail, die erst letztes Jahr eingestellt wurde –, sind andere vielversprechende Vorhaben versandet oder wurden nicht weiterentwickelt.
Schaufensterdigitalisierung Mangelnden politischen Aktivismus und fehlende Mittel kann man schwerlich unterstellen, wenn man sich die Regierungserklärungen, Strategien, Programme und damit verbundenen Ressourcen in ihrer Gesamtheit ansieht. Allerdings war das politische Interesse nie wirklich nachhaltig, sondern erfolgte nach politischen Opportunitäten. Die Folge: „Schaufensterdigitalisierung“ statt Infrastrukturentwicklungen und innerbehördlicher Transformation. Auch ein zukunftsfähiges Zielbild für die Verwaltung der Zukunft
jenseits von inkrementellen Änderungen fehlt (Strategielücke). Budgetlogik und Haushaltsgrundsätze verhindern langfristige und nachhaltige Planungen. Konsenskultur und bürokratische Entscheidungsverfahren erschweren die Entscheidungsfindung und die Projektarbeit erforderte andere Kompetenzen als sie in den Ministerien vorhanden waren bzw. sind (Kompetenzlücke). Hinzu kommt das sowohl vertikal als auch horizontal fragmentierte Verwaltungssystem, das keine „Wimmelbild“-Architekturen, sondern eine darauf abgestimmte Umsetzungsstruktur benötigt. Keine der bisherigen Entwicklungen im Bereich der (IT-)Governance vermochte es, die Eigeninteressen der verschiedenen Akteure zusammenzuführen und in funktionsfähige Steuerungsprozesse zu überführen (Organisationslücke). Es ist nicht verwunderlich und bis zu einem gewissen Grad auch normal, dass in den letzten 25 Jahren der Digitalisierung von Staat und Verwaltung Fehler gemacht wurden. Manchmal stellen sie sich auch erst im Nachhinein als Fehler heraus. Verwunderlich ist allerdings die Beharrlichkeit, mit der sich dem Lernen systematisch verweigert wurde. Vermeintlich hoheitliches Wissen wird gehütet, unabhängige Evaluierungen konsequent vermieden, die offene Reflexion von Fehlern durch kulturelle Faktoren und personalpolitische Maßnahmen verhindert, wichtige transformative Kompetenzen auch weiterhin nicht aufgebaut.
Nachhaltige Transformation notwendig
Geschichtsvergessenheit ist auch für die Verwaltungsdigitalisierung fatal. Die Fehlentwicklungen der letzten 25 Jahre lassen sich nicht
Ein Kommentar von Cristian Mudure, CEO von Stackfield (BS/Cristian Mudure) 1985 – Boris Becker gewinnt erstmals Wimbledon, das Internet steckt noch in den Kinderschuhen, ich selbst bin gerade fünf Jahre alt und in Deutschland erscheint die erste Ausgabe des Behörden Spiegel. Seit 40 Jahren begleitet dieses Medium die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung, spiegelt Trends wider und baut Brücken zwischen Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft. Heute stehen wir erneut an einem Wendepunkt: Geopolitische Konflikte, die zweite Amtszeit von Donald Trump, der rasante Aufstieg Künstlicher Intelligenz (KI) – all das verändert auch die Verwaltung.
Wir bei Stackfield erleben aus erster Hand, wie wichtig dieser Diskurs ist. Als deutscher Anbieter einer sicheren Kollaborationsplattform setzen wir uns dafür ein, dass Verwaltungen moderne, datenschutzkonforme und leistungsfähige Lösungen aus Europa nutzen können. Der Behörden Spiegel bietet uns dabei die Plattform, um mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern in den Austausch zu treten, zu verstehen, wo der Bedarf liegt, und konkrete Lösungen aufzuzeigen. Ohne dieses Medium wäre es für uns als Alternative zu großen US-Playern kaum möglich gewesen, uns in der öffentlichen Verwaltung zu etablieren. Die Erfolgsgeschichten sprechen für sich: Die Stadt Nürnberg setzt Stackfield für ihr Projekt- und Prozessmanagement ein. Knapp 2.000 Mitarbeitende nutzen hier unser Tool, um ihre Zusammenarbeit effizienter und sicherer zu gestalten. Aber auch in anderen
Städten wie Aschaffenburg oder Erlangen konnten wir unsere Alternative zu US-Lösungen etablieren. Diese und über 300 weitere Partnerschaften mit Kommunen, Landes- und Bundesbehörden zeigen, dass digitale Souveränität nicht nur eine Vision ist, sondern bereits Realität – mit konkretem Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger.
Europäische Kompetenzen nutzen Immer mehr Verwaltungen setzen auf europäische Lösungen, um die Abhängigkeit von internationalen Großkonzernen zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur um Eigenständigkeit, sondern auch um Kontrolle über eigene Daten. Es geht um Investitionen in den eigenen Wirtschaftsraum und die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung von alternativen Lösungen, die auf europäischen Werten basieren, mitzuwirken. Doch es braucht noch mehr mutige Schritte. Die Verwaltung muss
in zwei bis drei Jahren wettmachen. Umso wichtiger ist es, die nächsten Schritte gezielt zu setzen und auf den Erkenntnissen der Vergangenheit aufzubauen. Ein neuer Ansatz ist erforderlich. Dazu braucht es:
• eine langfristige verwaltungspolitisch tragfähige Vision für die Verwaltung,
• die Entwicklung einer kohärenten Strategie für eine digital integrierte Verwaltung,
• modernisierte Verwaltungsstrukturen mit flexibleren Entscheidungswegen und Verbesserung der Kooperationsfähigkeit,
• stärkere Zentralisierung der Steuerung und Finanzierung von Digitalisierungsvorhaben und
• systematische Evaluierung und Erfahrungstransfer als feste Bestandteile künftiger Digitalisierungsprojekte für Lerneffekte. Im Zweifel gilt: Deregulierung und bessere Regulation vor Digitalisierung des Ist-Zustandes. Mit selektiven Digitalisierungsmaßnahmen und reaktiven Programmen allein ist kein Staat zu machen. Eine grundlegende nachhaltige Transformation ist notwendig: Wir müssen raus aus dem Hamsterrad und rauf auf die Leiter.
Die Studie „Lernen aus der Vergangenheit?! Entwicklungslinien der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland aus den letzten 25 Jahren“ steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://doi.org/10.5281/zenodo.14793086


moderne und sichere Alternativen aktiv fördern und implementieren. Wer sich für europäische Technologien entscheidet, setzt auf mehr Datensouveränität, eine stärkere Innovationslandschaft und eine digitale Verwaltung, die auf eigenen Beinen steht. Ein starkes Europa beginnt nicht nur mit politischen Entscheidungen, sondern auch mit gezielten Investitionen in eigene Technologien.
Wir haben die Zukunft in der Hand Die nächsten Jahre werden entscheidend sein: Wie gestalten wir die digitale Verwaltung Europas? Welche Rolle spielen deutsche Lösungen in einer Welt, in der ITInfrastrukturen zunehmend zum geopolitischen Spielfeld werden? Wie können wir Innovationen vorantreiben, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Datenschutz einzugehen? Der Behörden Spiegel wird diese Fragen begleiten – so wie er es in den vergangenen vier Jahrzehnten getan hat. Dafür wollen
ADVERTORIAL
wir uns bedanken und herzlich gratulieren!
Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen –mit einem starken, unabhängigen Behörden Spiegel und einer digitalen Verwaltung, die auf zukunftsfähige, souveräne Technologien setzt. Wir von Stackfield werden weiterhin alles geben, um die Zusammenarbeit und Kommunikation in der deutschen Verwaltung so einfach, übersichtlich und sicher wie möglich zu gestalten.
Weitere Informationen zu den Lösungen von Stackfield für Behörden


Unternehmens Stackfield. Foto: BS/Stackfield
In 40 Jahren kann Großes gelingen, wie der Deutschlandtakt, jener deutschlandweit abgestimmte integrale Taktfahrplan im Schienenpersonennah- und Fernverkehr, der regelmäßige Zugverbindungen, optimierte Umsteigezeiten und eine Verdichtung des Angebots vorsieht. In einem Jahr, in dem der Behörden Spiegel 40 Jahre zurückschauen kann und die Bahn 40 Jahre nach vorne blickt, ist die Frage berechtigt, wie es Deutschland, Europa und der Welt in vier Dekaden ergehen wird.
Kultur der Dystopie Wenn wir dieser Tage in die Zukunft blicken, sind Zukunftsbilder meist von neuen Technologien inspiriert. Nicht selten zeigen sie dystopische Szenarien, in denen Staatensysteme völlig gescheitert und zerfallen sind oder übermächtige Organisationen gesellschaftliches Leben und individuelle Freiheiten vollständig unterdrücken. Die Liste solcher Werke ist lang und vielfältig: Bücher über dystopische Biopolitik wie Juli Zehs „Corpus Delicti“ und Zoë Becks „Paradise City“, die hinter vermeintlich erfolgreichen Gesundheitssystemen verborgene Formen sozialer Kontrolle aufdecken. Romane, die katastrophale Folgen des Klimawandels zeichnen, wie Stephen Markleys „The Deluge“ oder C. Pam Zhangs „Land of Milk and Honey“. Erzählungen über staatliche Überwachung im privaten Raum, etwa Celeste Ngs „Our Missing Hearts“. Ebenso vertreten sind Filme wie „Crimes of the Future“ oder „The Midnight Sky“, die technischen Fortschritt mit gesellschaftlichem Zerfall verbinden, sowie immersive Kunstausstellungen, beispielsweise von Mike Nelson oder Josh Kline, die den Betrachter in postapokalyptische Szenerien eintauchen lassen, um Kritik an Kapitalismus, Konsum und Klimakrise zu formulieren.
Gesellschaft provoziert Technologie Betrachtet man die neue Generation emergenter Technologien, fühlt man sich in diesen Zukunftsbildern bestätigt: Eine generelle Künstliche Intelligenz (KI), die sich selbst Zwecke setzen kann, scheint vielen nur noch wenige Jahre entfernt zu sein. Gehirn-Computer-Schnittstellen machen große Fortschritte dabei, Gedanken zu lesen und in Zukunft vielleicht sogar zu steuern. Quantencomputer könnten bislang unlösbare Probleme in Angriff neh-
Die öffentliche Verwaltung 2065
(BS/Prof. Dr. Christian Djeffal) Wir sollten anders über die Zukunft nachdenken, insbesondere über zeitliche Entfernungen, die sehr weit reichen, aber dennoch überschaubar bleiben. 40 Jahre sind eine angemessene Perspektive – so weit können die meisten zurückblicken oder hoffentlich vorausschauen.

Das Denken prägt das Handeln, das Handeln formt die Zukunft. Allein deshalb ist es ratsam, KI in der Verwaltung nicht als Konkurrenz, sondern als Kooperation zu verstehen. Grafik: BS/TA design, stock.adobe.com
men, Biocomputer mit Organismen verschmelzen. Und sicherlich wird es in 40 Jahren Technologien geben, die für uns heute nach ferner Zukunftsmusik klingen.
„Die Technik muss dort eingesetzt werden, wo sie den Menschen hilft“
Dabei drängt sich die Frage auf, warum Utopien heute so aus der Mode gekommen sind. Niemand denkt mehr über eine Welt ohne Krieg nach, wie Kant in seiner Streitschrift „Zum Ewigen Frieden“, niemand über bildungsfokussierte glückliche Staaten wie Bacons „Neues Atlantis“ oder Harringtons „Commonwealth von Ozeanien“. Diese Werke sind immer noch anspruchsvoll und lehrreich, doch sie sind uns fremd geworden, weil
wir der Zukunft misstrauen. Diese Einstellung könnte gerade in Zeiten eines technischen Wandels mit immer schnelleren Zyklen der falsche Ansatz sein.
Denn die Einsicht ist gewachsen, dass technologische Durchbrüche nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern vielmehr von den Wünschen und Überzeugungen der jeweiligen Gesellschaften provoziert werden. So ist es sicher kein Zufall, dass Distributed-Ledger-Technologien (Technik verteilter Kassenbücher, eine Technik zur Dokumentation von Transaktionen, Anm. d. R.) und Blockchain in anarchischen Kreisen entstanden sind und das dezentrale, resiliente Internet maßgeblich auch vom Militär geprägt wurde.
Gewinnbringendes Denken
Diese Erkenntnis gibt Anlass zu einem interessanten Gedankenexperiment: Müssten wir vor diesem Hintergrund nicht positive Zukunftsbilder entwickeln und diese offensiv einfordern, um die Entwicklungen möglichst in diese Richtung zu lenken? Gehen wir diesem Experiment einmal nach. Der erste Schritt wäre, sich zu überle-
gen, welche Verwaltung wir uns im Jahr 2065 wünschen. Es geht also nicht darum, wilde Spekulationen über die möglichen Auswirkungen und Möglichkeiten von Technologien anzustellen, sondern zu verstehen, was wir in dieser Zeit erreicht haben wollen. Der zweite Schritt ist dann zu ergründen, was uns eigentlich davon abhält, diese Wünsche zu erfüllen und wie man diese Hürden überwinden kann. Erst hier kommen neue Technologien ins Spiel. Sie werden daraufhin befragt, was sie zur Umsetzung der menschlichen Ziele beitragen können. Schon hier zeigt sich, dass man bei diesem Ansatz ganz anders über Technologien und die Zukunft nachdenkt. Es geht nicht mehr darum, welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben werden, sondern wie sie gewinnbringend eingesetzt werden können. Das ist alles andere als eine triviale Frage. Denn man muss erst einmal verstehen, dass KI auch zur Vereinfachung der Verwaltungssprache, insbesondere für Menschen mit Einschränkungen, verwendet werden kann und auch in anderen Bereichen Gemeinwohlzwecken dienen kann.
Effektivität und Menschlichkeit Wenn wir diesem Experiment folgen und uns fragen, was sich die Menschen heute für eine Verwaltung wünschen, gibt es wahrscheinlich keine bessere Quelle als die Bürgerbeauftragten, die in vielen Ländern und im Bund Anlaufstelle für Beschwerden sind. Liest man ihre Berichte, wird erstaunlich oft der Wunsch nach Digitalisierung geäußert, damit die Verwaltung schnellere und bessere Dienstleistungen anbieten kann. Dabei ist auch schon davon die Rede, dass die Verwaltung an vielen Stellen überlastet ist, was teilweise bereits als Versagen wahrgenommen wird. Auch das Once-Only-Prinzip wird immer wieder eingefordert. Ferner wünschen sich Bürgerinnen und Bürger an vielen Stellen Personalisierung und möchten mit ihren spezifischen Fragen
und Problemen wahrgenommen werden. Sie wollen beteiligt werden und die Gelegenheit haben, wichtige Entscheidungen gemeinschaftlich mit der Verwaltung zu entwickeln. Wenn es auch seltsam anmutet, dass Bürger gleichzeitig mehr Technik und mehr Menschlichkeit und Gemeinschaft einfordern, so liegt darin nicht notwendigerweise ein Widerspruch. Die Technik muss dort eingesetzt werden, wo sie den Menschen hilft, und menschliche Ressourcen in der Verwaltung müssen gezielt freigesetzt werden, um einen besseren Kontakt zu gewährleisten. Mehr Effektivität und mehr Menschlichkeit – das sind durchaus Ziele, die sich die deutsche Verwaltung vornehmen könnte. Aber ist ein solches Vorgehen am Ende nicht naiv?
Lust auf die Zukunft
Die Erfahrungen im Verfassungsrecht zeigen, dass das nicht der Fall sein muss. Denn nur so konnte das Grundgesetz 1949 formulieren, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind – eines von vielen Beispielen im Verfassungsrecht, in denen Wünsche nicht nur Väter und Mütter von Gedanken, sondern Realität werden. Wenn ich an Staat und Verwaltung in 40 Jahren denke, dann wünsche ich mir diesen mutigen Zweckoptimismus. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass niemand die Zukunft wirklich vorhersagen kann; sie ist offen. Deshalb ist es so bedeutend, gemeinsame Überzeugungen zu formulieren und diese mit Mut und Engagement umzusetzen, auch in der Technik. Diese Zukunftslust und dieser Kampfgeist sprechen aus dem Recht auf gute Verwaltung der Grundrechtecharta der Europäischen Union und der Verfassung der Hansestadt Bremen, die immerhin 1947 formulierte: „Der Mensch steht höher als Technik und Maschine.“

Prof. Dr. Christian Djeffal ist Rechtswissenschaftler und Professor für Recht, Wissenschaft und Technologie an der TU München. Zu seinen Veröffentlichungen gehören u.a. „Artificial Intelligence and Public Governance“ und „AI, Democracy and the Law“. Foto: BS/HIIG

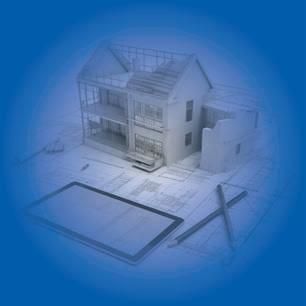



Behörden Spiegel: Frau Lindstrøm, wie stark werden digitale Identitäten in Dänemark genutzt?
Mette Lindstrøm: In Dänemark verfolgen wir eine sehr erfolgreiche Strategie. MitID, unser nationales elektronisches Identifizierungssystem, wird sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor stark nachgefragt und von der Bevölkerung intensiv genutzt. Es handelt sich um die „dritte Generation“ der digitalen Identität, was bedeutet, dass das System sichere Identifikationsmethoden wie Multi-Faktor-Authentifizierung und biometrische Verifizierung integriert. Etwa 96 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die über 13 Jahre alt sind, nutzen das Identifikationssystem. Laut einer letzten Befragung sind 83 Prozent damit zufrieden, lediglich zwei Prozent nicht. Diese Identitätslösung ist ein integraler Bestandteil unseres Alltags, da sie beispielsweise bei der Kontoeröffnung oder der Anmeldung von Kindern im Kindergarten verwendet wird.
Behörden Spiegel: Im Bereich der digitalen Identitäten arbeitet Europa an verschiedenen EUDIWalletProjekten. Ist Dänemark auch in diesem Bereich aktiv?
Lindstrøm: In Dänemark konzentrieren wir uns vor allem darauf, Use-Cases für die Wallet zu entwickeln. Wir wollen uns insbesondere auf Identifikation und Altersverifikation konzentrieren. Ziel ist es, eine Wallet zu schaffen, mit der man beispielsweise ein Paket bei der Post abholen kann. Bei der Altersverifikation möchten wir die Daten der Bürgerinnen und Bürger schützen und nur die relevanten Informationen weitergeben. Wenn wir beispielsweise Produkte erwerben möchten, die erst ab 30 Jahren erhältlich sind, soll in der Wallet nur angezeigt werden, ob man über oder unter 30 Jahren alt ist – ein Grünes-Licht-Rotes-Licht-Prinzip.
Behörden Spiegel: Wenn wir in Deutschland über digitale Prozesse sprechen, reden wir auch viel über Inklusion. Das Konzept DigitalOnly ist hier umstritten. Wie geht Dänemark mit der Inklusion von weniger digitalversierten Menschen um?
Lindstrøm: Dänemark ist ein demokratisches Land, und wir möchten niemanden ausschließen, nur weil er weniger digital-affin ist. Hinzu kommt, dass wir ein „alterndes“ Land sind, sodass früher oder später jeder mit digitalen Prozessen als Herausforderung konfrontiert wird.
Dänemark testet Anwendungsfälle für die EUDI-Wallet
(BS) Dänemark ist in der Verwaltungsdigitalisierung Deutschland einen Schritt voraus. Maßgeblich dafür ist die Behörde Digitaliseringsstyrelsen. Sie ist für die Umsetzung und Koordination der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor zuständig ist. Zu ihren Aufgaben gehört das Bürgerportal Borger.dk und die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der digitalen Transformation. Im Interview mit der Vizechefin von Digitaliseringsstyrelsen, Mette Lindstrøm Lage, spricht Paul Schubert über den Erfolg von MitID und die Inklusion des weniger digital-affinen Teils der Bevölkerung bei Digitalisierungsprojekten.

unter anderem, die Folgen der Digitalisierung zu berücksichtigen und nutzbare Alternativen bereitzustellen. Dazu zählt beispielsweise, dass Bürgerinnen und Bürger am Telefon unterstützt werden, sie im Bürgeramt beraten werden oder dass sie jemanden benennen können, der die digitalen Dienste für sie beantragt.
Behörden Spiegel: Neben der EUDIWallet wurde von der Europäischen Union auch der Digital Service Act (DSA) geschaffen, der Einfluss auf die Mitgliedsländer hat. Wie geht Dänemark hier mit den Herausforderungen um?
Lindstrøm: In Dänemark gilt der DSA nur für rund 400 Unternehmen, das Ausmaß ist also begrenzt. Es ist für uns wichtig, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Die meisten Herausforderungen beim DSA sind jedoch nicht in Dänemark zu lösen.
Behörden Spiegel: Neben dem DSA hat die EU auch den AI Act geschaffen. Wie blickt Ihr Land auf die Regulierung von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI)?
„Die Menschen erkennen, dass die Verwaltungsdigitalisierung mehr Optionen bietet und 24 Stunden verfügbar ist.“
Allerdings stellen wir fest, dass auch der ältere Teil der Bevölkerung die Chancen der Digitalisierung gut annimmt. Die Menschen erkennen, dass die Verwaltungsdigitalisierung mehr Optionen bietet und 24 Stunden verfügbar ist. Hier entwickeln wir verschiedene Werkzeuge, um die digitale Teilhabe zu erleichtern. 2024 haben wir Prinzipien für die digitale Inklusion im öffentlichen Sektor festgelegt. Dazu gehören
Lindstrøm: Man kann beobachten, dass die KI-Regulierung nun wirklich Fahrt aufnimmt. Als Land sind wir in der Verantwortung, schnell und ausführlich die Leitlinien und deren Interpretation mit den beteiligten Institutionen zu teilen. Dafür haben wir eine Sandbox entwickelt, in der Organisationen testen können, ob ihre Projekte unter die KI-Regulierung fallen. Zudem haben wir Expertengruppen aus der Industrie
und Wirtschaft gebildet, die das Potenzial von KI ergründen und über die aktuelle KI-Regulierung informieren.
Insbesondere in den „Hoch-Risiko-Sektoren“, die vom AI Act am stärksten betroffen sind, herrscht noch eine gewisse Unsicherheit. Wir empfehlen den Institutionen, bereits frühzeitig mit der Dokumentation ihrer Prozesse zu beginnen, um eine mögliche Sanktionierung zu vermeiden.
Behörden Spiegel: Sind die Organisationen mit der Regulierung von KIAnwendungen einverstanden?
Lindstrøm: Grundsätzlich vertreten die Organisationen eine ähnliche Ansicht wie unsere Behörden. Sie sind jedoch sehr unsicher, wie sich die verschiedenen Regulierungen miteinander vereinbaren lassen. Wie verhält sich der AI Act zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)? Häufig gibt es verschiedene Richtlinien, die sich auf die Sektoren auswirken und die alle berücksichtigt werden müssen.
Das ist für die Beteiligten der schwierigste Part. Genau dafür ist die Sandbox da. Die Unsicherheit kommt meist von der unterschiedlichen Interpretation der Richtlinien hinsichtlich des AI Acts. Wir arbeiten jedoch daran, diese Unsicherheiten auszuräumen.

(BS/ast) Um seine Souveränität zu stärken, investiert Deutschland in die Erforschung von IT-Sicherheitstechnologien. Die Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit (Cyberagentur) bekommt ab diesem Jahr dazu mehr Mittel: 80 Millionen Euro statt 50 Millionen. Den größten Beitrag zur Erforschung und Entwicklung von Sicherheitstechnologien leistet aber nach wie vor das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Geplante Mittel für die Cyberagentur 2024-2028 (in Mio Euro)
Mittel für die
Mittel für Förderprogramme der Bundesregierung zur Wissensentwicklung und -verbreitung zu Sicherheitstechnologien im Zusammenhang mit digitaler Souveränität 2018-2024 (in Mio Euro)
Forschungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit „Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt“
Forschungsrahmenprogramm der Bundesregierung zur IT-Sicherheit „Digital. Sicher. Souverän.“
Förderprogramm für Forschungs-und Entwicklungsvorhaben im Bereich „Cybersicherheit und digitale Souveränität in den Kommunikationstechnologien 5G/6G“
Förderprogramm „Innovationen im breitbandigen Digitalfunk BOS“
Mittel im Bundeshaushalt zur Erforschung und Entwicklung von Sicherheitstechnologien im Zusammenhang mit digitaler Souveränität 2023-2025 nach Ressort (in Mio Euro)










www.datagroup.de





Behörden Spiegel: Dr. Schabhüser, wie fühlt sich Ihr neuer Alltag an?
Gerhard Schabhüser: Der fühlt sich sehr gut an. Erstens ist es schön, länger ausschlafen zu können, denn ich gehöre zu den Eulen und nicht zu den Lerchen. Zweitens kann ich länger mit unserem Hund spazieren gehen, das soll ja gesund sein. Das Dritte – und das ist wirklich ein Stück Arbeit – ist die Vorbereitung für meine Vorlesung an der Univeristät Bonn, die ich im Sommersemester halte. Der letzte Punkt kommt noch nicht so zum Tragen: Moped fahren. Dazu muss das Wetter noch besser werden.
Behörden Spiegel: Als der Behörden Spiegel 1985 gegründet wurde, waren Sie selbst noch Student der Mathematik. Hatten Sie sich in dieser Zeit schon mit Kryptografie befasst?
Schabhüser: Ganz platt gesagt: 1985 wusste ich, wie Kryptografie geschrieben wird. Aber was das ist, wusste ich nicht. Wirklich damit befasst habe ich mich erst, als ich mich beim BSI bewarb. Im Bewerbungsgespräch kam das Wort Kryptografie übrigens gar nicht vor. Das war damals an der Grenze zur Geheimwissenschaft.
Behörden Spiegel: Wie entstand Ihre Faszination für den Bereich der Kryptografie?
Schabhüser: Ich habe in der Evaluierung von Kryptoverfahren angefangen. Man schafft es, in ein System einzubrechen, zum Beispiel, indem man aus einem Chiffretext Klartext gewinnt, ohne den Schlüssel vorher gekannt zu haben. Das gibt schon einen Adrenalinstoß. Das macht einfach richtig Spaß. Auf der anderen Seite ist es eine Mischung aus Mathematik und Ingenieurswissen, wobei man viel Mathematik anwenden kann: Statistik, algebraische Geometrie, kommutative Algebra. Das passt zu Mathematikern natürlich ganz gut.
Behörden Spiegel: Wäre es nach Ihrem Studium nicht reizvoller gewesen, in die Privatwirtschaft zu gehen – zumindest aus finanzieller Sicht? Immerhin nahm das Internetzeitalter gerade erst Fahrt auf und neue Tech-Unternehmen entstanden. Wieso haben Sie sich für den Öffentlichen Dienst entschieden?
Gerhard Schabhüser blickt auf seine Zeit beim BSI
(BS/Christian Brecht) Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), bezeichnet ihn als „Titan der IT-Sicherheit“: Dr. Gerhard Schabhüser, langjähriger BSI-Vize und eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Seit Kurzem ist der Mathematiker im Ruhestand. Im Interview mit dem Behörden Spiegel reflektiert er mehr als drei Dekaden in Deutschlands IT-Sicherheitsbehörde und erklärt seine Faszination für die Welt der Kryptografie.

Schabhüser: In der Tat stellte sich 1991 die Frage: Wissenschaftliche Karriere, ja oder nein? Und wenn nicht, was macht man dann? Die Wahrscheinlichkeit, als reiner Mathematiker einen Job zu kriegen, in dem man genau das Erlernte anwenden kann, ist relativ gering. Ich hatte sogar ein Angebot in Münster, wo ich damals gewohnt habe, aber es war dann einfach eine Bauchentscheidung. Irgendwie fühlte sich das BSI interessanter an. Vom Einstiegsgehalt her war der Unterschied gar nicht so groß. Auch bei Mathematikern in der Wirtschaft orientierte man sich am TvÖD (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Anm. d. R.). Zwischendurch bin ich doch fast in der Privatwirtschaft gelandet. Das muss 1999 gewesen sein, als mir ein paar Aspekte im BSI nicht gefielen. Ich bin dann aber geblieben und das war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Im Jahr 2000 platzte nämlich die Internet-Blase. Das hätte für mich vielleicht bedeutet: „Last hired, first fired“ („als Letzter eingestellt, als Erster gefeuert“, Anm. d. R.).
Behörden Spiegel: Im BSI leiteten Sie zunächst den Fachbereich Kryptographie und wissenschaftliche Grund-
lagen, von 2005 bis 2016 waren Sie dann Abteilungsleiter für die Themenfelder Kryptographie, wissenschaftliche Koordinierung und technische Verschlusssachensicherheit. Geben Sie uns ein Beispiel für ein Problemfeld, das Sie in diesen Jahren besonders umgetrieben hat!
Schabhüser: Was mich immer getrieben hat, ist, angemessene, sichere, aber auch performante Kryptoysteme für die öffentliche Verwaltung, den Bund und die Militärs bereitzustellen. Das hört sich so einfach an. Doch erstens muss die Algorithmik hinreichend schnell sein, damit sie mit dem Fortschritt der Übertragungsprotokolle mithalten kann. Zweitens muss man sie auch noch hinreichend schnell implementiert bekommen. Es war traditionell so, dass man die Algorithmik in Chips gegossen hat, also wirklich Hardware-orientiert. Später haben wir dann sogenannte FPGA-Implementierungen versucht, einfach gesagt, eine Software-Implementierung auf programmierbarer Spezialhardware. Und dann muss die Implementierung auch noch sicher und vertrauenswürdig sein. Das hat uns und mich viel Zeit und Arbeit gekostet, aber es hat auch Spaß gemacht.
Behörden Spiegel: Werfen wir nochmal einen Blick auf das große Ganze. Wie würden Sie die Entwicklung der IT- und Cyber-Sicherheit in den letzten 40 Jahren in Deutschland skizzieren?
Schabhüser: Abstrakt würde ich sagen, das Thema IT-Sicherheit kam aus dem Bereich Kommunikationssicherheit, also Vertraulichkeit. Diese ist immer noch ein wesentlicher Punkt, aber mindestens genauso wichtig ist die Frage der Kryptografie im Sinne von Authentizität geworden, etwa mit Blick auf digitale Signaturen und die Frage, ob Dokumente verfälscht wurden.
Die Informationssicherheit hat sich in eine ganzheitliche Perspektive gewandelt: Sind Rechnerarchitekturen robust gegen Angriffe? Für das BSI ist die Entwicklung ähnlich: Sehr stark von der Vertraulichkeit kommend, dann eher die Verwaltung in den Griff kriegend. Der nächste Schritt war, für Wirtschaft und Gesellschaft das Thema Informationssicherheit voranzutreiben. Das wiederum ist an die Entwicklung der Digitalisierung gekoppelt.
Insgesamt kann man konstatieren: Von einem Technikinstitut haben wir uns zu einer sehr breit aufgestellten Behörde entwickelt. Heute haben wir Befugnisse und Aufsichtsrollen – das BSI ist der Link zwischen Sicherheit und Digitalisierung.
Behörden Spiegel: Welche Befugnisse und Aufgaben sollten Ihrer Meinung noch dazukommen?
Schabhüser: Wir dürfen in den Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) und in den Netzen des Bundes nach Anomalien suchen und müssen, falls wir etwas finden, die Betreiber oder Eigentümer darüber informieren. Das würde ich gern auf ganz Deutschland ausdehnen. Damit würden wir den Sicherheitsstandard in Deutschland drastisch erhöhen. Das Zweite betrifft den Cyber Resilience Act (CRA), der
dafür sorgt, dass die Hersteller von Produkten mit digitalen Elementen Mindestanforderungen an Informationssicherheit umsetzen. Der CRA sieht eine Marktaufsicht vor, eine Behörde, die diese Mindestanforderungen überprüft. Werden diese nicht eingehalten, kann diese Marktaufsicht Bußgelder verhängen oder Produkte ganz aus dem europäischen Markt entfernen. Diese Rolle würde supergut zum BSI passen.
Behörden Spiegel: Die BSI-Präsidentin Claudia Plattner hat Sie als „Titan der IT-Sicherheit“ bezeichnet. Wie schätzen Sie sich und das Erreichte selbst ein?
Schabhüser: Meine Frau wies mich danach darauf hin, dass Titanen uralt seien. Also die Frage ist, ob das ein Kompliment war (lacht). Was macht mich aus? Ich glaube, dass ich ein gutes Gespür für angemessene IT und Informationssicherheit habe. Ich glaube auch, dass ich relativ gut kommunizieren und zielgruppengerecht mit Menschen reden kann. Und ich glaube, dass ich einen relativ starken gestalterischen Willen habe, also irgendwas verändern und die Welt ein bisschen besser machen möchte. Die Erfolge beim BSI sind aber immer Teamarbeit gewesen. Da muss man mit Demut herangehen.
Behörden Spiegel: Sind das auch Eigenschaften, die Sie Ihren Studierenden an der Uni Bonn mitgeben wollen? Oder hat die Technik erstmal Vorrang?
Schabhüser: Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, auch ethische Botschaften irgendwie mit einzubinden. Da passt natürlich so etwas wie gestalterischer Wille oder zielgruppenorientierte Kommunikation.
Primär möchte ich den Studierenden aber ein Verständnis dafür geben, wie Kryptografie, wie insbesondere Kryptoanalyse funktioniert und welches Handwerkszeug man dafür beherrschen muss. Erstens, um so etwas durchführen zu können und zweitens, wenn man auf der Kryptodesign-Ebene ist, worauf man achten muss, damit Kryptoanalyse eben nicht funktioniert. Wenn ich das rübergebracht habe, mit ein bisschen Mathematikverständnis, dann habe ich meinen Job getan.





So titelte im Januar dieses Jahres schon kurze Zeit nach der Einführung von Donald Trump die New York Times (https://www.nytimes. com/2025/01/22/us/trump-privacy-civil-liberties-oversight-board. html) als Erste, dass das Data Privacy Framework paralysiert werde, indem der US-Präsident die für die Datenschutzaufsicht in den USA zuständigen Mitarbeiter des „Privacy and Civil Liberties Oversight Board“ (PCLOB) zum Großteil entlassen hat. Und das nicht ohne Grund, denn ebenjenes PCLOB war bislang dafür zuständig, die durch den EuGH in Schrems-II geforderten rechtlichen Rahmenbedingungen für den US-Auslandstransfer von personenbezogenen Daten aus der EU zu gewährleisten.
US-Datenschutzrecht entspricht nicht europäischen Grundwerten Was sodann folgte, war wenig überraschend: Im Februar verfasste der Vorsitzende des zuständigen „Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs“ (LIBE) des Europäischen Parlaments einen Brief an die EU-Kommission verbunden mit der Prüfbitte, welche Auswirkungen der Rückschnitt des PCLOB auf das EU-US Data Privacy Framework haben könnte – und insbesondere, ob infolgedessen tatsächlich noch juristisch gewährleistet werden kann, dass das aktuelle US-Datenschutzniveau den
Wie die EU ihre digitalpolitische Haltung gegenüber den USA verliert
(BS/Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker) In diesen Zeiten werden viele bewährte Konzepte aus dem letzten Jahrzehnt auf den Prüfstand gestellt – und eines davon ist der europäische Datenschutz. Nachdem es hier eigentlich schon die letzten zwanzig Jahre mit den zwei durch den Europäischer Gerichtshof (EuGH) gekippten EU-Angemessenheitsbeschlüssen zur Datenübermittlung zwischen der EU und den USA nicht besonders gut lief und man sich in einer mühseligen politischen Einigung auf ein drittes und nicht minder kritikbehaftetes transnationales Datenschutzabkommen mit dem Titel „EU-US Data Privacy Framework“ einigen konnte, bahnen sich nunmehr weitere gravierende Änderungen an, die nicht nur unseren EU-Datenschutz, sondern gleichzeitig auch die Krisenfestigkeit unserer digitalen Grundwerte hart auf die Probe stellen.

Eigentlich haben die USA und die Europäische Union mit dem DPF ein geregeltes Datenschutzabkommen. Doch die Entlassung zahlreicher Mitarbeitender der US-amerikanischen Datenschutzaufsichtsbehörde PCLOB wirft nun die Frage auf, ob die Behörde noch effektiv genug ist, um die im Abkommen vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu gewährleisten – und wie die europäischen Behörden darauf reagieren werden. Foto: BS/PhotoSG, stock.adobe.com
europäischen Grundsätzen genügt.
Bislang lagen mit Blick auf diese Frage im Wesentlichen zwei Optionen auf dem Tisch: Erstens hätte
die EU-Kommission das angemessene US-Datenschutzniveau trotz allem weiterhin bestätigen können, womit sie zugleich die euro-

Regelungen zur Datenübermittlung in die USA wie Standard Contractual Clauses (SCC) für mittelständische Unternehmen und Binding Corporate Rules (BCR) für Konzernstrukturen waren bislang nur begrenzt in der Lage, die Zweifel am US-amerikanischen Datenschutzniveau nachhaltig auszuräumen, weil sie eben selbst nichts an der zugrundliegenden Jurisdiktion zu ändern vermögen.
Entgegenkommen auf beiden Seiten?





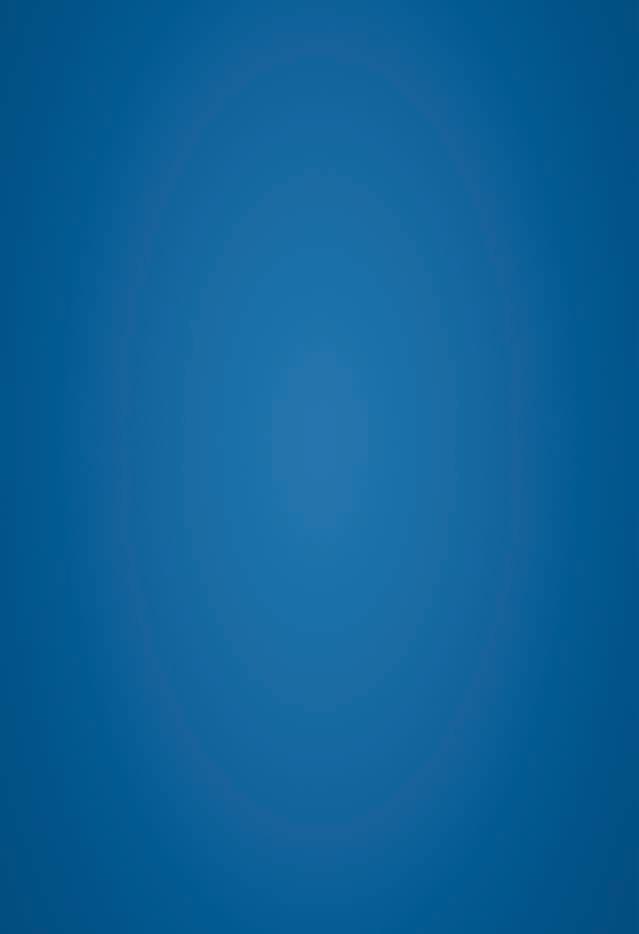

päischen verfassungsrechtlichen Grundwerte negiert hätte, denn datenschutzrechtliche Betroffenenrechte sind ein Kernelement der informationellen Selbstbestimmung. Zweitens hätte sie durchaus feststellen können, dass mit der fehlenden Arbeitsfähigkeit des PCLOB die Rechtsfolge einhergeht, dass das US-Datenschutzniveau eben doch nicht mehr den europäischen Grundwerten entspricht und das bislang geltende Abkommen damit zumindest in dieser aktuellen Form keinen Bestand mehr haben kann. Insbesondere letztgenannte und eigentlich fachlich naheliegendste Entscheidung hätte die Behörden jedoch vor ein Dilemma gestellt, denn die Folge wäre gewesen, dass zunächst weiterhin weitestgehend unkontrolliert personenbezogene Daten aus der Europäischen Union in die USA abgeflossen wären, wie es auch schon nach dem Wegfall
Wenig überraschen sollte deshalb eigentlich der neue Weg, den die EU-Kommission aktuell einzuschlagen beabsichtigt: Sich an einen Tisch setzen, den Dialog suchen und Diskrepanzen einfach ausbügeln (https://iapp.org/news/a/ european-commissioner-discusseseu-us-data-privacy-framework-potential-gdpr-reform/). Genau jenes „Ausbügeln“ setzt eben aber auch ein Entgegenkommen beider Parteien voraus, und genau dies will man nun mit einer Absenkung des europäischen Datenschutzniveaus in Richtung USA politisch vorbereiten, indem die DSGVO aufgeschnürt und unter anderem in ihrem Anwendungsbereich reduziert werden soll. Damit kommt man letztlich genau jenem Narrativ entgegen, dass schon US-Vizepräsident JD Vance anlässlich des AI Summit in Paris im Februar 2025 geprägt hatte: Digitale Überregulierung zurücknehmen und die EU technologiepolitisch „endlich“ wieder wettbewerbsfähig machen.
Ignorieren löst keine Probleme Wem damit jedoch vorrangig gedient ist, dürfte auch allen klar sein: Weder den politischen Interessen der EU, noch der ihrer Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Denn das so verstandene digitalpolitische Entgegenkommen ist nichts weiter als Selbsttäuschung, denn es mag zwar den transatlantischen Datenverkehr in Zukunft erleichtern, macht ihn aber keinen Deut sicherer als zuvor, indem die eigentlichen Probleme in Sachen Cyber-Sicherheit und Datenschutz nicht ausgeräumt, sondern regula-
„Die Umsetzungsdefizite im transatlantischen Datenschutz waren und sind enorm und wurden aufsichtsbehördlich in der Vergangenheit weitestgehend ignoriert.“
des vorhergehenden Datenschutzabkommens „Privacy Shield“ der Fall gewesen ist, nachdem der EuGH im Jahr 2020 den Entfall der Rechtsgrundlage feststellte und europäische Unternehmen inklusive der EU-Kommission selbst massenhaft weiter personenbezogene Daten in die USA übermittelten.
Umsetzungsdefizite aus Europa
Dass sich die Europäische Union damit deshalb schwer tun würde, ist auch einer amtierenden US-Regierung nur allzu bewusst, denn die Umsetzungsdefizite im transatlantischen Datenschutz waren und sind enorm und wurden aufsichtsbehördlich in der Vergangenheit weitestgehend ignoriert – einerseits aufgrund von mangelnden Prüfkapazitäten, andererseits weil ansonsten Datenschutzverstöße in großer Zahl sowohl von Unternehmen wie auch von öffentlichen Einrichtungen festzustellen gewesen wären. Und auch alternative vertragliche
torisch zukünftig einfach ignoriert werden. Viel übrig geblieben ist damit von der in den vergangenen Monaten medial vielzitierten neuen europäischen Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten zumindest unter digitalpolitischen Gesichtspunkten nicht wirklich. Aber wie denn auch? Wahre politische Souveränität setzt auch entsprechende technologische Digitalsouveränität voraus – ansonsten sind unsere hehren europäischen Grundwerte auf dem internationalen politischen Parkett schon jetzt nicht mehr viel wert.

Prof. Dr. DennisKenji Kipker ist Research Director & Gründer des cyberintelligence. institute sowie Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen. Foto: BS/privat

Invasive Arten

Kommentar
Unter Angela Merkel waren Nachrichtendienste kein Thema. Sie sollten im Verborgenen bleiben. Als Säule der Sicherheit hätten sie mehr Aufmerksamkeit verdient.
Ex-Präsident Gerhard Schindler musste gehen, weil er zu viel Wahrnehmbarkeit für den BND wollte. Sein Nachfolger Bruno Kahl brachte den Dienst aus der Öffentlichkeit. Nun haben die Grünen mit ihrer Zustimmung zu den Sondervermögen mit Union und SPD den erweiterten Sicherheitsbegriff eingebracht. Demnach sollen auch die Geheimdienste profitieren, vorneweg der BND. Doch das alleine wird nicht helfen. Der BND ist durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts stark eingeschränkt. Deutsche darf der Auslandsgeheimdienst gar nicht abhören, Ausländer nur in Verdachtsfällen. Experten halten das für katastrophal, weil ihm damit Augen und Ohren genommen seien. Hier muss der Gesetzgeber ran. Der Berner Club – bestehend aus den
Geheimdienst-Chefs der EU-Mitglieder und weiteren Staaten wie der Schweiz – schaffte es nie, an die Five Eyes (Australien, Kanada, Neu-Seeland, Großbritannien und USA) heranzukommen. Es blieb bei jährlichen Treffen und standardisiertem Informationsaustausch. Daneben gibt es auf EU-Ebene das Intelligence Analysis Centre (INTCEN). Es ist ohne operative Aufgaben, weil die Brüsseler Kommission keine Zuständigkeit hat.
von Uwe Proll
Hier wäre der erste Schritt: eine institutionalisierte Zusammenarbeit europäischer Geheimdienste. Es besteht in dieser Zeitenwende die Chance, ein westliches – Staaten mit gleichen Grundwerten und einer parlamentarischen Demokratie – Nachrichtendienstabkommen zu etablieren, das, vergleichbar mit den Five Eyes, hilft, den Herausforderungen durch Russland, China und dem Terrorismus zu begegnen.
Mit dem Einkaufswagen ins Darknet
Wie sich Cybercrime an der freien Marktwirtschaft orientiert
Das Gras war nicht grüner
Jochen Stein zur Zukunft der Feuerwehr
Drei Treiber der Veränderung
Die Zukunft der Wettervorhersage
Iteration 3.0 Panzerbrigade 45 ist offiziell im Dienst
Rückblick: 2001

Kommentar Berührungsängste abbauen
Zurück zum BND, der nach wie vor ausgezeichnet bei der Funkaufklärung ist. Das Mobilfunktelefon von Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin, dem getöteten Chef der WagnerGruppe, wurde vom BND abgehört. Doch das Abstellen menschlicher Quellen im ehemaligen Warschauer Pakt rächt sich. Ohne menschliche Quellen ist Geheimdienstarbeit nicht vorstellbar. Die größte Aufgabe wird sein, den BND ins Cyber-Zeitalter zu katapultieren. Nach der Ära des Runterkühlens sollte jetzt nicht nur auf finanzielle Mittel, sondern auf Humankapital und die Analysefähigkeiten des Dienstes gesetzt werden. Ein neues Selbstverständnis gilt es bei den Mitarbeitenden zu wecken. Politische Anerkennung gehört dazu. Aber auch die Berücksichtigung der Analysen des Dienstes durch die Bundesregierung, was 2014 mit der Vorhersage der Flüchtlingsströme oder dem russischen Einmarsch in die Ukraine nicht geschah.
50,1 Prozent der Anteile an Patria, dem größten Rüstungsunternehmen Finnlands, hält der finnische Staat. Ähnlich verhält es sich in Norwegen: Auch die KongsbergGruppe, der norwegische Rüstungsprimus, ist mehrheitlich in staatlicher Hand. Dass sich der Staat an der heimischen Rüstungsindustrie beteiligt, ist jedoch kein rein skandinavisches Phänomen. Deutschlands engster europäischer Verbündeter, Frankreich, hält ebenfalls Anteile an nationalen Rüstungskonzernen. So sind etwa 20 Prozent der in Paris ansässigen Thales-Gruppe Staatseigentum. Am Hersteller des Kampfjets Rafale, Dassault Aviation, hält der französische Staat sogar Mehrheitsanteile.
von Jonas Brandstetter
In Deutschland hingegen blickte die politische Mitte über Jahre hinweg – gelinde gesagt – mit Skepsis auf derartige Arrangements. Die Berührungsängste mit der Branche waren groß, Verbindungen zu ihr galten gar als moralisch anstößig. Die Sorge wog schwer, dass das Parlament seiner Kontrollfunktion bei Rüstungsexporten und -beschaffung nicht mehr unbeeinflusst nachkommen könnte, wenn die Beziehungen zur Rüstungsindustrie zu eng würden. Doch es setzt ein Umdenken ein. 2020 beteiligte sich der deutsche Staat am Sensor-Spezialisten Hen-
soldt. Die Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie von 2022 schlägt Staatsbeteiligungen an verteidigungswichtigen Rüstungsunternehmen offensiv vor. Ein richtiger Schritt. Die neuen sicherheitspolitischen Realitäten – Kriegsgefahr in Europa, die Entkernung des US-amerikanischen Solidaritätsversprechens und das Zerfleddern globaler Lieferketten – machen die Notwendigkeit souveräner Rüstungsmöglichkeiten unverkennbar deutlich. Langfristiger Kapazitätsaufbau, Unabhängigkeit von wechselhaften internationalen Partnern und die Gewissheit, dass deutsches Know-how nicht abwandert, sind überlebenswichtig. Das Beispiel Frankreich zeigt, dass staatliche Beteiligungen an der Industrie ein Weg sind, um dies sicherzustellen. Auch die üblichen marktwirtschaftlichen Argumente gegen staatliche Unternehmensbeteiligungen verlieren angesichts des wirtschaftlichen Sonderfalls Rüstung an Stichhaltigkeit. Die Sorge um mangelnde Effizienz durch staatliche Organisationsstrukturen ist in einem Markt, dessen wichtigster Kunde der Staat ist, schwer nachzuvollziehen. Auch die Befürchtung, dass sich bürokratische Prozesse durch staatliche Beteiligungen weiter aufblähen, ist unbegründet. Angesichts der ohnehin hochkomplexen Beschaffungsprozesse wird es auch dem findigsten Technokraten kaum gelingen, diese noch weiter zu verkomplizieren.
Behörden Spiegel: Was macht die Sicherheitslage in Ihrem Bundesland besser als anderswo?
Georg Maier: Ich behaupte nicht, wir würden alles richtig und besser machen. Thüringen ist ein sicheres Bundesland. Darauf sind wir stolz. Dennoch gibt es immer wieder Entwicklungen, die sich negativ auf die Kriminalitätsstatistik auswirken. Besonders im Bereich der Gewaltdelikte war das im vergangenen Jahr besorgniserregend. Ein wichtiger Faktor: das Superwahljahr in Thüringen mit drei Wahlen – der Europawahl, der Kommunalwahl und der Landtagswahl. Diese politischen Ereignisse spiegeln sich im Bereich der politisch motivierten Kriminalität wider. Leider ist es zuletzt auch in Thüringen häufiger zu Messerattacken gekommen. Wir werden verstärkt präventive Maßnahmen ergreifen, um in Kriminalitätsschwerpunkten oder bei größeren Veranstaltungen für mehr Sicherheit zu sorgen. In diesen Zusammenhang spielt eine zeitgemäße Ausstattung der Polizei eine zentrale Rolle. Als ich vor siebeneinhalb Jahren mein Amt antrat, habe ich mir selbst ein Bild vom Alltag im Streifenwagen gemacht. Damals wurde noch viel mit Papier und Bleistift gearbeitet. Obwohl die vorrangigen Systeme bereits digital waren, gab es immer noch Medienbrüche, die wir mittlerweile weitestgehend überwunden haben. Heute gehören digitale Endgeräte im Streifenwagen zum Standard – ebenso wie Bildaufzeichnungen und Bodycams. Auch der aktive Schutz der Einsatzkräfte wurde verbessert. So haben wir beispielsweise in ballistische Helme und weitere Schutzausrüstung investiert. Zuletzt haben wir eine neue Mittel-Distanz-Waffe eingeführt, die in Terrorlagen eingesetzt werden kann, um Angreifer effektiv zu bekämpfen. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage
Die Bundespolitik steht aktuell vor großen Veränderungen. Insbesondere der Sicherheitspolitik kommt in der künftigen Regierungsarbeit eine besondere Bedeutung zu – nicht zuletzt angesichts des anhaltenden Ukrainekonflikts sowie des sich wandelnden Verhältnisses zwischen Europa und den USA. Mit den im März beschlossenen Grundgesetzänderungen hat sich die kommende Bundesregierung den notwendigen Handlungsspielraum geschaffen, um Worten Taten folgen zu lassen und gegenüber Deutschlands globalen Partnern ein klares Zeichen der Verlässlichkeit zu setzen. Doch nicht nur im Verteidigungswesen besteht dringender Handlungsbedarf. Auch im Bereich der inneren und öffentlichen Sicherheit ist ein umfassender Kraftakt seitens der Politik erforderlich, um unsere Sicherheitsbehörden noch besser in die Lage zu versetzen, ihre wertvolle Arbeit effizient und nachhaltig zu leisten. Schließlich stellen Bedrohungen von innen eine ebenso bedeutende Herausforderung für unser gesellschaftliches Zusammenleben und unsere Sicherheit dar. Neben Kriminalitätsphänomenen im Zusammenhang mit Migration und Zuwanderung ist der Handlungsbedarf auch in anderen Kriminalitätsfeldern enorm – insbesondere im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK).
Dies zeigt sich exemplarisch am illegalen Tabakhandel: So lag Deutschland laut devm jüngsten KPMG-Bericht über den Konsum von illegalen Zigaretten in Europa im Jahr 2023 mit 1,6 Milliarden Zigaretten jährlich unter den fünf größten Konsummärkten des
Es ist noch viel zu tun im Kampf gegen Extremismus
(BS) Ob mehr Polizeipräsenz, eine modernere Ausstattung oder der Kampf gegen Extremismus – Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erklärt im Interview, wie die Landesregierung die Innere Sicherheit nachhaltig stärken will. Das Interview führte Dr. Eva-Charlotte Proll.

Im Interview wies Georg Maier auf das große Vertrauen in die Arbeit der Polizei hin. Knapp drei Viertel aller Thüringer und Thüringerinnen vertrauen der Polizei. Die Zahlen stammen vom Thüringer-Monitor 2024 – eine Studie zu den politischen Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger des Freistaates Thüringen.
und der sich häufenden Anschläge müssen wir solche Maßnahmen stets im Blick behalten.
Behörden Spiegel: Die neue Landesregierung hat mit ihrem 100-TageProgramm Akzente zur Stärkung der Inneren Sicherheit gesetzt. Welche konkreten Maßnahmen sind da geplant?
Maier: Das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung hat auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt. Das ist bedauerlicherweise schlechter als die statistisch nachweisbare Sicherheit. Das Aufstreben populistischer Strömungen hat dazu geführt, dass bewusst Unsicherheit verbreitet wird –zum Beispiel im Zusammenhang mit Migration. Wir wollen als Landesregierung das
Foto: BS/Klinger
subjektive Sicherheitsempfinden positiv beeinflussen. Das bedeutet vor allem mehr Polizeipräsenz auf der Straße sowie eine Verjüngung des Personalkörpers. Wir stellen mehr Polizistinnen und Polizisten ein und wir bauen unsere Bildungsstätte in Meiningen aus. 360 Auszubildende pro Jahr werden das sein – ein Riesenfortschritt. Als ich ins Amt kam, waren es noch 150 pro Jahr. Wichtig ist wie gesagt auch eine zeitgemäße Ausstattung: bei der Digitalisierung, aber auch bei den rechtlichen Grundlagen – ein modernes Polizeiaufgabengesetz. In bestimmten Bereichen, wie etwa der Cybersicherheit und dem Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern im Netz, gibt es große Herausforderungen. Besonders die Datenweiterleitung aus den
Vereinigten Staaten spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir müssen diese Daten verarbeiten, daraus Fahndungsmaßnahmen ableiten und entsprechende Ermittlungen durchführen können.
Behörden Spiegel: Wie sehen die Maßnahmen mit Blick auf den Bereich Rechtsextremismus aus, um diesen nachhaltig bekämpfen zu können?
Maier: Rechtsextremismus – ist leider weiterhin ein Problemfeld in Thüringen. Wir haben zwar durch gezielte Maßnahmen wichtige Erfolge erzielt. Beispielsweise haben wir rechtsextreme Strukturen im Bereich der organisierten Kriminalität zerschlagen das Phänomen der Rechtsrockfestivals erfolgreich bekämpft. Jedoch haben die Umtriebe der Reichsbürger weiter zugenommen und es ist eine fortschreitende Entgrenzung rechter Netzwerke im Umfeld von sogenannten Montagsund Friedensdemonstrationen festzustellen.
Behörden Spiegel: Eine Koalition mit der CDU im Bund könnte mehr Befugnisse für die Polizei und die Dienste mit sich bringen. Was bedeutet das konkret für die gesetzliche Lage?
Maier: Die Befugnisse brauchen wir, um schwere Straftaten oder Anschläge zu verhindern. In der Vergangenheit konnten wir solche Taten häufig nur deshalb unterbinden, weil wir Hinweise von ausländischen Diensten erhalten haben. Ein Grund dafür ist, dass wir nicht in der Lage sind, selbst vergleichbare Vorhersagen zu generieren, da bestimmte Befugnisse fehlen. Ein zentrales Beispiel ist die Speicherung von IP-Adressen. Diese ist notwendig, um im Netz nachverfolgen zu können, wenn sich jemand radikalisiert oder Anschlagspläne ausgetauscht werden. Der Europäische Gerichtshof hat zur sogenannten Vorratsdatenspeicherung klare Regelungen getroffen, die bestimmte Möglichkeiten zulassen. Diese sind jedoch bei uns noch längst nicht ausgeschöpft.
Unser Verfassungsschutz ist vergleichsweise klein und steht vor einigen Herausforderungen. Ein Problem betrifft das Kontrollgremium, das den Verfassungsschutz überwacht. Dieses Gremium stammt noch aus der vorherigen Legislaturperiode, da es im Thüringer Landtag durch die politischen Gegebenheiten bislang nicht neu konstituiert werden konnte. Die AfD verfügt über eine Sperrminorität und versucht, die Neubesetzung gezielt zu blockieren. Grund hierfür: Die AfD wurde als rechtsextrem eingestuft und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Entsprechend groß ist ihr Interesse daran, selbst im Kontrollgremium vertreten zu sein. Ich hoffe, dass wir durch eine Änderung der gesetzlichen Grundlage bald ein neues Kontrollgremium wählen können. Natürlich soll die Opposition darin angemessen vertreten sein. Eine parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes ist unerlässlich. Ob jedoch die AfD in dieses Gremium gehört, halte ich angesichts der Tatsache, dass sie selbst ein Beobachtungsobjekt ist, für mehr als fraglich. Grundsätzlich jedoch warne ich davor, bei politisch motivierter Kriminalität auf einen Phänomenbereich zu fokussieren. Auch die islamistische Gefahr ist in Thüringen nicht null. Sie ist sehr abstrakt, aber sie ist da.
Illegalen Tabakhandel und Organisierte Kriminalität entschlossen bekämpfen
(BS/ Tammo Körner*) Die Eindämmung des illegalen Tabakhandels und der Organisierten Kriminalität muss mehr im sicherheitspolitischen Fokus stehen. Gerade angesichts Deutschlands wachsender Rolle als Produktionsstandort für illegale Tabakwaren braucht es ausreichend Ressourcen und Befugnisse für den Zoll, um diese Entwicklung zu stoppen und kriminelle Netzwerke von zentralen Finanzierungsquellen abzuschneiden.

Der illegale Tabakhandel zählt zu den zentralen Finanzierungsquellen der Organisierten Kriminalität.
Kontinents. Der dadurch entstandene Steuerausfall belief sich laut KPMG auf fast 370 Millionen Euro. Besonders besorgniserregend ist jedoch, wie flexibel sich die OK immer wieder an neue Bedingungen anpasst: Produktions- und Lieferwege der Schattenwirtschaft werden kontinuierlich verändert, um dem Verfolgungsdruck staatlicher Behörden zu entgehen oder um auf neue Marktrealitäten zu reagieren.
Entschlossenes Vorgehen Gerade Deutschlands Rolle als Produktionsstandort für illegale Tabakwaren hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. So werden auch hierzulande immer wieder illegale Zigarettenfabriken
Foto: BS/andriano_cz, stock.adobe.com
aufgedeckt. Die Gewinnmargen sind enorm: Eine illegale Produktionsstätte für Zigaretten erzielt laut dem Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 von EUIPO und Europol schätzungsweise 625.000 Euro pro Woche - ein höchst lukratives Geschäftsmodell also. Die neuen politischen Entscheidungsträger stehen daher in der Verantwortung, entschlossen gegen diesen Fälschermarkt vorzugehen und den Zoll mit ausreichend Ressourcen und durchsetzbaren Befugnissen auszustatten. Nur so lassen sich illegale Produktionsstätten frühzeitig aufdecken und der OK wichtige Finanzierungsquellen entziehen. Doch auch uns als Originalhersteller ist es ein zentrales Anliegen
unsere Behörden bestmöglich bei der Eindämmung des illegalen Tabakhandels und der Organisierten Kriminalität zu unterstützen. Daher engagiert sich Philip Morris seit über 20 Jahren in der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen für die Bekämpfung des illegalen Tabakhandels und beauftragt KPMG jährlich mit der Erstellung einer der bedeutendsten Langzeituntersuchungen zum Zigarettenschwarzmarkt. Zudem stehen Forensikexperten unseres Unternehmens dem Zoll zum Beispiel bei der Echtheitsprüfung und Analyse beschlagnahmter Waren zur Seite oder erstellen Gutachten für Gerichtsverfahren. Auch bei Verkaufswegefeststellung arbeiten wir mit den Behörden zusammen, beispielsweise wenn im Rahmen polizeilicher Einsätze illegale Zigaretten gefunden werden. Unter der E-Mail-Adresse produktmeldung. pmg@pmi.com bietet Philip Morris den Ermittlungsbehörden eine zentrale Anlaufstelle.
Höhere politische Priorität Ebenso entscheidend wie effektive Strafverfolgungsmaßnahmen ist unserer Auffassung nach die Verringerung finanzieller Anreize für die OK, um den illegalen Tabakhandel langfristig unattraktiver zu machen. Dafür ist eine wirksame Geldwäschebekämpfung unerläss-
lich, die es Kriminellen erschwert ihre illegal erwirtschafteten Gewinne aus Schmuggel und Fälschung für sich nutzbar zu machen oder in weitere Straftaten zu reinvestieren. Umso wichtiger ist es daher, dass die neue Regierungskoalition entschlossene Reformen im Bereich der Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung vorantreibt und damit auch die noch offenen Kritikpunkte der Financial Action Task Force (FATF) adressiert. Gleichwohl muss die Eindämmung der Organisierten Kriminalität und ihrer gezielten Unterwanderung der europäischen Volkswirtschaften insgesamt eine noch höhere Priorität in der Finanz-, Innen- und Wirtschaftspolitik erhalten, denn die Schattenwirtschaft und ihre verborgenen Finanzsysteme sind längst zu einer ernsthaften Bedrohung nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland und Europa geworden. Für eine wirksame Bekämpfung des illegalen Tabakhandels, der OK und der Geldwäsche sind daher ein personell, finanziell und technisch besser ausgestatteter Zoll und durchsetzbare Ermittlungsbefugnisse notwendig. Ebenso braucht es unserer Überzeugung nach für die Bekämpfung von kriminellen Netzwerken eine breite Allianz bestehend aus Politik und Strafverfolgung sowie der betroffenen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Für einen weiteren Austausch stehen wir daher gerne jederzeit zur Verfügung.
*Tammo Körner, Senior Manager Fiscal Affairs & Illicit Trade Prevention, Philip Morris GmbH
Angesichts dieser großen Bedeutung hochwertiger Wetterinformationen stellt sich die Frage, wie sich die Wettervorhersage künftig weiterentwickeln wird. Welche Technologien und Verfahren werden zu welchen Veränderungen führen, welche Verbesserungen können wir erwarten? Drei große Themenkomplexe mit signifikantem Veränderungspotenzial zeichnen sich dabei ab: Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI), die Nutzung und Kombination großer Datenmengen sowie eine intensivierte und fokussierte Beratung zur Wettervorhersage.
Künstliche Intelligenz wird Wettervorhersage künftig deutlich verbessern
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wird gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern seine bisherigen Entwicklungen im Bereich der numerischen, also großrechnergestützten Wettervorhersage mit neuen KI-Verfahren erweitern. Dies wird zu signifikanten Verbesserungen der Vorhersagequalität führen. Die Vorhersagen werden einerseits in der räumlichen Auflösung genauer und kleinräumigere lokale Gegebenheiten können berücksichtigt werden.
Andererseits wird es möglich sein, mit längerem Vorlauf als heute den möglichen Wetterablauf zu beschreiben. Bislang offen ist die Frage, ob mit KI-Methoden erstellte Wettervorhersagen in Zukunft rein auf Beobachtungen als Trainingsdaten basieren können und welche Rolle die traditionelle numerische Wettervorhersage dann einnehmen wird. Die Antwort auf diese Frage wird ein wesentlicher Faktor für die weiteren Modellentwicklungen sein und die Zukunft der numerischen Wettervorhersage mitentscheiden.
Neue Datenquellen erschlossen Ein weiterer Quantensprung liegt in der Nutzung und Integration von bisher unzugänglichen Daten aus Social Media, Crowdsourcing etc. in die Wettervorhersage. Die dadurch ermöglichte Vernetzung von unterschiedlichsten Daten erlaubt nicht nur präzisere Warnungen vor
Ich selbst habe Kyjiw im August 2024 besucht und war erschüttert von der Zerstörung, aber auch tief beeindruckt von der Stärke, der Entschlossenheit der Ukrainerinnen und Ukrainern. Der Krieg in der Ukraine und die politische Lage weltweit machen aber noch etwas deutlich: Der Zivilschutz ist in den Fokus gerückt und beschäftigt nicht nur das THW als Zivilschutzorganisation.
Seit der Gründung des THW im Jahr 1950 ist der Zivilschutz unser gesetzlicher Auftrag. Das bedeutet, dass es die Aufgabe des THW ist, die Zivilbevölkerung vor Kriegseinwirkungen zu schützen und die Folgen eines Krieges zu beseitigen. Daran hat sich in den vergangenen 75 Jahren – in Zeiten des Friedens – nichts geändert. Nun rückt das Thema verstärkt in den Fokus, jedoch unter veränderten und neuen Rahmenbedingungen. Die Bedrohungslage ist eine andere als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Dementsprechend muss es Veränderungen geben.
Historische Einordnung mit Blick auf 75 Jahre THW Otto Lummitzsch gründete das THW am 22. August 1950 auf der Basis des deutschen Grundgesetzes unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Als Zivil- und Katastrophenschutzbehörde des Bundes war es Ziel und Hauptaufgabe des THW, für den Schutz der Zivilbevölkerung vor Kriegseinwirkungen und die Ab-
(BS/Prof. Dr. Sarah Jones/Dr. Renate Hagedorn) Wer interessiert sich nicht dafür, wie das Wetter morgen wird? Wettervorhersagen spielen zweifellos eine entscheidende Rolle für vielfältige wirtschaftliche Aktivitäten und gesellschaftliche Belange sowie im täglichen Leben jedes Einzelnen von uns. Nicht von ungefähr haben wir alle mindestens eine Wetter-App auf unseren Handys. Dabei beobachten wir in vielen Anwendungsgebieten einen weiter zunehmenden Bedarf nach verlässlichen Wetterinformationen und entsprechenden Services. Das hat zwei Gründe: Extremwetterereignissen nehmen zu und wir beobachten eine verstärkte Vulnerabilität unserer Gesellschaft hinsichtlich meteorologischer Bedingungen.

Mittels KI könnten Einsatzkräften bessere Strategien zur Evakuierung und Rettung zur Verfügung stehen. Foto: BS/DWD
eintretenden Naturkatastrophen. Entscheidend ist, dass dadurch gänzlich neue Möglichkeiten entstehen, konkrete Vorhersagen der Auswirkungen von Wetterextremen bereitzustellen. Damit werden die zuständigen Behörden bereits Tage bis Wochen im Voraus in die Lage versetzt, auf Basis von hochaufgelösten Analysen verschiedenster Datentypen wie Niederschlagsmuster, Bodenfeuchtigkeit, Flusspegel und geografischen Merkmalen wie Bevölkerungszahlen und demografischer Struktur geeignete Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Diese Ermittlung der bestmöglichen Präventions- oder auch Hilfsmaßnahmen wird durch den Einsatz sogenannter digitaler Zwillinge unterstützt. Mit deren Hilfe können unterschiedliche Einsatzszenarien erstellt und auf ihre Wirksamkeit
analysiert werden. Zugleich werden Automatisierung und KI-Nutzung die Herausgabe von Informationen beschleunigen bis hin zu EchtzeitLagebildern. Damit stehen verantwortlichen Behörden im Katastrophenfall effektive Strategien zur Evakuierung, Rettung und Unterbringung zur Verfügung.
Vorstellung von Gefahren als Voraussetzung
Eine zentrale Erkenntnis aus der Analyse vergangener Extremwetter und deren Folgen ist: Ein wesentliches Hindernis für die effektive Nutzung von Wettervorhersagen und Wetterwarnungen liegt in der mangelnden Erfahrbarkeit und Konkretisierung der Vorhersagen der Ereignisse selbst sowie von deren Auswirkungen. Menschen handeln, wenn sie sich die Auswirkungen
konkret vorstellen können, wenn ihnen Handlungsoptionen bekannt und für sie umsetzbar sind. Um hier Verbesserungen zu erzielen, ist es wichtig, die individuelle Expertenberatung auszubauen. Die Zusammenarbeit wird deshalb in vielen Bereichen zunehmen, wie zum Beispiel dem Bevölkerungsschutz und damit unseren Beratungen für Katastrophenstäbe und Hochwasserzentralen. Mehr Kooperation wird es aber auch bei unseren zielgerichteten Beratungsleistungen im Energiesektor zur Sicherung der Netzstabilität bei steigender Integration von erneuerbaren Energien geben. Wetterwarnungen virtuell erlebbar machen Schauen wir noch weiter in die Zukunft ist es denkbar, dass individuelle KI-Assistenten auch für die all-
75 Jahre THW
(BS/Sabine Lackner) Die aktuelle politische Lage zeigt: Europa muss sich in naher Zukunft neu aufstellen. Das verdeutlicht der Krieg in der Ukraine. Der Angriff Russlands auf die Ukraine bewegt auch das Technische Hilfswerk (THW). Nicht nur bei der Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland, sondern auch mit Hilfsgüterlieferungen unterstützte das THW im Auftrag der Bundesregierung. Die THW-Ukraine-Hilfe ist der bisher größte Logistik-Einsatz unserer 75-jährigen Geschichte. Bisher konnten Hilfsgüter im Wert von mehr als 138 Millionen Euro beschafft und größtenteils bereits in die Ukraine geliefert werden.
milderung der Folgen bewaffneter Auseinandersetzungen zu sorgen. Blickt man auf die Zeit des Kalten Krieges, so blieb der grundlegende Auftrag des THW bis in die Mitte der 1990er Jahre unverändert. Das THW-Einsatzkonzept sah vor, die Bundesländer im Kriegsfall zu unterstützen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Aber auch bei „normalen“ Unglücken, Schadenslagen oder Katastrophen mit überregionaler Auswirkung half das THW. Erst nach Ende des Kalten Krieges definierten wir unsere Bedarfe neu und nahmen verstärkt die Unterstützung des Katastrophenschutzes der Länder in den Fokus. Wir lösten beispielsweise Bergungs- und Instandsetzungszüge auf und etablierten stattdessen flexiblere technische Züge mit unterschiedlichen Fachgruppen, die nun auf regionale Besonderheiten bei Katastrophenszenarien ausgerichtet waren. Der Schwerpunkt unserer fachlichen Fähigkeiten verlagerte sich zunehmend auf die technische Hilfeleistung im Katastrophenschutz.
Der Zivilschutz blieb dem THW dabei als gesetzliche Aufgabe erhalten. Initiiert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) mit der „Konzeption zivile Verteidigung“ von 2014 verfasste das THW 2016 ein neues Rahmenkonzept, in dem der Ausbau von Fähigkeiten zur Notversorgung und -instandsetzung vor allem Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) hervorgehoben wurde. Schwerpunkt blieb die Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Rettungs- und Hilfsorganisationen bei der täglichen Gefahrenabwehr, größeren Unglückfällen und Katastrophen. Dieses THW-Rahmenkonzept wurde 2023 erneut angepasst. Es benennt die großen Handlungsfelder und grundlegenden Bedarfe des THW und stellt damit die Basis für die mittelfristige strategische Ausrichtung und die Grundlage der weiteren Planungen des THW dar, um noch zivilschutztüchtiger zu werden. Blickt man auf die 75-jährige Einsatzgeschichte des THW, wird
gemeine Bevölkerung und nicht nur unsere Expertennutzer einen völlig neuen Zugang zu maßgeschneiderten Wetter- und Warninformationen liefern und dabei die persönliche Betroffenheit optimal wiedergeben. Dank KI-basierter Vorhersage kann die Möglichkeit bestehen, Warnungen und Wetterinformationen auch bis zu 14 Tage im Voraus auf dem Smartphone oder via Mixed-reality-Headset direkt erfahrbar zu machen. Das direkte Erleben fördert eine optimale Verhaltensanpassung und wird so zum zentralen Werkzeug, um Leben und Sachwerte gleichermaßen optimal zu schützen. Als hoheitliche Einrichtung kann und wird der DWD den verantwortungsvollen Umgang mit allen dafür notwendigen Daten sicherstellen sowie die passgenaue und ethisch verantwortbare Auswahl der verwendeten Daten und Algorithmen unterstützen. Insgesamt können wir in den kommenden Jahrzehnten sowohl durch den intelligenten Einsatz von KITechnologien als auch von neuen und zielgerichteten Produkten und Beratungsleistungen eine deutliche Weiterentwicklung der Wetterservices erwarten. Dadurch könnten Extremwetterereignisse besser vorhergesagt und Schäden minimiert werden. Die Wettervorhersage der Zukunft wird also noch mehr als heute dazu beitragen, Leben und Infrastrukturen zu schützen und nachhaltig mit der Natur umzugehen.


Prof. Dr. Sarah Jones ist Präsidentin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Foto: BS/DWD
Dr. Renate Hagedorn ist Vizepräsidentin des DWD. Foto: BS/DWD
deutlich, dass wir uns immer den Herausforderungen der jeweiligen Zeit angepasst und diese in vielen In- und Auslandseinsätzen gemeistert haben. Schließlich bleibt die Aufgabenstellung der technischen Hilfe gleich, wenn man Menschen in einer Flutkatastrophe mit Trinkwasser versorgen muss oder nach der Sabotage eines kommunalen Wasserwerks.
Ausblick in die Zukunft Menschen nach einem Erdbeben oder einem Drohnenangriff aus Trümmern zerstörter Häuser zu bergen, erfordert auch eine ähnliche Ausrüstung und Fachkompetenz. Die Ursache beim Ausfall einer Stromversorgung spielt für das THW bei der Sicherung einer Ersatzstromversorgung ebenfalls eine nachgeordnete Rolle. Unsere Einsätze der letzten 75 Jahre, auch wenn sie im Rahmen des Katastrophenschutzes stattfanden, haben uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet und zahlen auf mögliche Zivilschutztätigkeiten ein.
Größter Unterschied ist dabei stets nicht die Aufgabe, sondern der Auslöser der jeweiligen Einsätze und die Besonderheiten des Zivilschutzfalles, die dabei beachtet werden müssen. Wir müssen zu einem neuen Bewusstsein gelangen und uns bewusst sein, welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Um für zukünftige Anforderungen bestmöglich aufgestellt zu sein, prüfen wir kontinuierlich, welche Anpassungen im THW notwendig sind, um die Zivilschutztüchtigkeit weiter zu stärken. So müssen wir unsere Führungsfähigkeiten inklusive eines Lagedienstes ausbauen, Bereiche der Ausbildung anpassen und Strategien für verschiedene Bedrohungslagen entwickeln. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, unsere eigene Einsatzbereitschaft zu erhalten und die Resilienz aller THW-Angehörigen zu stärken. Trotz dieser Herausforderungen bin ich sicher: Das THW bleibt auch in Zukunft die leistungsfähige, jederzeit einsatzbereite Zivilschutzorganisation des Bundes, getragen vom ehrenamtlichen Engagement aus der Mitte unserer Bevölkerung.

Sabine Lackner ist Präsidentin des Technischen Hilfswerkes (THW). Foto: BS/THW
Vergangenen Monat verkündete
Brigadegeneral Michael D. Rose, der Kommandeur der 3rd MultiDomain Task Force der U.S. Army, dass die jüngste der US-Konzepteinheiten einen der beiden TyphonRaketenwerfer erhalten wird. „Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, solche Fähigkeiten einzusetzen“, kommentierte Rose das neue Material.
Zurzeit verfügen die US-Landstreitkräfte über drei derartige MDO-Einheiten – zwei weitere sollen noch folgen. Der Terminplan sieht vor, dass die nächste Einheit im Jahr 2027 in Dienst gestellt wird.
Die Grundprinzipien der MultiDomain Task Force – die Integration von Informations-, Cyber- und elektronischer Kriegsführung mit Langstreckenfähigkeiten unter einem Kommando – hat die U.S. Army 2022 in einer Doktrin verankert. Eine Abkehr von dem jahrelang dominierenden Ansatz isolierter Luft-, Land- und Informationskampagnen, der den globalen Krieg gegen den Terror bestimmte. Diese Entwicklung erfolgte jedoch nicht über Nacht.
Ein neuer Ansatz für eine neue Bedrohung
Bereits im Jahr 2015 erläuterte der damalige Deputy Secretary of Defense, Bob Work, dass die Streitkräfte der USA vor großen strategischen Herausforderungen stehen. In den vergangenen 13 Jahren habe der Kampf gegen irreguläre Kräfte und Terrorismus im Irak, Syrien und Afghanistan im Vordergrund gestanden. Die Zukunft aber, zeigte sich Work überzeugt, werde von anderen Szenarien bestimmt. „Ich glaube, dass sich die Bodentruppen zunehmend auf künftige hybride Kriege vorbereiten müssen“, so der stellvertretende Verteidigungsminister.
Ausschlaggebend für diese Analyse waren zwei historische Ereignisse: der Krieg zwischen den Israel Defence Forces (IDF) und der Hisbollah im Jahr 2006 sowie der Krim- und Donbass-Krieg im Jahr 2014. Aus den Beobachtungen dieser Konflikte destillierte Work fünf zukünftige Bedrohungsszenarien: Irregular Warfare, Hybrid Warfare, Non-Linear Warfare, State-Sponsored Hybrid Warfare und High-End Combined Arms Warfare.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, erarbeitete der ehemalige Deputy Secretary of Defense drei Prinzipien. Zunächst zeigte er sich überzeugt, dass Bodenkriegsführung in Zukunft von Lenkmunition und fortschrittlicher Waffentechnik geprägt sein wird.
Die Zukunft der Verteidigung ist verschränkt
(BS/Jonas Brandstetter) Multi-Domain Operations (MDO) heißt das zukünftige Operationskonzept der NATO. Die Voraussetzungen dafür werden zurzeit geschaffen. Viele Hindernisse sind zu überwinden. Die Herausforderungen sind sowohl technischer als auch organisatorischer Natur.

Die Orchestrierung militärischer Aktivitäten über alle Dimensionen ist der Kerngedanke von Multi Domain Operations (MDO). Foto: BS/Bundeswehr/Francis Hildemann
Überlegungen finden sich bereits in einem Konzept aus den 1980erJahren wieder: dem AirLand Battle. Dieses Konzept bildete die technologischen Entwicklungen der Zeit ab und argumentierte auf dieser Basis für schnelle, integrierte Luftund Bodenmanöver auf einem geografisch und zeitlich ausgedehnten Gefechtsfeld. Dabei ist schneller Nachschub eine kritische Größe. Deckungsgleich sind AirLand Battle und die Idee der MDO jedoch keinesfalls. Dem AirLand BattleGedanken inhärent ist nämlich die Annahme, dass die permanente Auseinandersetzung zwischen Staaten – die bisweilen zum bewaffneten Konflikt ausartet – die Normalität darstellt. MDO hingegen strebt die Abschreckung an. Darüber hinaus unterscheiden sich beide Konzepte wesentlich in den Bereichen Logistik sowie in Bezug auf die Bedeutung des Cyber- und Informationskrieges.
„Voraussetzung und bestimmendes Merkmal von MDO ist die umfassende und bruchfreie Vernetzung.“
Handreichung zu „Multi Domain Operations“ des Planungsamtes der Bundeswehr
Das zweite Prinzip sieht vor, Cyberspace, elektronische Kriegsführung, Informationsoperationen und das Stören von Funkverbindungen kombiniert einzusetzen, um Vorteile im Entscheidungsprozess zu erzielen. Works letztes Prinzip verbindet seine vorherigen Erkenntnisse: „Das dritte Prinzip ist die Kombination von gelenkter Munition und informatisierter Kriegsführung“, so der stellvertretende Verteidigungsminister. Mit seinen Analysen und Vorschlägen beschritt Work keine gänzlich neuen Pfade. Viele seiner
Unterschiedliche Perspektiven auf die Logistik ergeben sich aus einer grundlegend unterschiedlichen Bedrohungsanalyse. Im AirLand Battle ging die Bedrohung einzig von der Sowjetunion aus. MDO hingegen muss eine Logistik organisieren, die Gefechte im Indo-Pazifik ebenso wie im Osten Europas versorgen kann. Dass das AirLand Battle-Konzept Cyber-Bedrohungen keine Beachtung schenkte, überrascht nicht – in den 1980er-Jahren fehlten schlicht die technischen Möglichkeiten, um im Cyber-Raum militärisch aktiv zu
werden. Zehn Jahre später, haben sich Works Prognosen in vielen Punkten bestätigt. Die Idee des MDO nahm seit 2015 entsprechend weiter Fahrt auf. Knapp ein Jahr nach Works Rede stellte die Army ein erstes operatives Konzept für MDO auf dem U.S. Army Annual Meeting vor. Eine weitere Ausarbeitung erfolgte im Jahr 2018 durch das United States Army Training and Doctrine Command (TRADOC). Dessen damaliger Kommandeur General a. D. Stephen J. Townsend positionierte MDO als strategisches Konzept, um im Konflikt mit Supermächten zu bestehen. Er prognostizierte, dass die Gegner der Vereinigten Staaten und ihrer Partner Maßnahmen zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberspace einsetzen würden, um die Kräfte zeitlich, räumlich und funktional aufzutrennen.
Wie MDO in die NATO und die Bundeswehr fand Neben den USA fand die Idee der MDO auch in der NATO und ihren Mitgliedstaaten zunehmend Anklang. Im Jahr 2020 einigten sich die Bündnispartner auf das Konzept für die Abschreckung und Verteidigung des euro-atlantischen Raums (DDA). Es verspricht einen einheitlichen, kohärenten Rahmen für die NATO-Bündnispartner zur Bekämpfung, Abschreckung und Verteidigung gegen die wichtigsten Bedrohungen in einem mehrdimensionalen Umfeld. Ein Jahr später folgte das NATO Warfighting Capstone Concept (NWCC). In diesem Dokument entwickeln die Autorinnen und Autoren sechs Imperative für die zukünftige Entwicklung der Kriegsführung. Integrated Multi-Domain Defence ist einer davon.
Bis zur offiziellen Anerkennung des Konzepts mussten allerdings noch zwei weitere Jahre verstreichen. Am 19. Mai 2023 einigten sich die Mitgliedstaaten auf das Alliance Concept for Multi-Domain
Operations. Die Bundeswehr orientiert sich bei der Implementierung des Konzepts an den Definitionen und Anforderungen des Verteidigungsbündnisses. Im Zentrum der deutschen Auseinandersetzung mit MDO steht das Planungsamt der Bundeswehr.
Das technische Element
Die deutsche Bundeswehr setzt unter anderem auf umfassende Digitalisierungsprojekte, um die Truppe für MDO fit zu machen. Generalmajor Jürgen Setzer, Stellvertreter des Inspekteurs im Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn sowie Chief Information Security Officer der Bundeswehr (CISOBw), erklärte in Berlin, dass vor allem die Vernetzung in Zukunft kriegsentscheidend sein werde. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch das Planungsamt der Bundeswehr: „Voraussetzung und bestimmendes Merkmal von MDO ist die umfassende und bruchfreie Vernetzung. Zweck ist die zeitliche Verkürzung des Ablaufs zwischen Auffassen des Ziels durch Sensoren, Entscheiden über die erforderliche Wirkung und Auslösen des Effektors.“ Aus diesem Grund ist der Digitalisierungsdienstleister der Bundeswehr, die BWI GmbH, in verschiedenen Projekten beauftragt, die digitale Anbindung aller Truppenteile bis in die Spitze sicherzustellen. Das Vorzeigeprojekt hierbei stellt der Aufbau eines Cloud-Systems für die deutschen Streitkräfte dar. Als Multi Domain Combat Cloud soll sie stationäre Lösungen mit mobilen, verlegefähigen Systemen verknüpfen. Zurzeit befindet sich das Projekt in der ersten Ausbaustufe. Die Private Cloud der Bundeswehr (pCloudBw) kommt dabei als stationäre Plattform im Inland zum Einsatz. Sie kann auch Daten, die als „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) eingestuft sind, verarbeiten. Einen
ersten Meilenstein konnten die Bundeswehr und ihr Digitalisierungsdienstleister beim pCloudBwProjekt am 6. Januar dieses Jahres nehmen. An diesem Datum erhielt die erste Ausbaustufe ihre formale Betriebsfreigabe. Dem ging die Akkreditierung durch die Deutsche militärische Security Accreditation Authority (DEUmilSAA) bis zum Geheimhaltungsgrad VS-NfD voraus. Konkret stehen seitdem zwölf Services bereit. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Infrastruktur- und Plattform-Services. Kein neuer Ansatz ohne organisatorische Anpassungen Damit ein technisches Fundament tragfähig ist, muss es allerdings immer durch ein organisatorisches ergänzt werden. Im Rahmen der MDO plant die Bundeswehr deshalb mit einer gesamtstaatlichen Perspektive. „MDO werden effektiver, wenn sie von nichtmilitärischen Handlungen flankiert und unterstützt werden“, stellt das Planungsamt klar. Aus diesem Grund sieht das Amt Bedarf für die Schaffung von Schnittstellen, um militärische und zivile Lagebilder zu synchronisieren. Trotz des Ansatzes, Effekte aus mehreren Dimensionen zusammenzuführen, bedeutet das in keinem Fall eine Auflösung der bestehenden Teilstreitkräfte und ihrer distinkten, dimensionsbasierten Verantwortlichkeiten. Denn die Komplexität der verschiedenen Dimensionen macht es unausweichlich, Expertise in Teilstreitkräften zu binden. Allerdings müssen innerhalb der Dimensionen interoperable Verfahren und Methoden sowie das Wissen über teilstreitkraftübergreifende Aspekte deutlich vertieft und ausgebaut werden. Hier ist insbesondere das Führungspersonal gefragt.
Ein Konzept etabliert sich
2015 Deputy Secretary of Defense Bob Work prognostiziert einen Paradigmenwechsel: Hybride Kriegsführung werde die Auseinandersetzungen der Zukunft wesentlich bestimmen. Um dem zu begegnen, fordert er, umfassend in Lenkwaffen zu investieren und diese durch Integration des Cyer-Raumes weiter zu befähigen.
2016
Auf der annual Association of the United States Army forderte General David Perkins, Kommandeut des United States Army Training and Doctrine Command (TRADOC), dass die U.S. Army Multi-Domain Battle und bisher unbeachtete Dimensionen in den Blick nimmt.
2018
General a. D. Stephen J. Townsend, zu diesem Zeitpunkt Kommandeur des TRADOC, positioniert das Thema in einem Fachartikel als Zielbild für die US-Streitkräfte.
2020
Mit dem Konzept für die Abschreckung und Verteidigung des euro-atlantischen Raums (DDA) findet sich der Begriff der Multi-Dimensionalität erstmals in einem offiziellen NATO-Dokument.
2023
Die NATO-Mitgliedsstaaten verabschieden das Alliance Concept for Multi-Domain Operations.
Zwar
werden in der Jean-Monnet-Straße 4 in Berlin-Mitte – der Heimat des Veteranenbüros der Bundeswehr – auch E-Mails beantwortet und Telefonanrufe entgegengenommen, vom grauen Alltag kann aber keinesfalls die Rede sein, macht Oberstleutnant Sylvia Mehl deutlich. Denn so vielfältig wie die Veteranen-Community sei, so unterschiedlich seien auch die individuellen Anliegen. „Jeden Tag ist etwas Neues dabei“, stellt die stellvertretende Leiterin klar.
Darüber hinaus begrüßen die Mitarbeitenden des Büros regelmäßig Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Von Vereins- oder Verbandsvertreterinnen und -vertretern über Politikerinnen und Politikern bis hin zu hochrangigen Militärs aus dem In- und Ausland sei das Spektrum der Personen, die sich vor Ort über die Arbeit des 2024 gegründeten Büros informieren wollen, groß. Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden selbst bundesweit aktiv, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und auf das Thema Respekt, Anerkennung und Wertschätzung für Veteranen hinzuweisen. „Wir halten Vorträge und sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit unserem Promotionstruck auf diversen Großveranstaltungen vertreten“, konkretisiert Mehl Das sei allerdings auch mit einem gewissen Druck verbunden. Denn das Veteranenbüro müsse mit den verfügbaren Ressourcen einer insgesamt hohen Erwartungshaltung gerecht werden. Ein erster Meilenstein stehe bereits im kommenden Jahr an. Dann müsse sich das Büro nach Ablauf des dreijährigen Pilotprojektes einer Evaluierung stellen. Zusätzlich steht dem Veteranenbüro noch in diesem Jahr eine weitere Feuerprobe bevor, mit der bei dessen Aufstellung noch niemand gerechnet hat.
Am 15. Juni veranstaltet die Bundesregierung erstmals den sogenannten Veteranentag. „Das war bei der Aufstellung des Veteranenbüros noch nicht absehbar und ist demnach zusätzlich zu wuppen“, konstatiert Mehl. In der Jean-Monnet-Straße 4 freut man sich daher über die tatkräftige Unterstützung der vielen Vereine und Verbände, die sich bereits seit vielen Jahren umfänglich in der Veteraninnenund Veteranenarbeit engagieren.
Die Bundeswehr und hier das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) wurde mit der Planung und Durchführung der Zentralveranstaltung am Reichstag beauftragt, das Veteranenbüro der Bundeswehr unterstützt hierbei
Oberstleutnant Sylvia Mehl pflegt die deutsche Veteranenkultur
(BS/Jonas Brandstetter) Die Etablierung einer Veteranenkultur in Deutschland mitzugestalten und voranzutreiben, ist
Oberstleutnant Sylvia Mehls Auftrag als stellvertretende Leiterin des Veteranenbüros der Bundeswehr. Eine Aufgabe, die so vielfältig ist wie die Veteraninnen und Veteranen selbst.

„Als stellvertretende Leiterin des Veteranenbüros der Bundeswehr darf ich etwas ganz Neues und noch nicht Dagewesenes von Anfang an mitaufbauen und mitgestalten.“
Oberstleutnant Sylvia Mehl, stellvertretende Leiterin des Veteranenbüros der Bundeswehr
tatkräftig. Gleichzeitig widmet sich Mehl der Aufgabe, ein Lagebild aller bundesweit stattfindenden Veranstaltungen anlässlich des nationalen Veteranentages zu erstellen und über eine interaktive Deutschlandkarte zu veröffentlichen.
Ausgleich in der heimischen „Homebase“ Abseits des Berufslebens steht für Mehl zuallererst ihre Familie im Vordergrund. Um für ihre Arbeit Kraft zu schöpfen, hält sie sich aber auch gern in der Natur auf – am liebsten begleitet von ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Unter freiem Himmel bereiten ihr das
Wandern sowie Ski- oder Radfahren besondere Freude. Darüber hinaus verreist sie gern. Um ihren Outdoor-Interessen nachzugehen, muss Mehl keine großen Distanzen zurücklegen. Denn nachdem vor sechs Jahren ihre gemeinsame Tochter zur Welt kam, beschlossen die stellvertretende Büroleiterin und ihr Ehepartner, ihren Lebensmittelpunkt in die fränkische Heimat zurückzuverlegen.
Mit der neuen „Homebase“ geht zwar einher, dass Mehl häufiger zu ihrem Arbeitsplatz pendeln muss, dennoch hat sich die Familie bewusst für diesen Schritt entschie-

2003 Berufs- und Erwachsenenpädagogik an der Universität der Bundeswehr München studierte. 2007 schloss sie das Studium mit Diplom ab. Ihre Karriere in den vergangenen zehn Jahren bezeichnet Mehl rückblickend als klassisch. Mit der Beförderung auf die Ebene eines Stabsoffiziers folgten vielfältige Führungsverwendungen im Personalmanagement auf unterschiedlichen Ebenen – vom Regiment bis zur Kommandoebene. Besonders stolz ist die stellvertretende Büroleiterin aber auf ihre aktuelle Tätigkeit: „Als stellvertretende Leiterin des Veteranenbüros der Bundeswehr darf ich etwas ganz Neues und noch nicht Dagewesenes von Anfang an mitaufbauen und mitgestalten.“
den. Dabei kommen ihr die Unterstützung ihres Ehepartners und die Flexibilität ihres Arbeitgebers entgegen. Dank mobilen Arbeitens und der Telearbeit kann sie Privatund Berufsleben sowie die Distanz zwischen Lebensmittelpunkt und Arbeitsplatz vereinbaren.
Einsatz für den Mensch: beruflich und privat Mehl ist mittlerweile seit über 22 Jahren Teil der deutschen Streitkräfte. Ihren Grundwehrdienst trat sie 2002 an, weil sie sich einen vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf wünschte. Den, so sagt sie, habe sie bei der Bundeswehr absolut gefunden. Es überrascht daher nicht, dass Mehl nach ihrer Grundausbildung das Offizierspatent an der Offizierschule der Luftwaffe erwarb und anschließend ab
Dennoch sind ihr noch viele weitere Stationen ihrer Dienstzeit lebendig in Erinnerung. Darunter fallen zum Beispiel ihre Beförderung zum Leutnant sowie die beiden Auslandseinsätze in Afghanistan im Jahr 2009 und über den Jahreswechsel 2012/2013. Darüber hinaus ist ihr die Zeit, in der sie die Stabskompanie in Germersheim führte, besonders positiv im Gedächtnis geblieben. „Eine der schönsten Verwendungen ist meist die eines ‚Chefs‘ bzw. einer ‚Chefin‘ – die war es bei mir auch“, so Mehl. Grundsätzlich gelte aber über alle Verwendungen hinweg, dass ihr die „Begegnungen mit den tollen Menschen, die ich in meinen Teams hatte oder mit denen ich zusammenarbeiten durfte“, besonders am Herzen liegen. Eine Erfahrung, die sie auch in der kommenden Dekade wieder zu machen hofft. Auf die Frage, was sie sich von ihrer beruflichen Zukunft wünsche, antwortet Mehl folgerichtig, dass sie einer Tätigkeit nachgehen möchte, die stets motiviert und erfüllt – und die mit Menschen zu tun hat. Gerade letzterer Aspekt ist ihr eine Herzensangelegenheit. Der Wunsch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, spiegelt sich auch in ihrem Privatleben wider: Ehrenamtliche Tätigkeiten haben für sie große Bedeutung. Seit weit über 25 Jahren engagiert sie sich unentgeltlich. Zurzeit erfolgt das im Rahmen eines Skivereins in ihrer Heimat. Dort ist sie als Übungsleiterin und im Vorstand aktiv.
Das Veteranenbüro der Bundeswehr
Das Veteranenbüro der Bundeswehr wird seit dem 30. Januar 2024 als zentrale Ansprechstelle für Veteraninnen und Veteranen sowie für alle Vereine, Verbände und Organisationen, die sich in der Veteranenarbeit engagieren, pilotiert. Dabei richtet sich das Angebot insbesondere an ehemalige Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen hier Antworten auf vielfältige Fragen zu Themen, wie zum Beispiel Einsatzbelastungen finden. Neben Verbänden und Vereinen sowie den Veteraninnen und Veteranen selbst dient das Büro auch als Ansprechstelle für deren Familienangehörige. Das Veteranenbüro steht unter der Leitung von Oberstleutnant Michael Krause. Um möglichst niederschwellig erreichbar zu sein, befindet es sich zentral und außerhalb von Kasernenzäunen in Berlin-Mitte. Darüber hinaus können Hilfesuchende es über eine Telefonhotline erreichen. Innerhalb der ersten zwölf Monate seines Bestehens bearbeiteten die Mitarbeitenden nahezu 780 „Fälle“. Das Themenspektrum reichte von der Beantragung des Veteranenabzeichens bis hin zu vielfältigen Vermittlungsaufgaben an das „Netzwerk der Hilfe“ der Bundeswehr.
Neben der Unterstützung der Veteraninnen und Veteranen in Deutschland stellt die Förderung der Veteranenkultur einen weiteren Schwerpunkt dar. So ist das Veteranenbüro umfänglich in die Organisation des ersten deutschen Veteranentages am 15. Juni eingebunden. Geplant ist ein Volksfest rund um das Reichstagsgebäude in Berlin für die Veteraninnen und Veteranen, ihre Familien sowie alle Interessierten. Das Veteranenbüro kooperiert bei der Organisation eng mit dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und ist für das sogenannte Veteranendorf verantwortlich.
Konkret soll es ein durchgängiges Rahmenprogramm mit Musik, Podiumsdiskussionen, der Aushändigung des Veteranenabzeichens und vielem mehr geben. Das Veteranendorf soll den einzelnen Veteranenvereinen und -organisationen, aber auch verschiedenen Ansprechstellen der Bundeswehr eine Bühne bieten, um ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Um auf die eigene Sache hinzuweisen, verfügt das Veteranenbüro darüber hinaus über einen Promotions-Truck. Der sogenannte IHopper ist auf Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs. Für das Jahr 2025 stehen mehr als 25 Stationen auf dem Tourplan.