












Auch Behörden sind längst in den Sozialen Medien unterwegs. Sie informieren, zeigen Gesicht und treten in den direkten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Wer hier mutig vorangeht, kann Vertrauen schaffen und die Verwaltung erlebbar machen. Doch wie gelingt ein professioneller und überzeugender Auftritt im Netz?
Mehr dazu auf den Schwerpunktseiten dieser Ausgabe.
Initiative will Recht von Beginn an digital (BS/Anna Ströbele) if (wohnflaeche<=100) { buergerkonto++; } – so könnte ein Gesetz aussehen, das direkt als Software ausführbar ist. Das ist die Vision der Initiative „Law as Code“. Das Team der SPRIND verspricht sich davon Effizienzgewinne und eine einheitliche Anwendung von Gesetzen. Doch wie realitisch ist dieser Systemwandel?
Spätestens seit der Einführung des Digitalchecks auf Bundesebene im Jahr 2023 ist vielen das Ziel digitaltauglicher Gesetze bekannt. Gemeint ist, dass Recht auch in der digitalen Verwaltungspraxis funktionieren muss, nicht nur in der analogen. Die Initiative „Law as Code“ der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) möchte hingegen noch einen Schritt weitergehen: Sie schlägt vor, Gesetze nicht erst analog als Fließtexte zu verabschieden und im Nachhinein aufwendig zu digitalisieren, sondern sie von Anfang an zusätzlich als Code zu entwerfen und bereitzustellen.
Davon erhofft sich die Initiative mehr Effizienz und Standardisierung. Ein Beispiel ist das Lohnsteuergesetz: Würde seine nächste Änderung nicht nur als juristischer Text, sondern auch als ausführbarer Code veröffentlicht, könnten Unternehmen diesen direkt in ihre jeweiligen Steuerprogramme übernehmen. So würden sie sich die ‚Übersetzung’ des Gesetzestextes in Software sparen, die in der derzeitigen Praxis jeder Anwender für sich erledigt. Das hat unterschiedliche Ergebnisse und damit nicht miteinander interoperable Programme zur Folge.
Adressfeld
Und es gibt noch einen weiteren Aspekt – die Transparenz. „Das Recht ist heute ein Expertentool geworden – kaum ein Bürger liest Gesetzestexte und hat dazu Zugang“, meint Dr. Hakke Hansen , der die Initiative der SPRIND leitet. Das digitalisierte Recht könnte das ändern, so die Vision. Bürgerinnen und Bürger könnten nachvollziehen, welche Regeln wann angewendet werden –in klar strukturierter, verständlicher Form. Auch die künftige Automatisierung, für
die das maschinenlesbare Recht die Basis darstelle, solle keineswegs eine Blackbox sein, erklärt sein Kollege Jörg Resch
Revolution erproben
Diesen innovativen Weg in der Gesetzgebung zu gehen, ist eine politische Entscheidung, weiß das Team der SPRIND, welches für die Initiative rege Unterstützung erhält. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus etwa ist der Meinung, dass das Konzept von „Law as Code“ einer „Revolution unseres Rechtswesens“ gleichkomme –und diese hält er für dringend nötig. Er plädiert dafür, zeitnah Pilotprojekte zu starten, um das aus seiner Sicht „vielversprechende Konzept“ möglichst viel in der Praxis zu erproben und daraus zu lernen. Dies sollte auch ohne gesetzliche Grundlage möglich sein. In Frankreich und Estland würden indes bereits erste prototypische Anwendungen für maschinenlesbare Rechtsnormen entwickelt und auch die EU-Kommission verfolge vergleichbare Ziele, sagt Alisha Andert, Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verbands. Das zeige, dass „die Vision einer maschinenlesbaren und damit digitaltauglichen Gesetzgebung längst keine Utopie mehr“ sei. Für ihre Umsetzung brauche es neben Pilotprojekten auch standardisierte Modelle, Überzeugungsarbeit, Aus- und Wei-
terbildung in der Legistik (Gesetzgebungslehre) sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen Juristen, Informatikern und Fachleuten aus der Verwaltung, beispielsweise in Normlaboren. Die neue Bundesregierung scheint zumindest Schritte in diese Richtung gehen zu wollen. Im Koalitionsvertrag sind Praxistauglichkeitstests, die Visualisierung von Strukturen und Prozessen sowie die digitale Umsetzung festgeschrieben. Erst kürzlich kündigte der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Dr. Karsten Wildberger (CDU), an, die Frühphasen von Gesetzen „besser nutzen“ zu wollen, etwa mithilfe von Reallaboren und dem „Mut zum Neudenken“. Sein Haus ist für die „bessere Rechtssetzung“ verantwortlich. Und auch der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium, Philipp Amthor (CDU) findet die Idee „super“, jedoch müssten erst einmal Standards gesetzt und Medienbrüche abgebaut werden, zum Beispiel durch die Registermodernisierung. Inwiefern „Law as Code“ Realität werden kann, wird sich in den kommenden Jahren und durch erste Pilotprojekte zeigen. Bis dahin lädt die Initiative alle relevanten Akteure dazu ein, sich aktiv einzubringen. Der Anspruch der SPRIND ist es schließlich, mit ihren Innovationen „den größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen“ zu erzielen.


Auf dem Prüfstand
Der DEMO-Kommunalkongress bot neben Perspektiven zur Sozialdemokratie auch eine Einstimmung auf die Kommunalwahlen in NRW. Seite 13

Wärme planen
Die Wärmeplanung ist der schlafende Riese des Klimaschutzes in Deutschland, den viele Kommunen noch wecken müssen. Seite 19

Mehr als Realität
AR und VR bieten große Potenziale für die Streitkräfte. In der Bundeswehr setzt man die Technik vornehmlich zur Ausbildung ein. Seite 36



Bedarfsmeldung

Schwerpunktthema der Ausgabe #Amt


Übersetzungsarbeit im Netz
Barrierefreie Social Media Posts
Demokratie braucht Vertrauen
Wie Verwaltung handlungsfähig und bürgernah bleibt
ChatGPT-Actionfigur des BSI
Cyber Security auf Social Media ist Talentanwerbung und Trendverfolgung
Blaulicht im Netz
Ohne Social Media geht es für die Polizei nicht mehr


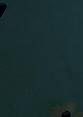
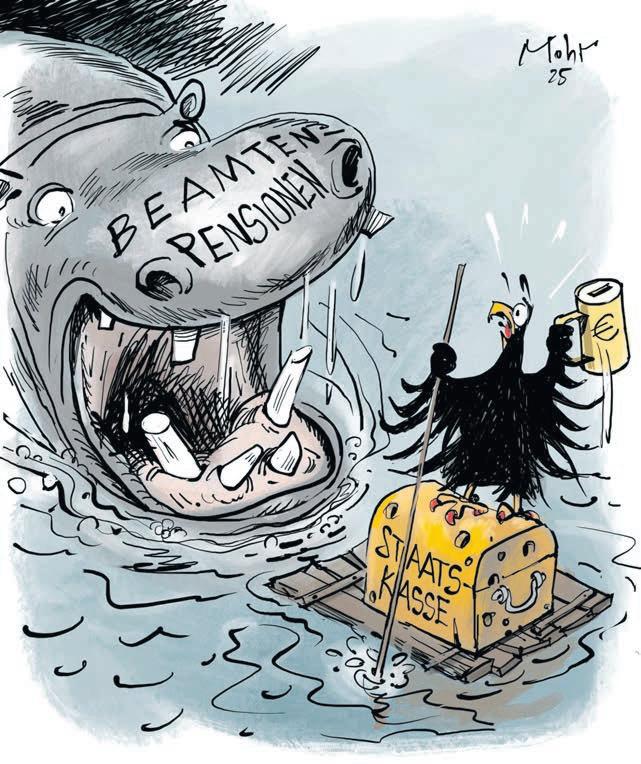
BS/BWI
BS/Hoffmann unter Verwendung von thebeststocker, stock.adobe.com
Impressum
Der Behörden Spiegel wird verlegt von der ProPress Verlagsgesellschaft mbH.
Herausgeberin und Chefredakteurin Dr. Eva-Charlotte Proll
Stellvertretender Chefredakteur Guido Gehrt
Leiterin der Berliner Redaktion Anne Mareile Moschinski
Leiter der Bonner Redaktion Bennet Biskup-Klawon
Aktuelles Öffentlicher Dienst Ann Kathrin Herweg, Sven Rudolf, Hans-Jürgen Leersch
Kommune Julian Faber, Scarlett Lüsser
Digitaler Staat Christian Brecht, Paul Schubert, Frederik Steinhage, Anna Ströbele, Sicherheit & Verteidigung Jonas Brandstetter, Thomas Hönig, Mirjam Klinger, Lars Mahnke, Klaus Pokatzky
Sonderkorrespondenten BOS Gerd Lehmann
Online-Redaktion Tanja Klement
Parlamentsredaktion Berlin
Tel. 030/726 26 22 12, Fax 030/726 26 22 10
Zentraler Kontakt
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 57
Tel. 0228/970 97-0
Verlag Berlin 10317 Berlin, Kaskelstr. 41
Tel. 030/55 74 12-0
Geschäftsführung Dr. Fabian Rusch
Anzeigenleitung Dr. Fabian Rusch Layout Fabienne Besold, Yonca Bilgi, Marvin Hoffmann, André Offenhammer Satz Spree Service und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin & ProGov GmbH, Bonn
Druck Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau Herausgeber- und Programmbeirat Uwe Proll (Vorsitz)
Im Falle höherer Gewalt und Störungen des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Belieferung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen (auch Werbeeinschaltungen) sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Auflagenkontrolle durch IVW (www. ivw.de). Jahresabonnement 9,80 Euro (12 Ausgaben inkl. Porto und MwSt.)
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bonn Altpapieranteil 100 Prozent
Für Bezugsänderungen:
Folgen Sie diesem Icon: Dieses Icon finden Sie auf mehreren Seiten der aktuellen Ausgabe. Es zeigt an, dass es sich bei dem jeweiligen Beitrag um einen Schwerpunktartikel zum Thema „#Amt“ handelt.
Kommentare
(BS) Ob beim Future Combat Air System (FCAS) oder dem Main Ground Combat System (MGCS): Die großen europäischen Rüstungsprojekte setzen auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI). Das wirft ethische Fragen auf. Eine plumpe Verweigerungshaltung wird die Welt aber nicht vom KI-unterstützten Waffengebrauch abhalten. Nicht nur technisch soll das FCAS maßgebend sein – auch bei der Frage, wie KI ethisch in Waffensysteme integriert werden kann, gibt sich das Entwicklungsteam avantgardistisch. Die FCAS-Entwickler verfügen über ein Gremium, in dem die ethischen Grundregeln für den Einsatz von KI im Kampfjet transdiziplinär erörtert werden. Denn klar ist: Ohne den Einsatz neuer Technologien ist FCAS und andere Waffensysteme nicht konkurrenzfähig. Die Intelligenz aus dem Computerchip ist längst Realität. Wer sich militärischer KI verweigert, ist nicht nur waffenlos in der Offensive. Auch die Verteidigung ist ohne computergestützte Intelligen künftig nicht denkbar. Moderne Sensorik erzeugt Datenmengen, die ein Mensch ohne automatisierte digitale Unterstützung nicht mehr bewältigen kann. Hinzu kommt: Ein konsequentes Nein Deutschlands und der EU wird andere Staaten nicht davon abhalten, ihre militärische KI-Aufrüstung voranzutreiben. Rüstungsaktivitäten weltweit nehmen zu –mit Fokus auf technologischer Innovation. Die USA und China füh-
ren diese Entwicklung an. Zudem zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass eine orthodoxe Debatte in Deutschland nicht zu einer friedlicheren Welt beiträgt. Die Kontroverse um die Beschaffung (bewaffneter) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – umgangssprachlich Drohnen genannt – in der Bundesrepublik tobte über Jahre. Unbeeindruckt davon wurden UAV in Bergkarabach und in der Ukraine zum kriegsentscheidenden Wirkmittel. Den Status quo haben andere gesetzt. Deutschland rüstet jetzt nach.
Europa muss seine KI-Kompetenzen ausbauen. Mit dem Konzept des human-in-the-loop – der Idee, Aufklärung und Datengenerierung teilautomatisiert durchzuführen und so den Menschen zu Entscheidungen zu befähigen – bestehen bereits Ansätze für ethisch vertretbare und militärisch leistungsfähige KI-Anwendungen.
Zudem gilt: Die EU kann sich aus einer Position technologischer Teilhabe weit wirksamer in Abrüstungs- und Regulierungsverhandlungen einbringen. Nur wer über valide Fähigkeiten und eine klare Haltung verfügt, kann am Verhandlungstisch Alternativen aufzeigen und seine Position glaubhaft vertreten. Die EU muss ihre Technologie und Ethik weiterentwickeln, damit der Human-in-the-loop nicht nur aus dem Weißen Haus oder aus in Peking steuert.
(BS) Die Erwartungen an die Ergebnisse der Initiative „Handlungsfähiger Staat“ waren groß. Immerhin waren Vertreter der Initiative auch an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und hatten die Chance, einen möglichen Umbau in den kommenden Jahren mitzugestalten. Da liegt zugleich ein Teil des Problems. Während der Abschlussbericht der Initiative viele Herausforderungen, die einem handlungsfähigen Staat im Weg stehen, analysiert und benennt, fehlt es an neuen Lösungsansätzen.
von Sven Rudolf
Die Idee bürokratiearmer Gesetze ist keine Neuerung und auch konkretere Vorschläge, wie das Abschaffen von Aufbewahrungsfristen, wurden bereits häufiger eingebracht, teilweise sogar umgesetzt so zuletzt im Bürokratieabbaugesetz IV. Beim Überfliegen des 150 Seiten langen Abschlussberichts findet der Lesende dafür
jedes erdenkliche „Buzzword“, das mit Staatsmoderniserung in Verbindung gebracht werden kann. Solche Schlagwörter helfen aber nicht dabei, den deutschen Staat tatsächlich handlungsfähiger zu gestalten. Wie der Abschlussbericht selbst darlegt, ist es nicht die eine Idee, die den Staat verändert, sondern die „Atemluft für Reformer“, die geschaffen werden muss. Ein Punkt, auf den die nun beendete Initiative keinen Einfluss mehr haben wird. Der Umstand weckt Zweifel, was es bringt, wenn über 50 Expertinnen und Experten bekannte Probleme und ebenso im Raum stehende Lösungen aufzeigen. Es wäre besser gewesen, wenn Thomas de Maizière und Peer Steinbrück schon in ihrer politisch aktiven Zeit Weichen für einen handlungsfähigen Staat gestellt hätten. So liest sich der Abschlussbericht wie Buhrufe von den eigentlichen Zuschauerrängen, die ihr Team kritisieren, obwohl sie es selbst nicht besser hätten umsetzen können.
Um eine gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen am Arbeitsleben zu ermöglichen, braucht es zunächst einmal eines: ein Bewusstsein für die Thematik. Wer Ungleichheiten nicht als solche wahrnimmt, versteht das Problem nicht. Wer Maßnahmen für mehr Gleichstellung nicht kennt, kann sie nicht in Anspruch nehmen. Hier setzt Diana Reimann an. Die Gleichstellungsbeauftragte beim Bundesverwaltungsamt (BVA) bietet Weiterbildungen und Führungstrainings zu verschiedenen Themen an, um mit den Beschäftigten aller Standorte und Ebenen im Gespräch zu bleiben. Zudem nutzt sie Personalversammlungen oder andere Veranstaltungen, bei denen viele Beschäftigte zusammenkommen, um dem Thema Gleichstellung eine Bühne zu geben. „Wir brauchen verschiedene Formate, um die Menschen zu erreichen“, erklärt sie. „Soziale Medien und das Intranet reichen da nicht aus.“
Pragmatisch ans Ziel
Echte Gleichstellung geht nur gemeinsam
(BS/Ann Kathrin Herweg) Der Öffentliche Dienst ist weiblich – zumindest auf den ersten Blick, denn die Mehrheit der Beschäftigten sind Frauen. Aber der Schein trügt: In den Führungsebenen ist Gleichstellung z. B. noch längst nicht angekommen. Nicht, weil Frauen weniger motiviert oder qualifiziert sind als die männlichen Kollegen, sondern weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Doch die lassen sich ändern.

Karriere bei der Feuerwehr entschieden, hänge u. a. auch damit zusammen, wie das Berufsbild in der Gesellschaft wahrgenommen werde, betont der Gleichstellungsbeauftragte. Hier sei auch die mediale Darstellung des Feuerwehr-Berufs ein Problem – überzeichnete Bilder in Actionfilmen genau wie Kinderserien mit stereotypen Rollenbildern. Er appelliert an alle Frauen, sich von solchen Darstellungen und nicht abschrecken zu lassen und den Beruf auszuüben, den sie sich wünschen. Grundlagen schaffen
Das BVA hat eine ganze Reihe von Projekten in Leben gerufen, um Gleichstellung im Arbeitsalltag zu fördern. Darunter auch die sogenannten Eltern- und Pflege-Guides, die Wissen zum Thema Care-Arbeit bündeln und bei verschiedensten Fragen unterstützen. Care-Arbeit wird nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet. Lässt die sich nicht mit dem Arbeitsalltag zusammenbringen, ist es vielen Frauen schlicht nicht möglich, einen Beruf auszuüben. Neben den Beratungsangeboten gibt es im BVA eine Vielzahl an flexiblen Arbeitszeitmodellen und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten. „Diese Angebote werden gern genutzt, denn sie spiegeln das reale Leben wider“, so Reimann. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass pragmatische Lösungen oft am besten sind und am stärksten auf Zustimmung treffen. „Manchmal muss man einfach loslaufen und ggf. feststellen, dass eine Idee zu utopisch ist“, sagt sie. Nachbessern und anpassen könne man immer noch. Wichtig seien dabei ein gutes Vertrauensverhältnis zur Behördenleitung und die Verbindlichkeit, einzuhalten, was angekündigt wurde.
Die Erwartungen der Bevölkerung an staatliche Kommunikation haben sich verändert. Gerade jüngere Zielgruppen informieren sich kaum noch über klassische Kanäle, sondern über Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube. Wer hier nicht sichtbar ist, wird schnell übersehen. Für Behörden bedeutet das: Wer Vertrauen aufbauen, Informationen streuen oder Verständnis für politische Entscheidungen schaffen will, muss dort präsent sein, wo die Menschen sich aufhalten – auch in digitalen Räumen.
Kommunikation mit Mehrwert
Doch Reichweite allein ist kein Selbstzweck. Social Media kann wesentlich mehr: Krisenkommunikation in Echtzeit, Einblick in Verwaltungsprozesse, Bürgernähe durch authentische Kommunikation oder das Aufbrechen von Vorurteilen gegenüber Behörden – die Chancen sind vielfältig. Voraussetzung ist allerdings ein klares Konzept und die Bereitschaft, sich auf den Charakter der jeweiligen Plattform einzulassen.
Interessen verstehen und ernst nehmen
Zielgruppengerechte Kommunikation beginnt mit dem Verständnis dafür, wen man eigentlich erreichen will. Junge Menschen auf Instagram erwarten andere Inhalte als Berufstätige auf LinkedIn. Facebook lebt von Service-Themen, TikTok vom Unterhaltungsgrad.
Deshalb gilt: Je besser die Kommunikationsabteilung die Lebensrealitäten, Fragen und medialen Vorlieben ihrer Zielgruppen kennt, desto gezielter kann sie Inhalte gestalten, die auch wahrgenommen und geschätzt werden. Dafür braucht es
Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen, Aufklärungsarbeit leisten und, wenn nötig, das System hinterfragen, um ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern zu erreichen.
Foto: BS/Jacob Lund, stock.adobe.com
Mit Sichtbarkeit Es brauche viel Entwicklung, Veränderungsbereitschaft und den Mut, Altbewährtes zu hinterfragen oder zu überarbeiten, erklärt Chris-
tian Theierl, Gleichstellungsbeauftragter der Feuerwehr Hamburg. Dass sich das lohnen kann, macht er an einem Beispiel deutlich: Die Feuerwehr Hamburg hat in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln ihren herausfordernden Sporttest überprüft. Dabei wurden Übungen identifiziert, die anatomisch für Frauen schwieriger zu leisten waren. Um gerechte Einstellungsvoraussetzungen zu schaffen, habe man den Test verändert, berichtet Theierl Statt mit Klimmzügen müssten die Bewerberinnen und Bewerber sich nun beispielsweise beim Beugehang beweisen – einer Übung, die beide
Geschlechter gleichermaßen gut absolvieren können. Gerade die Feuerwehr gilt für einige Menschen nach wie vor als Männerdomäne – zu Unrecht. „Es gibt ganz viele Frauen in der Feuerwehr, man sieht sie nur manchmal nicht“, so Theierl. Auch weil sie in der schweren Montur oft nicht als Frauen zu erkennen seien. „Einen Aufdruck Zugführerin gibt es für die Uniform gar nicht“, erklärt er. „Wir arbeiten daran, Verbesserung herzustellen und mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Feuerwehr zu schaffen.“ Denn dass junge Frauen sich wohlmöglich nicht für eine
Wie zielgruppengerechte Kommunikation auf Social Media gelingt
(BS/Julia Binder) Die Kommunikation öffentlicher Institutionen verändert sich rasant. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl erkennen immer mehr Behörden und Verwaltungen Social Media als wertvolles Instrument der Öffentlichkeitsarbeit an. Doch wie gelingt der Spagat zwischen seriösem Auftreten und einer ansprechenden, nahbaren Kommunikation? Wie erreichen Behörden ihre Zielgruppen wirklich – und wie gehen sie mit Gegenwind um?

Soziale Medien sind für Behörden mittlerweile der Schlüssel, um vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Die Voraussetzung dafür sind eine passende Organisationskultur und ausreichende Ressourcen.
Datenanalyse, Feedbackkultur –und definitiv auch den Mut, Dinge auszuprobieren.
Zwischen Unterhaltungswert und Seriosität
Eine der größten Herausforderungen für Behörden auf Social Media ist die Tonalität: Wie locker darf, wie sachlich muss man kommunizieren? Die gute Nachricht: Authentizität schlägt Perfektion. Bürgerinnen und Bürger erwarten heute nicht mehr nur Informationen, sondern auch Persönlichkeit. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass jede Behörde plötzlich Memes posten oder TikTok-Tänze aufführen muss. Der Schlüssel liegt in der
Balance: Inhalte dürfen durchaus unterhaltsam sein, solange sie zum Absender passen. Ein augenzwinkernder Kommentar zur Arbeit im Ordnungsamt kann Nähe schaffen –solange er sachlich fundiert bleibt. Wichtig ist, die jeweilige Plattform ernst zu nehmen, ohne sich zu verbiegen.
Vertrauen aufbauen durch Krisenfestigkeit
Doch nicht jeder Beitrag wird mit positiven Kommentaren belohnt. Gerade in Sozialen Netzwerken sind Gegenwind und Kritik keine Seltenheit – ob wegen missverständlicher Formulierungen, politischer Entscheidungen oder schlicht schlech-
ter Erfahrungen einzelner Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist, nicht in Abwehrhaltung zu verfallen. Ein souveräner Umgang mit Kritik zeigt Größe – und trägt zur Vertrauensbildung bei. Wer sachlich, freundlich und transparent reagiert, statt zu löschen oder zu ignorieren, gewinnt langfristig. Auch das Eingestehen von Fehlern kann glaubwürdig wirken: „Wir haben dazugelernt, danke für den Hinweis“ – solche Sätze zeigen, dass eine Behörde nicht nur sendet, sondern auch zuhört. Misserfolge gehören in der digitalen Kommunikation dazu. Nicht jeder Beitrag geht viral, manche Strategien funktionieren nicht wie geplant. Entscheidend ist, diese Erfahrungen auszuwerten und daraus zu lernen. Social Media ist kein starres Instrument, sondern ein dynamisches Feld, das ständige Anpassung und Weiterentwicklung erfordert.
Der Erfolgsfaktor Professionelle Social Media-Kommunikation ist keine Nebenaufgabe, die „irgendwer mitmacht“. Sie braucht klare Zuständigkeiten, entsprechende Budgets, Weiterbildungsangebote – und vor allem Rückhalt aus der Führungsebene. Wenn Social Media als strategisches Kommunikationsinstrument begriffen wird, können auch Verwaltungsstrukturen davon profitieren: Prozesse werden transparenter, Entscheidungen nachvollziehbarer
Julia Welford sieht auch die Politik in der Verantwortung, Gleichstellung zu fördern. „Das darf kein parteipolitisches Interesse werden, das ist ein Verfassungsauftrag“, so die Parlamentarische Beraterin für Digitalisierung, Frauen und Jugend in der bayerischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Der Staat müsse die nötigen gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen und verbessern. Ein interessantes Beispiel, was das bewirken könne, liefere Schweden. Hier habe es eine Zeit lang freiwillige Elternzeit für Väter gegeben. Die habe nicht dazu geführt, dass eine überwiegende Mehrheit davon Gebrauch gemacht hätte. Dann wurde Elternzeit auch für Väter verpflichtend. Das habe schließlich langfristige Wirkung auf die Rollenverteilungen in Familien entfaltet. Welford plädiert außerdem für Maßnahmen wie geschlechtersensible Berufsberatung an Schulen, dafür, dass Männer von der Politik besser angesprochen werden und aufgezeigt bekommen, dass auch sie von Gleichstellungsarbeit profitieren und dafür, dass Gleichstellungsbeauftragte mehr Unterstützung erhalten und mit ihren Anliegen in der Politik Gehör finden.
und die Verwaltung insgesamt bürgernäher.
Mut zur neuen Behördensprache Social Media bietet Behörden eine große Chance, Nähe, Transparenz und Vertrauen aufzubauen – vorausgesetzt, sie nehmen die Plattformen ernst und begegnen ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe. Der Weg dorthin führt nicht über perfektes Marketing, sondern über authentische Kommunikation, strategisches Vorgehen und den Mut, auch mal neue Töne anzuschlagen. Dabei müssen Behörden keine Entertainer werden – aber sie sollten wissen, wie man Menschen erreicht. Zwischen Dienstsiegel und Dialog liegt eine neue Behördensprache, die sowohl seriös als auch menschlich sein darf. Wer sie beherrscht, wird gehört.



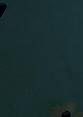
Der Nutzen liegt auf der Hand:
Das BMM trägt zu strategischen Zielen auf kommunaler und regionaler Ebene bei – zum Beispiel zur Stärkung der nachhaltigen Mobilität, zum Klimaschutz, zur Entlastung der Verkehrsinfrastruktur sowie zur Wirtschaftsförderung. Arbeitgeber profitieren zudem von einer hohen Mitarbeitendenzufriedenheit und bei der Fachkräftegewinnung und -bindung. Anlässe für ein BMM sind vielschichtig – sie reichen von der Standorterweiterung oder einem Standortwechsel über hohen Parkdruck bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Mehr als eine Öko-Bilanz
Das BMM zeigt auf, wie Arbeitsund Dienstwege umweltfreundlicher, gesünder und aktiver gestaltet werden können und bindet alle relevanten Stellen beim Arbeitgeber ein. Dies führt zu einer hohen Akzeptanz der im Mobilitätsplan festgehaltenen Maßnahmen und hilft so, die ökologische Bilanz zu verbessern, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen und langfristig Kosten zu senken. Arbeitgeber profitieren von einer besseren Erreichbarkeit des Standorts für alle. Gleichzeitig kann das PkwAufkommen am Standort reduziert werden. Weitere wichtige Aspekte sind die Gewinnung und Bindung von Fachkräften sowie die Förderung der Gesundheit und Motivation der Beschäftigten. Sie selbst sparen Kosten, erreichen ihre Ziele stressfreier und erzielen durch aktive Mobilität positive Effekte für die Gesundheit.
Betriebliche Mobilität gemeinsam gestalten
(BS/Christine Breser/Heike Mühlhans) Seit mehr als zehn Jahren fördert die Region Frankfurt RheinMain erfolgreich das betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM). Mit dem Programm „Besser zur Arbeit“ haben bereits über 150 Arbeitgeber und Hochschulen, etwa die Hälfte davon aus dem öffentlichen Sektor, mit insgesamt rund 150.000 Beschäftigten und Studierenden in ganz Hessen maßgeschneiderte Mobilitätspläne erarbeitet.
Die Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (ivm) begleitet mit „Besser zur Arbeit“ öffentliche Arbeitgeber, Unternehmen und Hochschulen auf dem Weg zu maßgeschneiderten Mobilitätskonzepten. Die Wirksamkeit des für Arbeitgeber kostenlosen Beratungsprogramms hat sich hierbei bereits in zahlreichen Unternehmen und Behörden bewiesen. In der Region Frankfurt RheinMain und Hessen haben dabei unter anderem die Verwaltungen der Städte Rüsselsheim, Lampertheim, Neu-Isenburg, Langen und Dreieich sowie die Verwaltungen des Rheingau-Taunus-Kreises, des Lahn-Dill-Kreises und des Hochtaunuskreises Mobilitätskonzepte erarbeitet und umgesetzt. Teilnehmer sind zudem das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RheinlandPfalz, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, der Deutsche Wetterdienst als Bundesbehörde sowie die Goethe-Universität Frankfurt und die Technische Universität Darmstadt. Für ein erfolgreiches BMM ist es entscheidend, dass das Maßnahmenset auf die individuellen Ge-
Aktuelles aus dem Arbeitsrecht
Eine Kolumne von Ralph Heiermann
Ein Segen können die Sozialen Medien wohl nicht sein, denn als es sie noch nicht gab, hat sie auch niemand vermisst. Für Werbezwecke und auch zur Information tat es der Internetauftritt über eine eigene Homepage. Für schnelle Mitteilungen genügte die E-Mail.
Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Natürlich gibt es weiter Homepages von Behörden, Unternehmen und auch Privaten. Hinzugekommen sind aber insbesondere Plattformen wie zunächst Facebook und später Twitter/X, Instagram und TikTok. Für den Austausch untereinander über Wichtiges und Unwichtiges gibt es diverse Messengerdienste. Unternehmen und Behörden kommen daran nicht mehr vorbei. Sie sind häufig oder sogar zum größten Teil auch dort vertreten. Für die Medien gilt das ausnahmslos. Das hat für beide Seiten, für diejenigen, die Inhalte einstellen und für die Nutzenden, Vorteile. Neue Informationen kommen schnell bei den Zielgruppen an, ohne dass diese gezielt suchen müssen. Für die öffentliche Hand ist es sogar eine Chance, sperrige Inhalte verständlich zu machen, wie Beispiele im In- und Ausland zeigen. So präsentiert der römische Bürgermeister in TikTok-Videos von Baustellen in der Stadt und schafft so Verständnis für damit zeitweise einhergehende Behinderungen. Dienen die Sozialen Medien der seriösen Information, erreichen sie viel eher die Generation der unter 35-Jährigen, die sich in erster Linie über diese Plattformen informiert. Es ist deswegen wichtig, dass nicht nur die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanäle in den
sozialen Medien präsent sind, sondern auch die öffentliche Hand.
Moderner Klatsch
Das Gefahrenpotenzial der Sozialen Medien ist enorm. Das liegt nicht nur an dem außerordentlichen Suchtpotenzial und an den Möglichkeiten gezielter Beeinflussung durch Desinformation, wie wir sie ständig erleben. Es hängt auch damit zusammen, dass früher Klatsch und Tratsch, halbgare politische Einschätzungen, Lästereien, Beschimpfungen und Ähnliches – wirklich – privat am Stammtisch, über den Gartenzaun, an der Ecke oder auf dem Markt ausgetauscht wurden. Unbedachte Äußerungen oder peinliche Selbstdarstellungen hatten meistens kein großes Publikum und waren im günstigsten Fall schnell vergessen.
Diese Zeiten sind vorbei. Das Netz vergisst nicht, die Welt schaut zu und liest mit. Das gilt für die bewusst ins Netz gestellten Beleidigungen und Hasskommentare, aber auch für solche, die auf den Plattformen gepostet werden, weil man vielleicht erst geschrieben und dann nachgedacht hat. In beiden Fällen ist es häufig eine Katastrophe für diejenigen, die betroffen sind. Sie haben nicht selten einen langen Leidensweg vor sich. Mehr Bewusstsein wäre deshalb
gebenheiten des Arbeitgebers und seiner Beschäftigten zugeschnitten ist. Es muss zu den verkehrlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen ebenso passen wie zu den finanziellen und personellen Ressourcen. Damit dies gelingt, wird ein erprobter Prozess erfolgreich eingesetzt. Grundlage für die Beratung bilden drei Analysebausteine. Den ersten Schritt stellt die Bestandsaufnahme am Standort bzw. an den Standorten dar. Ergänzt wird diese durch eine Wohnstandortanalyse, die Aufschluss darüber gibt, wie gut die Standorte mit verschiedenen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Ein dritter wichtiger Baustein ist die Befragung der Beschäftigten. Sie liefert wertvolle Einblicke in das aktuelle Mobilitätsverhalten und zeigt zugleich Potenziale für Veränderungen auf. Darüber hinaus können zusätzliche Informationen erhoben werden – etwa zur CO2-Bilanz oder zu dienstlichen Wegen.
Handlungsfelder
In der Beratung selbst werden auf Grundlage der vorangegangenen Analysen gezielt Maßnahmen entwickelt, welche die Beschäftigten bei ihrer Mobilität unterstüt-
zen. Das betriebliche Mobilitätsmanagement orientiert sich dabei an den konkreten Bedürfnissen vor Ort und bezieht alle Verkehrsmittel mit ein. Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort sowie persönliche Lebensumstände wie Kinderbetreuung, Pflegeverpflichtungen oder eingeschränkte Mobilität spielen bei der Verkehrsmittelwahl eine wichtige Rolle. Deshalb werden verschiedene Handlungsfelder betrachtet: die Förderung von Bus- und Bahnnutzung, Fahrradnutzung, Nahmobilität, Elektromobilität, effizienter Pkw-Nutzung sowie Maßnahmen im Bereich Kommunikation, Information und Organisation. Diese Handlungsfelder lassen sich mit einer Vielzahl konkreter Maßnahmen füllen. Dazu zählen zum Beispiel ein attraktives Ticketangebot wie aktuell das Deutschlandticket Job, Fahrradleasing, eine gute Fahrradinfrastruktur am Standort, Ladepunkte für E-Fahrzeuge oder Carsharing für Dienstfahrten. So kann das Maßnahmenpaket an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
Vorbildlich mobil Ergänzend bieten die Industrie- und Handelskammern in der Region Frankfurt RheinMain in Zusammenarbeit mit der ivm das Prädikat „Vorbildlich Mobil“ an. Das Prädikat zeichnet das Engagement
der Arbeitgeber aus und schafft im Sinne einer Zielvereinbarung Verbindlichkeit für die Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen. Darüber hinaus kann das Prädikat auch bei der Fachkräftesuche und in Ausschreibungen aufgeführt werden. Das BMM entfaltet seine Wirkung jedoch nicht nur intern, sondern auch nach außen. Eine engagierte Verwaltung wird zum Vorbild für andere Arbeitgeber. Und hier kommt ein weiterer Vorteil des Programms „Besser zur Arbeit“ der ivm zum Tragen. Die das Programm begleitenden Netzwerke schaffen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den Akteuren in der Region.
Weitere Informationen unter www. BesserZurArbeit.de

Christine Breser ist Diplom-Bauingenieurin und leitet bei der Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm) den Bereich „Mobilitätsmanagement und Konzepte“. Foto: BS/ivm

Heike Mühlhans ist Diplom-Bauingenieurin mit dem Schwerpunkt Verkehrswesen und Raumplanung. Seit 2011 leitet sie als Geschäftsführerin die Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm). Foto: BS/ivm
AfD-Mitgliedschaft: Pauschalen Ausschluss wird es nicht geben
sehr hilfreich. Möchte ich das über mich lesen, was ich hier über andere schreibe?
Beweisstück Social Media
In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten und Disziplinarverfahren spielen solche Posts und vermeintlich privaten Äußerungen in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Die Problematik der Sozialen Medien lässt sich daraus durchaus ableiten.
Die Likes und bestätigenden Kommentare zu rassistischen, beleidigenden, sexistischen Posts, Memes, Videos oder solchen mit extremistischem Inhalt sind in den vergangenen Jahren immer häufiger Gegenstand arbeitsrechtlicher Abmahnungen oder Kündigungen, im Beamtenbereich von Disziplinarverfahren, geworden. Erst recht gilt dies für entsprechende eigene Beiträge im Netz. Gefährlich sind auch die scheinbar privaten Chats, beispielsweise in der Kollegengruppe, in der man untereinander Dienste oder Fahrgemeinschaften abstimmt. Werden hier dann etwa extremistische Inhalte verbreitet oder wird über Kollegen oder Vorgesetzte in beleidigender Weise hergezogen, kann das selbst für diejenigen Gruppenmitglieder arbeitsrechtlich oder disziplinarrechtlich gefährlich werden.

Dr. Ralph Heiermann ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht und besitzt eine Kanzlei in Hannover. Er berichtet an dieser Stelle regelmäßig über arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Verwaltung und die aktuelle Rechtsprechung.
Foto: BS/privat
(BS/sr) Zunächst klang es so, als ob Rheinland-Pfalz mit seiner neuen Verwaltungsvorschrift einen Vorstoß für einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Öffentlichen Dienst vornimmt. Doch recht schnell stellte sich heraus: Es war ein Missverständnis, ein pauschales Verbot wird es nicht geben. Damit wird noch einmal deutlich, dass eine Einzelprüfung Pflicht bleibt, wenn es um Fragen der Verfassungstreue geht.
In einer ersten Veröffentlichung des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift des Landes klang es noch nach einem pauschalen Ausschluss aller Mitglieder extremistischer Vereinigungen. Doch bereits eine Woche später kam es zu einer Klarstellung, dass nach wie vor eine Einzelfallprüfung darüber entscheidet, wer für den Dienst geeignet ist und wer nicht. Entscheidend bleibt: „Wer sich in den Dienst dieses Staates stellt, muss jederzeit loyal zur Verfassung stehen – ohne Wenn und Aber“, so der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. Besteht eine Mitgliedschaft in einer der in der Extremismus-Liste des Landes aufgeführten Organisationen und kann aus diesem Grund die Belehrung zur Verfassungstreue nicht unterzeichnet werden, bestehen begründete Zweifel an der Verfassungstreue. Anders als es in der ersten Veröffentlichung anklang, haben die Bewerberinnen und Bewerber aber die Möglichkeit, die dadurch bestehenden Zweifel zu beseitigen.
Bekanntes Modell Rheinland-Pfalz folgt hierbei dem Ansatz Bayerns. Dort wurde, bereits im Juni die AfD in die Liste der extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen
aufgenommen, um nach Aussage der bayerischen Staatsregierung Bewerber effektiver auf ihre Verfassungstreue überprüfen zu können. Die thematische Frage, ob ein pauschaler Ausschluss aus dem Öffentlichen Dienst möglich ist, ist in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder aufgekommen und obliegt nach wie vor der Einzelfallprüfung. Dennoch hat die Einstufung von Organisationen als extremistisch Auswirkungen auf betroffene Beschäftigte im Öffentlichen Dienst.
Konsequenzen für den Status Erst nach der Einstufung der AfD als in Teilen gesichert rechtsextrem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Anfang Mai war das Thema zuletzt groß diskutiert worden. Durch eine Klage der AfDFraktion obliegt die finale Entscheidung darüber dem Bundesverfassungsgericht. Dr. Ralph Heiermann, Fachanwalt für Verwaltungs- und Arbeitsrecht, erklärte dazu auf Anfrage des Behörden Spiegel: eine Mitgliedschaft allein rechtfertige noch keinen Ausschluss, die Einzelfallprüfung bleibe entscheidend. Eine Funktionärstätigkeit oder das Liken von verfassungsfeindlichen Aussagen in den Sozialen Medien oder Ähnliches können jedoch schnell zu dienstrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.
In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit Behinderungen. Viele von ihnen, auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Ältere, profitieren von barrierefreier Kommunikation.
Deshalb ist es des Anspruch des BMAS, möglichst barrierefrei und inklusiv zu kommunizieren – auf unserer Website und über SocialMedia-Kanäle wie Facebook, Instagram, X und LinkedIn. Das BMAS möchte barrierefrei kommunizieren – und ‚muss‘ es auch. Als öffentliche Institution sind Ministerien laut Paragraf 12 Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, Online-Angebote barrierefrei zu gestalten – etwa durch Untertitel in Videos, kontrastreiche Gestaltung oder einfache Sprache. Dass ein Ministerium für Soziales und Teilhabe dem nachkommt, ist selbstverständlich. Grundsätzlich gilt, Posts klar und verständlich in einfacher Sprache zu verfassen. Praktisch ist das oft herausfordernd, da die Quellen und Themen oft sehr fachlich sind. Die Kunst besteht darin, Übersetzungsarbeit zu leisten – inhaltlich und sprachlich. Oft helfen schon ein paar Grundregeln: aktiv formulieren, kurze Sätze bilden, Fremdwörter vermeiden und Fachbegriffe, wo nötig, erläutern. Sprachauswahl
Einfache Sprache kann die Redaktion eigenständig verwenden. Für Leichte Sprache sind Fachleute
Barrierefreie Social Media Posts
(BS/Bundesministerium für Arbeit und Soziales) Inklusion und Teilhabe sind zentrale Ziele für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Wichtig ist, alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zu erreichen – unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Nur wer Zugang zu Informationen hat, kann selbstbestimmt am politischen, gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und entscheidend für das alltägliche Funktionieren der Demokratie.

Auch auf Sozialen Medien können Menschen schnell ausgeschlossen werden, wenn für sie kein passendes Angebot besteht. Foto: BS/Tina, stock.adobe.com
wenn Formulierungen immer weiter vereinfacht oder die Kontraste angepasst werden müssen. Wie erwähnt bekommen Videos des BMAS grundsätzlich schwarze Untertitel auf weißem Balken – möglichst in leserlichem Satz. In sehr eiligen Fällen muss jedoch die plattformeigene Untertitelung reichen – auch wenn diese nicht immer optimal alle Ansprüche an Barrierefreiheit erfüllt.
Gebärdensprache und Leichte Sprache auch in zeitkritischen Fällen bereitzustellen, ist eine besondere Herausforderung. Hier haben einzelne Ressorts schon gute Lösungen. Bessere Vernetzung und der Austausch von Best-PracticeBeispielen können hier sicher noch weiter helfen.



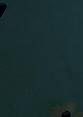
Nach dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Ende 2022 und den anschließenden Änderungen durch das sogenannte OmnibusPaket wurden große Kapitalgesellschaften mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und 50 Millionen Euro Umsatzerlösen oder 25 Millionen Euro Bilanzsumme (zuvor 250 Mitarbeitende und zwei aus drei Kriterien; die endgültige Größenordnung wird erst nach der Bekanntmachung durch die EU-Kommission verbindlich vorliegen) zu einer jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ab dem Jahr 2028 über das Geschäftsjahr 2027 im Lagebericht verpflichtet.
nötig. Leichte Sprache wurde speziell für Menschen mit Behinderungen entwickelt, zum Beispiel für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie folgt klaren Regeln und ist noch stärker vereinfacht als Einfache Sprache. Auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten profitieren von Leichter Sprache. Wer sich hier gerne belesen möchte, findet weiterführende Informationen im Ratgeber Leichte Sprache. Beim Verwenden von Hashtags achtet das BMAS darauf, Großbuchstaben für jedes Wort und jede Abkürzung zu verwenden. Das trägt zur besseren Lesbarkeit bei. Grafiken haben ausreichende Farbkontraste und möglichst lesbare Schriftarten und -größen, um
Menschen mit Sehbehinderung zu erreichen. Bei Vordergrund und Hintergrundfarbe, etwa bei Schrift auf Farbfläche oder Bildern, muss der Kontrastwert ausreichend hoch sein. Entsprechend setzt das BMAS eher Volltonfarben als Pastelltöne ein. Mithilfe einfacher Tools lassen sich die Kontraste im Gestaltungsprozess schnell und unkompliziert überprüfen.
Barrierefreies Bewegtbild Grafiken und Fotos erhalten ergänzend Bildbeschreibungen, die via Screenreader lesbar sind. Videos der Ministerin laufen meist mit Untertiteln. Diese sind hilfreich für gehörlose Interessierte – und auch Nutzer am Smartphone, die ohne Ton zuschauen, können den Inhalt erfassen.
Teile der Videos werden auch in Gebärdensprache übersetzt und im Splitscreen veröffentlicht. Die Bildschirmfläche wird in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt, um mehrere Ansichten parallel anzuzeigen. Manchmal stößt die Übersetzungsarbeit bei Fachbegriffen an Grenzen. Auch bei Eigennamen oder den Titeln von Gesetzen und Verordnungen sind die Möglichkeiten begrenzt. Zwar lässt sich das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Lieferkettengesetz kürzen. Die SozialversicherungsrechengrößenVerordnung hingegen lässt sich schwer vereinfachen.
Inklusion im Zeitfaktor Oft spielt der Faktor Zeit eine erhebliche Rolle: Was einfach aussieht ist manchmal langwierig,
Frankfurter Modell zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
(BS/Lars Scheider) Im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfassen Unternehmen Informationen und Daten über Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (z. B. Energieverbrauch, Ausstoß von Treibhausgas-Emissionen, Gleichstellung) und geben Auskunft über Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsaspekte bzw. die Auswirkungen von Klimarisiken auf ein Unternehmen.
Freiwillig berichten Für alle Unternehmen und Organisationen, die nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht (CSRD) fallen, wurde auf EU-Ebene der Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Small and Medium sized Enterprises (VSME; Freiwilliger Nachhaltigkeitsberichtsstandard für nicht börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen) entwickelt. Dieser freiwillige KMUStandard unterstützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen dabei, Berichtsanforderungen von z. B. Banken, Versicherungen und Geschäftspartnern pragmatisch und einfach zu erfüllen. Der VSME-Standard ist im Vergleich zu den ESRS deutlich reduziert und enthält ein Basis- sowie ein umfassendes Modul. Im Basismodul werden grundlegende Informationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eingefordert (z. B. THG-Emissionen, Personal, Arbeitssicherheit), im umfassenden Modul wird u. a. auch zu Klimazielen und -risiken des Unternehmens berichtet. Darüber hinaus gibt es dann noch ein Erweiterungsmodul, sodass auch eine vertiefte Betrachtung möglich ist. Seit der Neufassung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) im Februar 2023 hat das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nach dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) im Februar 2022 wurden große Kapitalgesellschaften zu einer jährlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Lagebericht verpflichtet. Durch den ersten Teil des sogenannten Omnibus-Pakets wurde der Startzeitpunkt um zwei Jahre nach hinten verschoben (Berichtspflicht ab dem Jahr 2028 über das Geschäftsjahr 2027). Für alle Unternehmen und Organisationen, die nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht fallen, wurde auf EU-
Ebene der Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) entwickelt. Dieser freiwillige KMU-Standard unterstützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen dabei, Berichtsanforderungen von z. B. Banken, Versicherungen und Geschäftspartnern pragmatisch und einfach zu erfüllen.
Reduzierter Aufwand
Der VSME-Standard ist im Vergleich zu den ESRS deutlich reduziert und enthält ein Basis- sowie ein umfassendes Modul. Im Basismodul werden grundlegende Informationen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eingefordert (z. B. THG-Emissionen, Personal, Arbeitssicherheit), im umfassenden Modul wird u. a. auch zu Klimazielen und -risiken des Unternehmens berichtet. Um die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand zu erfüllen sowie einen besseren Überblick der Nachhaltigkeitsleistung der städtischen Mehrheitsbeteiligungen zu erhalten, soll auch für Unternehmen, die nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine jährliche Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Grundlage der VSME eingeführt werden.
Im Entwurf des PCGK der Stadt Frankfurt am Main (Teil D; ‚Transparenz für Bürgernähe und Vertrauen in öffentliche Institutionen‘) werden die Beteiligungsunternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main, die nicht unter die CSRD fallen, verpflichtet einen Nachhaltigkeitsbericht nach den Vorgaben des Basismodul des VSME mit grundlegenden Informationen zu Umwelt, Soziales und Governance zu erstellen.
Integration in Unternehmensstrategie
Die Plattformen entwickeln sich stetig weiter. Als das BMAS mit Social Media angefangen hat, gab es einige Funktionalitäten noch nicht, etwa eine automatische Untertitelung. Ebenso bieten heutige Smartphones bereits Tools wie Screenreader, die eine Teilhabe an digitaler und Social-Media-Kommunikation ermöglichen bzw. vereinfachen. Auch lassen sich Texte übersetzen und Schriften vergrößern. Seit Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes im Juni 2025 gilt: Smartphones und Tablets müssen Funktionen enthalten, die Menschen mit Sehbehinderungen eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen. Zum Thema Barrierefreiheit sind Verbände wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. oder auch das Team von #BarrierefreiPosten gut ansprechbar. Auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ( www. bundesfachstelle-barrierefreiheit. de) kann bei Fragen weiterhelfen. Die beim BMAS angesiedelte Bundesinitiative Barrierefreiheit (www. deutschland-barrierefrei.de), macht deutlich: Barrierefreiheit ist eine Querschnittsaufgabe und ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag.
Der Bericht soll jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses veröffentlicht werden. Eine externe Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer ist dazu nicht vorgesehen. Eine formale Prüfung durch den Deutschen Nachhaltigkeitskodex wird empfohlen. Dies ist für die Beteiligungsunternehmen kostenfrei. Der Aufwand für die Beteiligungsunternehmen für die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts (VSME-Basismodul) wird auf ca. 22 – 30 Personentage geschätzt und ist somit sehr überschaubar. Nach der ersten Berichterstattung im Sommer 2026 (auf Basis JA 2025), soll dann von den Beteiligungsunternehmen geprüft werden, ob die Berichterstattung auf das umfassende VSME-Modul (sog. Comprehensivemodul mit detaillierteren Informationen zu Umwelt, Soziales und Governance) ausgeweitet werden kann und dem Aufsichtsrat im Herbst 2026 zur Entscheidung vorgelegt werden. Dadurch soll die Diskussion im Aufsichtsrat über die Nachhaltigkeitsstrategie des jeweiligen Beteiligungsunternehmens im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Konzernverbund Stadt Frankfurt am Main unterstützt werden, damit die Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie integriert werden kann.
Um Nachhaltigkeitsberichterstattung geht es auch beim Webinar Zukunftsfähiges Beteiligungsmanagement: „Strategien für Resilienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung“ am 18.09.2025. Mehr Informationen unter: https:// www.fuehrungskraefte-forum.de/ detail.jsp?v_id=12022

Lars Scheider ist Assessor jur. und seit über zwölf Jahren er Verwaltungsdirektor und Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement bei der Stadtkämmerei in Frankfurt am Main. Dort ist er für alle Grundsatzfragen der Beteiligungssteuerung der rund 500 städtischen Beteiligungsgesellschaften verantwortlich. Foto: BS/privat
In Deutschland kostet Börsenstrom überall das Gleiche. Und das, obwohl im Norden dank Windenergie weit mehr Strom erzeugt wird als im Süden – doch auch dort werden große Mengen Strom benötigt. Im Normalfall wird also ein Teil des Stroms aus Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert. Erzeugen die Windparks allerdings besonders viel Strom, reichen die Leitungen quer durch Deutschland nicht aus, um diesen zu transportieren. Es kommt zu Netzengpässen. Die Folge: In Norddeutschland müssen Windparks abgeschaltet und in den südlichen Bundesländern dafür z. B. Gaskraftwerke hochgefahren werden, um den Strombedarf weiterhin decken zu können. All das kostet Geld – und diese Kosten werden auf die Kunden in ganz Deutschland umgelegt. Durch die Aufteilung Deutschlands in fünf Strompreiszonen würde sich das ändern.
Einsparpotenzial
Durch die vorgeschlagene Neukonfiguration könnten laut Bidding Zone Review insgesamt 339 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Zudem würde Strom dort günstiger, wo er produziert wird: im Norden. Das begrüßen die norddeutschen Bundesländer. Für sie bieten sich nicht nur finanzielle Vorteile. „Mit einer Aufteilung der Gebotszone würde die Produktion von grünem Wasserstoff in Norddeutschland starken Auftrieb bekommen“, betont Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt Die Zonen könnten zudem Anreize schaffen, das Stromnetz in
nicht berücksichtigt – darauf würden die Autorinnen und Autoren im Bericht selbst hinweisen. Eine so weitreichende Veränderung brauche jedoch eine viel fundiertere Grundlage, so Neubaur

(BS/akh) Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber raten dazu, die deutsch-luxemburgische Stromgebotszone in fünf Zonen aufzuteilen. Das ist ihre Folgerung aus dem Bidding Zone Review einer Analyse, in der sie gemeinsam mit weiteren Akteuren überprüft haben, ob die aktuelle Einteilung der Zonen sinnvoll und markteffizient ist. Bis Oktober muss die Bundesregierung der europäischen Kommission mitteleilen, ob sie den Rat befolgen wird oder nicht.
Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt kritisiert, dass die Preise für Strom nicht die tatsächliche Verfügbarkeit widerspiegeln. Das sei nicht marktwirtschaftlich. Er fordert eine ernsthafte Diskussion über die Thematik. Foto: BS/gottsfam, stock.adobe.com
Deutschland schneller auszubauen und damit effizienter aufzustellen, so Sachsen-Anhalts Energieminister Prof. Dr. Armin Willingmann Zweifelhafter Nutzen
In Mittel- und Süddeutschland wird an der geltenden Regel festgehalten. Anders als im Norden würden hier bei einer Umstrukturierung die Preise steigen, was sich schlecht auf die Wirtschaftsstandorte auswirken könnte.
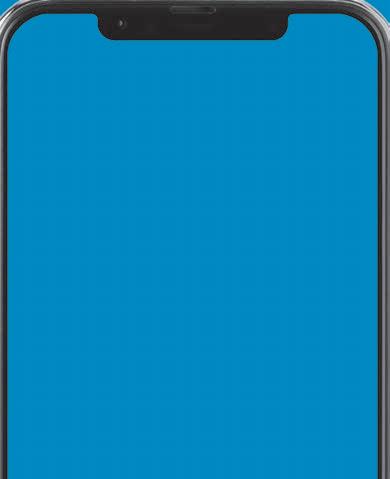
– Tägliche News rund um den Public Sector – Vernetzen Sie sich zu aktuellen Themen und erstellen Sie Ihren individuellen Newsfeed
– Direkter Zugriff auf Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts und vieles mehr







„Die deutsche Wirtschaft braucht weiterhin die einheitliche Strompreiszone. Jede andere Debatte führt nur zu einer großen Verunsicherung bei allen Akteuren und schadet der Wirtschaft in Süd wie Nord gleichermaßen“, mahnt Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger. Die Idee sei teuer, der Umsetzungsaufwand immens und der Nutzen zweifelhaft.
Baden-Württembergs Energieministerin Thekla Walker hält die
Einführung neuer Gebotszonen für einen komplizierten, langwierigen und bürokratischen Eingriff ins Marktsystem. Sie appelliert dafür, lieber jetzt Möglichkeiten zu nutzen und z. B. den Aufwuchs Erneuerbarer Energien zu fördern. Nordrhein-Westfalens Energieministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur kritisiert das Bidding Zone Review als Grundlage für die Diskussion. Viele wichtige Aspekte würden hier
Fokus Netzausbau Auch in Expertenkreisen wird von der Neukonfiguration der deutschen Gebotszone abgeraten. So betont Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: „Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass eine einheitliche deutsche Gebotszone das bessere Modell ist und bleibt. Dafür sind ein beschleunigter Netzausbau und grenzüberschreitende Kapazitäten das A und O.“ Prof. Dr. Claudia Kemfert , Abteilungsleiterin in der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e. V., sieht die Lösung ebenfalls im Netzausbau. Strompreiszonen brächten zudem keinen Anreiz für den stärkeren Ausbau von Erneuerbaren Energien im Süden, dafür brauche es vielmehr konkrete finanzielle Anreize und die Ausweisung ausreichender Flächen für Windenergie. Die Meinungen gehen weit auseinander. Entscheiden muss die Bundesregierung. Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie heißt es dazu: „Klares Ziel der Bundesregierung ist es, an der deutschen Stromgebotszone festzuhalten. Dies bekräftigt auch der Koalitionsvertrag.“ Das führe zu einem liquiden Stromhandel. Im Strommix setzten sich dann jeweils deutschlandweit die kostengünstigsten Erzeugungstechnologien durch.
Gut, aber alt Abschlussbericht „Handlungsfähiger Staat“
(BS/sr) Die Initiative „Handlungsfähiger Staat“ hat nach einem Jahr ihren Abschlussbericht für eine Staatsmodernisierung abgegeben und zeigt sich erfreut, dass viele Anregungen aus dem Zwischenbericht der Initiative ihren Weg in den Koalitionsvertrag gefunden haben. Im Bericht selbst heißt es: Würde die Hälfte der Vorhaben umgesetzt, sei Deutschland bereits ein anderes Land.
Mit insgesamt 35 Empfehlungen liefert die Initiative von Julia Jäkel, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück und Andreas Voßkuhle eine Bandbreite von Verbesserungsbedarf. Dabei reichen die Themen von Gesetzgebung über Digitalisierung bis hin zu Bildung und allgemeinen Empfehlungen. Ziel ist eine ressortübergreifende Staatsmodernisierung. Ob die Impulse der Initiative jedoch die erwünschte Staatswende herbeiführen, bleibt strittig.
Allgemein gehalten
Ziele wie Bürokratieabbau, Digitalisierung und Aufgabenbündelung stoßen auf Zustimmung, doch gibt es auch Kritik und Forderungen. So zeigte sich DBB-Bundesvorsitzender Volker Geyer enttäuscht von den Vorschlägen für die Personalpolitik. Die Erkenntnis, dass der demografische Wandel ein Loch in die Personaldecke reiße, sei nicht neu. „Aber was ist die Konsequenz daraus? Hier gibt es nur die allgemeine Aussage, dass der Staat als Arbeitgeber deutlich attraktiver werden muss, aber zu naheliegenden Maßnahmen kann man sich nicht durchringen,“ moniert Geyer. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes hätte sich mehr Vorschläge zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber gewünscht. Auch die Verlagerung der Personalkompetenz in eine einzelne Bundesbehörde (das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung) sieht er mit großen Bedenken. Denn die Personalvorgänge benötigen ein hohes Maß an Fachlichkeit,

Ist der Abschlussbericht ein Handbuch dafür, was ein handlungsfähiger
erörterte Geyer. Als Beispiel nannte er die Einstellung von Beschäftigten der Bundespolizei. „Gleiches gilt für das Dienstrecht: Das muss beim Bundesinnenministerium bleiben, eine Verlagerung ist nicht sachgerecht," konstatierte Geyer Kernelemente fehlen Auch aus Sicht von Kommunalvertretern gibt es gute Punkte, aber im Großen und Ganzen gehen ihnen die Empfehlungen nicht weit genug, um den gedachten Reformansatz zu Ende zu führen. Es würden grundlegende Fragen wie die Finanzierung und der Leistungsdruck der Kommunen ausgelassen oder nur am Rande behandelt, heißt es beispielsweise von Stimmen aus dem Netzwerk Junge Bürgermeister*innen und dem Deutschen Städte-
und Gemeindebund. Zu den konkreten Vorschlägen heißt es von Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: diese seien „durch die Bank weg nicht neu“. Die Ideen seien zwar eine gute Vorlage, aber wie auch die Initiatoren im Abschlussbericht selbst anmerkten, brauche es nun eine zweite Reformphase, nämlich die aktive Umsetzung. Das Netzwerk betont, die Frage sei nicht, ob Ideen funktionierten, sondern ob sie unter Alltagsbedingungen mit normalem Personalstand (und zwar in einer Spanne von zehn bis 40.000 Mitarbeitenden) und mit eingeschränkten Mitteln umsetzbar seien. Pilotkomunen entfalteten in diesem Zusammenhang nur selten die benötigte Breitenwirkung.
Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 30 39114 Magdeburg
Telefon:
0391/567-01
Fax: 0391/567-7510
E-Mail:
poststelle-mid@sachsen-anhalt.de
Internet: mid.sachsen-anhalt.de
Chief Digital Officer (CDO)
Tobias Krüger -7102
Hauptamtliche
Gleichstellungsbeauftragte
Michaela Neersen -7527
Abteilung 1
Allgemeine Angelegenheiten
Leiter/-in: NN
Vertreterin: Beate Genetzke -7593
Informationssicherheitsbeauftrager
Jens Hoffmann -7445
Referat 11
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, Innerer Dienst
N.N.
Referat 12
Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
Carmen Schmudlach -7435
Referat 13
Haushalt, Finanz- und Fördercontrolling
Beate Genetzke -7593
Referat 14
EU-Angelegenheiten, Justiziariat, Vergabewesen, Korruptionsprävention
Maria Kreitsch -7544
Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte
Jessica Lorenz -7466
Hauptschwerbehindertenvertretung
René Ewert -8752

Staatssekretär/ Amtschef
Sven Haller
LMB, Stellv. Regierungssprecher
Stefan Thurmann -7503
Persönlicher Referent der Ministerin Tim Baldauf -7505
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Peter Mennicke -7504
Staatssekretär/ Beauftragter der Landesregierung für Informationsund Kommunikationstechnologie (CIO)
Bernd Schlömer
Abteilung 2 Städtebau und Bauaufsicht, Landesentwicklung
Iris Grunenberg 3521/22
Referat 21 Grundsatz Städtebau, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Wohngeld, Haushalt Michael Klotz -7475
Referat 22 Städtebauförderung, Architektur Maik Grawenhoff -7467
Referat 23 Öffentliches Baurecht, Rechtsangelegenheiten
Astrid Just -3545
Referat 24
Sicherung der Landesentwicklung
Christine Flach 0345-69 12 800
Referat 25
Bauaufsicht, Bautechnik, technische Fragen des Städte- und Wohnungsbaus
Christian Lander -3543
Referat 26 Landesentwicklungsplanung, Europäische Raumentwicklung
Dr. Martin Stötzer -3501
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Babette Oswald -7547
Vorsitzender des Hauptpersonalrates Volker Simon -7460
Abteilung 3
Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
Dr. Stefan Hörold -7580
Referat 31
Grundsatzfragen, Verkehrspolitik, Öffentlicher Personenverkehr
Dirk Grothmann -7489
Referat 32
Straßeninfrastruktur
Melanie Sorgatz -7590
Referat 33
Luftverkehr, Schifffahrt, Güterverkehr, Bahnen
Daniela Düring -7433
Referat 34
Verkehrs- und Straßenbaufinanzierung
Annett Stadler-Roes -7483
Referat 35
Straßenverkehrsrecht, Gefahrgutrecht, Straßenrecht, Verkehrssicherheit
Michael Baum -3508
Referat 36
Verkehrsstrategie, Alternative Mobilitätskonzepte
Andy Lübke -7557
Vorsitzende des örtlichen Personalrates
Simone Pieper -3525
Datenschutzbeauftragter Andy Staudte -3577
Abteilung 4 Digitale Gesellschaft und Geoinformation Karin Schultze -7420/21
Unterstützung Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
Enrico Fiedler -7103
Referat 41 Rechtsangelegenheiten der Abteilung Christina Schwarz -3556
Referat 42 Geobasisinformationssystem, Geodateninfrastruktur
Steffen Patzschke -3509
Referat 43 Demografische Entwicklung und Prognosen Harald Kreibich -3500
Referat 44 Flächenmanagement, Amtliches Raumordnungs- und Informationssystem Bernhard Hintzen -7541
Referat 45 Digitalstrategie, digitale Projekte Ines Cieslok -7120
Referat 46 Digitale Infrastruktur, Breitbandversorgung, Post und Telekommunikation Theo Struhkamp -7130





Kabinetts-, Landtags- und Bundesratsangelegenheiten
Jörg Sambleben -7502
Persönliche Referentin CIO
Elisabeth Breitenstein -7105
Projektmanagementoffice – PMO N.N.
Abteilung 5 Digitale Verwaltung
Dr. Kai Rothenberg* -7218
Referat 51
Grundsatzangelegenheiten digitale Verwaltung
Dr. Kai Rothenberg -7218
Referat 52 Kommunikationsstruktur und Netze des Landes Sascha Hanf -7220
Referat 53
IT-Services, E-Government-Basisbetrieb, Infrastruktur und Dienste für den digitalen Arbeitsplatz
Kerstin Dittmar -7262
Referat 54
IT-Verfahren für die Landesverwaltung Elke Bartels -7240
Referat 55 Koordinierung OZG und Registermodernisierungsgesetz, IT-Kooperationen Frank Bonse -7260
Referat 56 IT-Compliance, Standardisierung
Dr. Manuela Kunze -7270
Aufgaben werden in Halle (Saale) wahrgenommen *m. d. W. d. G. b.


Wirtschaftsministerin Katherina Reiche kündigt Innovationsoffensive an
(BS/Anne Mareile Moschinski) Die neue Bundesregierung will die Fördermittel zur Stärkung des Start Up-Standorts Deutschland verdoppeln. Andere Instrumente zur Unterstützung der Gründerszene fallen hingegen dem Rotstift zum Opfer.
Die
neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will großzügige Finanzpakete auf den Weg bringen, um der deutschen Start Up-Szene vom Fleck zu verhelfen. Kürzlich kündigte sie vor Pressevertretern an: „Wir verdoppeln die Mittel, die wir in unserem Ministerium haben.“ Sie wolle „Kapital in großem Stil“ mobilisieren, um den Technologiestandort Deutschland zu stärken.
Konkret bedeutet das: Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) erhöht die Gelder für die „Initiative für Wachstums- und Innovationskapital“ (WIN-Initiative) von zwölf Milliarden Euro auf 25 Milliarden, um damit bis 2030 das deutsche Venture-Capital-Ökosystem zu bezuschussen. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin des BMWE mit, dass die angekündigte Aufstockung der WIN-Fördermittel einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag entspreche. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an der Umsetzung.
Kapital durch Sicherheitsgarantien des Bundes
Die WIN-Initiative hatte die Ampel-Regierung bereits im September vergangenen Jahres auf den Weg gebracht. Das Programm soll Regierung, Banken und Versicherer zusammenbringen und so gezielt Innovationen aus Deutschland fördern. Der Kerngedanke: Der Bund trägt nur einen Bruchteil des investierten Geldes bei, sorgt durch seine Sicherheitsgarantien aber dafür, dass aus der Privatwirtschaft mehr Kapital beigesteuert wird. Bislang waren deutsche Start Ups häufig
Keine 100 Tage nach der Kanzlerwahl schlagen die Wogen in der Berliner Koalition hoch. Der schon sehr heftige Streit um die Besetzung von Richterstellen und die Debatten über zu stark wachsende Sozialausgaben können Kanzler Friedrich Merz (CDU) jedoch nicht erschüttern: „Diese Regierung steht auf einem stabilen Fundament. Das ist keine Krise, es ist eine Situation, die besser sein könnte.“ Dass die Situation tatsächlich wieder besser wird, daran wollten er und sein Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) arbeiten, sicherte Merz in seiner Sommerpressekonferenz zu.
Wichtigstes Projekt von Union und SPD ist derzeit die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025, der dazu dienen soll, „das Land auf Vordermann zu bringen“, wie Klingbeil es ausdrückt. Und Merz sagt: „Wir übernehmen als Koalition Verantwortung für Deutschland, wie es im Koalitionsvertrag heißt. So soll Deutschland Motor für die Wirtschaft in Europa werden.“
Wachstum und sichere Arbeitsplätze schaffen
Das soll vor allem über die von Klingbeil angekündigten „Rekordinvestitionen“ in Höhe von 115 Milliarden Euro geschehen. „Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde“, sagt Klingbeil. Fließen sollen die Gelder in Investitionen etwa in Schienen und Straßen, Bildung, Betreuung und Forschung, neuen Wohnraum, Digitalisierung und Klimaschutz sowie in die Innere und Äußere Sicherheit des Landes. Das schaffe Wachstum, sichere Arbeitsplätze und sei zugleich ein Beitrag

BMWE mit einer Aufstockung der Mittel für die WIN-Initiative erreichen.
vom Kapital ausländischer Investoren abhängig mit der Folge, dass diese auch verstärkt in die unternehmerischen Strategien eingreifen konnten.
Wie das BMWE betont, habe die Bundesregierung der Start UpPolitik im Koalitionsvertrag hohe Priorität eingeräumt, die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit Deutschlands sei von großer Bedeutung für das Wachstum des Landes. Vor diesem Hintergrund irritiert ein anderer Beschluss der neuen Bundesregierung. So kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an, in seinem Kabinett auf den Posten des Start Up-Beauftragten verzichten zu wollen.
Die Pressestelle des BMWE teilt dazu mit: „Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Anzahl der Beauftragten des Bundes zu halbieren.“ Im Zuge dessen werde auch dieser Posten abgeschafft. An der Entschlossenheit des Ministeriums, sich für Start Ups einzusetzen, ändere das aber nichts. Dieses werde auch ohne Beauftragten weiterhin Ansprechpartner für die Branche bleiben.
Erhöhung der WIN-Gelder reicht nicht aus
Die Abschaffung des Beauftragten stößt beim Deutschen Start Up-Verband auf Unverständnis. So habe sich dessen Bedeutung in der Ver-
„Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung zeitnah klare Zuständigkeiten schafft.“
Verena Pausder, Vorsitzende, Start UpVerband Deutschland
gangenheit bewährt, erklärt Pressesprecherin Jana Pyrek. Da die Start Up-Beauftragten bisher vom Ministerium selbst und nicht von der Bundesregierung ins Amt gesetzt wurden, seien die Koalitionsvorgaben aber nicht bindend.
Die Verdoppelung der Gelder für die WIN-Initiative treffen beim Branchenverband, wenig überraschend, auf Zustimmung. Dies allein reiche jedoch nicht aus, um den Standort Deutschland zu stärken. „Es sind zusätzliche Anreize nötig“, so Sprecherin Pyrek Die Vorsitzende des Verbands, Verena Pausder, erklärte kürzlich: „Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung zeitnah klare Zuständigkeiten schafft, um in den kommenden Jahren die richtigen Weichen stellen zu können.“ Darüber hinaus plant das BMWE auch, die Mittel des „Deutschlandfonds“ um mindestens zehn Milliarden Euro auf 100 Milliarden Euro aufzustocken. Die Förderung avisiert in erster Linie allerdings mittelständische Unternehmen, die die Start Up-Phase bereits hinter sich gelassen haben.
Die Prioritäten im neuen Haushalt
(BS/Hans-Jürgen Leersch) Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Koalition auf Kurs und den Haushalt auf einem guten Weg. Bei den Ausgaben für Zivil- und Bevölkerungsschutz demonstriert die Regierung Einigkeit, Diskussionsstoff liefert hingegen das Bürgergeld.

Die Ausgabenplanung im Finanzministerium ist weitgehend unstrittig: Wegen höherer Investitionen werden die Aufwendungen für die Zollverwaltung 2025 um 400 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro steigen.
dafür, Deutschland gerechter zu machen.
Die Zahlen sind in der Tat eindrucksvoll. 503 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr ausgeben, nach 476,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Eindrucksvoll ist aber auch die von 39 Milliarden auf 81,8 Milliarden wachsende Neuverschuldung. Damit wird ein Viertel der Bundesausgaben auf Pump finanziert. Möglich macht dies die faktische Aufhebung der Schuldenbremse: „Wir haben hier im Parlament
Foto: BS/Medienzunft Berlin, stock.adobe.com
die Fesseln endlich gelöst“, sagt Klingbeil und betont: „Wir investieren so stark wie noch nie zuvor in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ Handlungsbedarf für die Zukunft wird bei den Zinsausgaben sichtbar: Statt 38 Milliarden Euro Zinsen, die der Bund 2024 für seine Schulden bezahlen musste, wird ein Anstieg auf 45,3 Milliarden Euro im Jahr 2028 erwartet.
Der größte Brocken im Haushalt ist zugleich das massivste Problem: Sozialministerin Bärbel Bas (SPD)
Hessischer Rechnungshof: Becker folgt auf Wallmann
(BS/gg) Nach zwölf Amtsjahren ist Dr. Walter Wallmann Ende Juni als Präsident des Hessischen Rechnungshofes ausgeschieden und hat sich in den Ruhestand verabschiedet.
Seine Nachfolge trat zum 1. Juli der bisherige hessische Finanzstaatssekretär und ehemalige Kämmerer der Stadt Frankfurt, Uwe Becker, an. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein erklärte anlässlich der Amtswechselfeier im Hessischen Landtag: „Mit Dr. Walter Wallmann verabschieden wir einen überaus engagierten und hoch geschätzten Präsidenten in den Ruhestand.“ Wallmanns Arbeit habe maßgeblich dazu beigetragen, die Transparenz in der öffentlichen Verwaltung zu stärken und das Vertrauen in demokratische Strukturen zu festigen. Mit Uwe Becker übernehme ein ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger kommunaler Erfahrung das Amt des Präsidenten. Der scheidende Präsident Dr. Wallmann dankte den Beschäftigten und zeigte sich stolz, dass er „mit so vielen kompetenten und sympathischen Menschen über eine so lange Zeit zusammenarbeiten durfte“. Mit Uwe Becker habe der Landtag einen hervorragenden neuen Präsidenten gewählt.
Uwe Becker ordnete in seinen Ausführungen die Aufgabe des Rechnungshofes und seine persönliche Rolle ein. Der Hessische Rechnungshof sei oberster Berater für Landtag und Landesregierung sowie für die hessischen Kommunen. „Ich freue mich auf die Aufgabe an der Spitze dieses Hauses“, sagte Becker. Seine Verantwortung gelte dem Land, seinen Gesetzen und ganz besonders seinen Menschen.
will 190,3 Milliarden Euro ausgeben, 14,62 Milliarden Euro mehr als bisher. Größte Posten sind hier die Zuschüsse an die Rentenversicherung, die 122,5 Milliarden Euro (2024: 116,27 Milliarden) betragen und bis 2028 auf 140,8 Milliarden Euro steigen sollen, falls es keine Reform gibt. Fast 52 Milliarden und damit fünf Milliarden mehr als bisher sind für den Bereich Bürgergeld veranschlagt.
Die Mehrausgaben für das Bürgergeld gefallen Merz gar nicht. Unterstützung bekommt er aus der Wissenschaft, etwa von Hans-Werner Sinn, dem ehemaligen Chef des Münchener Ifo-Instituts: „Die Politik muss den Sozialstaat zähmen, weil er lähmend wirkt und zu viel Geld verschlingt.“
Die Sozialministerin hält dagegen: „In die Debatte über unseren Sozialstaat hat sich ein schriller Ton eingeschlichen, der uns nicht guttut.“ Reformbedarf sieht sie aber auch. Der vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ins Gespräch gebrachte „Boomer-Soli“, eine Zwangsabgabe auf alle Alterseinkünfte zur Finanzierung der Bezüge der jetzt in Rente gehenden geburtenstarken Jahrgänge, wird jedoch allgemein abgelehnt. In anderen Politikbereichen sind sich Union und SPD weitgehend einig. „Wir rüsten auf beim Bevölkerungsschutz, beim Zivilschutz“, sagt Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).
„Richtig durchstarten“ könne man im Innenbereich, freut sich Martin Gerster (SPD). So steige die Mittelausstattung für das Bundeskriminalamt (BKA) im Vergleich zum vergangenen Jahr um knapp 170 Millionen Euro an und werde erstmals bei über einer Milliarde Euro liegen.
Größter Block sind Ausgaben für die Bundespolizei
Die Bundespolizei erhält 1.000 neue Stellen und ihr Etat steigt im Vergleich zu 2024 um eine Dreiviertelmilliarde Euro. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sind Ausgaben in Höhe von 336 Millionen Euro eingeplant, 168 Millionen Euro mehr als bisher. Größter Block im Innenetat sind mit 4,94 Milliarden Euro (bisher 4,19) erneut die Ausgaben für die Bundespolizei. Weitgehend unstrittig sind auch die Ausgabenplanungen in Klingbeils Finanzministerium. So sollen die Ausgaben für die Zollverwaltung wegen höherer Investitionen um 400 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro steigen. Für das Bundeszentralamt für Steuern wird mit Ausgaben in Höhe von 894,5 Millionen Euro gerechnet, 73,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Kanzler Merz ist optimistisch, dass die Koalition zu Lösungen finden wird. CDU/CSU und SPD hätten eine ganz normale Arbeitsbeziehung. Er sei zufrieden und werde in der zweiten Jahreshälfte „das fortsetzen, was wir begonnen haben“. Mehr über die Ausgaben für die Zollverwaltung und andere Themen erfahren Sie beim Digitalen Zolltag des Behörden Spiegel am 24. November 2025 auf www.zolltage.de.
► TÄUSCHUNG
Vorgespiegelte Eignung
Gleiche Entscheidungsmaßstäbe
Ein Landesbetrieb schrieb Winterdienstleistungen in einer Abfolge von verschiedenen Vergabeverfahren aus. Er kündigte gegenüber einem der Bieter an, ihn infolge einer Täuschung über Eignungsmerkmale auszuschließen. Dazu initiierte er eine Anhörung. Stein des Anstoßes war, dass der betreffende Bieter eine Angabe in einem anderen Vergabeverfahren gemacht hatte, welche nicht den Tatsachen entsprach. Es ging um eine bestimmte Mindestlagerungskapazität von Streumaterial bzw. -sole (500 Kubikmeter), die für den Winterdienst benötigt wird. Im vorangegangenen Vergabeverfahren hatte er allerdings den betreffenden Bieter nicht wegen Falschabgaben zur Eignung (Paragraph 124 Abs. 1 Nr. 8 GWB) ausgeschlossen. In dem aktuellen Vergabeverfahren dachte der Auftraggeber jedoch, dieses tun zu können. Der betreffende Bieter wehrte sich gegen den angekündigten Ausschluss infolge einer behaupteten mangelnden Zuverlässigkeit. Das Nachprüfungsverfahren hatte Erfolg. Der Vergabesenat stellte heraus, dass offenbleiben kann, ob es für den Ausschluss eines Vorsatzes bzgl. effektiver Falschangaben bedarf. Er lässt die Auffassung erkennen, dass ein sich fachspezifisch bewerbendes Unternehmen verpflichtet ist, richtige und vollständige Angaben zu machen. Er untersuchte weiter die Frage, ob es möglich ist, eine eignungsbezogene Falschangabe in einem anderen, zeitlich vorausgegangenen Vergabeverfahren auf das aktuelle Verfahren zu übertragen. Er bejahte dies im Grundsatz, verneinte es aber im konkreten Fall. Die Begründung dafür ist, dass es hier ermessensfehlerhaft und sogar willkürlich wäre.
OLG Jena, Beschl. v. 02.10.2024 (Verg 5/24)
► FÖRDERMITTEL
Rückforderung
Unnötige Nennung von Produkten
Es ging um den Ausbau eines Gemeindeweges, der anteilig aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (ILERL M-V)“ gefördert wurde. Im Zuwendungsbescheid lautete es ausdrücklich, dass nicht produktbezogen ausgeschrieben werden darf. Die einschlägigen ANBestILE und NBest-Bau verwiesen auf die VOB/A, 1. Abschnitt. Das Leistungsverzeichnis enthielt bestimmte Herstellerprodukte. Die einschlägigen Leistungspositionen waren jeweils mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ und der ergänzenden Formulierung versehen: „Sofern ein anderes Fabrikat […] angeboten wird, ist eine ausführliche Produktbeschreibung des Herstellers dieser Ausschreibung beizufügen, mit der die Gleichwertigkeit eindeutig nachgewiesen wird.“
Der Zuwendungsgeber nahm einen teilweisen Widerruf (fünf Prozent Kürzung) vor, und zwar aufgrund von Verstößen gegen Paragraf 7 Abs. 2 VOB/A, also den Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung. Er wandte diesen Korrektursatz der COCOF-Leitlinien der EU an. Die Klage des Zuwendungsempfängers gegen diese Kürzung bleibt ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht erkennt keine Berechtigung, unter Bezugnahme auf bestimmte Produkte diese Ausschreibung vorgenommen zu haben. Der Grundsatz der Produktneutralität verlangt, dass im Ausnahmefall der Benennung bestimmter Produkte oder Verfahren eine absolute Notwendigkeit dafür bestehen muss und dass gleichzeitig auch eine sonstige Beschreibung in allgemeinverständlicher Form nicht möglich ist. Dies ist hier nicht der Fall.
VG Schwerin, Urt. v. 10.04.2025 (3 A 1671/20)
► REFERENZEN
Vergleichbarkeit
Liefermengen aus einem Vertrag
In diesem Vergabenachprüfungsund sofortigen Beschwerdeverfahren ging es um die Grundfrage, ob und inwieweit ein Bieter Referenzauftragsmengen aus verschiedenen referenzierten Verträgen herleiten darf. Ausgeschrieben waren Drogentests, wobei die Bieter gemäß der in der EU-Bekanntmachung veröffentlichten Maßgaben eine Mindestbelieferungsmenge von 100.000 Stück als Referenz nachweisen mussten. Ein Konkurrent wundert sich darüber, dass der vorgesehene Zuschlagsbieter, der nach seiner Marktkenntnis bisher gar nicht über entsprechende Referenzauftragsmengen verfügen dürfte, nun diesen Vertrag ausführen soll. Im Nachprüfungsverfahren wurde diese Rüge des Konkurrenten als ausreichend substantiiert angesehen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der designierte Zuschlagsbieter im Rahmen seiner Bewerbung Teilmengen aus verschiedenen referenzierten Auftragsverhältnissen zusammengelegt hatte. Es sollte sich dabei außerdem gemäß den Angaben des Bieters um „landesweit gelieferte 10.500 Stück“ handeln. Die Bewertung des Auftraggebers, dass dies ausreiche und dass zudem eine solche Zusammenlegung aus mehreren Verträgen möglich sei, hielt der Münchener Vergabesenat nicht für rechtens. Es sei auf die Leistungsfähigkeit abzustellen und diese betreffe, und diese betreffe die Belieferung mit der Mindestmenge 100.000 Stück aus einem einzigen Vertrag heraus. Ein Bieter müsse, wenn er diese Stückzahl nicht aus einem Vertrag heraus als Referenz vorweisen könne, demzufolge gemäß den bekanntgemachten Eignungskriterien ausgeschlossen werden.
BayObLG,
Beschl. v. 09.04.2025 (Verg 1/25 e)
► BIETERVORSPRUNG Erfahrungswissen
Voraufträge können besserstellen
Im Rahmen einer Auftragsvergabe betreffend Hochwasserkartierungen entzündete sich Streit um die Frage, ob und inwieweit der designierte Zuschlagsbieter Erfahrungswissen für sich selbst nutzbar machen kann. Der Vergabesenat bejahte grundsätzlich, dass Kartierungsarbeiten, welche in dem entschiedenen Fall für das Vorland gemacht worden sind, von einem Bieter wissensmäßig verwendet werden dürfen. Die objektiven Arbeitsergebnisse, welche die Kartierungen für das angrenzende Vorland betrafen, sind jedoch allen Bietern zugänglich zu machen. Dabei hilft das Argument nicht, dass eine andere Behörde für diese Vorlandplanung zuständig war. Letztlich handelt es sich um objektive Tatsachen, die im Rahmen eines nachfolgenden Ausschreibungsverfahrens für alle Bieter nutzbar gemacht werden müssen. Die Behauptung des öffentlichen Auftraggebers noch im Nachprüfungsverfahren, dass er als zuständige Behörde die Arbeitsergebnisse aus der Vorlandplanung nicht kenne, dass er aber gleichzeitig wisse, dass diese Daten nicht verwendbar seien, wurde vom Vergabesenat zurückgewiesen. Eine Behörde könne die Frage der Verwendbarkeit von Vorarbeiten nicht verneinen, wenn sie sie gar nicht kenne. Bedeutsam ist, dass die Position als Vorauftragnehmer bei der Vorlandplanung dem betreffenden Bieter, dessen Bezuschlagung hier angegriffen werden sollte, nicht infrage zu stellen ist. Der Umstand, dass sich aus einem solchen Vorauftrag heraus unternehmerische Vorteile für ähnliche bzw. daran anknüpfende Arbeiten im Rahmen von weiteren öffentlichen Aufträgen ergeben, ist hinzunehmen.
OLG Saarbrücken, Beschl. v. 07.05.2025 (1 Verg 1/25)
► WERTUNG Nicht erfüllt
Ausschluss zwingend Die öffentliche Auftraggeberin schrieb europaweit eine Reihenbestuhlung aus. Musterstühle waren seitens der Bieter zur Verfügung zu stellen. Als Zuschlagskriterien fungierten der Angebotspreis und weitere Bewertungskriterien zu jeweils 50 Prozent.. Die Bewertungsmatrix wich jedoch hinsichtlich der Punktevergaben von dieser eigentlich vorgesehenen prozentualen Gewichtung von „50 zu 50“ ab. Die Höchstpunktzahl sollte 142 Wertungspunkte betragen. 100 Wertungspunkte sollten für den niedrigsten Wertungspreis (50 Prozent = 50 Punkte) vergeben werden und 42 Wertungspunkte für die Gestaltung bzw. Konstruktion (je 21 Punkte).
Das Vergabeverfahren leidet gemäß der Vergabekammer an derart schwerwiegenden Mängeln, dass das Verfahren in den Stand vor Auftragsbekanntmachung zurückversetzt werden muss. Aufgrund der konstruktiven Mängel ist die durchgeführte Angebotswertung als vergaberechtswidrig einzustufen.
Der Zuschlag wurde überdies unter Verstoß gegen die Informations- und Wartepflicht (Paragraf 134 GWB) erteilt und verletzt die Bieterrechte. Die Vergabekammer stellt fest: Eine zu erreichende maximale Punktzahl von 50 Punkten für den Angebotspreis und 21 Punkten für die Bewertungskriterien entspricht nicht der Vorgabe, dass die Zuschlagskriterien jeweils mit 50 Prozent gewertet werden sollen.
Zusammenfassung der Entscheidungen: RA und FA für Vergaberecht Dr. Rainer Noch, München (Kanzlei Dr. Noch) jeden Monat im Behörden Spiegel ◄
Preisprüfung als Vergabeinstrument (BS/bk) Wenn der Markt funktioniert und Wettbewerb stattfindet, ist das für Konsumentinnen und Konsumenten wie für den Staat als Auftraggeber, meistens positiv. Doch die vergangenen Jahre waren von Krisen geprägt, sodass die Marktmechanismen versagt haben. Der öffentliche Auftraggeber muss sich auch nicht alles gefallen lassen und kann das Werkzeug des Preisrechts einsetzen.
Öffentliche Auftraggeber sollten viel häufiger das Preisrecht nutzen, meint Prof. Dr. Andreas Hoffjan, Lehrstuhlinhaber für Unternehmensrechnung und Controlling an der TU Dortmund. Das Preisrecht sei wie eine Radarfalle. Es laufe im Hintergrund und sei wie das Atmen, so Hoffjan. Grundsätzlich kommt der Preis auf dem Markt aufgrund von Nachfrage und Angebot zustande. Aber der Markt kann bei Krisen versagen – sei es bei einer Pandemie oder einem außenpolitischen Spannungsfall. Durch das Preisrecht kann der Auftraggeber den Auftragnehmer zwingen, seine Preisbildung offenzulegen. Es muss nicht eigens vertraglich vereinbart werden, sondern gilt immer automatisch mit: „Das Preisrecht kann man als kleine Schwester des Vergaberechts betrachten“, sagt Hoffjan
Grundlage des Preisrechts ist die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen. Das Preisrecht soll die öffentliche

Zwar müssen öffentliche Stellen erst mal den Bedarf decken, doch das heißt nicht, dass sie jeden Preis zahlen müssen. Foto: BS/Frank H., stock. adobe.com
Hand vor sogenannten Mondpreisen schützen. Grundlage ist das Höchstpreisprinzip. Konkret müssten sich Auftragnehmer im Rahmen einer öffentlichen Auftragsvergabe an ihrem für die angebotene Leis-
tung bereits erzielten Marktpreis messen lassen. Ein Marktpreis kommt dann zustande, wenn mindestens zwei zuschlagsfähige Angebote vorliegen. Bei Verletzung des Höchstpreisprinzips kommt es zur Teilnichtigkeit des Vertrags. Hoffjan empfiehlt, ein Preisprüfungsersuchen durch einen Preisprüfer zuzustellen, wenn die Preise „explodieren“. Ebenso sollten öffentliche Auftraggeber intern Strategien entwickeln, Unterauftragnehmer in den Fokus nehmen, Preisobergrenzen festsetzen und Gewinnvereinbarungen treffen. Die Vereinbarungen sollten gerade bei lang laufenden Verträgen getroffen werden. Die Preisprüfung komme imm erzwar erst im Nachhinein zur Anwendung, es sei jedoch die „letzte Kugel in der Pistole“, so Hoffjan. „Der öffentliche Auftraggeber kann bei einer Preisprüfung nur gewinnen“, so Hoffjan weiter. Selbst als Drohinstrument könne sie genutzt werden, damit die öffentliche Hand Steuergelder sinnvoll einsetzt.
Beratung für Bewerter und Bieter Ausschreibungen · Submissionen













Berliner Gespräch mit Jordaniens Botschafter Fayiz F. Khouri (BS/ps) Fayiz Farhan Saleh Khouri hat sich nie auf ein bestimmtes Talent verlassen. Weder bei seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften, noch im Studium Public Administration, der Promotion in Rechtswissenschaften oder bei seinen Jobs im diplomatischen Dienst Jordaniens in Amman, Tokio, Dubai, Erbil (Irak), Italien und Berlin. Bislang ist der 58-Jährige gut damit gefahren, dass Ausdauer letztlich zum Ziel führt. Auch und gerade in Berlin, wo die bilateralen Beziehungen schon seit ihrer Aufnahme im Jahr 1953 sehr gut sind.


der imposanten Felslandschaft ist Teil des antiken Weltkulturerbes.


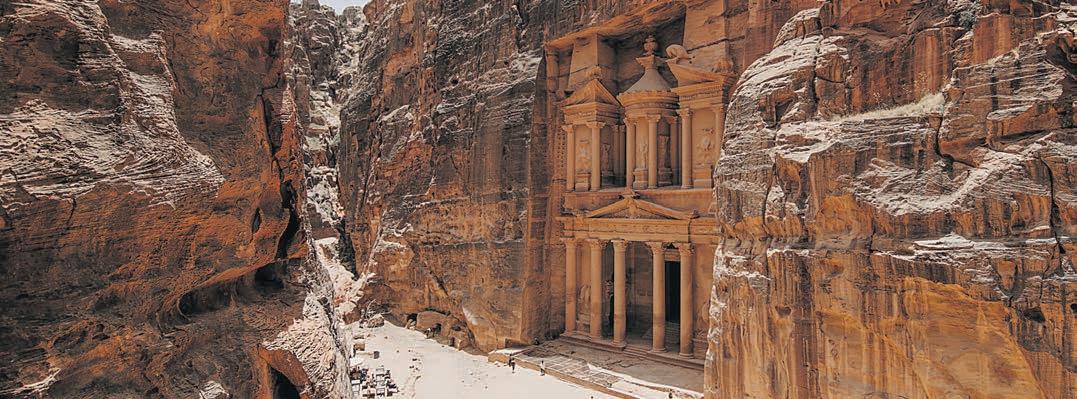
Deutschland ist ein wichtiger Entwicklungspartner, unterstützt unsere Bildung, Wassersicherheit und Energiewende und ist aufgrund seiner Führungsrolle in der Europäischen Union für die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit Europa insgesamt wichtig, so der Botschafter. Es geht dabei um die Erarbeitung von gemeinsamen Lösungen globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und der regionalen Friedenskonsolidierung. Jordanien sieht Berlin insbesondere in den Bereichen Humankapital, wirtschaftliche Zusammenarbeit und grüne Transformation als natürlichen Partner. Größtes nationales Kapital des Königreiches ist u. a. seine gut ausgebildete Jugend, bspw. an der Deutsch-Jordanischen Universität (GJU), mit guten Aussichten auch für den deutschen Arbeitsmarkt. Darüber hinaus hat sich das Land zu einem wichtigen Anbieter von qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen entwickelt: Mehr als 2.000 jordanische Ärztinnen und Ärzte sind in das deutsche Gesundheitssystem integriert, während Zehntausende weitere in und außerhalb Jordaniens in Medizin, Krankenpflege und pflegebezogenen Berufen ausgebildet werden. Bei der beruflichen Bildung bereitet die Initiative Partnerschaften für entwicklungsorientierte Arbeitsmigration (PAM) gemeinsam mit der Vocational Training Corporation (VTC) und der deutschen Handwerkskammer jordanische Jugendliche auf das duale Ausbildungssystem in Deutschland vor. GJU, VTC und PAM sind ein Beispiel dafür, dass Jordanien in der Lage ist, qualifizierte Arbeitskräfte zu generieren, die auf den strategischen Bedarf Deutschlands abgestimmt sind und langfristig Brücken sowohl im Bildungs- als auch im Beschäftigungssektor bauen.
Bei der wirtschaftlichen Kooperation bietet Jordanien ein unternehmensfreundliches Umfeld und einen bevorzugten Zugang zu regionalen Märkten.
„Wir sind als strategisches Drehkreuz für internatioale Unternehmen positioniert, die am Wiederaufbau und an der kommerziellen Wiederanbindung an regionale Märkte interessiert sind.“ Was den Weg in eine nachhaltige, umweltfreundliche und zukunftsfähige Wirtschaft betrifft, so decken sich Jordaniens Klimavorhaben eng mit denen hierzulande. „Wir arbeiten“, so Botschafter Khouri, „bereits an grünen Wasserstoffprojekten, Solarenergie und Wassereffizienztechnologien.“
In diesen Bereichen gebe es ein immenses Potenzial für gemeinsame Innovation und Finanzierung. Diese Bereiche seien nicht nur Felder der Zusammenarbeit, sondern ermöglichten gemeinsame Investitionen in regionale Stabilität, Klimasicherheit und globale Wettbewerbsfähigkeit.
Zukunftsorientierte Reformen
Unter Führung von König Abdullah II. durchläuft das Land derzeit die umfassendsten Reformbemühungen seiner modernen Geschichte. Die langfristig angelegte Modernisierung umfasst politische und wirtschaftliche Reformen, die Stärkung des Parlaments, wirtschaftliche Modernisierung, Innovationen, Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Umgestaltung des öffentlichen Sektors hin zu mehr Transparenz, Effizienz und bürgernahen Dienstleistungen.
„Diese Reformen sind nicht oberflächlich oder ad hoc, sondern systemisch und zukunftsorientiert. In diesem Zusammenhang stimmt Amman auch Teile seiner beruflichen Reformagenda auf die Dynamik des internationalen Arbeitsmarktes ab, einschließlich des wachsenden Be-

anderem über den Global Disability Summit, welcher dieses Jahr in Berlin stattfand. Foto: BS/Isabell Leeser
darfs an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland.“
Dies eröffne einen für beide Seiten vorteilhaften Weg für Mobilitätspartnerschaften, Weiterbildungsprogramme und potenzielle Modelle für den Export von Arbeitskräften, die auf technischer Exzellenz und der Förderung junger Menschen beruhen. Was die konstitutionelle Monarchie in der Region einzigartig mache, sei nicht nur ihre Stabilität, sondern auch die Bereitschaft, sich von innen heraus weiterzuentwickeln – friedlich, institutionell und durch nationalen Konsens.
In den letzten 15 Jahren hatte das Land einen nachhaltigen und komplexen Schock durch den SyrienKonflikt zu verkraften. Vor 2011 war der Nachbar im Norden sein größter arabischer Handelspartner. Durch den Zusammenbruch des Assad-Regimes wurden die regionalen Versorgungsketten und die damit für den jordanischen Handel wichtigen Wirtschaftsströme zum Erliegen gebracht.
„Gleichzeitig hat sich die Sicherheitslage entlang unserer gemeinsamen, 375 Kilometer langen Grenze in den letzten Jahren verschlechtert und der Drogenhandel nahm stark zu. In den letzten sechs Monaten konnten wir eine Verbesserung in der Situation an der Grenze beobachten“, so Khouri. Zusätzlich habe das Land über 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge unterbringen müssen, was weiterhin eine enorme Belastung für seinen Staatshaushalt darstelle. Der Jordan Response Plan, der sich seit 2017 auf insgesamt 6,6 Milliarden US-Dollar beläuft, ist chronisch unterfinanziert. Jordanien schultere mehr als 63 Prozent der Kosten, was sechs Prozent des BIP und 25 Prozent der jährlichen Staatseinnahmen entspreche.
Tor zum Wiederaufbau Syriens Allein die Integration von Flüchtlingskindern in das Bildungssystem verschlinge 16 Prozent des nationalen Bildungsbudgets – eine Belastung, die weit über den globalen Normen liege. „Jordanien hat die Verantwortung als humanitäre Verpflichtung übernommen, als andere sich abwandten. Unsere Forderung nach einer erneuten, gerechten Lastenteilung ist nicht nur legitim, sondern dringend und ethisch geboten“, erklärt Khouri
Im Einklang mit den tiefen Beziehungen zwischen den beiden Völkern sei Jordanien bereit, eng mit den syrischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Stabilität der Grenzen wiederherzustellen, die regionale Zusammenarbeit zu verstärken sowie den Wiederaufbau und die
wirtschaftliche Erholung Syriens zu unterstützen. Jordanien ist in einer einzigartigen Position, um der internationalen Gemeinschaft dafür als Tor nach Syrien zu dienen. Damaskus liegt nur 90 Kilometer von seinem nördlichen Grenzübergang entfernt. Die zwei großen jordanischen Industriezonen King Hussein Bin Talal und Al-Thuraia bieten eine leistungsstarke Infrastruktur, eine optimierte Logistik und eigene Zollzonen. Neben der Infrastruktur bietet Jordanien auch die für den Wiederaufbau notwendige institutionelle Stabilität. Sein Bankensystem wird von der Weltbank als eines der stabilsten der Welt eingestuft.
„Wir bieten sichere Kapitalmärkte, zuverlässige Finanzdienstleistungen und ein berechenbares Investitionsklima“, konstatiert der Botschafter. „Unser Bausektor ist für den Einsatz gerüstet, verfügt über die am weitesten entwickelten Fertighaus- und Stahlbaukapazitäten in der Region und ist in der Lage, kostengünstig Schulen, Kliniken, Wohneinheiten
Rezept des Botschafters
Jordanischer Mansaf (4 Portionen)
und Krankenhäuser zu bauen.“ Mit Tausenden gut ausgebildeter Ingenieure, Architekten und Projektmanager, die bereits aktiv seien, biete man ein schlüsselfertiges Ökosystem für Unternehmen, die in großem Maßstab tätig werden könnten. Kurzum: Wenn die Welt es mit dem Wiederaufbau Syriens ernst meine, dann sei Jordanien der Partner dafür. Vor allem für Deutschland – das sich in den Bereichen humanitäre Hilfe und regionaler Wiederaufbau als führend erwiesen habe – biete Jordanien nicht nur geografischen Zugang, sondern auch Vertrauen, Infrastruktur und Visionen. Über 34 Jahre ist Fayiz Khouri nun im diplomatischen Dienst aktiv und dies nach wie vor sehr gerne. „Wenn ich nicht Diplomat geworden wäre, dann wohl Arzt. Doch auch dann wäre mein Credo gewesen: Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Wenn ich also ein Talent nennen müsste, das ich am meisten schätze, dann ist es die Fähigkeit, weiterzuarbeiten, egal wie schwierig der Weg ist.“
Im Jahr 2022 erkannte die UNESCO Mansaf als Teil des immateriellen Kulturerbes Jordaniens an. Eine wesentliche Zutat ist Jameed, ein fermentierter, getrockneter Joghurt aus Schafs- oder Ziegenmilch, der dem Gericht seinen charakteristischen säuerlichen Geschmack verleiht.
Zutaten: 2 kg Lammfleisch, in große Stücke geschnitten, 10 Kardamomkapseln,1 große Zwiebel, in Viertel geschnitten, 3 Lorbeerblätter, 2 EL Ghee (geklärte Butter)
Zutaten für den Reis: 3 Gläser Reis, 1/4 Tasse Ghee (geklärte Butter), 2 EL Salz, 1 TL Kurkuma, 4 1/2 Gläser kochendes Wasser.
Zutaten für Jameed: 1 kg Jameed, 2 Tassen Buttermilch/Joghurt, 10 Nelken, Kardamom, 2 EL Ghee, 1 l Lammfond, Fladenbrot. Mit gebratenen Nüssen/Mandeln/Pinienkernen servieren.
Zubereitung: Reis kochen. Das Fleisch zusammen mit der Zwiebel in einen Topf mit Wasser geben, aufkochen und den Schaum abschöpfen. Kardamom, Lorbeer und Ghee hinzufügen und zugedeckt 90 Minuten garen, abseihen und die Brühe beiseitestellen. Jameed in Wasser einweichen, bis es weich und flüssig ist und mit Joghurt im Mixer pürieren. Diese Mischung durch ein feines Sieb drücken, bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren erhitzen, ohne dass der Joghurt gerinnt. Danach die beiseitegestellte Lammbrühe zugeben und unter ständigem Rühren nochmals aufkochen. Dann das Lammfleisch hineingeben und bei schwacher Flamme erhitzen. In einer anderen Pfanne Ghee und Kardamom drei bis fünf Minuten lang sautieren und den Kurkuma mit der Sauce vermischen. 20 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Den Reis abgießen und bei mittlerer Hitze warmhalten, Ghee und Kardamom hinzufügen und fünf Minuten lang braten, Salz und Kurkuma dazufügen, umrühren und so viel kochendes Wasser hinzugeben, dass der Reis bedeckt ist.
Das Ganze zugedeckt 15 bis 20 Minuten bei schwacher Hitze kochen.
Das Fladenbrot auf ein großes Tablett legen, mit etwas Jameed-Sauce beträufeln und den Reis daraufgeben. Das Lamm darauf anrichten, mit gerösteten Mandeln und Pinienkernen garnieren und mit Jameed-Sauce servieren. Dazu passen Pilsner-Bier und ein trockener Rotwein.

Behörden Spiegel Berlin und Bonn / August 2025

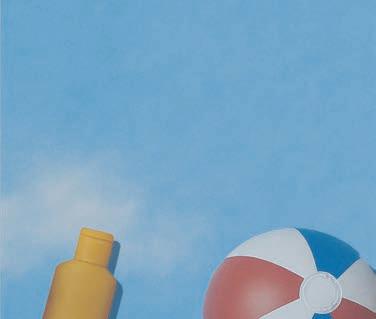

(BS/Anne Mareile Moschinski) Die Freibadsaison ist in vollem Gange. Doch nicht in jeder Kommune haben die Schwimmbäder geöffnet, Sanierungsstau und Personalmangel lassen das vielerorts nicht zu. Die Eintrittspreise sind bereits gestiegen, verbessert hat sich die Lage dadurch nicht.

Hochsommerliche Temperaturen, die Badetasche ist gepackt. Doch die Tore an der Schwimmbadkasse sind geschlossen und der Freibadbesuch muss an den nächsten Badesee verlegt werden. Gähnende Leere statt langer Besucherschlangen –dieses Szenario bietet sich in der aktuellen Freibadsaison in vielen Kommunen den Badegästen. Anfang Juli schrieben beispielsweise die Betreiber eines Nürnberger Freibads auf ihrer Webseite: „Der Worst Case ist eingetroffen.“ „Bei den heißesten Temperaturen des Jahres“ habe man das Freibad schließen müssen. Der Grund: technische Ausfälle, Sanierungsstau. Es habe schon lange vorher Vorbereitungen gegeben, um die aus dem Jahr 1967 stammende Badtechnik zu sanieren und Ausfälle zu vermeiden. Nun sei eine solche Situation trotzdem eingetreten.
Im Hamburger Bezirk Rahlstedt führte das örtliche Freibad in dieser Saison einen wöchentlichen Ruhetag ein. Als Grund nannten die Betreiber die Notwendigkeit, Personalengpässe auszugleichen: Im Falle einer Sieben-Tage-Öffnung bliebe den Mitarbeitenden keine Freizeit mehr. Ebenfalls wegen Personalmangels führte das Freibad im Essener Grugapark von Montag bis Freitag Schließzeiten in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein.
Einnahmen decken die Gesamtkosten nicht
Die Beispiele zeigen: Personalmangel und Sanierungsstau fallen den Freibädern vielerorts auf die Füße. Bereits in den vergangenen Jahren hat ein Großteil der Schwimmbäder die Eintrittspreise angehoben – seit 2020 im bundesweiten Durchschnitt um 20 Prozent. Die
Bewohner der Hauptstadt gehören zu den Badegästen, die mit am meisten Geld für eine Eintrittskarte bezahlen müssen. So verlangen die Berliner Bäderbetriebe in einigen Bezirken 7 Euro für einen Erwachsenen, in München sind die Preise mit 6,50 Euro für eine Erwachsenen-Eintrittskarte auf einem ähnlichen Niveau. In Hamburg müssen Badegäste 4,20 Euro berappen und Kinder unter zwölf können für 1,10 Euro die öffentlichen Freibäder nutzen. Auch wenn die Preise erhöht wurden, reichen die Einnahmen der Bäderbetriebe nicht aus, um die Gesamtkosten zu decken.
So stehen den Einnahmen der kommunalen Freibadbetreiber in Höhe von rund 108.000 Euro pro Jahr Gesamtkosten von 372.000 Euro gegenüber. Ohne staatliche Zuschüsse würde der Eintritt höher ausfallen und nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (GDfdB) bei elf Euro pro Erwachsenem liegen.
Hälfte der Schwimmbäder ist sanierungsbedürftig Dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass der Sanierungsbedarf steigt. Eine Erhebung der Förderbank KfW von Anfang 2025 zeigt: Jedes zweite Freibad in Deutschland hat einen nennenswerten oder sogar gravierenden Investitionsrückstand. Bereits jetzt droht jedem sechsten Freibad die Schließung. Um Abhilfe zu schaffen, legte die Bäderallianz Deutschland, der 15 Schwimmverbände angehören – darunter auch die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) – Anfang Juli einen bundesweiten Schwimmbadplan vor, der umfangreiche Investitionen vorsieht und eine zukunftsfähige Versorgung mit Schwimmbädern gewährleisten
soll. Die zentrale Forderung: Eine Milliarde Euro soll über einen Zeitraum von zwölf Jahren investiert werden. 700 Millionen Euro sollen pro Jahr als Zuschüsse für Neubau, energetische Sanierung, Digitalisierung und Substanzsanierung für Hallen-, Frei- und Kombibäder eingesetzt werden. 150 Millionen sind für den Bau und Betrieb von Spitzensportbädern vorgesehen, 100 Millionen für den Bau von Lehrschwimmbädern sowie 50 Millionen für die Förderung von bäderbezogener Forschung und Lehre.
„Es ist nicht verwunderlich, wenn die Eintrittspreise steigen.“
Ute Vogt, Präsidentin DLRG
Der Schwimmbadplan sei nötig, sagt auch DLRG-Präsidentin Ute Vogt: „Die Hälfte der Schwimmbäder in Deutschland ist sanierungsbedürftig.“ Die Kosten würden auch durch das Ringen um Personal in die Höhe getrieben. „Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn die Eintrittspreise steigen“, sagt sie. Bund, Länder und Kommunen müssten sich gemeinsam um die Bäderlandschaft kümmern, Versorgungslücken seien über den kommunalen Finanzausgleich zu schließen. Sonst trete folgende Situation ein: Immer mehr Badegäste weichen auf Seen und Flüsse aus – das sei mit Risiken behaftet. „Die Zahl der Badeunfälle wird dann womöglich
www.behoerdenspiegel.de


weiter ansteigen“, so Vogt. Rund 58 Prozent der Grundschulkinder können nach Angaben der DLRG beim Übergang in eine weiterführende Schule nicht sicher schwimmen, 20 Prozent können überhaupt nicht schwimmen. Niemand solle deshalb für einen Schwimmbadbesuch länger als 30 Minuten mit dem Auto unterwegs sein müssen. Derzeit gibt es laut dem „Bäderatlas“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen bundesweit rund 6.000 Hallen- und Freibäder. Dabei nimmt deren Zahl sukzessive ab: Nach einer Erhebung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) muss durchschnittlich alle vier Tage ein Schwimmbad schließen – 80 Bäder pro Jahr. Die wenigsten Schwimmbäder pro Kopf gibt es laut der IWAnalyse in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg, bundesweit am besten versorgt ist Thüringen. Schließung von bis zu 800 Schwimmbädern droht Den Investitionsbedarf der öffentlichen Schwimmbäder bezeichnet der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) ebenfalls als erheblich. In den nächsten Jahren drohe ohne Gegensteuern die Schließung von bis zu 800 Bädern. „Bereitstellung und Betrieb von Bädern gehören nicht zu den Pflichtaufgaben von Kommunen. Damit fallen solche freiwilligen Leistungen als erstes Sparzwängen zum Opfer“, erklärt DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger. Neben einer besseren Finanzausstattung der Kommunen durch umfangreichere Beteiligung an der Umsatzsteuer sei ein unbürokratisches Förderprogramm für kommunale Sportstätten mit einer pauschalen Bereitstellung von Mitteln nötig. „Damit könnten die Kommunen anhand
der tatsächlichen Bedarfe vor Ort direkt in die Sportstätten und Bäder investieren“, begründet Berghegger. Wie groß der Sanierungsstau der kommunalen Freibäder ist, zeigt auch eine im Juni veröffentlichte Umfrage des Verbands der kommunalen Unternehmen (VKU) unter 100 kommunalen Badbetreibern. Demnach sei mehr als ein Drittel der Freibäder hierzulande „umfassend sanierungsbedürftig“. Gegenüber 2024 ist dies ein Anstieg von drei Prozentpunkten. 35 Prozent der Befragten gaben an, dass in ihrem Freibad kleinere Reparaturen im Sinne von Ausbesserungen anstünden. 27 Prozent und damit mehr als jedes vierte Bad ist hingegen frisch saniert und damit gut in Schuss. Zu den Ergebnissen der Umfrage erklärte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing: „Sanierungen sind kein Luxus, sondern Voraussetzung dafür, dass unsere Bäder auch morgen noch für alle offenstehen.“ Bei der Frage, was einer umfassenden Sanierung entgegensteht, gaben die kommunalen Badbetreiber unterschiedliche Finanzierungsfragen an. Bei 88 Prozent waren die Fördermittel nicht ausreichend oder passten nicht zum Bedarf. Gestiegene Baukosten standen bei 79 Prozent einer Sanierung entgegen, 71 Prozent sehen den Finanzierungsbedarf durch höhere Zinsbelastungen erschwert. Die Bundesregierung müsse mit den Ländern für besser ausgestattete Förderprogramme sorgen, sagt Liebing. So unterstütze das Förderprogramm Sport, Jugend, Kultur (SJK) beispielsweise eher Leuchtturmprojekte als finanziell schwache Kommunen.„Aus unserer Sicht ist es sinnvoller, hunderte einfache Bäder zu sanieren als zehn neue Hochglanzbäder zu bauen.“
Behörden Spiegel: Welche Verantwortung trägt Ihr Amt bei der Planung und Umsetzung von Ferienangeboten, insbesondere in Bezug auf Inklusion und Teilhabe?
Stephan Glaremin: Das Amt für Soziales und Jugend der Landeshauptstadt Düsseldorf versteht die Planung und Umsetzung von Ferienangeboten als Teil seines Auftrags, allen Kindern und Jugendlichen in Düsseldorf, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten, sozialen Hintergründen oder besonderen Bedürfnissen, eine Teilhabe zu ermöglichen. 10.000 Kinder können an den Ferienangeboten innerhalb und außerhalb Düsseldorfs teilnehmen. Der durch das Amt gesteuerte Arbeitskreis Ferien dient dabei als zentrale Koordinierungsplattform, auf der Vertreterinnen und Vertreter des Amtes, der freien Träger und Verbände regelmäßig zusammenkommen, um aktuelle Themen und Entwicklungen zu besprechen und gemeinsam die Grundrichtung für ein bedarfsgerechtes Ferienprogramm festzulegen.
Insbesondere in Bezug auf Inklusion und Teilhabe ergreifen wir Maßnahmen, um Barrieren abzubauen, inklusive Angebote zu entwickeln und die Teilhabe zu fördern. Zudem arbeiten wir mit anderen Organisationen und Fachstellen zusammen, um sicherzustellen, dass die Angebote vielfältig, zugänglich und auf die Bedürfnisse verschiedener Gruppen abgestimmt sind. Wir wollen Chancengleichheit schaffen und gewährleisten, dass Ferienerlebnisse für alle Kinder und Jugendlichen bereichernd und inklusiv sind.
Behörden Spiegel: Wie gelingt es in Düsseldorf, ein Ferienprogramm zwischen kommunalen Akteuren und freien Trägern zu realisieren?
Glaremin: Eine abgestimmte und verlässliche Ferienplanung wird durch eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit aller relevanten internen und externen Akteurinnen und Akteure ermöglicht. Bedarfe, neue Entwicklungen und Herausforderungen werden gemeinsam erörtert und in jährlichen Zielvereinbarungen verbindlich festgehalten. So wird ein
Wie Angebote der Jugendarbeit richtig greifen (BS) Nicht jedes Kind freut sich auf die Ferien. Der Leiter des Düsseldorfer Jugendamts, Stephan Glaremin, spricht über Lösungsansätze, neue Kooperationen und die Notwendigkeit, junge Menschen auf Augenhöhe zu begleiten. Die Fragen stellte Julian Faber.

„Wir wollen gewährleisten, dass Ferienerlebnisse für alle Kinder und Jugendliche bereichernd und inklusiv sind.“
gemeinsames Verständnis für die Rahmenbedingungen und die Weiterentwicklung des Ferienprogramms über die gesamte Trägerlandschaft hinweg geschaffen.
Für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bietet das Online-Portal düsselferien.info, das vom Jugendring Düsseldorf bereitgestellt wird, eine zentrale Informations- und Buchungsplattform.
Behörden Spiegel: Welche strukturellen oder finanziellen Hürden begegnen Ihnen bei der Umsetzung eines sozial
gerechten Ferienangebots – und wie geht die Kommune damit um?
Glaremin: Sozial gerechte Ferienangebote erfordern eine gezielte Strategie, eine gute Koordination, eine inklusive Planung und die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Vor allem die Finanzierung sozial gerechter Ferienangebote ist eine Herausforderung, insbesondere wenn zusätzliche Ressourcen für Inklusion, spezielle Betreuung oder barrierefreie Infrastruktur benötigt werden. Hier ist eine gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und -partnern wichtig, um finanzielle Ressourcen zu bündeln.
Das Amt für Soziales und Jugend hat durch das Team Inklusion im Bereich Jugendförderung eine Stelle geschaffen, die vorhandene Angebote begleitet und ausbaut, durchführende Einrichtungen von Ferienprogrammen berät und sich stadtweit vernetzt, um Hürden zu überwinden.
Behörden Spiegel: Wie wird die Qualität der Angebote kommunal gesteuert und evaluiert – z. B. bei Sicherheit, pädagogischer Wirkung oder Zugänglichkeit?
Glaremin: Die Qualitätssicherung unserer Düsselferien-Angebote basiert auf verbindlichen Standards, die unter anderem eine tägliche Betreuungszeit von mindestens sechs Stunden, ein warmes Mittagessen sowie einen Betreuungsschlüssel von mindestens eins zu sieben vorsehen. Diese Standards gelten für alle Anbieterinnen und Anbieter gleichermaßen. Fragen der Sicherheit und Prävention werden im Arbeitskreis Ferien gemeinsam abgestimmt. Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, ein eigenes, an die Gegebenheiten angepasstes Notfallmanagement sowie ein Schutzkonzept zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt vorzuhalten. Außerdem werden die Ferienbetreuerinnen und -betreuer gezielt geschult, etwa durch Juleica-Ausbildungen, Einführungen in
die Aufsichtspflicht und Erste-Hilfe-Kurse.
Die pädagogische Wirkung der Angebote wird in den regelmäßigen Austauschformaten und Zielvereinbarungen reflektiert und weiterentwickelt. Zudem ist die Evaluation ein fester Bestandteil der Qualitätssteuerung. Die Angebote werden intern ausgewertet und verbessert. Die Angebote werden sowohl online über düsselferien.info als auch über die direkte Ansprache durch die Einrichtungen zugänglich gemacht.
Behörden Spiegel: Was würden Sie anderen Städten raten, die mehr Verantwortung für inklusive Ferienangebote übernehmen wollen?
„Inklusion sollte als langfristiger Prozess gesehen werden, der kontinuierlich weiterentwickelt werden muss.“
Glaremin: Um mehr Verantwortung für inklusive Ferienangebote zu übernehmen, sollten inklusive Konzepte frühzeitig entwickelt und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren gestärkt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen entsprechend fortgebildet werden. Gleichzeitig sollten die finanzielle und rechtliche Sicherheit vorhanden sein und die räumlichen Ressourcen bei Bedarf angepasst werden. Auch die Partizipation der Zielgruppe ist von hoher Bedeutung, ebenso die kontinuierliche Evaluation der Qualität der Angebote und das Anpassen an neue Gegebenheiten. Darüber hinaus ist es förderlich, die Gesellschaft durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Inklusion zu sensibilisieren, um mehr Akzeptanz zu schaffen. Inklusion sollte als langfristiger Prozess gesehen werden, der kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Hierfür ist eine offene Haltung wichtig. Also: Groß denken und klein anfangen!
… schaute ich mir einige Wahlplakate an, die immer mehr anlässlich der diesjährigen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen wieder das Straßenbild meiner Stadt bestimmen. Wer lässt sich heute noch durch Plakate beeinflussen? Ich erinnerte mich an meinen ersten Wahlkampf als Bürgermeister 2004. Bereits damals habe ich das Internet genutzt. Im Gegensatz zu Angela Merkel war es für mich nie Neuland.
Mein erster Wahlkampf im digitalen Raum
Kennen Sie noch das Online-Portal Wer-kennt-wen (WKW)? Es war das deutsche Facebook und wurde im Jahr 2006 gegründet. Bis dahin war die Welt der meisten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister noch analog. Sie war in Ordnung. Der Bürgermeister kam




mit der eigenen Bevölkerung auf dem Marktplatz ins Gespräch oder eben in der Bäckerei. Ich wagte 2009 den damals viel beachteten Schritt und war plötzlich im Sozialen Netzwerk WKW unterwegs und steuerte von dort –im Übrigen sehr erfolgreich –meinen zweiten Wahlkampf. Viele neue Portale sind zwischenzeitlich entstanden. Die Tageszeitungen verlieren immer mehr an Bedeutung. Immer weniger Menschen sind bereit, für Informationen Geld auszugeben. So bleibt Social Media heute oft als der einzige Weg übrig, um die Menschen zu erreichen.
Kommunikation in Krisenzeiten: Social Media als Lebensader Über die digitalen Plattformen werden Veranstaltungshinweise und amtliche Meldungen publi-
ziert. Social Media ist unverzichtbar für die Krisenkommunikation geworden. Gerade in Krisenzeiten –etwa bei Naturkatastrophen, Pandemien oder plötzlichen Sicherheitslagen – ist die schnelle und zielgerichtete Kommunikation entscheidend. Die Relevanz von Social Media in solchen Situationen zeigt sich in einer raschen Informationsverbreitung, Transparenz, Orientierung und das zeitnahe Reagieren auf Gerüchte und Sorgen. Menschen wenden sich in unsicheren Zeiten gezielt an Behörden und erwarten verlässliche Informationen. Es gibt immer weniger Menschen unter 25 Jahren – der demografische Wandel lässt grüßen. Im Wettstreit um die besten Talente ist professionelles Personalrecruitung essenziell.
kommen – Gott sei Dank – nicht mehr so häufig vor. Aber es fehlt ein Employer Branding.
Zwischen Behördengrau und digitaler Ansprache
Dass ein Beamtenjob ein sicherer Beruf ist, war sicherlich bereits in den 80er Jahren bekannt, weniger allerdings, wie interessant und sinnstiftend die Tätigkeit in einer Behörde sein kann. Junge Menschen denken da eher an graue Anzüge, noch grauere Akten und null Flexibilität. Das Ergebnis: Der wissbegierige Nachwuchs bleibt weg. Die Generation TikTok hat den Öffentlichen Dienst nicht einmal mehr auf dem Zettel.
will, findet man Gründe und keine Wege. So verkommt der Begriff Bestenauslese leider nur zu einem theoretischen Verfassungsgrundsatz, solange die Besten nicht den Eingang ins System erst gar nicht finden.
Professionelles Social Media-Recruiting ist ein unverzichtbares Werkzeug, um im Wettbewerb um junge Talente Anschluss halten zu können. Bund, Länder und Kommunen sind sicherlich bemüht. Die Versetzung ist (noch) nicht gefährdet. Mehr als ausreichend kann jedoch auf dem Zeugnis im Moment nicht stehen.
Foto: BS/privat
Nachwuchsmangel: Wie Social Media beim Recruiting hilft Trotzdem lassen sich insbesondere junge Zielgruppen über Social Media-Kampagnen ansprechen. Hier hat der Staat viel Nachholbedarf. Veraltete Bewerbungsverfahren in einem zeitraubenden System von bürokratischen Hürden
Die Herausforderung liegt darin, den Spagat zwischen der Ernsthaftigkeit öffentlicher Aufgaben und der lockeren und lustigen TikTokKultur zu schaffen.
Bund, Länder und Kommunen: stets bemüht
Die Qualität der Prozesse haben sicherlich noch viel Luft nach oben. Der Datenschutz wird häufig als Totschlagargument missbraucht. Wenn man eben nicht



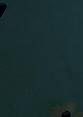








Behörden Spiegel: Wie verändert Social Media Ihren Berufsalltag? Sind Sie mittlerweile auch Chefkommunikator Ihrer Kommune?
Matthias Beer: Ja, absolut. Ich bin davon überzeugt, dass in Kommunen unserer Größenordnung – bei uns leben rund 5.900 Menschen –die gesamte Öffentlichkeitsarbeit maßgeblich über den Bürgermeister laufen muss. Natürlich kann die Verwaltung zuarbeiten, vorbereiten oder unterstützen, aber entscheidend ist, dass der Bürgermeister mit seiner eigenen Stimme spricht. Denn Kommunikation in den Sozialen Medien lebt von Authentizität, Persönlichkeit und direkter Ansprache. Die Menschen erwarten heute keine gesichtslosen Pressemitteilungen, sondern möchten ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter erleben – nahbar, verständlich, auch mal spontan oder humorvoll. Ich bin damit tatsächlich eine Art Chefkommunikator, weil ich bewusst entscheide, wie, wann und mit welchem Ton wir auf Ereignisse reagieren, Bürgeranliegen thematisieren oder Projekte vorstellen. Das geht auch mal in der Nacht mit einem schnellen Post vom Handy aus – dieser direkte Draht zur Bevölkerung ist unbezahlbar. Social Media ist für mich kein nettes Zusatzinstrument, sondern zentrales Element moderner Führungskultur in der Kommunalpolitik.
Behörden Spiegel: Muss die Verwaltung heute auf TikTok, Instagramm oder LinkdIn. präsent sein oder reicht der klassische Amtsweg?
Beer: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Obwohl ich auf TikTok eine gewisse Followerzahl habe, ist die Plattform mit gewisser Vorsicht
Zum 20. Jubiläum des vom sozialdemokratischen Magazin DEMO in Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) NRW organisierten Kongresses fand dieser erstmals nicht in Berlin, sondern in Duisburg statt. Eine symbolträchtige Wahl, liegt der Veranstaltungsort doch nicht nur im traditionellen Herzland der SPD, sondern auch im Wahlkreis der neu gewählten Parteivorsitzenden und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Als Brennglas bundespolitischer Herausforderungen bot das Ruhrgebiet eine authentische Kulisse für die drängendsten Fragen der Kommunalpolitik.
Von der Bremse zum Bauhelm
Bundesbauministerin Verena Hubertz gab einen energischen Impuls zum Bauturbo, der Schluss machen soll mit Genehmigungsstaus und veralteten Normen. Baustandards sollen vereinfacht, Umweltverträglichkeitsprüfungen einfacher übertragbar und Genehmigungen binnen zwei Monaten möglich werden – „damit wir endlich von der Bremse zum Bauhelm kommen“, so Hubertz. Hamburgs neuer Baustandard diene dabei als Vorbild. Auch eine Leerstandsstrategie und Wohnraummobilisierung wurden angekündigt.
Zugleich machte die Ministerin klar: „Wohnen ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Mieten müssen für jeden bezahlbar sein!“ Deshalb sei es richtig, dass die Bundesregie-
Interview mit Matthias Beer, Bürgermeister der Stadt Beratzhausen
Foto: BS/privat
Der TikTok-Bürgermeister
(BS) Die Prinzipien sind klar: Der Bürgermeister postet persönlich. Das ist authentisch. Social Media wird zum zentralen Element moderner Führung in der Kommune – auch ohen Pressestelle. Die Fragen stellte Julian Faber.

Mehr Präsenz auf Social Media – ein Instrument für mehr Authentizität und Bürgernähe? Foto: BS/FellowNeko, stock.adobe.com
zu genießen. Es kommt vor allem darauf an, was man erreichen will. Aufgrund der Algorithmussystematik ist der Streuverlust bei TikTok sehr groß. Die Einweihung der neuen Schule oder die Kommunikation des politischen Tagesgeschäfts sind hier sehr irrelevant. Dafür braucht man sich die Arbeit auf TikTok nicht machen, weil das den Zuschauer in 300 km Entfernung nicht interessiert. Mit meinem Account verfolge ich das Ziel, das Berufsbild des Bürgermeisters im Allgemeinen positiver zu besetzen oder Lust auf Kommunalpolitik zu machen. Da ist egal, ob das ein Bürger in Niedersachsen oder in meiner Heimat sieht.
Behörden Spiegel: Zwischen Bürgerdialog und Datenschutz: Wo ziehen
Sie persönlich die Grenze, was in Sozialen Medien gezeigt werden darf und was nicht?
Beer: Ich hab da eine abweichende Meinung zur Allgemeinheit. Wer sich auf Social Media bewegt, hat den Bedingungen der jeweiligen Plattform bereits zugestimmt – das gilt für die User genauso wie für mich als Absender. Ich stelle über meine Kanäle also lediglich zusätzlichen Content bereit – niemand wird gezwungen, ihn zu konsumieren.
Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, meine Social-MediaAktivitäten unter meinem Namen –also Matthias Beer – und nicht etwa als Rathaus-Account zu führen. Das schafft Spielraum, ermöglicht persönliche Kommunikation und
erlaubt mir, authentisch zu agieren – auch mit Humor, Haltung oder politischen Kommentaren. Das hat natürlich zur Folge, dass ich auf kommunale Ressourcen – wie etwa einen Pressereferenten oder eine Kommunikationsabteilung – nicht zurückgreifen kann. Aber gerade das halte ich für richtig: Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Es ist ein Unterschied, ob ein Bürgermeister als Person kommuniziert oder eine anonyme Verwaltung für ihn spricht. Natürlich gibt es auch bei mir Grenzen – zum Beispiel bei sensiblen, personenbezogenen Daten oder wenn es um Kinder geht. Hier agiere ich mit gesundem Menschenverstand, frage im Zweifel nach oder lasse lieber ein Foto weg. Aber insgesamt gilt für mich: Die digitale Öffentlichkeit ist Teil unserer Gesellschaft. Wer gestalten will, sollte sich ihr nicht entziehen – sondern sie souverän und verantwortungsbewusst nutzen.
Behörden Spiegel: Viele zögern beim Thema. Was raten Sie anderen Kommunen, die digital sichtbarer werden wollen?
Beer: Mein Rat lautet, einfach anzufangen. Niemand erwartet, dass Social-Media-Auftritte HochglanzNiveau haben. Wichtig ist, dass sie echt sind. Starten Sie mit einem Kanal, mit einfachen Infos aus dem
DEMO-Kommunalkongress erstmals in Duisburg
(BS/Julian Faber) Welche Bedeutung haben die diesjährigen Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen für die deutsche Sozialdemokratie? Zündet der angekündigte Bauturbo der Bundesregierung? Und wie kann die öffentliche Daseinsvorsorge gestärkt werden? Diese und weitere Fragen prägten den diesjährigen DEMO-Kommunalkongress.

Jochen Ott, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, skizziert die Strategie des kommenden Kommunalwahlkampfes. Foto: BS/Dietmar Meinert, SGK NRW
rung die Mietpreisbremse verlängert habe. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften müssten gestärkt und die Mittel der Städtebauförderung verdoppelt werden. „Die Kommunen sind die Werkstätten des Alltages.
Ihnen gebührt Respekt und Unterstützung – und darauf können sie sich verlassen“, versprach Hubertz Sozialstaat sichern
Bundesarbeitsministerin Bärbel
Bas stellte das Ruhrgebiet als Prüfstein für bundespolitische Lösungen heraus: „Hier zeigt sich, ob unsere
Antworten auf Strukturwandel, Migration, Wohnraumnot und Klimakrise funktionieren.“ Sie forderte ein klares Bekenntnis der SPD zum Sozialstaat – aber auch eine mutige Reformhaltung. Antragsprozesse sollen digitalisiert und entbürokratisiert werden. Statt strenger Einzelfallprüfungen plädierte Bas für Pauschalisierungen. Weiterhin prüfe ihr Ministerium aktuell Möglichkeiten zur Fusion bestimmter Sozialleistungen. Der noch bis Oktober tagende Sozialpartnerdialog zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften
solle den Weg zu flexibleren Arbeitszeitmodellen entwickeln, ohne dabei Nachteile für die Beschäftigten entstehen zu lassen.
In Richtung der Länder forderte Bas die konsequente Kompensation kommunaler Steuerausfälle und eine Lösung der kommunalen Altschuldenfrage: „Leistungsgesetze, die kommunale Kosten verursachen, müssen ausgeglichen werden.“ Zudem brauche es mehr Qualifizierung und Weiterbildung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Sanktionen für Totalverweigerer im Leistungsbezug müssten nachgeschärft werden. Nicht zuletzt sprach sich Bas für eine stärkere kommunale Perspektive auf Bundesparteitagen aus: „Wir brauchen die Stimme der Städte und Gemeinden auch in unserer strategischen Aufstellung –nicht nur auf Landesebene.“
Schwarz-Grün den Kampf ansagen Jochen Ott, Vorsitzender der SPDLandtagsfraktion NRW, begrüßte zunächst die Aufweichung der Schuldenbremse auf Bundesebene. Dies eröffne die Möglichkeit zur Modernisierung der kommunalen Infrastruktur. Doch: „Der Löwenanteil des Sondervermögens muss auch
Rathaus, mit kleinen Einblicken in den Alltag – dann entwickeln Sie sich Schritt für Schritt weiter. Ein Foto vom Schreibtisch oder vom Besuch des Wochenmarkts der Kommune oder von der reparierten Parkbank. Früher oder Später sollten sie sich aber selber eine Social-MediaStrategie geben. Einfach eine kurze Liste schreiben: Wie möchte ich authentisch draußen wahrgenommen werden? Was möchte ich dafür posten und was lasse ich lieber? Entscheidend ist, dass Sie die Verantwortung nicht einfach delegieren. Wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin selbst aktiv ist, hat das eine ganz andere Wirkung. Und: Haben Sie keine Angst vor Fehlern. Ja, es kann mal ein Tippfehler durchrutschen oder ein Shitstorm losgehen – aber das gehört zur digitalen Welt dazu. Viel schlimmer ist es, wenn Menschen das Gefühl haben, ihre Kommune spricht nicht mit ihnen. Sichtbarkeit schafft Vertrauen, gerade in kleinen Gemeinden. Und wer Vertrauen aufbaut, kann auch in schwierigen Situationen besser führen. Social Media ist kein Selbstzweck – sondern eine Chance, Demokratie im Alltag zu leben. Greifen Sie zu!



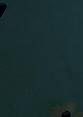
bei den Kommunen ankommen.“ Seine scharfe Kritik galt Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sich weigere, den kommunalen Verbundsatz zu erhöhen: „Die Sicherung der Kommunalfinanzen ist Kernaufgabe der Landespolitik“, stellte Ott klar. Vielerorts herrsche Frust über die Regierung in Düsseldorf, die von vielen als kommunalfeindlich wahrgenommen werde. Die SPD müsse diesen Unmut ernst nehmen und als „Regierung im Wartestand“ in aktive politische Mobilisierung übersetzen. Zur Kommunalwahl 2025 wurden personalisierte Wahlkämpfe, Haustürgespräche und eine klare Abgrenzung zu CDU und Grünen empfohlen. Gleichwohl Ott die AfD als „Feind der Arbeiter und Knecht der Kapitalisten“ kritisierte, dürfe man sich nicht in einem „alle gegen die AfD“-Narrativ verlieren. Stattdessen gelte es, den sozialdemokratischen Markenkern zu stärken: Gesellschaftspolitik, Vergemeinschaftung, soziale Sicherheit. „Wir müssen wieder stolz sein, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu sein“, lautete einer der Sätze, die in Duisburg besonders oft fielen. Eines hat der zweitägige Kongress eindrücklich gezeigt: Die zentralen gesellschaftlichen Konflikte unserer Zeit – von Wohnraum bis Migration, von Energie bis Arbeit – lassen sich nicht in Berlin oder Düsseldorf lösen. Sie werdem in den Rathäusern, Stadtteilen und Bezirken gelöst –dort, wo Politik konkret wird. Dort, wo der Alltag der Menschen ist.
Behörden Spiegel: Herr Tetzlaff, die kommunale Demokratie steht unter Druck. Wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen?
Sven Tetzlaff: Viele Kommunalpolitikerinnen und -politiker erleben aktuell Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar körperliche Angriffe. Die stärker werdende Polarisierung der Gesellschaft spiegelt sich in kommunalen Gremien wider. Extreme Gruppen nutzen sie gezielt zur Unterwanderung demokratischer Strukturen. Hinzu kommt die Komplexität von Verwaltung, die vielerorts Frustration erzeugt – bei Bürgerinnen und Bürgern wie bei den Beschäftigten. Wir sehen, dass sich ehrenamtlich Engagierte zurückziehen oder sich gar nicht erst zur Wahl stellen, weil sie die Belastung oder die Risiken scheuen.
Behörden Spiegel: Welche Auswirkungen hat das konkret?
Tetzlaff: Unsere Studien zeigen: Das Vertrauen in den Staat und die demokratischen Institutionen sinkt. Gleichzeitig schränken Finanznöte die Handlungsspielräume in den Kommunen ein. Weniger Geld und mehr Regulierung – diese toxische Mischung verwandelt die lokale Demokratie schleichend in eine Mangelverwaltung. Eine solche Entwicklung gefährdet die Bewältigung von Herausforderungen durch demokratische Entscheidungen vor Ort. Gerade ländliche Kommunen leiden darunter besonders.
Jane Möller: Diese Frustration spüren auch wir in der Verwaltungsarbeit. Viele Prozesse sind überreguliert, föderal zersplittert und zu wenig nutzerorientiert. Die Verwaltung kämpft mit Erwartungen, denen sie kaum gerecht werden kann – auch weil politische Entscheidungen oft keine Rücksicht auf Umsetzbarkeit nehmen. Dabei wollen die Mitarbeitenden ja gestalten, stoßen aber auf zu viele Hürden.
Behörden Spiegel: Was heißt das für die Verwaltungspraxis?
Möller: Wir sehen vielfach Prozesse, die eher um ihrer selbst willen existieren. Digitalisierungsinitiativen werden gestartet, aber nicht strategisch eingebettet. Der politische Wille fehlt, mutige Entscheidungen
Regelmäßig übersteigen die Temperaturen auch in diesem Sommer die 30-Grad-Marke, die Waldbrandgefahr ist hoch und hat in einigen Regionen bereits zu Feuerausbrüchen geführt. Die sich verändernden klimatischen Bedingungen stellen auch die Kommunen vor neue Herausforderungen. Doch wie gut sind Deutschlands Städte vor extremen Temperaturen geschützt? Das zeigt der Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe (DHU).
190 Städte mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurden dafür untersucht. Geschaut wurde dabei nicht nur auf die Städte insgesamt, sondern erstmals erfasste auch ein „Hitzebetroffenheitsindex“, wie viele Menschen innerhalb der Kommunen in stark belasteten Gebieten leben – dort, wo hohe Temperaturen, dichte Versiegelung und zu wenig Grün zusammentreffen.
28 Städte erhielten grüne Karte
Das Ergebnis: Mehr als zwölf Millionen Menschen sind an ihrem Wohnort einer extremen Hitzebelastung ausgesetzt. 31 Städte bekamen eine rote Karte, vor allem solche, die im Süden Deutschlands liegen, Ludwigshafen beispielsweise,
Wie Verwaltung handlungsfähig und bürgernah bleibt
(BS) Angriffe auf Ehrenamtliche, digitale Radikalisierung, lähmende Prozesse: Die Demokratie steht unter Druck, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Sven Tetzlaff von der Körber-Stiftung und Jane Möller von der MACH AG sprechen über Wege aus der Krise. Die Fragen stellten Guido Gehrt und Julian Faber.

Pluralismus, Partizipation und Deliberation: Demokratie muss sich auf ihren Kern besinnen, wenn sie tragfähig bleiben will. Foto: BS/Anat art, stock.adobe.com
zu treffen – etwa beim Vergaberecht oder bei der Abschaffung unnötiger Berichtspflichten. Vieles ließe sich schneller und effizienter gestalten, wenn man die Fachkräfte vor Ort stärker einbezieht und Standards praxisnäher definiert.
Tetzlaff: Stärkung von Effizienz ist auch ein Stichwort für die Arbeit der Stadt- und Gemeinderäte. Eine Zersplitterung in immer mehr Fraktionen und destruktive Anträge extremistischer Parteien lähmen Abstimmungen und Entscheidungsprozesse. Wir haben auch deshalb das Projekt „Respekt im Rat“ gestartet, um die Räte zu unterstützen, konstruktiver zu debattieren und sich aktiv gegen demokratiefeindliche Kräfte zu positionieren.
Die Verantwortung für die Sicherung der Demokratie darf nicht allein bei einzelnen Engagierten liegen.
Behörden Spiegel: Wie lässt sich verlorenes Vertrauen zurückgewinnen?
Tetzlaff: Vertrauen entsteht durch Kommunikation und aufsuchende Beteiligung. Politik und Verwal-
tung müssen sich den Menschen zuwenden – nicht über Social-Media-Bubbles, sondern durch echte Begegnung. Unsere kommunalen Initiativen laden Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zu Tischgesprächen ein, um gemeinsam den Ort, die Gemeinde oder die Stadt besser zu machen. Wer erlebt, dass er gehört wird und dass Vorschläge auch umgesetzt werden, gewinnt mehr Vertrauen in Verwaltung und Politik.
Möller: Und Verwaltung muss erklären, warum manches dauert. Prozesse verständlich zu machen, ist eine Führungsaufgabe. Bürgerinnen und Bürger akzeptieren Wartezeiten eher, wenn sie wissen, woran es liegt – und wenn sie merken, dass sich jemand kümmert. Gleichzeitig müssen wir intern eine Kultur etablieren, die Fehler zulässt, statt sie zu sanktionieren.
Behörden Spiegel: Wie kann Digitalisierung dabei helfen?
Möller: Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss konkrete Probleme lösen. Dafür braucht es verlässliche
Architekturen, effiziente Schnittstellen und rechtssichere Standards. Kommunen sind häufig auf sich gestellt. Dabei wäre ein einheitlicher Rahmen überfällig – zum Beispiel beim Zugriff auf Registerdaten. Besonders wichtig ist, dass sich Mitarbeitende mitgenommen fühlen und wissen, wofür die Umstellung dient.
Tetzlaff: Das ist ein wichtiger Punkt. Digitalisierung muss auch dazu führen, dass die Menschen Verwaltung als handlungsfähig erleben – nicht als zusätzlichen Hürdenlauf. Das gelingt leichter, wenn sie selbst mitgestalten dürfen. Beteiligung darf nicht als Feigenblatt genutzt werden, sondern muss verbindlich sein. Wir dürfen nicht nur Transparenz versprechen, sondern auch nachvollziehbare Entscheidungen liefern.
Behörden Spiegel: Was empfehlen Sie konkret?
Tetzlaff: Wir brauchen eine klare Haltung gegen Hass – durch Schutzkonzepte für Amts- und Mandatstragende, durch verbindliche Maßnahmen gegen extremistische Unterwande-
190 Städte im Hitze-Check
(BS/Anne Mareile Moschinski) Mehr Natur, weniger Beton – das fordert die Deutsche Umwelthilfe. In einer umfangreichen Analyse untersuchte sie, wie gut Kommunen für hochsommerliche Temperaturen gerüstet sind.

Insgesamt 190 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat die Deutsche Umwelthilfe einem Hitze-Check unterzogen, mehr als zwölf Millionen Menschen sind demnach einer extremen Hitzebelastung ausgesetzt. Foto: BS/Jenny Sturm, stock.adobe.com
Mannheim oder Worms. Hier leben 88 bis 91 Prozent der Bevölkerung in stark belasteten Gebieten. Marktplätze wurden hier ohne Bäume
angelegt und Schulhöfe komplett asphaltiert.
131 Städte erhielten eine gelbe Karte, lediglich 28 eine grüne. Un-
rung. Hier müssen Kommunen als System resilienter gemacht werden. Demokratie braucht auch eine gut finanzierte Daseinsvorsorge, Politik darf sich nicht schleichend aus dem ländlichen Raum zurückziehen.
Möller: Eine Kultur des Machens muss sich breit etablieren, in der verstanden wird, dass die 80- oder 90-Prozent-Lösung, die etabliert ist, mehr Wert ist als die 120-ProzentLösung, die aber nie zum Fliegen kommt. Und wir brauchen mutige politische Entscheidungen. Das Vergaberecht blockiert Innovation, viele Standards sind praxisfern. Kommunen müssen Spielräume bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Dafür braucht es Vertrauen – von oben nach unten und umgekehrt. Ohne dieses Vertrauen wird keine Strukturreform dauerhaft tragen.
Behörden Spiegel: Welche Rolle spielen dabei Verwaltungsmitarbeitende?
Möller: Eine entscheidende. Sie sind die Gesichter des Staates vor Ort. Aber sie brauchen Rückhalt –durch gute Führung, Weiterbildung und Beteiligung. Wir müssen auch intern über Kommunikationskultur sprechen: Wie gestalten wir Zusammenarbeit? Wie gehen wir mit Fehlern um? Das sind keine Randfragen – sie betreffen die Zukunftsfähigkeit der gesamten Organisation.
Tetzlaff: Verwaltung ist mehr als Organisation – sie ist Mitgestalterin. Wenn wir Demokratie stärken wollen, müssen wir auch die Bedingungen verbessern, unter denen sie vor Ort gelebt wird. Das heißt: weniger Komplexität, mehr Zusammenarbeit und vor allem: mehr Respekt. Wer heute eine starke Demokratie will, muss auch in die Fähigkeit investieren, sie praktisch zu füllen und umzusetzen.
ter den Städten mit grüner Karte sind vor allem Städte im Norden Deutschlands wie Flensburg, Wilhelmshaven oder Kiel. Doch auch dort sieht die Deutsche Umwelthilfe Handlungsbedarf. Denn hier wiesen einige Städte Versiegelungsanteile von über 45 Prozent auf, schreibt sie und fordert, dass in den kommenden Jahren verstärkt in Grünflächen investiert werden müsse.
Mit fortschreitender Klimakrise seien auch diese Städte künftig noch stärker von Hitze betroffen. Neue Vorgaben für das Baugesetzbuch gefordert
Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH, sieht den HitzeCheck als „Weckruf für Kommunal-, Landes- und Bundespolitik“. „Er zeigt klar auf, wo der Handlungsbedarf, Grünflächen zu schaffen, am dringlichsten ist“, erklärte sie. Ab sofort müssten die Begrünung von Städten sowie der Erhalt von



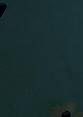
Bäumen ebenso priorisiert werden wie der Wohnungsbau oder der Erhalt jeder anderen Infrastruktur. Von den 34 Millionen Menschen in den untersuchten Städten seien 32 Millionen von mittleren und extremen Hitzebelastungen betroffen. Laut DHU sterben in Deutschland jedes Jahr rund 3.000 Menschen an den Folgen extremer Hitze. Daher seien verbindliche Mindestgrünanteile auf Grundstücken, Gebäuden sowie im öffentlichen Raum nötig und es müsse entsprechende Vorgaben im Baugesetzbuch und in den Landesbauordnungen geben. „Die Kommunen brauchen die notwendige finanzielle Unterstützung, um die Städte zu begrünen und für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen“, so Metz. Insgesamt müssten mehr Flächen entsiegelt sowie Fassaden und Straßen begrünt werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken legte im Juni drei neue Hitzeschutzpläne vor, um Bürgerinnen und Bürger besser auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitzewellen vorzubereiten. Damit wird der seit 2023 bestehende „Hitzeschutzplan Gesundheit“ um die Bereiche Sport, Apotheke und psychotherapeutische Praxen ergänzt.
Wie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bei einer Regierungserklärung Anfang Juli verlauten ließ, sollten die Handlungsstärke der Kommunen in drei Schritten verbessert und die Voraussetzungen für einen schnellen Investitionsbeginn geschaffen werden. Im ersten Schritt werde noch in diesem Sommer ein 600-Millionen-EuroSofortprogramm aus Landesmitteln zusammengestellt. Diese sollen über einen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 und '26 (jeweils 300 Millionen Euro pro Jahr) bedarfsorientiert verteilt werden. „Damit unterstützen wir die Kommunen entscheidend in einer herausfordernden konjunkturellen Lage“, so der Ministerpräsident.
Für Schritt zwei wird aktuell ein Sondervermögensgesetz entwickelt, welches die wichtigsten Zukunftsprojekte für Rheinland-Pfalz aus Bildung, Klima und Infrastruktur definiert. Unter anderem sollen Schulen und Kitas, eine Klima-Wald-Offensive, verbesserte Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung, aber auch Investitionen in Mobilität und Hochwasserschutz finanziert werden. Dies dient laut Schweitzer dazu, die 4,8 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen über die kommenden zwölf Jahre einzusetzen. Im dritten Schritt sollen noch in diesem Sommer weitere Bürokratieabbau-Maßnahmen umgesetzt werden, um die definierten Zukunftsprojekte schneller und digitaler auf den Weg zu bringen. Das Sondervermögen Infrastruktur soll vollständig digital verteilt werden. „Über die Sommerpause werden wir Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden über das Vorhaben einer Investitionsoffensive führen. Wir werden selbstverständlich ebenso, wie es in Rheinland-Pfalz gute Tradition ist, mit Gewerkschaften und der Wirtschaft sprechen. Nach den Sommerferien werden wir die Gesetzentwürfe im Kabinett beraten und sie im Herbst ins Parlament einbringen“, erklärt Schweitzer das weitere Vorgehen.
Gemischte Gefühle Nun gibt es zu dem Sofortprogramm und dem Zeitpunkt der Ankündigung unterschiedliche Meinungen. Mit voller Überzeugung steht die mitregierende Landesfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hinter der Ankündigung des Ministerpräsidenten. So sieht die Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Haushalt, Kommunen und Digitalpolitik, Pia Schellhammer, darin eine „beispiellose Investitionsoffensive“. Gemeint sind neben dem Sofortprogramm aber auch die 4,8 Milliarden Euro des Bundes. Gleichzeitig kritisiert sie auch die kommunale Seite: Damit die Mittel ihre Wirkung richtig entfalten könnten, brauche es auch eine leistungsfähige Verwaltungsstruktur, besonders vor Ort, wo die Projekte geplant und umgesetzt werden müssen. „Es kann nicht sein, dass die Kommunen auf der einen Seiten immer mehr Geld fordern und auf der anderen Seite nicht reformbereit sind, wenn es darum geht, auch die Kommunalstruktur an die Erfordernisse ihrer Zeit anzupassen“, ist Schellhammer der Überzeugung. Ralph Spiegler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (SPD), Vorsitzender des Gemeindeund Städtebunds Rheinland-Pfalz (GStB RLP) sowie Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), vertritt eine gespaltene Meinung. Für ihn haben Bund und Land mit den geplanten Maßnahmen wichtige Weichen für Städte und Gemeinden gestellt – damit sei es aber noch nicht getan. Zwar seien
Rheinland-Pfalz startet Soforthilfeprogramm für klamme Kommunen (BS/Scarlett Lüsser) Deutsche Kommunen klagen immer wieder über schlecht aufgestellte Haushalte und Finanzierungen: Zu viele Aufgaben werden ihnen von Bund und Ländern übertragen und zu wenig Geld zur Verfügung gestellt. Rheinland-Pfalz (RLP) möchte dies nun mit einer Investitionsoffensive für die eigenen Kommunen ändern. Das Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen soll mit 600 Millionen Euro Soforthilfe die angespannten Kommunalfinanzen verbessern.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (hier auf dem Kongress Digitale Verwaltung Rheinland-Pfalz des Behörden Spiegel) möchte die Voraussetzungen für einen schnellen Investitionsbeginn schaffen. Foto: BS/Bildschön
600 Millionen Euro eine gewaltige Summe, die auch zu einer Entlastung der Stadt- und Kreishaushalte führen werde, jedoch werde die Mehrheit der Städte, Gemeinden und Ortsgemeinden von den Mitteln nichts erhalten, da das Geld nicht in den kreisangehörigen Raum fließe. Spiegler ist sich sicher: „Die Soforthilfe lindert Symptome, löst aber keinesfalls die strukturelle Finanzkrise der Kommunen.“ Auch das Sondervermögen des Bundes sei ein „Hoffnungssignal für kommunale Investitionen“, jedoch sollten sich Kommunen darauf beschränken, in die „Kerninfrastruktur wie Schulen, Kitas, Sportanlagen und Feuerwehr zu investieren“. Der Digital-Only-Ansatz, den RLP in seinem dritten Schritt für die Auszahlung der Mittel anstrebt, sei längst überfällig. Zusätzlich dürften die Investitionen nicht mit bestehenden Fördermaßnahmen des Landes kollidieren und es bedürfe einer deutlichen Lockerung des Vergaberechts, erklärt Spiegler Für eine Sprecherin und den geschäftsführenden Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz, Michael Mätzig, ist es positiv, dass das Land das Problem der Kommunen erkannt habe und mit dem Sofortprogramm weitere Schritte einleite, allerdings kritisieren sie das Vorgehen des Landes insgesamt.
Kein wirklicher Befreiungsschlag Wie Mätzig aufschlüsselt, weise der Gesamthaushalt der Städte und Landkreise allein 2025 ein Defizit von über einer Milliarde Euro auf. Noch schlimmer sehe es im Teilbereich der Jugend- und Sozialhilfe aus, wo das Defizit bei mehr als drei Milliarden Euro liege. In diesem Punkt sind sich Städtetag und der GStB RLP einig: Es handele sich um eine Linderung aber keinesfalls um eine Behebung der kommunalen Haushaltsprobleme. Auch was die 4,8 Milliarden angeht, sind beide Organisationen einer Meinung. Doch der Städtetag RLP hinterfragt den Zeitpunkt der Regierungserklärung – und deren Hintergründe. Denn die katastrophale kommunale Finanzsituation habe einige Kommunen und Landkreise zu offiziellen Klagen gegen das Land gebracht, erklärt die Sprecherin des Städtetags. Erst Ende Juni – nur wenige Tage vor der Regierungserklärung – hatte die Stadt Pirmasens zusammen mit dem Städtetag RLP eine erneute
offizielle Klage gegen das Land beschlossen. Darin fordern sie, dass das Land die Kommunen finanziell so ausstattet, dass sie ihre Aufga-
ben erfüllen können – insbesondere diejenigen, die ihnen von Bund und Land übertragen wurden. So soll einer immer neuen Verschuldung
vorgebeugt werden. „Vor dem Hintergrund, dass die strukturellen Probleme der Städte – und damit insbesondere auch der Stadt Pirmasens – mit den vorgestellten Maßnahmen nicht gelöst werden können, wird die Stadt ihre Klage – auch stellvertretend für alle Städte im Land – weiter vorantreiben“, ergänzt die Sprecherin.
Kein Blatt vor dem Mund Der enge zeitliche Zusammenhang lege nahe, dass der Druck von kommunaler Seite doch hoch genug geworden sei, um das Land zum Handeln zu bewegen, ist Mätzig überzeugt. Besonders im Zusammenspiel mit den vom Ministerpräsidenten angekündigten Lockerungen bei der Kommunalaufsicht dränge sich Mätzig der Verdacht auf, dass durch die Maßnahmen „die Kommunen bis zur nächsten Landtagswahl ruhig gehalten werden sollen“. Seriöse und nachhaltige Finanzpolitik sehe anders aus und vom Konnexitätsprinzip fehle ebenfalls jede Spur. Daher richtet der geschäftsführende Direktor des Städtetags RLP klare Worte an die Landesregierung: „Die Kommunen sind keine Bettler, denen man je nach Kassenlage mal ein paar Almosen zuwirft. Wir sind die, die den Laden zusammenhalten und für Bund und Land die Arbeit erledigen.“ Dafür brauche es auch das nötige Geld – vollumfänglich und dauerhaft, ohne ständige Diskussionen oder politische Taktiererei.


Ob Kommunen oder kommunale Unternehmen: Wir fördern Ihre nachhaltigen Ideen rund um neue Energien.

Neugierig? Wir beraten Sie gerne persönlich.


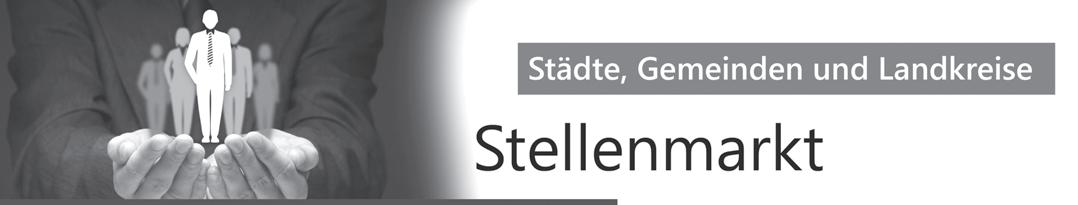
Für soziale Sicherheit und Gesundheit der Menschen in unserem Landkreis.

Das Sozialdezernat des Landkreises Reutlingen setzt sich aus dem Kreissozialamt, dem Kreisjugendamt und dem Kreisgesundheitsamt zusammen. Es verantwortet damit die Planung, Steuerung und Umsetzung sozialer Leistungen und Hilfen sowie als öffentlicher Jugendhilfeträger alle damit verbundenen Aufgaben. Im Dezernat wird zudem die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Reutlingen mit klarem Fokus auf innovative und nachhaltige Lösungsansätze für die Bürgerschaft vorangetrieben. Neben den beschriebenen Ämtern wird die Dezernatsleitung bei allen Aufgaben zusätzlich durch die Stabsstelle Planung und Steuerung unterstützt. Ob Kinderschutz, Familienhilfe, soziale Sicherung oder Gesundheit – Das Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt begleitet Menschen in allen Lebenslagen.
Im Zuge einer Altersnachfolge suchen wir zum 01.08.2026 eine kommunikationsstarke und umsetzungsorientierte
Leitung des Sozialdezernates (w/m/d)
Diese attraktive Stelle ist nach B2 LBesGBW besoldet. Angestellten (w/m/d) unterbreiten wir ein adäquates außertarifliches Angebot. Als Dezernatsleitung (w/m/d) sind Sie eine zentrale Schnittstelle zwischen dem Landrat, der Politik und den einzelnen Bereichen in Ihrem Dezernat.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Raza Hoxhaj oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Lt-Sozialdezernat_LK-Reutlingen_08-2025.indd
Stadtplanung als Balance zwischen Fortschritt und Heimatgefühl –Formen Sie die Zukunft der Stadt Marl

Die Stadt Marl an der Schwelle der Metropole Ruhr und des ländlichen Münsterlandes ist mit ihren rund 88.000 Einwohner*innen idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der beiden Regionen. Beeindruckende Industriekulissen und weitläufige Wälder, die sich weit in das Stadtgebiet erstrecken, bilden einen spannungsreichen Kontrast und verleihen Marl einen ganz besonderen Reiz. Das dichte Angebot an Museen und Musicals, Festivals und Freizeittreffs sowie eine einzigartige Kulisse mit Zeugen der traditionellen Industrie und Vorboten der Zukunftstechnologien machen das Ruhrgebiet zu einer spannenden und attraktiven Region. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir im Baudezernat der Stadtverwaltung Marl eine gestaltungsmotivierte Führungspersönlichkeit als
Sachgebietsleitung
Stadtplanung (w/m/d)
Als stellvertretende Amtsleitung und Sachgebietsleitung im Bereich Stadtplanung übernehmen Sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Entwicklung der Stadt. Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt nach Besoldungsgruppe A 14 LBesG NRW bzw. Entgeltgruppe 14 TVöD
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Sanny Martinez oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Übernehmen Sie Verantwortung für die Sauna-Kultur von morgen!

Der Deutsche Sauna-Bund e.V. mit Sitz in Bielefeld ist die größte Interessenvertretung der Saunabranche weltweit. Seit über 70 Jahren verfolgt der gemeinnützige Verband das Ziel, den Gedanken des Saunabades in Deutschland zu verbreiten und seine Mitglieder durch ein umfangreiches Dienstleistungsangebot zu beraten und zu stärken. Dazu gehören unter anderem das etablierte Qualitätssystem, das Erarbeiten von Richtlinien und Normen, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie ein marketingwirksamer Wettbewerbsvorteil für Saunabäder. Zusammengefasst engagiert sich der Verband aktiv für Gesundheit, Normung und Wirtschaftlichkeit –national wie international.
Zum 01.01.2026 suchen wir eine kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit als Geschäftsführung (w/m/d)
In dieser Funktion sind Sie sowohl Geschäftsführung (w/m/d) des Deutschen Sauna-Bundes e.V. als auch Geschäftsführung (w/m/d) der Sauna-Matti GmbH, deren Gesellschafter der Verband ist. Das Vertragsverhältnis ist unbefristet.
Freuen Sie sich auf ein hochqualifiziertes und motiviertes Team, das sich mit großer Leidenschaft für eine gesundheitsorientierte Saunakultur einsetzt. In diesem engagierten Umfeld erwarten Sie flache Hierarchien, Raum für eigene Ideen und eine Kultur des eigenverantwortlichen Arbeitens. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Alexander Wodara, Yanna Schneider oder Roland Matuszewski gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_GF_Saunabund_08-2025.indd 1
Als Interimsmanager*in schaffen Sie in kurzer Zeit einen Mehrwert.
23.07.25 15:13
Vieles ist aktuell in Bewegung. Der demographische Wandel fordert von öffentlichen Verwaltungen und kommunalen Unternehmen neue Herangehensweisen und Lösungsansätze für anstehende Aufgaben.
Für Kundenprojekte in allen Funktionsbereichen des öffentlichen Sektors suchen wir erfahrene und ambitionierte Persönlichkeiten als
Interimsmanagerin / Interimsmanager (w/m/d)
Als Interimsmanager*in übernehmen Sie bei unseren Kunden kurzfristig Verantwortung, um dringende Aufgaben und Projekte effizient und erfolgreich umzusetzen.
Was Sie mitbringen sollten:
Erfahrung: Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in verantwortungsvoller Position, idealerweise im öffentlichen Sektor oder in projektnahen Aufgabenstellungen.
Flexibilität: Bereitschaft, sich schnell in neue Themenfelder und Organisationen einzuarbeiten.
Kompetenz: Fundiertes Wissen in den Bereichen Verwaltung, Prozessoptimierung, Digitalisierung oder strategisches Management.
Persönlichkeit: Ausgeprägte Kommunikations- und Führungskompetenz sowie eine hohe soziale und interkulturelle Sensibilität.
Verfügbarkeit: Offenheit für zeitlich befristete Einsätze mit wechselnden Aufgabenstellungen.
Interessiert?
Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen unter der Rufnummer 0178 8894251 zfm-Geschäftsführer Edmund Mastiaux zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Verkehr neu denken. Ulm bewegen. Zukunft gestalten.
Mit knapp 190.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bildet die Universitäts- und Wissenschaftsstadt Ulm gemeinsam mit der benachbarten Stadt Neu-Ulm eines der länderübergreifenden Doppelzentren Deutschlands. Als wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum zwischen Stuttgart und München verbindet Ulm urbane Dynamik mit hoher Lebensqualität und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Die Abteilung Verkehrsplanung ist für rund 500 Kilometer Straßen und Wege im Ulmer Stadtgebiet verantwortlich. Sie übernimmt die strategische, planerische und wirtschaftliche Betreuung des Verkehrsnetzes, trägt aktiv zur Verkehrs- und Mobilitätswende bei und entwickelt die Stadt Ulm als lebenswerte und attraktive Stadt weiter.

Spätestens zum 01.04.2026 suchen wir eine innovative und gestaltungsmotivierte Persönlichkeit als
Die Position wird nach A 15 LBesGBW bzw. nach EG 14 TVöD vergütet. Die Stadt Ulm bietet ein vielseitiges Aufgabengebiet mit großem Gestaltungsfreiraum, flexible Arbeitszeiten sowie attraktive Zusatzleistungen – von vergünstigten Nahverkehrstickets bis hin zu Kultur-, Sport- und Essenszuschüssen.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Elisa Heinen oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Abtl-Verkehrsplanung_ulm_08-2025.indd 1
Mit Weitblick und Engagement gemeinsam die Zukunft von Steinheim am Albuch gestalten.

Mit rund 8.900 Einwohnerinnen und Einwohnern präsentiert sich Steinheim am Albuch als lebendige Gemeinde im Landkreis Heidenheim. Die sehr gute Infrastruktur, verbunden mit einer reizvollen und naturnahen Umgebung, schafft ideale Voraussetzungen für ein hohes Maß an Lebensqualität. Ein ausgeprägter Wohn- und Freizeitwert sowie zahlreiche Annehmlichkeiten für Einheimische und Gäste machen Steinheim zu einem Ort, der Lebensraum und Lebensgefühl harmonisch vereint.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine umsetzungsorientierte und praxisnahe Persönlichkeit als
Kämmerin / Kämmerer (w/m/d)
Die Position wird nach A 14 LBesO bzw. nach EG 13 TVöD vergütet.
Für die erfolgreiche Wahrnehmung dieser verantwortungsvollen und vielseitigen Tätigkeit in einer bürgerorientierten Verwaltung sind ein strategischer Weitblick, vernetztes Denken sowie Teamfähigkeit und ein überdurchschnittliches Engagement von zentraler Bedeutung.
Sie erwartet eine offene, wertschätzende Kommunikationskultur mit kurzen Entscheidungswegen sowie die Mitarbeit in einem engagierten und kollegialen Team. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Gianna Forcella oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
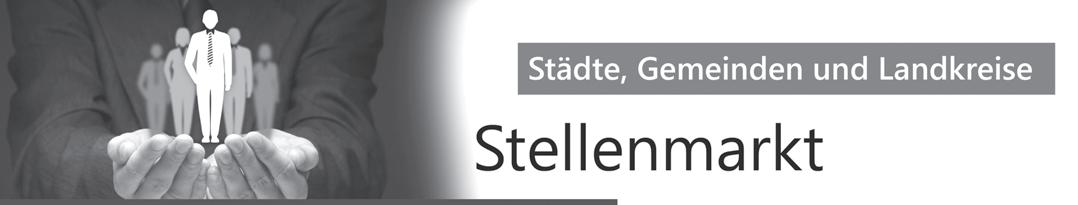
Zukunft aktiv steuern: Für einen starken, modernen und serviceorientierten Landkreis Lörrach.

Der Landkreis Lörrach mit rund 235.000 Einwohner*innen ist ein starker Lebensund Wirtschaftsstandort im Dreiländereck. Eine ausgezeichnete Infrastruktur, vielfältige Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie ein breites Kultur- und Freizeitangebot tragen zu einer hohen Lebensqualität bei. Die Nähe zu urbanen Zentren wie Basel, verbunden mit landschaftlichem Reiz, macht die Region besonders attraktiv – auch für Führungspersönlichkeiten mit Weitblick.
Das Landratsamt liegt mitten in der Innenstadt von Lörrach – eingebettet zwischen Weinbergen, dem Rhein- und Wiesental. Rund 1.500 engagierte Mitarbeitende setzen sich hier täglich für das Gemeinwohl ein. Sie gestalten aktiv die Zukunft der Region mit.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der Landkreis eine ambitionierte, gestaltungsmotivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als Dezernatsleitung für Finanzen, Zentrales Management und Bildung (w/m/d)
Die Position wird nach B 2 LBesGBW bzw. im Rahmen eines außertariflichen Vertrags vergütet.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Yanna Schneider oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung Anz_Dez-Finanzen_LK-Loerrach_08-2025.indd 1 23.07.25 16:07
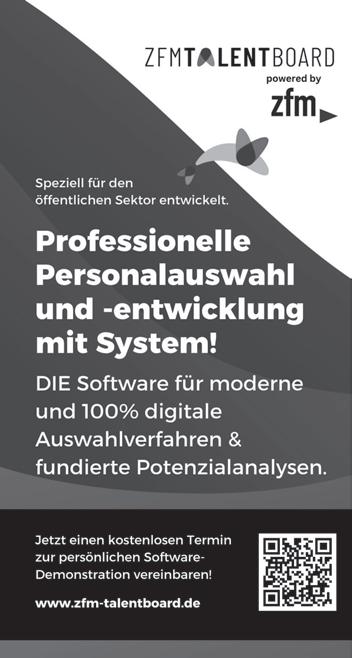
Wohnräume schaffen – Führungspersönlichkeit mit Visionen und Weitblick gesucht.

Die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH (Wohnbau) ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Koblenz mit rund 115.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Als hundertprozentige Tochter der Stadt leistet sie mit rund 60 engagierten Mitarbeitenden einen unverzichtbaren Beitrag zur sozialen Daseinsvorsorge: Ziel ist es, viele Menschen sicher und sozial verantwortungsvoll mit Wohnraum zu versorgen – bezahlbar und nachhaltig.
Neben der Bewirtschaftung und energetischen Sanierung des Wohnungsbestands steht der Wohnungsneubau im gesellschaftlichen Fokus. Die Umsetzung der Energieund Wärmewende im Gebäudebestand, die digitale Transformation sowie neue Förderlogiken stellen dabei ebenso aktuelle Aufgaben dar wie die ambitionierten wohnungspolitischen Erwartungen in einer wachsenden Stadt. Wir suchen möglichst zum 01.01.2026 eine erfahrene und gestaltungsmotivierte Führungspersönlichkeit als
Geschäftsführung (w/m/d) für die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Die Position ist als Vollzeitstelle ausgeschrieben und bietet attraktive gehaltliche Rahmenbedingungen. Die Bestellung erfolgt zunächst auf 5 Jahre. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Sanny Martinez, Raza Hoxhaj oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_GF_Koblenzer-Wohnbau_08-2025.indd 1
23.07.25 15:40

Planen, gestalten, umsetzen –Ihre Handschrift für Friedrichshafen Friedrichshafen – das bedeutet Leben, wo andere Urlaub machen. Als wirtschaftliches Zentrum steht Friedrichshafen für Dynamik, Lebensqualität und nachhaltige Stadtentwicklung. Rund 1.600 Mitarbeitende der Stadtverwaltung setzen sich hier täglich engagiert dafür ein, dass sich rund 62.000 Einwohnerinnen und Einwohner in ihrer Stadt wohlfühlen und entfalten können. Unser Amt für Stadtplanung und Umwelt ist dabei mittendrin: In den Abteilungen Stadtplanung sowie Landschaftsplanung und Umwelt gestalten wir nicht nur das Stadtbild, sondern das Lebensgefühl in Friedrichshafen – mit Blick auf heute, morgen und übermorgen. Gestalten Sie die Zukunft Friedrichshafens aktiv mit. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine strukturierte und umsetzungsorientierte Führungspersönlichkeit als Amtsleitung Stadtplanung und Umwelt (w/m/d)
Die Vergütung dieser unbefristeten Vollzeitstelle erfolgt nach Besoldungsgruppe A 15 LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 15 TVöD.
Mit einem klaren Blick für das große Ganze sind Sie nicht nur der kreative Kopf hinter smarten Stadtplanungskonzepten – wie der Neugestaltung der Uferpromenade oder dem Sanierungsgebiet „Zukunftsquartier Fallenbrunnen“ – , sondern setzen diese mit Umsetzungsstärke, Drive und Struktur erfolgreich um. Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Elisa Heinen, Sanny Martinez oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Stadt gestalten. Zukunft bauen. Gemeinsam für Königs Wusterhausen. Mit rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Königs Wusterhausen die größte Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald. Südöstlich der Bundeshauptstadt gelegen und in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg überzeugt die Stadt durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung in alle Richtungen. Königs Wusterhausen vereint die Vorteile urbanen Lebens mit hoher Lebensqualität, moderner Infrastruktur und einer naturnahen Umgebung. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine zielstrebige und entscheidungsfreudige Persönlichkeit als

Dezernentin * Dezernent Bauen und Stadtentwicklung (w/m/d)
Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Die Besetzung erfolgt zunächst als Führung auf Probe. Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 15 TVöD. Die Übernahme verbeamteter Bewerber*innen ist möglich.
Sofern ein unmittelbarer Wechsel aus dem öffentlichen Dienst erfolgt, kann die zuvor erworbene Stufe ganz oder teilweise anerkannt werden.
Die Stadt Königs Wusterhausen bietet Ihnen eine abwechslungsreiche und herausgehobene Position mit Gestaltungsspielraum und hoher Außenwirkung.
Interessiert?
Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Rebecca Engels oder Julia Schwick gerne zur Verfügung.
Lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte über die zfm-Jobbörse zukommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die Personalberatung für die Kommunalwirtschaft und die öffentliche Verwaltung
Anz_Dez-Bauen_Koenigs-Wusterhausen_08-2025.indd


Sind Sie bereit für die zukünftigen Herausforderungen der Mitarbeitergewinnung und -bindung?
Unser Weiterbildungsangebot:
Qualifizierung
Recruiting für den öffentlichen Sektor
Sie haben die Wahl:
Basis-Qualifizierung für Einsteiger (08.09. - 09.09.2025)
Aufbau-Qualifizierung für Fortgeschrittene (27.10. - 28.10.2025)
Online-Trainings zu Einzelthemen (Jeweils 1 Tag) Mehr Infos:
Jetzt zur Online-Info-Veranstaltung anmelden unter www.zfm-bonn.de
Die Digitalisierung zeigt in vielen Bereichen der kommunalen Verwaltung ihr Potenzial. Das gilt auch für die Wasserversorgung. Hier lassen sich durch den Einsatz moderner Technologien erhebliche Effizienzgewinne erzielen und personelle Ressourcen schonen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür liefert der Bereich der Wasserverbrauchserfassung.
Traditionell ist die Erhebung individueller Wasserverbräuche mit erheblichem personellem Aufwand verbunden. Bis vor wenigen Jahren war es Standard, dass Ableser von Kommunen die Haushalte aufsuchten, um die Zählerstände manuell zu erfassen. Diese Daten mussten anschließend händisch in das jeweilige Veranlagungssystem übertragen werden. Ein fehleranfälliger, zeit- und kostenintensiver Prozess.
Ein erster Schritt zur Automatisierung bestand darin, die Verbrauchsdaten dezentral durch die Bürgerinnen und Bürger selbst erheben zu lassen. Dabei erhielten sie per Post eine Ablesekarte, die sie eigenständig ausfüllen und zurücksenden konnten. Zwar reduzierte dieses Verfahren den Außendienstaufwand, doch musste die Verwaltung die Rückläufe weiterhin manuell erfassen. Eine vollständige Automatisierung war auf diesem Wege nicht erreichbar. Inzwischen nutzen Kommunen sogenannte Ablesekarten mit einem
Bürokratie wird allgemein beschrieben als „ein System zur Kontrolle oder Verwaltung eines Landes, eines Unternehmens oder einer Organisation“. Regulatorische Vorgaben dienen übergeordneten Zielen wie Rechtssicherheit, Verbraucherschutz, Marktstabilität oder dem Arbeits-, Gesundheitsund Umweltschutz. Doch konterkariert übermäßige und ineffektive Regulierung diese positiven Absichten, wenn sich Verwaltungsprozesse von ihrem praktischen oder strategischen Zweck lösen. Die Fülle an staatlichen Informations- und Dokumentationspflichten, gesetzlichen Regelungen und Vorschriften für deutsche Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Laut einer Untersuchung der Universität Wien summierte sich Anfang 2025 der Umfang auf 1.306 Einzelgesetze mit rund 39.536 Normseiten. Dies entspricht einem Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Jahr 2010. Mittlerweile führen Bürokratiekosten die Liste der negativen Standortfaktoren an, da sie sich auf die Kostenstruktur und die Produktivität und damit die Wirtschaftsleistung von Unternehmen auswirken. Das ifo-Institut schätzt die entgangene Wirtschaftsleistung deutscher Unternehmen durch direkte und indirekte Bürokratiekosten auf 146


In den meisten Städten und Gemeinden werden die Zählerstände direkt online eingegeben, in einigen hessischen Kommunen sind allerdings bereits digitale Funkwasserzähler im Einsatz. Foto: BS/Ton, stock.adobe.com
QR-Code, der per Smartphone zu einem benutzerfreundlichen Webportal führt. Hier können die Zählerstände direkt online eingegeben werden.
Qualitativer Technologiesprung durch digitale Funkwasserzähler
Das ist zwar schon eine deutliche Erleichterung, allerdings nur für die digital affinen Haushalte. Weil aber diese Online-Eingabe freiwillig ist, bleibt die Verwaltung weiterhin verpflichtet, die Daten derjenigen, die weiterhin analog zurückmelden, mit entsprechendem Aufwand manuell zu erfassen.
Ein qualitativer Technologie-
fangsgerät im Fahrzeug senden. Sie werden anschließend medienbruchfrei in das Abrechnungssystem übertragen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Alle Verbrauchsstellen werden sicher und einheitlich erfasst.
• Falsches Ablesen oder Eingabefehler durch Verbraucher entfallen vollständig.
• Undichtigkeiten und Rohrbrüche können frühzeitig auch unterjährig erkannt werden.
• Der Verwaltungsaufwand wird signifikant reduziert. Ein konkretes Beispiel liefert Bad Emstal. Die dort eingeführten Funkwasserzähler ermöglichen nicht nur eine präzise Verbrauchserfassung, sondern haben sich auch finanziell und operativ für die Gemeinde ausgezahlt:
• Rund 7.500 Euro an jährlichem Personalaufwand konnten eingespart werden.
lastung für die Gebührenzahler.
• Zudem entstanden bemerkenswerte Synergieeffekte: Die Kommune kombinierte die Fahrt zur Erfassung der Funkdaten mit der Sichtprüfung der Straßenbeleuchtung.
Doch Bad Emstal denkt bereits weiter: Künftig sollen auch Straßenzustände parallel erfasst werden. Mit im Dienstfahrzeug installierten Smartphones lassen sich Fahrbahnschäden registrieren, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) analysiert und klassifiziert werden. So wird die Wasserablesung zur Plattform für einen intelligenten kommunalen InfrastrukturCheck – ein Paradebeispiel für praxisnahe Digitalisierung im Sinne der Daseinsvorsorge.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Kommunalbericht 2024, Hessischer Landtag, Drucksache 21/1148 vom 11. Oktober 2024, S. 169 ff. Der vollständige Bericht ist kostenfrei unter https://rechnungshof.hessen.de abrufbar. Praxisnahe Digitalisierung und Daseinsvorsorge
sprung gelingt erst dort, wo digitale Funkwasserzähler zum Einsatz kommen. Einige Kommunen in Hessen haben bereits damit begonnen oder sind aktuell dabei, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen, turnusmäßigen Zählerwechsel auf diese moderne Technik umzurüsten. Die neuen Geräte ermöglichen es, die Verbrauchsdaten automatisiert per Funk zu übermitteln. Dies erfolgt ganz ohne Zutritt zu den Liegenschaften oder die Beteiligung der Bürger. Bei der sogenannten „Drive-by-Erfassung“ fährt das Erhebungsteam die Straßen systematisch ab, während die Funkzähler die Daten an ein Emp-
• Etwa 20 Leckagen und Rohrbrüche wurden aufgedeckt, bevor größere Schäden entstehen konnten – eine spürbare Ent-
Dr. Ulrich Keilmann leitet die Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof in Darmstadt.
Foto: BS/privat
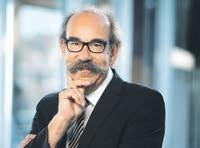
Regulatorische Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
(BS/Andreas Kolb/Prof. Dr. Diane Robers/Prof. Dr. Frank Walthes) Bürokratieabbau ist in aller Munde und staatliches Handeln mehr denn je notwendig. Wie können unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema – die der öffentlichen Hand und die der Unternehmen – zusammengebracht werden und welche Ansätze helfen bei einer strategischen Steuerung?
Milliarden Euro pro Jahr. In einer explorativen, branchenübergreifenden Erhebung an der EBS Universität betonten Befragte vor allem Widersprüche aufgrund verschiedener Regulierungsinstanzen sowie eine strukturelle Überlastung und Unstimmigkeiten zwischen sich überschneidenden Richtlinien und doppelten Berichtspflichten. Dies mündet in administrativen Redundanzen und behindert die operative Effizienz.
Regulierungsmaßnahmen häufig nicht ausgereift und praxiserprobt
Insbesondere die Versicherungsbranche, die als Querschnittsbranche eine Vielzahl von anderen Wirtschaftsbereichen berührt und unterstützt, gerade in ihrer Funktion als bedeutender Kapitalanleger, ist von verschiedenen Regulierungen betroffen. Der Finanzdienstleistungssektor ist auf EU- wie auf nationaler Ebene (wie zum Beispiel Solvency II) branchenspezifischen, sowie übergreifenden Regulierungen, wie der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder der Lieferkettenrichtlinie, unterworfen.
Allein die hohe Zahl an verschiedenen Regulierungsmaßnahmen, welche in sich auch häufig nicht ausgereift und praxiserprobt sind, führt zwangsläufig zu ineffizienten Doppelregulierungen und vielfach zu Regulierungswidersprüchen. Ein Regulierungsschwerpunkt auf EUEbene lag in den vergangenen Jahren auf dem sogenannten „Green Deal“. Dabei war der Grundgedanke – die Herstellung von Transparenz als Basis für Steuerungseffekte –sinnvoll.
Omnibus-Initiative soll Belastungen reduzieren
Kommission, Parlament und Rat haben von 2019 bis 2024 über 77 Rechtsakte mit ca. 10.000 Seiten Umfang auf den Weg gebracht. Zusätzlich wurden weitere, mit Cyberrisiken und digitaler operationaler Resilienz einhergehende regulatorische Verpflichtungen wie die neue Version der Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie (NIS2) oder DORA (Digital Operational Resilience Act) für den Finanzsektor geschaffen. Auch die europäische Verordnung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (EU AI Act) wird zusätzliche Berichtspflichten für Versicherungsunternehmen nach sich ziehen, da diese sicherstellen müssen, dass die Systeme ihrer IT-Dienstleister transparente und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und den ComplianceAnforderungen gerecht werden.
Die viel zu große Fülle an geforderten Einzeldaten in Verbindung mit einer Prüfungspflicht hat aber zu Recht hohe politische Widerstände hervorgerufen. Nun hat sich die Kommission in ihrer neuen Strategie für langfristige Wettbewerbsfähigkeit mit der sogenannten ersten Omnibus-Initiative das Ziel gesetzt, die mit den Berichtspflichten verbundenen Belastungen um 25 Prozent zu verringern. Vor allem die Berichts- und Sorgfaltspflichten sollen vereinfacht und damit auch der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Allerdings ist noch nicht ersichtlich, dass insbesondere für die Finanzwirtschaft eine wirkliche Entlastung zu erwarten ist. Echte marktwirtschaftliche Steuerungseffekte und damit verbundene Preissignale sind nur zu erwarten, wenn wenige aussagekräftige Datenpunkte wie z. B. konkrete CO2 Emissionen berichtet werden. Die Omnibus-Initiative geht diese konsequente Reduzierung leider nicht an. Stattdessen werden die Anstrengungen der Finanzinstitute weitgehend auf die bloße Erfüllung von überbordenden Berichts- und Prüfungspflichten gelenkt. Diese Ressourcen fehlen für strategische Initiativen und die Entwicklung neuer innovativer Ansätze. Die Kraft des Marktes wird damit nicht genutzt. Aus Sicht der Unternehmen sind deshalb eigene Effizienz- und Effektivitätschecks des Regulierers begrüßenswert. Denn die Verhältnismäßigkeit von Informationspflichten muss in Bezug zu deren Wirksamkeit hinsichtlich der beabsichtigten Zielerreichung gesetzt werden. Dabei sollten sowohl Zeitpunkt als auch Menge und damit die Verhältnismäßigkeit von neuen Regelwerken auf Basis ihrer Kosten (Effizienz) und ihrer intendierten Wirkung (Effektivität) vom Gesetzgeber kritisch überprüft werden. Die bürokratische Effizienz spielt eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Um bürokratiebedingte Kosten zu reduzieren und zielgerichtete
Prozesse zu gestalten, benötigen aber auch die berichtspflichtigen Unternehmen selbst strukturierte Ansätze, die über isolierte operative Maßnahmen hinausgehen. Bürokratische Anforderungen müssen als kontrollierbare Variable betrachtet werden. Mit einer fachlich übergreifenden „Expert Advocacy Platform" schlagen wir deswegen einen Weg vor, der Strategie, Regulierung und digitale Ausführung miteinander verbindet.

Andreas Kolb ist Finanzvorstand des Konzerns Versicherungskammer und u. a. für die Bereiche Kapitalanlage und -verwaltung, Controlling sowie Unternehmensplanung verantwortlich.
Foto: BS/Konzern Versicherungskammer

Prof. Dr. Diane Robers ist Professorin an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und leitet seit Oktober 2024 das Europa-Institut der EBS.
Foto: BS/S. Buff, Hans-Seidel-Stiftung

Prof. Dr. Frank Walthes ist Vorstandsvorsitzender des Konzerns Versicherungskammer und u. a. für die Bereiche Personal und Transformation, Organisationsentwicklung, Revision, Unternehmensrecht, Geldwäscheprävention und Compliance verantwortlich.
Foto: BS/Konzern Versicherungskammer
Die kommunale Wärmeplanung ist dabei zentraler Bestandteil der Bemühungen einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis ins Jahr 2045. Ohne sie sind die Ziele einer Reduktion von Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis zum Jahr 2030 nicht möglich. Die Informationen und Verfügbaren Heizmöglichkeiten, welche die kommunale Wärmeplanung dabei aufzeigen, bleiben vielfältig. Das kürzlich beschlossenen Wärmeplan der Stadt Aachen sieht zentrale Versorgungsmöglichkeiten wie Fernwärme oder die Verwendung von Abwärme und Geothermie vor. Daneben gibt es aber auch dezentralere Lösungen für eine nachhaltige Wärmeversorgung angewendet. Die Ergebnisse eines Wärmeplanes welche Heizmethoden wo sinnvoll sind dabei nicht verpflichtend. Der Wärmeplan liefert also einen Überblick was möglich ist.
Nicht für die Schublade
Die Erstellung eines Wärmeplans sei dabei für Kommunen eine große Herausforderung, äußerte sich Ingbert Liebing (CDU), Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), angesichts eines Gutachtens zu den unterschiedlichen Kosten der Wärmeoptionen. Er erinnerte daran, dass die Pläne nach Erstellung auch umgesetzt werden müssen und nicht nur in der Schublade verschwinden dürfen. Dazu müsse aber auch die Politik einen entsprechenden Markt- und Finanzierungsrahmen schaffen. „Andernfalls bleiben die kommunalen Wärmepläne insbesondere beim entscheidend wichtigen Wärmenetzausbau bloße Absichtserklä-
In der für den Oberschwellenbereich geltenden Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Architekten- und Ingenieurleistungen im Leistungswettbewerb zu vergeben sind (Paragraf 76 Absatz 1 Satz 1 VgV). Das bedeutet, dass im Anwendungsbereich dieser Vorschrift der Preis nicht das einzige und auch nicht das entscheidende Zuschlagskriterium sein darf. Die entsprechenden Aufträge sind stattdessen im Wesentlichen nach qualitativen Kriterien zu vergeben. Geltung bleibt bestehen Öffentliche Auftraggeber vertreten oft die Auffassung, dass diese Regelung für die Tragwerksplanung keine Geltung habe. Diese Leistungen seien eindeutig und erschöpfend beschreibbar; ein Leistungswettbewerb sei daher nicht angezeigt. Richtig daran ist lediglich, dass Paragraf 76 Absatz 1 Satz 1 VgV, der den Leistungswettbewerb statuiert, nur auf solche Architekten- und Ingenieurleistungen anwendbar ist, deren „Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann“ (Paragraf 73 Absatz 1 VgV). Eine Planungsaufgabe für Architekten und Ingenieure ist nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar, wenn mehrere verschiedene Lösungen dafür möglich sind. Maßgeblich für die Anwendbarkeit des Paragraf 76 Absatz 1 Satz 1 VgV ist also, ob den Planern ein Spielraum für ihre Kreativität verbleibt, innerhalb dessen sie die jeweilige Planungsleistung selbständig gestalten und die beste Lösung für die jeweilige Aufgabe auswählen können. Besteht ein solcher Freiraum, gilt Paragraf 76 Absatz 1 Satz 1 VgV, sodass die Leistungen im Leistungswettbewerb zu vergeben sind.
Vorantreiben der klimaneutralen Energieversorgung
(BS/sr) Im Juli hat auch die saarländische Gemeinde Blieskastel als erste saarländische Kommune ihren Wärmeplan veröffentlicht und befindet sich damit auf Kurs für die Deadline 2028 aus dem Wärmeplanungsgesetzes. Für Großstädte wie zum Beispiel Saarbrücken bleibt aber kein Jahr mehr, um ihre kommunalen Wärmepläne vorzulegen. Da alle Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern diese Pläne bereits schon 2026 vorlegen müssen.

Den Klimawandel nicht verschlafen! Eine effektive Wärmeplanung nutzt nicht nur Hausbesitzern. Foto: BS/olivierk5, pixabay.com
rungen ohne Aussicht auf konkrete Umsetzung“, erklärt Liebing
Kein Hin und Her mehr Ein Vergleich der Pläne verdeutlicht, dass Fernwärme nicht überall möglich ist. Diese Erkenntnis, überrascht wenig, denn wie bei der Energiegewinnung sind es die Umgebungsfaktoren, die darüber ent-
scheiden, welche Wärmeversorgung gut geeignet ist. Die Wärmeplanung schafft zunächt Klarheit. Dennoch fordern die Vertreter der Branche noch gesetzliche Anpassungen vonseiten der Politik, z. B. beim effektiven Einsatz der Fördermitteln. Laut einem von der Arbeitsgemeinschaft für Fernwärme (AGFW) und VKU erstellten Gutachten sollten in Ge-
bieten, in denen Wärmepläne zum Beispiel Fernwärme als beste Option ausweisen, keine Fördermittel mehr für Wärmepumpen gezahlt werden.
Tragende Länderrolle
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat als Koordinator eines gemeinsamen
Vergabe von Tragwerksplanungsleistungen
(BS/Katja Hennig) Oft werden öffentliche Aufträge über Leistungen der Tragwerksplanung allein nach dem niedrigsten Preis vergeben. Auftraggeber irren in der Annahme, dass dies wegen der Natur der Tragwerksplanung zulässig sei. Dies ist jedoch vollkommen sachfremd! Leistungen der Tragwerksplanung müssen grundsätzlich im Leistungswettbewerb vergeben werden!

Der Bau von Brücken ist keine reine Mathematikaufgabe, die es lösen zu gilt. Die Möglichkeiten bei der Planung und Umsetzung sind durchaus vielfältig. Foto: BS/hayoshka, stock.adobe.com
Nun nehmen Auftraggeber immer häufiger bei der Tragwerksplanung an, dass diese keinen Spielraum für verschiedene schöpferische Lösungen biete. Die Tragwerksplanung sei doch nur das Ergebnis einer „Rechenoperation“, so dass es dabei keine Leistungsunterschiede geben könne. Diese Annahme ist grundlegend falsch. Brückenbau ist kein reines Formelwerk Tragwerksplanung beschränkt sich gerade nicht auf reine „Rechenwege“, sondern ist eine hochkomplexe, geistig-schöpferische Planungsleistung. In ihrem Mittelpunkt stehen konzeptionelle Leistungen, die individuell und unter
Berücksichtigung zahlreicher technischer, funktionaler, ästhetischer und wirtschaftlicher Belange auf das jeweilige Projekt abzustimmen sind.
Folgerichtig führt die Verordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (HOAI) zahlreiche Grundleistungen zur Tragwerksplanung auf, die weit über bloße Rechenoperationen hinausgehen. Nur beispielhaft seien hier das „Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven
Dialogs einen Überblick über den aktuellen Stand. Es kommt dabei unter anderem zu dem Ergebnis: Die westlichen Bundesländer sind deutlich weiter mit der Erstellung der kommunaler Wärmepläne fortgeschritten. Ein Grund dafür ist die frühzeitige Verabschiedung von Landesgesetzen in einigen der westlichen Bundesländer. Die Entscheidungen der Länder leisten also einen wichtigen Beitrag, aber die Rolle der Länder in der ist nicht nur die Verabschiedung eines Landesgesetz.
Wärmeliniendichte
Schleswig-Holsteins Energiestaatssekretär Joschka K nuth (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, dass die Wärmewende der noch schlafende Riese des Klimaschutzes sei, weshalb das Flächenland die Kommunen bestmöglich bei derselben unterstütze. So stellt Schleswig-Holstein seinen Kommuen beispielsweise seit Juli eine Karte zur Wärmeliniendichte zur Verfügung. Die Karte liefert belastbare und differenzierte Daten über Wärmeverbräuche als Grundlage für die Wärmeplanung vor Ort. Knuth konstatierte: „Mi t dieser einheitlichen Datengrundlage erleichtern wir die Arbeit der Kommunen für die Wärmewende: Wir geben ihnen ein Werkzeug an die Hand, das ihnen Zeit sowie Ressourcen spart.“ Neben der Wärmeliniendichte-Karte wurden auch flächenscharfe Wärmebedarfe im 100-Meter-Raster sowie der Wärmebedarf pro Baublock berechnet und den Kommunen bereitgestellt. Diese Datensätze erleichtern auch Kooperationen im Planungsprozess zwischen den Kommunen.
Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart“ (Grundleistungen der Leistungsphase 2) oder auch das „Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung“ (Grundleistungen der Leistungsphase 3) genannt.
Da es sich bei der Tragwerksplanung um eine komplexe, kreative Leistung handelt, wird ihre Qualität wesentlich auch von der individuellen Kompetenz und Erfahrung der jeweiligen Planerin bzw. des jeweiligen Planers beeinflusst. Deshalb unterscheiden sich Lösungsansätze in der Tragwerksplanung zum Teil erheblich, beispielweise in Art und Menge der dafür zu verwendenden Baustoffe oder bzgl. der entstehenden Bauzustände.
Die Wahl des statischen Systems kann sich positiv, aber auch negativ auf die Realisierung des Bauvorhabens, seine Ästhetik und Funktionalität, die Kosten der Bauausführung oder auch den Wert des errichteten Objektes auswirken. Die Konzeption einer tragwerksplanerischen Lösung ist also entgegen einem leider weit verbreiteten Irrtum keine Leistung, die vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar wäre und daher allein nach dem Preis vergeben werden dürfte.
Qualität und Kosten
Im Übrigen widerspricht es auch den Interessen der Auftraggeber,
die Auswahl einer Tragwerksplanerin oder eines Tragwerksplaners allein am angebotenen Preis zu orientieren. Nur wenn bei der Vergabe dieser Leistungen auch qualitative Kriterien wie die Qualifikation und Erfahrungen der Bieter berücksichtigt werden, sind gute, qualitätsvolle Ergebnisse bei der Tragwerksplanung zu erwarten. Ein Vergabeverfahren für Planungsleistungen jedweder Art hat das Ziel, die besten Ideen für das Projekt einzukaufen. Die besten Ideen sind im Regelfall nicht mit dem geringsten Preis zu gewinnen. Zudem sehen immer mehr leistungsfähige Bieter davon ab, sich an Vergabeverfahren zu beteiligen, bei denen sich die Zuschlagsentscheidung ausschließlich am Preis orientiert. Sie sind – aus guten Gründen – nicht bereit, Angebote abzugeben, die „auf Kante genäht“ sind, sehen aber mit einem wirtschaftlich kalkulierten Angebot keine ausreichenden Chancen auf den Zuschlag, wenn dieser allein nach dem niedrigsten Preis erfolgt. Nach Überzeugung der Ingenieurkammer-Bau NRW ist es also unter allen Gesichtspunkten stets angezeigt, bei der Vergabe von Leistungen der Tragwerksplanung neben dem Preis in der Mehrzahl qualitative Aspekte für den Zuschlag zu berücksichtigen.

Katja Hennig ist seit rund acht Jahren im Rechtsreferat der IngenieurkammerBau NordrheinWestfalen tätig. Dort verantwortet sie unter anderem die Themen Honorar- und Vergaberecht. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für die von der Kammer eingerichtete Honorar- und Informationsstelle. Foto: BS/Christian Holthausen
Online-Plattformen wie „Canngo“ oder „Dr. Ansay“ nutzen eine Gesetzeslücke und hebeln die eigentliche Intention der Auslagerung des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) aus. Über diese können sich Konsumentinnen und Konsumenten von der Couch aus mit dem begehrten Stoff versorgen. Nur wenige Klicks genügen. Die Diagnose für das Arzneimittelrezept kann sich der Patient nach eigenem Gusto selbst ausstellen. Die Lieferung landet nur wenige Tage später direkt in seinem Briefkasten. Die Szene hat die neue Bezugsmöglichkeit adaptiert: Im ersten Quartal 2025 wurden 37 Tonnen Cannabis und damit 29 Tonnen mehr als im ersten Quartal 2024 für medizinische Zwecke importiert – eine Steigerung von über 360 Prozent. Der neuen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) missfällt der Missbrauch des medizinalen Cannabis als Konsumcannabis: Dieses sei „nicht für den normalen Konsum gedacht, sondern nur für Menschen, die es wegen schwerwiegender Erkrankungen gesundheitlich brauchen.“ Sie möchte die medizinische Integrität wieder stärken, um Missbrauch zu verhindern.
Striktere Reglementierung
Ende Juli legte das Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf vor, der auf eine Neuausrichtung des medizinischen Cannabismarktes abzielt. Im Zentrum steht die Absicht, die ausufernde Praxis der Online-Verordnungen ohne persönlichen Arztkontakt einzudämmen.
Zentrale im Entwurf enthaltene Maßnahmen sind die Pflicht zu einem persönlichen Arztkontakt vor der Erst- und Folgeverschreibung sowie das Verbot des Versandhandels von Cannabisblüten. Diese dürfen nach dem Entwurf nur noch nach pharmazeutischer Beratung in Präsenzapotheken abgegeben werden. Verstöße sollen als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.
Der Gesetzesentwurf polarisiert.
Während Apothekerverbände, konservative Landespolitiker und Teile der Ärzteschaft die Reform als notwendige Rückbesinnung auf medizinische Standards begrüßen, äußern sich Patientenvertretungen, Branchenverbände und Teile der Opposition kritisch. Die Bundesvereinigung Deutscher
Welchen Weg geht Deutschland beim Cannabis?
(BS/lm) Wenn sich der geneigte Cannabis-Connaisseur in der Vergangenheit dem Rauschmittel seiner Wahl hingeben wollte, blieb ihm nur der Weg zum Dealer seines Vertrauens. Dies sollte das Cannabisgesetz (CanG), das seit April 2024 in Kraft ist, ändern. Die Legalisierung zielte unter anderem darauf, den Schwarzmarkt zu schwächen und nicht-profitorientierte Strukturen für den legalen Bezug zu fördern. Doch es hat in den letzten Monaten eine weitere Bezugsquelle bei den Konsumenten deutlich an Beliebtheit gewonnen.
Apothekerverbände (ABDA) sieht in der Reform einen Schritt hin zu mehr Professionalität und warnt vor dem Missbrauchspotenzial einer zu laxen Verordnungspraxis. Auch die Bayerische Staatsregierung fordert eine noch engere medizinische Indikationsprüfung.
Gegner des Entwurfs, darunter der Branchenverband der Cannabiswirtschaft (BvCW), kritisieren hingegen die Pauschalität der Maßnahmen. Besonders das Versandverbot gefährde seriöse Anbieter und treffe vulnerable Patientinnen und Patienten – etwa mobilitätseingeschränkte Personen oder solche in strukturschwachen Regionen. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Grünen, Linken und FDP befürchten, dass Patientinnen und Patienten wieder auf den Schwarzmarkt gedrängt werden könnten – mit Risiken für Gesundheit und Rechtsstaatlichkeit.
Gesundheitliche Warnsignale
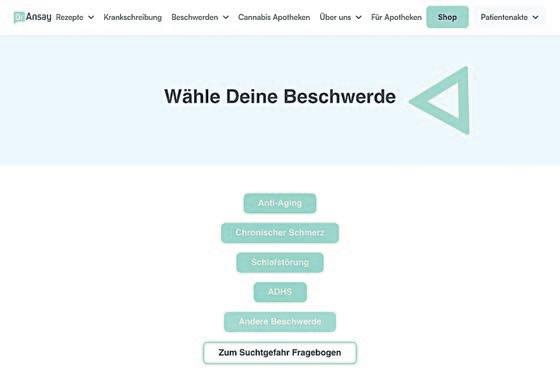
Parallel zur politischen Debatte häufen sich medizinische Warnungen zu den Folgen der Legalisierung. Der Anstieg des Konsums seit 2024 bleibt nicht folgenlos. Laut Daten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) wurden im vergangenen Jahr über 250.000 Menschen wegen cannabisbezogener psychischer Störungen behandelt – ein Plus von 14,5 Prozent. Besonders betroffen sind junge Erwachsene zwischen 25 und 29 Jahren.
Suchtfachstellen und Therapieeinrichtungen berichten von vermehrten Anfragen. Die Bundesärztekammer und zahlreiche Fachverbände fordern eine Kehrtwende: Cannabis sei ein Arzneimittel mit psychotropem Potenzial – dürfe nicht wie ein Lifestyle-Produkt behandelt werden. Die aktuell erleichterte Rezeptausstellung ohne persönliche Diagnostik begünstige problematischen Konsum und Abhängigkeit.
In Fachkreisen wird vereinzelt bereits die Rückführung von Medi-
Bei Online-Plattformen wie Dr. Ansay können die Kundinnen und Kunden ihre vermeintlichen oder realen Gesundheitsbeschwerden selbst wählen, um an das benötigte Rezept zu kommen. Die Betreiber beteuern zwar, dass die Rezepte letztendlich von Medizinern ausgestellt würden, ein direktes Gespräch zwischen Arzt und Besteller findet aber nicht statt. Screenshot: BS/Mahnke
zinalcannabis ins Betäubungsmittelgesetz diskutiert – ein Schritt, der die politische Liberalisierung massiv zurückdrehen würde.
Die wirtschaftliche Perspektive Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung in der Cannabisbranche steht unter Druck. Unternehmen wie Cantourage, Cannamedical oder Semdor Pharma hatten stark in Telemedizin und Online-Vertrieb investiert. Der Markt wuchs rasant, allein 2024 lag das Importvolumen bei 73 Tonnen – ein Plus von über 460 Prozent. Die niedrigschwellige Rezeptangebote befeuerten den Konsum.
Sollte das neue Gesetz wie geplant in Kraft treten, prognostizieren Branchenverbände einen Markteinbruch. Bis zu 70Prozent der Anbieter könnten verschwinden. Auch
europäische Produktionsbetriebe, die den deutschen Markt beliefern, würden erheblich betroffen. Dennoch gibt es differenzierte Stimmen: Einige Anbieter begrüßen die geplante Rückkehr zu einem stärker medizinisch ausgerichteten Markt als Chance für langfristige Professionalisierung. Doch eines ist klar: Der Cannabisboom der letzten Monate war auch ein Ergebnis regulatorischer Lücken. Die angekündigten Gesetzesänderungen markieren eine Zäsur – mit offenem Ausgang für Versorgungssicherheit, Marktstruktur und Innovationskraft.
Kommunale Überforderung
Während auf Bundesebene über Leitlinien und Marktregulierung gestritten wird, spielt sich die praktische Umsetzung der Legalisierung
auf kommunaler Ebene ab – vor allem in den Ordnungsämtern. Doch genau dort zeigen sich besonders deutliche Risse im System. Die Verantwortung für die Kontrolle der Besitzmengen und der Einhaltung der Abstandsregeln zu Schulen und Kindergärten sowie die Genehmigung von CannabisClubs liegt bei den kommunalen Ordnungsbehörden. Viele berichten von massiver Überlastung, unklaren Zuständigkeiten und unzureichender technischer Ausstattung. Ein Beispiel ist die rechtlich verankerte 100-Meter-Abstandsregel. In der Praxis ist diese kaum mess-, geschweige denn kontrollierbar. Sichtbezüge zu sensiblen Orten lassen sich oft nicht eindeutig dokumentieren. Hinzu kommt der Mangel an Personal und Ausrüstung: In vielen Kommunen fehlen geeichte Waagen, Schulungen und klare Vollzugshinweise. Mancherorts, etwa in Niedersachsen oder Berlin, ist bis heute nicht abschließend geklärt, welche Behörde für die Genehmigung und Überwachung von Anbauvereinigungen verantwortlich ist. In Berlin haben alle zwölf Bezirks-Ordnungsämter explizit erklärt, nicht zuständig zu sein für die Genehmigung und Kontrolle von Cannabis-Anbauvereinigungen. Sie lehnen die Zuständigkeit ausdrücklich ab und fordern klare Landesregelungen. Anträge auf Anbaugenehmigungen werden zwar entgegengenommen, in der Praxis aber nicht bearbeitet –sie werden „ruhender Weise“ liegen gelassen.
Anspruch und Wirklichkeit Trotz aller Widrigkeiten gibt es auch lokale Lösungsansätze: Städte wie Lüdenscheid investieren in Schulungen, neue Ausrüstung und gezielte Präventionsarbeit. In Köln setzt man auf enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Ordnungsdienst und Gesundheitsbehörden. Dennoch bleibt die Lage angespannt: Viele Kommunen sehen sich mit der Umsetzung des Bundesgesetzes alleingelassen. Die Schere zwischen politischen Ansprüchen und praktischen Möglichkeiten öffnet sich immer weiter. Ohne zusätzliche Ressourcen, klare Verantwortlichkeiten und praxistaugliche Vorgaben droht die Legalisierung ansonsten auf der letzten Meile bei den kommunalen Vollzugsbehörden zu scheitern.





Behörden Spiegel Berlin und Bonn / August 2025





(BS/Christian Brecht) Seit März dieses Jahres ist Alexander Pröll Österreichs Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, den Öffentlichen Dienst sowie für die Koordinierung und den Kampf gegen Antisemitismus. In der österreichischen Botschaft in Berlin verriet er, was Deutschland in Sachen Digitalisierung von der Alpenrepublik lernen kann – und umgekehrt.
Anfang des Jahres war Pröll noch Generalsekretär der regierenden Österreichischen Volkspartei (ÖVP), seit März ist er Staatssekretär und u. a. verantwortlich für Digitalisierung. Die Kombination mit dem Aufgabenfeld Öffentlicher Dienst zeigt den Stellenwert, den die Verwaltungsdigitalisierung auch in Österreich hat und macht Pröll zum Pendant von Deutschlands Digitalminister Dr. Karsten Wildberger (CDU) – seines Zeichens auch für Staatsmodernisierung zuständig.
„Wir wollen in die Top 3 Europas.“
Alexander Pröll, Österreichs Staatsekretär für Digitalisierung (ÖVP)
Dementsprechend trafen sich die beiden zum Austausch in Berlin. Eines der Kernthemen seien dabei die digitalen Identitäten in beiden Ländern gewesen.
Starke Nutzungszahlen
Der zentrale Identitätsschlüssel in Österreich heißt ID Austria, eine Kombination aus elektronischem Identitätsnachweis (eID) und LoginPlattform für Verwaltungsservices. 3,9 Millionen Nutzende verzeichnet ID Austria aktuell, was 42 Prozent der österreichischen Bevölkerung entspricht. Eine Quote, von der Deutschland nur träumen kann –was neben der ausbaufähigen Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern auch daran liegen könnte, dass die genannten Funktionen hierzulande aufgesplittet sind:

32 Millionen Deutsche haben derzeit den nPA („neuer Personalausweis“) mit eID-Funktion aktiviert, es nutzen ihn allerdings nur 22 Prozent davon, was letztlich acht Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Für das zentrale digitale Nutzerkonto BundID sind wiederum rund fünf Millionen Deutsche registriert, was sechs Prozent der Bevölkerung entspricht. Nicht zuletzt ist die ID Austria auch von Unternehmen nutzbar, wohingegen es in Deutschland das begrifflich abschweifende „Mein Unternehmenskonto“ gibt. Irgendwas Öffentliches Hinzu komme „die Aufgabenzerfaserung über die föderalen Ebenen“, wie Münchens IT-Referentin und CDO Dr. Laura Dornheim (Bündnis 90/Die Grünen) jüngst im Behörden Spiegel-Interview auf dem grünen Sofa beim Digitalen Staat erzählte. Kein Mensch wolle sich Gedanken machen, ob er mit der Kommunalverwaltung, dem Land oder dem Bund kommuniziere, so Dornheim: „Die Leute wollen irgendwas Öffentliches und das soll funktionieren.“ In Sachen Konsolidierung und Kommunikation kann sich Deutschland von seinem Nachbarn südlich der Alpen also etwas abschauen. Pröll sieht indes keine Konkurrenzsituation, der Vergleich mit Deutschland oder anderen Nationen habe keine Priorität. Vielmehr wolle er „von Best Practices anderer Staaten lernen“. Der Staatssekretär denkt europäisch und sucht, wenn überhaupt, die kontinentalen Referenzen: Bis 2030, also zum Ende der von der EU ausgerufenen Digital Decade (siehe Grafikseite 23, Anm. d. Red.), wolle Österreich „in die Top 3“ Europas. Laut DESI (Digital Economy and Society Index) rangiert es

www.behoerdenspiegel.de



derzeit Platz neun. Um aufs Treppchen zu kommen, müsste das Land an den skandinavischen Staaten und an den Niederlanden vorbei, die in der fortlaufenden digitalen Europameisterschaft momentan die vorderen Plätze belegen.
Die jüngste Digital-Decade-Auswertung bescheinigt Österreich Fortschritte bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) und bei der Konnektivität, dazu starke Leistungen bei digitalen Kompetenzen und gezielten Maßnahmen zur Überbrückung struktureller Lücken. Auch bei der Digitalisierung des Öffentlichen Dienstes schneidet das Land gut ab. Nachholbedarf gibt es bei der Einführung von Hochleistungsnetzwerken (VHCN) und dem Glasfaserausbau (FTTP).
Noch mehr Services verknüpfen Ein Schlüssel, um digital weiter aufzuholen, liegt für Pröll darin, möglichst viele elektronische Bürgerdienste zusammenzufassen. Die ID Austria sei „eine Reise, die wir jährlich adaptieren werden“, so der Staatssekretär. Perspektivisch soll die ID Austria noch enger mit der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), der österreichischen Variante der hiesigen elektronischen Patientenakte (ePA), zusammengeführt werden. Im Rahmen eines nächsten Relaunchs sollen eine verpflichtende Befundübermittlung durch Labore und Radiologen, die Einführung der „Patient Summary“ (eine kurze Übersicht aller relevanten Gesundheitsdaten) sowie die digitalen Medikationspläne „DigiMed“ hinzukommen. Ein anderes Beispiel für digitale Konsolidierung liefert Pröll mit der Dienstleistung Wohnsitzummeldung: Es sei sinnvoll, im Zuge dieses Prozesses auch gleich weitere



externe Services wie den Internetanschluss oder den Stromanbieter auswählen zu können.
Vorbild GovTech Campus Neben den Gesprächen mit Digitalminister Wildberger und Bundeskanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) machte sich Pröll ein Bild von den deutschen IT-Dienstleister SAP und der Schwarz-Gruppe sowie vom GovTech Campus. Die 2021 gegründete Plattform, die staatliche Akteure und IT-Unternehmen zusammenbringt und für Innovationen in der Verwaltungsdigitalisierung sorgen soll, habe ihn überzeugt – auch als Vorbild für sein Heimatland. Insbesondere was die spezifische Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Verwaltung angehe, könne „Österreich von Deutschland lernen“, so Pröll. In Österreich gingen in den nächsten 13 Jahren 44 Prozent des Verwaltungspersonals in Pension – der drohende Fachkräftemangel ist dementsprechend auch dort ein großes Thema.
Harte Pflichten für VLOPs Apropos KI: Die EU plant in den nächsten Jahren europaweit mehrere KI-Gigafactories, um die Forschung an Künstlicher Intelligenz voranzutreiben und eigene, europäische KI-Lösungen zu entwickeln. Als Standort für eine dieser Gigafactories (extrem leistungsfähige Rechenzentren) habe sich die Stadt Wien beworben, erklärt Pröll. Dahinter steckt der Wunsch nach mehr digitaler Souveränität auf nationaler wie kontinentaler Ebene. Bei Rechenzentren und Cloud-Strukturen ausschließlich auf die ressourcenstarken US-Anbieter zu setzen, wird nicht nur in Österreich kritisch betrachtet. Pröll spricht sich für einen vernünftigen
„Mittelweg aus Hyperscalern und eigenen Lösungen“ aus sowie dafür, in der Digitalisierung möglichst viel zentral zu steuern: „Als ÖVPPolitiker bin ich Föderalist, in der Digitalisierung bin ich Zentralist.“ Kein rein österreichisches, sondern ein globales Problem ist die Abhängigkeit insbesondere junger Menschen von Sozialen Medien und Apps „in unfassbarer Dimension“, wie Pröll es formuliert. Hierbei ist der Staatssekretär „tendenziell für eine Altersbeschränkung“ von Online-Plattformen mit jugendgefährdenden Inhalten. In Australien etwa ist Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren erlaubt. Es brauche bei diesem Thema eine europäische Lösung und „harte Verpflichtungen für VLOPs“ (Very Large Online Platforms). Diese müssten etwaige Altersüberprüfungen gewissenhaft durchführen.
„Es braucht einen vernünftigen Mittelweg aus Hyperscalern und eigenen Lösungen.“
Derweil steht für Pröll das Tagesgeschäft in der Heimat an: Im Rahmen der österreichischen Verwaltungsreform erarbeitet er in der Arbeitsgruppe „Verfassung und Verwaltungsbereinigung“ derzeit konkrete Maßnahmen. Diese sollen bis spätestens Ende 2026 spürbar sein – und nebenbei ein weiterer Schritt zu dem Ziel, die digitale Dekade erfolgreich abzuschließen.
Behörden Spiegel: Frau Dr. Goll, Sie sind als Tochter eines Ingenieurs aufgewachsen. Gibt es Schlüsselerinnerungen oder -erlebnisse, die ihre Faszination für Technologie geweckt haben?
Dr. Frauke Goll: Absolut. Mein Vater ist super begeistert bei allem, was Innovationen anbelangt und ich hatte schon früh die Gelegenheit, mit ganz neuen Fahrzeugen und Technologien in Berührung zu kommen. Als ich zum ersten Mal ein Navigationssystem im Auto sprechen hörte, das fand ich schon cool. Es war auch noch in einem Erlkönig, man konnte das Fahrzeug von außen also nicht richtig erkennen. Wir hatten auch früh einen Laptop zu Hause und ich habe daran Tetris gespielt. Also ja, Technologie war bei uns schon an der Tagesordnung.
Behörden Spiegel: Jetzt sind Sie Managing Director am appliedAI Institute. Wieviel in Ihrem Alltag ist tatsächliches Management und wie nah sind Sie an den technologischen Entwicklungen dran?
Goll: Zunächst bin ich auf jeden Fall Unternehmerin. Ich trage die Verantwortung für das Unternehmen, für unsere Mitarbeitenden, aber auch für die Themen. Für tiefe Entwicklung fehlt mir oft die Zeit. Trotzdem versuche ich, ganz eng mit unseren Entwicklern an den Inhalten dranzubleiben. Insofern ist es für mich ein Zusammenspiel von Technologie, Innovation und den vielfältigen Aufgaben, die ich als Managing Director habe. Essenziell ist am Ende des Tages, dass wir ein AI-first-Unternehmen („KI-zentriertes Unternehmen“) sind.
Behörden Spiegel: Was ist mit „Human first“? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Lösungen menschenzentriert und verantwortungsvoll funktionieren?
Goll: Der Themenkomplex Trustworthy AI („Vertrauenswürdige KI“) umfasst rechtliche Fragestellungen, hat einen großen technologischen Anteil, aber natürlich auch ethische Fragestellungen. Es geht nicht nur um die reine Entwicklung, sondern auch um die Anwendung der Technologie. Da ist die menschliche Komponente mit drin, also die Fra-
Ideen sprudelten. Alle verstanden, worum es geht. Die Aufbruchstimmung wirkt noch nach. Und das, obwohl sie sonst DesignThinking-Formaten eher skeptisch gegenübersteht und eigentlich gar nicht gerne teilnehmen wollte. Aber dann ist Montag. Jetzt will Rosi es wirklich versuchen. Doch der Schreibtisch ist voll. Deadlines rücken näher. Die Routine ist zurück, die Zwänge sind zurück, „Alles ist möglich“ muss sich in diesen Alltag einfügen können. Der Blocker „Neue Wege denken“ wandert und wandert weiter im Kalender, immer in Sichtweite am Horizont, bis ein dringlicherer Termin Vorrang bekommt. Es vergehen Wochen, ohne dass neue Wege Thema sind. Nur noch der bunte Stapel Post-its erzählt davon.
Das appliedAI Institute und souveräne KI für Europa
(BS) Dr. Frauke Goll gehört zur Doppelspitze des appliedAI Institute for Europe, einer gemeinnützigen Organisation mit dem Ziel, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz in und aus Europa voranzutreiben. Im Gespräch mit dem Behörden Spiegel erklärt sie, wie digitale Selbstbestimmung im Kontext von KI aussehen kann, welche Rolle der Öffentliche Dienst dabei spielt und wie Ihr Vater ihren beruflichen Werdegang prägte. Das Interview führte Christian Brecht.

fördernde Umsetzung notwendig, um auch die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen. Gleichzeitig muss die öffentliche Verwaltung ein Multiplikator sein, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch bei Förderprojekten. Wir versuchen deshalb, auf allen Ebenen mit der Politik zu arbeiten: kommunal, regional, aber auch national und sehr eng mit dem EUAI Office sowie der Europäischen Kommission.
Behörden Spiegel: Welche KI-Projekte in der öffentlichen Verwaltung begeistern Sie zurzeit?
„Es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren.“
Dr. Frauke Goll, Managing Director des appliedAI Institute, glaubt an das Potenzial europäischer KI-Lösungen. Foto: BS/appliedAI Institute for Europe gGmbH Behörden
gestellung, wie wir als Menschen eigentlich mit der Technik interagieren. Für mich ist das Spannende, Disziplinen zusammenzubringen, eine gemeinsame Sprache aufzubauen und Verständnis zu schaffen. Das spiegelt sich auch bei uns am Institute wider: Wir haben Juristen, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Data Scientists und Ingenieure, die mit einem holistischen Blick verantwortungsbewusst auf das Thema Künstliche Intelligenz schauen und sicherstellen, dass wir menschenzentrierte KI sowohl in der Entwicklung als auch in der Anwendung vorantreiben.
Behörden Spiegel: Welche Unternehmensform hat das appliedAI Institute und wie ist es mit der Welt der Politik vernetzt?
Goll: Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Mir ist wichtig, dass wir als neutraler Partner wahrgenommen werden, der hochqualitatives Wissen zur Verfügung stellt. Wenn wir uns das KI-Innovationsökosystem ansehen, haben wir auf der einen Seite Wirtschaftsunternehmen und Start Ups, mit denen wir arbeiten. Wir haben die Wissenschaft, denn wir sprechen von hochinnovativen Technologien. Ein ganz wesentliches Feld ist das der Politik und der öffentlichen Verwaltung, welches vielfältige KI-Räume bietet. Im Zuge der Staatsmodernisierung müssen wir technologisch schneller vorankommen. Es ist aber auch die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu gestalten, beispielsweise durch die Implementierung des EU AI Acts. Hier ist eine innovations-
Goll: Es gibt diesen wunderbaren Marktplatz für KI-Projekte im öffentlichen Bereich, der auch einsehbar ist. Das finde ich richtig klasse. Wir müssen aus den Pilotprojekten herauskommen, hin zu Skalierung und wirklicher Anwendung. In den meisten Bereichen sehen wir Fragestellungen rund um Bots, Textzusammenfassung usw. Ich persönlich finde es toll, wenn KI für soziale Bereiche eingesetzt wird. Welche Möglichkeiten es beispielweise gibt, Blinden zu helfen, sich noch besser in der Umgebung zurechtzufinden als mit einem Blindenstock. Ein ganz tolles Projekt, das KI nutzt, ist auch Off Road Kids (Hilfe für Straßenkinder und obdachlose Jugendliche, Anm. d. Red.) . Im Rahmen der Social Impact Republic unterstützen wir daher Gründerteams dabei KI-Technologien für soziale Innovationen einzusetzen.
Warum Kulturwandel manchmal länger dauert
(BS/Dr. Konstanze Schlegelberger) Für den Moment war alles möglich, fand Rosi, langjährige Führungskraft in der Verwaltung. In der interessanten Gruppe, die sich schnell gefunden hatte, mit Führungskräften aus unterschiedlichen Bereichen, mit Serious Lego und Wänden voller Post-its. Alle hatte die Frage bewegt „Was braucht Verwaltung, um ihre Mitarbeitenden binden, bewegen, begeistern zu können?“
Behörden Spiegel: Die viel beschworene digitale Souveränität ist ohne KI kaum denkbar. Was bedeutet der Begriff für Sie und glauben Sie, dass ein digital souveränes Europa bei der technologischen Übermacht von China und den USA realistisch ist?
Goll: Wir schauen immer gerne nach links und nach rechts, vergleichen uns mit den anderen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren. Selbstverständlich gibt es gerade in den USA sehr hohe Investitionssummen. Im Rahmen des „EU AI Continent Action“ Plans wurden aber auch hier seitens der Politik neue Summen angekündigt. Die Gigafactories zeigen, dass die EU nachziehen möchte und verstanden hat, dass Infrastruktur ein wesentliches Element ist. Auch Start-Ups brauchen gute Möglichkeiten, in Europa ihr Potenzial vollständig zu entfalten. Wir bringen einmal im Jahr eine „KI-Start-Up-Landscape“ heraus. Letztes Jahr hatten wir rund 690 KI-Start-Ups in Deutschland. In diesem Sommer ist der Launch der KI-Start-Up-Landscape 2025 und ich kann schon mal ein bisschen spoilern: Es wird abermals einen Anstieg geben.
Behörden Spiegel: Wie sieht Ihre utopische KI-Zukunftsvision aus, wie ihre dystopische – und wie Ihre realistische?
Goll: Science-Fiction-Autoren, Regisseure und Co haben uns schon viele – oft dystopische – Bilder in den Kopf gesetzt. Das ist tatsächlich auch wichtig, um aktiv dagegenzuarbeiten. Die Utopie ist, dass wir das Potenzial erkennen, wie KI uns helfen kann, gesellschaftliche Themen tatsächlich zu lösen. Jetzt die realistische Variante: Ich glaube, wir haben ganz schön viele Schritte zu tun. Wir müssen darüber aufklären, was die Technologie tatsächlich kann. Wo sind gute Einsatzfelder, was kann KI aber auch nicht? Wir müssen einen guten Umgang mit KI als Tool entwickeln. Wenn wir das hinbekommen, werden wir durch die Anwendung von KI-Technologien ganz viel Potenzial, Effizienz und Möglichkeiten haben. Es wird unser Leben noch mal reicher machen.
Wieso Ideen auf Widerstand stoßen – und danach der Knoten platzt
Diese Geschichte ist erfunden –und gleichzeitig Realität für viele Führungskräfte in deutschen Verwaltungen. Egal ob Kommune, Land oder Bund: Es gibt unzählige
Komplexes Netz aus Prozessen Währenddessen fängt eine neue Kollegin im Team an. Nach wenigen Tagen meldet sie sich zu Wort, ob man einmal über die Abläufe sprechen könnte: Einiges daran fände sie irritierend kompliziert, das ginge doch einfacher? Für Rosi ist diese Beobachtung lästig, sie wirft Abläufe durcheinander, wo der Zeitdruck hoch ist. Wenn es einfacher ginge, würde man es einfacher machen, erklärt sie langsam und geduldig. Man habe es mit einem komplexen Netz aus ineinandergreifenden Prozessen zu tun. Impulse seien natürlich immer willkommen, nur genau dieser passe jetzt gerade nicht, schließt Rosi. Aber: Vielleicht – wenn sich die Kollegin besser eingearbeitet hat. Dann wird sie verstehen, warum es nicht so einfach geht. Die neue Kollegin nimmt sich den Impuls zu Herzen. Sie schweigt von nun an, wenn sie Ideen für neue Wege hat. Und Rosi? Löscht eine Woche später den Blocker „Neue Wege denken“ – mit dem aktuellen Druck hätte das sowieso keinen Sinn.
Versuche, Innovationsfähigkeit zu stärken. Man führt agile Methoden ein, schult systemisches Denken, installiert Labs und Plattformen. Und trotzdem landen viele gute Ideen wie Wasser auf einer heißen Herdplatte: zischend, dampfend –und schnell verdunstet.
Regelungen, Strukturen und Zuständigkeiten hindern Wandel
Das liegt selten am Inhalt. Es liegt am System. Die Organisation erkennt unbewusst, dass hier etwas am Status quo rütteln könnte – und aktiviert ihre inneren Abwehrkräfte. Die Verteidigung läuft elegant und effizient. Mit Verweis auf Regelungen, Strukturen, Zuständigkeiten. Der Trick: Man argumentiert nicht gegen die Idee, sondern gegen ihre Umsetzbarkeit.
Die Ironie: Führungskräfte, im Workshop begeistert von neuen Möglichkeiten, hören sich selbst im Alltag sagen: „Das wird nicht
funktionieren.“ Nicht aus Heuchelei, sondern weil der eigene Erfahrungsraum, die eigene Rolle, deutlich sagt, dass diese neuen Ideen nicht zum Status quo passen. So hoffnungslos sich das zwischendurch für alle Beteiligten anfühlen mag: Es ist keine vollends vergebene Mühe, die Verwaltung zu verändern. Doch man liegt nicht falsch, wenn man den Eindruck hat, neue Ideen müssen erst ganz zur Verwaltungslogik passen, bevor sie in die Verwaltung eindringen können. Für den Einzelnen ist es frustrierend, wenn eigene Ideen von den Abwehrkräften der Routine absorbiert werden. Aber der Versuch bleibt wichtig, denn beim nächsten Mal kann eine neue Idee schon etwas machbarer wirken.
Die wirklichen Hebel in Bewegung setzen
So wird es irgendwann den unvorhersehbaren Moment geben, in dem
sich alle Widerstände plötzlich lösen. Es ist der Moment, in dem Neues entweder so sehr verwaltungstauglich gemacht wurde, dass es nichts Neues mehr darstellt. Oder aber es sind die wirklichen Transformationshebel, die langsam, dafür aber richtig etwas bewegen. Wenn sie im Alltag echte Verbesserungen bewirkt haben, erscheinen sie häufig wie selbstverständlich und ihre eigentliche Innovationskraft wirkt wie normaler Alltag, dabei sind es echte Veränderungsbooster, die zum Teil der Organisation geworden sind.
Vielleicht braucht es in der Verwaltung manchmal länger. Aber was dann einmal da ist, geht auch nicht einfach wieder weg. Es ist Teil der Kultur geworden.

Dr. Konstanze Schlegelberger leitet die Unternehmensentwicklung der DRV Bund. Sie hat Kulturanthropologie, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht studiert. Zudem ist sie systemische und transformationale Team Coachin.
Foto: BS/DRV Bund
Die gleichnamige Initiative der Europäischen Union hat das Ziel, den digitalen Wandel in Europa bis zum Jahr 2030 umfassend voranzutreiben.
…laut Digital Economy and Society Index (DESI), der die digitale Gesamtleistung in den Bereichen digitale Kompetenzen, Konnektivität, Integration digitaler Technologien, Nutzung digitaler Technologien und digitale öffentliche Dienste berücksichtigt.
Nutzerfreundlichkeit (User Experience)
Vollständigkeit der Online-Angebote 68
Interoperabilität & Datenaustausch 65 %
Mobile Nutzung von Verwaltungsdiensten 62 %
Transparenz und offene Daten 60 %
Online-Interaktion (Chatbots, Self-Service) 58 %
Digitale Identität Nutzung 55 %
Grenzüberschreitende Dienste 50 %

...basierend auf dem DESI (Digital Economy and Society Index) 2025.







Die Digitalisierung brauche eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung, erklärte Philipp Zinkgräf auf dem Kongress BW 4.0 in Stuttgart. Die Realität sehe hingegen anders aus: „Wir alle werden vom Prinzip der Jährlichkeit regiert.“ Das erschwere die langfristige Planung deutlich. Doch auch mit vergleichsweise wenig Mitteln könnten Erfolge erzielt werden. Der Abteilungsleiter nannte hier das Beispiel von F13, einem KI-Assistenzsystem, welches mit einem „einstelligen Millionenbetrag“ entwickelt worden sei. Mittlerweile stehe es der Landesverwaltung BadenWürttembergs sowie Lehrkräften zur Verfügung, auch im Saarland werde es momentan ausgerollt, erzählte Zinkgräf
Koordiniertes Vorgehen Er sprach sich insgesamt für mehr Kooperationen aus – gerade in Zeiten knapper Mittel seien diese sinnvoll. Außerdem sei im Digitalisierungsumfeld alles miteinander verbunden, sodass ein koordiniertes Vorgehen und eine gute Abstimmung über alle Ebenen hinweg sinnvoll sei. Dazu gehöre neben dem Austausch zwischen Land und
„Esgibt nur zwei Treiber, mit denen so etwas funktionieren kann“, so Prof. Dr. Robert Müller-Török, Professor und Studiendekan für digitales Verwaltungsmanagement an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, über den notwendigen Kulturwandel in der öffentlichen Verwaltung.
Um die preußische Regeltreue und die aus den Jahren des Wohlstands geborene Risikoaversion abzulegen und echte Entbürokratisierung zu ermöglichen, brauche es entweder leere Staatskassen oder einen starken politischen Willen. So sei etwa Portugal an sein erstklassiges zentrales Beschaffungssystem oder Österreich an seine digitale Verwaltung gekommen.
In Deutschland sei die Not aktuell noch nicht groß genug. Zwar sei die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren nicht gewachsen, der demografische Wandel habe aber bisher verhindert, dass dies zu massiv steigenden Arbeitslosenquoten führe. Auch die Haushaltsdefizite wüchsen an, doch noch könnten die wichtigsten Ausgaben bewältigt werden.
Großes Entlastungspotenzial Es sei eine Begleiterscheinung unserer langen Friedensperiode, er-
Hoffnung auf größere Nutzungszahlen der Verwaltungsleistung
(BS/Anna Ströbele) In Baden-Württemberg wird die digitale Fahrzeugzulassung trotz ihrer erfolgreichen Umsetzung bislang wenig genutzt. In Zukunft sollte das Land daher mehr auf „Digital Only“ setzen, appelliert Philipp Zinkgräf, Abteilungsleiter IT, E-Government, Verwaltungsdigitalisierung im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen. Daneben wird die Bündelung und Standardisierung von Verwaltungsleistungen geprüft.

Kommunen ebenso die Kommunikation zwischen den Ressorts. Auch auf die elektronische KfzZulassung (i-Kfz) kam der Abtei-
lungsleiter zu sprechen. Diese habe der kommunale IT-Dienstleister Komm.ONE erfolgreich umgesetzt. Jedoch sei die Nutzungsquote
durch die Bürgerinnen und Bürger „überraschend gering“, gab Zinkgräf zu. Obwohl sie sich bemüht hätten, das Online-Angebot attraktiv zu gestalten, indem es günstiger sei als der analoge Weg, werde der Großteil der Fahrzeugzulassungen noch immer vor Ort in den zuständigen Behörden abgewickelt. Der Abteilungsleiter glaubt, dass viele Menschen „keine Lust“ hätten, sich mit dem womöglich zu komplexen Online-Verfahren zu beschäftigen. Auch würden viele Bürger diese Option schlicht nicht kennen. Als Lösung erwägt Zinkgräf das Prinzip „Digital Only“ – also den analogen Weg zugunsten des digitalen Verfahrens abzuschaffen. In Dänemark sei dies schon lange etabliert. Ein Kongressteilnehmer vom Landratsamt Tübingen merkte
Große Veränderung braucht eine Krise
(BS/tkl) Ein Kulturwandel in der Verwaltung ist dringend nötig – doch er gelingt nur mit politischem Willen oder unter dem Druck leerer Staatskassen. Während die große Krise in Deutschland noch ausbleibt, gehen Initiativen und engagierte Kommunen bereits eigene Wege zur Entbürokratisierung. Der Studiengang Digitales Verwaltungsmanagement bereitet künftige Fachkräfte gezielt auf diesen Wandel vor.
klärt die ehemalige Vorsitzende des Normenkontrollrats Baden-Württemberg und Staatssekretärin a. D., Dr. Gisela Meister-Scheufelen, dass die Gesellschaft durch Risiken mehr zu verlieren habe, als sie potenziell gewinnen könne. Das wiederum fördere die Tendenz, alle Entscheidungen so gut wie möglich absichern zu wollen und führe so langfristig zu einer Überbürokratisierung.
Die Agentur Bayern Innovativ will nicht warten, bis die Krise einen Umbruch erzwingt und hat in Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, der Fachhochschule Landshut, dem Landkreis Augsburg, der Landeshauptstadt Stuttgart und der Stadt Landshut innerhalb eines Wintersemesters konkrete Handlungsempfehlungen für die Entlastung von Unternehmen erarbeitet. Die Ergebnisse sollen nun in die Umsetzung gehen, so Willi Steincke, Projektleiter Smart Cities and Regions bei Bayern Innovativ.

Die potenzielle Wirkung dieses Vorhabens sei immens, prognostiziert Meister-Scheufelen. Immerhin empfänden bis zu 70 Prozent deutscher Familienunternehmen die Bürokratie als größten Wettbewerbsnachteil. In Großbritannien werde bei neuen Gesetzen stets geprüft, inwiefern sie dem Wirtschaftsstandort nützen könnten. Hierzulande vermisse sie eine solche Regelung. Überhaupt werde Juristen nicht beigebracht, wie gute Gesetze


an, dass die Identifikation (eID) zu kompliziert zu nutzen sei und sich die geringe Nutzungsquote der i-Kfz seiner Ansicht nach damit erklären lasse. Zinkgräf bestätigte, dass diese Diskussionen rund um die eID geführt würden.
Bundesweite Bündelung? Er berichtete weiterhin von einem Vorhaben des Innenministeriums, bei welchem derzeit die Bündelung der Kfz-Zulassung geprüft werde. Im Wesentlichen sei diese nämlich ortsunabhängig, weswegen man sein Auto nicht unbedingt im eigenen Wohnort zulassen müsste. Nun werde untersucht, wie der Gesamtprozess – vom Antrag bis zum Bescheid – grundlegend neugestaltet werden könnte. „Dazu führen wir aktuell Gespräche mit interessierten Zulassungsbehörden“, sagte der Abteilungsleiter. Bis Herbst dieses Jahres soll das Vorprojekt abgeschlossen sein. Die Erkenntnisse sollen dann für die Evaluierung von anderen Verwaltungsleistungen dienen und könnten auch andere Länder und den Bund interessieren. In seiner letzten Sitzung habe der IT-Planungsrat zudem beschlossen, das Vorhaben zu begleiten.
gemacht würden. Aus Sicht der Expertin stelle dies ein großes Manko dar.
Auch Tobias Märtterer, Leiter IT und Digitalisierung der Stadt Ludwigsburg, will nicht warten. Als Teil der interkommunalen OZGTaskforce lebt er das Motto „Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner“. Auf kommunaler Ebene könne man Entscheidungen oft deutlich schneller erwirken als im Land oder gar im Bund. Märtterer fordert den Wegfall der Schriftform, mehr antragsfreie Prozesse und womöglich sogar einen „Digital Reset“. 16 Serviceportale, die nicht miteinander kommunizieren können – das müsse besser gehen. Unterstützt wird der angestrebte Kulturwandel unter anderem im noch recht jungen Studiengang Digitales Verwaltungsmanagement. Müller-Török und seine Kollegin von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Prof. Dr. Antje Dietrich, möchten ihren Studierenden neben der klassischen Verwaltung auch die juristische und digitale Seite ihres Themenfeldes näherbringen. Mit dem so geschulten Blick wären Absolventen dann gut vorbereitet, um aktiv an der Entbürokratisierung der Verwaltung mitzuwirken.

einem Top-down-Ansatz sei das „Virtuelle Bauamt

Felix Ette, Projektmanager bei der govdigital, erklärt, wie die Genossenschaft Kooperationen unterstützt: durch Services wie Threat Sharing und Plattformen wie die Deutsche Verwaltungscloud.
„Wirhaben verschiedene Herausforderungen, welche wir als Kommune bewältigen müssen“, erklärte Ralph Erhardt, Leiter des Amts für Digitalisierung, Smart City und Informationstechnik in Friedrichshafen. Daten aus unterschiedlichen Gebieten sollen zur Problemlösung beitragen. „Wir hatten die Chance, eine LoRaWanFörderung vom Land zu bekommen“, erläutert Erhardt den Ursprung des Smart-City-Projekts in Friedrichshafen. Das Long Range Wide Area Network (LoRaWan) ermöglicht die Übertragung von kleinen Datenmengen über einen sehr großen Umgebungsradius hinweg. In Friedrichshafen wird dieses System zur Unterstützung der stadtweiten Sicherheitsinfrastruktur eingesetzt.
KI überwacht Einfahrten
„Schöne Kita, Feuerwehrzufahrtund wer parkt da natürlich? Das Elterntaxi!“, beschreibt der Amtsleiter eine der kommunalen Herausforderungen. Zugeparkte Einfahrten seien überall in der Stadt zu beobachten und würden die Bürgerinnen und Bürger akut gefährden, da so allen voran die Feuerwehr im Ernstfall nicht halten könne. An den betroffenen Stellen seien kleine KI-Kameras angebracht worden, um damit die Feuerwehrzufahrten zu über-
An der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz beteiligt ist auch Richard Hu. Der Staatsanwalt ist Referent im IuK-Referat im Ministerium der Justiz in Baden-Württemberg. Die Arbeitsgruppe ist Teil der Bundes-Länder-Kommission (BLK) für Informationstechnik und koordiniert den Einsatz von Justiz-KI in Bund und Ländern. In der BLK werde die nationale und internationale Entwicklung der KI beobachtet, so Hu
KI-Plattform für die Justiz In der KI-Strategie des Landes Baden-Württemberg sollen für den Bereich der Justiz geeignete Geschäftsprozesse transformiert werden. Es geht darum, Innovation und nachhaltigen Ressourceneinsatz voranzubringen. Einzelne Hand-

In der Fachausstellung tauschen sich die Teilnehmenden zu aktuellen Themen der Verwaltungsdigitalisierung aus: etwa zur Rolle von Low-Code-Plattformen bei der Entwicklung von Anwendungen.

Die Referatsleiterin IT-Leitstelle und Landeseinheitliche E-Akte im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, Dr. Daniela Oellers, gibt Einblicke in die Prozessdigitalisierung.
Wie Smart-City-Projekte den urbanen Alltag prägen
(BS/fst) Wie können Daten dabei helfen, das Leben in der Stadt sicherer und effizienter zu gestalten? In Baden-Württemberg sind bereits zahlreiche Smart-City-Projekte entstanden, welche die Kommunen bei der Verkehrssicherheit, dem Klimaschutz und Ressourcenmanagement voranbringen. Dabei spielt der kreative Einsatz verschiedener Datensätzen eine entscheidende Rolle.
wachen. Dabei wird jedoch nicht das Bild verschickt, sondern die KI rechnet eine Wahrscheinlichkeit aus, mit der die Zufahrt von einem Fahrzeug versperrt ist und leitet diese über LoRaWan weiter. „Die erhobenen Daten werden vom lokalen Verwaltungspersonal eingesehen, die dann die Meldung verifizieren können“, so der Chief Digital Officer zum weiteren Prozess. Vor Ort könne dann entschieden werden, ob es einer Eskalation bedürfe oder nicht.
Lohnendes Zusammenspiel
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Daten ist die Plattform SmartCondi, welche von der Smart City Mannheim GmbH, einem Joint Venture der MVV Energie AG und der Stadt Mannheim bzw. Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH, entwickelt wurde. Geschäftsführer Robert Thomann präsentierte einige Anwendungsbeispiele der Plattform: „Mithilfe
von Infrarot-Systemen können wir Fahrzeuge klassifizieren, wodurch wir den Verkehr in Echtzeit erfassen können.“ Langfristig sollen 200 Systeme installiert werden, um Informationen an den wichtigsten Knotenpunkten zu erhalten. Weiter erläutert Thomann, dass diese Messpunkte in Kombination mit dem Modell Simulation of Urban Mobility (SUMO), einer Open-Source-Software des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, ihren vollen Mehrwert entfalten. In SUMO sind sämtliche Eckdaten zu den lokalen Gegebenheiten enthalten, z.B. die Ampelschaltung, die Breite der Straße oder auch der Plan des ÖPNV. Dieses Zusammenspiel wiederum ermögliche es, Simulationen durchzuführen, die vorhersagen könnten, welche Auswirkungen das Wegfallen bestimmter Straßen oder Kreuzungen auf die kommunale Verkehrsinfrastruktur hätte, so Thomann.
SmartCondi bietet zusätzlich Funktionen, welche in den Bereichen Klimaschutz und Energiemanagement zu verorten sind. „Zuerst wollen wir die Daten visualisieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Anschließend geht es darum, diese Daten zu verarbeiten und sie schlussendlich zu modellieren, um damit in die Zukunft blicken zu können“, fasst Thomann die Idee hinter SmartCondi zusammen.
Smart City für den Radverkehr Ganz im Sinne der Projekte, welche Ralph Erhardt und Robert Thomann vorgestellt haben, glaubt auch Patricia Hergesell, Teamleiterin im Kompetenzzentrum Digitale Infrastrukturen und Daten der Metropolregion Rhein-Neckar, dass „Daten mittlerweile für die Infrastruktur essenziell geworden sind“. Als konkretes Beispiel führt die Teamleiterin den Fahrradverkehr an, wobei es vor allem darum gehe, „durch eine belastbare
Welche Prozesse sich in der Justiz durch KI verbessern lassen
(BS/sp) KI in der Justiz bietet enormes Potenzial. Vor allem Organisationsthemen, die stark repetitiv sind, können künftig vereinfacht werden. Noch ist man jedoch nicht so weit. Es stehen einige verwaltungstechnische Hürden im Raum. In der Arbeitsgruppe KI wird über dieses Potenzial diskutiert. Bis 2026 möchte man dort messbare Ergebnisse liefern.
lungsfelder der Strategie seien zum Beispiel die Förderung der flexiblen Nutzung von KI-Technologien und der Aufbau einer KI-Plattform für die Justiz, berichtet Hu. Durch die Automatisierung einiger Aufgaben sollen insbesondere Prozesse wie das Lesen von Akten, Vorarbeiten und Verwaltungstätigkeiten durch KI erleichtert werden, teilt Hu mit.
Bis 2026 werden die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe erwartet, so der Staatsanwalt.
Leider sei man beim Thema KI

Der Referent im Justizministerium, Richard Hu (r.), betont, dass die gemeinsame KI-Strategie von Bund und Ländern für die Justiz die Konsistenz und Kohärenz von Geschäftsprozessen steigern solle.
in der Justiz derzeit noch nicht arbeitsfähig, berichtet Richter Dr. Philipp Schmieder vom Landgericht Karlsruhe. Auch er hat Ideen, wo sich Arbeitserleichterungen anbieten würden. Dazu zählt zum Beispiel die Aufstellung der Prozesskosten, die einen Richter üblicherweise viel Zeit und Mühe koste, erläutert Schmieder. Bei Organisationsthemen wie etwa der Terminfindung zwischen Staatsanwalt, Verteidiger und Richter könnten ebenfalls mithilfe von KI-
Technologien die Prozesse verkürzt werden. Dystopie-Fantasien wie etwa der Präsenz von Robo-Richtern erteilten alle Teilnehmenden der Diskussionsrunde eine Absage. Ein RoboRichter – oft in Sozialen Medien als eine Art Roboter in Richterroben porträtiert – soll den menschlichen Richter vollständig ersetzen. Das seien jedoch Scheindebatten, beurteilten die Juristen. Insbesondere in Deutschland gehe es bei der JustizHilfe um kleinere Angelegenheiten.

Detlef Bäumer, Kundenberater bei der PICTURE GmbH, empfiehlt die Kooperation zwischen Kommunen für ein erfolgreiches Prozessmanagement.
Datengrundlage das Sicherheitsgefühl auf dem Fahrrad zu erhöhen“. Einerseits stelle die Region verschiedenen Kommunen kostenlose Radzählgeräte, automatisierte Zählstellen, die den Fahrradverkehr rund um die Uhr erfassen, zur Verfügung. Andererseits komme die App „Sicherheit im Radverkehr“ (SimRa) zum Einsatz, welche es Freiwilligen ermögliche, ihre Radstrecken anzugeben. „Das kann uns dabei helfen, mögliche Lücken im Fahrradwegenetz zu schließen“, erklärt Hergesell Ebenfalls dient SimRa dazu, über die Smartphone-Sensorik beispielsweise starke und plötzliche Bremsmanöver zu erfassen und so Gefahrenstellen zu identifizieren. „Wir überprüfen gerade, ob man die Daten aus der App mit Daten der Abbiegeassistenten von Bussen und LKW kombinieren kann. Das könnte zur besseren Gefahrenidentifizierung beitragen“, arbeitet Hergesell ein potenzielles Einsatzgebiet der SimRa-Daten heraus. Als Effekt dieser genannten Maßnahmen verspricht man sich einen steigenden Radverkehr in der Region. Angesichts der Herausforderungen in den Kommunen zeigt sich: Der gezielte Einsatz von Daten ist ein entscheidender Schlüssel, um Städte zukunftsfähig, effizient und lebensnah zu gestalten.
„Die kernrichterliche Tätigkeit soll erhalten bleiben. Die sogenannten Robo-Richter sind kein realistisches Szenario“, urteilt Schmieder Generell werde „menschliche Erfahrung“ weiterhin ein wichtiger Teil des Justizwesens bleiben, erklärte Dr. Sarah Becker, Partnerin AI Strategy and Transformation bei Deloitte. Insbesondere die „letzte Meile“ der Entscheidung müsse menschlich bleiben. „Aber diese letzte Meile – diese Entscheidung – kann nur gefällt werden, wenn entsprechend Vorerfahrung vorhanden ist.“ Es werde interessant sein zu beobachten, wie die neu ausgebildete Generation, die nur mit dem Endergebnis automatisierter Prozesse konfrontiert wird, künftig Entscheidungen fällen werde, so Becker

Für Dr. Eva Sonnenmoser, Referentin bei InnoLab_bw, ist die Zusammenarbeit von Behörden und Start-ups der Schlüssel für den erfolgreichen Verwaltungseinsatz von KI. Fotos: BS/Bildschön
Die Finanzaufsicht verfügt damit über eine eigene KI-Infrastruktur, welche die Umsetzung von Anwendungsfällen wie maschinellem Lernen, Datenanalysen, Sprachverarbeitung oder Automatisierung ermöglicht. Basierend auf dieser Infrastruktur wurde in diesem Jahr ein KI-Assistent in der BaFin eingeführt: der RAGulator. Der Begriff RAGulator ist eine Wortschöpfung. Sie bezieht sich auf die Abkürzung RAG (Retrieval Augmented Generation), eine KI-Technik, die die Verarbeitung und Darstellung von Inhalten in großen Sprachmodellen optimiert und damit eine präzisere und relevantere Informationsbereitstellung ermöglicht.
Der KI-Assistent kann Dokumentenanalysen durchführen, Texte generieren, umformulieren, übersetzen und korrigieren. Dies ermöglicht es der BaFin, große Mengen an Dokumenten schnell und zielgerichtet zu durchsuchen, zu vergleichen und zusammenzufassen. Die BaFin kann so die enorme Flut
Der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, hatte im Jahr 2023 einen Bescheid erlassen, mit dem er dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Bundespresseamt) den Betrieb der Facebook-Seite („Fanpage“) der Bundesregierung untersagt hatte. Mit dem nun ergangenen Urteil hat das Verwaltungsgericht Köln diesen Bescheid aufgehoben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der BfDI hatte seinerzeit Bedenken bezüglich fehlenden Datenschutzes auf der Regierungs-Facebook-Seite. Unter anderem hielt Kelber die Einwilligung von Usern beim Setzen bestimmter Cookies für problematisch.
Die Bewertung von Stellen zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Organisation und im Personalwesen der öffentlichen Verwaltung. Unterschiedliche Tarifwerke, unklare Begriffe und eine Vielzahl an Urteilen erschweren fundierte Entscheidungen – bei gleichzeitig wachsendem Effizienzdruck und hohen Erwartungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Folgen von Fehlbewertungen reichen von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bis hin zu langfristigen Akzeptanzproblemen in der Belegschaft.
Ein Werkzeug, das diesen Herausforderungen begegnet, ist Kasaia: eine Softwarelösung der PICTURE GmbH, die Verwaltungen bei der rechtssicheren und systematischen Bewertung von Stellen nach TVöD, TV-L, TV-V und dem KGSt-Dienstpostenmodell 2009 für Beamtenstellen unterstützt. Das optionale Rechtsinformationen-Erweiterungsmodul – realisiert in Kooperation mit Wolters Kluwer – stellt für KasaiaAnwender zudem eine Datenbank von Urteilsanalysen sowie ein juristisches Begriffslexikon bereit, die die tägliche Bewertungspraxis rechtlich absichern. Mit einer neu integrierten KI-Komponente entwickelt sich Kasaia nun zu einem noch leistungsfähigeren Assistenten.
Urteilsanalysen mit KIUnterstützung
Das „Kasaia-Rechtsinformationen-Modul – powered by Wolters Kluwer“ basiert auf einer strukturierten Datenbank mit den eingruppierungsrelevanten Ur -
RAGulator optimiert Analyse und schützt Daten
(BS/Silke Deppmeyer) Die BaFin setzt auf KI zur Unterstützung der Aufgabenerledigung in der Aufsicht: Kernstück der KI-Initiative der BaFin ist die eigene KI-Plattform, auf welcher der KI-Assistent RAGulator basiert. Mit ihm können Dokumentenanalysen automatisiert und Risiken schneller erkannt werden, während Datenschutz und Datenhoheit oberste Priorität haben.
von Daten, die sie täglich erhält und deren manuelle Verarbeitung ohne digitale Unterstützung kaum noch zu bewältigen wäre, wirksamer auswerten.
Die KI hilft, Informationen zu identifizieren und Prioritäten zu setzen. Dadurch entstehen Freiräume, die es den Beschäftigten ermöglichen, sich kreativeren und qualitativ anspruchsvolleren Aufgaben zu widmen. Wichtig ist: Die KI ist dabei ein Werkzeug, das die Prozesse unterstützt, jedoch die menschliche Expertise nicht ersetzt. Die finale Prüfung der von der KI aufbereiteten Ergebnisse sowie die abschließenden Entscheidungen lie-
gen weiterhin uneingeschränkt in der Verantwortung der erfahrenen Aufseherinnen und Aufseher. Der Mensch bleibt in diesem Prozess die letzte Instanz.
Eigenentwicklung für Datenhoheit
Der Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung ist auch mit Herausforderungen verbunden. Kritische Aspekte sind die Informationssicherheit und der Datenschutz. Die Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten erfordert robuste Sicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen. Es muss sichergestellt werden, dass sensible
Daten geschützt sind und nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verwendet werden.
Deshalb haben wir unseren KI-Assistenten selbst entwickelt. Dieser Ansatz ist der besonderen Verantwortung der BaFin geschuldet, die mit hochsensiblen und vertraulichen Daten umgeht. Der Schutz dieser Daten hat für die BaFin oberste Priorität. Unsere KI-Plattform, auf der der RAGulator basiert, läuft komplett in unseren eigenen Rechenzentren. Dies bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber Public-Cloud-Lösungen: Wir haben die Kontrolle über die Daten und können verhindern, dass sensible
Bescheid des Ex-Bundesdatenschutzbeauftragten aufgehoben
(BS/cb) Das Verwaltungsgericht Köln teilt die Ansicht des Bundespresseamts: Der Facebook-Auftritt der Bundesregierung darf in seiner jetzigen Form online bleiben. Die Verantwortung für den Datenschutz liege bei Meta.
„Das Urteil bestätigt uns darin, an unserem Facebook-Auftritt als wichtigem Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit festzuhalten“, kommentierte Regierungssprecher Stefan Kornelius die Entscheidung. Datenschutzfreundliche Ausgestaltung
Aus dem demokratischen Informationsauftrag ergebe sich, „die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über die Tätigkeit, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung zu informieren“ – auch via Soziale Medien und „ganz konkret“ Facebook. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln bestätige die Auffassung des Bundespresseamts, dass allein Meta verpflichtet sei, die datenschutzkonforme Ausgestaltung von Facebook sicherzustellen. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Bundesregierung „mit allen Einzelheiten der Geschäfts- und Datenschutzpraxis“ von Meta einverstanden sei: „Wir
setzen uns als Bundespresseamt für eine möglichst datenschutzfreundliche Ausgestaltung der Sozialen Medien ein“, so Regierungssprecher Kornelius
Specht-Riemenschneider prüft
Informationen für externe KI-Trainingszwecke genutzt oder von Dritten eingesehen werden können. Informationssicherheit und Datenintegrität sind für uns unverzichtbar: BaFin-Daten bleiben bei der BaFin. Die Entwicklung dieser KI-Plattform wurde eigeninitiativ von der BaFin-IT in Zusammenarbeit mit externen Expertinnen und Experten vorangetrieben. Dies hat uns ermöglicht, internes Know-how aufzubauen. Unsere Mitarbeitenden sind dadurch gefragte Spezialistinnen und Spezialisten, die den RAGulator bereits auf internationalen Konferenzen in München, Wien, Las Vegas und Boston präsentiert haben.

Silke Deppmeyer ist Exekutivdirektorin für Innere Verwaltung bei der BaFin.
Obwohl der Bescheid des alten BfDI nicht an Meta gerichtet war, hatte das Unternehmen 2023 ebenfalls eigenständig Klage erhoben. Diese erklärte das Gericht nun in drei von vier Punkten für unzulässig. Das Verfahren geht u. a. auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 zurück. Dieser hatte entschieden, dass nicht Facebook allein für die Einhaltung des Datenschutzes auf seiner Plattform zuständig ist, sondern auch die Betreiber der Fanpages für Datenschutzmängel verantwortlich gemacht werden können. Die aktuelle Bundesdatenschutzbeauftragte, Prof. Dr. Louisa SpechtRiemenschneider, will das Urteil prüfen: „Ich werde mir die Urteilsbegründung sehr gründlich ansehen und entscheiden, ob ich die Sache der nächsthöheren Instanz, dem Oberverwaltungsgericht Münster, zur Entscheidung vorlege“, so die BfDI.
Ein Quantensprung für die Verwaltungspraxis
(BS/ Silke Nolopp*) Mit über 6.200 vielfach KI-gestützten Urteilsanalysen hilft die digitale Stellenbewertungslösung Kasaia® Verwaltungen dabei, Eingruppierungen fundierter und rechtssicherer zu gestalten.

Eine KI-Komponente ergänzt das „Kasaia®-Rechtsinformationen-Modul – powered by Wolters Kluwer“. Foto: BS/PICTURE GmbH
teilsanalysen von Bundes-, Landes- und Arbeitsgerichten, die speziell für den Einsatz in der Stellenbewertung aufbereitet sind. Bis vor Kurzem standen rund 100 manuell durch die Rechtsexpertinnen und -experten von Wolters Kluwer erstellten Analysen zur Verfügung – ein beachtlicher Fundus, jedoch mit natürlichen Grenzen. Die neue
KI-Erweiterung hebt diese Begrenzung nun auf. Mit über 6.200 vielfach KI-gestützt ausgewerteten Urteilen deckt das Modul nun die relevanten Entscheidungen aus Eingruppierungsfeststellungsklagen vor Arbeitsgerichten ab. Die KI analysiert die Urteile dabei vollautomatisch, erkennt rechtliche Struk-
turen, extrahiert Kernaussagen und verschlagwortet die Inhalte kontextbezogen. Daraus entsteht ein intelligentes Werkzeug, das die Bewertung fundierter, vergleichbarer und besser begründbar macht. Der Zuwachs an Datenverfügbarkeit stärkt die Argumentationsbasis, verkürzt Bearbeitungszeiten und verbessert die Qualität der Gutachten. Bewertungen werden transparenter, konsistenter und besser nachvollziehbar.
„Eine rechtssichere Stellenbewertung gewährleistet die tarifkonforme Eingruppierung, erhöht die Akzeptanz bei Führungskräften und Mitarbeitenden und vermeidet unnötige arbeitsgerichtliche Verfahren“, erklärt Norbert Ottersbach , Stellenbewertungs-Experte der PICTURE GmbH. „Mit der neuen KI-Erweiterung schaffen wir es, komplexe Rechtsprechung verständlich aufzubereiten – und das direkt im digitalen Workflow der Verwaltungen.“
Assistent statt Automat Die Künstliche Intelligenz handelt dabei nicht autonom. Sie arbeitet eingebettet in ein kuratiertes System juristischer Rahmenbedingungen. Die Verantwortung für jede Bewertung verbleibt bei den qualifizierten Fachkräften – die KI strukturiert und unterstützt, ersetzt jedoch keine menschliche Entscheidung. Gerade dieser kon-
trollierte Einsatz stärkt das Vertrauen und zeigt beispielhaft, wie neue Technologien im öffentlichen Sektor verantwortungsvoll eingesetzt werden können.
Ein Blick in die Zukunft
Die Einbindung Künstlicher Intelligenz in die Arbeitsabläufe von Verwaltungen ist längst Realität. Kasaia zeigt, wie moderne Technologie komplexes Fachwissen zugänglich macht, ohne dabei bestehende Abläufe zu ersetzen. Der Nutzen liegt nicht in der Automatisierung von Entscheidungen, sondern in der intelligenten Strukturierung relevanter Informationen. Der Schritt von 100 auf über 6.200 Urteilsanalysen markiert einen Meilenstein für die Bewertungspraxis. PICTURE und Wolters Kluwer zeigen mit ihrer Lösung, dass KI im Öffentlichen Dienst bereits heute konkreten Nutzen stiften kann, wenn sie gezielt und verantwortungsvoll eingesetzt wird.
Die kommenden Jahre werden zeigen, in welchen weiteren Feldern die Zusammenarbeit von Fachkräften und KI den Arbeitsalltag in Verwaltungen erleichtert. Kasaia liefert dafür ein überzeugendes Beispiel: als Werkzeug zur Stärkung von Rechtssicherheit und Effizienz – und nicht als Ersatz, sondern als verlässlicher Assistent im Dienst der öffentlichen Verwaltung.
Mehr Informationen rund um Kasaia unter: www.kasaia.de
*Silke Nolopp ist Junior Content Managerin bei der PICTURE GmbH.

„Mit der Freigabe erster Projektvorhaben starten wir in die strategische Portfoliosteuerung“, erklärte Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und mittlerweile ehemalige Vorsitzende des IT-Planungsrates, im Anschluss an die 47. Sitzung des Gremiums. Die Föderale IT-Kooperation (FITKO) wurde dabei mit der Bewertung und Priorisierung der Projektvorhaben beauftragt. Neben der Übereinstimmung mit den verabschiedeten Themenschwerpunkts-Zielbildern, sollten die Projekte außerdem auf die Föderale IT-Strategie als Gesamtbild einwirken und das Potenzial haben, eine bundesweite Wirkung entfalten zu können. Aus den über 60 Projektanträgen, welche die Mitglieder des IT-Planungsrates eingereicht hatten, wurden 27 Projektvorhaben beschlossen, wovon fünf als Nachrücker festgelegt wurden. Inhaltlich sind die Maßnahmen dabei über alle fünf Themenschwerpunkte (Digitale Transformation, Digitale Infrastruktur, Digitale Anwendungen, Datennutzung, Informationssicherheit) verteilt. Der Wirtschaftsplan der FITKO stellt für die Vorhaben ein Budget von 15 Millionen Euro zur Verfügung. Zwei Drittel der Vorhaben sollen bereits im Sommer 2026 abgeschlossen sein, das restliche Drittel bis Ende 2026.
Bewährtes soll weitergedacht werden Nicht alle der 27 Projektvorhaben sind grundlegende Neuheiten, da sie auf bereits existierenden Maßnahmen aufbauen. Ein Beispiel dafür ist der Antrag zum Ausbau der Schnittstelle des Online-Dienstes „Einfache Leistungen für Eltern“ (ELFE), welcher von Bremen gestellt wurde.
ELFE ermöglicht es werdenden Eltern einen Kombiantrag auf Namensgebung, Geburtsurkunde sowie Eltern- und Kindergeld zu stellen. Dabei tauschen Standesamt und Elterngeldstelle, mit Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer, die einmal angegebenen Daten untereinander aus, um zu verhindern, dass die werdenden Eltern mehrfach physische Nachweise erbringen müssen. Dieser Dienst ist in Hamburg und Bremen bereits seit 2022 nutzbar und soll jetzt im Rahmen der operativen Strategiephase ausgebaut werden.
ELFEConnect ist dazu konzipiert, die Datenschnittstelle von ELFE auf behördliche Stellen wie die Familienkasse der Agentur für Arbeit oder das Finanzamt auszuweiten. Dieser Schritt soll dazu führen, dass Eltern von weiteren Papiernachweisen befreit und so entlastet werden. Als Voraussetzung für die strategische
Eine moderne Verwaltung braucht mehr als Tools – sie braucht Orientierung. Die strategische Beratung von Materna schafft Klarheit, priorisiert sinnvoll und begleitet Veränderung mit Fingerspitzengefühl. Entwickelt werden digitale Zielbilder, starke Markenbzw. Content-Strategien und die mit professionellem Change-Management für nachhaltige Transformation sorgen. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern um die gezielte Gestaltung von Veränderungsprozessen, die Menschen mitnehmen und Organisationen stärken.
Digitale Services müssen hierbei intuitiv, verständlich und einfach nutzbar sein. Gerade im behördlichen Umfeld haben viele Menschen wenig Zeit und mitunter wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen
27 Projekte sollen bis Ende 2026 umgesetzt werden
(BS/Frederik Steinhage) Der IT-Planungsrat hat in seiner Sommersitzung mit dem Beschluss erster Projektvorhaben die praktische Umsetzung der föderalen Digitalstrategie gestartet. Unter anderem zählen eine Machbarkeitsstudie für eine bundesweite KI-Plattform, der Ausbau von bestehenden Datenschnittstellen und die Vereinfachungen von Antragsstellungen für beispielsweise den Führerschein zu den ausgewählten Projekten.

im
Umsetzung dieser Projektidee wies das Föderale IT-Standardisierungsboard (FIT-SB) darauf hin, in den Austausch mit der nun ebenfalls neu gegründeten Steuerungsgruppe für das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) zu treten.
Ein weiteres bereits laufendes Projekt ist der eGov-Campus. Die digitale Lernplattform zu den Themen E-Government und Verwaltungsdigitalisierung ist bereits seit 2021 online und umfasst bislang 20 verschiedene Lernmodule.
Der Beschluss im Rahmen der Föderalen IT-Strategie soll jetzt dafür sorgen, dass die Plattform flächendeckend als Fort- und Weiterbildungsmethode im behördlichen Kontext anerkannt wird. Ziel ist es, dass die Module auf der Plattform fest in die Weiterbildungsprogramme der Behörden aufgenommen und als gleichwertig zu etwaigen Präsenzveranstaltungen gewertet werden.
Die neuen Projektvorhaben
Während die beiden benannten
Vorhaben bereits bestehende Projekte weiter ausbauen sollen, ge-
hen andere mit dem getätigten Beschluss erstmals in die Aufbauphase.
Im Priorisierungsprozess mit am besten abgeschnitten hat das Projekt „Föderale API-Autorisierungsinfrastruktur“, welches im Themenschwerpunkt Digitale Transformation verortet wurde. Ziel des Vorhabens ist es, ein zentralisiertes, interoperables Berechtigungs- und Rechteverwaltungssystem zu schaffen, das sämtliche Verwaltungs-APIs sicher steuert und Zugriffsrechte an die passenden Stellen vergibt. Dabei zahlt das Projekt auf das vom IT-Planungsrat ausgegebene Motto „API First“ ein, wobei der Fokus darauf liegen soll, die aktuell vorherrschende Verschachtelung der API-Schnittstellen abzubauen und eine föderale Governance zu etablieren.
Ähnlich wie bei bereits bestehenden APIs könnte das geplante System auf OAuth 2.0/OpenID zur sicheren Authentifizierung setzen, welche durch entsprechende Mandats- und Rollenkonzepte ergänzt werden würde. Die föderale API-Infrastruktur wurde mit einem Budget von 369.600 Euro ausgestattet und findet zum 30. Ju-
Wie Materna Verwaltung neu denkt
Foto:BS/FITKO
ni 2026 ihren Abschluss. Natürlich spielt auch das allgegenwärtige Thema Künstliche Intelligenz in mehreren der beschlossenen Projekte eine zentrale Rolle. Beispielsweise stellten Hamburg und Schleswig-Holstein einen Antrag für die Umsetzung einer KI-Assistenz zur Beantragung von Wohngeld. Zwar existieren bereits einige Pilotprojekte, welche den Prozess der Wohngeld-Beantragung in den Mittelpunkt rücken, jedoch fokussieren diese sich bis dato lediglich auf die Perspektive der Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen. So laufen beispielsweise in Potsdam und in Hannover seit April bzw. März 2025 Maßnahmen, welche die automatische Erfassung und Klassifizierung von Unterlagen mithilfe von KI ermöglichen sollen. Sachsen-Anhalt gab solche Modelle an die Antragsteller weiter. Diese erklärten, dass sich das bis 30. Juni 2026 laufende Projekt gezielt auf die Antragstellung konzentriert. Beispielsweise könnte bei der Ausfüllung des Antrages selbst oder bei der Erläuterung fachspezifischer Begriffe unterstützt werden. Dadurch könnten unvollständi-
ge Anträge oder Abbrüche verhindert werden. Neben diesem Vorhaben zählen im Bereich KI auch noch eine mögliche Dokumentenanalyse beim digitalen Führerscheinantrag sowie die automatisierte Übersetzung von Gesetzestexten in maschinell lesbare Regeln im Bereich der digitalen Baugenehmigungen zu den 27 ausgewählten Projekten. All diese Projekte könnten in Verbindung mit einem weiteren Projekt des Stadtstaates Hamburg gebracht werden, welcher eine Machbarkeitsstudie für eine föderale KI-Plattform beantragt hat, die ebenfalls beschlossen wurde. Dabei sollen die technische Umsetzbarkeit, die Identifizierung bereits existierender Strukturen und die mögliche bundesweite Vernetzung dieser im Vordergrund stehen. Mit „GovTeuken“ hat NRW ein Projekt gestartet, welches ein deutschlandweites, souveränes Sprachmodell für die Verwaltung als Zielsetzung ausgegeben hat. Der Titel des Projektes legt nahe, dass das Modell Teuken-7B aus dem Forschungsprojekt OpenGPTX, welches unter anderem vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme durchgeführt wurde, als Grundlage für dieses neue Projekt dienen könnte. Bei Teuken-7B handelt es sich um ein multilinguales KI-Sprachmodell, das Entwicklern aus Forschung und Unternehmen per Open Source zur Verfügung steht. Davon könnte auch beim Projekt GovTeuken Gebrauch gemacht werden, indem die bereits bestehenden Grundzüge des Programms auf Verwaltungsbelange angepasst werden.
Vom Projekt zum Produkt Über die strategische Umsetzungsphase hinweg begleitet die FITKO als Portfoliomanager die Projekte. Sind alle davon abgeschlossen, erfolgt ähnlich wie bei der vorhergegangenen Priorisierung der Projektvorhaben eine Evaluation entlang der Zielbilder innerhalb der einzelnen Themenschwerpunkte. Zeitgleich ist die FITKO damit beauftragt, bis zur 50. Sitzung des Gremiums, die aktuell noch nicht terminiert wurde, mögliche Transitionspläne sowie Betriebsabläufe für die einzelnen Projekte zu erarbeiten. Diese sollen die erfolgreichen Projekte möglichst reibungslos vom Projektstatus in den Produktkatalog überführen. Wie bei allen bisherigen Projekten des IT-Planungsrates würden bei einer Überführung in den Produktstatus dauerhafte Betreuungsstrukturen, ein Produktboard sowie möglicherweise eigene Steuerungsgruppen eingeführt werden. Dadurch wird die dauerhafte Weiterentwicklung und Betreuung der Projekte sichergestellt.
(BS/Johannes Rosenboom*) Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Doch wahre Innovation entsteht nicht allein durch Technik – sie beginnt beim Menschen. Hier setzt Materna an: Mit einem ganzheitlichen Full-ServiceAnsatz, der strategische Weitsicht, kreative Exzellenz und technologische Kompetenz vereint. Es entstehen digitale Verwaltungsangebote, die nicht nur funktionieren, sondern begeistern. Materna entwickelt digitale Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig Prozesse effizienter und zukunftssicher gestalten.
Formularen und Portalen. Anwendungen, die sich an den Bedürfnissen der Nutzenden orientieren, reduzieren Rückfragen, sparen Zeit und erhöhen die Zufriedenheit.
UX-Expertinnen und -Experten gestalten Anwendungen, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Mit fundiertem UX-Research, klaren Navigationskonzepten, DesignSystemen und kontinuierlicher Optimierung werden digitale Er-
lebnisse gestaltet, die Vertrauen schaffen.
Digitale Teilhabe ist in diesem Zusammenhang kein Extra – sie ist Pflicht. Materna sorgt dafür, dass digitale Angebote für alle zugänglich sind: durch barrierefreies Design, Inhalte in Leichter- und Gebärdensprache sowie begleitende Schulungen und E Learnings. So wird Inklusion gelebt – und gesetzliche Anforderungen wie die BITVKonformität zuverlässig erfüllt.
Nur wer niemanden ausschließt, schafft echte digitale Souveränität. Ob Storytelling, Kampagnen oder multimediale Inhalte – Materna macht digitale Angebote sichtbar, verständlich und vertrauenswürdig. Mit zielgruppengerechtem Content, passenden Styleguides und kreativen Ideen sorgen die Expertinnen und Experten dafür, dass Botschaften wirken. Kommunikation wird ganzheitlich gedacht – von der ersten Idee bis
zur erfolgreichen Umsetzung auf allen Kanälen.Die technologischen Services von Materna bilden das Rückgrat der Projekte. Von der technischen Übersetzung des kreativen Konzepts bis zur Realisierung KI-gestützter Websites und Apps – Materna schafft eine leistungsfähige, sichere und nachhaltige Infrastruktur, die alle Elemente nahtlos miteinander verbindet. Eine moderne Verwaltung denkt digital – aber vor allem nutzendenzentriert. Der Full-Service-Ansatz von Materna schafft Lösungen, die nicht nur funktionieren, sondern begeistern. Nur wer die Menschen in den Mittelpunkt stellt, gestaltet Verwaltung zukunftsfähig.
*Johannes Rosenboom ist SVP Sales, BDM und Marketing im Ressort Public Sector bei Materna.
Sie sich
Behörden und geheimschutzbetreute Unternehmen können ab sofort hochsensible und eingestufte Daten rechtskonform zur Verschlusssachenanweisung (VSA) in der Cloud verarbeiten. Der open-source-basierte SINA Cloud Stack ist die erste Technologie, die das neue Komponentenzulassungsverfahren des BSI erfolgreich durchlaufen und eine Einsatzerlaubnis für VS-NfD und GEHEIM erhalten hat.
Durch den Einsatz eines mitgelieferten IT-Grundschutzprofils wird ein wertvolles Werkzeug für eine VS-Freigabe beigesteuert. Der Funktionsumfang der SINA Cloud lässt sich flexibel erweitern und aktualisieren, ohne dass dadurch die VSA-Konformität beeinträchtigt wird. Diese Architektur sorgt für uneingeschränkte Funktionalität, Skalierbarkeit und ermöglicht den souveränen Einsatz bestehender und cloud-nativer Anwendungen. secunet.com/sina-cloud
Die kleinste klassische Cyber-Sicherheitsbehörde auf Landesebene ist das Hessen3C CyberCompetenceCenter (Hessen3C). Das Hessen3C ist in das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) integriert und dient dort als interdisziplinäre Fachstelle. Mit insgesamt 32 Mitarbeitenden besitzt das Hessen3C keine eigenständige Social Media-Abteilung, sondern wird durch die Pressestelle des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz mitbetreut. Dabei ist das Innenministerium auf Instagram und LinkedIn vertreten. Die Social Media-Kanäle des Ministeriums sollen die Themenvielfalt des Innenministeriums aufzeigen. Themen zur Cyber Security sind dort nur sporadisch zu finden.
CSBW produziert Info-Videos für YouTube Anders sieht es bei der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg (CSBW) aus. Mit 73 Stellen besitzt die Agentur mehr als doppelt so viele Mitarbeitende wie das Hessen3C. Dabei beschäftigt sich eine Mitarbeitende in Teilzeit ausschließlich mit Social Media und bedient dabei einen LinkedIn- und einen YouTube-Account. Auf ihren Kanälen berichtet die CSBW über Inhalte, Angebote und Kommunikation, bietet einen direkten Dialog zu Verwaltungsstellen an und soll als Anlaufstelle für Interessenten der CSBW fungieren. Von der Agentur heißt es, dass „Social Media als Kommunikationskanal Teil der Kommunikationsstrategie“ sei. Die CSBW veröffentlicht mehrmals wöchentlich verschiedene Inhalte auf ihren Social Media-Plattformen.
Cyber Security auf Social Media ist Talentanwerbung und Trendverfolgung
(BS/Paul Schubert) In der Cyber Security ist Awareness der Grundpfeiler einer funktionierenden Verwaltung. Um Aufmerksamkeit für die Themen zu generieren, versuchen Cyber-Sicherheitsbehörden auch auf den Sozialen Medien für ihre Inhalte zu werben. Wir haben einen Blick auf ausgewählte Cyber Security-Behörden auf Landes- und Bundesebene geworfen. Eine Behörde sticht hervor.
tenden aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreut. Ähnlich wie in der CSBW informiert das LSI Öffentlichkeit und Fachkreise über aktuelle Themen und Angebote aus der eigenen Cyber-Welt und versucht aktiv, IT-Talente anzusprechen. Dazu werden die Kanäle XING und LinkedIn verwendet. Der Umfang der Aktivitäten ist etwas unterhalb der CSBW anzusiedeln.
Der Bund wird kreativ
Die Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), hat aufgrund ihrer Größe und Budgets bessere Voraussetzungen, ihre Social-Media-Kanäle regelmäßig zu bespielen. Von den 1.707 Mitarbeitenden kümmern sich drei Vollzeitkräfte um die Themen Redaktion, Strategie und Umsetzung. Eine Teilzeitkraft beschäftigt sich mit dem Thema Verbraucherkommunikation und eine Teilzeitkraft mit Employer Brand/ Recruiting. Darüber hinaus werden auch „Fachleute in die Social Media-Aktivitäten eingebunden“. Dabei prüfen diese technische Aussagen, liefern Inhalte und sorgen dafür, dass die Posts fachlich fundiert und korrekt sind. Das BSI ist dabei umfangreich auf den einzelnen Netzwerken vertreten.
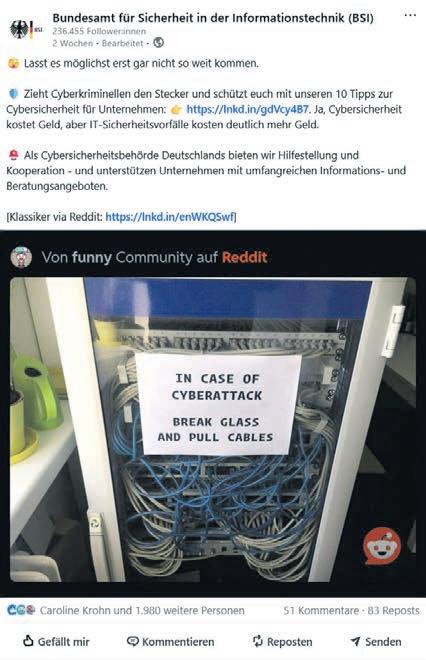
Die älteste und größte eigenständige Cyber-Sicherheitseinrichtung auf Landesebene mit 160 Mitarbeitenden ist das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) aus Bayern. Die Social-Media-Kanäle werden von Mitarbei-
Es beesitzt LinkedIn, Mastodon, Bluesky, YouTube, Instagram und XING. Nach eigener Aussage benutzt das Bundesamt Social Media, um „zielgruppengerecht, verständlich und aktuell über Cyber-Sicherheit zu informieren“. Das Interesse
an den Inhalten ist dabei groß. Allein auf LinkedIn folgen dem BSI etwa 236.000 Nutzende, auf Instagram sind es noch knapp 25.000. Das BSI setzt dabei auch auf Kooperationskampagnen.
auf die Anwerbung von neuen ITTalenten mittels der Sozialen Medien setzen. Eines bleibt auch noch hängen: Alle angefragten Behörden haben noch unbesetzte Stellen in diesem Bereich. Dennoch: der Öffentliche Dienst geht mit der Zeit.
ChatGPT-Actionfigur
„Für Social Media werden gezielt Fachleute aus
dem
gesamten BSI eingebunden.“
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Medienstrategie
So produzierte die Behörde im März dieses Jahres mit zwei YouTubern sogenannte „Challenges“, welche umfangreich ausgespielt wurden. Die Themen waren dabei z. B. die Vertrauensprüfung von Online-Shops während des Surfens auf einer (echten) Welle oder
die Einrichtung eines Gast-WLANs, während einer der YouTuber ein „zwiebelreiches“ Essen anrichtet. Damit möchte das BSI auf humorvolle Weise die Relevanz von Cyber Security vermitteln und nutzt die Reichweite bekannter Social-Media-Akteure, um neue Zielgruppen zu erreichen. Darüber hinaus: die Cyber-Sicherheitsbehörde machte auch bei der Erstellung einer ChatGPT-Actionfigur mit oder ließ BSI-Präsidentin Claudia Plattner 24 kurze Fragen jenseits von Cyber Security beantworten.
Immer auf der Suche nach neuen Ideen
Für die Cyber Security-Behörden ist die Nutzung von Sozialen Medien von entscheidender Bedeutung. Dabei muss es nicht gleich ein kreatives Musikvideo sein wie jenes von Prof. Dominik Merli von der Technischen Hochschule Augsburg (siehe Juni-Ausgabe des Behörden Spiegel, S. 30). Zudem zeigen alle Behörden, dass sie insbesondere


Die ChatGPT-Actionfigur war ein viraler Trend, der auf LinkedIn seinen Anfang nahm und sich rasch über Instagram und Co. verbreitete. Nutzende ließen sich mithilfe von KI als detailreich gestaltete Spielfiguren in Verpackung darstellen –inklusive Namen, Berufsbezug, Zubehör und typischem Retro-Design. Ein Selfie und ein kurzer Prompt genügten, um Teil des Hypes zu werden. Auch das BSI hatte sich im April auf Mastodon, Instagram und LinkedIn dem Trend angeschlossen.



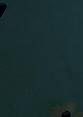




Behörden Spiegel Berlin und Bonn / August 2025














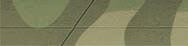














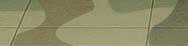
Zwischen den Zeilen schwingt ein gewisser Stolz mit. Dies ist natürlich verständlich nach einigen Jahren, bei denen das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) immer wieder Kritik einstecken musste. „Seit der Verabschiedung des BwBBG stellen wir deutliche Beschleunigungseffekte fest: In der letzten Legislaturperiode haben wir gut 180 sogenannte 25 MillionenEuro-Vorlagen erfolgreich durch das Parlament gebracht und in Verträgen mit einem Gesamtvolumen von knapp 150 Milliarden Euro umgesetzt. Aus dem Sondervermögen konnten wir im Jahr 2024 bereits erste Waffensysteme in die Bundeswehr einführen“, so eine Sprecherin des BAAINBw auf Anfrage des Behörden Spiegel. Die Bilanz des BwBBG kann sich also sehen lassen. Dies sei auch ein Resultat der beschleunigten Beschaffung auf der Grundlage des Gesetzes und interner Verkürzungen der Prozesse. Das BAAINBw habe neue Verfahren implementiert. „Zudem haben wir intern von fast 160 Verfahrensregeln gut 80 'über Bord geworfen', damit haben wir unsere Prozesse optimiert und sind entsprechend schneller geworden“, heißt es aus dem Bundesamt.
Die Beschleunigung sei deshalb möglich gewesen, weil man marktverfügbare Produkte gekauft habe und auf Goldrandlösungen verzichtet habe. Außerdem nutze das BAAINBw verstärkt Rahmenverträge, was den Abruf und damit die Lieferung von Material beschleunige. Dadurch könnten identische Produkte, wie z. B. persönliche Ausrüstung, geschützte und ungeschützte Führungs- und Funktionsfahrzeuge oder auch Munition,















kontinuierlich aus dem jeweiligen Vertrag abgerufen werden. Auch der Verzicht auf sogenannte Losvergaben wirke sich positiv auf die Beschleunigung aus. „Zeit ist nun der handlungsleitende Faktor“, so die Sprecherin des BAAINBw. Auch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) zieht eine positive Bilanz.
Leistungen aus einem Guss „Durch ein angepasstes BwBBG erhoffen wir uns weitere Vereinfachungen, indem wir zum Beispiel in vielen Fällen auf Ausschreibungen ganz verzichten oder Verfahren weiter verkürzen können“, heißt es vonseiten des BAAINBW. Es entwickelt die Kernpunkte des BwBBG konsequent weiter. U. a. wird der Anwendungsbereich des Gesetzes erweitert und bezieht sich nun auf alle Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge der Bundeswehr sowie der restlichen Geschäftsbereiche des BMVg. Die Pflicht zur Losaufteilung wird weiter ausgesetzt.
„Das BwPBBG stellt eine deutliche Weiterentwicklung des bisherigen BwBBG dar. Zwar knüpft es an bekannte Elemente an – etwa den Fokus auf Beschleunigung und marktverfügbare Produkte – doch es geht in vielerlei Hinsicht darüber hinaus“, schätzt Prof. Dr. Michael Eßig, Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Bundeswehruniversität München, den Entwurf ein. Ein Punkt sei die Förderung von Innovation – z. B. durch die Stärkung funktionaler Leistungsbeschreibungen oder durch die Möglichkeit, das Vergabeverfahren der Innovationspartnerschaft zu nutzen. „Das zeigt sich auch daran, dass wir uns mittlerweile in einer zweiten Phase be-
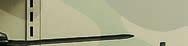






www.polizeitage.de
27.08.2025 |HILTON
DER SICHERHEITSBEHÖRDEN
www.behoerdenspiegel.de
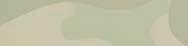








(BS/Bennet Biskup-Klawon) Eine der ersten Maßnahmen zur Modernisierung und Aufrüstung der Bundeswehr war das Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr (BwBBG). Hauptziel war der Zeitgewinn. Mit Version 2.0 – dem Bundeswehr-Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz (BwPBBG) – geht die Bundesregierung weiter, opfert aber auch Vergabeprinzipien.

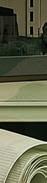











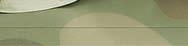
finden. Die erste Phase – das Sondervermögen – diente dazu, Defizite im Bestand kurzfristig zu beheben. Nun aber geht es darum, das Ziel der 3,5 Prozent dauerhaft zu erreichen und die Verteidigungsfähigkeit strategisch zu sichern. In dieser Phase reicht reine Geschwindigkeit nicht mehr aus – nun muss auch Innovationsfähigkeit systematisch gefördert werden“, so Eßig
Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) begrüßt das Vorhaben. „Das Vorgängergesetz hat ohne Frage bereits zu einer gewissen Beschleunigung der Beschaffung beigetragen, auch wenn diese Beschleunigung in Teilen auf Kosten der Angebotsmöglichkeiten für den wehrtechnischen Mittelstand ging und auch dort schon Rechtsschutz reduziert wurde“, erklärt Dr. Hans Christoph Atzpodien, BDSV-Hauptgeschäftsführer, auf Anfrage. Beschleunigung hat ihren Preis Der Rechtsschutz wird weiter aufgeweicht. Bei Beschwerden oder Rügen wegen Vergabeverstößen haben diese keine aufschiebende Wirkung. Selbst wenn in einem Nachprüfungsverfahren ein Verstoß des Auftraggebers festgestellt wird, kann die Wirkung des Vertrages erhalten bleiben, wenn nach Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung von Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen zwingende Gründe eines Allgemeininteresses dies rechtfertigen. Zudem kann dem Auftraggeber die Möglichkeit eingeräumt werden, Bagatellfehler zu beheben oder ein Vergabeverfahren einzuleiten, ohne dass die Finanzierung gesichert ist. „Natürlich führt der Fokus auf Beschleunigung zu Zielkonflikten –etwa beim Rechtsschutz. Es ist klar:










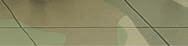
Alles hat seinen Preis. Verfahren nach Aktenlage, Verzicht auf mündliche Verhandlungen, elektronische Kommunikation – all das verändert die gewohnte Struktur des Vergaberechts“, stellt Eßig klar.
Mehr Souveränität
Neu ist u. a. auch, dass Vergaben nur auf Unternehmen aus EU-Staaten beschränkt werden können. Es soll möglich sein, zu verlangen, dass ein Anteil der beschafften Leistung aus der EU stammt. Außerdem ist vorgesehen, Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerbung durchzuführen, wenn nur ein bestimmter Hersteller aufgrund der Interoperabilität infrage kommt.
Zwar gewinnt die Bedeutung von Souveränität in der Diskussion immer mehr an Gewicht, doch merkt Eßig an: „Die Einschränkung auf europäische Anbieter ist richtig, aber es bleibt die Realität: Wir haben es mit global verzweigten Lieferketten zu tun. Auch wenn der unmittelbare Lieferant europäisch ist, sind viele Komponenten in der zweiten oder dritten Stufe der Wertschöpfungskette importiert – etwa aus China. Die vollständige Kontrolle dieser Ketten ist faktisch kaum möglich.“ Es brauche dazu noch ein strategisches Lieferkettenmanagement. Das kann der Gesetzgeber jedoch nicht alleine stemmen. Industrieseitig heißt es dazu von Atzpodien: „Neu sind diejenigen Passagen, die den Ausschluss von Bietern und Unterauftragnehmern erlauben, welche ihren Sitz nicht in der EU haben. Dies mag im einen oder anderen Fall gerade bei 'marktverfügbaren Produkten' zu weit gehen.“ Hier sei auch die Industrie gefragt. Medial herausgehobene Rüstungsprojekte wie die F-35, CH-47, P-8A Poseidon und PATRIOT-Systeme
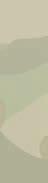
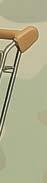


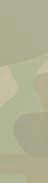


verstellten den Blick, heißt es vonseiten des BMVg. „Ganz grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass die überwiegende Zahl von Rüstungsgütern in Deutschland oder europäischen Ländern beschafft wird“, so eine BMVg-Sprecherin. Man ist sich jedoch bewusst, dass in einer globalisierten Welt mit verflochtenen Zulieferketten auch Rüstungsbeschaffungsprojekte oftmals einen multinationalen Bezug haben. Ein weiterer zentraler Punkt sei trotz allem der spürbare Versuch, den Wettbewerb zu stärken, sagt Eßig. Das zeige sich an mehreren Stellen des Gesetzes, etwa in der Vereinfachung von Unterlagen oder der Öffnung für zusätzliche Bieter. „Hintergrund ist ein reales Problem: Die Zahl der Bieter auf europäische Vergaben hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert – von etwa sechs auf gut drei pro Verfahren. Intern liegen uns ebenfalls Daten vor, die eine unbefriedigende Wettbewerbssituation bestätigen“, erklärt Eßig. „Dass diese Maßnahmen nicht kostenlos sind, ist offensichtlich. Wenn wir auf europäische Hersteller setzen, Innovationsförderung betreiben und die Qualität der Systeme erhöhen wollen, wird das zwangsläufig teurer“, so Eßig weiter.. Dies habe mit der sogenannten „Defense Inflation“ zu tun. Verkürzt gesagt: Dadurch, dass die neue Generation von Wehrprodukten immer wesentlich leistungsfähiger sei als ihre Vorgänger, schlage sich das immer auch im Preis nieder (sog. „Intergenerational Cost Escalation“, d. Red.). Generell sei der Entwurf mehr als eine Fortschreibung des Vorgängergesetzes. „Es ist ein strategisches Instrument, das – bei aller Komplexität – zeigt, dass man aus den ersten Erfahrungen gelernt hat.“
Eine
Polizistin und ein Polizist stehen bei strahlendem Sonnenschein vor dem Eingang zum U-Bahnhof Leopoldplatz. Sie halten einen Flyer, der über das kürzlich eingeführte Waffenverbot im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) informiert. Unter dem vom Instagram-Account der Polizei Berlin geposteten Beitrag steht: „Abschnittsübergreifend haben Kolleginnen und Kollegen der Direktion 1 gestern Abend verschiedene Bahnhöfe […] begangen, Flyer verteilt und Personen kontrolliert all das im Hinblick auf das Waffen- und Messerverbot im ÖPNV.“ Die Polizei Berlin informiert über ihre Arbeit – und dazu nutzt sie inzwischen seit 2018 die Social Media-Plattform Instagram. Aber nicht nur: Bereits ab 2014 war die Polizei Berlin auf Facebook und Twitter – heute X – und ein Jahr später auch auf YouTube zu finden. „Zwischenzeitlich hatten wir auch einen aktiven Snapchat-Kanal, der zwar nicht mehr bespielt wird, aber als Dialogkanal weiterhin offen ist – man kann uns dort noch anschreiben“, erklärt Yvonne Tamborini, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Berlin gegenüber dem Behörden Spiegel. Social Recruting, also die Nachwuchsgewinnung, betreibt die Sicherheitsbehörde hauptsächlich über TikTok und den digitalen Berufsberater, bzw. Influencer Mario auf Instagram. Als letzte Kommunikationsplattform kam Anfang Mai des vergangenen Jahres noch der WhatsApp-Kanal dazu. „Unser Ziel ist es, die gesamte Bevölkerung zu erreichen, die auf den diversen Plattformen unterwegs ist – von den Silver Agern bis hin zu den ganz Jungen“, betont Tamborini
Mehr als Imagepflege
Viele Polizeien in Deutschland finden inzwischen auf diversen Sozialen Plattformen statt. Die Gründe sind vielfältig. So erläutert Tamborini: „Die Social Media-Arbeit der Polizei ist ein fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit – besonders in Einsatzlagen, in Krisensituationen, zur Imagepflege und insbesondere zur Darstellung des Polizeiberufs.“ Bei der Polizei Berlin gehöre das inzwischen zum Standard. Die Social Media-Arbeit habe den Stellenwert
Ohne Social Media geht es für die Polizei nicht mehr
(BS/Mirjam Klinger) Instagram, TikTok und WhatsApp: Die Kommunikationswege der Polizeien werden immer breiter.
Über Soziale Medien will die Polizei Nachwuchs gewinnen und ihre Arbeit der Bevölkerung näherbringen.




















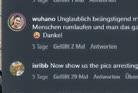

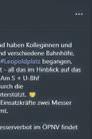
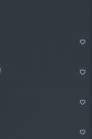


Polizeibeamte der Direktion 1 informieren am Berliner Leopoldplatz über das Waffenverbot im ÖPNV – und stehen dabei freiwillig für den Instagram-Auftritt der Polizei Berlin vor der Kamera und in der Öffentlichkeit.
Screenshot: BS/Klinger
einer modernen Bürgerkommunikation, weil sie per se im Dialog stattfinde. „Durch unsere Veröffentlichungen in Sozialen Netzwerken ermöglichen wir eine große Teilhabe – Menschen können Inhalte einfach und schnell mit Freunden und Familie teilen“, so Tamborini Das sei vor allem bei polizeilichen Ad-hoc-Einsätzen, großen Veranstaltungen und Versammlungen ein großer Vorteil und Standard. Polizeibeiträge entstehen auf unterschiedliche Weise. Manche sind langfristig geplant – wie der Post zum Waffenverbot im ÖPNV. „Das war ein längerer Prozess – ein geplanter Content. Den bereiten wir
Die neue Rolle der Dienste
Zwischen weltpolitischen Paradigmen und realweltlichen Bedrohungen
In diesem Jahr mit:
Marc Henrichmann, MdB, CDU, Vorsitzender PKGr, Deutscher Bundestag
Stephan Kramer, Präsident, Amt für Verfassungsschutz Thüringen
Vizeadmiral Dr. Thomas Daum, Inspekteur, Cyber- u. Informationsraum, Bundeswehr Konstantin von Notz, MdB, Bündnis90/Die Grünen, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Mitglied PKGr

vor, begleiten ihn medial und gehen teilweise live mit in den Einsatz“, sagt die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem gebe es auf Instagram auch Beiträge direkt von den Polizeibeamtinnen und -beamten. Sie haben die Möglichkeit, dem Social Media-Team Inhalte zu schicken, die zur Imagepflege beitragen oder den Polizeiberuf erlebbar machen – direkt aus dem Funkwagen oder auch mal als sogenannten Pet Content. Finden Berliner Polizistinnen und Polizisten ein herren- oder frauenloses Tier, können sie die Besitzerin oder den Besitzer über Instagram suchen. Laut Tamborini mit einer 80-prozentigen Erfolgschance. „Ohne Social Media könnten wir solche Fahndungen gar nicht machen.“ Glaubhaft und bürgernah wirkt die Kommunikation laut Tamborini durch kontinuierlichen Austausch, ehrliche Sprache, Lernprozesse und die Bereitschaft, Fehler einzugestehen. So müsse besonders bei sensiblen Themen, wie beispielsweise einem Verkehrsunfall, Rücksicht genommen werden – gerade auf die Perspektive der Betroffenen.

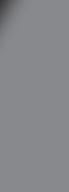

15. – 16. OKT 2025 Hotel Adlon Kempinski Berlin

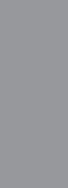
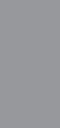

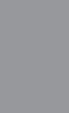






Ausbildung und Arbeitsalltag Inzwischen sind sechs Personen aus dem Social Media-Team der Polizei Berlin direkt in der Presseund Medienarbeit tätig. Mit ihrem Chef, dem Pressesprecher Florian Nath, verantworten sie die digitale Tages-, Einsatz- und Krisenkommunikation und gehen damit neue Wege. Seine Video-Statements direkt aus den Einsätzen stehen der Community sehr zeitnah zur Verfügung und auf weitere Kommunikationsbedarfe kann ebenso schnell reagiert werden. Zusätzlich gibt es drei Mitarbeitende in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie kümmern sich ausschließlich um die digitale Imagekommunikation und deren Contentproduktion. Im Bereich Human Resources (HR) sind nochmals sechs Personen mit dem Social Recruting befasst. Um für eine Polizei Social Media qualifiziert betreiben zu können, gibt es in Deutschland eine zertifizierte Fortbildung zum
Social Media Manager Polizei. In drei Wochen lernen die Mitglieder der Social Media-Teams der Polizeien des Bundes und der Länder an der Polizeihochschule MünsterHiltrup alles Wichtige: von SocialMedia-Strategien bis zu rechtlichen Fragen wie Medienrecht, Persönlichkeitsrecht und Datenschutz. Des Weiteren wird ihnen auch Community-Management, Krisenkommunikation, Bildbearbeitung und Videoschnitt beigebracht und am Ende erarbeiten die Teilnehmenden ein strategisches Konzept. Laut Tamborini lernen die Mitarbeitenden des Teams voneinander und im direkten Einsatz während ihrer Arbeit. „Das Team schaut sich im Jahr fast eine Million Kommentare und persönliche Nachrichten an. Das heißt, sie lernen sehr schnell, auch weil sie im Team arbeiten, sich austauschen, sich besprechen, wie man mit Postings und Reaktionen umgehen kann – und jede Reaktion mindestens im Vier-Augenprinzip erfolgt.“ Wichtig ist besonders der Umgang mit Kommentaren oder Privatnachrichten auf den Kanälen. Denn die sind, so Tamborini, überwiegend kritisch. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die unsere Inhalte gut finden, eher nicht kommentieren.“ Gegen Kommentare oder Privatnachrichten, die pietätlos sind oder die Schwelle zum möglicherweise Strafbaren überschreiten, geht das Team klar vor. Diese Reaktionen werden bei Bedarf ausgeblendet und gegebenenfalls angezeigt. „Man muss schon aufpassen, wenn man der Polizei schreibt – wir verfolgen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten selbstverständlich auch im Netz.“


Ein Blick hinter die Kulissen Das positive Feedback, welches die Behörde durchaus auch erreicht, wird meist über Privatnachrichten oder als Reaktion auf eine Instagram-Story verschickt. So erhält auch der hessische „Cop-Influencer“ Christopher, kurz Chris, immer wieder freundliche Nachrichten aus seiner Community. „Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind überwiegend positiv“, erklärt Chris beim Gespräch mit dem Behörden Spiegel. Der 31-jährige Polizeihauptkommissar betreibt seit Februar dieses Jahres einen Instagram-Account für die hessische Polizei. Neben sechs weiteren Polizeibeamtinnen und -anwärtern gibt Chris auf seinem Kanal unter dem Motto „Mehr als Blaulicht“ einen Blick hinter die Kulissen des Polizeialltags. Dabei füllen die sechs „Cop-Influencer“ ihre Instagram-Kanäle entweder alleine oder zu zweit. „Wir sind regelmäßig in Kontakt und es gibt selbstverständlich auch Absprachen zu unseren Postings. Grundsätzlich betreiben wir aber eigenständige Kanäle und veröffentlichen unseren eigenen Content“, so Chris Seit 2013 ist er bei der Polizei Hessen. Nach dem Studium begann er im Streifendienst im Hochtaunuskreis, wo sein Interesse für Verkehrssicherheitsarbeit wuchs. Es folgte ein Wechsel zur Autobahnstation Wiesbaden, bevor er 2019 zur Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) ging. Dort ist er heute als Fahrlehrer tätig, verantwortet die Fahr- und Fortbildung und unterrichtet Verkehrsrecht. Zu Instagram kam Chris über einen internen Aufruf der Polizei Hessen. „Als ich das gesehen habe, war ich direkt interessiert und habe mir überlegt, was ich dort kreativ darstellen könnte – über meine Person bei der Polizei.“ Inzwischen postet Chris regelmäßig über seinen Beruf als Fahrlehrer bei der Polizei, spricht dabei Themen wie Verkehrssicherheit an und klärt über die Motorradaus- und -fortbildung auf. „Instagram ist eine gute Plattform, um gerade junge Menschen zu erreichen – in allen Bereichen der Sicherheit“, betont der „CopInfluencer“. Alles rund ums Thema Motorrad komme besonders gut an, da die Motorrad-Community auf der Plattform stark vertreten sei. Das Projekt der Polizei Hessen mit den sieben „Cop-Influencern“ zielt neben der Aufklärung über Sicherheitsthemen auch auf die Nachwuchsgewinnung ab. Laut Chris mit Erfolg: „Ich bekomme regelmäßig Anfragen von Personen, die sich für den Polizeiberuf interessieren.“ So erhalte er Nachrichten wie: „Das, was du machst, würde mich auch interessieren.“ Oder: „Ich habe mich schon immer gefragt, wie man Motorradpolizist wird. Wo kann ich mich bewerben?“ Diese Anfragen beantworte er selbstverständlich gerne. Selbst dann, wenn er dafür auch mal nach dem Abendessen ans Handy muss. „Der Kanal kann nicht nur von 8 bis 16 Uhr betreut werden. Was ich abends auf der Couch mache, wird aber ebenfalls vergütet.“ Der Einsatz in den Sozialen Medien verlangt von den Beamtinnen und Beamten also nicht nur kommunikative Fähigkeiten, sondern auch ein gewisses Maß an Flexibilität im Alltag. Der Einsatz Sozialer Medien gehört wie in Hessen und Berlin bei vielen Polizeibehörden mittlerweile zur alltäglichen Kommunikation. Damit hat sich die digitale Präsenz als fester Baustein der modernen polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit etabliert.
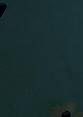
In jüngster Zeit mehrten sich einerseits terroristische Angriffe auf die Zivilbevölkerung, andererseits wurde die Polizei selbst direktes Ziel radikalisierter Gewalt. Die Straftäter haben eine Geschichte der Radikalisierung hinter sich, die bis heute von der Forschung und den deutschen Sicherheitsbehörden vernachlässigt wurde.
Doch um den Prozess der Radikalisierung zu verstehen, muss die Polizei mehr als den Radikalen vor sich sehen. Radikalisierung beginnt i. d. R. schon lange vor einer entsprechend motivierten Straftat und wird durch viele Faktoren beeinflusst.
Die Forschungsabteilung CEPOLIS ist Teil der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachberei Polizei, und hat sich im Forschungsprojekt PrAMiRa – Praxisbezogene Analyse von Herausforderungen im Kontext Migration und Radikalisierung – das Ziel gesetzt, den Polizeibeamtinnen und -beamten und Deradikalisierungmitarbeitenden in Bayern bzw. ganz Deutschland bei ihrer lebenswichtigen Arbeit neue Erkenntnisse zu liefern. Das 2024 gestartete Forschungsprojekt wird in Kooperation mit dem Bayerischen Landeskriminalamt durchgeführt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Unterstützung erfahren die Forschungspartner dabei durch das BKA und das BfV, die mit ihrer Expertise aus realen Fällen der jüngsten Vergangenheit praxisnahe Erfahrungen liefern.
Betrachtung auf jeder Ebene
Islamistische Radikalisierung durch Forschung verstehen
(BS/Tim Beyer/Daniela Obster) Radikalisierung ist kein isoliertes Phänomen und einzelnes Ereignis, sondern ein Prozess, der durch gesellschaftliche Dynamiken von der größtmöglichen Ebene bis zur persönlichen Perspektive begünstigt wird.
Die Polizei steht oft als Institution im Zentrum dieser Dynamik.

Das Projekt PrAMiRa untersucht Radikalisierungsverläufe Geflüchteter, um die Polizei und die Deradikalisierungsarbeit gezielt zu unterstützen.
Die Forschende legen im Projekt besonderes Augenmerk auf männliche Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund mit islamistischem Hintergrund, die in der letzten Dekade nach Deutschland gekommen sind. Sie schauen sich dabei nicht nur die persönliche Situation des jeweiligen Täters an, sondern versuchen, einen holistischen Ansatz über die Makro-, Meso- und Mikroebene zu finden, um möglichst viele Faktoren zu ermitteln, die zur Radikalisierung des Individuums geführt haben. Hinter diesen wissenschaftlichen Begriffen verbirgt sich ein innovativer Ansatz. Nicht nur soll der Täter kurz vor oder während der Straftat betrachtet werden, sondern es werden die gesellschaftlichen Umstände, unter denen ein Täter aufgewachsen ist, die Gruppendynamiken im Freun-
deskreis und in der Familie sowie die schlussendlichen Auswirkungen auf die psychologische Entwicklung beim Täter betrachtet – sowohl im Herkunftsland als auch später als Geflüchteter bzw. Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland.
Anonymisierte Fallanalysen
Die psychologische Ebene richtet den Blick auf das Individuum. Sie beantwortet etwa die Frage, wieso ein Mensch zu einer Gruppe gehören möchte. Denn innerhalb dieser wirken Gruppentendenzen, die das Individuum in seinen eigenen Einstellungen, Emotionen und Verhaltensweisen beeinflussen. Im hiesi-
gen Kontext steht dabei im Fokus, wieso ein Mensch im Sinne einer radikalen Ideologie handelt und dafür gar möglicherweise Gewalt ausübt. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, haben wir Stand Juni 2025 fünf anonymisierte Fallanalysen durchgeführt, in denen aufwendig Migrationsgeschichten, Gerichtsaussagen, psychologische Gesprächsprotokolle und Auswertungen von Social Media-Aktivitäten von nach Paragraf 129a oder 89a StGB verurteilten Straftätern als Quellen herangezogen, analysiert und kategorisiert wurden. Diese helfen dabei, die Täter „ganzheitlich“ zu verstehen und sollen, so die Hoffnung des Projekts, Typologien von Radikalisierungsverläufen aufzeigen.
Eine wichtige Frage für uns Forschende lautet dabei: Radikalisieren sich Geflüchtete bereits im Herkunftsland, also vor der Flucht, oder tritt die Radikalisierung erst nach Ankunft in einem fremden Kulturkreis, bspw. aufgrund von beengten Räumlichkeiten innerhalb einer deutschen Flüchtlingsunterkunft, auf? Dabei wird auch der innerdeutsche Diskurs über Flüchtlinge in den Blick genommen, um zu erkennen, ob eine ablehnende Haltung der Mehrheitsgesellschaft Radikalisierung begünstigen bzw. eine Willkommenskultur der Radikalisierung entgegenwirken kann.
Das Projekt soll noch bis Ende 2026 fortgeführt werden, aber bereits jetzt sind wir uns als Forschende
von CEPOLIS sicher, dass unsere Arbeit Früchte tragen wird. Mehrwert für die Polizei PrAMiRa schafft einen Mehrwert für die Polizei, da das Projekt einen ganzheitlichen Einblick für ebendiese liefern möchte. Es entsteht eine Synthese bedeutender Faktoren im Radikalisierungsverlauf, an dessen Ende Handlungsempfehlungen für die allgemeine Strategie der Polizeikräfte auf höchster Ebene sowie Ableitungen für die Praxis behördlicher Deradikalisierungsarbeit mit radikalisierten Individuen entstehen. Das ermöglicht den Beamten, ihren Umgang mit radikalisierten Geflüchteten und Migranten an aktuelle Forschungserkenntnisse und damit an neue Begebenheiten der Weltlage anzupassen.

Tim Beyer ist studierter Politologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei CEPOLIS. Sein Forschungsschwerpunkt liegt aktuell auf Radikalisierung, Desinformation und Organisierter Kriminalität. Foto: BS/privat

Daniela Obster ist studierte Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei CEPOLIS. Vor ihrer Tätigkeit dort arbeitete sie in der Deradikalisierung beim Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen aktuell auf Radikalisierung und Menschenhandel. Foto: BS/privat



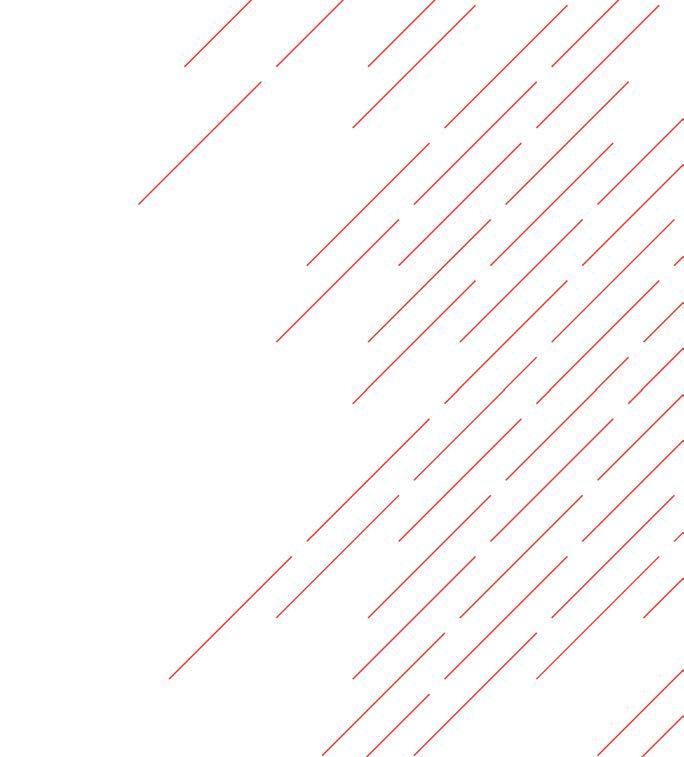

Wichtig ist es, bei diesen Formen der Massengewalt Terrorangriffe von Amoktaten zu unterscheiden. Während erstere politisch, ideologisch oder religiös motiviert sind und in erster Linie Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreiten sollen, sind Amoktaten in der Regel unmittelbare Reaktion auf persönliche Krisen oder Konflikte und von Verzweiflung, Hass oder Rachegefühlen getrieben.
Prof. Dr. Britta Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität in Gießen hat unter anderem die gesellschaftlichen Auswirkungen von Amoktaten und Anschlägen untersucht. Sie zeigte auf der OpferschutzFachtagung „Wenn das Messer trifft…Amoktaten und Anschläge – Aufarbeitung und Unterstützung der Opfer“ anhand einer Chronologie der letzten Massengewalttaten von Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, München und wiederum Mannheim Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deneinzelnen Taten auf. Während sich die Medien in der Folge häufig mit den Tätern beschäftigen, richtete die Veranstaltung, die die Behörden Spiegel-Stiftung gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg veranstaltete, einen besonderen Blick auf die Opfer solcher Gewalttaten.
Notfallseelsorge nach Solingen Simone Henn-Pausch , als Notfallseelsorgerin zuständig für die Psychosoziale Notfallversorgung von Einsatzkräften und Betroffenen, berichtete von der Nachversorgung traumatisierter Opfer und deren Angehörigen in der Folge des Messeranschlags von Solingen. Das Team für psychosoziale Unterstützung (PSU) der Johanniter-Unfall-Hilfe war bis in die Nacht von Freitag auf Samstag hinein dafür zuständig, die Angehörigen
B
ehörden Spiegel: Von was für einer Steigerung bei den Aufwendungen für Ausbildung, Material und Fahrzeugen sprechen wir?
Dr. Ralf Selbach: Die letzte Gesamterhebung der Aufwendungen und Erträge im DRK-Katastrophenschutz in Niedersachsen wurde für das Jahr 2018 durchgeführt. Im Vergleich zu 2018 sind die Ausgaben im Jahr 2023 um etwa 50 Prozent gestiegen. Der rasante Ausgabenanstieg begründet sich in Erweiterungen der Vorhaltung sowie rasant gestiegenen Preisen.
Behörden Spiegel: Wie groß ist mittlerweile die Lücke zwischen Ausgaben und der Erstattung durch das Land?
Dr. Selbach: Als DRK sind wir die mit Abstand größte Hilfsorganisation und haben 2023 über elf Millionen Euro für den Katastrophenschutz verausgabt, Land und Kommunen haben etwa 3,3 Millionen Euro hierzu beigetragen – weniger als ein Drittel.
Behörden Spiegel: Besteht die Gefahr, dass die Katastrophenschutzeinheiten des DRK nicht mehr einsatzfähig sind?
Dr. Selbach: Um den DRK-Katastrophenschutz in Niedersachsen bedarfsgerecht ausbauen zu können, brauchen wir dringend mehr Mittel. Wir haben errechnet, dass 1,50 Euro pro Einwohner und Jahr erforderlich sind. Wollen wir den Status quo bewahren, braucht es mindestens einen Euro pro Einwohner. Derzeit bekommen wir im Durchschnitt 0,31 Euro pro Einwohner. Sollte es hierbei bleiben, kommt es unweigerlich zum Abbau von Kapazitäten, weil wir als DRK nicht mehr in der Lage
Nach Massengewalttaten ist die Nachbetreuung von immenser Bedeutung
(BS/Lars Mahnke) In letzter Zeit kam es wiederholt zu Anschlägen, bei denen die Täter möglichst hohe Opferzahlen angestrebt hatten. Dies nicht zuletzt, um ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen. Genau dies – da sind sich die meisten Opferschützer einig – sollte aber verhindert werden. Vielmehr müsse der Blick auf die Opfer und deren Nachbetreuung gerichtet werden.

der Opfer zu betreuen. Dies erfolge idealerweise gemeinsam mit der Polizei, die für die Überbringung der Todesnachricht zuständig ist.
Allerdings, kritisiert Henn-Pausch, machten die PSU-Teams „in letzter Zeit häufiger die Erfahrung, dass die Polizei uns gar nicht dazuholt oder nur verspätet“.
Vom Publikum wurde kritisiert, dass es für die NotfallseelsorgeTeams oft zu schwierigen Situationen komme, wenn die Polizei beim Eintreffen nicht mehr vor Ort sei. Eine engere Zusammenarbeit sei wünschenswert. Der mangelnde Wissenstransfer zwischen den Generationen sei für dieses Problem
verantwortlich, was eine Führungsaufgabe darstelle: Bei den Trainings zur Überbringung der Todesnachricht, sollte vermittelt werden, dass die Anwesenheit eines SeelsorgeTeam sichergestellt wird. Um Posttraumatische Belastungsstörungen zu vermeiden, sei dies auch im EUGesetz so festgelegt worden. Der personelle Aufwand sei enorm gewesen, nicht zuletzt aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit – so seien allein zwei Kräfte für die Betreuung der Presse gebunden gewesen. Man habe in Absprache mit der Stadtkirche versucht, Letztere so gut es ging von den Trauernden fernzuhalten, um diesen einen angemessenen Ort für ihre Trauer anbieten zu können. Die Einsatznachbereitung erfolgte am Sonntag für insgesamt 120 Einsatzkräfte sowie das Ordnungsamt der Stadt. Im Anschluss wurde der Bevölkerung im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes, an dem auch die damalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) teilnahm, die Gelegenheit gegeben, ihrer TrauerAusdruck zu verleihen. Hier traten auch Ersthelfer an die Seelsorgerinnen und Seelsorger heran, um Hilfe zu erhalten. Diese wurde durch das Heranziehen eines zusätzlichen PSU-Teams ermöglicht. Zudem wurde für die Bevölkerung in der Folgewoche
DRK-Landesverband Niedersachsen unter Druck (BS) Vertreter der Katastrophenschutzorganisationen in Niedersachsen schlagen Alarm. „Die laufenden Kosten für Treibstoffe, Mieten, Strom und vieles anderes steigen seit Jahren, die Zuweisungen des Landes aber nicht. Das kann so nicht weitergehen“, mahnt
DRK-Landesgeschäftsführer Dr. Ralf Selbach. Die finanzielle Lage der Katastrophenschutzeinheiten sei dramatisch. Im Interview erklärt er, wie viel tatsächlich gebraucht wird. Die Fragen stellte Bennet Biskup-Klawon.

Dr. Ralf Selbach, niedersächsischer DRK-Landesgeschäftsführer, warnt vor Kapazitätsabbau. Foto: BS/Isabell Massel, DRK-LV Nds.
sind, eine gesetzliche Aufgabe der Kommunen zu zwei Dritteln aus eigenen Mitteln zu finanzieren.
Behörden Spiegel: Was soll aus dem Topf des Sondervermögens in den Katastrophenschutz investiert werden?
Dr. Selbach: Katastrophenschutz ist Ländersache. Das Sondervermögen wird vom Bund zur Verfügung gestellt und der Bund ist zuständig für
den Zivilschutz. Unter dem Begriff Zivilschutz werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die im Verteidigungsfall zum Tragen kommen. Da wir hier in den vergangenen 30 Jahren nahezu alle Strukturen abgebaut haben, besteht erheblicher Nachholbedarf. Insofern haben wir mit dem Zivil- und Katastrophenschutz quasi zwei Großbaustellen.
Behörden Spiegel: Im Bundesrat kursiert diese Forderung: zehn Mil-
zwischen 16 und 19 Uhr eine Nachmittagsbetreuung durch die Notfallseelsorge angeboten.
Nachbetreuung positiv bewertet Thea Ilse von der Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland berichtete ihrerseits von der Opferbetreuung im Anschluss an die Amokfahrt von Magdeburg kurz vor Weihnachten 2024. Den Rettungskräften kam seinerzeit zugute, dass zufällig ein ehemaliger Leiter des Katastrophenschutzes sowie aufgrund eines Geburtstages 30 Ärzte in der Nähe des Tatorts waren. Nach der Einrichtung zweier Notbehandlungsplätze konnten die 35 Schwerstverletzten innerhalb einer Dreiviertelstunde zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden.
Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) hatte für den Abend einen eigenen Einsatzabschnitt erhalten, wobei die zwei Teams mit 40 Magdeburger Kräften durch 30 weitere Notfallseelsorger aus dem Umland unterstützt wurden. Die weitere Betreuung wurde von auswärtigen Teams übernommen und stand von 9 bis 18 Uhr in den Folgetagen zur Verfügung. Ilse hob das Mitmenschliche und den Beistand aller Betroffenen vor Ort hervor. Auf der Betroffenenliste seien insgesamt 1.200 Menschen erfasst und in der Folge Kontakt zu denjenigen aufgenommen worden, die weitere Hilfe benötigt hätten. Über Gespräche konnten zudem weitere Betroffene ermittelt werden. In mehr als 170 Fällen erfolgte eine zügige psychotherapeutische Unterstützung über die Notaufnahme, die bis März dieses Jahres fortgesetzt wurde. Von der Kassenärztlichen Vereinigung wurden zudem innerhalb von einer Woche drei Therapeutensitze angeboten. In der Mehrzahl habe es positive Rückmeldungen zur direkten Nachbetreuung gegeben.
Behörden Spiegel: Wie kann der Katastrophenschutz in Niedersachsen zukunftsfähig gemacht werden?
„Sollte es hierbei bleiben, kommt es unweigerlich zum Abbau von Kapazitäten, weil wir als DRK nicht mehr in der Lage sind, eine gesetzliche Aufgabe der Kommunen zu zwei Dritteln aus eigenen Mitteln zu finanzieren.“
liarden in zehn Jahren für den Bevölkerungsschutz. DRK-Generalsekretär Christian Reuter nannte einmal die Zahl von 0,5 Prozent des Bundeshaushalts für den Bevölkerungsschutz. Wie schätzen Sie das ein?
Dr. Selbach: Unter Bezugnahme auf die geschilderten immensen Herausforderungen im Zivil- und Katastrophenschutz ist die Forderung des Bundesverbandes angemessen.
Dr. Selbach: Zunächst benötigen wir eine verlässliche Finanzierung unserer konsumtiven Kosten, die zur Wartung, Instandhaltung sowie Unterbringung von Fahrzeugen und Material des Katastrophenschutzes entstehen. Hierauf aufbauend können Strukturen fortentwickelt werden. Für uns spielt beispielsweise der Betreuungsdienst eine immer größere Rolle im Katastrophenschutz. Hier gilt es nachzubessern. Daneben benötigen wir noch mehr ehrenamtliche Unterstützung für die vor uns liegenden Herausforderungen. Zurzeit sind 8.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im DRK-Katastrophenschutz aktiv. Für sie und für weitere neue Helfer/-innen benötigen wir gutes Material, Schutzkleidung sowie hochwertige Aus-, Fort- und Weiterbildung. Unsere Einsätze werden immer komplexer – hierauf müssen wir unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden entsprechend vorbereiten.
Behörden Spiegel: Vor welchen Herausforderungen steht das DRK in Niedersachsen?
Dr. Selbach: Wenn die Finanzierung unserer Aktivitäten im Katastrophenschutz gewährleistet wird, liegt es an uns, in ganz Niedersachsen attraktive Rahmenbedingungen für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Bevölkerungsschutz zu schaffen. Hierfür bedarf es einer guten Ausrüstung, vernünftiger Unterkünfte sowie moderner, zeitgemäßer Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung und agiler Führungsstrukturen.
Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Bundestagsabgeordneten Jan Köstering (Die Linke) hervor Insbesondere das Thema Doppelverpflichtungen bzw. Doppelfunktion steht dabei im Vordergrund. So sei z. B. nicht klar, wie viele Soldatinnen und Soldaten oder Polizistinnen und Polizisten auch ehrenamtlich bei den verschiedenen Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk (THW) oder dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) tätig sind. In der Antwort heißt es: „Sowohl die Bundeswehr als auch die übrigen Organe des Bundes und die genannten Hilfsorganisationen wie die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) erfassen derzeit mangels rechtlicher Grundlage keine Doppelmitgliedschaften in anderen Behörden und Organisationen — weder hinsichtlich eines zusätzlichen Ehrenamtes noch einer hauptamtlichen Tätigkeit.“
Sollte ein Zivilschutzfall vorliegen, müssen sich staatliche Stellen, wie die Bundeswehr oder die Polizei, weniger Sorgen machen, da sowohl Soldatinnen und Soldaten als auch Polizistinnen und Polizisten hoheit-
Mehrfach verpflichtet, nur einmal einsetzbar
(BS/bk) Stell dir vor, es ist einen Spannungsfall und keiner kommt. Das kann tatsächlich passieren. Aber nicht etwa, weil sich niemand engagiert oder sich alle drücken, sondern weil ehrenamtliche Einsatzkräfte im Zivilschutz schon anderweitig benötigt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass anscheinend die Bundesregierung keinen Überblick darüber hat, wie viele einsatzfähige Kräfte im Ernstfall tatsächlich zur Verfügung stehen.
liche Aufgaben haben, zu denen sie verpflichtet sind. Die Schwierigkeiten haben eher die Hilfsorganisationen.
Bekanntes Problem und erste Lösungsansätze
Das Problem der Doppelverpflichtungen ist auf operativer Ebene schon bekannt. So plant der Malteser Hilfsdienst (MHD), Daten zu den Doppelverpflichtungen seiner ehrenamtlichen Einsatzkräfte bis zum Ende des Jahres zu erheben. „Viel hängt von einer intelligenten Führung und Steuerung der Helferpotentiale ab. Trifft uns die eine große Krise flächendeckend und zeitgleich in Deutschland, ist es natürlich ein Problem“, sagt ein Sprecher der Hilfsorganisation gegenüber dem Behörden Spiegel.

Wie viele Kräfte stehen dem Zivilschutz zur Verfügung? Die tatsächlichen Zahlen sind anscheinend nicht bekannt. Foto: BS/Biskup-Klawon
Bei lokal begrenzten Krisen sei dies weniger der Fall. Vonseiten des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) heißt es auf Anfrage: „Wir gehen
Albrecht Broemme über Krisenmanagement in Deutschland (BS) Wie bereitet man sich auf Krisen und Katastrophen der Zukunft vor? THW-Präsident a. D. Albrecht Broemme, dem „Krisenmanager der Nation“, hat seinen Erfahrungsschatz in einem Buch veröffentlicht. Im Gespräch erklärt er, welche Ratschläge er hat und was ihn selbst überrascht hat. Die Fragen stellte Bennet Biskup-Klawon.
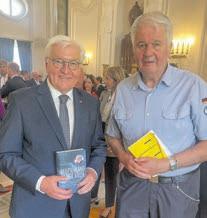
Albrecht Broemme (rechts) überreicht sein Buch an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: BS/privat
Behörden Spiegel: Warum haben Sie das Buch geschrieben?
Albrecht Broemme: Ich wurde im privaten und beruflichen Umfeld immer wieder angesprochen – 'Du musst mal ein Buch schreiben!' Und ich habe oft geantwortet: 'Ja, das müsste ich mal machen.' Letztes Jahr habe ich dann beschlossen: Ich höre mit diesem 'man müsste mal' auf: entweder man macht es oder man lässt es bleiben. Ich habe allerdings die Methode verändert: Aus Podcasts und Interviews habe ich gesprochene Inhalte zusammengetragen. Das Buch ist also im Wesentlichen ein Mosaik aus gesprochenem Wort, das mithilfe eines Journalisten zu Text verarbeitet wurde. Viele Leserinnen und Leser sagen: „Wenn ich das Buch lese, höre ich Sie reden.“ Und das freut mich sehr.
Behörden Spiegel: Sie stellen im Buch ein Potpourri an Krisen und Katastrophen dar. Wie haben Sie diese Szenarien ausgewählt – nur rückblickend oder auch mit Blick in die Zukunft?
Broemme: Diese Szenarien sind das Ergebnis jahrelanger Überlegungen und Gespräche mit Fachleuten, vor allem im europäischen Ausland. Ich habe mich gefragt: Was sind die realistischen, denkbaren Szenarien, die uns auf europäischer Ebene künftig beschäftigen werden? Anfangs dachte
ich noch, diese Ereignisse würden immer einzeln auftreten – das hat sich inzwischen als falsche Annahme herausgestellt. Die Szenarien hatte ich bisher nicht veröffentlicht. Am Ende jedes Szenarios gebe ich eine kurze Einschätzung: Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit – grob gesagt: hoch oder niedrig? Und: Wie schnell würde sich die Wirkung entfalten – langsam oder schnell? Ich habe das bewusst einfach gehalten, um ein grobes Raster zu bieten.
Behörden Spiegel: Gab es beim Schreiben Erkenntnisse, die Sie selbst überrascht haben?
Broemme: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich hinsetzt und die Gedanken systematisch aufschreibt, muss man sich klar werden: Was will ich eigentlich sagen? Es reicht nicht, ein Problem zu beschreiben – man muss auch eine Botschaft oder eine mögliche Lösung mitliefern. Für fast jedes Kapitel habe ich daher versucht, konkrete Vorschläge zu formulieren. Diese Lösungsvorschläge stehen am Ende der Kapitel jeweils in grau hinterlegten Kästen. Sie sollen nicht nur zeigen, was nicht funktioniert, sondern auch Ansätze bieten, was wir tun können – konkret und umsetzbar.
Behörden Spiegel: Im Buch schreiben Sie, dass jede Katastrophe immer eine politische Dimension hat. Was meinen Sie damit?
Broemme: Katastrophen sind nicht nur Naturereignisse oder technische Zwischenfälle – sie sind immer auch politische Ereignisse. Es braucht politische Entscheidungen: Wird der Katastrophenfall ausgerufen oder nicht? Wer schlägt das vor und auf welcher Grundlage? Und was bedeutet das dann für das staatliche Handeln? Die Politik muss bereit sein, eine Krise auch als solche zu benennen – und nicht so tun, als sei das nur ein Störfall, der bald vorbei ist. Ein gutes Beispiel ist die Corona-Pandemie: Anfangs wurde sie lange kleingeredet, obwohl bereits
viele Menschen gestorben waren. Das hat wertvolle Zeit gekostet, in der man hätte handeln können – oder zumindest planen.
Behörden Spiegel: Wie bereitet man sich auf Krisen vor, die man noch gar nicht erlebt hat – wie zum Beispiel einen Meteoriteneinschlag?
Broemme: Gute Frage. Vieles kann man heute recherchieren. aber natürlich stößt man im Internet auch auf viel Unsinn. Allein zu erkennen, was fundiert ist und was nicht, ist schon eine Herausforderung. Ich glaube nicht, dass es an Erkenntnissen mangelt – wir leiden eher an der Umsetzung. Wir müssen bereit sein, unbequeme Wahrheiten anzuerkennen. Auch wenn etwas vielleicht Jahre dauert, muss man trotzdem heute damit anfangen. Meteoriteneinschläge sind ein Naturereignis, wo wir ziemlich machtlos wären. Es bliebe nur die Flucht. Ein anderes Beispiel ist die Vorbereitung auf militärische Konflikte. Wir hoffen natürlich, dass es hier nicht zum Krieg kommt – aber schon ein Krieg in der Nähe hätte massive Auswirkungen auf unsere Krankenhäuser, auf die Straßenlogistik, auf die Energieversorgung. Solche Szenarien muss man durchdenken, bevor sie eintreten. Das gilt auch für Starkregen, Hitzewellen, Unwetter, Pandemien. Die nächste Pandemie wird kommen – da sind sich Fachleute weltweit einig. Die Frage ist nur: Was für eine wird es sein?
Behörden Spiegel: Haben Sie einen allgemeinen Ratschlag?
Broemme: Ja, und er ist einfach: Bereite dich in Ruhe auf eine Katastrophe vor – dann bist du im Ernstfall nicht so schnell überfordert. Ich habe Vorträge schon oft mit dem Ratschlag beendet: „Sei vorbereitet! Es kommt schlimmer, als Du denkst.“
Das Buch „Deutschland in der Krise“ ist im riva-Verlag erschienen. In Newsletter Rettung. Feuer. Katastrophe. kommentiert er alle zwei Wochen den deutschen Katastrophenschutz.
Einsatzplanungen. Bei der Ausgestaltung der Schutzverordnung werde beispielsweise genau geprüft, welche Fähigkeiten welcher Verwaltung realistisch zugewiesen werden könnten. Dabei zeige sich: Nicht alle Fähigkeiten könnten jederzeit parallel bereitstehen.
Umfrage offenbart Lücke auch im medizinischen Bereich
davon aus, dass 20 bis 30 Prozent unserer Ehrenamtlichen — über ihr Engagement beim ASB hinaus — bei weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen, Feuerwehren und anderen HiOrgs aktiv sind. Wenn der Rettungsdienst auch als KRITIS betrachtet wird, gehen wir von 40 Prozent aus. Die Quote an Reservisten im Ehrenamt dürfte eher gering ausfallen.“ Auch hier schätzt man das Problem ähnlich ein: „In Katastrophenlagen war das bisher kein großes Problem, im Rahmen eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls könnte das jedoch ein Problem werden. Der Gesetzgeber sollte hier Regelungen treffen und Unabkömmlichkeiten feststellen.“
Nicht immer alles verfügbar „Das Thema ist komplex, aber gut bekannt und im Fokus. Oft sind engagierte Ehrenamtliche in mehreren Strukturen aktiv“, sagt auch René Schubert, Präsident des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Rheinland-Pfalz. Die Frage der realen Verfügbarkeit sei zentral für alle
Bereits Anfang des Jahres machte Dr. Andreas Follmann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin (DGKM), auf dem Forschungskongress des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf das Problem aufmerksam. Die Gesellschaft führte im vergangenen Jahr eine Umfrage durch, an der 4.200 Personen, davon 3.681 Ehrenamtliche, teilgenommen haben, um die Problematik der Doppelverpflichtungen zu untersuchen. Die finalen Ergebnisse befinden sich momentan noch in einem wissenschaftlichen Review-Prozess und sind noch nicht veröffentlicht, teilt Follmann gegenüber dem Behörden Spiegel mit. Bei den vorläufigen Ergebnissen kam jedoch zum Vorschein, dass gerade bei medizinischem Personal eine Doppelverpflichtung vorläge. Rund 20Prozent der Befragten hätten mehr als ein Ehrenamt im Bevölkerungsschutz – oft sind es sogar drei oder mehr. Viele leitende Notärzte fungieren gleichzeitig als Gruppen- oder Zugführer. 57 Prozent der organisatorischen Leiter seien zudem Verbandsführer. Follmann selbst ist dabei das beste Beispiel für eine Doppelverpflichtung. Er ist Anästhesist an der Uniklinik Aachen, Notarzt bei der Feuerwehr Aachen sowie im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz aktiv. Im Ernstfall könne er nicht alle Rollen gleichzeitig ausfüllen. Als Lösung schlägt Follmann vor, die Qualifizierung und Ausbildung im medizinischen Bereich bei Helfenden zu verstärken, um Abhängigkeiten zu senken, flexiblere Konzepte zu schaffen sowie die Ungleichheiten bei der Helferfreistellung abzubauen.
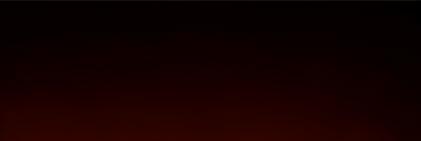
KATASTROPHENSCHUTZKONGRESS
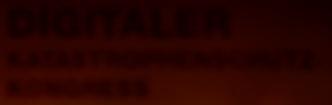
9.–10. SEPTEMBER 2025


EINSATZ DER ZUKUNFT
Alltag meets Zivilschutz und Klimawandel


www.katastrophenschutzkongress.de
Rund 49 Millionen Euro ist dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Beschaffung von 4.375 Clip-on-Wärmebild geräten für die Bildverstärkerbrille der deutschen Infanteristinnen und Infanteristen wert. Die Gerä te des Typs IRIS versprechen dank Bildfusion eine deutlich verbesser te Wahrnehmung der Umgebung. Bei dem Verfahren werden Nacht sichtinformationen der Bildverstär kerbrille mit Wärmebildinformatio nen des Clip-on-Geräts überlagert. Konkret werden die Eigenschaften der Restlichtverstärker- und Wär mebildtechnik in einem Gesamt bild kombiniert. Damit sind die technischen Fähigkeiten des Ge räts aber noch nicht erschöpft: In seiner fortschrittlichsten Konfigu ration kann IRIS zusätzlich zum Wärmebild auch Augmented-Rea lity(AR-)Informationen projizieren. Außerdem kann sich die Clip-onLösung mit bestehenden BattleManagement-Systemen wie ATAK verbinden. Dieses System soll Sensoren und Effektoren effizient vernetzen. Ob die Bundeswehr diese Mög lichkeiten ausschöpfen wird, ist unklar. Bisher richteten sich die Bemühungen der deutschen Streit kräfte im Bereich AR und Virtual Reality (VR) vornehmlich auf Trainings- und Ausbildungsverfahren. Ein Blick auf die zurzeit laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Innovationsvorhaben des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr (CIHBw), in denen VR/AR zum Einsatz kommt, verdeutlicht das: Mit TrainAR, DrivAR und Raptor FPV nehmen drei von vier Innovationsvorhaben Ausbildungsprozesse in den Blick. Konkret streben TrainAR und dessen Weiterentwicklung DrivAR an, Probleme in der Kraftfahrerausbildung aufgrund fehlenden Materials durch AR zu mildern. Zu diesem Zweck stellt das System den Ausbilderinnen und Ausbildern ein sogenanntes AR-Toolkit zur Verfügung. Dadurch sind sie befähigt, virtuelle Lehrmaterialien und AR-Hologramme verschiedenster Fahrzeugtypen eigenständig zu erstellen und einzusetzen. Die auszubildenden Soldatinnen und Soldaten können wiederum dank der AR-Brillen die zuvor erstellten

Krisenzeiten ändern auch die Beschaffung – ein Wandel hin zu handfesten Gütern. Viel Geld wurde und wird vermehrt in die Ausrüstung und physische Infrastruktur von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) investiert. Beispiele gibt es viele: Das bislang größte Einzelbeschaffungsverfahren der Bundespolizei (BPOL), die Beschaffung von bis zu 44 Transporthubschraubern des Typs, H225 konnte 2024 nach eineinhalb Jahren mit insgesamt drei Monaten Verhandlungszeit auf den Weg gebracht werden. Dies sei notwendig gewesen, „um bei diesem äußerst komplexen Produkt eine konsensfähige Einigung zu erzielen“, heißt es vonseiten des Beschaffungsamtes des BMI (BeschA). Die Zeit war nötig, da die Leistungsbeschreibung rund 300 Seiten stark war. Die Auslieferung des ersten Hubschraubers ist für 2029 geplant. Insgesamt hat die vom BeschA geschlossene Rahmenvereinbarung mit dem Hersteller Airbus Helicopters eine Laufzeit bis 2037. Das Auftragsvolumen liegt bei 1,9 Milliarden Euro.
Steigender Anteil für Innere Sicherheit
Bei den deutschen Streitkräften werden virtual und Augmented Reality noch primär in Ausbildungsszenarien gedacht. Foto: BS/BWI
Anwendungsszenarien absolvieren. Ähnlich verhält es sich mit Raptor FPV. Ziel dieses Entwicklungsprojekts ist es, eine realistische Ausbildung an sogenannten First-Person-View-Drohnen zu ermöglichen. In der Ukraine kommen sie bereits umfassend zum Einsatz. Die Simulation erlaubt unter anderem das Trainieren des Abwurfs von Wirkmitteln. Dank automatisierter Szenarioerstellung aus Satellitendaten kann Raptor FPV einsatzspezifisch angepasst werden.
Ein echter Wendepunkt
Trotz des Fokus auf Ausbildungssysteme erprobte die Bundeswehr auch operative Systeme. Das Augmented Common Operational Picture (ACOP) wurde 2024 erstmals als AR-System in bestehende Führungsinformationssysteme der Bundeswehr integriert. Es ermöglicht eine realitätsnahe, interaktive 3D-Visualisierung des Gefechtsfelds. Durch eine Mixed-Reality-
Brille können sich Soldatinnen und Soldaten virtuell im Operationsraum bewegen und direkt mit der Lage interagieren. ACOP kam bereits bei NATO-Übungen wie „Schneller Degen 23“ und „Quadriga 24“ zum Einsatz. Der Leiter des CIHBw, Sven Weizenegger, zeigt sich von der Technologie und den bisher erprobten Systemen überzeugt: „Die Innovationskraft von Virtual und Augmented Reality markiert einen echten Wendepunkt für die Ausbildung und Einsatzvorbereitung sowie reale Einsätze der Bundeswehr.“ Gerade in einem sicherheitsrelevanten Umfeld, in dem Zeit, Material und Verfügbarkeit begrenzt seien, eröffneten VR und AR die Möglichkeit, komplexe Szenarien realitätsnah, risikolos und ortsunabhängig zu trainieren, führte Weizenegger weiter aus. Zu einem ähnlichen Schluss kam die Wehrtechnische Dienststelle 91 (WTD 91) im vergangenen Jahr. Drei
Jahre lang erprobte die WTD gemeinsam mit dem Münchner Software-Unternehmen Hologate eine Extended-Reality-Trainingslösung. Die Ergebnisse flossen in der Studie „Virtual Training of Urban Operations as a Multi-user Scenario“ (VIRTUOS) zusammen.
Ärger im Paradies
Deutschland ist beim Thema AR und VR bemüht; im Vergleich zu den Investitionen, die in den USA — dem in diesem Bereich führenden Staat — getätigt werden, sind die Aufwendungen der Bundesrepublik aber marginal. Seit 2018 läuft in den Vereinigten Staaten das Integrated Visual Augmentation System (IVAS)-Programm der U.S. Army. Anspruch von IVAS war, ein Augmented-Reality-Headset, das Sensorbilder und andere Informationen ins Sichtfeld der Soldatinnen und Soldaten einblendet, zu entwickeln. Den Zuschlag für das Entwicklungs -
Rekordvolumen für Innere Sicherheit
(BS/bk) Es sind Meldungen, die Pressestellen von Innenministerien gerne verbreiten. Dort wurde ein Vertrag über Summe X für die Ausrüstungsgestand Y beschlossen. Einsatzfahrzeuge konnten an die Kräfte des Landes ausgegeben werden. Und tatsächlich steigt das Investitionsvolumen. Das zeigt ein Bericht der zentralen Beschaffungsstelle des Bundesinnenministeriums. Doch die Forderung nach einem Mehr besteht. Es bleibt dabei aber immer die Frage, wer die Beschaffungen bezahlt.
projekt im Umfang von 22 Milliarden US-Dollar konnte sich der USSoftware-Riese Microsoft sichern. Konkret plante das von Bill Gates gegründete Unternehmen, das hauseigene Mixed-Reality-HeadMounted-Display „HoloLens 2“ auf militärische Bedarfe anzupassen. Allerdings gestaltete sich die Entwicklung von Anfang an schwierig. Schnell wurde offenbar, dass die geplante Indienststellung im Jahr 2021 nicht zu halten war. Hinzu kam wiederholte Kritik am Produkt und dem Projektmanagement – von politischer, aber auch militärischer Seite. Microsoft tat sich schwer, die Ansprüche der Soldatinnen und Soldaten zu erfüllen. Das Entwicklungschaos gip felte im Februar 2025 in der Entziehung der Projektleitung durch die U.S. Army. Statt des Weltmarktführers aus Seattle zeichnet nun das Rüstungs-Start-up Anduril für die Fortentwicklung von IVAS verantwortlich. Microsoft ist auf die Rolle des Cloud-Providers zurückgestuft worden.Mittlerweile hat die U.S. Army bereits den Nachfolger des IVAS-Programms, das Soldier Borne Mission Command (SBMC), beauftragt. Microsoft wird dabei nicht länger mitwirken. Stattdessen arbeiten Anduril und Meta –das Unternehmen hinter Facebook – zusammen. Technisch stützen sich beide Firmen auf die Arbeit von Metas AR/VR-Forschungszentrum Reality Labs. Konkret soll das KI-Modell Llama mit der Kommando- und Kontrollsoftware Lattice von Anduril verknüpft werden. Auf diese Weise entsteht ein Heads-upDisplay, das die Truppe im Feld mit Informationen in Echtzeit versorgt. Dass gerade Meta und Anduril zusammenarbeiten, ist durchaus überraschend. Andurils Gründer Palmer Luckey wurde bei Meta im Jahr 2016 gekündigt. Zuvor hatte das Social-Media-Unternehmen Luckeys VR-Start-up Oculus aufgekauft. Anlass für die Kündigung des Start Up-Gründers gab Luckeys öffentliche Unterstützung des damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Neun Jahre später absolviert Trump seine zweite Amtszeit und Palmer ist Begünstigter eines Milliardenauftrages der U.S. Army.

Beschaffung, die zusammen mit dem Beschaffungsamt durchgeführt wurde, verzögert.
Der Bund soll mehr zahlen, sagen die Länder
Der Anteil der Beschaffungen des BeschA für Ausrüstung in der Inneren Sicherheit hat im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht. Foto: BS/Biskup-Klawon
Im nichtpolizeilichen Bereich zeigt sich eine Modernisierung des Fuhrparks. Hier ist beispielhaft die Beschaffung der CBRNErkundungswagen zu nennen. An der Beschaffung arbeiten das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie das BeschA nach eigenen Angaben seit 2019. Die Komplexität des Einsatzmittels – der Fahrzeuge –machte umfangreiche Arbeiten mit
den unterschiedlichen Auftragnehmern, von Messgeräteherstellern über Softwareentwickler bis zum Fahrzeugausbauer, notwendig. Auswirkungen durch die CoronaPandemie, die Ahr-Katastrophe oder den Ukraine-Krieg haben die Entwicklung, Konzeption sowie die
Insgesamt 518 Fahrzeuge der neuen CBRN-ErkW im Wert von 162 Millionen Euro werden an alle Bundesländer verteilt. Ein CBRN-ErkW schlägt mit 311.000 Euro pro Stück zu Buche. Drei der CBRN-ErkW bleiben in den Händen des BBK. Auch in der Gesamtschau zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar ist das Auftragsvolumen des BeschA im Vergleich zum Vorjahr (zwölf Milliarden Euro) im vergangenen Jahr auf noch zehn Milliarden Euro gesunken jedoch erreichte das Beschaffungsvolumen im Bereich Innere Sicherheit mit vier Milliarden Euro einen neuen Höchststand.
Dies geht aus dem Tätigkeitsbericht des BeschA hervor. Ob das reicht, steht auf einem anderen Blatt. In regelmäßigen
Abständen fordern Landespolitikerinnen und -politiker, dass die Investitionen erhöht werden müssen. Zuletzt meldete sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit der altbekannten Forderung nach zehn Milliarden Euro vom Bund für den Bevölkerungsschutz zu Wort. Eine Forderung, die es schon lange gibt. Einige Verantwortliche im Bevölkerungsschutz halten selbst diese Zahl für zu niedrig angesetzt. Aber nicht nur SPD-seitig ertönt der Ruf nach mehr Geld. Behrens‘ Kollegin, Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), hält es für geboten, mit Teilen des Infrastruktur-Sondervermögens in den Bevölkerungsschutz zu investieren. Hoffnungsblick in Den Haag Ein Silberstreifen am Horizont könnte zumindest der Beschluss des letzten NATO-Gipfels sein. Die NATO-Mitgliedsstaaten haben sich in Den Haag das Ziel gesetzt, bis 2035 mindestens 3,5 Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes für die Stärkung ihrer Streitkräfte und weitere 1,5 Prozent für den Zivilschutz sowie die verteidigungsrelevante Infrastruktur auszugeben. Da die meisten Beschaffungen im Zivilschutz auch im Katastrophenschutz genutzt werden, könnte hier mehr passieren.
Der Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Ausübung unmittelbaren Zwangs durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG) ergänzt den Katalog zulässiger Einsatzmittel. Neben Hieb- und Schusswaffen sollen künftig auch DEIG ausdrücklich gesetzlich verankert werden. Hintergrund ist die bisherige rechtliche Unsicherheit, ob DEIG als Waffe im Sinne des UZwG gelten. Das Bundesinnenministerium sieht eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage als notwendig an, da der Einsatz in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit eingreift (Art. 2 Abs. 2 GG).
Rechtssicherheit für Einsatzkräfte
Das Gesetz soll Rechtssicherheit schaffen und die Handlungsmöglichkeiten der Bundespolizei erweitern – ohne Mehraufwand für die Bürger oder die Verwaltung. Eine Evaluierung oder Befristung der Regelung ist nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber geht von einer dauerhaften Notwendigkeit aus.
Ein DEIG verschießt kleine Pfeile, die über Drähte mit dem Gerät verbunden sind. Sie senden Stromstöße in den Körper der Zielperson, die für einige Sekunden Muskelkontraktionen auslösen und die Person bewegungsunfähig machen sollen. Die Geräte sind auffällig gelb markiert und dienen primär der Deeskalation. Schon die Androhung des Einsatzes führt laut Erfahrungen aus der Praxis häufig zur Aufgabe des Gegenübers.
Bereits seit 2020 testete die Bundespolizei das Einsatzmittel im Rahmen eines Pilotprojekts an 15 Dienststellen. Rund 200 geschulte Einsatzkräfte führten die Geräte bei über 40.000 Einsätzen mit sich. In 132 Fällen wurde der Einsatz angedroht, in 16 Fällen tatsächlich durchgeführt – ohne dokumentierte
Flächendeckende Einführung von DEIG auf dem Weg
(BS/lm) Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der die rechtliche Grundlage für den flächendeckenden Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) bei der Bundespolizei schaffen soll. Ziel ist es, den Einsatzkräften ein zusätzliches, nichttödliches Einsatzmittel zur Verfügung zu stellen, das in gefährlichen Situationen zwischen körperlicher Gewalt und Schusswaffe angesiedelt ist. Der Bundestag muss dem Vorhaben noch zustimmen.

Der Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten bleibt umstritten. Während Gegner die Gefährlichkeit – insbesondere für vorgeschädigte Menschen – betonen, loben die Befürworter gerade die Tatsache, dass der Einsatz tödlicher Schusswaffen vermieden werden könne. Foto: BS/Karlis, stock.adobe.com
behandlungsbedürftige Verletzungen. Medizinische Begleitung und wissenschaftliche Studien bestätigen die Sicherheit der Geräte bei sachgemäßer Anwendung.
Begründung durch das Bundesinnenministerium Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) betonte die gestiegene Gefährdungslage für Polizeikräfte – insbesondere durch Angriffe mit Stichwaffen in öffentlichen Räumen. Das DEIG soll es Polizistinnen und Polizisten ermöglichen, Angreifer auf Distanz zu stoppen, ohne sofort auf die Schusswaffe zu-
rückgreifen zu müssen. Ziel sei ein kontrolliertes, verhältnismäßiges Vorgehen – vor allem in komplexen Einsatzlagen wie an Bahnhöfen, bei Großveranstaltungen oder Demonstrationen.
Im Bundeshaushalt 2025 sind zunächst fünf Millionen Euro für die Beschaffung von 10.000 Geräten vorgesehen. Für die Folgejahre sollen weitere Mittel in vergleichbarer Höhe bereitgestellt werden. Neben der Ausstattung sind auch Schulungs- und Betriebskosten einkalkuliert. Sowohl die Gewerkschaft der Polizei (GdP) als auch die Deutsche Polizeigewerkschaft
(DPolG) befürworten die flächendeckende Einführung ausdrücklich. Sie sehen im DEIG ein modernes und deeskalierendes Einsatzmittel mit geringem Verletzungsrisiko. Es schließe eine Lücke im Einsatzmittelkatalog – zwischen Pfefferspray und Schusswaffe. Die GdP fordert eine schrittweise Ausweitung des Nutzerkreises und betont, dass schon die Androhung eines DEIG-Einsatzes deeskalierend wirken könne. Laut dem stellvertretenden DPolG-Bundesvorsitzenden Heiko Teggatz ist die Einführung überfällig, insbesondere zum Schutz vor Messerangriffen.
DPolG-Chef Rainer Wendt sieht im DEIG eine lebensrettende Alternative: Täter würden häufig allein durch Drohgebärden zum Aufgeben bewegt. Beide Gewerkschaften setzen sich zudem dafür ein, dass das DEIG als „Hilfsmittel körperlicher Gewalt“ und nicht als „Waffe“ im Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes (UZwG) klassifiziert wird. Gesundheitliche Gefahren?
Trotz breiter politischer und gewerkschaftlicher Zustimmung bleibt das Vorhaben umstritten. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Juristenverbände und Vertreter der Opposition warnen vor möglichen gesundheitlichen Risiken, insbesondere bei Menschen mit Herzproblemen oder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Amnesty dokumentierte seit 2021 zehn Todesfälle im Zusammenhang mit DEIG-Einsätzen in Deutschland. Der Deutsche Anwaltverein fordert deshalb klare Regeln zur Anwendung – etwa zur Zahl und Dauer der Stromstöße, um Missbrauch vorzubeugen.
In Rheinland-Pfalz sind die Geräte bereits seit 2017 und damit am längsten in Deutschland im Einsatz. Auf Anfrage teilte das Innenministerium mit, dass sich das DEIG in der Praxis „als zuverlässiges und effektives Einsatzmittel erwiesen“ und „grundsätzlich nur minimale Verletzungen verursacht“ habe. Insgesamt sei es seit Beginn der Pilotphase 2.581 Mal eingesetzt worden. In 1.402 Fällen habe die „reine Androhung des DEIG zur Erreichung des polizeilichen Zieles“ ausgereicht. Dabei sei es lediglich zu leichten Verletzungen gekommen. Todesfälle habe es seit der Einführung keine gegeben.

Eurofighter Tranche 5 „Credible and Capable“
Sichert Kernkompetenzen und mehr als 25.000 Hochtechnologie-Arbeitsplätze in Deutschland Schlüsseltechnologie „Made in Germany“
Unterstützt Weiterentwicklung von Technologien und Fähigkeitsaufwuchs hinsichtlich des Future Combat Air Systems (FCAS)







„Simplifizierung, Standardisierung und Skaleneffekte“ – während der Feier zum 70-jährigen Jubiläum der deutschen NATO-Mitgliedschaft versprach Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dass dieser Dreiklang die Beschaffungen der Bundeswehr in Zukunft prägen wird. Diesen Plan verfolgte bereits die Vorgängerregierung. Den europäischen Vergabedschungel zu roden, gelang aber nur bedingt. So musste auch Merz bereits im nächsten Satz zugeben, dass „die Zahl der Systeme, die wir in Europa haben“, zu hoch sei. Darüber hinaus seien die vorhandenen Waffensysteme zu komplex. Das führe dazu, dass immer nur geringe Stückzahlen bestellt würden. Die gewünschten Skaleneffekte ließen sich auf diese Weise nicht erzielen. Dafür gibt es viele Beispiele. Am deutlichsten wird das Entwicklungswirrwarr aber bei den europäischen Bemühungen um die Entwicklung eines Kampfpanzers der fünften Generation. Allein die EU fördert gegenwärtig drei Entwicklungsprojekte mit diesem Ziel. Zusätzlich arbeiten vier europäische Staaten an nationalen Kampfpanzern.
Immer wieder neue Projekte
Das jüngste der EU geförderten Projekte stammt aus dem Vormonat und firmiert unter dem Namen Main Armoured Tank of Europe (MARTE). 20 Millionen Euro stellt die Union der „MARTE-ARGE“, bestehend aus 51 europäischen Rüstungsunternehmen aus elf EU-Staaten plus Norwegen, zur Verfügung. Ziel des unter der Führung von KNDS und Rheinmetall stehenden Projektes ist, Entwürfe für ein zukünftiges Kampfpanzersystem zu erarbeiten. Offiziell existiert das Projekt bereits seit dem 1. Dezember 2024. Zu diesem Zeitpunkt unterzeichnete die MARTEARGE das Grant Agreement mit der Europäischen Kommission.
Sechs Monate später ist MARTE nun offiziell gestartet. Glaubt man den Förderdaten der Kommission, ist die Projektdauer auf 24 Monate ausgelegt. Neben den deutschen Schwergewichten der Rüstungsindustrie, Rheinmetall und KNDS, ist auch die weitere paneuropäische Konsortiumsbeteiligung hochkarätig. Für Italien entwickelt Leonardo mit, in Spanien ist Indra beteiligt, Schweden nimmt mit Saab am Entwicklungsprojekt teil und Finnland partizipiert mit dem größten nationalen Rüstungsunternehmen Patria bei MARTE.
Konsolidierung der europäischen Rüstungsprojekte bleibt aus
(BS/Jonas Brandstetter) Dass in Europa zu viele Systeme parallel entwickelt werden, ist ein bekanntes Problem. Die Bundesregierung strebt seit dem Sondervermögen an, militärisches Gerät noch stärker europäisch und effizienter zu entwickeln und zu beschaffen. Doch die Realität ist eine andere.

Herausforderungen der modernen Kriegsführung als auch Lehren aus aktuellen Konflikten in die Entwicklung einfließen.
Im gleichen Umfang wie die MARTE-ARGE profitiert das unter der Führung des französischen Rüstungsunternehmens Thales stehende Projekt Future Main Battle Tank Technologies (FMBTech). Neben den Franzosen sind sechs Unternehmen aus 13 Mitgliedsstaaten der EU sowie Norwegen beteiligt. Gemeinsam streben sie an, einen intelligenten Kampfpanzer zu entwickeln.
Platzhirsch mit Startschwierigkeiten
In Umfang und in der Größe können die genannten Projekte allerdings nicht mit dem deutschfranzösischen Main Ground Combat System (MGCS) mithalten. Deutschland und Frankreich planen, etwa 1,5 Milliarden Euro in die Entwicklung eines Kampfpanzers zu investieren. Dieser soll bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem ersetzen. Dafür verbindet es einen bemannten Hauptpanzer, ein bemanntes Kettenfahrzeug mit Rake-
„Die Zahl der Systeme, die wir in Europa haben, ist zu hoch. “
Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler
Darüber hinaus wissen die Unternehmen des Konsortiums die Unterstützung mehrerer europäischer Verteidigungsministerien hinter sich. Insgesamt elf Staaten unterstützen als potenzielle Kunden das Projekt. Neben der Bundesrepublik sind das Belgien, Spanien, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Rumänien und Schweden. Sie ließen sich von dem Argument der MARTE-ARGE überzeugen, größere strategische Autonomie in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen über das Projekt zu gewinnen. Konkret versprechen Rheinmetall und KNDS, durch die Integration innovativer und disruptiver Technologien ein widerstandsfähiges Verteidigungssystem zu entwickeln. Dabei sollen sowohl
tensystem sowie ein unbemanntes Fahrzeug mit Panzerabwehrraketen. Hinzu kommen Drohnen und eine eigene Cloud-Plattform. Eigentlich läuft das Projekt bereits seit 2012. Richtig Schwung kam allerdings erst im vergangenen Jahr ins MGCS. Im April 2025 erfolgte die Gründung der MGCS Project Company (MPC) durch KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme und Thales. Zunächst ist die MGCS Project Company damit befasst, Komponenten zu entwickeln und Auswahlentscheidungen vorzubereiten. Dass es zur Gründung der MPC kam, war wahrlich kein Selbstläufer. Pläne für die gemeinschaftliche Entwicklung eines deutsch-französischen Panzers gibt es bereits seit
mehr als einer Dekade. Doch die Vertragspartner taten sich schwer, eine gemeinsame Ausrichtung für das Projekt zu finden. Nach stotterndem Fortschritt traf sich im April vergangenen Jahres der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu. Sie nutzten das Treffen, um im Rahmen eines Memorandum of Understanding (MoU) die Rolle beider Vertragspartner und die Anteile der nationalen Industrien festzulegen. Dem Stillstand beim MGCS ist damit ein Ende bereitet.
in der Produktion befänden. Seinen Erstflug soll der Tempest laut Zeitplan im Jahr 2027 durchführen. Die Serienmodelle werden voraussichtlich im Jahr 2035 in Dienst gestellt. Zu diesem Zeitpunkt soll der Kampfjet der sechsten Generation den Streitkräften Italiens, Japans und Großbritanniens gerichtete Energiewaffen, KI-Operationen und AR-Cockpits bereitstellen. Darüber hinaus soll das Flugzeugmuster nahtlos mit unbemannten Flugsystemen zusammenarbeiten. Die gleiche Aufgabe – die Entwicklung eines Kampfflugzeugs der
„Ich will keineswegs arrogant klingen, aber wessen Fähigkeiten – außer meiner eigenen – brauche ich, um um ein Kampfflugzeug zu bauen?“
Éric Trappier, CEO Dassault Aviation
Die Beteiligten, Thales, KNDS und Rheinmetall, investieren trotzdem parallel in andere KampfpanzerProjekte. In Deutschland betrifft das den Kampfpanzer Leopard 2 mit der Kampfwertsteigerung A8 sowie das Konkurrenzprodukt aus Düsseldorf. Die deutsch-französische KNDS konnte für ihren Leopard 2 A8 bereits über 400 Lieferaufträge verzeichnen.
Rheinmetall entwickelt unterdessen über das Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles eine auf die Bedürfnisse der italienischen Streitkräfte optimierte Version des Panthers.
Frankreich schlägt quer
Ein ähnliches Bild offenbart sich bei den europäischen Versuchen, einen Kampfjet der sechsten Generation zu entwickeln. Italien, Japan und England arbeiten gemeinsam an einem System. Ihr Global Combat Air Programme (GCAP) verspricht einen potenten Nachfolger für die bisher eingesetzten Eurofighter Typhoon und Mitsubishi F-2. Ein erster Demonstrator, der Tempest, entsteht zurzeit auf britischem Boden. Vergangenen Monat gaben die beteiligten Unternehmen bekannt, dass „gemessen am Strukturgewicht zwei Drittel“ des späteren Flugzeugs sich
sechsten Generation – stellt sich das trinationale Entwicklungsprojekt FCAS zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien. Mit geschätzten Gesamtkosten von 100 Milliarden Euro handelt es sich dabei um das teuerste Rüstungsprojekt Europas. Mit diesen Mitteln soll ein Kampfjetsystem bestehend aus einem Jet, einer unbemannten Begleitdrohne und einer Combat Cloud entstehen. Um dieses Mammut-Projekt zu schultern, teilt das für die Entwicklung verantwortliche FCAS-Konsortium die Aufgaben in verschiedene Entwicklungsstränge auf. Zurzeit läuft die Projektphase 1B. Diese sieht die Entwicklung der Technologien für den Bau eines Demonstrators vor und soll im Jahr 2026 ihren Abschluss finden. Daran schließt die zweite Phase an, in welcher der Demonstrator realisiert werden soll. Laut Zeitplan soll Mitte der 2040er-Jahre das fertige System in den Einsatz gehen. Allerdings läuft die Zusammenarbeit zwischen den drei Industriepartnern Airbus, Indra und Dassault Aviation alles andere als reibungslos. Zwischen dem führenden französischen Entwicklungsanteil Dassault Aviation und Airbus bestehen Spannungen. Besonders unverblümt bringt diese der CEO
von Dassault Aviation, Éric Trappier, auf den Punkt. Während einer Anhörung vor dem nationalen Verteidigungskomitee stellte der Luftfahrtingenieur das geplante Indienststellungsdatum infrage. Grund für den Verzug sei die Zusammenarbeit mit Airbus. Außerdem deutet Trappier vor dem Verteidigungskomitee an, dass Dassault Aviation durchaus in der Lage sei, einen Kampfjet ohne die europäischen Partner zu entwickeln: „Ich will keineswegs arrogant klingen, aber wessen Fähigkeiten – außer meiner eignen – brauche ich, um ein Kampfflugzeug zu bauen?“, lies der Dassault-CEO gegenüber den Parlamentariern verlauten. Vergangenen Monat erreichte das Unverständnis der beiden Unternehmen füreinander ein neues Plateau. Trappier forderte während der Jahresversammlung von Dassault Aviation, die Aufgabenverteilung bei FCAS neu zu gewichten. Aus Sicht des französischen CEOs sollte sein Unternehmen für mehr zentrale Entwicklungsvorhaben wie die Aerodynamik und die Tarnkappentechnik verantwortlich zeichnen. Konkret verlangte der Dassault-CEO, dass ein „Architekt“ Entscheidungen treffen dürfe und sich nicht länger auf Kompromisse einigen müsse. Damit gehe einher, dass dieser Architekt Zulieferer auswählen und im Zweifel wieder austauschen könne. Das demokratische Verständnis einer gemeinsamen Entwicklung stößt bei Trappier auf wenig Gegenliebe. Airbus verfolge einen Ansatz, bei dem alle Entscheidungen demokratisch getroffen werden sollten. Ein derartiges Vorgehen bei einem großen Industrieprojekt sei weltweit beispiellos, monierte er. Sollte es zur Umsetzung der vom Dassault-Aviation-CEO geforderten Anpassungen beim FCAS-Projekt kommen, wäre Airbus zum Juniorpartner degradiert. Wie zu erwarten, stieß der Vorschlag in der Bundesrepublik auf wenig Gegenliebe. Merz bügelte Trappiers Vorstoß ab. Der vom französischen CEO gewünschte Entwicklungsmodus ist an anderer Stelle bereits umgesetzt. Im Rahmen des Projekts nEUROn entwickelt Frankreich gemeinsam mit Griechenland, Italien, Spanien, Schweden und der Schweiz den Demonstrator einer getarnten Drohne. Dabei tritt Dassault Aviation als Hauptauftragnehmer der französischen Rüstungsbehörde Direction Générale de l'Armement (DGA) auf. Das erlaubt es dem französischen Luftfahrtunternehmen, das Programm zu steuern und technologische Entscheidungen sowie den Umfang und die Aufgabenteilung zwischen den Partnern final zu bestimmen. Die europäischen Partner zeichnen innerhalb dieses Konstrukts für etwa 50 Prozent des gesamten Entwicklungsaufwands verantwortlich.
Déjà-vu droht
Dass die französischen Vertragspartner in einem gemeinsamen europäischen Kampfjetprojekt mit den Prozessen der gemeinsamen Entwicklung fremdeln, ist keine Neuheit. Als im Jahr 1983 die Entwicklung des Eurofighter Typhoons – damals noch unter dem Namen European Fighter Aircraft (EFA) –begann, plante auch Dassault Aviation, zur Entwicklung beizutragen. Allerdings kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Frankreich entschied sich letztendlich, aus dem Programm auszusteigen. Statt gemeinsam mit den europäischen Partnern am Typhoon zu arbeiten, präferierte Frankreich den nationalen Alleingang. Das Ergebnis der französischen Entwicklungsbemühungen ist die von Dassault Aviation entwickelte und gebaute Rafale.
Eine
„neue Ebene hybrider Eskalation“, diagnostizierte Vizeadmiral Dr. Thomas Daum, Inspekteur des Kommandos Cyber- und Informationsraum, auf dem Pre-Event zur Berlin Security Conference (BSC) 2025 in Berlin. Anlass zu dieser Feststellung gab dem Inspekteur der jüngste Brandanschlag auf Logistikfahrzeuge der Bundeswehr in Erfurt. „Zum ersten Mal haben sich russische Quellen zu einem Sabotageakt in Deutschland bekannt“, stellte Daum klar. Diese Gefahr greife auch auf den Cyberund Informationsraum aus. Der frühere Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Generalleutnant Wolfgang Wien, habe bereits bestätigt, dass Russland in unsere Netzwerke eingedrungen sei. Für Daum ist deshalb klar: Die Bedrohung durch hybride Einflussnahme ist reell. Im Cyberspace begegne man ihr ohne Unterlass, aber auch in der analogen Welt nähmen die Ereignisse zu.
Die Bundeswehr als Betreiber von Waffensystemen, Kriegsschiffen, Flugzeugen sowie Krankenhäusern und ABC-Forschungslaboren mit komplexer IT und Büro-IT sei dabei ein exponiertes Ziel. Zwar sei es bisher noch keinem Angreifer gelungen, die deutschen Streitkräfte zu kompromittieren, Cyber-Attacken seien aber regelmäßig und kontinuierlich zu beobachten. Darüber hinaus würden Aktivitäten sogenannter hacktivistischer Gruppen im Vorfeld politischer Entscheidungen zunehmen.
Umfassender Ansatz
Um im digitalen Raum zu verteidigen, genüge es nicht, ausschließlich im Cyber-Raum zu agieren.
„Der Cyberspace ist auf eine physische Ebene angewiesen, auf ein Medium, um Daten von A nach B zu übertragen“, verdeutlichte Daum Dieses Übertragungsmedium sei gemeinhin als das elektromagnetische Spektrum bekannt. Darüber hinaus gelte es zu bedenken, dass die Effekte der Domäne Cyber über sich selbst hinausstrahlten.
„Die Cyber-Domain steht nicht für sich allein“, so Daum. Folgerichtig müssten sowohl die physischen Voraussetzungen als auch der Zweck, dem sie dienten, berücksichtigt werden. Die Bundesrepublik habe in ihrem Anspruch, eine holistische Perspektive auf die Cyber- und Informationsdomäne einzunehmen,
(BS/Jonas Brandstetter) Längst ist der Cyber- und Informationsraum zum zentralen Vektor für die hybride Kriegsführung geworden. Um in dieser Dimension zu bestehen, plant die Bundeswehr deshalb auch mit offensiven Fähigkeiten. Die entsprechenden Vorraussetzungen sind zu schaffen.

Vorreiterstatus. Denn bereits 2017 fiel in den deutschen Streitkräften die Entscheidung, einen Cyberund Informationsdienst einzurichten. Bis das Kommando CIR zur Teilstreitkraft erhoben wurde, mussten allerdings weitere sieben Jahre verstreichen. Dennoch habe das deutsche Vorgehen in der Verteidigungsallianz Vorbildcharakter.
Trotz eigener Teilstreitkraft agiert die Bundeswehr in ihren Cyber-Bemühungen allerdings nicht autark. Neben den Streitkräften tummeln sich zivile Akteure, Privathaushalte, Industrie und Verwaltung in dieser Domäne. Dass liege darin begründet, dass eine vollständige Trennung der zivilen und militärischen Nutzung des Cyber-Raumes nur unter enormen Kosten zu erreichen oder technisch schlicht nicht umsetzbar sei. Wenn die Truppe also ihre Präsenz im Cyber- und Informationsraum schützen wolle, könne das nur in Kooperation mit den übrigen Stakeholdern gelingen.
Ein gemeinsames Lagebild über Situation und Gefahren im digitalen Raum ist dafür Voraussetzung.
Doch auch darüber hinaus bedarf es Kenntnis und Verständnis, um gemeinsam einer Cyber-Lage Herr zu werden. Ende September
2023 organisierte das Bundesministerium des Innern (BMI) die Krisenmanagementübung LÜKEX 23. Das Übungsszenar sah einen massiven Cyber-Angriff gegen die Bundesregierung vor – lokale Verwaltungen in mehreren Landkreisen und Städten wurden angegriffen. Eine Schadsoftware verbreitete sich über die Netzwerke der Bundesbehörden. Gleichzeitig erfolgte ein Angriff auf die Wasser- und Stromversorgung. Darüber hinaus wirkte der simulierte Gegner mit auf Social Media verbreiteten Desinformationskampagnen und Drohvideos zum Sturz der politischen Führung auf die Bevölkerung ein. Das Beüben solcher Szenarien sei notwendig, weil durch Konflikte im Cyberspace schnell Konflikte vor der eigenen Haustür entstünden, erläuterte Daum
Es geht nicht ohne Offensive Allerdings beließ es Daum in Berlin nicht dabei, die Bedeutung der Verteidigung im Cyber-Raum in den Blick zu nehmen. Auch offensive Fähigkeiten fanden in seiner Keynote Erwähnung. Denn für den Inspekteur ist klar, dass Aufklärung und Situationsbewusstsein im Cyberspace zu einem gewissen Grad
präventive Maßnahmen erfordern. Das Eindringen oder die Infiltration des gegnerischen Netzes sei hier zu nennen. „Der potenzielle Einsatz von Cyber-Angriffen im Rahmen des Gesamtkonzepts von Konflikten und Kriegen ist Teil der Cyber-Verteidigung“, stellte der Inspekteur klar. Diese könnten von Nutzen sein, um Schäden beim potenziellen Gegner zu verursachen. Ein Allheilmittel seien offensive Cyber-Operationen allerdings nicht. Spezifische Nachteile setzten dem militärischen Einsatz Grenzen. Zu nennen sei die Zeit, die in die Vorbereitung einer derartigen Aktion fließen müsse. „In die Netze eines Gegners einzudringen, kann ein langwieriges Unterfangen sein“, mahnte Daum Der Vorbereitungsaufwand, den es brauche, um gegnerische Netze zu infiltrieren, wachse mit dem Schutzniveau des Zielsystems an. Bei der Synchronisation der Aktivitäten im Cyber-Raum mit denen anderer Teilstreitkräfte stelle das eine Herausforderung dar. Hinzu komme, dass es keine hundertprozentige Garantie für den Erfolg einer Cyber-Operation gebe. Ein gut geschütztes System mit entsprechend geschultem Personal könne die Chancen eines Angreifers auf ei-
nen erfolgreichen Angriff erheblich mindern, gab Daum zu bedenken. Es gelte zu beachten, dass nicht alle Cyber-Operationen die gleiche Wirkung bei einem Gegner entfalteten. Dabei gelte die Faustregel: Je geringer der Organisationsaufwand auf Angreifer-Seite, umso leichter falle es den Attackierten, die Folgen zu mitigieren. Generell hielt der Inspekteur fest, dass die Wirkung einer Cyber-Operation auf der Zeitachse meistens begrenzt bleibe. Daten und Informationen könnten aus Back-ups oder unabhängigen Cloud-Systemen zurückgewonnen und das System so wiederhergestellt werden.Dem pflichtete Dr. Ulrik Franke, Senior Lecturer an der Swedish Defence University bei. Vor zwanizig Jahren fürchteten sich die Verteidigungsplaner noch vor einem „Cyber Pearl Harbor“. Die Realität habe gezeigt, dass solche Szenarien unwahrscheinlich seien.
In gemeinsamer Mission Wenn die Bundeswehr im Cyberraum agiert, tut sie das nicht allein. Sie kooperiert mit ihren internationalen Partnern. Auf NATO-Ebene besteht dafür seit 2018 das Cyberspace Operations Centre im belgischen Mons. Das Zentrum unterstützt die militärischen Befehlshaber mit Lagebildern. Außerdem koordiniert es die operativen Aktivitäten der NATO im Cyberspace. Auch auf Ebene der Europäischen Union gäbe es Kooperationsmaßnahmen für den Cyber- und Informationsraum. Eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen wird im Staatenbündnis betrieben. Zu nennen ist hier unter anderem ein von Deutschland initiiertes PESCO-Projekt mit dem Ziel, die Nachrichtendienste mit Lageberichten und Bedrohungsanalysen zum Cyber- und Informationsbereich zu versorgen. In der gegenwärtigen Phase erfolgt das durch den Austausch von Lageberichten, die dann auf EU-Ebene zusammengeführt werden. Generell gilt laut Daum, dass EU und NATO in ihren Bemühungen um den Cyber- und Informationsraum unterschiedliche Schwerpunkte setzen und über unterschiedliche Kompetenzen verfügen. Während die Stärken der NATO vorwiegend im Sicherheitsbereich lägen, zeichne sich die EU in Technologiefragen und bei der Cyber-Abwehr aus.



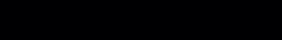


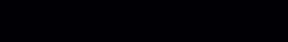
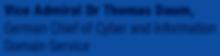




(BS/Mirjam Klinger) Mit einer etwas scheuen, schneeweißen Schweizer Schäferhündin fing alles an. Heute hat Sina Kupka drei Hunde – und ein ganz besonderes Ehrenamt: Sie ist Teil der Rettungshundestaffel Berlin.
fast 13 Jahren im Einsatz: Sina Kupka von der Rettungshundestaffel Berlin – zunächst mit Tessa, später mit Fly und künftig auch mit Nachwuchshündin Nova. Foto: BS/Martina Memmert
Tessa, Fly und Nova – so heißen die drei Hündinnen an der Seite von Sina Kupka. Ein Großteil ihres Alltags spielt sich im Pflegeheim ab, wo Kupka als Physiotherapeutin arbeitet. Die Hunde sind stets mit dabei. Sie haben dort sogar ihren eigenen Raum, in dem sie entspannt auf Decken und in Körbchen ruhen. Für Kupka ist das eine Grundvoraussetzung: „Entweder sie kommen mit auf die Arbeit, oder ich suche mir einen anderen Job“, sagt sie entschieden.
Berlin aufmerksam gemacht. „Dort findet ein Schnupperkurs der Rettungshundestaffel Berlin statt. Geh doch mal hin, schau es dir an – ich glaube, das wäre etwas für dich“, sagte sie – und sollte Recht behalten. Kupka hatte sich kurz zuvor
Tessa angeschafft, eine damals sechs Monate alte, weiße Schweizer Schäferhündin, mit der sie ihre Freizeit nun sinnvoll gestalten wollte. Doch zunächst sah es nicht danach aus, als wäre die Rettungshundestaffel der richtige Ort für

tren in Malchin, Hünxe und Mosbach. Dort lernen die Hunde, sich sicher und geschickt in unwegsamem Gelände zu bewegen. Je nach Eignung können sie für eine von drei Sucharten ausgebildet werden: Flächensuchhunde durchkämmen Wälder, Wiesen oder Felder – auch auf größere Distanzen.
Für die Trümmersuche sind die Anforderungen noch höher. Die Hunde müssen sich in eingestürzten Gebäuden, auf schwierigem Untergrund und durch enge Gänge orientieren können – ohne sich von Lärm, Staub oder fremden Gerüchen ablenken zu lassen. Eine dritte Möglichkeit ist das sogenannte Mantrailing: Dabei folgt der Hund der individuellen Geruchsspur einer vermissten Person – meist ausgehend vom letzten bekannten Aufenthaltsort. Den Geruch nimmt der Hund über einen persönlichen Gegenstand, wie ein getragenes T-shirt oder eine benutzte Haarbürste, auf.
Bei allen drei Sucharten ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer/-in (HF) unerlässlich. Deshalb nehmen auch die HF regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen, wie Erste-HilfeKursen für Mensch und Hund, teil, während ihre vierbeinigen Partner lernen, mit Nase, Ausdauer und Geschick Leben zu retten.
An einem Abend im April
Durchsucht wurde damals im April ein Waldstück nach einem vermissten älteren Herrn. Tessa machte sich an die Arbeit – über heruntergefallene Äste durch das Dickicht. Jeder Quadratmeter des Waldes wurde von der weißen Hündin inspiziert. Bereits einige Meter von ihrer HF entfernt wurde sie fündig. Wie im Training einstudiert, lief Tessa zu Sina Kupka zurück und bellte sie an. Was für Außenstehende wie eine normale Reaktion wirken mag, ist für Rettungshundeführerinnen und -führer ein klares Zeichen: Tessa hatte etwas gefunden.
Dehydriert, geschwächt, aber am Leben.
Dass insbesondere Fly immer in ihrer Nähe ist, hat jedoch noch einen weiteren, ganz besonderen Grund: Die achtjährige, schwarzweiße Border-Collie-Hündin ist ausgebildeter Rettungshund und gemeinsam mit Kupka Teil der Rettungshundestaffel Berlin. Zusammen suchen sie nach vermissten Menschen – in Wäldern, auf freiem Feld oder in Trümmerlandschaften.
„Wenn die Polizei uns alarmiert, geht es los – egal ob am Tag oder mitten in der Nacht“, erzählt Kupka. Hierfür sind die beiden 365 Tage im Jahr einsatzbereit.
Über Stock und über Stein
Begonnen hat alles vor fast 13 Jahren. Damals wurde Sina Kupka von einer Nachbarin auf eine Anzeige der Rettungshundestaffel
Tessa: Die inzwischen fast 13-jährige Hündin ist eher zurückhaltend und begegnet Fremden zunächst mit Skepsis – nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um nach vermissten Menschen zu suchen. Doch Kupka glaubte an ihre Hündin und ließ sich gemeinsam mit ihr ausbilden. Denn grundsätzlich kann jeder Hund Rettungshund werden – ganz gleich, welcher Rasse er angehört. Entscheidend ist, dass er gesund, motiviert und sozial verträglich ist. Die Ausbildung bei der Rettungshundestaffel Berlin dauert etwa drei Jahre. Die Staffel ist Teil des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) – der erste und größte Verband seiner Art in Deutschland. Die Ausbildung erfolgt unter anderem in den drei BRH-Ausbildungszen-
Tessa absolvierte trotz erschwerter Umstände schließlich ihre Abschlussprüfung zum Flächensuchhund erfolgreich. Die sich inzwischen in Rente befindende Hündin leistete während ihrer Zeit als Rettungshund ganze Arbeit. So erinnert sich Sina Kupka gerne zurück an einen Abend im April vor fast sechs Jahren. Damals war sie gemeinsam mit ihrer Hündin Tessa auf einer Geburtstagsfeier, als sie plötzlich zu einem Einsatz gerufen wurde. Ohne zu zögern brachen sie auf – und sie waren nicht allein. Auch die Gastgeberin des Abends, eine Freundin Kupkas, ist Mitglied der Rettungshundestaffel und schloss sich dem Einsatz an. Vor Ort wurden schnell die Funkgeräte aus-, Suchflächen eingeteilt und der Rucksack mit Proviant für Halterin und Hund aufgesetzt. Die Suchaktion startete. Meist sind hierbei 10 bis 15 Hunde im Einsatz.

Border-Collie-Hündin Fly trainiert regelmäßig für den Ernstfall – und muss sich jährlich einer Prüfung stellen, um als Rettungshund im Einsatz bleiben zu dürfen. Foto: BS/Nadine Höhn Tessa und Fly – zwei erfahrene Rettungshunde mit besonderer Bindung: Auch im Ruhestand begleitet Tessa Fly (und auch Nova) weiterhin beim Training. Foto: BS/Nadine Höhn
Die Schäferhündin ist ein sogenannter Freiverweiser. Anders als die meisten anderen Rettungshunde, die bei einer aufgefundenen Person bleiben und dort bellen, kehrt ein Freiverweiser, wie oben erwähnt, zurück zur Hundeführerin oder zum Hundeführer, um durch Bellen und gezieltes Verhalten auf den Fund aufmerksam zu machen. Anschließend führt er sein Teammitglied direkt zur vermissten Person. Kupka nennt diese Anzeigeform auch die „Lassie-Methode“ – eine Hommage an den berühmten Serienhund, der bei Gefahr stets Hilfe holte. Tessa führte Kupka zielstrebig durch das Gelände – bis sie an einer schwer einsehbaren Stelle einen älteren Mann fanden, der nach einem Sturz bereits über 24 Stunden im Wald gelegen hatte.
Aus eins mach drei „Da fällt einem ein Stein vom Herzen, dass sich all das Training am Ende gelohnt hat.“ Doch nicht jeder Einsatz endet so glücklich. Bei den rund 20 bis 25 Einsätzen pro Jahr bleibt der Erfolg manchmal aus und häufig erhalten die Helferinnen keine Rückmeldung von der Polizei, ob der oder die Vermisste wieder aufgetaucht ist. Wird jedoch jemand gefunden, freut sich das gesamte Team – unabhängig davon, welcher Hund die Person gefunden hat: „Wir freuen uns für jeden. Dann wird deutlich wofür wir das alles tun“, sagt Kupka Mit Tessa war sie lange Zeit immer wieder im Sucheinsatz, bis die Hündin zu alt wurde. Inzwischen ist sie 13 Jahre alt, auf beiden Ohren taub und somit im wohlverdienten Ruhestand. Beim achtstündigen Training der Staffel jeden Samstag macht sie dennoch gerne mit. Dort ist Kupka inzwischen sogar mit drei Hunden am Start. „Ich wollte eigentlich nie drei Hunde“, sagt sie und muss dabei grinsen. Doch nachdem Tessa langsam auch für den Obedience Sport zu alt wurde, stieß zunächst Fly zum Rudel dazu. Den Hundesport betreibt Kupka mit ihren Hündinnen neben der Rettungsarbeit. Hierfür sind Border Collies aufgrund ihrer Geschwindigkeit prädestiniert. Also entschied sich Sina Kupka für eine schwarz-weiße, freundliche Hündin dieser Rasse. Fly ist inzwischen sowohl für die Flächen- als auch die Trümmersuche ausgebildet. „Fly hängt sehr an Tessa, deshalb habe ich Nova dazugeholt“, sagt die Physiotherapeutin und erklärt weiter: „Falls es Tessa irgendwann nicht mehr geben sollte, wird das Fly schwer treffen. Sie soll dann nicht alleine sein.“ Das Nesthäkchen Nova befindet sich selbst noch in Ausbildung. Wie Fly soll sie künftig sowohl in der Fläche als auch in Trümmern nach Vermissten suchen. Mal trainiert sie hierfür auf einem Trümmerfeld in Malchin, mal im Berliner Umland, mal auf Geländen von der Polizei Berlin oder der Bundeswehr. Die Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Bevölkerung beschreibt Kupka als sehr positiv. „Wir werden von der Polizei alarmiert. Genauer gesagt erhält unsere Zugführung die Einsatzmeldung von der Leitstelle und leitet sie dann an uns weiter. Anschließend fahren wir zum Einsatzort“, beschreibt Kupka. Doch ein Wunsch bleibt: Alle Einsätze und auch das Training finden rein ehrenamtlich statt – Fahrtkosten und Ausrüstung zahlen die Mitglieder der Staffel aus eigener Tasche. „Wenn es hier einen Weg gäbe, unsere Staffeln zu unterstützen, wäre das schön“, sagt Kupka